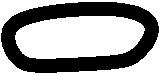Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Oberösterreich gefördert.
Auftraggeberin
Region Gusental – Verein für regionalwirtschaftliche Entwicklung Schloss Riedegg 1, 4211 Alberndorf in der Riedmark
Beteiligte Gemeinden
Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Marktgemeinde Altenberg bei Linz, Gemeinde Engerwitzdorf, Stadtgemeinde Gallneukirchen, Gemeinde Katsdorf
Bearbeitung
RAUMPOSITION. Scheuvens | Allmeier | Ziegler OG
Dipl.-Ing. René Ziegler, Mario Weisböck, BSc Lederergasse 18/1, 1080 Wien www.raumposition.at
Modul 5 – Raumforschung & Kommunikation OG Dipl.-Geogr. Dr. Peter Görgl, Mag. Max Aichinger Weihburggasse 16, 1010 Wien www.modul5.at
con.sens verkehrsplanung zt gmbh
Dipl.-Ing. Florian Kratochwil Kaiserstraße 37/15, 1070 Wien www.cvp.at
Gestaltung
RAUMPOSITION. Scheuvens | Allmeier | Ziegler OG
Kartengrundlage (sofern nicht anders angegeben) Land Oberösterreich; OpenStreetMap (Stand: 11/2020); Bearbeitung: Raumposition (Mario Weisböck)
Wien/Gusental, 2022


Erreichbarkeiten
Natur, Umwelt, Klima und Ökologie
Bevölkerungsentwicklung und Wanderungen
Verkehr und Mobilität
Familienidyll- und Siedlungsreife-Index
2. HANDLUNGS-
Landschaft und Klima
PRINZIPIEN
LEITZIELE Leitbildkarte
UMSETZUNGSMASSNAHMEN Übersicht
Mobilität
PRINZIPIEN
LEITZIELE
Leitbildkarte
UMSETZUNGSMASSNAHMEN Übersicht
Siedlungsentwicklung
PRINZIPIEN
LEITZIELE
UMSETZUNGSMASSNAHMEN Übersicht
Wirtschaftsentwicklung
PRINZIPIEN
LEITZIELE
LEITZIELE UND UMSETZUNGSMASSNAHMEN 4. AUSBLICK
Leitbildkarte Siedlungsund Wirtschaftsentwicklung
UMSETZUNGSMASSNAHMEN Übersicht
LEITBILDKARTE GESAMT
Verzeichnisse
OTTENSCHLAG IM MÜHLKREIS
HELLMONSÖDT
KIRCHSCHLAG BEI LINZ
LICHTENBERG
Oberbairing
ALTENBERG BEI LINZ
Altenberg
Steinbach
Pröselsdorf
Alberndorf
ALBERNDORF IN DER RIEDMARK
NEUMARKT IM MÜHLKREIS
Katzgraben
Oberndorf
GALLNEUKIRCHEN
Niederkulm
Treffling
Schweinbach
ENGERWITZDORF
Holzwiesen
UNTERWEITERSDORF
Engerwitzdorf
KEFERMARKT
Klendorf
HAGENBERG IM MÜHLKREIS
WARTBERG OB DER AIST
PREGARTEN
TRAGWEIN
Bodendorf
Katsdorf
KATSDORF LINZ
STEYREGG
ST. GEORGEN AN DER GUSEN
Standorf
Lungitz
RIED IN DER RIEDMARK
SCHWERTBERG
PASCHING
LUFTENBERG AN DER DONAU
Karte 1: Die fünf Gemeinden der Region Gusental

Gruppenfoto in Oberbairing
© Violetta Wakolbinger
Die Gemeinden der Region Gusental zeichnen sich durch eine besondere Lage aus: einerseits sind sie eher ländlich geprägt und dem Mühlviertel zugewandt, andererseits sind sie Teil des sich urbanisierenden Umlands von Linz und liegen innerhalb des Entwicklungskorridors Linz-Hagenberg. Aus dieser besonderen Ausgangslage lässt sich der Anspruch ableiten, zukünftige Entwicklungsaufgaben in der Region gemeinsam zu beantworten. Handlungsanforderungen enden nicht an administrativen Grenzen, daher haben sich die Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, die Marktgemeinde Altenberg bei Linz, die Gemeinde Engerwitzdorf, die Stadtgemeinde Gallneukirchen und die Gemeinde Katsdorf zu einer Kooperationspartnerschaft zusammengeschlossen. Das erklärte Ziel ist eine strukturierte und zielgerichtete Vorgehensweise in der Erstellung einer interkommunalen Entwicklungsstrategie. Gemeinsam soll an Lösungsansätzen für die Transformation und Gestaltung dieser wachsenden Region gearbeitet werden.
Die thematischen Schwerpunkte liegen dabei auf der integrativen räumlichen Entwicklung, der Optimierung der Mobilität in der Region und der Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit. Im Rahmen dieses Planungsprozesses soll es allerdings nicht nur um das Lösen konkreter planerischer Aufgaben gehen, sondern auch um das Stärken des Bewusstseins für eine gemeinsame Haltung in den großen Zukunftsaufgaben und das Bekenntnis zur Zusammenarbeit. Diese Region zukunftsfähig, lebenswert und unter einer vorausschauenden und aufeinander abgestimmten Perspektive klug weiterzuentwickeln, darin liegt unser zentraler Anspruch der interkommunalen Raumentwicklungsstrategie Gusental.
Die Bürgermeister der fünf Kooperationsgemeinden
Alberndorf in der Riedmark, Altenberg bei Linz, Engerwitzdorf, Gallneukirchen und Katsdorf

Die Region Gusental entwicklungsplanerisch zu behandeln ist aus drei Gründen eine hoch spannende Aufgabe: Erstens ist sie Teil einer der dynamischsten Wachstumsregionen Österreichs, zweitens eröffnen sich mit der geplanten Stadtregionalbahn hoch relevante Perspektiven im Sinne einer nachhaltigen und aufeinander abgestimmten Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung. Und nicht zuletzt beginnt die Region Gusental nicht bei Null, was interkommunale Zusammenarbeit betrifft. Die Gemeinden zeichnen sich vielmehr durch eine lange Kooperationstradition aus und durch Offenheit, Themen gemeinsam anzugehen, die miteinander effektiver zu lösen sind als alleine – dies ist keine Selbstverständlichkeit. Und so soll es Ziel des gemeinsamen Projekts sein, die bestehende interkommunale Kooperation inhaltlich und strategisch auf eine neue Ebene zu heben, damit jede beteiligte Gemeinde und die Region in ihrer Gesamtheit Antworten und Lösungswege für die in naher und weiterer Zukunft liegenden zentralen Entwicklungsthemen an die Hand bekommt.
Um welche Themen geht es dabei aus unserer Sicht ganz besonders? Zunächst einmal müssen die Gemeinden der Region (wenn auch in unterschiedlichem Maße) Wachstumsmanagement betreiben, da sie funktional und geographisch Teil der Stadtregion um Linz sind. Damit sind vor allem in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Verkehr und Wirtschaft gemeinsame Strategien für eine aufeinander abgestimmte Entwicklung zu erarbeiten. Wie soll sich das zu erwartende Bevölkerungswachstum auf die Gemeinden aufteilen? Wo sind aus Sicht nachhaltiger Mobilität die am besten geeigneten Siedlungsschwerpunkte der Zukunft? Wie können sich die Gemeinden in der Region im Bereich der gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung möglichst effizient und zukunftsfähig organisieren (Stichwort Kepler Valley)? Wie stark wollen die Gemeinden grundsätzlich wachsen und sich weiterentwickeln, wenn es um neue Einwohner:innen und die Wirtschaft geht? Und wie lassen sich Wachstum und Verkehr bestmöglich miteinander verbinden? Wenn es um die Beantwortung dieser (und vieler weiterer) Fragen geht, müssen wir gemeinsam mit Ihnen in größeren Zusammenhängen denken: Perspektivisch
wird der oberösterreichische Zentralraum insgesamt und insbesondere der Verdichtungs- und Funktionalraum Linz wachsen. Damit stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Rolle die Gemeinden der Region in diesem funktionalräumlichen Netzwerk künftig übernehmen wollen und welche „Aufgaben“ von übergeordneter Landesplanungsebene vorgesehen sind.
Es wurden bereits Entwicklungsstrategien und Projekte für die Region Gusental erstellt (bspw. „Kepler Valley der WKOÖ). Besonderer Ausdruck eines Bekenntnisses zur interkommunalen Zusammenarbeit ist der bereits im Jahr 1999 gegründete Verein Gusental, der alle beteiligten Gemeinden zu seinen Mitgliedern zählt. Wesentlich für die weitere Entwicklung wird also sein, den bereits eingeschlagenen Weg der Kooperation innerhalb der Region in aller Entschlossenheit weiter zu gehen. Der Faden darf nicht abreißen! Diese Kontinuität von Möglichkeiten eines aktiven Austausches ist eine wichtige Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen und das Schaffen von Vertrauen in die anstehenden umfassenden Entwicklungsprozesse.
Peter Görgl, Florian Kratochwil, René Ziegler
PROZESSDIAGRAMM
PHASEN
Der Planungsprozess gliederte sich in folgende Phasen:
A) Raum- und Strukturanalyse
Die erste Arbeitsphase diente der Sichtung und Bewertung der bisherigen relevanten Planungsdokumente und der für die Entwicklungsplanung wichtigen Rahmenbedingungen, Entwicklungsziele und Leitbildvorstellungen sowie der räumlich-statistischen Analyse der Region Gusental.
B) Handlungserfordernisse
Ein wesentlicher Bestandteil des Planungsprozesses war die sogenannte Regionskonferenz, um Erwartungen, Ziele und Schwerpunkte der künftigen Entwicklung in gebündelter und intensiver Form zu erarbeiten. Ausgehend von den Raum- und Strukturanalysen wurden erste Zukunftsbilder erarbeitet und im Rahmen der Regionskonferenz mit Gemeindevertreter:innen überprüft, diskutiert und verdichtet.
C) Regionales Leitbild
In dieser dritten Planungsphase wurden die Handlungsanforderungen zu strategischen und räumlichen Aussagen in Form eines Leitbildes verdichtet und konkretisiert. Damit konnte man sich auf eine gemeinsame Vorstellung von der künftigen räumlichen und strategischen Entwicklung mit den Schwerpunkten Landschaft und Klima, Mobilität, Siedlung- und Wirtschaftsstandortentwicklung.
D) Umsetzungsstrategie
Um Leitziele auch in die Umsetzung bringen zu können, wurden in der vierten und letzten Phasen Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet und die nächsten Schritte zur Realisierung skizziert.
INHALT DIALOG
24.08.2020 Vorstandssitzung
L.1.1 Raum- & Strukturanalyse
L.1.2. Abschätzen der Einwohner- und Arbeitsplatzpotenziale
L.1.3 Verkehrsknotenzählung
L.1.4 Kooperationsanalyse
Mitte Nov 2020 Versand Gusental-Atlas
Prozess Verkehrssystemstudie METHODEN/FORMATE
Screening
L.2.1 SWOT-Analyse
L.2.2 Ableiten konkreter Handlungserfordernisse für die räuml. Entwicklung
L.3.1 Räumliches Leitbild
L.3.2 Regionale Entwicklungsziele
L.4 Aktionsplan Basiskonzept (Nah-)Mobilität Spielregeln der interkommunalen Zusammenarbeit
Gespräche vor Ort
30.09.2020 Expedition in die Region
Verkehrsknotenzählung
Fokusgruppe Nahmobilität: Workshop 1 Nov/Dez 2020 Vorstandssitzung
Handlungskatalog
Mitte Jan 2021 Versand Unterlagen Regionskonferenz 1
Regionskonferenz 1: Zukunftsbilder
Mitte März 2021 Vorstandssitzung
Anfang Juni 2021 Versand Rohfassung Leitbild
Mitte Juni 2021 Vorstandssitzung
26.11.2021 Interkomm. Planungsausschuss
Regionskonferenz 2: Leitbild
Leitbild
Maßnahmen-Workshop zu den 3 Fokusgruppen:
Mobilität
Standortentwicklung
Mitte März 2022 Versand Rohfassung IKRE
03.02.2022 MaßnahmenWorkshop Ende März 2022 Vorstandssitzung
Interkomm. Zusammenarbeit ?
AP1: Zustands- und Mängelanalyse
AP2: Abbilden der generellen Verkehrsprognose 2035
AP3: Berechnung Prognosefälle
AP4a und 4b: Maßnahmenentwicklung
AP4c: Berechnung Prognose „Interkomm. Leitbild“
AP5: Ausarbeitung der Wirkungen von Maßnahmen auf die Kapazitäten der Knotenpunkte
Abschlussforum
IKRE REGION GUSENTAL !
Gemeinsam mit den Bürgermeistern, der Bürgermeisterin und weiteren Vertreterinnen und Vertretern der kooperierenden Gemeinden sowie des Landes OÖ wurde am 30.09.2020 eine Expedition in die Region Gusental unternommen. Hier konnten gewissermaßen auf Augenhöhe mit der Region konkrete Anforderungen an deren Entwicklungen gesammelt und diskutiert werden. Neue Perspektiven wurden eingenommen, der Blick von außen konnte mit dem lokalen Wissen verschränkt werden und so konnten gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten aufgedeckt und sichtbar gemacht werden. Ihren Abschluss fand die Expedition im Schöffl Kulturzentrum, an der alle Teilnehmenden gemeinsam den Tag reflektieren und konkrete Erwartungen an eine strategische Entwicklung abstecken konnten.




oben links:
oben rechts: Bgm. Martin Tanzer in Alberndorf
unten: beim geschlossenen Hallenbad


Alberndorf in der Riedmark, die Marktgemeinde Altenberg bei Linz, die Gemeinde Engerwitzdorf, die Stadtgemeinde Gallneukirchen und die Gemeinde Katsdorf bilden gemeinsam mit fast 27.500 Einwohner:innen die Region Gusental. Diese Region liegt im Ballungsraum Oberösterreichs, im südöstlichen Mühlviertel und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Linz an. Entsprechend eng sind auch die
wirtschaftlichen, verkehrlichen und räumlichen Verflechtungen innerhalb dieses Ballungsraums. Diese zentrale Lage, die gute Erreichbarkeit regionaler wie überregionaler Märkte und die Verfügbarkeit von entsprechend qualifizierten Arbeitskräften tragen maßgeblich zu einer starken Wirtschaftsentwicklung bei.
Mit der Mühlkreisautobahn A7 und durch die Schnellstraße S10 Richtung Prag ist Engerwitzdorf direkt und die anderen Gemeinden der Region indirekt über Engerwitzdorf an die Wirtschaftsräume Linz, Region Untere Feldaist (Hagenberg, Pregarten, Unterweitersdorf, Wartberg) sowie Freistadt angeschlossen. Mit einem Anteil von 71,9 % dominiert der motorisierte Individualverkehr im Modalsplit und hat seit 1992 auch kontinuierlich an Bedeutung gewonnen (+11,6 %-Punkte, 1992 – 2012) (vgl. Verkehrserhebung 2012). Die Summerauer Bahn bietet für den südöstlichen Teil der Region eine Bahnverbindung nach Linz. Von der geplanten Stadtregionalbahn von Linz bis Gallneukirchen und weiter bis Pregarten ist eine Verlagerung gewisser Anteile zugunsten des Umweltverbundes zu erwarten.
Hitzetage
Die durchschnittliche Anzahl von Hitzetagen (Tage mit min. 30 °C Tageshöchsttemperatur) hat in den letzten Jahren zugenommen und wird dies auch in Zukunft tun. Sogar die mittleren Klimaszenarien für Oberösterreich prognostizieren eine deutliche Zunahme der Hitzetage und davon ist auch das Gusental betroffen (vgl. http://doris.at/themen/umwelt/pdf/clairisa/coin/Klimaszenarien_Hitzetage.pdf). Vor allem im Vergleich mit der sehr hohen Anzahl an Hitzetagen in den Tieflagen des Zentralraums bekommt diese Analyse auch eine planungsstrategische Komponente: Die höheren Lagen im Mühlviertel könnten künftig verstärkt zum Ziel von „stadtregionalen Klimaflüchtlingen“ werden, wenn man die immer älter werdende Bevölkerung und die Zunahme an
Lungenkrankheiten wie COPD o.ä. in Betracht zieht. Auch wenn es sich dabei derzeit noch um Mutmaßungen handelt, sollten Gedankenspiele dieser Art gewagt werden.
Bodengüte
Im südlichen Teil der Region Gusental finden sich große Anteile an hochwertigem Ackerland und Grünland. Dies bedeutet nicht, dass in diesen Bereichen keine Entwicklung möglich ist. Diese Analyse weist aber darauf hin, dass es sich in manchen Gebieten um hochwertige Böden handelt, die in der räumlichen Planung „zur Disposition“ stehen und ein entsprechend reflektierter Umgang mit diesem Sachverhalt notwendig ist. Im Gusental finden sich Böden mit mittlerer bis sehr hoher Bodenqualität vor allem im südlichen Bereich

Karte 5: Bodengüte
hochwertiges Grünland
hochwertiges Ackerland
hochwertiges Ackerund Grünland
Datengrundlage: Lebensministerium eBOD; Stand: 2017; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)
der Stadtregion, während die Bodenqualität in den höheren Lagen abnimmt. Dies soll aus der Perspektive der Bodengüte jedoch kein „Freibrief“ für ungebremste Bodeninanspruchnahme in solchen Bereichen sein.
Regionale Grünzone
Das regionale Raumordnungsprogramm für die Region Linz-Umland 3 weist großflächig Regionale Grünzonen aus. In unserer Region sind die Gemeinden Altenberg und Engerwitzdorf Teil des Planungsgebiets. Die als Grünzone ausgewiesenen Flächen sind in den betroffenen Gemeinden von der Siedlungsentwicklung auszunehmen und es muss sich nicht nur die kommunale Flächenwidmung an diese verordnete planerische Vorgabe halten, sie ist ebenso eine ganz wesentliche Grundla-
ge für die strategische Planung im Kontext der stadtregionalen Entwicklung. In vielen Ortsteilen von Altenberg und Engerwitzdorf stellt die regionale Grünzone eine Art Siedlungsgrenze dar, weil sie oftmals unmittelbar an die letzte Reihe der Bebauung heranreicht. Gerade im unmittelbaren Verflechtungsbereich von Engerwitzdorf und Gallneukirchen stellt die regionale Grünzone ein wesentliches, gliederndes Raumordnungselement dar, das auch im Zusammenhang mit einer Entwicklung des Fokusgebiets "Kepler Valley" zu berücksichtigen sein wird. In Altenberg verhindert die regionale Grünzone hingegen großflächig und langfristig ein „Zusammenwachsen“ mit den sich von Süden her ausdehnenden Siedlungsstrukturen aus Linz.
0 1 2 3 4 5 km
Langfristige Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden
Die prozentuelle Veränderung des Bevölkerungsstands von 10.100 im Jahr 1951 auf 27.441 Menschen zum Jahresanfang 2020 beträgt 171 %. In ihrer Gesamtheit spiegelt diese Dynamik die Lage der Analyseregion im Stadtumland einer attraktiven Großstadt wider. Der größte Anteil des Wachstums in solchen Umlandgemeinden geht auf Zuzüge aus der Kernstadt zurück, meist getragen von jungen Familien, die ihren Wohnort ins „Grüne“ verlegen – mit dem Fachausdruck „Suburbanisierung“ bezeichnet. Blickt man auf die Entwicklungslinien der einzelnen Gemeinden im Gusental, so zeigen sich einige Unterschiede. Während die Entwicklung in Gallneukirchen und Engerwitzdorf bereits um das Jahr 1961 an Fahrt aufnahm, lässt sich das Referenzjahr 1971 als Startpunkt einer stärkeren Dynamik für Altenberg ausmachen, die Entwicklungsdynamik in Alberndorf und Katsdorf legte ab 1981 nochmals deutlich zu. Das prozentuell stärkste Wachstum ver-
bucht im betrachteten Zeitraum Engerwitzdorf auf sich (240 %), gefolgt von Altenberg (190 %); sogar Alberndorf, das die flachste Entwicklungslinie aufweist, hat sich in diesen Jahrzehnten bevölkerungsmäßig verdoppelt (Abb. 1). Im Jahr 1991 hatte sich die Bevölkerungszahl im Gusental bereits verdoppelt; die politische und planerische Auseinandersetzung mit Wachstum ist für alle fünf Gemeinden also schon seit einigen Jahrzehnten nichts Ungewöhnliches.
Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung
Betrachtet man in Karte 6 die Bevölkerungsentwicklung kleinräumig im Raster und für die jüngere Vergangenheit (2011 – 2020), so zeigt sich ein Nebeneinander von Rasterzellen mit starker, bis sehr starker Bevölkerungszunahme und solchen mit (starker) Abnahme. Rasterzellen mit Neubautätigkeiten liegen neben solchen, die ältere Siedlungsgebiete umfassen, in denen die abnehmende Bevölkerung demo-
Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung 1951 – 2020 (1951 = 100 %)
Katsdorf
Alberndorf
Altenberg
Engerwitzdorf
Gallneukirchen
Datengrundlage:
Karte 6: Bevölkerungsentwicklung 2011 – 2020
graphisch oder biographisch erklärbar ist (ältere Bevölkerung verstirbt / Jüngere verlassen das Elternhaus). Auf die gesamte Untersuchungsregion bezogen, lassen sich keine eindeutigen Wachstumsschwerpunkte ausmachen, was anteilige Bevölkerungsentwicklung anbelangt; vielmehr hat jede Gemeinde ihre eigenen diesbezüglichen Hot-Spots. Die Schwerpunkte der Entwicklung liegen in den meisten Fällen in den Hauptorten bzw. den größeren Ortsteilen, einige Streulagen weisen eine insgesamt eher negative Entwicklung auf.
Datengrundlage: Statistik Austria; Stand: 2020; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)
Bevölkerungsprognose
Für den gesamten oberösterreichischen Kernraum wird nach der Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich eine positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert; hier macht unsere Untersuchungsregion keine Ausnahme. Bereits im Jahr 2030 wird die Marke von 30.000 Einwohner:innen überschritten. Die prognostizierte Entwicklung kann nie die
tatsächliche Dynamik in einer Region abbilden, noch weniger die Entwicklung in einer einzelnen Gemeinde „vorhersagen“, die aus ihr ablesbaren Trends sind aber für die strategische Planung von Bedeutung. In unserem Fall bedeutet das, einen regionalen Weg für weiteres, untereinander abgestimmtes Wachstum zu erarbeiten.
Abb. 2: Bevölkerungsprognose Gusental
Datengrundlage: Statistik Austria und Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich, 2015; eigene Darstellung; Stand: 2020; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)
Wanderungsvolumen und -bilanz
Betrachtet man die Wanderungsbilanz nach Altersgruppen, so zeigt sich eine Verteilung, die typisch für suburbane Gemeinden ist und eingangs schon thematisiert wurde: Die Wanderungsgewinne im Gusental entstehen durch den Zuzug junger Familien. In der Altersgruppe von 30 bis 34 Jahren sind die stärksten Zuwächse verzeichnet (+400), die zweitstärksten Werte finden sich bei den Kindern von 0 bis 4 Jahren (+314). Demgegenüber stehen ebenfalls charakteristische Wanderungsverluste in den Gruppen der 15-19-Jährigen und vor allem der 20-24-Jährigen: Sie verlassen die Heimatorte, um einer höheren Ausbildung andernorts nachzugehen. Die Wanderungsgewinne entstehen dabei durch Wanderungsbewegungen innerhalb Österreichs, direkte Zuwanderung aus dem Ausland spielt im Vergleich hierzu eine untergeordnete Rolle.
Karte 7: Wanderungssaldo Gusental 2002 – 2019
Datengrundlage: Bevölkerungsund Wanderungsstatistik der Statistik Austria, eigene Berechnungen und Darstellung; Stand: 2019; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger) Zuzüge Wegzüge
Abb. 3: Wanderungsbilanz nach Altersgruppen 2012 – 2019
Zu- bzw. Abwanderung innerhalb Österreichs
Zu- bzw. Abwanderung aus dem bzw. ins Ausland
Datengrundlage: Bevölkerungsund Wanderungsstatistik der Statistik Austria; eigene Berechnungen; Stand: 2019; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)
Wanderungssaldo
Karte 7 stellt die Wanderungssalden der Untersuchungsregion mit den österreichischen Bundesländern (Binnenwanderungssaldo) und dem Ausland für den Zeitraum 2002 bis 2019 dar. Hier wird deutlich, dass die Wachstumsgewinne der Gusentalgemeinden hauptsächlich durch Zuzüge aus Oberösterreich entstehen (+1.941 im betrachteten Zeitraum); sämtliche Zuzüge aus dem Ausland stehen zusammengenommen mit einem Plus von 603 auf Platz zwei. Die Attraktivität der Bundeshauptstadt als Universitäts- und Berufsstandort strahlt auch ins Gusental aus: Die Gemeinden unserer Region haben im Betrachtungszeitraum 536 Bewohner:innen statistisch durch Wegzüge nach Wien verloren.
Pendler:innen
Die Analyse der Ein- und Auspendler:innen beschäftigt sich mit den mitunter wichtigsten Indikatoren, wenn es um funktionale Verflechtungen von Gemeinden geht. Gerade in Einflussbereichen von so dynamischen Großstädten wie Linz lassen sich hier wichtige Erkenntnisse erzielen. Betrachtet man zuerst den Pendlersaldo der Erwerbstätigen (Karte 8), so zeigt sich, dass alle Gemeinden der Untersuchungsregion einen negativen Saldo aufweisen, was die Berufspendler:innen betrifft: Aus jeder Gemeinde pendeln also täglich mehr Menschen in einen anderen Ort, um dort ihrer Beschäftigung nachzugehen als in eine unserer fünf Gemeinden im Gegenzug einpendeln. Im Jahr 2018 erreichte Engerwitzdorf mit einem negativen Saldo von 2.236 den diesbezüglich höchsten Wert, während der Saldo in Gallneukirchen mit -648 am niedrigsten liegt. Bei den Schulpendler:innen erreicht der Schulstandort Gallneukirchen mit einem Saldo von +45 den einzigen positiven Wert in der Analyseregion.
Verkehrsmittelwahl
Aus der Verkehrserhebung des Landes Oberösterreich liegen Daten zur Verkehrsmittelwahl für die Jahre 1992, 2002 und 2012 in den einzelnen Gemeinden vor. In allen Gemeinden zeigt sich das gleiche Bild, wenngleich in verschieden starker Ausprägung: Der Autoverkehr (motorisierter Individualverkehr MIV) dominiert und steigt; alle anderen Verkehrsmittel (Öffentlicher Verkehr, Radverkehr, Fußverkehr) sind schwach vertreten und gehen zurück. Aufgrund der Zunahme des Gesamtverkehrsaufkommens stieg der Autoverkehr in absoluten Zahlen noch stärker als die Anteile. Die Entwicklung der Verkehrsmittelwahl entspricht dem oberösterreichischen Durchschnitt. Die Mobilitätsziele des Mobilitätsleitbilds für die Region Linz* („Kumm Steig Um“) peilen einen Rückgang des Autoverkehrs von 57 % auf 47 % der Wege (das ist jede fünfte Autofahrt) an. Mit diesem Wert ergäbe sich ein Rückgang des absoluten Autoverkehrs um lediglich 5 bis 10 %, da der Rest durch das erwartete Bevölkerungswachstum kompensiert wird.
Die Erreichung dieses Mobilitätsziels erscheint beinahe unrealistisch. Es benötigt extreme Maßnahmen, um einen so starken Rückgang in so kurzer Zeit und entgegen der Entwicklung der letzten Jahrzehnte zu schaffen.
Pendlersaldo
Abb. 4: Entwicklung der Verkehrsmittelwahl
Karte 8:
Pendler:innensaldo Erwerbstätige nach Sektoren
Erwerbstät ge nach Sektoren Pr märe Sektor
-2.236 – -2.000
-2.000 – -1.500
Sekundäre Sektor Te t äre Sekto
Pendlersa do (2018)
-1.500 – -1.000
-2 236 - -2 000
-1.000 – -648
-2 000 - -1 500
Primärer Sektor
Sekundärer Sektor
Tertiärer Sektor
Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik; eigene Berechnungen; Stand: 2018; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)
-1 500 - -1 000 -1 000 - -648
* gemäß Mobilitätsleitbild „Kumm Steig Um“. Hinweis: Das Betrachtungsgebiet enthält aus der Region Gusental die Gemeinden Altenberg und Engerwitzdorf
FAMILIENIDYLL- UND SIEDLUNGSREIFE-INDEX
Mit Hilfe von Indizes können für einen Themenbereich unterschiedliche und aussagekräftige Indikatoren miteinander verknüpft werden, um räumliche Hotspots zu identifizieren, in denen planungsrelevante „Merkmalshäufungen“ vorkommen. Was abstrakt klingt, ist am Beispiel schnell erklärt. Familienidyll- und Siedlungsreife-Index werden von uns verwendet, um zwei ganz unterschiedliche Arten von Wohngebieten in der Untersuchungsregion zu identifizieren: Der Familienidyll-Index ermittelt, wie es der Name schon verrät, idealtypische Einfamilienhausgebiete, die hauptsächlich von jungen Familien bewohnt werden. Er setzt sich aus diesen Kriterien zusammen:
• Anteil der Bevölkerung unter 20 Jahre über 20 %
• Bevölkerungsentwicklung 2011 bis 2018 über dem regionalen Schnitt von 6 %
• Anteil der Paar-Kind-Familien über 50 %
• Anteil der Wohngebäude mit 1 – 2 Wohngebäude über 75 %
• Anteil der aus der Rasterzelle auspendelnden Bevölkerung über 66 %
Im Gegensatz hierzu steht der SiedlungsreifeIndex. Dabei handelt es sich um Wohngebiete, die eine ähnliche Siedlungsstruktur aufweisen und die klassische Einfamilienhausbebauung überwiegt. Allerdings sind sowohl die Gebäude als auch deren Bewohner:innen inzwischen in die Jahre gekommen. Klar ist, dass sich daraus ein ganz anderer planungsbezogener Handlungsbedarf ableiten lässt: Was passiert mit den Gebäuden, sollten die Einwohner:innen verstorben sein? Ist die Gebäudesubstanz an heutige Standards anpassbar? Handelt es sich um potenzielle Nachverdichtungsgebiete?
Steigt der Bedarf an mobilen sozialen Diensten in diesen Gebieten? Diese und viele weitere
Familienidyll- u
Karte 9: Familienidyllund Siedlungsreife-Index
Familienidyll-Index
4/5 Kriterien erfüllt
5/5 Kriterien erfüllt
Siedlungsreife-Index
4/5 Kriterien erfüllt
5/5 Kriterien erfüllt
Datengrundlage: Bevölkerungsstand 2020, Familien 2018, Gebäude 2018 der Statistik Austria; eigene Berechnungen; Bearbeitung: Modul 5 (Max Aichinger)
Fragen gehen damit einher. Der SiedlungsreifeIndex setzt sich aus diesen Komponenten zusammen:
• Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre über 33 %
• Bevölkerungsentwicklung 2011 bis 2018 unter 1 % (Stagnation bis Bevölkerungsabnahme)
• Anteil der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte über 60 %
In der Untersuchungsregion finden sich zwar, wie eingangs erwähnt, alle charakteristischen räumlichen Verteilungsmuster, im Gegensatz zu anderen suburban geprägten Stadtumlandbereichen gibt es derzeit allerdings keine aus planungsstrategischer Sicht wirklich relevante räumliche Konzentration von Siedlungsreife-Rastern; die Verteilung „junger“ und „alter“ Siedlungsbereiche ist sowohl in den Hauptorten als auch in den Ortsteilen und Streulagen eher von einem ausgewogenen Nebeneinander gekennzeichnet. Neben der Ausweisung von neuen Baugebieten, könnte auch die rechtzeitige demographische „Durchmischung“ älterer Siedlungen durch neue und jüngere Hinzuziehende ein Grund für dieses Ergebnis sein. Es bleibt allerdings zu bedenken, dass langfristig betrachtet viele der heute „jungen“ Wohngebiete in 15 – 30 Jahren die hier beschriebene „Siedlungsreife“ erreicht haben und damit ganz andere Ansprüche einhergehen, was z.B. ÖV-Angebot, soziale Infrastrukturen und Daseinsvorsorge betrifft.

Gerade in einer nach wie vor sehr „landschaftlich“ geprägten Region wie dem Gusental ist ebendiese Landschaft scheinbar noch in ausreichendem Maß, wenn nicht sogar „im Überfluss“ vorhanden. Gerade deshalb ist es wichtig, den immensen ökologischen Wert der großen, zusammenhängenden landwirtschaftlich genutzten Flächen und aller anderen Grünräume ins Bewusstsein zu rücken und sie nachhaltig zu sichern. Wachstum und sorgsamer Umgang mit Boden schließen sich nicht aus; es geht dabei darum, frühzeitig die Weichen für eine klimagerechte Siedlungsentwicklung zu stellen. Das Gusental hat die Möglichkeit, genau das zu tun, indem einerseits Siedlungsschwerpunkte in den am besten dafür geeigneten Bereichen festgelegt werden und andererseits die „freie und zusammenhängende Landschaft“ als ebendiese erhalten bleibt.
In Anbetracht der immer stärker und unzweifelhafter spürbaren Auswirkungen des Klimawandels ist es wahrscheinlich, dass vor allem die klimatischen Gunstlagen im Gusental mittel- bis langfristig ins Blickfeld derjenigen geraten, die der zunehmenden Hitze in dichter verbauten, urbanen Lagen den Rücken kehren wollen und entsprechend Wohnraum nachgefragt werden wird. Jegliche Art von steigender Nachfrage darf in Anbetracht der immensen ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht in einer planlosen oder althergebrachten Siedlungsentwicklung münden. Innovative, flächensparende und gemeinschaftsfördernde Architektur- und Wohnmodelle sind heute schon als planungsstrategische Visionen gefragt. Ebenso müssen die Kriterien für künftige Wohn- und Betriebsstandorte bereits heute schon definiert werden, auch wenn deren konkrete Umsetzung noch gar nicht auf der tagespolitischen Agenda steht.
Der Erhalt und die Inwertsetzung der Landschaft sind nicht nur aus ökologischer und klimawandelbedingter Motivation heraus ein zentraler Baustein der regionalen Strategie für das Gusental. Die Region lebt auch von ihrem höchst attraktivem naturräumlichen Setting, das gleichsam ihre Visitenkarte nach außen und ein identitätsstiftendes Element nach innen ist.
Die Gesellschaften Europas werden immer älter. Auch damit gehen große Herausforderungen für eine Region wie dem Gusental einher. Je stärker zwar die Wachstumsdynamik in einer Region ist, desto „jünger“ ist ihre Bevölkerung im Durchschnitt. Dennoch wird auch im Gusental die absolute Anzahl der Älteren und Alten mittel- bis langfristig so zunehmen, dass man sich schon heute Gedanken darüber machen muss, wie das künftige Zusammenleben in Bezug auf Wohnmodelle, die dörfliche und regionale Gemeinschaft und die Versorgung der älteren Bevölkerung räumlich und funktional organisiert werden können. Gerade in diesem Bereich bieten sich gemeindeübergreifende, regional gedachte und ausgeführte Konzepte an (z. B. im Bereich interkommunal organisierter Wohnmodelle für Ältere bzw. für verschiedene Generationen).
Aus den hier nur knapp skizzierten großen Herausforderungen, vor denen das Gusental genauso steht, wie alle Gemeinden in Österreich, ist es notwendig, jetzt schon die Leitplanken für die künftige räumliche Entwicklung einzuschlagen. Und es sind nur vermeintlich Schlagworte; es gilt für die Gemeinden des Gusentals, ganz spezifische und regional „nachvollziehbare“ Strategien und Maßnahmen abzuleiten:
• ein räumliches Gerüst aus Entwicklungsschwerpunkten und Freiräumen schaffen
• Zersiedelung vermeiden
• Freiräume nachhaltig sichern
• die Rolle der Landwirtschaft in einer wachsenden Stadtregion definieren
• Siedlungsentwicklung möglichst unabhängig vom privaten PKW machen
• zukunftsgewandte, flächenschonende Wohnmodelle umsetzen
HANDLUNGSERFORDERNISSE
Eine umfassende Raum- und Strukturanalyse inkl. ausführlicher Gemeindesteckbriefe ist im sogenannten Gusental-Atlas dokumentiert. Daraus lassen sich Handlungserfordernisse ableiten, die aus unserer Sicht bei der Entwicklung einer gemeinsamen regionalen Strategie eine sehr wichtige Rolle spielen. Bewusst nehmen wir dabei noch (weitgehend) die Perspektive von außen ein, um Schritt für Schritt vom „Allgemeinen“ zum „Besonderen“ zu kommen: Planungsherausforderungen, -ziele und Lösungsansätze, die über das Gusental hinaus Gültigkeit haben, werden dahingehend überprüft, welche Relevanz und Gültigkeit sie für unsere Region haben und welche ganz individuellen Lösungsansätze und Strategien es im Gusental dafür geben kann.
1.Sich Wachstums- und Entwicklungsziele geben
Schon im Jahr 2030 erreichen die Gemeinden im Gusental die Marke von 30.000 Einwohner:innen. Das bedeutet einen Zuwachs um gut 2.500 Menschen in den kommenden neun bis zehn Jahren. Diese Entwicklungsdynamik ist für unsere Gemeinden nichts Neues, im Sinne einer untereinander abgestimmten Planung und einer in allen Belangen nachhaltigen Entwicklung müssen sich die Gemeinden einige Fragen stellen:
• Wo sollen die künftigen Entwicklungsschwerpunkte in der Region liegen?
• Welche Wohnformen will man in der Region künftig anbieten?
• Gibt es attraktive Lösungen jenseits des klassischen Einfamilienhauses?
Die übergeordneten Rahmenbedingungen im Blick behalten
Klimawandel und Alterung der Gesellschaft sind zwei Einflussfaktoren, die die Entwicklung im Gusental in naher Zukunft ganz konkret beeinflussen könnten: Die klimatische Gunstlage vor allem im nördlichen Teil der Region kann attraktives Ziel für Menschen aus den tieferen Lagen und der Großstadt sein, die der zunehmenden Zahl an Hitzetagen fliehen wollen. Nicht nur die Menschen im Gusental werden mittelfristig deutlich älter werden, sondern im ganzen Land: Wird es einen verstärkten Zustrom von Silverund Golden-Agers ins Gusental geben und welche Ansprüche werden sie an ihr Lebens- und Wohnumfeld mitbringen?
• Wie lässt sich heute schon klimaangepasst und nachhaltig bauen, welche Siedlungsformen sind zukunftsweisend?
• Wo besteht die Gefahr von Hitzeinseln und wie lassen sie sich vermeiden?
• Wie gut sind die Voraussetzungen in unseren Gemeinden, um einer immer älteren Bevölkerung das Notwendige bieten zu können?
3. Entwicklung an den leistungsstarken
ÖV-Achsen ausrichten
Unabhängig von der in Punkt 1 diskutierten Intensität der künftigen Entwicklung sollte sich der überwiegende Teil des Wachstums auf den Nahbereich der schon heute bestehenden ÖV-Achsen bzw. sich an den Haltepunkten der künftigen Stadtregionalbahn orientieren. Natürlich wird das Auto auch mittelfristig das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel sein, um die täglichen Wege zurückzulegen; durch eine stärkere Verzahnung von Mobilitätsangeboten und Siedlungsentwicklung können die Gemeinden im Gusental aber hoch attraktive Alternativen für diejenigen entwickeln, die bewusst auf den PKW verzichten wollen. In diesem Zusammenhang reicht das Spektrum von handfesten Planungsmaßnahmen bis hin zu visionären Ideen:
• Mindestdichten bei der Bebauung im Nahbereich von ÖV-Haltestellen!
• Ausbau strategisch wichtiger Radrouten für den Alltagsradverkehr!
• Die erste autofreie Siedlung im Linzer Umland!
• Wie können die Gemeinden abseits der ÖVAchsen von dieser Strategie profitieren bzw. an ihr teilhaben?
4. Gusental breiter positionieren: Auf Forschung & Entwicklung setzen
Die Analyse zeigt es: Die Gemeinden im Gusental sind in erster Linie Wohn- und Lebensorte, ihre Bedeutung als (höherer) Ausbildungs- oder Wirtschaftsstandort ist deutlich nachgereiht.
Die Anzahl der Auspendler:innen übersteigt jene der Einpendler:innen um ein Vielfaches. Mit der Idee des Kepler Valley schlummert bereits seit einiger Zeit eine Strategie, die es aufzuwecken und mit Leben zu befüllen gilt. Die Lage an der Achse Linz-Hagenberg und die Aussicht auf die Anbindung durch die Stadtregionalbahn sind Gründe genug, das Kepler Valley konzentriert weiterzuentwickeln:
• Wo soll der Hauptstandort für das Kepler Valley sein? Was spricht für eine Neugründung auf der grünen Wiese und was für zentrale Standorte (wie z.B. das One in Gallneukirchen)?
• Welche Kriterien müssen dezentrale Standorte und Unternehmen erfüllen, die sich mit dem Kepler Valley-Siegel auszeichnen wollen?
5. Interkommunalität als ganz spezieller Erfolgsfaktor
„Interkommunalität“ prägt das Gusental einerseits räumlich: Die Siedlungsstruktur zwischen Engerwitzdorf und Gallneukirchen ist an vielen Stellen miteinander verschmolzen, ein ähnliches Muster zeigt sich zwischen Engerwitzdorf und Katsdorf (wenngleich in schwächerem Ausmaß).
Auch die sozialräumlichen und demographischen Strukturen sind oftmals „gleichverteilt“ über das Gusental; das heißt, dass sich die Gemeinden auch in Bezug auf Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Mobilität usw. die damit einhergehenden Ansprü-
che und Herausforderungen „teilen“. Andererseits beweisen die Gemeinden über die Arbeit in der Region Gusental, dass sie Interkommunalität seit vielen Jahren auch institutionell beherrschen. In der vorliegenden Analyse wurde aufgezeigt, dass die fünf Gemeinden in einigen Fällen vor denselben Planungsherausforderungen stehen, für die man gemeinsam Lösungen entwickeln kann, die mit einer interkommunalen Lasten- und Nutzenaufteilung einhergehen, von der alle im Gusental profitieren.
• Eine mittelfristig insgesamt alternde Bevölkerung in der Region und die damit verbundenen Ansprüche an Infrastrukturen, Daseinsvorsorge, Mobilität und Wohnen
• Interkommunale Wohngebiete
• Ein „soziales INKOBA“: Gemeinsame Wohnund Pflegeeinrichtungen an zentralen Standorten
• INKOBA klassisch, gemeinsames Betriebsgebiet
6. Sich einen gemeinsamen Planungsrahmen geben
Die Gemeinden im Gusental zeichnen sich durch z.T. hoch interessante individuelle Lösungen aus, wenn es um Siedlungsentwicklungsplanung geht. Welche dieser Maßnahmen und Strategien lassen sich verallgemeinern bzw. in der ganzen Region anwenden? Wenn sich das Gusental künftig durch nachhaltige, vernünftige Raumstrukturen im Großen und ebenso nachhaltige Wohnformen im Kleinen, braucht es untereinander abgestimmte raumplanerische Vorgaben, damit überall dieselben Rahmenbedingungen herrschen. Auf diese Weise können zukunftsweisende, flächenschonende Siedlungsstrukturen in der Region erreicht wer- den, die einer fortschreitenden Zersiedelung keine Chance lassen:
• Regionale Mindestdichten in Innenbereichen/ Ortskernen
• Regionale Beschränkung der Größe von Einfamiliengrundstücken
• Regionales Vorkaufsrecht für die Gemeinden

Die Landschaft ist die erste Adresse im Gusental
Die Region Gusental ist in ganz besonderer Weise von ihren Landschaften geprägt: von den hügeligen Ausläufern des Mühlviertels und den Gewässern der Großen und Kleinen Gusen, die gewissermaßen als „blaues Rückgrat“ die Region durchziehen und ihr auch ihren Namen geben.
So soll die gesamte Region aus ihrer Landschaft heraus begriffen und Grünräume als Standortfaktor und Adressbildner positioniert werden. In der räumlichen Entwicklung der Region ist die Landschaft in besonders sorgfältiger Weise zu integrieren und dauerhaft zu sichern.
Das grüne Gerüst gliedert die Region
Die Landschaft besitzt raumstrukturierende Funktionen, die es aktiv zu gestalten gilt. Ein großzügiges und engmaschiges Netz aus unterschiedlichen Grün- und Freiräumen legt sich über die Region und verknüpft die einzelnen Gemeinden miteinander. Dieses „grüne Gerüst“ schafft Orientierung, sichert das Landschaftsbild und gewährleistet die Nutzbarkeit und Erreichbarkeit regional relevanter Grünräume.
Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind integrierte Aufgaben
Die Folgen des Klimawandels lassen sich nicht mehr umkehren. Um jedoch die weitere Erderwärmung in den Griff zu bekommen, sind zwei Strategien gleichzeitig zu verfolgen: Der Klimaschutz, um den weiteren Anstieg der Temperatur einzudämmen und die Klimawandelanpassung, um besser mit der zunehmenden Hitze und Starkregen etc. umgehen zu können. Dabei lassen sich diese Strategien nicht losgelöst von anderen räumlichen Entwicklungsfragen behandeln. Die Eindämmung des Klimawandels ist daher als integrierte Aufgabe zu verstehen, die in Grünraum-, Siedlungs- und Standortentwicklungen ebenso einfließen muss wie in die Gestaltung von Mobilitätsangeboten.
Leitziel 1
Regional bedeutsame Grünräume sichern
Das regionale Raumordnungsprogramm für die Region Linz-Umland 3 weist großflächige regionale Grünzonen aus. Auch Grünräume außerhalb dieser verordneten Bereiche sollen als zusammenhängende Landschaft gesichert werden. Sie weisen zum einen ganz zentrale ökologische Funktionen auf – nicht zuletzt sichern sie Kaltluftschneisen und tragen maßgeblich dazu bei, die sommerliche Überhitzung der Region zu mindern. Darüber hinaus prägen sie das identitätsstiftende Bild der Region und wirken raumgliedernd. Damit ist auch in der Siedlungsentwicklung ein zentraler Anspruch an einen möglichst sparsamen Umgang mit Boden verbunden, nicht zuletzt aufgrund der teilweise sehr hohen Bodengüte in der Region (vgl. Karte 5). Auch die Land- und Forstwirtschaft trägt zur Kultivierung und Sicherung dieser prägenden Kulturlandschaft bei. Ebenso sind die siedlungsnahen Produktionsfunktionen und Grünräume zu erhalten.
Leitziel 2 Vernetzung von Siedlungen und Landschaft entlang regionaler Freizeitrouten
Neben dem Erhalt gilt es auch, bedeutende Grün- und Freiräume besser miteinander zu vernetzen und deren Erreichbarkeit zu sichern.
Ein engmaschiges Netz an Grün- und Freiräumen verwebt die Region zu einem zusammenhängenden, ökologischen Netz und reicht bis in die Siedlungsbereiche. Ziel soll es sein, über möglichst kurze Wege vom Wohnraum einen Grün- und Naherholungsraum erreichen zu können, zu Fuß oder mit dem Rad. Vor allem
durch die Vernetzung und den Ausbau von bestehenden lokalen Rad- und Wanderrouten zu einem gemeinsamen regionalen Netz lassen sich so mit vergleichsweise einfachen Mitteln die Erreichbarkeit und Erlebbarkeit der grünen Infrastruktur der Region verbessern. Einen besonderen Stellenwert als Naherholungsräume nehmen dabei die Uferbereiche der Großen und Kleinen Gusen bzw. der Gusen ein, die heute nur an wenigen Stellen erlebbar sind.
Leitziel 3
Hochwasserschutz als Voraussetzung für Standortentwicklung
Entlang der (Großen) Gusen in Gallneukirchen, Engerwitzdorf und Katsdorf liegen einige Siedlungsbereiche in der Hochwasser-Gefahrenzone. Bei der Entwicklung von neuen Standorten spielen Schutzmaßnahmen vor Hochwassergefahren eine ganz zentrale Rolle. So ergibt sich überall dort, wo strategisch relevante Entwicklungsschwerpunkte an diesen Zonen liegen –wie etwa im Fokusgebiet Kepler Valley – ein entsprechender Planungsbedarf.
Leitziel 4
Siedlungsnahe Wald- und Landwirtschaftsflächen erhalten
Großflächige Grünräume ab etwa 1 ha tragen nachweislich zur Kühlung ganzer Ortsteile bei. Auch wenn die sommerliche Überhitzung vor allem in dicht bebauten und stark versiegelten Stadträumen spürbar ist, kann es auch in weniger dicht verbautem Siedlungsgebiet zu lokalen Hitzeentwicklungen kommen. Gerade Grünflächen, wie Wald- und Landwirtschaftsflächen sind besonders gute Kaltluftentstehungsgebiete, die in siedlungsnahen Gebieten zu erhalten sind.
Leitziel 5
Klimafitness und Energieraumplanung in neuen Entwicklungsschwerpunkten zum Standard machen
Sowohl bei der Sanierung und Anpassung von Bestandsgebieten als auch bei der Entwicklung neuer Siedlungsgebiete ergibt sich die Möglichkeit, ganz grundsätzlich die Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung zu integrieren und in die Planungen aufzunehmen. In allen Entwicklungsschwerpunkten der Region Gusental soll möglichst
klimaneutral – also mit starker Reduktion von Treibhausgasemissionen – hitzeangepasst und innovativ im Umgang mit dem Regenwassermanagement, mit Heizen und Kühlen sowie mit der Energieversorgung gearbeitet werden. Leitlinien der Energieraumplanung sind in besonderem Maße auch in Bestandssiedlungen aufzunehmen.
S-Bahnen Bestand (dunkelgrau)
Entwicklungskorridor
S-Bahn
S-Bahnen
Bestand (hellgrau)
KIRCHSCHLAG BEI LINZ
HELLMONSÖDT
G r . Haselb ach
LICHTENBERG
S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Haltestelle
Bahn (rot)
Entwicklungskorridor
S-Bahn
Entwicklungskorridor
S-Bahn
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
ALTENBERG BEI LINZ
OTTENSCHLAG IM MÜHLKREIS
Altenberg
Steinbach
Alberndorf
Pröselsdorf
ALBERNDORF IN DER RIEDMARK
NEUMARKT IM MÜHLKREIS
KEFERMARKT
HAGENBERG IM MÜHLKREIS
Oberndorf
GALLNEUKIRCHEN
Katzgraben
Niederkulm
Schweinbach
Treffling
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 60‘ Takt
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch
Radpotenzial hoch
Radpotenzial sehr hoch
ENGERWITZDORF
Radpotenzial hoch
Radpotenzial mittel
Holzwiesen
ÖV-Güteklasse B
Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse C
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
UNTERWEITERSDORF
Enger witzdorf
ÖV-Güteklasse B
ÖV-Güteklasse D
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
WARTBERG OB DER AIST
PREGARTEN
Karte 10: Landschaft und Klima
LEITBILDBAUSTEINE
Flusskorridore Vernetzung von Siedlungen und Landschaft entlang regionaler Freizeitrouten
Bestehende lokale Freizeitrouten zu regionalem Netz verbinden
TRAGWEIN
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewäs ser (grau)
Gusentalterrasse GRUNDLAGEN
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze
Bauland Kerngebiet, gemischtes Baugebiet, Sondergebiete des Baulandes (lt. Flächenwidmungsplan)
ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Z K Bauland Geschäftsgebiet, Betriebsbaugebiet, Industriegebiet, eingeschränktes gemischtes Baugebiet (lt. Flächenwidmungsplan)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
ÖV-Güteklasse E
ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)
Klendorf
Bodendorf
Katsdorf
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
Fokusgebiet Z Fokusgebiet
Z Bauland Dorfgebiet, Wohngebiet, Reines Wohngebiet (lt. Flächenwidmungsplan)
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet
G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau) Z K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewäs ser (Farbe) Grünland (lt. Flächenwidmungsplan)
KATSDORF
Hauptgewässer Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft
Hauptgewässer (Farbe)
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Wald Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichts punkte Landschaft Regionale Grünzonen Linzer Umland
HQ 10-Flächen Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft
Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorri dore Nebengewässer
HQ 30-Flächen Wildtierkorridore
ALLERHEILIGEN
Grünzonen lt. ÖEK Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeinde grenzen
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau)
Standorf Lungitz
K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)
ST. GEORGEN AN DER GUSEN
Stadtregionalbahn (in Planung)
Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
RIED IN DER RIEDMARK
ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau)
LUFTENBERG AN DER DONAU
Entwicklungskorridor S-Bahn
Entwicklungs korridor S-Bahn
Haltestelle Bahn
SCHWERTBERG
L01
Ausbau regionaler Freizeitrouten
Die besondere Qualität der Grün- und Freiräume des Gusentals werden nicht zuletzt dann erlebbar, wenn man sie gut erreichbar und nutzbar macht. Dabei lässt sich sehr gut an das bereits bestehende Netz aus unterschiedlichen regional relevanten Freizeitrouten anknüpfen, wie etwa dem Pferdeeisenbahn Wanderweg, dessen Strecke von Linz bis ins Tschechische Bujanov auch durch Engerwitzdorf und Gallneukirchen und vorbei an Alberndorf führt. Folgende Kriterien sollten die Freizeitrouten dabei unbedingt erfüllen:
• Zum einen sollen die Strecken mehrere Gemeinden miteinander verbinden und damit die regionale Perspektive der Freizeiträume sichtbar machen.
• Siedlungsbereiche sollen gut an die Freizeitrouten angebunden sein. Je besser die Erreichbarkeit der Erholungsräume für die Menschen in der Region hergestellt ist, desto besser werden sie auch im Alltag genutzt.
• Die Freizeitrouten sollen gut an das Netz des öffentlichen Verkehrs angebunden sein. Ziel ist es, die Grün- und Erholungsräume des Gusentals zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen zu können.
Folgende Maßnahmen sind hier zu setzen:
Workshop „regionale Freizeitrouten“
Im Rahmen eines Workshops lässt sich der Status Quo bereits bestehender regionaler Wander- und Radwege ermitteln und Ausbaupotenziale klären. Ziel soll es sein, den Fokus auf interkommunale Wanderwege zu richten, die möglichst vielseitig die Freiraumqualitäten des Gusentals erlebbar machen. Neben den entsprechenden Ausschussmitgliedern aller Gemeinden können auch Vertreter:innen von Tourismusverbänden, dem Regionalmanagement und Jugendverbänden in diesen Workshop eingebunden werden.
Wanderkarte Gusental
Um die regionalen Freizeitrouten und die Erlebnis- und Freiraumqualitäten des Gusentals anschaulich vermitteln zu können, empfiehlt sich die Erstellung einer „Wanderkarte Gusental“. Hier lassen sich alle regional relevanten Freizeitwege, die Anbindung an die verschiedenen Ortsteile und besondere Orte in der Region sichtbar machen.
Einen zentralen Stellenwert in der Erlebbarkeit der regionalen Grün- und Freiräume und damit auch der regionalen Freizeitrouten nehmen Orte mit besonderer Aufenthalts- und Gestaltungsqualität ein. So wird empfohlen, an ausgewählten Standorten sogenannte „Gusentalterrassen“ zu errichten, die attraktive Ziele und Anziehungspunkte mit Verweilmöglichkeiten innerhalb des Freizeitroutennetzes darstellen. Entlang der Gusen hat man in Gallneukirchen mit dem Projekt Gusentrail bereits ein vergleichbares Projekt erfolgreich für eine
Umsetzung vorbereiten können. Ziel des Projekts „Gusentalterrassen“ ist es, die Erlebbarkeit und Sichtbarkeit des Wassers im Gusental zu verbessern. An gut zugänglichen Stellen entlang der Großen Gusen bzw. der Gusen können Holzplateaus im Uferbereich errichtet werden, die Sitz- und Liegegelegenheit bieten und so die Lage am Wasser noch zusätzlich aufwerten. Die Gusentalterrassen beschränken sich allerdings nicht auf Standorte am Wasser: auch in Gemeinden abseits der Gusen lassen sich attraktive Standorte finden. Kreuzungen
von Wanderwegen oder Punkte mit besonders attraktiver Aussicht in die Region können mit einer Gusentalterrasse als Ankerpunkt im regionalen Freizeitroutennetz hervorgehoben werden. Ein konsequentes Gestaltungskonzept macht die unterschiedlichen Gusentalterrassen als zusammenhängende Bausteine lesbar.
Folgende Maßnahme ist hier zu setzen:
Vorbereitung und Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs Mit dem Anspruch an eine kohärente Gestaltungslinie aller Gusentalterrassen und eine qualitätsvolle Konzeption und Umsetzung, lässt sich ein kleiner Gestaltungswettbewerb
für Landschaftsplaner:innen, Architekt:innen und Künstler:Innen durchführen. In Vorbereitung zur Aufgabenstellung empfiehlt sich ein Workshop mit allen relevanten Ausschussmitgliedern. Explizit wird auch auf Synergien und den Erfahrungsaustausch mit der Gemeinde Gallneukirchen verwiesen, die mit ihrem Projekt Gusentrail bereits auf konkrete Erfahrungen in einem vergleichbaren Projekt aufbauen kann.
L03
Punkteplan zur klimagerechten Entwicklung der Region
Um die Ziele in der Klimawandelanpassung und dem Klimaschutz auch in Fragen der räumlichen Entwicklung im Gusental auf den Boden zu bringen, soll ein Punkteplan alle relevanten Anforderungen zur klimagerechten Entwicklung der Region zusammenstellen. Dieser wird im Sinn einer Checklist für die Beurteilung von neuen Projekten den entsprechenden Ausschussmitgliedern zur Hand gelegt. Eine Bewertungsskala zur Klimawirksamkeit ist zu entwickeln.
Folgende Maßnahmen sind hier zu setzen:
Workshop klimagerechte Entwicklung der Region
In einer Workshop-Reihe mit den Mitgliedern aller entsprechender Ausschüsse sowie Vertreter:innen der KEM- und KLAR-Regionen, des Regionalmanagements und der oö. Landesregierung lassen sich Maßnahmen zur klimagerechten Entwicklung der Region vertiefen.
Erstellung eines anschaulichen Punkteplans Klimawandelanpassung ist auch eine Kommunikationsaufgabe. Es braucht gute Beispiele und motivierende Bilder, die alle Entscheidungsträger:innen dabei unterstützen, die Ziele in der Klimawandelanpassung in alle relevanten Handlungsfelder zu integrieren und mitzudenken. Eine anschauliche und publikationsfähige Aufbereitung des Punkteplans mit konkreten Beispielen soll dazu beitragen, den Punkteplan in der planungspolitischen Praxis zu verankern.
Nr. Maßnahme
L01 Ausbau regionaler Freizeitrouten Ziel: Gemeinsames regionales Freizeitwegenetz
Umsetzung: Workshop „Freizeitwege“, Erstellung einer „Wanderkarte Region Gusental“; Einbindung der Gusentalterrassen-Standorte (s. L02)
Ausschüsse, Tourismusverbände
Verbesserung der Sichtbarkeit und Erlebbarkeit regionaler Freiraum- und Erholungsqualitäten kurzfristig gering-mittel LZ 2 –
L02 Gusentalterrassen Ziel: Erreichbarkeit und Erlebbarkeit der regionalen Landschaft
Umsetzung: Standorte im Uferbereich der Kl. und Großen Gusen sowie Aussichtspunkte in der Landschaft der Region zu Aufenthaltsbereichen (Holzplattform mit Sitzmöglichkeiten) ausstatten; Wiedererkennbarkeit der Gestaltungselemente schaffen Identifikationsmöglichkeit mit der Region Gusental; Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs
Ausschüsse
Verbesserung der Sichtbarkeit und Erlebbarkeit regionaler Freiraum- und Erholungsqualitäten
L03 Punkteplan zur klimagerechten Entwicklung der Region
Ziel: Entwicklung eines regional abgestimmten Punkteplans zur Konkretisierung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung in jeder Gemeinde; integrierter Bestandteil des Qualitätskatalog Hauptsiedlungsbereiche (s. S04).
Umsetzung: Workshop zur Konkretisierung von Maßnahmenpaketen (bspw. Klimawandelanpassung bei jeder Straßen- und Platzsanierung, Sanierungsoffensive bei Eigenheimen, Straßenbaum-Offensive etc.)
Bürgermeister:innen; Amtsleitungen; Bauämter; KLAR-Region
Stadtregional abgestimmte Qualitätskriterien mittelfristig gering LZ 5 – Landschaft hoch
PRINZIPIEN
In der Region Gusental bedarf es einer Änderung des Mobilitätsverhaltens aller Einwohner:innen weg von der Dominanz des privaten Kfz hin zu anderen Mobilitätsformen. Übergeordnetes Ziel ist, trotz Bevölkerungswachstums den absoluten Zuwachs an Kfz-Fahrten zu stoppen Dies bedeutet eine deutliche Zunahme von Fuß-, Rad- und ÖV-Wegen und eine Trendumkehr der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Mit der geplanten Stadtregionalbahn bietet sich hierfür eine Jahrhundert-Chance. Auch im Radverkehr besteht ein hohes ungenutztes Nachfragepotenzial, welches es zu aktivieren gilt.
Für die Zielerreichung müssen große Investitionen in den Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Verkehr getätigt werden. Ebenso benötigt es regulierende Maßnahmen, wie beispielsweise eine ÖV-Mindestqualität für neue Wohnwidmungen, um die Abhängigkeit vom privaten Pkw zu verringern.
Fuß- und Radverkehr
Leitziel 1 Straßenräume im Ortsgebiet zugunsten des Fuß- und Radverkehrs umgestalten
Viele Straßen, insbesondere Hauptstraßen, sind derzeit für das Auto optimiert. Meist gibt es breite Fahrbahnen mit Parkstreifen neben schmalen Gehsteigen und ohne Radverkehrsanlagen. Oft kann alleine durch die Reduktion der Fahrbahnbreite auf die Mindestbreite gemäß geltender Richtlinien Platz gewonnen und der Straßenraum attraktiver gestaltet werden. Parkstreifen sollen aufgelassen werden, wenn andernfalls die gewünschte Qualität im Fußund Radverkehr nicht erreicht werden kann.
Leitziel 2
Attraktive und sichere Radverbindungen errichten
Das zum Teil große Radpotenzial wird hauptsächlich aufgrund des Mangels an sicherer Radinfrastruktur nicht ausgenützt. Es braucht direkte, vom Kfz-Verkehr weitgehend getrennte Straßen bzw. Radwege. Die Planung der Radverkehrsanlagen darf sich nicht an den heute fahrenden Radfahrenden orientieren, sondern muss auch für jene geeignet sein, die sich heute noch nicht Rad fahren trauen. In der Region besteht ein großer Aufholbedarf für die Schaffung von sicheren Radverbindungen und die entsprechende Infrastruktur für E-Fahrräder.
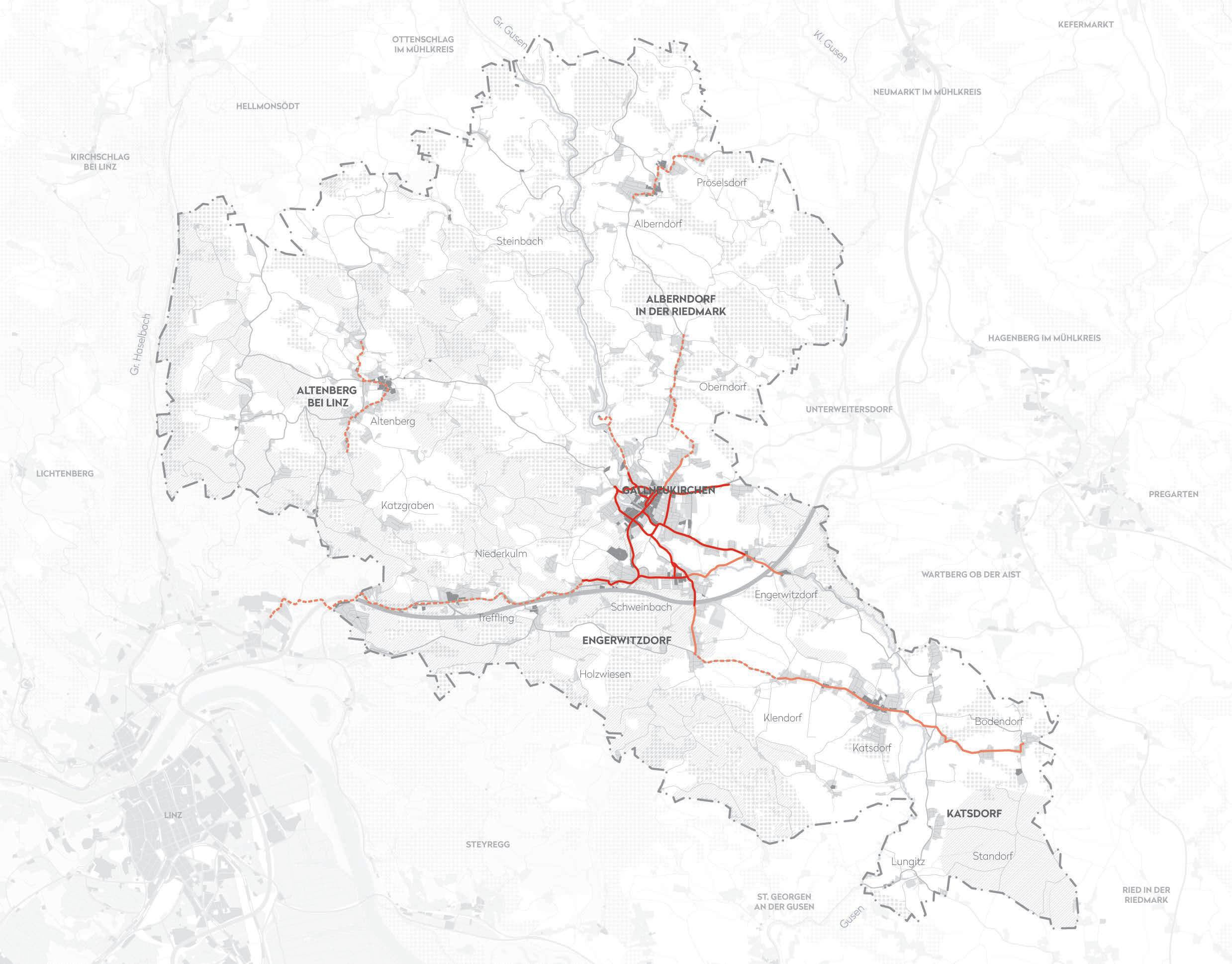
Der Fokus der zu schaffenden Radverbindungen liegt auf den Strecken mit dem höchsten Potenzial. Dies sind kurze Wege innerorts und im Ballungsraum Gallneukirchen–Engerwitzdorf.
Lange Strecken zwischen den Gemeinden haben aufgrund der Distanz und der Topographie ein geringeres Potenzial.
Leitziel 3
Haupt-ÖV-Achsen ausbauen
Für einen Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr sind häufige und regelmäßige Verbindungen nötig, die den Fahrgästen die Sicherheit geben, auch bei unvorhergesehenen Verzögerungen und abends verlässlich nach Hause kommen zu können. Im Sinne einer effizienten Geldverwendung soll der öffentliche Verkehr (Bus und Bahn) auf Haupt-
achsen fokussiert werden und dort in dichten Intervallen fahren. Als Mindestwert für diese Achsen wird ein 30-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit angestrebt. Mit einem halbstündlich verkehrenden Bus wird im direkten Stationsumfeld eine ÖV-Güteklasse D erreicht, siehe auchTab. 1 auf Seite 53.
Öffentlicher Verkehr
Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Tab. 1: Kategorien der ÖV-Güteklassen
Güteklasse Qualitätsbeschreibung Beispiel
A Höchstrangige ÖV-Erschließung
B Hochrangige ÖV-Erschließung
C Sehr gute ÖV-Erschließung
D Gute ÖV-Erschließung
E Sehr gute Basiserschließung
F Gute Basiserschließung
REX-Haltestelle mit Abfahrten alle 15 Minuten in 300 m Entfernung
Regionalbahnhaltestelle mit Abfahrten alle 15 Minuten in 300 m Entfernung
Regionalbahnhaltestelle mit Abfahrten alle 15 Minuten in 500 m Entfernung
Bushaltestelle mit Abfahrten alle 30 Minuten in 300 m Entfernung
Bushaltestelle mit Abfahrten alle 30 Minuten in 500 m Entfernung
Bushaltestelle mit Abfahrten alle 60 Minuten in 500 m Entfernung
G Basiserschließung S-Bahnhaltestelle mit Abfahrten alle 60 Minuten in 1 km Entfernung
Leitziel 4
Periphere Erschließung durch Mikro-ÖV sichern
Die Erschließung der verstreuten Siedlungsgebiete kann nur durch ein bedarfsbasiertes Mikro ÖV-Angebot sinnvoll abgedeckt werden. Ziel des Mikro-ÖV ist es, die Mobilität für alle Personen sicherzustellen. Dies erleichtert den Verzicht auf Zweit- oder Drittauto und ermöglicht die Mobili-
tät für Personen, die aufgrund von Alter, Gesundheit oder Kosten ohne Auto an ihren Wohnort gebunden wären. Im Bereich des Mikro-ÖV ist eine laufende Weiterentwicklung zu beobachten. Bei der Planung des Systems soll auf aktuelle erfolgreiche Beispiele Bezug genommen werden.
Karte 12: ÖV-Zukunftsnetz (Vorschlag)
Stadtregionalbahn (in Planung)
Z K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)
Privater
Kfz-Verkehr
Summerauerbahn Haltestellen Bahn
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau)
mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Leitziel 5
Zuwachs an Pkw-Fahrten stoppen
Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau) Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag)
30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Haltestelle (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle (hellgrau)
Busverbin(Vorschlag)
Busverbindung (Vorschlag)

Haltestelle Bahn (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Busverbindung (Vorschlag)
S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch
Radpotenzial hoch
Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse B
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Bushaltestellen 60‘ Takt
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag) Bushaltestellen 30‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch
Haltestelle (30-Minuten-Takt, Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Haltestelle (60-Minuten-Takt, Vorschlag)
ÖV-Güteklasse D
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D
Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse B
ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklas se D
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich
Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag) Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Abb. 5: Aktueller und ZielModal-Split im Gusental Fuß/Rad/ÖV MIV
ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum
Datengrundlage: Verkehrssystemstudie Gusental, Land OÖ
Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Bauland Betrieblich
Dorfgebiet und Wohnen
Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Zentrum (Graustufen)
Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
Fokusgebiet
Bauland
Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet
Derzeit werden in der Region Gusental von der Wohnbevölkerung täglich rund 82.000 Wege zurückgelegt, davon 58.000 mit dem eigenen Auto, das sind 71 %. Die Zahl von 58.000 MIVFahrten pro Tag soll nicht weiter wachsen. Bei einem Bevölkerungswachstum bedeutet dies eine Reduktion des MIV-Anteils. Die nötigen Verlagerungen im Modal Split sind beträchtlich und verlangen große Anstrengungen. Bei einem Wachstum gemäß Bevölkerungsprognose der Statistik Austria für das Jahr 2040 (+8 %), welche nicht alle Baulandreserven ausnutzt, müssten 6.700 Fahrten pro Tag beim ÖV, Fuß- oder Radverkehr hinzukommen. Dies entspräche einer Reduktion des MIV-Anteils von derzeit 71 % auf 65 %, beinahe einer Verdoppelung der ÖV-Fahrten (von 8 % auf 16 % Wegeanteil) oder mehr als einer Verdreifachung aller Radfahrten (von 3,5 % auf 11 % Wegeanteil). Ein dringender Handlungsbedarf für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie der Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr ist gegeben.
Leitziel 6
Neue Wohnwidmungen nur bei guter ÖV-Anbindung durchführen
Neue Wohngebiete sollen neben den bereits bestehenden Grundsätzen der Raumordnung nur noch bei einer ÖV-Güteklasse D oder besser gewidmet werden. Dies entspricht beispielsweise einer Bushaltestelle in maximal 300 m Entfernung mit Bedienung alle 30 Minuten.
Durch diese Regelung wird ein vom Autoverkehr unabhängiges Mobilitätsverhalten ermöglicht. Sie kann auch als Argument für Taktverdichtungen im öffentlichen Verkehr dienen, da das Nachfragepotenzial erhöht wird.
Die ÖV-Güteklassen werden jährlich neu berechnet. Mit Verbesserungen im ÖV-Angebot, zum Beispiel Taktverdichtungen, können höhere ÖV-Güteklassen erreicht werden.
Von der Regelung ausgenommen sind Abrundungen bestehender Siedlungsgebiete und Betriebsstandorte. Allerdings soll auch bei künftigen Betriebsstandorten eine entsprechende Erreichbarkeit mit dem ÖV bzw. zu Fuß oder mit dem Rad gewährleistet sein.
Siedlungsentwicklung
Haltestelle (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Leitziel 7
Kfz-Stellplatzschlüssel reduzieren
Die Errichtung von Kfz-Stellplätzen fördert den Kfz-Verkehr und erhöht die Baukosten. In zentralen Lagen mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist der aktuelle Stellplatzschlüssel von zwei Pkw-Stellplätzen je Wohneinheit zu hoch. Nach der Aktualisierung der aktuell in Überarbeitung befindlichen RVS 03.07.11 (Organisation und Anzahl der Stellplätze für den Individualverkehr) soll die darin empfohlene Regelung (welche unter anderem die ÖV-Qualität berücksichtigt) übernommen werden.
Leitziel 8
Mobilitätsziele für Großprojekte definieren
Für Großprojekte ab 100 Bewohner:innen oder 100 Beschäftigten bzw. bei verkehrsintensiven Nutzungen ab 200 Besucher:innen/Kund:innen pro Tag sollen verpflichtend Mobilitätskonzepte mit zumindest folgenden Inhalten ausgearbeitet werden:
• Erschließung im Fußverkehr, Radverkehr und im öffentlichen Verkehr
• Anzahl, Qualität und Erreichbarkeit von Radabstellplätzen
• Lage und Anzahl Kfz-Stellplätze (Stellplatzschlüssel)
Diese Maßnahme dient zum einen der Sicherung einer hohen Qualität im Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr, hilft andererseits auch, Überlastungen im Straßennetz durch zusätzliche Kfz-Fahrten zu minimieren.
Busverbin(Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse C Haltestelle (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag)

Bushaltestellen 30‘ Takt
ÖV-Güteklasse D
se C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F
se G Siedlungsgrenzen
Baulandreserven Bauland Zentrum
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 60‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch
Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungs-
ven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)
Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet
OTTENSCHLAG IM MÜHLKREIS
HELLMONSÖDT
KIRCHSCHLAG BEI LINZ
LICHTENBERG
FLW Grünland
Flusskorridore Regionale Freizeitrouten
Regionale Freizeitrouten
ALTENBERG BEI LINZ
Altenberg
Steinbach
Alberndorf
Pröselsdorf
ALBERNDORF IN DER RIEDMARK
KEFERMARKT
NEUMARKT IM MÜHLKREIS
HAGENBERG IM MÜHLKREIS
Oberndorf
UNTERWEITERSDORF
Karte 14: Mobilität
LEITBILDBAUSTEINE
Busverbindung
PREGARTEN
Haltestelle (30-Minuten-Takt) (Vorschlag)
Katzgraben
GALLNEUKIRCHEN
Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Aussichtspunkte in die Landschaft
Aussichtspunkte in die Landschaft
Hauptgewässer (Farbe)
Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe)
Nebengewäs(grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen
Regionsgrenze Gemeindegrenzen
Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Niederkulm
Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Wildtierkorri- mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Entwicklungskorridor S-Bahn
Entwicklungskorridor S-Bahn
Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau)
Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau)
Gallneukirchen
Schweinbach
Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Treffling
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag)
Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
die Hauptgewässer (Farbe)
Nebengewässer (Farbe)
Hauptgewäs- Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau)
Hauptgewässer (grau)
Nebengewässer (grau)
Nebengewässer (grau)
Regionsgrenze Gemeindegrenzen
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 60‘ Takt
ENGERWITZDORF
Entwicklungskorridor S-Bahn
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
WARTBERG OB DER AIST
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Radpotenzial sehr hoch
Radpotenzial hoch
Busverbindung (Vorschlag)
Radpotenzial hoch
Radpotenzial mittel
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse B
Enger witzdorf
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch
Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Busverbindung (Vorschlag)
Haltestelle (60-Minuten-Takt) (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
ÖV-Güteklasse B*
Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch
Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse C*
Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse D*
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D
ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D
ÖV-Güteklasse E*
se E
ÖV-Güteklas se B
se F ÖV-Güteklas se G
ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen
ÖV-Güteklasse F* 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau) Entwicklungskorridor S-Bahn
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreser ven
ÖV-Güteklasse G* Gebiete mit min. ÖV-Güteklasse D*
Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Fahrradpotenzial (sehr hoch)
Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag) Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich
Holzwiesen
Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Nebengewäs- Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Entwicklungskorridor S-Bahn
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Klendorf
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Katsdorf
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Fahrradpotenzial (hoch)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch
Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse B
ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D
Z K S W+I W+I
ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C
Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Radpotenzial
ÖV-Güteklasse B
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch
Fahrradpotenzial (mittel)
Radpotenzial hoch
Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklas se D
Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklas-
GRUNDLAGEN
Bodendorf
Bushaltestellen 60‘ Takt
Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
KATSDORF
Radpotenzial sehr hoch
Radpotenzial hoch
Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse B
ÖV-Güteklasse C
se D
Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)
Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau)
ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichts-
Z K S W+I W+I
Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
Regionale Grünzonen Linzer Umland
Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Z K S W+I W+I Bauland (lt. Flächenwidmungsplan) Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Wald Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore
Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)
Stadtregionalbahn (in Planung)
Grünzonen lt. ÖEK Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeinde grenzen
Standorf Lungitz
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau)
Z K S W+I W+I
RIED IN DER RIEDMARK
Landesstraßen (B und L)
Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)
ALLERHEILIGEN
Hauptgewässer Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorri dore Nebengewässer
ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)
und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I
ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
(dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau) Z K S W+I W+I Autobahn
(B und L)
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau)
Regionsgrenze *nach Umsetzung der vorgeschlagenen ÖV-Korridore
S-Bahnen in Planung (hellgrau)
ÖEK (Farbe)
SCHWERTBERG
Gemeindestraßen Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore
Planung eines regionalen Alltagsradverkehrsnetzes inkl. Bauprogramm
Zur verbreiteten Nutzung des Fahrrades als Alltagsverkehrsmittel ist es nötig, ein flächendeckendes Netz an sicheren Verbindungen (Radrouten) zu haben. Diese Routen können baulich vom Kfz-Verkehr getrennte Radwege, aber auch verkehrsberuhigte Straßen sein. Wichtig für die Akzeptanz einer Radroute ist deren durchgängige Qualität bis zum Ziel. Einzelne sichere Abschnitte, welche nur über unsichere Straßen erreicht werden können, haben kaum Wirkung auf die Verkehrsmittelwahl. Der erste Schritt zur Schaffung einer sicheren Radverkehrsinfrastruktur ist die Planung eines Radverkehrsnetzes, in welchem Haupt-, Verbindungs- und Sammelrouten definiert werden, welche wichtige Quell- und Zielpunkte (Ortszentren, Bildungseinrichtungen, Bahnhöfe etc.) miteinander verbinden. Im Netzplan soll dargestellt sein, welche Routen bereits heute sicher befahrbar sind und welche noch Ausbaubedarf haben. Die Unterscheidung in
Haupt- sowie in Verbindungs- und Sammelrouten ist wichtig, weil mit unterschiedlichen Routenfunktionen verschiedene Anforderungen an die Infrastruktur (z. B. Mindestbreiten) einhergehen. Abschnitte mit Ausbaubedarf sollen in einem Maßnahmenkatalog beschrieben und priorisiert werden. Projekte mit hoher Priorität sollen im Zuge einer Vorplanung auf ihre Machbarkeit untersucht und die Kosten geschätzt werden. Auf Basis der Vorplanungen soll ein mehrjähriges Radwege-Bauprogramm inklusive Reservierung der entsprechenden Budgetmittel erstellt werden. Zur Planung eines Radverkehrsnetzes inkl. Bauprogramm ist ein Verkehrsplanungsplanungsbüro zu beauftragen. Die Gemeinde Gallneukirchen wird diese Ausschreibung federführend übernehmen. Das Land Oberösterreich kann bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung unterstützen.
Bildung eines Mobilitätsrats mit Schwerpunkt Bewusstseinsbildung
Einige der bestehenden Mobilitätsangebote sind in der Bevölkerung, aber auch in den Gemeindeämtern und der Politik teilweise nicht oder nur wenig bekannt. Es wird das Potenzial gesehen, allein durch Bewusstseinsbildung Menschen vom privaten Pkw auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu bringen. Die genaue Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und deren gemeinsame Umsetzung soll durch einen dazu eigens gegründeten Mobilitätsrat erfolgen. Der Mobilitätsrat wird durch das Regionalmanagement (Hubert Zamut) einberufen und setzt sich aus Gemeindevertreter:innen zusammen. Mögliche Bewusstseinsbildungsmaßnahmen sind:
Regelmäßige Bereitstellung von Mobilitätsinformationen (ÖV-Fahrpläne, Fördermöglichkeiten, Aktionstage, Sharing-Angebote etc.) in Gemeindezeitungen und Gemeinde-Apps.
• Durchführung von Mobilitätsaktionen (z. B. Mobilitätswoche, Gewinnspiel, mobile Fahrradwerkstatt etc.).
• Bereitstellung von Schnuppertickets für den öffentlichen Verkehr (z.B. Zeitkarte für die Region und Linz) für ein Monat, damit Bürger:innen ohne Kostenaufwand das ÖVAngebot kennen lernen können.
• Sichtbarmachung des (teilweise schon guten) ÖV-Angebots durch Abfahrtstafeln mit Echtzeit-Anzeige an wichtigen Haltestellen.
M03
Einführung eines Mikro-ÖV-Systems in der Region
Die Entscheidung über die Einführung eines Mikro-ÖV-Systems ist bereits parallel zum IKRE-Prozess im Gange.
M04
Ausbau des öffentlichen Verkehrs
Das öffentliche Verkehrsangebot soll schrittweise verbessert werden. Die Gemeinden haben bei der Gestaltung der Fahrpläne keine Entscheidungskompetenz, können aber Rückmeldungen an den Verkehrsverbund geben und so Verbesserungen anregen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, gegen Bezahlung zusätzliche Kurse zu bestellen. Vor der Diskussion von Verbesserungen bedarf es einer Bestandsanalyse, da sich gezeigt hat, dass das aktuelle ÖV-Angebot nicht überall bzw. nicht aus der Praxis bekannt ist. Um nicht auf (teilweise verzerrte) Rückmeldungen der Bevölkerung angewiesen zu sein, wird empfohlen, dass die zuständigen Gemeindebediensteten sowie politische Funktionsträger:innen das ÖV-Angebot (zumindest testweise) nutzen, um einen Einblick in den ÖV-Alltag (wer fährt aller mit dem Bus bzw. der Bahn, wie viele Verbindungen gibt es wirklich, sind die Busse pünktlich, wie gut funktioniert das Umsteigen, …) zu bekommen, sofern dies nicht bereits bekannt ist. Nach der Analyse sollen Verbesserungsmaß-
nahmen überlegt und diskutiert werden. Vorschläge zu gemeindeübergreifenden Buslinien sollen gemeinsam abgestimmt und dem Verkehrsverbund unterbreitet werden. Es ist zwischen kurz- und mittelfristigen Maßnahmen sowie der Vision Stadtregionalbahn zu unterscheiden. Kurzfristige Maßnahmen: Geringfügige Änderungen im Fahrplan können bereits innerhalb der aktuellen Ausschreibung des Linienverkehrs, welche bis Dezember 2027 läuft, vollzogen werden. Mittelfristige Maßnahmen: Signifikante Änderungen am Fahrplan, wie z.B. Änderungen der Linienführungen oder eine deutliche Verdichtung der Intervalle auf bestehenden Linien können erst in der nächsten Ausschreibung des Linienverkehrs berücksichtigt werden. Vision Stadtregionalbahn: Bei Inbetriebnahme der Stadtregionalbahn wird das Busnetz neu organisiert. Wenn die Gemeinden konkrete Wünsche an die Planer:innen und Entscheidungsträger:innen formulieren, steigt deren Umsetzungswahrscheinlichkeit.
Erstellung eines Punkteplans für Mobilitätskonzepte für Großprojekte
Für verkehrserregende Großprojekte (ab 100 Bewohner:innen oder Beschäftigten bzw. ab 200 Besucher:innen/Kund:innen pro Tag) sollen in Zukunft verpflichtend Mobilitätskonzepte erstellt werden, die von den Projektwerber:innen vorzulegen sind. Von den Gemeinden soll dafür ein Punkteplan bereitgestellt werden, in welchem festgehalten ist, welche Aspekte das Mobilitätskonzept jedenfalls behandeln muss. Für jeden Punkt sollen gewisse Mindeststandards vorgegeben werden, welche im Projekt erfüllt werden müssen. Die konkrete Ausformulierung des Punkteplans soll durch die Gemeinden erfolgen, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von externen Fachleuten. Folgende Inhalte erscheinen jedenfalls sinnvoll:
• Erschließung für den Fußverkehr: Beschreibung und Qualitätsnachweis der wichtigsten Fußwege (zu ÖV-Haltestellen, Einkaufsmöglichkeiten etc.) sowie des Fußwegenetzes am Projektareal.
• Erschließung für den Radverkehr: Beschreibung und Qualitätsnachweis der Anbindung an das Radverkehrsnetz (siehe Maßnahme 1) sowie mit dem Fahrrad befahrbare Strecken am Projektareal. M05
• Erschließung mit dem öffentlichen Verkehr: Beschreibung der ÖV-Qualität (Nachweis der Güteklasse D oder besser, Beschreibung des Fahrplans, Haltestellenausstattung, Zugangsstrecke etc.).
• Erschließung im Kfz-Verkehr: Beschreibung der Lage der Ein- und Ausfahrten sowie der Routen zum hochrangigen Straßennetz.
• Ruhender Verkehr: Festlegungen der Anzahl, der Lage (inkl. Zugänglichkeit) und der Qualität von Radabstellanlagen und Kfz-Stellplätzen.
• Mobilitätsmanagement: Beschreibung von weiteren Maßnahmen zur Förderung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln.
• Klimawandelanpassung: Beschreibung von für die Mobilität relevanten Maßnahmen zur Klimawandelanpassung (Nachweise der Beschattung von Fuß- und Radwegen, Windkomfort, Vermeidung von Versiegelung für Stellplätze etc.).
ÜBERSICHT:
UMSETZUNGSMASSNAHMEN MOBILITÄT
Nr. Maßnahme
Kurzbeschreibung
M01 Planung eines regionalen Alltagsradverkehrsnetzes inkl. Bauprogramm
Das regionale Radverkehrsnetz definiert Haupt-, Verbindungs- und Sammelrouten zwischen und innerhalb der Gemeinden. Dieses Radverkehrsnetz mündet in einen Maßnahmenkatalog mit einem mehrjährigem Radwege-Bauprogramm.
Zuständigkeiten Regionale Wirkung
Bürgermeister*innen; Amtsleitungen; Bauämter
Erhöhung des Radverkehrs auf Gemeindeübergreifenden Strecken
langfristig
M02 Bildung eines Mobilitätsrats mit Schwerpunkt Bewusstseinsbildung
Erarbeitung von Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und deren gemeinsame Umsetzung in einem dazu eigens gegründeten Mobilitätsrat
M03 Bildung eines Mikro-ÖV-Systems (Läuft bereits in eigenem Prozess)
Einführung eines Mikro-ÖV (Anruf-Sammeltaxi) als Zusätzliches Angebot für Fahrten außerhalb des ÖV Angebots
Regionalmanagement
Verstärkung der Wirkung durch gemeinsame Aktionen kurzmittelfristig gering
M04 Ausbau des öffentlichen Verkehrs
Kurzfristig: gerinfügige Verbesserungen im Fahrplan
Mittelfristig: Signifikante Änderungen am Fahrplan
Vision: Stadtregionalbahn mit neu organisierten Buslinien als Zubringer.
M05
Erstellung eines Punkteplans für Mobilitätskonzepte für Großprojekte
Für verkehrserregende Großprojekte sollen in Zukunft verpflichtend Mobilitätskonzepte erstellt werden, die von den Projektwerber:innen vorzulegen sind. Der Punkteplan beschreibt, welche Aspekte das Mobilitätskonzept jedenfalls behandeln muss.
Bürgermeister:innen; Amtsleitungen
Mobilitätsgarantie auch ohne (Zweit-) Auto, Reduktion der Kfz-Fahrten läuft bereits mittel LZ 4, 5 – Mobilität
OÖVV, Wünsche sollen von den Gemeinden eingebracht werden (Amtsleitungen)
Steigerung der Fahrgastzahlen bei gleicher Anzahl an Kursen kleine Anpassungen ab sofort, große Änderungen im Zuge der nächsten Ausschreibung kurz-, mittel- und langfristig
Bürgermeister:innen; Amtsleitungen; Bauämter
Verlagerung der von Großprojekten induzierten Kfz-Fahrten auf umweltfreundliche Verkehrsmittel
kurzfristig gering LZ 5, 8 – Mobilität hoch
PRINZIPIEN
Sparsamer Umgang mit Boden
Das Gusental ist eine hochattraktive Wohn- und Arbeitsregion, die Nachfrage nach Wohnraum wird weiterhin kontinuierlich zunehmen. Aus diesem Grund sollen schon heute die Weichen für eine möglichst flächensparende Siedlungsentwicklung gestellt werden. Das bedeutet keine vollständige Abkehr vom freistehenden Einfamilienhaus, aber deren kritische Überprüfung, vor allem der Grundstücksgrößen. Im Falle von neuen Baulandausweisungen sollen zeitgemäße, nachhaltigere und flächenschonendere Bebauungsalternativen konsequent in die Planungen mit einbezogen werden.
Innenentwicklung vor Außenentwicklung
Generell soll das Planungsprinzip „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ gelten. Auf der überörtlichen Maßstabsebene bedeutet das, dass sich die Siedlungsentwicklung auf die Hauptorte der Gemeinden und die jeweils am besten an den öffentlichen Verkehr angeschlossenen Gemeindeteile konzentrieren soll. Auf der lokalen Ebene sollen zunächst Baulücken und Baulandreserven im Bestand aktiviert und bebaut werden, bevor neue Siedlungsgebiete ausgewiesen werden.
Kompakte Siedlungsstrukturen
Das Gusental profitiert von seiner in weiten Teilen unzerschnittenen Landschaft und gegenwärtig noch vergleichsweise wenig zersiedelten Siedlungsstrukturen. Neben der hohen städtebaulichen und funktionalen Qualität, die mit kompakten Siedlungsstrukturen einhergeht, ist das planerische Prinzip kompakter Siedlungsstrukturen auch Voraussetzung dafür, dass sich die Gemeinden nicht nur in ökologischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf ihr gesellschaftliches Gefüge nachhaltig entwickeln. Denn gerade in Hinblick auf eine immer älter immer werdende Bevölkerung sind kurze Wege und die damit verbundene soziale und räumliche Nähe von großer Bedeutung.
Karte 15: Fokusgebiete
Siedlungsentwicklung
Baulandreserven
Gebiete mit min.
ÖV-Güteklasse D
Z Fokusgebiet
Stadtzentrum
K Fokusgebiete
Ortskern
S Fokusgebiete
Siedlungsentwicklung
Stadtzentrum
Gallneukirchen
2 Siedlung
Engerwitzdorf
3 Ortskern
Schweinbach
4 Siedlung Haid
5 Siedlung Linzerberg
6 Siedlung Linzerberg II
7 Ortskern
Mittertreffling
8 Ortskern Altenberg
9 Siedlung Alberndorf
10 Ortskern Alberndorf
11 Siedlung
Spattendorf
12 Siedlung Klendorf
13 Ortskern Katsdorf
14 Siedlung Katsdorf
15 Siedlung Lungitz
Leitziel 1
Siedlungsentwicklung auf räumliche Schwerpunkte (Hauptsiedlungsbereiche) fokussieren
Die zukünftige Siedlungsentwicklung soll sich auf jene Schwerpunkte konzentrieren, die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen:
• zentrale Lage
• gute Anbindung an das ÖV-Netz mit einer Güteklasse von mindestens D
• besondere Funktion als Zentrum bzw. Ortskern oder besonderes Potenzial als Siedlungserweiterungsgebiet in gemischter Nutzung
Diese drei unterschiedlichen Fokusgebiete sind:
• Fokusgebiet Stadtzentrum
• Fokusgebiet Ortskern
• Fokusgebiet Siedlungsentwicklung
Die Bauland- und Entwicklungspotenziale, die in den Fokusgebieten „Stadtzentrum“ und „Ortskern“ oder in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft vorhanden sind, sollen bei den künftigen Planungen prioritär behandelt wer-

den. Neben ihrer Funktion als kleinstädtische Wohnstandorte, die sich durch ein entsprechend innovatives und hochwertiges Wohnangebot auszeichnen sollen, ist auch die wirtschaftliche und soziale Funktion der Stadt- und Ortszentren aktiv mitzudenken und mitzuplanen: Welche Nutzungen und welches Angebot im Handel, bei Versorgung und Dienstleistungen oder im Bereich der Daseinsvorsorge sind vorhanden und welche fehlen? Wie können bei Neubaumaßnahmen entsprechend attraktive Raumangebote dafür geschaffen werden? Das neue Gemeindezentrum von Katsdorf dient als gutes Beispiel für einen neuen, hochattraktiven und integrierten Baustein für das Fokusgebiet „Ortskern“.
Folgende Qualitätsanforderungen sind an die Fokusgebiete zu richten:
• integrierte und ganzheitliche Entwicklung (Siedlung, Freiraum, Mobilität)
• angemessene Nutzungsmischung zur Vermeidung von monofunktionalen Wohnsiedlungen
• angemessene bauliche Dichte (z.B. Reihenhausbebauung oder verdichteter Flachbau)
• Modal-Split-Ziele und Mobilitätsmanagement entwickeln
• Qualitätssicherung in Planung und Umsetzung (z.B. durch regionalen Gestaltungsbeirat)
In den Fokusgebieten sind insgesamt knappe 60 ha Baulandreserven gewidmet (Stand Juli 2021).
Legt man das fortgeschriebene Bevölkerungswachstum von ca. 5.000 EinwohnerInnen bis zum Jahr 2045 zugrunde, sind alleine diese Fokusgebiete ausreichend, um bei angenommener Bevölkerungsdichte von 85 EW/ha Wohnraum für rund 5.100 Menschen zu schaffen. Im Sinne
der drei Prinzipien, die den Leitzielen zur Siedlungsentwicklung zugrundeliegen, hat das Gusental hier also eine aus planungsstrategischer Sicht optimale Ausgangslage, wenn es um die Lenkung des Wachstums in die dafür am besten geeigneten Teilbereiche in der Region geht.
Dies soll im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass außerhalb der Fokusgebiete keine Entwicklung mehr stattfinden soll. Jede Ortschaft soll auch weiterhin die Möglichkeit haben, im Sinne der Eigenentwicklung auch weiterhin zu wachsen, um den Bedarf nach neuem Wohnraum und Bauland, der sich aus der dort bereits ansässigen Bevölkerung heraus ergibt, decken zu können. Jede Neuausweisung von Bauland außerhalb der Fokusgebiete muss im Einzelfall sehr gut begründet sein, denn hier sind im Gusental insgesamt weitere 90ha bereits gewidmeter Baulandreserven vorhanden!
Es ist also aus heutiger Sicht aus rein fachlicher Sicht nicht mehr notwendig, im Gusental neues Bauland auszuweisen. Weil aber die Reserven nicht gleichmäßig über die einzelnen Gemeinden verteilt sind und auch deren Mobilisierbarkeit unterschiedlich sein dürfte, kann es sein, dass im Einzelfall trotz der (über)großen Reserven Neuwidmungen nötig sind, um lokalen Bedarf zu decken. Diese müssen jeweils sehr gut begründet sein und im besten Fall an klare Bedingungen geknüpft sein (z.B. Vorkaufsrecht durch die Gemeinde, Vertragsraumordnung, Beschränkung der Parzellengrößen etc.). Der Erfolg einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung wird im Gusental ein umso größerer sein, wenn der Löwenanteil der künftigen Siedlungsentwicklung aber nicht auf zusätzlich neu gewidmeten Flächen stattfindet, sondern auf den bereits heute vorhandenen Baulandreserven in den Fokusgebieten!
Leitziel 2
Entwicklungskorridor entlang der Stadtregionalbahn aktiv planen
Mit der Stadtregionalbahn entsteht ein neuer Entwicklungskorridor, an dem sich wie an einer kleinen Perlenkette höchst attraktive Standorte für die künftige Entwicklung aneinander reihen werden. Diese Standorte gilt es rechtzeitig zu identifizieren und planerische Rahmenbedingungen zu formulieren, die der Standortqualität gerecht werden. Gerade an diesen
Standorten bieten sich Konzepte für urbane und auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtete Wohn- und Lebenskonzepte an. Hier gilt es, „out of the box“ zu denken und die Ansprüche von Nachfragegruppen zu antizipieren, für die das Gusental spätestens dann als Wohn- und/ oder Arbeitsort attraktiv werden wird, wenn die Stadtregionalbahn umgesetzt worden ist.
Leitziel 3
Kompakte Siedlungsstrukturen schaffen
Durch die gemeinsame Verständigung, den planerischen Fokus in der gesamten Stadtregion auf möglichst kompakte Siedlungsstrukturen zu legen, können Wachstum und sparsamer Umgang mit Boden miteinander in Einklang gebracht werden. Kompakte Siedlungsstrukturen dienen nicht nur zum Erhalt der heute noch weitgehend unzerschnittenen Landschaftsteile, sie tragen ebenso bei zu kurzen Wegen in-
nerhalb der Gemeinden und zur nachhaltigen Stärkung des sozialen Miteinanders und Austauschs. Konkret sollen klare Siedlungsränder festgelegt werden und/oder planerische Konzepte zur Ortsrandgestaltung und -abrundung ausgearbeitet werden. Die Übergangsbereiche von „Ort“ zu „Landschaft“ können aktiv in Wert gesetzt und gestaltet werden (z.B. Fahrradwege, begleitende Streuobstwiesen etc.).
Leitziel 4
Baulandreserven aktivieren
Im Sinne einer nach innen ausgerichteten Siedlungsentwicklung muss der Aktivierung von Baulandreserven Priorität eingeräumt werden, bevor neue Flächen ausgewiesen werden. Auch wenn nicht das gesamte zu erwartende Bevölkerungswachstum in bereits heute schon gewidmeten Flächen „untergebracht“ werden kann, sollte es das Ziel sein, mindestens ein Drittel des Wachstums in den Bestand bzw. heute schon gewidmete Flächen zu lenken.
Leitziel 5
Qualitätsvolle und leistbare Wohnraumentwicklung anstreben
Der Bedarf an „leistbarem“ Wohnen wird heute genauso wie in Zukunft gegeben sein. Das Kriterium „leistbar“ muss dabei nicht in Widerspruch zu „qualitätsvoll“ stehen, sondern sollte vielmehr aktiv miteinander verbunden werden. Dies betrifft die Standortwahl gleichermaßen wie städtebauliche Konzepte und Investitionsmodelle. Entsprechende Qualitätskriterien und Konzepte sollen im regionalen Dialog ausgearbeitet werden; denn dafür kann es keine von außen herangetragene Einheitslösung geben.
Leitziel 6
Die heute schon oft sehr attraktiven Ortskerne nachhaltig entwickeln
Die Stadtzentren und Ortskerne im Gusental sollen mit ihrer Baukultur, ihren vielfältig genutzten Räumen und ihren öffentlichen Räumen nicht nur die „Visitenkarte“ nach außen sein, sondern auch für ihre eigene Bevölkerung funktionale und identifikatorische Mittelpunkte sein. Hier haben die Gemeinden im Gusental bereits vieles geleistet. Wie die heute schon z. T. sehr hohe Attraktivität der Ortskerne nachhaltig gesichert und ausgebaut werden kann und welche Handlungserfordernisse es gibt, sollte im regionalen Dialog erarbeitet werden.
Leitziel 7
Die ländlichen Bereiche außerhalb der Fokusgebiete nicht vergessen
Das Gusental zeichnet sich durch eine sehr vielfältige Siedlungsstruktur aus, in der auch kleine, stark ländlich geprägte Ortschaften eine wichtige Rolle spielen. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft oder eine älter werdende Bevölkerung schlagen sich in den kleinen Ortschaften oft schneller sichtbar nieder als in den größeren Gemeindeteilen. Eine qualitätsvolle Eigenentwicklung, die z. B. auch das
Neudenken und Inwertsetzen von leerstehenden oder durch Leerstand bedrohten Gebäuden beinhaltet, sollte planerische Aufgabe der Zukunft sein. Wenn die Qualitäten und Begabungen der kleineren, ländlichen Ortschaften erkannt und aktiv in die Planung einbezogen werden, übernehmen sie eine wichtige komplementäre Funktion außerhalb der künftigen Siedlungsschwerpunkte.
Im Themenfeld Siedlung zielen die Maßnahmen darauf ab, das Planungs- und Entwicklungsprinzip „Innen vor Außen“ in die Tat umzusetzen. Dies beinhaltet strategisch-analytische Maßnahmen ebenso wie solche, die auf eine nachhaltige Sicherung von Baukultur und Qualität abzielen.
S01
Aktionsplan Ortskernentwicklung
Vonseiten der OÖ Landesregierung wird eine für die Region Gusental spannende und ganz im Sinne der gesetzten Leitbilder einsetzbare Förderschiene angeboten, die „Konzeptentwicklung zur Aktivierung von Leerstand, Nachnutzung von Gebäudebrachen, Entwicklung von Ortsund Stadtkernen“ (gem. Richtlinie Land OÖ). Die dadurch förderbaren Maßnahmen bilden einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Belebung und (Wieder-)Inwertsetzung von derzeit untergenutzten Innenbereichen. Anknüpfen daran lassen sich weitreichende und integrierte Konzepte zur Ortskernbelebung, der Nachverdichtung, Nachnutzung und Sanierung entwickeln.
Folgende Maßnahmen sind dafür zu setzen:
Aufbau eines interkommunalen Projektteams und Bestimmen einer verantwortlichen Person oder Gruppe, die die Projektleitung und Ausschreibungsvorbereitung übernimmt. Organisation bzw. Durchführung einer vorbereitenden Leerstandserhebung bzw. Abgleich mit bereits durchgeführten Erhebungen und Integration der Daten in das Konzept. Formulieren der Ausschreibung und Durchführung (in Kooperation mit RMOÖ)
S02
Interkommunales leistbares Wohnen
Leistbares Wohnen für verschiedene Bevölkerungsgruppen (z.B. junge Erwachsene, Ältere) ist ein wichtiger Baustein kommunaler Wohnungsund Siedlungsentwicklung. Für eine einzelne Gemeinde können damit vergleichsweise hohe Investitionen und ein hoher Planungsaufwand verbunden sein, vor allem in Hinblick darauf, dass sich die Nachfrage nach diesem Wohnraum mittel- bis langfristig nicht einfach abschätzen lässt. Aus diesen Gründen kann es zielführend sein, leistbares Wohnen zu einem interkommunalen Projekt zu machen: Es werden die am besten dafür geeigneten Standorte in einer Region gesucht und in Form eines interkommunalen Investitionsund Betreibermodells umgesetzt. Diese Maßnahme trägt wesentlich zur funktionalen Stärkung und Aufwertung von Innenbereichen bei und entlastet die Gemeinden der Stadtregion zu-
gleich, da sie diese Planungs- und Entwicklungsherausforderung nicht alleine bewältigen müssen. Folgende Maßnahme ist hierfür zu setzen:
Ausarbeitung eines Umsetzungskonzeptes „interkommunales leistbares Wohnen“ Die Gemeinden des Gusentals betreten mit diesem Projekt Neuland; deshalb ist es in einem ersten Schritt notwendig gemeinsam ein entsprechendes Umsetzungskonzept auszuarbeiten, das die inhaltliche und konzeptionellorganisatorische Basis für die weiteren Realisierungsschritte bildet. Den Startschuss soll ein Workhsop „Interkommunales leistbares Wohnen“ bilden, zu dem neben den kommunalen Vertreter:innen auch Expert:innen und Stakeholder aus verschiedenen relevanten Bereichen geladen werden (z.B. Landesregierung, Wohn-
baugenossenschaften, Sozialpartner, Architektur, etc.). In einem zweiten Schritt können von einer eingesetzten Projektgruppe planerische, rechtliche, organisatorische und konzeptionelle Punkte systematisch geklärt werden sowie
S03
Qualitätskatalog Hauptsiedlungsbereiche
Die aus dem Leitbild hervorgehenden räumlichen Entwicklungsschwerpunkte im Gusental, die sogenannten Hauptsiedlungsbereiche, zeichnen sich durch ihre besondere Lagegunst, ihr besonderes Entwicklungspotenzial und damit auch durch einen besonderen Anspruch an eine qualitätsvolle Entwicklung aus. Um für die besten Standorte in der Region auch die besten Entwicklungsvoraussetzungen zu schaffen, sollen die im Leitbild formulierten Qualitätsanforderungen konkretisiert und vertieft werden. Ziel ist es, sich für alle Hauptsiedlungsbereiche in der Region auf vergleichbare Standards zu verständigen, um gemeinsam als Region mit einem klaren Anspruch an eine qualitätsvolle Entwicklung aufzutreten.
Folgende Qualitätsanforderungen sind an die Hauptsiedlungsbereiche zu richten:
• integrierte und ganzheitliche Entwicklung (Siedlung, Freiraum, Mobilität)
• angemessene Nutzungsmischung zur Vermeidung von monofunktionalen Wohnsiedlungen
Potenzialstandorte im Gusental für die Umsetzung solcher Porjekt sondiert werden. Im nächsten Schritt steht die Abstimmung mit zuständigen Landesstellen und die Sondierung von Fördermöglichkeiten.
• angemessene bauliche Dichte (z. B. Reihenhausbebauung oder verdichteter Flachbau)
• Modal-Split-Ziele und Mobilitätsmanagement entwickeln
• Qualitätssicherung in Planung und Umsetzung (z.B. durch regionalen Gestaltungsbeirat)
Folgende Maßnahme ist zu setzen:
Workshop „Qualitätskatalog Hauptsiedlungsbereiche“
Im Rahmen einer Workshop-Reihe lassen sich die Qualitätsanforderungen erarbeiten. Neben Vertreter:innen der jeweiligen Ausschüsse aller Gemeinden sollen an diesen Runden auch die Ortsplaner:innen, weitere externe Fachplaner:innen aus den Disziplinen Architektur, Landschafts- und Verkehrsplanung sowie Vertreter:innen der oö. Landesregierung teilnehmen. Gebündelt und anschaulich aufbereitet werden die Ergebnisse in einem Qualitätenkatalog, der als Orientierungs- und Entscheidungsgrundlage für alle Entwicklungsfragen in den Hauptsiedlungsbereichen herangezogen werden wird. S 04
Regionaler Gestaltungsbeirat
Um über den Qualitätskatalog hinaus eine kontinuierliche qualitätssichernde Begleitung in Entwicklungsfragen sicherstellen zu können, soll ein regionaler Gestaltungsbeirat eingesetzt werden. Ein Gestaltungsbeirat ist ein unabhängiges, fachliches Gremium, das die Gemeinden in konkreten Entwicklungs- und Bauvorhaben berät. In diesem Fall wären im Beirat vor allem jene Projekte zu behandeln, die in den Hauptsiedlungsbereichen liegen und damit auch die besonderen
Qualitätsanforderungen geltend gemacht werden. Ausgehend vom Qualitätenkatalog kann der Beirat vorliegende Konzepte beurteilen und Empfehlungen zur weiteren Bearbeitung aussprechen. Der regionale Gestaltungsbeirat setzt sich interdisziplinär zusammen aus Expert:Innen der Fachrichtungen Raumplanung, Architektur, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Klima/ Meteorologie und ggf. weiteren Expert:innen und tagt nach Bedarf ca. zwei- bis dreimal jährlich.
ÜBERSICHT:
UMSETZUNGSMASSNAHMEN SIEDLUNGSENTWICKLUNG
Nr. Maßnahme Kurzbeschreibung
S01 Aktionsplan Ortskernentwicklung
Ziel: Ausschreibung „Konzeptentwicklung zur Aktivierung von Leerstand, Nachnutzung von Gebäudebrachen, Entwicklung von Orts- und Stadtkernen“ gem. Richtlinie Land OÖ.
Umsetzung: Aufbau eines interkommunalen Projektteams, vorbereitende Leerstandserhebung, Formulieren und Durchführen der Ausschreibung.
Bürgermeister:innen; Amtsleitungen; Bauämter
stadtregionale Leerstandserhebung und gemeinsame Strategie plus konkrete Umsetzungsschritte gegen Leerstände kurzmittelfristig
S02 Interkommunales leistbares Wohnen
Ziel: Ausarbeitung eines Umsetzungskonzepts „interkommunales leistbares Wohnen“.
Umsetzung: Workshop „Interkommunales Wohnen - Standorte und Voraussetzungen“; Klärung rechtlicher, planerischer und investiver Fragen und Abstimmung mit Land
Bürgermeister:innen; Amtsleitungen; Bauämter
Leistbares Wohnen an den besten Standorten mit stadtregionaler Aufgaben-, Lasten- und Nutzenverteilung mittellangfristig mittel-hoch
S03 Qualitätskatalog Hauptsiedlungsbereiche
Ziel: Konkretisierung der im Leitbild formulierten Qualitätsanforderungen an die Entwicklung in Fokusgebieten.
Umsetzung: Workshop „Qualitätskriterien“ mit Architekturbüros, Planer:innen und Expert:innen der Landesregierung.
Bürgermeister:innen, Bauämter, Amtsleitungen
Stadtregional abgestimmte Qualitätskriterien mittelfristig gering-mittel LZ 1 – Siedlung hoch
S04 Regionaler Gestaltungsbeirat
Ziel: Regionalen Gestaltungsbeirat als qualitätssichernde Maßnahme der Siedlungsentwicklung einrichten.
Umsetzung: Workshop „Zusammensetzung und Aufgaben Gestaltungsbeirat“; gewünschte Mitglieder ansprechen/Abstimmungstreffen organisieren; Satzung formulieren.
Bürgermeister:innen, Bauämter, Amtsleitungen
Sicherung städtebaulicher und entwerferischer Mindeststandards auf stadtregionaler Ebene für Fokusgebiete mittelfristig gering LZ 1, 5, 6 – Siedlung mittel
PRINZIPIEN
Kooperation und strategische Abstimmung, um vorne mit dabei zu sein
Was seine Zukunft als Wirtschaftsraum betrifft, hat sich das Gusental viel vorgenommen. Um überregional oder sogar international sichtbar werden zu können, müssen die Gemeinden ihre Kräfte und Bemühungen bündeln und sich strategisch abstimmen. Das Gusental kann auf eine lange und erfolgreiche Kooperationsgeschichte zurückblicken, die mit dem Ziel, einen hochattraktiven gemeinsamen Wirtschaftsraum zu entwickeln, ein neues Kapitel aufschlägt.
Über die eigene Region hinaus denken und alle Player mit ins Boot holen
Durch die Lage an der Achse „Linz-JKU-Hagenberg“ hat das Gusental die Chance, sich in ein bestehendes Netzwerk einzuklinken und darin zu einem neuen und wichtigen Netzwerkknoten zu werden. Dafür ist es notwendig, die relevanten Player aus Forschung, Verwaltung und Wirtschaft mit ins Boot zu holen und den eigenen Wirtschaftsraum nicht „hinter verschlossenen Türen“ zu entwickeln.
Auch die Wirtschaftsentwicklung jenseits des Kepler Valley im Blick behalten
Der starke Fokus auf das Kepler Valley darf nicht bedeuten, dass die anderen Aspekte und Handlungserfordernisse der regionalen Wirtschaftsentwicklung ins Hintertreffen geraten. Neben diesem „großen“ Thema gibt es eine Vielzahl „kleiner“ Themen (wie etwa Leerstandsaktivierung), die nicht nur die einzelnen Gemeinden beschäftigen, sondern die auch regionale Relevanz haben.
Leitziel 1
Kooperative, gemeindeübergreifende Entwicklung zu einer „Wirtschaftsregion Gusental“ und Aufbau einer starken Dachmarke für die Region
Wenn es um wirtschaftliche und regionalökonomische Themen geht, sind die Entwicklungsund Standortpotenziale in der Region Gusental vielfältig und vielversprechend. In der Region finden sich Standorte, die sich durch eine hohe Standortqualität und eine sehr gute (über-)regionale Anbindung auszeichnen. Es existieren darüber hinaus Ideen und Konzeptvorschläge, wie man die Region im Bereich Forschung und Entwicklung ins Netzwerk bereits in der Nachbarschaft vorhandener Standorte und Forschungseinrichtungen (JKU, Hagenberg, etc.) einbinden kann. Darüber gibt es Verständnis und Bereitschaft dafür, der auch im Gusental immer relevanteren Leerstandsthematik mit innovativen Ansätzen entgegenzutreten.
Um diese vielfältigen Ansätze organisatorisch und strategisch zu bündeln und zu koordinieren soll eine regionale Dachmarke etabliert werden, die sich langfristig und aktiv um die Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Gusental kümmert. Die Wirtschaftsentwicklung
wird personell und organisatorisch auf breite Schultern gestellt, indem entsprechende Managementstrukturen geschaffen werden, mit denen alle relevanten Stakeholder eingebunden werden können und die Kommunikation nach innen und nach außen organisiert wird.
Durch die Bündelung der derzeit noch weitgehend unabhängig voneinander existierenden Ideen und Initiativen zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Region unter einer aktiv gemanagten Dachmarke werden interkommunale Synergien geschaffen, von denen die beteiligten Gemeinden stark profitieren können.
Unter dieser Dachmarke können alle regionalökonomisch relevanten Einzelprojekte, Visionen und Konzepte zur Wirtschaftsentwicklung zusammengefasst werden: Die derzeit im Aufbau befindliche INKOBA1 die Vision des „Kepler Valleys“ und weitere Themenfelder wie „Wirtschaft am Land“ und die Konzeptentwicklung zur Leerstandsbehebung.
„KEPLER VALLEY“
„WIRTSCHAFT AM LAND“ LEERSTANDSMANAGEMENT INKOBA
1) Die fünf Gemeinden der Region haben sich bereits 2021, aufbauend auf den Diskussionen und ersten Erkenntnissen des IKRE-Prozesses, dazu entschlossen, sich der Idee eines gemeinsamen Verbandes zur Interkommunalen Betriebsansiedlung, kurz INKOBA, intensiv zu widmen und die Möglichkeiten und Potentiale festzustellen. Derzeit wird an einem Entwurf gemeinsamer Statuten gearbeitet, um wesentliche Eckpunkte einer Zusammenarbeit zu konkretisieren. Ein erstes Fokusgebiet, das in die INKOBA eingebracht und für die Region entwickelt werden könnte, ist das „DENK-Areal“ in Engerwitzdorf.
Leitziel 2
Betriebliche Standortentwicklung auf räumliche Schwerpunkte fokussieren
Die Entwicklung der Wirtschaftsstandorte soll sich in der Region Gusental an den besten Standorten bündeln. Wie in der Siedlungsentwicklung werden auch für die Entwicklung von Wirtschafts- und Innovationsstandorte besondere Fokusgebiete identifiziert. Diese sind:
An diese Fokusgebiete lassen sich auch besondere Qualitätsanforderungen richten:
• ökologische Standards (PV, Freiflächen, Regenwassermanagement etc.)
• hohe gestalterische Qualität
• für gute Erreichbarkeit (ÖV, Rad) aus der Region sorgen
• Fokusgebiet Kepler Valley
• Fokusgebiet Denk-Areal
• Fokusgebiet Langwiesen
• Modal-Split-Ziele und Mobilitätsmanagement entwickeln
• Einbettung in regionale Wirtschaftsstrategie (Fokus auf ausgewählte Branchen)

Fokusgebiete Wirtschaftsentwicklung 1 Fokusgebiet
Fokusgebiet
Leitziel 3
Die Vision „Kepler Valley“ weiter auf den Boden bringen
Die Vision des „Kepler Valley“ kursiert seit einigen Jahren und es gibt bereits einige konzeptionelle und strategische Vorüberlegungen. Kern der Vision ist es, die Lage der Region Gusental zwischen den beiden Hochschulstandorten JKU und FH Hagenberg bestmöglich zu nutzen und hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Diese „Innovationsachse Kepler-Valley“ soll eine Strahlkraft weiter über die Region hinaus entwickeln und durch höchste gestalterische, städtebauliche und ökologische Standards im Wettbewerb um die besten Köpfe punkten. Dabei soll, neben der Nähe zu Linz bzw. zur JKU und FH Hagenberg, besonders die hohe Lebensqualität in der Region Gusental als wichtiger Standortfaktor genutzt und gestärkt werden. Im Mittelpunkt steht dabei derzeit der Standort „Fokusgebiet Kepler Valley“. Es ist notwendig, die Ausrichtung des KeplerValley-Konzepts weiter zu schärfen, um den tatsächlichen Flächenbedarf und den stadträumlich-funktionalen Anspruch der Vision „Kepler-Valley“ formulieren zu können. Klar ist, dass hier kein herkömmliches Betriebsgebiet entwickelt werden soll, sondern ein besonderer Anspruch an die Programmierung besteht.
Das Fokusgebiet „Kepler-Valley“
Um zu einer national und international sichtbaren und attraktiven Marke werden zu können, muss sich das Fokusgebiet „Kepler Valley“ durch ein hochwertiges funktionales Konzept und durch eine sehr hohe städtebauliche Qualität auszeichnen. Im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe und Führungspersonen zählen nachhaltige Mobilitätskonzepte, vielfältige und zeitgemäße Wohnangebote für unterschiedlichste Zielgruppen (z.B. internationale Führungskräfte, Studierende etc.) und eine hohe Freizeitqualität etc. zu
weiteren wesentlichen Standortfaktoren. Hier können alle Gemeinden des Gusentals einen wichtigen Teil zum Gelingen der „Kepler Valley“-Vision beitragen.
Im Fokusgebiet sind besondere Qualitätsanforderungen geltend zu machen, die gemeinsam zu entwickeln sind. Als Mindestanforderungen lassen sich folgende Punkte benennen:
• Einbindung in die Region und Anknüpfung an die angrenzenden Stadt- und Ortsteile ohne in Konkurrenz zu diesen zu treten
• Integration der regional relevanten Grünräume und der HQ-Flächen als Teil der Grünund Freiraumplanung
• Qualitätssicherung für Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur
• Mobilitätskonzept und Modal Split-Ziele
Die Stadtregionalbahn als funktionale Voraussetzung für das Fokusgebiet „Kepler Valley“
Die Umsetzung der Schienenachse Linz –Gallneukirchen bzw. Linz – Hagenberg ist zentrale Voraussetzung für die Entwicklung des Fokusgebietes „Kepler Valley“. Die Anbindung des „Kepler Valley“ an ein leistungsfähiges Schienennetz und die damit verbundene (über-)regionale Erreichbarkeit ist ein ein wesentlicher Standortfaktor, ohne den die in der Vision formulierten Ansprüche und die anvisierte (internationale) Zielgruppe an jungen, innovativen und jenseits des herkömmlichen Individualverkehrs „sozialisierten“, Forscher:innen und Entwickler:innen künftig kaum angesprochen werden können. Deshalb ist eine enge Verzahnung und das im Blick Halten der Entwicklungen rund um die Stadtregionalbahn auch wesentlich für das „Kepler Valley“.
Der Vision Qualität geben und die planerischen Rahmenbedingungen ernst nehmen Es ist deutlich zu betonen, dass das Fokusgebiet „Kepler Valley“ in einem aus raumplanerischer Perspektive schwierig zu entwickelnden Raum liegt: bestimmte Flächenanteile liegen in der Hochwasser-Gefahrenzone, es gibt verordnete Freihaltebereiche für die Stadtregionalbahn und verordnete Regionale Grünzonen. Zudem besteht bereits jetzt gerade im Bereich des Fokusgebietes „Kepler-Valley“ eine starke Belastung durch den motorisierten Individualverkehr.
In den nächsten Schritten muss die Vision „Kepler Valley“ diese planungsbezogenen Rahmenbedingungen für das Fokusgebiet anerkennen und die Grundlagen für ein städtebaulich-funktionales und integriertes Konzept schaffen, in denen diese komplexe Ausgangs-
Leitziel 4
Auch die Wirtschaft am Land im Blick behalten
Schon heute sind in Streulagen und kleineren Ortschaften der Gusentalgemeinden z. B. großflächige landwirtschaftliche Leerstände vorhanden, die baulich und funktional bestimmte Qualitäten mitbringen, aus denen sich innovative Nachnutzungskonzepte entwickeln lassen. Gerade im Bereich der Leerstandsaktivierung und Nachnutzung verschiedener Gebäudetypologien in verschiedenen Lagen des Gusentals liegt ein wesentlicher Faktor, wenn es um innovative Impulse und das Schaffen von Möglichkeitsräumen für regionale Geschäftsideen und Wirtschaftskonzepte geht. Dies reicht vom Coworking über regionale Lebensmittelproduktion/-verkauf, bis hin zu temporären Nutzungen und Start-up-Standorten aus hoch innovativen Branchen.
lage gewürdigt und aktiv in die Programmformulierung miteinbezogen wird. Dies geht weit über rein bauliche Vorhaben hinaus und schließt die Grün- und Freiraumentwicklung (inkl. Regenwassermanagement etc.) mit ein. Für bauliche Entwicklungen sind die dafür heranzuziehenden Flächen entsprechend zu prüfen und einem Realisierungs-Check zu unterziehen (HW30-Flächen sind z.B. nicht als Bauland realisierbar).
Ebenso sind verkehrsplanerische Herausforderungen zu beachten und denkbare Lösungsansätze zu entwickeln, wie man den Zuwachs des Individualverkehrs durch das „Kepler Valley“ möglichst gering halten und den trotzdem zu erwartenden Zuwachs in diesem Raumausschnitt der Region Gusental angehen könnte.
KIRCHSCHLAG BEI LINZ
HELLMONSÖDT
Entwicklungskorridor
S-Bahn
S-Bahnen
Bestand (hellgrau)
LICHTENBERG
Haltestelle
Bahn (rot)
Entwicklungskorridor
S-Bahn
Entwicklungskorridor
Haltestelle
Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag) Bushaltestellen 30‘ Takt
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
ALTENBERG BEI LINZ
OTTENSCHLAG IM MÜHLKREIS


Alberndorf
Pröselsdorf
Steinbach
ALBERNDORF IN DER


Altenberg
Katzgraben

Niederkulm





NEUMARKT IM MÜHLKREIS
KEFERMARKT
Karte 17: Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung
LEITBILDBAUSTEINE
Entwicklungskorridor Stadtregionalbahn Gebiete mit min. ÖV-Güteklasse D
Siedlungsentwicklung
Z Fokusgebiet Stadtzentrum
K Fokusgebiet Ortskern
S Fokusgebiet Siedlungsentwicklung Stadtzentrum Gallneukirchen
2 Siedlung Engerwitzdorf
3 Ortskern Schweinbach
HAGENBERG IM MÜHLKREIS
4 Siedlung Haid
5 Siedlung Linzerberg I
6 Siedlung Linzerberg II
7 Ortskern Mittertreffling
UNTERWEITERSDORF
Enger witzdorf Schweinbach Treffling
ENGERWITZDORF
Holzwiesen
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 60‘ Takt
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt



Bushaltestellen 60‘ Takt
PREGARTEN
8 Ortskern Altenberg
9 Siedlung Alberndorf
10 Ortskern Alberndorf
11 Siedlung Spattendorf
12 Siedlung Klendorf
13 Ortskern Katsdorf
14 Siedlung Katsdorf
15 Siedlung Lungitz Wirtschaftsentwicklung
WARTBERG OB DER AIST
Fokusgebiet Wirtschaft+Innovation Fokusgebiet Kepler Valley
2 Fokusgebiet Denk-Areal
3 Fokusgebiet Langwiesen
GRUNDLAGEN
Bauland Kerngebiet, gemischtes Baugebiet, Sondergebiete des Baulandes (lt. Flächenwidmungsplan)
Klendorf
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Radpotenzial sehr hoch
Entwicklungs-
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
ÖV-Güteklas- ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel


Bodendorf
Katsdorf
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)
Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Z K Bauland Geschäftsgebiet, Betriebsbaugebiet, Industriegebiet, eingeschränktes gemischtes Baugebiet (lt. Flächenwidmungsplan)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Bauland Dorfgebiet, Wohngebiet, Reines Wohngebiet (lt. Flächenwidmungsplan) S-Bahnen
Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch
hoch
mittel
Z K S W+I W+I
se
se C
Regionale Grünzonen Linzer Umland
Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Baulandreserven Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore
Freizeitrouten Wald Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewäs ser (Farbe)
se D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau)
Standorf Lungitz
Grünzonen lt. ÖEK Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeinde grenzen
Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)
Hauptgewässer Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorri dore Nebengewässer
(in
Z K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)

ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau)
SCHWERTBERG
UMSETZUNGSMASSNAHMEN WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
W01
Aufbau einer Organisationsstruktur und Dachmarke für die kooperative, gemeindeübergreifende Entwicklung der „Wirtschaftsregion Gusental“
Wie bereits in Leitziel 1 formuliert wurde, sollen die verschiedenen vorhandenen Entwicklungsaktivitäten und Visionen für die Weiterentwicklung unter einer zentral organisierten und aktiv gemanagden Dachmarke zusammengefasst werden, um die Organisation und die Kommunikation sowohl nach außen als auch nach innen zu bündeln und dadurch zu stärken. Es gilt eine zentrale interkommunale Stelle für die Entwicklung und Verwaltung der Liegenschaften zu schaffen, welche die Ansiedlung von Forschungs- und Wirtschaftseinrichtungen professionell unterstützt und
W02
begleitet und zwischen allen relevanten Stakeholdern vermittelt. Nicht zuletzt soll sich diese Dachmarke auch als Kommunikationsplattform zwischen den Unternehmen und der Bevölkerung in der Region Gusental begreifen, um in bestem Austausch die Interessen beider Seiten in die Standortentwicklung einfließen zu lassen.
Die Umsetzung kann in Form einer INKOBA erfolgen, in der neben einer geeigneten Organisationsstruktur auch die inhaltliche Ausrichtung und die Zuständigkeiten näher definiert werden.
Die Vision „Kepler Valley“ vor den Vorhang holen –Transparenz schaffen und Stakeholder einbinden
Für die Vision des „Kepler Valley“ wurde in den letzten Jahren von einem kleinen Kreis kompetenter und hoch engagierter Personen der Grundstein gelegt und viele konzeptionelle Vorarbeiten geleistet. Um diese Vision schrittweise in Richtung Umsetzung bringen zu können und eine breite Akzeptanz zu erzeugen, müssen die kommunalen Entscheidungsträger:innen und regionale Stakeholder über die Vision informiert werden. Je breiter die Basis jener, die von
der Idee des „Kepler Valley“ begeistert werden können, desto höher die Akzeptanz und ausgeprägter der Beteiligungswille bei den nächsten Schritten. Die erste konkrete Maßnahme sollte also sein:
Die Vision „Kepler Valley“ vor den Vorhang holen: Informations- und Diskussionsrunde für Gemeinderät:innen und regionale Stakeholder (Kammern, Unternehmen, Planungsbüros etc.).
W03
Ein integriertes Entwicklungskonzept für das Fokusgebiet „Kepler Valley“ erarbeiten
Die Vision „Kepler Valley“ stellt ein wirtschaftsstrategisches Leitprojekt dar, dessen Wirkung weit über das Gusental hinaus reichen kann. Es sind bereits zahlreiche Vorarbeiten geleistet worden und damit liegt eine vergleichsweise konkrete Vision für das Entwicklungskonzept auf dem Tisch. Ziel muss es sein, diese Vision einen weiteren Schritt Richtung Boden zu bringen und eine nächste mögliche Umsetzungsstufe einzuleiten. Diese nächste Stufe kann durch die gemeinsame Arbeit an einem integrierten Entwicklungskonzept erreicht werden, in dem wesentliche Rahmenbedingungen und Zielformulierungen für das Fokusgebiet „Kepler Valley“ geschärft werden.
Im Zuge der einzelnen Workshops und Beteiligungsschritte, die im Rahmen des IKRE-Prozesses durchgeführt wurden, wurden von verschiedenen Akteuren relevante Fragen zur Konzeption des „Kepler Valley“ und zu dessen Umsetzung aufgeworfen, die den Rahmen für ein solches integriertes Konzepts abstecken können:
• Welche Ausrichtung soll das Fokusgebiet „Kepler Valley“ haben - integrierter Stadtteil oder Forschungscampus?
• Wen brauchen wir als Stakeholder, damit die Entwicklung wirklich funktionieren kann?
• Wer hat die Steuerungshoheit, was die Auswahl der Unternehmen betrifft?
• Wer wird die Möglichkeit haben, im Fokusgebiet zu investieren?
• In wessen Eigentum werden sich die Gebäude im Fokusgebiet des Kepler Valley befinden?
• Wer kümmert sich um die Pflege der öffentlichen Bereiche im Fokusgebiet?
• Welche Widmungskategorie ist die passende für das Fokusgebiet?
• Wie stehen INKOBA und das Konzept des „Kepler Valley“ zueinander?
Ebenso wurden verschiedene Ansprüche diskutiert, die für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts wesentlich sein können:
• Das „Kepler Valley“ muss unbedingt multifunktional gedacht werden und muss einen Mehrwert für die Bewohner:innen und Anrainer:innen darstellen: Hierzu ist bereits im Vorfeld die Abstimmung mit den Anrainer:innen notwendig, auch um potenzielle Synergieeffekte erkennen und nutzen zu können.
• Ein Beirat für das Fokusgebiet „Kepler Valley“ sollte geschaffen werden, der in den ersten Phasen die gestalterische, städtebauliche und konzeptionelle Umsetzung als Qualitätssicherer koordiniert und dies in weiterer Folge auch in Bezug auf die Ansiedlung von Unternehmen tut.
• Dieses Projekt „lebt“ von seinen hohen städtebaulichen und Freiraumqualitäten.
• Unbedingt Konsens zwischen den GusentalGemeinden herstellen und sie gleichwertig informieren, um eine gemeinsame Sicht aller herzustellen (v.a. auch auf Ebene der Gemeinderät:innen): Die Standortfrage sollte offen geklärt werden.
• Werden im Fokusgebiet „Kepler Valley“ nur Jobs für High Potentials geschaffen, dann darf man nicht aus den Augen verlieren, dass eine wirtschaftlich resiliente Region auch Standorte und Entwicklungsmöglichkeiten für „einfache“ Jobs braucht.
• Welchen Rolle in Bezug auf die nutzbare Fläche, das gesamte Konzept und die zu tätigenden Investitionen sollen/werden die Linzer Universitäten und Hochschulen haben?
Realitätscheck: Abklärung raumordnungsrelevanter Fragestellungen
Das anvisierte Fokusgebiet des „Kepler Valley“ liegt in einem aus raumordnungsfachlicher Sicht komplexen Standortbereich. Um einen Überblick über die geeigneten und damit potentiell in Frage kommenden Flächen zu bekommen, bedarf es einer konkreten raumordnungsfachlichen Untersuchung durch ein Planungsbüro. Ebenso muss die bereits jetzt angespannte Verkehrssituation im Bereich des Fokusgebiets näher beleuchtet und Lösungsansätze für die verkehrliche Organisation bzw. Reduktion des MIV-Aufkommens durch ein Verkehrsplanungsbüro erarbeitet werden. Dieser Realitäts-Check dient zur Faktenschaffung und als inhaltliche Grundlage für nachfolgende konkrete Planungs- und Umsetzungsschritte. Letztlich muss auch die Grundstücksverfügbarkeit und eine am Bedarf orientierte schrittweise Umsetzung Beachtung finden.
W04
Wirtschaft am Land
Im Themenfeld Wirtschaft soll sich der Fokus auch auf die Wirtschaftspotenziale richten, die außerhalb der stadtregionalen Fokusgebiete liegen. Es geht vor allem darum, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche (regional-)ökonomischen Potenziale sich in Einzellagen (z.B. Umnutzung von ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden) befinden und welche Nutzungskonzepte für sie erfolgreich sein können.
Im Rahmen der Beteiligungsprozesse wurden folgende Handlungsideen und inhaltlich-konzeptionelle Hinweise bzw. Fragen gegeben, die auch in die folgenden Maßnahmenvorschläge integriert werden können:
• Die Ortsbauernschaft sollte unbedingt mit eingebunden werden (als Zielgruppe, aber auch als Expert:innen)
• Kann man mit diesem Konzept ein Raumangebot für Unternehmen schaffen, die sofort und dringend (mehr) Platz benötigen?
Konzeption eines dialogorientierten Planungsprozesses
Aufbauend auf der Umsetzung der vorangestellten Maßnahmen kann die nächste Realisierungsstufe der Vision „Kepler Valley“ angegangen werden: Um das „Kepler Valley“ überregional bzw. international konkurrenzfähig und attraktiv zu machen, bedarf es nicht nur auf der konzeptionellen Ebene, sondern auch im Bereich von Städtebau und Architektur höchster Qualität. In Form eines dialogorientierten, (inter-)national besetzten Prozesses soll ein integriertes Entwicklungskonzept für das Fokusgebiet „Kepler Valley“ ausgearbeitet werden, das die Grundlage für die konkrete Realisierung bzw. die Ausschreibung von städtebaulichen, architektonischen Wettbewerben bildet, indem es den städtebaulich-funktionalen Gesamtanspruch formuliert und Rahmenbedingungen für die Entwicklung absteckt.
• Exkursion zu Best-Practice-Beispielen „Wirtschaft am Land“ und zu erfolgreichen Nachnutzungen im Gusental.
Folgende Maßnahmen sind zu setzen:
Erhebung von Leerständen und untergenutzten Potenzialen in den ländlich geprägten Ortsteilen Im stadtregionalen Kontext wurde bereits im Rahmen von LEADER eine Erhebung von Leerständen und Nachnutzungspotenzialen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen im stadtregionalen Kontext gesichtet und dahingehend bewertet werden, ob sie eine ausreichende Datenbasis für die intensive Bearbeitung des Themas im Kontext der Stadtregion Gusental bilden. Sollten bestimmte Aspekte noch offen sein, wäre eine entsprechende Nacherhebung innerhalb der Stadtregion durchzuführen, um alle relevanten Fragen zu diesem Thema klären zu können.
Workshop Nutzungskonzepte und Strategien für eine starke Wirtschaft am Land Aufbauend auf den Grundlagen der vorangestellten Erhebung sollen in einem stadtregionalen Workshop Zukunftsperspektiven und realistische Nutzungskonzepte und Strategien für typische Leerstände und untergenutzte Gebäude/Hofstellen entwickelt werden. Der Kreis der Beteiligten soll dabei umfassend und repräsentativ sein: Bürgermeister*innen, Gemeinderat, kommunale Verwaltung, Unter-
nehmer*innen, Grundstücks-/Gebäudeeigentümer*innen, Expert*innen aus Planung und Architektur. Ausgehend von den gemeinsam erarbeiteten konkreten Nach-/Umnutzungsstrategien, können im Nachgang z.B. Möglichkeiten sondiert werden, welche (landesweiten, nationalen, EU-basierten) Fördermöglichkeiten es für deren Umsetzung gibt und wo eine Abstimmung/Kooperation mit anderen regionalen Initiativen (z.B. LEADER) möglich ist.
Um langfristig konkurrenzfähig sein zu können, müssen Betriebsgebiete funktional und ökologisch höchsten Ansprüchen genügen. Ziel dieser Maßnahme ist es, einen regional abgestimmten und akkordierten Punkteplan zu entwickeln, der gemeinsame Standards für städtebauliche, funktionale, ökologische und mobilitätsbezogene Standards festlegt. Diese sollen die Grundlage für die Bauleitplanung aller künftigen Betriebsgebiete bilden, können Basis für städtebauliche Wettbewerbe für Betriebsgebiete sein oder auch in Bebauungspläne bestehender Betriebsgebietsstandorte aufgenommen werden und z.B. bei genehmigungspflichtigen Umbaumaßen wirksam werden.
In den Beteiligungsprozessen und Workshops wurden einige Hinweise und Anregungen gegeben, die in die Maßnahmenvorschläge integriert werden können:
• Kooperation mit KLAR- und KEM-Region, um sich über Best-Practice-Beispiele informieren zu können. Hier geht es um „große“ und „kleine“ Beispiele, die maßgeschneidert für Regionen wie das Gusental sind (z.B. im Bereich Mobilität E-Mopeds als Anreiz für junge Auszubildende etc.).
• Es gibt kaum Bebauungspläne für Betriebsgebiete, obwohl man mit diesen sehr viel in diese Richtung bewegen könnte (Stellplatzschlüssel, Grünflächenanteile etc.); hier liegt ein großer Hebel, über dessen Einsatzmöglichkeiten man mehr lernen muss.
• In Bezug auf das Baurecht muss man mehr erfahren: Was darf man als Gemeinde vorschreiben, was nicht?
• Gibt es spezielle Baulandsicherungsmaßnahmen für Betriebs- und Industriegebiete?
• In den Workshop sollte man aktiv das aktuelle Handbuch des BizUp zur nachhaltigen Entwicklung von Betriebsstandorten mit einbeziehen bzw. vom BizUp dort vorstellen lassen.
Folgende Maßnahmen sind zu setzen:
Workshop „Gemeinsame Standards für Betriebsgebiete“
Die inhaltliche Basis hierfür wird in einem (mehrteiligen) Workshop geschaffen, an dem neben kommunalen Vertreter:innen und kommunalen Expert:innen auch externe Expert:innen teilnehmen sollen (z.B. BizUp, Planungsbüros, Landesregierung).
• Idee: Vielleicht ein regionales Leuchtturmprojekt ausloben und somit nach innen und nach außen Bewusstsein für das Thema zu schaffen und um (über-)regional „Werbung“ für das Gusental als Standort zu machen.
ÜBERSICHT:
UMSETZUNGSMASSNAHMEN WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
Nr. Maßnahme
W01
Aufbau einer Organisationsstruktur und Dachmarke für die kooperative, gemeindeübergreifende
Entwicklung der „Wirtschaftsregion Gusental“
W02 Die Vision „Kepler Valley“ vor den Vorhang holen – Transparenz schaffen und Stakeholder einbinden
W03
Ein integriertes Entwicklungskonzept für das Fokusgebiet „Kepler Valley“ erarbeiten
W04 Wirtschaft am Land
zentral organisierte und gemanagde Dachmarke bündelt die Organisation und Kommunikation der „Wirtschaftsregion Gusental“ nach innen und nach außen
Verein Gusental, biz-up
gut strukturierter Interessensaustausch zwischen Unternehmen/Institutionen und den Gemeinden der Region sowie der Bevölkerung mittelfristig mittel LZ 1 - Wirtschaft hoch
Informations- und Diskussionsrunde für Gemeinderät:innen und regionale Stakeholder
Verein Gusental, Kepler-Valley-Projektteam
Realitätscheck: Abklärung raumordnungsrelevanter Fragestellungen
Verein Gusental
Konzeption eines dialogorientierten Planungsprozesses
Verein Gusental
Abstimmung mit bereits durchgeführten Erhebungen und ggf. Durchführung einer (Detail-) Erhebung von Leerständen und untergenutzten Potenzialen in den ländlich geprägten Bereichen des Gusentals.
Organisation und Durchführung eines Workshops „Nutzungskonzepte und Strategien für eine starke Wirtschaft am Land“ (in enger Abstimmung mit LEADER etc.).
Verein Gusental und/oder Amtsleitungen als koordinierende Ebene
W05 Punkteplan zur nachhaltigen Gewerbegebietsentwicklung
Workshop (mehrteilig) zur gemeinsamen Erarbeitung von Standards für Betriebsgebiete im Gusental.
Verein Gusental und/oder Amtsleitungen als koordinierende Ebene
gemeinsames Verständnis für die Vision "Kepler-Valley" unter allen Beteiligten der Region und entwicklungsrelevanten Stakeholdern gewinnen kurzfristig
Überprüfung der Entwickelbarkeit des zentralen Fokusgebiets im Kontext der gesamten Region
Schaffen einer regional tragfähigen Planungsgrundlage unter Einbeziehung aller entwicklungsrelevanter Stakeholder der Region
Klares Bild über die in der Stadtregion vorhandenen Leerstände/Unternutzungen als Grundlage für eine abgestimmte Strategie zu deren Belebung und Neunutzung.
kurzfristig gering LZ 2, 3 - Wirtschaft hoch
mittelfristig mittel LZ 2, 3 - Wirtschaft hoch
kurzfristig gering LZ 3 - Wirtschaft mittel
Klares Bild über die in der Stadtregion vorhandenen Leerstände/Unternutzungen als Grundlage für eine abgestimmte Strategie zu deren Belebung und Neunutzung und Koordination mit parallel laufenden Projekten (z.B. LEADER). kurzmittelfristig gering-mittel
Gemeinsame Standards für Betriebsgebiete machen das Gusental als Wirtschaftsstandort zukunftstauglich und (über-)regional attraktiv.
mittelfristig mittel LZ 2, 4 – Wirtschaft hoch
KEFERMARKT
OTTENSCHLAG IM MÜHLKREIS
HELLMONSÖDT
KIRCHSCHLAG BEI LINZ
NEUMARKT IM MÜHLKREIS


Alberndorf
Pröselsdorf
Steinbach
ALBERNDORF IN DER RIEDMARK

Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
HAGENBERG IM MÜHLKREIS
Karte 18: Leitbildkarte gesamt
LEITBILDBAUSTEINE
Landschaft und Klima Flusskorridore Vernetzung von Siedlungen und Landschaft entlang regionaler Freizeitrouten
Bestehende lokale Freizeitrouten zu regionalem Netz verbinden
Gusentalterrasse Mobilität
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewäs ser (grau)
Busverbindung (Vorschlag)
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze
Haltestelle (30-Minuten-Takt, Vorschlag)
Oberndorf
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Regionale
Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft
Freizeitrouten
die Hauptgewässer (Farbe)
Aussichtspunkte in die Landschaft
Hauptgewäs- Nebengewässer (Farbe)
Nebengewäs- Hauptgewässer (grau)
Hauptgewässer (Farbe)
Nebengewässer (Farbe)
Hauptgewässer (grau)
Nebengewässer (grau)
LICHTENBERG
ALTENBERG BEI LINZ

Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Hauptgewässer (grau)
Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Nebengewässer (grau)
Nebengewässer (grau)
Regionsgrenze Gemeindegrenzen
Regionsgrenze Gemeindegrenzen
Regionsgrenze Gemeindegrenzen
Altenberg
Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Katzgraben
Niederkulm

S-Bahnen
Bestand (dunkelgrau)
Entwicklungskorridor S-Bahn
S-Bahnen Bestand
S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Haltestelle Bahn (rot)
Entwicklungs-
S-Bahn
Entwicklungskorridor
S-Bahn
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 60‘ Takt
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Radpotenzial sehr hoch
Entwicklungskorridor S-Bahn
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)




Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (rot)
Entwicklungskorridor S-Bahn
Entwicklungskorridor S-Bahn
Haltestelle Bahn (rot)
Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Entwicklungskorridor S-Bahn Haltestelle Bahn (rot) Haltestelle Bahn (dunkelgrau) Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag)
Haltestelle (60-Minuten-Takt, Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch
Siedlungs-
Radpotenzial hoch
Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch


ENGERWITZDORF
UNTERWEITERSDORF
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Enger witzdorf Schweinbach Treffling
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Haltestelle Bahn (dunkelgrau)
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Haltestelle Bahn (hellgrau)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
WARTBERG OB DER AIST
Haltestelle Bahn (hellgrau) Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Busverbindung (Vorschlag)
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Bushaltestellen 30‘ Takt
Bushaltestellen 60‘ Takt
Fahrradpotenzial (sehr hoch)
Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel
Fahrradpotenzial (hoch)
Radpotenzial sehr hoch
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklas se B
Radpotenzial hoch
Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklas se D
Bushaltestellen 60‘ Takt Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D
Radpotenzial sehr hoch
Radpotenzial hoch
Radpotenzial mittel
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C
Fahrradpotenzial (mittel) Entwicklungskorridor Stadtregionalbahn Gebiete mit min. ÖV-Güteklasse D Siedlungsentwicklung
PREGARTEN
Z Fokusgebiet Stadtzentrum K Fokusgebiete Ortskern S Fokusgebiete Siedlungsentwicklung Wirtschaftsentwicklung
W+ W+ Fokusgebiete Wirtschaft+Innovation GRUNDLAGEN
ÖV-Güteklas se E
ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklas se F
Bauland Kerngebiet, gemischtes Baugebiet, Sondergebiete des Baulandes (lt. Flächenwidmungsplan)
Radpotenzial sehr hoch Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Radpotenzial mittel
Holzwiesen
ÖV-Güteklasse B
Radpotenzial hoch Radpotenzial mittel

ÖV-Güteklasse B
ÖV-Güteklasse C

Z K Bauland Geschäftsgebiet, Betriebsbaugebiet, Industriegebiet, eingeschränktes gemischtes Baugebiet (lt. Flächenwidmungsplan)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen
Klendorf

Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen)

Bodendorf
Katsdorf
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Bauland Betrieblich (Graustufen)
Fokusgebiet Z Fokusgebiet
Z Bauland Dorfgebiet, Wohngebiet, Reines Wohngebiet (lt. Flächenwidmungsplan)
Grünland (lt. Flächenwidmungsplan)
ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen)
Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau) Z K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau)
Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewäs ser (Farbe)
Hauptgewässer
Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Wald Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichts punkte Landschaft Regionale Grünzonen Linzer Umland
Nebengewässer
HQ 10-Flächen
Grünzonen lt. ÖEK Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeinde grenzen
ALLERHEILIGEN
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorri dore
HQ 30-Flächen Wildtierkorridore
FLW Grünland Flusskorridore Regionale Freizeitrouten Aussichtspunkte in die Landschaft Hauptgewässer (Farbe) Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau) Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)
Hauptgewässer (Farbe)
ÖV-Güteklasse B ÖV-Güteklasse C ÖV-Güteklasse D ÖV-Güteklasse E ÖV-Güteklasse F ÖV-Güteklasse G Siedlungsgrenzen Baulandreserven Bauland Zentrum Bauland Dorfgebiet und Wohnen Bauland Betrieblich Bauland Zentrum (Graustufen) Bauland Dorfgebiet und Wohnen (Graustufen) Bauland Betrieblich (Graustufen) Fokusgebiet Z Fokusgebiet K Fokusgebiet S Fokusgebiet W+I Autobahn Landesstraßen (B und L) Gemeindestraßen S-Bahnen in Planung (rot) S-Bahnen in Planung (dunkelgrau) S-Bahnen in Planung (hellgrau) Z K S W+I W+I Grünzonen lt. ÖEK (Farbe) Grünzonen lt. ÖEK (grau)
Nebengewässer (Farbe) Hauptgewässer (grau)
Standorf Lungitz
Stadtregionalbahn (in Planung) Wald (Farbe) Wald (grau) Regionale Grünzonen (Farbe) Regionale Grünzonen (grau) FLW
Nebengewässer (grau) Regionsgrenze Gemeindegrenzen Wildtierkorridore mind. ÖVGüteklasse D HQ 10-Flächen HQ 30-Flächen S-Bahnen Bestand (rot) S-Bahnen Bestand (dunkelgrau) S-Bahnen Bestand (hellgrau)

RIED IN DER RIEDMARK
SCHWERTBERG
Entwicklungskorridor S-Bahn
Entwicklungs korridor S-Bahn
Haltestelle Bahn

Tragfähigkeit durch Konsens
Die Interkommunale Raumentwicklungsstrategie für die Region Gusental besitzt als informelles Planungsinstrument keine Rechtsverbindlichkeit. Um die gemeinsamen Zielsetzungen wirksam werden zu lassen, müssen sie auf breiten Konsens aller Beteiligten aufgebaut werden. Der IKRE-Prozess schafft die optimale Grundlage für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und für eine konsensorientierte Kooperation in der Region. In einem umfassenden Prozess wurden planerische Positionen verhandelt, offene Fragen diskutiert und Interessenslagen abgewogen.
Das daraus resultierende Ergebnis lässt auf eine hohe Tragfähigkeit von allen Beteiligten schließen und stellt eine Vertrauensgrundlage für die nächsten Entwicklungsschritte her.
Das IKRE als Steuerungsinstrument Mit dem IKRE sind die regionalen Entwicklungsaufgaben nicht abgeschlossen. Vielmehr ist die strategische räumliche Entwicklung der Region eine Daueraufgabe. Das IKRE soll dabei als Navigationshilfe dienen und den strategischen Orientierungsrahmen für langfristige Perspektiven bilden.
Der Verein Gusental als Kooperationsplattform
Die fünf Gemeinden der Region Gusental können bereits auf eine langjährige Zusammenarbeit verweisen. Mit dem IKRE-Prozess hat diese Kooperation nun einen maßgeblichen Meilenstein geschafft, von dem aus die Zusammenarbeit nun unbedingt intensiv fortgesetzt werden soll. Der Faden darf nicht abreißen! Es wird nachdrücklich empfohlen, die Arbeit im Verein im Sinn einer Kooperationsplattform zu verstätigen und sich regelmäßig über den Fortgang der Entwicklungen in der Region Gusental auszutauschen.
Das Regionalmanagement als Partner
Die Begleitung des gesamten IKRE-Prozesses durch das Regionalmanagement Oberösterreich hat laufend sichergestellt, die komplexen Koordinationsaufgaben zu steuern. Um die kommenden Entwicklungsschritte auch weiterhin strukturiert zu begleiten und beratend zu unterstützen ist zu empfehlen, das Regionalmanagement auch in die Planung und Umsetzung der Maßnahmen einzubinden. Entsprechende personelle Ressourcen und eine Kontinuität in der Begleitung stellen sicher, dass der Weg der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann.
Abbildungen
26 Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung 1951 – 2020 (1951 = 100 %)
28 Abb. 2: Bevölkerungsprognose Gusental
28 Abb. 3: Wanderungsbilanz nach Altersgruppen 2012 – 2019
31 Abb. 4: Entwicklung der Verkehrsmittelwahl
55 Abb. 5: Aktueller und Ziel-Modal-Split im Gusental
Tabellen
9 Tab. 1: Kategorien der ÖV-Güteklassen
Karten
6 Karte 1: Die fünf Gemeinden der Region Gusental
22 Karte 2: Lage der Region Gusental in Oberösterreich
23 Karte 3: Wichtige Anbindungen der Region
24 Karte 4: Durchschnittliche Anzahl Hitzetage (1981 – 2010)
25 Karte 5: Bodengüte
27 Karte 6: Bevölkerungsentwicklung 2011 – 2020
29 Karte 7: Wanderungssaldo Gusental 2002 – 2019
30 Karte 8: Pendler:innensaldo
32 Karte 9: Familienidyll- und Siedlungsreife-Index
46 Karte 10: Landschaft und Klima
53 Karte 11: Fahrradpotenzial
54 Karte 12: ÖV-Zukunftsnetz (Vorschlag)
56 Karte 13: Gebiete mit mindestens ÖV-Güteklasse D gemäß ÖVNetzvorschlag
58 Karte 14: Mobilität
67 Karte 15: Fokusgebiete Siedlungsentwicklung
77 Karte 16: Fokusgebiete Wirtschaftsentwicklung
80 Karte 17: Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung
88 Karte 18: Leitbildkarte gesamt