











Wien/Wels, 2018


PROLOG
Der Strategieplan kompakt
Das gemeinsame Ganze finden Warum eine Strategie für die Stadtregion?
Prozessablauf
Raum- und Strukturanalyse Raumtypen der Stadtregion
SWOT-Analyse Kooperationsanalyse Handlungserfordernisse
LANDSCHAFT
Leitziele & Maßnahmen
Leitbildbausteine Leitbildkarte
SIEDLUNG
Leitziele & Maßnahmen Leitbildbausteine Leitbildkarte
WIRTSCHAFT
Leitziele & Maßnahmen
Leitbildbausteine Leitbildkarte
MOBILITÄT
Leitziele Maßnahmen Leitbildkarte
Leitbildkarte gesamt
Maßnahmen im Überblick
Maßnahmen Landschaft
Maßnahmen Siedlung
Maßnahmen Wirtschaft
Maßnahmen Mobilität
Long List-Maßnahmen Mobilität
Umsetzungsprojekte
Maßnahmenbündel A
Maßnahmenbündel B
Maßnahmenbündel C
Impressum
Die Stadtregion Wels ist räumlich und strukturell sehr heterogen, sodass diesem komplexen Gefüge nur eine in sich differenzierte Entwicklungsstrategie Rechnung tragen kann. Die zukünftige Entwicklung wird dabei von gemäßigtem Wachstum gekennzeichnet sein. Es muss im Leitbild also nicht um Wachstumsmanagement, sondern um die sozioökonomische, räumlich-strukturelle und funktionale Qualifizierung der Stadtregion Wels gehen. Vier Leitbildthemen geben dafür Orientierung:
Die naturräumliche Lage der Stadtregion ist einerseits geprägt durch das „Welser Hügelland“ im Norden, die Traun-Enns-Platte mit der Traunleiten als Geländekante im Süden und das Untere Trauntal als „Grünes Rückgrat“ der ganzen Stadtregion. Diese hochrangigen Landschaftsräume umschließen bzw. durchziehen das Stadtgebiet von Wels, sodass durch die Vernetzung dieser Grünkorridore sowohl für die Stadt Wels als auch für die Umlandgemeinden ein „Grüngürtel“ entsteht.
Das für die Zukunft erwartete Bevölkerungswachstum in der Stadtregion Wels ist im Vergleich zu hochdynamischen Wachstumsregionen moderat; der Entwicklungsschwerpunkt liegt dabei eindeutig auf dem Gebiet der „kleinen Großstadt“ Wels. In der gesamten Stadtregion geht es nicht nur um das Management von Wachstum, sondern vor allem um die Qualitätssteigerung der Gemeinden bzw. ihrer Ortsmitten und Ortskerne; das trifft auf Wels ebenso zu wie z.B. auf Krenglbach. Innenentwicklung vor Außenentwicklung soll das stadtregionale Leitmotiv der künftigen Siedlungsentwicklung sein; und auch die „Verteilung“ des Wachstums auf Wels als eindeutigem Siedlungsschwerpunkt braucht vorausschauende Planung.
Die Stadtregion Wels entwickelt sich immer mehr zu einem der ganz bedeutenden ökonomischen Hotspots Oberösterreichs, ja sogar ganz Österreichs. Die meisten Gemeinden der Stadtregion sind am Wirtschaftspark Voral-
Abb.2: Der Strategieplan kompakt: Landschaft, Siedlung, Wirtschaft und Mobilität. Eigene Darstellung
penland beteiligt. Ein Konzept wie dieses weist den Weg in die Zukunft: Die steigenden Anforderungen an eine Region als Wirtschaftsstandort, der im internationalen Business sichtbar und konkurrenzfähig bleiben will, können nur kooperativ bewältigt werden. Doch auch über die Idee eines gemeinsamen Wirtschaftsparks hinaus gibt es in den Städten und Gemeinden in der Region planerische Herausforderungen, vor denen alle gleichermaßen stehen und die sich ebenso viel eher kooperativ lösen lassen als wenn man insuläre Lösungen anstrebt.
Vor dem Hintergrund der Gestaltung eines klima- und umweltfreundlichen Mobilitätssystems geht es darum, den Trend der letzten Jahrzehnte mit einem stetigen Wachstum des Kfz-Verkehrs zu brechen und die Verkehrsarten öffentlicher Verkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr zu stärken. Dazu braucht es eine gute Abstimmung der weiteren Siedlungsentwicklung mit der ÖV-Erschließung und der Erschließung mit dem Radverkehr. Der weitere Ausbau des Radwegenetzes, Lückenschlüsse im bestehenden Netz und die Qualitätsverbesserung bestehender Anlagen können einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in der Stadtregion leisten.
MASSNAHMEN
Zu allen vier Leitbildthemen werden Maßnahmen vorgeschlagen, anhand derer die Zielsetzungen erreicht werden sollen. Die Maßnahmenlisten sollen den EntscheidungsträgerInnen dabei helfen, eine Priorisierung in Bezug auf mögliche Umsetzungen vorzunehmen.
Aufenthaltsorte in der Stadtregion Eine der zentralen Qualitäten der Stadtregion Wels liegt in ihrer Landschaft, die neben ökologischen und klimatischen Aspekten auch ganz wichtige Freizeit- und Naherholungsfunktionen erfüllt. So werden innerhalb der gesamten
Stadtregion Verbesserungen der Aufenthaltsund Erholungsqualität vorgeschlagen – sowohl entlang der Traun, als auch in der hügeligen Landschaft des Welser Hügellandes.
Die Schaffung von sogenannten Naturerlebnis-Rastplätzen entlang der Traun ist im Zusammenhang mit Anforderungen an das Europaschutzgebiet „Untere Traun“ und „Natura 2000“ zu verstehen und trägt zur Belebung der Erholungsnutzung bei. Erholungswert, Besucherlenkung und naturschutzfachliche Vermittlung stehen im Vordergrund. Die Ausstattung der Rastplätze besteht aus Sitzmöglichkeiten, Spielgeräten für Kinder und Hinweis- und Vermittlungstafeln.
Das Modul Bank-Baum-Platz ist ein wiedererkennbares Element an geeigneten Orten innerhalb der Siedlungs- und Kulturlandschaft wie z.B. an Kreuzungsbereichen von Wegen, an Anhöhen mit Sichtbezügen usw. Das Grundmodul besteht aus einer Sitzbank, einer Baumpflanzung und einem Staudenbeet, die einen Platz definieren. Das „Traunschiff“ in Thalheim bei Wels – nahe der Volksschule positioniert – soll Raum für öffentliche Nutzungen wie einer Bibliothek, einem Café und einem Standesamt schaffen. Mit diesem „Traunschiff“ wird ein starker Anziehungspunkt am Wasser und am Traunufer geschaffen, ein Bindeglied zwischen den beiden einander an der Traun gegenüberliegenden Gemeinden Thalheim und Wels und ein Ort für Freizeit, Erholung und Kultur für die gesamte Stadtregion und darüber hinaus.
Ausbau des Stadtregionalen Radwegenetzes
Die Short-list-Projekte zum Stadtregionalen Radwegenetz wurden gemeinsam mit den GemeindevertreterInnen ausgewählt. Dabei wurde auch auf eine ausgewogene Verteilung der Projekte innerhalb der Stadtregion Bedacht genommen. Die ausgewählten Short-list-Projekte bilden den Projektpool, aus dem nach Maßgabe der verfügbaren Fördermittel die Auswahl jener Projekte erfolgt, die für eine Fördereinreichung in Frage kommen.Projekte erfolgt, die für eine Fördereinreichung in Frage kommen.
Die Stadtregion Wels ist eine der bedeutendsten Stadtregionen in Oberösterreich, bezogen auf ihre EinwohnerInnenzahl, aber auch als regionalökonomisch wichtiger Standort und in ihrer Funktion als Verkehrsknotenpunkt. Hier treffen städtische Bausteine, markante Landschaftsräume, Verkehrsbauwerke und weitgehend erhaltene dörfliche Strukturen aufeinander. All dies unter der Prämisse einer integrierten und vorausschauenden Perspektive klug weiterzuentwickeln, darin liegt die Kernaufgabe der strategischen Entwicklungsplanung der Stadtregion Wels.
Da die großen Zukunftsaufgaben nicht an Gemeindegrenzen enden, haben sich Wels, Buchkirchen, Gunskirchen, Holzhausen, Krenglbach, Schleißheim, Steinhaus, Thalheim bei Wels und Weißkirchen an der Traun zu einer Kooperationspartnerschaft zusammengeschlossen. Erklärtes Ziel ist eine strukturierte und zielgerichtete Vorgehensweise in der Erarbeitung einer gemeinsamen Perspektive, eines gemeinsamen Ganzen. Die strukturellen, funktionalen und baulichen Verflechtungen sind auch mit der Nachbargemeinde Marchtrenk Realität – auch dieser Raum ist ein gelebter Teil der Stadtregion. In strategischen Überlegungen wurde auf eine Anknüpfbarkeit über die Gemeindegrenzen hinaus geachtet. Langfristig ist hier eine Kooperation in strategischen Entwicklungsfragen anzustreben.
Es lässt sich ganz klar sagen: Wels braucht die Umlandgemeinden und die Umlandgemeinden brauchen Wels. Und so machte man sich auf den Weg, um festzustellen, was jede einzelne Gemeinde an der Gestaltung der Stadtregion beitragen kann und was umgekehrt die Stadtregion für jede einzelne Gemeinde leistet. Das Ergebnis dieses Prozesses liegt nun als Strategieplan vor und zeichnet von langfristigen Zielsetzungen bis zu kurzfristig umsetzbaren
»WELS BRAUCHT DIE UMLANDGEMEINDEN UND DIE UMLANDGEMEINDEN BRAUCHEN WELS.«
Abb.3: Die Kooperationsgemeinden, eigene Darstellung
Haiding
KRENGLBACH
Schmiding
Maßnahmen einen Pfad für diese gemeinsame und qualitätsvolle Entwicklung.
Die Bürgermeister und die Bürgermeisterin der neun Kooperationsgemeinden
Wels, Buchkirchen, Gunskirchen, Holzhausen, Krenglbach, Schleißheim, Steinhaus, Thalheim bei Wels und Weißkirchen an der Traun
Katzbach
PICHL
Radlach
Hundsham
Mistelbach
BUCHKIRCHEN
Oberperwend
HOLZHAUSEN
OFTERING
MARCHTRENK
Puchberg
Obereisenfeld
WELS
Untereisenfeld
Pernau
Sinnersdorf
WEIßKIRCHEN
Dietach
SCHLEIßHEIM
Fallsbach
Irnharting
Grünbach
Straß
GUNSKIRCHEN
Lichtenegg
Oberschauersberg
Aschet
THALHEIM
Ottstorf
Weyerbach
HÖRSCHING
Grassing
STEINHAUS
SIPBACHZELL
EGGENDORF
In der Stadtregion Wels finden sich ganz unterschiedliche Siedlungstypen: städtische Kernbereiche in Wels, suburbane Strukturen, die Gemeindegrenzen teils aufzulösen scheinen und Ortsteile, die wie Inseln in einer die Region prägenden Landschaft liegen. So heterogen diese Teilräume sind, so differenziert ist auch die strategische Entwicklungsperspektive zu beschreiben.
Die Stadtregion als Orientierungshilfe
Um diese komplexe, heterogene und hoch dynamische Stadtregion zu steuern und zu gestalten braucht es gemeinsame Bilder, eine gemeinsam Vorstellung davon, wie sich die räumliche Zukunft gestalten soll und es braucht neue Partnerschaften, um all dies auch umzusetzen. Dies betrifft räumliche Schwerpunkte ebenso wie sektorale Themenfelder der Siedlungs- und Zentrenentwicklung, des Bevölkerungswachstums, des Zusammenlebens und der Integration, der Wirtschaft, der Infrastruktur, der Naherholung und Freiräume, der Qualität der öffentlichen Räume wie der Mobilität. Und es gilt auch Instrumente und Plattformen aufzubauen, die diese Entwicklungen begleiten und langfristig sichern können.
Die Strategie als gemeinsamer Nenner der Stadtregion
Der Stadtregion mangelt es nicht an Plänen und Konzepten. Unterschiedliche Strategien auf Landesebene und interkommunaler Austausch über einzelne Vorhaben – wie z.B. der Wirtschaftspark Voralpenland – drücken den Anspruch aus, Entwicklungsaufgaben gemeinsam zu bearbeiten. Anknüpfend an all diese Auseinandersetzungen müssen vorhandene Entwicklungspotenziale lokalisiert, priorisiert und Instrumente zu deren Aktivierung entwickelt und implementiert werden. Es müssen die unterschiedlichen Ansprü-
che und Interessen an die Entwicklung des Raumes erfasst, aufgenommen und gebündelt werden. Letztlich bildet all dies die Grundlage für die Stadtregionale Strategie, die Aussagen zu folgenden Punkten umfasst:
• Aufzeigen einer Raumvision mit zentralen Aussagen zu einem „Bild der Stadtregion“,
• Definition räumlich-funktionaler Entwicklungsschwerpunkte und Aufzeigen strategischer Handlungserfordernisse zur Gestaltung der Stadtregion,
• Aussagen zu stadtregional relevanten Grünräumen und deren Vernetzung, den Siedlungsschwerpunkten und der Zentrenentwicklung, wesentlicher Wirtschaftsstandorte und des Nahmobilitätsnetzes,
• Maßnahmen und Umsetzungsstrategien mit Priorisierung konkreter konzeptioneller Projekte,
• Darstellung der Anforderungen an weitere Planungs-, Kommunikations- und Qualifizierungsprozesse.
Die vorliegende Stadtregionale Strategie für die Stadtregion Wels fasst die erarbeiteten Leitziele und Maßnahmen zu einer tragfähigen Gesamtperspektive zusammen. So wird der Strategieplan zum „gemeinsamen Nenner“ und zur Orientierungshilfe für Entwicklungen in der Stadtregion Wels. Er ist außerdem Kommunikationswerkzeug und Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses für die Stadtregion nach außen.
Der Aufbau der Stadtregionalen Strategie
Die Stadtregionale Strategie setzt sich aus folgenden Abschnitten zusammen:
1. Raum- und Strukturanalyse
Die Ausgangslage und zentrale Herausforderungen in den Bereichen Natur und Umwelt, Klima und Ökologie, Demografie und Soziales, Wirtschaft, Siedlung und Mobilität werden dargestellt. In diesen Abschlussbericht fließt eine Kurzfassung mit ein, die umfassenden Analyseergebnisse sind im sog. Atlas der Stadtregion zusammengestellt.
2. Handlungserfordernisse
Die Raum- und Strukturanalyse wird um eine SWOT-Analyse und eine Kooperationsanalyse ergänzt. Daraus werden die Handlungserfordernisse abgeleitet, die Aussagen zur räumlichen Entwicklung und zu den Themenfeldern Wirtschaft, Ökologie, Klima, Demografie und Soziales treffen.
3. Stadtregionales Leitbild
Anknüpfend an die Handlungserfordernisse werden die strategischen Leitziele und räumlichen Leitbilder dargestellt, die in konkreten Maßnahmen münden. Die Abschnitte gliedern sich dabei nach den Themenfeldern Landschaft, Siedlung, Wirtschaft und Mobilität.
4. Umsetzungsstrategie
Abschließend werden Umsetzungsprojekte empfohlen, die auf Basis der zeitlichen und inhaltlichen Kriterien des EFRE-Förderprogrammes für eine tatsächliche Umsetzung in Frage kommen.
AUFBAU DES BERICHTS
1 RAUM- UND STRUKTURANALYSE
2 HANDLUNGSERFORDERNISSE
SWOT-Analyse und Kooperationsanalyse
Atlas*
Räumliche Entwicklung
Wirtschaft
Ökologie
Klima Demografie
3 STADTREGIONALES LEITBILD
Landschaft
Siedlung
Leitziele
Leitbild
Wirtschaft Maßnahmen
Mobilität
4 UMSETZUNGSSTRATEGIE
5 AUSBLICK
Abb.4: Aufbau des Berichts, eigene Darstellung
*Der sog. „Atlas der Stadtregion“ als Bericht der Raumund Strukturanalyse liegt als gesondertes Dokument vor und beinhaltet auch Thesen und Thesenkarten.
5. Ausblick
Abschließend wird bekräftigend dargestellt, wie der Strategieplan als Instrument für eine gemeinsame Entwicklung der Stadtregion Wels zum Einsatz kommen soll.
Im Rahmen des Planungsprozesses ging es nicht nur um die konkrete Lösung planerischer Aufgaben, sondern auch um die Förderung des Bewusstseins, gemeinsam an der künftigen Entwicklung der Stadtregion Wels zu arbeiten und Grundzüge künftiger Planungen und Umsetzungsprojekte auch gemeinsam zu formulieren.
In regelmäßigen Sitzungen des sogenannten Kernteams mit Vertretern der Stadt Wels, dem Sprecher der Umlandgemeinden und dem Land OÖ wurden Zwischenstände diskutiert und für das Stadtregionale Forum vorbereitet. Der Planungsprozess wurde damit zum Anlass und zur Plattform für einen Austausch über gemeinsame Vorgehensweisen in der Entwicklung der Stadtregion.
Einen besonderen Auftakt stellte die „Expedition in die Stadtregion“ dar. Gemeinsam mit den Bürgermeistern und der Bürgermeisterin und weiteren Vertreterinnen und Vertretern der kooperierenden Gemeinden sowie des Landes konnte man konkrete Anforderungen sammeln und diskutieren. Aus Gesprächen vor Ort und der Analyse wurden schließlich Thesen und Handlungserfordernisse formuliert, die man im Rahmen der Stadtregionskonferenz vertiefte, bevor sie zu Leitbildentwürfen weiterentwickelt wurden. Ergänzt um konkrete Maßnahmenvorschläge und Empfehlungen von Umsetzungsprojekten fügen sich alle Bausteine zum ganzheitlichen Ergebnis der Stadtegionalen Strategie für die Stadtregion Wels zusammen.
Abb.5: Prozessdiagramm, eigene Darstellung
PHASEN INHALT DIALOG PRODUKTE METHODEN/FORMATE
Erfassen der relevanten Informationen – Screening
Analyse der räumlichen und sozioökonomischen Grundlagen
Regionales Strukturmodell der maßgeblichen Raumstruktur und der funktionalen Gliederung
Kooperationsanalyse
SWOT-Analyse
Ableiten konkreter Handlungserfordernisse für die räuml. Entwicklung
Ableiten konkreter Handlungserfordernisse für die Nahmobilität
KernteamSitzung
Stadtregionales Forum
KernteamSitzung
Screening
Gespräche vor Ort
Expeditionsvorbereitung
Expedition in die Stadtregion und Lange Tafel der Stadtregion
Stadtregionskonferenz mit Forum und Fokusgruppen
Erstellen genereller Zielsetzungen
Erstellung eines räuml. Leitbildes
Erstellung eines räuml. Leitbildes Nahmobilität und Radhauptrouten
KernteamSitzung
Workshops
Umsetzungsstratien und -projekte
Stadtregionales Forum
Umsetzungsstrategie mit Prioritätenliste
Umsetzungsprojekte konzipieren
KernteamSitzung
Stadtregionales Forum
Abschlussforum mit Langer Tafel der Stadtregion
Strategieplan Stadtregion Wels
Atlas der Stadtregion & Thesenpapier
Projektzeitung 1
Handlungskatalog
Leitbild
Umsetzungsprojekte
Projektzeitung 2




Abb. 5 – 7 (linke Seite): Expedition in der Stadtregion mit allen BürgermeisterInnen der Kooperationsgemeinden und VertreterInnen der Gemeindeverwaltung.
Fotos: Katharina Acht
Abb. 8 (rechte Seite): Lange Tafel der Stadtregion zum Auftakt des Planungsprozesses. Foto: Katharina Acht
Abb.6: Abb.7: Abb.8: Abb.9:


Die ausführliche Raum- und Strukturanalyse findet sich in der Beilage „Atlas der Stadtregion Wels“. An dieser Stelle sind die wesentlichen Punkte zusammengefasst.
Die Lage der Stadtregion
Die Gemeinden Wels, Buchkirchen, Gunskirchen, Holzhausen, Krenglbach, Schleißheim, Steinhaus, Thalheim bei Wels, Weißkirchen an der Traun bilden mit gemeinsam mehr als 86.000 EinwohnerInnen den gemeinsamen Planungsraum der Stadtregion Wels. Gemessen am Bruttoregionalprodukt pro Kopf ist diese Region im oberösterreichischen Zentralraum die wirtschaftlich stärkste Region Österreichs. Diese zentrale Lage, die gute Erreichbarkeit regionaler wie überregionaler Märkte und die Verfügbarkeit von entsprechend qualifizierten Arbeitskräften tragen maßgeblich zu dieser Wirtschaftsentwicklung bei.
Bevölkerungsentwicklung bis 2017
Die Bevölkerungsentwicklung ist der wichtigste Indikator zur Darstellung der Dynamik einer Stadtregion und ist vom natürlichen Bevölkerungswachstum und von der Migration abhängig. Der primäre Motor für das Bevölkerungswachstum in allen prosperierenden Stadtregionen ist die (Im-)Migration. Neben der Betrachtung der gesamten Stadtregion wird der Fokus hier aber auf Veränderungen innerhalb der Stadtregion gelegt.
In der Stadtregion konzentrierte sich das langfristige Wachstum zwischen 1951 und 2017 primär auf die Kernstadt Wels. Die gesamte Stadtregion wuchs in diesem Zeitraum von rund 53.000 auf knapp 88.000 EinwohnerInnen an, wobei rund 22.700 EinwohnerInnen auf die Stadt Wels entfallen und mit 12.300 mehr als ein Drittel des gesamten Wachstums auf die acht Umlandgemeinden. Das stärkste prozentuelle Wachstum verzeichneten dabei die Gemeinden Krenglbach und Weißkirchen an der Traun, die ihre Bevölkerungszahl beide mehr als verdoppeln konnten.
Stadtregion Wels
Abb.11: Die Lage der Stadtregion Wels in Oberösterreich, eigene Darstellung
Andere Gemeinden, wie etwa Holzhausen oder Steinhaus, hatten bis in die 1980er Jahre hingegen mit Bevölkerungsrückgang zu kämpfen, sind seit diesem Zeitraum aber auch auf einem stabilen Wachstumskurs.1
Bevölkerungsprognose bis 2040 Wie in allen österreichischen Kernräumen wird auch der Stadtregion Wels in Zukunft ein Bevölkerungswachstum prognostiziert. Für die Darstellung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung wird die Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich verwendet, wobei zum Vergleich auch der Bevölkerungsstand von 2001, 2011 und 2017 für das Gebiet der Stadtregion abgebildet wird.
Bei Verwendung dieser Datenbasis kann für die Stadtregion ein Bevölkerungstand von 92.400 Personen im Jahr 2030 prognostiziert werden. Dieses Wachstum von etwa 5.500 Personen entspricht in etwa den kumulierten Zielen der Gemeinden der Stadtregion, die alle ein moderates Wachstum anstreben.
1 Ausführliche Untersuchungen zur Bevölkerungsentwicklung in der Stadtregion Wels und allen neun Kooperationsgemeinden finden sich im Atlas der Stadtregion Wels.
2 Ausführliche Untersuchungen zur Bevölkerungsprognose und Wanderungsbilanz finden sich im Atlas der Stadtregion Wels.
3 ÖEK 2015 Motivenbericht, Stadt Wels, Februar 2015
Bis 2040 wird die Stadtregion dann noch um weitere 2.500 Personen anwachsen und einen Bevölkerungsstand von knapp 95.000 Personen erreichen. Gemäß der Bevölkerungsprognose des Landes Oberösterreich wird sich das Wachstum in den Gemeinden entlang der Westbahnstrecke konzentrieren, was primär die Stadt Wels sowie Gunskirchen betreffen würde. Allerdings müssen Prognosen für kleine Einheiten (wie etwa die Umland-Gemeinden der Stadtregion) immer mit Vorsicht genossen werden, da diese bereits mit einem einzigen größeren Bauvorhaben in den jeweiligen Gemeinden übertroffen werden könnten. Außerdem wird anhand der aktuellen Entwicklung der Altersstruktur ersichtlich, dass sich ein qualitativer Wandel der Altersstruktur vollzieht, wodurch vor allem die Altersgruppen über 65 Jahren zunehmen werden.2
Wohnbauentwicklung und Baulandbedarf
Der künftige Bedarf an neuen Wohnungen wird im Motivenbericht des ÖEK 2015 für Wels3 mit einer jährlichen Wohnbauleistung von etwa 220 Wohneinheiten bis zum Jahr 2025 angegeben. Nimmt man dies als Richtwert für den in der stadtregionalen Strategie zugrunde gelegten Betrachtungszeitraum bis 2030, so ergibt sich für den Zeitraum von 2019 bis 2030 eine erforderliche Wohnbauleistung von gut 2.400 Wohneinheiten in der Stadt Wels.
man für Wels die Richtwerte der bisherigen Flächeninanspruchnahme an, so bedeutet dies einen zusätzlichen Bedarf von etwa 8590 ha Bauland. In den Umlandgemeinden dominieren weniger dichte Bauformen, sollte dies auch der künftige Trend sein, würden bei reiner Einfamilienhausbebauung (auf kleinen Grundstücken mit angenommenen 550 m2 Fläche) gut 23 ha Bauland benötigt werden, um den zusätzlichen Wohnraumbedarf zu decken. Geht man von einer Reihenhausbebauung mit entsprechend kleineren Grundstücken aus (350 m2), so würde sich der Bedarf bereits auf gut 14 ha reduzieren.
4 Integrationsleitbild des Landes Oberösterreich, Juni 2018. Im Internet: www. land-oberoesterreich.gv.at/ Mediendateien/LK/Integrationsleitbild.pdf
Geht man von einer geringeren durchschnittlichen Haushaltsgröße in der Kernstadt Wels aus (1,9 Personen pro Haushalt, statt 2,2 Personen wie im Jahr 2015), so würde man mit der angegebenen Wohnbauleistung Wohnraum für 4.500 neue Einwohnerinnen und Einwohner schaffen. Um das in der Prognose bis 2030 errechnete Gesamtwachstum von 5.500 Personen zu bewältigen, müsste in den Umlandgemeinden bis dahin Wohnraum für gut 1.000 Menschen geschaffen werden. Je nach Bebauungstyp und Dichte unterscheidet sich der dadurch entstehende Flächenbedarf. Legt
Die Herausforderung wird darin liegen, die notwendigen Neubauleistungen nicht nur auf neu gewidmeten Flächen zu realisieren, sondern zu großen Teilen auf bereits gewidmeten und möglicherweise bislang nur schwer verfügbaren Baulandreserven und durch geeignete Nachverdichtungsmaßnahmen oder Nachnutzungskonzepte. Auch was Dichte, Bauformen und die Mischung von Bautypologien anbelangt, wird es notwendig sein, das richtige Maß aus mittelstädtischer Dichte in Wels auf der einen Seite und dichteren Bauformen weg vom freistehenden Einfamilienhaus auf der anderen Seite in den Umlandgemeinden zu finden. Neben städtebaulichen und ökologischen Ansprüchen ist dabei auch auf eine ausgewogene sozioökonomische Mischung zu achten und Segregationstendenzen entgegenzuwirken, wie es z.B. auch im OÖ Integrationsleitbild gefordert wird.4
Wirtschaftsentwicklung und Baulandbedarf für gewerbliche Nutzungen
Im Gegensatz zur Bevölkerungsentwicklung ist die Entwicklung der Wirtschaft nur sehr schwer zu prognostizieren und damit auch der Baulandbedarf nur bedingt einzuschätzen. Für die Stadt Wels wurde im Jahr 2015 ein Flächengesamtbedarf von 120 ha ermittelt5, Für den Wirtschaftspark Voralpenland wurden davon 92,5 ha nominiert. Im Zuge der Analyse im Rahmen der stadtregionalen Strategie wurde ein theoretisches „Angebot“ an Flächen von ca. 235 ha bis 245 ha ermittelt (variierend je nach Diskussionsstand). Damit wäre der vor einigen Jahren ermittelte Bedarf mehr als gedeckt, es ist aber zu bedenken, dass es sich dabei um Flächen handelt, die kurzfristig oft gar nicht und mittel- bis langfristig nur sehr schwer oder zu nicht realistischen Preisvorstellungen verfügbar sind.
Somit liegt die größte Herausforderung bei der Aktivierung der für eine zielgerichtete Entwicklung des Wirtschaftsparks notwendigen Flächen. Darüber hinaus sind Fragen der verkehrlichen Erschließung der Hauptstandorte zu berücksichtigen und zu klären, ggf. notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen für bestimmte Teilbereiche zu bedenken und Interessensabwägungen mit anderen Funktionsansprüchen zu erwirken.
Freiraum, Landschaft, Natuschutz
Die Stadtregion Wels ist geprägt durch unterschiedliche Freiraum- und Landschaftstypen, die den vielfältigen Charakter der regionalen Stadtlandschaft ausmachen: Durchzogen vom Trauntal liegt im Norden das Inn- und Hausruckviertler Hügelland (in weiterer Folge wird in diesem Bericht vom Welser Hügelland gesprochen) und südlich der Traun das Traun-Enns-Riedelland (oder Traun-EnnsPlatte)6.Von beiden Seiten fällt die Topografie zum Trauntal hin ab – im Norden wird hier von der „Welser Kante“ gesprochen, im Süden
bildet die Traunleiten die Geländestufe zum rechten Traunufer.
Der Schutz der Natur und der Umwelt ist sowohl im oberösterreichischen Raumordnungsgesetz unter den Zielen der Raumordnung in §2 Abs. 1 festgehalten, wo auf den umfassenden Schutz der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen sowie die Sicherung oder Wiederherstellung eines ausgewogenen Naturhaushaltes hingewiesen wird, als auch im oberösterreichischen Naturschutzgesetz verankert.
Seit 2001 existiert im oberösterreichischen Naturschutzgesetz die Kategorie der Europaschutzgebiete, die auf der Vogelschutzrichtlinie und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) der Europäischen Union basiert. Maßnahmen, die den Schutzzweck dieser Gebiete beeinträchtigen, brauchen demnach eine Bewilligung der Landesregierung. Sind prioritäre Lebensraumtypen oder Arten von potentiellen Maßnahmen betroffen, muss außerdem eine Stellungnahme der Europäischen Union eingeholt werden.
In der Stadtregion Wels sind zwei Europaschutzgebiete ausgewiesen: die Untere Traun im Gemeindegebiet von Gunskirchen, Wels und Steinhaus sowie die Welser Heide. Beide Gebiete sind aufgrund der für die Zugvögel (z.B. Rohrdommel, Silberreiher) aber auch für heimische Vögel wichtigen Lebensräume unter Schutz gestellt. Die Welser Heide nimmt diesbezüglich mit ihren Magerwiesen eine wichtige Biotopfunktion ein.
Für die Erholungs- und Freizeitnutzung bedeutet dies, langfristig die Lebensqualität der Stadtregion zu erhalten, die Erholungsnutzungen in und Zugänglichkeiten von Landschaftsräumen zu verbessern und in besonders sensiblen und geschützten Gebieten eine entsprechende Nutzerlenkung zu erzielen.
5 vgl. ÖEK 2015 Motivenbericht, Stadt Wels, Februar 2015
6 vgl. OÖ. Raumeinheiten, Stand: September 2007
7 vgl. Land OÖ: Oberösterreichische Verkehrserhebung
Mobilitätsentwicklung
Die Stadtregion Wels ist mit erheblichen mobilitätspolitischen Herausforderungen konfrontiert, die durch die Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Wohnbevölkerung, aber auch durch das dynamische Wachstum der Wohnbevölkerung und der Arbeitsplätze vor allem in den Umlandgebieten der Kernstadt Wels verursacht werden.
Folgende Aspekte prägen die bisherige Mobilitätsentwicklung der Stadtregion:
• Starke Zunahme des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf Kosten vor allem des Fußgänger- und Radverkehrs: der MIV-Anteil an alle Wegen der Wohnbevölkerung nahm von 1992 bis 2012 von 55% auf 67% zu7
• Nahmobilität: starke Anteilsverluste von Fußgänger- und Radverkehr von 32% auf 23% an allen Wegen
• Öffentlicher Verkehr: stabil mit leichtem Anteilsverlust von 11% auf 9% aller Wege
• Starke Zuwächse bei der Motorisierung
• Starke Zuwächse des Quell- und Zielverkehrs der Stadtregion (von 40% auf 49% aller Wege), Rückgang des Gemeindebinnenverkehrs (von 50% auf 41% aller Wege), längere Wege erhöhen die Wahrscheinlichkeit der MIV-Nutzung
• Aber: Hoher Anteil an MIV-Binnenwegen bietet Chance für Rückgewinnung für den Radverkehr. 33% aller Wege mit dem MIV sind Gemeindebinnenwege, weitere 11% sind Binnenwege innerhalb der Stadtregion.
Die künftige Entwicklung ist von einem weiteren Bevölkerungswachstum in der Stadtregion geprägt:
• Bei einer unveränderten Verkehrsmittelwahl nehmen die MIV-Wege, aber auch die Wege im Umweltverbund (zu Fuß, Rad, ÖV, Mischverkehr) bis 2030 jeweils um ca. 13 % zu. Das entspricht dem Bevölkerungswachstum 2012 – 2030 (Annahme:
die durchschnittliche Wegezahl / Person bleibt konstant).
• Soll die Zahl der Pkw-Wege nicht weiter steigen, muss der Anteil der MIV-Wege von 67 % auf 59 % sinken, die Zahl der Wege mit dem Umweltverbund müsste etwa um 38 % (+29.000 Wege / Tag) zunehmen.
• Soll die Zahl der Pkw-Wege um 10 % sinken (-15.000 Wege), muss der Anteil der MIV-Wege von heute 67 % auf 53 % (weniger als 1992) sinken. Die Zahl der Wege mit dem Umweltverbund würde um fast 60 % zu nehmen (+44.000 Wege).
Vor dem Hintergrund der klima- und umweltpolitischen Ziele und Verpflichtungen sowie der begrenzten Kapazitäten des Straßenetzes ist eine zentrale Herausforderung sowohl die Kapazitäten als auch die Qualitäten für die Verkehrsarten der Nahmobilität (öffentlicher Lokalverkehr, Radverkehr, Fußgängerverkehr, kombinierter Verkehr) auszubauen.
Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehrserschließung als zentrale Herausforderung – ÖV-Güteklassen als neues Planungsinstrument für eine Abstimmung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung
Der Anteil des öffentlichen Verkehrs mit weniger als 10% an allen Wegen ist für eine Stadtregion relativ niedrig. Ein Schlüssel für eine Erhöhung des Nachfragepotenzials für den öffentlichen Verkehr ist eine bessere Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und ÖV-Verkehrserschließung. Nur wenn die gut bedienten Haltestellen des öffentlichen Verkehrs von möglichst vielen BewohnerInnen gut erreichbar sind bzw. wenn in Siedlungsgebieten mit hohem Nachfragepotenzial eine gute ÖV-Verkehrsbedienung angeboten wird, kann der Anteil des öffentlichen Vekehrs erhöht werden. Da in den nächsten Jahren in der Stadtregion eine dynamische Siedlungsentwicklung erwartet wird, geht es darum, diese möglichst gut mit der öffentlichen Verkehrserschließung abzustimmen.
Im Jahr 2015 hat die österreichische Landesverkehrsreferenten-Konferenz die Schaffung einer österreichweiten Grundlage zur besseren Abstimmung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung beschlossen. Seither wurden sogenannte ÖV-Güteklassen entwickelt, die als Analyse-, Planungs-, und Evaluierungsinstrument für die Raumordnung und ÖV-Planung dienen sollen. Die Güteklassen können unter anderem für die Information über ÖV-Erschließungsqualitäten in den Gemeinden, zur Optimierung von Wegenetzen, für die Feststellung von Nutzungsreserven zur Erhöhung der Nachfrage im ÖV, zur Koppelung der Güteklassen mit der Höhe von Infrastrukturabgaben zur Baulandmobilisierung oder auch zur Koppelung der ÖV-Güteklassen zur Anpassung der Stellplatzverpflichtungen an die ÖV-Erschließungsqualität eingesetzt werden.
Für ÖV-Haltestellen wurden – je nach Verkehrsmittel und Intervall – Kategorien festgelegt. Je nach räumlicher Zuordnung zu städtischen oder ländlichen Räumen gibt es unterschiedliche Güteklassen von A bis G. Für die Stadtregion Wels sind aufgrund der städtischen und ländlichen Struktur alle Güteklassen relevant. Die ÖV-Güteklassen für Siedlungsgebiete/EinwohnerInnen ergeben sich aus der räumlichen Zuordnung und der tatsächlichen Fußwegedistanz zur Haltestelle. Der öffentliche Verkehr kann in den Güteklassen A bis C/teilweise D als realistische Alternative zum PKW gesehen werden. Die Güteklassen E bis G bilden eine Grundversorgung für jene Bevölkerungsgruppen ab, die über keinen PKW als Alternative verfügen. Bei der Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zeigt sich, dass etwa die Hälfte der BewohnerInnen der Stadtregion in den ÖV-Güteklassen A bis C leben, also eine vergleichsweise gute städtische ÖV-Erschließung aufweisen. Etwa ein Viertel der BewohnerInnen ist zwar mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, hat aber wenig attraktive Intervalle. Ein weiteres Viertel wird unattraktiv oder gar nicht mit ÖV bedient. Diese Ausgangslage erklärt auch den relativ niedrigen Anteil der ÖV-Wege an allen Wegen in der Stadtregion. Die ÖV-Güteklassen sollten für die künftige Siedlungsentwicklung als Planungshilfe herangezogen werden. Neue Siedlungen und Betriebsgebiete oder Verdichtungen sollten dort erfolgen, wo ÖV-Güteklassen A bis C/D vorhanden sind oder hergestellt werden können. Haltestellenbereiche mit einer sehr guten ÖV-Bedienung, aber einer geringen Siedlungsdichte sollten hinsichtsichtlich Verdichtungsmöglichkeiten geprüft werden. In Gebieten mit hohem Nachfragepotenzial (EW, Apl) aber ungünstiger ÖV-Erschließung, sollte eine Verbesserung des ÖV-Angebotes überlegt werden.
irchen
ÖV-Güteklassen und Haltestellen-Kategorien in der Stadtregion Wels
ÖV-Güteklassen und Haltestellen-Kategorien in der Stadtregion Wels
ÖV-Güteklassen und Haltestellen-Kategorien in der Stadtregion Wels
Holzhausen
Schleißheim
bei Wels
Krenglbach
Weißkirchen an der Traun
Buchkirchen
Holzhausen
Krenglbach
Krenglbach
Schleißheim
Gunskirchen
Gunskirchen
Buchkirchen
Gunskirchen Buchkirchen
Thalheim bei Wels
Steinhaus
1001-1250m 0 10 Km 5 2,5
Güteklasse D
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse G
Haltestellenkategorie
Güteklasse G
Gemeindegrenzen
Quellen: Österreichweite ÖV-Güteklassen, ÖREK Partnerschaft (2017) Stichtag ÖV-Angebot: 11. Mai 2016 (Schul- und Werktag) Kartengrundlage: Basemap.at Darstellung: Rosinak und Partner, Vincent Linsmeier Haltestellen ohne Hst.-Kategorie
Weißkirchen an der Traun
Schleißheim
Thalheim bei Wels
Thalheim bei Wels Sch
Steinhaus
Steinhaus
Haltestellenkategorie
Distanz zur Haltestelle
m <=300 m
Güteklasse A Güteklasse A
Güteklasse A
Güteklasse B
Güteklasse C
Güteklasse D
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse G
Güteklasse B
Güteklasse C
Güteklasse D
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse G
Güteklasse G
m
Güteklasse B
Güteklasse C
Güteklasse D
Haltestellenkategorie I II III IV V
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse G
Güteklasse G
m
Güteklasse C
Güteklasse D
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse G
Distanz zur Haltestelle
751-1000 m 301-500
Güteklasse A Güteklasse A
Güteklasse A Güteklasse A
Güteklasse A
Güteklasse A
Güteklasse D
Güteklasse B
Güteklasse B
Güteklasse B
Güteklasse C
Güteklasse E
Güteklasse C
Güteklasse C
Güteklasse D
Güteklasse F
Güteklasse B
Güteklasse B Güteklasse C
Güteklasse D
Güteklasse D
Güteklasse E
Güteklasse G
Güteklasse B
Güteklasse C
m
Güteklasse C
Güteklasse C
Güteklasse D
Güteklasse D
Güteklasse E
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse G
Güteklasse G
Güteklasse C
Güteklasse D
Güteklasse D
Güteklasse E
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse F Güteklasse G
Güteklasse D
Güteklasse D
Güteklasse E
Gemeindegrenzen
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse F
Güteklasse G
Güteklasse D
Güteklasse E
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse E
Güteklasse F
Güteklasse F
Güteklasse F
Güteklasse G
Güteklasse G
Quellen:
Güteklasse F
Güteklasse G
Güteklasse G
Güteklasse G
Güteklasse G
Güteklasse G
Güteklasse G
Güteklasse G
Güteklasse G
Haltestellen ohne Hst.-Kategorie
Güteklasse G
Güteklasse G
Quellen: Österreichweite ÖV-Güteklassen, ÖREK Partnerschaft (2017) Stichtag ÖV-Angebot: 11. Mai 2016 (Schul- und Werktag)
Güteklasse G
Kartengrundlage: Basemap.at
Darstellung: Rosinak und Partner, Vincent Linsmeier
Die Stadtregion Wels ist räumlich und strukturell so heterogen, dass diesem komplexen Gefüge nur eine in sich differenzierte Entwicklungsstrategie Rechnung tragen kann.
Die zukünftige Entwicklung wird von gemäßigtem Wachstum gekennzeichnet sein. Es muss im Leitbild also nicht ausschließlich um Wachstumsmanagement, sondern um die sozioökonomische, räumlich-strukturelle und funktionale Qualifizierung der Stadtregion Wels gehen.
Die Stadtregion Wels wird durch vier Raumtypen wesentlich geprägt:
Raumtyp 1: Wels, die kleine Großstadt Betrachtet man die städtebaulichen Gegebenheiten, den Bevölkerungsmix oder den Stellenwert als Verkehrsknotenpunkt und wirtschaftliches Zentrum, so finden sich in Wels Strukturen, aufgrund derer man berechtigt von der „kleinen Großstadt“ sprechen kann.
Raumtyp 2: „Die unmittelbaren Nachbarn“ Gunskirchen, Marchtrenk und Thalheim schließen mit ihren Siedlungsflächen direkt an das Welser Stadtgebiet an; die Grenzen sind fließend bzw. mancherorts kaum erlebbar; sie sind weder im Alltag der Menschen noch im funktionalen Netzwerk generell relevant. Gerade das macht die gemeinsame Siedlungs- und Standortentwicklungsstrategie erforderlich.
Raumtyp 3: „Die Inseln in der Landschaft“ Krenglbach, Buchkirchen und Holzhausen liegen als „Siedlungskranz“ im Norden von Wels; sie sind von einem markanten Landschaftsraum umschlossen, ihre Siedlungsstrukturen sind vielerorts noch richtig dörflich und in sich stimmig. Hier sind es vor allem die Verbindungen untereinander und nach Wels, die es zu qualifizieren gilt. Kompakte Siedlungsentwicklung, klar definierte und gestaltete Freiraumränder tragen dazu bei, innerhalb des stadtregionalen Gefüges den eigenständigen Charakter noch klarer zu definieren und in Szene zu setzen.
Raumtyp 4: „die Siedlungsbänder“
Schleißheim, Weißkirchen und Steinhaus: die räumliche Entwicklung erfolgte überwiegend entlang von Verkehrskorridoren; deshalb ist hier eine besonders enge Abstimmung zwischen Verkehrskonzeption und Siedlungsentwicklung notwendig. Klar definierte Freiraumränder und Siedlungskanten übernehmen hier eine wichtige ordnende Funktion.
Die heterogenen Raumstrukturen müssen miteinander vernetzt und in Beziehung zueinander gesetzt werden. Hier bieten die prägenden Landschaftsräume einen zentralen Ansatzpunkt, um strukturell, vor allem aber auch atmosphärisch zu integrieren und ein gemeinsames Bild der Stadtregion entstehen zu lassen, das über ein intelligentes System von Alltags- und Freizeitwegen für die Menschen in der Stadtregion auf vielfältige Art und Weise nutz- und erlebbar wird.
Abb.12: Die vier Raumtypen der Stadtregion Wels, eigene Darstellung
DIE UNMITTELBAREN NACHBARN
DIE SIEDLUNGSBÄNDER
DIE UNMITTELBAREN NACHBARN
DIE UNMITTELBAREN NACHBARN
DIE SIEDLUNGSBÄNDER


LANDSCHAFT
Stärken
• Attraktive Landschaftsräume (Welser Hügelland und Unteres Trauntal) mit hohem Naherholungswert
• Intakte Landschaftsräume mit wichtigen Funktionen für Ökologie und Naturschutz
• Freiraumrahmenplan Wels zur langfristigen, strategischen Entwicklung und Qualifizierung von Grün- und Freiräumen in der Stadt Wels
• Funktionsfähige Landwirtschaft und Versorgung mit regionalen Produkten
Schwächen
• Zerschneidung zusammenhängender Landschaftsräume durch insuläre Flächenwidmungen
• Teilweise schlechte Anbindung an Naherholungsgebiete
• hoher Verwertungsdruck auf Bauland
Chancen
• Hohe raumgliedernde Funktion der stadtregionalen Landschaftsräume
• Ausbau der Freizeit- und Naherholungsnutzungen in den hochwertigen Landschaftsräumen
• Grünräume der Umlandgemeinden an Welser Freiraumnetz anknüpfen
Risiken
• Zerschneidung von zusammenhängenden Landschaftsräumen aufgrund von erhöhten Flächenansprüchen durch Siedlung, Gewerbe und Verkehrsinfrastruktur
• Konflikt zwischen Naturschutz und Naherholungsfunktion (v.a. im Unteren Trauntal)
Stärken
• Kompakte Siedlungsstrukturen trotz Wachstumsdynamik
• Umsetzung von großen innerstädtischen Entwicklungsprojekten in Wels
• Weitgehend intakte Ortsstrukturen in den Gemeinden der Stadtregion
• große Vielfalt an unterschiedlichen Wohn- und Siedlungsmodellen innerhalb der Stadtregion
• lokale Vorbilder für Wohnbau in angemessenen Dichten und hoher Qualität
Schwächen
• teils undifferenziertes Nebeneinander von konkurrierenden Nutzungen (Wohnen und Gewerbe)
• stark verkehrsbelastete Stadteinfahrten mit geringer städtebaulicher Qualität
• großer Anteil an nicht mobilisierbarem Bauland
• Überhang freistehender Einfamilienhäuser
Chancen
• Hohe Innenentwicklungspotenziale in der gesamten Stadtregion
• Aufgrund klarer Bekenntnisse zur Innenentwicklung gute Chancen auf Umsetzung von baulandaktivierenden Strategien und Maßnahmen
Risiken
• Konflikt zwischen Siedlungsentwicklung und der Erlebbarkeit hochwertiger Landschaftsräume (z.B. Bachläufe in Schafwiese, Vogelweide, Neustadt, Lichtenegg)
• Undifferenziertes und ungesteuertes Zusammenwachsen der Siedlungsflächen entlang der B1 und der L563
• Steigende Grundstückspreise erschweren die Gewährleistung qualitätsvoller Siedlungen und leistbaren Wohnens
• Überalterung in homogen strukturierten Siedlungsbereichen
Stärken
• Sehr wirtschafts- und innovationsfreundliches Klima
• Standort von international bedeutenden Top-Unternehmen
• Sehr gute überregionale Erreichbarkeit
• Kooperation im Rahmen des Wirtschaftsparks Voralpenland
• Hochwertige Forschungs- und Bildungseinrichtungen vorhanden
• Sehr starke Verfügbarkeit an Breitband
Schwächen
• Bandartige Entwicklung von Betriebsgebieten bei geringem Anspruch an Gestaltung und funktionalem Zusammenwirken mit Umgebungsräumen
• Fehlende Flächenverfügbarkeit für Umsetzung von beträchtlichen Teilen des Wirtschaftsparks Voralpenland
• Teilweise mangelnde Nahversorgung in den Umlandgemeinden
Chancen
• Agglomerationseffekte in zukunftsfähigen Branchen erzielbar
• Versorgungsfunktionen für das Hinterland (außerhalb der Stadtregion) können durch Ausbau dezentraler Standorte (bspw. in Buchkirchen, Weißkirchen an der Traun) gestärkt werden
• Städtebauliche und funktionale Aufwertung bestehender Wirtschaftsstandorte
• Ausbau von Messe- und Kongresstourismus
Risiken
• Gehemmte Entwicklung durch ungenügende Verfügbarkeiten neuer Flächen für Betriebsgebiete
• Rückgang des kleinteiligen Einzelhandels in innerstädtischen Lagen
Stärken
• Sehr gute Erreichbarkeit im hochrangigen Schienennetz: Westbahn, Westbahn-Passauer Ast, Logistikzentrum Wels
• Sehr gute Erreichbarkeit im hochrangigen Straßennetz: A 8, A 9
• Ausgebaute Radverkehrsnetze in der Stadt Wels und in Gunskirchen
• Überregionales Landesradwegenetz
• Vergleichsweise hoher Radverkehrsanteil in der Stadt Wels
Schwächen
• Veränderung der Verkehrsmittelwahl zugunsten des MIV (von 55% im Jahr 1992 auf 67% im Jahr 2012) auf Kosten der umweltfreundlichen Verkehrsarten (ÖV, Rad, Gehen)
• Qualität der Radverkehrsanlagen: Breite, Radfahren im Mischverkehr auf Gehsteigen, Bike&Ride am Bahnhof Wels
• Große Lücken im stadtgrenzenüberschreitenden regionalen Radwegenetz
• Fehlendes einheitliches und lückenhaftes Orientierungssystem im regionalen Radroutennetz
• Hoher Anteil an FußgängerInnen und RadfahrerInnen an den im Straßenverkehr verunglückten Personen (25% im Zeitraum 2014-2016)
• Hohe Verkehrsbelastung aufgrund des Durchzugsverkehrs in kleineren Gemeinden
Chancen
• Allgemeine Veränderung des Bewusstseins zugunsten umwelt- und klimaschonender Verkehrsmittel vor allem in städtischen Regionen
• Stärkeres Gesundheitsbewusstsein und Trendwende zugunsten aktiver Mobilität
• Technologiesprung durch das E-Bike: längere Wege, größere Steigungen werden bewältigbar, mehr Komfort auch für ältere Personen
• Marktanteil der E-Bikes steigt stark an
• Klimastrategie der Bundesregierung forciert Radfahren und öffentlichen
Verkehr: der Radverkehrsanteil an allen Wegen in Österreich soll bis 2030 verdoppelt werden
• Ein hoher Anteil der MIV-Wege (30% in der Stadtregion, 40% in der Stadt Wels) werden im Gemeindebinnenverkehr zurückgelegt und stellen ein Potenzial für den Radverkehr dar.
Risiken
• Zunahme gemeindeübergreifender Pendlerbeziehungen mit längeren Wegen und damit steigender Abhängigkeit vom PKW
• Weiter steigende Motorisierung
Stärken
• Große Vetrauensbasis unter den Gemeinden (drückt sich z.B. durch nominierten Bürgermeistersprecher für Welser Umlandgemeinden aus)
• Kooperation im Rahmen des Wirtschaftsparks Voralpenland
• Kooperationswille im Rahmen des Projekts zur Stadtregionalen Strategie deutlich erkennbar
Schwächen
• Teilweise Wettbewerb zwischen den Gemeinden um Firmenansiedlung
Chancen
• Verstetigung des Stadtregionalen Forums als Plattform für langfristigen Austausch und Kooperation
• Erweiterung um funktional und räumlich mit der Stadtregion Wels verbundene Gemeinden
• Bestehende Kooperationen können institutionalisiert werden und bestehende Strukturen gebündelt und professionalisiert werden (z.B. Stadtregionale Entwicklungsagentur)
• Durch Kooperation und Abstimmung wird gemeinsames Auftreten nach außen (z.B. gegenüber dem Land und anderen Institutionen) schlagkräftiger
Risiken
• Drohende Kooperationsmüdigkeit bei fehlender Institutionalisierung , gleichzeitiger Parallelität und klarer Aufgabenzuschreibung
• Mangelnde Transparenz und Vertrauenseinbußen bei Kooperation „hinter verschlossenen Türen“
• Bei zu wenig Institutionalisierung und klarer Aufgabenzuschreibung droht Kooperationsmüdigkeit
• Kooperation „hinter verschlossenen Türen“ führt zu mangelnder Transparenz und Vertrauenseinbußen
Die Kooperationskultur ist innerhalb der Stadtregion Wels gut ausgeprägt, sowohl auf Ebene informeller Zusammenarbeit im Bereich der regionalen Konzept- und Strategieentwicklung als auch auf Ebene der zweckorientierten Zusammenarbeit. Die Kooperationsverflechtungen innerhalb der Stadtregion sind zum Teil relativ stark ausgeprägt, je nach Themenfeld bzw. Bedarf handelt es sich dabei um bilaterale Zusammenarbeit oder um die Beteiligung (fast) aller; darüber hinaus haben sich einige Kooperationsbeziehungen mit Gemeinden außerhalb der Stadtregion Wels etabliert.
Das Stadtregionale Forum ist dabei der jüngste Zusammenschluss und zugleich ein Beleg für die verlässliche Vertrauens- und Kooperationsbasis innerhalb der Stadtregion Wels. Dies zeigt sich nicht nur immer wieder am konstruktiven Klima bei den gemeinsamen Treffen, sondern auch daran, dass die Gemeinden einen Repräsentanten bestimmt haben, der sie vertritt.
In einer heterogen strukturierten Stadtregion sind Grad und Bereitschaft zur interkommunalen Kooperation erwartungsgemäß unterschiedlich stark ausgeprägt. Nicht jede Gemeinde sieht aus der spezifischen kommunalen Perspektive heraus in manchen existierenden oder denkbaren Kooperationsmöglichkeiten Sinn und beteiligt sich deshalb weniger aktiv bzw. nicht daran. Wichtig ist aber die Erkenntnis, dass es innerhalb der Stadtregion Wels keine Gemeinde gibt, die eine grundlegend ablehnende Haltung gegenüber interkommunaler Kooperation hätte; auch wenn es in Einzelfällen (noch) keine Beteiligung an aus externer fachlicher Sicht sehr wichtigen Kooperationsprojekten wie dem Wirtschaftspark Voralpenland gibt, scheint überall Gesprächsund Verhandlungsbereitschaft zu existieren.
Im Bereich Regionalentwicklung ist die LEADER-Region Wels-Land (LEWEL) seit einiger Zeit erfolgreich aktiv und hat wichtige Schritte für die Bewusstseinsbildung hin zu einer die Gemeindegrenze übergreifenden Entwick-
lungsperspektive geleistet. Darauf aufbauend hat der Regionalverein Forum Wels-Eferding mit der Erarbeitung der Regionalen Themenszenarien auch inhaltlich eine Stoßrichtung vorgeben können, die für die weitere regionale Strategie- und Leitbildentwicklung wichtig ist. Aus diesem Grund kann die Arbeit an dieser stadtregionalen Strategie auf einer umfangreichen „Vorbildung“ in den beteiligten Gemeinden aufbauen.
Auf Ebene der zweckorientierten Zusammenarbeit existiert eine Vielzahl an Verbänden, in der sich Wels und die Gemeinden in verschiedenen Konstellationen (auch über die Gemeinden der Stadtregion Wels hinaus) zusammengeschlossen haben. Die existierenden Reinhaltungs-, Bezirksabfall-, Abwasser-, Wegeerhaltungs-, Bauhof-, Sozialhilfe- und Standesamtsverbände sind Belege für die stark ausgeprägte interkommunale Aufgabenteilung und Vernetzung. Im Bildungs-, Betreuungs- und Kulturbereich bestehen ebenfalls bilaterale Kooperationen, an denen Gemeinden der Stadtregion beteiligt sind, z.T. innerhalb der Stadtregion oder aber auch darüber hinaus. Auch auf administrativer Ebene sind der gemeinsame Winterdienst (Brückendienst, gemeinsamer Einkauf, ein gemeinsames Salzlager in Wels etc.) und die Übernahme von verwaltungstechnischen Tätigkeiten durch die in Bezug auf Personal und Know-How besser ausgestattete Gemeinde zu nennen (Gunskirchen übernimmt Bauamt/Personalverrechnung für kleinere Gemeinden, die nicht Teil der Stadtregion sind).
Das INKOBA-Projekt Wirtschaftspark Voralpenland ist in diesem Kontext zweifellos das zentrale Kooperationsprojekt für die Gemeinden der Stadtregion Wels. Die Gemeinden, die sich bislang noch nicht daran beteiligen wollen, haben Argumente, die zwar aus der gegenwärtigen kommunalen Sicht und Situation heraus nachvollziehbar sein mögen, aus externer Sicht aber nicht zielführend sind: die langfristig erfolgreiche Positionierung als international konkurrenzfähiger Gewerbestandort kann in
7 Als Ideengeber können dafür auch erfolgreiche Verwaltungs- und Organisationsmodelle von Stadtregionen dienen, die vermeintlich „zu groß“ sind, wie etwa die Stadtregion Hannover (https://www.hannover. de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/ Die-Verwaltung-der-Region-Hannover)
einem gemeinsamen Wirtschaftsraum nur dann gelingen, wenn Planung, Entwicklung und Organisation kooperativ erfolgen. Hier gilt es, die Gemeinden davon zu überzeugen, dass die politischen und/oder monetären Kosten einer Beteiligung nur vermeintlich zu hoch sind und eine Investition in den Wirtschaftspark mittelfristig auch eine Investition in die eigene Gemeinde als stabilen Wirtschaftsstandort ist.
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen können drei Empfehlungen in Bezug auf künftige Kooperationsaktivitäten und -intensitäten gegeben werden:
1. Der Wirtschaftspark Voralpenland ist für alle Gemeinden, gleich welcher Größe und gleich welcher Entwicklungspotenziale, langfristig notwendig, um selbst als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig zu bleiben; deshalb sollten alle noch nicht daran beteiligten Gemeinden intensiv einen Beitritt in Erwägung ziehen. Zudem ist eine Perspektive für professionelles Agieren notwendig
2. Zweckorientierte Kooperationen sind in der Stadtregion stark ausgeprägt und im Ansatz auch die Zusammenarbeit bzw. die Übernahme von administrativen Aufgaben aus anderen Gemeinden. Was „im Kleinen“ bereits funktioniert, kann auch „im Großen“ funktionieren: eine schrittweise und bedürfnisadäquat intensivierte Verwaltungskooperation sollte unbedingt diskutiert werden.7
3. Das Stadtregionale Forum hat sich im Laufe des Strategieprozesses als eine zielführend organisierte Plattform erwiesen, die über den Prozess hinaus Bestand haben sollte. Die bestehenden Kooperationen in der Stadtregion sollten unbedingt gefestigt bzw. inhaltlich-konzeptionell ausgebaut werden; dafür ist das Stadtregionale Forum die geeignete „institutionelle“ Basis.
Aus den Analysen im „Atlas der Stadtregion Wels“ und der SWOT-Analyse lassen sich erste Handlungserfordernisse ableiten, die gewissermaßen die Grundlage bilden, auf der in weiterer Folge das stadtregionale Leitbild entwickelt wird. Die Handlungserfordernisse lassen sich den folgenden sechs Themenfeldern zuordnen.
1. Räumliche Entwicklung
Die Stadtregion Wels zeichnet sich durch eine klar lesbare und bislang nicht besonders stark zersiedelte Siedlungsstruktur aus, in der sich hochverdichtete Bereiche neben weitläufigen Freiräumen finden. In Anbetracht des zu erwartenden Wachstums sind übergeordnete Planungsprinzipien notwendig, die gewährleisten, dass die dynamischen Entwicklung nicht auf Kosten der ökologisch so wichtigen Freiräume oder der Lebensqualität in den Siedlungsbereichen geschieht: Unzerschnittene Grünräume, bedarfsgerechte Freiräume und kompakte Siedlungsstrukturen müssen das
Rückgrat einer kompakten Siedlungsentwicklung sein. Aufbauend darauf ergeben sich weitere konkrete Handlungserfordernisse:
• Die Siedlungsentwicklung muss am leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr ausgerichtet werden, um kurze und weitestgehend PKW-freie Wege ermöglichen zu können; je kompakter die Siedlungsstrukturen, desto leichter lässt sich dieses Prinzip umsetzen.
• Innenentwicklung muss vor Außenentwicklung gehen. Das zu erwartende Wachstum und der damit verbundene Flächenbedarf dürfen nicht durch die beliebige Ausweisung neuer Siedlungsgebiete auf der grünen Wiese bewältigt werden. Ein gemeinsames Bekenntnis zu dichteren Bauweisen und der Aktivierung von existierenden und bislang nicht aktivierten Flächenpotenzialen ist notwendig.

Bevölkerungsentwicklung 2001 - 2015 < -50% -50 % - < -10 % -10 % - 0 %
0 % - < 10 %
10 % - < 100 %
> 100 % (max. 8.400 %)
Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik, 31.10.2015, eigene Berechnungen und Darstellung
Einpendler_innen je Rasterzelle (2015)
0 - 9
10 - 49
50 - 99
100 - 499
500, > 500 (max. 3.253)
Die Stadtregion Wels ist dynamischer Teil eines der bedeutendsten Wirtschaftsräume Österreichs und Standort vieler innovativer Unternehmen aus zukunftsfähigen Branchen. Durch die sehr gute überregionale Erreichbarkeit und das auch im Wirtschaftssektor zu erwartende Wachstum wird die Nachfrage nach Betriebsflächen auch künftig hoch sein. Das Nebeneinander von Wohnen, Natur und Wirtschaft darf nicht zu einem Gegeneinander werden: Bei der Entwicklung neuer Betriebsstandorte sind flächensparende, kooperative Umsetzungsmodelle mit nachhaltigen Verkehrslösungen an den am besten dafür geeigneten Standorten zu priorisieren, um eine konfliktfreie und umweltschonende Weiterentwicklung des Wirtschaftsraums zu garantieren.
Neben intensiv genutzten und hoch versiegelten Siedlungs- und Wirtschaftsräumen zeichnet sich die Stadtregion Wels ebenso durch mehrere Naturräume aus, die nicht nur einen großen landschaftlichen Wert haben, sondern auch ökologisch sehr bedeutend sind; die Traunauen und die Welser Heide sind das naturräumliche und ökologische Rückgrat der wachsenden Stadtregion und müssen als solche erhalten und geschützt bleiben; sie sind nicht nur wichtige Lebensräume für z.T. seltene Tierarten, sondern auch dringend notwendiger Erholungsraum für die in der Stadtregion lebenden Menschen.
Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik, 31.10.2015, eigene Berechnungen und Darstellung
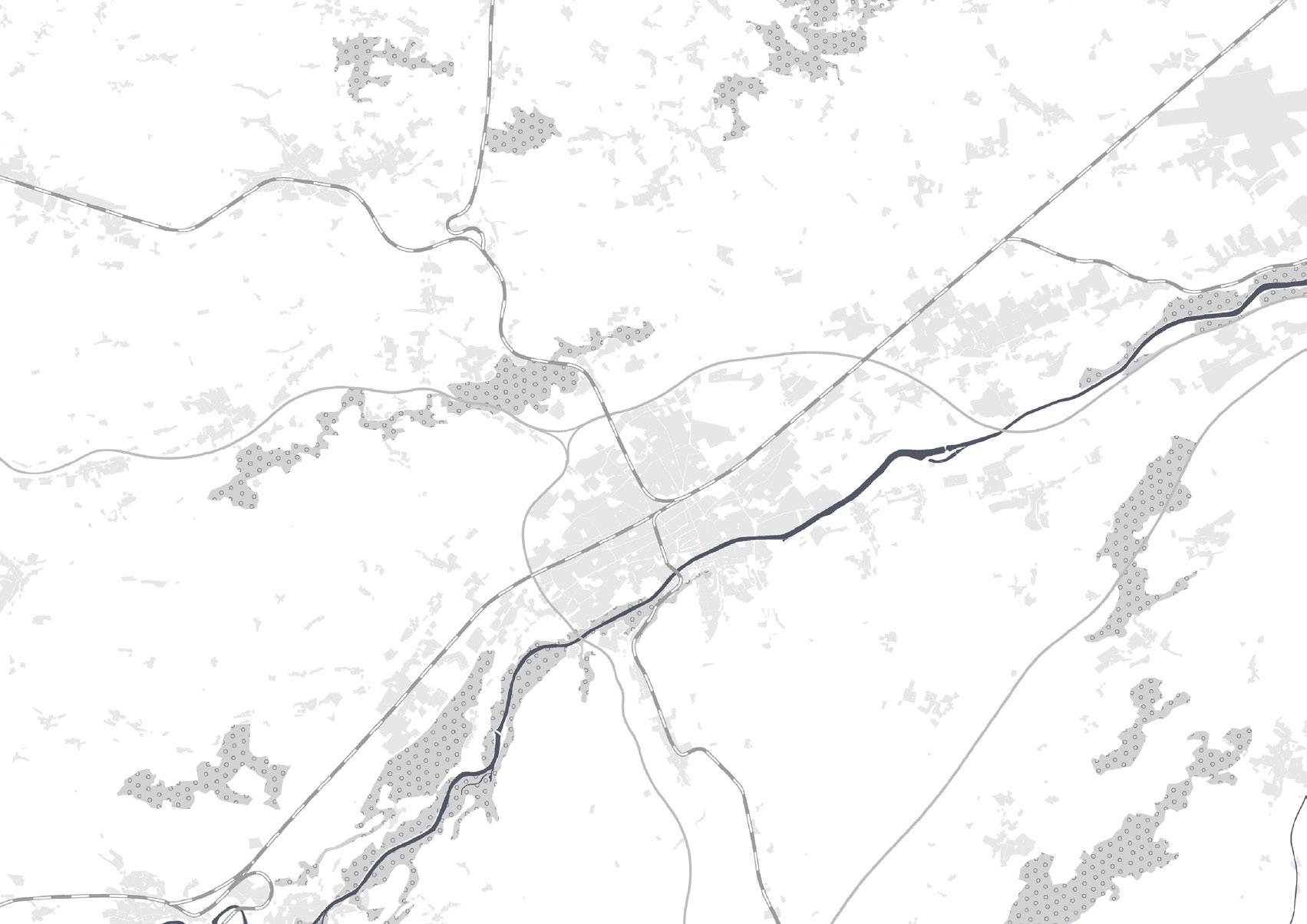
Die Weiterentwicklung der Stadtregion Wels kann und muss unter klimaschonenden Gesichtspunkten erfolgen. Der Anteil des PKW-Verkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen muss verringert werden, was durch eine intelligente, möglichst kompakte und in den siedlungsstrukturell leistungsfähigen Teilbereichen der Stadtregion erfolgende Siedlungsentwicklung ebenso erreicht werden kann wie durch die Fokussierung auf weniger flächenextensive und verkehrsinduzierenden Branchen bei der Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes. Der Erhalt der heute noch weitestgehend unzerschnittenen Freiräume und die bewusste Freihaltung von Grünkorridoren bei der Siedlungsentwicklung sowie eine klimawirksame Freiraumplanung in den Siedlungsbereichen verfolgt nicht nur einen ökologischen Zweck, sondern erfüllt auch eine wesentliche Funktion für das städtische Mikroklima.
Durch das stetige Wachstum, das vor allem durch den Zuzug von Menschen im erwerbsfähigen Alter geprägt ist, ist die Stadtregion Wels vergleichsweise „jung“. In nicht wenigen Teilbereichen liegt der Anteil der Menschen, die über 65 Jahre alt sind, aber schon heute bei über einem Drittel. Diesen demographischen Wandel wahrzunehmen und planerisch zu begleiten, ist eine wichtige stadtregionale Aufgabe.

Anteil über 65-jährige in % (2015)
< 5 %
5 % - < 10 %
10 % - < 20 %
20 % - < 30 %
30 %, > 30 %
(max. 100 %)
Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik, 31.10.2015, eigene Berechnungen und Darstellung
6. Soziales
Neben der „kleinen Großstadt“ Wels finden sich in der Stadtregion suburban und stark ländlich geprägte Gemeinden und entsprechend heterogen sind die sozialen Strukturen. Es lassen sich Gebiete mit extrem hohen Anteilen an AkademikerInnen ebenso finden wie solche, in denen sozioökonomisch schwächere Gruppen dominieren. Es muss darauf geachtet werden, dass stadtregionale Segregationstendenzen nicht überhand nehmen, sondern ein räumliches und soziales Miteinander im Vordergrund steht. Leistbares Wohnen und stadtregionale Integration sollen planerisches und sozialräumliches Prinzip werden.
Erläuterung: Sozialwirtschaftliche Indizes
• SoWi-Index I: Anteil der Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft über 25 %, AlleinerzieherInnen-Anteil über 15 %, Anteil der Pflichtschulabsolvent_innen über 30 %, Arbeitslosenquote über 10 %.
• SoWi-Index II: Anteil der Paar-Kind-Familien über 33 %, Anteil der Wohngebäude mit 1-2 Wohneinheiten über 80 %, Anteil der Personen mit Lehre, BMS, AHS oder BHS-Ausbildung als höchsten Abschluss über 60 %, Anteil der 35 bis 49-jährigen über 33 %, Weniger als 10 Einwohner_innen pro Gebäude
• SoWi-Index III: Anteil der über 65-jährigen unter 17 %, Akademikerquote über 15 %, Anteil der Pflichtschulabsolventen unter 20 %, Arbeitslosenquote unter 4 %.
SoWi-Index I
3/4 Kategorien erfüllt
4/4 Kategorien erfüllt
SoWi-Index II
4/5 Kategorien erfüllt
5/5 Kategorien erfüllt
SoWi-Index III
3/4 Kategorien erfüllt
4/4 Kategorien erfüllt
Datengrundlage: Abgestimmte Erwerbsstatistik 2015, Volkszählung 2001, Gebäude- und Wohnungsregister 2016, eigene Berechnungen und Darstellung 0 1 2 3 5 km 4



PRINZIP 1
Stadtregionale Funktions- und Aufgabenteilung
Eine lebendige Stadtregion muss als Netzwerk verstanden werden, in dem es unterschiedliche Netzknoten gibt, die sich in ihren Funktionen, ihrer Größe und ihrer räumlichen Lage zwar voneinander unterscheiden, jedoch nur im aufeinander abgestimmten Zusammenspiel funktionieren.
Auch die Stadtregion Wels ist ein solches Netzwerk, mit der „kleinen Großstadt“ Wels als deutlich größtem Netzknoten in seiner Mitte. Hier bündeln sich die meisten Funktionen, hier leben die meisten Menschen und hier gibt es auch die größten Entwicklungspotenziale für die Zukunft. Die sieben anderen Gemeinden übernehmen im funktionalen Gefüge der Stadtregion entweder die Rolle als vollwertig ausgestattete Gemeinden inklusive hochattraktiven Betriebsgebieten oder sehen sich eher als (reine) Wohn- und Lebensgemeinde.
Diese zum Teil sehr unterschiedlichen Selbstbilder und damit verbundenen Entwicklungsabsichten sind nachvollziehbar und legitim. Aus stadtregionaler Perspektive ist jedoch darauf zu achten, dass über eine klar definierte Funktions- und Aufgabenteilung ein Miteinander entsteht und kein Nebeneinander. Wels und die Gemeinden der Stadtregion haben alle bestimmte „Begabungen“, die zum Nutzen der ganzen Stadtregion ausgebaut und eingesetzt werden sollen.
PRINZIP 2
Gemeinsam agieren, wo es für die Stadtregion entscheidend ist
Eine gemeinsame Stadtregion bedeutet gemeinsame Arbeit an den Projekten, die für die abgestimmte und sinnvolle Weiterentwicklung des Gesamtraums notwendig sind. Auch wenn einzelne Kommunen aus der Beteiligung an solchen Projekten keinen unmittelbaren Nutzen ziehen oder sie räumlich
nicht betroffen sind, ist es wichtig, dass sie gemeinsam getragen werden. Letztendlich profitieren alle Gemeinden von der prosperierenden Stadtregion und Investitionen in sie sind Investitionen in die eigene Zukunft.
Gerade ambitionierte Projekte wie der gemeinsame Wirtschaftspark Voralpenland bringen einen hohen Koordinations- und Investitionsaufwand mit sich; der Nutzen für die Positionierung der Stadtregion als international hochattraktiver Unternehmensstandort rechtfertigt den Aufwand jedoch allemal.
Zukunftsfähigkeit als oberste Priorität bei allen Strategien und Entwicklungen
Bei geplanten Entwicklungen in der Stadtregion Wels muss sich stets die Frage nach deren Zukunftsfähigkeit gestellt werden. Dies betrifft Siedlungsprojekte ebenso wie die Konzeption neuer Betriebsgebiete oder die (mehrfache) Nutzung von Landschaften: Welche sind die Wohnformen der Zukunft, die in der Stadtregion nachgefragt werden? Und welche Lebensstile werden die Menschen pflegen, die in der Stadtregion künftig ihren Wohn- und Lebensort finden? Welche Ansprüche stellen hochmoderne, innovationsorientierte Unternehmen an ihren künftigen Standort? Welche Formen des Landschaftserlebnisses und der Landschaftsnutzung, egal ob Freizeit oder Landwirtschaft werden in Zukunft dominieren und wie kann man heute schon darauf reagieren?
Großzügige Grünzüge gliedern den Raum, sind wichtige Leitstrukturen bei der Orientierung im Landschaftsraum und tragen wichtige Funktionen für Ökologie und Naturschutz, Naherholung und Freizeit. Sie ermöglichen eine hindernisfreie Ausbreitung von Tieren, verbinden wertvolle Grünräume und sichern ein „landschaftliches Grundgerüst“ zur Gliederung der Siedlungsräume. Die naturräumliche Lage der Stadtregion ist einerseits geprägt durch das „Welser Hügelland“ und die „Welser Kante“ – dem markanten Höhensprung zwischen Niederterrasse und Hügelland – im Norden, die Traun-Enns-Platte mit der Traunleiten als Geländekante zum rechten Traunufer und das Untere Trauntal als „Grünes Rückgrat“ der ganzen Stadtregion. Diese hochrangigen Landschaftsräume durchziehen die Region bzw. umschließen das Stadtgebiet von Wels an seinen Rändern, sodass durch die Vernetzung dieser Grünkorridore sowohl für die Stadt Wels als auch für die Umlandgemeinden ein „Grüngürtel“ entsteht.
Die Stadtregion Wels hat also naturräumliche und landschaftliche Qualitäten, die es unbedingt zu bewahren gilt und deren Wert nicht gering geschätzt werden darf, wenn es bei künftigen Planungen um „Landschaft vs. Siedlung“ geht.
1. „Grüngürtel Wels“ als raumstrukturierendes Gerüst der Stadtregion etablieren
Das Leitbild des geschlossenen Grüngürtels umfasst ein Freiraumverbundsystem aus den hochrangingen Landschaftszügen Welser Hügelland/Welser Kante im Norden und dem Flusskorridor entlang Traun. Innerhalb diese Grünsystems sind die Belange des Naturschutzes und der Ökologie, der Naherholung und Freizeit sowie die landwirtschaftliche Nutzung zu koordinieren und miteinander zu verweben. Die Festlegung landwirtschaftlicher Vorrangzonen ist aufgrund von Bodenbonitäten und dem Zusammenspiel von Natur,- Kultur- und Erholungslandschaft vor allem beiderseits der Welser Kante aus planerischer Sicht sinnvoll. Die hochwertigen Böden sind langfristig für die landwirtschaftliche Nutzung zu sichern.
Die Verklammerung von Welser Kante und Traun-Korridor kann im Südwesten im Gebiet Waidhausen/Gunskirchen über die bereits heute ausgewiesenen Natura-2000-Flächen und die Bachläufe/-korridore Moosbach und Mühlbach gelingen, im Nordosten im Bereich Schafwiesen über die Vorbehaltsflächen für Erholung (ehem. Schottergruben), dem Bachkorridor Mühlbach und die Waldflächen nördlich der Autobahn. Flächen für urbane Landwirtschaft, Vorbehaltsflächen für Erholung, ökologische Ausgleichsflächen (Hochwasserschutz, ökologische Landwirtschaft) ergänzen begleitend den Grüngürtel.
Maßnahmen:
L1 Konzept zur stadtregional abgestimmten Bestimmung von (informellen) Vorrangflächen und zur planerischen Festlegung des Grüngürtels Wels - „Landschaftsplan“ für die Stadtregion Wels
L2 Modul „Baum-Bank-Platz“ und „Traunplatz“: Schaffung von Orientierungspunkten und Mosaiksteinen innerhalb des Freiraumverbundes; beispielsweise auf Vorrang flächen für Erholung, an Wegkreuzungen, geeigneten Aussichtspunkten, sowie Freihalten von Sichtachsen
2. Die Stadt und ihr Umland mit Grünkorridoren vernetzen
Der Grüngürtel Wels kann als das „primäre Ringsystem“ betrachtet werden, das die Grünzüge in der Stadtregion auf übergeordneter Ebene strukturieren und sichern soll. Dieser Grüngürtel sollte mit tangenzial verlaufenden Grünkorridoren (hochrangige und lokale Grünverbindungen, vgl. Freiraumrahmenplan für Wels) überlagert werden, die die Stadt ökologisch mit dem Umland vernetzen; zusammen bilden sie ein vielfältiges und hochwertiges Freiraumverbundsystem.
Maßnahmen:
L3 Identifizierung der für die Gründkorridore zentralen Bereiche und Erarbeitung stadtregional abgestimmter Maßnahmen zu deren Sicherung – Grünkorridore entlang der „kleinen und großen Graften“ ausbauen - „Landschaftsplan“ für die Stadtregion Wels
3. Naturschutz und Naherholungsmaßnahmen aufeinander abstimmen Nicht nur aus ökologischen Erwägungen heraus muss es Ziel sein, in der Stadtregion Wels existierende zusammenhängende Landschaftsräume zu identifizieren, deren ökologische Funktionen erhalten und Freizeitnutzungen im möglichen Rahmen auszubauen. Von deren Sicherung und den Nutzungsmöglichkeiten in ihnen hängt zu einem großen Teil das ab, was unter dem Standortfaktor „Lebensqualität“ subsummiert wird - vgl. Konzept zur naturverträglichen Erholungs - und Freiraumnutzung.
Maßnahmen Trauntal:
L4 Schutz und Entwicklung der Auwälder beiderseits der Traun im SW im Bereich Gunskirchen/Waidhausen und im NO Bereich Schafswiesen, Schleißheim, Weißkirchen bis zum Kraftwerk Marchtrenk
L5 Sicherung des schmalen, noch verbliebenen Uferstreifens im Stadtgebiet Wels/ Thalheim
L6 Erschließung der Traun für eine naturverträgliche Erholungs- u. Freizeitnutzung (z.B. Badenutzung, Wander- u. Radwege) - vgl. auch Leitziel 3
L7 Schaffung von Naturerlebnis-Rastplätzen entlang der Traun – „Traunplätze“
L8 Vernetzung der Gemeinden nördlich und südlich der Traun durch Stege im Bereich Schleißheim und Gunskirchen
L9 Pumptrack8 Gunskirchen als hochwertiges, stadtregional bedeutsames Freizeitangbot. Der vorgeschlagene Standort in Gunskirchen liegt in unmittelbarer Nähe zur den Auwäldern der Traun und lässt sich als Freizeitort in das Freiraumgerüst einbetten.
L10 Schwimmsteg-Anlage zwischen Traunbrücke und Eisenbahnbrücke – „Trauninsel“
Maßnahmen Natura 2000 Flächen/Europaschutzgebiet Untere Traun, Wels – Waidhausen/Gunskirchen:
L11 Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Wels und Gunskirchen
L12 Ausweisung von Vorrangflächen mit besonderer ökologischer Bedeutung
L13 Gebietsbetreuung hinsichtlich einer naturschutzfachlichen Vermittlung und Besucherlenkung
L14 Abrundung der Bauland- u. Siedlungsentwicklung (keine Erweiterung)
L15 Verbesserung der Zugänglichkeit und Erlebbarkeit als Natur- u. Naherholungsraum
L16 Verknüpfung und grüner Lückenschluss mit Welser Kante über die Gewässerkorridore Mühlbach und Moosbach, sowie Vorrangflächen für Erholung.
L17 Verbesserung der Anbindung von Gunskirchen und Waidhausen mit Stadtgebiet Wels
Maßnahmen Schafwiesen/Schleißheim:
L18 Großes Naherholungspotenzial durch ehemalige Schottergruben und deren Status als Vorrangflächen für Erholung sowie durch die Lage am Flusskorridor Traun nutzenvgl. Konzept zur naturverträglichen Erholungs - und Freiraumnutzung
L19 Verbesserung der Zugänglichkeit und Erschließung durch Traun-Steg zwischen Schleißheim und Wels
L20 Verknüpfung und grüner Lückenschluss mit der Welser Kante über die Gewässerkorridore Mühlbach und Waldgebiete nördlich Autobahn
L21 Ausweisung landwirtschaftlicher Vorrangflächen zur Erhaltung der kleinteiligen Kulturlandschaft
Sonstige Maßnahmen im Welser Hügelland
L22 Sicherung der ökologischen Funktionen und Ausbau der Freizeitnutzung Linetwald
L23 Renaturierung der Ziegellehmgrube Buchkirchen
8 Ein Pumptrack ist eine künstlich angelegte Mountainbikestrecke, meist aus Erde oder Lehm errichtet. Als Freizeit- bzw. Sportanlage trägt sie erheblich zur Bewegungsförderung bei.
4. Hochwasser- und Hangwasserschutzmaßnahmen als Voraussetzung für Standortentwicklung
Insbesondere bei der Entwicklung von neuen Betriebsstandorten spielen Schutzmaßnahmen vor Hoch- und Hangwassergefahren eine ganz zentrale Rolle. Ein Großteil der Flächen, auf denen sich die Entwicklung in der Stadtregion in Zukunft abspielen soll, liegt Hoch- oder Hangwassereinzugsbereich. Es wurden und werden zwar laufend entsprechende Maßnahmen getroffen, doch fehlt bislang eine stadtregional abgestimmte Darstellung der betroffenen Bereiche sowie eine Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen. Im Sinne der koordinierten Weiterentwicklung der Stadtregion sind hier ebenso koordinierende Maßnahmen zu setzen, wie zur Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber den übergeordneten Planungsebenen.
Maßnahmen:
L24 Hoch- bzw. Hangwasserschutzmaßnahmen in der Stadtregion Wels (vorrangig im potenziellen Betriebsgebiet Wels-Wimpassing/Gunskirchen-Hof und im Bereich Buchkirchen/Holzhausen); lokale Rahmenplanung und -umsetzung für Wasserbau, Naturschutz, und Erholungsnutzung auf Basis eines „Landschaftplan“ für die Stadtregion Wels und eines Konzepts zur naturverträglichen Erholungs - und Freiraumnutzung
5. Geh- und Radrouten in das Netz aus grüner Infrastruktur eingliedern
Die Erlebbarkeit und Nutzbarkeit der hochwertigen grünen Infrastruktur in der Stadtregion kann vor allem durch den Ausbau hochrangiger Rad- und Wegerouten mit vergleichsweise einfachen Mitteln gesteigert werden. Wegbegleitende Baumreihen, Alleen oder Feldgehölzstreifen tragen dazu bei, die Routen in dieses Grünsystem einzugliedern. Dort, wo noch keine vorhanden sind, sollte die Ausstattung der Grünkorridore mit Wander- und Radwegen langfristiges Ziel sein.
Maßnahmen:
L25 Erfassung aller aufzuwertender bzw. neu anzulegender Wegerouten innerhalb des Grünsystems und Priorisierung ihrer Umsetzung
6. Klare Übergangsbereiche zwischen Siedlung und Landschaft sicherstellen
Die Qualität von Landschafts- und Siedlungsstrukturen wird vor allem in den Übergangsbereichen zwischen den verschiedenen Raumnutzungen deutlich. Abgerundete Siedlungsränder, die z.B. durch Geh- und Radwege in Wert gesetzt sind, haben nicht nur einen funktionalen Mehrwert, sondern markieren auch klar das Ende der Bebauung und den Beginn der offenen Landschaft. Solchermaßen qualifizierte Siedlungsränder mit Übergangs- und Pufferzonen aus Gehölzstreifen, Baumreihen, Streuobstanpflanzungen etc. sind wesentliche Freiraum- und Siedlungsqualitäten zugleich.
Maßnahmen:
L26 stadtregional abgestimmter Gestaltungskatalog für Ortsrandabrundungen und Gestaltung von Übergangsbereichen zwischen Siedlung und Landschaft
L27 Gestaltung von Ortsrandabschlüssen in kommunale Planung und Siedlungsentwicklung integrieren
STADTREGIONAL BEDEUTSAME GRÜN- UND ERHOLUNGSRÄUME SICHERN
1 Welser Hügelland
Sicherung des Landschaftsraumes mit wichtigen Funktionen für Ökologie und Naturschutz, Naherholung und Freizeit
2 Flusskorridor und Landschaftszug Trauntal
Das Untere Trauntal weist mehrere lineare, mehr oder weniger parallel verlaufende (Leit-) Strukturen auf. Deren Durchgängigkeit und damit deren Fähigkeit als Wander- und Verbindungsstrecken zu fungieren, wurde durch viele Zerschneidungen mit Verkehrswegen durchbrochen. Die – zumindest teilweise – Wiederherstellung dieser Durchgängigkeit stellt eine wesentliche naturschutzfachliche Zielebene dar.
3 Traun-Enns-Platte
Sicherung des Landschaftsraumes mit wichtigen Funktionen für Ökologie und Naturschutz, Naherholung und Freizeit
STADTREGIONAL BEDEUTSAME GRÜN- UND ERHOLUNGSRÄUME VERNETZEN
Großräumige Verbindung stadtregional relevanter Grünräume zu einem zusammenhängenden „Grünen Ring“ – Durchlässigkeiten in bebauten Gebieten durch Fuß- und Radwege gewährleisten.
GRÜNE PUFFERZONE ENTLANG
DER WELSER KANTE SICHERN UND ENTWICKELN
Sicherung bzw. Entwicklung einer bandartigen, durchgängigen Biotopstruktur in ausreichender Breite; Sicherung der Vorrangflächen für Landwirtschaft südlich und nördlich der Welser Kante und damit Sicherung der gewachsenen, kleingliedrigen Kulturlandschaft
URBANE UFERBEREICHE AN DER TRAUN GESTALTEN
Sichern und gestalten der schmalen, noch verbliebenen Uferstreifen im Stadtgebiet Wels und Thalheim mit Fokus auf Gestaltqualität und Beleuchtung.
GRÜNKORRIDORE ENTLANG VON BÄCHEN SICHERN UND AUSBAUEN
Die Bachläufe im Süden der Stadtregion Wels stellen ganz wesentliche radiale Grünraumverbindungen aus dem Zentrum der Stadtregion in ihr südliches Umland dar. Als Freiraumkorridore unmittelbar an Siedlungsräumen gelegen sind sie in ihrer Zugänglichkeit und Nutzbarkeit zu sichern bzw. auszubauen.
A Aiterbach
B Thalbach
C Schleißbach
D Saubach
E Weyerbach
GRÜNKORRIDORE ENTLANG DER GRAFTEN AUSBAUEN
Verzahnung der Welser Kante mit dem Welser Hügelland, sowie dem Wildtierkorridor über Grünkorridore bzw über das System kleiner und großer Gräben und Bachläufe, der sogenannten Graften. Eingliederung hochrangiger Radrouten durch Ausstattung mit grüner Infrastruktur wie Baumreihen, Alleen, Feldgehölzstreifen insbesondere die Radrouten nach Krenglbach, Buchkirchen und Holzhausen
Mögliche Grünverbindungen (Auswahl):
F Oberthaner Graft oder Vogelweider Graft zwischen Wels und Krenglbach in Kombination mit Radroute
G Niederthaner Graft zum Erholungsgebiet Niederthan bzw Linetwald.
H Wallerer oder Grieskirchener Graft zum Erholungsgebiet Doppelgraben und weiter nach Haiding bzw. Buchkirchen
I Eferdinger Graft als Verknüpfung Welser Heide und Buchkirchen
J Niederlaaber Graft als Verknüpfung Erholungsgebiet Stockmayer/ Baggerseen und Holzhausen
F Grundlage
Bauland
Bauland Kerngebiet
Wald
Grünland
Gewässer
Europaschutzgebiet
Geländekanten
Freizeitorte
Bahn
Autobahn
Landesstraße
sonst. niederrangige Straße
Abgrenzung Kooperationsraum
Leitbildbausteine
Stadtregional bedeutsame Erholungsräume sichern (1-3)
Grüne Pufferzone entlang der Welser Kante sichern und entwickeln
Stadtregional bedeutsame Grün- und Erholungsräume vernetzen
Urbane Uferbereiche an der Traun gestalten
Grünkorridore entlang von Bächen sichern und ausbauen (A – E)
Grünkorridore entlang der Graften ausbauen (F – J)
2 1 0 3 4 km
Mistelbach
Naturpark „Obst-Hügel-Land”
Hundsham
BUCHKIRCHEN
Radlach
HÜGELL A N D
allerer Graf t E
Neustadt Puchberg
WELS
Hbf Wels
Vogelweide Innenstadt
Bhf Lokalbahn
Lichtenegg
Bhf Messe
„Welser Kante”
Europaschutzgebiet „Welser Haide”
HOLZHAUSEN
Pernau
Oberperwend
Bhf Marchtrenk
MARCHTRENK OFTERING
HÖRSCHING
Oberschauersberg
THALHEIM
Aschet
Bhf Schauersberg
STEINHAUS
Bhf Steinhaus
Schafwiesen Ottstorf
Dietach
SCHLEIßHEIM
Bhf Oberhardt
Bhf Unterhardt
Weyerbach
Golfclub Wels
WEIßKIRCHEN
Sinnersdorf Grassing
EGGENDORF
SIPBACHZELL
Abb.16: Leitbild Landschaft, eigene Darstellung
Das für die Zukunft erwartete Bevölkerungswachstum in der Stadtregion Wels ist im Vergleich zu hochdynamischen Wachstumsregionen moderat; der Entwicklungsschwerpunkt liegt dabei eindeutig auf dem Gebiet der „kleinen Großstadt“ Wels. Die anderen Gemeinden im Planungsraum haben ihre größten Entwicklungssprünge hinter sich und haben sich allesamt für ein gemäßigtes Wachstum entschieden, das sich zu großen Teilen auf den bereits heute gewidmeten Flächen konzentrieren wird. In der gesamten Stadtregion geht es nicht nur um das Management von Wachstum, sondern vor allem um die Qualitätssteigerung der Gemeinden bzw. ihrer Ortsmitten und Ortskerne; das trifft auf Wels ebenso zu wie z.B. auf Krenglbach. Dabei haben viele Gemeinden Projekte mit hohem Anspruch umgesetzt und Ortsmitten geschaffen, die funktional und sozial tatsächlich das Zentrum der Gemeinde sind. Weder in Bezug auf die Siedlungsentwicklung noch bei der Weiterentwicklung der Ortskerne und der Versorgungsinfrastrukturen lehnen sich die Gemeinden in der Stadtregion Wels zurück. Innenentwicklung vor Außenentwicklung soll das stadtregionale Leitmotiv der künftigen Siedlungsentwicklung sein; und auch die Bündelung des Wachstums auf Wels als eindeutigem Siedlungsschwerpunkt braucht vorausschauende Planung. Sowohl die „kleine Großstadt“ als auch die Gemeinden in der Stadtregion sind sich ihrer Verantwortung bewusst und bereit, gemeinsam in Konzepte einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Siedlungsentwicklung zu investieren. Abb.17: Strukturkarte Siedlung, eigene Darstellung
1. Differenzierte Entwicklung: Wels als Wachstumsschwerpunkt, Umlandgemeinden mit komplementären Aufgaben
Im stadtregionalen Leitbild sind Entwicklungsschwerpunkte ausgewiesen, auf die sich das künftige Wachstum verteilen soll. Die Besonderheit in der Stadtregion Wels liegt dabei darin, dass die „kleine Großstadt“ den ganz klaren Wachstumsschwerpunkt darstellt, während sich die Entwicklung der anderen Gemeinden in der Stadtregion entweder auf das „Auffüllen“ der noch vorhandenen Baulandflächen beschränkt oder in Zukunft sehr gemäßigt erfolgen soll. In Anbetracht der zu erwartenden Dynamiken ist das eine planerisch vertretbare Strategie, solange die Gemeinden sich dem Wachstum nicht zur Gänze verschließen und dabei Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten zur Verfügung stellen (in einem Verhältnis, das der jeweiligen Gemeindegröße angemessen ist).
Maßnahmen:
S1 abgestimmte bzw. bilaterale Koordination der Siedlungsentwicklung, wo es aus planerischen Erwägungen heraus notwendig ist (z.B. Wels Nord, Wels-BuchkirchenMarchtrenk)
2. Innenentwicklung vor Außenentwicklung: ein Drittel des künftigen Wachstums im Bestand
In Wels selbst und in vielen Gemeinden der Stadtregion gibt es ein klares Bekenntnis zur Innenentwicklung. Die Stadt Wels hat mit ihrem „Potentialplan Innenstadt 2020+“ eine wichtige Planungsgrundlage für die Zukunft, aus der sich verschiedene Entwicklungsstrategien ableiten lassen. Aufbauend darauf soll das Ziel sein, ein Drittel des künftigen Wachstums im Bestand zu bewältigen: Das umfasst die Aktivierung von Baulandreserven, maßvolle Nachverdichtungsmaßnahmen und die Wiederauslastung von untergenutztem Wohnraum. Kurze Wege, Freiraumqualität, Wiederbelebung der Innenbereiche und gemäßigtes Wachstum ohne zusätzlichen Flächenverbrauch sind die positiven Folgen!
Maßnahmen:
S2 stadtregional einheitliche Erfassung von Innenentwicklungspotenzialen S3 stadtregional abgestimmte Innenentwicklungsmaßnahmen und -prinzipien erarbeiten - „Rahmenplan Innenentwicklung“ für die Stadtregion Wels
3. Entwicklungs- und Transformationspotenzial von Gebieten im baulichen und demografischen Umbruch identifizieren und gestalten
Überall in der Stadtregion lassen sich Bestandssiedlungen aus den 1960er bis 1980er Jahren finden, die aufgrund ihrer alternden Bevölkerung einerseits im demographischen Umbruch sind, andererseits aber auch vor baulich-strukturellen Veränderungen stehen: Abriss und Nachverdichtungsmaßnahmen werden aufgrund steigender Bodenpreise und veränderter Bedürfnisse an den Wohnraum künftig noch stärker auf diese Siedlungen wirken. Daher sind klare Spielregeln notwendig, um Nachverdichtung und Veränderung im Bestand städtebaulich, sozial, infrastrukturell und verkehrstechnisch verantwortungsvoll zu gestalten.
Maßnahmen:
S4 stadtregionale Workshops mit Beteiligung von ExpertInnen (z.B. örtliche Raumplanungsbüros) für Problemaufriss und kartographische Festlegung betroffener Teilbereiche sowie für Erarbeitung gemeinsamer Qualitätskriterien zur Steuerung der dortigen Entwicklung - vgl. „Rahmenplan Innenentwicklung“ und „Potentialpläne“ für Siedlungsbereiche
S5 gemeinsame Erklärung zur Implementierung von Qualitätsstandards für Nachverdichtungsvorhaben im Bestand in die örtliche Raumplanung und Potentialpläne für die Siedlungsteilbereiche nach dem Vorbild „Potentialplan Innenstadt 2020+“ in Wels
4. Aktivierung von Baulandreserven
Die mangelhafte Verfügbarkeit von Bauland und Entwicklungsflächen ist so gut wie in jeder Gemeinde eine der größten Herausforderungen, wenn es um die künftige Siedlungsentwicklung geht. Auch wenn sich der dadurch entstehende Mangel im Rahmen dieses Projekts nicht eindeutig quantifizieren lässt, macht die Situation in der Stadtregion Wels keine Ausnahme und schränkt den Handlungsspielraum vieler Gemeinden nach deren eigener Einschätzung deutlich ein, obwohl Bauland in mehr als ausreichendem Maße gewidmet wäre. Diese künstliche Verknappung des Angebots führt überdies zum Anstieg der Grundstückspreise, die in vielen Lagen ohnehin schon die Schwelle der „Leistbarkeit“ überschritten haben. So hängt die Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum, zu dem sich die Gemeinden in der Stadtregion verpflichtet fühlen, auch wesentlich davon ab, in welchem Maße Bauland künftig auf den Markt gelangt. Und nicht zuletzt ist eine strukturierte Siedlungsentwicklung ebenfalls davon abhängig, neue Wohngebiete nicht dort zu realisieren, wo gerade „zufällig“ Bauland verfügbar ist, sondern dort, wo es planerisch sinnvoll ist.
Maßnahmen:
S6 stadtregional abgestimmte und einheitliche Erfassung von Baulandreserven in einer Flächenmanagement-Datenbank, z.B. erfasst durch den Wirtschaftspark Voralpenland
S7 Erarbeitung von Bewusstseinsbildungsmaßnahmen und direkter Ansprache von GrundstückseigentümerInnen
5. Zentrale Funktionen der Ortskerne stärken und ausbauen In vielen Gemeinden sind die Ortskerne die tatsächlichen Mitten des Ortes, auch in Wels entwickelt sich die Innenstadt kontinuierlich weiter und wird immer mehr zum Treffpunkt und Versorgungsstandort für die einheimische Bevölkerung und weit darüber hinaus. Doch in der „kleinen Großstadt“ ist eine funktionierende und lebendige Mitte kein Selbstläufer und bedarf ständiger Aufmerksamkeit und frischer Ideen. Hier können Stadt und Gemeinden in der Stadtregion viel voneinander lernen, da man auf zum Teil sehr erfolgreiche Zugänge und Strategien zurückblicken kann und sich für die Zukunft ebenso Anregungen aus der direkten Nachbarschaft holen kann. Vor allem auch die Gemeinden, deren Ortskerne künftig aufgewertet werden sollen, können vom stadtregionalen Wissensaustausch profitieren. Die multifunktionale Ausgestaltung der Ortskerne mit gemeindeübergreifenden Konzepten und
Angeboten ist dabei nicht nur etwas für die Kernstadt Wels, sondern auch ein Anspruch, der in den Gemeinden der Stadtregion verwirklicht werden kann.
Maßnahmen:
S8 Traunschiff Thalheim
S9 Stadtregionales Dialogforum „Best Practice Ortskern-/Innenentwicklung in der Stadtregion Wels“
S10 Schleißheim Ortskern: z.B. Ideenwettbewerb für Neunutzung Parkplatz-Grundstück
6. Entwicklung von zukunftsfähigen städtischen Quartieren
Die Rolle der „kleinen Großstadt“ Wels als Entwicklungsschwerpunkt macht es erforderlich, Qualitätsansprüche zu formulieren, die in den künftigen Welser Stadterweiterungsgebieten gelten sollen. Diese Ansprüche beziehen sich auf Nachbarschaftsbildung, die soziale und funktionale Mischung, die Umsetzung anpassungsfähiger Strukturen und der Realisierung von verschiedenen Wohnkonzepten (Wohngruppen etc.) mit den ihnen entsprechenden Errichtungs-, Betreibungs- und Finanzierungsmodellen. Auch die Gestaltung der städtischen Freiräume und die Einbettung der neuen Quartiere in den Bestand als Beitrag zum „Weiterbauen“ der Stadt Wels, sind zentrale Qualitäts- und Anspruchskriterien, die bei der künftigen Entwicklung mitgedacht und ernst genommen werden müssen.
Maßnahmen:
S11 Erarbeitung eines Anspruchs- und Qualitätskatalogs für die Entwicklung künftiger Stadterweiterungsgebiete - „Qualitätshandbuch Siedlungserweiterung“ für die Stadtregion Wels
7. Kompakte, kluge und leistbare Siedlungsformen
Die qualitätsvolle Entwicklung des Siedlungsbestands ist aber nicht nur Thema in der Stadt Wels, sondern soll in Zukunft noch viel stärker als bisher Leitlinie bei den Planungen in allen Gemeinden sein. Auch in den ländlicher geprägten Bereichen der Stadtregion kann das klassische Einfamilienhaus nicht mehr die „einzige“ Siedlungsform der Zukunft sein, der schon jetzt vorhandene und älter werdende Einfamilienhausbestand wird alle Gemeinden langfristig vor genügend planerische und soziale Herausforderungen stellen, sodass man bei neuen Siedlungsentwicklungen nachhaltigeren Formen des Wohnbaus unbedingt den Vorzug geben sollte. Nicht nur in Anbetracht der steigenden Bodenpreise sind kompaktere Siedlungsformen sinnvoll und nachhaltig, orientieren sich solche Konzepte an spezifischen Zielgruppen und Lebensstilanforderungen, bedeuten sie auch eine sozialen Mehrwert und Gewinn, was das kommunale Gemeinwesen betrifft: der Gefahr, immer mehr zum „Schlafdorf“ zu werden, kann auch durch intelligente und zukunftsfähige Wohn- und Siedlungsformen begegnet werden.
Maßnahmen:
S12 stadtregionaler Workshop „Wohnformen der Zukunft“, z.B. im Kontext „Qualitätshandbuch Siedlungserweiterung“
SIEDLUNGSENTWICKLUNG AUF STADTREGIONALE ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE KONZENTRIEREN
Innerhalb der Stadtregion liegt der Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung klar auf dem Gebiet der Stadt Wels; hier finden sich aus städtebaulicher und infrastruktureller Sicht die größten Potenziale. Diese eindeutige Konzentration des Wachstums ist wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung der „kleinen Großstadt“ Wels. Die Umlandgemeinden beschränken sich weitgehend auf Eigenentwicklung; Buchkirchen und Gunskirchen bilden zwei ergänzende Entwicklungsschwerpunkte innerhalb der Stadtregion.
hier sind an die Umgebung angepasste, maßvoll erhöhte Bebauungsdichten zu realisieren. Angebot an Wohnformen, die zukünftigen Bedürfnissen und Lebensstilen entsprechen. Herausforderung ist die Verfügbarkeit der Baulandreserven.
4 Gunskirchen Ortszentrum
5 Buchkirchen Ortszentrum
POTENZIALRÄUME FÜR INNENENTWICKLUNG IDENTIFIZIEREN/ NUTZEN
Standorte mit Neubau- oder Nachverdichtungspotenzialen innerhalb bestehender Strukturen; Vorteile durch kurze Wege bzw. einfache Anbindung an bereits bestehendes ÖV-System und Aufwertung der Umgebung durch qualitativ hochwertig Siedlungsentwicklungsprojekte. Schwerpunkt liegt auf Wohnen, aber auch multifunktionale Nutzungen, von denen die bereits bestehende Nachbarschaft profitieren kann. Für das Welser Stadtgebiet ergeben sich folgende Potenzialräume:
1 Quartier am Lokalbahnhof
2 Lagerhausviertel
3 Bahnhofsviertel
In den Umlandgemeinden finden sich vor allem zwei Entwicklungsschwerpunkte mit besonderem Innenentwicklungspotentzial. Auch
ORTS- UND STADTTEILZENTREN STÄRKEN UND ENTWICKELN
6 Wels Innenstadt
Fortsetzung der Belebungs- und Ausbaumaßnahmen; Innenstadt Wels als zentraler und am vielfältigsten ausgestatteter Versorgungs-, Dienstleistungs- und Kulturstandort in der Stadtregion. Potenzialräume für innovative temporäre Nutzungen mit Fokus auf innovationsorientierte und/oder kreative Branchen.
7 Ortsmitte Weißkirchen
Ausbau und Vervollständigung des Ortszentrums als Lebensmittelpunkt und Versorgungsstandort für die einheimische Bevölkerung; funktionale Aufwertung von Weißkirchen insgesamt in seiner Rolle als Versorgungsstandort für Hinterlandgemeinden.
8 „Ortsmitte neu“ Schleißheim Funktionale Aufwertung der Ortsmitte durch Überbauung und multifunktionale Nutzung des heutigen Parkplatzes (Parkmöglichkeiten müssen bei neuem Konzept erhalten bleiben). Konzeptioneller Fokus auf Mischung aus Wohnen und kleineren Büro-/Gewerbe-/Dienstleistungseinheiten.
POTENZIALRÄUME FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE STADTERWEITERUNG NUTZEN
In der Stadt Wels sind in zwei Stadtteilen Potenzialräume für Stadterweiterungen vorhanden, die sich aufgrund ihrer Lage und Dimension dafür eignen, dort Stadtquartiere zu entwickeln, die zukünftigen Ansprüchen an soziale und ökologische Nachhaltigkeit genügen können und hohe städtebauliche Standards erfüllen. Dadurch erfährt nicht nur die unmittelbare Umgebung eine Aufwertung, sondern auch die „kleine Großstadt“ Wels insgesamt einen wichtigen Entwicklungsschub.
9 Vogelweide
10 Pernau
11 Waidhausen
12 Neustadt
POTENZIALRÄUME „GEBIETE IM BAULICHEN UND DEMOGRAFISCHEN UMBRUCH NUTZEN
Im Rahmen dieses Projekts können die Siedlungsbereiche in Wels und den Umlandgemeinden, die sich aufgrund ihrer demographischen und städtebaulichen Strukturen (überdurchschnittlich alte Bevölkerung, sehr niedrige Belegungsdichte, hoher Anteil an älteren Einfamilienhäusern) gegenwärtig oder in naher Zukunft in einem Transformationsprozess befinden werden, großräumig identifiziert werden. Aufbauend auf Leitziel 3 müssen diese Teilgebiete in den nächsten Schritten näher abgegrenzt und gemeinsam stadtregional gültige Rahmenbedingungen für den Umgang mit Neubau- und Nachverdichtungsaktivitäten erarbeitet werden.
RAUMKANTEN ZUR SIEDLUNGSGLIEDERUNG AUSBILDEN
In der Stadtregion Wels halten sich Zersiedelungstendenzen in weiten Teilen noch in Grenzen, die Siedlungsbereiche sind zur offenen Landschaft hin weitgehend klar abgegrenzt. Diese Siedlungsstrukturen sind auch bei künftigem Wachstum zu bewahren und deshalb ist die Berücksichtigung von klaren Raumkanten auch weiterhin ein zentrales planerisches Leitmotiv, das z.B. durch gestaltete Ortsrandabschlüsse mittels Rad-/Fußwegkombinationen auch einen funktionalen Mehrwert für die jeweilige Gemeinde bieten kann.
Grundlage
vorwiegend Wohnen
Bauland Kerngebiet
Betriebsbaugebiet/Geschäftsgebiet/ Industriegebiet
Erweiterung Siedlungsgebiet (lt. ÖEK)
Stadtzentrum Wels
Stadtteilzentrum
Ortskern
Wald
Gewässer
Bahn
Autobahn
Landesstraße
sonst. niederrangige Straße
Abgrenzung Kooperationsraum
Leitbildbausteine 2 1 0 3 4 km
Siedlungsentwicklung auf stadtregionale Enwicklungsschwerpunkte konzentrieren
Potenzialräume für Innenentwicklung Identifizieren/nutzen (1 – 5)
Orts- und Stadtteilzentren stärken und entwickeln (6 – 8)
Potenzialräume für zukunftsfähige Stadterweiterung nutzen (9-12)
Potenzialräume „Gebiete im baulichen und demografischen Umbruch“ nutzen
Raumkanten zur Siedlungsgliederung ausbilden


Mistelbach
OFTERING
HOLZHAUSEN
HÖRSCHING
BUCHKIRCHEN
Oberperwend
MARCHTRENK


Sinnersdorf
WEIßKIRCHEN
Grassing
NEU” SCHLEIßHEIM
SCHLEIßHEIM
EGGENDORF
SIPBACHZELL
Abb.18: Leitbild Siedlung, eigene Darstellung
Die Stadtregion Wels entwickelt sich immer mehr zu einem der ganz bedeutenden ökonomischen Hotspots Oberösterreichs, ja sogar ganz Österreichs. Viele hoch innovative, international agierende Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen haben sich hier angesiedelt und oft wurden deren Standorte erweitert und ausgebaut bzw. ist das für die nahe Zukunft geplant. Aufseiten der Städte und Gemeinden in der Region haben sich z.T. sehr professionelle Strukturen entwickelt, was Wirtschaftsförderung oder die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftstreibenden vor Ort betrifft: Man kennt die Bedürfnisse der hier angesiedelten Weltmarktführer ebenso wie die des Einzelhandels und hat aufbauend auf diesem Wissen bereits einige Konzepte und Strategien zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes erarbeitet. Die meisten Gemeinden der Stadtregion sind am Wirtschaftspark Voralpenland beteiligt. Ein Konzept wie dieses weist den Weg in die Zukunft: Die steigenden Anforderungen an eine Region als Wirtschaftsstandort, der im internationalen Business sichtbar und konkurrenzfähig bleiben will, können nur kooperativ bewältigt werden. Doch auch über die Idee eines gemeinsamen Wirtschaftsparks hinaus gibt es in den Städten und Gemeinden in der Region planerische Herausforderungen, vor denen alle gleichermaßen stehen und die sich ebenso viel eher kooperativ lösen lassen als wenn man insuläre Lösungen anstrebt.
Abb.19: Strukturkarte Wirtschaft, eigene Darstellung
1. Stadtregional abgestimmte Lösungsansätze zur Sicherung der Flächenverfügbarkeit
Die mittel- bis langfristig unzureichende Verfügbarkeit von Entwicklungsflächen ist die zentrale Herausforderung, die die Entwicklung der Stadtregion als zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort am stärksten beeinflusst. Zwar existieren Entwicklungs- und Erschließungskonzepte für z.T. großflächige Betriebsgebietsentwicklungen, diese bleiben aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit jedoch Theorie. Auch Entwicklung und Erfolg des Wirtschaftsparks Voralpenland sind erheblich von der Verfügbarkeit der dafür benötigten Flächen abhängig: Entweder gibt es aufseiten der EigentümerInnen überhaupt keine Verkaufs- oder Verwertungsbereitschaft oder es fehlen geeignete Tauschgründe.
Die Stadt Wels steht hier vor denselben Herausforderungen wie fast alle anderen Gemeinden in der Stadtregion. Deshalb ist es notwendig, gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln, um Flächen aktivieren zu können, die bereits heute ansässige Unternehmen für Erweiterungen benötigen und die zur Ansiedelung neuer Betriebe dringend notwendig sind.
Maßnahmen:
W1 Einrichtung eines stadtregionalen Gewerbeflächendatenbank (über den Wirtschaftspark Voralpenland hinaus)
W2 stadtregional abgestimmte Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und zum aktiven „Marketing“ bei der Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen
W3 stadtregionaler Tauschflächenpool
W4 Entwicklung von neuartigen Verwertungsmodellen in Kooperation mit Unternehmen und FlächeneigentümerInnen
2. Kooperative Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Stadtregion Wels vorantreiben Je intensiver die Städte und Gemeinden in der Stadtregion in Fragen der Wirtschaftsentwicklung kooperieren, desto schneller, flexibler und zielorientierter kann auf Anfragen und Entwicklungswünsche von Unternehmen reagiert werden. Je mehr man im (inter-)nationalen Wettbewerb um Unternehmen involviert ist, umso wichtiger sind funktionsfähige Strukturen im Hintergrund. Das Konzept des Wirtschaftsparks Voralpenland trägt diesen Zukunftsanforderungen bereits Rechnung; umso entscheidender ist es, dass alle Gemeinden Teil davon sind bzw. werden. Wenn wesentliche Flächengemeinden nicht Mitglieder sind, kann er seine Wirksamkeit nicht entfalten. Denn auch wenn es kurz- oder mittelfristig keinen unmittelbaren Mehrwert für die einzelne Gemeinde bedeuten mag: Für die Weiterentwicklung der gesamten Stadtregion als handlungs- und konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandort sind umfassende Kooperation und Beteiligung unverzichtbar.
Doch auch über den Wirtschaftspark hinaus müssen Erweiterungs- oder Neuentwicklungspläne von Betriebsgebieten gemeindeübergreifend entwickelt werden, wo es aus planerischer Sicht sinnvoll bzw. notwendig ist. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die flächendeckende Breitbandverfügbarkeit in allen Betriebsgebieten in der Stadtregion Wels; auch in diesem Zusammenhang kann ein stadtregional abgestimmter und gemeinsam organisierter Zugang den Ausbau entsprechend beschleunigen.
Maßnahmen:
W5 Stadtregionale Konferenz zur Zukunft des Wirtschaftsparks Voralpenland
W6 Bilaterale Arbeitsgruppen zur (Weiter-)Entwicklung von Betriebsgebieten mit interkommunaler Planungserfordernis unter fachlicher Begleitung
W7 stadtregionale Arbeitsgruppe Breitbandausbau
3. Stadtregion als attraktiven Standort für innovative und zukunftsfähige Branchen vermarkten
Das Wirtschaftsservice Wels macht es vor, wie die zeitgemäße und aktive Vermarktung eines Wirtschaftsstandortes aussehen kann und welcher Organisations- und Finanzierungsstrukturen es dafür im Hintergrund bedarf. Dies leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Bekanntheitsgrades der „kleinen Großstadt“ und trägt zugleich zur Bildung eines positiven, vorwärtsgewandten Images bei.
Was die (inter)nationale Sichtbarkeit und Konkurrenzfähigkeit betrifft, ist es auf lange Sicht unabdingbar, die gesamte Stadtregion vor den Vorhang zu holen, als einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu positionieren und gemeinsame Alleinstellungsmerkmale aktiv zu promoten.
Maßnahmen:
W8 Sondierung der Rahmenbedingungen für einen stadtregionalen Image- und Markenbildungsprozess
W9 Best-Practice-Beispiele für stadtregionale Vermarktungs- und Organisationsstrategien von interkommunalen Wirtschaftsräumen sammeln
4. Gemeinsame Entwicklungsstandards für Betriebsgebiete
Je bedeutender Digitalisierungsprozesse und Informations- und Kommunikationstechologien in Zukunft werden, desto stärker werden sich viele der Unternehmen wandeln, die heute (noch) in den „klassischen“ Gewerbegebieten zu finden sind - und desto intensiver wird auch die Konkurrenz der Unternehmen um High Potentials und SpezialistInnen. Dabei wird man unweigerlich auch mit Unternehmen in Konkurrenz stehen, die sich in repräsentativen Lagen in den kreativ-urbanen Vierteln von Großstädten angesiedelt haben und auch wenn sich dabei heute noch um Zukunftsmusik handeln mag: Alleine aus diesem Grund müssen sich Städte und Gemeinden schon heute Gedanken über die Aufwertung und Weiterentwicklung ihrer Gewerbegebiete machen. Deren rein funktionale, städtebaulich und gestalterisch wenig ansprechenden und für (Schwerlast-)Verkehr optimierten Erscheinungsbilder sind in dieser Form vor allem dort nicht zukunftsfähig, wo der Anspruch besteht, erste Adresse für hochinnovative, IKT-orientierte Branchen zu sein.
Grundanforderungen für die Gestaltung, die Erschließung mit ÖV- und Radverkehr und städtebauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität sind Schritte, die innerhalb der Stadtregion erarbeitet werden und interkommunal zum Einsatz kommen können. Dabei es nicht um die totale Gestaltung von Betriebsgebieten, sondern um städtebaulich-funktionale Mindeststandards und Konzepte für die Übergangsbereiche zwischen Gewerbebereiche und umgebenden Raum.
Maßnahmen:
W10 „Qualitätshandbuch Gewerbegebiete“: Erarbeitung gemeinsamer Aufwertungsund Gestaltungsstandards
W11 stadtregional abgestimmte Konzepte zur ÖV- und Raderschließung von Betriebsgebieten
5. Transformationsstrategien für großflächige Betriebs- und Industriestandorte entwickeln
Die Flächen- und Nutzungsanforderungen an Betriebs- und Industriegebiete werden sich in der nahen Zukunft immer mehr verändern: Industrie 4.0 und Digitalisierung tragen dazu ebenso bei wie Entwicklungen im Mobilitäts- und Logistikbereich oder der Rückzug des großflächigen Einzelhandels aus bestimmten Flächenkategorien.
Damit stehen auch die etablierten Gewerbe- und Betriebszonen in der Stadtregion Wels vor Veränderungen, die schon im Vorfeld entsprechende planerische Antworten und Strategien benötigen. Die Themen reichen dabei von der vertikalen Verdichtung über die Neugestaltung von den Gewerbe- und Einzelhandelsportalen an den Eingangsbereichen von Wels bis hin zu Konzepten für die Nachnutzung von monofunktional strukturierten Fachmarktzentren oder der von freiwerdenden Flächen ehemals flächenextensiver Betriebe.
Maßnahmen:
W12 Konzept „Transformation Gewerbegebiete“ für die Stadtregion Wels: Gemeinsame Erarbeitung von Nachnutzungsstrategien/Mehrfachnutzungskonzepten monofunktional genutzter Gewerbe- und Betriebsstandorte
W13 Nachnutzungskonzepte für Landwirtschaftsschule Mistlbach als Innovation-Lab
6. Dezentrale Standorte mit Versorgungsfunktionen für das Hinterland stärken und ausbauen
Im funktionalen Netzwerk nehmen bestimmte Gemeinden in den Randlagen der Stadtregion eine wichtige Funktion als Versorgungsstandorte für das stadtregionale Hinterland bzw. die Gemeinden jenseits der Stadtregion Wels ein. Waren für den täglichen Bedarf und (soziale/ medizinische/sonstige) Dienstleistungen sollen in diesen dezentralen Versorgungsstandorten langfristig gesichert verfügbar sein bzw. das Angebot entsprechend ausgebaut werden.
Maßnahmen:
W14 Erstellung eines Ausstattungskataloges für dezentrale Versorgungsstandorte und Erarbeitung einer Strategie zu Ausbau und Sicherung des Versorgungsangebotes
7. Stadt- und Ortskerne stärken und Angebot bedarfsgerecht sichern
Egal ob „kleine Großstadt“ oder ländliche Gemeinden im Hinterland: die Ortskerne sind wesentliche Punkte, wenn es um die Versorgung, den sozialen Mittelpunkt oder die örtliche Identität geht. Aus diesem Grund ist es wichtig, Stadt- und Ortskerne in ihren Funktionen zu stärken und ihren funktional-ideellen Stellenwert ernst zu nehmen. Dabei können viele Gemeinden auf heu-
te weitestgehend intakte und ansprechend gestaltete Ortsmitten bauen, sie auf diesem Niveau zu erhalten, benötigt kontinuierliches Engagement und planerische Beschäftigung damit. Gerade deswegen, weil nicht nur die Stadt Wels, sondern auch andere Gemeinden in der Stadtregion auf einen breiten Erfahrungsschatz bauen können, was die Ortskernentwicklung betrifft, ist es wichtig, Erfahrungen auszutauschen und sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie man die Funktionen und die Bedeutung der Orts- und Stadtmitten in Zukunft sicher und ausbauen kann.
Maßnahmen:
W15 Konzept „Ortsmitte neu“ Schleißheim
W16 Stadtregionales Symposium/Dialogforum „Ortszentren in der Stadtregion Wels“
8. Ausbildungs- und Betreuungsangebot internationalisieren Nicht nur internationale, börsennotierte Großkonzerne haben Bedarf an internationalen Fachkräften, auch die mittelständisch geprägten Weltmarktführer und „Hidden Champions“ in der Stadtregion Wels konkurrieren bereits heute schon auf dem internationalen Arbeitsund Ausbildungsmarkt um die besten Köpfe aus aller Welt. Ein wichtiger Standortfaktor ist in diesem Zusammenhang nicht nur das Unternehmen als solches, sondern auch ein an internationalen Standards ausgerichtetes Betreuungs- und Bildungsangebot, das eine weltweit anerkannte und kompatible Ausbildung ermöglicht. Für internationale Spitzenkräfte mit Familie sind Schulen wie die International School Carinthia in Velden am Wörthersee ein ausschlaggebender Standortfaktor, der nicht nur in Großstädten wie Wien erwartet wird. Für eine nachhaltige und weiterhin konkurrenzfähige Entwicklung des Wirtschaftsraumes in und um die Stadtregion Wels ist die Etablierung von englischsprachigen bzw. internationalen Betreuungs- und Bildungsangeboten deshalb anzustreben.
Maßnahmen:
W17 Bedarfserhebung: Welche international ausgerichteten, mehrsprachigen Betreuungs- und Bildungsangebote werden von den Unternehmen nachgefragt bzw. erwünscht?
W18 Standortermittlung: Welche Voraussetzungen müssen geeignete Standorte dafür erfüllen und in welchen Städten/Gemeinden liegen sie?
STADTREGIONAL BEDEUTSAME ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE FÜR BETRIEBSGEBIETE
Die Entwicklung soll sich langfristig auf vier große und zusammenhängende Betriebsgebiete konzentrieren. Zentrale Voraussetzungen dabei sind: 1. Verfügbarmachung der benötigten Entwicklungsflächen 2. Interkommunal/stadtregional organisierte Umsetzung (Wirtschaftspark Voralpenland) 3. Städtebaulich-funktionale Kriterien für Entwicklung zukunftsfähiger, qualitativ hochwertiger Betriebsstandorte 4. Verkehrliche Erschließung
1 Wels Nordost Theoretisches Entwicklungspotenzial: ca. 40ha – Herausforderungen: Flächenverfügbarkeit herstellen
2 Wels Nord Theoretisches Entwicklungspotenzial: ca. 44ha – Herausforderungen: Flächenverfügbarkeit herstellen, Verkehrserschließung
3 Wels-Wimpassing/Gunskirchen-Hof Theoretisches Entwicklungspotenzial: ca. 125ha – Herausforderungen: Flächenverfügbarkeit herstellen, Hochwassermaßnahmen
4 Wels-West/Gunskirchen Theoretisches Entwicklungspotenzial: ca. 8 ha – Herausforderungen: Flächenverfügbarkeit herstellen, Verkehrsbelastung, Abstimmung zwischen unterschiedlichen Nutzungen (Wohnen, Gewerbe)
5 Wels Mitte – Entwicklungsschwrpunkt mit Transformationspotenzial; Zentraler Versorgungs-/Dienstleistungsstandort für die gesamte Stadtregion; Ausbau- und Belebungsmaßnahmen fortsetzen; temporäre Zwischennutzungen mit Fokus auf innovationsorientierte und/oder kreative Branchen.
6 Thalheim Komplettierung Betriebsbaugebiet „Am Thalbach“
7 Steinhaus Komplettierung Betriebsbaugebiet im Korridor zwischen Wels und Sattledt
8 Haiding Entwicklung von Nachnutzungskonzepten „Ziegelwerk Haiding“ in langfristiger Perspektive
9 Buchkirchen/Holzhausen
Herausforderungen: Grundstücksverfügbarkeiten, Verkehrserschließung. Die großflächige, betriebliche Standortentwicklung bedarf hier der Abwägung. Sie wird vonseiten der oö. Landesregierung negativ beurteilt; aus externer Sicht handelt es sich um einen verhältnismäßig kleinen, aber nicht unwesentlichen interkommunalen Komplementärstandort zu den großen Entwicklungspolen, der Teil des Wirtschaftsparks Voralpenland werden sollte.
STADTEINFAHRTEN MIT TRANSFORMATIONSPOTENZIAL
Aufwertung der Stadteinfahrten als „Visitenkarte“ und „Eingangsportale“ der Stadt in städtebaulicher und funktionaler Hinsicht.
STANDORT MIT TRANSFORMATIONSPOTENZIAL
Ehemalige landwirtschaftliche Fachschule Mistelbach Entwicklung eines Nachnutzungskonzepts mit stadtregionaler Relevanz (z.B. „Innovation-Campus Buchkirchen“)
V V
DEZENTRALE VERSORGUNGSSTANDORTE FÜR DAS HINTERLAND
Ausbau der Versorgungsfunktion der Standortgemeinden für die ländlich strukturierten Bereiche innerhalb der Stadtregion und auch für das anschließende Hinterland.
Grundlage
vorwiegend Wohnen
Bauland Kerngebiet
Betriebsbau-/Geschäfts-/Industriegebiet
Erweiterung Betriebsstandort (lt. ÖEK)
Potenzialflächen für den WirtschaftsparkVoralpenland
„Top-250-Unternehmen“ (eigene Erhebung)
Wald
Gewässer
Bahn
Autobahn
Landesstraße
sonst. niederrangige Straße
Abgrenzung Kooperationsraum
Leitbildbausteine
Stadtregional bedeutsame Entwicklungsschwerpunkte für Betriebsgebiete
Entwicklungsschwerpunkt mit Transformationspotenzial
Stadteinfahrten mit Transformationspotenzial
Standort mit Transformationspotenzial
Dezentrale Versorgungsstandorte für das Hinterland (Stadtregionale Versorgung)
Dezentrale Versorgungsstandorte für das Hinterland (Nahversorgung)
WELS-WIMPASSING/ GUNSKIRCHEN-HOF
WELS-WEST/ GUNSKIRCHEN

OFTERING
Mistelbach
Hundsham
BUCHKIRCHEN
Buchkirchen ca. 9,00 ha
Schule Mistelbach
HOLZHAUSEN

Bhf Marchtrenk
MARCHTRENK
WEIßKIRCHEN V V
Grassing
Sinnersdorf
HÖRSCHING
Weyerbach
EGGENDORF
SIPBACHZELL
Abb.20: Leitbild Wirtschaft, eigene Darstellung
Vor dem Hintergrund der Gestaltung eines klima- und umweltfreundlichen Mobilitätssystems geht es darum, den Trend der letzten Jahrzehnte mit einem stetigen Wachstum des Kfz-Verkehrs zu brechen und die Verkehrsarten öffentlicher Verkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr zu stärken. Dazu braucht es eine gute Abstimmung der weiteren Siedlungsentwicklung mit der ÖV-Erschließung und der Erschließung mit dem Radverkehr. In der Stadtregion Wels wurden in der Stadt Wels und in einigen Gemeinden bereits bisher eine aktive Radverkehrspolitik betrieben und ein Grundnetz für den Radverkehr aufgebaut. Die neuen technologischen Entwicklungen mit dem E-Bike eröffnen völlig neue Dimensionen für die Einsatzmöglichkeiten des Fahrrads im stadtregionalen Kontext. Der weitere Ausbau des Radwegenetzes, Lückenschlüsse im bestehenden Netz und die Qualitätsverbesserung bestehender Anlagen können einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in der Stadtregion leisten. Der Schwerpunkt der vorgeschlagenen Maßnahmen liegt daher im Folgenden beim Radverkehr. Für die weitere Entwicklung des öffentlichen Verkehrsangebotes und der übrigen Verkehrssysteme (MIV, Ruhender Verkehr, Fußgängerverkehr, multimodale Verkehrsangebote) sollte ein Gesamtverkehrskonzept für die Stadtregion Wels ausgearbeitet werden.
A. Allgemeine mobilitätspolitische Ziele:
1A Erhöhung der Anteile der Verkehrsarten des Umweltverbundes an den zurückgelegten Wegen
2A Stabilisierung der Zahl der Kfz-Wege im Personenverkehr trotz steigender Einwohnerzahl
3A Abstimmung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung bei der Flächenwidmungsplanung und Standortentwicklung
B. Leitziele zum Radverkehr:
1B Erhöhung des Radverkehrsanteils an allen Wegen
2B Entwicklung der Stadtregion Wels zur Modellregion für den Radverkehr
3B Etablierung von Radverkehrsbeauftragten in den Gemeinden
4B Weiterentwicklung eines regionalen Radroutennetzes für den Alltagsverkehr mit der Anbindung der wichtigsten Zielpunkte des Radverkehrs
5B Verpflichtende Erschließung von Wohn-, Betriebs-, Einkaufs- und Freizeitstandorten mit Radverkehrsanlagen
6B Erschließung von bestehenden grossen Betriebs- und Einkaufsstandorten mit dem Radverkehr
7B Verbesserung der Qualität der bestehenden Radverkehrsanlagen: Radnetz, Radabstellanlagen, Bike&Ride, Orientierungssystem
8B Verbesserung der Erreichbarkeit der Bahnhöfe und ÖV-Haltestellen mit dem Fahrrad
9B Bewusstseinsbildung für den Radverkehr als klimaschonendes, umweltverträgliches und platzsparendes Verkehrsmittel
REGIONALE RADROUTE KRENGLBACH-WELS
Mehrzweckstreifen Krenglbacher Straße bergaufwärts zwischen Ortszentrum und L519
Tempo 30 zwischen Ortszentrum und Schmidinger Straße
Temporeduktion durch bauliche Maßnahmen
Radweg an L519 zwischen Krenglbacherstraße und Welser Straße
Radweg R19 Donnerstraße – Forst
Lückenanschluss in der Vogelweiderstraße zwischen Römerstraße und Billrothstraße
Mehrzweckstreifen Krenglbacher Straße und Ziegeleistraße bergaufwärts
Asphaltierung entlang der Route Krenglbach–Sportplatzstraße–Katzbachstraße
Asphaltierung Feldweg von Katzbachstraße durch Doppelgraben bis Reiterhof
REGIONALE RADROUTE BUCHKIRCHEN-WELS
Asphaltierung Teilabschnitt zwischen Oberlaab und Mitterlaab
Radweg entlang Eferdinger Straße zwischen Schickenhäuser und Frühholzgasse
Querungshilfe Innviertler Straße zwischen Roithnerstraße und Wallerer Straße
ROUTE HOLZHAUSEN-BAHNHOF MARCHTRENK
Radweg entlang der Draxlholzstraße
REGIONALE RADROUTE THALHEIM-WELS
Lückenschluss Traunbrücke - Pater-Bernhard-Rodlberger-Straße (Querung nach Traunbrücke zu Pater-Bernhard-Rodlberger-Straße oder Mehrzweckstreifen zu Kreisverkehr)
Mehrzweckstreifen Pater-Bernhard-Rodlberger-Straße von Charwatweg bis Mühlenweg
REGIONALE RADROUTE SCHLEISSHEIM/WEISSKIRCHENWELS
Neuer Traunsteg mit Anbindung über Pfeffergasse oder Paradeisweg
Asphaltierung Birkenstraße zwischen Barbarossastraße und Ballstraße
Querungshilfe über die Bergernstraße
ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN
Versperrbare Fahrradboxen an den Bahnhöfen Wels, Gunskirchen und Haiding
R4: Rampe Höhe Karl-Wurmb-Straße/ Lottstraße
Beleuchtung Trepplweg zwischen Osttangente und Lottstraße
Priorisierung
# # # Short-List-Maßnahme: Kurzfristig umsetzbar, kommt für die Förderung in Frage
Long-List-Maßnahme, erste Priorität
Long-List-Maßnahme, zweite Priorität
Priorisierung
# # # Short-List-Maßnahme: Kurzfristig umsetzbar, kommt für die Förderung in Frage
Long-List-Maßnahme, erste Priorität
Long-List-Maßnahme, zweite Priorität
Durchgängige Radverbindung südlich der Traun bei der Marchtrenker Straße
Radweg entlang der B138 bis Betriebsgebiet Am Thalbach
Neuer Radweg östlich der Bahn von Katzbacher Straße bis Innviertler Straße
Radweg Innviertler Straße zwischen Haidinger Straße und Tankstelle
Neuer Radweg (südseitig in beide Richtungen) auf Voralpenstraße
Verlängerung Radweg am Damm
Radwegverbreiterung entlang Innviertler Bundesstraße B137 zwischen Eschenbachstraße und Friedhofsstraße
Macadam-Belag Am Bahndamm/Primelstraße
Neuer Geh- und Radweg entlang Bundesstraße B137 zwischen Hans-SachsStraße und Faßbinderstraße/Mitterweg
Grundlage
Siedlungsgebiet (lt. Flächenwidmungsplan)
Bauland Kerngebiet (lt. Flächenwidmungsplan)
Wald
Gewässer
Stadtzentrum Wels
Ortskern
Bahn
Autobahn
Landesstraße
sonst. niederrangige Straße
Abgrenzung Kooperationsraum
Maßnahmen
Regionales Hauptradroutennetz
Regionales Nebenradroutennetz
B&R
Bike & Ride Anlage
Long-List-Maßnahme, zweite Priorität # # #
Short List-Maßnahme: Kurzfristig umsetzbar, kommt für die Förderung in Frage
Long-List-Maßnahme, erste Priorität
Oberthan
BUCHKIRCHEN
Oberschauersberg
Sinnersdorf
Abb.22: Leitbild Mobilität, eigene Darstellung
Grundlage
vorwiegend Wohnen
Betriebsbau-/Geschäfts-/ Industriegebiet
Bauland Kerngebiet
Erweiterung Siedlungsgebiet
Erweiterung Betriebsstandort
Potenzialfläche für den Wirtschaftspark-Voralpenland Wald
Grünland
Gewässer
Europaschutzgebiet
Geländekante
Leitbildbausteine
Landschaft
Stadtregional bedeutsame Erholungsräume sichern Grüne Pufferzone entlang der Welser Kante sichern und entwickeln
Stadtregional bedeutsame Grün- und Erholungsräume vernetzen
Urbane Uferbereiche an der Traun gestalten Grünkorridore entlang von Bächen ausbauen Grünkorridore entlang der Graften ausbauen
Stadtzentrum Wels Stadtteilzentrum
Ortskern
„Top-250-Unternehmen“ Bahn
Autobahn
Landesstraße
sonst. niederrangige Straße
Abgr. Kooperationsraum
Siedlung Wirtschaft Mobilität
Siedlungsentwicklung auf stadtregionale Enwicklungsschwerpunkte konzentrieren
Potenzialräume für Innenentwicklung Identifizieren/ nutzen
Potenzialräume für zukunftsfähige Stadterweiterung nutzen
Ortszentren stärken und ausbauen
Potenzialräume „Gebiete im baulichen und demografischen Umbruch“ nutzen
Raumkanten zur Siedlungsgliederung ausbilden
Stadtregional bedeutsame Entwicklungsschwerpunkte für Betriebsgebiete
Entwicklungsschwerpunkt mit Transformationspotenzial
Stadteinfahrten mit Transformationspotenzial
lokaler Versorgungsstandort (Nahversorgung) Dezentrale Versorgungsstandort für das Hinterland (Stadtregionale Versorgung)
Regionales Hauptradroutennetz Regionales Nebenradroutennetz
INNENENTWICKLUNG QUARTIER AM LOKALBAHNHOF
WELS-WEST/ GUNSKIRCHEN
INNENENTWICKLUNG GUNSKIRCHEN
WELS-WIMPASSING/ GUNSKIRCHEN-HOF
STADTERWEITERUNG VOGELWEIDE
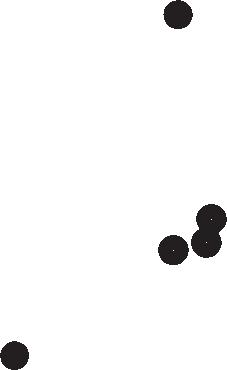
Europaschutzgebiet „Untere Traun”

Mistelbach
Hundsham
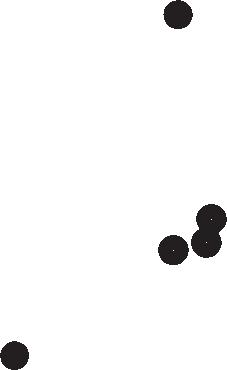
INNENENTWICKLUNG BUCHKIRCHEN
Wallerer Graf t
OFTERING
HOLZHAUSEN

Europaschutzgebiet „Welser Haide”
BUCHKIRCHEN/ HOLZHAUSEN
Bhf Marchtrenk
MARCHTRENK
WELS NORDOST
„UntereTraun”
WEIßKIRCHEN
Traunleiten
Sinnersdorf
Traunleiten
HÖRSCHING
STADTERWEITERUNG SCHAFWIESEN
INNENENTWICKLUNG BAHNHOFSVIERTEL
Grassing
WELS-MITTE
INNENENTWICKLUNG LAGERHAUSVIERTEL
Weyerbach
SIPBACHZELL
Bhf Unterhardt
EGGENDORF
Abb.23: Leitbild Gesamt, eigene Darstellung
Auf den folgenden Seiten werden alle vorgeschlagenen Maßnahmen zu den Themenfeldern Landschaft, Siedlung, Wirtschaft und Mobilität in vergleichender Weise und zusammenfassend dargestellt.
Diese Maßnahmenlisten sollen den EntscheidungsträgerInnen dabei helfen, eine Priorisierung in Bezug auf mögliche Umsetzungen vorzunehmen. Dazu wurden alle Maßnahmen nach folgenden Kategorien abgeschätzt:
• Sind die Maßnahmen investiv, also ergeben sich Kosten für bauliche Umsetzungen?
Ja/Nein
• Wie hoch ist der Finanzierungsbedarf abzuschätzen?
- gering (bis ca. €50.000,-)
- mittel (bis ca. €100.000,-)
- hoch (über €100.000,-)
• Wie groß ist die Stadtregionale Wirkung?
- gering (1 Gemeinde)
- mittel (2 Gemeinden)
- hoch (über 2 Gemeinden)
• Wie langfristig ist der Umsetzungshorizont abzuschätzen?
- kurzfristig (bis 1 Jahr)
- mittelfristig (bis 3 Jahre)
- langfristig (über 3 Jahre)
Die Maßnahmen zu den Themenfeldern Landschaft, Siedlung und Wirtschaft (Long Lists) sind alle 1. Priorität, im Themenfeld Mobilität werden zudem Maßnahmen der 2. Priorität aufgelistet.
Im anschließenden Kapitel (4. Umsetzungsstrategien) wird eine Auswahl an Maßnahmen zur Umsetzung im Rahmen des IWB-Förderprogramms empfohlen.
Tabelle 1: Übersicht und Bewertung der Maßnahmen
Landschaft
MASSNAHMEN – 1. PRIORITÄT
L1 Konzept zur stadtregional abgestimmten Bestimmung von (informellen) Vorrangflächen und zur planerischen Festlegung des „Grüngürtels Wels“
L2 Schaffung von Orientierungspunkten und Mosaiksteinen innerhalb des Freiraumverbundes – „Bank-Baum-Platz“
L3 Identifizierung der für die Gründkorridore zentralen Bereiche und Erarbeitung stadtregional abgestimmter Maßnahmen zu deren Sicherung
L4 Schutz und Entwicklung der Auwälder beiderseits der Traun
L5 Sicherung des schmalen, noch verbliebenen Uferstreifens im Stadtgebiet Wels/Thalheim
L6 Erschließung der Traun für eine naturverträgliche Erholungs- u. Freizeitnutzung
L7 Schaffung von Naturerlebnis-Rastplätzen entlang der Traun – „Traunplätze“
L8 Vernetzung der Gemeinden nördlich und südlich der Traun durch Stege im Bereich Schleißheim und Gunskirchen
L9 Pumptrack Gunskirchen als hochwertiges, stadtregional bedeutsames Freizeitangebot
L10 Traunsteg
L11 Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Wels und Gunskirchen
L12 Ausweisung von Vorrangflächen mit besonderer ökologischer Bedeutung
L13 Gebietsbetreuung hinsichtlich einer naturschutzfachlichen Vermittlung und Besucherlenkung
L14 Abrundung der Bauland- u. Siedlungsentwicklung (keine Erweiterung)
INVESTIV FINANZIERUNGSBEDARF
WIRKUNG UMSETZUNGSHORIZONT
L15 Verbesserung der Zugänglichkeit und Erlebbarkeit als Natur- u. Naherholungsraum ja nein gering (bis ca. €50.000,-) mittel (bis ca. €100.000,-) hoch (über €100.000,-) gering (1 Gemeinde) mittel (2 Gemeinden) hoch (über 2 Gemeinden)
kurzfristig (bis 1 Jahr) mittelfristig (bis 3 Jahre) langfristig (über 3 Jahre)
Short-list-Maßnahme
MASSNAHMEN – 1. PRIORITÄT
L16 Verknüpfung und grüner Lückenschluss mit Welser Kante über die Gewässerkorridore Mühlbach und Moosbach, sowie Vorrangflächen für Erholung
L17 Verbesserung der Anbindung von Gunskirchen und Waidhausen mit Stadtgebiet Wels
L18 Naherholungspotenzial durch ehemalige Schottergruben und deren Status als Vorrangflächen für Erholung sowie durch die Lage am Flusskorridor nutzen
L19 Verbesserung der Zugänglichkeit und Erschließung durch Traun-Steg bei Schleißheim
L20 Verknüpfung und grüner Lückenschluss mit der Welser Kante über die Gewässerkorridore Mühlbach und Waldgebiete nördlich Autobahn
L21 Ausweisung landwirtschaftlicher Vorrangflächen zur Erhaltung der kleinteiligen Kulturlandschaft
L22 Sicherung der ökologischen Funktionen und Ausbau der Freizeitnutzung Linetwald
L23 Renaturierung der Ziegellehmgrube Buchkirchen
L24 Hoch- bzw. Hangwasserschutzmaßnahmen in der Stadtregion Wels
L25 Erfassung aller aufzuwertender bzw. neu anzulegender Wegerouten innerhalb des Grünsystems und Priorisierung ihrer Umsetzung
L26 stadtregional abgestimmter Gestaltungskatalog für Ortsrandabrundungen und Gestaltung von Übergangsbereichen zwischen Siedlung und Landschaft
L27 Gestaltung von Ortsrandabschlüssen in kommunale Planung und Siedlungsentwicklung integrieren
INVESTIV
FINANZIERUNGSBEDARF
STADTREGIONALE WIRKUNG
UMSETZUNGSHORIZONT
Tabelle 1 (Fortsetzung): Übersicht und Bewertung der Maßnahmen Landschaft Short-list-Maßnahme
Tabelle 2: Übersicht und Bewertung der Maßnahmen Siedlung
MASSNAHMEN – 1. PRIORITÄT
S1 abgestimmte bzw. bilaterale Koordination der Siedlungsentwicklung, wo es aus planerischen Erwägungen heraus notwendig ist (z.B. Wels Nord)
S2 stadtregional einheitliche Erfassung von Innenentwicklungspotenzialen
S3 stadtregional abgestimmte Innenentwicklungsmaßnahmen und -prinzipien erarbeiten
S4 stadtregionale Workshops mit Beteiligung von ExpertInnen für Problemaufriss und kartographische Festlegung betroffener Teilbereiche sowie für Erarbeitung gemeinsamer Qualitätskriterien zur Steuerung der dortigen Entwicklung
S5 gemeinsame Erklärung zur Implementierung von Qualitätsstandards für Nachverdichtungsvorhaben im Bestand in die örtliche Raumplanung
S6 stadtregional abgestimmte und einheitliche Erfassung von Baulandreserven in einer Flächenmanagement-Datenbank
S7 Erarbeitung von Bewusstseinsbildungsmaßnahmen und direkter Ansprache von GrundstückseigentümerInnen
S8 Traunschiff Thalheim
S9 Stadtregionales Dialogforum „Best Practice Ortskern-/Innenstadtentwicklung in der Stadtregion Wels“
S10 Schleißheim Ortskern: z.B. Ideenwettbewerb für Neunutzung Parkplatz-Grundstück
S11 Erarbeitung eines Anspruchs- und Qualitätskatalogs für die Entwicklung künftiger Stadterweiterungsgebiete
S12 stadtregionaler Workshop „Wohnformen der Zukunft“
INVESTIV
UMSETZUNGSHORIZONT
Short-list-Maßnahme
MASSNAHMEN – 1. PRIORITÄT
W1 Einrichtung eines stadtregionalen Gewerbeflächendatenbank (über den Wirtschaftspark Voralpenland hinaus)
W2 stadtregional abgestimmte Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und zum aktiven „Marketing“ bei der Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen
W3 stadtregionaler Tauschflächenpool
W4 Entwicklung von neuartigen Verwertungsmodellen in Kooperation mit Unternehmen und FlächeneigentümerInnen
W5 Stadtregionale Konferenz zur Zukunft des Wirtschaftsparks Voralpenland
W6 Bilaterale Arbeitsgruppen zur (Weiter-) Entwicklung von Betriebsgebieten mit interkommunaler Planungserfordernis unter fachlicher Begleitung
W7 stadtregionale Arbeitsgruppe Breitbandausbau
W8 Sondierung der Rahmenbedingungen für einen stadtregionalen Image- und Markenbildungsprozess
W9 Best-Practice-Beispiele für stadtregionale Vermarktungs- und Organisationsstrategien von interkommunalen Wirtschaftsräumen sammeln
W10 Erarbeitung gemeinsamer Aufwertungs- und Gestaltungsstandards
W11 stadtregional abgestimmte Konzepte zur ÖV- und Raderschließung von Betriebsgebieten
W12 gemeinsame Erarbeitung von Nachnutzungsstrategien/Mehrfachnutzungskonzepten monofunktional genutzter Gewerbe- und Betriebsstandorte
W13 Nachnutzungskonzepte für Landwirtschaftsschule Mistlbach als Innovation-Lab
INVESTIV
FINANZIERUNGSBEDARF
STADTREGIONALE WIRKUNG
Tabelle 3: Übersicht und Bewertung der Maßnahmen Wirtschaft
UMSETZUNGSHORIZONT
Tabelle 3 (Fortsetzung): Übersicht und Bewertung der Maßnahmen Wirtschaft
MASSNAHMEN – 1. PRIORITÄT
W14 Erstellung eines Ausstattungskataloges für dezentrale Versorgungsstandorte und Erarbeitung einer Strategie zu Ausbau und Sicherung des Versorgungsangebotes
W15 Konzept „Ortsmitte neu“ Schleißheim
W16 Stadtregionales Symposium/Dialogforum „Ortszentren in der Stadtregion Wels“
W17 Bedarfserhebung: Welche international ausgerichteten, mehrsprachigen Betreuungs- und Bildungsangebote werden von den Unternehmen nachgefragt bzw. erwünscht?
W18 Standortermittlung: Welche Voraussetzungen müssen geeignete Standorte dafür erfüllen und in welchen Städten/ Gemeinden liegen sie?
INVESTIV
ja nein
FINANZIERUNGSBEDARF
STADTREGIONALE WIRKUNG
UMSETZUNGSHORIZONT
gering (bis ca. €50.000,-) mittel (bis ca. €100.000,-) hoch (über €100.000,-)
gering (1 Gemeinde) mittel (2 Gemeinden) hoch (über 2 Gemeinden)
kurzfristig (bis 1 Jahr) mittelfristig (bis 3 Jahre) langfristig (über 3 Jahre)
Das Zielnetz des regionalen Radroutenkonzepts für die Stadtregion Wels umfasst Haupt- und Nebenrouten. Das Hauptroutennetz verbindet die Gemeindehauptorte in erster Linie mit dem Stadtzentrum von Wels und den regional bedeutsamen Bahnhöfen (Wels, Gunskirchen, Haiding). Nebenrouten stellen Netzergänzungen zur Erschließung von Ortschaften, größeren Siedlungs- und Betriebsgebieten sowie Freizeitmöglichkeiten dar, sofern diese nicht bereits durch Hauptrouten erschlossen wurden. Im Folgenden werden die Maßnahmen zur Ertüchtigung des regionalen Hauptroutennetzes, die in zwei Workshops gemeinsam mit VertreterInnen der Region entwickelt wurden, nach folgenden Kriterien bewertet und in Maßnahmen erster und zweiter Priorität eingeteilt (Tab. 4 und 5):
• Lage an Hauptrouten
• gemeindeübergreifende Wirkung
• Nachfragepotenzial (gesellschaftlicher Nutzen)
• Anbindung regional bedeutsamer Bahnhöfe
• kurzfristige Umsetzbarkeit: Baubeginn bis 2020, Fertigstellung bis 2023
Tabelle 4: Übersicht und Bewertung der Maßnahmenbündel Mobilität
MASSNAHMEN – 1. PRIORITÄT 2 LAGE AN HAUPTROUTE
M1 Mehrzweckstreifen Krenglbacher Straße bergaufwärts zwischen Ortszentrum und L519
M2 Temporeduktion zwischen Ortszentrum und Schmidinger-Straße: Tempo 30, Bodenmarkierungen
1 bis 2020: Baubeginn, bis 2023: Fertigstellung
2 siehe auch „Leitbildkarte Mobilität“
GEMEINDEÜBERGREIFENDE WIRKUNG NACHFRAGEPOTENIAL ANBINDUNG AN BAHNHOF
M3 Temporeduktion zwischen Ortszentrum und Schmidinger Straße durch bauliche Maßnahmen /
M4 Radweg an L519 zwischen Krenglbacher Straße und Welser Straße
M5 Radweg R19 Donnerstraße – Forst
M6 Lückenschluss in der Vogelweiderstraße zwischen Römerstraße und Billrothstraße
M7 Mehrzweckstreifen bergauf in Ziegeleistraße zwischen Krenglbach Zentrum und bestehenden Radweg zum Bahnhof Haiding
M8 Asphaltierung Teilabschnitt zwischen Oberlaab und Mittellaab
M9 Radweg Eferdinger Straße (L531) zwischen Schickenhäuser und Abzweigung nach Oberlaab
M10 Querungshilfe Innviertler Straße zwischen Roithenstraße und Wallerer Straße (Schutzweg)
M11 Radweg entlang Draxlholzstraße
M12 Lückenschluss Traunbrücke – Pater-Bernhard-Rodlberger-Straße
M13 Mehrzweckstreifen Pater-Bernhard-Rodlberger Straße von Charwatweg bis Mühlenweg
M14 Neuer Traunsteg Schleißheim – Wels mit Anschluss Pfeffergasse oder Paradeisweg
MASSNAHMEN – 1. PRIORITÄT 2 LAGE AN HAUPTROUTE
M15 Asphaltierung Birkenstraße zwischen Barbarossastraße und Ballstraße
M16 Querungshilfe Bergernstraße
M17 Versperrbare Fahrradboxen an den Bahnhöfen Wels, Gunskirchen und Haiding
M18a R4: Rampe Höhe Karl-Wurmbstraße/Lottstraße
M18b Beleuchtung Trepplweg zwischen Osttangente und Lottstraße
M19 Durchgängige Radverbindung südlich der Trasse bei der Marchtrenker Straße
M20 Radweg entlang des Thalbachs bis Betriebsgebiet Am Thalbach
GEMEINDEÜBERGREIFENDE WIRKUNG
Tabelle 4 (Fortsetzung): Übersicht und Bewertung der Maßnahmenbündel Mobilität
NACHFRAGEPOTENIAL ANBINDUNG AN BAHNHOF
M23a Asphaltierung entlang der Route Krenglbach – Sportplatzstraße –Katzbachstraße /
M23b Asphaltierung Feldweg von Katzbachstraße durch Doppelgraben bis Reiterhof
M24 Neuer Geh- und Radweg (südseitig in beiden Richtungen) auf der Voralpenstraße
M27 Asphaltierung Radroute am Bahndamm/Westbahnstraße Umsetzung eines einheitlichen Wegweisesystems auf allen regionalen Hauptrouten: Piktogramme auf der Fahrbahn mit Richtungspfeilen und Zielangabe, Beschilderung gemäß RVS-Radverkehr
1 bis 2020: Baubeginn, bis 2023: Fertigstellung 2 siehe auch „Leitbildkarte Mobilität“
Tabelle 4 (Fortsetzung): Übersicht und Bewertung der Maßnahmenbündel Mobilität
MASSNAHMEN – 2. PRIORITÄT 2 LAGE AN HAUPTROUTE
M21 Neuer Radweg östlich der Bahn von Katzbacher Straße bis Innviertler Straße
M22 Radweg Innviertler Straße zwischen Haidinger Straße und Tankstelle an Innviertler Straße
M25 Verlängerung Radweg von neuem Traunsteg am Damm bis Lottstraße
M26 Radwegverbreiterung entlang Innviertler Bundesstraße B137 zwischen Eschenbachstraße und Friedhofstraße
M28 Neuer Geh- und Radweg entlang B137 zwischen Hans-Sachs-Straße und Faßbinderstraße/Mitterweg
1 bis 2020: Baubeginn, bis 2023: Fertigstellung 2 siehe auch „Leitbildkarte Mobilität“
GEMEINDEÜBERGREIFENDE WIRKUNG
Ausgehend von den Prioritäten erfolgt eine Beschreibung der Maßnahmen nach Hauptrouten (Tab. 5: Long list der Maßnahmen und Prioritäten – Empfehlung) . Daraus werden jene Maßnahmen extrahiert, die kurzfristig umsetzbar erscheinen, bei denen also ein Umsetzungsbeginn bis 2020 und eine Fertigstellung bis 2023 möglich erscheint.
1. PRIORITÄT
ROUTE
KURZFRISTIG UMSETZBAR
M1: Mehrzweckstreifen Krenglbacher Straße bergaufwärts zwischen Ortszentrum und L519
M2: Tempo 30 zwischen Ortszentrum und Schmidinger Straße
M2: Temporeduktion durch Bodenmarkierungen
Tabelle 5: Übersicht und Bewertung der Maßnahmenbündel Mobilität
2. PRIORITÄT
MITTELFRISTIG/ LANGFRISTIG UMSETZBAR KURZFRISTIG UMSETZBAR
MITTELFRISTIG/ LANGFRISTIG UMSETZBAR
M3: Temporeduktion durch bauliche Maßnahmen
M4: Radweg an L519 zwischen Krenglbacher Straße und Welser Straße
M5: Neuer Radweg entlang der Autobahn zwischen Welserstraße und Donnerstraße
M23a: Asphaltierung Feldweg entlang der Route Krenglbach–Sportplatzstraße–Katzbach
M23b: Asphaltierung Feldweg Doppelgraben – Reiterhof
M7: Mehrzweckstreifen bergauf in Ziegeleistraße zwischen Krenglbach Zentrum und bestehenden Geh- und Radweg
M8: Asphaltierung Teilabschnitt zwischen Oberlaab und Mittellaab
M10: Querungshilfe Innviertler Straße zwischen Roithenstraße und Wallerer Straße (Schutzweg)
M6: Lückenschluss in der Vogelweiderstraße zwischen Römerstraße und Billrothstraße
M9: Radweg entlang Eferdinger Straße zwischen Schickenhäuser und Abzweigung Oberlaab
M11: Radweg entlang der Draxlholzstraße
Tabelle 5 (Fortsetzung): Übersicht und Bewertung der Maßnahmenbündel Mobilität
ROUTE
Thalheim –Wels
Weißkirchen –Wels
R4
Krenglbach
Buchkirchen
1. PRIORITÄT
KURZFRISTIG UMSETZBAR
M12: Lückenschluss Traunbrücke – Pater-Bernhard-Rodlberger-Straße
M13: Mehrzweckstreifen
Pater-Bernhard-Rodlberger-Straße von Charwatweg bis Mühlenweg
M20: Radweg entlang der B138 bis Betriebsgebiet Am Thalbach
M15: Asphaltierung Birkenstraße zwischen Barbarossastraße und Ballstraße
M19: Durchgängige Radverbindung südlich der Traun bei der Marchtrenker Straße
2. PRIORITÄT
MITTELFRISTIG/ LANGFRISTIG UMSETZBAR KURZFRISTIG UMSETZBAR
MITTELFRISTIG/ LANGFRISTIG UMSETZBAR
M18: Rampe Höhe KarlWurmb-Straße/Lottstraße
M23a: Asphaltierung Feldweg entlang der Route Krenglbach – Sportplatzstraße – Katzbach
M16: Querungshilfe über die Bergernstraße
M14: Neuer Traunsteg mit Anbindung über Pfeffergasse oder Paradeisweg
M25: Verlängerung Radweg von neuem Traunsteg am Damm bis Lottstraße (R4)
M21: Neuer Radweg östlich der Bahn von Katzbacher Straße bis Innviertler Straße
M22: Radweg Innviertler Straße zwischen Haidinger Straße und Tankstelle
M24: Neuer Geh- und Radweg auf der Voralpenstraße
M23b: Asphaltierung Feldweg Doppelgraben – Reiterhof Wels
Gunsk.Wels
Bike & Ride
Alle Routen
M27: Asphaltierung Radroute Am Bahndamm – Westbahnstraße
M17: Versperrbare Fahrradboxen an den Bahnhöfen Wels, Gunskirchen, Haiding
Wegweisesystem mit Piktogrammen, Richtungspfeilen und Zielangaben, Beschilderung
M26: Radwegverbreiterung entlang B137 zwischen Eschenbachstraße und Friedhofstraße
M28: Neuer Geh- und Radweg entlang B137 zwischen HansSachs-Straße und Faßbinderstraße / Mitterweg


Das Stadtregionale Forum wird umsetzungsfähige Projekte auswählen, die im Rahmen einer EFRE-Förderung eingereicht werden können. Da der Fokus der Förderung auf investiven Projekten liegt und eine bestimmte Fördersumme nicht überschritten werden kann, sind die Förderungen auf bestimmte, in der Förderrichtlinie genannte Umsetzungsprojekte angewiesen.
Voraussetzungen für die Auswahl von Umsetzungsprojekten sind folgende Projektselektionskriterien:
• Konformität mit inhaltlichen Kriterien des operationellen Programms und Ableitung aus Stadtregionaler Strategie
• Beitrag zur Zielerreichung der Stadtregionalen Strategie
• Nachhaltigkeit der positive Wirkung auf die Stadtregion
• Kooperationsfördernde Wirkung – auf möglichst viele Gemeinden der Stadtregion
• Gesellschaftliche Relevanz – möglichst viele BürgerInnen profitieren
Der zeitliche Förderrahmen bis 2020 bedingt, dass die Stadtregionale Strategie inklusive der Prioritätenliste mit den Umsetzungsprojekten und den drei konzipierten Projekten vom Stadtregionalen Forum beschlossen werden, um anschließend die Umsetzungsprojekte auszuarbeitet. Für die (förderfähigen) Umsetzungsprojekte müssen Kosten und damit konkrete Planungen in hohem Detaillierungsgrad spätestens im Jahr 2019/20 vorliegen. Aus dem Förderprogramm und dem abgeleiteten Zeitplan ergeben sich daher kausale Abhängigkeiten.
Die Short list-Projekte sind auch jene Projekte, die für eine Einreichung im IWB/EFRE-Förderprogramm in Frage kommen (Tab. 4: Empfehlung zur Short list potenzieller Förderprojekte). Diese finden sich im folgenden Kapitel der Umsetzungsstrategien.
Die Umsetzungsprojekte der Short List werden zu Maßnahmenbündeln geschnürt, was sich konzeptionell, strategisch oder räumlich begründen lässt. Aus der Kombination von Prioritätenreihung und Umsetzbarkeit ergeben sich folgende Empfehlungen möglicher Umsetzungsprojekte aus den Bereichen Landschaft, Siedlung und Mobilität, die für eine Förderung im Rahmen von IWB/EFRE in Frage kommen:
MASSNAHMENBÜNDEL A „AUFENTHALTSORTE IN DER STADTREGION“ STANDORTGEMEINDE
L2 Schaffung von Orientierungspunkten und Mosaiksteinen innerhalb des Freiraumverbundes – „Bank-Baum-Platz“
L7 Schaffung von Naturerlebnis-Rastplätzen entlang der Traun –„Traunplätze“
MASSNAHMENBÜNDEL B „DAS TRAUNSCHIFF UND DIE TRAUNINSEL“
Wels (16), Holzhausen (1), Buchkirchen (2), Krenglbach (2), Schleißheim (3)
Wels (4), Gunskirchen, Steinhaus, Thalheim, Schleißheim, Weißkirchen
S6 „Traunschiff“ Thalheim
L10 „Trauninsel“ Wels
WEITERE SHORT LIST-MASSNAHMEN
L9 Pumptrack Gunskirchen als hochwertiges, stadtregional bedeutsames Freizeitangebot
L16 Verknüpfung und grüner Lückenschluss mit Welser Kante über die Gewässerkorridore Mühlbach und Moosbach, sowie Vorrangflächen für Erholung
L18 Naherholungspotenzial durch ehemalige Schottergruben und deren Status als Vorrangflächen für Erholung sowie durch die Lage am Flusskorridor nutzen
L20 Verknüpfung und grüner Lückenschluss mit der Welser Kante über die Gewässerkorridore Mühlbach und Waldgebiete nördlich Autobahn
Gunskirchen
Wels, Gunskirchen
Wels, Schleißheim, Weißkirchen
Wels, Gunskirchen, Krenglbach, Buchkirchen
Tabelle 6 (oben): Umsetzungsprojekte Landschaft – Short List
Tabelle 7 (unten): Umsetzungsprojekte Siedlung –Short List
Aus den beiden Maßnahmen des Moduls „Bank – Baum – Platz“ (L2) und den Naturerlebnis-Rastplätze an der Traun – Traunplätze“ (L7) wird das Umsetzungsprojekt „Aufenthaltsorte in der Stadtregion“ geschnürt.
Die Schaffung von Naturerlebnis-Rastplätzen entlang der Traun ist im Zusammenhang mit Anforderungen an das Europaschutzgebiet „Untere Traun“ und „Natura 2000“ (Managementplan) zu verstehen und trägt zur Belebung der Erholungsnutzung bei. Besucherlenkung und naturschutzfachliche Vermittlung stehen im Vordergrund. Die Ausstattung der Rastplätze besteht aus Sitzmöglichkeiten, Spielgeräten für Kinder und Hinweis- und Vermittlungstafeln.
Wichtige Kriterien in der konkreten Planung und Umsetzung der Rastplätze sind dabei neben einer geeigneten und aus naturräumlicher Sicht verträglichen Standortwahl:
• eine standortgerechte Einbettung der Aufenthaltsbereiche hinsichtlich Erschließung, Ausdehnung und Orientierung
• eine der naturräumlichen Umgebung angepasste Ausstattung vorzugsweise die Verwendung nachhaltiger und unbehandelter Holzmaterialien und sickerfähiger Belagsdecken wie z.B. wassergebundene Sanddecken
• eine Ergänzung der rahmenden Bepflanzung mit standortgerechte Gehölzen
• die Entwicklung eines „Branding“ und eines einheitlichen visuellen Erscheinungsbildes der Rastplätze, gerade was die Gestaltung der Hinweis- und Vermittlungstafeln oder der Sitzelemente und Spielgeräte betrifft, um den regionalen Zusammenhang deutlich zu machen
• eine gemeinsame Vermarktung mit dem Fokus auf Wasser- und Au-Erlebnis entlang der Traun
Folgende Standorte werden vorgeschlagen (Auswahl):
Wels
• Schafwiesen/BMX-Bahn
• Traunuferstr./Trodatsteg
• Traunuferpromenade/Traunstrand
• Traunau/Tannenstr.
Steinhaus: Am E-Werk Schleißheim: Am Traunsteg
MODUL „BANK-BAUM-PLATZ“ Wiedererkennbares Element an geeigneten Orten innerhalb der Siedlungs- und Kulturlandschaft wie z.B. an Kreuzungsbereichen von Wegen, an Anhöhen mit Sichtbezügen, an Orten mit geschichtlicher Bedeutung oder etwa auch an zentralen innerörtlichen Standorten mit Aufenthaltsqualität.
Das Grundmodul besteht aus einer Sitzbank und einer Baumpflanzung, die einen Platz definieren. Je nach Größe der Örtlichkeit können mehrere Module kombiniert werden.
Als Vorteile werden die geringen Herstellungskosten und die vergleichsweise einfache Verfügbarkeit von geeigneten Orten gesehen. Gestaltungsanspruch:
• Hochwertige Bank auswählen
• hochwertige Beläge (Naturstein) auswählen und verarbeiten
• großkronigen Baum auswählen mit Weitenwirkung und Identitätsstiftung
Kriterien in der konkreten Planung und Umsetzung sind auch hier
• einen geeignete Standortwahl,
• eine optimale Orientierung und Platzierung der Sitzmöglichkeit und des Baumes,
• die Wahl eines robusten, schlichten und nachhaltigen Sitzelement–Fabrikates,
• die Wahl einer großkronigen, heimischen Baumart mit Weitenwirkung und Identitätsstiftung wie z. B. Winter-Linde (Tilia cordata), Stiel-Eiche (Quercus robur), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) oder Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Mindestqualität HST, 4xv., STU 20/25 cm,
• die Verwendung von Belagsdecken aus Naturstein wie z.B. Granit-Kleinsteinpflaster, falls der Platz befestigt werden sollte
Folgende Standorte werden vorgeschlagen (Auswahl):
Wels
• Reinberg/Lokalbahn
• Traundamm/EWE
• Sandwirtstr./Gärtnerstr.
• Mariensäule
• Burggasse/Burggarten
• Adlerstr./Fischergasse
• Radweg/Autobahnbrücke
• A8 Einhausung/Europastr.
• Slacklinepark/Lichteneggerstr.
• Römerstr./Albert-Schw.-Str.
• Bahndamm/Europastr.
• Böhmerwaldstr./Karl-Görl.-Str.
• Eferdingerstr./Osttangente
• Kamerlweg
• Schießstättenstr./Traunradweg
• VS Vogelweide
Buchkirchen
• Kandlberg
• Früholzgasse
Krenglbach
• Schmiding
Holzhausen, Schule
Weitere Standorte lassen sich entsprechend der Qualitätsanforderungen, nach Grundstücksverfügbarkeiten und Finanzierungsmöglichkeiten ergänzen.
Zu empfehlen ist jedenfalls eine fachliche Begleitung/Beratung bei Standortwahl und Planung der Aufenthaltsorte durch eine/n Landschaftsplaner/in. Die Findung eines geeigneten Corporate Designs für die „Aufenthaltsorte in der Stadtregion“ könnte über einen niederschwelligen Gestaltungswettbewerb unter Beteiligung der Fachbereiche Design und Landschaftsplanung gelingen.
Der Mehrwert des Moduls „Bank-Baum-Platz“ liegt in der Schaffung von innerörtlichen Aufenthaltsmöglichkeiten, die eine städtebauliche Aufwertung des Umfelds bedeuten und nicht zuletzt auch Verweil- und Rastmöglichkeiten für diejenigen bieten, die aufgrund ihres Alters oder körperlichen Verfassung nur noch kürzere Wegstrecken am Stück zurücklegen können; der Anteil der älteren Bevölkerung wird in allen Gemeinden der Stadtregion mehr und mit dem Bank-Baum-Platz-Konzept setzt man ein diesbezügliches Zeichen.
Durch das angestrebte einheitliche Design und den damit verbundenen Wiedererkennungswert haben die Bank-Baum-Platz-Module aber nicht nur diesen funktionalen Mehrwert, sondern sind zusätzlich ein sichtbares und nutzbares Symbol für die Zugehörigkeit zur Stadtregion Wels. In weiterer Folge lassen sich neue Bank-Baum-Platz-Module auch als Rastpunkte ins stadtregionale Radwege- und Freizeitwegenetz einbinden.
TRAUNSCHIFF
Basierend auf einer Idee der örtlichen Volksschule hat sich in der Marktgemeinde Thalheim bei Wels eine Projektidee entwickelt, die eine funktionale und symbolische Aufwertung des Traunuferbereichs vorsieht und dabei für die gesamte Stadtregion Wels ein gemeinsam nutzbares Aushängeschild sein kann: das Traunschiff. Auf einem gebrauchten, nicht mehr motorisierten Schiff soll am Traunufer ein multifunktionaler Raum geschaffen werden, der Platz für folgende Möglichkeiten bietet:
• Schule und öffentliche Bibliothek
• öffentliches Restaurant/Café
• multifunktionaler Veranstaltungsraum
• Ort für standesamtliche Trauungen des Standesamtsverbandes
• Raum für temporäre Kreativnutzungen
Mit dem Traunschiff wird ein Ort für Freizeit, Erholung und Kultur geschaffen, von dem nicht nur die Thalheimer Bevölkerung profitiert, sondern die gesamte Stadtregion. Im Freizeitwegenetz entlang der Traun entsteht ein stadtregional bedeutsamer multifunktionaler Knotenpunkt mit Gastronomie und Verpflegung; von der Möglichkeit, standesamtliche Trauungen in diesem ungewohntem, feierlichen Ambiente durchführen zu können, profitieren die Gemeinden des Standesamtsverbands (und darüber hinaus). Das Traunschiff kann dadurch nicht nur Bindeglied zwischen Thalheim und Wels, sondern auch zwischen vielen Gemeinden innerhalb der Stadtregion sein. Schon bei der Ausarbeitung des Nutzungs- und Betreiberkonzeptes kann der stadtregionale Gedanke gewürdigt werden, indem alle Gemeinden der Stadtregion an diesem Prozess beteiligt werden.
Zwischen der Traunbrücke und der Eisenbahnbrücke soll eine Schwimmsteganlage errichtet werden, um die Erholungsqualität des Traunuferbereichs im dicht besiedelten Abschnitt des Flusses zu verbessern und das für die gesamte Stadtregion prägende Gewässer zugänglicher und erlebbarer zu machen.
Als Teil eines Freizeitparks in Gunskirchen versteht sich dieser sogenannte Pumptrack als Beitrag zu einem Sport- und Freizeitangebot für Jugendliche in der Stadtregion. Über den Traunradweg ist diese Anlage sehr gut an das regionale Radwegenetz angebunden und für NutzerInnen aus den Anrainergemeinden gut zu erreichen.
Als erste Freizeitanlage in dieser Form in Oberösterreich lässt der Pump Track eine Strahlkraft in die gesamte Stadtregion erwarten. Er fügt sich schlüssig als Baustein in das Freizeitangebot entlang der Traun ein und bildet einen „Trittstein“ sowohl vom Siedlungsgebiet Gunskirchen an die Traun als auch vom Gemeindegebiet Gunskirchen in die benachbarten Gemeinden Wels und Steinhaus.
In der Freizeitanlage des Pump Track können Kinder und Jugendliche der Stadtregion Sportund Bewegungsbedürfnissen nachkommen, der Ort ist Raum und Anlass für Treffpunkte und Kommunikation über die Gemeindegrenzen hinaus.
Tabelle 8: Umsetzungsprojekte Mobilität – Short List
MASSNAHME
Für die Auswahl der Short-list-Projekte wurden die Projekte der 1.Prioritätsstufe auf eine kurzfristige Umsetzbarkeit (Baubeginn bis 2020, Fertigstellung bis 2023) geprüft. Die Short-list-Projekte wurden gemeinsam mit den Gemeindevertretern ausgewählt. Dabei wurde auch auf eine ausgewogene Verteilung der Projekte innerhalb der Stadtregion Bedacht genommen. Die ausgewählten Short-list-Projekte bilden den Projektpool, aus dem nach Maßgabe der verfügbaren Fördermittel die Auswahl jener Projekte erfolgt, die für eine Fördereinreichung im Rahmen des IWB/ EFRE-Förderprogramms in Frage kommen.
M5 Radweg R19 Donnerstraße – Forst
M8 Asphaltierung Teilabschnitt zwischen Oberlaab und Mittellaab
M23b Asphaltierung Route Krenglbach– Katzbach –Reiterhof – Wallerer Straße/ Teilabschnitt Doppelgraben
M24 Neuer Geh- und Radweg Voralpenstraße
M27 Asphaltierung Radroute am Bahndamm/Westbahnstraße
18a R4: Rampe Höhe Karl-Wurmbstraße/Lottstraße offen
18b Beleuchtung Trepplweg zwischen Osttangente


Die neun beteiligten Städte und Gemeinden haben mit der gemeinsamen Erarbeitung der stadtregionalen Strategie einen wichtigen Schritt gesetzt, um die Entwicklung in Zukunft aufeinander abzustimmen und insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Gerade weil es sich in dieser Stadtregion um Gemeinden ganz unterschiedlicher Größenordnungen und damit verbunden auch ganz unterschiedlichen Herausforderungen handelt, ist es umso wichtiger und erfreulicher, dass alle Beteiligten den Wert dieses Prozesses erkannt haben und tatkräftig an der Entstehung des Leitbildes mitgewirkt haben.
Planungsprozesse sind immer Lern- und Qualifizierungsprozesse. Es geht um die Vernetzung vorhandenen Wissens, um den gemeinsamen Austausch von Ideen und um das Lernen von- und miteinander. Auch in dieser Hinsicht ist der Prozess bei allen Beteiligten auf großes Interesse gestoßen und es war stets die Bereitschaft vorhanden, zuzuhören, auf die anderen einzugehen und schließlich gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
Der Strategieplan ist in informelles Planungsinstrument und deshalb ist es umso wichtiger, dass seine Inhalte und Zielsetzungen auf eben jenen breiten Konsens stoßen, wie es in der Stadtregion Wels der Fall ist.
Die stadtregionale Strategie ist Anfang einer regionalen Daueraufgabe: Die gemeinsame Planung und Entwicklung ist damit nicht abgeschlossen, sondern hat eine erste konzeptionelle Grundlage erhalten, auf der aufbauend nun einzelne Themen- und Handlungsbereiche in Angriff genommen und umgesetzt werden müssen. Mit seinem weiten Zeithorizont gibt das Dokument eine zusammenhängende und vorausschauende Übersicht aufeinander bezogener Projekte zur stadtregionalen Entwicklung; somit versteht sich diese Strategie als:
• Wegweiser, der Richtungen aufzeigt, ohne sich an unveränderbare Ziele zu heften,
• Vermittler, um örtliche und landesweite bzw. sektorale Interessen abzugleichen,
• Schnittstelle, an der raum- und verkehrsplanerische sowie standortbezogene Zielsetzungen aufeinander abgestimmt werden.
In der stadtregionalen Strategie werden räumliche und themenbezogene Schwerpunkte benannt, auf die die planerische und politische Aufmerksamkeit zu richten sein wird. Dabei stellt jeder Schwerpunkt seine spezifischen Anforderungen an die weiteren Planungsschritte. Die hier dargestellten Zusammenhänge und Empfehlungen bilden das Entwicklungsgerüst, innerhalb dessen nun die nächsten Etappen genommen werden können.
FORUM ALS KOMMUNIKATIONS- UND ARBEITSPLATTFORM
Das Stadtregionale Forum hat sich in Wels als eine produktive Plattform bewährt, auf der man gemeinsam diskutieren und Konzepte entwickeln oder verfeinern kann. Hier begegnet man sich sehr vertraut und offen und spricht außerhalb der politisch-administrativen Routinen über Themen, die über die eigene Gemeindegrenzen hinausreichen und andere betreffen. Das Stadtregionale Forum hat sich als eine interne Austauschplattform in der kurzen Projektlaufzeit so bewährt, dass es in dieser Form unbedingt erhalten und ausgebaut werden sollte. Die anstehenden Projektaufgaben benötigen ein solches Forum weiterhin. Eine klare Agenda und eine konkrete Planung künftiger Treffen erscheinen dazu erforderlich.
MENT ALS PARTNER UND BINDEGLIED
Die Begleitung des Projekts durch das Regionalmanagement Oberösterreich hat den Anforderungen Rechnung getragen, die komplexen Koordinationsaufgaben zentral zu steuern. Dabei hat sich das Regionalmanagement als wesentliches Bindeglied zwischen den Gemeinden, dem Land Oberösterreich, der Förderstelle und den ProjektpartnerInnen bewiesen; aus diesem Grund wird empfohlen, dass auch die folgenden Projekt- und Umsetzungsschritte vom RMOÖ begleitet werden sollen. Das notwendige Fachwissen und die personellen Ressourcen sind vorhandenen, damit diese vertrauensvolle Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann.
Mit dem Beschluss der Stadtregionalen Strategie im Stadtregionalen Forum bekennen sich Wels, Gunskirchen, Thalheim, Steinhaus, Schleißheim, Weißkirchen, Holzhausen, Buchkirchen und Krenglbach zu den gemeinsamen erarbeiteten Leitlinien und zur gemeinsamen Entwicklungsstrategie.
In den nächsten Schritten geht es darum, die empfohlenen Umsetzungsprojekte zu förderfähigen Projekten auszuarbeiten und bei der Förderstelle einzureichen; dies stellt den nächsten Meilenstein im Rahmen der Stadtregionalen Strategie dar. Über diese konkreten Projekte hinaus sollen die mit dieser Strategie vorliegenden Zielsetzungen und Maßnahmen nachdrücklich weiter verfolgt werden. Damit leisten alle Beteiligten einen wichtigen Beitrag zu einer vorausschauenden und tragfähigen Weiterentwicklung der Stadtregion Wels.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Landes Oberösterreich kofinanziert.
Auftraggeberin
Stadt Wels
Stadtplatz 1, 4600 Wels
Beteiligte Gemeinden
Wels, Buchkirchen, Gunskirchen, Holzhausen, Krenglbach, Schleißheim, Steinhaus, Thalheim bei Wels, Weißkirchen an der Traun
Bearbeitung
RAUMPOSITION. Scheuvens | Allmeier | Ziegler OG Dipl.-Ing. René Ziegler, Denis Wizke Lederergasse 18/1, 1080 Wien www.raumposition.at
Modul 5 – Raumforschung & Kommunikation OG Dipl.-Geogr. Dr. Peter Görgl, Johannes Herburger MA Weihburggasse 16, 1010 Wien www.modul5.at
Rosinak & Partner Ziviltechniker GmbH Dipl.-Ing. Helmut Hiess, Vincent Linsmeier Schloßgasse 11, 1050 Wien www.rosinak.at
zwoPK Landschaftsarchitektur Dipl.-Ing. Christian Wagner Otto Bauer Gasse 14/4, 1060 Wien www.zwopk.at
Gestaltung
RAUMPOSITION. Scheuvens | Allmeier | Ziegler OG Denis Wizke, René Ziegler
Wien/Wels, 2018






