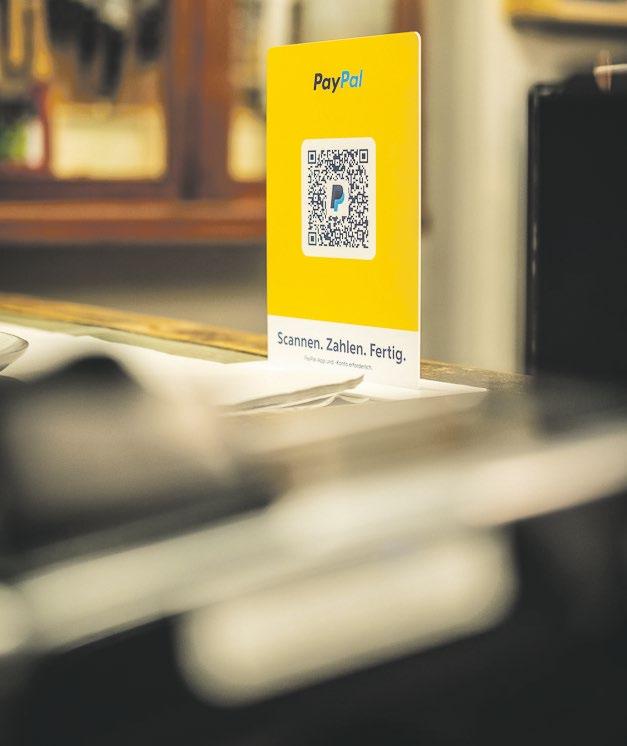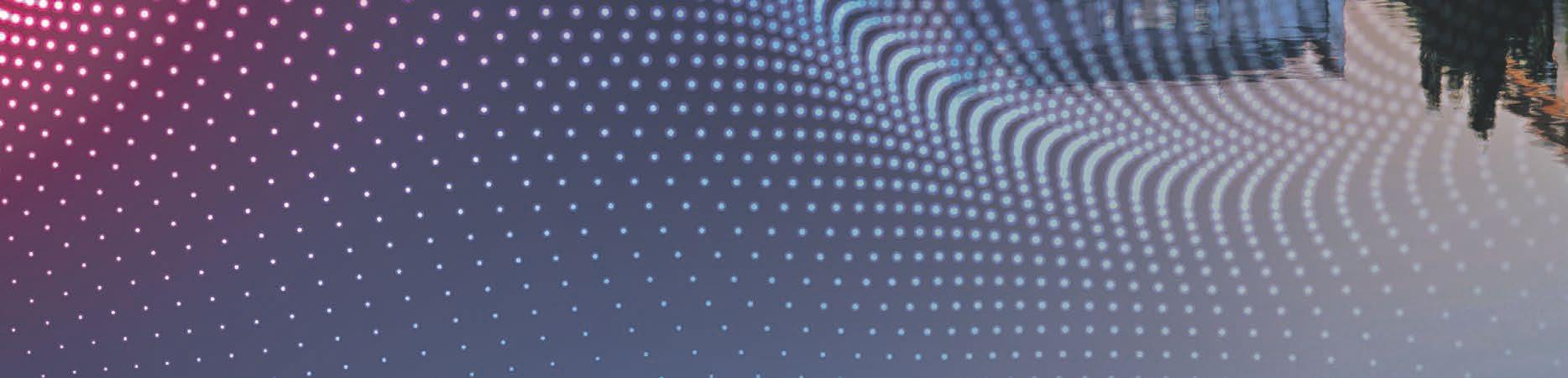ZUKUNFT
MENSCH, GESELLSCHAFT & TECHNOLOGIE
MENSCH & MASCHINE
Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine wird die Zukunft unserer Gesellschaft bestimmen. Eine erfolgreiche digitale Transformation bedeutet für eine Gesellschaft daher immer auch die Integration reibungsloser Schnittstellen zwischen Mensch und Technologie.
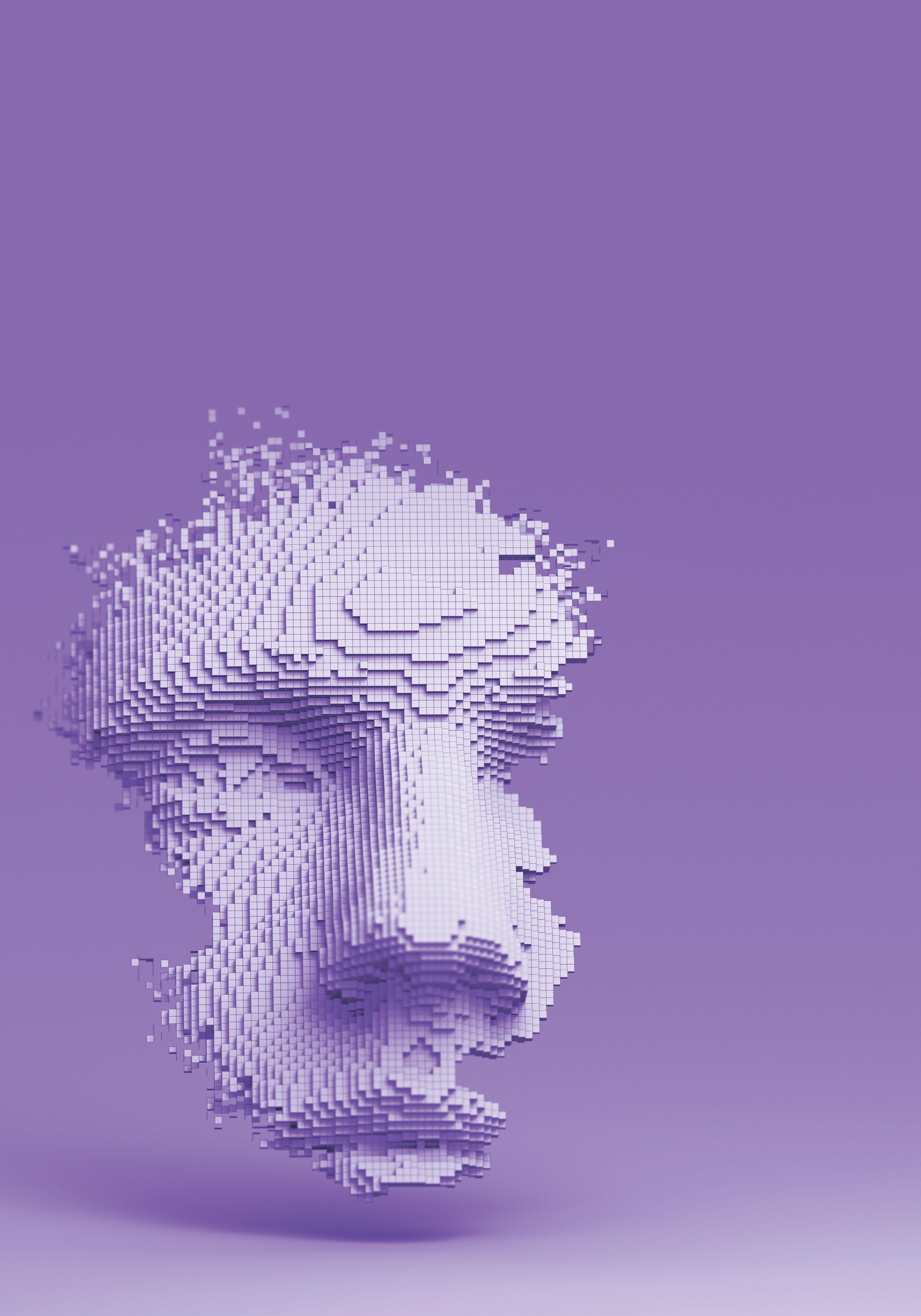
NICHT VERPASSEN:
Das digitale Krankenhaus Das Gesundheitswesen wird immer vernetzter. Innovative Technologien verbessern die Versorgung und senken Kosten.
Seite 4
Expertenpanel
Branchenführer sprechen über das Jetzt und das Morgen.
Seite 8–9
Schule 4.0
WLAN & Co. – So kommen deutsche Schulen schnell ins digitale Zeitalter.
Seite 11
EINE UNABHÄNGIGE KAMPAGNE VON MEDIAPLANET
Lesen Sie mehr auf www.zukunftstechnologien.info
Tanja Bickenbach, MBE
Der technologische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor neue Herausforderungen.
Chancen müssen erkannt und genutzt werden, damit der Mensch im Mittelpunkt bleibt.


05
Sicher im Homeoffice Cyberkriminelle sind nicht nur während einer Pandemie ein Problem –jetzt aber besonders.
07
Digitale Dekarbonisierung
Wie Smart Citys zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen können.

Die Zukunft des Zahlens
Die Finanzbranche muss in den kommenden Jahren Antworten finden, wie sie schneller am Markt ist und gleichzeitig ihre IT-Kosten senkt.

Entscheidung für Zukunft
DMehr Informationen unter: zukunfts institut.de
as Gute an der Zukunft vorab: Sie ist noch nicht da! Zukunft ist nichts, was sich auf uns zubewegt. Sie ist auch nicht festgeschrieben. Vielmehr ist diese Zukunft eine soziale Konstruktion. Lebendig wird Zukunft durch getroffene Entscheidungen. Diese zu treffen, wäre kein Problem, wenn Gewissheit vorherrscht. Gewissheit ist in der komplexen und dynamischen Welt jedoch nicht existent. Zehn-Jahres-Strategien oder die eine richtige Entscheidung sind Mythen der Vergangenheit. Wollen wir uns der Zukunft erfolgreich nähern, müssen wir unsere Denkweisen korrigieren. Das klassische, analytische Denken zerteilt in einzelne Bestandteile und führt zu Denksilos. Wir benötigen jedoch ein Denken in Kontexten, ein Denken in Zusammenhängen und Rückkopplungen. „Mensch – Gesellschaft – Technologie“ kann nur ganzheitlich gedacht werden. Der Ausgangspunkt dieser Trilogie sind die menschlichen Bedürfnisse. Der sich daraus ergebende Kontext ist die Gesellschaft, und erst dann folgt die Technologie. Die Fragestellung nach der nächsten großen Technologie ist demzufolge kontextlos und nicht zu beantworten. Nähern wir uns der Kontextbetrachtung von Mensch, Gesellschaft und Technologie exemplarisch anhand von drei langfristigen Veränderungsbewegungen (Megatrends): Sicherheit, Gesundheit und Konnektivität.
Die Sicherheit vermittelt uns das menschliche Bedürfnis danach, dass alles gut wird. Wir können uns versichern, also die Zukunft kontrollieren. Das Sicherheitsbedürfnis ist beispielsweise in urbanen Räumen relevant und bedarf technologischer Entwicklungen beim autonomen Fahren oder bei Smart Citys. Darüber hinaus ist der Umgang mit digitalen Medien und Daten von höchster Wichtigkeit. Ein pragmatischer Datenschutz, der Umgang mit Privatsphäre und Cybersecurity sind hier Zukunftsthemen. Eng verbunden mit der Sicherheit ist die Gesundheit. Diese umfasst zunehmend nicht nur die körperliche, sondern auch die geistig-seelische. Im Fokus der Gesundheit steht die Erhöhung der Lebensqualität. Eine achtsame und lebenswerte Gesellschaft ist in digitalen Zeiten gefährdet und gefördert zugleich. Aktuelle Entwicklungen im Bereich Digital Health nehmen gerade erst Fahrt auf. Spannend wird es sein, inwieweit hierbei Erkenntnissilos gebaut oder ob Open-SourceLösungen gesellschaftlichen Mehrwert liefern werden.
Wir benötigen jedoch ein Denken in Kontexten, ein Denken in Zusammenhängen und Rückkopplungen. „Mensch –Gesellschaft –Technologie“ kann nur ganzheitlich gedacht werden.
Die Verbundenheit (Konnektivität), die Nähe zu Menschen ist ein klares soziales Bedürfnis, welches wir aktuell schmerzlich vermissen. Zu erkennen ist eine Verschmelzung der physischen und digitalen Welt. Kollaborative und resiliente Ökosysteme formen zunehmend unsere Lebens- und Arbeitswelten. Die Konnektivität führt zur Förderung des Miteinanders – zwischen Menschen und zwischen Mensch und Maschine (HMI). Die gesellschaftliche Spaltung ist dabei eng mit der digitalen Spaltung (Stichwort: Digital Literacy) verbunden. So ist der Umgang mit Daten (z. B. Data Analytics) und digitalen Anwendungen eine zukunftsweisende Kernkompetenz.
Klar ist, dass diese wenigen Zeilen niemals Zukunft beschreiben können. Zukunft ist soziale Konstruktion. Zukunft ist von Menschen gemacht. Also von Ihnen. Arbeiten wir gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft.
Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 2 Head of Key Account Management: Tanja Bickenbach (tanja.bickenbach@mediaplanet.com) Geschäftsführung: Richard Båge (CEO), Philipp Colaço (Managing Director), Franziska Manske (Head of Editorial & Production), Henriette Schröder (Sales Director) Designer: Ute Knuppe Mediaplanet-Kontakt: redaktion.de@mediaplanet.com Coverbild: VAlex/shutterstock.com Alle mit gekennzeichneten Artikel sind keine neutrale Redaktion vom Mediaplanet Verlag.
DIESER AUSGABE
IN
Dr. Stefan Tewes Director of Business Innovation am ZUKUNFTSINSTITUT
Prof.
VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT IN DIESER AUSGABE Please recycle facebook.com/MediaplanetStories @Mediaplanet_germany Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit ZUKUNFTSINSTITUT entstanden.
13
Nachhaltig wirtschaften: Anspruch und Wirklichkeit in
deutschen Technologie-Unternehmen
Nachhaltiges Wirtschaften ist in Deutschland zu einem verbreiteten Zielbild von Unternehmen geworden. Dies gilt auch und besonders für den Technologiesektor. Doch wie verbreitet und verankert ist das Thema „Nachhaltigkeit“ im deutschen Technologiesektor wirklich? Im Januar 2021 hat Deloitte, eines der weltweit führenden Prüfungsund Beratungsunternehmen, im Rahmen eines Technology Sustainability Survey über 170 Führungskräfte aus Reihen deutscher Tech-Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz befragt.
Text Dominik Maaßen
 Dr. Wolfgang Falter Partner und Leiter Sustainability Services Board bei Deloitte
Dr. Wolfgang Falter Partner und Leiter Sustainability Services Board bei Deloitte
Tatsächlich belegen die Studienergebnisse eine bemerkenswerte Dynamik: Für 86 Prozent der deutschen Technologieunternehmen ist Nachhaltigkeit inzwischen zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit geworden. Acht von zehn haben sich sogar öffentlich zur Nachhaltigkeit verpflichtet.
Sonderrolle für Technologiekonzerne
„Dabei nehmen die großen Technologiekonzerne eine Sonderrolle ein“, sagt Milan Sallaba, Partner und Technologiesektor-Lead bei Deloitte. „Das in der Branche ohnehin schon ausgeprägte Engagement fällt in den Konzernen noch einmal erheblich stärker aus – sei es aus eigenem Antrieb oder als Reaktion auf die Erwartung externer Stakeholder, dass gerade die Großen der Branche beim Thema ‚Nachhaltigkeit‘ vorangehen müssen.“
Nachhaltigkeit bietet wirtschaftlichen Nutzen
 Milan Sallaba Partner und TechnologiesektorLead, Deloitte
Milan Sallaba Partner und TechnologiesektorLead, Deloitte
Mehr Informationen zum Deloitte Technology Sustainability Survey unter: deloitte.com/de/ sustainabilitysurvey
„Nachhaltigkeit ist für die Technologiebranche kein reines Investment oder gar notwendiges Übel“, ergänzt Wolfgang Falter, Partner und Leiter Sustainability Services Board bei Deloitte. „Im Gegenteil, ein konsequentes Engagement in den Unternehmen verspricht potenziell niedrigere Betriebskosten, höhere Margen sowie zusätzliche Marktanteile und neue Märkte. Darüber hinaus wirkt nachhaltiges Wirtschaften positiv auf Reputation und Mitarbeiterbindung.“
Operative und organisatorische Umsetzung
Wie wird Nachhaltigkeit in der deutschen Technologiebranche operativ und organisatorisch gelebt? Hier zeigen die Ergebnisse der Studie: In 64 Prozent der Unternehmen ist Nachhaltigkeit bereits Teil der Geschäftsstrategie. Doch nur acht Prozent setzen entsprechende Initiativen ganzheitlich um. Stattdessen verfolgen zwei Drittel der Technologieunternehmen einen eindimensionalen Ansatz mit entweder ökologischem (zum Beispiel Reduzierung von Energieverbrauch oder Abfallmenge), sozialem (zum Beispiel Mitarbeitervielfalt, Menschenrechte in der ausländischen Produktion) oder wirtschaftlichem (zum Beispiel wirtschaftliche Stabilität, Lieferketten) Schwerpunkt.
Lücke im Engagement
Auch im deutschen Tech-Sektor ist Nachhaltigkeit demnach höchst relevant, in den Unternehmen strategisch verankert und erzeugt positive Effekte. Doch es gibt auch eine Kehrseite: Zwei Drittel der Befragten nehmen eine Lücke zwischen dem kommunizierten und dem tatsächlich umgesetzten Engagement ihres Unternehmens wahr.
„Viele Technologieunternehmen haben sich intern und extern sehr hohe Zielvorgaben auferlegt oder auferlegen müssen, um ihre Geschäftstätigkeit mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen und ökologischen Belangen in Einklang zu bringen“, so Wolfgang Falter. Die Studienergebnisse belegen: Ein nachhaltiges Unternehmen entsteht nicht über Nacht.
Strategische Priorisierung und Engagement
„Nichtsdestotrotz sind Technologieunternehmen in Deutschland bei der Verfolgung von Zielen zur verstärkten Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg“, sagt Milan Sallaba. „Dies belegen die zahlreich wahrgenommenen positiven Effekte der bestehenden Initiativen. Die Rückmeldungen der befragten Technologie-Manager verdeutlichen aber auch weiteren Handlungsbedarf in Sachen strategischer Priorisierung, Change-Management und Kommunikation. Dabei gilt es, individuelle Strategien zu entwickeln und konsequent umzusetzen.“
Technologieunternehmen mit einem kritischen Ressourcenkonsum in Produktion oder Betrieb müssen hier anders priorisieren als beispielsweise digitale Lösungsanbieter, die ihre innovativen Produkte gezielt unter Verweise auf deren Nachhaltigkeit am Markt platzieren können. Auf diese Weise können ebenso ambitionierte wie realistische Nachhaltigkeitsziele erreicht und so das eigene Unternehmen zukunftsfest aufgestellt werden.
Ein zentraler Faktor dabei ist das Engagement der Mitarbeiter. Dieses leidet unter der häufig noch wahrgenommenen Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit – mit transparenten und schlüssigen Nachhaltigkeitsstrategien können Unternehmen hier zügig Abhilfe schaffen.
Vier Handlungsmaximen
Deloitte sieht generell vier Handlungsfelder, die Technologieunternehmen zusätzliche Orientierung im Nachhaltigkeitskontext versprechen:
Denke groß, beginne im Kleinen!
Eine Lücke zwischen ausgesprochenem und gelebtem Engagement kann die Motivation dämpfen. Kleine Schritte zum großen Ziel sind am erfolgreichsten.
Mache Nachhaltigkeit zum Bestandteil der DNA!
Die Verankerung von Nachhaltigkeit in der Unternehmens-DNA lässt Initiativen voll wirken. Wichtige Ankerpunkte für Nachhaltigkeit sind Kultur und Strategie.
Kenne die Potenziale und Risiken!
Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Jede Branche und jedes Unternehmen hat andere passende Hebel, um die Nachhaltigkeit zu steigern.
Lerne von den Besten!
Nachhaltigkeits-Champions haben bereits erprobt, wie sie Nachhaltigkeit steigern können. Sie sind ideale Vorbilder für eigene Nachhaltigkeitsinitiativen.






3 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit DELOITTE entstanden.
Das Krankenhauszukunftsgesetz
Mit dem neuen Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) investieren Bund und Länder rund 4,3 Milliarden Euro in moderne deutsche Krankenhäuser. Der Bund stellt seit dem 1. Januar 2021 rund drei Milliarden Euro bereit. Die Länder sollen weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro aufbringen. Gefördert werden Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere digitale Infrastruktur, zum Beispiel Patientenportale, elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement, Maßnahmen zur IT-Sicherheit sowie sektorenübergreifende telemedizinische Netzwerkstrukturen. Auch erforderliche personelle Maßnahmen können finanziert werden. Das langfristige Ziel: Es wird ein höherer Grad der Vernetzung innerhalb des Gesundheitswesens angestrebt und die Patientenversorgung verbessert. Mit dem Gesetz wird so auch das durch die Koalition am 3. Juni 2020 beschlossene „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ umgesetzt. Allerdings drängt die Zeit: Die umfassenden Förderanträge und kurzen Antragszeiträume benötigen viel Spezial-Knowhow und interne Ressourcen, die gerade in kleinen und mittleren Krankenhäusern rar sind. Nur noch bis zum 31. Dezember 2021 können die Kliniken Förderanträge an das Bundesamt für Soziale Sicherung stellen. Bis dahin nicht beantragte Bundesmittel werden bis Ende 2023 an den Bund zurückgeführt.
Mehr Informationen zu den Angeboten von Cisco rund um das KHZG unter:
wirmachen digitalisierung einfach.de/ gesundheit

Auf dem Weg zum digitalen Krankenhaus – mit Cisco
Das Gesundheitswesen in Deutschland wird immer vernetzter. Krankenhäuser nutzen dabei die Vorteile innovativer Technologien, um die Versorgung zu verbessern und Kosten zu senken. Der Spezialist Cisco unterstützt sie dabei mit seinen Lösungen auf dem Weg in die digitale Zukunft.
Text Dominik Maaßen
In der heutigen Welt sind Cybersicherheitsvorfälle für Unternehmen ein sehr großes Risiko. Das gilt auch für Krankenhäuser. Doch wie gut sind sie aufgestellt und wie gut gelingt der Brückenschlag zwischen ITSicherheit, effizienten Arbeitsabläufen und besserer Behandlung? Das hat Cisco im Healthcare Report der weltweiten Security Outcomes Study 2021 untersucht, für den 281 Teilnehmer(innen) aus dem Gesundheitswesen befragt wurden.
Gefahr durch Cyberattacken
Die Studie belegt: Kliniken sehen sich bei der Einhaltung von Compliance-Vorschriften und Sicherheitsvorgaben besser aufgestellt als andere Branchen. Zudem hat das Management im Gesundheitswesen ein hohes Verständnis für die Dringlichkeit von Cybersicherheit. Dennoch haben Krankenhäuser darüber hinaus Probleme, Cyberattacken zu erkennen und schnell darauf zu reagieren. Gleichzeitig bedeutet die rasche Expansion der digitalen Datenumgebung, dass eine enorme Menge an sensiblen Gesundheitsdaten produziert, bewegt und gespeichert wird. Durch die fortschreitende Vernetzung und Digitalisierung wächst die potenzielle Angriffsfläche. Wenn der Krankenhauscomputer zum Ziel von Cyberkriminellen wird, stehen Menschenleben auf dem Spiel und das Vertrauen in die Vorteile der Digitalisierung schwindet.
Investitionen dank Krankenhauszukunftsgesetz Diese Schwächen hat auch die Politik erkannt. Denn das Patientendatenschutzgesetz und das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sollen explizit dazu führen, dass in allen 2.000 Krankenhäusern in Deutschland die Erkennungs- und Reaktionsfähigkeiten gestärkt werden. Das Krankenhauszukunftsgesetz sorgt für die Mittel dafür – regelt aber auch explizit, dass mindestens 15 Prozent jeder Förderung in IT-Sicherheit fließen müssen.
Sicherheit muss daher bei der Digitalisierung von Anfang an mitgedacht werden. Die Antwort auf die steigende Komplexität der Netze und Daten sind ganzheitliche Lösungen: Für effektiven Schutz braucht es integrierte Lösungen, die beides können: Netzwerk und Security. Sicherheit ist bei der Digitalisierung kein „Add-on“, sondern sie ist Teil jeder Digitalisierungsstrategie.
Vernetzung und Sicherheit mit Cisco Cisco und seine Partner stehen seit Jahrzehnten für Vernetzung und Sicherheit. Mit State-of-the-Art-Lösungen erhalten Akteure im Gesundheitswesen die Infrastruktur, die sie für innovative, vernetzte Medizin brauchen – mit der Performance und Sicherheit, die ihr sensitives Feld erfordert.
So gibt es beispielsweise drei Grundprinzipien der Cybersicherheit im Krankenhaus zu beachten, bei denen Cisco unter anderem unterstützt: Krankenhäuser müssen ihre meist Compliance-fokussierte IT-Sicherheit zu einer kontinuierlichen risikoorientierten Cybersicherheit weiterentwickeln. Wichtig ist dabei, reale Risiken und unerwünschte Ereignisse kontinuierlich transparent zu machen, zu bewerten und zu mitigieren sowie die Schutzmaßnahmen organisationsübergreifend entsprechend kontinuierlich zu verbessern. Der Mangel an IT-SecuritySpezialist(inn)en trifft Krankenhäuser jedoch noch härter als andere. Denn andere Branchen sind oft attraktiver. Umso wichtiger sind dann effiziente Abläufe und Technologien, die unternehmensweit unerwünschte Vorfälle zeitnah erkennen und entschärfen können. Dafür schafft Automatisierung mehr Handlungsspielräume.
Workshops gegen Silodenken
Die größte Herausforderung ist nicht Technologie, sondern das Silodenken zwischen Fachbereichen. Cisco hilft mit Workshops dabei, alle Beteiligten zusammenzubringen, offen über Herausforderungen und Anforderungen zu sprechen und die technischen sowie operativen Voraussetzungen zu skizzieren. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven sichtbar zu machen und ein übergreifendes Verständnis zu schaffen. Denn nur ein organisationsübergreifender Ansatz ermöglicht die notwendige Sicherheit und Agilität bei der Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen. Er beinhaltet eine veränderte Fokussierung und die Erweiterung der Sicherheitskontrollen um moderne angriffszentrierte und vertrauensbasierte Konzepte und Technologien. Mit Partnern wie Cisco gelingt Krankenhäusern auf diese Weise die Brücke zwischen Digitalisierungsidee und ihrer sicheren Umsetzung. connectedhealth@cisco.com
Spezialist für Netzwerk und Sicherheit in Krankenhäusern
Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz investiert die Regierung gerade rund 4,3 Milliarden Euro in das Gesundheitswesen. Welche Einsatzszenarien gibt es für digitale Technologie in Kliniken?
Die Chancen, die sich bieten, sind groß. Sie erweitern den Zugang von Patient(inn)en z. B. mithilfe von Telemedizin und bieten ihnen ein digitales Aufnahme- und Entlassungsmanagement. Sie vernetzen Klinikpersonal auf sichere Weise, um im ganzen Krankenhaus eine korrekte und effiziente Gesundheitsfürsorge sicherzustellen. Sie unterstützen die Gebäudeverwaltung mit vernetzten Systemen und Endpunkten und fördern die Business Continuity sowie die klinische Widerstandsfähigkeit in ihrer Gesundheitsorganisation. Zu bedenken sind dabei immer IT-Sicherheit, Datenschutz und Compliance.
Vor welchen Herausforderungen stehen Kliniken dabei?
Der Fokus des neuen Gesetzes liegt darauf, klinische, betriebswirtschaftliche und patientenorientierte Services, Prozesse und Abläufe bereitzustellen. Der Ausbau des „digitalen Reifegrades“ der Kliniken funktioniert allerdings nicht, ohne eine digitale Befähigung des technologischen Fundaments mit zu berücksichtigen. Dafür braucht es flexible, sichere, skalierbare und wiederverwendbare Plattformen und Systeme. Ebenso wichtig ist aber auch die digitale Ertüchtigung der IT-Abteilung, um entsprechendes Fachwissen und neue operative Fähigkeiten zu etablieren. Es gilt, kontinuierlich die Prozesskompetenz zu verbessern und dabei die Mehrwerte für Patient(inn)en und Klinikum immer im Hinterkopf zu behalten. Kurz: Klini-
ken brauchen ein organisationsübergreifendes Verständnis, IT neu zu denken.
Wie können Sie Krankenhäuser dabei unterstützen?
Cisco verfügt als Spezialist für Netzwerke und Sicherheit auch im Gesundheitswesen über langjährige Erfahrung. Dank des großen Expert(inn)en- und Partnernetzwerks von Cisco haben wir zudem für fast jede Leistung und Fragestellung die richtige Ansprechpartnerin oder den richtigen Ansprechpartner. So können wir Gesamtprojekte ganzheitlich betrachten und in jedem der elf Förderfelder des Krankenhauszukunftsgesetzes unterstützen. Außerdem geben wir bei den Förderanträgen ganz praktische Hilfestellungen für Entscheider(innen).

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 4 Diese Artikel sind in Zusammenarbeit mit CISCO entstanden.
Text Uwe Franke
Franke Direktor Gesundheitswesen, Länder & Kommunen Deutschland, Cisco Systems GmbH
Uwe
Sicher arbeiten im Homeoffice –mit Security-Lösungen von Avira
Cyberkriminelle sind nicht nur während einer Pandemie ein Problem –da aber besonders. Sie nutzen die Situation unter anderem vermehrt dazu, Menschen zu verleiten, auf Links zu klicken, Anhänge zu öffnen und bewährte Sicherheitsverfahren zu vergessen. Wer sicher sein will, sollte ein paar wesentliche Punkte beachten. Pflicht ist aber auch Antiviren-Software. Diese muss nicht immer etwas kosten, wie die Lösung des Vorreiters für kostenlosen Antiviren-Schutz Avira zeigt.
Zentral für das sichere Arbeiten zu Hause sind generell eine Antiviren-Software, starke Passwörter, inklusive Passwort-Management, ein Bewusstsein für die Gefahren von Phishing-Mails, regelmäßige Updates von System und Software sowie die Sicherung des Routers.
1.Sichern Sie Ihre Geräte mithilfe einer Antivirus-Software gegen fundamentale Bedrohungen wie Viren und Trojaner. Um auch außerhalb des geschützten Unternehmensnetzwerks sicher arbeiten zu können, sollte unbedingt ein Antiviren-Programm installiert werden. Hierfür bietet Avira beispielsweise sein kostenloses Komplettpaket Free Security an. Die seit Jahrzehnten bewährte und immer weiter entwickelte ErkennungsEngine von Avira scannt den PC mit nur einem Klick nach Viren und Trojanern, erkennt und wehrt diese ab. Zudem beinhaltet die Lösung ein Tool zur Bereinigung des PCs, das für eine deutlich verbesserte PC-Performance und somit für effizienteres Arbeiten sorgt. Der ebenfalls im Paket enthaltene kostenlose Passwort-Manager erstellt und speichert sichere Passwörter, das integrierte VPN lässt Nutzer verschlüsselt und anonym surfen.
2.Nutzen Sie ein sicheres Passwort. Zu beachten sind dabei Zahlen, Sonderzeichen und eine Buchstabenkombination, die es möglichst nicht im Wörterbuch gibt. Am Ende scheitert es aber nicht nur an der Erstellung eines guten Passworts: Viele vergessen ihre sicheren – und manchmal auch nicht so sicheren – Passwörter. Auch hier bietet Avira mit dem kostenlosen „Password Manager“ eine praktische Lösung zur Erstellung, Speicherung und geräteübergreifenden Verwaltung von Passwörtern an.
3.Achten Sie auf verdächtige Mails. Bei Phishing-Mails gilt: Nicht alles glauben, was eine Mail verspricht. Versprechen E-Mails das schnelle Geld oder ungewöhnlich gute Angebote, ist es für gewöhnlich Phishing. Achten Sie auf Fehler und Schlüsselwörter. „Phisher“ kümmern sich meist nicht um Rechtschreibung und nutzen allgemeine Anreden. Achten Sie auf verdächtige Phrasen wie „Lieber Kunde“ oder „Konto aktualisieren“. Achten Sie auf Ungereimtheiten: Der Name in

Mehr Informationen rund um die kostenlosen Sicherheitslösungen von Avira: avira.com/de/freesecurity
der Unterschrift muss mit dem Absender übereinstimmen. Nicht sofort klicken: Fahren Sie erst mit dem Mauszeiger über die in der Mail enthaltenden Links, sodass die URL erscheint. Die Adresse muss zum erwarteten Ziel passen – und die Webseite muss richtig geschrieben sein.
4.Verwenden Sie Updates. Spielen
Sie regelmäßig Updates für Ihr Betriebssystem, Ihren Browser und weitere Programme auf. Internetfähige Geräte wie ans Netzwerk angeschlossene Drucker, der Smart-TV oder der Smart Speaker gehören ebenfalls ins Sicherheitskonzept. Oft nutzen Hacker ebendiese Geräte als Einfallstor für Angriffe.
5. Vergessen Sie nicht den heimischen Router. Auch er muss gut abgesichert werden, damit kein Unbefugter das WLAN-Netzwerk knackt und an sensible Daten gelangt. Hilfreich ist hier: Router-Passwort, WLAN-Passwort und WLAN-Namen (SSID) ändern, Firewall aktivieren und nicht benötigte Funktionen deaktivieren, WPA2-Verschlüsselung nutzen, Firmware regelmäßig updaten, Ports überprüfen, unnötige schließen und ein Gäste-WLAN einrichten.
Ein Virus kommt selten allein
Text Name Surname
Das Homeoffice ist für viele Mitarbeiter praktisch. Und für ihre Unternehmen ist es oft der einzige Weg, auch in Zeiten wie der aktuellen Pandemie weiter erfolgreich ihr Business zu betreiben. Problematisch ist jedoch, dass die IT-Security plötzlich mit noch mehr Sicherheitslücken zu kämpfen hat. Im schlimmsten Fall sind diese den Firmen gar nicht bewusst.
Die Pandemie hat die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, fundamental verändert. Ein neuer Trend, der wohl auch nach der Krise anhalten wird, ist das Homeoffice. Millionen von Menschen auf der Welt arbeiten von zu Hause aus. Viele nutzen dafür ihren privaten PC, kaufen andere neue Devices wie einen Drucker und schließen sie an das Heimnetzwerk an. Oder sie nutzen eigenes WLAN für das Diensthandy. Mit einher geht das vermehrte Arbeiten mit File-Sharing in der Cloud. Gleichzeitig steigt über diese Geräte die private Kommunikation mit Freunden und Familie. Unternehmen fördern diese Entwicklung, indem sie – möglichst schnell – RemoteSysteme oder Netzwerke für das Homeoffice bereitstellen.
Gefahr durch Cyberkriminelle
Das Problem: Die Sicherheit bleibt dabei oft auf der Strecke – und das nutzen Cyberkriminelle aus. Sie wissen nur zu gut, wie nachlässig Firmen und ihre Mitarbeiter mit der digitalen Sicherheit umgehen. So berichtete Interpol im vergangenen Jahr, dass es unter anderem allein zwischen Januar und April 2020 rund 48.000 schädliche URLs und 907.000 SpamMails gezählt hat – alle im Zusammenhang mit Covid-19. Im Zeitraum von Februar bis März 2020 stieg Interpol zufolge zudem die Zahl der gefährlichen Webadressen, die die Stichwörter „Coronavirus“ oder „Covid“ beinhalteten, um 569 Prozent an. Über die betrügerischen Domains könne beispielsweise Phishing betrieben oder schädliche Software bereitgestellt werden.
Angriff mit Schadsoftware
Denn Cyberkriminelle greifen nicht nur Regierungs- und medizinische Einrichtungen an, sondern auch Firmen. Vorrangig versuchen Kriminelle, Schadsoftware einzuschleusen. So gab es im vergangenen Jahr Kampagnen, in denen sie E-Mails mit vermeintlichen Geschäftsdokumenten wie Word- oder ExcelDateien versendeten. Wer dann darauf klickt, lädt einen Virus herunter. Im schlimmsten Fall erhält der Kriminelle so Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk. Kriminelle können danach Daten abgreifen oder Erpresser-Trojaner verschicken. Diese Entwicklung wird 2021 weiter anhalten. Zwar sind Kriminelle schon immer so vorgegangen. Allerdings sind die Daten nun im Homeoffice der Angestellten weniger geschützt.
Sicherheitsupdates und Antiviren-Software
Selbst wenn das Unternehmen einen gesicherten VPN-Zugang (virtuelles privates Netzwerk) und im Idealfall einen speziellen Computer zur Verfügung stellt, können die Daten in Gefahr geraten. Denn der Computer befindet sich dann eben nicht mehr in der geschützten Unternehmensumgebung, sondern im heimischen Netzwerk.
Im Büro des Unternehmens achtet die IT darauf, dass Geräte zum Beispiel mit aktueller Software und einem Virenscanner ausgerüstet sind. Das gilt jedoch nicht immer für private Devices. Im schlimmsten Fall verfügen diese nur über veraltete Systeme, keine Sicherheitsupdates oder keine AntivirenSoftware. Die wenigsten wissen auch, welche Gefahren durch ungesicherte Router oder Heimnetzwerke ausgehen.
Mehr Bewusstsein für IT-Security
Eine Herausforderung für die IT ist außerdem, dass sich im Homeoffice das sichere Aufbewahren der Geräte nicht kontrollieren lässt. Oft haben Familienmitglieder Zugriff auf die Geräte oder der Mitarbeiter verwendet nicht virenfreie USB-Sticks. Viele Unternehmen haben auch kein klares Rechte- und Zugriffsmanagement aufgesetzt. Mangelndes Bewusstsein und zu viel Gelassenheit gefährden so die Unternehmensdaten. Das Homeoffice ist auf diese Weise in Sachen IT-Security viel gefährlicher geworden – und Cyberkriminalität wächst sich zu einem immer größeren Unternehmensrisiko aus.
5 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info
FOTO: ADAMOV_D/SHUTTERSTOCK
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit AVIRA entstanden. Text Dominik Maaßen

Mit energielenker zur Smart City
Ein stadtweites Energiemanagement, das auf der innovativen Funktechnologie LoRaWAN basiert – das setzt die Stadt Lippstadt um, zusammen mit energielenker, einem ganzheitlichen Dienstleister für die Energiewende. Das gemeinsame Projekt soll die Kosten- und Energiebilanz der Stadt optimieren und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Smarte Zukunft dank LoRaWAN
Text Dominik Maaßen
In Zusammenarbeit mit energielenker hat die Stadt Lippstadt so den Weg zur Smart City eingeschlagen. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen plant die Ausrüstung von 56 Liegenschaften mit der von energielenker bereitgestellten Funktechnologie LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Diese zeichnet sich vor allem durch große Reichweiten und geringe Wartungs- und Hardwarekosten aus. Für die automatisierte Energiedatenerfassung rüstet energielenker die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmemengenzähler der Liegenschaften mit speziellen Sensoren aus.
Rückschlüsse aus Datenanalyse
In ausgewählten Gebäuden der Stadt gibt es darüber hinaus Untermessungen, um die Energieverbräuche exakt zuzuordnen. Kurt Weigelt, verantwortlicher Projektleiter für den Bereich Smart City bei der Stadt Lippstadt, sieht großes Potenzial in der Technologie: „LoRaWAN stellt für uns die Grundlage dafür dar, Sensorwerte aus dem Stadtgebiet automatisiert erfassen zu können. So werden die Entwicklungen verschiedener städtischer Systeme konstant überwacht und aus einer entsprechenden Datenanalyse können wichtige Rückschlüsse gezogen werden. Mit dem Aufbau eines Energiemanagements, als erstem Anwendungsfall für LoRaWAN, optimieren wir unsere Kosten- und Energiebilanz und leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.“
Mehr Effizienz durch Energiemanagementsysteme Stadtverwaltungen benötigen als Arbeitsgrundlage eine korrekte und umfassende Bilanz ihrer Energieverbräuche und Emissionen. Das Ablesen und Sammeln der Verbrauchsdaten etwa aus Stromzählern ist jedoch ein sehr fehleranfälliger und zeitaufwendiger Prozess. Hier setzen Energiemanagementsysteme (EnMS) an und entlasten die städtischen Abteilungen. Darüber hinaus ist ein Energiemanagementsystem ein geeignetes Instrument, um Einsparpotenziale zu ermitteln und die Energiekosten zu senken.
Was viele nicht wissen: Allein durch organisatorische Maßnahmen werden oftmals schon bis zu zehn Prozent der Energiekosten gespart. Die automatisierten Energieberichte liefern vollständige Aufstellungen aller Verbräuche – strukturiert etwa nach Aufgabenfeldern, Gebäuden oder Kostenstellen. Es können zudem die energetischen Standards verschiedener Einheiten verglichen und mögliche Einsparungen durch Modernisierungs- oder Umbaumaßnahmen ermittelt werden.
Mehr Perspektiven im LoRaWAN-Netz Perspektivisch besteht die Möglichkeit, neben der Energiedatenerfassung das aufgebaute LoRaWAN-Netz auch für weitere Smart-City-Anwendungen wie die Luftqualitätserfassung in oder außerhalb von Gebäuden oder das Parkraummanagement zu nutzen. Marc Henschel, Geschäftsfeldentwicklung bei energielenker, ergänzt: „Es besteht jederzeit die Möglichkeit, weitere Liegenschaften mit Sensoren auszustatten. Diese Flexibilität macht LoRaWAN zu einer attraktiven Technologie für Städte und Kommunen.“
Zum Leistungsportfolio von energielenker gehören auch Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie die stetige Weiterentwicklung der zugehörigen Software. Das gemeinsame Projekt der Stadt Lippstadt und energielenker ist zunächst für drei Jahre angelegt und wird durch das Bundesministerium für Umwelt im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative sowie durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert. Text
Sichere und einfache Datenübertragung gewinnt in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Parameter sollen gemessen werden, immer mehr Anlagen und Geräte sollen engmaschig überwacht werden können. Dabei gibt es verschiedenste Arten, die benötigten Daten zu übertragen. Eine davon ist LoRaWAN. Diese Technologie hat in den vergangenen Jahren insbesondere im Bereich Smart City immer mehr an Bedeutung gewonnen.
Das Long Range Wide Area Network, kurz LoRaWAN, ist dabei eine Funktechnologie für die Datenübertragung im Internet of Things (IoT) und ein weltweit offener Industriestandard für Funktechnologie. Seine Netzwerke zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Reichweite aus. Bei LoRaWAN kann diese teilweise sogar circa zehn Kilometer betragen. Die mögliche Reichweite eines LoRaWAN-Gateways hängt dabei aber stark von den räumlichen Gegebenheiten ab. Deshalb kann sich die Reichweite im städtischen Bereich auf einen bis zwei Kilometer abschwächen. Insbesondere in Ländern wie der Schweiz, Belgien oder Holland wird LoRaWAN durch die lokalen Telekommunikationsbetreiber verstärkt ausgebaut. In Deutschland hingegen gibt es noch kein flächendeckendes LoRaWAN-Netz. Vielmehr betreiben immer mehr Städte und Kommunen selbstständig ein Netzwerk für ihre Bedürfnisse. Dies liegt zum einen an dem günstigen und einfachen Aufbau eines LoRaWAN-Netzwerkes und zum anderen an den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Smart City.
Großer Mehrwert
Als Wegbereiter des Internet of Things und Baustein der Smart City schafft LoRaWAN vielfältigen Mehrwert. Es kann unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Energiedatenmanagement, Luftqualitäts- und Bodenfeuchtigkeitsmessung, Meldung von Füllständen von Mülltonnen, Steuerung von Ampelschaltungen und der Straßenbeleuchtung oder Parkraummanagement. Die Sicherheit gerade in städtischen Netzwerken ist dabei einer der wichtigsten Aspekte für eine Anwendung und hat höchste Priorität. LoRaWAN verwendet daher zwei Sicherheitsebenen, wobei eine für die Netzebene und eine für die Applikationsebene zuständig ist. LoRaWAN zeichnet sich außerdem durch den niedrigen Stromverbrauch, die niedrigen Installationskosten und die hohe Reichweite aus. Durch die bidirektionale Datenübertragung ist es mit LoRaWAN sowohl möglich, Daten zu empfangen, als auch, Geräte aus der Ferne aktiv zu steuern.

Offener Standard und herstellerunabhängig LoRaWAN arbeitet mit einem offenen Standard und ist somit herstellerunabhängig. Durch die Verwendung des unlizenzierten Frequenzspektrums kann also jeder sein eigenes LoRaWAN-Netzwerk unkompliziert aufbauen. Dabei ist das Netzwerk jederzeit beliebig erweiterbar. Damit ist LoRaWAN anders als zum Beispiel Narrow Band IoT unabhängig von Telekommunikationsanbietern. Es ist somit wohl eines der interessantesten Netzwerke für Smart City und Energiedatenerfassung. Durch seinen offenen Standard und das Vorantreiben der Technologie durch die LoRa-Alliance gewinnt LoRaWAN immer mehr an Bedeutung und kann eine kostengünstige und einfache Alternative zu NB-IoT, WLAN und 5G sein. Dabei sollte man sich zu den möglichen Anwendungsfeldern im Vorfeld Gedanken machen. So kann LoRaWAN überall dort seine Vorteile vollumfänglich ausspielen, wo es um kleinere Datenmengen geht, wie beispielsweise bei Zählerständen, Füllständen oder einfachen Messwerten. Für die Videoübertragung von Überwachungskameras ist LoRaWAN dagegen ungeeignet. Mit den richtigen Anwendungsfällen rechnet sich die Installation eines LoRaWAN-Netzwerkes sehr schnell und bietet große Chancen für die Entwicklung einer nachhaltigen Smart City.

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 6
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit ENERGIELENKER entstanden.
LoRaWAN-Antenne (oben) und Sensor an Stromzähler (unten)
Dominik Maaßen
Mehr Informationen zu den Services von energielenker: energie lenkersolutions. de
FOTOS:
FRIEDERIKE RESCHKE
Digitale Dekarbonisierung in der Smart City
Ballungsräume sind für einen Großteil der Treibhausgase verantwortlich. Der Bundesverband Smart City e. V. engagiert sich für neue Wege, wie Smart Citys zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen können.
Herr Doleski, kann der Einsatz digitaler Technologien die Freisetzung klimaschädlicher
Gase nachhaltig reduzieren?
Ein klares Ja. Nehmen wir unsere Ballungsräume, in denen wir leben und arbeiten. Wenn wir uns in klimatisierten Gebäuden befinden oder im Verkehr bewegen, werden große Energiemengen verbraucht und damit unzählige Tonnen Kohlendioxid freigesetzt.
Smart sind unsere Citys erst dann, wenn beispielsweise die Verkehre über Datenmodelle in Echtzeit gesteuert und somit Staus vermieden werden. In ähnlicher Weise kann eine smarte Optimierung dazu führen, dass in Städten bedarfsgerecht geheizt oder beleuchtet wird. Wir müssen nicht nur CO2-saubere Erzeugung in den Blick nehmen, sondern ebenso die smarte Verwendung des Stroms.
Das Thema scheint nicht neu. Warum also jetzt ein Buch zur Digitalen Dekarbonisierung?
Die Idee der Digitalen Dekarbonisierung ist eine grundlegende Erweiterung bisheriger Digitalisierungsansätze. In einem gleichnamigen Fachbuch zeigen wir, dass reines Bauchgefühl bei der
Optimierung von Energieverbräuchen vielfach doch trügt. Etablierte Optimierungsverfahren, auch wenn digital unterstützt, greifen zu kurz. Wesentliche Verbesserungspotenziale für mehr Klimaschutz in den Energiesystemen – dazu zählen alle an einem Ort installierten Turbinen, Solaranlagen, Windräder, Elektrogeräte usw. –bleiben ungenutzt.
Das Konzept der Digitalen Dekarbonisierung setzt insbesondere auf eine datenanalytische Verbesserung von Anlagenauswahl und -dimensionierung. Dabei wird zunächst die Wirklichkeit als digitale Kopie in Form eines digitalen Zwillings einer Stadt oder Region abgebildet. Mit dessen Hilfe können alle denkbaren Kombinationen von Energieanlagen simuliert und bewertet werden. Es entsteht eine smarte City mit kostengünstigem Energiesystem und weniger Treibhausgasen.
Aber was bedeutet die Dekarbonisierung energetischer Prozesse ganz konkret? Können Sie ein Beispiel nennen? Mithilfe der Digitalen Dekarbonisierung konnten wir im Bereich der Fernwärmeversorgung einer
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit PLATTFORM INDUSTRIE 4.0 entstanden.

Oliver Doleski
ist Principal bei Siemens Advanta Consulting und Herausgeber energiewirtschaftlicher Fachbücher. Sein Beratungsschwerpunkt liegt auf den Handlungsfeldern Utility 4.0, Digitale Dekarbonisierung und Smart City. Er ist Mitglied im Bundesverband
City e. V.
norddeutschen Stadt ein beträchtliches Einsparungspotenzial für Kohlendioxid ermitteln. Je nach Szenario zwischen 25 und 75 Prozent bis 2030. Dies geschieht durch die konsequente Umsetzung eines optimierten Anlagenparks, der technologieoffen ausgewählt wird. Unser Buch zeigt darüber hinaus noch weitere Beispiele im Rahmen der Digitalen Dekarbonisierung auf.
Unsere Verbandsmitglieder haben die Notwendigkeit konsequenten Klimaschutzes erkannt. Ist Digitale Dekarbonisierung ein wirksamer Hebel?
Ja, durchaus. Mit der Digitalen Dekarbonisierung zeigen wir, wie im Industriesektor, der etwa 40 Prozent aller Emissionen ausmacht, und bei der Heizung und Kühlung von Gebäuden, die etwa 30 Prozent ausmachen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden können.
Damit ist die Digitale Dekarbonisierung ein global deutlich wirksamerer Hebel als die vielbeachtete Elektrifizierung des Mobilitätssektors.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Doleski.

Megatrends Digitalisierung und Gesellschaft: Nachhaltigkeit ist zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungsfeld. So auch im Leitbild 2030 der Plattform Industrie 4.0. Mit ihrem Impulspapier „Nachhaltige Produktion“ stellt die Task Force Nachhaltigkeit nun vor, wie Industrie 4.0 zu einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Zukunft beitragen kann.
Die Sichtweisen auf Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit sind sehr unterschiedlich. Die einen sehen Digitalisierung als großen Stromfresser. Für die anderen macht Industrie 4.0 ökologische Nachhaltigkeit erst möglich. Expertinnen und Experten der Plattform Industrie 4.0 (PI4.0) aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gewerkschaft haben nun die unterschiedlichen Perspektiven zusammengetragen. Die Analyse von über 60 Unternehmens- und Forschungsbeispielen macht klar, dass vernetzte Industrie zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit beitragen kann. Wie genau das funktioniert, illustrieren ausgewählte Projekt- und Unternehmensbeispiele, Interviews und Exkurse. Die Task Force Nachhaltigkeit der Plattform zeigt drei Entwicklungspfade in eine zukunfts-, wettbewerbsfähige und nachhaltige Industrie:
PFAD 1: Verbrauch senken, Wirkung steigern: Auf dem Weg zu einer ressourceneffizienten und CO2-neutralen, digitalisierten Produktion.
PFAD 2: Vom Massenprodukt zum transparenten Serviceangebot: Wie ein verändertes Wertversprechen digitale Geschäftsmodelle beeinflusst.
PFAD 3: Teilen und vernetzen: Nachhaltig digital wirtschaften heißt, zu kooperieren und in zirkulären Wirtschaftssystemen zu agieren.

Um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen, spielt die Digitalisierung der Industrie (Industrie 4.0) eine große Rolle. Denn sie ermöglicht die horizontale und vertikale Datenintegration entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das erlaubt Transparenz während des gesamten Prozesses und damit den Übergang in eine nachhaltige und zirkuläre Wirtschaft. „Das Potenzial, Ressourcen zu schonen, ist enorm“, so Prof. Dr. Peter Post, Vice President bei Festo und seit diesem Jahr Leiter der Task Force Nachhaltigkeit. Eine Studie der Internationalen Energieagentur legt dar, dass der Maschinenbau circa ein Prozent der CO2-Emissionen verursacht, aber 67 Prozent der globalen Emissionen mit seinen Produkten beeinflusst. In Zukunft kann Nachhaltigkeit als
integrativer Ansatz für Unternehmen verstanden werden und den Firmen, Kunden sowie den Beschäftigten einen Mehrwert bringen. „Nachhaltigkeit ist zukünftige Wettbewerbsfähigkeit!“, erklärt Prof. Dr. Post.
Dieser Wandel ist im Gange, der jedoch förderliche politische Rahmenbedingungen und unternehmerisches Engagement benötigt beispielsweise mit Blick auf sichere und interoperable Datenräume oder Anreizstrukturen für eine zirkuläre Wirtschaftsweise. „Da die Digitalisierung ohnehin die Wirtschaft fundamental verändert, sollte man dieses Momentum zugleich nutzen, um Nachhaltigkeit in die Wirtschaftsprozesse hineinzutragen“, erklärt Henning Banthien, Leiter der Geschäftsstelle der Plattform Industrie 4.0.
Die Plattform Industrie 4.0 ist das zentrale Netzwerk in Deutschland, um die digitale Transformation in der Produktion voranzubringen. Im Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und Verbänden sind über 350 Akteure aus mehr als 150 Organisationen in der Plattform aktiv. Die Plattform unterstützt deutsche Unternehmen mit Praxisbeispielen, Informationsangeboten und Handlungsempfehlungen dabei, Industrie 4.0 zu implementieren.
7 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info
Mehr Informationen unter: plattformi40.de
Text Mirko de Paoli
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem BUNDESVERBAND SMART CITY E. V. entstanden.
Task Force
keit der
4.0 FOTO: PETER POST
Smart
Peter Post Vice President bei Festo und Leiter der
Nachhaltig-
Plattform Industrie
EXPERTENPANEL
Zukunftsprojekt
Industrie 4.0


Die digitale Revolution hält in allen Unternehmen Einzug. Wie können Firmen ihre Mitarbeiter in Sachen digitale Skills einbinden? Am Anfang steht für mich, die Mitarbeiter bei den Veränderungen immer auf einem aktuellen Stand zu halten und mitzunehmen. Die besten Ideen kommen dabei von den eigentlichen Expertinnen und Experten – und das sind die Beschäftigten, die die Tätigkeiten täglich ausführen, die Prozesse und Strukturen in- und auswendig kennen. Grundsätzlich sollte der Weiterbildung von Beschäftigten als notwendige Investition in die Zukunft viel mehr Wert beigemessen werden.
Wie sehen Sie deutsche Firmen im Vergleich zu internationalen aufgestellt?
Wir sollten nicht vergessen, dass die Industrie 4.0 vor zehn Jahren als deutsches Zukunftsprojekt gestartet ist. Mittlerweile setzt die Plattform Industrie 4.0 der Bundesregierung mit ihren mehr als 300 beteiligten Organisationen internationale Standards und Maßstäbe bei der Digitalisierung der industriellen Produktion. Einer unserer größten Vorteile in Deutschland ist die duale Ausbildung, durch die viele berufs- und branchenspezifische Technologien „on the job“ erlernt werden können.
Digitalisierung geht oft auch einher mit agilem Arbeiten, was dem deutschen Perfektionismus entgegensteht. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das stimmt sicherlich in traditionell geprägten Unternehmen. Agiles Arbeiten bedeutet auch, flache Hierarchien zu leben, Entscheidungskompetenz an die Beschäftigten abzugeben und Fehler zu erlauben. Das ist bisher nicht die typische Kultur in deutschen Unternehmen. Dabei geht es vor allem darum, Vertrauen aufzubauen und Perspektivwechsel zuzulassen. Ein schwieriges Feld mit hoher Dynamik und Komplexität für Unternehmensleitungen.
Auch die künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug. Welche Herausforderungen sehen Sie hier?
Es müssen gewisse Grundsätze zu Ethik und Moral diskutiert und es muss ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt werden. Diesem Konsens müssen sich dann auch die Unternehmen unterwerfen, es geht hier ja um Akzeptanz für diese Technik. Die Frage ist ja nicht nur, was kann KI technisch, sondern vielmehr: Welche Verantwortung übergeben wir an sie? Beim Erkennen und Diagnostizieren von Krebs ist KI sicherlich eine wertvolle Unterstützung. Gleichzeitig kann das Überbringen der Diagnose und die Ausarbeitung der Therapie für den Menschen keine reine Aufgabe für eine KI-Anwendung sein. Hier sind rein menschliche Fähigkeiten wie Kreativität oder soziale Kompetenzen wichtig. Damit sind Menschen Maschinen eindeutig überlegen.
Sicher digital leben

Das letzte Jahr hat die Welt, wie wir sie kennen, fundamental auf den Kopf gestellt. Vor welchen Herausforderungen steht die Gesellschaft und damit auch Avira als Cybersicherheitsfirma?
Die Welt wird immer digitaler und die Anzahl an Geräten, die mit dem Internet verbunden ist, steigt rasant. Um mit unseren Familien und Freunden in Verbindung zu bleiben, nutzen wir mehr digitale Kommunikation als je zuvor. Auch zeigen die Zahlen, dass Menschen zunehmend online shoppen. All diese Entwicklungen wurden durch die Pandemie natürlich extrem befeuert. Cyberkriminelle nutzen das gezielt aus. Die Cyberbedrohungen nahmen im letzten Jahr erheblich zu. Aber auch Firmen, die persönliche Daten im Internet erheben und weiterverkaufen, profitieren von diesem digitalen Schub – zulasten des Datenschutzes.
Es gibt immer mehr Bedrohungen auf immer mehr Geräten – was ist die Lösung? Als Pionier von kostenlosen Antivirenprodukten entwickeln wir bei Avira seit mehr als 30 Jahren branchenführende Lösungen, um alle Menschen in der vernetzten Welt zu schützen. Da die Bedrohungen immer komplexer werden, setzen wir mittlerweile auf ein komplettes Portfolio an Sicherheits-, Privatsphäre- und Leistungsoptimierungslösungen. Wir glauben, dass jeder Anwender das Recht auf ein sicheres digitales Leben hat, daher bieten wir unsere Produkte auch kostenlos an. Unser All-in-One-Schutz für Windows, Android, iOS und Mac wird durch kostenlose Stand-Alone-Lösungen, wie einen Passwortmanager oder das Virtual Private Network, ergänzt. Auch schützen wir gemeinsam mit unseren Technologiepartnern internetfähige Geräte durch den Einsatz unserer führenden Malware-Erkennungstechnologie, basierend auf maschinellem Lernen.
Gerade in Corona-Zeiten nutzen Menschen verstärkt Online-Services. Dabei geben viele manchmal zu leichtfertig Daten weiter. Wie kann Avira Menschen dabei helfen, ihre persönlichen Daten zu schützen? Zunächst einmal hat Datenschutz für uns oberste Priorität. Avira verkauft keine Daten und wird das nie tun. Unser kostenloses Privatsphäre-Tool Privacy Pal für Windows verhindert, dass persönliche Daten gesammelt werden. Außerdem löscht es Online-Spuren und vernichtet vertrauliche Daten endgültig. Und mit unserem kostenlosen Avira Phantom VPN für PC, Mac und Mobilgeräte surfen und shoppen Anwender anonym und sicher im Internet.
Sicher digital lernen

Die Schule von morgen sollte auch im Digitalen ein geschützter Raum sein. Welche Herausforderungen sehen Sie hier?
Cloud-Dienste erhalten mehr und mehr Einzug in den schulischen Alltag. Sie sind günstig und ohne Spezialisten-Knowhow sofort nutzbar. Selbst die Verwaltung des WLANs läuft heute oft über eine Cloud. Damit werden gleichzeitig Datenschutzfragen relevant: Kann meine Bildungsinfrastruktur die Daten der Schülerinnen und Schüler effektiv schützen?
Ich verstehe die individuelle Motivation und aufgrund des aktuellen Lockdowns auch die große Not vieler Schulen, auf bekannte Videokonferenz- und Kollaborations-Tools zurückzugreifen. Aber kommen diese aus dem Nicht-EU-Ausland, wird es schnell problematisch. Aus meiner Sicht ist Datenschutz ein nicht verhandelbares Grundrecht. Erst recht bei Kindern und in der Schule. Und, das werde ich nicht müde zu betonen: Es gibt datenschutzkonforme Alternativen!
Was empfehlen Sie als Alternative?
Ob Plattformen oder Messenger – oder, wie in unserem Fall bei LANCOM, das Schul-WLAN: Für all diese Lösungen gibt es technisch hervorragende Angebote von europäischen Herstellern, die hiesigem Datenschutzverständnis Rechnung tragen und den Schulen einen rechtssicheren Betrieb ihrer digitalen Lernumgebung ermöglichen. Diese Alternativen haben nur oft nicht dieselbe Sichtbarkeit und Marketing-Power wie die Lösungen großer Tech-Konzerne aus dem Nicht-EUAusland. Sie drängen sich daher nicht so auf. Bei der Suche nach sicheren Tools helfen Initiativen wie „Deutschland sicher im Netz“ oder die „Open Source Business Alliance“. Für datenschutzkonforme Schul-WLANs empfehle ich den Blick auf unsere zahlreichen BestPractice-Geschichten.
Welche Vorteile haben Ihre Lösungen von LANCOM?
Mit demselben Augenmerk auf Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit, das wir seit jeher bei unseren Hardware-Komponenten verfolgen, haben wir uns in den letzten Jahren erfolgreich im Markt für Cloud-basierte Netzwerklösungen positioniert. LANCOM Systems ist der einzige Hersteller mit einem Netzwerkinfrastruktur-Gesamtportfolio, der das Vertrauenszeichen „IT Security made in Germany“ tragen darf. Unsere WLAN-Lösungen dienen deshalb schon seit vielen Jahren als Basis für kommunale WiFi-Hotspots, vernetzen Schulen, Universitäten und Verwaltungsgebäude drahtlos und bilden in Kliniken und in der Logistik effiziente, voll digitalisierte Prozesse ab.
Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 8
Stephan Brenner Vice President of Product, Avira
Daniela Schiermeier Vorsitzende des Konzernbetriebsrats ABB AG und Vorsitzende des Europäischen Betriebsrats ABB
Ralf
Koenzen Gründer und Geschäftsführer von LANCOM Systems
Starter-Paket für Smart City

Ihr Unternehmen bietet Städten und Kommunen die Möglichkeit, schnell und effizient Smart-City-Projekte umzusetzen. Sie vertrauen dabei der Funktechnologie LoRaWAN. Was verbirgt sich dahinter?

LoRaWAN ermöglicht ein energieeffizientes Senden von Daten über lange Strecken. In Stadtgebieten beträgt die Reichweite bis zu zwei Kilometer und in ländlichen Gebieten sogar rund zehn Kilometer. Zudem wird eine optimale Durchdringung von Gebäuden erreicht. Dicke Wände stellen also kein Hindernis für die Datenübertragung dar und eine Funkverbindung bis in den Heizungskeller ist somit ohne Weiteres möglich. Zudem ist die Nutzung des LoRaWAN-Netzes kostenfrei und, im Gegensatz zu NB-IoT oder 5G, offen und herstellerunabhängig. Darüber hinaus fallen die Hardware- und Wartungskosten gering aus. Die LoRaWAN-Technologie besticht durch eine sichere Datenübertragung dank der zweistufigen symmetrischen Verschlüsselung sowie durch eine einfache Installation und Inbetriebnahme.
Sie bieten ein sogenanntes Starter-Paket an. Was enthält es und für wen eignet es sich?
Unsere Kunden können damit die ersten Schritte in Richtung Smart City gehen oder neue Anwendungsfälle schnell und einfach testen. Kurzum: Die Starter-Pakete dienen dazu, unterschiedliche Anwendungsfälle und Möglichkeiten kennenzulernen. Danach können diese simpel und modular ausgebaut werden.
Können Sie Anwendungsbeispiele nennen, die für diese Technologie infrage kommen?
Mit LoRaWAN können Sie die Zählerstände Ihrer Wasser-, Strom- oder Gaszähler und vieles mehr automatisiert und aus der Ferne erfassen. Sie machen Schluss mit manuellen Zählerablesungen und unendlich langen
Excel-Listen. Die Installation der Geräte ist dabei denkbar einfach – so werden viele Sensoren mit einem einzigen Handgriff auf den Zähler gesteckt. Oder Sie vermeiden Verschmutzungen, weil die Füllstände Ihrer Müllbehälter überwacht werden. Möglich ist auch, die Luftqualität, Temperatur und Belegung in Räumen zu überwachen. Das ist ideal für Schul- und Bürogebäude. Außerdem können Sie die Parkplatzsuche vereinfachen und Falschparkern einen Strich durch die Rechnung machen. Gleichzeitig überwachen Sie die Auslastung der Parkflächen. Alle Daten werden dabei durch unsere energielenkerSoftware übersichtlich dargestellt. Mit einem Starter-Paket testen Sie auf diese Weise unkompliziert und unverbindlich, wie Sie mit LoRaWAN Ihr Smart-City-Projekt auf Erfolgskurs bringen.
Autobahn ohne Tempolimit

Ein Großteil der Unternehmen aus der Finanzbranche arbeitet inzwischen in der Cloud. Warum und welche Vorteile bringt das mit sich?
Die Cloud lohnt sich aus drei Gründen. Sie bietet Infrastruktur, die Banken und Versicherer nicht mehr selbst unterhalten müssen. Dadurch sinkt die Fertigungstiefe und die Unternehmen gewinnen Zeit, sich um ihr Kerngeschäft zu kümmern. Inzwischen vertreiben auch immer mehr Anbieter ihre Software nur noch über die Cloud. Microsofts Office 365, das viele auch privat nutzen, gehört dazu.
Gleichzeitig steigen auch die Risiken – welche sind das?
Wer in die Cloud geht, steht ständig im Fadenkreuz von Hackern. Bots scannen permanent nach Sicherheitslücken auf den großen Plattformen und greifen alle auf einmal an, die diesen Dienst nutzen. Anders als früher müssen die Unternehmen deshalb ihre IT umfassend und auf allen Ebenen absichern, beispielsweise sowohl in der Entwicklung wie auch im Betrieb. Weil die Cloud das von vornherein berücksichtigt, gilt sie sogar als sicherer als ein klassisches Rechenzentrum.
Wolke ist auch nicht gleich Wolke – worin unterscheiden sie sich?
Die Cloud lässt sich als Plattform, wie eine Infrastruktur oder als einzelner Dienst nutzen, etwa wenn es um eine bestimmte Software geht. Ähnlich wie beim Autokauf gilt aber auch hier, dass der richtige Anbieter davon abhängt, was ein Unternehmen genau tun möchte. Ob Allrad im Gelände oder Windschott im Cabriolet, jede Cloud hat eigene Stärken.
Es gibt immer mehr Anbieter, die digital zusammenarbeiten oder es auch müssen. Was sollten IT-Verantwortliche dabei bedenken? Am wichtigsten ist, dass sich meine Dienste gut integrieren lassen. Wer mit anderen arbeitet, öffnet dafür seine IT. Das geschieht über Schnittstellen, sogenannte APIs, die sicher sein und trotzdem komfortabel zu nutzen sein müssen. Wir raten unseren Kunden dazu, sich vor allem um die Entwickler zu kümmern, weil die künftig eine noch viel größere Rolle spielen.
Gibt es alternative Anbieter in Europa? Europa verfügt über einige Cloud-Initiativen. Was die schiere Größe angeht, haben die USA und China aber klar die Nase vorn.
Große Händler bieten inzwischen auch Bezahlverfahren, Kreditkarten oder zusätzliche Versicherungen an. Welche Konkurrenz wächst hier für deutsche Unternehmen der Finanzbranche? Die Cloud, aber auch API-Schnittstellen erleichtern Unternehmen, schnell ein gutes Produkt herauszubringen oder ein bestehendes zu erweitern. Wir beobachten das bei den großen Tech-Konzernen genauso wie bei findigen Start-ups. Meist verfügen sie über einen direkten Kanal zu ihren Kunden und verbinden die konkurrierenden Angebote mit Diensten, die Kunden gerne und vor allem regelmäßig nutzen. Darin steckt die Gefahr.
Ganzheitliche CloudTransformation

Während des Digitalisierungsprozesses sind unter anderem Plattformen und der Aufbau von Schnittstellen zu anderen Plattformen relevant. Wie können sich Unternehmen hier idealerweise vorbereiten?
Sie sollten vor der Implementierung gezielt überlegen, welche Schnittstellen benötigt werden, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Software-Anwendungen miteinander kommunizieren können.
Ich empfehle auch, Funktionalitäten früh und mit Weitblick zu testen, um großen Enttäuschungen vorzubeugen. Klingt logisch, wird aber dennoch viel zu wenig praktiziert.
Wichtig zu bedenken ist auch: Viele Unternehmen erheben täglich Daten, die einen reellen Wert darstellen und mit anderen Daten zu kritischen Größen aggregiert, interpretiert, analysiert oder einfach auch zu diesem Zweck an Dritte verkauft werden können. So lässt sich das eigene Dienstleistungsportfolio erweitern und neue Umsatzquellen können erschlossen werden. Das müssen sie aber klug und strategisch umsetzen. Sonst erhält der Wettbewerb womöglich Einblicke, die er nicht erhalten sollte.
Cloud-Transformation erfordert die Balance zwischen Technologie, Organisation und Menschen. Sie beraten Firmen ganzheitlich – was bedeutet das?
Der wichtigste Aspekt ist das breite Verständnis, dass Cloud-Transformation keine reine IT-Disziplin ist und die Geschäftsleitung einbezogen werden muss. Wir sehen häufig gute Absichten, aber zu wenig Abstimmung. Das kann zu unnötigen Spannungen zwischen IT und Business führen. Ausgehend von einem verbesserten Kundennutzen, operativer Effizienz oder neuen Geschäftsansätzen leitet das Business die Transformation und gibt die grobe Richtung vor. Die IT setzt diese dann in enger Zusammenarbeit um. So ziehen alle am gleichen Strang.
Auf welche Industrieexpertise können Sie hier im Markt zurückgreifen?
Eine unserer Stärken ist, dass wir ein globales Cloud-Verständnis haben, weil wir eng mit den Hyperscalern zusammenarbeiten, also den weltweit großen Cloud-Anbietern. Gleichzeitig kombinieren wir es mit spezifischer Industrieerfahrung. Wir verknüpfen unser solides Technologieverständnis auch mit Blick auf zukunftsorientierte Themen wie künstliche Intelligenz und Machine Learning. Wichtig ist solides Verständnis neuer Geschäftsmodelle sowie fundierte Branchenkenntnis auch in den Details. Wir wollen den Wertbeitrag von Cloud und IT zum Unternehmenserfolg nachhaltig gestalten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden so über alle Industrien hinweg Innovation und Erneuerung zu vermitteln – und auf diese Weise ihren Geschäftserfolg zu optimieren.
9 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info
Tobias Hoedtke Managing Director, Senacor Technologies
Marc Henschel Geschäftsfeldentwicklung, energielenker solutions GmbH
Milan Sallaba Partner und TechnologiesektorLead, Deloitte
Interaktive Touchscreen-Lösungen im Bildungsbereich
Digitale Zukunft an Schulen: das Ende der Kreidezeit
Deutschlands Schulen müssen digitaler werden – das ist nicht erst seit der aktuellen Coronakrise klar. Noch sind die deutschen Klassenzimmer Orte, an denen Kreide und Tafeln regieren statt Touchscreens und Tablets. Der fünf Milliarden schwere Digitalpaket, den das Kultusministeriums dafür bereitstellt, verspicht endlich genügend Budget für den Ausbau leistungsstarker Infrastrukturen und digitaler Unterrichtshelfer wie moderne, interaktive Display-Lösungen.
Mit digitalen Medien und Lernangeboten können Schüler besser in ihrer individuellen Lerngeschwindigkeit lernen“, meint Frank Himmel, Technical & Sales Manager von Clevertouch, einer der marktführenden Touchscreen-Lösungen auf dem Markt. Die interaktiven Großformat-Touchdisplays verfügen über eine intuitiv designte Benutzeroberfläche und werden mit einer exklusiven Multi-TouchSoftware ausgeliefert, die sie besonders für den Einsatz im Schulbetrieb qualifiziert.
Touchscreen-Lösungen als simpler Tafelersatz?
Die wichtigste Rolle für das neue Lernerlebnis jedoch spielen die Lehrkräfte, meint Himmel. Es hilft also nichts, wenn die Klassenzimmer mit modernen, interaktiven Touchdisplays ausgestattet sind, diese aber nur wie klassische Tafeln oder Whiteboards, verwendet werden, anstatt die zahlreichen, interaktiven Programme zur Unterrichtsgestaltung zu nutzen. „Dass viele Lehrer das Potenzial von digitalen Displaylösungen nicht kennen und nicht ausschöpfen ist kein Wunder“, so Himmel. „Sie sind einfach überfordert, weil die Geräte oft ohne Schulung und Wartung eingeführt wurden“. Schneller, kostenloser Vor-Ort-Service und vor allem eine fundierte Beratung spielen für den Erfolg des digitalen Schubs an Schulen eine große Rolle.
Clevere Features speziell für Schulbetrieb Nur so lässt sich sicherstellen, dass intelligente Digital-Signage-Tools wie etwa Clever Message genutzt werden. Mit dem Dienst lassen sich Nachrichten an alle oder nur an ausgewählte Clevertouch-Displays der Schule senden. Das Sekretariat kann beispielsweise Stundenpläne auf die Displays schicken, Live-Video-Nachrichten vom Schulleiter versenden, Anweisungen während einer Brandschutzübung geben, aktuelle Nachrichten mitteilen oder allgemeine Ankündigungen verschicken.
Persönliche Nutzer-Accounts für Lehrer und Interaktion mit anderen Devices
Ein zentrales Kriterium für Schulbetrieb ist es, dass die Touchscreen-Lösungen mehrere Nutzerprofile speichern können, so dass die Lehrer ihre erarbeiteten Unterrichtsstunden und vorbereiteten Übungen sicher speichern können. Ebenfalls wichtig für den Einsatz im Bildungsbereich ist es, dass die Display-Lösungen flexibel mit jeder Art von mobilem Device und mit jedem Betriebssystem funktionieren. So lassen sich dank der Clevershare-App etwa Inhalte von Android-, iOS-, Windows und Chrome-Devices sehr schnell teilen. Bis zu 50 Devices können sich dafür gleichzeitig mit dem Display verbinden. Zudem ist eine direkte Übertragung via AirPlay oder Chromecast möglich. Der Lehrer hat als Moderator dabei die volle Kontrolle darüber, was geteilt und gezeigt wird.
Interaktive Lern-Apps aus aller Welt ganz einfach in den Unterricht integrieren Das umfangreiche Potenzial interaktiver
Touchscreen-Lösungen für den Schulbetrieb lässt sich am besten über die Vielzahl intelligenter Lern-Apps widerspiegeln, die über die Displays nutzbar sind. Egal, für welche Altersgruppe, für welches Fach und in welcher Sprache – weltweit kommen täglich neue Apps auf den Markt, die das Lernen spannender und einfacher machen. Clevertouch hat dazu für seine Displays einen eignen App-Store entwickelt, der bereits über 100 Apps enthält. Die dort gelisteten Apps können Lehrer kosten- und werbefrei für ihren Unterricht nutzen. Darüber hinaus können sie selbst Anwendungen vorschlagen, die in den Store aufgenommen werden sollen. „Wir prüfen diese Apps dann und passen sie für den Schulbetrieb an“, so Himmel. „Der App-Store ist ein perfektes Beispiel, dafür, welche Möglichkeiten digitale TouchscreenLösungen für Schulen bieten“, freut sich Himmel.
 Frank Himmel Technical & Sales Manager von Clevertouch
Frank Himmel Technical & Sales Manager von Clevertouch












Mehrfach preisgekrönte, digitale Lösungen für den Bildungsbereich

NEU von Clevertouch
Die IMPACT Serie
Make an IMPACT™ in the classroom
Perfekt zugeschnitten auf die Bedürfnisse von sowohl digitalen als auch konventionellen Klassenzimmern, hat die Clevertouch IMPACT Serie sehr viel mehr zu bieten, als nur interaktive Touchscreens. Sie ermöglicht ihren Nutzern ein komplett intuitives und kollaboratives Arbeits- und Lernerlebnis.



Vollgepackt mit Funktionen und Apps für individuelles Unterrichten und Lernen ist Clevertouch IMPACT Plus die ideale Lösung für einen lebendigen, hochwertigen Unterricht und befreit Lehrer von den Einschränkungen restriktiver, traditioneller Schultechnik.
Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 10 Vertrieb Deutschland | InfoDE@clevertouch.com | Tel. 0211-54085045 Clevertouch.com
IMPACT Plus™ IMPACT™
Diese Artikel sind in Zusammenarbeit mit CLEVERTOUCH entstanden. Weitere Informationen: clevertouch.com
Text Frank Himmel
WLAN & Co.: So kommen deutsche Schulen schnell ins digitale Zeitalter
Warum warten, wenn es schnell gehen kann: Mit den Lösungen des deutschen Anbieters LANCOM starten Schulen im Handumdrehen in die Digitalisierung. Sicher, nachhaltig und datenschutzkonform. Und auf Wunsch sogar über die Cloud.
Sie ist die kleinste Schule Deutschlands und spielt technisch doch ganz vorne mit: Mit einem top-modernen „WLAN aus der Cloud“ sorgt die Grund- und Gemeinschaftsschule Helgoland dafür, dass das Schulnetz jederzeit einwandfrei funktioniert. Sie hat keinen eigenen IT-Admin und teilt damit das Schicksal vieler deutscher Schulen, die sich nach der Installation des heißersehnten Netzwerkes einer ganz elementaren Frage ausgesetzt sehen: Wer stellt denn nun die Pflege und den einwandfreien Betrieb sicher?
Cloud statt Physiklehrer
Statt der vielerorts üblichen Lösung in Form engagierter Lehrkräfte, die sich ehrenamtlich um die Geräte- und Netzwerkwartung kümmern, wählten die Verantwortlichen auf Deutschlands einziger Hochseeinsel einen völlig neuen Ansatz. Sie entschieden sich für ein WLAN des deutschen Netzwerkausrüsters LANCOM Systems, das weitgehend automatisiert über einen Cloud-Dienst und die städtische IT verwaltet wird. So ist das Netz jederzeit technisch auf dem neusten Stand und einsatzbereit.
LANCOM: der Spezialist fürs
Schul-WLAN
Mit diesem Ansatz steht Helgoland nicht alleine da. Tausende von Schulen hat LANCOM im Rahmen des Digitalpakts mit leistungsfähigen Netzwerken ausgestattet. Von ganz klein bis sehr groß ist alles dabei. Rund 50 Prozent gehen dabei den Weg in die Cloud und sind auch hier mit LANCOM auf der sicheren Seite. Denn die NetzwerkmanagementCloud des Herstellers unterliegt deutschem Recht und ist vom Aus des Datenschutzabkommens „Privacy Shield“ nicht betroffen. Schulen können also selbst bei der Cloud-Nutzung in puncto Datenschutz ruhig schlafen.
Als Spezialist für vertrauenswürdige Netze stellt LANCOM Schulen auf dem Weg zum digitalen Klassenzimmer ein breites Portfolio leistungsfähiger Lösungen – Router, Switches, WLAN, Firewalls, Jugendschutzfilter – zur Verfügung. Der deutsche Anbieter punktet mit höchster Sicherheit, kompromissloser Profiqualität und einer BackdoorFreiheitsgarantie, die selbst die strengen vergaberechtlichen Anforderungen der EVB-IT erfüllt. Die LANCOM Management Cloud, von der aus ganze Schulnetze zentral und einfach administriert werden, komplettiert das Angebot.
Durchstarten in die digitale Zukunft Jenseits der Technik hält LANCOM umfangreiche thematische Hilfestellungen bereit. Darunter ein umfangreiches „Rechtspaket für Schulen zur Einführung eines pädagogischen Netzes“, das neben Vorlagen für Nutzungsbedingungen auch hilfreiche Informationen zur DSGVO sowie ein Muster für einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag enthält. Zudem bietet LANCOM mit dem „Themenforum Digitale Bildung“ eine Dialogplattform für den Austausch mit unabhängigen Experten aus Bildung, Medien, Datenschutz und Digitalisierung. Das mittlerweile dritte Forum dieser Art findet vom 13. bis 15. April als Online-Event statt. Mit diesem Rundum-sorglos-Paket aus exzellenter Technik, gesichertem Betrieb und geballter Information steht einem nachhaltigen Schul-WLAN mit Bestnote nichts mehr im Wege.
Weitere Informationen: lancom.de/ digitalpakt-schule

Datenschutz für die digitale Schule
Text Dominik Maaßen
Eltern, Schüler und Lehrer wünschen sich einen raschen Ausbau der digitalen Infrastrukturen. Getragen von einer Politik, die mit Bildung auf Spitzenniveau nicht weniger als die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sichern möchte. Der Bund unterstützt finanziell mit dem Digitalpakt und schießt das Geld für Schul-WLAN und Lernplattformen zu. Nachholbedarf gibt es allerdings bei Datenschutz und Sicherheit.
Durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) haben im Juli 2020 quasi über Nacht zahlreiche Lösungen für den digitalen Unterricht ihre Rechtskonformität verloren. Die Richter stellten ein unzulängliches Datenschutzniveau in den USA fest, das das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von EU-Bürgerinnen und -Bürgern – und damit auch Schülerinnen und Schülern – massiv gefährdet.
Sensible Daten in Unterricht und Verwaltung
In Schulen wimmelt es von sensiblen Daten und Noten, persönlichen Angaben, E-Mails und IP-Adressen. Gleichzeitig unterliegen Schulen beim Schutz der Daten Minderjähriger einer besonderen Sorgfaltspflicht. Nach der roten Karte für das Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ heißt es daher für die Schulträger, genau hinzusehen. Sollten sie bereits ein Schul-WLAN, Kollaborations-, Chat- oder Videokonferenz-Tools auf CloudBasis installiert haben, muss geprüft werden, ob sie von einem Anbieter mit Sitz in den USA oder beispielsweise China stammen und die hohen Anforderungen an den schulischen Datenschutz tatsächlich erfüllen. Sonst drohen Bußgelder oder Schadenersatzforderungen. Im schlimmsten Fall werden Fördergelder zurückgefordert.
Sicheres Schul-WLAN
Ist die Datenschutzfrage geklärt, kommen Sicherheitsaspekte zum Tragen. Schüler, Lehrer und Verwaltung nutzen unterschiedliche Daten mit eigenen Sicherheitsanforderungen. Diese Netze müssen sicher voneinander getrennt und effektive Zugangskontrollen eingerichtet werden. Ganz wichtig auch: Das Schul-WLAN muss aktuelle Verschlüsselung unterstützen, im Fachjargon: „WPA3“. Der Vorgänger WPA2 wurde bereits in 2017 durch massive Sicherheitsvorfälle als unsicher entlarvt und hat in modernen Schulnetzen nichts verloren. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor einem Einsatz.
Die Gretchenfrage der Administration
Gleichzeitig muss das WLAN dauerhaft instand gehalten werden. Nur wenn es während der gesamten Unterrichtszeit zuverlässig funktioniert und ausreichend Bandbreite liefert, kann digital gestütztes Lernen Wirklichkeit werden.
In Schulen kommen schnell mehr als 1.000 Endgeräte wie Notebooks, Tablets und Smartphones zum Einsatz, häufig sogar gleichzeitig. Online-Recherche, VideoStreaming und der Up- und Download von Materialien erzeugen jedoch hohe Datenmengen, die nach einem WLAN der neusten Generation WiFi6 verlangen.
Aber wie gelingt der technische Support, ohne dass Lehrkräfte im Nebenjob zum IT-Admin werden oder das Schulbudget überlastet wird? Helfen können Cloud-managed WLANs, die hoch automatisiert aus der Ferne verwaltet werden – etwa über ein kommunales Rechenzentrum, ein Systemhaus oder eine externe IT-Abteilung.
Orientierung im Anbieter-Jungle
Die gute Nachricht für Schulen, die bei der Auswahl sicherer und datenschutzkonformer Lösungen Orientierung brauchen: Die Bundesministerien in Berlin haben schon vor Jahren das Vertrauenszeichen „IT Security made in Germany“ ins Leben gerufen. Tragen dürfen es ausschließlich Unternehmen, die sich der Vertrauenswürdigkeit und vollständigen DSGVO-Konformität ihrer Lösungen verpflichten. Damit steht auch dem datenschutzkonformen Schul-WLAN nichts mehr im Wege.
11 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info
Text Dominik Maaßen
Diese Artikel sind in Zusammenarbeit mit LANCOM entstanden.
Die Digitalisierung als Chance begreifen
Digitalisierungsdebatten haben in den letzten zwölf Monaten enorm Fahrt aufgenommen. Zum Beispiel, wie man mit mehr Digitalisierung Geschwindigkeit und Transparenz beim Testen und Impfen hätte gewinnen können. Daraus ergäben sich zwangsläufig mehr Flexibilität bzw. weniger Einschränkungen für Menschen und Wirtschaft und somit weniger finanzielle Schäden in den Lockdown-Phasen.

Auch der immense Papieraufwand zum Beispiel bei Prüfung und Abwicklung von Finanzhilfen wäre digitaler sicher deutlich effizienter. Noch präsenter sind jedoch die Themen, die wir bei Arbeit und Bildung mit der Digitalisierung verbinden. Nach einem Jahr Home-Office diskutiert die Arbeitswelt immer noch kontrovers, ob selbiges eher Fluch oder Segen ist. Unternehmen sollten alles daransetzen, spätestens jetzt die Chancen von Modern Work zu sehen und dazu eine Strategie zu entwickeln.
Neue digitale Chancen Digitalisierung ist immer noch mit vielen negativen Attributen belastet: Es geht um Datensicherheit, gläserne Bürger, misstrauische Vorgesetzte, Kontrollverlust und vieles mehr. Und was ist Digitalisierung eigentlich? Laptop, Breitband-Internet und HomeOffice am Küchentisch zwischen lärmenden Kindern? Viel zu oft wird Digitalisierung nur auf der Technologieebene diskutiert. Stattdessen braucht es Kreativität und vor allem eine positive Einstellung. Kein ‚Ja, aber‘, sondern ‚Was wäre, wenn‘ muss es doch heißen. Nur so nimmt man die Menschen mit und vermittelt die Aspekte, die von Vorteil sind. Nicht jeder Mitarbeiter kann oder möchte remote arbeiten – das ist klar. Modern Work heißt aber auch nicht „entweder, oder“. Modernes Arbeiten ist vielmehr ein sinnvoller Mix aus Präsenz und mobilem bzw. virtuellem Arbeiten. Einfache und langweilige Prozesse müssen weiter digitalisiert werden, um mehr Zeit für die komplexen Themen zu schaffen, die von Mensch zu Mensch besprochen werden wollen. Der Bedarf nach flexiblen Arbeitsmodellen steht nicht im Widerspruch zu den Anforderungen der Unternehmen, sondern im Einklang. Firmen brauchen qualifizierte Mitarbeiter zu flexiblen Zeiten und diese finden sie weder im S-Bahn Einzugsgebiet ihrer Zentrale, noch sind sie für diese attraktiv mit Arbeitsmodellen, die in die Jahre gekommen sind.
Video als Bereicherung
Ein konkretes Beispiel: Videokonferenzen. Virtuelle Meetings werden häufig als schlechte Alternative zum persönlichen Treffen dargestellt. Dabei haben die vergangenen zwölf Monate eher das Gegenteil gezeigt. Gut geplante Videokonferenzen sind oft besser und effizienter als ein zur Routine

gewordenes, persönliches Meeting. Viele behaupten zwar noch strikt das Gegenteil, aber wir bei Jabra machen ganz eindeutig genau diese Erfahrung. Zudem lassen sich Reisezeit sowie erhebliche Kosten einsparen. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, spontan Gesprächsteilnehmer einzubinden, die unter normalen Umständen nicht am Meeting teilgenommen hätten, obwohl sie einen wertvollen Beitrag leisten würden. Videokommunikation ist prädestiniert für alle Gespräche, in denen Vertrauen aufgebaut werden muss oder komplizierte Inhalte verständlich vermittelt werden sollen. Vorstellungs- oder Verkaufsgespräche ausschließlich über Video wären noch vor einem Jahr unvorstellbar gewesen. Doch das Format funktioniert gut und ist für viele Firmen zu einer echten Alternative geworden.
Vorteile abseits der Arbeitswelt
Die Vorteile der Digitalisierung erstrecken sich nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern auch auf viele andere Bereiche. Dabei ist besonders die Bildung spannend. Hier beschränkt sich die Diskussion oft auf Tablets, WLan und vielleicht noch digitale Tafeln. Digitale Kompetenz bedeutet aber nicht, einen Computer bedienen und über soziale Netzwerke kommunizieren zu können. Es geht vielmehr auch darum, die Fähigkeit zu erlangen, wie man in einer virtuellen Besprechung effektiv kommuniziert. Die dazu erforderlichen Kompetenzen sind z.B. Empathie, emotionale Intelligenz, Komplexität zu vereinfachen und zu visualisieren, Relevanz. Insofern hilft eine über die reine Technik hinausgehende Strategie
den Schulen, ihre Absolventen auch methodisch besser auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Ein Umdenken in Richtung Modern Schooling lohnt sich: Unterrichtsinhalte können mit spannenden digitalen Inhalten bereichert werden. Das erhöht Motivation und begeistert. Wie bereichernd wäre es, wenn Experten von „Bildungspartnern“ virtuell zugeschaltet werden könnten und abseits des Lehrplans etwas Tolles präsentieren würden? Gute Konzepte helfen gegen Lern- und Lehrausfälle, Inhalte können besser verstanden werden, Betreuungszeiten und Lernkurven besser berücksichtigt werden. Mit Kreativität und Tatendrang ergäben sich hier viele neue Perspektiven.
Nicht jeder hat in den letzten Monaten nur positive Erfahrungen mit dem Thema Digitalisierung gemacht. Gerade deswegen sollten wir es jetzt erst recht angehen. Hybride Arbeitsund Bildungsmodelle werden zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Welt, sodass wir mit durchdachten Konzepten bereits jetzt die positiven Aspekte herausarbeiten und uns bestmöglich vorbereiten sollten. So überzeugen wir dann auch Skeptiker und sorgen für die optimale Verquickung von digitalen und menschlichen Faktoren.
Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 12
Die mobile Jabra PanaCast 180°-PanoramaKamera und Speak 710 Freisprecheinrichtung im Einsatz im Pädagogischen Zentrum Schloss Niedernfels in Marquartstein
Text Gregor Knipper
Weitere Informationen: jabra.com/ meetingroomtogo
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit JABRA entstanden.
Gregor Knipper Managing Director EMEA
DACH für Jabra Business Solutions

Wie Verwaltungen ihren Datenschatz heben – und alle davon profitieren
Ein Gespräch mit Jürgen Fritsche, Mitglied der Geschäftsleitung bei msg und Vorstandsmitglied bei der Initiative D21, über erfolgreiche Datenstrategien für Verwaltungen, Beteiligungstools und Prämissen für die Datendemokratie.
Mit ihrer Datenstrategie hat die Bundesregierung ein umfassendes Programm für eine verbesserte Datennutzung zur Förderung von Innovationen vorgelegt. Dabei soll der Staat zum Vorreiter werden. Was bedeutet das?
Schon heute verfügt der Staat über einen großen Datenschatz, der der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden könnte, damit auf dieser Grundlage Innovationen und neue Geschäftsmodelle entstehen können. Gleichzeitig könnte die Verwaltung effektiver und effizienter, aber auch dienstleistungsorientierter agieren, wenn sie selbst in der Lage wäre, diese Daten zu nutzen. Beide Aspekte erfordern ein hohes Maß an Datenschutz und -sicherheit, staatliche Souveränität über die Daten und entsprechende Datenkompetenz. Ein Beispiel für dieses Zusammenspiel ist etwa die Smart City. Schon heute verfügt eine Kommune über Geodaten, Daten aus Verkehrskameras, Messdaten zur Luftqualität, aber auch Daten der Behörden und viele mehr. Wenn diese Daten an einer Stelle zusammenkämen und ausgewertet würden, bieten sie eine hervorragende Grundlage für die Stadtplanung. Das geschieht heute schon, oft jedoch weitgehend analog. Jetzt kommen über das Internet of Things Daten aus Sensoren hinzu. Damit lassen sich städtische – und auch private – Services dynamisch anpassen: von einer Steuerung der Verkehrsflüsse über punktgenaue Transportdienste bis hin zur Leerung von Mülltonnen.
Wie können Unternehmen von den staatlichen Daten profitieren und Geschäftsideen und -modelle entwickeln?
Die „offenen“ Daten, die der Staat beziehungsweise die Verwaltung zur Verfügung stellen, sollen keine „ungeregelten“ Daten sein. Das beginnt schon damit, dass sie in einem bestimmten Standard vorliegen müssen, um umfassend und übergreifend genutzt werden zu können. Selbstverständlich sind keine personenbezogenen Daten enthalten. Und wichtig außerdem: Der Staat beziehungsweise seine Bürger entscheiden darüber, welche Nutzung sie zulassen und wie etwa Monopole zu verhindern sind. Das sind ein paar Grundelemente einer „Datendemokratie“. Auch und gerade unter diesen Prämissen können Geschäftsideen entstehen, die erfolgreich und nachhaltig sind. Der Anbieter eines Rufbusses beispielsweise, der auch noch Pakete mitnimmt, braucht die Daten zu den Mülltonnen nicht. Und er muss auch die Daten zu seinen Touren und
Fahrgästen nicht weiterverkaufen, um ökonomisch erfolgreich zu sein. Was in Zukunft denkbar und gewinnbringend sein wird, können wir uns heute noch kaum vorstellen – schon allein deshalb, weil wir die Daten noch nicht kennen. Die EU geht von einem Wachstum weltweit gespeicherter Daten um den Faktor fünf auf rund 175 Zettabyte bis zum Jahr 2025 aus. Besondere Potenziale liegen sicherlich im Gesundheitsbereich, individualisierte Medizin ist da ein Stichwort, sowie generell in Anwendungen Künstlicher Intelligenz.
Wo liegen die Chancen für die staatlichen Institutionen, also für die Verwaltung selbst?
Seit jeher ist es eine Kernaufgabe der Verwaltung, mit Daten zu arbeiten, Informationen zu managen. Ein erleichterter Zugriff auf Bestandsdaten auch über Behördengrenzen hinweg und technische Unterstützung bei ihrer Bearbeitung, auch durch Künstliche Intelligenz, würde und wird die Arbeit der Verwaltung deutlich voranbringen. Die digitale Rentenübersicht ist ein Beispiel, das die Datenstrategie benennt. Sie macht jedermann und jederfrau transparent, mit welchen Beträgen aus der staatlichen wie auch der privaten Vorsorge zu rechnen ist. KI kann die Kommunikation und Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern etwa durch Chatbots vereinfachen. Spracherkennung hilft bei der Auswertung von Bürgeranliegen, Bilderkennung bei der Bestimmung der Echtheit von Dokumenten. Und nicht zuletzt kann Künstliche Intelligenz entscheidungsvorbereitend unterstützen, etwa durch die Prüfung von Unterlagen und Anträgen.
Können Sie Beispiele geben, national oder international, wo und wie Kommunen bereits erfolgreich und vorbildlich ihren Datenschatz heben? Und wie profitiert die Gesellschaft davon? Hamburg hat ein digitales und medienbruchfreies System zur Bürgerbeteiligung online und vor Ort entwickelt. Über sogenannte „digitale Planungstische“ können Bürgerinnen und Bürger von zu Hause aus, mobil oder in Veranstaltungen digitale Karten, Luftbilder, Pläne, 3D Modelle und Geodaten abrufen und so genaues Feedback zu Planungsvorhaben geben. Das ist ein gutes Beispiel der Nutzung von Verwaltungsdaten, um Bürger an Entscheidungsfindungen zu beteiligen. Die Stadt Boston hat ein System, um die Gesamtleistung ihrer Stadt anhand des aktuellen Zustandes der kommunalen Serviceerbringung in Echtzeit
anzuzeigen. Der „Boston City Score“ berechnet sich aus Einzel-Indizes wie Zahl der Staus, Reaktionszeit der Servicebereiche der Stadt, Trends für kriminalistische Delikte und so weiter. Dazu werden aus diversen Diensten der Stadt nahezu in Echtzeit Statusinformationen gesammelt und angezeigt. Bürgerinnen und Bürger können auf einem Dashboard jederzeit sehen, wie ihre Stadt dasteht. Die städtische Verwaltung kann dann anhand der Informationen schnell Maßnahmen ableiten.
Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, was sind die nächsten Schritte? Manches hat bereits begonnen, etwa die Registermodernisierung, die auch in der Datenstrategie als zentrale Säule benannt wird. Registermodernisierung bedeutet eine Vereinheitlichung der Datentöpfe in der Verwaltung und einen geregelten Zugriff darauf. Daten müssen dann nicht immer wieder neu erfasst werden. Damit verbunden ist die Frage der registerübergreifenden digitalen Identifizierung – von Bürgern, Unternehmen und Behörden. Geplant ist dafür auch die Einführung eines Datencockpits, das den jeweiligen fallbezogenen Datenaustausch der Behörden dem Bürger, der Bürgerin transparent macht. Erforderlich ist außerdem ein Ausbau der Datenkompetenz in der Verwaltung. Benötigt werden etwa dringend Experten für Data Science.
Welche Rolle übernimmt msg in diesem Zusammenhang? Tatsächlich sind wir schon an vielen Stellen mit diesen Themen befasst. Wir unterstützen in der Registermodernisierung. Wir entwickeln Chatbots zur Unterstützung von Anfragen an Behörden. Wir haben Lösungen für sichere digitalen Identitäten, ein zentrales Thema. Wir haben darüber hinaus eine auf DIN-Normen und internationalen Standards basierte Datenplattform für Kommunen entwickelt, bei der die Datensouveränität in kommunaler Hand liegt. Darauf aufbauend, haben wir Dienste entwickelt, die jetzt in Corona-Zeiten unter anderem die Anmeldung für Schwimmbadbesuche oder Theater inklusive digitalem Bezahlen ermöglichen. Das Informationsmanagement ist die zentrale Kernkompetenz von msg. Wir unterstützen staatliche Organisationen und Kommunen dabei, ihre Arbeit zum Nutzen der Bevölkerung und Wirtschaft in die digitale Welt zu übersetzen.

Jürgen Fritsche Mitglied der Geschäftsleitung bei msg und Vorstandsmitglied bei der Initiative D21
Weitere Informationen unter:
msg.group/ public-sector
13 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit msg entstanden.
Text Dominik Maaßen
Die Zukunft beim Bezahlen
Während der Krise haben viele Unternehmen neue Angebote geschaffen, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten oder neue Einnahmequellen zu erschließen. Gleichzeitig sind sie natürlich auf vertrauenswürdiges und sicheres digitales Bezahlen angewiesen. Das wird sich auch in Zukunft für Händler wie Verbraucher noch einfacher gestalten.
Die Pandemie hat den Menschen in Deutschland gezeigt, dass digitale Zahlungen nicht nur optional, sondern mittlerweile eine wesentliche Dienstleistung sind. Gerade die Deutschen waren vor Corona überwiegend bargeldorientiert und die Entwicklung hin zu bargeldlosen Zahlungsmitteln ging eher langsam voran. Die Pandemie hat diesen Prozess beschleunigt. Immer mehr Unternehmen akzeptieren bargeldlose Zahlungsmittel und immer mehr Verbraucher fragen diese Option nach und nutzen sie. Großbritannien und die USA waren hier bereits vor der Pandemie viel weiter fortgeschritten.
Bezahlen über QR-Code Praktisch sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel neue QR-Code-Funktionalitäten: So können Händler, die ihre Produkte auf Wochenmärkten verkaufen, den QR-Code eines Bezahldienstleisters ausdrucken und an ihrem Stand gut sichtbar aushängen. Sie können ihn aber auch auf dem Tablet oder einem Smart-

phone zeigen. Kunden können den Code dann einfach scannen, den zu zahlenden Betrag eingeben und sofort das Geld an den Händler senden. Keine Berührung mit Bargeld oder Karte, keine PIN-Eingabe, keine Unterschrift ist notwendig. Auf diese Weise kann der Verkäufer den physischen Kontakt minimieren und so sich selbst, seine Mitarbeiter und seine Kunden schützen. Gleichzeitig verfügt er über eine erschwingliche und sofort verfügbare Lösung, ohne dass er in zusätzliche Hardware oder Software investieren muss.
Payment im Hintergrund Außerdem bewegt sich der Handel weg von Zahlungen zu einem festen Zeitpunkt hin zu Abonnementmodellen und dem Abwickeln von Zahlungen über Geräte wie Fernseher, Sprachassistenten, Messengerdienste, möglicherweise Autos und andere Dinge. Shopping kann in jedem Kontext stattfinden. Wenn man die Absicht hat, etwas zu kaufen, wird dann die Zahlung in dem Moment, in dem man die Absicht zum Ausdruck bringt, im Hintergrund stattfinden. Die Zahlung muss also kein separater Schritt mehr sein, nachdem man die Kaufabsicht geäußert hat. Bei Abonnements handelt es sich zum Beispiel um wiederkehrende Zahlungen, denen man zu einem bestimmten Zeitpunkt zugestimmt hat und die einfach im Hintergrund ablaufen. In Zukunft werden daher immer mehr Zahlungserlebnisse nahtlos vonstattengehen.
Praktisch für Zahlungen sind auch Wearables: Uhren sind als Gerät unabhängig. Man kann einen Anruf entgegennehmen oder mit der Uhr bezahlen,
auch ohne Telefon. Entscheidend ist am Ende nur die Identifikation. Interessant ist daher auch die Möglichkeit, Biometrie als potenzielles Zahlungsmittel nutzen zu können.
Schöne neue Shoppingwelt
Ein wichtiger Treiber beim Shoppen wird zudem 5G sein. Es wird auf der ganzen Welt für mehr und schnellere Verbindungen sorgen. Heute hat der Nutzer digital oft nur statische Erfahrungen – man sieht beispielsweise einfach nur eine Seite oder ein Bild. Mit 5G werden Virtual-Reality-Erfahrungen und das Erleben alternativer Wirklichkeiten möglich sein. Und das wird das Einkaufen noch persönlicher und für alle Sinne umfassend machen. In nicht allzu ferner Zukunft werden Verbraucher ein Kleid per Smartphone anprobieren können – und das ist besser, als nur das Kleid auf einer weißen Seite zu sehen. Solche Erlebnisse und schnellere Erfahrungen werden dazu führen, dass mehr Einkäufe online getätigt werden.

Kontaktlose Bezahllösung am Point of Sale: Zettle und der PayPal QR-Code
Immer mehr Verbraucher zahlen in der Pandemie bargeld- und kontaktlos. PayPal bietet Ladenbesitzern mit dem Kassensystem Zettle und dem darin integrierbaren QR-Code neue Möglichkeiten, Zahlungen vor Ort kontaktlos, schnell und sicher zu empfangen.
Barzahlung war in Deutschland bis vor Kurzem weit verbreitet. Die Pandemie hat das verändert: Kontaktlose Zahlarten werden bei Kunden immer beliebter. Eine Herausforderung –insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen und Selbstständige,
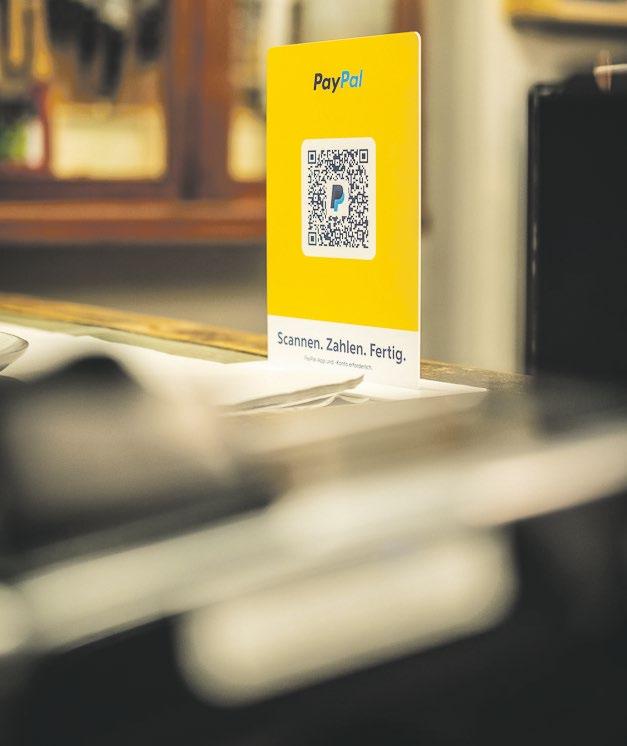

die nicht immer Bargeld-Alternativen anbieten. PayPal ermöglicht solchen Händlern schnelle und unkomplizierte Lösungen am Point of Sale (PoS), etwa mit dem digitalen Kassensystem Zettle oder dem PayPal QR-Code.
Ellen Teschendorf, Inhaberin der Küchenliebe-Stores in Berlin, bietet den PayPal QR-Code bereits seit September 2020 an. Während des Lockdowns musste sie für ihre angebotenen Küchen-Accessoires alternative Verkaufsmöglichkeiten finden: „Während die Läden geschlossen sind, biete ich sowohl Click and Collect, Video-Chat-Shopping als auch einen Lieferservice in Berlin an. Bei all diesen Optionen kann der Kunde gerne bei der Übergabe mit dem PayPal QR-Code bezahlen.“ So wie Teschendorf hat jeder Händler die Möglichkeit, in nur wenigen Minuten seinen individuellen QR-Code zu generieren und schnell und sicher Zahlungen zu empfangen. Dies funktioniert über die PayPal-App oder über ihr PayPal-Konto im Browser. Händler können ihren persönlichen QR-Code auf dem Smartphone oder Tablet vorzeigen oder sie drucken diesen aus, kleben ihn auf die Theke oder hängen ihn auf. Sticker, Aufsteller und andere professionelle
Die Anzahl der bargeldlosen Zahlungen, die wir entgegennehmen, hat sich verdreifacht.
Verkaufsmaterialien können sie im PayPal-Webstore bestellen. Auch im Gastronomiebereich hilft der QR-Code, Risiken zu reduzieren. Philip Vocke, Gründer von FirstLoveCoffee, einem mobilen Kaffee-Catering-Unternehmen aus Hamburg, setzt seit September 2020 auf bargeldlose Zahlungen. Im Zuge der Corona-Pandemie führte er den QR-Code von PayPal ein. Um das
Angebot an bargeldlosen Zahlungsmethoden auszuweiten, stieg Vocke dann im Januar 2021 auf PayPals Kassensystem Zettle um, welches zusätzlich zum QR-Code auch Kartenund weitere kontaktlose Zahlungen ermöglicht. „Die Anzahl der bargeldlosen Zahlungen, die wir entgegennehmen, hat sich verdreifacht. Ich überlege sogar, in Zukunft nur noch Bargeld-Alternativen anzunehmen, da dies die Kassenabrechnung deutlich vereinfacht“, so Vocke. Ein weiteres Plus für Händler, die sowohl online als auch stationär verkaufen: Zettle lässt sich nicht nur am PoS integrieren, sondern berücksichtigt auch die per PayPal getätigten Käufe im Webshop. Online- und Ladenbestände lassen sich so gebündelt an einem Ort prüfen und verwalten sowie die Umsätze aus beiden Einnahmequellen vergleichen.
Die Beispiele zeigen: Zettle und der PayPal QR-Code bieten gute Möglichkeiten, ohne großen Aufwand kontaktlose Zahlungen anzubieten, die Kundenbindung zu erhöhen und die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern zu schützen – sowohl für alle Geschäfte, die derzeit alternative Einkaufsmöglichkeiten anbieten, als auch zur Vorbereitung auf die Zeit nach dem Lockdown.
Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 14
Text Paul Howe Weitere Informationen: Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit PAYPAL entstanden.
Text Dominik Maaßen FOTO:KOONSIRI BOONNAK/SHUTTERSTOCK Weitere Informationen: paypal.de/qrc
Mit „Zero Trust“ sicher in der Cloud
– digitale Strategie für Banken und Versicherungen
Die Finanzbranche muss in den kommenden Jahren Antworten finden, wie sie schneller am Markt ist und gleichzeitig ihre IT-Kosten senkt. Die Cloud stellt einen von vielen Bausteinen dar, um sich effizient und zukunftssicher aufzustellen. Doch die Sicherheit dürfen die Unternehmen dabei nicht ganz aus der Hand geben. Vielmehr erfordert die Cloud eine „Zero Trust“-Architektur, in der jeder noch so kleine IT-Baustein penibel sicher gemacht wird.
Ein wichtiges Element für die künftigen Strategien von Banken und Versicherungen sind digitale Technologien wie Cloud-Computing, aber auch Data Analytics sowie die intelligente Automatisierung mithilfe von künstlicher Intelligenz und Robotic Process Automation (RPA). Mit der im März 2020 ausgebrochenen Covid-19-Krise kommt für viele Banken und Versicherungen nun noch der teilweise Verlust physischer Kunden-Kontaktpunkte wie Filialen oder Agenturen hinzu. Dadurch verstärkt sich der Druck, digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Corona führt so in den nächsten Jahren möglicherweise zu einem Digitalisierungspush bei Banken und Versicherungen.
Die Lünendonk-Studie
„Digital Outlook 2025: Financial Services“ hat sich diesen
Zukunftsstrategien von Banken und Versicherungen im deutschsprachigen Raum gewidmet. Dazu wurden Führungskräfte aus 129 Banken und Versicherungen befragt.
IT-Infrastruktur in der Cloud 68 Prozent der Anbieter arbeiten bereits mit der Cloud und weitere 29 Prozent verabschieden sich schon bald davon, ihre IT-Infrastruktur komplett selbst vorzuhalten. Rechenleistung aus dem Netz abzurufen, gilt inzwischen als normal. 82 Prozent der Versicherer wollen digitale Technologien nutzen, um Geschäfts- und IT-Abläufe zu verbessern, die schon da sind. Zwei Drittel setzen auf Gimmicks wie Sprachassistenten und neue Apps. 63 Prozent wollen damit beginnen, aus Daten Mehrwertdienste zu entwickeln und die bestehenden Produkte zu verbessern.
Auch die deutschen Banken sind zu 72 Prozent, das zeigt die
Am Black Friday steigen bei uns die Anfragen um das Vielfache eines normalen Tages. Dafür brauchen wir Rechenpower auf Knopfdruck und setzen deshalb künftig auf die Cloud.
zu sorgen. Dies passiert beispielsweise, wenn die API wegen zu vieler Anfragen in kurzer Zeit ausfällt. „Cyberangriffe können richtig Geld kosten“, warnt Tobias Hödtke, Managing Director beim IT-Dienstleiter Senacor Technologies. „Die Schäden gehen schnell in die Millionen und ramponieren oft auch das eigene Image.“
Neue Security-Architektur Unternehmen der Finanzbranche müssen daher mehr investieren. Und sie müssen sich von ihrer bisherigen SecurityArchitektur verabschieden. Diese basiert meist noch auf der Idee, um die kritischen IT-Systeme hohe Mauern zu ziehen und tiefe Gräben zu graben. Wer hinein will, braucht die richtigen Passwörter. Doch das System hat Lücken: Zu viele Benutzer verfügen über zu viele Rechte, wichtige Daten landen auf USB-Sticks oder in E-MailAnhängen. Hinzu kommt, dass nicht zuletzt durch die Cloud kaum noch ein Unternehmen alle Daten an einem Ort verwaltet. Die Methode der hohen Mauern funktioniert also wegen dezentral verwalteter Daten, mobiler Zugriffe und zunehmend offener IT-Systeme durch Programmierschnittstellen und extern eingebundene Dienste nicht mehr.

Lünendonk-Studie ebenfalls, bereits in der Cloud oder kurz davor. Nichts treibt die Banken zurzeit mehr um: Sie setzen von Infrastrukturen (IaaS) über Plattformen (PaaS) bis hin zu Software (SaaS) auf die Cloud, um künftig schneller am Markt zu sein und ihre Dienste besser zu skalieren. „Am Black Friday steigen bei uns die Anfragen um das Vielfache eines normalen Tages“, erklärt Luise Linden, CTO beim Zahlungsdienstleister Ratepay. „Dafür brauchen wir Rechenpower auf Knopfdruck und setzen deshalb künftig auf die Cloud.“
Gefahr durch Datenverlust und Cyberkriminelle
80 Prozent der Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen sich mit einem der großen Cloud-Anbieter zusammentun. Doch damit das gelingt, müssen sie genauso wie die Versicherer auch darüber nachdenken, wie sie ihre CloudAktivitäten absichern. Denn Cloud bedeutet, die IT nach außen zu öffnen und von überall aus online auf die wichtigsten Dienste zuzugreifen. Bei einer Bank reicht der digitale Durchgriff vom Mobile Banking bis ins Kernbanksystem.
Das Problem: Auf der digitalen Autobahn lassen sich Daten abfangen oder manipulieren. Schnittstellen (API) erlauben beispielsweise sehr leicht, von außen auf die Banksysteme zuzugreifen. Wer eine API falsch konfiguriert, kann dadurch auch Unbefugten ungewollt ermöglichen, vertrauliche Daten zu stehlen oder – schlimmer noch – für finanzielle Schäden
Schutz für jede Komponente durch „Zero Trust“
Die andere und sichere Strategie: Statt „die eine IT“ abzusichern, geht es künftig also vielmehr darum, jede einzelne Komponente für sich zu schützen. Der richtige Ansatz dafür heißt „Zero Trust“, also nichts und niemandem zu vertrauen. Weil „Zero Trust“ bedeutet, sehr detailliert jede IT-Komponente zu schützen, führt kein Weg daran vorbei, die Datenströme automatisch zu überwachen. „Das System muss merken, wenn sich plötzlich jemand statt aus dem Homeoffice in Frankfurt aus einem Café in Manila einwählt“, so IT-Experte Hödtke. „Einfach jeden reinzulassen, der das richtige Passwort kennt, ist im Cloud-Zeitalter viel zu riskant. Die Unternehmen brauchen neue Sicherheitskonzepte.“
Drei Methoden sind dafür notwendig, „Zero Trust“ in die Tat umzusetzen: 1. Zugänge kontrollieren: Jeder einzelne Workload nutzt eine eigene Identität und einen eigenen Dienst-Account. 2. Datenverkehr absichern: An jedem Kontaktpunkt müssen sich die beiden beteiligten Komponenten gegenseitig authentifizieren. Welche Dienste sich gegenseitig an- und aufrufen dürfen, regelt eine Policy. 3. Speicherplätze schützen: Alle Datenbanken, auch in der Cloud, sind über Schlüssel und Network Level Policies vor unbefugten Zugriffen geschützt. Dadurch können nur Workloads auf die Daten zugreifen, die über die richtige Identität sowie korrekte Rollen und Privilegien verfügen.
Spezialisierte Anbieter für eigene Software-Entwicklung Wichtig ist aber auch im nächsten Schritt: Bei diesen Vorkehrungen sollten sich die Unternehmen nicht allein auf ihren Cloud-Provider verlassen. Zwar verfügen gerade die großen Konzerne über eine große Heerschar an Security-Experten, die viel besser als eine Bank oder ein Versicherer dafür sorgen kann, dass alles seine Richtigkeit hat. Eine hundertprozentige Garantie gibt es aber nicht. Beispielsweise bietet sich an, eigene Schlüssel zu verwenden statt ein vom Provider gestelltes Key Management oder auf einen eigens dafür spezialisierten Anbieter zu setzen. Denn falls ausgerechnet dieser Dienst ausfällt, wären sämtliche Kunden betroffen und alle hätten auf einmal mit dem gleichen Sicherheitsleck zu kämpfen.
Eigene IT-Architektur anpassen Weil es dafür keine einzelne Technologie gibt, die Banken einfach einkaufen können, müssen sie das dafür nötige Know-how aufbauen und direkt in die Software-Entwicklung integrieren. Das liegt auch daran, dass sich der Cloud-Provider nicht dagegen schützen kann, dass ein schadhafter Code über eine Kunden-Schnittstelle in die Systeme gelangt. Dafür sind die Kunden, also die Banken, selbst verantwortlich. „Die Cloud kann einem nicht alles abnehmen“, so Ratepays IT-Chefin Linden. „Unternehmen brauchen redundante Infrastrukturen, wie gerade erst der Brand beim größten europäischen CloudAnbieter OVH gezeigt hat.“
Damit diese neuen IT-Systeme den veränderten Anforderungen an Offenheit, Vernetzung und Flexibilität gerecht werden, müssen die Banken und Versicherer die Transformation jetzt rechtzeitig starten. Denn der Umbau zu einer digitalen und modularen Plattform in der Cloud braucht in den kommenden Jahren ausreichend Know-how und Zeit.
15 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info
Luise Linden CTO beim Zahlungsdienstleister Ratepay FOTO: RATEPAY
Text Dominik Maaßen

Eine Unterrichtssoftware für alles –Präsenz, Distanz, Hybrid
Eine kostenlose Software mit der sich im Handumdrehen virtuelle Klassenzimmer einrichten lassen. Ohne technische Kenntnisse, ohne besondere Ausstattung und mit allem, was Schulen für ortsunabhängigen Unterricht brauchen? Gibt’s!

Ready to teach in einer Stunde: Jetzt zu unserem nächsten myViewBoard Classroom Einführungs-Webinar anmelden:

Einfach in der Handhabung, DSGVOkonform, auf unterschiedlichen Endgeräten einsetzbar und nah an den Möglichkeiten des Präsenzunterrichts –das waren die Bedingungen, mit denen sich Sprachlehrerin Franziska Wald-Lemke auf die Suche nach einer Softwarelösung für den Distanzunterricht, inmitten der Corona-Pandemie, machte. Fündig geworden ist sie zufällig: myViewBoard Classroom von ViewSonic biete alles, was sich ihr Kollegium gewünscht habe, so Wald-Lemke, die an der Sprachschule Lingua Masters in Paderborn Deutsch als Fremdsprache unterrichtet.
Die browserbasierte Online-Plattform ermöglicht es nun dem gesamten Kollegium trotz der physischen Distanz fast wie in der Schule zu unterrichten. Die Kursteilnehmenden können zudem über ihre Endgeräte nicht nur an die virtuelle Tafel schreiben, sondern auch per „Handhebe-Funktion“ aufzeigen und – sobald von der Lehrkraft freigeschaltet – sich mündlich am Unterricht beteiligen. Darüber hinaus gibt es die Funktion für Lehrpersonen, einen Live-Stream
starten zu können: „Gerade am Anfang lesen die Schüler oft von den Lippen ab – und so können sie uns während des Unterrichts permanent sehen“, erklärt die Lehrerin.
Vorbereiten und durchführen lässt sich der Unterricht mit der intuitiven und überwiegend über Drag-and-Drop-Funktionen arbeitenden Software sehr einfach. Lehrkräfte und Schüler(innen) brauchen neben einer Internetverbindung lediglich noch ein Smartphone oder ein anderes Endgerät, und loggen sich über einen Link datenschutzkonform ein.
Flexiblen Unterrichtsmodellen wie zum Beispiel synchrones Hybrid Lernen sind damit keine Grenzen gesetzt. myViewBoard Classroom ist nämlich so konzipiert, dass Schüler(innen) von jedem Ort aus gleichzeitig aktiv am Unterricht teilnehmen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich ein Teil der Lerngruppe gerade im Präsenzunterricht vor Ort befindet. Komplizierte und arbeitsaufwändige Wechselmodelle wie sie jetzt gerade unter Pandemie-Bedingungen stattfinden? Passé!
DIE DIGITALE TAFEL
FÜR ZUKUNFTSFÄHIGEN UNTERRICHT
Vielseitig, interaktiv und vor allem system-offen ermöglicht sie flexiblen Unterricht. Eine Investition für die Zukunft.
Mathe-Grundkurs am MariaWächtler-Gymnasium in Essen. Thema: bedingte Wahrscheinlichkeiten. Die Stimmung ist konzentriert, aber locker. Dafür sorgt gerade das Lernvideo mit der Beispielaufgabe. Für Lehrerin Laura Marie Walter ist es ein Leichtes, das Video spontan in den Unterricht einfließen zu lassen. Ein Klick genügt – mehr braucht es mit dem ViewBoard nicht.
Die digitale Tafel des im nordrhein-westfälischen Dorsten ansässigen Unternehmens ViewSonic lässt vieles, was an digitaler Technik oft kompliziert ist, einfach werden. Laptop starten, App aktivieren und im Nu ist das vorbereitete Tafelbild der Lehrerin auf dem Bildschirm zu sehen –ganz ohne HDMI-Kabel. Dabei ist es gleichgültig, über welches Betriebssystem das Lehrerlaptop läuft. Auch welche Art von Endgerät die Schülerinnen und Schüler nutzen, um das Tafelbild interaktiv vom Platz in der Klasse oder von zu Hause aus mitzugestalten, spielt keine Rolle. Das system-offene Whiteboard benötigt lediglich einen Internetanschluss für die Zusammenarbeit. Es funktioniert aber auch offline im Klassenzimmer als multifunktionales Präsentations-Tool.
Besonders die digitale Tafelfunktion mit den zahlreichen Visualisierungsmöglichkeiten genießt hohes Ansehen unter den Lehrkräften des Gymnasiums: Inhalte lassen sich viel schneller und eleganter darstellen, DSGVOkonform abspeichern und teilen.
Und wenn mal was kaputt geht?
Die ViewBoards sind nicht nur preiswert, sondern auch bruchsicher und für den Einsatz an Schulen konzipiert. Sollte dennoch ein Schaden entstehen, kommt die volle und für Bildungsträger exklusive 5-JahresGarantie zur Geltung: Mit VorOrt-Austausch sowie De- und Reinstallation.
Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 16
Text
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit VIEWSONIC entstanden.
Sonja Mankowsky
Weitere Informationen: viewsonic.com/de/ education/



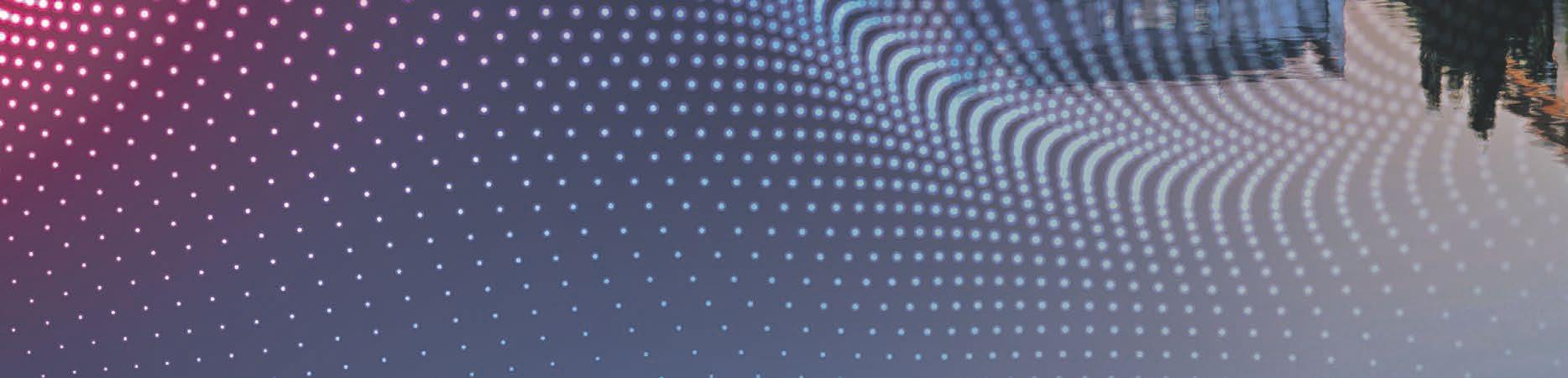

Wir unterstützen die Öffentliche Verwaltung bei der
41 Jahre msg

10 Jahre
im Public Sector
WERTEBASIERTEN DIGITALISIERUNG
Eine souveräne staatliche und private Infrastruktur ist heute wichtiger denn je für den Wirtschaftsstandort und das Gemeinwesen. Unsere Beiträge in den Bereichen GAIA-X, Digitale Identitäten, KI-Lösungen und Chatbots für die Verwaltung in Deutschland und für Europa ermöglichen verbesserte Prozesse, Interaktionen und Datennutzungen. Diese Arbeit macht uns stolz und wir setzen uns mit aller Kraft und unserer ganzen Expertise dafür ein.
Wir geben Auftraggebern wie Bundesministerien, Bundesverwaltung, Landesverwaltungen und Kommunen Impulse und schaffen innovative Lösungen „Made in Germany“. Der strategische Blick für das Ganze und für künftige Entwicklungen kennzeichnet die Arbeit unserer Berater.
Auf allen Ebenen und in den unterschiedlichsten Fachgebieten beraten und unterstützen wir zu digitaler Interaktion mit den Verwaltungskunden und zwischen Behörden, zur Digitalisierung von Prozessen und nicht zuletzt zu einer optimierten Datennutzung – sowie zu allen organisatorischen Veränderungen, die damit verbunden sind.
msg.group/public-sector
value – inspired by people
msg schafft einen Mehrwert in der digitalisierten Welt, indem wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen: als Kunden, als Nutzer unserer Lösungen und als Mitarbeitende. Wir bauen dabei auf über 40 Jahre Branchenexpertise und den kreativen, lösungsorientierten Unternehmergeist, der unsere Arbeit schon immer geprägt hat. Zudem schöpfen wir aus der Vielfalt in unserer Unternehmensgruppe: von der Ideen ndung bis zur Anwendung. Aus dieser ganzheitlichen Sicht nutzen wir das gesamte Angebot unserer Gruppe. Dies drückt sich auch in unserem Slogan „value – inspired by people“ aus.
Mit mehr als 8.500 Expertinnen und Experten in 28 Ländern sind wir auf den wichtigsten Märkten der Welt vertreten. Langjährige Partnerschaften verstärken unsere Schlagkraft und sorgen für nachhaltigen Er folg. Denn Nachhaltigkeit ist für uns ein entscheidender und richtungsweisender Wert.
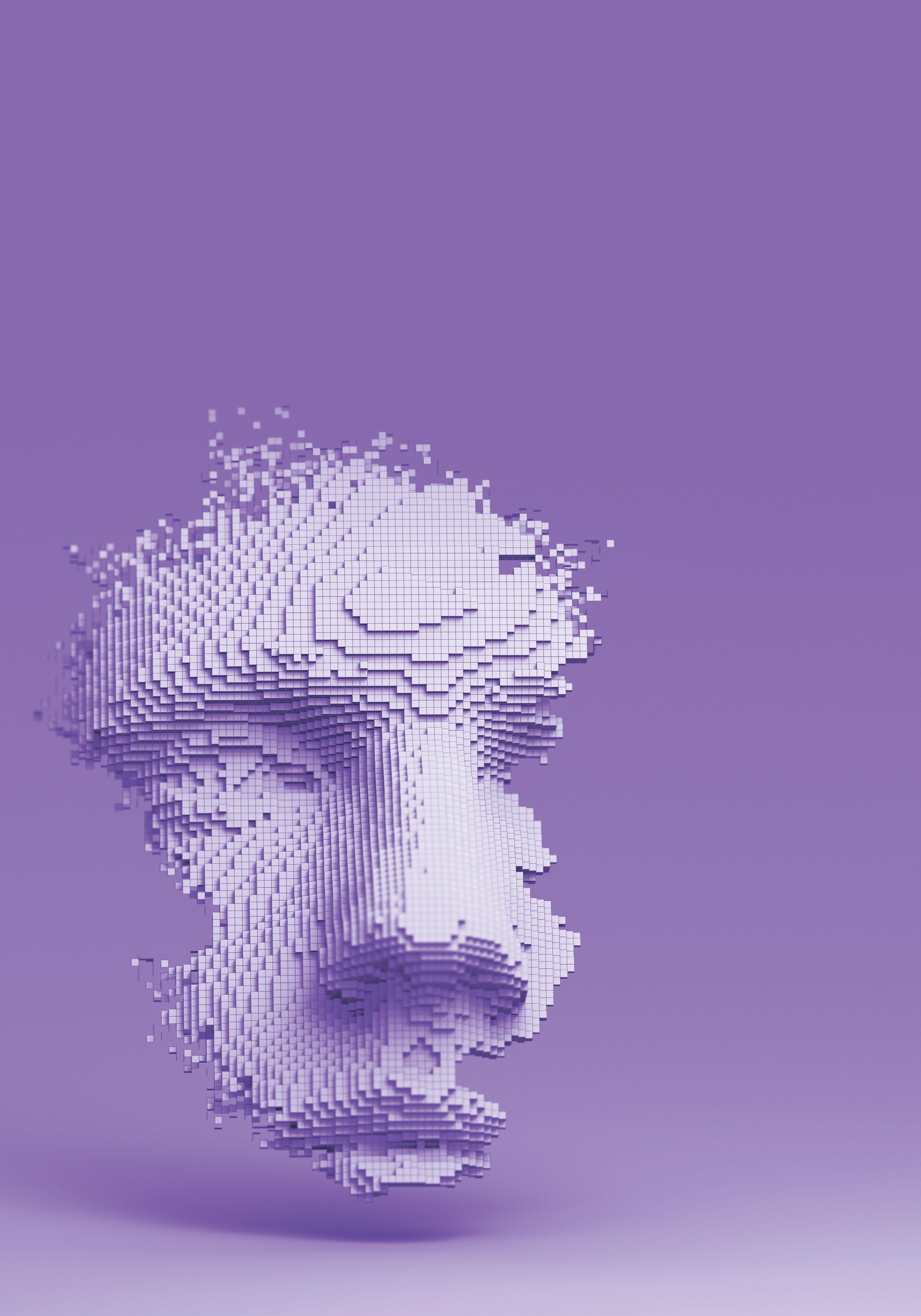





 Dr. Wolfgang Falter Partner und Leiter Sustainability Services Board bei Deloitte
Dr. Wolfgang Falter Partner und Leiter Sustainability Services Board bei Deloitte
 Milan Sallaba Partner und TechnologiesektorLead, Deloitte
Milan Sallaba Partner und TechnologiesektorLead, Deloitte























 Frank Himmel Technical & Sales Manager von Clevertouch
Frank Himmel Technical & Sales Manager von Clevertouch