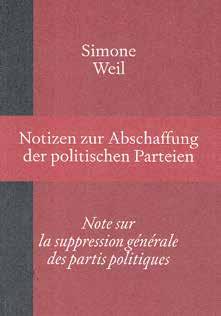
5 minute read
Ohne Parteien geht es nicht?
12 |
Text: Willibald Feinig
Advertisement
Es war ein langes Telefonat. Auf Empfehlung hatte ich Erwin Mohr, den Wolfurter Ex-Bürgermeister und Delegierten zu europäischen Räten, eingeladen, an einer Buchpräsentation am Spielboden teilzunehmen. Titel des Büchleins: „Notizen zur Abschaffung der politischen Parteien“. Autorin: Die französische, nirgendwo einzuordnende Denkerin Simone Weil, 1909-1943. Der provokante Text entstand im Untergrund: Die Philosophielehrerin aus bürgerlichem Haus – sie hatte, um das Leben von Arbeiter:innen kennenzulernen, ein Jahr in einer Fabrik gearbeitet – war erschrocken über die Hilflosigkeit der Demokratie, über die Kapitulation Frankreichs gegenüber dem Nationalsozialismus.
Der Traktat läuft darauf hinaus, dass man die Bildung politischer Parteien und jede Art von blindem Gehorsam und emotionaler Parteilichkeit in der Politik und im öffentlichen Leben gesetzlich verbieten soll. Gedanken, so herausfordernd für mich, dass ich sie neu übersetzt habe.
Auch der erfahrene und nach wie vor aktive Politiker i. R. hatte den Text verschlungen. Aber, bei allem Verständnis für die Kritik an Parteien – nach Ibiza, dem Sturm aufs Washingtoner Kapitol, angesichts von Personenkult, Propaganda und Korruption, für die er sich schäme – er habe schwere Bedenken: Wie soll das gehen, eine Demokratie ohne Parteien? Schon auf der niedrigsten, der Gemeinde-Ebene, und bei den einfachsten Fragen, sobald verschiedene Interessen im Spiel sind: Auch wenn man Fall um Fall abstimmt, wenn man Personen wählt statt Parteien – sofort würden die Mächtigeren, Redegewandten, Reichen die anderen auf ihre Seite ziehen, Clans würden an die Macht kommen, das wäre noch schlimmer als Parteien, die sich wenigstens ungefähr an ihr Programm halten müssten ....
Solche und viele ähnliche Einwände liegen nahe. Schließlich ist es ein wichtiges und hart erkämpftes Recht, sich zusammenzuschließen mit anderen, die gleiche oder ähnliche Probleme oder Ziele haben. Und über die für jedermann sichtbaren Schäden, die das demokratische Parteiwesen anrichten, tröstet man sich mit dem Churchill-Wort hinweg: „Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, aus-
genommen alle anderen.“ Oder durch Nicht-Wählen: Auf den gegenwärtigen französischen Staatspräsidenten entfiel etwa ein Drittel der Stimmen der Wahlberechtigten. Sind Parteien wirklich unumgänglich? Simone Weil sagt: Nein. Sie ist jung (im englischen Exil) gestorben, auch aus Enttäuschung, weil ihre konkreten Ideen und Gedanken zum Neuanfang Frankreichs und Europas nach dem NS-Grauen kein Gehör fanden. Nein – gegen jeden Augenschein, denn auch achtzig Jahre später bestimmen Parteien die Politik, und die Gesinnung der Parteilichkeit prägt die Gesellschaft inklusive Kunst und Religion bis hinein in die Schulaufsätze, ja sie feiert gerade in den Untiefen des Internet wenig fröhliche Urständ. Ihre Argumente: Unsere Unsere Parteien gibt es noch gar nicht Parteien gibt es noch gar nicht so lange, sie haben unter dem so lange, sie haben unter dem Druck Druck der Französischen Revolution Gestalt angenommen. Was der französischen Revolution Gestalt diese Revolution an grundlegend Neuem gebracht hat, verdanken angenommen. Die aufwändige, meist wir nicht Parteien, im Gegenteil. Die aufwändige, meist vergessene vergessene Prozedur der Befragung und Prozedur der Befragung und des Austausches, der Sammlung der des Austausches, der Sammlung der Be- Beschwerden noch der ärmsten Gemeinde des Landes, die von schwerden noch der ärmsten Gemeinde ihren Abgeordneten 1789 nach Versailles und Paris gebracht des Landes, die von ihren Abgeordneten wurde, sie ist es, die Frankreich – und die Welt – nachhaltig ver1789 nach Versailles und Paris gebracht ändert hat. Und der berühmte „Contrat social“ Rousseaus, auf wurde, sie ist es, die Frankreich – und den sich schon die Revolutionäre bezogen, ist keine Glorifizierung die Welt – nachhaltig verändert hat. der Demokratie, wie sie die Orbans, Trumps, Kaczynskis, Erdogans oder Bolsonaros heute weltweit in Zweifel ziehen – von den Diktatoren zu schweigen. Vielmehr klärt die Schrift die Bedingungen, unter denen die republikanische Staatsform am ehesten für Wahrheit und Gerechtigkeit aller sorgen kann. Damit gemeinsame Entscheide zum Wohl der Allgemeinheit in Wort und Tat zustande kommen können, so Weil, müssen nämlich - die Emotionen zurückgedrängt werden (statt angestachelt wie in den Wahlkämpfen) - Sachen zur Debatte stehen – nicht Personen; Personalisierung in der Politik (und überhaupt) ist Flucht vor Verantwortung und Nachdenken - Ideen und Fähigkeiten Einzelner, die der Allgemeinheit nützen, müssen auf eine neue Art gefördert werden. (Je-
mand mit politischer Begabung darf nicht darauf angewiesen sein, sich einer Partei anzuschließen, mit deren Programm er höchstens zum Teil übereinstimmt.) - Ohne Zirkel und Kreise, ohne Medien, in denen diese Ideen ausgeprochen und diskutiert werden, kann es keine nützliche Politik geben. (Zeitungsprojekte wie die marie hätten Simone Weil sehr entsprochen, denke ich; die Verwüstung der Medienlandschaft trotz oder wegen leicht zugänglichem und (noch) billigem Internet hätte sie alarmiert.) Dass aus solchen losen poltischen Zirkeln „Bewegungen“, geschlossene
Gruppen, letztlich Parteien mit Abstimmungszwang werden, gehöre gesetzlich verboten. - „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ (Ingeborg Bachmann) – und sie ist ein und dieselbe für alle, wenn auch oft nicht oder nur zum Teil klar oder von „Leidenschaften verdeckt“ (Weil). Einzig der Wahrheit und Gerechtigkeit darf ein:e politisch Tätige:r verpflichtet sein – nicht der Parteiräson, das heißt, dem Machterhalt und der Machtvermehrung.
Hellsichtige Gedanken, aus der Sorge um die Demokratie entsprungen. Simone Weil hat sie vor ihrem Tod 1943 im Hauptwerk „Die Einwurzelung“(L'enracinement) und auch in anderen Appellen wiederholt und ergänzt. Zum Beispiel pocht sie auf die Trennung von Gesetzgebung, Regierung und Justiz, die beide überprüft – ein Unterschied, der auch in Europa weitgehend zur Farce, zur Partei-Sache geworden ist. Es ist hoch an der Zeit, sich den Gedanken dieser Prophetin zu stellen.
Von Willibald Feinig, der Simone Weils Büchlein über die „Abschaffung der politischen Parteien“ neu übersetzt hat Simone Weil Notizen zur Abschaffung der politischen Parteien Dt.-frz., übersetzt und herausgegeben von Willibald Feinig. Verlag Bibliothek der Provinz, 2022, 64 S. ISBN 9 78 399126113 1
Simone Weil, geboren 1909 in Paris. Studiert Philosophie in Paris, Lehrerin, Fabriksarbeiterin, nimmt am spanischen Bürgerkrieg teil, ab 1936 intensive Auseinandersetzung mit Christentum und Kirche; ab 1941 in der Résistance, als Jüdin 1942 im Exil zuerst in den USA, dann in England, wo sie 1943 an Unterernährung und Tuberkulose stirbt. Schriften (Auswahl, alle posthum veröffentlicht): L'enracinement (dt. Die Einwurzelung), La condition ouvrière (dt. Fabriktagebuch), Pensées sans ordre concernant l'amour de Dieu (unübers.), Ecrits de Londres et dernières lettres (unübers.), La pesanteur et la grâce (Auswahl, dt. Schwerkraft und Gnade). Eine kritische Gesamtausgabe erscheint seit 1988 bei Gallimard.
Buchpräsentation am Spielboden
mit der Soziologin und Denkerin Marianne Gronemeyer, dem Weil-Kenner Walter Buder, dem Leiter des F. M. Felder-Archivs Jürgen Thaler, dem Landtagsabgeordneten und Musiker Bernie Weber (angefragt) und dem Innsbrucker Theologen Wolfgang Palaver. Abschließend geht der Herausgeber auf ihre Stellungnahmen ein.
Die Parteien, die Demokratie und das Gemeinwohl Spielboden, Dornbirn, Mittwoch, 21. September, 19:30 Uhr

WÜRDE/DIGNITY
Ausstellung und Performance von Conni Holzer
6. Oktober 2022, Performance 18:30 Uhr Kantine Kaplan Bonetti
Kunst in der Kantine
Kaplan Bonetti gGmbH
Kaplan-Bonetti-Straße 1 6850 Dornbirn www.kaplanbonetti.at









