




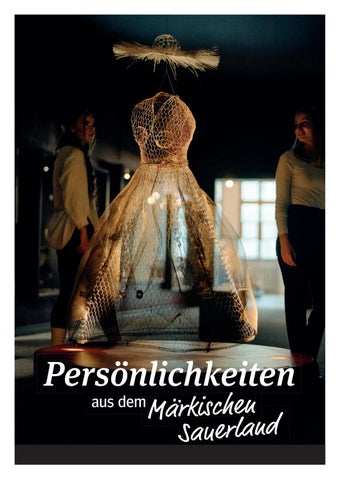





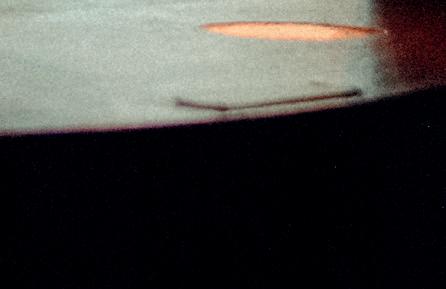







aus demMärkischen






16 Anna von Landsberg bringt das Hüttenwesen nach Wocklum
24 Friedrich Woeste auf der Spur heimatlicher Sagen und Mythen
30 Der Universalgelehrte Zuccalmaglio wird häuslich
36 Ernst Danz macht beim Verschönern Iserlohns eine Entdeckung
42 Wilhelm Seissenschmidt zeigt einmal mehr soziales Engagement
46 Das Kiepenlisettken erobert sich die Welt
50 Gustav Selve geht in Altena seinen eigenen Weg
56 Carl Berg und die Luft schiff-Projekte im Deutschen Kaiserreich
64 Dr. Friedrich Deisting unterstützt seine Mitmenschen in Kierspe
72 Eugen Schmalenbach aus Halver stellt die Weichen für seine Zukunft
78 Anna von Holtzbrinck , die Gnädige vom Habbel, muss umdenken
84 Alfred Colsman aus Werdohl verlagert seinen Schwerpunkt
90 Karl vom Ebbe erkundet das Märkische Sauerland von heute


das Märkische Sauerland öffnet seine Türen. Tritt ein und begegne fazinierenden Menschen mit ihren Geschichten, die für unsere Region und die Orte von besonderer Bedeutung waren. Die meisten von ihnen sind bis heute unvergessen. Sie repräsentieren vieles von dem, was die Menschen im Märkischen Sauerland noch immer auszeichnet und die ganze Region zu etwas Besonderem macht.
So haben unsere „Märkischen Originale“, wie wir sie gerne nennen, zum Beispiel ihren ganz eigenen Kopf. Nahmen sie sich etwas vor, setzten sie es auch um. Sie waren gradlinig, strebsam und offen für Neues. Viele von ihnen steckten voller Erfinder- und Forschergeist. Manche kamen aus der Ferne und fanden erst hier den fruchtbaren Boden, um ihre Ideen zur
Menschen wie sie – die sich auch durch Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Geselligkeit auszeichneten – haben das Märkische Sauerland zu dem gemacht, was es noch heute ist: eine erfolgreiche Wirtschaftsregion und zudem eine abwechslungsreiche Tourismusregion, die ihre gewerblich geprägte Entwicklung nicht versteckt. Schließlich hat gerade diese Geschichte auch ein reiches industriekulturelles Erbe hinterlassen, welches das Märkische Sauerland für dich besonders spannend und einzigartig macht.
Lerne jetzt unsere Originale kennen – als kleinen Vorgeschmack auf unsere Region!
Und dann: bis bald im Märkischen Sauerland.


Hana Beer, Geschäftsführerin
Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e. V
Kirsten Jütte, Erste Vorsitzende
Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e. V
Knapp 20 Jahre, nachdem Hermann Wilken seine Heimatstadt zum Studium verlassen hatte, kehrte er 1564 zu einem längeren Besuch nach Neuenrade zurück. Dort ließ man sich die Gelegenheit nicht entgehen, einen weit gereisten Universalgelehrten in der Stadt zu haben. Mit vereinten Kräften überzeugten die Räte den Heidelberger Professor, ihnen eine Kirchenordnung zu schreiben. So verfasste er innerhalb kurzer Zeit die Kerckenordeninge der Christliken Gemeine tho Niggen Rade. Wie genau es dazu kam, weiß man nicht. Aber so könnte es gewesen sein.
Als er endlich ankam, fühlte er sich erschöpft. Ganze neun Tage hatte Hermann Wilkens Reise gedauert. Meistenteils kalte Märztage. Zu Pferde war er in seine Heimatstadt Niggen Rade (Neuenrade) gekommen. Ohne Begleitung, nur mit dem nötigsten Gepäck. Erst kurz vor der Abreise hatte er der Familie per Boten eine Nachricht gesendet, dass er einige Wochen in der Heimat verbringen würde. Und dass er nicht aus Heydelberg (Heidelberg) anreise, sondern aus dem pfälzischen Oppenheim. Denn dorthin hatte die philosophische Fakultät der Universität umziehen müssen, nachdem in Heidelberg ein weiteres Mal die Pest ausgebrochen war. Kurz, bevor es für ihn nach Heidelberg zurückging, nutzte Hermann die Gelegenheit, für eine Weile die Familie zu besuchen.
Lange Ritte war er nicht mehr gewohnt, seitdem er in Heidelberg 1561 dauerhaft heimisch geworden war. Auf Empfehlung seines inzwischen verstorbenen Förderers Philip Melanchton war er an der Universität zunächst als Aushilfslehrer tätig gewesen. Ein hervorragender Abschluss des Magistertitels 1563 machte ihn zum Professor für Griechisch. Mit Anfang 40 war der Gelehrte dort angekommen, wo er sein wollte: Er lehrte und forschte an der, nach Prag und Wien, ältesten Universität im deutschen Sprachraum. Seine Position ließ ihm auch genug Zeit, eigene Schriften und Bücher zu verfassen. Die frühe Unterbrechung kam ihm nicht gelegen, doch die Pest war die Pest. Wer konnte, floh. Im Wissen, dass diese Plage kam und ging.


Neuenrade – seit gut 200 Jahren eine Stadt mit mehr als 500 Seelen – war zwar immer wieder Opfer von Stadtbränden geworden, doch von der Pest verschont geblieben. Der bestens befestigte Ort war von einer hohen Stadtmauer umschlossen. Zu jener Zeit war stets mindestens ein Mitglied von Hermanns Familie im Rat vertreten, bei seiner Ankunft im März des Jahres 1564 war sein Bruder Diederich Bürgermeister. Der ließ es sich nicht nehmen, ihn sogleich am Familiensitz in der Ersten Straße zu begrüßen, gleichzeitig der Sitz des Gasthauses der Familie. Auch der Rest der Familie bereitete ihm einen freundlichen Empfang. Seiner Mutter stand die Freude ins Gesicht geschrieben und sein Vater klopfte ihm gar auf die Schulter. Sein Gemach am Familiensitz war bereits hergerichtet. In zwei Tagen sollte zu seinen Ehren ein Festmahl stattfinden – schließlich war Hermann inzwischen ein berühmter Mann. Geladen waren alle Honoratioren der Stadt, viele Männer waren ihm bekannt. Doch zunächst wollte und sollte sich Hermann vom langen Ritt erholen. Er freute sich über wohlgeordnete Verhältnisse, vor allem aber auf eine komfortable Schlafstatt nach den Übernachtungen auf sehr unterschiedlichen Lagern der Herbergen. Nach einem kurzen Mahl begab er sich zur Ruhe und träumte in seiner ersten Nacht nicht eben angenehm von überstandenen Nächten in Frankofurtum (Frankfurt), Niwiheim (Bad Nauheim), Cleeburg (Hüttenberg), Kaczenfurt (Katzenfurt), Hegera (Haiger), Sige (Siegen), Heylichinbach (Hilchenbach) und Finnentrop.
Dennoch wachte er gestärkt auf, nahm ein Frühstück und begab sich zu seinem Bruder ins Rathaus. Der berichtete ihm vom Fortgang der kirchlichen Reformation in der Stadt. Nachdem Neuenrade sich Luthers Lehren angeschlossen hatte, sollten jetzt praktische Änderungen folgen. Hermann kannte die Situation bereits aus Briefen der Familie. Der Neuenrader Rat hatte vor kurzem entschieden, die katholische Marienkapelle als protestantische Kirche zu weihen. Für Hermann eine logische Konsequenz und ein nachvollziehbarer Plan – auch wenn in den Herzogtümern Jülich, Kleve und Berg offiziell noch das katholische Bekenntnis galt. Die Brüder nahmen gemeinsam ein Mittagsmahl ein und verabschiedeten sich dann voneinander. Hermann führte der Weg aus der Stadt hinaus in die winterlichen Wälder bis hinauf zum Berentroper Berg. Am Kloster ließ er sich von den Mönchen Wasser geben, dann kehrte er nach Neuenrade zurück. Während er sich auf die abendliche Zusammenkunft mit der Familie freute, ging ihm der Gedanke ans christliche Abendmahl durch den Kopf. Eine Kirche umzuwidmen, war eine Sache. Doch wie würde der Gottesdienst sich gestalten? Aus seiner Zeit an der Domschule in Riga kannte er die strenge Ordnung der dortigen Abläufe in der protestantischen Kirche – und auch in Neuenrades katholischer Kirche hatten die Messen nach klaren Regeln stattgefunden. Doch diese Regeln ließen sich in keiner Weise auf einen protestantischen Gottesdienst übertragen.
Beginn der Reformation durch Luthers 95 Thesen
In der Dämmerung des Märztages kehrte er nachdenklich zum Familienhaus zurück. Beim Nachtmahl ging es ausschließlich um familiäre Angelegenheiten. So sprach die Familie über die beruflichen Schritte, die Hermann und sein Bruder Philipp genommen hatten. Letzterer war Hermann – immer mit einigen Jahren Verzögerung – sowohl zum Studium nach Wittenberg als auch auf die Position in der Domschule in Riga gefolgt. Jetzt dachte Philipp daran, nach Heidelberg zu gehen, doch der Pestausbruch hatte diesen Wunsch vorerst zunichtegemacht. Der Abend endete früh, denn für den nächsten Tag waren reichlich Gäste geladen.
die Neuenrader Kirchenordnung von 1564 in der ganzen Region einzigartig war?
Hermann zog sich ins Schlafgemach zurück, trank im Kerzenschein noch ein Bier und dachte wieder an das Abendmahl. Neuenrade würde kirchliche Regeln brauchen – und stand damit sicher nicht allein. Er wusste von der Rigaer Kirchenordnung und der Mecklenburger Kirchenordnung von Melanchthon. So manche protestantische Stadt hatte sich lange vor dem Augsburger Religionsfrieden 1555 eine eigene Kirchenordnung gegeben. Soest zum Beispiel 1532 1557 war die Pfalz-Zweibrückische Kirchenordnung erlassen worden. Doch in den Herzogtümern Jülich, Kleve und Berg war ihm nichts bekannt. Allerdings war er ja bei aller protestantischen Prägung kein Theologe. Daher war es auch müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Er löschte die Kerze und ging zu Bett.
Den nächsten Vormittag widmete er sich seinen Vorlesungen zu Homer. Nach zwei Semestern stand er noch immer am Anfang seiner Lehrtätigkeit. Es galt, seine Studenten mit dem Stoff zu fesseln. Er wollte ihnen nicht nur Griechisch beibringen, sondern ihnen die besondere Bedeutung der beiden wichtigen Epen der Menschheitsgeschichte – der Illias und der Odyssee – vermitteln. Hermann wollte Homers Kosmos für sie aufspannen. Bis zum Mittag arbeitete er konzentriert am großen Eichentisch, den er noch aus seiner Schulzeit kannte.
Am Mittagstisch ging es lebhaft zu, da auch Diederichs Kinder zugegen waren. Der mahnte sie mit mäßigem Erfolg zur Ruhe, wirkte dennoch abwesend. Eine Zusammenkunft des Rats stand ihm bevor. Nach der Mahlzeit bat Diederich Hermann, ihn als Gast zu begleiten. Auf dem kurzen Weg zum Rathaus berichtete er seinem Bruder: Der Rat, der aus elf Ratsherren bestand, wollte nicht nur über das Procedere bei der protestantischen Weihe der Neuenrader Kirche sprechen, sondern auch über die Gestaltung des Gottesdienstes.
Hermann war nicht erstaunt, auch er hatte ja bereits über die Ausprägung des Gottesdiensts nachgedacht. Und neben dem Ablasshandel der katholischen Kirche war auch der Pomp ihrer Messen einer der Auslöser der Reformation gewesen. In der protestantischen Kirche hingegen sollte die Botschaft Gottes schlicht und für alle Gemeindemitglieder verständlich vermittelt werden. Er war gespannt, was im Rat besprochen würde.
Über die Kindheit Hermann Wilkens ist wenig bekannt. Seine Familie soll ein Gasthaus besessen und einflussreiche Mitglieder der städtischen Gemeinde hervorgebracht haben. 1545 schrieb sich Hermann als Student an der kurbrandenburgischen Landesuniversität Frankfurt/Oder ein. Zwei Jahre später wechselte er zum Studium nach Wittenberg, wo er auf Philipp Melanchthon traf, der dort Luthers Werk fortführte. Jener empfahl Hermann Wilken 1552 als Rektor an die Latein- bzw. Domschule in Riga, wo er viele Jahre blieb. 1561 wollte er sein Studium zunächst in Rostock fortsetzen, entschied sich dann jedoch für Heidelberg – vermutlich ebenfalls noch auf Empfehlung Melanchthons, der 1560 verstarb.
Sein Magisterabschluss 1563 in Heidelberg war so hervorragend, dass er zum Professor für Griechisch berufen wurde. Bereits im Sommersemester hielt er erste Vorlesungen, im Wintersemester gehörte er offiziell zur Philosophischen Fakultät. Kurz nach Beginn des Wintersemesters brach jedoch die Pest aus, die Philosophische Fakultät zog ins Städtchen Oppenheim. Zum Ende der Oppenheimer Zeit reiste Hermann Wilken nach Neuenrade zur Familie, wo er die Neuenrader Kirchenordnung verfasste. Der Landesherr allerdings, Herzog Wilhelm V. von Jülich, Kleve und Berg, ließ diese Kirchenordnung verbieten, obwohl er in Glaubensfragen keine strenge Linie vertrat und zwischen den christlichen Glaubensparteien vermittelte. Er ließ die gedruckten Bücher noch beim Buchdrucker in Dortmund vernichten. Zwei Exemplare blieben jedoch bis in unsere Zeit erhalten.
Hermann Wilken kehrte nach Heidelberg zurück, wo er zum angesehenen Mitglied des Lehrkörpers und 1569 sogar zum Rektor der Heidelberger Universität gewählt wurde. Bis 1579 blieb er Professor für Griechisch. Nach der Spaltung der evangelischen Kirche in reformiert und lutherisch versuchte der streng lutherische Kurfürst Ludwig VI. von der Pfalz, die Professoren zu diesem Bekenntnis zu zwingen. Doch die meisten Professoren weigerten sich – so auch Hermann Wilken. Ein Großteil des Lehrkörpers wechselte nach Neustadt an der Hardt. Nach Ludwigs Tod kehrten sie nach Heidelberg zurück – Hermann Wilken lehrte dann bis 1601 als Professor für Mathematik. 1603 starb er in Heidelberg.
Der Universalgelehrte hinterließ neben der Neuenrader Kirchenordnung und dem Neuenrader Gesangbuch viele wissenschaftliche Schriften, darunter Ausführungen zur Astronomie sowie Schriften zur Mathematik, zum Kalenderwesen und zur Landvermessung. Als sein Hauptwerk gilt jedoch „Christlich Bedenken und Erinnerung von Zauberey, woher, was und wie vielfältig sie sey …“, in dem er sich mit dem zunehmenden Hexenwahn auseinandersetzte, vor blinden Hexenjagden warnte und sich gegen Hinrichtungen aussprach. Die Hexenverfolger waren mächtig, daher veröffentlichte er das Buch 1585 unter dem Pseudonym Augustin Lercheimer. Weitere Auflagen erschienen 1586, 1597, 1627, 1654, 1847 und 1888
Die Ratsherren hießen Hermann willkommen und begrüßten ihn herzlich. Die meisten waren der Ansicht, dass man vom Beisein dieses Sohnes Neuenrades und weit gereisten Gelehrten nur profitieren könne. Auch der Pfarrer war der Einladung gefolgt. Es ging schon bald hoch her. Man kam vom Höckchen aufs Stöckchen, sprang von der Kirchenweihe über die Länge der Predigt bis zur Ausprägung des abschließenden Segens. Irgendwann hob einer der Ratsherren die Hand und schlug vor, erst über die Weihe zu beraten und dann über die Gestaltung des Gottesdienstes.
Hermann tatsächlich innerhalb kürzester Zeit eine individuelle Kirchenordnung für seine Heimatstadt verfasste und die Stadt sie trotz Verbots lange Zeit nutzte?
Man stimmte zu, diskutierte weiter und legte Pfingsten als Tag der Weihe fest. Der Pfarrer erklärte sich bereit, die Vorbereitungen zu treffen, kam aber dann auf einen wichtigen Punkt zurück: Die Gestaltung des anschließenden ersten Gottesdienstes in der neu geweihten Kirche – immerhin an einem der höchsten christlichen Feiertage. Hermann nickte bedächtig. Dann hob er die Hand und warf ein, dass einige protestantische Städte diese Abläufe in einer Kirchenordnung festgeschrieben hätten. Und dass eine solche Kirchenordnung auch für Neuenrade eine Lösung sein könne.
Der Pfarrer gab ihm Recht und erwähnte die seit langen Jahren existierende Soester Kirchenordnung, von der er gehört hatte, die er jedoch nicht im Detail kannte. Auch die Räte und der Bürgermeister waren von der Idee angetan. Die Frage war nur: Wer könnte eine solche Kirchenordnung für Neuenrade verfassen? Dazu noch innerhalb weniger Wochen?
Diederichs Blick wanderte zu seinem Bruder. Der hob fragend die Augenbrauen, schüttelte dann leicht den Kopf. Doch es war zu spät. Der Pfarrer erinnerte sich, dass Hermann in Wittenberg studiert hatte – noch dazu bei Philipp Melanchthon. Die perfekte Referenz.
Doch Hermann wehrte ab, er sei kein Theologe und in Kirchenfragen nicht bewandert. Seine Erfahrungen beruhten beinahe ausschließlich auf eigenen Gottesdienst-Besuchen. Doch auch die Ratsherren hatten inzwischen Feuer gefangen und redeten wieder durcheinander. Gelehrter, Wittenberg, Professor, Melanchthon klangen aus dem Stimmengewirr immer wieder durch. Der Professor hatte die wie zum Gebet zusammengeführten Hände an den Mund gelegt. Mehr überrascht als verärgert, welchen Lauf die Diskussion nahm. Besser ginge es doch nicht, erklang es von den Herrschaften. Hermann hob beschwichtigend beide Hände und bat sich Bedenkzeit aus. Dann verließ er mit freundlichem Gruß die Versammlung.
Quitmannsturm
Auf dem Kohlberg, mit 514 m die höchste Erhebung in Neuenrade, befindet sich der 14 m hohe Quitmannsturm – ein Aussichtsturm mit tollem Ausblick auf das Sauerland

Der Tag war weit fortgeschritten. Bis zum abendlichen Festmahl blieb keine Zeit mehr, durch Wald und Flur zu wandern. Daher entschied sich Hermann, Neuenrade auf der Stadtmauer zu umrunden. Die Heimatstadt zu seinen Füßen ging er los. Zweimal grüßte er die Wächter, die auf der Mauer ihre Runden drehten. An allen vier Enden der rechteckigen Anlage blieb er stehen, blickte erst auf die Stadt, dann auf das Umland. Auch auf der Höhe des Kirchleins verweilte er länger.
Sicher würde er seiner Heimatstadt gerne helfen. Allein, ihm fehlte das tiefe Wissen. Eine schlechte Ausgangsposition für einen Gelehrten. Er müsste das Ganze überschlafen. Aus dem Stegreif konnte er keine Entscheidung treffen. Andererseits drängte die Zeit. Pfingsten war nicht weit. Die heutige Versammlung war für eine so weitrechende Entscheidung viel zu spät gewesen. Sei’s drum. Er freute sich erstmal auf einen festlichen Abend.
das Neuenrader Sanctus überregionale Bedeutung erlangte und bis heute noch in Neuenrade und in vielen Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen vor der Gabenbereitung des Heiligen Abendmahls angestimmt wird?
Das Gasthaus der Wilkens summte wie ein Bienenstock. Dabei waren die Gäste noch gar nicht eingetroffen, doch Köchinnen und Mägde steckten tief in den Vorbereitungen. Hermann blieb also noch Zeit, sich in sein Gemach zurückzuziehen. Kurz darauf klopfte es an der Tür, Diederich trat ein und kam sogleich auf die Versammlung zu sprechen –ausdrücklich, um seinen Bruder nicht zu bedrängen. Hermann wiegelte ab und versprach, am nächsten Tag eine Entscheidung zu treffen. Jetzt würde man feiern. Gemeinsam gingen sie ins Gasthaus hinunter.
Der Abend versprach, sehr gesellig zu werden. Die Familie ließ sich nicht lumpen und fuhr trotz Fastenzeit reichlich Fleisch und Brot auf, auch an Bier wurde nicht gespart. Alle Ratsherren waren gekommen, dazu der Amtsherr, weitere Honoratioren der Stadt sowie der Pfarrer.
Es wurde geschmaust und viel gelacht. Man sprach über die Pest, vor der Hermann geflohen war, und die Neuenrade verschont hatte. Über den erfolgreichen Handel der Neuenrader mit Eisen- und Tuchwaren in der Hanse.
Über den Segen des Osemundeisens. Und hin und wieder auch über Pfingsten und ein Schrift stück namens Kerckenordeninge. Lange sah man Hermann mit dem Pfarrer zusammensitzen und ernst miteinander sprechen. Auch mit seinem Bruder, dem Bürgermeister, und mit manchem Ratsherrn steckte er die Köpfe zusammen.
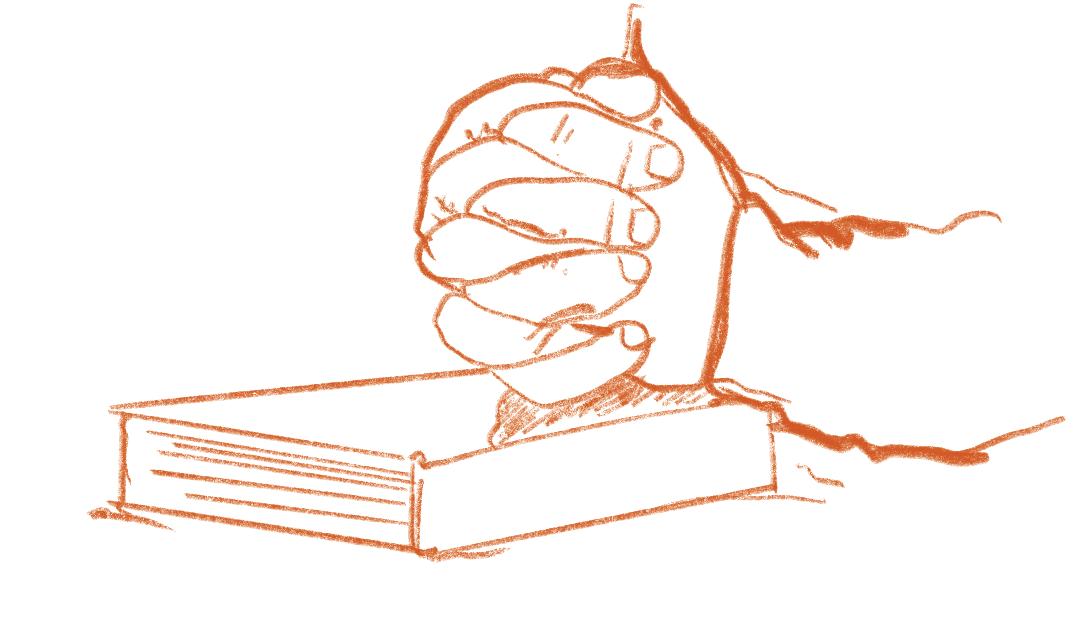
Roden-Hennes-Weg
ein Ausflug für die ganze Familie
Nach einer traumlosen Nacht erwachte Hermann früh am nächsten Morgen mit einer Eingebung: Wittenberg! Er zweifelte gar nicht mehr daran, eine individuelle Kirchenordnung für Neuenrade verfassen zu können. Immerhin hatte er in Riga bereits eine Abhandlung über die Kindstaufe geschrieben. Der Pfarrer hatte ihm am Abend zudem Unterstützung in religiösen Fragen zugesagt. Er war überzeugt, dass er sich ausreichend an die Abläufe verschiedener Gottesdienste erinnern würde, sei es in Riga, in Rostock oder in Heidelberg. Was ihm fehlte, war jedoch das Wissen um das Spektrum der Inhalte. Deswegen war es ihm wichtig, sich eine Kirchenordnung anzusehen – möglichst aus einem Ort, deren Gottesdienste er gut kannte. Die Zeit würde nicht reichen, einen Boten nach Riga zu senden. Obwohl ihm sein Bruder Phillipp, der seine frühere Position an der Domschule übernommen hatte, sicher sofort ein Exemplar der Rigaer Kirchenordnung würde zusenden können. Doch der Bote wäre kaum vor Pfingsten zurück.
Ein schneller Bote nach Wittenberg bräuchte allerdings deutlich weniger Zeit, 10 bis 11 Tage pro Weg vielleicht. Dort sollten sicher Exemplare der Mecklenburger Kirchenordnung von Phillipp Melanchthon vorliegen, die auch in Rostock galt. Hermann sprang vom Lager auf und setzte sich an den Eichentisch. Er spitzte die Feder, nahm einen Bogen Pergament und schrieb an seinen guten Freund Johannes in Wittenberg. Er hatte mit ihm bei Melanchthon studiert und verfügte in der Stadt über die besten Verbindungen. Dann versiegelte er den Brief, kleidete sich an und begab sich samt Brief zum Frühstück.
Dort traf er auf seinen Bruder und den Rest der Familie. Hermann nickte Diederich zu, der verstand sofort und reichte ihm froh ein Stück Brot. Hermann deutete auf seinen Brief und fragte nach einem schnellen Boten. Der Bürgermeister schickte sogleich nach seinem besten Mann und nach einem weiteren Boten, um den Rat nochmals einzuberufen. Hermann wiederum kündigte an, sich mit dem Pfarrer treffen zu wollen, denn die Arbeit an der Kirchenordnung dulde keinen weiteren Verzug. Statt den homerischen Kosmos für seine Studenten aufzuspannen, würde er sich in den nächsten Wochen vorwiegend der Neuenrader Kirchenordnung widmen und sich in dieser Zeit von der Familie verwöhnen lassen.
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Hermann Wilken. Dennoch ist er hier eine Kunstfigur. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figur fiktiv.
März 1631: Wie ganz Europa steckt Menden mitten im Dreißigjährigen Krieg. Doch das schert Inquisitor Dr. hc. Christoph Osthaus wenig. Er ist mit dem Ziel nach Menden gekommen, möglichst viele Hexen und Hexer zu überführen. Als einer der gefürchtetsten Männer wird er in die Geschichte der Stadt eingehen. Und mit ihm Dorte Hilleke, eine tiefgläubige junge Frau, die er anklagt. Sie widersteht Folterungen wie Exorzismus und unterbricht die Kette der Denunziationen. Dennoch nimmt ihr Prozess für sie keinen guten Ausgang.
Dorte betete. Seit man sie gestern nach der Vernehmung zu weiteren Frauen in die feuchte Kammer im Poenigeturm eingesperrt hatte, betete sie. Tränen vergoss sie nicht. Nein, um keinen Preis hätte sie gezeigt, wie ängstlich sie war. Aber sie betete, an die raue, kalte Wand gelehnt, die Hände eng aneinandergepresst. Sie hatte Glück, ihre Handgelenke waren nicht angekettet. Der Turmwächter war Rudger, der liebe Freund und Nachbar, den sie seit ihren Kindertagen kannte. Er hatte ihr die Ketten erspart. In alter Verbundenheit vielleicht. Und weil er tief im Herzen wusste, dass sie weder eine Hexe war noch versuchen würde zu fliehen.
Dorte war keine Hexe. Das wussten alle. Auch Gerdt Schrick und seine Frau Hohoff, die sie unter Folter bezichtigt hatten, der Zauberei zu frönen und am Hexentanzplatz Orgien mit Dämonen zu feiern. Sie war am 3. März beschuldigt und gestern, am 4. März 1631 im Namen des Inquisitors Christoph Osthaus angeklagt worden – so hatten es die Boten verkündet. Gerdt und Hohoff waren inzwischen bereits per Schwert getötet worden. Ihre Leichname würden schon bald auf dem Scheiterhaufen brennen. Auch sie waren sicher kein Hexer und keine Hexe gewesen.
1618
Beginn des 30-jährigen Kriegs
1631
Anklage von Dorte Hilleke
Seit Wochen hing der beißende Feuergeruch über der Stadt. Er klebte an den Mauern, zog in die Häuser wie eine immerwährende Mahnung. Seit der Inquisitor Dr. hc. Christoph Osthaus im Februar 1631 sein Amt in Menden angetreten hatte, fanden Denunziationen ein noch offeneres Ohr als zuvor. In der Stadt herrschten Verrat und Furcht.
Dorte betete. Rief den Herrn an, ihr Kraft zu geben für die Stunden und vielleicht Tage, die ihr bevorstanden. Sie war sicher, er würde ihr beistehen. Schließlich hatte sie ihm ihr Leben geweiht. Ihre Gedanken schweiften zur gestrigen Vernehmung im Rathaus. Vor Richter Heinrich Schmidtmann stehend hatte sie mit klarer Stimme gesagt „Das Kreuz, das mir Gott auferlegt, will ich in Geduld ertragen. Ich will die Wahrheit sagen und niemanden zu Unrecht beschuldigen, damit meine Seligkeit keinen Schaden erleidet.“
sich im Keller des damaligen, heute nicht mehr vorhandenen Rathauses in Menden die Folterkammer mit Schraubzwingen für Hände und Füße befanden?
Christoph Osthaus hatte sodann sein Verhör begonnen. „Ist dir bekannt, dass du eine Hexe sein sollst?“, hatte der Commissarius Inquisitionis des abscheulichen und verfluchten Zauberlasters sie gefragt. „Nein“, hatte sie geantwortet. „Sind Verwandte oder Bekannte von dir hingerichtet?“ „Ja, meine Großmutter“, hatte sie gesagt. Osthaus trug daraufhin vor, dass ihr Zauberei zur Last gelegt wurde. Seine Frage „Bekennst du dich schuldig?“ hatte sie mit Nein beantwortet und dem Inquisitor dabei in seine eiskalten grauen Augen gesehen. Sie hege auch gegen niemanden Feindschaft, war sie fortgefahren. So war es und so würde es für sie bleiben.
Doch der Richter blieb unbeeindruckt. Schmidtmann sprach: „Demnächst gütlich ermahnt, aber nicht bekennen wollen, auch keine Argumente zur Verteidigung gehabt, also ist sie zur Folter verurteilt.“ Er sah keine Beweise für ihre Unschuld, erklärte die Anklage für berechtigt und verhängte die Folter als Strafe.
Zwischen 1592 und 1631 fanden in Menden immer wieder Hexenverfolgungen und Hexenprozesse statt. Die Menschen glaubten an das Hexenwesen und suchten bei Katastrophen wie Seuchen, Bränden, Hungersnöten oder Missernten nach Schuldigen. Viele Menschen wurden vermeintlich als Hexen und Hexer denunziert, ohne große Untersuchung angeklagt und vor Gericht gestellt. Unter Folter denunzierten sie weitere Menschen, Hexe oder Hexer zu sein. Die Angeschuldigten waren angeblich einen Pakt mit dem Teufel eingegangen und hatten im Gegenzug Zauberkrä e erhalten, die sie gegen die Mitmenschen richteten. Manchen Hexen sagte man gar die Teufelsbuhlscha nach.
Für 1628 bis 1631, den Mendener Hexenwahn, sind 47 Protokoll nachgewiesen, darunter der Prozess gegen Dorte Hilleke. Aufgrund der dortigen Denunziationen ist von mehr als 100 Menschen auszugehen, die dem Hexenwahn zum Opfer elen. Dr. hc. Christoph Osthaus, der am 18. Februar 1631 seinen
Dienst in Menden antrat, galt als besonders harter Inquisitor und war in der Stadt der meistgehasste Mann seiner Zeit.
Menden war nicht die einzige Stadt im damaligen, zu Kurköln gehörenden Herzogtum Westfalen. Im Kurkölner Sauerland wurden sehr viele Menschen als Hexen oder Hexen verurteilt und hingerichtet.
Mit der Linken umfasste Dorte das hölzerne Kreuz, das sie in ihrer Rocktasche verbarg. Sie wusste, was kommen würde. In der ganzen Stadt war bekannt, was Schmidmann unter gütlicher Ermahnung und Osthaus unter Folter verstanden. Die Schmerzschreie aus dem Rathauskeller, in dem die Folterknechte ihre Arbeit an den Hand- und Fußschrauben verrichteten, hatte sie selbst vernommen. Manches Mal, wenn sie auf dem Weg zur St. Vinzenz-Kirche war, schallten sogar die Klänge der Ruten aus dem tiefen Gewölbe heraus.
Dorte bei der ersten Folter keine Regung zeigte, weiterhin ihre Unschuld beteuerte und niemanden denunzierte, bis sie schließlich ohnmächtig wurde?
Und dass Pastor Stracke einen Exorzismus vollzog, sie aber viele weitere Male gefoltert wurde und vermutlich bei dieser letzten Folterung verstarbohne je einen anderen Mensch zu denunzieren?
Draußen dämmerte der Abend. Sie vernahm das Stöhnen und Seufzen ihrer drei Mitgefangenen, die wie kleine Elendshäufchen auf dem Boden saßen, den Kopf auf den Knien, eine Hand auf halber Höhe an der Kette. Dorte legte die Hände wieder zum Gebet aneinander. Unvermittelt klirrte ein Schlüssel im Schloss. Rudger betrat die Zelle, ergriff ihren Arm und führte sie wortlos hinaus. Die Mitgefangenen hoben nicht einmal den Kopf. Er brachte sie in den Wächterraum, wo der Pastor Stracke wartete. „Leise“, sagte er, legte den Finger an die Lippen,
nickte und verließ den kleinen Raum.
Dorte fiel sogleich vor ihm auf die Knie. Stracke nahm ihre Hände und flüsterte tröstende Worte. Auch ihm gegenüber betonte sie, dass die Anklage absurd sei, sie keineswegs der Zauberei anhänge. Dennoch sehe sie, dass ihre Situation aussichtslos sei und wolle mit sich im Reinen das Leben verlassen. „Möchtest du beichten, mein Kind?“, fragte er. Dorte nickte und begann sogleich zu sprechen, da sie ihre Entdeckung fürchtete – mit schlimmen Folgen für Rudger und den Pastor. Stracke hörte zu, als Sünden hätte er nicht bezeichnet, was er hörte. Dann legte er ihr die Hand auf den Kopf und segnete sie. Die geheime Zusammenkunft war beendet. Auf dem Weg in die Zelle drückte sie Rudger zum Dank die Hand.

bringen sollten. Dieses Mal ins Kellergewölbe.
Im Verlies lehnte sich Dorte wieder an die Wand. Es stimmte, was sie vor Richter Schmidtmann gesagt hatte: Das Kreuz, das Gott ihr auferlegt hatte, wollte sie in Geduld ertragen. Sie setzte sich, legte den Kopf auf die Knie und schlief ein. Erneutes Schlüsselklirren weckte sie. Durch die Schießscharte fiel das Licht des grauenden Tags. Rudger führte Dorte zu den wartenden Stadtdienern, die sie zum Rathaus bringen sollten. Dieses Mal ins Kellergewölbe.

Historische Orte entdecken
Poenigturm Menden
Einige Schauplätze der Hexenverfolgung kannst du auch im heutigen Menden noch entdecken.
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Dorte Hilleke und einigen Zeitgenossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figuren fiktiv.
Heute ist der Ort bekannt als Luisenhütte. Doch der passendere Name wäre eigentlich Annahütte. Oder Marienhütte. Oder Theresienhütte. Denn gegründet wurde der Wocklumer Hammer bzw. die Eisenerzhütte in Balve-Wocklum von Anna Maria Theresia Freifrau von Landsberg zu Erwitte, geborene von Recke zu Steinfurt.
1732 hatte sie Franz Casper Ferdinand, Freiherrn von Landsberg zu Erwitte geheiratet, der mit päpstlicher Erlaubnis zum Familienerhalt den Stand des Geistlichen aufgegeben hatte. Das Unterfangen gelang. Doch ganz nebenbei eröff nete Anna von Landsberg der Familie in ihrer neuen märkischen Heimat auch frische unternehmerische Perspektiven. 1739 steckte sie mitten in den Planungen.
1732
Clemens August und Johann Matthias tollten über den Millimeter kurzen Rasen. Das Kindermädchen rief die Jungen zur Ordnung, nahm Clemens August an die rechte, Johann Matthias an die linke Hand und führte sie zurück ins Schloss. Bald würde der Hauslehrer eintreffen und die beiden unter seine Fittiche nehmen. Höchste Zeit, dass der Stammhalter und sein kleiner Bruder etwas Disziplin lernten.
Anna beobachtete die Szene aus der Distanz. Im Schatten eines Baumes saß sie vor einem Bauplan, in der Rechten einen Bleistift . Ihr Gatte, Franz Casper Ferdinand Freiherr von Landsberg zu Erwitte, hatte begonnen, den vollständigen Umbau des heimischen Schlosses zu planen. Zweigeschossig sollte es werden, mit prachtvollen Salons und Gemächern.
1789
Beginn der Französischen Revolution
Mehr Platz für die stetig wachsende Familie sollte es bieten. Er ließ Anna an den Planungen teilhaben, legte Wert auf ihre Meinung. Und so machte sie von Zeit zu Zeit Vorschläge. Vor allem, wenn ihr etwas zu sakral erschien. Denn die Prägung durch seine jahrzehntelange Tätigkeit als Kleriker ließ sich nicht verhehlen. So hatte Anna bei der Neugestaltung der Schlosskapelle eine gewisse Schlichtheit angeregt. Wocklum sei schließlich nicht Rom. Beide einigten sich auf in Stuck gearbeitete Amphoren mit Blüten an der Decke und figürlich ausgearbeitete Evangelisten in den vier Ecken des Raumes. Putten allerdings wurden weitgehend aus den Entwürfen gestrichen. Nur über dem Altar würde es einige geben.
Sieben Jahre währte ihre Ehe mit dem 40 Jahre älteren Franz Casper nun bereits. Um ein Haar wäre sein Familienzweig ausgestorben, doch davon konnte jetzt keine Rede mehr sein. Andererseits hatte man nie genug männliche Erben. Vorsichtig erhob sich Anna von ihrem Platz, rollte den Plan zusammen und ging, die Linke von hinten in die Hüfte gestützt, gemessenen Schrittes zum Schloss. Am Morgen hatte sie wie gewöhnlich die Köchin und die Dienerschaft instruiert. Heute sollte üppiger getafelt werden als sonst, denn man erwartete verwandtschaftlichen Besuch: Sie hatte Wilhelm Christian von der Reck, einen Verwandten aus der Stockhäuser Linie in Lübbecke eingeladen. Bis dahin wollte sie sich ihren eigenen Projekten widmen.
Eines der Dienstmädchen kam ihr auf der Freitreppe entgegen, bereit, sie zu stützen. Doch Anna lehnte ab, fühlte sich weder krank noch gebrechlich. Stattdessen gab sie dem Mädchen den Plan mit dem Auftrag, ihn dem Sekretär ihres Mannes zu bringen. Das Mädchen knickste und verschwand. Sie selbst stieg die Treppe mit gehobenen Röcken hinauf und begab sich in ihren Salon.
Bei ihrer Heirat hätte sie es wahrlich schlechter treffen können. Sofort hatte sie begonnen, täglich spazieren zu gehen oder auszureiten und die nähere Umgebung zu erkunden. Jede Entdeckung hatte sie auf ihrem Plan festgehalten.
Anna 1748 den Wocklumer Hammer mit Eisenhütte gründete und den ersten Hochofen in der Grafschaft Mark bauen ließ? Nebenan ließ sie einen Stabhammer einrichten.
Franz Casper Ferdinand hatte sie auf den Exkursionen anfangs begleitet, war aber zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um sich täglich dafür Zeit zu nehmen. Wenn er sich nicht um den Umbau des Schlosses kümmerte, wartete die leidige Erbschaft sangelegenheit, angestoßen von der Frau seines verstorbenen Bruders. Anna Maria von Landsberg, geborene von Galen, genannt die Generalin, hatte sämtliche Güter der von Landsbergs zu Erwitte für ihre Tochter Antonetta Helena und deren Gatten beansprucht. Die Generalin war bereits vor fünf Jahren verstorben, dennoch zogen sich die juristischen Prozesse hin.



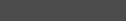





bei ihrem leitenden Beamten in der Schreibstube die liebste. Seit sie nach Wocklum gekommen war,




Der Schreibschrank war ausgeklappt und überhäuft mit Rötel-, Kohle- und Bleistiften, Lageplänen und Zeichnungen von Gebäuden. Daneben hatte sie sich ein großes Stehpult aufstellen lassen, wie sie es bei ihrem leitenden Beamten in der Schreibstube gesehen hatte. Es erleichterte ihr das Arbeiten in Zeiten, in denen sie guter Hoff nung war. Sie nahm den obersten Plan zur Hand und legte ihn aufs Pult. Ihre selbst gefertigte Zeichnung war ihr noch immer die liebste. Seit sie nach Wocklum gekommen war, hatte sie immer wieder daran gearbeitet und Details ergänzt. Die Landschaft hatte es ihr sofort angetan. Das milde Tal des Orlebachs am Fuß des Burgbergs. Mittendrin das Wasserschloss der Familie von Landsberg zu Erwitte.
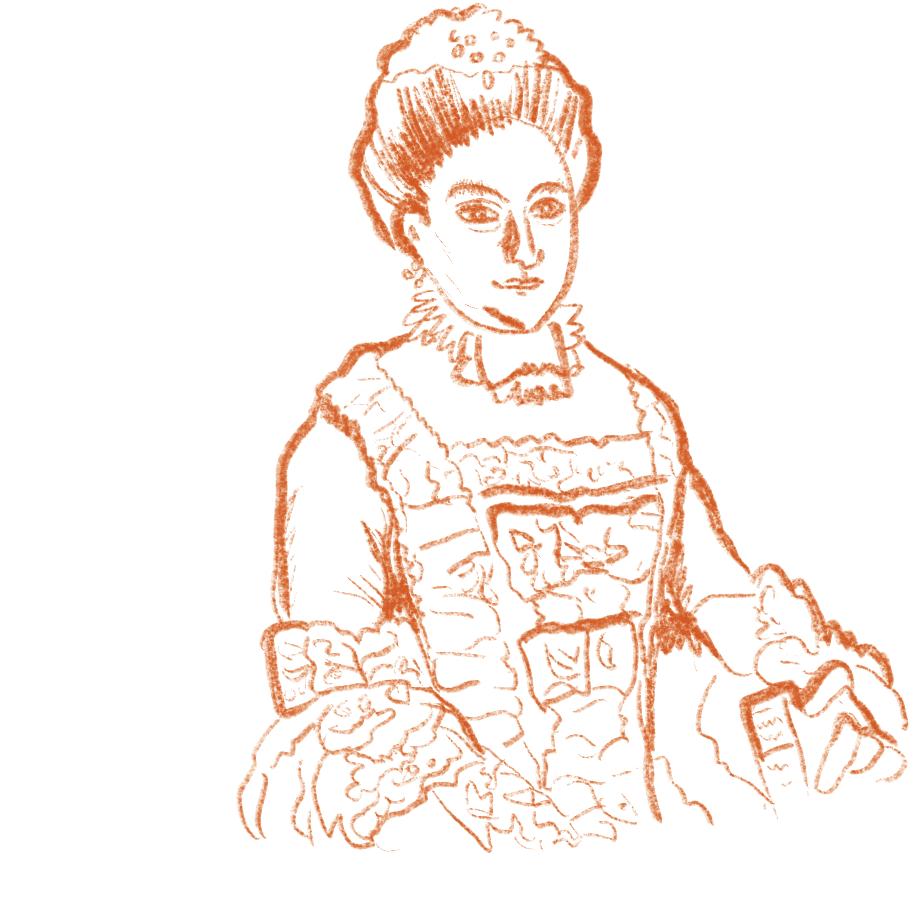


Also machte Anna ihre täglichen Spaziergänge oft in Begleitung ihrer Gesellschaft sdame und des leitenden Beamten oder mit Besuchern aus der Verwandtschaft. Ihre Ausritte unternahm sie am liebsten allein. Wenn Reiten nicht möglich war, ließ sie sich kutschieren. Inzwischen kannte sie jeden Baum, jeden Wasserlauf, jeden Hügel in der näheren Umgebung. Dabei ging es Anna neben der Lieblichkeit der Landschaft mit Bergen, Bächen und Wäldern auch darum, was sich daraus machen ließe. Als geborene von Recke zu Steinfurt entstammte Anna von Landsberg zu Erwitte einer weitverzweigten Familie, in der sich mancher auch mit Bergbau und Eisenverhüttung befasste.
Das Familienwissen und ihr geschultes Auge hatten ihr schon bald nach ihrer Ankunft und Vermählung im Jahr 1732 verraten, dass der Boden reich an Eisenerz war. An den Ufern der Bäche hatte sie die typischen rotbraunen Spuren des Erzes erkannt und später auch entdeckt, wo entsprechendes Gestein zu finden war. Überhaupt das Wasser: Die sprudelnden Flüsschen Orlebach und Borkebach eigneten sich bestens, um Mühlen zu betreiben.
Auch ein Hammerwerk, falls sich die Eisenerzvorkommen als ergiebig erweisen sollten. Zumal die umgebenden Wälder die Holzkohle für die Eisenverhüttung liefern könnten.
Allem Anschein nach war oben unweit des Borkebachs früher bereits Eisen verhüttet worden. Sie hatte entsprechende Reste gefunden und in ihren Plan eingezeichnet. Ihr heutiger Besucher engagierte sich im Abbau von Erzen. Daher wollte sie das Gelände mit ihm in Augenschein nehmen.
Der Blick auf den Plan vergegenwärtigte ihr nochmals, welche Orte sie mit ihm besuchen wollte: das Feld, wo sie lose herumliegende Erzbrocken entdeckt hatte und die Relikte einer möglichen früheren Verhüttungsstelle. Sie klopfte mit dem Bleistift auf den Plan und nickte. Doch jetzt konzentrierte sie sich auf mehrere Vierecke, die sie mit Rötelstift zwischen einen Wegesrand und den Borkebach gesetzt hatte. Dann durchsuchte sie den Stapel mit den Zeichnungen auf ihrem Sekretär und zog mehrere Zeichnungen hervor: Fein säuberlich waren dort Gebäude dargestellt – ihre Kornmühle und vor allem ihre Sägemühle. Südlich davon hatte sie eine Senke eingezeichnet, eigentlich ideal als Mühlenteich. Nur machte der Borkebach ausgerechnet dort einen weiten Bogen.
Anna den Wocklumer Hammer, die Eisenhütte und einen Stabhammer 1758 an ihren Sohn Clemens August von Landsberg zu Erwitte übergab, der sie kurz darauf in Betrieb nahm?
Ein Diener trat durch die offene Tür und verbeugte sich. „Die Post, Frau Baronin“, sagte er und hielt ihr ein Tablett entgegen. „Danke, Ernfried“, antwortete sie und nahm die Briefe. Das Schreiben vom örtlichen Baumeister hatte Vorrang, denn es sollte eine Aufstellung der Kosten für die Sägemühle enthalten. Und richtig. Fein säuberlich war alles notiert. Noch während sie las, runzelte sie die Stirn, raffte die Röcke und ging mit dem Schreiben in den anderen Flügel, ins Bureau ihres Gatten. Der saß über Zeichnungen gebeugt, während sein Privatsekretär einen Brief schrieb.
„Franz Casper, auf ein Wort, bitte?“, fragte sie und hielt das Schreiben hoch. Er blickte auf und nickte ihr zu. „Die Kosten für die Mühlen“, erläuterte sie knapp und zeigte ihm das Schreiben. Er las den Brief, sah die Summen, hob die Augenbrauen und sah sie an. „Das ist weitaus mehr, als erwartet“, sagte er. „In der Tat, das ist es“, antwortete sie. „Wir würden summa summarum weniger einsparen, als gedacht.“ Denn der ursprüngliche Grund für den Bau des Sägewerks war, alle Balken und Bretter für den Umbau des Schlosses vor Ort aus dem eigenen Holz selbst herzustellen – und anschließend deren Dienste natürlich auch anderen anzubieten.
„Mir scheint, das Baumaterial fällt am stärksten ins Gewicht“, fuhr er fort und übergab ihr das Schreiben wieder. Sie nahm es und überprüfte, was er gesagt hatte. „Sie haben recht. Das Material und der Transport!“ Nachdenklich blickte sie durchs Fenster in den kleinen Park hinaus. Franz Casper plante, das Gesindehaus durch ein neues Gebäude zu ersetzen. Mit einem Gartensalon und einem Archiv im Obergeschoss.
Er gesellte sich zu ihr und blickte ebenfalls hinaus. „Brauchen wir für Ihre Mühlen denn neue Steine? Oder könnten wir die Reste des Gesindehauses wiederverwenden?“, fragte er. „Ja, der Gedanke kam mir auch gerade“, sprach sie. „Die Mühlen müssen nicht besonders repräsentativ sein, nur funktionell“, fuhr sie fort, wandte sich ihm zu und lächelte. „Das wäre eine Lösung!“
Er nickte. „Ja, möglicherweise“, sagte er. „Wir sollten es in Ruhe überdenken. Aber sehen Sie.“ Franz Casper deutete in den Park hinunter, wo am Tor jenseits des Schlossgrabens eine Kutsche gehalten hatte. „Unser Gast ist eingetroffen.“
Beginn des Ersten Koalitions- kriegs gegen Frankreich
Anna eilte zurück in ihren Salon und legte den Kostenplan in eine Schublade. Kaum war dies getan, kündete Ernfried ihr den Besuch an. Schnell begab sie sich zur Freitreppe, wo auch Franz Casper wartete. Freundlich empfingen sie Annas Verwandten, Wilhelm Christian von der Reck zu Stockhausen, der die Treppe hinauf kam. Nach der Begrüßung bat Wilhelm Christian, sich zunächst etwas kurz zurückziehen zu dürfen. Ernfried führte ihn ins Gästehaus. Anschließend beschloss man, einige Schritte im Park zu gehen.
Franz Casper berichtete vom bevorstehenden Umbau des Schlosses, die Planungen seien inzwischen so gut wie abgeschlossen. Schon bald würden die Arbeiten beginnen. Wilhelm Christian wiederum schilderte die Neuerungen, die er am geerbten Familiensitz, Gut Stockhausen, vornahm. Bester Dinge begab man sich zu Tisch und genoss das Mittagsmahl. Während sie speisten, lenkte Anna das Gespräch auf die Bergbauaktivitäten von Wilhelm Christian.
Der berichtete zwar aus der Verwandtschaft und von eigenen Bergbauaktivitäten, erklärte jedoch künftige Vorhaben für noch nicht spruchreif. Überraschend kündigte er dann an, er habe seinen Fachmann herbestellt, der ihn in allen Fragen des Erzabbaus und der Erzverarbeitung zuverlässig berate und sicher auch Anna gute Dienste leisten würde. Gruber würde in Kürze eintreffen.
Nach der Mittagsruhe bereiteten sich Anna und Wilhelm Christian also wie geplant auf ihre kleine Ausfahrt vor. Anna hatte sich umgekleidet und ein schlichteres Gewand an- und die Perücke abgelegt.
Die Kutsche wartete am Tor. Schließlich traf auch der Fachmann ein, der sie zu Pferde begleiten sollte. Anna begrüßte den Neuankömmling freundlich, der nach dem Absitzen seinerseits mit einer tiefen Verbeugung antwortete. Sie gebot Eile, da es früh dunkeln würde. Ganz in ihrem Element wies sie dem Kutscher den Weg.
Nicht weit vom Schloss entfernt ließ sie ihn halten, verließ das Gefährt und stieg eine leichte Anhöhe hinauf in ein Schotterfeld. Gerade wollte sie sich nach einigen Gesteinsbrocken bücken, als Wilhelm Christian sie abhielt und seinerseits zwei davon aufhob. Einen reichte er Gruber, einen behielt er in der Hand. „Der Orlebach und der Borkebach führen Wasser mit Spuren von Eisen“, sagte sie. „Sehen Sie hier“, deutete sie auf dunkle Stellen im Gestein. „Dies scheint mir der Grund zu sein - Eisenerz.“
Gruber nahm seine Lupe zur Hand, die ihm an einem Band um den Hals hing und begutachtete das Gestein von allen Seiten. Auch Wilhelm Christian betrachtete seinen Klumpen interessiert. „Frau Baronin haben recht!“, sprach Gruber. „Das Gestein enthält zweifelsfrei Eisenerz.“ Er holte einen kleinen Hammer aus seiner Tasche und klopfte auf den Stein, der zerbrach. Eine dunkle Ader zeigte sich. „Erstaunlich, dass es hier oberirdisch zu finden ist.“ „Wie ist es um die Qualität bestellt?“, fragte ihn Wilhelm Christian.
Anna als Begründerin des märkischen Hüttenwesens gilt? in handelt sich um hohe Qualität, aber bitte erlauben können, wie ergiebig das Gelände ist“, antwortete Gruber. Anna nickte und schritt zurück zur Kutsche.
Gruber sah sich in dem Schotterfeld um, griff nach einem weiteren Brocken und wiegte den Kopf. „Es handelt sich um hohe Qualität, aber bitte erlauben Sie mir zunächst, dieses Feld genauer zu untersuchen.“ „Meint er, eine Verhüttung ist geboten?“, fragte Anna. „Mit Ihrer Erlaubnis, Frau Baronin, werde ich an verschiedenen Stellen Proben aus tieferen Schichten nehmen. Daran werden wir sehen können, wie ergiebig das Gelände ist“, antwortete Gruber. Anna nickte und schritt zurück zur Kutsche.
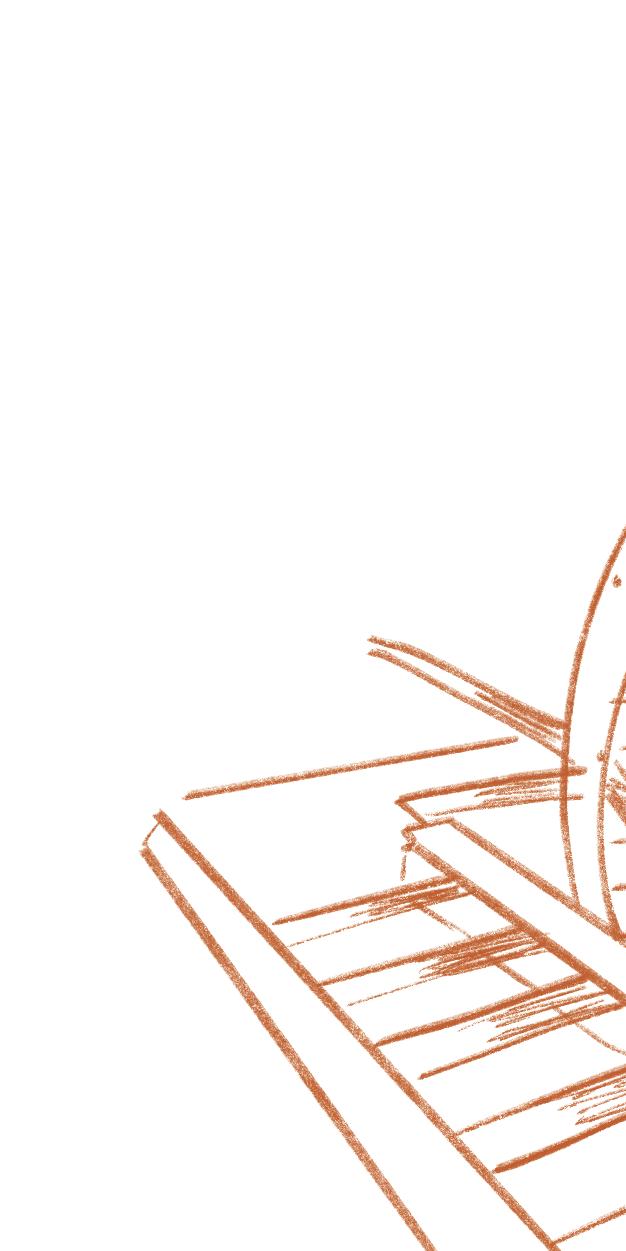
Der nächste Halt war nicht weit entfernt. Der Kutscher bremste die Pferde zwischen einer Furt und einer Weggabelung. Dieses Mal verließ Anna den Wagen nicht. Sie zeigte ihren Begleitern lediglich die Richtung, wo die Mühlen entstehen sollten. Anschließend klopfte sie und der Kutscher bog in einen Waldweg ein. Nach einem halben Kilometer stoppte er erneut. Sie hatten eine Lichtung erreicht, die in einer Talmulde lag. An zwei Seiten stieg das waldige Gelände schnell an. Man stieg wieder aus der Kutsche, Gruber saß ab.
Anna führte die Herren seitlich ins Dickicht hinein und blieb an einem unregelmäßig gemauerten Rund stehen. „Hier ist es“, sagte sie. „Dies sieht mir wie eine aufgelassene Esse aus, oder was meinen Sie?“ Wilhelm Christian zuckte kaum merklich die Achseln, aber Gruber ging in die Hocke. Wieder nahm er seine Lupe zur Hand. Er zerkrümelte den Boden zwischen den Fingern, wiegte den Kopf. „Mit Gewissheit ist das nicht zu sagen, Frau Baronin. Erlauben Sie mir, auch hier Proben zu nehmen?“
Auch die Männer wandten den Blick in Richtung des Waldwegs, auf dem sie gekommen waren. Von dort näherte sich ein Reiter in vollem Galopp. Bei der Kutsche kam er zum Halten, das Pferd tanzte auf der Stelle. Ein Bote vom Schloss. „Frau Baronin, der Junker, ihr Sohn …“, rief er. „Mein Sohn? Was ist mit meinem Sohn. So sprecht doch?“, fragte sie alarmiert. „Junker Clemens August, er ist in den Schlossgraben gestürzt!“ „Herr im Himmel“, rief sie aus und eilte zur Kutsche.
„Schnell, zurück!“, gab sie dem Kutscher Kommando. Der hatte auf der Lichtung glücklicherweise bereits gewendet, sodass man unverzüglich fahren konnte. Mit Rücksicht auf den Zustand der Frau Baronin konnte er die Pferde nicht zu sehr antreiben. Dennoch waren sie schnell am Schloss. Wilhelm Christian half Anna aus dem Wagen. Sofort eilte sie durch den Park, rechts waren einige Dienstboten versammelt.



Anna nickte, sie war gespannt, ob sie mit ihrer Vermutung richtig lag. „Es könnte also ein vormaliger Standort zur Eisenverhüttung sein. Doch mich verwundert, dass sich hier kein Bachlauf findet, den man hätte stauen können. Auf Wasserkraft hat man hier sicher nicht setzen können. Der BorkeMeter in jener Richtung“, ihr Arm wies gen Westen. „Gehen wir die paar ….“, sie hielt inne

bach liegt 50 gen Westen. „Gehen wir die paar ….“, sie hielt inne und lauschte.
Die hohe Gestalt Franz Caspers ragte aus der Gruppe hervor. Das Kindermädchen kniete am Boden, Johann Matthias stand daneben. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Auf dem Rasen saß Clemens August, in eine Decke gewickelt, weiß im Gesicht und vor Kälte und Schreck schlotternd. Erleichtert ließ sich Anna neben ihm nieder, umarmte ihn und flüsterte ihm beruhigende Worte zu. Obwohl sie wusste, dass die beiden Jungen schwer zu bändigen waren, warf sie dem Kindermädchen einen strengen Blick zu.
Ernfried gab sie ein Zeichen, Clemens August in sein Schlafzimmer tragen zu lassen. Das Kindermädchen erhielt den Auft rag, ihn heiß zu baden und anschließend warm im Bett einzupacken. Einer der Dienstboden namens Joseph stand tropfnass am Rand der Gruppe. Franz Casper dankte dem Retter seines Sohnes und ging zurück ins Schloss. Auch Anna dankte ihm und schickte ihn zum Abtrocknen und Umziehen in seine Unterkunft .

Dann tröstete sie Johann Matthias, der schluchzend an ihrem Rock hing, und nahm ihn auf dem Weg in die Gemächer der Kinder an die Hand. Oben auf der Treppe erinnerte sie sich ihrer Besucher, die sie bei ihrer Ankunft so unhöflich verlassen hatte. Wilhelm Christian stand mit Gruber noch immer nahe dem Tor. Ernfried sollte sich um eine Unterkunft für Gruber sowie um seine Verpflegung kümmern und dessen Pferd versorgen lassen. Ihr Verwandter hatte das Gästehaus ja bereits bezogen. Man würde sich beim Nachtmahl wiedersehen.
Anna tatsächlich Wasser vom Borkebach abzweigte, das sowohl den Hüttenteich als auch den Mühlenteich speiste?
Jetzt jedoch hatte der Nachwuchs Vorrang, auch wenn die drei Kleineren sicher nicht so verstört waren, wie die beiden Ältesten Clemens August und Johann Matthias. Sogar sie selbst musste sich nach dem Schreck erst wieder ein wenig sammeln. So verbrachte sie die nächsten beiden Stunden bei den Kindern, ließ sich dort auch den Tee servieren. Ihr Gatte, dessen war sie gewiss, würde Wilhelm Christian derweil Gesellschaft leisten.

Luisenhütte - hier steht die älteste vollständig erhaltene Hochofenanlage Deutschlands
Posthumes Interview in der Luisenhütte in Balve
Während sie an der Seite von Clemens August am Tee nippte, dankte sie Gott für seinen Schutz. Welch ein Glück, dass der Schlossgraben nur mannstief und zudem ein stehendes Gewässer war. Welch ein Glück auch, dass der unerschrockene Joseph gleich zur Stelle gewesen war. Sie betrachtete den schlafenden Clemens August. Wie sollte sie ihre Söhne vor der Unbill des Lebens schützen, wenn sie nicht einmal im heimischen Park sicher waren?
Möglicherweise brauchte es eine Umzäunung, damit nicht wieder ein Kind in den Graben fiel. Unter dem Eindruck der Geschehnisse schien ihr das ein wichtigeres Projekt als jede Eisenhütte oder Mühle. Andererseits scheute gebranntes Kind erfahrungsgemäß das Feuer. Womöglich wären die Söhne künftig vorsichtiger. Zumal sicherlich auch der Erzieher und Hauslehrer, den sie in Bälde erwarteten, seinen Beitrag leisten würde.
Unvermittelt fiel ihr Kopf zur Seite, sie nickte ein. Im Traum tobten alle fünf Kinder auf einem umzäunten Rasen. Ein strenger Herr wachte darüber und hieß die Kleinen, ruhig zu bleiben. Der verflixte Schlossgraben schrumpfte, schien zu zerfließen. Er nahm die schlangenartige Form eines Bachs an, zog sich dann plötzlich gerade wie mit dem Lineal gezogen.
Verwirrt schlug sie die Augen auf. Clemens August schlief und auch nebenan herrschte schläfrige Ruhe. Draußen dämmerte es. Höchste Zeit, sich für das Diner umzukleiden.
Auf dem Weg zu ihrem Boudoir holte sie ihr Traum wieder ein. Dieser schnurgerade Graben ging ihr nicht aus dem Kopf. Könnte das der Weg sein, das Wasser aus dem Borkebach in die Senke zu leiten und einen Mühlenteich anzulegen? Wer sagt denn, dass man dazu den Bach selbst stauen muss. Warum war sie nicht früher darauf gekommen? Seit Jahrtausenden baute die Menschheit Gräben und Kanäle. Warum also nicht auch in Wocklum? Sie würde Gruber dazu befragen. Am liebsten hätte sie sich sofort ihren Plan angesehen, um zu sehen, wie sich ein Kanal einfügen würde. Doch sie musste sich gedulden und das Ganze auf morgen vertragen. Denn jetzt erwarteten sie ihr Gemahl und ihr Gast.
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Anna Maria Theresia Freifrau von Landsberg zu Erwitte, geborene von Recke zu Steinfurt und einiger ihrer Zeitgenossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren. Beschreibungen und Handlungen der Figuren sowie Ereignisse und Situationen sind fiktiv.
Friedrich Woeste auf der Spur heimatlicher Sagen und Mythen
Anfang der 1840er Jahre. Johann Friedrich Leopold Woeste arbeitet seit einem guten Jahr als Haus- und Privatlehrer in Iserlohn. Mindestens genauso wichtig sind dem ewigen Junggesellen aber seine Forschungen. Alles, was die Sprache und Überlieferungen seiner Heimat betrifft , interessiert ihn. Doch die heimischen Weisheiten, die Mythen, Sagen und Märchen erfährt er nur, wenn er mit den Menschen spricht. Und genau das macht er. Landauf, landab. An jedem freien Tag.
Zufrieden legte Friedrich Woeste die Feder beiseite und schloss das Tintenfass. Er las den letzten niederländischen Text noch einmal und nickte. Kaufmann Eisenstein konnte und würde mit seinen Übersetzungen zufrieden sein. Woeste hatte sein Wochenwerk vollbracht und konnte sich am Sonntag wieder ganz seinem Steckenpferd widmen: dem Sammeln von Weisheiten, Geschichten, Erzählungen und Überlieferungen seiner Heimat. Die nächste Route über die Höfe hatte er sich bereits überlegt. Sie sollte ihn rund um Hemer führen.
Die Landkarte lag bereit, die Wanderschuhe waren geputzt und der Wanderstock stand neben der Tür. Er rieb sich die Hände, Zeit für das Abendessen. Die Haushälterin Lene, seine gute Seele, hatte ihm etwas hingestellt und auch schon den Proviant für den Sonntag vorbereitet. Insgeheim nannte sie ihn ihren kleinen Hänfling und befürchtete, er würde vom Fleisch fallen, wenn sie ihn nicht gut versorgte. Woeste hingegen war immer wieder überrascht von den Mengen, die sie ihm zubereitete. Doch meistens aß er alles brav auf. Jedenfalls würde er am nächsten Morgen nur noch den Rucksack packen müssen.

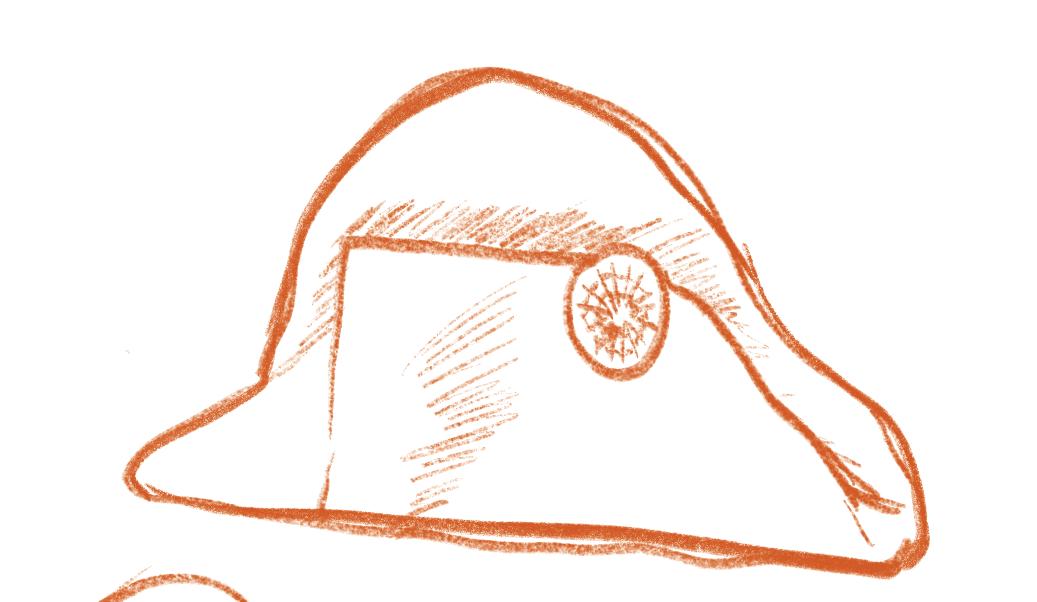
1815
Niederlage Napoleons bei Waterloo und Ende der Koalitionskriege
1835
Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampfkraft
1848 Märzrevolution und Frankfurter Nationalversammlung
In aller Frühe sprang er aus dem Bett, machte sich an der Waschschüssel frisch, kleidete sich an, schnappte seine Utensilien und verließ das Haus. Die Übersetzung hatte er vorsichtig in Papier eingeschlagen. Eisenmanns Kontor war auch sonntags besetzt und so konnte er die Arbeiten auf seinem Weg in Richtung Osten abliefern. Draußen empfing ihn ein sonniger, kühler Morgen. Woestes Barometer hatte ein Hoch angezeigt und es würde einer dieser unendlich klaren Herbsttage werden, an denen sich der Himmel höher als sonst zu wölben schien.
Frohgemut ging er los. In Eisenmanns Kontor traf er auf den Buchhalter Meyer, der über Zahlenkolonnen brütete. „Guten Morgen, Herr Meyer“, begrüßte er ihn freundlich. „Schon so tief in Zahlen versunken?“ Meyer winkte ab. „Die Geschäfte laufen so gut, da muss man täglich den Überblick über die Einnahmen und Ausgaben behalten.“ „Sie werden lachen“, sagte Woeste. „Ich bringe hier weitere erfolgversprechende Korrespondenz für Herrn Eisenmann.“ „Na, dann“, sagte Meyer, nahm die Papiere und lachte tatsächlich, „treffen wir uns nächsten Sonntag sicherlich wieder hier.“ „Mag sein“, sagte Woeste und hob schmunzelnd die Hand zum Gruß. „Viel Erfolg beim Geschichten sammeln!“, rief Meyer ihm hinterher.
Woestes Weg führte ihn ab Iserlohn nördlich der Hänge des Mühlenbergs und des Hilborn in Richtung Westig. Er blieb südlich von Hemer und ließ auch Sundwig links liegen. Erst dann wandte er sich in Richtung Nordosten. Die Dörfer Deilinghofen und Apricke waren sein Ziel. Als sich der erste Hunger regte, warf er einen Blick auf die Karte. In Hembecke war ein Hof eingezeichnet, dort wollte er eine kurze Pause einlegen. Schließlich war seine selbstgestellte Aufgabe nicht Müßiggang, sondern die Ohren weit offenzuhalten. Bald hatte er das Gehöft erreicht. Doch am hellen Sonntagvormittag war dort kein Mensch zu sehen. Wahrscheinlich war die Familie in der Kirche. Bis Deilinghofen war es aber nicht mehr weit.
Er blickte auf seine Uhr, holte sich ein Brot aus dem Rucksack und ging kauend in Richtung des Dorfs. Redseliger waren die Menschen ohnehin im Gasthaus. Er würde sich einfach zu den Kirchgängern gesellen. Schon bald erreichte er die Stephanuskirche. Natürlich befand sich unweit davon ein Wirtshaus. Er trat ein, begrüßte den Wirt, setzte sich an einen der freien Tische und bestellte ein Bier, das er kurz darauf genüsslich antrank. Schon bald läuteten die Kirchenglocken das Ende des Gottesdienstes ein und rund 20 Männer strömten hinein.
Friedrich die meiste Zeit als Privatlehrer tätig war und zusätzlichh als Dolmetscher arbeitete?
Es wurde so voll, dass sich die Männer auch zu Woeste an den Tisch setzten. Genau darauf hatte er spekuliert und stellte sich vor – er sei Privatlehrer und Gelehrter und erforsche heimatliche Geschichten. Die Männer nickten freundlich und begannen, sich wie üblich über die Neuigkeiten aus dem Dorf zu unterhalten. Woeste konnte nicht umhin zuzuhören – zum Glück hatte er seit seiner Rückkehr das Sauerländer Platt studiert und konnte den Gesprächen folgen. Bald ging es um die Wetteraussichten für die nächste Woche. „Sehr gut“, dachte er sich.


„Meine Herren“, sagte er, „ich stelle eine Sammlung der bäuerlichen Erfahrungen aus unserer Heimat zusammen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Die ersten Schwalben bringen noch keinen Sommer. Nach welchen weiteren Regeln richten Sie sich denn?“ Er zückte sein Notizbuch. Die Männer waren überrascht über sein Ansinnen, begannen aber, sich darüber auszutauschen. „Wenn der Hahn am Mittag kräht, gibt es Regen“, sagte einer. „Und wenn die Hühner die Schwänze hängen lassen, gibt es viel Regen“, ergänzte ein anderer. „Aber wenn der Hahn auf dem Mist kräht, bleibt das Wetter wie es ist“, gab ein dritter zum Besten. Woeste notierte eifrig mit.
Die ersten Schwalben bringen noch keinen Sommer
„Was machen Sie denn mit unseren Weisheiten?“, fragte der erste Bauer. „Nun“, sagte Woeste. „Zunächst einmal werde ich alles sammeln, was mir in unserer Region zu Ohren kommt. Nicht nur um Hemer und Iserlohn, sondern auch weiter im Süden. Mich interessieren zum Beispiel auch Reime für Kinder und Erwachsene. Oder Rätsel! Haben ihre Eltern oder Großeltern Ihnen Aufgaben gestellt?“
Wenn der Hahn am Mittag kräht, gibt es Regen
Die Männer blickten nachdenklich, schüttelten aber die Köpfe. „Wir mussten immer nur aufs Feld, solange ich denken kann“, sagte ein junger Bauer, der bisher geschwiegen hatte. „Aber vielleicht hat Ihnen bei der Arbeit etwas den Takt vorgegeben?“ Der Angesprochene schüttelte den Kopf. „Aber gesungen haben wir!“, fuhr der junge Mann fort und ließ sogleich eine einfache Melodie erklingen. Die anderen Männer am Tisch fielen in den Gesang ein und Woeste notierte den Text eifrig mit.
Er gab eine Runde Bier aus und hörte den Bauern weiter zu, die bald darauf noch einen ihm unbekannten Trinkreim riefen. Irgendwann am frühen Nachmittag bemerkte einer der Männer jedoch, wie weit die Zeit fortgeschritten war. Er erhob sich. „Herr Gelehrter“, sagte er, „auf dem Hof warten meine Arbeit und die Frau. Ich muss jetzt gehen. Aber lustig war‘s mit Ihnen.“ Als hätte er ein Signal gegeben, standen auch die anderen Männer auf, um nach Hause zu gehen. Doch Woeste war sehr zufrieden, denn es waren ertragreiche Stunden gewesen, er würde mit reicher Beute heimkehren.
Gut gelaunt trat er aus dem Wirtshaus. Die Sonne blendete ihn einen kurzen Moment, denn sie stand schon recht tief. Hatte er so viel Zeit mit den Männern verbracht? Er blickte auf seine Uhr. Den Kilometer bis ins Dorf Apricke würde er sicher noch schaffen, aber würde das lohnen? Er entschied sich dagegen und machte sich auf den Rückweg nach Iserlohn. Es wäre nicht schlecht, frühzeitig zurück zu sein. Dann könnte er noch seine Notizen ordnen und ins Reine schreiben. Denn so frisch wie heute wäre die Erinnerung an das Erzählte in den nächsten Tagen nicht mehr. Beschwingt pfiff er die einfache Melodie, die der Bauer zuvor zum Besten gegeben hatte, schwang den Stock und nahm schnellen Schrittes den Weg, den er am Morgen gekommen war.
Die Woche begann für ihn mit den regelmäßigen Unterrichtsstunden, die er verschiedenen Schülern als Hauslehrer gab. Jeder Tag war mit einigen Stunden am Vormittag belegt, nachmittags bereitete er den nächsten Unterrichtstag vor. Auch die Abende waren gut gefüllt, denn nicht nur der Kaufmann Eisenstein hatte eine Übersetzung gewünscht – dieses Mal ins Schwedische. Auch andere Herrschaften hatten sich mit verschiedenen Anliegen bei ihm gemeldet. So war er mehr als froh, seine Notizen vom Sonntag bereits geordnet zu haben. Er hatte gerade ausreichend Zeit gehabt, die nächste Route zu planen. Das Dorf Apricke sollte das Ziel bleiben, allerdings würde er über Niederhemer wandern.
Friedrich Woeste stammt aus Niederhemer. Als eines von acht Kindern eines Volksschullehrers erhielt er eine umfangreiche Schulbildung. Zunächst wurde er in Hemer in Geschichte, Geographie, Latein und Französisch unterrichtet. Dann besuchte er das Gymnasium in Elberfeld. Anschließend führte sein Weg ihn nach Halle/Saale an die Frankeschen Sti ungen, wo er einen exzellenten Abschluss machte. In Halle studierte er im Anschluss bis Theologie, wozu er auch Griechisch und Hebräisch lernte. Nach dem Studium kehrte er als Privat- und Hauslehrer nach Hemer zurück und arbeite in diesem Beruf auch in Altena.








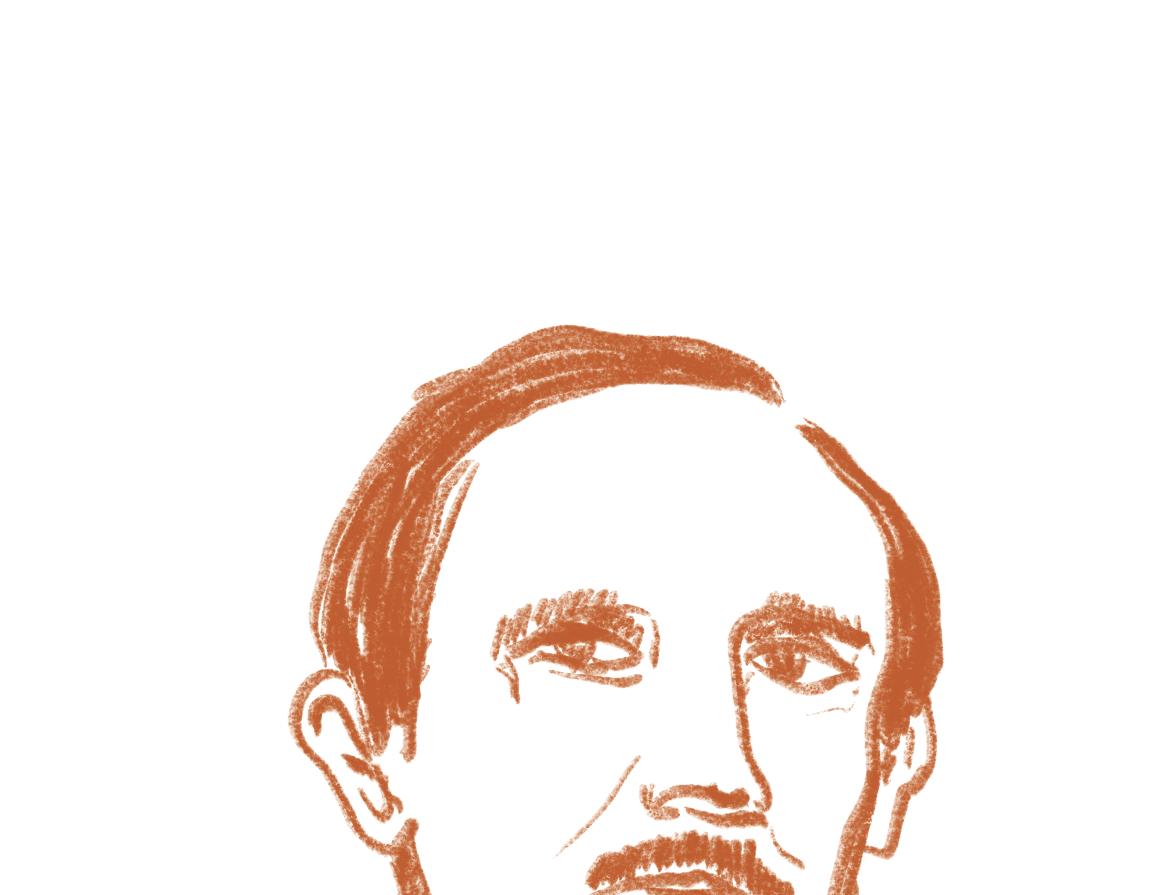



In der Heimat begann er parallel zu seiner Lehrertätigkeit das Plattdeutsche zu lernen und zu erforschen. Ab 1839 lebte er als Privatgelehrter sowie als Haus- und Privatlehrer in Iserlohn. Woeste sprach acht Sprachen fließend: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch und Spanisch. 1849 übernahm er eine Position als Lehrer für neuere Sprachen an der Höheren Stadtschule in Iserlohn. Zu seinen sprachlichen Forschungen sowie zu den Über-lieferungen seiner Heimat, die er ebenfalls erforschte, verö entlichte er zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschri en sowie drei Bücher, darunter eine Zusammenstellung an Volksüberlieferungen in der Grafscha Mark und Wörterbuch der westfälischen Mundart. Er war in diesem Zusammenhang auch mit berühmten Zeitgenossen wie z.B. Jacob Grimm im Austausch.

Der Sonntag kam schneller als gedacht und wie prophezeit hatte er wieder eine Übersetzung für Eisenstein abzuliefern. „Guten Morgen, Herr Meyer“, begrüßte er den Buchhalter freundlich. „Haben Sie wieder Sonntagsdienst?“ „Nicht den ganzen Tag“, antwortete Meier. „Meine Gattin erwartet mich zum Gottesdienst. Wie war denn Ihre Wanderung am letzten Sonntag?“ „Hochinteressant, Herr Meyer!“, berichtete Woeste. „Ich konnte einige neue Bauernregeln notieren – in den meisten stand das liebe Federvieh im Mittelpunkt. Es gab sogar noch einige Reime und Lieder.“
Er verkniff sich, ihm etwas vorzusingen. „Heute besuche ich nochmals den Osten von Hemer. Ich gehe zum Dorf Apricke.“ „Dann wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen, Herr Woeste!“ „Vielen Dank, Ihnen ebenso!“, sagte Woeste. Er winkte zum
Abschied und schlug den Weg in Richtung Niederhemer ein, seinem Heimatort. Seine Eltern waren bereits verstorben, doch er hatte sich überlegt, die Familie seines Bruders zum Gottesdienst in die Ebbergkirche zu begleiten.
Sein Bruder war freudig überrascht und die beiden sprachen über Familienangelegenheiten, bis die Orgel begann zu spielen. Als sie wieder aus der Kirche traten, lud sein Bruder Woeste zum Mittag ein, doch der lehnte dankend ab. Ein anderes Mal aber sicher.
Woeste schlug den Weg nach Apricke ein. Das Wetter war nicht ganz so warm wie am Sonntag zuvor, doch heute würde er sich in kein Gasthaus setzen. Er wollte sehen, was ihm auf seinen Wegen begegnete. Querfeldein nahm er den Weg den Jüberg hinauf und dann weiter in das kleine Dorf, das um das ehemalige Gut Apricke entstanden war.
Während er so ging, sah er auf einem Feld einige Menschen arbeiten und überlegte, ob er sie ansprechen sollte. Doch sie wirkten so beschäftigt, dass sie sicher keine Zeit für einen Schwatz hätten. Also schritt er weiter. Kurz vor dem Dorf sah er im Gras eine junge Frau sitzen, die ein Kind in den Armen wiegte. Um diese Jahreszeit fand er verwunderlich, dass sie dort saß. Der Boden musste kalt sein.
Friedrich ab 1839 in Iserlohn lebte?
Er näherte sich ihr. Sie schien zu singen. Im Näherkommen räusperte er sich, woraufhin sie einen Schreckensschrei ausstieß. Woeste sprach beruhigende Worte, doch sie versuchte hektisch aufzustehen. Ein schwieriges Unterfangen, mit dem Kind im Arm. Als Woeste ihr die Hand reichen wollte, schrie sie erneut. Endlich stand sie und begann zu laufen. Währenddessen hörte er hinter sich jemanden kommen, der ihn dann rüde am Arm griff. „He da“, hörte er die Stimme eines Mannes. „Was machen Sie da? Lassen Sie die Frau in Ruhe!“ Woeste war völlig perplex. Bevor er sich umdrehen konnte, lag er schon am Boden. „Ich wollte doch nur …“, begann er zu sprechen. „Was wollten Sie?“, fragte die Stimme bedrohlich.
Woeste hatte sich am Boden umgedreht und schaute jetzt zum Angreifer hinauf. „Ich wollte doch nur das Lied besser hören, das schöne Kinderlied“, sagte er. „Ach, Sie sind das“, sagte der Mann und raufte sich die Haare. „Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf.“ Der junge Mann, der ihm letzte Woche die Melodie ins Ohr gesetzt hatte, reichte ihm die Hand, um ihn hochzuziehen. Die junge Frau war ein paar Meter weiter stehen geblieben und kehrte wieder zurück. „Sie müssen verstehen, dass ich auf meine Schwester aufpasse“, fuhr der Jungbauer fort. „Hier treiben sich manchmal finstere Typen herum. Das ist ein Gelehrter“, sagte er zu seiner Schwester. „Er sammelt Lieder und so’n Kram.“
Woeste nickte zustimmend. „Und ich hörte Sie singen und wollte nur fragen, ob ich mir die Zeilen notieren darf“, sagte er. „Keinesfalls wollte ich Ihnen zu nahe treten!“ Die junge Frau blickte noch immer etwas verstört, schien aber langsam aufzutauen. „Kommen Sie“, sagte der Mann. „Wir gehen auf den Hof und trinken auf den Schreck erstmal einen Schnaps. Indem er sich die Kleidung abklopfte, nickte Woeste. „Ja, gerne“, antwortete er. Und so fand er sich bald in der Küche des Bauernhofs wieder, wo der Bauer eine Flasche mit klarer Flüssigkeit auf den Tisch stellte.
Seine Mutter rührte am Herd in einem Topf und sah skeptisch hinüber. „Sie wollen also das Lied notieren? Dann sing es doch noch einmal“, forderte er seine Schwester auf. Die begann tatsächlich leise zu singen und Woeste schrieb alles schnell in sein Notizbuch. Erst nach dem zweiten Schnaps war er sicher, dass die Stimmung nicht noch einmal umschlagen würde. Der junge Bauer berichtete den Frauen vom letzten Sonntag und wie fleißig der Herr Gelehrte die ganze Zeit mitgeschrieben hatte. Dass er Geschichten sammle und Reime und Lieder und sonstige überlieferte Weisheiten. Die Mutter brachte den Topf zum Tisch und verteilte die dicke Suppe auf fünf tiefe Teller.
Es war Mittagszeit und auch der Vater traf kurz darauf ein. Wie selbstverständlich war Woeste zum Mahl eingeladen. Der Vater erfuhr die Hintergründe des unerwarteten Besuchs und schüttelte den Kopf. „Ein Gelehrter möchte wissen, was wir Bauern erzählen?“, fragte er. „Was es alles gibt.“ Im Gespräch erfuhr Woeste, dass der Schwiegersohn vor mehr als einem Jahr unerwartet verstorben und die Tochter mit ihren Anderthalbjährigen auf den elterlichen Hof zurückgekehrt war. Oben im Dach lebte die Großmutter, stand aber nur zum Nachtmahl auf.
„Mit der würde ich sehr gerne mal sprechen“, dachte sich Woeste, schwieg jedoch. Heute würde er nicht mehr riskieren, falsch verstanden zu werden. Auch wenn die Stimmung inzwischen gelöst war.
Friedrich bei seinen Forschungen auch mit Jacob Grimm im Austausch war?
Von Vater und Sohn schnappte er zwei, drei Bauernregeln auf, die er nicht kannte. Noch beim Essen notierte er dazu Stichworte. Als die Männer sich erhoben, um ihre Arbeit auf dem Feld fortzusetzen, stand auch Woeste auf. „Meinen herzlichsten Dank für die Einladung“, sagte er.
„Ich habe wieder viel Neues erfahren und werde es in meine Sammlung aufnehmen – auch das Kinderlied.“ Er verbeugte sich leicht in Richtung der jungen Frau und ihrer Mutter. „Auf Wiedersehen!“ „Kennen Sie denn auch schon das Märchen vom Däumeling?“, fragte ihn die Bäuerin. „Nein, das kenne ich nicht“, sagte Woeste überrascht. „Na dann, kommen Sie bei Gelegenheit wieder vorbei und wir erzählen es Ihnen“, antwortete sie. „Auf Wiedersehen!“
Hier versteckt sich das Felsenmeer.

Hinweis
Die Hemeraner Landschaft vom Naturschutzgebiet Apricke aus, in dem Pferde und Heckrinder leben.
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Johann Friedrich Leopold Woeste. Dennoch ist er hier eine Kunstfigur. Die Personen, denen er begegnet, sind frei erfunden. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen aller Figuren fiktiv.
Als Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio im damaligen Ort Kelleramt 1860 seine Stellung als Erzieher und Privatlehrer antrat, war er weitgereist, hatte schon viel erlebt und vieles erforscht. Aus seinen Studien der Geographie, Länderkunde und (Erd-) Geschichte, Biologie und Botanik, der Literatur sowie besonders der Musik und der Volkslieder formte er lebhafte Unterrichtsstunden – allerdings selten in geschlossenen Räumen. Seine letzten Schüler, die Söhne des aus einer einflussreichen Kaufmannsfamilie stammenden Fabrikanten Robert Löbbecke und seiner Frau Emma in Haus Nachrodt, führte er häufig in die geliebte, vielseitige Natur des Lennetals. Obwohl ihm Tätigkeit und Gegend behagten, dachte er 1864, mit Anfang 60, daran, sich langsam zur Ruhe zu setzen. Doch es kam anders.
Die Lampe auf seinem Schreibtisch flackert, das Petroleum geht zur Neige. Es ist weit nach Mitternacht. Zu spät, um den Tank nachfüllen zu lassen. Seufzend legt Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio die Feder zur Seite und streckt sich. Seine Abhandlung über den Regenwurm, seiner Meinung nach eine Landplage, ist weit gediehen. Es fehlt nur noch die abschließende Zusammenfassung. Morgen wird er den Aufsatz beenden können. Zeit für die Abendgymnastik und die Nachtruhe.
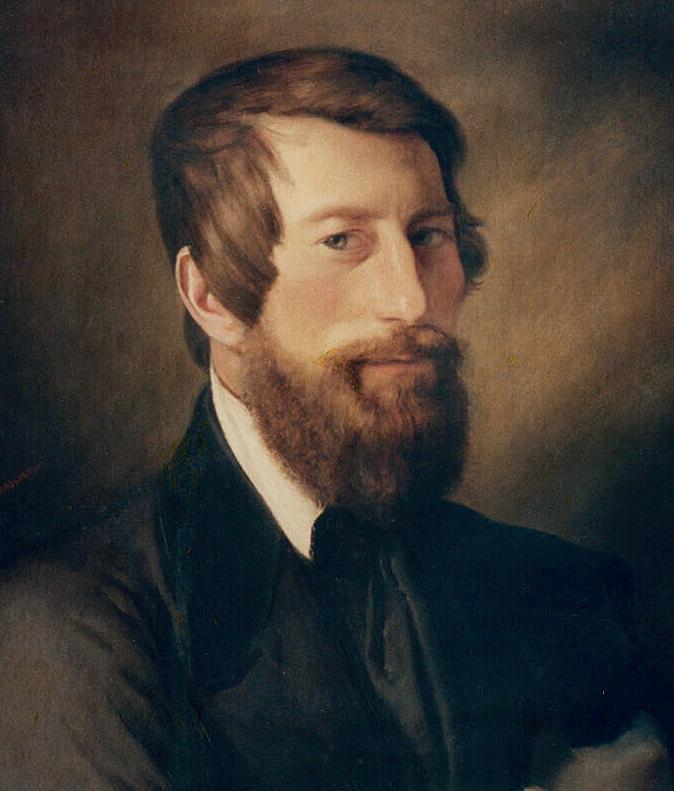
Alles andere als ein Langschläfer liebt er es, wenn ihn zwitschernde Vögel früh wecken. Erst recht, wenn der neue Morgen so sonnig ist wie heute. Dem Tag sieht Wilhelm mit Freude entgegen, denn der Hausherr und Freund, Robert Löbbecke, hat einige Herrschaften zur Jagd eingeladen, denen er ebenfalls freundschaftlich verbunden ist. Er selbst wird nicht jagen, denn das gehört nicht zu seinen Leidenschaften.
Stattdessen wird er nachmittags mit Löbbeckes Söhnen, Töchtern, Nichten und Neffen für die Auff ührung seines Singspiels Die Vögel proben, das morgen, am Abend des Pfingstsonntags, vor Freunden und Familie aufgeführt werden soll. Eine Urauff ührung, wenn man so will. Johann Peter Cornelius d’ Alquen hatte die Musik dazu geschrieben und ihm die Noten erst vor drei Wochen gesendet.
Seither probten sie fleißig. Das Stück, in denen die Kinder verschiedene Singvögel spielen, passt wunderbar zum Frühling und die Gesellschaft wird sicherlich entzückt sein.
Beim Frühstück trifft er auf Robert Löbbecke und seine Frau Emma, ihre beiden kleinen Töchter sowie ihre Söhne, Otto und Eduard, 9 und 10 Jahre.
Alle schwatzen angeregt miteinander, während sie sich dem Frühstück widmen. Am Tisch herrscht fröhliche Stimmung, man freut sich auf ein Pfingstfest mit Gästen und auf das Singspiel mit den Kindern.
Wilhelm selbst nimmt wie immer nur einen Kräutertee zu sich. Frühes Essen liegt ihm nicht, daher bereitet er sich ein Brot für die Pause und bedeutet seinen beiden Schülern, sich ebenfalls etwas einzupacken. Otto und Eduard nicken wissend, es geht wieder in die Natur. Wilhelm begibt sich schon mal ins Studierzimmer, wo die Jungen wenig später eintreffen.
Der Hauslehrer kündigt an, den wunderschönen Tag zu nutzen, um Singvögel zu beobachten und vor allem zu hören. Der Unterricht im Freien wird die Gesangskünste der beiden auf der nachmittäglichen Probe sicherlich beflügeln. Wilhelm vermittelt seinen Schülern die Zusammenhänge der Welt sowieso am liebsten im Freien, zumal Mitte Mai. Otto und Eduard zwinkern sich zu, sie haben es geahnt. Mit festem Schuhwerk an den Füßen brechen sie kurz darauf zu ihrer Wanderung auf.
Ihr Weg führt sie zu Klaras Höh, einem Paradies für Singvögel. Von Löbbeckes Villa im Schweizer Stil im Park von Haus Nachrodt ist es nicht sehr weit zu gehen. Der Legende von der jungen Frau namens Klara, die sich von diesem steilen Felsen mit ihrem Pferd in vollem Galopp in die Lenne gestürzt haben soll, hat Wilhelm nie besondere Beachtung geschenkt. Und das, obwohl er immer auf der Suche nach regionalen Sagen ist. Dennoch hat er dort oben schon sehr viel Zeit verbracht, die natürlichen Gegebenheiten erforscht und Karten gezeichnet. Dieser Abschnitt an der Lenne mit seinen Klippkes, wie die Einheimischen sie nennen, ist ihm bestens vertraut.
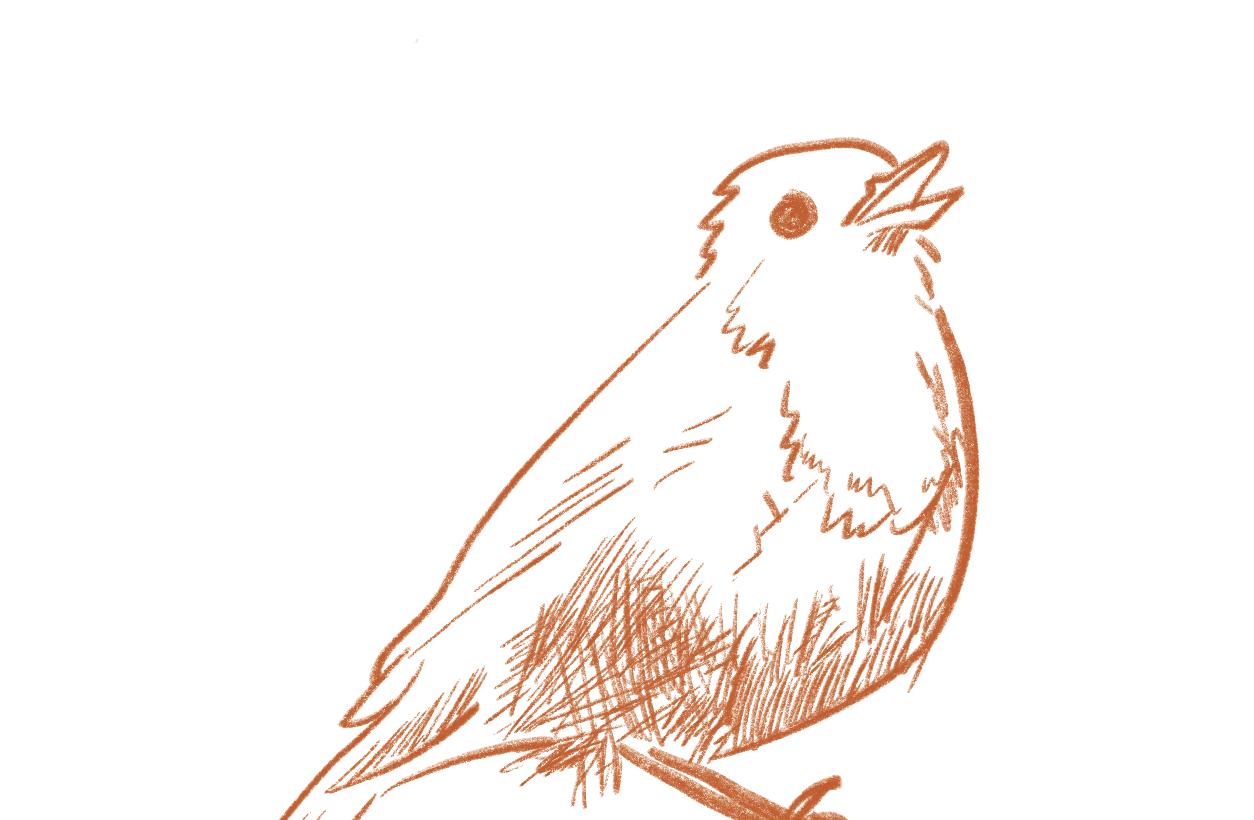

Und auch die Jungen kennen die Gegend bereits wie ihre Westentaschen. Darum forschen sie heute mit Feuereifer. Mit strahlenden Augen und wachem Verstand folgen sie ihrem Lehrer ins Dickicht, wo er ihnen Amseln, Birkenzeisig, Buntspecht, Gimpel, Pirol, Rotkehlchen, Stieglitz und Zilpzalp zeigt. Mit Unterstützung der eigenen Stimme erklärt er ihnen die unterschiedlichen Gesänge.
Wusstest du schon, dass
Anton auch viele eigene Volkslieder dichtete, zum Beispiel „Kein schöner Land in dieser Zeit“ oder „Die Blümelein sie schlafen“? Einige wurden von Brahms, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Carl Maria von Weber und Carl Loewe vertont.
Er macht sie auf die Schimpftiraden der Amseln aufmerksam, auf die beeindruckenden Melodien des gelbschwarz gefiederten Pirols und das Tschilpen des perfekt getarnten Zilpzalps. Um ihre Stimmen schon mal warmzumachen, lässt er die Buben ebenfalls tirilieren.
Ihre Pause verbringen sie an einem sonnigen Plätzchen in der Ruine der Taufk apelle, genießen ihre Zwischenmahlzeit mit Ausblick zum Obstfeld und zur Aue zum Dümpel. Der Rückweg führt sie nach dem Abstieg an der Lenne entlang, wo die Jungen noch die zwitschernde Bachstelze kennenlernen und sogar Eisvögel zu Gesicht bekommen. Gegen Mittag kehren die drei singend und trällernd zurück. Das Mittagessen ist schon bereitet. Selbst Wilhelm verspürt inzwischen Hunger, denn das kleine Frühstück füllte nicht einmal einen hohlen Zahn.

Nach einer kurzen Ruhepause beginnen die Proben. Orgelpfeifen gleich hat sich der Kinderchor im Gartensaal des Hauses Nachrodt, wo das Singspiel aufgeführt werden soll, aufgebaut und singt die seit Tagen geübten Stücke. Von Zeit zu Zeit runzelt Wilhelm ob misslungener Töne der kleinen Solisten Otto und Eduard noch die Stirn.
Doch im Grunde ist er mit dem zwitschernden Gesang und der leidenschaftlichen schauspielerischen Leistung der Kinder sehr zufrieden. Am späten Nachmittag will er gerade die Kinder entlassen, als eine Kutsche auf den Hof rollt. Der Zeitpunkt zum Schlussakkord ist glücklich gewählt, die ersten Jagdgäste reisen an.
Anton der bis heute berühmte Herausgeber einer umfassenden Sammlung Deutscher Volkslieder war und darüber hinaus z.B. slawische und kaukasische Volkslieder sammelte, übersetzte und herausgab?
Er verabschiedet die Kleinen und ermahnt sie, sich warm anzuziehen, damit sie sich nicht noch verkühlen. Für den Sonntagvormittag setzt er die Generalprobe an. In Kostümen, wie er betont. Wilhelm selbst begibt sich zu den Ankömmlingen, um sie zu begrüßen. Er ist nicht nur der Familie Löbbecke, sondern auch Emma Schmidt, Emmas Mutter und Roberts Schwiegermutter, sehr freundschaftlich verbunden und damit selbstverständlich Gast der Gesellschaft .
So verbringt er mit den Gastgebern und deren Gästen, darunter seinem ehemaligen Schüler Heinrich Flinsch aus Frankfurt und dem Arzt Dr. Gosebruch aus Hagen, Sohn eines Freundes aus Oberlahnstein, einen geselligen Abend mit Speis und durchaus auch gehaltvollem Trank in der Villa Schweiz. Erst sehr spät geht er zu Bett und verschiebt das Abschlusswort zum Regenwurm-Aufsatz auf den nächsten Tag. Schließlich wird zwischen Generalprobe und Auff ührung noch genügend Zeit bleiben.
Trotz der wunderbaren Arbeit mit den Kindern würde er sich inzwischen gerne ausschließlich seinen verschiedenen Studien widmen. Das Singspiel hat er als letzten großen Einsatz gedacht. Nach Pfingsten möchte er mit Löbbecke über seine Ablösung sprechen. Doch jetzt ist erstmal wieder Zeit für Abendgymnastik.
Auch der Pfingstsonntag beginnt für ihn früh. Spontan entscheidet er sich für einen Spaziergang durch den in allen Grüntönen sprießenden Park, deren Pflanzen im Morgentau schimmern. Als er den Speisesaal betritt, ist er schon voll mit Menschen in Jagdmontur und erfüllt von angeregten Gesprächen, in denen sich vieles um die anstehende Pirschjagd dreht.
Man nippt am Kaffee und stärkt sich am reichhaltigen Angebot. Selbst Wilhelm lässt sich in dieser nicht alltäglichen Gesellschaft zu einer Scheibe Brot und einer Tasse Schwarzen Tees hinreißen. Schließlich verabschiedet sich das gute Dutzend Jäger zu Fuß in Richtung der Höhen von Wiblingwerde. Das Mittagspicknick ist bereits in Vorbereitung und soll ihnen per Kutsche geschickt werden. Wilhelm winkt zum Abschied und reibt sich dann die Hände. Für sein Singspiel wird es jetzt ernst. In Kürze beginnt die Generalprobe.
Er sammelt die als Vögel kostümierten Löbbeckeschen Kinder ein und geht mit ihnen hinüber zum Haus Nachrodt in den Gartensaal, wo die anderen Kinder warten. Die Kulissen stehen seit Tagen. Links ist ein sprießender Frühlingswald zu sehen, Bäume mit bunten und weniger bunten Singvögeln und rechts die breite, geöff nete zweiflügelige Terrassentür eines gelben Hauses mit zwei überdimensionierten goldenen Käfigen zu beiden Seiten. Dazwischen liegt ein hellblauer Bachlauf.
Ursprünglicher Gründer und Besitzer von Haus Nachrodt war der aus einer Kaufmanns-Familie stammende Eduard Schmidt. 1818 erwarb er Gut Nachrodt und baute das klassizistische Herrenhaus. 1826 heiratete er die ebenfalls aus einer einflussreichen Familie stammende Emma Löbbecke aus Iserlohn.
Emma Schmidt veranlasste in den 1840er Jahren die Verwandlung der benachbarten Obstgärten in einen weitläu gen Landscha spark mit Wiese, Rundwegen und Badehäuschen an der Lenne. Bis heute wachsen dort exotische Bäume und Pflanzen: Rhododendren, Azaleen und Kamelien sowie Eiben, Tulpen- und Trompetenbäume, Platanen, Hängebuchen, seltene Koniferen, Kastanien, Robinien, Blutbuchen und meterhohe Buxbäume.
Sie ließ auch den Ostteil des Hauses im Stil des Biedermeier repräsentativ um- und den Gartensaal anbauen. In dieser Zeit hatte sie zwei Todesfälle zu beklagen: Ihr einziger Sohn verstarb 1841, ihr Mann Eduard 1842. Als Witwe Schmidt führte sie erfolgreich das Unternehmen ihres Mannes weiter, bis sie es 1873 verkau e. Ihre Tochter Emma heiratete Robert Löbbecke.
Witwe Schmidt und Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio hatten sich bereits durch einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt, als er die Stelle als Hauslehrer bei den Löbbeckes übernahm. Sie verband jahrelange gegenseitige Hochachtung und Freundscha . Als er kurz vor seinem Tod nochmals nach Nachrodt zurückkehrte, hatte er vor, dort seinen Ruhestand zu verbringen.

Otto und seine jüngste Schwester, verkleidet als Kanarienvögel, beziehen sogleich Position in den beiden Käfigen. Eduard als Buntfink stellt sich hinter einen Baum, seine Schwester sitzt als Zaunkönig in einem Strauch. Den Chor bilden vier weitere Buchfinken und ein Eisvogel. In letzter Sekunde kommt noch ein Hausmädchen im Kostüm einer Blaumeise angelaufen. Sie ist die Zuflüsterin, falls eines der Kinder seinen Text vergisst.
Emma Schmidt, Emma Löbbecke, die anderen Mütter und die Jäger-Gattinnen haben inzwischen im Saal Platz genommen, um sich die Generalprobe des Stückes anzusehen, in dem sich freie Singvögel und Kanarienvögel über ihre Lebensweisen streiten. Die Kinder sind aufgeregt, doch dann konzentrieren sie sich. Wilhelm hebt die Hände und gibt das Zeichen zum Einsatz. Die musikalische Stunde vergeht wie im Flug.
Die Damen jubeln, nur Wilhelm kraust die Stirn. Zufrieden ist er nicht. Doch meist bedeutet eine mäßige Generalprobe eine gute Vorstellung. Darum schimpft er nicht, sondern gibt den Kindern lediglich noch einige Ratschläge mit auf den Weg.
Mittags isst er nur eine Kleinigkeit, dann kümmert er sich um den Abschluss des Regenwurm-Aufsatzes. Anschließend nutzt er die letzten Sonnenstrahlen, um nochmals durch den Park zu schlendern. Als die Sonne sinkt, hört er die Jäger lachend zurückkehren. Es hört sich nach reicher Beute an. Umso besser. Er freut sich auf ein wohlwollendes Publikum. Doch zunächst wartet ein reichhaltiges Feiertagsabendessen auf die fröhliche Gesellschaft .
Die Auff ührung wird ein kleiner Triumph. Die Kinder gehen in ihren Rollen auf und singen wie Engel. Die Gäste und die begeisterten Eltern spenden frenetisch Applaus. Schließlich verabschieden sich die Kleinen. Hellwach in die Federn zu müssen, ist für sie an diesem Abend nicht leicht zu ertragen. Doch schließlich fügen sie sich in ihr Schicksal und lassen sich zu Bett bringen. Für die Gesellschaft folgt der gesellige Teil, in dem die Männer ihre Jagd Revue passieren lassen, und die Frauen sich noch über Details des Singspiels austauschen. Schließlich fällt auch hier der Vorhang und man begibt sich nach diesem erfüllten Tag zur Ruhe.
Anton neben seinen Anstellungen als Erzieher und Hauslehrer wissenschaftliche Arbeiten z. B. zu botanischen Themen oder Beiträge zu Robert Schumanns Neuer Zeitschrift für Musik schrieb?
Am nächsten Morgen summt die Villa Löbbecke wie ein Bienenstock. Die Gäste stehen kurz vor der Abreise. Sie genießen noch das üppige Frühstück, während fleißige Hände bereits die Kutschen einspannen und beladen. Als die Hufe auf der Straße verklingen, ist die Aufregung mit einem Schlag vorbei. Die Erwachsenen haben das Bedürfnis nach etwas Stille: Robert Löbbecke zieht sich zurück in sein Zimmer, seine Frau ruht im Salon, Wilhelm macht einen Spaziergang entlang der Lenne. Die Söhne sind wegen des allgemeinen Trubels vormittags vom Unterricht befreit und so verschwinden die vier Kinder im Park der Großeltern, um Verstecken zu spielen.
Anton am 23. März 1869 bei einem Besuch im Haus Nachrodt verstarb, nachdem er am Tag zuvor die Dechenhöhle besucht hatte und dass sein Grabstein im oberen Burghof der Burg Altena an ihn erinnert?
Erst am Mittagstisch trifft man sich wieder. Die Kinder, noch vertieft in das soeben beendete Spiel, werden von Emma zur Ruhe ermahnt. Robert fühlt sich nicht gut. Die Kinder schweigen betreten und auch Wilhelm betrachtet den Hausherrn besorgt. Der sitzt mit glühendem Kopf am Tisch, scheint zu frieren und schnäuzt sich in einem Fort die Nase. Nach der Suppe entschuldigt er sich und verschwindet in sein Zimmer, um sich weiter auszuruhen. Otto und Eduard begeben sich mit Wilhelm ins Studierzimmer. Er hat einige Gesteinsproben mitgebracht, anhand derer er den Kindern erdgeschichtliche Entwicklungen erklären möchte.
Zur Teezeit trifft sich die Familie wieder – doch Robert Löbbecke fehlt. Wie Emma Wilhelm flüsternd berichtet, hat sich sein Zustand verschlechtert. Er liegt mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. Wahrscheinlich, so vermutet sie, hat er sich bei der Jagd verkühlt.
Während der Pirsch habe er lange auf dem noch sehr kalten Boden gelegen. Während die Kinder Waffeln und Gebäck knabbern, schickt sie nach Tee für ihren Mann und kehrt sie zurück ans Krankenbett.
Bis zum Abend verschlimmert sich Löbbeckes Zustand weiter, das Fieber steigt. Emma und der ebenfalls sehr besorgte Wilhelm wachen in der Nacht abwechselnd an seinem Bett. Morgens wird der Hausherr von Hustenattacken geschüttelt. Man versucht, ihm durch Kräuterumschläge Linderung zu verschaffen. Das Fieber sinkt den ganzen Tag trotz permanenter Wadenwickel nicht. Die Kinder haben inzwischen erfahren, dass ihr Vater schwer erkrankt ist. Die Mädchen sind verängstigt, die Jungen still. Der Unterricht hat trotz aller Bemühungen seitens Wilhelm an Schwung verloren.
Emma wacht auch die nächsten Tage am Krankenbett, während sich Wilhelm um die Betreuung der Kinder kümmert. Doch Roberts gesundheitlicher Zustand bessert sich in keinster Weise, im Gegenteil. Als sich die Krankheit immer weiter verschlimmert, verständigt Emma Löbbecke Dr. Gosebruch aus Hagen, der noch wenige Tage zuvor ihr Gast gewesen war. Doch auch er kann nichts ausrichten, die Erkältung hat den Körper mittlerweile so weit geschwächt, dass Robert Löbbecke einer Gichtattacke nichts mehr entgegenzusetzen hat. Gerade 36 Jahre alt, verstirbt er und hinterlässt eine verzweifelte Witwe.
Anton neben seinen Anstellungen als Erzieher und Hauslehrer wissenschaftliche Arbeiten z. B. zu botanischen Themen oder Beiträge zu Robert Schumanns Neuer Zeitschrift für Musik schrieb?
Gezeichnet von den Tagen an der Seite ihres schwerkranken Mannes, von den durchwachten Nächten, von Verzweiflung und Trauer erkrankt auch Emma Löbbecke schwer. Sie kann sich weder um die Bestattung noch um die Kinder oder den Haushalt kümmert.
Wilhelm – selbst vom Tod des guten Freundes tief betroffen – stellt seine eigenen Wünsche zurück, übernimmt Emmas Aufgaben und begleitet die Familie über die Trauerzeit. Er steht den Kindern zur Seite, deren unbeschwerte Tage für lange Zeit beendet sind, zumal permanent die Sorge um den Gesundheitszustand der Mutter über ihnen schwebt.
Erst im Herbst erholt sich Emma gesundheitlich, doch die Trauer dauert an. Wilhelm legt seinen Wunsch nach einem Forscherleben daher erstmal ad acta und ist der Familie weitere zwei Jahre eine Stütze. Erst im Herbst 1866 verabschiedet er sich in den Ruhestand und zieht zu seinem Bruder nach Grevenbroich.
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio und einigen seiner Zeitgenossinnen und -genossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren. Beschreibungen und Handlungen der Figuren sowie Ereignisse und Situationen sind fiktiv. 1850 Beginn der industriellen Revolution
Wie so häufig macht sich Ernst Danz im Frühherbst 1882 mit seinen Schülern auf den Weg in die Wälder südlich von Iserlohn. Sie haben einige Bäume geschultert, die sie für den Iserlohner VerschönerungsVerein neu pflanzen. Ein arbeitsreicher Tag, bei dem fast jeder weiß, was er zu tun hat, erwartet sie. An dem der Professor mal wieder zeigt, dass ihn nichts so leicht aus der Fassung bringt.
Wäre es an diesem Morgen in der Stadt still gewesen, hätte man den Gesang gehört, der den Mühlenberg hinab klang. Man hätte vielleicht sogar erkannt, dass es Knabenstimmen waren, die hell das Lied Kein schöner Land erklingen ließen, gestützt von einem tiefen Bass.
Ah, hätte sich mancher vielleicht gedacht, der Professor steigt wieder mit seinen Schülern in den Wald, um Bäume zu pflanzen. Eichen und Buchen, vielleicht auch Erlen und Eschen. Je nachdem, wo Ernst Danz sie gerade hinführt, der große kräftige Professor mit dem weiten Mantel und dem Hut. Doch in Iserlohn war es nicht still, die Stadt versank in ihrer alltäglichen Betriebsamkeit.
Es war das Jahr 1882. In den Schmieden und Fabriken wurde unter lautem Getöse Metall geschmolzen oder verarbeitet. Aus Letmathe fuhr in einer dicken, irgendwie geräuschvollen Dampfwolke gerade ein Zug in den Iserlohner Bahnhof ein und gab ein lautes Pfeifen von sich.
Es war Markttag und die Dienstmädchen, Lieferanten und Boten feilschten mit den Bauern der Umgebung um angemessene Preise. In den Küchen blubberten in großen Töpfen bereits die ersten Brühen auf den Herden. Und so verhallte der Gesang beinahe ungehört. Nur tief im Wald, nahe dem Wolfsplatz hatte jemand zu wimmern aufgehört, und das Lied vernommen. Doch hier, auf der Südseite des Mühlenbergs, war es kaum mehr als ein zarter Hall.
„Haaalt!“, rief der Professor schließlich und ließ die stämmige Stieleiche, die er über der rechten Schulter getragen hatte, auf den Boden gleiten. Mit seinem Trupp aus rund 50 Schülern zwischen zwölf und 15 Jahren war er vom Hallenweg auf den Teichweg eingebogen, hatte den ersten Stadtsteich hinter sich gelassen und war nun an der Kreuzung von Teich- und Talweg angekommen. angekommen.

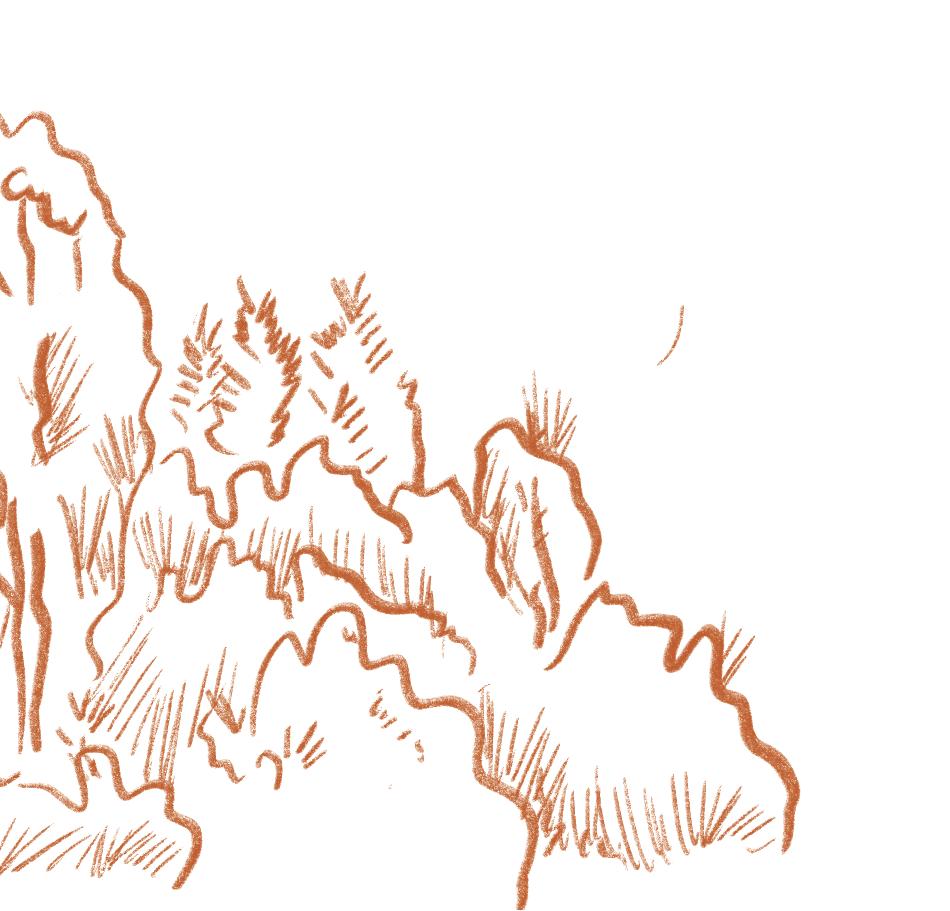
1871
Otto von Bismarck wird
Reichskanzler des Deutsche Reichs
Die Jungen taten es ihm nach, setzten unter Geplauder die Bäumchen zu Gruppen zusammen oder legten Hacken und Schaufeln ab, die sie getragen hatten. Der Professor hob die Hand, unter den Jungen kehrte Ruhe ein. Nur das Plätschern des Wermingser Bachs und das Zwitschern verschiedener Vögel war zu vernehmen.
Danz deutete den Hang hinauf, an dessen Fuß sie standen. Obwohl junge Birken und Ebereschen zu sehen waren, erinnerte der Bewuchs eher an ein gerupftes Huhn, denn an einen Wald. „Schaut euch diesen Hang an“, sprach er. „Wie ihr seht, haben die Köhler ganze Arbeit geleistet. Wir werden unsere Bäume hier einsetzen, damit wieder ein schöner Wald wächst. Doch zuerst machen wir eine kurze Rast.“ Er nahm seinen Rucksack ab, löste die Eimer, die er daran befestigt hatte, öff nete den Rucksack und verteilte Äpfel unter den Schülern. Die waren selbst mit Broten ausgestattet und schöpften sich frisches Wasser aus dem Bach. Doch schon bald klatschte Danz, der inzwischen auch den Mantel abgelegt hatte, in die Hände und rief die Jugendlichen zur Arbeit.
Er stieg ein Stück den Hang hinauf, zog einen Pflock aus dem Boden und hielt ihn in die Höhe. „Diese Pflöcke zeigen euch, wo ihr die Bäumchen setzen sollt“, sagte er und deutete auf die Kennzeichnung. „Ei steht für Eiche, Bu für Buche. Tut euch für jeden Baum zu zweit zusammen. Einer gräbt das Loch ungefähr doppelt so groß wie den Wurzelballen. Lockert den Boden unten in der Grube etwas auf. Der andere entfernt die Jute. Aber Obacht! Die Ballen sind feucht! Dann setzt ihr den Baum ein und schüttet das Loch wieder zu. Sucht euch dicke Äste, um die Bäumchen zu stützen, und wickelt dann die Jute unten um den Stamm, damit das Wild nicht daran knabbern kann. Bindfaden gibt’s bei mir.“
1888
Wilhelm II. wird
Deutscher Kaiser
Mit Feuereifer gingen die Jungen an die Arbeit. Gemeinsam suchten sie die Pflöcke, brachten das passende Bäumchen und Arbeitsgerät den Hang hinauf und begannen bald zu graben. Wie von selbst taten sich diejenigen, die schon mehrmals solche Exkursion mit dem Professor unternommen hatten, mit Neulingen zusammen. Drüben in der Stadt entwickelte sich inzwischen ein warmer Tag, doch hier im Tal und am Osthang streifte die Sonne nur die Höhen, es blieb angenehm kühl. Die Jungen konnten in Ruhe arbeiten und kamen gut voran.
Ernst ein großer Naturfreund war, der oft in den Wald ging und viele Wanderungen im Sauerland unternahm?
Danz hatte seine Stieleiche, den größten aller Stämme, bereits nahe der Weggabelung gepflanzt und beobachtete jetzt die Arbeiten am Hang. Wann immer ein Baum zu kippen drohte, eine Schaufel herunterkullerte oder Bindfaden gebraucht wurde, war er zur Stelle. Doch meist nickte er zufrieden, denn seine Schüler machten ihre Sache sehr gut. Als die ersten Bäumchen gesetzt waren und die Jungen sich den Schweiß von der Stirn wischten, rief er von unten herauf: „Jetzt müsst ihr die Bäumchen noch wässern, dazu könnt ihr die Eimer oder eure Tassen benutzen. Und bringt die Pflöcke mit.“
Gehorsam taten die Jungen, wie ihnen geheißen. Am Bach füllten sie Eimer oder Tassen und kletterten mit der Fracht so hurtig wie möglich wieder hinauf. Am Fuß des Hangs nahm Danz die Pfähle in Empfang und verstaute sie in seinem Rucksack. Dann ließ er die Jungen erneut pausieren und genehmigte sich selbst auch einen Apfel, ein Stück Brot sowie etwas Speck. Bald klatschte er erneut in die Hände, rief „Zweite Runde!“, schnappte sich selbst ein Bäumchen und eine Hacke. Schwungvoll kletterte er aufwärts und pflanzte die kleine Buche im Handumdrehen. Auf dem Rückweg sammelte er die weiteren Pflöcke ein. Dann holte er Wasser zum Angießen. Zurück im Tal, packte er die restlichen Pflöcke ein, holte eine Tute aus der Seitentasche des Rucksacks und blies hinein. Alle Köpfe fuhren herum.
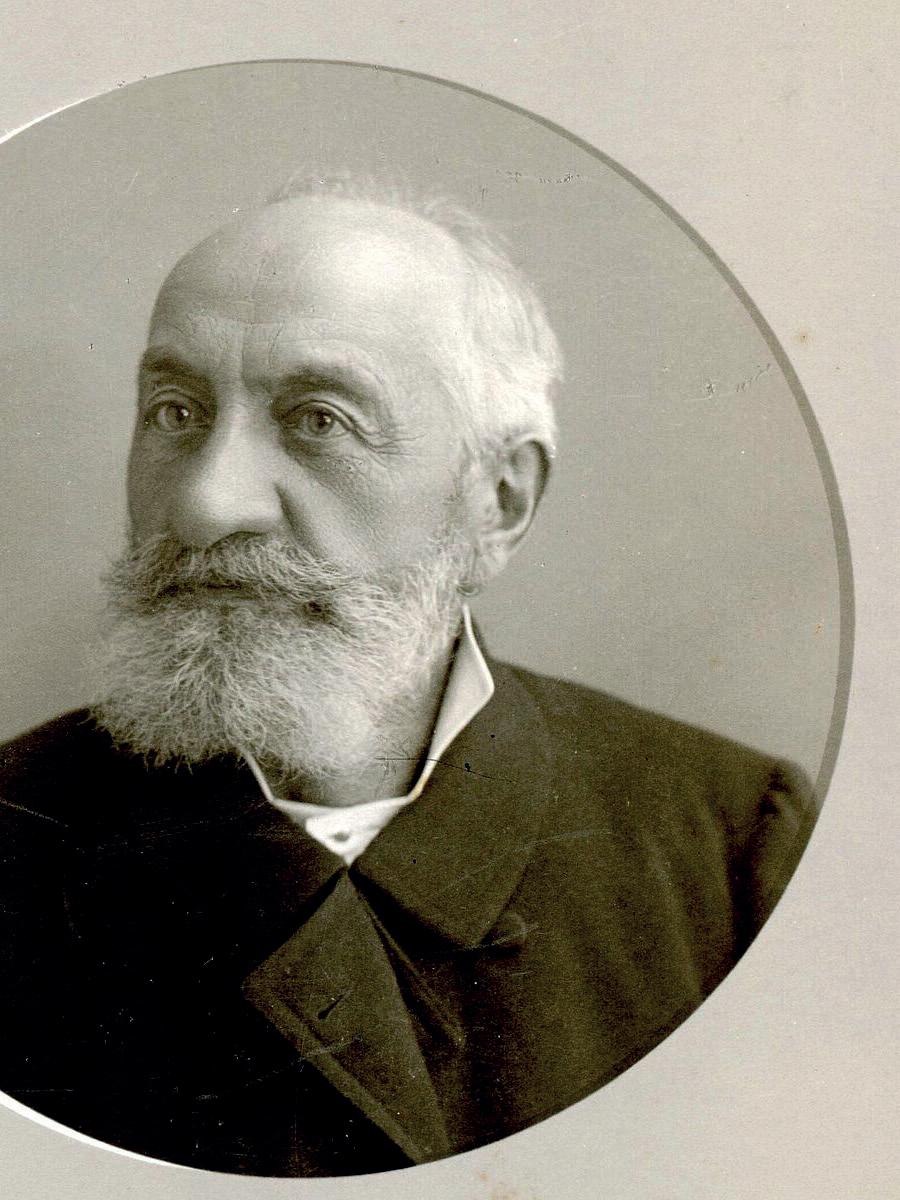
„Ich setze jetzt die Pflöcke für die nächsten Pflanzungen“, rief er. „Die Tute bleibt hier. Wenn etwas passiert, könnt ihr mich damit rufen!“ Er stellte das Instrument auf einen Baumstumpf, winkte und stapfte auf dem Dunklen Weg davon. Nach gut zweihundert Metern kam er zu den nächsten Stadtsteichen. Der Weg bog scharf nach rechts ab und stieg an. Hier wollte er zu beiden Seiten des Weges die nächsten Pflöcke einsetzen – und dazu brauchte er immer etwas Ruhe.
Ernst Danz wurde 1822 als Sohn eines Landwirtschaft sbeamten im westpreußischen Neustadt geboren, der heutige Ort Wejherowo Kilometer nordwestlich von Danzig. Er verließ die Heimat zum Theologie- und Philologie-Studium in Jena, Halle und Berlin. Seine ersten Jahre als Lehrer verbrachte Danz in Magdeburg, Merseburg und Halle, danach ging er nach Siegen und Hagen. 1863 kam er an die Iserlohner Realschule, die später das Iserlohner Realgymnasium wurde. An dieser Schule, heute das Märkische Gymnasium Iserlohn, unterrichtete Danz die Fächer Englisch, Französisch, Geschichte, Deutsch, Erdkunde und Turnen. Danz war ab 1873 auch stellvertretender Direktor der Schule. 1880 wurde er zum Professor ernannt. Erst mit 79 Jahren, , verließ er den Schuldienst.
1902 zum Ehrenbürger ernannte, war nicht nur seiner langjährigen Tätigkeit als Lehrer geschuldet, sondern auch seinem besonderen Engagement für die Stadt. So war der Naturfreund 1874 eines der Gründungsmitglieder des Iserlohner Verschönerungs-Vereins, 1877 übernahm er dessen Vorsitz. 1890 setzte er sich zudem für die Gründung der Iserlohner Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins
Besonders nachhaltig war jedoch sein Engagement im Rahmen des Iserlohner VerschönerungsVereins: Der Verein legte in der Stadt sogenannte Promenaden an, Wege, auf denen Menschen aller Bevölkerungsschichten spazieren und promenieren konnten.
Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Gebiet um den Rupenteich, wo später auch ein Stadtpark angelegt wurde.
Zudem investierten die Vereinsmitglieder eigene finanzielle Mittel, Spenden und ihre Muskelkraft in die Wiederaufforstung der Wälder auf den Höhenzügen um die Stadt. Durch uneingeschränkte Bewirtschaftung waren die ursprünglichen Wälder extrem ausgedünnt: Nicht nur übermäßige Rodung, sondern auch die Holzkohlegewinnung und die Beweidung der Wälder hatten dazu geführt. Danz selbst traf man häufig bei Pflanzarbeiten im Wald an, oft in Begleitung seiner Schüler.
Nach Danz‘ Tod wurde der Aussichtsturm gebaut, den der Iserlohner Verschönerungs-Verein lange geplant hatte. Er wurde 1909 eröff net und zu seinen Ehren Danzturm genannt. Der Turm auf dem Fröndenberg ist bis heute eines der Wahrzeichen der Waldstadt.
Schließlich war nicht jeder Platz für jeden Baum geeignet. Vorsichtig stieg er den rechten Hang hinauf, schaute sich um, testete den Boden, prüfte den Bewuchs und entschied sich für Pflanzplätze. Er arbeitete sicher und schnell, schon bald hatte er den ersten Hang bestückt.
Doch plötzlich stutzte er. Durch das Rauschen der Bäume und Sträucher, durch das Vogelgezwitscher hatte er ein Geräusch gehört, das nicht hierher gehörte. Angestrengt lauschte er, vernahm aber nichts. Er setzte den letzten Pflock mit dem Kennzeichen Er für Erle in den Hang. Da! Da war es wieder! Nicht die Tute, dafür war es zu leise, und außerdem ein ganz anderer Ton. War das ein Tier? Kein Waldtier machte solche Geräusche. Es klang eher wie ein Weinen. Ein verletzter Luchs? Er schüttelte den Kopf. Unwahrscheinlich. Er kletterte aus dem Hang und folgte dem Weg weiter hinauf. Immer dem Geräusch nach. Täuschte er sich, oder kam es aus der Richtung des Wolfsplatzes? Er traf auf den Weg nach Ihmert. Das Wimmern kam näher. Danz begann zu laufen, im Rucksack klapperten die Pflöcke.
Nach einem letzten Abzweig erreichte er den Wolfsplatz. Leer. Kein Vogel, kein Säugetier. Er blieb stehen und lauschte. Lauschte noch angestrengter. Jetzt! Es kam von links aus dem Gebüsch. Ein Wimmern, fast ein Weinen. War das ein Mensch? Langsam pirschte er sich heran. Gar nicht so einfach, bei seiner Größe. Er bog ein paar Zweige auseinander.
Da war ein gelber Fleck im Gestrüpp, ungewöhnlich für diese Jahreszeit, wo sich das Laub bald rötlich färben würde. Doch es war der gelbe Fleck, der wimmerte. Kein Tier, das stand fest. Ein Mensch? Er ging um den Busch herum und erschrak – aber nur kurz. Denn es war ein kleines Mädchen, das unter dem Strauch saß. Ein kleines Mädchen von vielleicht sechs, sieben Jahren. Mit einem gelben Hütchen. Es hob das Gesicht, sah ihn mit großen Augen an, die Wangen von Tränen ganz verschmiert.
Ernst keineswegs ein Waldschrat war, sondern glücklich verheiratet und sechs Kinder hatte, vier Töchter und zwei Söhne?
„Gütiger Himmel“, sagte Danz. „Was machst du hier?“ Das Mädchen wimmerte, ein Bein war merkwürdig verschwunden. „Bist du verletzt?“, fragte er. Es deutete nach unten. Sein Bein war in einen Kaninchenbau geraten. Das Mädchen konnte sich offenbar nicht selbst befreien. Vorsichtig zog Danz das Bein heraus. Über dem Stiefelchen zeigte sich eine breite Schürfwunde. Er untersuchte die Wunde genauer. Gebrochen war nichts, ein Glück. Aber das Bein blutete. Danz durchsuchte seinen Rucksack, brachte jedoch nur einen Apfel zutage. Er reichte ihn dem Mädchen und riss einen Fetzen Stoff aus seinem Hemd. „Woher kommst du denn?“, fragte er während er das Bein verband. Sie zuckte die Schultern. „Weiß nicht“, antwortete die Kleine. „Wie kommst du hierher?“, setzte er nach. „Gelaufen“, war die Antwort. „Wohl eher verlaufen“, meinte Danz. Sie zuckte wieder die Schultern.
„Wo ist deine Mutter?“ Dem Mädchen schossen wieder die Tränen in die Augen. „Weiß nicht“, sagte es. Danz atmete tief ein. Woher konnte die Kleine kommen? Er gab nichts auf Mode, aber ihre Kleidung wirkte bürgerlich, überhaupt nicht ärmlich. Und sogar er konnte erkennen, dass das Kleidchen farblich zum gelben Hütchen passte. Sie kam aus der Stadt und nicht aus den Dörfern im Süden. Ein weiter Weg für ein kleines Mädchen. „Und wo sind dein Vater und deine Geschwister?“ „Weiß nicht“, antwortete es erneut. Vielleicht war sie auf einem Ausflug mit der Kutsche ausgebüxt. Aber warum suchte sie niemand? „So, fertig“, sagte Danz und betrachtete seinen Verband. „Kannst du auft reten?“
Die Kleine streckte das Bein und berührte mit dem gestiefelten Fuß kurz den Boden, zog ihn aber sofort zurück. Er nickte, er hatte sich schon gedacht, dass der Fuß auch leicht verstaucht war.
Ernst als Vorsitzender des Verschönerungs-Vereins jahrzehntelang in den Iserlohner Wäldern arbeitete, Bäume pflanzte und Bänke aufstellte, Wege befestigen und Ziermauern errichten ließ?
Kurzerhand nahm Danz das Mädchen auf den Arm, es klammerte sich verschreckt an ihm fest. „Na dann gehen wir mal in die Stadt“, sagte er und war flugs auf dem Rückweg. Die Jungen staunten sehr, als er mit der Kleinen ankam. Er setzte sie auf den Baumstumpf, wobei sie ängstlich darauf achtete, ihr Kleid nicht zu beschmutzen. Doch nach ihrem Unfall hinter dem Strauch war es sowieso schon egal. Die Jungen hatten ihr Werk bereits vollbracht, waren gerade beim Wässern. Nach und nach kamen sie den Hang hinab und versammelten sich neugierig um den Baumstamm. „Sie ist in einen Kaninchenbau eingebrochen“, erklärte Danz und warf sich seinen Mantel über. Er wusste natürlich, dass dies keine wirkliche Erklärung war, doch was sollte er machen.
Danz zählte die Jungen durch und blies dann einmal kurz die Tute zum Aufbruch. Erschrocken hielt sich das Mädchen die Ohren zu. Doch ihr Retter hatte sie schon wieder mit Schwung auf den Arm genommen und marschierte voran. Seine Schüler hatten die Geräte unter sich verteilt und trabten hinterher. Bald waren sie an der Schule, wo die Jungen die Gerätschaften verstauten. Sie verabschiedeten sich einer nach dem anderen. „Die Iserlohner werden es euch danken!“, rief der Lehrer, noch immer mit dem Kind auf dem Arm, ihnen fröhlich hinterher.
„Und was mache ich jetzt mit dir?“, fragte Danz das Mädchen. Das zuckte die Schultern. „Weiß nicht“, sagte sie. „Wie heißt du denn eigentlich?“ „Emilie“, antwortete sie. Er beschloss, mit ihr zur Gendarmerie zu gehen. Gedacht, getan. „Guten Abend, Herr Professor“, begrüßte man ihn dort. „Guten Abend, meine Herren“, antwortete er. „Ich habe hier eine kleine Fundsache“, schmunzelnd ließ er das Kind auf dem Arm hüpfen. Der Gendarm zog die Augenbrauen hoch. „Eine Fundsache?“, fragte er. „Die kleine Emilie ist im Wald in einen Kaninchenbau geraten“, erklärte Danz. „Und wo sind ihre Eltern?“, fragte der Gendarm. „Weiß nicht“, sagte der Professor und zwinkerte Emilie zu. „Wird sie denn nicht vermisst?“ „Bisher nicht“, sagte der Gendarm. „Aber ich nehme den Vorfall natürlich auf.“
„Und was passiert dann?“ „Dann behalten wir sie hier.“ Emilie schossen Tränen in die Augen. „Hier? Sie war mutterseelenallein im Wald und jetzt soll sie mutterseelenallein in eine Zelle? Kommt nicht infrage“, sagte der Professor laut. „Aber das ist das Procedere“, sagte der Gendarm. „Procedere, Procedere!“, sagte Danz. „Wir haben hier ein verängstigtes Kind.“ Er lächelte Emilie an. „Sie kommt mit zu uns. Wenn sich die Eltern melden, wissen Sie, wo sie zu finden ist.“ „Aber Herr Professor …“ Doch der hatte die Wache bereits verlassen und ging seinem Zuhause entgegen.
Seine Frau war von ihrem Ehemann so manche Überraschung gewohnt. Manchmal hatte er ganze Schulklassen mit nach Hause gebracht. „Emilie bleibt, bis ihre Eltern sie holen“, erklärte Danz, während er sie absetzte. Seine Frau nickte und lächelte Emilie an. Platz für ein zusätzliches Kind gab es genug. „Dann komm“, sagte sie. „Du hast sicher Hunger. Und anschließend waschen wir dich und verarzten deine Wunde. Und dann lernst du unsere Kinder kennen, die sind allerdings schon etwas älter.“ Sie nahm Emilie bei der Hand, die hüpfte auf einem Bein neben ihr in die Küche. Nach dem Bad, mit einem neuen Verband, gehüllt in ein weiches Nachthemd lag sie schon bald in einem der Mädchenzimmer im Bett. Erschöpft von den Aufregungen des Tages schlief sie sofort ein.
Tage vergingen, in denen sich Emilie gut im Danzschen Haushalt einlebte. Der Professor ging täglich nach dem Unterricht zur Gendarmerie, um Neuigkeiten zu erfragen.
Das Wahrzeichen von Iserlohn
Mehrmals ohne Erfolg. Am Abend des vierten Tages tauchte dann ein eleganter Herr am Haus Danz auf, stellte sich als Emil Möllering vor und fragte nach Emilie. Die konnte schon wieder laufen, rannte ihrem Vater schluchzend entgegen und fiel ihm in die Arme.
Die Männer gaben sich die Hand. „Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Professor“, sagte Möllering. „Wissen Sie, ich war in geschäftlichen Angelegenheiten in Frankfurt und meine zweite Frau kommt mit meinem kleinen Wildfang nicht zurecht“, er strich seiner Tochter über den Kopf. „Emilie ist ihr einfach davongelaufen.“ Danz ging in die Hocke und ergriff Emilies Hände. „Das nächste Mal kommst du gleich zu mir. Wir gehen dann gemeinsam in den Wald und pflanzen Bäume“, sagte er. Emilie nickte, auf ihrem tränennassen Gesicht blitzte ein Lächeln auf.
Hinweis

Wilhelm Seissenschmidt zeigt einmal mehr soziales Engagement
Winter 1893: Wilhelm Seissenschmidt hat sich in seiner Heimatstadt Plettenberg bereits durch viele Wohltaten hervorgetan. Für seine rund 150 Mitarbeiter hat er eine Betriebskrankenkasse eingeführt und Wohnungen gebaut. Jeden Winter lässt er Kohlen und Kartoffeln an sie verteilen. Doch das, was er jetzt in die Wege leitet, sprengt alles zuvor Dagewesene. Um sein Geschenk an die Evangelischen Kirche zu überreichen, das indirekt der ganzen Stadt zugutekommt, hat er sich einen besonderen Tag ausgesucht, der sich für ihn vielleicht wie folgt gestaltete.
Seit er vor einigen Jahren mit seiner Familie die Villa in der Grünestraße bezogen hatte, war es ihm zur lieben Gewohnheit geworden: Wilhelm Seissenschmidt zog sich kurz vor der Abenddämmerung auf den Turm seines Hauses zurück. Aus der offenen Laterne bot sich ihm ein wunderschöner Rundumblick: über seine nahegelegene Fabrik und seine Heimatstadt, die waldigen Berge und die von meistens sprudelnden Bächen durchzogenen Täler.
Bei entsprechender Witterung bewunderte er den Sonnenuntergang. Es waren Momente der Stille in seinem sehr geschäftigen, abwechslungsreichen Leben zwischen der Leitung seiner Fabrik, seiner ehrenamtlichen Arbeit im Magistrat der Stadt und seinen Aufgaben als Familienvater.
Einmal im Jahr, kurz vor Jahresende, hielt er bewusst Rückschau auf Vergangenes und öff nete sich künftigen Perspektiven. Und so stand Seissenschmidt heute bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in seinem warmen Seehundmantel wieder einmal hier oben. Lächelnd zog er seine Pfeife aus der einen und seinen Tabaksbeutel aus der anderen Manteltasche. Er stopfte die Pfeife, drehte sich gegen die Richtung, aus der ein leichter Wind blies, und zündete sie an. Mit der Pfeife im rechten Mundwinkel paffte er still vor sich hin.
Ein ereignisreiches Jahr lag hinter ihm. Frühjahr und Sommer waren von den Feierlichkeiten zum 30. Hochzeitstag bestimmt. Eleonore, seiner Frau, war dieses Jubiläum gar nicht so wichtig gewesen. Sie hätte es am liebsten bei der kleinen Frühlingsfeier im Familienkreis belassen. Doch Seissenschmidt wollte diese Möglichkeit, die Plettenberger an seinem Glück teilhaben zu lassen, nutzen. Wer wusste schon, wie viele runde Hochzeitstage man noch feiern konnte?

Er hatte gelernt, die guten Zeiten zu nutzen. Und so gab es ein rauschendes Fest, auf dem sich Familie, Freunde und Bekannte, Unternehmer und Politik vergnügt hatten. Für seine Arbeiter und die restlichen Plettenberger hatte er auf dem Fabrikgelände Freibier ausschenken lassen.
Ein solches Fest konnte er sich ohne Probleme leisten. Seit er Anfang der 60er Jahre auch Schrauben für den Eisenbahnbau herstellte, wuchs und gedieh seine Fabrik. Bald würde er nicht mehr wissen, wie er seine Fabrik erweitern sollte, dann wäre sein Grundstück in der Grünestraße komplett bebaut. Doch er hatte schon eine Idee, wo es Möglichkeiten zur Vergrößerung gab. Dazu müsste allerdings erstmal die Schmalspurbahn durch die engen Täler gebaut werden. Eines der Projekte, an denen er sich auf jeden Fall beteiligen würde. Er hielt sein Gesicht jetzt in den kalten Wind.
Die meisten seiner mittlerweile fast 150 Arbeiter waren ihm und der Firma gegenüber sehr loyal. Das durfte er auch erwarten, denn seine Leute lagen ihm am Herzen und hatten es bei ihm wirklich gut. Er hatte Häuser für seine Mitarbeiter gebaut und eine eigene Krankenkasse eingeführt, die weit über die Leistungen der Bismarck‘schen Kasse hinausging.
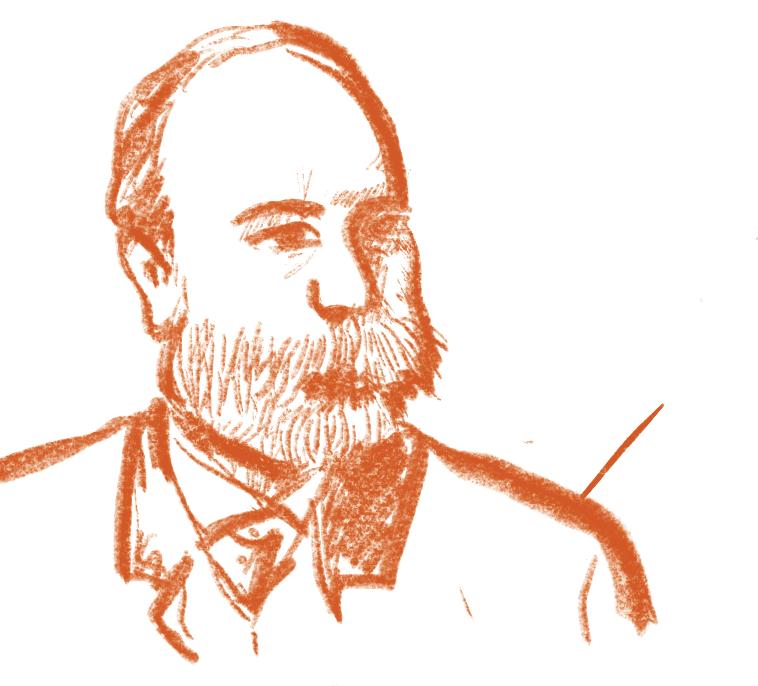
WilhelmSeissenschmidt
Seinen Mitarbeitern sollte es gut gehen, sie sollten gesund bleiben und sich genug Essen leisten können.
Wusstest du schon, dass
Wilhelm eine Betriebskrankenkasse für seine
Mitarbeiter gründete und ihnen als einer der ersten Unternehmer freiwillig Weihnachtsgeld zahlte?
Und tatsächlich wussten die meisten seiner Arbeiter die Leistungen zu schätzen: Einige der Mitarbeiter waren schon seit Gründung der Firma H.B. Seissenschmidt durch seinen Vater im Jahr 1846 im Unternehmen. In gut zwei Jahren würde er das 50 -jährige Bestehen feiern und er plante bereits großzügige Gratifikationen, gestaff elt nach Betriebszugehörigkeit.
Inzwischen hatte es leise zu schneien begonnen, der Wind wirbelte ihm einige Flocken ins Gesicht. Schnell verwandelten sie sich in Wassertropfen. Die Pfeife ging aus, sein Frohsinn verflog. Betrübt schaute Seissenschmidt hinüber zur Fabrik. Einer dieser langjährigen Mitarbeiter würde das Jubiläum nicht mehr erleben. Er hatte ihn im Herbst bei einem Unfall verloren. Bis heute konnte sich Wilhelm nicht erklären, wie es hatte passieren können, dass der erfahrene Jupp in die Esse fiel. Wo doch in seiner Fabrik so auf Sicherheit geachtet wurde. Man hatte ihn sofort geborgen, mit schwersten Verbrennungen.
Er seufzte tief. Unfälle passierten in den Plettenberger Fabriken immer wieder. Manche Wunden konnte der ortsansässige Doktor behandeln. Aber häufig waren die Verletzungen zu schwer. Nur eine Operation oder Behandlung im Krankenhaus hätte helfen können. Doch das nächste Krankenhaus stand im 14 Kilometer entfernten Werdohl – und die schlechten Straßen waren für Krankentransporte nicht geeignet.
Bei Jupp war nicht einmal an einen kurzen Transport zu denken gewesen. Man schaffte es gerade so, ihn auf einer Trage in sein Haus zu bringen. Der Doktor hatte sein Bestes gegeben, mit heilenden Salbenverbänden und schmerzlindernden Mitteln gearbeitet. Gleichzeitig verabreichte er stärkende Mittel.
Wilhelms Geschäft sverbindungen bis nach Russland, in die Türkei und auf den Balkan reichten?
Die Familie wachte Tag und Nacht bei ihm, mehrere Tage vergingen zwischen Hoffen und Bangen. Seissenschmidt ließ sich regelmäßig über Jupps Zustand unterrichten. Doch schnell stellte der Doktor bei seinen täglichen Hausbesuchen fest, dass sich der Zustand des Patienten verschlechterte. Am fünften Tag starb Jupp an einer Sepsis.
Als Pfarrer Klein dann Anfang November den dringenden Appell an die Gemeinde erneuerte, Geld für den Bau eines Krankenhauses zu spenden, fühlte sich Seissenschmidt beinahe persönlich angesprochen. Und er hatte gewusst, was zu tun war. Auch jetzt war er sich seiner Sache sicher. Vielleicht hätte ein Plettenberger Krankenhaus Jupps Tod nicht verhindern können, aber es hätte ihm eine größere Chance geboten, zu überleben. Er nahm die Pfeife aus dem Mund, blickte ein letztes Mal über seine Heimatstadt und nickte. In der Ferne ertönte das Vorläuten der Christuskirche.
Wilhelm 1899 im Rahmen der neu gegründeten
Seissenschmidtschen Stiftung auch den Bau eines Armenhauses in Plettenberg finanzierte?
Seissenschmidt wandte sich zur Treppe. Auf dem Absatz kam ihm seine Tochter Anna entgegen. „Vater“, sagte sie. „Die Kutsche ist angespannt! Wir müssen zur Kirche.“ „Gewiss“, antwortete er. „Ich komme!“ In der Halle erwartete Eleonore ihn vor dem geschmückten Tannenbaum. Er reichte seiner Frau den Arm. „Meine Liebe“, sagte er und tätschelte ihre Hand. „Heute werden wir für Plettenberg ein neues Kapitel aufschlagen.“ Die Kutsche machte sich auf den Weg in die Stadtmitte, vorbei an festlich erleuchteten Villen. Noch immer schneite es. Womöglich würde es ein weißes Weihnachtsfest geben.
In der Kirche angekommen, ging die Familie, freundlich in alle Richtungen grüßend, zu ihren Stammplätzen in der zweiten Reihe. Das Langhaus war schon gut gefüllt, wie immer zur Christmette.
Seissenschmidt entschuldigte sich bei Eleonore und Anna, um in der Sakristei ein Wort mit Pfarrer Klein zu wechseln. Der staunte, als Seissenschmidt den kleinen Raum betrat und begrüßte ihn erfreut. „Herr Seissenschmidt, was führt Sie an diesem hohen Festtag zu mir?“, fragte er.
Der Angesprochene zog einen Umschlag aus der Innentasche seines Mantels und überreichte ihn dem Pfarrer. „Sie haben recht“, sagte er. „Es wird höchste Zeit, dass Plettenberg ein eigenes Krankenhaus bekommt. Damit“, er deutete auf den Umschlag. „sollte das möglich sein.“ Pfarrer Klein öff nete den Umschlag und starrte ungläubig auf das Schreiben, das mit dem Titel „Schenkung“ überschrieben war.
Wilhelm Seissenschmidt schenkte der evangelischen Kirche mit dem Schreiben nicht nur ein Baugrundstück für ein Krankenhaus, sondern erklärte sich auch bereit, die Kosten für den Bau zu tragen. „Das ist ja … Sie machen mich sprachlos“, sagte der Pfarrer. „Das wäre nicht gut“, antwortete Wilhelm lächelnd und deutet auf den Ausgang zum Kirchenraum. „Draußen wartet die Gemeinde auf Ihre Weihnachtspredigt!“
Ein echter Spaß!
Sauerländer Kleinbahn live im Einsatz

Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Wilhelm Seissenschmidt und einigen seiner Zeitgenossinnen und -genossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren. Beschreibungen und Handlungen der Figuren sowie Ereignisse und Situationen sind fiktiv.
Was heute Facebook und Amazon sind, war im 19. Jahrhundert in der ländlichen Grafschaft Mark der Kiepenkerl oder - wesentlich seltener - die Kiepenfrau, die zu Fuß als wandernde Händler und Händlerinnen von Hof zu Hof und Ort zu Ort zogen. Eine von ihnen ist bis heute im Märkischen Sauerland als Kiepenlisettken bekannt und war wegen ihres etwas schrulligen, aber sympathischen Wesens überall beliebt.
Lisette kannte ihre Kundschaft sehr genau, wusste, was die Landbevölkerung glücklich machte, die so gar keine Kramerläden in der Nähe hatten: Dinge des täglichen Bedarfs wie Garne, Nadeln, Knöpfe und Gewürze. Gratis dazu gab es Klatsch, Tratsch und Neuigkeiten. In Schalksmühle auf dem Rathausplatz steht ihr Denkmal. Tagein, tagaus und meist allein, wie auf ihren einsamen Wanderungen. Nur am Markttag mischt sie sich unter die Menschen. Hier erzählt sie ihre Geschichte.
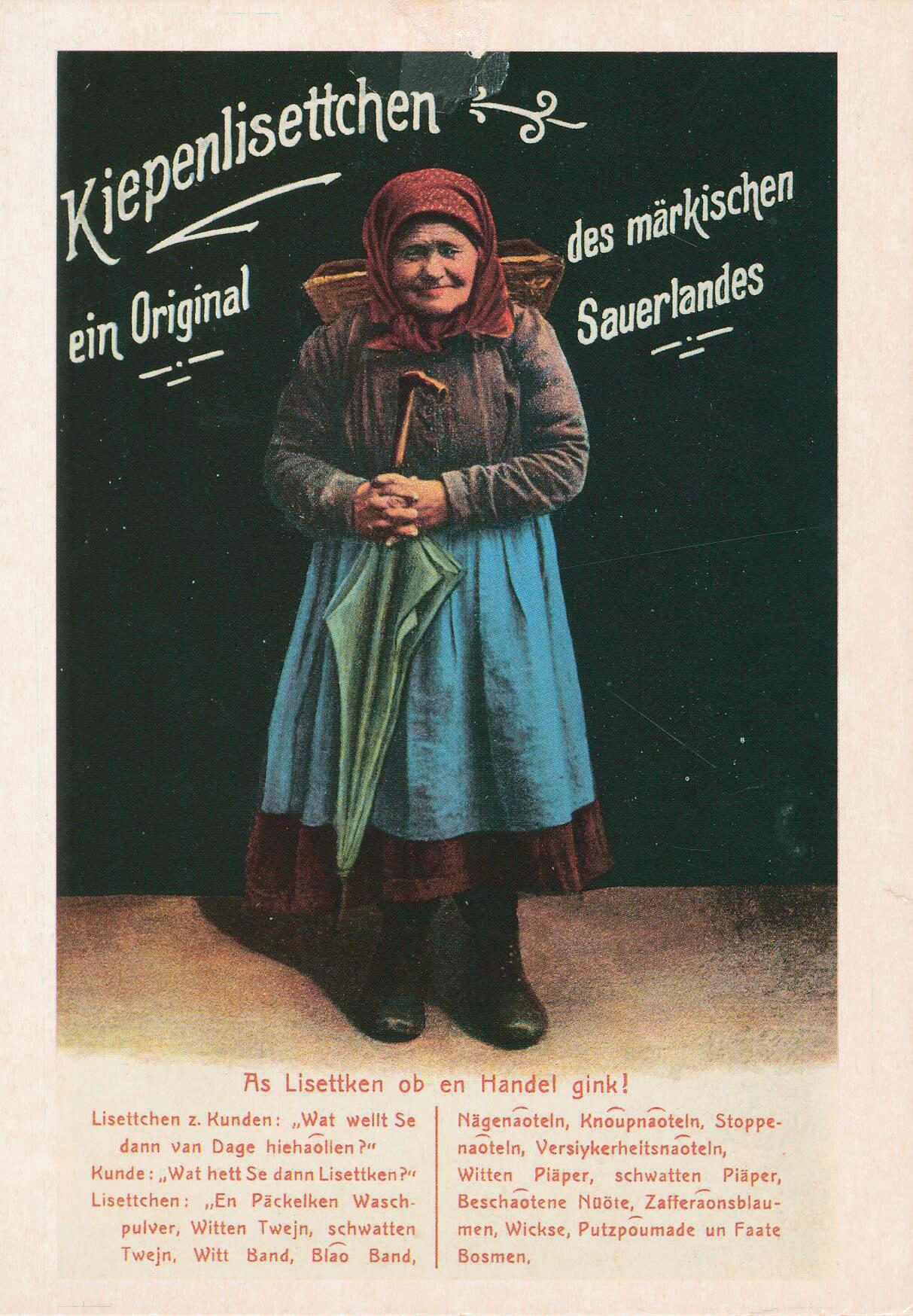

„Mein Mann Carl und ich zogen nach unserer Heirat von Halver nach Rotthausen. Er arbeitete dort als Knecht“, beginnt Lisette zu erzählen. „Wir lebten davon mehr schlecht als recht, mit unseren Kindern, Friedrich und Lina. So wird es uns niemals besser gehen, dachte ich mir.“ Lisette, nicht mehr jung, in schweren Kleidern, die Kiepe auf dem Rücken und mit faltigem, freundlichem Gesicht zuckt schmunzelnd die Schultern. „Es musste etwas passieren.“
„Die Kiepenkerle, die immer am Hof vorbeikamen, brachten mich auf einen Gedanken“, fährt sie fort. „Ich war jung und kräftig, nicht besonders schüchtern. Frauen machten das natürlich eigentlich nicht, aber ich wollte mich als wandernde Händlerin auf den Weg machen.“ Lisette lächelt breit über das gutmütige Gesicht. „Es war ganz einfach, mir eine Kiepe zu bauen. Carl half mir dabei, obwohl er meinen Plan nicht guthieß.“
„Die Kinder brachten wir zu Verwandten, ich packte die Kiepe voll mit Schinken und Würsten von unserem Bauern und brach auf. Ich ging nach Lüdenscheid, um alles zu verkaufen und Waren für die Wanderung über Land zu bekommen. Was auf den Höfen fehlt, wusste ich genau und füllte die Kiepe mit Garnen, Nadeln und Knöpfen. Damit machte ich mich auf den Weg in Richtung Halver und Kierspe.“
Lisette schmunzelt erneut. „Es waren milde Frühlingstage, aber die Kiepe war sehr schwer und ich hatte auch noch einen Korb dabei. Arme und Füße taten mir weh, der Schlamm in Wäldern und Wiesen machte mir zu schaffen. Dauernd rutschte ich aus und bekam nasse Füße. Doch ich lernte schnell dazu, wickelte mir Stoff als Gamaschen um die Beine. Ich wanderte und wanderte, war leichten Herzens und stieß stets auf Menschen, die mich froh begrüßten. Schlafen konnte ich meistens in Scheunen. An meine erste Nacht erinnere ich mich gut. Der Bauer war nur etwas älter als ich und ziemlich erstaunt, als ich gegen Abend an die Tür klopfte.
Die Bäuerin kam dazu und beide luden mich zu Essen und Trinken ein. Ich erzählte meine Geschichte und verkaufte gleich die ersten Garne und Knöpfe. Richtig gut habe ich in ihrer Scheune geschlafen. Der Hof war dann oft meine erste oder letzte Station.“
„Die ganze Wanderung war ein guter Anfang, ich brachte ein paar Taler heim nach Rotthausen. Das besänftige Carl ein bisschen.“ Lisettes Augen glänzen. „Schon bald machte ich mich wieder auf den Weg. Mit jedem Mal wurde ich mutiger, ging weitere Wege und begann auch, Gewürze zu verkaufen. Manchmal suchte ich mir im Wald einfach ein trockenes Plätzchen zum Schlafen. Dort huschte ich immer knurrend dreimal im Kreis um meinen Schlafplatz, um Tiere und böse Geister zu vertreiben.“
Wusstest du schon, dass
Lisette als Kiepenlisettchen Anfang des 20. Jahrhunderts zahllose Postkarten schmückte?
Sie kichert. „Das wirkte ganz gut. Aber natürlich hatte ich auch immer meinen dicken Wanderstock an der Schlafstatt.“ „Schon im Sommer des ersten Jahres wanderte ich bis nach Mainz und Frankfurt, nahm auf dem Hinweg von den Höfen Briefe und Pakete für Jungs aus der Heimat mit, die beim Militärdienst waren“, berichtet sie. „Damit war ich immer sehr willkommen, vor allem weil ich auch unterwegs viele Neuigkeiten erfuhr und berichten konnte.“
„Ich erinnere mich noch gut an meinen Rückweg im Spätsommer 1870. In Mainz hatte ich erfahren, dass Napoleon III. kapitulieren und anschließend abdanken musste. Mitten im Krieg. Auf den Höfen hatte sich diese Kunde noch gar nicht verbreitet, es gab ja dort kaum Zeitungen. Besonders in der Heimat war die Freude groß. Denn es gab Hoff nung auf ein Ende des Deutsch-Französischen Kriegs und die Rückkehr von Söhnen und Brüdern. Mehrere Abende lang schwatzte ich darüber mit vielen Familien, die ich am Weg besuchte.“
Die Kiepe ist eine Rückentrage aus Holz oder Korbgeflecht. Sie wurde z.B. von den sogenannten Kiepenkerlen und -frauen zum Transport von Waren verwendet. Sie konnte in zwei Bereiche eingeteilt werden, z. B. unten für lebende Tiere und oben für Lebensmittel.
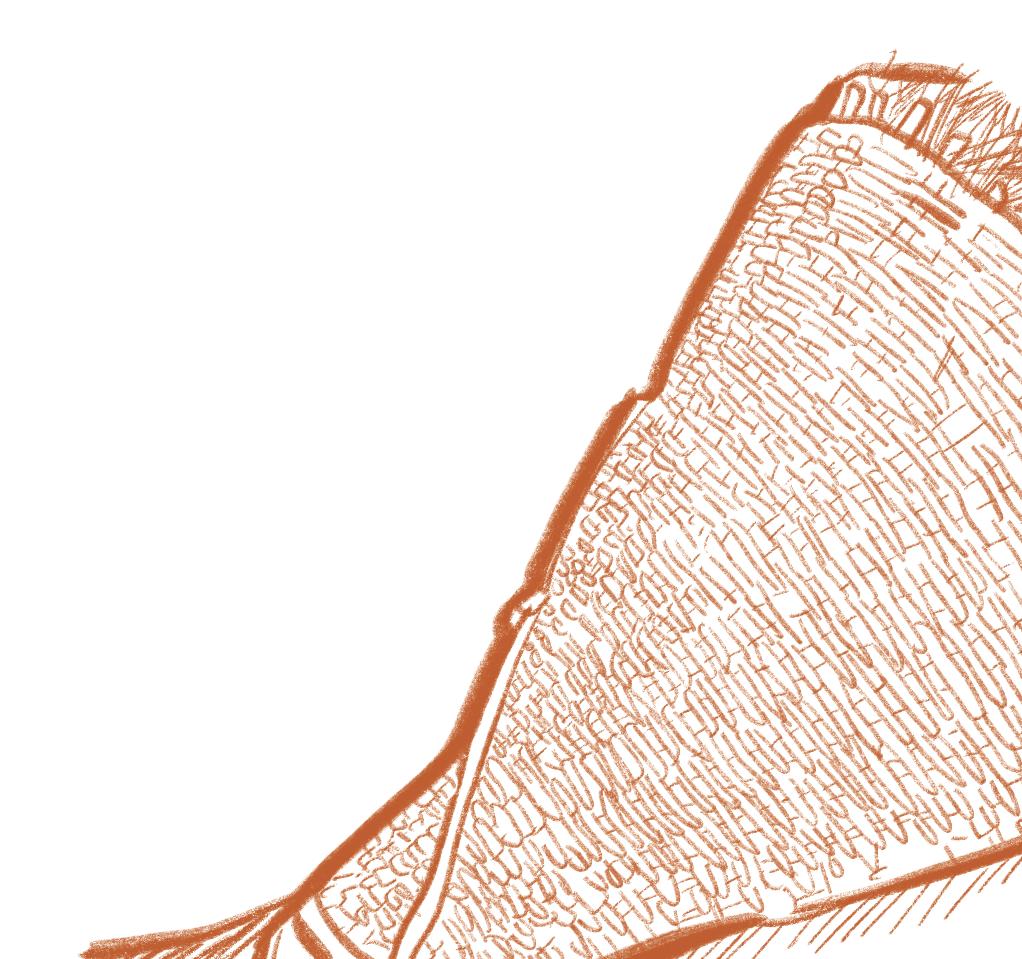
Der obere Bereich war meist mit Leinen ausgeschlagen. Mit dem Eigengewicht der Kiepe waren
auf dem Rücken bis zu




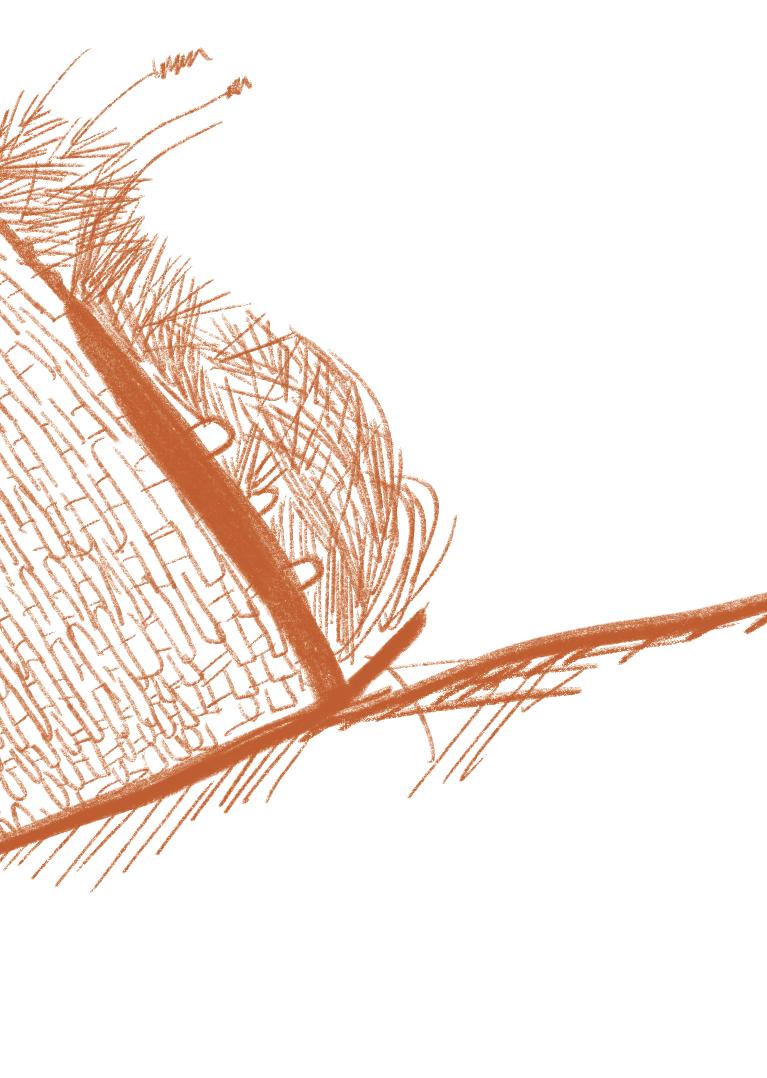
Wie das Kiepenlisettken kannst du heute in der Region Schalksmühle, Halver und Kierspe wandern. Für dich ist es natürlich leichter, denn dein Rucksack ist sicher nicht so schwer wie eine Kiepe. Hier sind einige Strecken, auf denen sie bestimmt auch unterwegs war:

Rund um Halver Schalksmühler Rundweg
VolmeSchatz - Acker, Hof und Vieh: vom „einfachen Landleben“
Sie schaut versonnen. „Fröhlich war das. Vor allem, als ich dann noch erzählte, dass in Rönsahl gerade eine Schnapsbrennerei errichtet wird. Ich versprach, beim nächsten Mal ein paar Flaschen mitzubringen.“ Lächelnd fährt sie fort. „Diese weiten Wanderungen habe ich noch viele Male gemacht. Nicht nur nach Frankfurt und Mainz, auch nach Einbeck. Das war eine gute Zeit, bestimmt 15 Jahre lang. Mit den Leuten kam ich gut zurecht, sie nannten mich schon lange Lisettken. Die Familie in Rotthausen kam ohne mich zurecht, vor allem steuerte ich einen guten Teil an Talern bei. Es hätte so weitergehen können.“
„Doch dann wurde alles anders.“ Lisette wirkt plötzlich bekümmert. „Ich war nie in der Dunkelheit gewandert, denn im Dunkeln waren Wege und Wälder gefährlich. Nicht nur wegen Schlamm, Gestein und Wurzeln, sondern auch wegen Halunken im Unterholz“, erklärt sie.
Lisette bis 1907 lebte und zuletzt bei ihrer Tochter Lina wohnte?
„Es war im Frühherbst ungefähr auf halbem Rückweg von Frankfurt. Die Sonne ging recht früh unter und ich hatte noch keinen Schlafplatz. Neben einem Haferkasten wollte ich die Nacht verbringen, doch es regnete. Der Wald bot da mehr Schutz“, sie seufzt, „also suchte ich in der Dämmerung einen geschützten Platz am Waldrand. Wie immer schaute ich sehr genau, wo ich mich niederließ und drehte meine Runden um den Schlafplatz.“
„Wahrscheinlich habe ich doch nicht gut genug aufgepasst. Nachts wurde ich jedenfalls wach und spürte jemanden in der Nähe. Kein Tier, das war sicher. Ich blieb mucksmäuschenstill, doch ich war bereits entdeckt.“ Lisette schüttelt den Kopf.
„Ein Räuber hatte sich angeschlichen. Er hatte es auf meine Kiepe und meine Taler abgesehen, die ich in einem Beutel unter meiner Schürze verbarg. Er warf sich auf mich und suchte danach. Mein Kleid war nicht so leicht kaputt zu kriegen“, lächelnd hebt sie ihren schweren Rock, „aber die Schürze riss er samt Beutel ab. Ich griff nach meinem Stock und schlug den Mann mit kräftigen Hieben in die Flucht. Was für ein Glück, dass er allein war!“
Lisette bewegt nochmals den Kopf, wie um die Erinnerung abzuschütteln. „Er rannte schnell davon, ließ die Kiepe liegen. Aber er hatte meine Taler. Das war schlimm!“ Sie schweigt einen Moment. „Natürlich schlief ich in jener Nacht nicht mehr. Bei Morgengrauen wanderte ich weiter. Ich schaute mich immer wieder um, aber der Angreifer war weg. Erst langsam wurde mir klar, dass ich mit dem Schrecken, ein paar Beulen und dem Leben davongekommen war.“
„Eine Warnung war das, doch den Handel wollte ich nicht ganz aufgeben. Aber ich entschloss mich, in der näheren Umgebung zu bleiben. Hier kannte und kenne ich jeden Hof, jeden Weg, beinahe jeden Strauch. Und so werde ich zwischen Halver und Schalksmühle von Hof zu Hof und von Ort zu Ort wandern bis ich eben nicht mehr wandern kann –mit Garnen, Nadeln, Knöpfen in der Kiepe und vielen Neuigkeiten im Gepäck.“
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details des Kiepenlisettkens, eines Originals des Märkischen Sauerlands. Dennoch ist es hier eine Kunstfigur. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figur fiktiv.
Ende März 1895. Basse & Selve ist ein äußerst erfolgreiches Unternehmen mit Sitz und mehreren Werken in Altena sowie weltweiten Verbindungen. Gustav Selve, der Sohn eines der Gründer, hat es mit viel Sinn für Innovationen und Mut zum Risiko zu einem der erfolgreichsten Hersteller von Messing-, Nickel- und Aluminiumprodukten im Deutschen Reich gemacht. Dabei ist Selve ein sozialer Unternehmer, der stets das Wohl seiner Belegschaft und den Fortschritt der Region im Blick behält. Umso weniger versteht er, warum manche seiner Neuerungen wenig Anklang finden.
Unwillig klopfte Gustav Selve auf den Kopf seines Frühstückseis. Er hatte schlecht geschlafen. Die Geschichte um sein Stauwehr an der Lenne zog sich jetzt schon seit mehr als einem halben Jahr hin. Sein Werk Hünengraben sollte damit deren Wasserkraft besser ausnutzen. Doch es gab Bedenken seitens der Kommune, die Hochwasser befürchtete. Und es gab Einwände seitens einzelner Drahtproduzenten, deren Werke flussabwärts an der Lenne lagen. Jene waren sicher, dass die Lenneströmung durch ein Wehr weiter unten für den eigenen Bedarf an Wasserkraft zu schwach würde.
Was er nicht verstand, denn schließlich wollte er die Lenne nicht permanent stauen, sondern mit einem Nadelwehr regulieren. Doch die Konzession, die er letztes Jahr, 1894, beantragt hatte, war ihm bisher nicht erteilt worden.
Er warf die Serviette auf den Tisch, erhob sich und nahm auf einem der beiden Sessel im Erker Platz. Die Zeitung lag bereit, das Mädchen brachte ihm einen weiteren Kaffee und eine Zigarrenauswahl. Von hier aus blickte er flussaufwärts über die Lenne. Noch waren die Bäume an den Hängen kahl. Oben vom Türmchen aus könnte er bis zum Werk Lennestein sehen.
Gustav mit der Familie seit 1874 im Haus in die Lüdenscheider Straße nach Altena wohnte, hinter dem er einen weitläufigen Garten anlegen ließ? Wegen der vielen Schnörkel und Türmchen hatte das Haus den , Spitznamen Villa Alpenburg.
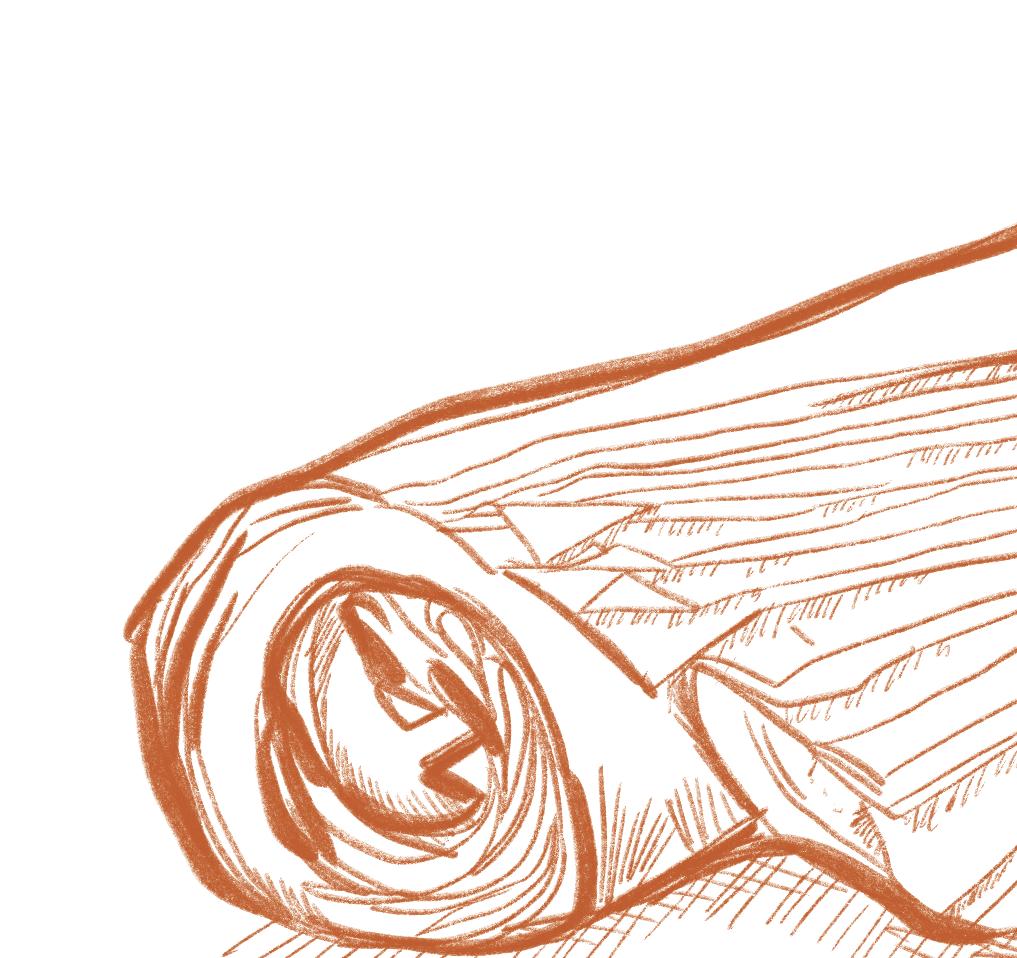
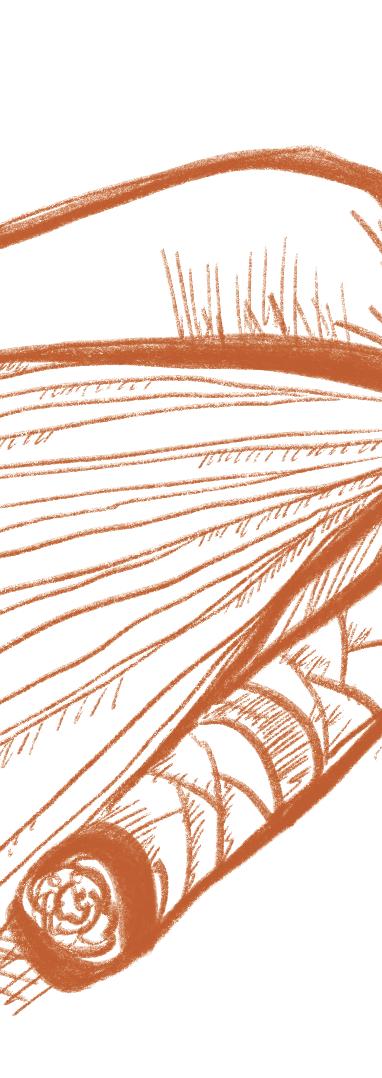

Während er sich eine Zigarre anzündete, studierte er die Titelseite. Italien kämpfte noch immer in Äthiopien, sein italienisches Werk würde sicher Nachschub an Patronenhülsen produzieren müssen. Er las die Seite 2, in der Hauptstadt lief alles seinen Gang. Auf Seite 3 fand er einen interessanten Artikel über die Anstrengungen von Carl Berg, der von Lüdenscheid aus den Luft schiff bauer David Schwarz unterstützte – Aluminium war das Zaubermaterial. Selve selbst war nach einer längeren Versuchsphase mit der Aluminiumproduktion inzwischen ebenfalls auf einem guten Weg.
Auf derselben Seite verwies eine Anzeige auf die Deutsch-Nordische Handels- und Industrie-Ausstellung in Lübeck, die von Juni bis September des Jahres stattfinden sollte. Einer der Ausstellungsschwerpunkte war Marinebedarf. Über eine Teilnahme war daher durchaus nachzudenken. Jedoch müsste man sich wahrscheinlich sputen, um dort noch mit von der Partie zu sein.
Genug der Lektüre für heute, befand Selve und legte die Zeitung beiseite. Er hatte sich mit seinem Generalbevollmächtigten Ashoff wegen des Wehrs abzustimmen, damit dort etwas voranging. Dass ihm so viele Steine in den Weg gelegt wurden, verstand er nicht. Nicht nur wegen des Wehrs, man warf ihm auch vor, dass seine Werke – insbesondere die Nickelproduktion in Schwarzenstein - schädliche Emissionen verursachten. Dabei hatte er viel getan für diese Stadt und er hatte noch viel vor, es ging ihm um das wirtschaftliche Gedeihen der ganzen Region.
Nicht von ungefähr engagierte er sich politisch auch als Stadtverordneter. König von Altena nannten ihn die Leute unter anderem deswegen.
Wobei sein ganz besonderes Engagement dem Wohlergehen seiner Mitarbeiter galt: Von Wohnraum über Betriebskrankenkasse bis zum Unterstützungsfonds hatte er in den vergangenen Jahrzehnten die besten Rahmenbedingungen für seine Leute geschaffen.
Und im Central-Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen setzte er sich für eine generelle Verbesserung der Verhältnisse ein
sich die Genehmigung des Nadelwehrs bis zum Jahr 1900 hinzog und das Unternehmen die Konzession nur unter Auflagen erhielt?
Selve machte sich auf den Weg und traf wenig später im Werk Hünengraben auf Ashoff. Vor Ort begutachteten sie gemeinsam mit einem Fachmann aus dem Werk zum wiederholten Mal die geplante Lage des Nadelwehrs und konnten daran nichts Hinderliches entdecken. Sie besprachen nochmals die Details zu den aktuellen Einsprüchen. Unter vier Augen gab Ashoff später allerdings seiner Befürchtung Ausdruck, dass es nicht die letzten Hindernisse für die Konzession gewesen sein könnten. Doch von Selve erhielt er lediglich die Order, für zügige Klärung zu sorgen.
Der Unternehmer verließ das Werk und fuhr von der Lenneschleife mit dem Einspänner einmal quer durch Altena – vorbei an seiner Villa, die man in Altena Villa Alpenburg nannte, über die Steinerne Brücke, am Werk Lennestein entlang. Er gelangte zum Werk Schwarzenstein, wo er sich im Tagesgeschäft ausführlich kaufmännischen Angelegenheiten widmete. Nach einem arbeitsreichen Tag und einem Abend im Kreise der Familie war diese Nacht geruhsamer.
So war seine Laune am nächsten Morgen erheblich besser als am Vortag. Er genoss nach dem Frühstück seinen Kaffee und seine Zigarre im Erker. Da die Sonne schien, beschloss er, heute alle Werke in und um Altena einer Kurzinspektion zu unterziehen. Er blieb gerne in die Produktionsprozesse involviert, nur so konnte er Verbesserungen und innovative Ideen entwickeln.
Außerdem war es nicht verkehrt, seinen Beamten und Arbeitern gelegentlich auf die Finger zu schauen. Aktuell interessierten ihn besonders die Fortschritte bei der Aluminiumverarbeitung. Gerade wollte er die Zeitung zusammenfalten, als ihm auf Seite 4 eine Notiz ins Auge fiel.
Der 80ste Geburtstag seines großen Idols, Otto von Bismarck, stand kurz bevor – am 1. April 1895 Im Reichstag hatte es eine Abstimmung darüber gegeben, ob ihm ein offizielles Glückwunschtelegramm zu senden sei. Das Ansinnen war abgelehnt worden! Gustav Selve war fassungslos, er schüttelte den Kopf. Die Verdienste Bismarcks mussten doch anerkannt werden! Dieser Mann, dessen Wirtschaft s- und Schutzzollpolitik er so geschätzt hatte. Und der sich bei der Sozialgesetzgebung auch vom sozialen Engagement von Unternehmern wie ihm hatte inspirieren lassen. Er schüttelte nochmals den Kopf. Respektlos war das.
Gustav Selve wurde 1842 als ältester Sohn des Landwirts und Mühlenbesitzers Hermann Dietrich Selve und seiner Frau Anna Katharina geboren. Hermann Dietrich Selve gründete 1861 gemeinsam mit Manufakturwarenhändler Carl Basse das Messingwalzwerk Basse & Selve in Bärenstein (Werdohl). Nach Ausbildungen an der Iserlohner Gewerbeschule, im Handelshaus Josephon & Quäbicker sowie in der Maschinenfabrik Gerhardi trat Gustav Selve kurz nach der Gründung von Basse & Selve ins Unternehmen ein.
Schnell zeigte er sein Geschick in geschäftlichen Dingen, legte den Fokus zunächst auf Patronenhülsen, später auch auf Münzen. 1868 erhielt er erstmals Auft räge für Patronenhülsen aus der Schweiz, wenig später folgten Auft räge aus Italien. Als die Bärensteiner Produktionskapazitäten nicht mehr ausreichten, kaufte Basse & Selve ein stillgelegtes Werk am Schwarzenstein in Altena.


Ab 1869 war der Firmensitz Altena. Als nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 die Mark bisherige Währungen ablöste, erhielt Gustav Selve den Zuschlag für die Produktion der Rohlinge für 1 -, 2-, 5 - und 10 -Pfennig-Münzen. Ab 1872 war er Teilhaber und Geschäft sführer des Unternehmens.
In der Nickelverarbeitung für die Münzen musste er zunächst in einer eigens gebauten Nickelhütte Erfahrungen sammeln, bei denen es auch zu Rückschlägen kam. Letztlich wurde seine Nickelhütte zur größten Deutschlands. 1883, nach dem Tod seines Vaters war er Alleininhaber –die Erben Basse hatten sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Als weiteren Werkstoff nahm er in den 1890er Jahren Aluminium hinzu und wurde später u.a. zum Lieferanten des Luft schiffbauers Ferdinand Graf von Zeppelin.
Gustav Selve führte das Unternehmen mit strenger Hand, doch er erkannte seine Fürsorgepflicht und die Bedeutung von Fachpersonal für sein Unternehmen früh. Daher engagierte sich besonders stark für seine Mitarbeiter. Er begann 1879 mit betrieblichem Wohnungsbau als Grundlage, schuf aber darüber hinaus eine Speiseanstalt, Bäder und Metzgereien für seine Leute. Im Laufe der Jahre führte er u.a. eine Betriebskrankenkasse, eine Fabriksparkasse, Konsumanstalten sowie Unterstützungsfonds für soziale Härtefälle ein.
Viele Leistungen bot er schon, bevor die allgemeine Sozialversicherungspflicht eingeführt wurde. Dafür forderte er höchsten Einsatz und „Treue um Treue“, so sein Wahlspruch. Doch er engagierte sich nicht nur für seine Belegschaft. 1896 stiftete er 100.000 Mark für den Bau der ersten Lungenheilanstalt des Landes in Lüdenscheid-Hellersen. Träger war der Kreis Altena.
Nach seinem Tod setzte ihm seine Arbeiterschaft , die er sogar in seinem Testament bedachte, ein Denkmal. 37.000 Mark an Spenden wurden dafür gesammelt. Das Gustav-Selve-Denkmal befindet sich in Altena an einer markanten Stelle auf einem Bergsporn, westlich der Steinernen Brücke, über der Lenne. Von hier aus hätte Selve sowohl sein Wohnhaus in der Lüdenscheider Straße als auch seine Industrieanlagen in südlicher Richtung im Blick gehabt.
Selve selbst würde auf jeden Fall hochachtungsvoll gratulieren! Das Telegramm würde er bei seinem Sekretär unverzüglich in Auft rag geben, damit es rechtzeitig zugestellt würde. Daher beschloss er, seine Inspektionsrunde im Werk Schwarzenstein zu beginnen, wo er sein Büro hatte. Dann könnte das Telegramm am Montag ohne Verzögerung aufgegeben werden. Und er könnte seine Besichtigungen dann im Werk Lennestein fortsetzen, das sowieso in unmittelbarer Nähe lag. Im Anschluss würde er Linscheid und das Werk Hünengraben besuchen. Ob er am Montag noch eine Visite im Werdohler Stammwerk Bärenstein einlegen würde, könnte er sich am Abend überlegen. Wieder ließ er den Einspänner bereitmachen und machte sich wie geplant auf den Weg. Die frische Luft würde ihm guttun.
das Unternehmen Basse & Selve unter der Leitung von Gustav immer weiter expandierte und mehrere Werke in Altena sowie Werke in Lüdenscheid, Werdohl und Hemer hatte?
Als er abends in die Lüdenscheider Straße zurückkehrte, war er weitgehend zufrieden mit den Abläufen in seinen Fabriken. Kleinigkeiten waren immer zu verbessern, aber zumindest hatte er heute keine großen Fehler entdeckt. Nach dem Abendessen mit der Familie saß er in seinem Erker, in der Rechten eine Zigarre, in der Linken zur Feier des Sonnabends einen Cognac – und ließ die Woche und den Tag Revue passieren. Er dachte an Otto von Bismarck und die schmachvolle Abstimmung im Reichstag. Wieder schüttelte er den Kopf. Man sollte ein Zeichen setzen.
Draußen dunkelte es, der Lichtkegel der Gaslaterne war weit entfernt. Doch Selve kannte die Aussicht. Den schmalen Streifen Land auf der anderen Straßenseite, bevor das Gelände steil zur Lenne abfiel. Das wäre der perfekte Platz! Zumal er das Ganze stets im Blick hätte. Lächelnd lehnte er sich zurück und zog genüsslich an seiner Zigarre. Genau dort würde er ein Bismarck-Denkmal bauen lassen. Schon am Montag würde er die entsprechenden Vorbereitungen treffen. Das wäre ja noch schöner, wenn dieser Mann nicht geehrt würde. Wenn nicht in Berlin, dann eben in Altena in Westfalen.
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Gustav Selve. Dennoch ist er hier eine Kunstfigur. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen aller Figuren fiktiv.
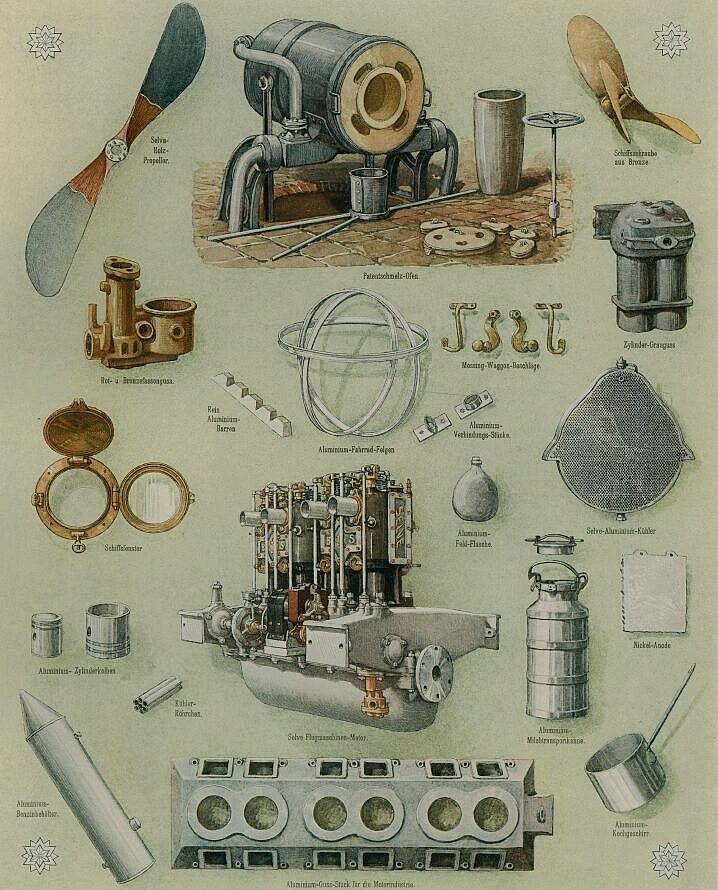
Carl Berg ist bereits erfolgreicher Unternehmer in Lüdenscheid, als er Aluminium für sich entdeckt und beginnt, Produkte aus eigenen Aluminiumlegierungen herzustellen. Er entwickelt daraus zum Beispiel Feldbesteck und -geschirr für das Militär. Als ihn 1892 David Schwarz anspricht, ein technischer Autodidakt, der ein Luft schiff aus Aluminium bauen möchte, ist Berg Feuer und Flamme. Fasziniert von der Idee und dem Traum vom Fliegen, investiert er über Jahre sehr viel Geld in ein gemeinsames Unternehmen – das, was man heute Risikokapital nennen würde. Und darüber hinaus den Grips seiner Ingenieure.
Carl Berg ließ die Taschenuhr aufschnappen. Melanie Schwarz verspätete sich. Vielleicht lag es in der Familie. Auch ihr Ehemann, David Schwarz, hatte ihn häufig warten lassen. Schwarz, dessen geniale Idee eines starren, lenkbaren Luft schiff s ihre Zusammenarbeit begründet hatte. Doch er schalt sich ob seiner Kleinlichkeit. Madame Schwarz‘ Lage war traurig und prekär genug. Berg klappte die Taschenuhr zu und bestellte einen weiteren Verlängerten. Der dünne Kaffee würde ihm die Wartezeit vertreiben.
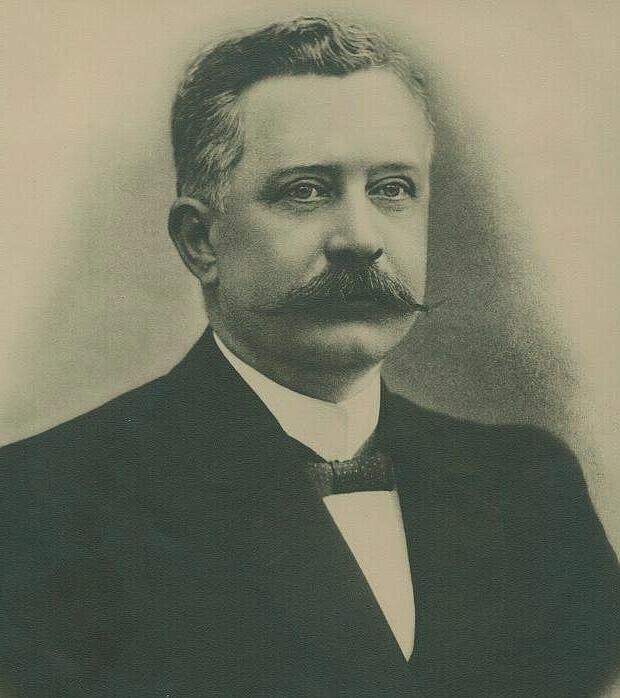
Seit ihrem ersten Kooperationsvertrag im Sommer 1892 hatten seine Ingenieure Schwarz‘ ursprünglichen Entwurf eines starren Luft schiff s aus Aluminium jahrelang überarbeitet. Sie hatten kontinuierlich entscheidende Konstruktionsarbeit geleistet und an der Flugfähigkeit des Geräts gearbeitet. Mit den aus Carl Bergs Fabrik gelieferten Bauteilen aus Aluminium hatte Schwarz dann Anfang 1896 in Berlin endlich begonnen, sein zweites starres Luftschiff bauen lassen. Dabei war es allerdings – auch wegen gesundheitlicher Probleme des Luft schiffbauers – immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Sein erstes Modell war angeblich in St. Petersburg bereits in der Luft gewesen.
Carl ein Pionier der Aluminium-Verarbeitung war und seine Werke in Lüdenscheid und Werdohl-Eveking zum ersten Zentrum dieser Industrie machte?
Berg
Dass Schwarz ihn hinsichtlich des Baus seines ersten Luft schiff s für das russische Militär ganz offensichtlich belogen hatte, dass sein dortiger Flugversuch gescheitert war und er hatte fliehen müssen, hatte Bergs Vertrauen dann bis in die Grundfesten erschüttert. Erst vergangenen Sommer, während sich die Vorbereitungen für den Flugversuch ihres gemeinsamen Projekts immer weiter verzögerten, hatte er davon erfahren. Nach vierjähriger Zusammenarbeit und enorm hohen Investitionen seinerseits.
Eben diese Investitionen bewegten Berg, weiterzumachen. Denn das Geld und auch die Arbeit seiner Ingenieure vollständig zu verlieren, kam für ihn nicht in Betracht. Im September hatten Schwarz und er das Luft schiff dann gemeinsam in Berlin Tempelhof inspiziert und den Start für den 9 Oktober 1896 festgelegt. Schließlich brauchten sie den Beweis, dass das Luft schiff flog, um sich die Erfindung und Umsetzung patentieren zu lassen. Zwar sahen er und seine Ingenieure noch einige Mängel, aber Schwarz ließ sich in manchen Punkten nicht von Änderungen überzeugen.
Als dann die Konstruktion auf dem Tempelhofer Feld für den Flug vorbereitet werden sollte, waren neue Probleme aufgetreten. Der erste Versuch, den Hohlkörper mit Wasserstoff zu füllen, misslang. Beim zweiten Versuch war der Druck bei der Befüllung zu stark erhöht worden und die Aluminiumbespannung zerriss. Ein herber Rückschlag. Für Schwarz ebenso wie für Berg, der in Lüdenscheid geweilt hatte.
Sicher war das Gas nicht von bester Qualität gewesen und sicher musste man den Druck während der Gaszufuhr optimieren. Doch auch bei der Bespannung des Hohlkörpers galt es nachzubessern. Bergs Ingenieure arbeiteten bereits daran. Der neue Flugversuch hätte gleich nach der witterungsbedingten Winterpause stattfinden sollen.
In Gedanken versunken nippte Berg an seinem Kaffee. Sonst stets sachlicher Geschäft smann konnte er dem Vertrauensverlust und dem Misserfolg zum Trotz vom Traum des Fliegens nicht lassen. Schwarz‘ Idee war lange Zeit sein Vehikel gewesen. So mancher Lüdenscheider nannte ihn hinter vorgehaltener Hand Ikarus. Sei ’s drum. Er würde nicht abstürzen, denn er glaubte fest an Luft schiffe – und daran, dass sie seinem Vaterland noch sehr viel nützen könnten. Seit dem Sommer war er außer mit Schwarz auch mit einem weiteren Luft schiff-Pionier in Kontakt: Ferdinand Graf von Zeppelin, zu dessen Unterstützung zum Jahreswechsel immerhin der Verein Deutscher Ingenieure aufgerufen hatte.
Carl ein Pionier der Aluminium-Verarbeitung war und seine Werke in Lüdenscheid und Werdohl-Eveking zum ersten Zentrum dieser Industrie machte?
Dass Schwarz hier in Wien vor einer guten Woche so unerwartet verstorben war, warf das gemeinsame Unternehmen ein weiteres Mal zurück. Die Verbesserung der Konstruktion war so gut wie abgeschlossen, doch wie es mit dem Bau des Luft schiffes weitergehen sollte, war noch nicht klar. Dass seine Witwe ihn so schnell um eine Unterredung bat, hatte Berg überrascht. Doch letztlich begrüßte er den frühen Zeitpunkt, denn er musste sie über das weitere Vorgehen informieren.
Berg ließ die Taschenuhr in der Linken wieder aufschnappen, schaute aufs Ziffernblatt und rieb sich mit der Rechten die Augen. In diesem Moment trat Melanie Schwarz durch die Drehtür ins Foyer, ganz in Schwarz, mit Trauerschleier am Hut.
Er ging ihr entgegen, verbeugte sich zum Handkuss. „Meine Verehrung, gnädige Frau, und mein tief empfundenes Beileid“, begrüßte er sie. „Kommen Sie, und nehmen Sie Platz.“ Er geleitete sie zum Tisch. „Danke, mein lieber Herr Berg“, erwiderte sie und lüftete den Schleier, ihre Augen waren leicht gerötet. „Und ebenfalls vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Es gibt Wichtiges zu besprechen.“
Carl mit Graf von Zeppelin kooperierte, aber auch um die Leitung der gemeinsamen Unternehmungen konkurrierte?
Berg gab dem Kellner ein Zeichen, der umgehend am Tisch erschien. „Sie nehmen sicher einen Kaffee und ein Stück Torte?“ Sie nickte und sagte: „Ein Einspänner und eine Sacher, bitte.“ Ihrer Wahl schloss er sich gerne an. Denn den starken Kaffee mit Sahnehaube – Obers, wie man hier sagte – erhielt man in den Lüdenscheider Kaffeehäusern nicht.
„Liebe Madame Schwarz, in dieser unerwarteten Situation möchte ich Sie meines Beistands versichern“, begann er. „Selbstverständlich kann die Familie Schwarz weiterhin auf meine Unterstützung zählen.“ Melanie Schwarz nickte. „Das hilft uns sehr“, sagte sie. „Wichtig ist jetzt jedoch auch, dass die Vorbereitungen für einen weiteren Flugversuch unternommen werden. Ohne ihn erhalten wir das Patent niemals. Wie geht es denn mit den Arbeiten an der Bespannungskonstruktion voran?“ Der Kellner servierte ihnen ihre Gedecke. Berg überspielte seine Überraschung, dass sie die Details so gut kannte, indem er vorsichtig am Einspänner nippte. „Sehr gut geht es voran“, antwortete er dann. „Die verbesserte Konstruktion können wir bereits im Februar vorlegen. Im Anschluss beginnen wir, die neuen Bauteile herzustellen.“ Melanie Schwarz nickte.
„Ich habe bereits die Facharbeiter meines verstorbenen Mannes kontaktiert, mit denen er sehr verbunden war. Sie verstehen?“, sagte sie. „Ich musste sie ja über den Tod meines Mannes in Kenntnis setzen. Alle stehen unseren Unternehmungen weiterhin zur Seite.“
Insgeheim zollte er Madame Schwarz Respekt, er hatte sie unterschätzt. Es war immer Schwarz‘ Aufgabe gewesen, die Arbeiter für den Bau des Luft schiff s in Berlin einzustellen. Sie nach seinem Ableben quasi persönlich anzusprechen, würde die erfahrenen Männer dem Luft schiff bau nicht nur als Arbeitskräfte für den erneuten Flugversuch zurückbringen, sondern auch ihre Loyalität fördern.
„Das sind wahrlich gute Nachrichten in diesen traurigen Tagen“, bestätigte Berg. „Dann kann der Bau des Luft schiff s ja sehr bald beginnen.“ Melanie Schwarz nickte erneut, während sie weiter von der Torte naschte. „Ja“, sagte sie. „die Arbeiter müssen nur wissen, wann die Bauteile geliefert werden.“ „Einen genauen Termin kann ich Ihnen nennen, sobald die Teile gefertigt sind. Wie Sie sicher wissen, setzen wir alle Teile zur Probe zusammen. So können wir garantieren, dass unsere Lieferung vollständig per Eisenbahn auf die Reise nach Berlin geht.“
Melanie Schwarz‘ Situation war klar: Sie musste sicherstellen, dass das Erbe ihres Mannes die Familie weiterhin ernährte – auch wenn es zunächst weiterhin Bergs Kapital war, das dafür aufkam. So vereinbarten die beiden, während sie Kaffee und Torte verspeisten, weitere Einspänner und Verlängerte bestellten, dass nach dem Gelingen des Aufstiegs der Ertrag aus dem Verkauf der Luft schiffe bzw. aus sonstiger Verwertung zwischen ihnen geteilt würde – nach Rückerstattung von Bergs Auslagen.

„Ich danke Ihnen nochmals“, verabschiedete sich Melanie Schwarz schließlich. „Ich sehe Sie beim Begräbnis?“ „Gewiss, meine liebe Madame Schwarz“, sagte Berg. „Unsere Vereinbarung geht Ihnen in den nächsten Tagen schriftlich zu. Meine Hochachtung.“ Wieder verbeugte er sich zum Handkuss. Sie nickte ein letztes Mal, lächelte und verschwand durch die Drehtür. Er sah ihr nach und wandte sich dann an den Portier. „Ein Telegramm nach Lüdenscheid, bitte.“
Wie gut der aus Zagreb stammende David Schwarz in Wien vernetzt gewesen war, zeigte sich zwei Tage später beim Trauerzug. Die Stadt Wien hatte ihm ein Ehrenbegräbnis ausgerichtet, das Carl Berg in Erstaunen versetzte. Mit Pomp und unter großer Anteilnahme wurde Schwarz auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Berg drückte Familie Schwarz – der Witwe und ihren drei Kindern – erneut sein Beileid aus und bereitete anschließend seine Abreise vor.
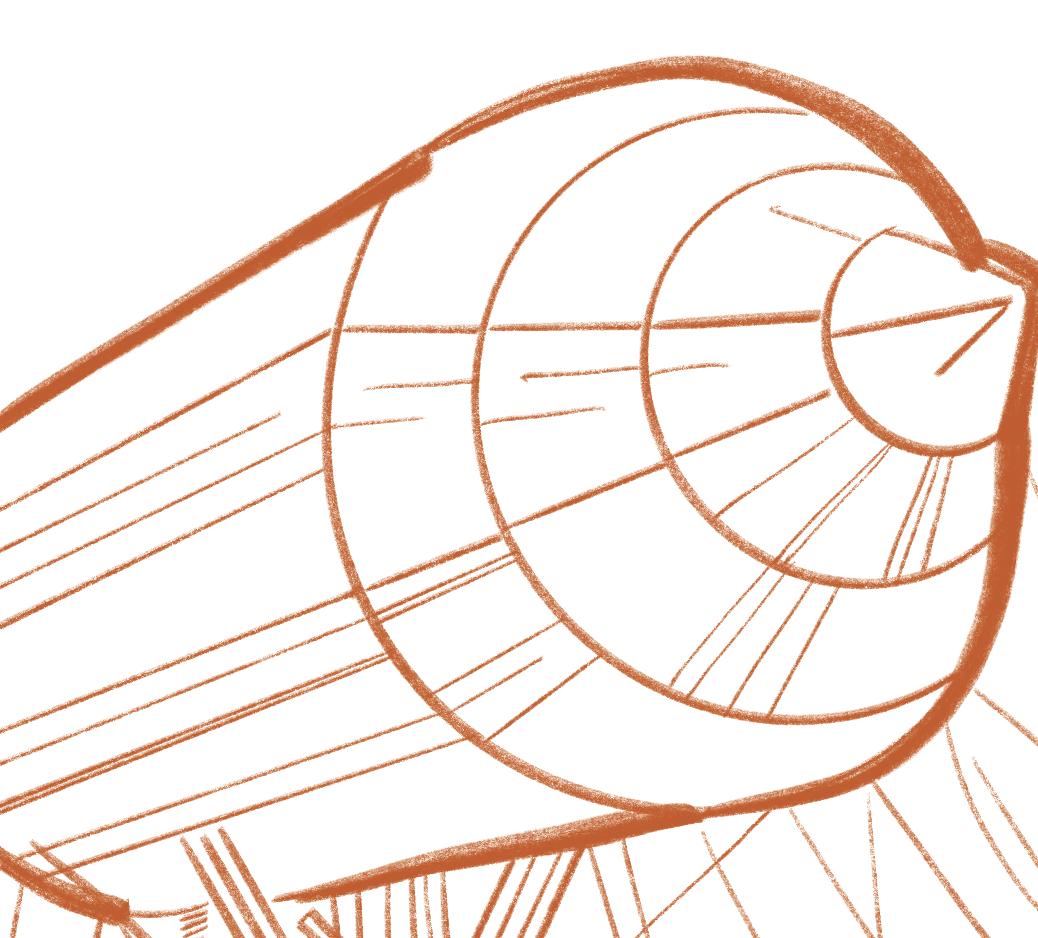


Zurück in Lüdenscheid setzte er sich mit seinen Ingenieuren in Verbindung, um sich nach dem Stand der überarbeiteten Konstruktion zu erkundigen. Alles lief bestens und nach einem Gespräch mit seinem Justiziar konnte auch der Vertrag an Melanie Schwarz verschickt werden. Die weilte inzwischen bereits in Berlin, um sich um die Vorbereitungen in Tempelhof zu kümmern. Die Chemischen Fabriken hatten ausgerechnet an Schwarz‘ Todestag angekündigt, einwandfreies Gas liefern zu können.
Weder Carl Berg noch Melanie Schwarz hätten erwartet, dass der neue Flugversuch noch ein dreiviertel Jahr auf sich warten lassen würde. Denn nachdem alle technischen Hürden ausgeräumt waren, zeigte sich eine weitere Herausforderung: Niemand schien wagemutig genug, das Luft schiff zu steuern. Den Part des Piloten hatte selbstverständlich Schwarz übernehmen wollen. Schließlich fand sich doch noch ein ehemaliger Unteroffizier der Luftschifferabteilung des Militärs. Ernst Jagels wollte den Flugversuch gegen entsprechende Vergütung am 3. November 1897 unternehmen.
An jenem Tag sah zunächst alles nach einem durchschlagenden Erfolg aus. Das Aluminiumluft schiff stieg auf, Jagels startete den Motor: Elegant steuerte er es eine Runde über das Tempelhofer Feld. Doch dann löste sich ein Riemen, das Luft schiff war nicht mehr lenkbar. In Panik ließ der Fahrer den Großteil des Gases ab.
Zunächst schien das Luft schiff flexibel genug, eine Bruchlandung abzufangen. Doch dann sprang Jagels ab, die Konstruktion wurde vom Wind erfasst und letztlich schwer beschädigt.
Am Rand des Tempelhofer Feldes hatte der Beobachter Ferdinand Graf von Zeppelin das Schauspiel gebannt verfolgt, die Werkstatt durfte er als Konkurrent natürlich nicht betreten. Schließlich verfolgte er seit Jahrzehnten eigene Ideen für den Bau eines starren, lenkbaren Luft schiffes. Melanie Schwarz jedoch sandte dem abwesenden Carl Berg noch am selben Tag ein optimistisches Telegramm nach Lüdenscheid. Immerhin hatten sie bewiesen, dass ihr gemeinsames Projekt geglückt war: Das Luft schiff konnte mit Gas befüllt werden, es war geflogen und es hatte sich steuern lassen.
Graf von Zeppelin Carls Unternehmen über seinen Tod hinaus lange verbunden blieb? Carls Schwiegersohn Alfred Colsman wurde 1908 zum Geschäft sführer der Zeppelin-Luft schiff bau GmbH und baute Zeppelins Unternehmen bis 1929 zu einem weitverzweigten Konzern aus.
Doch diese Einschätzung teilten außer Berg – inzwischen zum Kommerzienrat avanciert – und Familie Schwarz wenige. Zumindest niemand, der seinen Einfluss hätte geltend machen können. Und so fehlte die Unterstützung seitens des Kaisers ebenso wie die seitens des Militärs. Versuche, ein weiteres Luft schiff über Banken oder Industrielle finanziert zu bekommen, scheiterten. Letztlich war auch Berg nach den hohen Auslagen von mehr 200.000 Mark nicht mehr bereit, weitere Gelder zu investieren. Und so wurde das Unternehmen beendet, die Trümmer des Luft schiff s nach Eveking bei Lüdenscheid transportiert und eingeschmolzen.
Doch bald zeigte sich eine neue Perspektive für Berg wie für die Schwarz-Erben: Mitte 1898 schloss sich Carl Berg mit Ferdinand Graf von Zeppelin zusammen, der seit den 1870er Jahren die Entwicklung eines starren Luft schiffes verfolgt hatte. Der Graf stellte jedoch die Bedingung, dass die rechtlichen Verhältnisse zwischen Carl Berg und Schwarz‘ Erben geklärt sein müssten. Dies bedeutete im Vorfeld langwierige Verhandlungen mit Melanie Schwarz und den Anwälten ihrer Kinder, doch schließlich kam man zu einer Einigung.
Die Schwarz‘ erhielten eine Entschädigung und sollten an künftig verkauften Luft schiffen beteiligt werden, dafür durften die Erfahrungen aus den früheren Konstruktionen in die Entwicklung einfließen. Ferdinand Graf von Zeppelin und wiederum die Carl Berg OHG als Hauptinvestoren sowie weitere Geldgeber gründeten in Stuttgart die Aktiengesellschaft zur Förderung der Luft schiffahrt mit einem Grundkapital von 800.000 Mark. Carl Bergs Ingenieure begannen sogleich mit der Überarbeitung und Verbesserung des ersten Luftschiff s Zeppelin (LZ).
Die Bauteile wurden ab 1898 im Werk Eveking hergestellt, die Montage von Zeppelins Luft schiffen sollte künftig in einer neuen Halle in Lüdenscheid erfolgen. Im Juni und Oktober 1900 unternahm das LZ-1 drei erfolgreiche Fahrversuche über dem Bodensee. Doch dann ging der Gesellschaft das Geld aus, sie wurde im November desselben Jahres aufgelöst. Damit verloren nicht nur Graf Zeppelin und Carl Berg ihre Einlagen, sondern auch die Schwarz-Erben jegliche Hoff nungen und Ansprüche auf mögliche Gewinne.
Mehrere Jahre konnten sich Graf von Zeppelin und Berg nicht über ein mögliches weiteres Vorgehen einigen. Erst Anfang 1904 kamen sie wieder ins Geschäft . Den Höhenflug der Luft schiffe Zeppelin, der trotz weiterer Rückschläge schließlich einsetzte, und die große Popularität des Grafen, der bis heute zum Inbegriff der Luft schiff fahrt wurde, erlebte Carl Berg nicht mehr. Er verstarb 1906. Doch Bergs Schwiegersohn, Dr. h.c. Alfred Colsman wurde Geschäft sführer der 1908 von Graf Zeppelin gegründeten Luft schiff bau Zeppelin Gesellschaft mit beschränkter Haftung und leitete das Unternehmen bis 1929. Ab 1906 kamen auch andere AluminiumLieferanten zum Zug, doch der Graf arbeitete bis 1915 mit der Carl Berg OHG zusammen.
Zu Zeiten Carl Bergs war die Industrialisierung in Lüdenscheid und den umgebenden Tälern in vollem Gange. Der Schwerpunkt der Industrie lag noch auf der Metallverarbeitung, die sich aus den Schmieden früherer Jahrhunderte entwickelt hatte. Ursprünglich hatten die Schmieden das in den Tälern gewonnene Eisen verarbeitet. Nach mehreren Stadtbränden verbannte man sie im 17. Jahrhundert vor die Stadtmauern.
Durch neue Verarbeitungsmethoden mit Stanzen und Pressen blieb Lüdenscheid der Metallverarbeitung dennoch treu. Es wurde zum Zentrum der Knopf-, Schnallenund Ordenherstellung. Carl Berg etablierte in Lüdenscheid und Umgebung zudem die Aluminiumverarbeitung. Nach der Entwicklung des ersten vollsynthetischen Kunststoff s Bakelit® im Jahr 1905 entstand in der Region Kierspe – Lüdenscheid –Schalksmühle außerdem ein Schwerpunkt der Kunststoffindustrie.
Übrigens: Zu jener Zeit gab es auch in Lüdenscheid mehrere Kaffeehäuser. Eines davon existiert bis heute: Das Kaffeehaus Weßling in der Hochstraße 1A.

Graf Engelbert in der Lüdenscheider Altstadt

Wenn du durch Lüdenscheid schlenderst, findest du noch Zeugnisse aus der Zeit, in der Carl Berg alles daran setzte, Luft schiffe zum Fliegen zu bringen. Hier einige Beispiele
Geschichtsmuseum der Stadt Lüdenscheid
Hinweis
Homertturm (539 m Höhe)
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Carl Berg und einiger Zeitgenossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figuren fiktiv.
Wer selbst aus eher ärmlichen Verhältnissen stammt, erkennt früh, wo Menschen in Not sind. Friedrich Deisting kam als junger Arzt direkt nach seinem Studium in Berlin 1880 nach Kierspe und eröff nete eine Praxis. Jahrelang pflegte der Doktor dort selbst einen sehr bescheidenen Lebensstil. Denn die Ärmsten zu behandeln und zu heilen war ihm wichtiger, als angemessene Rechnungen zu stellen.
Dabei wurde ihm immer klarer, dass seine Unterstützung nicht mehr war, als ein Tropfen auf den heißen Stein. Grundsätzliche Änderungen der Verhältnisse waren nötig, um der zumeist bäuerlichen Bevölkerung zu helfen. 1900 beteiligte er sich daher maßgeblich an den Vorbereitungen zur Gründung der ersten bäuerlichen Genossenschaft in Kierspe. So könnte es sich zugetragen haben.
Erschöpft schloss Dr. Friedrich Deisting die Tür seiner Praxis hinter dem letzten Patienten ab. Er zog seine Taschenuhr heraus. Sieben. Hohe Zeit für das Abendessen, Anna und Friederike würden schon warten. Wie gut, dass er einen wahren Rossmagen hatte. Nicht wegen Annas Kochkünsten natürlich. Denn angesichts der offenen Beine von Hertha Klugmann und der Arbeit mit den Blutegeln wäre einer empfindsameren Seele sicher der Appetit vergangen. Er zog sein Jackett aus, goss Wasser in die Waschschüssel, krempelte die Hemdsärmel hoch und begann, sich gründlich Hände und Unterarme einzuseifen und zu schrubben. Dann spülte er sie einzeln mit klarem Wasser aus dem Krug ab, schüttelte sie trocken und strich anschließend mit den Händen durchs Gesicht. Das tat gut. Er griff nach einem Handtuch.
Zwar hatten Hertha Klugmanns Beine heute schon etwas besser ausgesehen als noch vor einigen Tagen, doch der Heilungsprozess verlief zäh. Er hatte die Bäuerin in Verdacht, sich nicht an die verordnete Bettruhe zu halten. Dass sie den ganzen Tag auf den Beinen war, um den Haushalt am Laufen zu halten. Er dachte an seine eigene Mutter, die ebenfalls 10 Kinder und einen Mann zu umsorgen gehabt hatte. In solch einem Haushalt war viel Arbeit zu leisten. Hertha ging darüber hinaus bestimmt noch mit auf die Felder, denn die Ernte war in vollem Gange. Deisting seufzte und schüttelte den Kopf. Er hoffte, dass sie seine erneuerte Mahnung ernst nahm. Wurde das Leiden erst einmal chronisch, gab es keine Heilungschancen mehr.
1900
Deisting bereitet die Gründung der ersten bäuerlichen Genossenschaft in Kierspe vor
Erst jetzt bemerkte er, dass er von der letzten Behandlung einige Blutspritzer auf dem Hemd hatte. Anna würde es waschen müssen, es reichte nicht, nur den Kragen zu wechseln. Deisting warf noch einen prüfenden Blick durch die Praxis, dann öff nete er die Durchgangstür zur Wohnung, wo seine Familie ihn bereits erwartete. „Gut, dass du kommst“, empfing Anna ihn. „Der Kohl in der Suppe wurde schon weich, ich musste sie vom Feuer nehmen.“ Sie schob einen Topf sogleich in die Mitte des gusseiserenen Herds zurück. Friederike deckte den Tisch. „Verzeiht die Verspätung“, antwortete Deisting. „Die Behandlung von Hertha Klugmanns Bein braucht einfach Zeit.“ Anna nickte verständnisvoll. „Ich weiß, ich weiß“, sagte sie. „Konnten Sie denn ihre Rechnung zahlen?“
Deisting schüttelte den Kopf. „Nur einen Abschlag“, sagte er. „Aber sie haben einen Sack Kartoffeln mitgebracht.“ Anna füllte am Herd einen ersten, dann einen zweiten Teller mit der Kohlsuppe und brachte sie ihrem Mann und ihrer Tochter, die inzwischen das Brot schnitt. Dann nahm sie sich selbst und setze sich zu ihnen. Sie sprachen ein kurzes Gebet und aßen dann, bis der erste Hunger gestillt war. „Kann das immer so weitergehen?“, fragte Anna. Der Doktor tunkte ein Stück Brot in die Suppe und biss davon ab. Kauend wiegte er den Kopf. „Ich weiß es nicht“, antwortete er dann. „Wir leben sehr sparsam“, sagte seine Frau. „Aber selbst wir brauchen etwas Geld.“ Sie deutete auf sein Hemd. „Für Soda und Seife zum Beispiel.“
„Ich weiß, aber die Menschen sind arm und es ist meine Pflicht, zu helfen“, sprach er. „Die kleinen Höfe ernähren sie nun mal nicht. Und dann unterbieten sie sich noch gegenseitig in den Preisen.“ Er schüttelte den Kopf. Seit vielen Jahren beobachtete er dieses Phänomen, sah, dass die Landwirte keine Chance hatten, ihre Lage zu verbessern. Zudem war Unterernährung keine gute Voraussetzung für blühende Gesundheit. Arztbesuche wiederum konnte kaum jemand bezahlen. „Man kann nur hoffen, dass die nächste Ernte gut wird.“ Anna nickte. „Ja, aber selbst wenn, bedeutet das keine langfristige Besserung. Die Situation müsste sich grundsätzlich verändern“, sagte sie. „Was meinst du damit?“, fragte er. „Ich weiß es nicht genau“, antwortete sie. „Aber mit so kleinen Stücken Land schafft es keiner für sich allein.“ Friederike nickte.
Nach dem Abendessen räumten die Frauen noch die Küche auf und setzte sich dann mit ihrem Nähzeug zu Deisting, der in der Zeitung las. Immer wieder senkte Deisting das Blatt, berichtete den beiden von Vorkommnissen in der Welt oder der näheren Umgebung. „Hört euch das an“, sagte er. „In Hamburg haben sie Anfang des Jahres schon eine Genossenschaft gegründet. Konsum-, Bau- und Sparverein „Produktion“ nennt sie sich. Das ist ja äußerst interessant!“ „Und was macht diese Genossenschaft?“, fragte Anna. „Ich nehme an, sie sammelt Kapital um günstig Waren einzukaufen und den Bau von Häusern oder Wohnungen zu ermöglichen“, erklärte Deisting. „Jeder, der einzahlt, hat Anspruch auf vergünstigte Waren oder auf eine spätere Geldzuteilung. Wir müssen in Kierspe auch endlich in diese Richtung gehen.“ Anna nickte. „Ja, das glaube ich auch“, sagte sie. Dann kamen sie wieder auf die Patienten zu sprechen. Es gab mehrere heikle Fälle im Ort und für Deisting standen am nächsten Tag nach der Sprechstunde einige Hausbesuche an.
Wie gewohnt öff nete Deisting am nächsten Morgen die Praxis. Es war erst Sieben, doch die Leute saßen bereits auf der Wartebank, weitere standen in einer Schlange. Er fragte nach besonders dringlichen Fällen. Ein Bauer mit schmerzverzerrtem Blick hob seine Linke, die in einem blutigen Tuch steckte. „Ich habe mir einen Finger abgeschlagen“, sagte er. „Heute Morgen?“, fragte Deisting, während er auf ihn zu ging, und als der Bauer nickte: „Haben Sie den Finger dabei?“Der Bauer nickte wieder, zeigte ihm ein in Leinen gehülltes Päckchen in der Rechten. Deisting, nachdem er den Wartenden gesagt hatte, es könne etwas länger dauern, geleitete ihn in die Praxis zu einem Stuhl. „Wir kennen uns noch nicht“, sagte er. „Wie heißen Sie?“ „Fuchs, Eberhardt Fuchs aus Isenburg“, antwortete der Landwirt.
Friedrich im April 1900 maßgeblich an der Gründung der Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft in Kierspe beteiligt war?
„Also, Herr Fuchs, wir müssen jetzt schnell handeln, um Ihren Finger zu retten. Halten Sie den Arm senkrecht in die Höhe!“, ordnete er an und rief durch die Zwischentür. „Anna. Operation!“ Er griff nach seiner frisch gewaschenen Schürze und ging zum Bauern, der ihn mit verschrecktem Blick ansah. „Operation? Wieso Operation?“, fragte Fuchs ängstlich. „Ich brauche einen Verband.“ „Und ihren Finger brauchen Sie nicht?“, fragte Deisting. Der Bauer schaute ihn verstört an. „Doch natürlich, aber …“, sagte er. „Na, dann probieren wir, ihn wieder anzunähen“, unterbrach ihn der Arzt und bedeutete ihm, sich auf die Liege zu legen.
Anna war hereingekommen, ebenfalls mit einer weißen Schürze, Tüchern und einem Kessel kochend heißen Wassers. „Aber …“, der Bauer schaute den Doktor verzweifelt an. „Aber eine Operation kann ich nicht bezahlen.“ Deisting hatte den schmutzigen Hemdsärmel des Mannes hochgekrempelt und band ihm den Arm ab, um die Blutung zu stoppen.
„Machen Sie sich darüber erstmal keine Gedanken“, sagte er und klopfte dem Bauern auf die Schulter. „Aber …“, sagte der Bauer. „Aber ich muss auf dem Hof 10 Mäuler stopfen.“ „Das habe ich mir gedacht“, sagte Deisting. „Genau deswegen sollten Sie Ihren linken Zeigefinger wieder nutzen können. Sind sie einverstanden, dass ich Sie jetzt ein wenig ruhigstelle? Die Operation ist schmerzhaft .“ Schließlich lenkte Fuchs ein und Deisting hielt ihm ein in Äther getränktes Tuch vor die Nase.
Während der Operation arbeiteten Anna und er routiniert zusammen. Sie reinigte die Wunde und den Finger und legte Nadel, Faden und Verbandszeug bereit. Er untersuchte den Stumpf und den Zeigefinger. „Sauberer Schnitt, umso besser“, murmelte er und begann, den Finger anzunähen. Nach der Operation verbargen sie den schlafenden Bauern hinter einem Paravent und Deisting rief die wartenden Patienten einen nach dem anderen hinein. Als Fuchs wieder aufwachte, war der Vormittag fast vorbei. Skeptisch betrachtete er den dick verbundenen Finger an der der linken Hand. „Und Sie meinen, er wächst wieder an?“, fragte er. Deisting nickte. „Aber Sie müssen ihn ruhig halten“, sagte er, band ihm ein Dreieckstuch um und legte den Arm in die Schlinge. „Wie kommen Sie zurück?“ „Mein Ältester wartet sicher schon.“ „Gut, wir sehen uns morgen früh wieder.“
Der Vormittag hatte es in sich gehabt. Nach der Fingerrettung hatte er sich noch um weitere Wunden, einen Erwachsenen mit Fieber und einen Fall von Gicht kümmern müssen. Der Gichtfall war ein gut situierter Herr, dem er strenge Diät verordnete. Der Mann bezahlte seine Rechnung und verließ beleidigt die Praxis. Vor dem Mittag blieb Deisting keine Zeit mehr für seine Fahrt zu den Bettlägerigen. Darum begab er sich zunächst an den Mittagstisch. „Kohlsuppe?“, fragte er, als er den Eintopf auf seinem Teller sah. Anna nickte. „Aber heute mit Kartoffeln“, sagte sie. „Der Gichtfall hat seine Rechnung gleich beglichen. Fürs Wochenende kannst du ein Stück Fleisch kaufen“, regte er an. Anna wiegte den Kopf. „Wir werden sehen“, antwortetet sie.
Friedrich Deisting wurde in Mölln geboren, als 9. von 10 Kindern. Ein Studium wäre unter normalen Umständen für ihn nicht möglich gewesen, doch sein Fleiß bescherte ihm einen Freiplatz, um Medizin in Berlin zu studieren. Als junger Arzt kam er 1880 mit seiner Frau Anna aus Berlin nach Kierspe und erö nete eine Praxis. Hier wurden ihm die existenziellen Nöte der zumeist bäuerlichen Bevölkerung schnell klar.








die Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenscha , die Molkerei und
Er unterstützte sie, indem er niedrige Rechnungen ausstellte, wodurch er und seine Frau selbst lange in bescheidenen Verhältnissen lebten. Sein Ziel war aber auch die langfristige Verbesserung der Verhältnisse. Daher gründete er über die Jahre, zum Teil gemeinsam mit anderen, die Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenscha , die Molkerei und den Bauverein. 1901 war er an der Gründung der örtlichen Spar- und Darlehenskasse beteiligt und 1907 wurde er selbst nebenbei Unternehmer, indem er die Elektrotechnische Fabrik Dr. Deisting & Co. erö nete. Lange war seine Firma das größte Unternehmen in Kierspe. Gegen Ende seines Lebens verfasste Dr. Deisting, inzwischen zum Sanitätsrat avanciert, ein Werk über die Geschichte Kierspes.


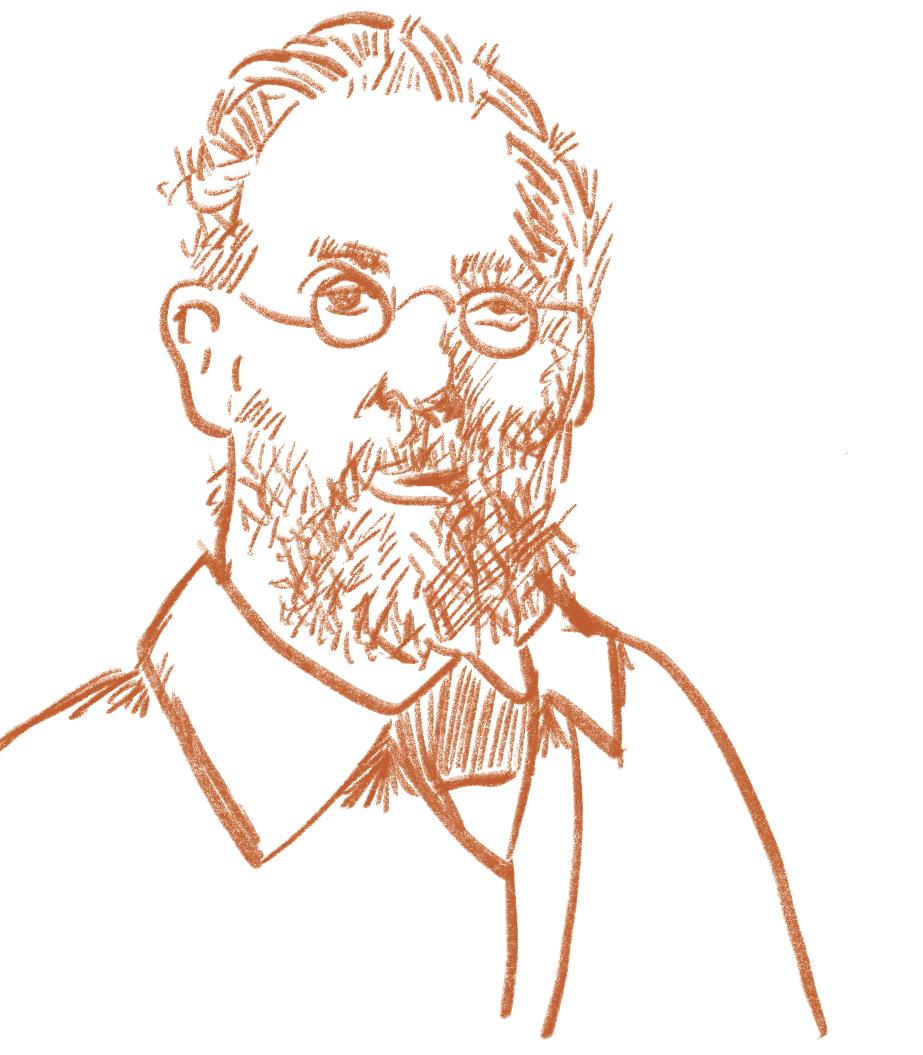
Am frühen Nachmittag stieg Deisting auf sein Pferd, band seine Arzttasche am Sattelknauf fest und ritt in Richtung Oberbremecke. Wegen heftiger Blutungen hatte er der schwangeren Gerlinde strikte Bettruhe verordnet. Jetzt wollte er sehen, wie es ihr ging, doch die Schwangere schien sich gut zu erholen. Eine Lungenentzündung erwartete ihn auf einem nahegelegenen Gut. Er untersuchte den 70 -jährigen Senior des Hauses mit dem Hörrohr. Sein Zustand hatte sich gegenüber seinem letzten Besuch offenbar verschlechtert. Er fragte nach den regelmäßigen Wadenwickeln, der frischen Luft zufuhr und den Inhalationen mit Kräutern, die er verordnet hatte.
Eigentlich gehörte der Mann in ein Krankenhaus, doch dies war eine ländliche Gegend. Es standen nur das Städtische Krankenhaus im mehr als 15 Kilometer entfernten Lüdenscheid oder das Krankenhaus im auch nicht viel näheren Gummersbach zur Auswahl. Beide waren eigentlich zu weit weg für einen Transport des geschwächten Mannes. Deisting teilte der Familie seine Überlegungen mit. Sie baten um seinen Rat. Guten Gewissens konnte er nur empfehlen, die Behandlung vor Ort konsequent fortzusetzen und dem Patienten leichte, stärkende Speisen zu verabreichen.
Nachdenklich ritt der Doktor zurück. Eine Lungenentzündung war eine tückische Krankheit, die sich nur schwer heilen ließ und oft mals tödlich endete –zumal bei älteren Herrschaften. Er hoffte inständig, dass der Senior dem Tod nochmal von der Schippe sprang. Nach seiner Rückkehr trank er mit seiner Frau einen Getreidekaffee, Friederike war noch in der Schule.
Friedrich sich 1901 für die Gründung der Spar- und Darlehenskasse einsetzte, die heute die Volksbank Kierspe ist?
Dann verbrachte er den Rest des Nachmittags in der Praxis. Es ging ruhiger zu als am Vormittag, sodass er pünktlich zum Abendessen erschien. „Du kommst zur rechten Zeit“, sagte Anna. „Die Suppe ist gerade fertig.“ „Kohlsuppe?“, fragte Deisting. Anna blickte kurz vom Topf hoch. „Nein“, sagte sie. „Kartoffelsuppe.“ Beide lächelten.
Beim Essen berichtete er Frau und Tochter von den Krankenbesuchen, seiner Sorge um den Senior mit der Lungenentzündung und seiner Freude, dass es der Schwangeren besser ging. Sie kamen auf Fuchs zu sprechen, den Bauern mit dem abgehackten Finger. Friederike fragte, wer das sei und Anna berichtete von der Operation am Morgen. „Meinst du, dass er anwächst?“, fragte Anna dann, an Deisting gewandt. „Es war eine glatte Wunde und wir haben schnell gehandelt“, antwortete er. „Ich glaube, er hat gute Chancen.“ „Schwierig, dass er so mitten in der Ernte ausfällt“, sagte sie. „Ja“, bestätigte er. „da wird die Familie ganz schön zu tun haben. Aber Ich hoffe trotzdem, dass er sich zurückhält und die Heilung nicht riskiert.“
Er erhob sich, um die Zeitung zu holen. „Gehst du heute nicht hinüber ins Pastorat?“, fragte Anna. „Doch, doch“, gab er zurück, schon ganz versunken in der Lektüre. „Eigentlich“, sagte er kurz darauf. „wäre Herr Fuchs doch ein klassischer Fall für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft .“ Seine Miene hatte sich aufgehellt. „Das müssen wir ihm morgen gleich mitteilen.“ Er legte die Zeitung weg. „Wahrscheinlich müssen wir ihm dabei helfen, aber sei’s drum.“ „Ich kann das tun“, sagte Friederike. Deisting sah sie lächelnd an. „Würdest du das machen? Das ist sehr liebenswürdig von dir“, sagte er. Und während auch Anna nickte, ergänzte er: „Meine Lieben, ich muss gehen. Die Herren erwarten mich sicherlich schon.“
Deisting war Mitglied der Gemeinde- und Amtsvertretung sowie der Kirchenvertretung in Kierspe. Er ging die 200 Meter bis zum Pastorat zu Fuß, es lag ein Stück von der Margarethenkirche entfernt neben dem Friedhof. Pastor Nierhoff lud die Herren der Kirchenvertretung regelmäßig zu Gesprächen ein. Dort wurden dringliche Themen der Kirchengemeinde besprochen, doch stets ging es der Herrenrunde auch um das Wohlergehen aller Gemeindemitglieder und der Stadt. Und immer wieder beratschlagten sie, wie sie die bäuerliche Bevölkerung unterstützen
wie könnten. Mit Sach- und Geldspenden natürlich, doch die halfen immer nur kurzfristig. Gleiches galt für seine eigenen großzügigen Nachlässe bei den ärztlichen Behandlungskosten.










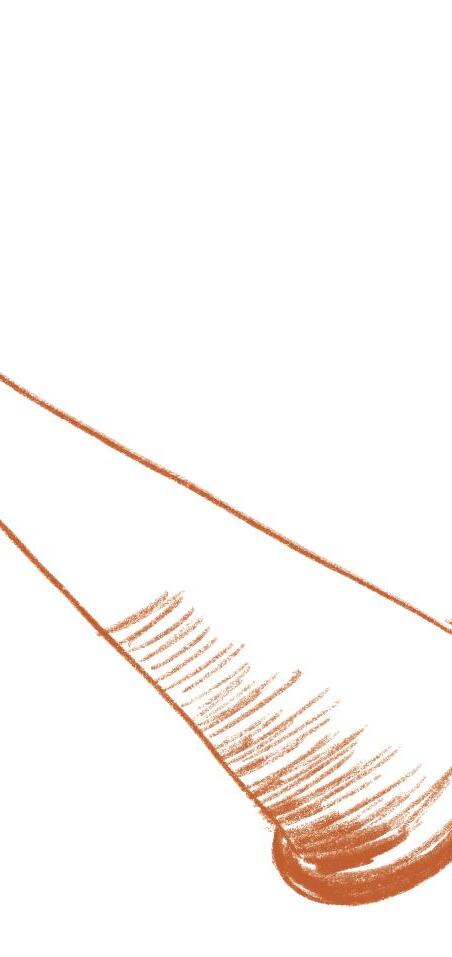
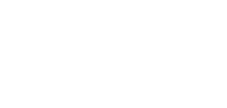


Der Doktor berichtete zum wiederholten Mal von seinen Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis. Davon, wie prekär die Verhältnisse der Bauern waren. Dass sie kaum Möglichkeiten hatten, Krankheiten auszukurieren. Sei es, weil sie mitarbeiten mussten, sei es, weil sie in ihren Behausungen keine Ruhe bekamen. Kaum jemand kam den Menschen und den schwierigen Verhältnissen, in denen sie lebten, so nah wie er. Darum brachte er die Rede erneut auf das Thema Genossenschaften. Nach seinem Empfinden war die Hilfe zur Selbsthilfe die einzige Möglichkeit, die Situation der Bauern langfristig zu verbessern.
Wusstest du schon, dass
Friedrich im Januar 1907 die Elektrotechnische Fabrik Dr. Deisting gründete, um vor Ort Arbeitsplätze für die verarmte Bauernschaft zu schaffen?
Es war das genossenschaftliche Prinzip, das ihnen im Zusammenschluss und in eigenverantwortlicher Selbstverwaltung Wege in bessere Verhältnisse ebnen würde. Der Pastor und auch Lehrer Schmidthausen waren der gleichen Ansicht. Die anderen Herren jedoch wägten ab, brachten Gegenargumente, waren unschlüssig. Deisting verwies nochmals darauf, dass sich Genossenschaften ja offenbar zu bewähren schienen, sonst wären in den letzten Jahrzehnten kaum so viele entstanden.
Nach langen Diskussionen schloss der Pastor die Versammlung und verabschiedete die Herren. Der Doktor ging zurück und betrat leise das Haus. Im Schlafzimmer drehte sich Anna zu ihm um, als er eintrat. „Wie war der Abend?“, fragte sie. „Konntest du sie von deinen Ideen überzeugen?“ „Es dauert alles so lange, es gibt noch immer Zweifler. Aber steter Tropfen höhlt den Stein“, antwortete er.
Tage und Wochen zogen ins Land. Auf den Feldern wurde weiter geerntet, auf manchen schon gesät. Hertha Klugmanns offene Beine heilten nicht gut, aber immerhin verschlimmerte sich das Ganze nicht. Eberhardt Fuchs war anfangs beinahe täglich in die Praxis gekommen, um seinen angenähten Finger begutachten, mit Jod bepinseln und neu verbinden zu lassen. Fuchs konnte es nicht fassen, dass er tatsächlich anzuwachsen schien.
Mittlerweile kam er seltener. Auch Deistings Hausbesuche zeigten erfreuliche Entwicklungen. Nach schweren Wochen kam der Patient mit der Lungenentzündung tatsächlich wieder etwas zu Kräften.
Der Kranke schob dies auf seine tägliche Ration Rinderbrühe. Auch Gerlinde, die schwangere Bäuerin, schien außer Gefahr. Deisting blieb jedoch vorsichtig und verordnete ihr weiterhin Bettruhe.
Im Pastorat hatten derweil mehrere abendliche Runden stattgefunden. Auch in der Gemeinde- und Amtsvertretung hatte Deisting seine Argumente vorgebracht. Die Herren in den verschiedenen Gremien waren sich inzwischen weitgehend einig, dass es eine Genossenschaft in Kierspe geben sollte und wo ihre Schwerpunkte liegen würden: Über eine Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft sollten die Bauern ihre Erzeugnisse verkaufen und gemeinsam vermarkten können sowie ihr Saatgut zu günstigen Konditionen bzw. auf Kredit kaufen können.

Und so konnte Deisting seiner Frau eines Abends, als er aus dem Pastorat zurückkehrte, verkünden: „Aus Sicht der Herren steht der Gründung unserer Genossenschaft nichts mehr im Wege. Endlich! Jetzt gilt es, die Bauern zu überzeugen, sich zu beteiligen.“ „Und wer wird sich darum kümmern?“, fragte Anna. „Diejenigen, die sie am besten kennen: der Pastor, der Lehrer und ich wahrscheinlich“, antwortete er. „Und ich hoffe sehr, dass sie sich schnell entscheiden. Je früher die Genossenschaft die Arbeit aufnimmt, desto besser.“ „Ich bin mir sicher, dass ihr drei ihnen ihre Vorteile bestens darlegt. Sie werden Feuer und Flamme sein!“, sagte Anna. „Danke für deine Zuversicht“, sagte er und löschte das Licht.
Geschickte Kommunikation
Am nächsten Morgen empfing er Fuchs als ersten Patienten. Der Bauer trug einen großen Sack in die Praxis. Er reichte ihn dem Arzt. „Vielen Dank, Herr Fuchs“, sagte Deisting. „Was haben wir denn da?“ Er löste den Bindfaden und schaute hinein. Darin lagen sechs oder sieben hellgrüne Kohlköpfe. „Unten sind auch Kartoffeln“, erklärte der Patient. „Vielen Dank“, wiederholte Deisting. „Meine Familie und ich freuen uns sehr. Doch lassen Sie uns ihren Finger ansehen. Wie macht er sich denn?“ „Bestens“, strahlte Fuchs und knickte den linken Zeigefinger ab. „Ich kann ihn sogar schon wieder bewegen!“ „Tatsächlich, ich gratuliere!“, schmunzelte Deisting, dem gerade eine Idee kam. Während er den Finger ein weiteres Mal reinigte, bepinselte und verband, begann er, Fuchs von dem genossenschaftlichen Gedanken zu berichten. Davon, dass die Bauern gemeinsam ihre Ernten vermarkten und günstiger einkaufen könnten.
„Was halten Sie davon?“, fragte er Fuchs schließlich. Der wiegte den Kopf. „Herr Doktor“, sagte er. „das klingt zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Was sind die Bedingungen?“ „Einen Haken gibt es eigentlich nicht“, sagte Deisting. „Jeder Bauer oder jeder Hof leistet einen kleinen Beitrag, die sogenannte Einlage.“ „Hmmm“, machte Fuchs. „Und wie soll das gehen? Wir kommen ja so schon kaum über die Runden.“ Deisting nickte verständnisvoll. „Ja, ich weiß“, sagte er. „Vielleicht denken Sie trotzdem einmal darüber nach. Alle beteiligten Bauern würden sich gegenseitig unterstützen. Einer für alle, alle für einen.“ Der Bauer versprach, sich Gedanken zu machen und Deisting kündigte an, dass die Bauern bald zu einer Versammlung eingeladen würden.
Der Doktor beglückwünschte sich zu seinem Geistesblitz. Er hatte gar nicht damit gerechnet, gleich auf Begeisterung zu stoßen. Doch so konnte er zumindest jene Bauern, mit denen er in seiner Praxis zu tun hatte, schon mal mit dem genossenschaftlichen Gedanken vertraut machen. Er rieb sich die Hände. Draußen auf der Bank hatte er Hertha Klugmann gesehen, wie immer in Begleitung ihres Mannes. Da waren ja schon die nächsten Kandidaten.
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Dr. Friedrich Deisting, seiner Frau Anna sowie weiterer Zeitgenossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren, ebenso wie die erfundenen Patienten und Patientinnen. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen aller Figuren fiktiv.
Eugen Schmalenbach aus Halver stellt die Weichen für seine Zukunft
1900. Das 20. Jahrhundert beginnt. Manche Menschen blicken ängstlich in die Zukunft. Viele neugierig. Einige sogar zuversichtlich. Zu letzteren gehört der aus Halver stammende Eugen Schmalenbach. Für ihn beginnt nach dem sehr guten Abschluss seines Studiums an der Handelshochschule Leipzig ein neuer Lebensabschnitt, in dem er sich – einzelnen Rückschlägen zum Trotz – Schritt für Schritt den Weg in eine erfolgreiche Zukunft ebnet.
Eugen Schmalenbach ließ die Hand mit dem Brief sinken. Mit der anderen nahm er den Kneifer von der Nase. Sein Vater war schon immer ein Freund klarer Worte gewesen. Auch in diesem Schreiben: Unmissverständlich brach er den Kontakt zu seinem Sohn ab. Schmalenbach wusste zwar, dass seine Eltern wenig erfreut gewesen waren, als er den väterlichen Betrieb vor zwei Jahren unvermittelt verließ, um in Leipzig an der ersten deutschen Handelshochschule zu studieren. Denn eigentlich war er als Nachfolger vorgesehen. Doch das hier war ein Schlag.
Nach dem sehr guten Abschluss seines Studiums hatte Schmalenbach vor kurzem angekündigt, definitiv nicht mehr in den Kleineisenbetrieb des Vaters zurückzukehren. Dennoch war er davon ausgegangen, dass sich Vater und Mutter über seinen aussichtsreichen Werdegang zumindest freuen würden. Zumal er sich gerade mit Marianne verlobt hatte. Doch dass die Schwiegertochter in spe jüdischen Glaubens war, stieß auf Ablehnung. Die Eltern zogen einen Schlussstrich, brachen den Kontakt zu Schmalenbach ab. Nachdenklich setzte er den Zwicker wieder auf und las den Brief erneut. Schmalenbach könne nicht mit weiterer Unterstützung der Familie rechnen, stand da.
Er nahm den Kneifer von der Nase, steckte ihn in die Brusttasche seines Jacketts und strich mit den Fingern über seinen Kinnbart. Den völligen Bruch bedauerte er. Er würde seinen Heimatort vermissen. Die Familienzusammenkünfte im kleinen sauerländischen Weiler bei Halver, durch dessen Tal sich der namensgebende Schmalenbach als Zufluss der Ennepe zog, und in dem er mit der Mutter und seinen Geschwistern bis zur Jugend gelebt hatte. Das Elternhaus mit dem großen Garten, in dem sich Vater und Mutter inzwischen nur noch selten aufhielten, seit die Fabrik im hessischen Butzbach war.
Um die Zuwendungen machte er sich allerdings weniger Sorgen. Ohne Frage war das Geld von zu Hause eine willkommene Stütze gewesen. Andererseits wurden seine Artikel seit der Veröffentlichung seines Aufsatzes Buchführung und Kalkulation im Fabrikgeschäft in der Deutschen Metall-IndustrieZeitung, dem Organ des Bergischen FabrikantenVereins zu Remscheid, gerne genommen. Er hatte also begonnen, in bescheidenem Umfang eigenes Geld zu verdienen. Erneut zog Schmalenbach den Zwicker hervor, las den Brief ein weiteres Mal.


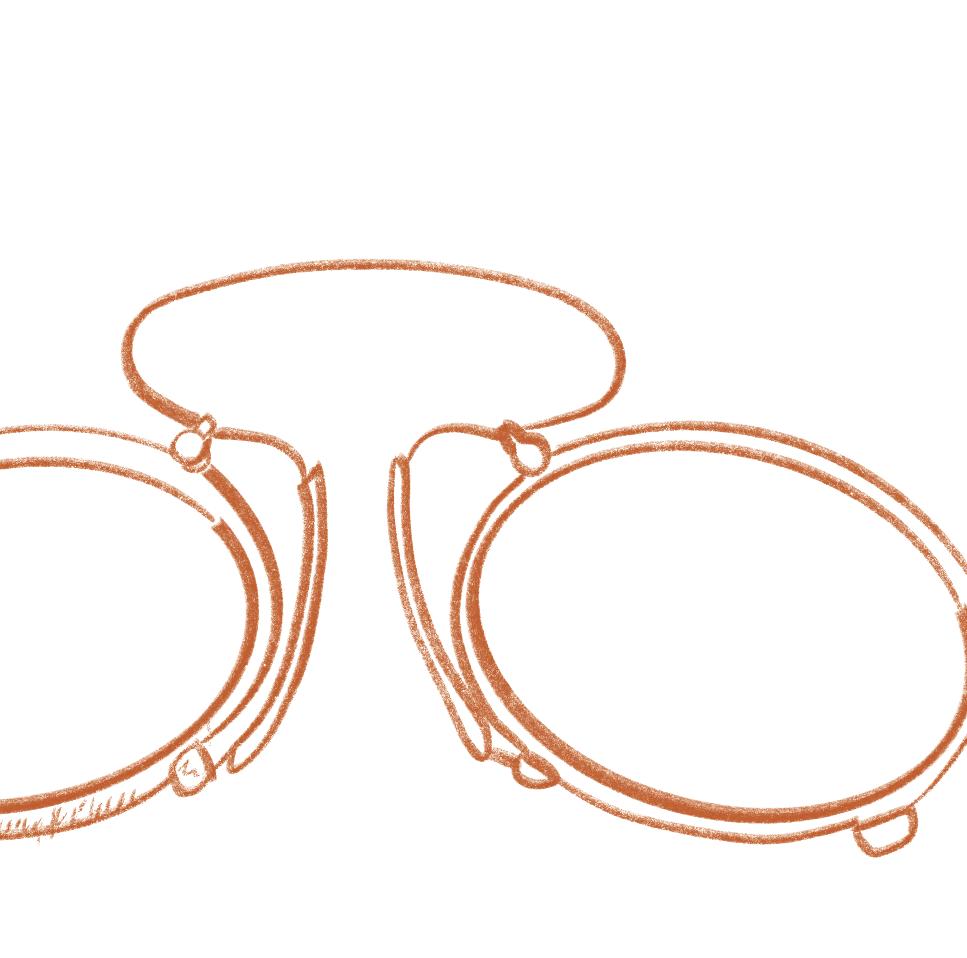
Im Grunde war es auch ein Freibrief, denn über seine Entscheidungen wäre er ab jetzt niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Und so würde ihn auch niemand mehr daran hindern, der Empfehlung seines Dozenten Prof. Dr. Karl Bücher zu folgen und sich an der Universität Leipzig für das Fach Nationalökonomie einzuschreiben.
Das zweite Studium und …
Kurze Zeit darauf nahm Schmalenbach tatsächlich das Studium der Nationalökonomie in Leipzig auf.
Sein Steckenpferd war zwar noch immer die effiziente Buchhaltung, Kalkulation und Organisation in Fabriken und Betrieben, doch auch in der Nationalökonomie gab es für ihn viel zu lernen. Das Studium eröff nete ihm die größeren Zusammenhänge. Das Geld war jedoch knapp, obwohl er sich immer mehr zu einem gefragten Autor mauserte und seine journalistische Arbeit parallel zum Studium fortsetzte.
Aus Sparsamkeit verzichtete er auf so manchen Gasthausbesuch mit Studienkollegen. Ein Umstand, den er als geselliger Mensch sehr bedauerte. Doch er war überzeugt, dass ihn bessere Zeiten erwarteten. So schrieb er fleißig Artikel um Artikel über Betriebsführung für die Deutsche Metall-Industrie-Zeitung –stets unmissverständlich und klar formuliert, wie er es von seinem Vater kannte. Positive Resonanz auf seine Ausführungen gab ihm recht und so gewann er schnell das Vertrauen des Herausgebers Karl Wilhelm Türck.

Eines Frühsommertags im Jahr 1900 erhielt Schmalenbach ein Telegramm von Türck. Er erschrak, fürchtete im ersten Moment um seine Einkommensquelle. Doch er konnte schnell aufatmen: +++ Brauche Vertretung in den Sommermonaten +++ STOP +++ Bitte übernehmen Sie +++ STOP +++ Einzelheiten per Post +++ STOP +++ Verbindlichst +++ STOP +++ Türck +++ STOP
Schmalenbach nahm den Zwicker von der Nase und strich sich über den Kinnbart. Was für gute Nachrichten! Er beglückwünschte sich selbst und telegraphierte seinerseits Zustimmung. Das musste er Marianne berichten. Sie würden sich ohnehin beim wöchentlichen Konzert im Zimmermannschen Kaffeehaus sehen. Sicherlich wäre sie ebenfalls erfreut über diese Perspektive. Und er würde zur Feier des Tages ein Glas Wein spendieren.
Als Schmalenbach ihr am späten Nachmittag die Neuigkeit eröff nete, hob Marianne vor Überraschung die Hände an die Wangen,. „Nein!“, rief sie aus. „Welch glückliche Fügung.“ Er nickte eifrig und winkte dem Ober. „Champagner“, bestellte er. Marianne legte ihm die Hand auf den Arm, wie um ihn zu stoppen. Er winkte ab. „Heute wird gefeiert“, sagte er. „Sparen kann ich morgen wieder.“
Einige Minuten später stießen sie an und berieten sich ausführlich, denn bei aller Freude bedeutete die Vertretung auch, dass Schmalenbach Leipzig für zwei Monate verlassen und in Remscheid arbeiten müsste. Erst als die Musiker die Bühne betraten und begannen, Robert Schumanns Romanzen für Oboe und Piano zu spielen, schwiegen sie und lauschten andächtig.
Für Schmalenbach folgten beschwingte Tage. Bald erhielt er den angekündigten Brief von Türck, in dem jener nicht nur ein anständiges Honorar, sondern auch eine Bleibe sowie die Übernahme der Fahrtkosten avisierte. Tatsächlich waren es nur wenige Tage bis zur Abfahrt und so begann er schnell mit den Vorbereitungen. Vor allem musste er seine Notizen für die Texte zusammenstellen, an denen er bereits arbeitete.
Eugen auch später immer wieder auf das Thema seiner umstrittenen beiden Artikel zur SyndikatsBildung zurückkam, in der er eine Gefährdung der freien Wirtschaft sah?
Während die Studienkollegen sich auf die Freizeit zwischen den Semestern vorbereiteten, freute er sich auf die Aufgabe in Remscheid – noch immer angetan vom großen Vertrauen, das Türck ihm damit entgegenbrachte. Für die Verlobten nahte schon bald der Tag des Abschieds auf Zeit. Doch da dieser nur vorübergehend war, nahmen sie ihn nicht sehr schwer. Am Bahnhof versprachen beide, sich täglich zu schreiben.
In Remscheid angekommen, fand sich Schmalenbach schnell in seine Aufgaben hinein. Sein Tag war erfüllt mit dem Lesen von Nachrichten und Manuskripten sowie Abstimmungsrunden mit der Redaktion und dem Verleger. Wie der Verleger stand Schmalenbach in Kontakt mit einigen Verbandsmitgliedern, einflussreichen Vertretern der regionalen Metallindustrie. Seinen eigenen Texten konnte er sich meist erst gegen Abend widmen.

Eugen Schmalenbach stammte aus dem Örtchen Schmalenbach bei Halver, heute ein Ortsteil der Stadt. Während sein Vater einen Kleineisenbetrieb in Breckerfeld aufbaute, wuchsen er und seine Geschwister dort bei der Mutter auf. 1891-1994 machte er eine kaufmännische Ausbildung und war anschließend im väterlichen Kleineisenbetrieb u.a. für Buchhaltung und Kalkulation zuständig. 1898 verließ er den Heimat und Betrieb, um an der ersten deutschen Handelshochschule in Leipzig zu studieren. Nach dem erfolgreichen Abschluss im Jahr 1900 kehrte er nicht wie geplant in den väterlichen Betrieb zurück, sondern studierte an der Universität Leipzig Nationalökonomie, wo er 1901 Assistent und Bibliothekar von Professor Bücher wurde. Bereits 1902 bewarb er sich bei der neu gegründeten Handelshochschule Köln als Privat-Dozent. Seine Habilitationsschrift wurde 1903 angenommen, 1906 wurde Schmalenbach zum Professor berufen.
Die Position als Professor in Köln wurde zur Lebensstellung. Umworben von anderen Hochschulen, lehnte er jedes andere Angebot ab. In Köln forschte er, stellte dabei immer wieder den Bezug zur Praxis her und entwickelte die Basis der Betriebswirtschaft slehre. Er verfasste Bücher, zum Beispiel zu Grundlagen der dynamischen Bilanz oder zum Kontenrahmen, die zu Standardwerken der Betriebswirtschaft wurden. Seine Hauptwerke wurden ins Französische, Englische, Spanische, Russische und Japanische übersetzt. Zum Schreiben zog er sich meistens in sein Landhaus in Halver/Schmalenbach zurück.
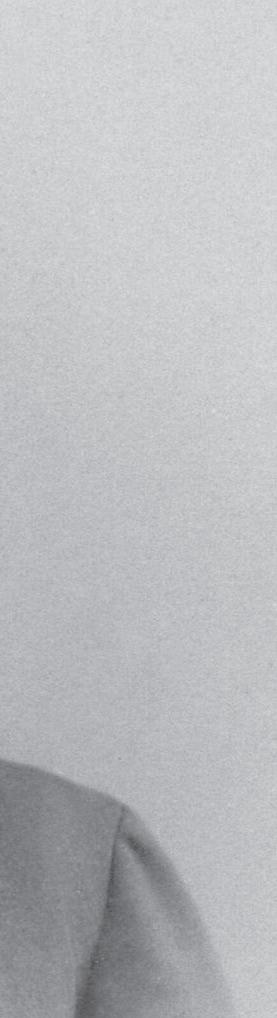
Das elterliche Landhaus hatte er 1907 von seiner Mutter erworben. Dorthin lud er immer wieder Kollegen und Studenten ein, ein Vorläufer der später gegründeten Schmalenbach-Vereinigung. Hier fanden auch seine berühmten Geburtstagsgespräche statt. Parallel zu seiner Lehrtätigkeit wurde Schmalenbach zum begehrten Berater von Unternehmen. Zu seinen Kunden gehörten beispielsweise das Kaufhaus Tietz und das Unternehmen Krupp. In der NS-Zeit zog er sich aus dem Rampenlicht zurück, auch, um seine Frau Marianne zu schützen. Im letzten Kriegsjahr lebten beide versteckt bei einem seiner früheren Studenten. Schon 1945 beteiligt er sich an der Wiedereröff nung der Universität Köln und leitete dort bis ins hohe Alter das Seminar für Betriebsorganisation.
In denen befasste sich Schmalenbach zu jener Zeit besonders mit seinen Beobachtungen zu Entwicklungen in der deutschen Wirtschaft . Für seine Begriffe waren Syndikats-Bildungen gefährlich für den freien Wettbewerb. Wie man es von ihm bereits gewohnt war, formulierte er seine Analysen scharf, streckenweise beinahe ironisch, und ohne Rücksicht auf etwaige Befindlichkeiten. Und stets, wenn er sein Tagwerk vollendet hatte, las er die Post seiner Liebsten und schrieb ihr zurück.
Eugen der Betriebswirtschaft slehre ihren heutigen Namen gab und er Zeit seines Lebens Artikel und Bücher zu betriebswirtschaftlichen Themen verfasste, darunter viele Standardwerke?
Eines Morgens kam Schmalenbach frohgemut in den Verlag. Auf dem Weg hatte er einen Brief an Marianne aufgegeben. Er vermisste sie, doch ihr Wiedersehen rückte langsam näher. Kaum hatte er
an seinem Schreibtisch Platz genommen, trat der Verleger ins Büro – ohne anzuklopfen. Kein gutes Vorzeichen, das erkannte Schmalenbach sofort. „Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?“, tobte der Verleger, ohne sich Zeit für einen Gruß zu lassen. Schmalenbach erhob sich. „Guten Morgen“, antwortete Schmalenbach, äußerlich ungerührt, mit einer leichten Verbeugung. „Welche guten Geister?“, fragte er, obwohl ihm die Antwort bereits schwante.
„Schmalenbach, wie können Sie es wagen, unsere Unternehmen derart anzugehen“, stieß der Verleger hervor. „Welche Unternehmen?“, fragte Schmalenbach. „Werden Sie nicht frech! Sie wissen genau, wen ich meine!“, rief der andere. „Es gab Beschwerden von mehreren Verbandsmitgliedern! Sie haben mich persönlich angesprochen, dass sie sich solche Anmaßungen in der Deutschen Metall-IndustrieZeitung verbitten!“ „In meinen Artikeln gibt es keine namentlichen Erwähnungen“, versuchte Schmalenbach zu protestieren. „Sie behandeln lediglich Beobachtungen, die der Wirtschaft meiner Meinung nach gefährlich werden können.“


Der Verleger machte eine Handbewegung, die wohl einen Schlussstrich darstellen sollte. „Eine solche Beurteilung steht Ihnen nicht zu, junger Mann – und schon gar nicht in meiner Verbandszeitung“, fuhr er fort. „Entweder, Sie nehmen Ihre Behauptungen in der nächsten Ausgabe zurück, oder Sie packen Ihre Sachen!“ Schmalenbach war sich sicher, dass er nichts zurückzunehmen hatte. Er hatte seine Beobachtungen journalistisch fundiert, aber eben kritisch kommentiert. Daher gab es für ihn nur eine Entscheidung. „Ich bleibe bei meiner Meinung“, sagte er. „Dann sind Sie entlassen“, antwortete der Verleger.
Schmalenbach nickte und noch während der Verleger überrascht das Büro verließ, begann er, seinen Schreibtisch aufzuräumen. Keine Stunde später war er auf dem Weg zu seiner Unterkunft , packte sein restliches Hab und Gut und machte sich auf den Weg zum Remscheider Bahnhof.
Marianne war überrascht und froh, als er tags darauf vor ihrer Tür stand. Für seine Entscheidung hatte sie vollstes Verständnis. Außerdem freute sie sich, dass er zurück in Leipzig war. Für Schmalenbach blieb auch gar nicht mehr viel Zeit bis zum Beginn des nächsten Semesters und er gönnte sich ein paar freie Tage, die er mit Wanderungen im Umland verbrachte.
Mit den manchmal lieblich und manchmal rauen landschaftlichen Gegebenheiten des heimatlichen Sauerlands war die Leipziger Tieflandbucht zwar in keiner Weise zu vergleichen, doch er genoss die Flusslandschaften.
Wie immer, wenn er in der Natur unterwegs war, ließ er die Gedanken schweifen. Nach dem Eklat in der Redaktion wollte er sich mehr denn je dem Studium widmen und auf jeden Fall wissenschaftlich arbeiten. Bedauerlich, dass er die Ergebnisse seiner Forschungen und Überlegungen nicht mehr veröffentlichen konnte, doch ansonsten hatte er den Vorfall bereits hinter sich gelassen.
Immerhin hatte er sich durch die Vertretung von Türck ein finanzielles Polster erarbeitet, das würde ihn gut über die nächste Zeit bringen. Der Rest würde sich finden.
Als er an einem dieser Abende in seine Bleibe zurückkehrte, fand er ein weiteres Mal ein Telegramm von Türck vor. +++ Zurück in Remscheid +++ STOP +++ Bleiben bei unserem Kurs +++ STOP +++ Erwarte Ihre nächsten Themen +++ STOP +++ Verbindlichst +++ STOP +++ Türck +++ STOP
Auf Schmalenbachs Gesicht breitete sich ein Grinsen aus. Der gute alte Türck! Wusste er doch, dass ihm seine umstrittenen Beiträge gefallen würden! Auch er war ein Mensch, der kein Blatt vor den Mund nahm und Gefahren oder Missstände benannte, wo Gefahren oder Missstände waren. Gut, dass Türck zurück war. Ein Mann, der zu Schmalenbach hielt, ohne auch nur zu ahnen, welche Berühmtheit er werden würde.
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Eugen Schmalenbach und einiger seiner Zeitgenossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figuren fiktiv.
Anna von Holtzbrinck, die Gnädige vom Habbel, muss umdenken
Seit 21 Jahren lebt Anna von Holtzbrinck wieder auf Haus Habbel. Schon ihre Kindheit hatte sie mit ihren Geschwistern auf dem größten Gut Herscheids verbracht. Es war damals ein gesellschaftlicher Mittelpunkt für die Verwandtschaft und den Freundeskreis der Eltern. Das ist lang her. Sie selbst ist mittlerweile 63 und hat nie eine Familie gegründet. Dafür kümmert sie sich um die Mitmenschen in ihrer Heimat - nicht nur jetzt, zu Kriegszeiten - und natürlich um ihr Gut. Denn wer will sich nur damit beschäftigen, Goethe zu lesen oder sich von Zeit zu Zeit ein neues Hütchen zu kaufen?
Selig lächelnd wirbelt Emma Caroline Auguste Johanna Henriette Anna, kurz Anna, von Holtzbrinck, durch den Ballsaal. Ihr Tanzpartner lässt sie schweben – in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist er ein schneidiger Mann und exzellenter Walzertänzer. Zum anderen ist es nicht irgendjemand, der sie da so gekonnt übers Parkett führt, sondern Kaiser Wilhelm II.

Sie seufzt wohlig. Diese Partie wäre so ganz nach ihrem Geschmack gewesen, doch der vier Jahre jüngere Wilhelm war schon lange vermählt. Eine weitere schwungvolle Drehung entlockt ihr ein kurzes Lachen. Dieses Lachen weckt sie und ihr wird blitzartig klar, wo sie sich befindet. Nicht in Bonn, sondern in Haus Habbel bei Herscheid. Nicht in den Armen des Kaisers, sondern so tief versunken in den Federn ihres Betts, dass die Schlafmütze verrutscht ist. Indem sie die Mütze zurechtrückt, seufzt sie erneut. Entgegen ihrer Gewohnheit, sofort aufzustehen, bleibt sie noch einen Moment liegen. Sinniert, wann sie mit seiner Majestät tanzte. Es ist Anfang November 1918, also vor mehr als 25 Jahren.
Noch kurz lässt sie die Traumbilder nachwirken, bis sie vollständig verblassen. Dann schüttelt sie den Kopf, vertreibt die sentimentalen Gedanken und zieht an der Glocke neben dem Bett. Die Kammerzofe erscheint wenige Sekunden später, mit einem „Guten Morgen, gnädige Frau“, auf den Lippen. „Guten Morgen, Else. Wie ist das Wetter?“ „Es regnet nicht mehr, doch es ist nebelig“, antwortet Else, öff net die Fensterläden und lässt trübes Morgenlicht herein. „Aber sicher kommt die Sonne später raus.“ Dann macht sie sich am Kamin zu schaffen. „Ja, vielleicht, dann hol mir doch das dunkelgraue Kleid heraus. Ich fahre heute in den Ort.“
Eine halbe Stunde später ist die Morgentoilette beendet und Anna von Holtzbrinck geht energischen Schrittes die Treppe hinunter ins Speisezimmer, wo sie schon das Frühstück erwartet. Die kriegsbedingten Versorgungsengpässe machen sich auch hier bemerkbar, obwohl sie viele Lebensmittel auf dem Gut selbst produzieren könnten. Doch die meisten Männer sind an der Front. Die Frauen, die Alten und die Kinder halten den landwirtschaftlichen Betrieb so weit wie möglich am Laufen. Und obwohl immer wieder Tiere und Lebensmittel beschlagnahmt werden, muss auf ihrem Landgut, anders als in den Städten, niemand Hunger leiden.
Am großen Tisch gießt sich Anna von Holtzbrinck etwas Milch in ihren Eichelkaffee, nimmt einen ersten Schluck und verzieht leicht das Gesicht. „Wie gut, dass bald Sonntag ist“, denkt sie sich und ist froh über ihre eiserne Bohnenkaffee-Reserve im Keller. Sie isst ein Ei und ein dunkles Brot mit ein wenig Butter. Dann nimmt sie das Süderländer Tagblatt vom Vortag zur Hand und legt es kurz darauf wieder weg.
Gute Nachrichten sind rar geworden in diesen Tagen. Für die deutschen Truppen sieht es schlecht aus, auch wenn das keiner laut sagen will. Der Kaiser hat das Land sogar verlassen. Bei der Marine herrscht Unruhe, der Matrosenaufstand vor wenigen Tagen in Kiel verheißt nichts Gutes. Viele Soldaten sind gefallen, der Bevölkerung geht es sehr schlecht. Wer weiß, wie sich die Dinge weiterentwickeln.
Doch Anna von Holtzbrinck verscheucht die trüben Gedanken. Sie nimmt die Tischglocke und läutet nach dem Mädchen. „Lass das Cabriolet anspannen. Ich fahre nach Herscheid“, ordnet sie an. „Sehr wohl, gnädige Frau“, antwortet das Mädchen, knickst und verschwindet. Kurz darauf kehrt es zurück und meldet, dass die Kutsche bereitsteht. Die Hausherrin hat sich inzwischen ein Hütchen ausgesucht, das Else ihr feststeckt.
Anna sich bis an ihr Lebensende gerne an den Tanz mit Wilhelm II. erinnerte?
Anschließend hilft sie Anna von Holtzbrinck in ein warmes Cape, während deren Hände in ein Paar Lederhandschuhe schlüpfen. Als sie aus dem Haus tritt, brechen hier und da erste Sonnenstrahlen durch den Nebel. Die Gutsfrau freut sich, denn das Wetter ist genau nach ihrem Geschmack. Sie lässt sich in den Zweisitzer helfen und nimmt die Zügel zur Hand. „Hü!“, ruft sie und der Braune setzt sich in Bewegung.
1914
Ausbruch des Ersten Weltkriegs
Anna von Holtzbrinck dirigiert das Pferd zu dem steilen Weg über den Habbel. In der Höhe kommt man schneller an ein paar Sonnenstrahlen. Zügig geht es bergauf. Schon bald blitzt die Sonne durchs bunte Blätterdach, die kühle Luft riecht würzig nach Wald, Moos und Pilzen. Irgendwann schlängelt sich der Weg wieder hinab. Bei Blumenthal entschließt sich Anna, durchs Tal weiterzufahren.
Anna zeit ihres Lebens Wert darauf legte, als Fräulein angesprochen zu werden?
Nach rund anderthalb Stunden erreicht sie Herscheid und zügelt das Pferd vor dem Kurzwarenladen. Eigentlich hätte sie gerne ein neues Hütchen, doch in diesen Zeiten verzichtet sie lieber auf die stundenlange Fahrt bis nach Lüdenscheid. Ein Herr eilt ihr entgegen. „Guten Morgen, Fräulein von Holtzbrinck“, begrüßt er sie, hilft ihr aus der Kutsche und macht die Zügel fest. „Was verschafft uns die Ehre?“ „Ich brauche Spitze“, antwortet sie. „Meine Else soll mir einen Kopfschmuck nähen.“
„Sehr gerne, gnädiges Fräulein. Kommen Sie herein.“ Er hält ihr die Tür auf und eilt hinter den Tresen. „Ich habe wunderschöne handgeklöppelte Spitze aus dem Erzgebirge für Sie“, er greift in zwei Fächer und zaubert die Spitzen hervor. „Was halten Sie davon?“ Anna von Holtzbrinck hat die Handschuhe ausgezogen, greift danach und befühlt sie mit den Fingerspitzen. „Eigentlich dachte ich an etwas Schwarzes“, sie deutet auf ihr Hütchen. „Sonst sieht der Schmuck ja aus wie eine Schlafmütze.“ „Oh ja, selbstverständlich.“ Er greift in ein anderes Fach und breitet zwei verschiedene Modelle vor ihr aus.
„Die Auswahl ist allerdings momentan nicht sehr groß, weil uns die Importware aus Frankreich und Belgien fehlt.“ Anna von Holtzbrinck betastet auch diesen Stoff, wiegt den Kopf. „Wie sieht es denn mit Seide aus?“, fragt sie. „Tja, schwarze Seide. Lassen Sie mich kurz überlegen.“ Er geht in den hinteren Teil seines Geschäft s, sucht in einer Schublade.

Quer durch die Wälder führen heute viele Wanderwege rund um Herscheid

„Hier ist noch etwas ganz Besonderes“, sagt er, als er zurückkommt. „Allerdings nur ein Rest, aber für einen Kopfschmuck sollte es reichen.“ Die Gutsherrin ist wirklich überrascht, solch entzückende Ware in Herscheid zu finden, lässt sich aber nichts anmerken. Schließlich will sie den Preis nicht hochtreiben. „Aha“, sagt sie. „Meinen Sie wirklich?“ Nach einigem Handeln werden sich die beiden einig. Das zarte Seidengespinst wird gut verpackt und Anna von Holtzbrinck lässt sich wieder in die Kutsche helfen.
Die Sonne hat den Nebel inzwischen fast vollständig verscheucht, nur letzte Fetzen hängen in den Bäumen. Anna von Holtzbrinck schmunzelt ob des guten Geschäft s vor sich hin, der Sonnenschein gibt ihrer Laune zusätzlichen Auft rieb. Sie nimmt zurück den Weg durchs Tal über die Chaussee, die von Lüdenscheid über Herscheid nach Plettenberg führt. Sie verläuft hier entlang der Weißen Ahe. Am anderen Ufer liegt die Bahnlinie. Der Bach führt heute viel Wasser und die Route ist noch voller Pfützen, doch der Braune ist kräftig und meistert die Aufgabe im flotten Trab bestens.
Im Blumenthal sieht sie auf einmal ein kleines Mädchen die Chaussee entlang gehen. Als sie mit ihm auf einer Höhe ist, zügelt sie den Braunen. „Nanu“, sagt sie zu dem dürren Mädchen, das ebenfalls angehalten hat und sie schüchtern ansieht. „Was machst du denn hier mutterseelenallein?“ Das Mädchen knickst und deutet auf ihren kleinen, kaum gefüllten Korb. „Ich habe Kräuter gesammelt“, sagt es. „Und wohin musst du?“ „Nach Friedrichsthal“, antwortet das Mädchen. „Na komm, steig ein“, sagt Anna von Holtzbrinck, worauf das Mädchen sie mit großen Augen ansieht, aber gehorcht.
„Du bist Martha, richtig?“, fragt Anna von Holtzbrinck. „Ja“, antwortet die Kleine einsilbig. „Habt ihr Nachricht von deinem Vater?“ „Nein.“ „Und habt ihr genug zu essen?“ „Weiß nicht“, sagt Martha. „Also nein“, schließt die Ältere. Das Mädchen zieht die Schultern hoch. Schweigend fahren sie weiter, lassen den Bahnhof Birkenhof rechts liegen, bis Anna von Holtzbrinck einige Zeit später den Braunen auf der Höhe von Friedrichsthal bremst. Das Mädchen klettert flink aus der Kutsche, knickst erneut und sagt „Vielen Dank!“ „Grüß mir deine Mutter“, sagt die Gutsherrin zum Abschied und gibt dem Pferd mit einem Schnalzen das Zeichen, weiterzutraben.
Auf Haus Habbel angekommen, begibt sie sich sogleich in die Küche. „Elfriede“, ruft sie ihre Köchin. „Was haben wir an Vorräten übrig?“, fragt sie. Elfriede überlegt kurz und antwortet „Nicht viel. Etwas Schmalz, Äpfel, Mehl, Weizenschrot.“ „Gut, pack etwas davon zusammen, und lass es zu unseren Nachbarn nach Friedrichsthal bringen.“ „Sehr wohl, gnädige Frau“, nickt Elfriede. „Dürfen wir jetzt das Mittagessen servieren?“ „Selbstverständlich“, sagt Anna von Holtzbrinck.
Anna in Herscheid wegen ihrer Wohltaten „Die Gnädige vom Habbel“ genannt wurde?
Nachdem sie sich gestärkt hat, verschwindet die Gutsherrin im Schlafgemach, um etwas zu ruhen. Am Nachmittag läutet sie nach Else, überreicht ihr die seidige Spitze und instruiert sie bezüglich des Kopfschmucks, der ihr vorschwebt. Dann begibt sie sich ins Büro, um Schrift verkehr zu erledigen. Zum Beispiel bezüglich der Schule in Hüinghausen, damit dort endlich etwas vorangeht.
Als ihr Tagwerk erledigt ist, nimmt sie ein leichtes Abendessen ein, liest auf der Chaiselongue in der Bibliothek bei Sherry und Pfeife noch einige Seiten in Goethes Wahlverwandtschaften und begibt sich dann zu Bett.
Der nächste Morgen beginnt für die Gutsherrin nach einer traumlosen Nacht. Sie läutet nach Else, erkundigt sich nach ihrem Kopfschmuck – fast fertig –, absolviert die Morgentoilette, begibt sich zum Frühstück – zum Glück ist morgen Sonntag –, und liest mit gerunzelter Stirn die Zeitung vom Vortag. Die Unruhen in Berlin breiten sich aus. „Hoffentlich wird das nicht schlimmer“, denkt sie sich.
Kopfschüttelnd geht Anna von Holtzbrinck in ihr Büro, um sich wieder der Schule zu widmen. Sie möchte einen neuen Baubeschluss unterstützen, nachdem der erste durch den Kriegsausbruch hinfällig wurde und sie das bereits gespendete Bauholz zwischenzeitlich verkaufen musste. Sie lässt ihren Verwalter kommen, um mit ihm zu besprechen, welches neue Holz für den Schulbau in Betracht kommt.
die Schule, deren Bau Anna unterstützte, 1922 endlich eröff net wurde und fast 100 Jahre bestand?
Nach dem Mittagsmahl macht sie heute einen Spaziergang über das Gut, auf dem sie sich in der Kornmühle und beim Vieh in den Ställen auf den Stand der Dinge bringt. Dann dreht sie eine Runde um den großen Stauteich.
Bereits auf dem Rückweg sieht Anna von Holtzbrinck einen ihrer Diener vom Gutshaus her auf sich zu eilen. „Gnädige Frau“, ruft er schon von weitem. „Gnädige Frau …“, japst er, als er bei ihr ankommt. „Ein Telegramm!“ „Ein Telegramm?“ Das verheißt nichts Gutes.
Sie öff net den Umschlag, das Telegramm stammt von ihrem Neffen auf Schloss Oedenthal bei Lüdenscheid. „Revolution in Berlin +++ STOP +++ Wilhelm dankt ab +++ STOP +++ Kapitulation“ steht da. Anna von Holtzbrinck wankt, stützt sich an einem Baum ab. Ihr Kaiser soll abgedankt haben? Das darf nicht wahr sein! Sie schnappt sich einen Holzstecken und geht zurück zum Haus. Der Diener trottet hinterher und sagt: „Der Bote wartet auf Antwort.“ „Es gibt keine Antwort“, stellt sie fest.
Anna von Holtzbrinck ist erschüttert. Mit Wilhelm II. hatte sie ja nicht nur getanzt. Sie hatte 30 Jahre lang fest an ihn geglaubt. Natürlich war es ein Fehler, den großen Krieg zuzulassen. Doch niemand konnte ahnen, dass er sich zu einem Flächenbrand entwickeln wird. Und man dankt doch nicht einfach ab, lässt alle im Stich. Auch wenn der Krieg enden muss, gar keine Frage. Je früher, desto besser. Zu viele Soldaten hatten ihr Leben gelassen.
Selbst hier, im tiefsten Sauerland, hatten zahllose Familien Väter und Söhne verloren. Aber hätte es nicht doch einen anderen Weg gegeben, als abzudanken? 30 Jahre war Wilhelm II. ihr Kaiser gewesen. Ihr Kaiser, den sie persönlich kannte. Sie kann es nicht glauben.
Das Ende von Glanz und Gloria: Kurzfilm über Wilhelm II und seine treuen „Märker“ Jetzt anschauen
An diesem 9. November zieht sich Anna von Holtzbrinck früh ins Schlafgemach zurück. Sie lässt sich noch eine Hühnerbrühe bringen. Der neue Kopfschmuck liegt auf ihrer Kommode bereit für den morgendlichen Kirchgang. Sie nimmt ihn zur Hand und beginnt, die Nähte aufzutrennen, bis sie wieder das ursprüngliche zarte Stück Spitze in der Hand hat. Zum Glück hat Else es nicht zerschnitten. Sie beginnt nachdenklich, es zu umsäumen. Der Krieg ist vorbei, das steht fest. Es ist eine gute Nachricht. Und sie wird tun, was immer sie kann, um den Heimkehrern von der Front und ihren Familien das Leben zu erleichtern. Morgen ist der erste Tag seit langem in Frieden. Die beste Nachricht seit langem, doch zum Feiern ist ihr nicht zumute.
Am nächsten Morgen versammelt sie ihre Leute im Speisezimmer. Mit belegter Stimme liest sie ihnen das Telegramm vor. „Revolution in Berlin +++ STOP +++ Wilhelm dankt ab +++ STOP +++ Kapitulation. Dieses Telegramm erreichte mich gestern“, sagt sie. „Der Krieg ist zu Ende. Hoffen wir, dass ihr viele eurer Lieben bald wiederseht. Unseren Kaiser aber haben wir verloren.“
Ein Raunen geht durch die Schar ihrer Leute. Sie wirken betroffen und gleichzeitig erleichtert. Im ganzen Märkischen Sauerland war Kaiser Wilhelm II. sehr beliebt und hochverehrt.
Anna 1919, wie der gesamte Adel in Deutschland, ihre Privilegien verlor und noch bis zu ihrem Tod 1936 auf Haus Habbel lebte?
Ohne Frühstück macht sich Anna von Holtzbrinck auf den Weg zur Kirche in Herscheid. Nicht mal ihren geliebten Bohnenkaffee mag sie trinken. Das schwarze Spitzentuch dient ihr als Schleier. Im Gedenken an die vielen, vielen Toten und Versehrten. Und auch zum Abschied von ihrem geliebten Kaiser, der er in ihrer Erinnerung immer bleiben wird. Wer weiß, was die Zukunft bringt, angesichts der Revolution in Berlin. Doch Berlin ist weit weg und der große Krieg ist beendet.
1918
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Anna von Holtzbrinck. Dennoch ist sie hier eine Kunstfigur. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figur fiktiv.
Mehr als 20 Jahre hatte er die Geschicke der Zeppelin Luft schiff bau GmbH geleitet. Ab 1908 baute er den Zeppelin-Konzern auf, gründete Tochterunternehmen, die bis heute Bestand haben. Mit Ferdinand Graf von Zeppelin war er bereits seit 1899 befreundet gewesen. 1929 verließ er dessen Konzern, blieb noch einige Jahre Aufsichtsrat verschiedener Zeppelin-Unternehmen und begann Bücher über die Luft schiff fahrt zu schreiben. In den frühen 1930ern kehrte er vom Bodensee in seine Heimat Werdohl zurück, um den väterlichen Betrieb auf Vordermann zu bringen. Doch dort wurde sein Elan unvermittelt gebremst.

Als Alfred Colsman sein Bewusstsein wiedererlangte, versuchte er sich zu orientieren. Gerade noch hatte er auf seinem Fahrrad gesessen und war mit Schwung den Pungelscheider Weg hinuntergesaust. Die letzte Kurve hatte er sehr weit genommen. Und dann? Verlor sich seine Erinnerung. Er lag in einem Bett mit frisch gestärkter Bettwäsche, am Leib ein leichtes Hemdchen. Am Kopf bemerkte er einen dicken Verband. Sein Anzug hing lädiert an einem schlichten Holzschrank.
Colsman wollte den Kopf bewegen, doch der schmerzte ziemlich. Wie lange er wohl schon hier lag? Draußen dämmerte es. Er war morgens mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Seine Frau Helene würde sich bestimmt bereits sorgen. Er versuchte, sich aufzusetzen. Schmerzen hielten ihn zurück. Das linke Bein steckte in einem Gips. Was war geschehen?

„Sie sind mit einem Kraft wagen kollidiert!“, berichtete der Professor. „Sie waren bewusstlos und man hat Sie sofort hierher gebracht.“ „Zum Glück!“, setzte er hinzu. „Sie haben eine schwere Gehirnerschütterung, ein gebrochenes Bein, einige Schnittwunden und reichlich Prellungen. Ich verordne Ihnen absolute Ruhe.“ „Wann war das?“, fragte Colsman. „Gestern Vormittag“, erwiderte der Professor und machte eine beruhigende Geste, als Colsman anhob zu sprechen. „Ihre Frau habe ich heute Mittag nach Hause geschickt, damit sie sich ausruht. Ein Bote ist aber bereits zu ihr unterwegs.“
du schon, dass
Alfred der Schwiegersohn des berühmten Lüdenscheider Luft schiff fahrt-Unternehmers Carl Berg war und früh Führungsaufgaben in dessen Unternehmen übernahm?
Die Zimmertür öff nete sich und eine Schwester kam herein. „Sie sind wach!“, rief sie aus. „Ich verständige sofort den Professor.“ Schon hatte sie auf dem Absatz kehrt gemacht. Keine Minute später betrat ein Respekt einflößender Herr im weißen Kittel das Patientenzimmer. „Mein lieber Herr Kommerzienrat“, begann er. „Da hatten Sie aber Glück! Etwas schneller, und sie wären nicht mehr aufgewacht.“ „Was ist denn passiert?“, fragte Colsman.
„Gestern!“, rief Colsman aus. „Und Helene war hier?“ Der Professor nickte. „Sie hat die ganze Nacht an Ihrem Bett gewacht.“ Er widmete sich seinem Patienten noch einige Minuten, prüfte die Pupillen und einige Reflexe, um ihn dann mit einer optimistischen Einschätzung zu verlassen. „Herr Kommerzienrat“, sagte er. „Strikte Bettruhe, dann werden Sie sich schnell erholen!“
Wieder allein, war Colsman versucht, den Kopf zu schütteln. Doch jede Bewegung schmerzte. Eine Kollision! Und er konnte sich nicht daran erinnern! „Mein lieber Herr Gesangsverein!“, murmelte er und musste sich wohl eingestehen, dass sich in jüngeren Jahren anders die Berge hinabsausen ließ, als mit 60. Wären diese Schmerzen nicht, hätte er vielleicht sogar über sich gelacht. Sein Blick fiel auf den Anzug am Schrank, der ihn leise ermahnte.
Zart klopfte es an der Tür. Auf sein „Herein!“ kam Helene ins Zimmer. Etwas außer Atem, mit geröteten Wangen. Sie trat zu ihm ans Krankenbett und nahm seine Linke mit beiden Händen. „Alfred!“, sagte sie. „Du machst mir Geschichten! Ich hatte schon die schlimmsten Befürchtungen!“ Er versuchte ein Grinsen, es misslang. „Wie fühlst du dich?“ „Das weiß ich noch nicht so genau“, erwiderte er. „Was hat man dir berichtet? Ich habe keine Erinnerung.“ „Nur, dass du mit einem Kraft wagen zusammengestoßen bist“, sagte Helene. „Einem Kraft wagen? Das sagte der Professor bereits.“ „Ja, mit einem Kohlenwagen. Er kam dir entgegen.“
„Ein Kohlenwagen! Jetzt erinnere ich mich! Er hat die Kurve sehr eng genommen. Und ich war wohl etwas schnell unterwegs.“ „Er hat dich zum Glück nur gestreift . Durch seine abrupte Bremsung sind die Kohlen aus dem Wagen gerutscht. Ein Teil ist wohl den Berg hinunter gekullert.“ Er meinte, den Kohlenstaub zu riechen und im Gesicht zu spüren. „Nach dem Absturz mit dem Zeppelin also ein zweiter Sturzflug“, sinnierte er. „Mir scheint, mit der Fliegerei sollte jetzt aber mal Schluss sein!“
Alfred ab 1908 Geschäft sführer der ZeppelinLuft schiff bau GmbH war und das Unternehmen bis 1929 zu einem weitverzweigten Konzern ausbaute?
Helene berührte ihn sacht an der Schulter und sagte: „Wenn du schon wieder scherzen kannst, bist du ja auf dem Weg der Besserung.“ Sie nahm den Anzug vom Bügel, schaute ihn an und legte ihn sich dann über den Arm. „Ob der noch zu retten ist?“, murmelte sie vor sich hin. An Colsman gewandt, sagte sie: „Mein lieber Alfred, ich wünsche dir eine gesegnete Nachtruhe. Erhole dich! Morgen früh komme ich wieder.“
Wie angekündigt, kehrte Helene am nächsten Morgen zurück. Nach der Begrüßung reichte sie ihrem Gatten die aktuelle örtliche Tageszeitung sowie die Ausgabe des Vortages. Am Vortag war über seinen Unfall auf die Titelseite berichtet worden. Direktor Colsman verunglückt, stand dort. Eine Porträt-Aufnahme aus jüngeren Jahren war abgebildet, dazu eine Fotografie des Kohlenwagens, im Artikel wurde sein ganzes Leben aufgerollt:
Die frühen Jahre in Werdohl, seine Ausbildungen, die Heirat mit Helene Berg, sein Wechsel an den Bodensee ins Unternehmen des Grafen von Zeppelin und schließlich seine Rückkehr in die Heimat nach mehr als 20 Jahren. Abschließend ließ sich der Schreiber noch über die schönen kurvigen Strecken Werdohls mit ihren wunderbaren Aussichten und ihren starken Höhenunterschieden aus.
„Ziemlich viel Aufhebens“, kommentierte Colsman. „Du bist eben ein wichtiger Mann“, erwiderte Helene. „Und schließlich sieht man einen auf der Straße entleerten Kohlenwagen auch nicht alle Tage.“ In der aktuellen Ausgabe wurde über die Aufräumarbeiten berichtet, ein Lüdenscheider Reporter wollte zudem erfahren haben, dass Alfred Colsman mit dem Tode ringe. Was wiederum die Eheleute amüsierte. „Wir sollten deine Verletzungen dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen“, mahnte Helene.

Ohne ihn wäre Graf Zeppelins Unternehmung in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts kaum so erfolgreich gewesen. Alfred Colsman war kurz nach der beeindruckenden Volksspende für den Bau von Luft schiffen im Jahr 1908 Geschäft sführer der Zeppelin Luft schiff bau GmbH geworden. Er gründete zahlreiche Tochterunternehmen und schuf damit den Zeppelin-Konzern, zu dessen Generaldirektor er wurde. Zu den Tochterunternehmen gehörten zum Beispiel die Deutsche Luft schiff ahrts-AG (DELAG) als erste Luft reederei der Welt, die Zahnradfabrik Friedrichshafen GmbH und die spätere Maybach-Motorenbau GmbH. Einige der Unternehmen haben bis heute Bestand.

zeitsreise 1899 Doch er


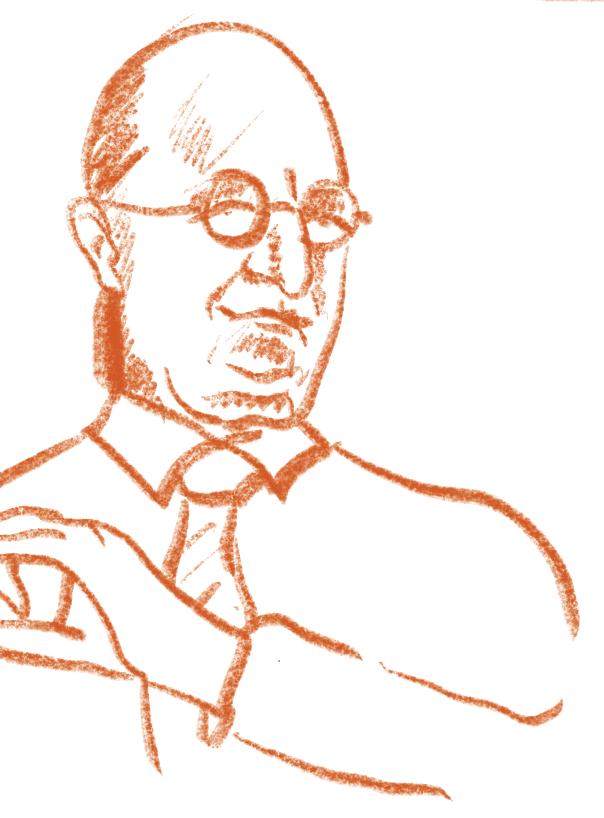
Alfred Colsman hatte Ferdinand Graf von Zeppelin bereits auf seiner Hochkennengelernt. Doch auch zuvor waren ihm dessen Projekte vertraut gewesen. Schließlich hatte er nicht nur das väterliche Unternehmen in Werdohl geleitet, sondern er hatte auch Führungsaufgaben in der Carl Berg OHG, dem Unternehmen seines Schwiegervaters Carl Berg, der an der Finanzierung wie an der Konstruktion der Zeppeline maßgeblich beteiligt gewesen war und die AluminiumTeile für die Luft schiffe produziert hatte.
Konstruktion
Die nächsten Tage waren bestimmt, vom langsamen gesundheitlichen Fortschritt Colsmans. Nach einer Woche waren die Schnittwunden oberflächlich verheilt, die Bandage am Kopf war entfernt worden. Allerdings schmerzte der Schädel gelegentlich noch und das gebrochene Bein brauchte einfach seine Zeit. Colsman studierte regelmäßig verschiedene Tageszeitungen. Tatsächlich gab es in einigen von ihnen Beiträge über Wanderungen durch die steilen Hänge des wunderschönen Werdohls, die der Gesundheit besonders zuträglich seien. Er schmunzelte. „Auf jeden Fall gesünder, als Fahrten mit dem Rad“, dachte er. Trotz der Lektüre begann Colsman, sich zu langweilen. „Wie steht es in der Firma?“, fragte er seine Frau zum wiederholten Mal. Sie wiegelte ab, mit dem Hinweis, dass seine Leute schon wüssten, was sie zu tun haben. „Lass nach Reinhardt und Fips schicken“, bat Colsman trotzdem.
„Sie sind über 20 Jahre ohne dich ausgekommen! Erst musst du wieder gesund sein“, bemerkte seine Frau. „Du weißt, der Professor hat strikte Bettruhe verordnet!“ „Das war vor mehr als einer Woche!“ Missmutig sah Colsman aus dem Fenster und runzelte die Stirn. In den mehr als 20 Jahren hatte sich der väterliche Betrieb allerdings nicht besonders gut entwickelt. Andererseits schmerzte der Kopf immer noch, verflixt und zugenäht! Er wandte sich Helene zu. „Gut, aber ich brauche einen Zeitvertreib.“ Sie nickte. „Ich lasse dir Bücher bringen.“ „Ja bitte“, sagte er. „Aber nichts über Luft schiff fahrt.“ Helene blickte ihn überrascht an. „Ich möchte etwas Neues. Mein Buch habe ich ja, wie du weißt, gerade abgeschlossen. Jetzt wünsche ich mir mal ein ganz anderes Thema.“ „Ich werde sehen, was ich für dich finde“, versprach Helene.
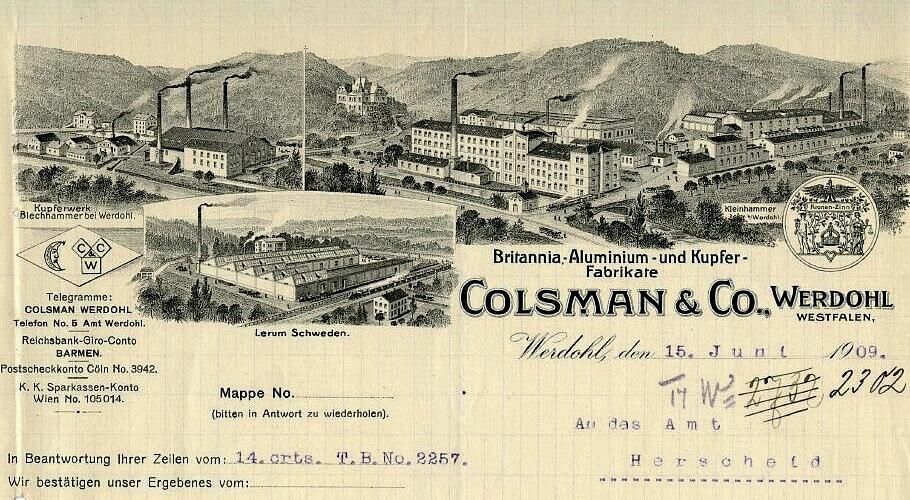
Tags darauf brachte sie ihrem Mann zunächst die VDI Nachrichten sowie weitere Tageszeitungen aus ganz Deutschland mit, die, wie z.B. die WeserZeitung vom 16. September 1933, eine Notiz oder einen Bericht über seinen Unfall veröffentlicht hatten. „Morgen bekommst du die Literatur“, sagte sie so verschmitzt, dass er sich wunderte. Wollte sie ihm einen Liebesroman anbieten? Während er sich der Presse widmete, sah er dem nächsten Tag mit Spannung entgegen. Und tatsächlich kam am frühen Morgen ein Bote mit einem dicken Paket. Colsman entfernte schnell die Schnüre und fand darin zwei Bücher: Die Grafschaft Mark, Festschrift zum Gedächtnis der 300 -jährigen Vereinigung mit Brandenburg-Preußen. Band 1 und Band 2 1909 von Aloys Meister verfasst. Aha. Das war ja nun schon etwas älter. Er begann darin zu blättern und blieb an verschiedenen Passagen hängen. Napoleon? Was hatte der mit seiner Heimat zu tun? War es tatsächlich …? Ja, es muss der Napoleon gewesen sein, also der erste. Der, der auf Korsika landete und bei Waterloo verlor.
Als Helene wenig später eintraf, fand sie den Gatten in die Lektüre vertieft . „Oh, wie ich sehe, war der Bote schon da“, kommentierte sie. „Was macht der Kopf?“ „Besser, besser, danke“, antwortete Colsman. „Wo hast du denn dieses Exemplar aufgetrieben?“ „Mein Bruder Rudolf hatte es in seiner Bibliothek“, erwiderte Helene. „Und er hat dafür keine Verwendung mehr.“
Alfred 1930 in seinen Heimatort Werdohl zurückkehrte und sich der Sanierung des väterlichen Betriebs widmete?
„Das ist hochinteressant!“, sprach Colsman. „Eine gute Wahl, meine Liebe.“ Helene strahlte, froh, die Interessen ihres Gatten richtig eingeschätzt zu haben. „Hier sind wieder einige Zeitungen“, sagte sie. „Verbindlichsten Dank“, antwortete er. „Mittlerweile ist mir allerdings bekannt, dass ich einen schweren Verkehrsunfall hatte. Vor fast zwei Wochen inzwischen!“ „Das heißt nicht, dass du genesen bist. Schau dir dein Bein an und deine Prellungen.“
„Mag sein, aber dem Kopf geht es wieder gut. Lass doch bitte nach Reinhardt und Fips schicken!“, bat Colsman. Sie nickte und sagte. „Morgen.“
Tatsächlich statteten ihm seine beiden leitenden Mitarbeiter am nächsten Vormittag einen Besuch ab und brachten ihn auf den neuesten Stand. Dem väterlichen Unternehmen, spezialisiert auf Aluminium- und Kupferlegierungen, war es nach dem Tod seines Bruders 1915 nicht besonders gut gegangen. Doch Colsman hatte seit seiner Übernahme einige geschäftliche Weichen so gestellt, dass sich die Lage bereits deutlich verbessert hatte. Da sollte es natürlich keine erneuten Rückschläge geben. Von jetzt an sollten die beiden ihm alle zwei Tage Bericht erstatten.
Ohne, dass Helene oder der Professor hätten Einwände erheben können, widmete sich Colsman also wieder ausführlich seinen Geschäften. Nebenbei vertiefte er sich immer weiter in die zweibändige Festschrift . Bald verlangte er nach zusätzlichem Material über die Werdohler Geschichte, doch Helene kam unverrichteter Dinge vom Buchhändler zurück. „Es gibt offenbar keine aktuellen Werke“, berichtete sie, nachdem sie ihm wieder einige Tageszeitungen gereicht hatte. „Wir können es nur in Archiven versuchen.“ „Wie bedauerlich“, sagte Colsman.
Alfred 1933 nach seinem schweren Unfall von mehreren Tageszeitungen fälschlicherweise für tot erklärt wurde und er den Redakteuren der Frankfurter Zeitung eine launige Postkarte vom Bodensee schrieb, in der er sie darauf hinwies, dass er noch unter den Lebenden weilte?
Einige Tage darauf – Colsmans Kopfschmerzen waren verklungen, die Prellungen verschwunden, die Wunden geheilt – kam Helene morgens einigermaßen aufgebracht ins Krankenzimmer. „Sieh dir das an“, sagte sie und warf ihm die bereits einige Tage alte Frankfurter Zeitung vom 30. September 1933 aufs Bett. „Immer noch mein Unfall?“, fragte Colsman. Helene nickte und sagte „Lies selbst!“
Er nahm die Zeitung zur Hand und rief „Oho!“, denn der Artikel war mit seinem Namen und einem fettgedruckten Kreuz überschrieben. Er sei vor wenigen Tagen das Opfer eines Verkehrsunfalls geworden und verstorben. Dann folgten ca. 35 Zeilen über seine Verdienste. „Oho!“, wiederholte er. „Meine Liebe, off enbar beginne ich gerade mein zweites Leben.“
Lächelnd fuhr er fort: „Und ich weiß auch schon, was ich damit anfange. Denn scheinbar gibt es ja nicht genügend Literatur zu meiner Heimat. Ich werde mich ihrer Erforschung widmen und dafür sorgen, dass man etwas mehr über Werdohl, das Süderland und die ehemalige Grafschaft Mark erfahren kann. Und ich denke, ich werde mit Erinnerungen aus meiner Jugend beginnen!“ 1933
Machtübernahme der Nationalsozialisten
Hinweis
Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Alfred Colsman und seiner Ehefrau. Dennoch sind die hier Kunstfiguren. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figuren fiktiv.
Karl vom Ebbe erkundet das Märkische Sauerland von heute
1996 war er das letzte Mal aufgetreten: Karl vom Ebbe oder Kaal vam Ebbe, die von Fritz Sträter geschaffene Kunstfigur: Konzipiert und zum Leben erweckt als Original und wohlwollend kritischer Geist aus dem Märkischen Sauerland, der sich stets im sauerländisch-märkischen Platt äußerte. Karl, ein bäuerlicher Typ mit Backenbart und Pfeife, blauem Kittel und Kiepe, trat erstmals 1960 auf dem Schützenfest in Meinerzhagen in Erscheinung.
Damals zunächst verkörpert von Wilhelm Vogel, gab er ein paar Dönekes mit Bezug zur Meinerzhagener Lokalpolitik zum Besten. Später schlüpfte der Autor selbst in die Rolle des Karl vom Ebbe, zum letzten Mal 1996 bei der Eröff nung des Denkmals, das ihm in Meinerzhagen errichtet worden war.
Mehr als 25 Jahre später schicken wir ihn mit seiner Kiepe noch einmal für ein paar Tage durchs Märkische Sauerland. Er macht dabei viele Entdeckungen, die Themen seiner liebevoll-ironischen Kommentare zur Heimat werden könnten. Und ihn trifft eine Erkenntnis.
Karl vom Ebbe – so erdachte ihn sein Erfinder Fritz Sträter – war ein Kleinbauer aus dem Ebbegebirge, arbeitsam und viel unterwegs, mit seiner Kiepe auf dem Rücken. Wie das Kiepenlisettken hielt er den einen oder anderen Schnack mit den Leuten, war immer gut informiert und hatte eine Meinung zu den Dingen, die um ihn herum passierten.
Geboren um die vorletzte Jahrhundertwende, kommentierte er humorvoll und mit Augenzwinkern das politische wie gesellschaftliche Geschehen seiner Heimat Meinerzhagen, kurz Meinerzen. Gerne legte er dabei auf mal einen Finger in die Wunde. Nachdem er sich seit 1996 nicht mehr geäußert hat, lassen wir ihn heute nochmal eine Tour durchs Märkische Sauerland machen.
Das Ebbegebirge kennt Karl vom Ebbe wie seine Westentasche. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Hängen mit ihren dichten Wäldern wurde er geboren. Dort wohnte, lebte und arbeitete er, wenn er nicht gerade unterwegs war. In jungen Jahren fand er seinen Weg über den Ebbekamm blind. Das musste er auch, denn durch die dichten Wipfel drang kaum Tageslicht. Den Orkan Wiebke und die vorhergehenden Stürme erlebte er Anfang 1990 selbst noch. Sie hinterließen auf seiner Nordhelle deutliche Spuren.
Im Spätsommer 2023 macht sich Karl vom Ebbe also von seiner Hütte unweit der Nordhelle aus auf den Weg. Frohgemut wandert er los, die Kiepe auf dem Rücken, die Pfeife im Mund. Zunächst freut er sich, wie schön sich der Wald in damaligen Sturmzonen regeneriert hat. Doch schon bald stockt ihm der Atem. Denn wo früher dichter Fichtenwald stand, kann er heute bis nach Herscheid blicken.
Auf weiten Flächen stehen nur noch einzelne Bäume, sind die Stämme abgeholzt und liegen Baumstämme herum. Über dem Wald hängt das Geräusch von Motorsägen und schwerem Gerät. Er begegnet einem Förster, der ihm von den Orkanen der letzten Jahrzehnte berichtet – Lothar, Kyrill, Friederike, Sabine und wie sie alle hießen –, von der Trockenheit der letzten Jahre und vom Borkenkäfer. All das habe dem Wald sehr zugesetzt.
Karl nickt traurig, dann hebt er seine Mütze, grüßt und folgt dem Waldweg, der ihm heute wie ein Panoramaweg vorkommt. „Borkenkäfer?“, denkt er. „Hatte der nicht schon Ende der 1980er Jahre Probleme bereitet?“ Er schüttelt den Kopf und nimmt sich vor, sich genauer mit dem Thema zu befassen. Doch dann stutzt er, weil in einem entfernten Tal plötzlich ein See schimmert. Sollte das etwa die Oestertalsperre sein? Das wird er mal aus der Nähe angucken.
Fritz Sträter 36 Jahre lang Texte für Karl vom Ebbe schrieb - immer im sauerländisch-märkischem Platt und in Versform? 1945 Kriegsende 1989 Deutsche Wiedervereinigung
Noch während des Abstiegs wird ihm klar: Es ist tatsächlich die Oestertalsperre. Was auch sonst? Der Stausee hatte ganz früher einmal hauptsächlich die regelmäßige Wasserzufuhr für die unterhalb liegenden Schmieden und Kleinindustriebetriebe garantiert. Er kannte ihn fast sein ganzes Leben, doch meistens war der See in den Wäldern besser versteckt als heute. Er erinnert sich, dass man den Brauchwasserspeicher auch nutzte, um den Wasserstand der Ruhr zu regeln.
Als er näher kommt, staunt er nicht schlecht. Nicht über den Campingplatz, nein, den kannte er schon. Auch nicht darüber, dass es Badegäste gibt. Ihn überraschen die Menschen, die auf Brettern über das Wasser paddeln. Er kennt Kähne, Boote und Kanus, aber diese Bretter kennt er nicht. Ungefähr auf mittlerer Höhe des Stausees, nimmt er die Kiepe ab, setzt er sich unter einen Baum und beobachtet das Treiben am und auf dem Wasser. Wieder hebt er seine Kappe und kratzt sich am Kopf. Warm ist ihm in seinem dunklen Kittel. Vielleicht sollte er selbst eine kleine Abkühlung wagen.
Geschwind zieht er die schweren Schuhe aus, krempelt sich die Hose hoch und stapft , noch immer die Pfeife im Mund, zum Ufer und einige Schritte ins Wasser hinein. Ah! Das tut gut, obwohl er die vielen kleinen Wasserläufe und Bäche im Märkischen
Sauerland meist noch erfrischender findet. Grinsend beobachtet er, wie einige Jugendliche sich mit den Brettern aufs Wasser begeben, es scheint so eine Art Kursus zu sein. Um seine Augen verteilt sich ein fröhlicher Faltenkranz.
Scheint gar nicht so einfach, denn die Kinder beginnen kniend zu paddeln. Und trotzdem platscht es immer wieder, weil jemand ins Wasser fällt. Er fragt einen Jungen am Wasser, wie sich dieses Brett nennt. Der sieht ihn merkwürdig an, antwortet aber: „SUP.“ Das klingt wie der Name einer Partei, denkt Karl. „Eine Abkürzung?“, fragt er. „Wofür?“ „Standup-Paddling“, sagt der Junge. „Danke“, sagt Karl, nickt dem Jungen freundlich zu und denkt: „Sehr originell, Paddeln im Stehen.“ Ihn erinnert das eher an Einbäume und damit eine sehr frühe Form der Fortbewegung auf dem Wasser.
Karl vom Ebbe in den frühen 1960er Jahren zunächst viermal von Wilhelm Vogel dargestellt wurde? Dann übernahm Fritz Sträter selbst und trat bis 1996 als Karl vom Ebbe in und um Meinerzhagen auf.
Da hätte er seinen Zuhörern etwas zu berichten!
Doch wer weiß? Vielleicht vergnügen sich in den heutigen Generationen mehr Leute mit SUP, als er denkt. Es sieht immerhin nach einem tollen Freizeitvergnügen aus. „Freizeit“, denkt er. „Davon habe ich selbst immer viel zu wenig gekostet.“ Doch er freut sich für die jungen Leute. Und wenn er mit einem dieser Bretter alleine hier wäre, würde er den Spaß glatt mal ausprobieren. Aber jetzt hat er genug gesehen, er wird noch ein paar Kilometer in Richtung Plettenberg weitergehen, sich einen Platz zum Schlafen suchen und morgen die nächste Etappe wandern.
Am Hestenberg findet er schließlich ein Plätzchen im Grünen, nicht weit von der früheren Trasse der Bahnstrecke Plettenberg – Herscheid. Schön gelegen, auch wenn der Verkehr im Tal permanent rauscht. Am nächsten Morgen wäscht er sich an einem Bachlauf und erinnert sich daran, dass die früheren Gleise bereits im letzten Jahrhundert abgebaut wurden. Heute verläuft dort ein gepflegter Waldweg. Der ehemalige Haltepunkt ist inzwischen schick renoviert – in Rosa – und in ein Lokal umgewandelt worden. Einen Moment überlegt er, dort einen Kaffee zu trinken. Doch er entscheidet sich dagegen und geht durch den Wald – auf der Strecke, wo früher die Bahn fuhr.
Dort erwarten ihn weitere Überraschungen. Unter ihm wurde offenbar ein Tunnel in den Berg gebaut, denn die rauschenden Autos verschwinden, ohne das Tempo zu drosseln, im Berg. Oben auf dem Weg sieht er große Tafeln mit Gemälden. „Plettenberger Kunstpfad“, liest er, auch eine interessante Geschichte für seine Zuhörer: eine Galerie mitten im Wald! Er geht weiter und schlägt sich bald darauf durch die Büsche. Er hat sich entschlossen, die Pfarrkirche St. Lambertus in Affeln zur nächsten Station zu machen. Dazu will er runter zur Lenne und auf der anderen Seite wieder rauf. Mal sehen, was sich dort verändert hat.
Kersmecke lässt er links liegen, nimmt die alte Brücke über den Fluss und merkt bald, dass er sich viel vorgenommen hat, schließlich ist er nicht mehr der Jüngste. Mit ordentlichen Steigungen hat er es zu tun, sogar die Autos fahren die schlangenförmige Straße langsam hinauf. Das liegt jedoch auch am Tempolimit. Karl versucht es mit Abkürzungen querfeldein. Je höher er kommt, desto kahler die Umgebung, denn der Wald hat auch hier gelitten. Schatten muss er suchen. Einmal macht er Rast, nimmt sich Brot und Speck aus der Kiepe. Dazu ein Bier, nicht mehr ganz taufrisch. Immer wieder wischt er sich die Stirn mit seinem Halstuch. So steil hatte er die Route nicht in Erinnerung, doch auf halbem Wege wird er nicht kehrtmachen.
Zwei Stunden später hat er es geschafft, steht vor der romanischen Kirche mit ihrer Welschen Haube auf dem Turm. Erleichtert ist er, denn es scheint alles beim Alten: Das kleine dreischiffige Langhaus mit Rundbogenfenstern aus Bruchstein, im Osten abgeschlossen durch die Apsis. Der verputzte, helle Turm im Westen. Stimmt nicht ganz, stellt er fest, als er durch das Tor im Turm eintritt. Zwar ist es hier schön kühl, doch ein festes Gitter hindert ihn, das Kirchenschiff zu betreten. Den berühmten flandrischen Barockaltar kann er daher nur aus der Ferne begrüßen. Etwas enttäuscht lehnt er den Kopf ans Eisen.
Bald verlässt er die Kirche wieder und beschließt, im Kirchhof auf einem Mäuerchen im Schatten ein Nickerchen einzulegen. Wenig später weckt ihn eine alte Frau. Sie habe gesehen, dass er in die Kirche ging, sagt sie. Und lädt ihn ein, freitags die Früh- oder samstags die Vorabendmesse zu besuchen. Zur Besichtigung sei St. Lambertus nur selten geöff net. Karl nickt, bedankt sich für die Auskunft und gähnt verstohlen.
Die alte Frau hatte es spannend gemacht. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Doch er war schon immer bereit, sich überraschen zu lassen. Und so entdeckt er in Neuenrade-Küntrop einen ungewöhnlichen Holzbau, den er noch nicht kannte. Die Küntroper Motte ist auf einem Transparent an der Wand zu lesen. Als Untertitel Idealtypisches Modell einer spätmittelalterlichen Turmhügelburg. „Aha“, denkt sich Karl. „Motte, was für ein lustiger Name. Und wie kommt die hierhin?“ Er geht einmal um den Bau herum, drückt die Klinke der Tür – verschlossen. Ausgegraben wurde sie sicher nicht, denn er erinnert sich, dass man ganz in der Nähe Reste eines alten Burggrabens gefunden hatte und Teile des alten Fundaments von Burg Gevern. Mehr aber auch nicht.
Er lässt sich auf einem der Steine nieder, die vor dem Holzbau in einem Halbrund um ein paar in den Boden eingelassene Schilder und Waffen angeordnet sind. Auch das sehr lustig! Was es mit dieser Motte auf sich hat, muss er jedenfalls auch noch genauer herausfinden. Er setzt die Kiepe ab, holt ein schwarzes Büchlein mit Bleistift heraus und macht sich unter Wald Nordhelle, SUP Oestertalsperre Einbaum!, Rosa Lokal am Haltepunkt, HestenbergTunnel, Plettenberger Kunstpfad und St. Lambertus? eine weitere Notiz: Nachtfalter Küntrop.




Dann wiegt sie den Kopf und gibt ihm den Tipp, in




zwar ein kleiner Umweg, aber leicht zu machen. Er



Die Frau fragt ihn nach seiner Wanderung, sie habe schon sehr lange niemanden mehr mit Kiepe über die Dörfer ziehen sehen. Er stellt sich vor und berichtet von seinem Wunsch, zu sehen, was sich in seiner Heimat in den letzten 25 Jahren verändert hat. Lächelnd sagt sie, sie erinnere sich an ihn. Dann wiegt sie den Kopf und gibt ihm den Tipp, in Küntrop in der Dinneike die Augen offenzuhalten und in Balve-Wocklum die Luisenhütte zu besuchen. Er überlegt. Der Neuenrader Stadtteil Küntrop wäre zwar ein kleiner Umweg, aber leicht zu machen. Er braucht nur bergab der Straße zu folgen. Balve und Wocklum liegen ohnehin in der Richtung, die er einschlagen wollte.


Wie schade, dass die Motte geschlossen ist. Mit ein paar eisernen Sprossen an der Außenwand und einer Falltür in der Plattform, könnte man wenigstens spontan hinaufklettern und die Aussicht ins Hönnetal genießen, die bestimmt ganz wunderbar ist. Doch er wird die Besichtigung nachholen. Zwischen Ostern und Oktober ist sie jeden ersten Sonntag im Monat geöff net, stand an der Tür der Motte. Jetzt rastet er erstmal, dann schaut er sich die nächste Etappe auf seiner Karte an. Den Weg bis Wocklum wird er heute noch gut schaffen. Und eine Idee für den nächsten Schlafplatz hat er auch schon.
Frisch gestärkt schwingt er seine Kiepe auf den Rücken und geht in Richtung Hönne und Bahngleise. Angesichts der Wärme hat er beschlossen, einen Teil der Strecke mit der Hönnetalbahn zurückzulegen. Hoffentlich muss er nicht zu lange warten. Doch hat er hat Glück, tatsächlich kommt bald ein Zug, die stündlich fahrende RB54. Er steigt ein und beschließt, vom Haltepunkt Sanssouci aus das Stück bis nach Wocklum zurückzugehen. Er weiß genau, wo die Luisenhütte liegt. An der Kurve, die zum Schloss führt, wo rechts die Sägemühle liegt, biegt er in die kleine Straße nach rechts ein. „Asphaltiert ist sie, guck an“, sagt er sich.
die Neu- und Umbauten der Meinhardus-Mattenschanzen immer wieder ein willkommenes Thema für Karl vom Ebbes ironische Kommentare waren?
Von hier ist es nicht mehr weit, knapp 500 Meter. Er kommt an einem kleinen Parkplatz und einem erstaunlich großen Spielplatz vorbei. Letzterer hat sogar einen Namen: Kleine Luise. Man scheint sich auf größere Besucherzahlen eingestellt zu haben. Als sich der Weg öff net und er links ein großes Gebäude entdeckt, staunt er nicht schlecht! „Donnerlittchen“, denkt er. Die Luisenhütte, im letzten Jahrhundert noch ziemlich verfallen, ist wieder aufgebaut.
Karl geht hinein. Er sieht den Hochofen in der Gießhalle. Er geht in die Abstichhalle und ins Gebläsehaus. Dann geht er über die steile Rampe auf den Möllerboden, wo der Hochofen bestückt wurde und wieder herunter durch das ganze Gebäude. Manches Mal wird er dabei ganz schön eng mit seiner Kiepe. Schwer beeindruckt betrachtet es draußen noch den Hüttenteich. Tatsächlich sieht es so aus, als könnte die Hütte jederzeit wieder in Betrieb gehen! Er nickt zufrieden. Dieser Besuch hat sich gelohnt!
Schnell trinkt er noch ein kühles Bier im benachbarten Gasthaus, dann steigt er den Burgberg hinauf. Dort muss eine alte Wallburg sein, wo er sich zum Schlafen legen will. Nachdem er die historische Stätte gefunden hat, macht er es sich zwischen deren Wällen bequem und ist froh über den interessanten Tag. Er zückt sein Buch und macht sich Notizen, freut sich schon jetzt darauf, seinen Zuhörern spannende Geschichten zu erzählen. Am nächsten Tag will er noch nach Altena gehen und die Burg besuchen.
Gleich frühmorgens marschiert er in Richtung Südwesten. Er wählt Strecken quer über die Berge, geht streckenweise auf nummerierten Wanderwegen, die er auch auf seiner Karte findet. Zum Schluss landet er auf einem Abschnitt des Sauerland Höhenflugs, der ihn bis zur Burg Altena führt.
Manche dieser Wege, die heute dem Freizeitvergnügen dienen, wurden in seinen jüngeren Jahren, noch für Transporte genutzt. Doch wie immer freut er sich, dass das Leben heute nicht mehr so beschwerlich ist und sich Menschen aller Generationen erholsame Stunden gönnen können.
An der Burg Altena hat sich kaum etwas geändert, nur ein moderner Anbau scheint neu zu sein. Er gehört zur Jugendherberge, wie sich herausstellt. Wie früher geht er durch den unteren Burghof bis in den oberen Burghof, bewundert die starken Mauern, den Bergfried und den Pulverturm.
Doch dann lässt ihn etwas stutzen, denn im oberen Burghof ist ein Bereich abgesperrt. Plötzlich taucht dahinter eine fröhliche Menschengruppe auf, Erwachsene und Kinder. „Was ist das?“, fragt Karl einen von ihnen. „Der Erlebnisaufzug zur Burg Altena“, antwortet der junge Mann. „Was ist denn ein Erlebnisaufzug?“. fragt Karl weiter. „Im Fahrstuhl, der einen übrigens innerhalb kürzester Zeit auf die Burg bringt, werden Geschichten über die Burg erzählt“, sagt der Familienvater. „Außerdem fährt der Aufzug mitten durch den Berg.“ „Mitten durch den Berg!“, wiederholt Karl voller Ehrfurcht. Sein Gegenüber nickt und verabschiedet sich, seine Familie erwarte ihn.
Karl tritt näher an die Absperrung. Ein Uniformierter fragt nach seinem Ticket. Karl schüttelt den Kopf, habe er nicht. Aber er sei Karl vom Ebbe und gerade auf einer Recherche-Wanderung. „Karl vom Ebbe?“, fragt der Mann und mustert ihn von oben bis unten. „Den gibt es doch gar nicht!“ Woraufhin dieser die Hände in die Hüften stemmt und ihn auffordert, genauer hinzusehen. Wer liefe schließlich heute noch mit einer Kiepe auf dem Rücken durch die Gegend, wenn nicht Karl vom Ebbe.
Der Kontrolleur zögert, lässt den Blick über den oberen Burghof schweifen und winkt ihn dann mit dem Kopf hinter die Schranke. „Gehen Sie schon rein“, knurrt er. Doch Karl schüttelt den Kopf. „Ich will ja nur gucken“, sagt er und schaut sich den Aufzug an, der gerade wieder neue Gäste gebracht hat. „Und der geht durch den Berg?“, fragt er. „ 90 Meter“, sagt der andere nickend. Karl schüttelt erneut den Kopf.
„Danke, runter gehe ich lieber zu Fuß“, sagt er und tritt durch die Schranke wieder in den Burghof. „Noch tragen mich meine Füße“, denkt er sich. „Aber beim nächsten Mal fahre ich rauf!“ Er wandert den Panoramaweg hinab, genießt den Blick auf die Stadt. Doch so langsam wird er tatsächlich etwas müde. Er gähnt und kratzt sich am Kopf. Bis nach Meinerzhagen schafft er es zu Fuß heute sicher nicht mehr. Doch ihm kommt eine Idee.
Es fährt doch sicher ein Bus nach Lüdenscheid, oder sogar nach Lüdenscheid-Brügge. Und von dort nimmt er die Bahn nach Meinerzhagen.
Sehr angetan von diesem Gedanken geht Karl weiter zum Markaner. Tatsächlich: Die Linie 37 kann ihn nach Lüdenscheid bringen. Er steigt ein, kapert einen Doppelsitz und stellt die Kiepe ab. Der Bus macht sich auf den Weg, fährt die Lüdenscheider Straße, biegt bald ab in Richtung Rahmede. Der Verkehr staut sich, das Schunkeln und das monotone Geräusch schläfern Karl ein, doch immer wieder schreckt er hoch. Mühlenrahmede, Altroggenrahmede, Dünnebrett. Er blinzelt, wobei ihm wieder freie Flächen an den Hängen ins Auge fallen.
Wusstest du schon, dass
das Karl-vom-Ebbe-Denkmal in Meinerzhagen die Sauerländer zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigen soll? Die Figur wird von vielen kleinen Figürchen begleitet, die beispielsweise verschiedene Handwerker darstellen.
„Stürme, Hitze, Borkenkäfer“, denkt er. Dann plötzlich reibt er sich die Augen. Das kann doch nicht sein! Da … Da fehlt doch was. Er schaut sich um. Ja, ganz sicher. Hier müsste eine Brücke stehen, die Autobahnbrücke über das Rahmedetal. Doch nach oben hat er freie Sicht. „Wo ist die Brücke?“, fragt er die junge Frau auf dem benachbarten Platz. „Gesprengt“, antwortet die lapidar. „Gesprengt?“, fragt Karl. „Warum?“ „Kaputt“, sagt die Frau.
„Und was ist mit der Autobahn?“, hakt er nach. Die A 45, vor mehr als 50 Jahren Zankapfel und Stolz der Region zugleich. Anschluss an die weite Welt, oder zumindest nach Nord- und Süddeutschland, nach Frankfurt! „Unterbrochen“, sagt die Frau, deutet dabei nach links und rechts. „Zwischen Lüdenscheid Nord und Lüdenscheid.“ „Nein!“, sagt Karl. „Doch“, sagt sie. Seit Dezember 2021 sei dort kein Auto mehr gefahren.
Karl erinnert sich an seine launigen Vorträge zur Sauerlandlinie, die 1968 bis Lüdenscheid-Nord und 1971 bis Freudenberg – und somit auch bis zu seinem Heimatort Meinerzhagen – eröff net worden war. Damals war Valbert in der Beschilderung ab der Autobahn nicht mehr vorgekommen. Doch davon unabhängig hatte die Autobahn auf den gigantischen Stelzen der Talbrücken allen plötzlich rasante Geschwindigkeiten über die Berge erlaubt – auch zwischen dem Norden und dem Süden des Kreises.
Und jetzt hat die marode Rahmedetalbrücke der Schnelligkeit ein Ende setzt? Und die Gemächlichkeit ins Märkischen Sauerland zurückgebracht?
Mein lieber Scholli. Im Vorbeifahren sieht er, wie Trümmer der Brücke von Lastwagen abtransportiert werden. Eine Steilvorlage, denkt er und nimmt sein Büchlein aus der Kiepe. Unter Erlebnisaufzug Burg Altena setzt er Rahmedetalbrücke. Es gibt einiges zu behandeln und zu berichten. Das steht schon fest.
Noch immer in Gedanken versunken, erreicht er den ZOB in Lüdenscheid, schwingt seine Kiepe auf den Rücken und steigt in die Linie 58 um, die ihn zum Bahnhof Lüdenscheid-Brügge bringen wird. Dort angekommen, steht der Zug bereits am Gleis, ist aber noch nicht für den Zustieg geöff net. Karl wundert sich über die Aushänge zum Schienenersatzverkehr. Alle Bahnsignale gen Norden leuchten Knallrot. Neugierig spricht er einen ebenfalls am Gleis wartenden Wanderer an, was da los sei. Die Strecke sei gesperrt, erfährt er. Bereits seit zwei Jahren. Da habe die Volme bei einem starken Hochwasser im Juli 2021 zwischen Hagen und Brügge Böschungen, Bahndämme und Gleise zerstört. „Ein Hochwasser?“, fragt Karl. „Durch meinen Lieblingsfluss Volme? Im schönen Volmetal?“
„Oh ja, tagelanger Starkregen hatte dazu geführt“, antwortet der Wanderer. „Die Volme konnte das viele Wasser nicht mehr fassen. Kleinere Brücken wurden mitgerissen und Häuser beschädigt. Lange Zeit konnte man die Schäden von der Bundesstraße aus sehen. Gleise hingen teilweise in der Luft . Eine tonnenschwere Baumulde lag im Flussbett. Die Reparaturen an der Volmetalbahn laufen aber jetzt schon seit Längerem.“ Der Wanderer lächelt traurig. „Solche Schäden zu reparieren, braucht viel Zeit“, fügt er noch hinzu. „Doch zum Glück sind wir beide ja gut zu Fuß.“ Zum Abschied tippt sich der Wanderer an den Hut, nickt und steigt in den Zug.
Karl ist noch ganz erschüttert. Wer hätte sich denn vorstellen können, dass die schmale, fröhlich plätschernde Volme eine solche Kraft entwickelt und eine Bahnstrecke, Brücken und Häuser beschädigt? Still und nachdenklich nimmt er auf einem Doppelsitz Platz, holt sein Notizbuch aus der Kiepe. Hochwasser Volme (Starkregen) schreibt er auf seine Liste. Wieder ein Thema, über das er sich genauer informieren müsste.
Waren die Hochwasserschäden im Volmetal, die Sperrung der Autobahn oder auch der Zustand der Wälder noch ein Thema, das sich lokal oder regional lösen ließ? Seine kabarettistischen Spitzen hatten meist die kleinen Themen behandelt, sich an die Lokal- und manchmal an die Regionalpolitik gerichtet. In Meinerzhagen und vielleicht auch mal im Märkischen Sauerland. Doch diese Themen schienen ihm eine ganz andere Nummer zu sein. Er blickt aus dem Fenster, der Zug bleibt immer nah am Fluss. Mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Er liebt diese Strecke, die nicht von ungefähr Volmetalbahn heißt.

Mehr Infos
Meinhardus-Mattenschanzen
Draußen dunkelt es jetzt. Wenig später erreicht er Meinerzhagen, schultert seine Kiepe, steigt aus und geht die letzten Kilometer bis zum Fumberg, wo er seine feste Bleibe hat, zu Fuß. Morgen früh werden ihn beim Blick aus dem Fenster die MeinhardusSchanzen begrüßen. Ihre Neu- und Umbauten waren immer wieder ein willkommenes Thema seiner ironischen Kommentare. Doch inzwischen haben die drei Schanzen sich zu einem Wahrzeichen in der Stadt entwickelt. Zu einer echten Konstante über die er gerade angesichts der Entdeckungen der letzten Tage froh ist.
Auch unterwegs gab es zum Glück viele Konstanten: Berge und Täler, die Kirchen und die Burg. Doch darüber hinaus entdeckte er interessante und teilweise völlig unerwartete Veränderungen im Märkischen Kreis. Gewünschte und unerwünschte Veränderungen. Er nimmt seine Notizen zur Hand und erkennt: Seine Heimatstadt und seine Heimatregion kann er gar nicht mehr so kleinräumig betrachten wie damals.
Hinweis
Früher mag Meinerzhagen eine eigene kleine Welt gewesen sein, in der er ironische Kommentare zu lokalen Entwicklungen machen konnte. Oder darüber hinaus die eine oder andere Spitze über das Märkische Sauerland fallen lassen konnte.
Heute hängt alles mit allem zusammen. Kein Ort ist mehr eine Insel, nicht Meinerzhagen, nicht das Märkische Sauerland. Alles ist Teil einer sich immer schneller verändernden, vernetzten Welt. Das muss er im Hinterkopf behalten, wenn er sich wieder einmal über die kleinen Ärgernisse des Lebens, die Bagatellen auslässt. Die bessere Idee wäre allerdings, seinen Fokus künftig gleich auf die größeren Zusammenhänge zu legen.
Wusstest du schon, dass die Volmetalbahn seit April 2024 wieder in Betrieb ist und der Bau der neuen Autobahnbrücke über das Rahmedetal mit großen Schritten vorangeht?
Die Geschichte dreht sich um die von Fritz Sträter entwickelte Kunstfigur Karl vom Ebbe. Alle Handlungen und Situationen sind fiktiv.
Hermann Wilken, S. 4-11
Dieter Stievermann, Die Neuenrader Kirchenordnung von 1564 und ihr Verfasser Hermann Wilken, Festvortrag zum 450jährigen Jubiläum, in: Der Märker – Landeskundliche Zeitschrift für den Bereich der ehem. Grafschaft Mark und den Märkischen Kreis, Heft 2015, S. 48- 66, Altena, 2015
Georg Gudelius, Die Neuenrader Kirchenordnung von 1564, in: Der Märker – Landeskundliche Zeitschrift für den Bereich der ehem. Grafschaft Mark und den Märkischen Kreis, Heft 3/4 1955, S. 108-115, Altena, 1955
Binz, C., „Witekind, Hermann“ in: Allgemeine Deutsche Biographie 43 (1898), S. 554-556 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd100705367.html#adbcontent (Letzte Überprüfung: 25. März 2023) Dorte Hilleke, S. 12-15
Stadt Menden, der Stadtdirektor (Hrsg.): Wer war Dorte Hilleke? Ein geschichtlicher Abriss über die Hexenprozesse in Menden und eine Übersicht über die Geschichte der Stadtbücherei, Menden
Kranz, Gisbert: Mendener Recht und Gericht - Hexenprozesse 1592-1631, Menden, 1929
Schulte, Anton: Mendener Köpfe. Stadtgeschichte in Kurzbiographien, S. 79-81, Menden, 1989
Kranz, Gisbert: Mendener Recht und Gericht - Hexenprozesse 1592-1631, Menden, 1929
Wikipedia, Hexenverfolgung im Herzogtum Westfalen (https://de.wikipedia.org/wiki/Hexenverfolgung_ im_Herzogtum_Westfalen) (Letzte Überprüfung: 17. April 2023)
Anna von Landsberg, S. 16-23
Hinz, Frank-Lothar, Die Geschichte der Wocklumer Eisenhütte 1758-1864 als Beispiel westfälischen adligen Unternehmertums, herausgegeben im Auftrag der Freunde der Burg Altena e.V. im Rahmen der Altenaer Beiträge (Band 12) von Rolf Dieter Kohl, Altena, 1977
Ralf J. Günter, Schloss Wocklum - Geschichten von Adel, Industrie und Sport, S.56-71, Velen, 2016
Anna Maria Theresia von der Recke, veröffentlicht unter Wikipedia, online verfügbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Theresia_von_der_Recke (Letzte Überprüfung: 10. August 2023)
Franz Kaspar Ferdinand von Landsberg zu Erwitte, veröffentlicht unter Wikipedia, online verfügbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Kaspar_Ferdinand_von_Landsberg_zu_Erwitte (Letzte Überprüfung: 10. August 2023)
Franz Kaspar Ferdinand von Landsberg zu Erwitte, veröffentlicht im Internet-Portal „Westfälische Geschichte“, online verfügbar unter http://www.westfaelische-geschichte.de/per2936 (Letzte Überprüfung: 10. August 2023)
Schloss Wocklum, veröffentlicht unter Wikipedia, online verfügbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/ Schloss_Wocklum (Letzte Überprüfung: 10. August 2023)
Gut Stockhausen (Lübbecke), veröffentlicht unter Wikipedia, online verfügbar unter https://de.wikipedia. org/wiki/Gut_Stockhausen_(L%C3%BCbbecke) (Letzte Überprüfung: 10. August 2023)
Friedrich Woeste, S. 24-29
J.F.L. Woeste, Volksüberlieferungen in der Grafschaft Mark nebst einem Glossar, Iserlohn, 1848, , online verfügbar unter: https://books.google.com.fj/books?id=eKlJAAAAIAAJ&hl=de&pg=PR 1#v=onepage&q&f=false
Willhelm Bleicher, Woestes Bedeutung – eine Würdigung des Werkes von Johann Friedrich Woeste, Vorwort zur Neuauflage der Volksüberlieferungen in der Grafschaft Mark von J.F.L. Woeste, Iserlohn, 2007
Georg Gudelius, Friedrich Woeste, in: Hemer – Beiträge zur Heimatkunde, Hemer
Artikel „Woeste, Friedrich“ von Edward Schröder in: Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 43 (1898), S. 706–707, Digitale Volltext-Ausgabe in Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Woeste,_Friedrich&oldid=- (Version vom 4. Juni 2023, 06:49 Uhr UTC)
Eintrag Friedrich Leopold Woeste unter Wikipedia, online verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/ Friedrich_Leopold_Woeste (Letzte Überprüfung: 4. November 2023)
Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio, S. 30-35
Heimatbund Märkischer Kreis (Hrsg.), Veröffentlichungen des Heimatbundes Märkischer Kreis, Band 11, Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio – Ein „Lieder“-liches Genie, Altena, 1991 von Löbbecke-Campe, Charlotte, Haus Nachrodt und die Familie Schmidt – Eine Geschichte zu den Industrieanfängen und Entwicklung einer Ortsgemeinde im Lennetal, in: Hohenlimburger Heimatblätter für den Raum Hagen und Iserlohn, Heft 9/2022 September 2022, S. 309-323, Iserlohn, 2022
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) - Literaturkommission für Westfalen, Lexikon Westfälischer Autorinnen und Autoren, Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio, https://www.lexikon-westfaelischerautorinnen-und-autoren.de/autoren/zuccalmaglio-anton-wilhelm-florentin-von/ (Letzte Überprüfung: 10. Oktober 2022)
Dr. Schulze, Nachrodt und Zuccalmaglio – wie ehrt(e) unsere Gemeinde ihren berühmtesten Sohn?, Manuskript zum Vortrag am 24.06.2019 in der Heimatstube Wiblingwerde, veröffentlicht auf der Website des Heimat- und Verkehrsvereins Nachrodt-Wiblingwerde, online verfügbar unter: https://hvv-nachrodtwiblingwerde.de/index.php/vortraege/8-vortragsmanuskript-zuccalmaglio-und-nachrodt-wiblingwerdedr-schulze-am-24-06-2019 (Letzte Überprüfung: 11. Oktober 2022)
Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Haus Nachrodt - Vom mittelalterlichen Amtshaus zum bürgerlichen Wohnsitz, veröffentlicht auf der Website der Deutsche Stiftung Denkmalschutz, online verfügbar unter: https://www.denkmalschutz.de/denkmal/haus-nachrodt.html (Letzte Überprüfung: 11. Oktober 2022)
Stadt Nachrodt-Wiblingwerde, Klarashöhe, veröffentlicht auf der Website der Stadt Nachrodt-Wiblingwerde, online verfügbar unter: https://www.nachrodt-wiblingwerde.de/Klaras-Hoehe.htm (Letzte Überprüfung: 11 Oktober 2022)
Bildnachweis S. 33: Archiv Haus Nachrodt.
Ernst Danz, S. 36-41
Marlis Gorki, Der Iserlohner Verschönerungsverein, in: Beiträge zur Heimatkunde für Iserlohn und den märkischen Raum, Band 23 (2019), Seite 125-140, Iserlohn, 2019
Rico Quaschny: Unermüdlich um die Verschönerung der Stadt und ihrer Umgebung bemüht. Zum 200 Geburtstag von Professor Ernst Danz aus Iserlohn, in: Peter Kracht (Hrsg.): Schönes Westfalen Jahrbuch 2022, S. 189–194, Münster 2021
Professor Ernst Danz, in: Der Märker – Heimatblatt für die ehemalige Grafschaft Mark, Heft 1/1957, S. 8, Altena, 1957
Danz-Turm-Basar, Einige Erinnerungen an Ernst Danz, Iserlohn, 1908
Stadtarchiv Iserlohn, Dokumentation anlässlich des 100. Todestags von Ernst Danz, https://www.iserlohn. de/kultur/stadtarchiv/stadtgeschichte/professor-danz-neu (Letzte Überprüfung: 22. Mai 2023)
Dr. Friedrich Deisting, S. 64-71
Heimatverein Kierspe, 120 Jahre Volksbank in Kierspe - Die Geschichte der Kiersper Genossenschaften, in: Werkstatt Geschichte, Band 27, Kierspe, 2021
Lisa-Marie Weber, Bücher statt Brot: Dr. Deisting setzt Prioritäten, unter come-on.de, erschienen am: 13.08.2010, online verfügbar unter: https://www.come-on.de/volmetal/kierspe/buecher-statt-brotdeisting-setzt-prioritaeten-877477.html (Letzte Überprüfung: 5. Oktober 2023)
Eintrag Berufsgenossenschaften, Abschnitt Geschichte unter Wikipedia, online verfügbar unter: https:// de.wikipedia.org/wiki/Berufsgenossenschaft#cite_ref-75_Jahre_BGW_16-0 (Letzte Überprüfung: 5 Oktober 2023)
Eintrag Raiffeisen unter Wikipedia, online verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Raiffeisen, (Letzte Überprüfung: 5. Oktober 2023)
Eintrag Friedrich Wilhelm Heinrich Raiffeisen unter Wikipedia, online verfügbar unter: https://de.wikipedia. org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Raiffeisen#cite_note-33 (Letzte Überprüfung: 5. Oktober 2023)
Kiersper Geschichte auf der Website der Stadt Kierspe, online verfügbar unter: https://www.kierspe.de/de/ stadt/menschen-und-geschichte/geschichte-kierspe.php (Letzte Überprüfung: 5. Oktober 2023)
Wilhelm Seissenschmidt, S. 42-45
Kempa, Christine, Die Sozialleistungen des Wilhelm Seissenschmidt während der Industriellen Revolution in Plettenberg, in Im Tunnel der Geschichte – Facetten aus der Vergangenheit von Plettenberg, hrsg. von Peter Schmidtsiefer und Martina Wittkopp-Beine, Plettenberg, 2008
Martina Wittkopp-Beine, Wolf-Dietrich Groote, Horst Hassel, Martin Zimmer, Zur Plettenberger Wirtschaft in der Frühindustrialisierung 1850-1895, in Plettenberger Stadtgeschichte Band 4, Von Arbeitswelten Unterund Übertage, Plettenberg 1996
Stadt Plettenberg (Hrsg.), Plettenberger Köpfe – Interessante Persönlichkeiten der Stadt Plettenberg, S. 73, Plettenberg, 2000
Das Kiepenlisettken, S. 46-49
Der Mond über Lüdenscheid – Die unglaubliche Karriere des „Kiepenlisettken“ aus P. Bürger (Bearb.): Dai van der Stroten – Menschen des Straßenlebens in der Mundartlyrik Christine Kochs und in der Geschichte des Sauerlandes, veröffentlicht in daunlots. internetbeiträge des christine-koch-mundartarchivs am museum eslohe, nr. 72, Eslohe, 2014, online verfügbar unter: http://www.sauerlandmundart.de/daunlots. html (Stand: 2014, letzte Überprüfung: 11. Oktober.2022)
https://www.sauerland.com/de/neusta-pois/kiepenlisettken (Letzte Überprüfung: 1. April 2025)
Gustav Selve, S. 50-55
Andreas Daniel, Zur Entstehung der „Volksheilstätten“ (Lungensanatorien) Hellersen bei Lüdenscheid und Ambrock bei Hagen (eröffnet 1898 und 1903), in: Der Märker – Heimatblatt für die ehemalige Grafschaft Mark, Heft 3/1990, S. 113-118, Altena, 1990
Ulrich Barth, Das Denkmal für den Industriellen Gustav Selve (1842–1909) in Altena, in: Denkmalpflege in Westfalen-Lippe, Jahrgang 2007, Heft 1, S. 24–27, Münster, 2007
Ralf Stremmel, Gustav Selve – Annäherungen an einen Großindustriellen und märkischen Wirtschaftsbürger im Kaiserreich, in: Der Märker – Heimatblatt für die ehemalige Grafschaft Mark, Heft 1/2002, S. 5-19, Altena, 2002
Ralf Stremmel, Gustav Selve. Ein Großindustrieller im Deutschen Kaiserreich, in: Der Reidemeister, Geschichtsblätter für Lüdenscheid Stadt und Land, Nr. 180 vom 3. November 2009, S. 1481–1486, Lüdenscheid, 2009
Ralf Stremmel, „Selve, Gustav“, in: Neue Deutsche Biographie 24 (2010), S. 231-232 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd189539097.html#ndbcontent (Letzte Überprüfung: 16. Juni 2023)
Carl Berg, S. 56-63
Müller-Wusterwitz, Nikolaj, Die Unternehmen der Familie Berg, Chronik ab 1787, Unternehmenspublikation, Lüdenscheid, 1999
Dr. Berg, Carl, David Schwarz · Carl Berg - Die Anfänge des Zeppelin - Ein Beitrag zur Geschichte der Luftschiffahrt, München, 1926 – Nachdruck in: Lüdenscheider Geschichtsverein e.V. (Hrsg.), Der Reidemeister – Geschichtsblätter für Lüdenscheid Stadt und Land Karl von Holtzbrinck, Ausgabe 118 und 119, Lüdenscheid, 1991
Trox, Eckhard (Hrsg.), Der Traum vom Fliegen – Carl Berg und die Luftschiffindustrie von Lüdenscheid bis Lakehurst, Lüdenscheid, 2000
Trox, Eckhard, Der unterschätzte Industrielle Carl Berg (1851-1906) – Aluminiumlegierungen, diffizile Geschäftsbeziehungen und Zeppeline, in: Der Märker – Landeskundliche Zeitschrift für den Bereich der ehem. Grafschaft Mark und den Märkischen Kreis, Heft 1/2 2001, S. 57-67, Altena, 2001
Chant, Christopher, Der Zeppelin – 100 Jahre Luftfahrtgeschichte, Augsburg, 2000
Bildnachweis S. 56: Kreisarchiv des Märkischen Kreises, Bilddatenbank, Signatur F 3550
Eugen Schmalenbach , S.72-77
Werner Sinnwell, … indem man sich selbst treu bleibt – Eugen Schmalenbach 1873-1855, Halver, 2005
Bildnachweis S. 74: Archiv Peter Bell
Anna von Holtzbrinck , S. 78-83
Geschichts- und Heimatverein Herscheid e.V.
Stadtarchiv Lüdenscheid
Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 114, S. 288, Karl von Holtzbrinck, veröffentlicht im Internet-Portal ‚Westfälische Geschichte‘, online verfügbar unter: http://www.westfaelische-geschichte.de/per 837 (Stand: 18.02.2004, letzte Überprüfung: 30.09.2022)
Statista Research Department, Mangel und Lebensmittelversorgung im Ersten Weltkrieg 1914-1918, veröffentlicht im Internet-Portal Statista, online verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/ studie/1072784/umfrage/mangel-und-lebensmittelversorgung-im-ersten-weltkrieg/ (Stand: 01.10.2013, letzte Überprüfung: 30.09.2022)
Bildnachweis S. 78: Geschichts- und Heimatverein Herscheid e.V.. Frank Holthaus aus Herscheid
Alfred Colsman , S. 84-89
Eintrag „Colsman, Alfred“ in Munzinger Online/Personen - Internationales Biographisches Archiv, URL: http://www.munzinger.de/document/00000005299 (Zuletzt abgerufen von Münchner Stadtbibliothek am 8. November 2022)
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) - Personen-Mappen, Colsman, Alfred, veröffentlicht im ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Pressearchiv, online verfügbar unter: http://purl.org/pressemappe20/folder/pe/003409 (Letzte Überprüfung: 8. November 2022)
Swientek, Horst-Oskar, „Colsman, Alfred“ in: Neue Deutsche Biographie 3 (1957 ), S. 330-331 [OnlineVersion]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd11943654X.html#ndbcontent (Letzte Überprüfung: 10. November 2022)
Colsman, Alfred, Jugenderinnerungen aus dem Dorf Werdohl, in Süderland – Heimatblatt für den südlichen Teil der Grafschaft Mark, Nr. 4, 1936, Altena
Industrie-Jubiläen – 100 Jahre Colsman & Co., Werdohl. Kommerzienrat Dr. Alfred Colsman, ein Freund des Grafen Zeppelin, die Seele des Unternehmens, in: Landeskundliche Zeitschrift für den Bereich der ehem. Grafschaft Mark, Doppelheft 5/6 1954, S. 138, Altena, 1954
Christopher Chant, Der Zeppelin – 100 Jahre Luftfahrtgeschichte, Augsburg, 2000
Trox, Eckhardt, Der unterschätzte Industrielle Carl Berg (1851-1906) – Aluminiumlegierungen, diffizile Geschäftsbeziehungen und Zeppeline, in: Der Märker – Landeskundliche Zeitschrift für den Bereich der ehem. Grafschaft Mark und den Märkischen Kreis, Heft 1/2 2001, S. 57-67, Altena, 2001
Karl vom Ebbe , S. 90-97
Karl vom Ebbe. Heiteres und Nachdenkliches über große & vor allem kleine Begebenheiten in und um Meinerzhagen. Verfasst von Fritz Sträter. Herausgegeben von Detlev Sträter, Dagmar Sträter-Müller und Uwe Sträter, Selbstverlag; Meinerzhagen 2007

Herausgeber:
Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e.V. | Märkischer Kreis, Bismarckstr. 15, 58762 Altena
Konzeption: Laura Schneider | Herz an Hirn, Hana Beer | FTV, Anja Tröbitz | DICREATE
Text: Sabine Schlüter | Die flotte Feder Layout: Anja Tröbitz | DICREATE
Druck: Märkischer Kreis, Printed in Germany.
www.maerkisches-sauerland.com
Gender-Hinweis:
Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Geschlechter (m/w/d).
Änderungen vorbehalten. Einzelangaben ohne Gewähr.
Stand: September 2025
Fotografen: Michael Kotowski; mit folgenden Ausnahmen: S. 3 (2) Linda Nitsch Fotografie




www.maerkisches-sauerland.com
Benötigst du Hilfe oder Informationen rund um deinen Ausflug ins Märkische Sauerland?
Dann wende dich für örtliche Informationen als ersten Anlaufpunkt an die touristischen Infostellen. Du vermisst Angebote, Anbieter oder Informationen auf unserer Website? Sende uns dein Anliegen mit entsprechendem Betreff über das Kontaktformular oder an info@maerkisches-sauerland.com.