Geschichte(n) Sauerland
aus dem Märkischen

Weyhe Park hier entdecken!



Weyhe Park hier entdecken!

willkommen im Märkischen Sauerland. Vielleicht kennst du bei uns schon einige Ecken, vielleicht ist dir auch alles neu. So oder so: Unsere Region hält neben Natur- und Freizeiterlebnissen auch eine spannende Historie für dich bereit, die uns zum Beispiel ein reiches industriekulturelles Erbe hinterlassen hat. Immer wieder zeugt sie von der Tatkraft und Energie, vom Engagement und vom Organisationstalent der Märker. Wegen dieser Menschen gibt es über das Märkische Sauerland auch so viel zu erzählen.
Im Booklet, das du gerade in den Händen hältst, haben wir einige ungewöhnliche Geschichten aus dem Märkischen Sauerland für dich zusammengestellt. Manche haben wir für dich herausgefunden, manche haben wir uns für dich ausgedacht. Mal lassen sie dich in die Vergangenheit eintauchen, mal an Erlebnissen teilhaben, die du gerne auf deine Bucket List setzen und bei uns ausprobieren kannst.
Erfahre Dinge, die du nicht im Traum geahnt hättest, und lass dich inspirieren, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen!
Viel Spaß beim Eintauchen in unsere Geschichten und unsere Region! Und dann: bis bald im Märkischen Sauerland.

Hana Beer
Geschäftsführerin Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e.V .

Geschichte des Märkischen Sauerlands
6 L icht, Halbdunkel und Schatten – Begegnungen mit einem Bewohner der Burg Altena
12 Auf die Ziege gekommen – Vom Leben, Lehren und Lernen in der Schule an der Heesfelder Mühle
18 Ein architektonischer Traum in Weiß – Die Villa Wippermann und ihre Geschichte
24 Jacobs Schatz – Schwierige Zeiten im Bauernhaus Wippekühl in Schalksmühle
Natur im Märkischen Sauerland
32 Bunte Tupfer im Maiengrün – Eine Rangerführung durch den Frühlingswald auf der Nordhelle
38 Die Natur kehrt zurück – Eine Kräuterwanderung am Rande des Naturschutzgebiets Apricke in Hemer
44 Die Entdeckung der unterirdischen Glitzerwelt – In der Iserlohner Dechenhöhle wartet ein beeindruckendes Kunstwerk der Natur
Industriegeschichte des Märkischen Sauerlands
52 Ein Fall von Hüttenzauber – Erstaunliche Geschehnisse an der Luisenhütte in Balve
58 E s ist nicht alles Gold, was glänzt – Auf den Spuren der Messingproduktion in der Fabrikanlage Maste-Barendorf in Iserlohn
64 Von der Rolle – Anno dazumal auf dem Drahthandelsweg zwischen Altena und Iserlohn
70 K leines Tal, starke Geschichte – Entdeckungen entlang der Drahtrollenroute in Altena-Evingsen
76 Der Stoff für besonderes Design – Kierspe und das Bakelit
82 In der Ruhe liegt die Kraft – Wie in der Lüdenscheider Knopfindustrie Metallknöpfe entstanden
88 Von Oberkellnern zu Industrieunternehmern – 300 Jahre im Wirken der Familie von Dücker in Menden-Rödinghausen
94 Weber, bleib bei deinen Strümpfen – Die Geschichte der Bleierzgrube Neu Glück in Plettenberg
100 Vom Wirtschaftsmotor zum Freizeitort – Die Geschichte der Talsperren im Märkischen Sauerland
Freizeit im Märkischen Sauerland
108 Sprung mit Schwung – Auf den Mattenschanzen in Meinerzhagen lernen Skispringer fliegen
114 900 Reben auf 999 Quadratmetern – Ein Südhang über der Stadt liefert in Neuenrade süffigen Ertrag
120 Hoch hinaus – In Werdohl laden fünf markante Felsen zum Klettern ein
126 Eine flauschige Angelegenheit – Unterwegs mit den Höhendorf Alpakas vom Hof Hegemann in Nachrodt-Wiblingwerde
131 Impressum, Kontakt & Weitere Informationen

Hier finden Yoga und andere Freizeitangebote statt


Diesen Winter erstrahlt die Burg Altena wieder in ganz besonderem Schein. „GlanzLicht“ nennt sich die Zeit, in der die Burg sich außen wie innen von einer ungewöhnlichen Seite zeigt. Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt die Lightshow an der Außenfassade. Doch einem kleinen Dauerbewohner der Burg Altena behagt das überhaupt nicht.


„ Nicht schon wieder! “, jammert Maxi, als die kräftigen Strahler auf der Flussseite der Burg Altena aufleuchten. Knallrot dieses Mal. Fast so rot, wie Maxis Kopf, der jetzt vor Wut auch noch anschwillt. Na ja, bei dieser Beleuchtung wäre das sowieso nicht zu erkennen. Mal ganz davon abgesehen, dass man Gespenster bei Licht ja eh nicht sieht. Also: Menschen sehen sie nicht bei Licht. Sondern nur im Dunkeln. Und dann auch nur, wenn die Geister es wollen.
Maxi hatte sich jedenfalls seit Monaten auf die dunkle Jahreszeit gefreut. Denn an den kürzesten Tagen des Jahres sind er und seine Freunde immer so richtig in ihrem Element. Dann, wenn die Nacht schon um halb fünf beginnt. Eigentlich.
Dann tobt die Familie durch die Burg, die Burghöfe und bis in die Türme und Türmchen, dass es eine Freude ist. „ Hihihi “ und „ Hehe“ schallt es durchs Gemäuer. Oder „ Hahaaa.“ Und natürlich immer wieder „ Huuhuuhuu“.
Das „ Hohoho“ sparen sie sich übrigens für ganz besondere Tage auf: Da muss schon der Weihnachtsmann im Flugschlitten über die Burg hinwegsausen. Oder der Nikolaus mit seinem Schlitten Halt machen und Geschenke an glückliche Kinder verteilen. Und wenn seine Freunde aus benachbarten Burgen und Schlössern zu Gast sind, veranstalten sie Geisterspiele: Bockspringen über die hohen Zinnen, 555 -Meter-Lauf durch die Wehrgänge, Stabhochsprung über den Burgfried. Ui. Wie gesagt, eigentlich.
Burg Altena im Winter bunt leuchtet? Vom ersten Adventswochenende bis Anfang Januar findet jährlich das „GlanzLicht“ statt.
ausdrücklichProbeliegen erwünscht

Burg Altena mehrere Museen hat? Die Museen in der Burg Altena halten tolle Erlebnisse und Entdeckungen für dich bereit: vom Mittelalter bis zur ersten Jugendherberge der Welt.

Im Dunkeln wäre gut Munkeln. Eigentlich.
Uneigentlich macht der ganze Spuk Maxi überhaupt keinen Spaß, wenn das schöne düstere Zuhause auf einmal stundenlang im Scheinwerferlicht steht. Und dann noch in allen Farben. Nicht nur in Rot! Auch in Grün! In Blau! Gelb! Orange! Lila!! Oh nein. Manchmal alle Farben gemischt. Maxi hört dann draußen die Zuschauerrufe: „ Ooh“, „ Ahh“ und „ Schöön“. Während er selbst denkt „ Bääh! “. Denn für Maxi ist dieses Lichterwerk nur eins: gru-se-lig! Draußen spielen und trainieren kann man völlig vergessen.
Daher zieht er sich jetzt erstmal in sein Lieblingsversteck im Museum der Grafschaft Mark zurück und schmollt. Jedes Burggespenst hat ein Lieblingsversteck und so zwei bis drei Lieblings-Buhs. Das sind Plätze, an denen das Erschrecken besonders viel Spaß macht. In der Burg Altena – und gerade in den Museen –gibt es so viele tolle Verstecke und Buhs, dass die Geister darum überhaupt nicht streiten müssen. Hier wäre Platz für Gespenster in allen Formen und Größen.
Maxi selbst ist noch lange nicht ausgewachsen. Seine Schwester schon fast. Und sein Vater ist über die Jahre ziemlich breit geworden. Daher liegt dessen Lieblingsversteck im Museum Weltjugendherberge unterm vorletzten Bett rechts hinten. Sein Onkel Hugo muss seine Plätze mit Bedacht aussuchen.
Er hatte als jugendlicher Geist eine Kollision mit einem Ritterschwert in Raum 18 Seitdem trägt er seinen Kopf unterm Arm und setzt ihn nur manchmal auf – natürlich um Menschen zu erschrecken. Onkel Hugos aktuelles Lieblingsversteck ist für Maxis Begriffe etwas langweilig: der Kamin in Raum 11. Na ja. Er hätte wenigstens den hübschen Kachelofen nehmen können.
Seine Schwester Aline nächtigt üblicherweise im Himmelbett im Luxuszimmer 16 Typisch und auch nicht besonders originell. Am liebsten liegt sie unter der Bettdecke und lässt ihr Haar zu beiden Seiten heraushängen. Als wäre sie Rapunzel! Und dann versucht sie auch noch, mit der Mode zu gehen. Kürzlich war sie als Burgfräulein unterwegs, da lag ihr spitzer Hut mit Schleier auf dem Himmel des Betts. Sehr dezent!
Und immer, wenn sie sich mit ihren Freundinnen aus Schloss Wocklum getroffen hat, zwirbelt sie sich das Haar tagelang zu barocken Locken oder bastelt sich eine hohe Perücke. Die liegt dann beim Schlafen wie ein Helm neben ihr. Maxi hat Alines Perücke mal gemopst und versteckt. In einem großen Vorratstopf, in der 20. Da war was los!
Sein eigenes Lieblingsversteck findet Maxi selbstverständlich großartig: Es ist die kleine Rüstung für angehende Ritter im Turnierzimmer, Raum 19. Meist zieht er sich komplett hinter das Scharnier im Helm zurück und heckt Streiche aus. So wie jetzt. Bis er beschließt, trotz der schrillen Beleuchtung sein tägliches Erschreck-Training zu absolvieren. Er darf schließlich nicht aus der Übung kommen.
Maxi beginnt gleich nebenan, in Raum 21. Sein Lieblings-Buh Nummer 1: das Kettenhemd. Schon 700 Jahre alt und komplett aus Draht. Der wurde vor vielen hundert Jahren von Hand in Altena gezogen. Geschickt schlängelt sich Maxi zwischen Vorder- und Rückseite, streckt sich in alle Richtungen, bis er fast durchsichtig ist. Dann reißt er plötzlich die Augen weit auf und presst sich unvermittelt mit einem Schrei durch das Hemd. „ Hihihi “, kichert er laut. „ Huhuuu! “
Das hat schon mal sehr gut geklappt! Weiter geht es im Pulverturm, im Raum 23 Lieblings-Buh Nummer 2: ein wunderschönes Nachtwächterhorn, mit dem die Wächter die Stadtbewohner früher nachts bei Bränden warnten. Schon schlüpft er hinein, sammelt Kräfte und schießt mit lautem Trompetenton wieder hinaus. „ Hahaaa“, freut sich Maxi. Das läuft ja wie am Schnürchen. „ Huhuuu! “
Flugs schwebt Maxi die Wendeltreppe hinunter, huscht über den Hof und verschwindet gegenüber im Eingang zum Kellergewölbe. Lieblings-Buh Nummer 3: Der Rennofen im Raum 5. Auch so ein uraltes Teil. Darin wurde früher das Eisen aus dem Erzgestein geschmolzen. Dort brennt natürlich kein echtes Feuer mehr, nur noch manchmal ein Pseudofeuer. Heute aber nicht und so schmiegt sich Maxi in die Höhlung und konzentriert sich, um dann mit einem lauten Zischen aus dem Loch zu fahren. „ Hehe“, gluckst er. Perfekt! Er wird immer besser. „ Huhuuu! “

die Burg Führungen für Klein und Groß anbietet? Die Angebote reichen von der Schatzsuche für Kinder bis zur Ritterprüfung für Erwachsene.

Angebote Führungen


du rund um die Burg noch mehr erleben kannst – und zwar zu jeder Jahreszeit? Geocaching ist im Angebot und ein spannender Natur- und Geschichtspfad. Außerdem kannst du von Zeit zu Zeit an einer Lichterführung teilnehmen, auf der es manchmal auch ein bisschen gruselig zugeht.
Beschwingt gleitet er die Treppe wieder hinauf – und erstarrt vor Schreck. Eine ganze Kolonne an kleinen spitzen weißen Hügelchen, auf denen sanft die Farbe der Burgbeleuchtung schimmert, schwebt im Schneckentempo über den Burghof. Allen voran ein großer spitzer weißer Hügel. Was ist das? Woher kommen diese Hügel? Hat es geschneit? Aber wieso bewegen sie sich? Und warum machen sie so komische, murmelnde Geräusche? Jetzt bleiben die Hügel stehen, der große wird noch höher – und lauter. Maxi beginnt am ganzen Leib zu schlottern. Vorsichtig tastet er sich zur nächsten Treppe, die zur Weltjugendherberge hinunterführt, und schwebt rückwärts hinab.
Auch außerhalb der Burg gibt‘s Erlebnisse

Geocaching
Unten angekommen, geht er sogleich in Deckung und schleicht zum Lieblingsplatz des Vaters. Der ist zwar bereits eingeschlafen, aber immerhin da. Was für ein Glück! Maxi kuschelt sich erleichtert an ihn. Der Vater staunt nicht schlecht, als er kurz darauf mit einem Grunzen erwacht. „Was ist los?“, fragt er das Söhnchen. „Weiße Hügel. Im Hof. Sie bewegen sich. Machen Geräusche“, stottert Maxi mit schreckgeweiteten Augen. „Wie bitte? Das kann ich nicht glauben. Du willst mich wohl verkohlen! “, antwortet der Vater. Doch Maxi schüttelt stumm und verängstigt den Kopf. „ Komm“, sagt der Papa. „ Das schauen wir uns gemeinsam an. Wer wird denn hier Geister erschrecken? “
Er nimmt seinen Sohn an die Hand und schwebt bedächtig die Stufen hinauf. Auch der Vater fährt zunächst zurück, als er sieht, was im Burghof vor sich geht. Maxi hat sich zitternd hinter seinem Rücken versteckt. Das Herz klopft ihm bis zum Hals. Noch einmal riskiert er den Blick in den Hof und sieht die Hügel gerade gegenüber im Eingang zum Museum verschwinden.
Dann beginnt Maxis Papa plötzlich schallend zu lachen. „ Hihihi “, kichert er laut. „ Hahaha.“ Lachtränen kullern ihm aus den Augen. Maxi versteht die Welt nicht mehr. Ungeduldig fragt er: „Was ist los? Warum lachst du? “
„ Hihihi “, kichert der weiter, während Maxi an ihm zerrt. „ Hahaha.“ Der Papa schnappt nach Luft. „ Hihihi, das sind Kinder “, sagt er. „ Menschenkinder, die sich als Gespenster verkleiden. Hihihi.“ Wieder will er sich ausschütten vor Lachen. „ Findest du das nicht lustig? “ Maxi schüttelt ungläubig den Kopf. Lustig findet er das überhaupt nicht! Im Gegenteil! Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass jetzt die Kinder die Gespenster erschrecken! „ Na wartet “, denkt er sich. Und schon beginnt er, sich einen besonders gruseligen Spuk zu überlegen. Vielleicht würde es ihm ja gelingen, das ausgestopfte Wildschwein im Jagdsaal 17 in Bewegung zu bringen? Das wird er gleich mal ausprobieren, wenn die Hügel-Kolonne dort vorbeikommt.
Du möchtest
Dann nimm entweder den Erlebnisaufzug, der dich mitten durch den Berg in den oberen Burghof fährt und dabei schon die ersten Geschichten erzählt. Oder gehe den schönen Panoramaweg hinauf, der sich von der Stadt den Berg hinauf schlängelt. Die Museen Burg Altena haben das ganze Jahr für dich geöffnet.
Schau mal, ob du die Verstecke und Lieblings-Buhs von Maxi und seiner Familie entdeckst. Besonders gut kannst du das bei einer Schatzsuche auf der Burg Altena, bei der du als Gespenster verkleidet nach dem Burggespenst suchst. Und vielleicht kannst du es sogar erschrecken!

Das „neue Tor zur Burg“Der Erlebnisaufzug: „Durch sieben Tore musst du gehen...“
Vom Leben, Lehren und Lernen in der Schule an der Heesfelder Mühle
Theodor hatte seinen Dienst beim Militär quittieren müssen. Die Zeiten waren friedlich, Soldaten nicht besonders gefragt. Seither zog er durchs Märkische. Die Eltern waren verstorben, den Geschwistern wollte er nicht zur Last fallen. Er blieb auf Wanderschaft und bot seine Dienste als Schreiber an. Doch dann ergab sich unvermittelt die Gelegenheit, als Lehrer tätig zu werden. Zwar hatte er noch nie unterrichtet, aber wer hatte das schon in jenen Jahren. Seine ersten Tage in der Schule an der Heesfelder Mühle wurden jedoch zu einer größeren Herausforderung als erwartet. Und das lag weder am Unterricht noch an den Schülern.

Eines guten Tages kam Theodor auf dem Heerweg nach Halver durch Heesfeld. Wie immer bot er seine Dienste an. Niemand brauchte eine amtliche Korrespondenz oder einen Brief, aber man erzählte ihm, dass der Winkelschule unten im Tal der Hälver der Lehrer abhandengekommen war. Es bedurfte keiner langen Überlegungen, schließlich konnte er nicht nur lesen und schreiben, sondern sogar rechnen. So bog er kurzerhand in den Hohlweg ab, durch den seit Jahrhunderten die Wagen zur Heesfelder Mühle zogen. Direkt neben der Mühle, so hatte man ihm gesagt, sei die Schule zu finden.
Als der nächste Morgen graute und die Vögel zwitscherten, hatte sich das Blatt für den Heimatlosen bereits gewendet. Das Wasser rauschte über das große klappernde Rad der Heesfelder Mühle. Theodor lag im Heu unter dem Dach der Schule. Er hatte es geschafft, sogleich Nägel mit Köpfen gemacht, dies war jetzt seine Bleibe. Die Herren Fabrikanten Winkhaus in Carthausen waren mehr als froh gewesen, dass ihnen das Schicksal so schnell einen neuen Lehrer zuspielte.
Der letzte war nicht lange geblieben, hatte sich offenbar in tiefster Nacht heimlich aus dem Staub machen wollen. Man fischte ihn eines Morgens samt seinem Bündel aus dem Becken unterhalb des Mühlrads. In der Hand hielt er noch den Strick, an den er seine Ziege gebunden hatte. Neben ihm schwamm eine irdene Branntweinflasche – leer. Seine Ziege hatte lauthals meckernd am Rand gestanden. Wie sie es geschafft hatte, nicht ins Wasser zu fallen, würde man nie klären.
Jetzt zeigte ihr Meckern, dass der Tag auch für sie begonnen hatte. Ihren Platz hatte sie unten, im flachen Anbau neben der Schule. Das Tier, mit kleinen kecken Hörnchen auf dem Kopf, vorne geflecktes und hinten braunes Fell, war direkt in seinen Besitz übergegangen. Jeder Lehrer in der Heesfelder Schule durfte eine Ziege halten. Und diese war eine Dreingabe der Herrschaften Winkhaus, für Theodor die Garantie eines täglichen Frühstücks. Höchste Zeit dafür. Bald würden die Buben und wahrscheinlich auch einige Mädels kommen.
Theodor reckte sich noch einmal und sprang auf. Fast zu schwungvoll, denn um ein Haar hätte er sich den Kopf an den Dachbalken gestoßen. Er kletterte die Leiter in seine Stube hinunter, schnappte seine Holzschale, ging die Stiege hinab und stellte die Schale zunächst im kleinen Fenster des Schulraums ab. Erstmal brauchte er eine Erfrischung. In den Trog an der Mühle sprudelte frisches Wasser, er nahm einen Schluck, tauchte den Kopf unter und wusch sich. Dann holte er die Schale und schlenderte er zum Stall. Die Ziege sah ihn mit schief gelegtem Kopf an.
Zwei Minuten später trat er wieder aus dem Stall und sah an sich herunter. In der Schale war nicht mehr als eine kleine Pfütze, Sprenkel waren auf seiner Kleidung verteilt. Theo trank den Schluck Ziegenmilch. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Eine ziemlich zickige Ziege war das. Kopfschüttelnd ging er erneut zum Trog, um sich zu säubern. Dann trat er in den Schulraum.

für den Bau und den Erhalt der Heesfelder Schule eine Art Genossenschaft gegründet worden war?
Sie meckern nie über die Strecke! Oder lieber hinter dem Berg mit Alpakas gehen, weil die immer so süß lächeln?


Weitere Informationen
Ziegenwanderung
Wusstest du schon, dass
die ländlichen Schulen im Märkischen Sauerland früher Winkelschulen hießen?
Draußen begann ein strahlender Frühlingstag, doch hier drinnen war es düster und kühl. Die Sonne fand keinen Weg hinein durch die kleinen offenen Fenster in den dicken Wänden. „ Sei’s drum“, dachte er. „Wenn erst die Kinder hier sind, wird es von selbst wärmer.“ So langsam müssten sie auch auftauchen. Er betrachtete die Tafel mit dem Alphabet. In der Nacht hatte er sich alles zurechtgelegt. Zuerst würde er schauen, wie es in der Klasse mit dem Buchstabieren, Lesen und Schreiben bestellt war.
Plötzlich fühlte er sich beobachtet. Er drehte sich um und sah in einem der Fenster einen strubbeligen Haarschopf. Daneben tauchte ein gerader Scheitel auf. „ Kommt herein! “, rief er, doch außer einem Wispern vor dem Fenster tat sich nichts. Er schaute durch die Tür und entdeckte einen Buben und ein Mädel, beide zwischen sechs und sieben Jahren. Mit großen Augen schauten sie ihn an. „ Seid ihr allein? “, fragte er. Der Junge nickte. „Wo sind die anderen? “ Beide blieben stumm. „ Auf dem Acker “, antwortete das Mädchen schließlich. „ Auf dem Acker? “, wiederholte Theodor. „ Alle? “ Beide zuckten mit den Schultern. Das fing ja gut an, schließlich richtete sich seine Bezahlung nach der Anzahl der Schüler.
Er winkte die beiden herein. Sie hockten sich auf zwei Plätze in der hintersten Ecke. „ Nein, nein, nein“, sagte Theodor. „ Kommt hierher! “ Er deutete auf die erste Reihe. Beide zogen die Köpfe ein, gehorchten aber. So weit vorne fühlten sie sich sichtlich unwohl, doch Theodor ließ sich davon nicht beeindrucken. „Wie heißt ihr? “, fragte er. „ Heinrich“, hauchte er. „ Liese“, antwortete sie leise. „ Also gut, Heinrich und Liese. Was habt ihr denn schon gelernt? Könnt ihr mir die Buchstaben vorlesen? “ Theodor deutete lächelnd erneut auf die Tafel.
Schweigen. Plötzlich durchbrach ein lautes Meckern die Stille. Das Zicklein kam durch die Tür, es schleifte das Seil hinter sich her, mit dem es im Stall festgebunden gewesen war. Hinter der letzten Stuhlreihe blieb es stehen und kaute gemütlich vor sich hin. Liese und Heinrich kicherten, wollten aufstehen und zur Ziege laufen. Doch Theodor bedeutete ihnen, sitzen zu bleiben. Er zog die Ziege zurück in den Stall, wo er das Seil fest verzurrte. Zurück im Schulzimmer zeigte er wieder auf die Tafel. „ Könnt ihr mir die Buchstaben vorlesen? “
„ A“, sagte Heinrich. „ B “, sagte Liese. „C “, sagte Heinrich. Pause. Theodor schaute die beiden erwartungsvoll an. „Weiter? “ „D“, sagte Liese nach einigen Sekunden. „ Heinrich? “ Der zuckte die Schultern. „ Also gut “, sagte Theodor. „ Der nächste Buchstabe im Alphabet ist das E.“ Er deutet mit einem Zeigestock darauf. „ Fallen euch Wörter ein, die mit diesem Buchstaben beginnen? “ Fragend sah er die beiden an, die aussahen, als würden sie angestrengt nachdenken. „ Emil “, sagte Liese nach einer Weile. „ Esel “, sagte Heinrich kurz darauf. „ Und Erbse! “, ergänzte er triumphierend. „ Essen“, rief Liese freudig aus. Theodors Magen machte ein Geräusch.
Doch die drei setzten ihre Lektionen fort, wobei die Kinder immer lebhafter wurden. Gegen Mittag waren sie beim H angelangt. Liese rief „ Heinrich! “ und Heinrich rief „ Hunger! “ Theodor nahm das als Pausenzeichen, zumal sein Magen immer vernehmlicher knurrte. Liese und Heinrich setzen sich an den Trog in die Sonne, tranken ein paar Schlucke Wasser und teilten sich ihr Brot. Theodor nahm seine Schale und ging in den Stall. Wieder wehrte sich die Ziege gegen das Melken, wieder nur eine Pfütze, eine Krux! Nachdenklich betrachtete er das Tier, das in aller Seelenruhe wiederkäute. Immerhin musste er sich nicht erneut waschen. Er stieg hinauf in seine Stube und aß seinen letzten Kanten Brot, eigentlich die Ration für den Abend.
Wieder unten angekommen rief er die Kinder ins Klassenzimmer. „ Holt mal eure Tafeln raus“, forderte er sie auf. Es stellte sich heraus, dass sie nur ein mit schwarzer Farbe bemaltes, glattes Holzbrett hatten. Darauf malten sie mit weißem Griffel abwechselnd große Lettern von A bis H. Eine Reihe schrieb Liese, die nächste Heinrich. Unvermittelt erklang ein lautes Meckern. Erneut stand die Ziege in der Tür. Theodor konnte es nicht glauben. Er stemmte die Hände in die Hüften. Wie konnte das sein? Kopfschüttelnd griff er nach dem Seilende – es war durchgeknabbert. Wieder zerrte er die Zicke in den Stall, band das Seil noch fester und kehrte zurück. Die Kinder hatten sich nur grinsend angeschaut und setzten ihre Schreibübungen fleißig fort. Abwechselnd rannten sie zum Trog, um das Brett zu reinigen. So ging es den ganzen Nachmittag, bis die Kinder irgendwann zu gähnen begannen. Auch Theodor fand, dass das Tagespensum reichte.
Der nächste Morgen graute, die Vögel zwitscherten, das Mühlrad klapperte und die Ziege meckerte. Theodor lag wach. Den Abend hatte er ziemlich hungrig verbracht. Unterwegs hatte er oft Beeren und Pilze gesammelt, doch um diese Jahreszeit gab der Wald noch nicht viel her. Er überlegte, wie er die Ziege bändigen könnte. Vielleicht half es, wenn er während des Melkens das Seil löste. Einen Versuch war es wert. Er ging mit seiner Schale in den Stall, begrüßte die Ziege freundlich und band das Seil los. Und Husch! Weg war die Ziege. Langsam wurde er ärgerlich. Er trat aus dem Stall, die leere Schale in der Hand, blickte nach links, blickte nach rechts –keine Ziege.

du ein typisches Klassenzimmer aus früheren Zeiten im Regionalmuseum Oben an der Volme in der Villa Wippermann in Halver findest?


im 18. Jahrhundert oft ehemalige Offiziere oder Geistliche Lehrer wurden?
Entmutigt ging er zur Mühle hinüber. Er fragte den Müller nach etwas Kleie. Der nahm die Schale, ruckelte am Kleiekotzer und schon schoss ein Schwall in die Schüssel. Als Theodor zahlen wollte, winkte er gutmütig ab. „Geheimvorrat “, schmunzelte er und zwinkerte ihm zu. Am Trog fügte er etwas Wasser hinzu und stellte die Schale in einer Fensternische ab. Bis zum Mittag wäre der Brei genießbar. Von Heesfeld her sah er Heinrich und Liese den Hügel hinabkommen. Er wandte sich um, die Tür stand einen Spalt offen.
Beim Eintreten staunte er nicht schlecht. Seine Ziege hatte es sich in der Ecke neben dem Pult gemütlich gemacht. Ein leiser Fluch schlüpfte ihm über die Lippen, als die Kinder gerade ankamen. Sie sahen ihn mit großen Augen an und murmelten im Chor „Guten Morgen, Herr Lehrer.“ Dann erblickten sie die Ziege im Klassenzimmer und wollten auf sie zustürmen. Doch Theodor sagte „Guten Morgen, Heinrich, guten Morgen, Liese“, und deutete auf die Plätze in der ersten Reihe. Dann griff er nach dem Seil der Ziege, zerrte sie zurück in den Stall und band sie sehr, sehr fest.
„Wo sind die anderen? “ fragte er, als er in den Schulraum zurückkehrte. „ Auf dem Acker “, antwortete Heinrich. „ Auf dem Acker “, wiederholte Theodor. „ Heute auch? “ Beide zuckten die Schultern. Theodor seufzte. Ihm waren mehr als 35 Kinder angekündigt worden. „ Nicht gut “, sagte er. Doch es war zu früh, sich ernsthafte Sorgen zu machen. „ Dann lasst uns weitermachen. Heinrich, liest du bitte die Buchstaben vor? “ Heinrich begann: „ A, B, C, D, E, F, G, H …“. „Gut “, sagte Theodor. „ Liese, liest du bitte ab H von hinten nach vorne? “ „ H, G, F, E, D, C, B, A …“, las sie langsam vor. „ Auch gut, danke“, nickte Theodor.
„ Nach dem H kommt das I. Welche Wörter beginnen denn mit diesem Buchstaben? “ Wieder herrschte Schweigen, bis sich Luise zaghaft hören ließ: „ Igel “, sagte sie. „ Ja, sehr gut “, antwortete Theodor. „ Heinrich? “ „ Isolde? “, antwortete der. „ Ja“, sagte Theodor, „ auch sehr gut. Ich gebe zu, das I ist wirklich …“ Lautes Meckern unterbrach ihn. Die Ziege trat kauend in den Raum. „ Ja, sag mal …“, Theodor fehlten die Worte. Was sollte er mit diesem Tier anfangen? Kopfschüttelnd zog er es wieder in den Stall, band es fest und kehrte zurück. Nachmittags wiederholte sich das Spiel. Theodor war ratlos und verabschiedete sich zerstreut von Liese und Heinrich. Mit frischem Gras im Arm trat er durch die Stalltür. Vielleicht würde das die Ziege beruhigen. Die stürzte sich tatsächlich auf das frische Futter und begann sogleich mit dem Fressen. Theodor aß den Rest der weichen Kleie und kroch bald müde in sein Heubett unterm Dach.
„ Neuer Tag, neues Glück “, dachte sich Theodor am nächsten Morgen, während die Vögel zwitscherten, das Mühlrad klapperte und die Ziege meckerte. Sein erster Gang führte ihn zum Wassertrog, der zweite in den Stall. Sie mussten miteinander auskommen. Darum führte er die Ziege an diesem Tag auf die Wiese hinter dem Schulhaus. Das Seil machte er an einem Pflock fest und ging in den Klassenraum. Kurz darauf kamen Heinrich, Liese sowie tatsächlich ein weiteres Kind. „Gustav, neun Jahre“, beantwortete es Theodors Frage nach Namen und Alter. Mühelos las Gustav das ganze Alphabet vor und sagte, er könne sogar schon ganze Wörter schreiben.
Streuobstwiesen sind wertvoll, weil sie vielen Tieren und Pflanzen
ein Zuhause bieten und alte Obstsorten bewahren.


Streuobstwiesen Picknick
Daraufhin ließ Theodor ihn Absätze aus dem Lesebuch abschreiben, während er mit den Jüngeren im Alphabet weitermachte. Bis M waren sie gestern gekommen. Mit N ging es weiter.
Sie waren gerade beim O angelangt, als in der Tür das bekannte Meckern ertönte. Die Ziege trat kauend durch die Tür und war schneller in der Ecke, als Theodor gucken konnte. Sie legte sich hin und war nicht dazu zu bewegen, wieder aufzustehen. Theodor begann zu schwitzen. „ Jetzt kommt das Geißlein“, sagte Liese. Theodor schaute erst sie, dann das Tier ungläubig an, nahe dran, sich an den Kopf zu schlagen. Er überlegte, ob er es noch in den Stall tragen sollte. Doch er verwarf den Gedanken. „ Heinrich, Gustav, holt schnell Stroh! “, forderte er die beiden Jungen auf.
Die waren flugs zurück und die Ziege bereitete sich aus dem Heu ein weiches Bett. Mit einem kurzen Schrei begann wenig später die Geburt. Weil es so langsam voranging, wollte Theodor eingreifen, doch die Kinder schüttelten den Kopf. „ Sie macht das allein“, sagte Heinrich. Nach zwei Stunden lag das Ziegenlamm endlich im Stroh. Kurz darauf begann das Lamm Milch zu saugen und Theodor hätte sich wieder an den Kopf schlagen können. Er schüttelte den Kopf. Dieses Mal über sich selbst.
Wann immer Theodor die Ziege und ihr Lamm in den nächsten Monaten in der Ecke rechts neben dem Pult sah, dachte er an seine ersten Tage zurück. Warum sie ihr Zicklein unbedingt im Klassenraum bekommen wollte, würde niemand ergründen. Aber es schien, als fühlten sich die Kinder wohler mit den Ziegen im Raum. Es kamen mittlerweile 15 Mädels und Buben regelmäßig – obwohl auch im Sommer viel auf den Feldern und mit dem Vieh zu tun war. Die wöchentliche Bezahlung hatte sich noch nicht eingespielt, doch manchmal ging er abends mit einem Kind nach Hause und bekam eine Mahlzeit. Und ob er sich seine Milch morgens im Stall oder in der Klasse holte, machte nun wirklich keinen Unterschied.

Wusstest du schon, dass viele Lehrer schnell das Handtuch warfen, weil sie weder Lohn noch Essen bekamen?
Kunst, Konzert, Trauung? Hier bist du richtig

Die Villa Wippermann und ihre Geschichte
Ende des 19. Jahrhunderts entstand in Halver die Villa Wippermann als besonders schönes Exemplar einer Fabrikantenvilla im Stil des späten Historismus. Gebaut wurde sie direkt gegenüber der Brennerei Gebrüder Wippermann. 1895 bezogen Gustav Adolf Wippermann, seine Frau Aline und ihre drei Kinder das imposante Haus. Heute bildet es als eines der drei Häuser der Kultur das Zentrum der Neuen Mitte Halver und beherbergt das Regionalmuseum Oben an der Volme.
Gute Zeiten waren das, als die Villa Wippermann entstand. Man nannte sie Belle Époque, die Schöne Epoche. Es herrschte Frieden in Europa, die Wirtschaft florierte. Genau dieses Flair strahlt die Villa heute wieder aus: an einem Hang gelegen, von Grund auf saniert, strahlend weiß, mit schönen Ornamenten, praktisch wie neu. Doch für die Familie von Gustav Adolf Wippermann endeten die guten Zeiten recht bald. Wie es mit der Villa weiterging, zeigen einige Schlaglichter. Doch von Anfang an.
Als Teilhaber der Brennerei Gebrüder Wippermann, in der z. B. Schnaps und Parfum produziert wurden und die er mit seinen Brüdern Ernst Wilhelm Wippermann und Karl August Wippermann besaß, führte Gustav Adolf Wippermann ein angenehmes Leben in Halver. Seine Frau Aline, geborene Lüsebrink, und er beschlossen Ende des 19. Jahrhunderts, sich einen neuen Wohnsitz in unmittelbarer Nähe der Brennerei erbauen zu lassen. Platz war reichlich vorhanden.
So entstand 1895 in einem kleinen Park ein Musterbeispiel des Villenbaus jener Zeit: Eine schneeweiße Villa im Stil des späten Historismus mit reich verzierten Fenstern, die bald von der fünfköpfigen Familie bezogen werden konnte.
Im Jahr 1900 ließen die Wippermanns eine Veranda anbauen. Sie wurde 1910 in einen Wintergarten umgestaltet und um ein Stockwerk aufgestockt. An der Rückseite entstand in einem Anbau eine neue Küche, um mehr Wohnraum für die inzwischen fast erwachsenen Kinder zu gewinnen. Doch die Zeiten änderten sich: Aline verstarb 1916, Sohn Hugo fiel ein Jahr später in Ersten Weltkrieg. Gustav Adolf Wippermann, ein aktiver Gestalter der Stadt Halver, der beispielsweise 1881 schon die örtliche Freiwillige Feuerwehr mitgründet hatte, überlebte seinen Sohn um 10 Jahre – er starb 1927.
Seine beiden Töchter Margarete und Elisabeth hatten inzwischen geheiratet und Halver verlassen. Sie vermieteten die Villa: die Unternehmerfamilie Schnöring wohnte hier, der Zahnarzt Karl Schartmann mietete Wohnung und Praxis im Haus. Nach Kriegsende wurden in freien Räumen auch immer wieder Flüchtlinge untergebracht. 1950, fünf Jahre nach dem Tod ihrer Schwester Margarete, verkaufte Elisabeth die Villa an die Stadt Halver.
Wusstest du schon, dass
Gustav Adolf Wippermann und seine Frau Aline Ende des 19. Jahrhunderts beschlossen, sich einen neuen Wohnsitz zu bauen und die Villa 1895 bezogen?

in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder Flüchtlinge in der Villa Wippermann untergebracht wurden?
Anders als heute lag das Grundstück der Villa Wippermann an der Frankfurter Straße im Jahr 1895 noch inmitten von Weiden und Wiesen. Das Terrain wurde erst in den Folgejahren erschlossen. Abgesehen von der schräg gegenüberliegenden Brennerei und der Villa von Ernst Wilhelm Wippermann gab es keine Nachbarschaft. Daher entschied sich Gustav Adolf Wippermann, das Grundstück von einer Mauer umbauen zu lassen. Und natürlich brauchte diese Mauer auch in standesgemäßes Tor.
Praktischerweise hatte ein Heizer der Kornbrennerei namens Ewald Förster während seines Militärdienstes als Fahnenschmied gearbeitet. Fahnenschmied war damals eine ehrenvolle Tätigkeit, denn er hatte die Aufgabe, die Regimentsfahnen zu pflegen und instand zu halten – was auch Schmiedearbeiten der Fahnenstangen einschloss.
Ewald Förster verfügte also über eine gewisse Fingerfertigkeit als Schmied. Und diese setzte er gerne ein, um das Tor zum Garten der Villa Wippermann herzustellen. Was er sich vornahm, war durchaus ambitioniert, denn sein großes Vorbild war das Tor zum Schloss Versailles. Er entwickelte jedoch eigene Ornamente und gab dem Tor auch eine andere Form.
Die kunstvolle Arbeit stand zwischenzeitlich – um einen Meter verkürzt – in der Von-Vincke-Straße 22 vor der Etage des früheren Heimatmuseums. Heute findet sich das Tor jedoch wieder an der ursprünglichen Stelle – ohne Mauer allerdings. Denn die wurde Mitte der 1970er Jahre entfernt.
Ulla Turck, geborene Wirths, kam im Herbst 1945 gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren zwei Geschwistern aus dem österreichischen Linz nach Halver zu den Großeltern. Ihr Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft. Da Linz 1943 und 1944 vor allem tagsüber stark bombardiert worden war, konnte Ulla zwei Jahre keine Schule besuchen. Wie viele andere verbrachte sie die Tage in Bunkern. Als sie zehnjährig in Halver ankam, konnte sie weder richtig schreiben noch rechnen.
Die Villa Wippermann war zu jener Zeit größtenteils vermietet – an den Zahnarzt Dr. Schartmann mit Familie im Erdgeschoss und die Unternehmerfamilie Schnöring im Obergeschoss. Freie Räume boten geflüchteten Familien in dieser Zeit jedoch immer wieder Unterkunft. Auch ein Mitgefangener des Vaters, ein Lehrer, wohnte hier mit Frau und Sohn in Räumen unterm Dach. Wegen einer Verletzung war er früher aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden und auf Empfehlung von Ullas Vater nach Halver gezogen. Doch die Bedingungen waren schwierig. „ Die kalte Bruchbude war voller Menschen“, beschrieb Ulla die Zustände in der Villa.
Sie erhielt mehrere Monate Nachhilfeunterricht beim Kameraden ihres Vaters, der noch immer im Krankenbett lag. „ Er unterrichtete in der obersten Wohnung, in einem alten Metallbett, zugedeckt mit einer dunklen Pferdedecke“, berichtet sie. Doch für sie lohnte sich das Ganze: Schon zu Ostern 1946 bestand sie die Aufnahmeprüfung für die damalige Mittelschule Halver.
Ines Berg, geborene Berndt, war gerade 2 Jahre alt, als ihre Familie Ende 1947 aus Swinemünde im heutigen Polen, vertrieben wurde. Da ein Bruder der Mutter bereits in Halver lebte, wurde die Stadt zum Ziel der anstrengenden Flucht Richtung Westen. Nach ihrer Ankunft im Sommer 1948, kam die Familie, der Zahnarzt Dr. Erhardt Berndt, die Mutter, Großmutter, ihr Bruder und sie selbst im Aufbau über dem Wintergarten der Villa Wippermann unter. In der benachbarten Wohnung lebte die Familie Fritz Schnöring.
Im Erdgeschoss wohnte der Zahnarzt Dr. Schartmann, der dort auch Räumlichkeiten für seine Praxis hatte. So gab es für kurze Zeit zwei Zahnärzte unter einem Dach, Dr. Berndt praktizierte jedoch nicht in Halver. Er hatte ein Angebot aus Bad Harzburg, eine Praxis zu übernehmen.


die Villa Wippermann heute das Regionalmuseum Oben an der Volme beherbergt?
Am 21. September 1948 unternahm er die, für die damalige Zeit, recht beschwerliche Reise in den Harz, um sich die Praxis anzusehen. Nach den Strapazen der Flucht, dem Verlust der Heimat und der ungewissen Zukunft war die Belastung zu groß geworden – nach seiner Rückkehr verstarb er am selben Abend, gerade mal 51 -jährig, an einem Herzinfarkt.
Ein zusätzlicher schwerer Schicksalsschlag für die Familie, den auch die damals Dreijährige als erste Erinnerung mit auf den Lebensweg nahm. Die Familie blieb in Halver, in der sie auch rasch eine Wohnung fand. Ines Berg wuchs hier auf, heiratete und lebt bis heute in Halver. Die Villa Wippermann aber erinnert sie immer an die traurigen ersten Tage in dieser Stadt, die ihr zur Heimat geworden ist.
In den 2010er Jahren begann die Umstrukturierung der Innenstadt Halvers im Zuge des Landesstrukturförderprogramms Regionale 2013. In der Neuen Mitte der Stadt wurde die Villa Wippermann nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten eines der drei Häuser der Kultur. In dieser Zeit wurde sie 2015 auch unter Denkmalschutz gestellt. Bei den langjährigen Arbeiten unterstützte der Heimatverein Halver e.V. in historischen Fragen.
2017 wurde die sanierte Villa Wippermann für die Öffentlichkeit geöffnet, sie beherbergt heute das Regionalmuseum Oben an der Volme – als Nachfolgeeinrichtung der Heimatstube, des früheren Museums vom Heimatverein Halver.


heute Das Regionalmuseum Oben an der Volme ist regelmäßig geöffnet. Du kannst hier im Obergeschoss wechselnde Sonderausstellungen zu spannenden Themen aus Halver und Umgebung entdecken und dir in einer kleinen Dauerausstellung z. B. ansehen, wie zu Zeiten der Wippermanns ein typisches Klassenzimmer aussah. Im Erdgeschoss finden ebenfalls spannende Wechselausstellungen und kulturelle Veranstaltungen statt.
Dabei entdeckst du die wunderschöne Villa Wippermann auf ihrem Parkgrundstück von innen und außen. Und lass dir auch das schmiedeeiserne Tor nicht entgehen. Das Standesamt Halver nutzt die Villa sogar für Trauungen. Und oberhalb der Villa ist ein toller Spielplatz mit Kletterburg und Wasserspielen.


Wie lebten Bauern damals? Schau mal rein...
Kein gutes Jahr für die Bauern im westlichen Sauerland: 1829 regnet es monatelang. An eine Ernte, geschweige denn an eine gute, ist nicht zu denken. Das Getreide auf den Feldern ist ertrunken, die Kartoffeln bleiben kümmerlich. Die Kleinbauern sind harte Arbeit gewohnt, bei der alle mit anpacken. Auch Jacobs Familie hat schon lange gelernt, mit unerwarteten Bedingungen umzugehen. Sogar, wenn es noch schlimmer kommt, als erwartet. Wenn Dinge passieren, die ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. So wie in diesem November.
Jacob horcht auf. Schnell verbirgt er die Hände hinter dem Rücken. Eine schwere Bö zerrt an Hemd und Hose, während er sich hinter dem Stamm der Eiche im Hof versteckt. Die Mutter ruft. Soeben tritt sie aus dem großen Tor des Bauernhauses, trocknet sich die Hände an der dunklen Schürze. „ Jacob! “, ruft sie gegen das Brausen des Windes an. „ Komm herein! “ Er zögert, blickt auf die Birne, die verlockend in seinen Händen liegt. Der Novembersturm hatte die letzte Frucht vom Birnbaum geschüttelt, der ein paar Meter hinter ihm steht.
Sie war direkt vor seinen Füßen gelandet. Prall und ganz bestimmt zuckersüß. Ein Geschenk des Himmels. Wenn er sie jetzt mit hineinnimmt, packt die Mutter sie in die Milchkammer. Das will er aber nicht. Sie gehört ihm. Verzweifelt überlegt er, wo er sie verstecken kann. Die Mutter steht noch immer in der Tür, ruft wieder „ Jacob! “. Laut, energisch. Dann dreht sie sich um. „ Heinrich“, hört er sie ins Haus brüllen. „Wo ist Jacob? “ Die Antwort des Vaters ist nicht mehr als ein Grummeln. Jacob nutzt die Chance, hinter Mutters Rücken zum Haferkasten zu flitzen.
Das Manöver gelingt. Am hölzernen Häuschen ist ein Brett lose. Bis morgen kann er seine Birne dort lagern. Mit rotem Kopf biegt er kurz darauf um die Ecke des Getreidespeichers und geht zum beinahe fensterlosen Bauernhaus, das am Hang Wippekühling steht. Er prallt mit dem Vater zusammen, der ihn sogleich am Ohr ins Innere zieht. „Was hast du jetzt schon wieder ausgeheckt? “, fragt er. Zwecklos, zu antworten oder sich zu wehren. Der Vater schließt mit der Rechten geschickt das mächtige Tor und zerrt Jacob in die nur durch eine Talglampe beleuchtete Stube. Seinem Jüngsten wird er die Flausen schon austreiben.
Am Tisch warten die Geschwister, die Löffel senkrecht in der Hand. Auch Knecht Frieder schaut ihn missmutig an. Eigentlich ist er Jacobs Freund, aber beim Abendessen versteht er keinen Spaß. Über dem offenen Feuer in der Küche hängt der Kessel mit der brodelnden Suppe. Ihr Aroma geht im Rauch unter. Das Haus ist davon erfüllt. Die Mutter schöpft die Suppe in Schalen. Je zwei Kellen für den Vater und für Frieder. Anderthalb Kellen für Peter, den ältesten Sohn. Je eine Kelle für Mathilde und Almut, den mittleren Sohn Karl, sie selbst und Erna. Für Jacob den Rest.
Empört schaut Jacob in seine Schale, doch er schweigt und denkt an die versteckte Birne. Nach dem Gebet wird schweigend gegessen. Die drei Kühe in der Tenne käuen ihr Heu wieder, das Pferd knabbert am Hafer, die Ziegen am Gras. Jacob versenkt Schwarzbrot, um es aufzuweichen, und löffelt es heraus. Bald darauf liegt er mit Brüdern und Schwestern, Magd und Knecht oben auf der Galerie im Strohbett. Kaum, dass er liegt, schläft er. Direkt unter der Schlafnische jedoch – im Bettkasten in der Stube – unterhalten sich Heinrich und Margarethe flüsternd. Der monatelange Regen hat das Heu auf den Weiden faulen lassen, der Futtervorrat für die Tiere ist knapp. Sie müssen so lange wie möglich hinaus auf die Weide.
Die Kartoffelernte war karg, der Hafer ist wegen des Regens nicht gereift und mit dem Roggen sieht es nicht besser aus. Der Ertrag wird gering sein. Zudem konnte bisher – immerhin schon Mitte November – die Wintersaat nicht ausgebracht werden. Sie würde in den feuchten Böden verfaulen – oder gar hangabwärts geschwemmt. Es sieht also düster aus.
Vor Morgengrauen ist das Haus wieder wach. Der Sturm hat nachgelassen, es regnet seit Langem erstmals schwächer. Mutter Margarethe facht das Feuer an. Erna melkt die Kühe. Frieder und Peter misten den Stall. Der Haufen unter der Eiche dampft. Bauer Heinrich begutachtet auf einem der Felder den Stand der Dinge, schaut die kläglichen Haferpflanzen an, klaubt Erde auf, wirft sie zurück, schüttelt den Kopf. Nass und schwer. Im Haferkasten liegt dieses Jahr nur wenig Saatgut. Soll er es säen oder aufheben? Säen. Er muss es wagen. Keine Saat, keine Ernte. Noch ist der Boden zu nass, aber der Regen lässt nach. Er nickt und kehrt zurück.
Wusstest du schon, dass im ganzen Sauerland 1829 auf sehr regenreiche Monate tatsächlich ein extrem strenger Winter folgte?

Dort stehen schon Getreidekaffee, frische Milch und Brot bereit. Alle kommen für ein kurzes Frühstück zusammen. „ Peter, Karl: Ihr geht zur Schule“, ordnet der Vater an. Die sind eher erstaunt als begeistert. Nicht gerade der nächste Weg zur Heesfelder Schule (siehe Seite 16-19). Doch die Arbeit auf den schlammigen Feldern ist auch wenig verlockend. „ Mathilde, Almut, Jacob: Ihr holt Holz im Wald! “ Er erhebt sich, nickt Frieder dabei zu. Margarethe schafft Ordnung und Erna begibt sich in die Milchkammer, um Butter zu schlagen. Samstags bringt Heinrich sie zum Markt.
auf den kargen Böden in der gebirgigen Region hauptsächlich Hafer und Roggen gediehen?
Indessen machen Jacob und seine Schwestern sich mit Rückentragen auf den Weg durch den Wald. Der ist wie ausgefegt, weil die gesamte bäuerliche Nachbarschaft immer wieder Brennholz sucht. Eine halbe Stunde gehen sie, bis der Mischwald in Nadelwald übergeht. Hier finden sie noch Reisig und bündeln es auf einem Haufen. Mathilde hackt mit der alten Axt Stücke von einem umgeworfenen Baum, die sie auf ihren Tragen festzurren. Jacob will schnell zurück, seine Birne wartet. Gegen Mittag sind sie zu Hause, durchnässt vom Nieselregen.
Dort stellen sie die Tragen ab und laufen zum Feuer, um sich aufzuwärmen. Im Kessel blubbert Haferbrei. „Gleich ist Mittag“, sagt Margarethe. „Geh den Vater und Frieder holen“, fordert sie Jacob auf. Der lässt sich nicht lang bitten. Endlich eine Gelegenheit, beim Haferkasten vorbeizusehen. Schnell huscht er hinüber und lugt unter das Brett. Sie ist noch da! Froh hüpft er den Feldweg hinunter. Er sieht seinen Vater am Rand des hangabwärts reichenden Felds. Frieder hat gerade eine schnurgerade Furche vollendet, ungefähr auf der Hälfte des Feldes hat er die kläglichen Reste des nicht unreifen Hafers untergearbeitet. Scheinbar wird die Saat vorbereitet. Ohne Peter und Karl? Jacob kratzt sich am Kopf, rennt aber weiter. „ Mittagessen“, brüllt er.

Heinrich nickt knapp, Frieder spannt das Pferd aus. Schweigend gehen sie bergan zum Haus. Der Wind pfeift durch ihre Beine, kälter als vor einer Stunde. Abrupt bleibt Heinrich stehen. Er schnuppert, horcht, guckt in die Luft, betrachtet die Krone der großen Eiche. Dreht sich um, schaut den Weg hinunter zu den zwei Eichen, die ihn begrenzen. Lässt den Blick über die bewaldeten Berge im Osten – Hüttenberg, Bocksberg, Ahnritt – und über den wolkigen Himmel gleiten.
Dann hält er einen feuchten Finger in die Luft. „Ostwind! “, stellt er fest und beginnt zu fluchen. „ Schnell! “, treibt er Frieder und Jacob an. „Wir bekommen Schnee! “ „ Schnee? “, ruft Jacob freudig. Doch dann sieht er das unter dem verstrubbelten grauen Haaransatz aschfahle und grimmige Gesicht seines Vaters. In Eile erreichen sie das Haus, wo Frieder das Pferd auf die Weide bringt. So ganz versteht Jacob den Aufruhr nicht. Aber er erkennt, dass seine Birne noch warten muss.
„ Margarethe“, ruft Heinrich schon vom Tor ins dunkle Haus hinein. „ Es gibt Schnee! Wir müssen uns sputen.“ „ Schnee? “, fragt sie ungläubig und auch die Mädchen blicken erstaunt von ihrer Arbeit auf. „ Ja, heute. Spätestens bei Nacht.“ „ Aber sicher nur ein bisschen“, beruhigt sie ihn. Er schüttelt den Kopf. „Guck‘ raus! “ Margarethe schnuppert kurz und nickt, auch Frieder macht ein sorgenvolles Gesicht. „ Ausgerechnet heute habe ich die Söhne in die Schule geschickt! “, stöhnt Heinrich und flucht wieder. „ Heinrich! “, schilt ihn Margarethe und blickt ihn beschwörend an. Nicht vor den Kindern!
Der Gescholtene zuckt die Schultern und verteilt Aufgaben. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht aus dem Haus können. Mädchen, ihr geht nochmal in den Wald. Wir brauchen mehr Holz. Jacob, du kommst mit aufs Feld. Erna, du holst die Tiere und guckst, dass du noch Heu zusammenbringst. Margarethe, feg die Eicheln zusammen und hol sie ins Haus“, sagt er und will wieder hinaus. „Wohin? “ fragt seine Frau. „ Das Essen wartet.“ „ Keine Zeit “, antwortet Heinrich. „ Doch“, sagt Margarethe. „Wir essen! “ Mürrisch gibt sich Heinrich geschlagen.
Frisch gestärkt verlassen die Männer kurz darauf das Haus. Jacob möchte zum Speicher abbiegen, trottet aber lieber brav hinterher. Er soll das Pferd von der Weide holen und führt es zum Leiterwagen, auf den Vater und Knecht die hölzerne Egge verladen. Heinrich hat beschlossen, trotz des Schnees ein halbes Feld Roggen auszusäen. Zuvor ist der gepflügte Boden allerdings noch mit der Egge zu bearbeiten. Frieder hatte die Stirn gerunzelt. Dass dies nicht den Bauernregeln entspricht, weiß Heinrich selbst. Doch womöglich taut der Boden in diesem Jahr nicht mehr auf. Unterm Schnee hat das Saatgut immerhin eine kleine Chance, zu keimen.

die einfachen Bauern ihre Butter nicht selbst aßen, sondern verkauften, um Geld z. B. für Saatgut zu verdienen?


„ Jacob, hol‘ den kleinen Sack Roggensaat “, ruft er. Der staunt zwar, trollt sich aber. Er betritt den Haferkasten, blickt verstohlen ins hinterste Eck und stellt erleichtert fest, dass sein Schatz gut verborgen ist. Dann zieht er am Sack gleich vornean, schwer! Er stellt sich rückwärts davor und greift über die rechte Schulter mit beiden Händen nach dem zugeschnürten Ende. „ Uff! “, schnauft er, als der Sack auf seinem Rücken liegt. Gebeugt setzt er langsam einen Fuß vor den anderen.
das Bauernhaus Wippekühl, in dem unsere Geschichte spielt, um 1600 gebaut und Ende des 20. Jahrhunderts aufwendig renoviert wurde?
Frieder sieht die kleine, gekrümmte Figur auf sich zuwanken, springt vom Wagen und läuft ihr entgegen. Er greift nach dem Sack, wirft ihn sich auf die Schulter und sagt grinsend: „Wir wollen ja nicht, dass du einen Buckel kriegst “, sagt er. Der Sack landet auf dem Wagen und Jacob daneben. Auch Frieder schwingt sich aufs Brett. Heinrich schnalzt mit der Zunge, los geht‘s. Es folgen arbeitsreiche Stunden. Während leichter Schnee einsetzt, eggt Frieder die gepflügte Hälfte des Felds. Heinrich und Jacob folgen ihm mit Eimern voll Roggensaat, die sie in weitem Bogen auswerfen. Anschließend beraten sich die Männer kurz. Sie verladen die Egge wieder auf den Wagen. Dann spannt Frieder den Pflug an und kümmert sich um die andere Feldhälfte.
„Geh‘ hinauf und hilf der Mutter “, sagt Heinrich bald darauf zu Jacob. Der lässt sich das nicht zweimal sagen, denn die Kälte zieht ihm schon durch Mark und Bein. Er nickt und läuft, begleitet von klitzekleinen tanzenden Schneeflocken, sich ein paarmal um die eigene Achse drehend, den Weg hinauf zum Haus. Die Mutter harkt dort Eicheln und Laub zusammen. Sie winkt ihren Jüngsten zu sich und drückt ihm die Harke in die Hand. „ Mach‘ du weiter “, sagt sie. „ Ich bringe die Eimer rein.“
Während Jacob harkt, hört er seine Brüder den Hügel herunterkommen. Beide tragen Kleinholzbündel, geschnürt mit einem Bindfaden. Jacob lässt die Harke fallen und rennt ihnen entgegen. „ Der Vater sagt, es gibt Schnee! “, verkündet er. „ Haben wir gemerkt “, sagt Peter grinsend. „ Darum sind wir ja schon da! “ Schwatzend gehen die Jungen ins Haus, wo sie das Holz abladen und den Rest Haferbrei essen. Margarethe hebt derweil mit einer Stange eine fette Speckschwarte aus dem Rauchfang und widmet sich weiter dem Abendessen.
Peter und Karl ziehen wenig später mit Sense, Rechen und Rückentrage weit nach oben zur zweiten Weide. Dorthin, wo es trockener ist. Jacob füllt den Rest seiner Ausbeute in den letzten Eimer und schleppt ihn ins Haus. Als er wieder heraustritt, sieht er seine mit Reisigbündeln bepackten Schwestern. „ Es schneit! “, schreit er. Die beiden schauen sich an und kichern. „Wirklich? “, fragt Mathilde und klopft sich mit einer Hand die Flocken von der Jacke.
„ Jacob, geh‘ den Vater und Frieder zum Abendessen holen“, ruft die Mutter im selben Moment aus dem Haus, als Peter und Karl von den Weiden zurückkehren. Drinnen herrscht Geschäftigkeit. Das Holz der Mädchen, das Gras der Jungen und die Werkzeuge müssen verstaut werden. Über dem Feuer brutzeln Speck und Kartoffeln in einer Pfanne. Immerhin ist es dort hinten warm. Seufzend zwängt sich Jacob durch das jetzt angelehnte Tor und läuft durch die immer dickeren Flocken bergab. Die Männer haben ihr Tagwerk bereits vollendet. Der Pflug steht neben der Egge auf dem Wagen, das Pferd ist angespannt. Wieder setzt Frieder den Jungen hinten auf den Wagen und schwingt sich daneben. Im Schneegestöber rollen sie gemächlich bergan. Oben springen sie ab, Geräte und Wagen sind schnell im Schuppen neben dem Schweinekoben verstaut. Jacob bringt das treue Pferd ins Haus, seine Brüder reiben es trocken. Dann ist Feierabend. Das Tor schließt, Schnee und Kälte bleiben draußen.
Wieder pfeift der Wind ums Haus. Nach der Geschäftigkeit der letzten Stunden verschlingt die Gemeinschaft die gebratenen Kartoffeln, die wie ein Festmahl anmuten. Festmahl? Siedend heiß fällt Jacob seine Birne wieder ein. Minutenlang starrt er grübelnd in seine Schüssel. Und nun? Das Tor ist geschlossen, keiner kommt mehr raus. Langsam löffelt er seine Kartoffeln weiter. Gleich gehen alle zu Bett. Aber morgen muss er sich um seinen Schatz kümmern. Noch am Tisch fallen ihm die Augen zu. Auch die anderen sind müde. Bald mischt sich nur noch das Rascheln der Rinder, das Schnauben des Pferds und das Schnarchen der Männer ins Sturmgeheul.
Der nächste Morgen graut noch nicht einmal, als das Haus schon wieder auf den Beinen ist. Die Tiere verlangen nach Futter, sodass für alle sofort die morgendliche Routine beginnt. Heinrich öffnet vorsichtig die Nebentür, die zur Hangseite führt. Viel kann er nicht erkennen, noch ist es zu dunkel. Der Lichtschimmer zeigt ihm jedoch eine Schneedecke von einem halben Meter, die bis zur Schwelle reicht. Viel für eine einzige Novembernacht. Der Wind bläst stark, fängt sich zwischen Haus und Hang, wirbelt Eiskristalle hinein. Schnell schließt er die Tür. Es ist wie befürchtet. Felder und Weiden sind schneebedeckt, die Tiere müssen auf der Tenne bleiben ...




Eine Rangerführung durch den Frühlingswald auf der Nordhelle

Das ist Jannick Rüsche
Alles neu macht der Mai. Das ist auch das Motto der Führung Ebbegebirge im Frühjahr mit Ranger Christoph Nolte. Sie widmet sich besonders den farbenfrohen Frühblühern, die zwischen den vielen Grünschattierungen aufblitzen und führt auf der Nordhelle vorbei an Quellen und Hangmooren. Neben spannenden Entdeckungen und wertvollen Informationen sind tolle Panoramablicke auf der acht Kilometer langen Wanderung inklusive.
Die Vorzeichen waren nicht gut. Am Vortag hatte es in Strömen geregnet. Echte Bindfäden, die sich selbst bei wetterfester Kleidung bis auf die Haut vorarbeiten konnten. Ein dunkler Tag, wie man ihn im Mai eigentlich nicht erwartet. Mit bunten, abgeregneten Blütenteppichen unter Bäumen. Umso größer die Überraschung, als am Morgen die Sonne durch die Wolken blinzelt. Sie übertreibt es nicht, doch sie scheint zu sagen „ Hey, ich bin noch da.“
Eine gute Nachricht. Denn am Telefon hieß es einige Tage zuvor: „ Die Führung findet grundsätzlich statt. Nur bei Starkregen oder Sturm fällt sie aus.“ Alles klar, es kann also losgehen. Schon bald ist der große Wanderparkplatz an der Nordhelle erreicht, umgeben von frischem Grün. Nach und nach trudeln die Teilnehmer ein. Die Luft ist feucht, der Boden auch, und alle entscheiden sich für die halbhohen Wanderschuhe. Ein kleiner Trupp von sechs Leuten kommt zusammen, vier Männer und zwei Frauen.
Während wir auf eventuelle Nachzügler warten, begrüßt uns Christoph Nolte, Ranger beim Landesverband Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Er stellt seine Tätigkeit kurz vor. Seine Hauptaufgabe: Umweltbildung. Meist für Kinder und Jugendliche, bei denen man – insbesondere, wenn sie aus städtischen Regionen kommen – mit den Naturthemen immer öfter bei null anfangen muss, wie er sagt.
Bei den Führungen für Erwachsene geht es neben der Bekanntschaft mit Naturschönheiten auch um Sensibilisierung: Denn Müll gehört ebenso wenig in den Wald wie brennende Zigaretten, vor allem im Sommer. Forst- und Wanderwege sind auch keine Pisten für Motorräder oder Quads. Eigentlich selbstverständlich, sollte man meinen. Ist es aber scheinbar nicht. Im Einsatz sind er und seine Kollegen aus Südwestfalen auf dem Rothaarsteig, auf der Sauerland Waldroute und – wie wir heute – auf dem Sauerland Höhenflug.
Als klar ist, dass wir vollständig sind, wandern wir los. Wie es scheint, mitten hinein ins sprießende Grün des Nordrhein-Westfälischen Staatswalds – aber natürlich auf dem Weg, dem Höhenflug. Schon kurz nach dem Aufbruch fällt einem der Teilnehmer die Baumform in einer kleinen Fichtengruppe auf. Gut bemerkt, denn tatsächlich ist es eine spezielle Art. „ Die serbische Fichte ist besonders schmal. Sie wird gerne in den Höhenlagen gepflanzt, weil sie nicht so anfällig für Schneebruch ist “, erklärt Christoph Nolte. Schließlich ist die Nordhelle, an deren Flanke wir uns bewegen, mit 663 Metern der höchste Berg im Märkischen Sauerland.
Wusstest du schon, dass in Südwestfalen zehn Ranger des Landesverbands Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (Wald und Holz NRW) Führungen und Wanderungen durchführen?

Weitere Informationen Ebbegebirge

allein im Märkischen Sauerland rund 140 kleinere Gebiete aus verschiedenen Gründen unter Naturschutz stehen?

Kurz darauf greift Christoph Nolte das erste Mal ins Grüne und zupft eine Pflanze mit kleinen weißen Blüten ab, die am Wegesrand eher unauffällig wirkt – vor allem, wenn man noch keinen Blick für die kleinen Schönheiten entwickelt hat. „ Das ist die Knoblauchsrauke. Wenn Sie die Blätter verreiben, riechen Sie, woher ihr Name kommt “, sagt er lächelnd. Schon bald nimmt er die nächste Pflanze ins Visier: Das Scharbockskraut mit seinen leuchtend gelben Blüten hat was von einer Butterblume, allerdings sind die Blütenblätter spitz. „ Der Name Scharbock bedeutet Skorbut. Das Kraut enthält viel Vitamin C und konnte die Krankheit verhindern“, erläutert Christoph Nolte.
Wir passieren eine Eberesche, besser bekannt als Vogelbeere. Wie Christoph Nolte berichtet, ernähren die Beeren rund 30 Vogelarten, was den Namen erklärt. Auch verschiedene Insektenarten naschen daran. Von den prachtvollen Blüten ist noch nichts zu sehen. Aus ihnen entstehen später die orangen Beeren, die entgegen der verbreiteten Meinung nicht giftig sind. In früheren Zeiten haben die Bauern auch ihre Schweine zum Fressen in die Wälder getrieben, sie waren auf die Beeren ganz versessen. Christoph Nolte schwärmt außerdem vom außergewöhnlich schönen, hellen Holz, das aus ihr gewonnen wird.
Leicht bergan geht es weiter, rechts zeigt sich ein großer Bereich mit jungem Laubwald in zartem Grün. Zwei bis drei Meter ragen sie in den Himmel, Birken sind zu erkennen. „ Das ist eine ehemalige Kyrill-Fläche“, berichtet Christoph Nolte. „ Der Sturm im Januar 2007 hatte hier alles zerstört. Und jetzt haben wir wieder einen tollen Laubwald.“ „ Haben sich die Bäume selbst ausgesät? “, fragt eine der Teilnehmerinnen. Teils, teils.
Christoph Nolte erläutert, dass der junge Wald durch eine Mischung aus Anflug und Kulturpflanzung entstand. Birken und Ebereschen waren die Pioniere. Dann wurden Eichen und Bergahorn zusätzlich gesetzt. Denn Birken- und Eschenlaub ist für sie perfekter Dünger.
Kurz nach einem Abzweig wendet sich Christoph Nolte wieder den Frühblühern am Boden zu und pflückt ein besonders hübsches Exemplar in Blau-Violett. „ Das ist ein Waldveilchen“, stellt er die Pflanze vor. „ Es hat einen ganz besonderen Trick, um sich fortzupflanzen. Der Samen ist umgeben von einer süßen Flüssigkeit, die die Ameisen anlockt. Sie tragen den Samen dann in andere Gebiete.“
Auf der anderen Seite des Weges sieht es allerdings nicht ganz so hübsch aus, denn dort hat sich der Borkenkäfer offenbar sehr heimisch gefühlt. Nach dem Ausräumen ist viel Totholz geblieben, das nicht mehr wirtschaftlich zu verwerten ist. Zu sehen ist jedoch auch, dass sich auf der Fläche bereits wieder heimische Sträucher und Bäume ansiedeln.
Inzwischen zeigt uns Christoph Nolte weitere Pflanzen am Boden. Den Huflattich zum Beispiel, eine Heilpflanze mit sehr großen Blättern, die eine weiche Unterseite haben.

Er empfiehlt sie als Toilettenpapier im Wald, denn entgegen der landläufigen Meinung brauchen Papiertaschentücher bis zu fünf Jahre, um zu verrotten. Auch der Spitzwegerich, der häufig am Wegesrand zu finden ist, hat relativ große Blätter. Deren Saft wirkt antibakteriell. Vermischt mit Spucke ist er zum Beispiel ein schnelles und wirksames Mittel gegen Insektenstiche. Seine ährenartigen Blüten stehen auf langen Stängeln.
Ganz anders die Gänseblümchen mit weißem Blütenblätterkranz und gelber Blüte. Da sie fast das ganze Jahr blühen, sind sie auch unter dem Namen Immerschön bekannt. In unmittelbarer Nähe finden sich im Unterholz weite Felder mit Waldheidelbeeren. Ihre kleinen, hängenden Blüten sind im dichten Grün kaum auszumachen. Später finden wir Bereiche, in denen Waldheidelbeeren und Preiselbeeren wachsen – zu erkennen an den dunkleren Blättern.
Wir wandern jetzt am nördlichen Hang der Nordhelle. Hangabwärts ist der Wald nach trockenen Jahren und Borkenkäferbefall nicht mehr so dicht, wie er mal war. Hangaufwärts zeigt uns Christoph Nolte eine Lärche, an deren Stamm sich ein Pilz angesiedelt hat. „ Dieser Baum war geschwächt und wurde dann vom Zunderschwamm befallen“, erklärt Christoph Nolte. „ Anders als zum Beispiel Steinpilze, die mit den Bäumen in einer Symbiose leben, ist er ein Parasit und zerfrisst das Holz. Man kann davon ausgehen, dass der Baum bereits tot ist.“ Ein Bild, das traurig stimmt, zumal es auf unserer Runde nicht der letzte befallene Baum sein wird. Der Zunderschwamm trägt seinen Namen übrigens nicht von ungefähr, er wurde in früheren Zeiten zum Feuermachen verwendet.
In Richtung Norden bietet sich jetzt an vielen Stellen ein atemberaubendes Panorama über Weiden und Äcker, aber auch über geräumte Waldflächen hinweg, die vielleicht sogenannte Sukzessionsflächen bleiben, in denen sich der Wald weitgehend selbst regeneriert. Herscheid liegt idyllisch an einem Hang gegenüber –passend steht hier unter Kastanien ein Waldsofa bereit. Wenig später sehen wir bis zum Wixberg in Altena und schließlich geht der Ausblick bis zur Oestertalsperre, die von hier aus ganz klein wirkt. Christoph Nolte erzählt von den Versuchen, passende Baumarten zu finden, die mit dem Klimawandel gut zurechtkommen.
Wusstest du schon, dass dazu zum Beispiel die Hangquellmoore im Ebbegebirge, Buchenwälder um Iserlohn oder die Formationen des Felsenmeers in Hemer gehören?

es in Naturschutzgebieten nicht erlaubt ist, Beeren und Pilze zu sammeln, dir die Ranger aber gerne Stellen zeigen, an denen das Sammeln erlaubt ist?

Er macht uns auf eine vor Jahrzehnten gepflanzte Amerikanische Eiche aufmerksam, die im Ebbegebirge prächtig gedeiht – nur ihr Laub zersetzt sich sehr langsam. Ein Zeichen dafür, dass sie hier noch nicht heimisch ist.
Bald darauf liegen rechter Hand einige der Hangmoore, besonders geschützte Bereiche im Ebbegebirge. Sie bieten Pflanzen nur wenige Nährstoffe, sodass hier nur jene gedeihen, die mit den Bedingungen zurechtkommen. Sonnentau, Wollgras und Moorbirke zum Beispiel. Direkt im Quellwasser wächst das stark gefährdete Torfmoos, das das 30 -fache seines Gewichts an Wasser aufnehmen kann. In diesem Bereich zeigt uns Christoph Nolte auch einen der typischen Totholzbäume – ohne Krone, dafür mit vielen Höhlen. „ Schwarz- und Buntspechte nutzen die Höhlen zur Brut “, berichtet er. „ Oft nisten darin auch Sperber, sie kleben die Löcher teilweise zu. Zuletzt kommen dann die Siebenschläfer und richten sich ein.“
Unter Bäumen empfangen uns dann saftige Moose und ein weiteres weiß blühendes Pflänzlein am Boden. „ Schauen Sie sich die Blätter mal genau an“, fordert Christoph Nolte uns auf. Wir erkennen die typische Form des Klees. „ Das ist Sauerklee“, erklärt er uns. „ Er ist ebenfalls sehr reich an Vitamin C und früher hat man ihn sogar für den Winter konserviert. Auf Klassenfahrten kommt es immer besonders gut an, wenn wir den Sauerklee im Wald pflücken und später Salat daraus machen.“
An der ursprünglichen Wegführung des Höhenflugs sind einige Buchen vom Zunderschwamm befallen und drohen umzustürzen, daher folgen wir jetzt einer Umleitung. Wir haben die Spitze der Nordhelle fast erreicht, die eigentlich eher ein Plateau ist. Die Strecke führt an mehreren Flächen entlang, die gerade wiederaufgeforstet werden. In kleinen Plastikrohren stecken junge Stieleichen, gut geschützt vor Wildverbiss. Bis sie weit in den Himmel ragen, wird es viele Jahre dauern. Doch der Anfang ist gemacht. Ansonsten ist die Vegetation hier oben vielfältiger, Weiden sind zu sehen, auch Sträucher wie Schlehen und Schwarzdorn. Am Wegesrand tauchen Waldveilchen in großer Zahl auf, ein wunderschöner Anblick.
So großblättrig, dass er an Rhabarber erinnert, zeigt sich dann der Pestwurz. Auch hier ist der Name Programm, denn im Mittelalter kochte man daraus einen übel riechenden Sud, der gegen die Pest helfen sollte. Christoph Nolte reibt an einem Blatt und bietet an, daran zu riechen. Wir verzichten dankend. Da gefallen uns der Beinwell am Robert-Kolb-Turm – aus ihm wird laut Christoph Nolte heute noch Schmerzsalbe gemacht – und der Gundermann, beide blühen leuchtend blau, schon besser. Wie Christoph Nolte erzählt, braute man mit letzterem früher sogar Bier, Gundermann ersetzte den Hopfen. Ein gutes Stichwort, denn ein kühles Getränk wäre jetzt, wo der Rundgang fast beendet ist, gar keine schlechte Idee. Doch das Café Nordhelle ist noch geschlossen. Wir sind etwas zu früh dran.

Ein Buchtipp gefällig?
Geheimnisvolle Moore, Skivergnügen und der letzte Auerhahn. Die Geschichten der Forstwege im Ebbegebirge vom Heimatbund Märkischer Kreis


Eine Kräuterwanderung am Rande des Naturschutzgebiets Apricke
Spätsommer 2022 im Märkischen Sauerland. Spätsommer auch auf dem ehemaligen Militärübungsplatz gleich neben dem Sauerlandpark Hemer, der sich ins Naturschutzgebiet Apricke verwandelt hat. Für die Menschen und für manche Tiere rückt die Ernte- und Sammelzeit näher. Nur muss man erstmal erkennen, was man ernten und sammeln könnte. Die zertifizierte Naturparkführerin des Naturparks SauerlandRothaargebirge, Birgit Stübe, öffnet auf der Wanderung Zeit der Ernte Samen und Früchte so manche Augen für Kräuter, Sträucher und Bäume.
Birgit Stübe begrüßt uns am Pavillon mit Tourist-Info und Naturpark-Infozentrum Hemer am östlichen Ende des Sauerlandparks Hemer. Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 5 und 65 Jahren hatten sie erwartet – gespannt auf das, was auf der Kräuterwanderung zu entdecken sein wird. Die Route führt am Rand der sogenannten Magerwiese des Naturschutzgebiets Apricke entlang.
Unsere erste Station sind die Obstbäume gleich am Anfang des Weges. „ Dies ist eine Streuobstwiese, wo alte Obstsorten angepflanzt werden“, berichtet Birgit Stübe. „ Sie gehört dem Naturschutzzentrum Märkischer Kreis.“ Streuobstwiese klingt irgendwie niedlich, wird aber dem, was wir sehen, gar nicht gerecht. Denn es sind heute an die 300 Bäume mit verschiedenen alten Apfel-, Birnen-, Pflaumenund Kirschsorten, die an drei Seiten des Naturschutzgebiets Apricke wachsen. Einige Apfelbäume mit klangvollen Namen wie Rheinischer Krummstiel, Roter Trierer Weinapfel oder Prinz Albrecht von Preußen schauen wir uns näher an.
„ Anders als die Apfel-Neuzüchtungen seit den 1960er Jahren enthalten die alten Sorten noch Eiweiße und rufen daher selten Allergien hervor. Generell sind Äpfel reich an Calcium und Eisen, sie sind zum Beispiel gut für die Muskeln, aber auch für den Stoffwechsel, das Herz und die Gefäße“, erläutert Birgit Stübe und verweist auf das englische Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away “.
Den Kindern sind anscheinend die Pflanzen am Boden näher als die hoch hängenden Früchte. Sie hocken sich interessiert mal über gelbe, mal über weiße Blüten. „Was ist das? “, fragen sie. „ Und was ist das? “ Birgit Stübe weiß jede Frage zu beantworten. „ Spitzwegerich, entzündungshemmend. Der Saft aus den Blättern wirkt zum Beispiel lindernd gegen Insektenstiche. Oder Wiesenlabkraut, wurde früher zum Rotfärben verwendet.“
Indessen ist die Runde zum nächsten Stopp gelangt: einer großen Fläche mit grünen, halbhohen Pflanzen. Selbst die Kleinsten wissen, worum es sich handelt. „ Brennnesseln! “, rufen zwei. Klar, wer draußen spielt, macht schon von Kindesbeinen an seine Erfahrungen damit. Birgit Stübe pflückt gekonnt eine Spitze –dieses Mal hat niemand das Bedürfnis, es ihr gleichzutun. Birgit Stübe hält den Stängel auf den Kopf, man sieht die Unterseite der Blätter. „ Unter den Blättern sind die Nesselhaare, die Flüssigkeit verursacht schmerzhafte Quaddeln auf der Haut. Das macht die Pflanze natürlich aus gutem Grund, denn dies dient ihr als Schutz gegen Fressfeinde“, erklärt sie.
Dann deutet sie auf grüne Minikügelchen an der Nessel. „ Dies sind die Samen der Brennnessel. Sie sind essbar, sehr schmackhaft und gut für Haut und Haar,“ sagt sie. „ Die Samen der jungen Pflanzen schmecken am besten“, sie deutet auf saftig grüne, kleinere Pflanzen mit noch hellen Samen. „ Am besten quetscht man sie leicht.“ Sie verrät auch noch einen Trick, der Rheuma und Arthrose lindern soll.

Wusstest du schon, dass
das heutige drei km2 große Naturschutzgebiet Apricke von 1940 bis 2007 ein Militärübungsplatz war, der zur benachbarten Kaserne gehörte?


du schon, dass
im Naturschutzgebiet Apricke Heckrinder, Dülmener Pferde und Ziegen wild leben?
„ Doch solche Sachen müssen Sie natürlich mit Ihrem Arzt besprechen. Ich bin hier nur die Kräuterhexe“, sagt sie schmunzelnd. Brennnesseltee wird übrigens aus jungen Blättern gemacht.
Als Nächstes steuert Birgit Stübe ein Kraut mit großen weißen Blüten an, die sich als Zusammensetzung aus vielen kleinen Blüten herausstellen. „ Dies ist die Wilde Möhre“, sagt sie. „ Die Blüte hat immer einen schwarzen Punkt, um Insekten anzulocken, die dann für Bestäubung sorgen.“ Sie berichtet, dass die Wurzeln nur im ersten Jahr genießbar sind, und deutet auf ein nestförmiges Gebilde. „ Dies ist die Fruchtdolde mit den Samen“, fährt sie fort. „ Auch die Samen sind essbar, man kann sogar Öl daraus gewinnen. Und ihr Saft half früher gegen Gelbsucht. Aber es gibt viele Pflanzen, die ihr zum Verwechseln ähneln. Daher muss man sehr genau hinschauen.“
Dann entdeckt sie vor einem alten Gebäude einen Strauch mit vielen schwarzen Früchten und geht darauf zu. „Wissen Sie, was das ist? “, fragt sie in die Runde. „ Holunder “, antwortet jemand. „ Richtig“, sagt Birgit Stübe. „Von diesem Busch können Sie Blüten und Früchte verwenden. Aus den Blüten wird Sirup gemacht, zum Beispiel für den Hugo. Die schwarzen Beeren können nur gekocht als Saft, Marmelade oder Gelee verwendet werden, sonst sind sie nicht gut verträglich.“ Auch die Frage nach dem merkwürdigen überwucherten Gebäude hinter dem Busch beantwortet sie: „ Das ist die ehemalige Panzerwaschanlage.“ Wer hätte das gedacht? Die wuchernden Pflanzen lassen einen die Historie des Geländes fast vergessen.
Kurz darauf biegen wir vom Hauptweg nach links auf einen Pfad in einen Bereich, der nach dem trockenen Sommer fast wie eine Steppe wirkt. Am ausgedörrten Boden sind ein paar eher struppige Pflanzen verblieben. Doch wie wir bereits gelernt haben, lohnt es sich immer, genauer hinzusehen. Birgit Stübe fordert uns auf, die Blätter zweier Pflanzen zwischen den Fingern zu zerreiben und daran zu riechen. Sofort duftet es aromatisch. „ Das sind wilder Majoran, also Oregano, – sehr beliebt in der italienischen Küche – und wilder Thymian“, sagt sie.
Der Sauerlandpark mit dem Jübergturm und einer fantastischen Aussicht ist gleich nebenan

„ Und diese Pflanze“, sie deutet auf einen langen gelben Stängel, „ steht unter Naturschutz. Von der Golddistel dürfen Sie nicht einmal das kleinste Blatt abreißen.“ Sie zeigt auf eine Distelgruppe. „ Sie hat eine ganz besondere Art, ihre Samen zu verteilen. Sie vertrocknet, wird vom Wind abgerissen und in Bündeln durch die Gegend gerollt – so wie man das manchmal in alten Western sieht. Beim Rollen verliert sie dann ihre Samen. Früher wurde sie übrigens genutzt, um Würmer auszutreiben.“
Wir kehren auf den Hauptweg zurück und wenden uns nach den Bodendeckern wieder einem Busch zu, dem Weißdorn. Birgit Stübe zeigt uns Fotos der weißen Blüten, die natürlich nur im Frühjahr zu sehen sind. Jetzt trägt der Weißdorn dunkelgrüne, kräftige Blätter und kleine orangerote Früchte. Birgit Stübe öffnet eine von ihnen. Wie die Hagebutte, die wir zuvor bereits gesehen hatten, enthält sie kleine Kerne, die Samen. „ Beim Weißdorn sind die Blätter und die Früchte essbar und werden hauptsächlich zu Tee verarbeitet. Weißdorn soll gut für den Herzrhythmus sein.“
Wir nehmen jetzt den Weg, der zum Steinbruch führt. Rechts von uns breitet sich das Naturschutzgebiet mit seinen Wiesen, Sträuchern und Bäumen aus. Es ist durch einen elektrischen Zaun abgesperrt. „ Das Gebiet besteht zu einem Großteil aus Magerwiesen“, erläutert Birgit Stübe. „ Hier leben heute Heckrinder, Dülmener Pferde, Ziegen und Schafe wild. Schade, dass wir sie nicht sehen können. Sie scheinen sich momentan in einem anderen Winkel aufzuhalten.“ Wahrscheinlich haben sie sich ein schattiges Plätzchen gesucht, denn die Sonne brennt inzwischen ordentlich auf uns herab. Die Wiesen werden übrigens nicht gemäht, sondern ausschließlich von den Tieren beweidet, die bei Gräsern, Kräutern und Sträuchern unterschiedliche Vorlieben haben.
Kurz vor dem Steinbruch, den wir linkerhand hinter Zaun und Hecken nur erahnen können, hält Birgit Stübe eine Überraschung für uns bereit: Direkt unter dem Zugangsverbotsschild hat es sich ein riesiger Busch gemütlich gemacht, der eigentlich nicht im Märkischen Sauerland heimisch ist: Hopfen mit den typischen hellgrünen Dolden, der weiblichen Frucht, auch Hopfenzapfen genannt. „ Hopfen hat beruhigende Wirkung“, sagt Birgit Stübe. „ Aber er wird natürlich hauptsächlich zum Bierbrauen verwendet.“ Wie er hier hinkam, wird gefragt. „ Das weiß ich nicht “, sagt Birgit Stübe. „Vielleicht sogar über Panzerketten.“ Da ist sie wieder, die militärische Vorgeschichte des Geländes. Auch in den Magerwiesen findet man noch die Betontrassen der Panzer, doch die Pflanzen wachsen und überwuchern sie fleißig.
Unser Weg führt uns noch bis zur Aussichtsplattform, vorbei an Kardendisteln, die verirrten Wanderern durch ihr Wasserreservoir das Leben retten könnten und aus deren Wurzeln eine Tinktur gegen Borreliose hergestellt wird. Ebenfalls am Wegesrand zu finden sind Schlehen, die Vorgänger von Zwetschgen und Pflaumen, sowie Kletten, deren Anhänglichkeit eine optimale Strategie ist, sich weit zu verbreiten. Denn in den Dolden werden Samen transportiert, die sich mit ihren kleinen Häkchen gerne an Kleidung oder Fell haften und so mitgetragen werden. Und: Sie inspirierten zur Erfindung des Klettverschlusses. Die Plattform bietet schließlich einen grandiosen Rundum-Blick. Einerseits in den tiefen Steinbruch und andererseits über das Naturschutzgebiet – wobei sich die Herden offenbar wirklich gut versteckt haben.

Wusstest du schon, dass sich an den Rändern des Naturschutzgebiets Apricke Streuobstwiesen des Naturschutzzentrums MK befinden, auf denen mittlerweile knapp 300 (alte) Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschsorten wachsen?

das Naturschutzzentrum
MK in Lüdenscheid einen eigenen Pomologen hat, der alte Apfelsorten betreut und Hobbygärtner auch bei der Bestimmung von Apfelsorten unterstützt?
Wir machen uns plaudernd an die Rückkehr zum Pavillon, vorbei an den vielen Pflanzen, die wir inzwischen kennengelernt haben. Unsere Blätter- und Blütensammlungen sind angewachsen. Birgit Stübe weist uns noch auf ihre Lieblingspflanze hin, das Tausendgüldenkraut. Eine einzelne kräftig rosafarbene Blüte ist vom Sommer verblieben. „ Das Tausendgüldenkraut wird zu medizinischen Zwecken genutzt, es ist fiebersenkend und gut für das Verdauungssystem. Es wird für Tees oder Liköre verwendet, nicht in der Küche“, sagt sie. Ein Bläuling kreuzt unseren Weg. „ Der Bläuling gehört zu den bedrohten Arten, wie schön, ihn zu sehen“, erklärt Birgit Stübe zu dem hübschen blauen Schmetterling.
Zum Abschluss zeigt sie uns noch einen besonderen Baum mit gefiederten Blättern und grünen, wachteleiergroßen Früchten. „ Dieser Baum ist untypisch für diesen Standort, denn er mag feuchte Böden“, erzählt Birgit Stübe. „ Kennt ihn jemand? “ Da niemand sich sicher ist, hilft sie uns auf die Sprünge. „ Es ist ein Walnussbaum“, sagt sie. „ Früher wurden Walnussbäume in der Nähe des Hauses gepflanzt, weil sie Mücken und Fliegen vertreiben. Insbesondere auch am Häuschen mit dem Herz “, sagt sie. „Wisst ihr, was das war, das Häuschen mit dem Herz? “, fragt sie die Kinder, doch die schütteln den Kopf. Sie löst das Rätsel auf – Außentoilette oder Plumpsklo.
„ Beim Sammeln der Früchte sollte man Handschuhe tragen, die Farbstoffe der Schale wurden früher sogar zum Färben genutzt “, berichtet sie. „ Die Blätter kann man für Tees und zum Baden verwenden. Insgesamt sind sie gut für die Atemwege, Haut und Haar. Und auch die Nüsse sind sehr gesund und gut fürs Gehirn.“
Sie zieht eine Frucht heran, um sie uns zu zeigen. „ Die Nüsse stecken unter dieser dicken grünen Schale und sind dann nochmal von einer hölzernen Schale umschlossen. Erst, wenn die Früchte herunterfallen, sind sie reif.“
Unvermittelt huscht ein Tier über ihre Hand. Allgemeines Raunen. Die fette Spinne, mit einem Leib von der Größe eines Fingernagels, verursacht Gänsehaut. „Was für eine ist das? “, wird gefragt. „ Eine Kreuzspinne wahrscheinlich“, antwortet Birgit Stübe. Die Spinne versucht, zu fliehen. Während die Gruppe gebannt zuschaut, stößt sie dicke, feste Fäden aus, um zu entkommen. Über die schimmernden, im Wind wehenden Strippen hangelt sie sich durch die Luft. Wir dagegen versuchen, den klebrigen Fäden auszuweichen. Dann hat die Spinne es auf den Boden geschafft und flitzt davon. Auch wir machen uns langsam auf den Weg zurück zum Parkplatz, wo Birgit Stübe noch eine weitere Überraschung für uns bereithält.
Direkt gegenüber dem Pavillon findest du den Zugang zum Felsenmeer Hemer. Wenn du schonmal da bist, solltest du dir die in Deutschland einzigartigen Felsformationen keinesfalls entgehen lassen. Es ist nicht nur ein Naturschauspiel, sondern auch eines der ältesten Abbaugebiete von Eisenerz in Westfalen. Über Stege kannst du das Felsenmeer ganzjährig durchwandern.
Das Felsenmeer Hemer gehört übrigens zu den Naturpark-Juwelen, den schönsten und spannendsten Orten des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge.

Tipp: Virtueller Rundgang durch das Felsenmeer

In der Dechenhöhle wartet ein beeindruckendes Kunstwerk der Natur

Die einzige Schauhöhle in Deutschland mit eigenem Eisenbahnhaltepunkt. Achtung, nicht komplett barrierefrei...
Wer sagt, Höhlenexkursionen seien nicht seine Lieblingsbeschäftigung, sollte mal die 400 Meter lange Führung durch die Dechenhöhle ausprobieren. Denn ihr Zauber hat das Potenzial, den Blick auf die Unterwelt zu verändern. Selbst wer die Höhle am Eingang im Osten mit leichter Skepsis betritt, kommt am Ausgang im Westen als Höhlenfan wieder heraus.
Eine schlichte Stahltür im Fels. Dies soll der Eingang zur berühmten Dechenhöhle sein? Schräg unter dem Eisensteg verläuft die Bahnlinie von Letmathe nach Iserlohn,deren Bau zur Entdeckung der Höhle geführt hatte. Gewissermaßen, denn als zwei Eisenbahnarbeiter die Höhle im Juni 1868 fanden, waren sie mit Restarbeiten am Fels beschäftigt. Die Gleise waren längst fertig, die Zuglinie seit 1865 in Betrieb. Zur Sicherung sollte nur noch überstehendes Gestein abgeschlagen werden.
Bevor er die Tür öffnet, zeigt der Höhlenführer und -forscher Dr. Stefan Niggemann, der auch Geschäftsführer der Dechenhöhle ist, entlang der Bahnlinie in Richtung Osten. „ An den Gleisen gab es damals mehrere kleine Höhlen“, berichtet er. „ Die Gleisbauer und Eisenbahnarbeiter kamen häufig von weit her. Um Miete zu sparen, wohnten sie zum Beispiel in der Pferdestallhöhle.“
Jetzt schließt er die Stahltür auf. Dahinter ist es zunächst düster. Ein Notlicht, eine Taschenlampe. Mit der leuchtet der Höhlenführer nach oben. „ Das war der ursprüngliche Zugang“, sagt er. Einige Meter über uns ist eine Luke zu erkennen, daneben ein großer Pfeil auf einem Hinweisschild. „ Man erzählt sich, dass einem der Arbeiter ein Hammer in die Spalte fiel“, fährt er fort, „doch ob das tatsächlich stimmt, weiß man nicht “. Sicher ist, dass sie sich hineinwagten, sich abseilten in diese Höhlung und damit eine der spektakulärsten Entdeckungen jener Zeit machten.
Wie dunkel war es wohl damals, als sie einstiegen, gewappnet mit einer, maximal zwei Fackeln. Ganz im Gegensatz zu jetzt, wo plötzlich Licht aufflammt und unwillkürlich ein „Wow! Eine Kathedrale!“ über die Lippen schlüpft. Vor uns liegt eine hohe Grotte mit langen Stalaktiten (wachsen von oben) und kürzeren Stalagmiten (wachsen von unten).
Sie vermitteln den himmelstürmenden Eindruck einer gotischen Kirche – nur, dass der Himmel hier natürlich fehlt, denn alles verliert sich weit oben in der Höhlendecke. „ Eigentlich nennen wir diesen Bereich Kapelle“, merkt Dr. Niggemann an. Mittig erinnern ein paar Stalagmiten sogar an die heilige Familie. Wie beeindruckt müssen erst die Eisenbahnarbeiter gewesen sein?
„ Man muss sich die Höhle flacher vorstellen“, fährt er fort. „ Am Boden waren Gesteinsbrocken und Sedimente, die dann abgetragen wurden. Schon einen Monat später wurde die Höhle für Besucher geöffnet.“ Zunächst nur provisorisch, doch die Nachfrage war groß. Ganz Iserlohn und Umgebung wollte den Aufsehen erregenden Fund mit eigenen Augen sehen. Daher wurde die Höhle gesichert, mit Stiegen ausgestattet und noch 1868 offiziell als Schauhöhle eröffnet. Die Bahnlinie bekam einen eigenen Haltepunkt. Schon bald reisten die Gäste auch von weiter her an. Der Zauber dieser Unterwelt hatte sich in Windeseile herumgesprochen.

Wusstest du schon, dass die Gänge in der Dechenhöhle über 900 Meter lang sind?


Weitere Informationen
Dechenhöhle
du bei einer Höhlenführung die schönsten 400 Meter kennenlernst?
Es ist nicht leicht, sich vom Anblick der Kapelle zu lösen. Doch schnell stellt sich heraus, dass sie hier drinnen nicht die einzige Attraktion ist. Am Rand des Weges liegen von Tropfsteinen begrenzte Arkaden bis zur sogenannten Orgel. Schon wieder ein sakrales Bild. Die vielen glitzernden weißen Tropfsteine vermitteln den Eindruck einer Kirchenorgel. Davor eine riesige Hand. Fast meint man, ein Oratorium zu hören. Wer war zuerst da? Stalaktiten oder Orgelpfeifen? Die Frage ist schnell beantwortet: „ Die Höhle entstand vor etwa einer Million Jahren“, sagt der Höhlenforscher. Damit dürfte der Fall klar sein.
Der Weg schlängelt sich weiter durchs markante Gestein. „ Direkt nach ihrer Entdeckung haben die damals berühmtesten Forscher des Landes diesen Teil der Höhle begutachtet.“ Ernst Heinrich von Dechen, Professor für Bergbaukunde, Geologe und Vorsitzender des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens, besuchte die Höhle zweimal. Nach ihm wurde die Höhle benannt. Johann Carl Fuhlrott, ein bedeutender Naturforscher, erkundete den Höhlenboden länger. Er war auf der Suche nach Beweisen für seine Theorie, dass die im Neandertal gefundenen Knochen von einem eigenen Menschentyp stammen.

Im März verwandelt sich die Höhle für einen Monat in eine magische Farbenwelt mit beeindruckenden Lichtinstallationen
Er fand zwar keine Belege für menschliche Bewohner, war aber der Erste, der die Höhle erforschte. Hinweise auf menschliches Leben gibt es bis heute nicht. „ Hier sind allerdings erst einige Bereiche intensiver erforscht “, merkt Dr. Niggemann an. Immerhin fand man bei viel späteren Grabungen in der Grube vor der Königshalle, die wir soeben passieren, unter vielen weiteren Knochen auch das Skelett eines Höhlenbärenbabys. Es ist heute im angrenzenden Deutschen Höhlenmuseum ausgestellt.
An einer Seitenwand der Königshalle wartet die nächste große Überraschung. An der Decke der Kanzelgrotte hängt unvermittelt ein Gebilde wie ein Kronleuchter. Wieder in glitzerndes Weiß gehüllt, von dem es leise und beständig tropft. Wir verlassen die Kanzelgrotte über eine feste Treppe, die zu einem höher gelegenen Teil der Dechenhöhle führt. Den Kopf etwas einzuziehen, ist hier durchaus angebracht.
Oben treffen wir auf einen weiteren Höhepunkt: In der Nixengrotte schimmert zwischen steinernen Säulen und unter zahllosen Stalaktiten ein entzückendes natürliches Wasserbecken. Selten gab es klareres Wasser zu sehen. Das könnte ein perfektes Plätzchen für Romantiker sein, allerdings ist man hier natürlich nie allein. Lächelnd zeigt der Höhlenführer auf ein kleines Püppchen in der Grotte: Arielle. „ Sie war einfach irgendwann da“, schmunzelt er. Und sie stammt garantiert nicht aus einer Grabung.
Vorbei an der dramatisch rot beleuchteten Höllenschlucht geht es wieder einige Stufen hinunter in Richtung Grufthalle und Palmengrotte. Dort steht ein prachtvoller Stalagmit, der über Jahrtausende in die Höhe gewachsen sein muss. Wie ein schlanker Palmenstamm reckt er sich in die Höhe. Die Blätter denkt man sich dazu. Doch tatsächlich ist das Staunen auch dieses Mal noch zu überbieten. Denn in der Alhambrahalle erwarten uns Stalagmiten und Stalaktiten unterschiedlichster Formen und Größen. Zudem gibt es filigrane Gebilde, die man sich nicht hätte vorstellen können.
Unzählige, übereinander geschichtete kleine terrassenförmige Wasserbecken –nicht größer als anderthalb, zwei Zentimeter – verteilen sich über die ganze Wand. Sie funkelt wie ein riesiger Bergkristall, doch es ist hauptsächlich fließendes und tropfendes Wasser, das im Licht glitzert. „ Das sind die Sinterterrassen von Pamukkale in der Türkei im Kleinformat “, erläutert der Höhlenführer. Sinter, aus Wasser auskristallisierte Kalkmineralien, ist der Stoff, aus dem hier die Stein-Kalk-Träume entstanden und weiterhin entstehen.
Kurz darauf durchstreifen wir die Kristallgrotte, an deren Wände sich zahllose zarte Tropfsteine schmiegen. Weiter geht es zur Kaiserhalle, in der nochmals eine von unten nach oben gewachsene Säule zu entdecken ist. Allerdings sicher fünfmal so umfangreich wie die Palme.

Wusstest du schon, dass die Höhle im Zweiten Weltkrieg teilweise als Luftschutzraum genutzt wurde?

ein englisches Museum
die Palme 1912 für 60.000 Goldmark kaufen wollte?

Mit der hinter der Kaiserhalle liegenden, damals noch tiefen Wolfsschlucht endet jener Teil der Höhle, der 1868 entdeckt und für Besucher erschlossen wurde. Doch die Entdeckungsgeschichte war noch nicht beendet. Denn rund 40 Jahre später kam ein weiterer Höhlenforscher ins Spiel.
Die Höhlenforscher sind immer noch aktiv
Die Rede ist von Dr. Benno Wolf, der zwischen 1909 und 1912 hinter der Wolfsschlucht weitere Gänge fand und erkundete. „ Alles war voller Geröll, das später teilweise gesprengt wurde.“ Der Aushub an Steinen und Lehm beim Ausbau der neuen Gänge wurde in die Wolfsschlucht gekippt, bis sie einen ebenen Boden hatte. Einen Eindruck von der Größe dieser Brocken vermittelt der riesige sogenannte Gespenstertisch mitten in der heutigen Halle.
Ende des 20. Jahrhunderts wurden in der Dechenhöhle unter der Leitung von Elmar Hammerschmidt, Höhlenforscher und Pächter der Dechenhöhle, weitere Seitengänge entdeckt. Die Vermessung der Höhle sowie die Forschungen am Gestein und im Boden sind längst nicht abgeschlossen. Sie brauchen Zeit und werden heute unter Dr. Stefan Niggemann weitergeführt. So lange wie die Entstehung der Höhle wird das zwar nicht dauern, aber sicherlich noch einige Jahrzehnte.
Auf einigen der von Dr. Wolf entdeckten Gänge sind wir jetzt unterwegs und noch immer gibt es Neues zu entdecken – auch wenn die größten Stalagmiten und Stalaktiten inzwischen hinter uns liegen.
Kanten, Klüfte und große Gesteinsbrocken prägen jetzt das Bild. Einmal führt der Weg durch einen Tropfsteintunnel. Im Gegensatz zu denen im vorderen Teil der Höhle sind die Tropfsteine jedoch klein und gedrungen. „ An was erinnert uns das? “, fragt der Höhlenführer verschmitzt. Das wird an dieser Stelle nicht verraten. Allerdings gibt der Name dieser Passage einen dezenten Hinweis: Gemüsegarten.
Kurz darauf ist der Ausgang der Dechenhöhle erreicht. Schade eigentlich, es hätte gerne noch weitergehen dürfen. Doch es bleibt ein unvergesslicher Eindruck. Der Höhlenführer schließt die Tür ab, wie er es auch bereits mit dem Eingang getan hatte. „ Die Dechenhöhle wurde von Anfang an verschlossen“, erzählt er. „ Solche Höhlen sind oft geplündert und zerstört worden. Meist wurden Tropfsteine einfach abgeschlagen.“ Wenn man die Tour durch die wunderschöne Dechenhöhle gerade hinter sich hat, erscheint das unvorstellbar. Gerade das Zusammenspiel der unterschiedlichsten in zigtausend Jahren von der Natur geformten Elemente macht eine solche Höhle doch zu einem Kunstwerk. Was für ein Glück, dass die beiden Eisenbahner ihren wiedergefundenen Hammer nicht zerstörerisch nutzten.
Dann schau dir die Dechenhöhle auf jeden Fall in ihrer natürlichen Pracht an, denn die Realität stellt jede noch so gute Beschreibung in den Schatten. Über zigtausende Jahre hat die Natur hier einen Ort geschaffen, wie der Mensch ihn schöner nicht anlegen könnte. Freue dich auf die Erzählungen deines Höhlenführers, der sich in der Dechenhöhle bestens auskennt und dich durch die Schauhöhle führt. Er wird dir z. B. zeigen, wo sich die Schichten des Berges verschoben haben und woher überhaupt das Wasser kommt, das die traumhaft schönen Gebilde in der Höhle formte und immer noch formt.

Deutschlands größtes Höhlenmuseum liegt unmittelbar an der Bahnstation Letmathe-Dechenhöhle. Hier kannst du herausfinden, wie Höhlen entstehen und wie Höhlenforscher vorgehen, um ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Du erfährst, wo in und um Iserlohn weitere Höhlen entdeckt wurden.
Außerdem kannst du dir ansehen, was die Forscher bis heute in der Dechenhöhle gefunden haben – fossile Knochen von Urzeittieren wie Mammut und Waldnashorn oder das komplette Skelett eines Höhlenbärenbabys zum Beispiel.




Wusstest du, dass eine Drahtrolle rund 30 kg wog und die Händler früher bis zu zwei Drahtrollen händisch über die Berge des Märkischen Sauerlandes transportieren mussten?
Die Wege waren besonders in dieser bergigen Region oft steil und unbefestigt. Mehr zum Thema erfährst du am Drahthandelsweg, an der Drahtrollenroute oder im Drahtmuseum in Altena.

Erstaunliche Geschehnisse an der Luisenhütte in Balve
Als Clemens August von Landsberg zu Erwitte Anfang 1758 die Leitung der Wocklumer Eisenhütte übernimmt, ist sie noch gar nicht in Betrieb. Seine Mutter, Anna Maria Theresia von Landsberg hatte jedoch alles vorbereitet, damit er durchstarten kann. Obwohl er eigentlich Jurist ist, geht er frohen Mutes ans Werk. Doch erst ein einprägsames Erlebnis entfacht seinen Ehrgeiz so richtig.
In seine Rolle als neuer Fideikomissherr von Wocklum hat sich Clemens August schnell eingefunden. Normalerweise hätte er schon 1748, nach dem Tod seines Vaters, die alleinige Verantwortung für die kompletten Wocklumer Besitzungen der Familie übernommen. Doch mit gerade mal 15 schien er zu jung. Und so führte seine Mutter Anna Maria Theresia von Landsberg die Geschäfte für zehn Jahre. Zehn Jahre, in denen sie die entscheidenden Weichen stellte für neue geschäftliche Unternehmungen der Familie. Zum Beispiel für die Eisenproduktion im großen Stil. Vor gut sechs Monaten übergab sie den Stab an Clemens August, der sogleich die Eisenhütte in Betrieb nahm, die seine Mutter bereits hatte bauen lassen. Jetzt kümmert er sich intensiv um die Geschäfte. Täglich reitet er am Nachmittag von Schloss Wocklum, wo die Familie residiert, hinüber zur Hütte.
Jedes Mal zügelt er das Pferd auf der Anhöhe und blickt hinab ins Tal auf die Hütte, den Stabhammer neben dem Hüttenteich und das Mühlrad, das den Blasebalg treibt. Meist verbringt er dann einige Stunden auf dem Gelände, um die Arbeiten zu verfolgen und sich mit seinen Beamten zu besprechen.
Auch heute sieht er vor Ort das vertraute Bild: In der hohen Halle schmelzen die Arbeiter unter der Aufsicht des Hüttenmeisters wie immer Eisen im Hochofen. Die Hitze ist unerträglich, deswegen bleiben er und sein leitender Beamter im Tor stehen. Clemens August nickt zufrieden und wendet sich zum Gehen. Vor der Halle stehen mehrere Pferdekarren mit Eisenstein aus dem nahegelegenen eigenen Erzabbau, dazu einige Karren mit Holzkohle. Noch viel Material für die aktuelle Hüttenreise. Nebenan im Stabhammer, auf den er jetzt mit seinem Beamten, Albert Möller, zugeht, wird gehämmert und geklopft. Auch dort geht alles seinen normalen Gang.
Das Mühlrad hatte sich vor einigen Tagen verhakt, was den Betrieb gleich behinderte. Wenn der Blasebalg nicht permanent in Betrieb ist, erreicht der Ofen nicht die erforderliche Temperatur von 1.400 Grad Celsius. Clemens August äußert seine Erleichterung, dass sich das Mühlrad wieder dreht. „Wir sollten einen zweiten Ofen bauen“, fährt er fort. „ Und ein zweites Mühlrad! “ Doch Möller wiegt nachdenklich den Kopf. „Vielleicht, gnädiger Herr, aber womöglich reicht uns der Schwung dann nicht. Der Borkebach führt derzeit wenig Wasser. Die Hitze.“, sagt er und deutet nach oben. „Wenn es nicht bald regnet, wird auch der Hüttenteich austrocknen.“ Clemens August hebt die linke Augenbraue. „Tatsächlich? Das ist mir gar nicht bekannt! “, sagt er. Möller nickt. „ Sehen wir es uns an“, sagt Clemens August. Energisch schreitet er voran, am Stabhammer vorbei, den Hang zum Stauteich hinauf. Am Ufer bleiben beide stehen.

Wusstest du schon, dass die Luisenhütte bis 1865 in Betrieb war und stillgelegt wurde, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig war?


Weitere Informationen Luisenhütte
Clemens August von Landsberg zu Erwitte die Eisenhütte ausbaute und lange erfolgreich führte?

Den Hüttenteich kennt Clemens August nur randvoll, jetzt ist der Wasserspiegel deutlich gesunken. Er nickt nachdenklich, dann schaut er Möller an und sagt: „ Der Wassermangel wird uns sicher nur temporär treffen. Wir lassen das mal auf uns zukommen. Über zu wenig Regen können wir uns ja eigentlich nicht beklahahaha …. Aaah! “
Ein Stück des ausgetrockneten Ufers bricht unter seinen Füßen weg und rutscht in den Teich. Clemens August verliert das Gleichgewicht, er rudert mit den Armen, findet jedoch keinen Halt. Sein Oberkörper schwingt nah vorne und Clemens August stürzt kopfüber hinein. Ein runder Wellenkreis bewegt sich auf die Ufer zu. Stille. „Gnädiger Herr? “, ruft Möller. „ Herr von Landsberg zu Erwitte ? “ Stille. „ Zu Hilfe! “, brüllt Müller. „ Zu Hilfe! Herr von Landsberg zu Erwitte … ertrinkt! “ Schon kommen Männer aus dem Stabhammer angelaufen und erklimmen den Hang. Sie erfassen die Lage sofort. Auf dem Teich schwimmt ein Hut.
Prustend taucht Clemens August aus dem Wasser des Hüttenteichs auf, seine Perücke schwimmt auf Entengrütze. Was für ein Debakel! Er macht einige hilflose Züge in deren Richtung. Da er sich aber gerade so über Wasser halten kann, gibt er gleich wieder auf. Soll sich Möller darum kümmern. Der hätte ihn mal lieber festhalten sollen. Wo ist der eigentlich? Und was ist das für ein Lärm?
Er versucht, sich im Wasser zu drehen und irgendwo Halt zu finden. Diese Grütze ist ja ekelig, sie war ihm gar nicht aufgefallen, als er am Ufer stand. Er findet einen Holzpfahl, an dem er sich festhalten kann. „ Möller! “, ruft er. Er soll ihm gefälligst heraushelfen. Völlig unwürdig, dass er im eigenen Hüttenteich treibt. Er, Clemens August von Landsberg zu Erwitte. Suchend schaut er sich nach Möller um. Stattdessen trifft sein Blick auf – eine Meerjungfrau? Mit langen dunklen Haaren über dem bleichen Oberkörper und goldschimmernder Flosse. „ Möller! “, ruft er erneut, jetzt etwas ungehalten, und fragt sich, ob er sich unter Wasser den Kopf gestoßen hat. Mit der freien Hand reibt er sich die Augen.

Als er sie wieder öffnet, erschrickt er nochmals. Die Meerjungfrau schwebt auf ihrem Floß über ihm und lächelt lieblich. „ Komm‘“, sagt sie. „ Ich helfe dir.“ Sie reicht ihm die Hand. Clemens August fährt erschrocken zurück. „Wo ist Möller? “, fragt er. „Wer ist Möller? “, fragt sie zurück. Er verrenkt sich den Hals. „ Mein … Eben stand er noch da beim Stabhammer …“, er stutzt und bemerkt erst jetzt eine Traube von Menschen am Ufer, die herüber starrt. Wo kommen die denn her? Und wie sehen sie aus? Mechanisch lässt er den Holzpfahl los und versinkt.
Kurz darauf taucht Clemens August wieder auf und schaut sich vorsichtig um. Er muss träumen. Erneut streckt ihm die Meerjungfrau lächelnd die Hand entgegen. Was für ein betörendes Lächeln, was für eine zarte Hand. Dieses Mal nimmt er sie. Doch natürlich klappt die Rettung nicht auf Anhieb, die Flosse ist einfach hinderlich. „ Kann mal jemand helfen? “, ruft die Nixe. In der Menge greifen Hände an Hinterteile. „ Sofort! “, brüllt sie. „ So ein zartes Wesen und so eine Stimme“, denkt Clemens August, während er versucht, sich am Floß hochzuhangeln.
Neben ihm platscht es. Jemand ist ins Wasser gesprungen. „ Möller? “, fragt er. Doch nein, es ist ein junger Mann, der ihn jetzt hochschiebt. Endlich liegt er auf dem Floß und atmet schwer. Die Menschen am Ufer scheinen zu applaudieren.
„ Kannst du denn nicht schwimmen? Mit den schweren Klamotten hättest du leicht untergehen können“, sagt die Meerjungfrau, während sie das Floß an einem Seilzug ans Ufer zieht. „ Schau, dass du wieder trocken wirst. Setz dich am besten etwas in die Sonne.“
Clemens August ist aufgestanden. Er versteht die Welt nicht mehr, versucht aber die Form zu wahren. „ Darf ich mich kurz vorstellen? “, er deutet eine Verbeugung an. „Clemens August von Landsberg zu Erwitte! “ Er betont das von und das zu besonders. „ Hi Clemens, ich bin Nike“, sie gibt ihm die Hand. „ Deine Kolleg*innen laufen hier auch auf dem Gelände rum. Luise und Alfred können dir sicher helfen.“ Verstört lässt sich Clemens August von dem jungen Mann ans Ufer helfen. Der reicht ihm auch seine Perücke. „ Danke“, sagt er, setzt sie auf und nickt Nike ein letztes Mal zu.
Was macht die Meerjungfrau auf seinem Hüttenteich? Woher kommen die merkwürdig gekleideten Menschen, die – auch wenn manche ein bisschen so aussehen –weder seine Hüttenarbeiter oder Hammerschmiede noch seine Beamten sind, die er ja alle persönlich kennt? Er tritt durch die Menschentraube zum Hang, den er eben mit Möller hinaufgestiegen ist und stockt schockiert – Menschen über Menschen, Zirkusleute, Frauen in Hosen, Frauen in luftigen Nachtgewändern, lachende, herumlaufende Kinder und eben diese Männer in Arbeitskleidung. Viele haben Flaschen oder Gläser in der Hand, manche etwas zum Essen, die meisten halten kleine, schwarze, rechteckige Platten in verschiedene Richtungen, aber keiner arbeitet. Wo zum Henker ist Möller?
Den Hang führt eine stabile Treppe hinab. Links steht der Stabhammer, doch davor sind bunte Blumen aus dem Boden geschossen, mittendrin steht ein Elefant. Nein, ein Mammut. Das Schreiberhaus, Möllers Amtsstube, ist umringt von hüpfenden Menschen beiderlei Geschlechts. Clemens August steuert mutig darauf zu. Schwungvoll tritt er ein und wäre um ein Haar gegen eine Glasscheibe geprallt, hinter der Möllers Katheder steht. Hier ist Möller also nicht. Kopfschüttelnd tritt er aus dem Häuschen und erschrickt erneut.

Wusstest du schon, dass
Clemens Augusts Enkel Ignaz von Landsberg-Velen und Gemen die Luisenhütte im 19. Jahrhundert nach seiner Frau Luise von WesterholtGysenberg benannte?

erst Ignaz die bahnbrechenden Neuerungen wie den Röhrenwinderhitzer, die Gebläsedampfmaschine und das Zylindergebläse einführte?
Seine Eisenhütte! Das Gebäude ist unverkennbar, aber es ist gewachsen. Nach rechts und in die Höhe. Und es scheint nicht in Betrieb zu sein, denn der Schornstein qualmt nicht. Auch der markante Geruch von Feuer, Eisen und Schlacke fehlt. Verzweiflung macht sich in ihm breit. Was ist das hier? Wo ist er hier? Er muss nachdenken. Aber wie soll er das bei diesem Lärm?
Ein hohes Sirren liegt in der Luft, Trommeln geben einen Takt. Sind hier Truppen im Anmarsch? Er lokalisiert endlich den Lärm und entdeckt – eine Wanderkapelle. Soll das Musik sein? Die Töne kommen von einem verkürzten Cembalo, einem Bass, der ohne Bogen gespielt wird, einer Staffel unterschiedlicher Trommeln und einem anderen, sehr merkwürdigen Saiteninstrument, gespielt von einem Piraten! Einer der Männer singt, wie ihm scheint, völlig unmelodisch in einer ihm unbekannten Sprache immer wieder Mörie, Mörie. Oder ist das Englisch? Männer, Frauen, Kinder wippen, lachen und tanzen.
Er muss hier weg. Er muss nachdenken! Clemens August bahnt sich den Weg durch die Menschen, um die Anhöhe hinaufzugehen, von der aus er heute Morgen wie jeden Tag auf seine Hütte geblickt hatte. Vorbei an einem Schwertschlucker und einem Gaukler, der farbenfroh gekleideten, unerschrockenen Kindern in ein merkwürdiges Schleudergerät hilft. Unter einem bunten Zirkusdach, mit spielenden Kleinen hindurch über die Wiese und mitten hinein ins Gerstenfeld.


Oben angelangt, setzt er sich hin, einen Halm im Mund. Hier ist alles vertraut. Die Erde, die Felder, die Wälder am Burgberg. Er streckt sich in der Sonne aus und beruhigt sich ein wenig. „Grotesk “, murmelt er vor sich hin und denkt nach. Doch er begreift nicht, was passiert ist. Vielleicht sollte er einfach zum Schloss laufen. Seine Kleidung und seine Perücke sind inzwischen fast trocken, grüne Schlieren sind an beiden noch zu sehen. Er steht auf und geht einige Schritte den Burgberg hinauf, bis er das im Tal des Orlebachs liegende heimatliche Schloss sieht. Wieder läuft ihm ein Schauder über den Rücken. Neben dem Schloss stehen mehrere unbekannte Gebäude.
Entsetzt dreht er sich um und blickt wieder hinunter zur Eisenhütte. Über das hochstehende Getreide hinweg verfolgt er das bunte Treiben auf seinem Land im Tal. Er schüttelt den Kopf. Manchmal, wenn ihm der Stoff während seiner juristischen Studien zu trocken wurde, hatte er fantastische Bücher gelesen. Mit Voltaire war er in den Weltraum gereist, mit Swifts Gulliver in unentdeckte Länder. Und bei Margaret Cavendish sogar in eine Parallelwelt am Nordpol. Aber das ist philosophische Literatur. Und dies hier eigentlich das bodenständige Westfalen. Doch er scheint in einer fremden Welt, in einer fremden Zeit zu sein...


die Luisenhütte die älteste vollständig erhaltene Hochofenanlage Deutschlands ist?

Tipp: Direkt am Maste-Barendorf entlang verläuft der Ruhr-Lenne-Achter.
Dieser Radweg ist eine Rundtour, die die Flüsse Ruhr und Lenne miteinander verbindet und landschaftlich, sowie kulturell sehr reizvoll ist.
Mit 14 Jahren beginnt Ludwig in Letmathe im Galmei-Abbau zu arbeiten. Das Erz wird in Iserlohn für die Messing-Produktion benötigt, aus dem bereits im 18. Jahrhundert weltberühmte Tabaksdosen gefertigt wurden. Zu Ludwigs Zeit im 19. Jahrhundert werden daraus auch Möbel- und Türbeschläge, Schlitten- und Tischglocken, Türklinken und Kerzenleuchter hergestellt. Zum Beispiel in der Fabrikanlage der Firma Dunker und Maste in Barendorf, in der Ludwig sich forsch ein neues Leben sucht.
Ludwig musste sich sputen. Um ein Haar hätte er zu lange geschlafen, im Stroh, neben seiner Liebsten, Marie. Jetzt lief er dennoch leichten Herzens querfeldein, um rechtzeitig in Barendorf zu sein. Denn es war ein besonderer Tag: Zum ersten Mal durfte er in der Gelbgießerei arbeiten. Er war aufgeregt, denn dass das nicht ungefährlich war, hatte er schon erfahren.
In der Welt der Erze war er zu Hause, seitdem er seine ersten Thaler mit der Arbeit der eigenen Hände verdient hatte. Im Galmei-Abbau, kaum dass er 14 Lenze zählte. In Letmathe war das gewesen, wo sich viele zugereiste Männer ihren Lohn mit harter Bergbauarbeit verdienten und in Unterkünften auf engstem Raum lebten. Er selbst hatte es besser, denn er konnte abends mit dem Vater ins Grüner Tal zurückkehren. Dort war es ebenfalls eng, aber immerhin war er im Kreis der Familie.
Eines Tages hatte er einen Transport des kostbaren Zinkerzes nach Barendorf begleiten müssen, um das Gestein vor Ort zu entladen. In Barendorf, das wusste er schon aus Erzählungen seines Vaters, wurde daraus nach langer Schmelze in einem Gemisch mit Kupfer Messing gemacht.
Messing, das aussah wie Gold und das Iserlohn durch seine Tabaksdosen ebenso berühmt gemacht hatte wie jetzt seine Eisennadeln. Johannes Dunker und Franz Maste hatten deswegen in Barendorf ein Messingwalzwerk gebaut, später noch die mittlere und die untere Fabrik, wo auch Draht gezogen und Eisen gegossen wurde.

Wusstest du schon, dass die Fabrik Mitte der 1820er Jahre entstand und anfangs die Messingverarbeitung, eine Eisengießerei, eine Feilenhauerschmiede und eine Ahlenschmiede beherbergte?
Im Walzwerk wurde das Messing zu großen, glänzenden Platten ausgerollt, aus denen Beschläge oder Knöpfe entstanden. Dort, etwas oberhalb der mittleren Fabrik, arbeitete Ludwig jetzt schon geraume Zeit. Denn nachdem er mit eigenen Augen gesehen hatte, wie das Messing entstand, wollte er keinesfalls wieder zurück in die Galmei-Minen.
So hatte er in Letmathe seinen Hut genommen und im Grüner Tal mit dem Segen seines Vaters sein Ränzlein gepackt. Er versprach, die Familie zu besuchen, und wanderte im dichten Wald am Baarbach entlang Richtung Norden. Als er auf die Barendorfer Wasserräder gestoßen war, hatte er sein Ziel erreicht. Wasserräder waren die Zauberformel im beginnenden Industriezeitalter und in Barendorf hatten sie vier davon.
Beherzt hatte er sich dem Verwalter vorgestellt. Der hatte zwar eine strenge Miene aufgesetzt und ihm beschieden, auf die Entscheidung Franz Mastes zu warten – der Gründer wohnte mit seiner Familie direkt bei der mittleren Fabrik im Fabrikantenhaus. Doch dem Mutigen gehörte schon damals die Welt.
Und junge, kräftige Männer waren Ende der 1830er Jahre gesucht, um die schweren Arbeiten im Oberen Walzwerk zu übernehmen. Daher konnte Ludwig in der Messingwalze schnell seine Lehrjahre beginnen. Denn natürlich reichte Mut allein nicht aus, um gutes Messing zu schmelzen und zu walzen.

Fast drei Jahre waren seitdem vergangen. Jahre, in denen er viel über Messing und seine Verarbeitung gelernt hatte. Gerade anfangs hatte er manche Schelte einsteckenmüssen, wenn er im Walzwerk einen Fehler machte. Doch diese Zeiten waren lange vorbei und inzwischen hatte er gelernt, Bügeleisen oder Schnallen herzustellen und Messing zu prägen. Seit Kurzem aber gab es die Gelbgießerei in der mittleren Fabrik, wo glühendes Messing in Formen gegossen wurde. Der Verwalter hatte ihn zu sich beordert und beauftragt, dem dortigen Meister zur Hand zu gehen. Ludwig hatte sofort eingewilligt, denn die Gelbgießerei faszinierte ihn.
Jetzt betrat er etwas außer Atem die kleine Gießerei. Im Ofen schlugen die Flammen bereits hoch, das Messing köchelte golden vor sich hin. Mitten in der Nacht hatten die Helfer angeheizt, damit es sich tagsüber gut gießen ließe. In einem geschlossenen Ofen mit langem Kamin, denn die Dämpfe hatten es in sich. Ludwig nahm eine der schweren Lederschürzen vom Haken, wand sie sich um und griff nach einem Paar Handschuhe, bevor er zum Meister trat. Der blickte gerade konzentriert in den Ofen, um abzuschätzen, wann gegossen werden könnte.
Sodann zeigte er Ludwig, wie er künftig die Gussformen vorbereiten sollte. Manche, zum Beispiel die Formen für eine ganze Reihe an Türklinken oder Glocken, waren relativ schlicht und zweckmäßig. Andere aber waren für kunstvollen Zierrat geformt, der an Zäunen und Kaminen an und in Häusern reicher Kaufleute genutzt wurde. Doch unabhängig von der Gestalt mussten alle Formen auf dieselbe Art behandelt werden: Die zweiteiligen Hohlformen wurden in griffigem Sand angelegt und verfestigt, zur Isolierung mit Puder bestäubt und über ein Scharnier geschlossen. Durch ein Gussloch in der Form wurde dann das glühende Messing gegossen.
Als das Messing an diesem Tag die richtige Farbe, Fließfähigkeit und Temperatur –fast 1.000 Grad – hatte, nahm der Meister eine Kelle. Routiniert, aber doch vorsichtig schöpfte er das siedend heiße Messing aus dem Ofen und füllte es zielgenau in eine Glockenform. Als nächstes goss er mehrere Kellen in eine Form für putzige Figürchen. Dann folgte eine größere Form für ein Kamingitter. Der Meister arbeitete so sorgfältig wie zuvor, doch plötzlich verrutschte die Form und kippte vom Tisch, dem Meister entgegen.
Der sprang einen Schritt zurück, drohte das Gleichgewicht zu verlieren. Ludwig konnte verhindern, dass er in Richtung Ofen stürzte. Doch vor Schreck ließ der Meister die Kelle fallen. Sie landete zischend auf einem Stapel leerer Formrahmen, die sofort Feuer zu fangen drohten.
Geistesgegenwärtig riss sich Ludwig seine schwere Schürze vom Leib, warf sie auf den Stapel und erstickte das Feuer. Die Schürze war hinüber, dennoch war er der Held des Tages. Er erhielt großes Lob und zum Dank für seinen mutigen Einsatz konnte er in der Gelbgießerei bleiben. Ihm wurde sogar der Lohn ein wenig erhöht. Ludwig war selig.

in Barendorf nach und nach drei Produktionsstätten aufgebaut wurden – das obere Walzwerk, die mittlere Fabrik und die untere Fabrik?


Vor allem, weil er jetzt vielleicht endlich seine Marie heiraten und mit ihr eine kleine eigene Bleibe suchen könnte. Nicht zu weit weg von Barendorf. Schließlich wollte er hier später selbst Meister in der Gelbgießerei werden und sich immer neue Formen für den Messingguss ausdenken.
Wusstest du schon, dass die Fabriken durch ein Wasserführungssystem im Baarbach mit vier Wasserrädern angetrieben wurden, die Wasserkraft später aber nicht mehr ausreichte?
Du hast Lust, mehr über die Industriegeschichte Iserlohns zu erfahren? Dann mach dich auf den Weg und erkunde das Fabrikendorf Maste in Barendorf. Denn dort sind die im Auftrag der Stadt Iserlohn originalgetreu restaurierten Fachwerkgebäude der ehemaligen mittleren Fabrik erhalten. Diese entstand Mitte der 1820er Jahre und beherbergte anfangs die Messingverarbeitung, eine Eisengießerei, eine Feilenhauerschmiede und eine Ahlenschmiede.
Die nach und nach aufgebauten Produktionsstätten – das obere Walzwerk, die mittlere Fabrik und die untere Fabrik – wurden damals durch ein Wasserführungssystem im Baarbach mit vier Wasserrädern angetrieben. Auf lange Sicht erwies sich die Wasserkraft jedoch als nicht ergiebig genug. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die obere Walze und die untere Fabrik verkauft. Die mittlere Fabrik ging ab 1923 an einen Pächter, bis in die 1950er Jahre wurde sie industriell genutzt.

Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf in Iserlohn
Heute ist der idyllische Komplex ein Museums- und Künstlerdorf. Wegen einer Neukonzeption des Nadelmuseums ist das Museum in Barendorf derzeit geschlossen. Das Gelände sowie der industriekulturelle Spielplatz sind jedoch frei zugänglich. Zudem finden weiterhin einzelne Führungen sowie weitere Veranstaltungen, Konzerte und Workshops statt, zum Beispiel Vorführungen in der Gelbgießerei, bei denen du live erleben kannst, wie Messing zu Ludwigs Lebzeiten gegossen wurde. Auch das Café hat geöffnet.
Du erreichst Barendorf entweder mit dem Auto oder mit dem Bus. Oder auf deiner Wanderung bzw. deiner Radtour am Baarbach, der noch heute nördlich von Iserlohn plätschert. Wenn du ihm folgst – zu Fuß oder mit dem Rad – triffst du unweigerlich auf Barendorf, das du auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht als ehemalige Fabrik erkennst.


Anno dazumal auf dem Drahthandelsweg zwischen Altena und Iserlohn
Wir schreiben das Jahr 1770: Kaspar ist ein fleißiger Bursche, Anfang 20. Er arbeitet als Zöger in einer Drahtrolle im Rahmedetal zwischen Lüdenscheid und Altena. Einmal im Monat schickt ihn sein Reidemeister mit einer Wagenladung Rollen über Berg und Tal bis nach Iserlohn. Dort wird der Draht zu Nadeln weiterverarbeitet. 18 Kilometer sind auch damals eigentlich nicht besonders weit. Doch die Strecke hat es in sich und dauert, vor allem an kurzen Herbsttagen mit durchwachsenem Wetter, gerne mal von morgens bis abends. Auf dem Kutschbock muss Kaspar immer wachsam bleiben und nicht nur dort.
Kaspar trat vor die Tür. Hinter dem Haus rauschte die Rahmede, sie führte zu dieser Zeit ausreichend Wasser, um die Drahtrolle zu betreiben. Der Morgen war dunkel, frisch und feucht. Er brachte den erdigen Duft des Herbstes mit sich. Die nächsten Tage würden kalt werden, dazu brauchte man kein Wetterprophet zu sein. Hauptsache, es würde nicht mehr so stark regnen wie die letzten Tage. Regen war zwar gut für den Betrieb des Wasserrads, aber schlecht für die Wege und für den Draht, den er zu transportieren hatte. Durch das Fenster über seinem Lager schimmerte eine Öllampe. Das einzige Licht weit und breit, abgesehen von der Glut im benachbarten Drahthammer.

Das Feuer ließ der Reidemeister nie ausgehen, denn um das Eisen zum Drahtziehen anzuwärmen und geschmeidig zu machen, brauchte man es den ganzen Tag. Immer neu anzufeuern, kostete zu viel Zeit und eine von Kaspars Aufgaben war, nachts über das Feuer zu wachen. Deswegen war sein Lager im Schuppen direkt neben der Drahtrolle. Doch kommende Nacht würde sich jemand anders kümmern müssen. Kaspar sollte wieder eine Fuhre Draht nach Iserlohn bringen und nur bei gutem Wetter war der einfache Weg an einem Tag zu schaffen. Und der Rückweg am Tag darauf.
Inzwischen hatte es begonnen zu dämmern. Schnell wusch er sich am Trog und begann, den Wagen mit Draht zu beladen. Rund 30 Kilogramm wog eine Rolle mit einem Durchmesser von 70 bis 80 Zentimetern, die er eigenhändig gezogen hatte. Beim seinem ersten Reidemeister musste er noch jede Rolle auf den Schultern einzeln nach Iserlohn tragen. Das Fuhrwerk erleichterte die Reisen ungemein, doch nicht jeder Meister konnte sich Pferd und Wagen leisten. Und für ihn gab es sowieso einen Grund, sich auf jede Reise zu freuen.
Lächelnd hievte er die nächste Rolle auf den Wagen. 30 Rollen würde er nach Iserlohn bringen. Der kräftige Kaltblüter könnte auch ein höheres Gewicht ziehen, doch die Strecke war teilweise sehr steil und der Reidemeister wollte den Verlust des Gespanns nicht riskieren. Kurz darauf war der Wagen beladen, durch den nebeligen Dunst schimmerte jetzt das erste Tageslicht. Schnell spannte er noch das Pferd an. Dann warf er seine Schaffellweste über, ging zum Wohnhaus von Eberhard, dem Reisemeister, und klopfte. Der öffnete die Tür und lud ihn noch auf eine Morgensuppe ein. Kaspar nickte, grüßte Gertrude, Eberhards Frau, und nahm das Angebot dankbar an. Kurz darauf fuhr er los.
Zunächst ging es an der Rahmede entlang den abschüssigen Weg bis zur Mündung in die Lenne. Rechts davon fuhr er auf die Steinerne Brücke. Es herrschte viel Betrieb. Dies war die einzige Brücke über die Lenne weit und breit.
Wusstest du schon, dass der Handelsweg des Drahtgewerbes zwischen Lüdenscheid, Altena und Iserlohn vom Mittelalter bis zur Industrialisierung bestand?

der Draht in Altena ab dem 18. Jahrhundert aus Stabeisen gezogen wurde, das in Lüdenscheid aus Osemundeisen vorgeschmiedet wurde?
Und so kamen die Drahtfuhrwerke nicht nur aus dem Rahmedetal wie der Wagen hinter ihm, sondern auch aus dem weiter westlich liegenden Tal der Brachtenbecke. Die Zöger kannten und grüßten sich. Bis zum Iserlohner Tor hätten sie den gleichen Weg. In stillem Einverständnis hielten sie sich rechts, um die Strecke am Hang zu nehmen. Unten am Lenneufer war es zu schlammig.
Der Nebel hatte sich inzwischen gelichtet, doch in den Wäldern hingen noch Wolkenfetzen. Bald passierten die Fuhrwerke linkerhand Altena. Die Ruine der Burg Altena oben auf der Wolfsegge war durch die Bäume hingegen kaum zu sehen. Nur der Bergfried ragte in die Höhe. Kaspar hatte für solche Details jetzt ohnehin keinen Blick. Der Weg war ausgefahren und noch feucht vom Regen der letzten Tage. Im Wald hielt sich die Nässe oft tagelang. Er kannte den Weg bestens, dennoch achtete er konzentriert darauf, dass der brave Kaltblüter und der Wagen die Spur hielten.
Nachdem sie das Tal der Nette gekreuzt hatten, begann auf der Mühlendorfer Seite der erste größere Anstieg. Erst verlief der Weg parallel zum Hang, dann aber schlängelte er sich steil den Berg zum Gehegde hinauf. Oben erwartete die Männer das erste Gasthaus und alle brachten ihre Pferde zum Halten. Die Sonne hatte inzwischen den Himmel vollständig erobert. So gaben die Männer ihren Pferden Wasser, holten sich dann Bier, setzten sich mit Blick auf die Burgruine auf die Wiese und schnitten ihr Brot. Die erste Etappe war geschafft.
Bald darauf verabschiedeten sich die fünf Männer vom Wirt und nahmen ihre Plätze auf den Böcken wieder ein. Die zweite Etappe wurde einfacher. Sie war über Jahrhunderte ausgeklügelt und verlief zunächst über den Toten Mann, den Berggrat, dessen Eisenvorkommen schon lange erschöpft waren. Dann ging es weiter in Richtung Norden. Die Strecke des Drahthandelswegs umging Täler, da die Wege dort unten oft zu rutschig waren, und mied zu starke Steigungen. Und so nahmen die fünf Wagen zwei Stunden später bergauf die letzte Kurve zum Gasthof in Kesbern. Kaspars Herz schlug höher.
Die herbstliche Sonne stand jetzt hoch am Himmel und schon von weitem sah er die Wirtstochter Katharina zwischen den draußen stehenden Tischen umherlaufen. Hier stellte sie eine Speise ab, dort nahm sie eine Bestellung auf, dann lief sie ins Haus. Er konzentrierte sich auf seine Arbeit, spannte das Pferd aus, brachte es auf die Weide. Erst dann nahm er am Tisch der Gesellen Platz. Schon bald trat Katharina freundlich heran, um die Bestellungen anzunehmen. Die Stimmung am Tisch war angesichts der jungen Frau aufgeräumt.
Als sie im Haus verschwand, stieß einer der Männer aus dem Brachtenbecker Tal den anderen in die Seite und forderte ihn auf, sich ihr gegenüber deutlicher bemerkbar zu machen. Kaspar schluckte. Katharinas Charme war natürlich auch den Kollegen aufgefallen, die Konkurrenz schlief nicht. Er musste handeln, aber wie? Gedankenverloren sah er ihr entgegen, als sie fünf Humpen Bier brachte. Sie lächelte. Meinte sie ihn? Er lächelte schüchtern zurück. Aber was war schon ein Lächeln, sie lächelte hier ja den ganzen Tag allerliebst. Kaspar hob das Bier und stieß mit den anderen an. Vielleicht hätte er sich wie sonst an einen Einzeltisch setzen sollen.
Die Zeit verrann und Kaspar sah keine Möglichkeit, Katharina allein zu sehen. Kurz vor der Weiterfahrt stand er mit der Bemerkung auf, sich noch ein Stück Brot zu holen. Auf dem Weg in die Gaststube kam sie ihm entgegen, lächelte und schwebte vorbei. Er hatte immerhin ebenfalls gelächelt – hoffentlich war es nicht zu einem Grinsen geraten. Das Brot bekam er sofort und steckte es in die Tasche, es würde ihn abends eine Mahlzeit sparen. Denn üppig war sein Lohn nicht gerade. Schnell folgte er den anderen auf die Weide und holte sein Pferd, das sich ebenfalls gestärkt hatte. Gut so, denn auf der letzten und längsten Etappe bis Iserlohn waren noch drei Berge zu überqueren.
Am Abend erreichten die Männer die Stadt durch das Iserlohner Tor. Sie winkten und fuhren in verschiedene Richtungen davon. Kaspar kannte den Weg zu seinem Nadler und erreichte die Nadelfabrik am Stadtrand bald. Es war schon dunkel, als er eintraf. Doch der Nadelhersteller wusste, um welche Zeit Kaspar üblicherweise kam, und erwartete ihn bereits. Gemeinsam luden sie den Wagen ab. Dann suchte sich der Zöger eine bescheidene Bleibe für die Nacht, wo er das Pferd versorgte und sich selbst angesichts der herbstlichen Temperaturen doch noch eine Abendsuppe gönnte.
Morgens ging es früh wieder los. Für den Rückweg lud er an der Fabrik noch einige Pakete Nadeln auf, die in Altena gebraucht wurden. Die nächste DrahtrollenLieferung vereinbarten sie in einem Monat. Doch jetzt ging es mit der leichten Ladung schnell zurück. Der Meister brauchte ihn. Seine Pause in Kesbern ließ er sich dennoch nicht nehmen, doch Katharina sah er nur kurz. Im sonnigen Garten bediente ein anderes Mädel und aus der Gaststube verschwand Katharinas lockiger Schopf mit der Haube gerade in der Küche. Als er den Gaul wieder anspannte, stand sie jedoch im Hintereingang und schaute zu ihm hinüber. Er hob er die Hand zum Gruß und setzte die Fahrt beschwingt fort.
Wusstest du schon, dass die Zöger, die den Draht zogen, schon früh die Wasserkraft der Bäche nutzten?

die Drahtrollen ursprünglich von Altena nach Iserlohn getragen wurden, bevor Fuhrwerke zum Einsatz kamen?
Der nächsten Fahrt fieberte er entgegen. In der Drahtrolle war er fleißiger denn je, obwohl er natürlich wusste, dass mit dem Nadler in Iserlohn ein fester Termin vereinbart war und er nicht einfach früher liefern konnte. Doch weil er so schnell war, gab ihm der Meister ein paar Münzen extra. Kaspar freute sich. Am Abend vor der nächsten Fahrt legte er sich froh auf sein Lager, er würde Katharina in Iserlohn ein Geschenk kaufen. Nachts stand er auf, um nach dem Feuer zu sehen. Dann legte er sich wieder hin und träumte mit offenen Augen von der hübschen Gastwirtstochter.
Der nächste Morgen war noch dunkler, frischer und feuchter als der Morgen seiner letzten Reise. Es war jetzt Mitte November. Nebel waberte. Ihn fröstelte. Wieder packte er 30 Drahtrollen aufs Fuhrwerk. Wieder spannte er den treuen Kaltblüter an. Wieder klopfte er an der Tür des Reisemeisters, um seine Abfahrt anzukündigen. Und wieder erhielt er eine Morgensuppe, die er dankend annahm. Als er aufbrechen wollte, nahm ihn der Reidemeister jedoch zur Seite. Er sei ein guter Zöger, sagte er. Und ein freundlicher Geselle, den er gerne als Schwiegersohn in seiner Familie hätte. Verlegen senkte Kaspar den Kopf. Seine Ohren glühten. Seiner Tochter Mathilde hätte er noch nichts gesagt, raunte der Reidemeister. Doch Kaspar solle auf seiner Fahrt einfach darüber nachdenken, sie zu heiraten, sagte er augenzwinkernd zum Abschied. Kaspar versuchte zu lächeln, nickte abwesend, schwang sich auf den Kutschbock und grüßte zum Abschied.
Während er vom Grundstück rollte, atmete er tief ein und wieder aus. Mathilde mochte ein herzensgutes Mädchen sein, aber sie war doch eben noch ein Kind gewesen. Ein Mädchen, das er in den letzten drei, vier Jahren hatte aufwachsen sehen. Der Nebel hatte ihn außerhalb der Siedlung fast umschlossen. Die Dämmerung tat sich schwer, die Nacht endgültig zu vertreiben. Zehn Meter, weiter konnte Kaspar kaum sehen. Doch er kannte den Weg, er musste nur bei der Sache bleiben.

Er schob alle störenden Gedanken beiseite, leitete den Wagen routiniert bis zur Lenne, überquerte den Fluss und nahm den Weg am Hang des Klusensteins entlang. Kollegen waren weder zu sehen noch – was bei diesen Bedingungen wahrscheinlicher gewesen wäre – zu hören. 30 Meter betrug die Sicht inzwischen. Er hätte sich Ablenkung gewünscht, doch Altena auf der linken Seite oder oben den Bergfried auf der rechten konnte er nur erahnen. Immer wieder dachte er an Katharina, wie federleicht sie ihrer Arbeit im Gasthaus nachging. Dann nahm der Aufstieg zum Gehegde seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Kaspar fluchte vor sich hin. Die Feuchtigkeit zog ihm durch alle Glieder und drückte ihm auf die Stimmung. Oben angelangt, war an ein Bier auf der Wiese nicht zu denken. Er war froh, sich kurz drinnen aufzuwärmen und schlürfte an der Schänke eine Brühe. Bald setzte er seinen Weg fort.
sich in und um Altena in vielen Tälern –z. B. Brachtenbecke, Nette, Rahmede, Springerbach –eine Drahtrolle an die andere reihte?

Wie hatte er sich auf die Fahrt gefreut. Darauf, Katharina wiederzusehen. Und jetzt? Machte ihm der Reidemeister diesen Vorschlag. Noch im April hätte er wahrscheinlich einfach zugestimmt. Was für ein Vertrauensbeweis und was für eine gute Gelegenheit, in das Reidemeister-Geschäft einzusteigen. Zumindest deutete Kaspar das Angebot so. Und Mathilde? War ein braves Mädchen und eigentlich ja auch im heiratsfähigen Alter. Aber seit Mai dachte er an Katharina, ach Katharina. Mittlerweile hatte er sich Kesbern schon deutlich genähert. Die Sicht besserte sich weiter und mit einem Mal hörte er hinter sich einen Wagen. Im Umdrehen erkannte er den Kollegen aus dem Brachtenbecker Tal, der fröhlich winkte. Als sie in Kesbern ankamen, schimpfte er über die Nebelbrühe. Kaspar pflichtete ihm bei. Beide stellten sich vor – der Kollege hieß Marius – und so kamen sie ins Gespräch. Sie betraten das Gasthaus gemeinsam und setzten sich.
Kaspar hielt verstohlen Ausschau nach Katharina und bemerkte, dass Marius ebenfalls den Blick schweifen ließ. Und dann tauchte sie auf. Freundlich wie immer trat sie an den Tisch und begrüßte die beiden Männer. Marius versuchte sogleich, ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es gelang ihm nicht, denn sie widmete sich beiden gleichermaßen. Das ärgerte Kaspar, hatte er doch zuvor das Gefühl gehabt, sie möge ihn besonders. Er schalt sich einen Trottel! Er sollte einfach Mathilde heiraten und Reidemeister werden.

Hier Weiterlesen


Drahthandelsweg Lüdenscheid –Altena – Iserlohn

Entdeckungen entlang der Drahtrollenroute in Altena-Evingsen
Evingsen liegt an einem steilen, waldigen Berg. Die Hauptstraße des Altenaer Ortsteils verläuft in Serpentinen, viele kleine Straßen durchziehen den Hang. Darunter die schmale, steile Gasse Im Springen, die auf einem kleinen, frisch gepflasterten Platz endet. Was man auf den ersten Blick gar nicht vermutet: Hier liegt eine Wiege der Industrie im Märkischen Sauerland. Wald, eine kräftig sprudelnde Quelle und Eisenerz, das einfach herumlag, bildeten das Fundament. Mut, Tatkraft und Erfindergeist ermöglichten den Rest. Das kleine Springer Tal in Evingsen zeigt im Kleinformat, wie sich die Eisen- und Metallindustrie im Märkischen Sauerland über Jahrhunderte entwickelte.
Die Wildschweine waren da, mal wieder. Sie lieben den feuchten Boden unweit der Springer-Quelle inmitten des waldigen Altenaer Ortsteils Evingsen und haben ihn ordentlich durchpflügt. Der freundliche Herr vom Heimatverein Evingsen deutet die Spuren, ohne zu zögern. Schließlich kennt er Ort und Geschichte wie seine Westentasche.
Die Springer-Quelle, so berichtet er, sprudele seit Ewigkeiten kräftig den steilen Hang hinab ins Springer Tal. Nicht nur die Wildschweine, auch die Menschen wussten die Quelle schon immer zu schätzen. Die Menschen nutzten vor allem die Kraft, mit der das Wasser hinunterschoss.
Spätestens Ende des 16. Jahrhundert entstanden im Springer Tal die ersten Drahtrollen. So heißen im Märkischen Sauerland kleine Metallwerke, in denen zu früheren Zeiten mit Unterstützung durch Wasserkraft Draht gezogen wurde. Mit der Springer-Quelle beginnt also die Drahtgeschichte im Springer Tal. Auf rund 700 Metern gründeten sich entlang des Springer Bachs zwölf kleine Drahtziehereien, die den Draht später sogar weiterverarbeiteten.
Der Standort war nicht nur wegen des Bachs günstig. Denn nur ein paar hundert Meter weiter, im unteren Springer Tal wurde auch das zum Drahtziehen besonders geeignete sogenannte Osemundeisen produziert. Eine Hütte übernahm das Schmelzen des speziellen Eisenerzes aus den Bergwerken in Evingsen und Dahle. Und eine Schmiede quasi nebenan arbeitete es zu dem besonderen Eisen auf.
Drahtrollen waren ab dem Spätmittelalter die ersten kleinen Metall- und Eisenwerke in unserer Region. In anderen Gegenden sind sie auch als Drahtzug, Drahtzieherei, Drahtmühle, Drahtwerk, Drahthütte oder Drahthammer bekannt. In ihren zunächst mit Tretmühlen und später mit Wasserkraft angetriebenen Kleinproduktionen stellten die Drahtzieher, die sogenannten Zöger, Draht mit unterschiedlichen Durchmessern her.

sich die Drahtrollen im Tal des Springerbachs in früheren Zeiten wie Perlen aneinanderreihten?


Weitere Informationen
Drahtrollenroute
jede Drahtrolle im Tal ein eigenes Wasserrad besaß, dass vom Springerbach angetrieben wurde?


Um Draht überhaupt herstellen zu können, waren besonders biegsame, geschmeidige Metalle erforderlich. Da die entsprechenden manganhaltigen Erze in Evingsen und im benachbarten Dahle zu finden waren, entwickelte sich Evingsen und hier insbesondere das Springer Tal begünstigt durch die Springer-Quelle und der damit reichlich vorhandenen Wasserkraft zu einem frühen Zentrum der Drahtherstellung. Der Draht wurde als Rollen meist über Drahthandelswege an weiterverarbeitende Betriebe z. B. nach Altena oder Iserlohn geliefert.
Die Drahtrollen im Springer Tal gehörten ursprünglich mehreren Eignern, sogenannten Reidemeistern. Im 19. Jahrhundert änderten sich die Eigentumsverhältnisse merklich, manche Anteilseigner übernahmen einzelne oder sogar mehrere Drahtrollen. Dies hatte auch Einfluss auf die Produkte. Um die Erträge zu steigern, wurden immer häufiger Erzeugnisse aus Draht wie z. B. Ahlen (Schusternadeln), Ketten oder Werkzeuge hergestellt und vertrieben.
Mit dem kundigen Begleiter des Heimatvereins an der Seite werden die Spuren dieses Mikrokosmos, der die Entwicklung der Drahtherstellung im Märkischen Sauerland wunderbar widerspiegelt, bereits beim Blick von der Quelle ins Tal erkennbar. „ Unser Drahtrollenweg“, berichtet er, während er ins Tal zeigt, „ erläutert an 13 Stationen Details zur Geschichte der Drahtrollen im Springer Tal.“ Wie historisches Kartenmaterial belegt, gab es im heute relativ eng bebauten Tal zunächst nur die zwölf Drahtrollen und sechs Wohnhäuser, in denen die Betreiber wohnten.
Der Heimatverein Evingsen e.V. hatte ihre Geschichte über Jahre recherchiert und aufgearbeitet. Schließlich entwickelte er mit Unterstützung des WasserEisenLand e.V. den Themenweg mit Infotafeln an interessanten Stationen. Entstanden war die Idee aus einem früheren Projekt, der Sanierung und Rekonstruktion der Drahtrolle Am Hurk. Heute ist das, was von außen wie ein schmuckes Häuschen mit Wasserrad aussieht, ein kleines Museum und die Endstation der Drahtrollenroute im Springer Tal.
In besagter Drahtrolle Am Hurk sieht es aus wie in einer uralten Werkstatt. In dem mit Bruchsteinwänden ummauerten Raum zeigt ein rostiger, raumhoher Rohrofen, wie Speisen und Getränke warmgehalten wurden. Auffällig sind die speziellen Gerätschaften. „ Beim Drahtziehen wurde dicker Draht immer weiter verfeinert “, erläutert der ehrenamtliche Museumsführer. „ Am Feindrahtzug musste zunächst der angespitzte Draht von der Krone, einer Abwickelhaspel, durch ein Zieheisen geführt und an der Winnenscheibe befestigt werden“.
Er zeigt eine Auswahl an eisernen Zieheisen mit Löchern von verschiedenen Durchmessern, durch die der Draht von der durch Wasserkraft angetriebenen Winnenscheibe gezogen wurde. „ Funktioniert hat das nur mit dem zähen Osemund-Eisen, wie es ganz früher die kleinen Rennöfen und später die Hütten und Schmieden in unserer Gegend erzeugten“. Die Wasserkraft war natürlich eine große Erleichterung. Bevor man sie nutzte, mussten die Zöger den Draht mit großem Kraftaufwand von Hand ziehen.
Drahtwerk Produktion modern

Um zu verdeutlichen, wie das Wasser die Arbeit unterstützte, verschwindet er kurz und gibt das Wasserrad an der linken Seite des Gebäudes frei. Während es draußen plätschert, beginnen sich in der Werkstatt Räder zu drehen. „ Später, Anfang des 19. Jahrhunderts, spezialisierten die Menschen sich weiter, sie wurden von reinen Drahtlieferanten zu Herstellern von Produkten aus Draht. Im Springer Tal wurden hauptsächlich Werkzeuge für Schuhmacher produziert. Hier Am Hurk entstanden zum Beispiel kleine Ahlen, mit denen Schuster Löcher ins Leder bohren“, fährt der Herr vom Heimatverein fort. „ Der Draht wurde geschnitten, gebogen und an der Ahlenschleifbank gespitzt. Anschließend kamen die Eisenwaren zum Polieren ins Rollfass im Untergeschoss“.
Die heutige Geschwindigkeit des Wasserrads, ergänzt er noch, sei mit der früherer Zeiten nicht mehr zu vergleichen. Das Museum nutzt lediglich das Oberflächenwasser der Springer-Quelle. Die Hauptquelle liegt schon lange unter einem Häuschen der Stadtwerke Altena, die das kostbare Trinkwasser heute kontinuierlich kontrollieren und an Haushalte bis nach Altena verteilen. Das köstliche Wasser der Springer Quelle kann man vor Ort sogar probieren oder ins Trinkfläschchen abfüllen, bevor die Entdeckungstour auf die Drahtrollenroute führt.
Drahtrollenroute: 13 informative Stationen mit 16 großformatigen Tafeln
Die nächsten Standorte ehemaliger Drahtrollen befinden sich talabwärts nur wenige Meter vom Museum entfernt. In der Straße Im Springen sind es auf 200 Metern allein fünf weitere erhaltene historische Gebäude: Hülhofs Rolle, Ossenbergs Rolle, Post Rolle, Schelten Rolle und Engel Rolle verarbeiteten in dieser gewundenen, steilen kleinen Straße entlang des Springer Bachs Draht. Details zu jeder einzelnen Drahtrolle finden sich auf den Hinweistafeln der Drahtrollenroute.


die Zöger mit ihren Familien oftmals auf kleinstem Raum in der Dahtrolle wohnten?


Nicht alle sind heute noch als frühere Drahtrollen erkennbar. Die Gebäude werden für andere Zwecke verwendet, zum Beispiel als Wohnraum wie bis in die 1980er Jahre auch die Drahtrolle Am Hurk. Doch hier und da erkennt man noch den Grundriss oder sieht eines der charakteristischen Wasserräder.
In einem scharfen Knick biegt die Drahtrollenroute dann leicht abschüssig in Richtung Westen durch die Springer Straße im Springer Haupttal. Sie folgt dem Bach, der vor Jahrhunderten diese Richtung genommen hatte. Wegen des schwächeren Gefälles war der Standort für Wasserkraft nicht mehr ganz so ideal wie am Hang unterhalb der Quelle. Sechs weitere Drahtrollen verteilten sich hier auf rund 500 Meter. Die Hälfte davon existiert nicht mehr, zwei nur noch teilweise.
In der Leier Rolle am Sundern gründete der Kaufmann Gustav-Adolf Kayser 1869 eine Metallwarenfabrik. Bis in das 20. Jahrhunderts produzierte er in sieben Drahtrollen verschiedenste Draht- und Metallerzeugnisse vom Pferdegeschirr bis zur Stricknadel. Die Leier Rolle am Sundern ist heute ebenso verschwunden bzw. überbaut wie die Eckbooms Rolle.
Up dem Hecking – im ersten oder letzten Drittel der Drahtrollenroute, je nachdem, ob man die Wanderung an der Quelle oder im Tal beginnt – ist noch erhalten und beherbergt ein heute gemütliches Lokal mit kleiner Terrasse vor dem Wasserrad, bestens geeignet für einen Zwischenstopp.
Im Anschluss folgt ein weiterer Höhepunkt auf der Drahtrollenroute: Im kleinen Schaufenster der ehemaligen Drahtrolle Beisenkamp ist ein Relief des gesamten Springer Tales im Maßstab 1:500 zu entdecken. Eindrucksvoll verdeutlicht es die dichte Folge der Drahtrollen entlang des Bachs.
Am tiefsten Punkt der Drahtrollenroute, dort wo am Start der Route die ersten vier Infotafeln stehen und der Heimatverein einen kleinen Rastplatz eingerichtet hat, lässt sich der Springer Bach dann tatsächlich wieder blicken. Hier nimmt er eine sanfte Kurve in Richtung Südwesten, wo er schon bald auf die Nette trifft.
Doch wie mag es hier vor 300 oder 200 Jahren ausgesehen haben? Waldig sicherlich. Mittendrin eine Schneise mit einem holprigen Weg hinüber bis nach Dahle. Der Blick zurück lässt seinen Verlauf nur erahnen, über die heutige Straße reicht er zwischen den Häusern gerade mal bis zur Höhe des Gasthauses Up dem Hecking. Ob die Sicht durch das Gehölz damals bis dorthin reichte? Eher nicht. Die ersten Drahtrollen waren zwischen den Bäumen sicherlich gut getarnt. Und sehr wahrscheinlich hatten sie öfter mal Besuch von Wildschweinen.
PS: Deinen Spaziergang entlang der Drahtrollenroute kannst du übrigens am offiziellen Startpunkt in der Springer Straße oder an der letzten Station bei der Drahtrolle Am Hurk beginnen. Die Route ist natürlich rund um die Uhr besuchbar, alle Tafeln sind öffentlich zugänglich. Das Museum Drahtrolle Am Hurk hat von April bis Oktober den letzten Sonntag des Monats 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem bietet der Heimatverein Evingsen Führungen.
Zu Gustav-Adolf Kaysers Unternehmen gehörte im 19. Jahrhundert auch die benachbarte Drahtrolle Up dem Hecking. Dort ließ er Fingerhüte herstellen und nannte sie dann Fingerhutmühle. Die ursprüngliche Nutzung ist am Wasserrad noch deutlich erkennbar - auch wenn das Rad heute nicht mehr in Betrieb ist.
Up dem Hecking ist inzwischen ein uriges Lokal mit kleiner Terrasse. Bestens geeignet, um nach der Spurensuche auf der Drahtrollenroute mit Getränken und kleinen Speisen zu stärken. Das Lokal ist Freitag- und Samstagabend geöffnet.

Du möchtest mehr über Drahtzieher und Drahtrollen im Märkischen Sauerland erfahren?

Freier Eintritt / Pay what you want
Dann besuche unbedingt auch das Deutsche Drahtmuseum in Altena. Denn was heute ein selbstverständliches Material ist, hat seine Wurzeln im Märkischen Sauerland zum Beispiel im Springer Tal. In der Erlebnisausstellung des Deutschen Drahtmuseums erfährst du alles darüber, wie man früher und heute die verschiedensten Dinge aus Draht produziert. „Nicht von ungefähr“ lautet der Titel der Ausstellung Vom Kettenhemd zum Supraleiter. Hier kannst du auch experimentieren und vieles selbst ausprobieren.



Wie im ganzen Märkischen Sauerland spielte die Eisengewinnung und -verarbeitung in Kierspe lange Zeit eine große Rolle. Entlang der Fluss- und Bachläufe waren kleine Schmelzöfen, Hämmer und Schmieden zu finden, die sich die Wasserkraft bei der schweren Arbeit zunutze machten. Mit der Industrialisierung fanden viele kleine Betriebe ihr Ende. Doch als zu Beginn des 20. Jahrhunderts der erste vollsynthetische Kunststoff erfunden wurde, begann in Kierspe eine neue Ära.

Es zischt und qualmt, klopft und hämmert im Schleiper Hammer. Wie jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals sind die Tore des historischen Gebäudes geöffnet. Die alte Schmiede am Ufer der Schleipe ist heute ein technisches Museum des Heimatvereins Kierspe. Und was für eins. Ein Museum wie eine Werkstatt – zum Staunen und zum Mitmachen. Es zeigt stellvertretend für weitere Hämmer, die sich über Jahrhunderte am Zufluss der Volme entlang zogen, wie dort gearbeitet wurde.
Schmelzöfen stellten aus Roheisen den damals weltberühmten Osemund, ein besonders weiches Eisen, her. Genutzt wurden dafür von Wasserkraft betriebene Gebläse. In den Osemundhämmern wurde das Eisen ebenfalls mit Unterstützung der Wasserkraft weiterverarbeitet.
Lange Zeit bot dies den Menschen ihr Auskommen – bis die uralten Methoden nicht mehr konkurrenzfähig waren. So verlegte man sich in den Hämmern auf die sogenannte Breiteware, also Spaten, Schaufeln und ähnliches.
Wusstest du schon, dass
Bakelit der erste synthetische, duroplastische Kunststoff war?
Wie das funktionierte, zeigen einige Mitglieder des Heimatvereins ihren Besucher an den Öffnungstagen des Schleiper Hammers. Auch heute wird dazu bereits morgens die Esse angeheizt, damit das Feuer die richtige Temperatur für die Vorführungen hat. Jetzt können die Schmiede das Eisen zum Glühen bringen und anschließend von Hand oder mit etwas altertümlich wirkenden Maschinen, den Feder- oder Fallhämmern, bearbeiten. Dabei dürfen auch kleine und große Zuschauer Hand anlegen und zum Beispiel bei der Produktion von Haken oder Nägeln mitwirken.
das deutsche Partnerunternehmen von Baekeland nach dem Zweiten Weltkrieg nach Iserlohn-Letmathe umzog, wo das Nachfolgeunternehmen Bakelite® Synthetics bis heute ansässig ist?
So schön es in unseren Zeiten ist, ein handwerkliches Produkt aus Eisen entstehen zu sehen und vielleicht sogar daran mitzuwirken: Auch diese Verfahren wurden irgendwann durch die industrielle Metallverarbeitung überholt und von größeren Betrieben übernommen. Wieder blieben einige Hämmer auf der Strecke. Wieder mussten sich die Menschen neu orientieren. Auch im Schleiper Hammer krempelte man die Ärmel hoch, nahm sich den innovativsten Betrieb in Kierspe zum Vorbild, setzte auf ein brandneues Material und rüstete sich für die Zukunft.
Das Material war der erste synthetische Kunststoff, den der belgische Chemiker Leo Hendrik Baekeland zu Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA erfunden hatte. Sein Name: Bakelit. Der Kunststoff isolierte, war form- und säurebeständig – zur damaligen Zeit war er der vielseitigste und vielversprechendste Werkstoff, den es gab. Von 1.000 Möglichkeiten war die Rede. Sie reichten vom Maschinenteil bis zum Haushaltsgerät, von isolierenden Elementen für Elektroanlagen bis zu künstlichem Bernstein.
In Kierspe hatte die elektrotechnische Firma Dr. Deisting, das größte Unternehmen im Ort, Bakelit früh für sich entdeckt. Es wurde der örtliche Pionier für Kunststoff-Produkte.


Insbesondere wegen seiner Robustheit, seiner außerordentlichen Isolierfähigkeit und seines relativ günstigen Preises war Bakelit die perfekte Alternative zu den teureren Produkten aus Porzellan oder Keramik, aus denen elektrotechnische Artikel bis dato gefertigt worden waren. Das Unternehmen begann, die Produktion umzustellen. Die ersten Werkzeuge wurden entwickelt und die Pressen im benachbarten Meinerzhagen gefertigt.
Wie das Prinzip funktionierte, lässt sich im Schleiper Hammer genau verfolgen. Denn hier stehen mehrere historische Pressen der Firma Battenfeld aus Meinerzhagen. Am Tag des offenen Denkmals sind sie im Dauereinsatz. Ein Kunststoffexperte des Heimatvereins Kierspe presst aus geheimnisvollen roten und grauen Pulvern ein Produkt nach dem anderen. Die Kombination aus Hitze und Druck verwandelt das Pulver „ Simsalabim“ in feste Formen. Anschließend setzt der Experte je zwei Teile zusammen, schleift und poliert sie: Fertig sind praktische Mitbringsel aus dem Schleiper Hammer.
In Kierspe setzte der richtige Boom für das Unternehmen Dr. Deisting Ende der 1920er Jahre ein, als Baekelands Patente ausliefen. Viele Kiersper Unternehmen –auch der Schleiper Hammer – folgten dem Beispiel Dr. Deistings und setzen auf Bakelit oder wurden neu gegründet. Heute würde man von Start-ups sprechen.
Bakelit 1907 vom belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland in den USA erfunden wurde?

Wusstest du schon, dass in Kierspe bis heute zahlreiche Unternehmen Produkte aus unterschiedlichsten Kunststoffen produzieren?



Bakelitmuseum Kierspe
In den 1930er Jahren entwickelte sich Kierspe gemeinsam mit Lüdenscheid und Schalksmühle deshalb innerhalb kurzer Zeit zu einem Zentrum der Kunststoffproduktion. Allein in Kierspe stellten damals 36 Betriebe mit rund 450 Kunststoffpressen ganz unterschiedliche Kunststoffprodukte her. Dr. Deisting produzierte neben den berühmten Dickhäuter-Lichtschaltern inzwischen auch KFZ-Zubehör, wie zum Beispiel ein Armaturenbrett für den Autohersteller DKW.
Nicht nur Dr. Deistings Dickhäuter gelten heute als Beispiel für gelungenes Design. Mit dem unverwüstlichen Bakelit waren der Entwicklung und Produktion schöner Dinge in großen Stückzahlen praktisch keine Grenzen gesetzt. Auf Schreibtischen prangten schwarze Telefone, dunkle Bleistiftspitzer, Stifthalter, Löschpapierrollen und Zettelkästen. Im Wohnzimmer stand das formschöne Radio neben dem Lampenklassiker und auch sonst erleichterten die vielen kleinen und großen Bakelit-Erzeugnisse mit dem besonderen Griffgefühl den Alltag.
Doch bald ging auch die große Zeit des Bakelits für Alltagsprodukte vorüber. Neue Kunststoffe wurden entwickelt und verdrängten Bakelit aus dem Alltag. Die Unternehmen orientierten sich um, setzten auf die neuen Materialien. In Kierspe jedoch blieb neben der Metallverarbeitung die Kunststoffindustrie als wichtiger Wirtschaftszweig erhalten.
Heute entdeckt man die alten Dickhäuter von Dr. Deisting noch manchmal in Altbauten. Ansonsten sind viele Bakelit-Produkte zu begehrten Sammlerobjekten geworden. Zum Glück, denn zwei gestiftete Bakelit-Sammlungen bilden den umfangreichen Grundstock der wunderschönen Ausstellungen mit wechselnden Exponaten im Bakelitmuseum in Kierspe.
Im Bakelitmuseum in Kierspe erwarten dich wechselnde Ausstellungen mit so manchem optischen Highlight. Darunter formschöne Rundfunkempfänger, Schreibmaschinen, Büroeinrichtungen, Telefone und Diktiergeräte. Oder Haushaltsgeräte wie Waagen, Uhren und ein ganz besonderer Staubsauger. Außerdem Wohnaccessoires aus dem Art Déco wie Leuchten, Schalen, Aschenbecher oder Salz- und Pfefferstreuer sowie aus späterer Zeit die berühmte Tischlampe „Bolide“ der französischen Firma Jumo Brevete.
Der Mediziner Dr. Friedrich Deisting (1855-1923) kam als junger Arzt nach Kierspe. Da er die existenziellen Nöte der bäuerlich geprägten Bevölkerung früh erkannte, setzte er sich von Anfang für eine Verbesserung der Verhältnisse ein. Zum einen berechnete er für seine Behandlungen nur ein Minimum. Zudem trieb der vielseitig interessierte und informierte Mensch Einrichtungen für die Absatzmöglichkeiten und die soziale Absicherung der Kiersper Bürger voran.
So gründete er die Bäuerliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft, die Molkerei, den Bauverein und die Spar- und Darlehenskasse. Im Jahr 1908 baute er schließlich die Elektrotechnik-Firma Dr. Deisting auf, um vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen. Es war lange Zeit das größte Unternehmen in Kierspe. Der nimmermüde Sanitätsrat verfasste schließlich auch noch eine fundierte Zusammenfassung der Geschichte Kierspes, die er kurz vor seinem Tod fertigstellte.

Wusstest du schon, dass
Bakelit noch immer in Bereichen verwendet wird, die starke mechanische und thermische Belastbarkeit, geringe Entflammbarkeit und chemische Beständigkeit fordern?

Offene Stadtführungen von April bis Oktober

Wie in der Lüdenscheider Knopfindustrie Metallknöpfe entstanden
Mitte der 1870 er Jahre in Lüdenscheid. Johannes, ambitionierter Graveurgeselle in einer Knopffabrik strebt seine Meisterprüfung an. In einer Zeit, da in der Stadt hauptsächlich Uniform- und Livreeknöpfe entworfen und produziert werden, bevorzugt er die Herstellung anderer Bilderknöpfe. Entsprechend hat er sich für sein Meisterstück ein ungewöhnliches Motiv überlegt. Obwohl nur noch wenige Tage bis zur Abgabe bleiben, lässt er sich Zeit mit der Umsetzung. Zunächst jedenfalls.
Ein Seufzer erfüllte die Werkstatt. Sechs Männer unterschiedlichen Alters hoben die Köpfe, neugierig, wer ihn wohl ausgestoßen hatte. Johannes biss sich auf die Lippe, dann warf er einen unschuldigen Blick in die Runde. Das durfte ihm als angehendem Meister nicht noch einmal passieren. Die einfachen und schlichten Wappen langweilten ihn, doch das sollte er sich nicht anmerken lassen. Zumal so kurz vor seiner Prüfung. Den Weg vom Gesellen zum Graveurmeister hatte er ja eingeschlagen, um kunstvoller arbeiten und mehr eigene Ideen entwickeln zu können. Auch jenseits von Wappenknöpfen für Uniformen und Livreen.
Zurzeit saß er abends lange an seinem Meisterstück: einem Prägewerkzeug für einen ganz besonderen, selbst entworfenen Modeknopf, sowie dem Gegenstück, dem Stanzwerkzeug. Tagsüber arbeitete er wie immer an Gravuren für Uniformknöpfe, die – zugegeben – auch recht anspruchsvoll sein konnten. Und natürlich wollte diese Arbeit auch erledigt sein, denn Knöpfe für Uniformen und Livreen waren schließlich das Hauptgeschäft der Fabrik.
Die Werkstatt versank wieder in arbeitsamem Schweigen, eine Zeit lang war nur das Kratzen der Werkzeuge zu hören. Dann schabte ein Hocker über den steinernen Boden. Wieder hoben sich die Köpfe der Männer. Gernot, ein Knabe von vielleicht 15 Jahren, war aufgestanden und kam zu Johannes. Er verbeugte sich leicht, zeigte seine Arbeit und sagte: „ Darf ich etwas fragen? “ Johannes nickte ihm ermunternd zu und sah sich bereits die Arbeit des Jungen an. „Wie kann ich die unterschiedlichen Farben des Wappens darstellen? “, fragte Gernot. Johannes schmunzelte. „ Das ist eine gute Frage, zeig mir doch einmal das Muster “, antwortete Johannes.

Wusstest du schon, dass findige Lüdenscheider Unternehmer die Produktion von Knöpfen einführten, als die Konkurrenz im Drahtgeschäft durch neue Produktionsverfahren immer größer wurde?


Anhand des Blatts erläuterte er dem Lehrling, dass er mit geraden und schrägen Schraffuren oder Punkten arbeiten solle, um die verschiedenen Farben abzubilden. Je dunkler die Farbe im Original, umso enger die Schraffur.
zunächst massive Metallknöpfe hergestellt wurden, bis man in den 1820er Jahren begann, Hohlknöpfe mit verziertem Oberteil und schlichtem Unterteil zu produzieren?
Der Junge bedankte sich und kehrte an seinen Platz zurück. Johannes arbeitete weiter an seinem Wappen. Als ihn Müdigkeit überkam, gähnte er verstohlen und beschloss, durch die Reihen zu gehen. Obwohl seine Prüfung zum Graveurmeister erst bevorstand, hatte man ihm bereits diese Gruppe an Graveuren zugeteilt. Mit drei Gehilfen, zwei Gesellen und einem Lehrling war sie gar nicht mal so klein. Er sah seinen Männern über die Schultern und begutachtete, wie sie unterschiedliche Wappen in die Formen für Knöpfe umsetzten. Die Gehilfen übernahmen die einfachsten Formen und reichten sie dann zur Ausarbeitung an die Gesellen weiter. Dieses Prinzip hatte sich Johannes selbst überlegt, als er die Leitung der Gruppe übernommen hatte. Es war ihm sinnvoll erschienen, dass die geschickteren – und teureren – Gesellen die schwierigeren Aufgaben übernahmen.
Die Arbeitsteilung bewährte sich. Die Gehilfen arbeiteten routiniert die Grundformen aus und die Gesellen konnten – im Rahmen der Vorgaben der Auftraggeber –ihr gestalterisches Können einfließen lassen. Johannes machte hier und da eine Anmerkung, war jedoch im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit seinen Leuten.
Als die Glocken der Stadtkirche Lüdenscheids schließlich sechsmal schlugen, klatschte er in die Hände und verabschiedete die Männer in den Abend.
Er selbst öffnete die Fenster, um den Dunst des Tages heraus- und frische Winterluft hereinzulassen. Während er einen Apfel und ein Stück Brot aß, sah er auf die Straße hinaus. Seine Männer und die der anderen Meister eilten fröhlich schwatzend ihren Wohnungen entgegen. Mancher bog noch zu einem Gasthaus ab. Bald wurde es stiller und Johannes schloss die Fenster.
Im Licht einer Petroleumlampe holte er die Knopfform hervor, die sein Meisterstück werden sollte. In zehn Tagen musste er es abgeben, danach würde er seine Prüfung ablegen. Liebevoll fuhr er über das millimeterdicke Metall, in dem bereits eine Silhouette zu erkennen war. Er hatte sich einen ganz besonderen Bilderknopf überlegt und freute sich auf das Ergebnis. Johannes griff nach dem Entwurf, den er von seinem Motiv gezeichnet hatte. Eine Madonna sah ihn freundlich an. Sie trug das Jesuskind auf Schulterhöhe, fast berührte es ihr Gesicht. Beide hatten einen Heiligenschein. Neben den beiden Gesichtern würden auch sie eine Herausforderung werden, denn er stellte sich die Gloriolen als Blütenkränze vor. Die Kleidung plastisch darzustellen, war dagegen beinahe ein Kinderspiel.
Seiner zeitlichen Planung hing er etwas hinterher, so gab es jetzt keinen Aufschub mehr. Er begann, unter dem Vergrößerungsglas mit verschiedensten Werkzeugen den Kopf des Kindes auszuarbeiten. Mit leichten Pausbacken, einem engelsgleichen Gesichtsausdruck und jenem erwachsenen Blick, den mancher Säugling an den Tag legte. Konzentriert arbeitend nutzte er seine feinsten Stichel sowie die eine oder die andere Feile. Immer wieder war er überrascht, wie er das Material formen konnte. Als die Lampe zu flackern begann, war es Zeit, nach Hause zu gehen. Es ging auf Mitternacht zu und er konnte gerade noch erkennen, dass ihm das kleine Gesicht gut gelungen war. Froh packte er seine Sachen zusammen, verließ die Werkstatt und die Fabrik.
Seine Nacht war kurz. Die Kirchenglocke schlug sechs, als Johannes die Werkstatt wieder betrat. Er öffnete die Fenster. Ihre Arbeiten legten seine Graveure abends immer auf einer separaten Werkbank ab. Er nahm sie zur Hand, begutachtete sie aus der Distanz und betrachtete sie unter der Lupe. Die meisten Gravuren waren präzise umgesetzt. Nur ein paar Kleinigkeiten waren zu korrigieren.
Wusstest du schon, dass
Uniform- und Livreeknöpfe einen Großteil des Geschäfts ausmachten und Lüdenscheider Knöpfe bis nach China exportiert wurden?


Lüdenscheid im Jahr 1895 die am stärksten industrialisierte Stadt Deutschlands war und die Knopfindustrie daran entscheidenden Anteil hatte?

Als die Fenster längst wieder geschlossen und seine Leute vollzählig waren, begrüßte Johannes sie. „Guten Morgen, die Herren“, sagte er. „Wir kommen gut voran. Doch wie ihr wisst, müssen wir vor dem Weihnachtsfest noch viele Formen fertigstellen. Wir dürfen also nicht nachlassen.“ Die Männer nickten zustimmend. „ Eure Arbeiten von gestern habe ich mir angesehen“, fuhr Johannes fort. „ Friedhelm, Bertram und Gernot, kommt bitte zu mir.“
Der Geselle Friedhelm machte den Anfang und hörte sich in Ruhe Johannes Kommentar an, der anregte, an zwei Stellen durch eine stärkere Gravur in einem Wappen mehr Tiefe zu erreichen. Dem Gehilfen Bertram gab er die Anweisung, Konturen mit einem breiteren Stichel anzulegen. Und dem Lehrling Gernot zeigte er, wie er den Stichel ansetzen musste, um die geraden und parallelen Linien der Schraffuren zu ziehen.
Bis zur Mittagszeit herrschte wieder geschäftige Stille in der Werkstatt. Außer den Werkzeugen und einem gelegentlichen Husten oder Räuspern war kein Mucks zu hören. Auch Johannes arbeitete wieder an einem Wappen. Insgeheim freute er sich darauf, abends mit dem Gesicht der Madonna zu beginnen. Doch erstmal stand die Mittagspause an. Einige seiner Männer ließen sich zu Hause verköstigen, andere hatten sich eine kalte Mahlzeit mitgebracht.
Johannes machte in der Mittagspause gerne einen Spaziergang, um sich zu erfrischen und Inspirationen zu sammeln. Auf dem Weg besuchte er den Laden des Bäckermeisters und aß unterwegs einen Teil seines Einkaufs. Seit er an seinem Meisterstück arbeitete, fehlten ihm die abendlichen Mahlzeiten bei seiner Wirtin, die sich bereits um seine Gesundheit sorgte. Eine warme Mahlzeit am Tag sei wichtig, betonte sie jeden Morgen. Doch Johannes winkte ab. Bis zur Abgabe seines Meisterstücks würde er ohne warmes Essen auskommen. Noch neun Tage, dann hätte er es geschafft.
Der Nachmittag verging schnell und mit dem Glockenschlag der Stadtkirche sprangen die Männer wieder auf. Nur Gernot blieb noch einen Moment sitzen und zog eifrig einen letzten Strich. Dann brachte er sein Werk zur Werkbank. Stolz blitzte in seinen Augen. Johannes freute sich für den Lehrling. Das gute Gefühl, wenn die Gravur langsam die richtige Form annahm, kannte er. „ Bis morgen, Gernot “, verabschiedete er den Jungen. Der verbeugte sich und erwiderte den Gruß, bevor er davonstob.
Lächelnd öffnete Johannes das Fenster und holte seine Arbeit und die Zeichnung aus der Schublade. Er gähnte und reckte sich, dann schloss er das Fenster und machte sich an die Arbeit. Heute war der richtige Tag für das Antlitz von Maria mit ihrem frohen, zugewandten Blick auf das Jesuskind. Gerade die ausgefeilte Mimik war in der Dimension eines kleinen Knopfes von zwei Zentimetern Durchmesser besonders anspruchsvoll. Johannes musste sein ganzes Können und alle Raffinessen der Gravierkunst aufwenden.
Andererseits war das ja genau die Aufgabe seines Meisterstücks: sein Können zu beweisen. So arbeitete Johannes froh vor sich hin, bis ihm der Ausdruck der Madonna gefiel. Endlich war er zufrieden und legte den Stichel ab. Er rieb sich die Hände an einem Lappen ab und fuhr sich über das Gesicht. Spät war es geworden, aber der Aufwand hatte sich gelohnt. Vorsichtig legte er sein Werk und die Zeichnung in die Schublade, schloss sie ab und ging gähnend den halben Kilometer bis zu seiner Stube. Das Schwierigste hatte er geschafft, morgen Nacht würde er sicher früher heimgehen.

Am nächsten Tag regnete es. Es war kein angenehmer, leichter Regen, sondern fieser, kalter Winterregen, der Feuchtigkeit in alle Gliedmaßen brachte. Johannes schloss die Fenster schneller als sonst und zündete den Ofen an. Wenn Graveure etwas nicht gebrauchen konnten, waren es klamme, unbewegliche Finger. Er legte Stofffetzen bereit, die sich seine Männer um die Hände wickeln könnten, um sie zu wärmen. Dann betrachtete er die Arbeiten des letzten Tages und war sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
Gernot hatte ihm gut zugehört, seine Schraffuren waren für einen Anfänger geradezu perfekt. Er hatte fraglos Talent. Johannes war froh, ihn in seiner Truppe zu haben. Nach und nach trafen seine Gehilfen und Gesellen ein. Im Nu begann die feuchte Wolle ihrer Umhänge zu dampfen, die Luft in der Werkstatt wurde schlecht. Doch es half nichts: Die Fenster konnte Johannes bei diesem Wetter nicht öffnen.
Er forderte die Männer auf, Mäntel und Umhänge aus der Werkstatt zu bringen, damit es im Raum nicht zu muffig wurde. Dann verteilte er neue Aufträge an diejenigen, die eine Arbeit abgeschlossen hatten. Die fertigen Prägewerkzeuge brachte er hinüber zu seinem Meister und Mentor Meyerhoff. Nach der Begutachtung der Formen nahm Meyerhoff Johannes mit zum Fabrikanten, der sein endgültiges Plazet geben sollte. Auch der war zufrieden mit der Ausführung und kündigte den beiden an, dass neue Aufträge aus China eingetroffen seien.
Gutgelaunt kehrte Johannes in seine Werkstatt zurück, wo die Männer ruhig vor sich hinarbeiteten. Auf die chinesischen Aufträge freute er sich, denn sie waren exotisch und abwechslungsreich. Der Tag verflog, auch weil mittags wegen des Regens alle vor Ort blieben und sich zusammensetzten. Selbst Johannes sparte sich seinen Spaziergang. Er entließ die Männer früher als sonst und holte sein Meisterstück hervor, um das Gewand der Maria auszuarbeiten. Plötzlich öffnete sich die Tür und Meyerhoff trat ein.

Wusstest du schon, dass die Knopfindustrie bis zum Ersten Weltkrieg die Hauptindustrie in Lüdenscheid war?
300 Jahre im Wirken der Familie von Dücker in Rödinghausen
Die von Dückers in Menden sind das Paradebeispiel einer einflussreichen Familie im ehemaligen Herzogtum Westfalen. Dabei stand es zu Beginn des 17. Jahrhunderts gar nicht so gut um sie. Die Nebenlinie der Familie, aus der Hermann Dücker (1591-1670) stammte, hatte eine Pechsträhne: Durch nicht standesgemäße Heiraten hatte sie den Adelstitel eingebüßt, zudem verlor sie in Kriegswirren ihren Besitz. Das hieß: alles auf Anfang. Die relativ mittellose Familie zog nach Arnsberg, wo ihr spannender Aufstieg begann.

Arnsberg wurde sicher mit Bedacht gewählt, denn es war zu Zeiten der kurkölnischen Herrschaft nicht irgendeine Stadt, sondern Residenz der Kölner Erzbischöfe im Herzogtum Westfalen. Eine Voraussetzung, welche die Dückers für sich zu nutzen wussten, denn Hermann Dücker machte in den Diensten des kölnischen Kurfürsten eine erstaunliche Karriere. Er begann als Sekretär des Landdrosten.
1624 wurde Hermann Dücker oberster Beamter für die Berg-, Hütten- und Hammerwerke im Herzogtum Westfalen. 1625 übernahm er zusätzlich die Position des kurfürstlichen Oberkellners und wurde damit zum obersten Finanzbeamten im Herzogtum. Nebenbei war er kurfürstlicher Rat, Droste des Amtes Menden und Landpfennigmeister. Keine schlechten Voraussetzungen, um gute Netzwerke zu knüpfen.

Und so bewies Hermann Dücker sein Geschick nicht nur beim beruflichen Aufstieg, sondern auch in der Vermehrung des Familienvermögens. 1627 baute er zum einen den Dückerschen Hof in Arnsberg, vergrößerte aber auch den Landbesitz um das Rittergut Obereimer nahe Arnsberg. Obereimer machte er quasi zur Traumimmobilie. Das wiederum weckte später die Begehrlichkeiten von Kurfürst Maximilian Heinrich von Bayern, ab 1650 Erzbischof und Kurfürst von Köln – und somit Dückers Chef.
Den Verkauf konnte Hermann Dücker seinem Kurfürsten schwer verweigern, und so ging das Rittergut 1652 in dessen Besitz über. Doch Dücker hatte längst vorgesorgt: Seine Vermählung mit der Witwe Anna Margaretha von Lürwald im Jahr 1638 brachte ihn in Besitz des Gutes Ober-Rödinghausen. Wieder kaufte er Ländereien sowie den Rittersitz Nieder-Rödinghausen hinzu, was sich als schlauer Schachzug bewies. Denn indem sie ihren Wohnsitz als Nieder-Rödinghausen bezeichneten, wohnten die Dückers praktisch wieder auf einem Rittergut.
In Summe konnte sich Hermann Dücker also weder über mangelnden Einfluss noch über mangelnden Wohlstand beklagen – die Liste der Güter soll bei seinem Tod 1670 20 eng beschriebene Seiten lang gewesen sein. Allein, es fehlte der Adelstitel. Um den kümmerten sich seine Söhne. Dietrich Gaudenz trat in die Fußstapfen des Vaters und wurde ebenfalls Oberkellner. Wilhelm Lothar Bernhard brachte es zum kurkölnischen Geheimen Rat und Gesandten von König Ludwig XIII. von Frankreich. Er nutzte seine Verbindungen, um den Adelsstand wiederherzustellen. Mehr noch: Durch Adoption gelangte auch sein Bruder Dietrich Gaudenz zu dem Titel von Dücker. Jener führte auch den Rödinghauser Fideikommiss ein, eine Art Stiftung, um das familiäre Vermögen im Ganzen zu erhalten. Es wurde in den folgenden Generationen von jeweils einem Nachfahren verwaltet.
Wusstest du schon, dass die Dückers bereits im frühen 17. Jahrhundert in den Besitz des Gutes Ober-Rödinghausen und des Rittersitzes NiederRödinghausen gelangten?

die Grafschaft Mark und insbesondere die Region Altena damals das Monopol auf die Drahtzieherei hatten und Märkische Truppen die Drahtrolle der von Dückers 1725 zerstörten?

Der erste dieser Nachfahren war sein Sohn, Bernhard Adolf von Dücker (1671-1738). Er erwies sich als echter Tausendsassa, was die Weiterentwicklung der unternehmerischen Aktivitäten betraf. Zum einen blieb er der Familientradition treu und wurde der letzte Oberkellner der Familie im Herzogtum Westfalen. Auf den Ländereien weitete er die landwirtschaftlichen Aktivitäten durch den Bau einer Sägemühle und einer Kornmühle aus, die beide mit Wasserkraft betrieben wurden. Daneben ging er völlig neue Wege durch den Bau einer Drahtrolle.
Dazu muss man wissen, dass tatsächlich die Grafschaft Mark und insbesondere die Region Altena das Monopol auf die Drahtzieherei hatten. Drahtzieher mussten dort einen Zunftschwur leisten, die Verfahren zur Drahtherstellung nicht zu verraten. Schwer zu sagen, was Bernhard Adolf dem Drahtzieher Johann Hermann Bomnüter aus Altena anbot. Es muss sehr überzeugend gewesen sein, denn Bomnüter wurde auf kurkölnischem Gebiet für ihn tätig und weihte ihn in die Geheimnisse des Drahtziehens ein.
Ein klarer Fall von Industriespionage – der für Bomnüter nicht ohne Folgen bleiben sollte. Von Dücker hatte allerdings übersehen, dass sich nicht jedes Eisen zu Draht ziehen lässt, sondern nur der geschmeidige Osemund. Dieses Geheimnis und wie man Osemund herstellte, kannten wiederum nur die Schmiede aus Altena und Lüdenscheid. Bomnüter allein reichte also nicht. Und Bernhard Adolfs Trick, Mitteldraht aus der Grafschaft Mark einzuführen und weiterzuverarbeiten, durchschauten die Märker schnell.
Sie unterbanden die Ausfuhr. Bomnüter blieb zunächst unbehelligt. Doch nachdem Bernhard Adolf 1725 für 30 Jahre das Privileg zur Drahtrollenproduktion im Kurkölnischen erhalten hatte, rückten Märkische Truppen an. Sie zerstörten die Drahtrolle und auch für Bomnüter ging die Geschichte nicht gut aus: Die Märker nahmen ihn gefangen und brachten ihn nach Altena, wo er in Festungshaft verstarb.
Nach Bernhard Adolfs Tod 1738 wurde sein jüngerer Bruder Johann Heinrich (16831749) Fideikommissherr auf Rödinghausen. Er begann 1744 – zunächst ohne Genehmigung – mit dem Aufbau der Rödinghauser Hammerwerke und Eisenhütte. Zu jener Zeit wurde die Eisenproduktion üblicherweise in einem Unternehmen gebündelt. Und so verfügten auch die von Dückers über mehrere kleine Bergwerke zur Eisenerzförderung sowie eine Eisenhütte und die erforderlichen Hämmer. Damit war Johann Henrich einer der Vorreiter im Adel, denn üblicherweise konzentrierte der sich eher auf Müßiggang oder allenfalls forst- und landwirtschaftliche Geschäfte.

Doch die von Dückers blieben auch weiterhin im Eisengeschäft. Maximilian Theodor (1723-1798) übernahm den Platz seines Vaters nach dessen Tod 1749 und führte die Geschäfte fort. Anfangs verpachtete er an Iserlohner Kaufleute, wollte den Vertrag dann rückgängig machen. Doch erst 1759 konnte er den Betrieb in Eigenregie übernehmen und expandierte. Er bezog Eisenerz auch aus der benachbarten Grafschaft Mark. Mit viel Verhandlungsgeschick beteiligte er sich außerdem an der Eisenhütte im märkischen Sundwig und konnte so die neuen Pächter der Hammerwerke kontinuierlich mit ausreichend Eisen beliefern. Dieses Geschäft lief gut und so begann Maximilian Theodor von Dücker, sich weitere Eisenvorkommen zu sichern.
Scheinbar versuchte Maximilian Theodor mit allen Mitteln, die Vorkommen der eigenen Eisenerzminen optimal zu erschließen, doch das Unternehmen scheiterte –auch weil er dem falschen Fachmann vertraute. Maximilian Theodor investierte zu viel in unergiebige Stollen und geriet ab 1770 in Zahlungsschwierigkeiten. Zeitweise musste er bei einem Gläubiger den gesamten Familienbesitz als Sicherheit hinterlegen. Dennoch war er schnell wieder auf einem guten Weg, seine Schulden zu begleichen.
Dann allerdings änderten sich die Bedingungen: In der Grafschaft Mark wurde ab 1771 die Ausfuhr von Eisenerzen verboten. Dies betraf insbesondere die Eisenerzlieferungen aus Sundwig und aus Dahle. Die Rödinghauser Eisenfabrique ließ sich bald nur noch als Zuschussunternehmen betreiben. Da er bereits mit dem Rücken zur Wand stand, suchte Maximilian Theodor nach einer Lösung, um den Konkurs des Unternehmens abzuwenden. Dank Fürsprache des Kurfürsten gelang es ihm, die Rödinghauser Eisenfabrique unter die Verwaltung des Bergamtes zu bringen.
Wusstest du schon, dass die von Dückers nach der Zerstörung der Drahtrolle 1744 mit dem Aufbau der Rödinghauser Hammerwerke und Eisenhütte begannen?
Caspar Ignaz von Dücker Anfang des 19. Jahrhunderts in NiederRödinghausen mit dem Bau eines neuen, repräsentativen Herrenhauses im klassizistischen Stil begann?

Dennoch rissen die Probleme nicht ab, auch wegen Streitigkeiten mit dem Pächter, der zu allem Überfluss gegen von Dücker intrigierte. Letztlich führte dies dazu, dass Maximilian Theodor die Hütte 1775 stilllegte und sie somit dem Bergamt entzog. Die Rödinghauser Hämmer blieben verpachtet. Trotz seiner Schwierigkeiten gelang es ihm im gleichen Jahr, die Genehmigung für eine neue Schmelzhütte auf der märkischen Seite der Hönne zu erhalten und die Mittel aufzubringen, sie zu eröffnen – auf Pump allerdings.
Erst 1786, als bereits sein Sohn Caspar Ignaz von Dücker (1759-1839) die Geschäfte übernommen hatte, schaltete sich das Bergamt wieder ein. Caspar Ignaz gelang es – auch durch Einbindung des Kurfürsten – die Verwaltung durch das Bergamt zu beenden. Der Pächter der Rödinghauser Hämmer geriet dann selbst in finanzielle Schwierigkeiten. Er trat seine Pacht nach und nach an den Altenaer Bürgermeister und den Freiherrn von Landsberg aus Wocklum ab. Diese hatten zwar gute Voraussetzungen, gemeinsam erfolgreich zu sein, doch die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich während des Ersten Koalitionskriegs zwischen Frankreich und Preußen/Österreich (1792-1797 ).
Caspar Ignaz packte die Gelegenheit beim Schopf und kaufte 1795 die Ländereien und die Rödinghauser Eisenfabrique zurück. Nachdem er in jungen Jahren in England die neuen Industrieverfahren studiert hatte, brachte er seine Erfahrungen in das Familienunternehmen ein. 1797 wurde auch das Gut Rödinghausen an ihn zurückübertragen. Innerhalb weniger Jahre beglich er alle Darlehen, die er für die Rückkäufe aufgenommen hatte, sowie die Schulden seines Vaters. 1807 stand fest, dass alle Verbindlichkeiten abgegolten waren.
Sogleich begann Caspar Ignaz in Nieder-Rödinghausen mit dem Bau eines neuen, repräsentativen Herrenhauses im klassizistischen Stil. Hinter den Haus ließ er bis zur Hönne einen englischen Landschaftsgarten anlegen. Die Rödinghauser Eisenfabrique führte er mit ausgeglichenem Erfolg weiter. Andere Beteiligungen wie die am Heller und Dahler Bergwerk und an der Sundwiger Hütte verkaufte er an den Freiherrn von Landsberg in Wocklum: Die von Dückers wollten sich künftig in der Rödinghauser Eisenfabrique nur noch auf die Weiterverarbeitung des Roheisens konzentrieren.
1819 übernahm Sohn Theodor von Dücker (1791-1866) den Familienbetrieb. Hatten die Hütten bis dahin immer mit Holzkohle aus eigenen Wäldern gearbeitet, führte Theodor 1823 in Rödinghausen erstmals das auf Steinkohleverfeuerung basierende Puddelverfahren aus England ein. Damit läutete er in Rödinghausen und der ganzen Region die Industrialisierung ein. Wenig später baute er zudem das zweite Eisenblech-Walzwerk Westfalens auf. Noch unter Theodor zog sich die Familie 1850 aus den Industrieunternehmen zurück. Einzelne Industrieanlagen wurden verpachtet, Grundstücke verkauft.
Ein Schleifwerk, das Theodor zwischen dem Alten Hammer in Oberrödinghausen und dem Gut Rödinghausen betrieb, wurde zum Beispiel zu einer Strohpapierfabrik umgebaut. Die Hämmer pachtete ab 1880 ein Hemeraner Unternehmer. Der alte Oberrödinghauser Hammer lag und liegt auf dem Gelände, das die damalige Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG (heute Lhoist Germany Rheinkalk GmbH) 1927 von der Familie von Dücker kaufte. Er war bis 1955 in Betrieb, zuletzt als Schmiede, und ist heute ein technisches Kulturdenkmal, das zu besonderen Veranstaltungen geöffnet. Das Gut Rödinghausen blieb bis Anfang der 1980er Jahre im Besitz der Familie.
Obwohl die von Dückers nicht mehr als Unternehmer in Erscheinung traten, blieb zumindest ein von Dücker der Eisen- und Bergbaubranche treu. Franz-Fritz von Dücker, 1827 als Sohn von Theodor in Rödinghausen geboren, studierte Bergbau und wurde nach weiten Reisen und vielseitigen Tätigkeiten als Oberbergamtsreferendar 1873 Oberbergrat.
Er machte mehrere Erfindungen, zum Beispiel eine Methode zur Herstellung von Schwefelsäure. 1861 erfand er das Prinzip der Drahtseilbahn mit getrenntem Trag- und Zugseil und wendete es in Bad Oeynhausen erstmals an, ohne es jedoch patentieren zu lassen. Obwohl sich seine Seilbahnen nicht sofort durchsetzten, war es sein Prinzip, das rund 10 Jahre später weltweit genutzt wurde.
Du möchtest die Welt der von Dückers näher kennenlernen?
Dann besuche das Gut Rödinghausen. Durch fachgerechte Restaurierung strahlt das Architekturdenkmal wie zu Zeiten Caspar Ignaz von Dückers. Im Südflügel des Erdgeschosses sind die ursprünglichen Räumlichkeiten wiederhergestellt, darunter der Kaminsaal, in dem du sogar heiraten kannst. Der Nordflügel mit niedrigeren Räumen wird heute für Sonderausstellungen genutzt.
Im Obergeschoss findest du das Industriemuseum Menden. Es wirft Schlaglichter auf die Geschichte der Industriellenfamilie von Dücker und zeigt dir die auch durch sie vorangetriebene Industriegeschichte Mendens und seiner Region. Die Galerie der sprechenden Porträts ist besonders spannend. Hinter dem Haus erwartet dich ein wunderschöner Landschaftspark. Viele der mehr als 200 Jahre alten Bäume könnten sicherlich ganz eigene Geschichten erzählen.


Die Geschichte der Bleierzgrube Neu Glück in Plettenberg

Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Bergbau in Plettenberg hatte bereits eine lange Tradition. Insgesamt mehr als 110 Gruben soll es in den umgebenden Bergen gegeben haben. Eisenerz, Kupfer, Zink und Blei wurden gewonnen, manchmal sogar Silber. Ein kräftezehrendes, anstrengendes Geschäft unter Tage. Nicht jeder Besitzer erzielte den erhofften Erfolg, wie das Beispiel der Bleierzgrube Neu Glück zeigt.
Hermann Schantz war eigentlich Strumpfweber. Wann genau er nach Plettenberg kam und sein eigenes Unternehmen gründete, weiß heute niemand mehr. Offenbar folgte er 1736 seinem älteren Bruder Johann Eberhard Schantz, der 1735 – zehn Jahre nach dem verheerenden Stadtbrand, Plettenberg war noch immer im Wiederaufbau – die erste Strumpfweberei im Ort gegründet hatte.
Wusstest du schon, dass sich ein Bleierzband vom Heiligenstuhl über den Saley und die Else bis ins Bommecketal und noch ein bisschen weiter zog?
heute noch Reste von 78 Gruben im Plettenberger Stadtgebiet nachweisbar sind?

nicht weit von der Bleierzgrube
Neu Glück die Gruben Henriette I und Brandenberg lagen?
Die beiden aus dem siegerländischen Hilchenbach stammenden Brüder trafen in Plettenberg auf gute Voraussetzungen: Die Stadt war bereits bekannt für ihre Textilwaren, die Tuchmacherzunft war stark und der Landesherr Brandenburg-Preußen setzte alles daran, das Textilgewerbe in der damaligen Grafschaft Mark – heute der größte Teil des Märkischen Sauerlands – zu fördern.
Zu den Maßnahmen gehörten Ausfuhrstopps für einheimische Rohstoffe, Zölle für auswärtige Textilien und die finanzielle Unterstützung für zugezogene auswärtige Fachkräfte und Unternehmensgründer aus der Branche. Wahrscheinlich folgten die Brüder Schantz genau diesem Ruf und wurden schnell zu einer Bereicherung des Plettenberger Marktes. Beide heirateten hier und gründeten Familien.
Doch was hat Hermann Schantz bewogen, nach knapp 20 Jahren in Plettenberg in eine für ihn völlig neue Branche, den Bergbau, einzusteigen? Womöglich hing es damit zusammen, dass sich die Tuchmacherei und damit das ganze Textilgeschäft in einer Krise befand. Wolle war zu vernünftigen Preisen schwer zu erhalten, oft mussten die Tuchmacher ihre Waren unter einem angemessenen Preis verkaufen. Hermann Schantz blieb zwar weiterhin im Textilgewerbe und gehörte sogar der 1752 von den Plettenberger Tuchmachern und dem Magistrat gegründeten Stapelvereinigung an – einer Art Kartellzusammenschluss. Doch er versuchte sich ein zweites Standbein zu verschaffen. Und vielleicht war es ihm ganz recht, einfach nochmal etwas ganz Neues beginnen – und eine gewisse Goldgräberstimmung in der Stadt begünstigte diesen Prozess. Immerhin arbeiteten sich Plettenberger Unternehmer, die über das nötige Kapital verfügten, an vielen Stellen in die umgebenden Berge – mal einzeln, mal im Verbund als sogenanntes Gewerk, mal waagerecht, mal senkrecht.
Wo immer also seine genauen Motive lagen: Er suchte neues Glück und seine Entscheidung zeugte von großem Unternehmergeist. 1755 mutete er eine Bleierzgrube, beantragte also die Genehmigung zum Erzabbau, und ließ, nachdem sie erteilt war, unverzüglich einen Stollen ansetzen. Seine Grube nannte er optimistisch Neu Glück. Bereits nach drei Monaten war der Stollen 18 Lachter – das sind 18 Armspannen, rund 36 Meter – im sogenannten Dreistufen-Abbau mit drei Männern hintereinander in den Berg getrieben. Und: Man fand Blei, förderte es und es sah nach hervorragenden Perspektiven aus. Alles lief gut – bis Hermann Schantz den Fehler machte, einen Nebenstollen anlegen zu lassen.
Eigentlich hätte er wissen müssen, dass die Regeln im Bergbau sehr streng waren. Der erlaubte Verlauf des Stollens war klar vorgegeben – eines einzigen Stollens wohlgemerkt. Da Hermann Schantz diese Regel verletzt hatte, schloss das Bergamt ihm den Stollen. Seine Exkursion in den Bergbau war beendet. Doch einiges deutet darauf, dass Hermann Schantz seine Strumpfweberei parallel zum Bergbau-Abenteuer weiterführte, denn auch zwei seiner Söhne, Hermann Richard und Johann Christoph Henrich, wurden Strumpffabrikanten. Hermann Schantz selbst verstarb 1769. Seine Bleierzgrube Neu Glück geriet in Vergessenheit. Für fast 200 Jahre.
200 Jahre, in denen sich zeigte, dass Hermann Schantz den richtigen Riecher gehabt hatte: Mit der Textilindustrie in Plettenberg ging es trotz verschiedener Maßnahmen der Zunft weiter abwärts und mit der Eisen- und Metallindustrie steil bergauf. 200 Jahre, in denen Kriege kamen und gingen, darunter zwei Weltkriege. Im Zweiten Weltkrieg brachte die Frage nach Luftschutzräumen vielerorts die Erinnerung an alte Bergwerke, Gruben und Stollen zurück – auch in Plettenberg. So wurde zum Beispiel die Bleierzgrube Neu Glück 1944 zu einem Luftschutzraum für Mitarbeiter der Fa. Voß & Schröder umfunktioniert.
Die Stollen wurden erweitert, ein zweiter Eingang gesprengt. Es war eng und dunkel in den Stollen, aber es war sicher: Gut 100 Menschen fanden hier Schutz. So sicher aber auch, dass man an diesem unwirtlichen Ort in einem Seitenstollen kurz vor Kriegsende noch amerikanische Kriegsgefangene unterbrachte – zum Glück wurden sie nach wenigen Tagen befreit. Nach diesem Kapitel geriet die Bleierzgrube Neu Glück erneut in Vergessenheit. Zumindest in der breiten Öffentlichkeit.
Und dabei wäre es sicherlich geblieben, hätte man nicht einen anderen, richtig großen Tunnel graben wollen. Um den Durchgangsverkehr über die sogenannte Westtangente aus der Stadt zu verbannen, sollte er 2002 in den Hestenberg gesprengt werden. Es waren Heimatforscher und Bergbau-Experten, die den Straßenbau über die Grube Neu Glück informierten, die quer durch die geplante Trasse verlief.
Wusstest du schon, dass in Plettenberg zwischen 1600 und 1952 112 Grubenfelder gab? 46 Eisensteingruben, 32 Kupfererzgruben, 18 Bleierzgruben, 8 Schwefelkiesgruben, 6 Zinkerzgruben sowie 1 Schwerspat- und 1 Steinkohlegrube.

Diese Tatsache musste beim Bau des Tunnels natürlich berücksichtigt werden. Und so wurde die Bleierzgrube Neu Glück wieder geöffnet, vom Schutt befreit und vermessen. Nachdem man den Verlauf des Stollens ermittelt hatte, fiel die Entscheidung, ihn beidseitig des Hestenbergtunnels zu schließen und den Tunnel quasi mittendurch zu führen.
die Erzvorkommen die Grundlage für die bis heute erfolgreiche Metallindustrie in Plettenberg bildeten?

Bleierzgrube Neu Glück in Plettenberg
Rund 40 Meter der Bleierzgrube Neu Glück blieben nach dem Bau östlich des Tunnels erhalten: der perfekte Ort für ein Schaubergwerk. Nachdem der Stollen gesichert und mit elektrischem Licht ausgestattet wurde, finden hier regelmäßige Führungen statt. Man spürt bei einer solchen Führung schnell, wie sich Bergarbeiter anno dazumal gefühlt haben müssen, die sich nur mit einer Talglampe, dem sogenannten Sauerländer Frosch ausgestattet, ihren Weg durch den Felsen bahnten. Oder die Menschen, die hier bei Bombenalarmen Schutz suchten. Auch die schwere Arbeit kann man sich lebhaft vorstellen und die Hoffnung, dass man – mit Hilfe der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute – immer wieder ans Tageslicht zurückkehrt.
Hermann Schantz hat natürlich nie selbst gegraben, gehackt und geschlagen. Aber als Besitzer der Bleierzgrube Neu Glück wird er sicherlich immer wieder vor Ort gewesen sein, im langen, dunklen Stollen. Und vielleicht war er am Ende ja sogar etwas erleichtert, dass er über Tage bei seinen Strümpfen bleiben konnte. Wer weiß?


Du hast Lust auf eine packende Exkursion unter Tage?
Dann schnapp dir Helm und Taschenlampe und schließ dich einer unserer Führungen durch die menschengemachte Unterwelt an. Erkunde in der Bleierzgrube Neu Glück selbst, wie es in den Stollen zuging und was die Bergleute leisteten. Denn eins ist klar: Ohne die Bergmänner, die sich wie hier in Plettenberg täglich unter Tage begaben, um verschiedene Erze zu gewinnen, hätte es viele Fortschritte nicht gegeben – einfach, weil die Rohstoffe nicht verfügbar gewesen wären.
Die Geschichte der Talsperren im Märkischen Sauerland

15 Orte, 10 Talsperren im Märkischen Sauerland
Das Märkische Sauerland ist heute eine Region mit einer der höchsten TalsperrenDichten Deutschlands. Für Einheimische wie für Gäste sind die zehn Stauseen Oasen der Ruhe, die zum Wandern und Radeln, zu Spaziergängen und teilweise auch zum Schwimmen und zu Wassersport einladen. Die Basis für den heutigen Freizeitschatz wurde vor 140 Jahren gelegt. Doch die Motivation war damals alles andere als Vergnügen. Im Gegenteil ging es um Hochwasserschutz, Grundversorgung und um wirtschaftliche Interessen.
Man muss den Kopf leicht in den Nacken legen, um hinauf bis zur Krone der gebogenen Staumauer zu schauen. Einer der fünf Überläufe ist geöffnet, Wasser rauscht mit beachtlichem Sound im breiten Strahl die Mauer hinab – der See ist relativ voll. Der rund 22 Meter hohen Mauer sieht man ihre fast 125 Jahre nicht an. Doch das mag daran liegen, dass sie mit 94 Jahren generalüberholt und um eine zusätzliche Mauer verstärkt wurde.
Von oben wirkt das Wasserwerk am Fuß der Mauer klein, in die andere Richtung öffnet sich die glitzernde Seeoberfläche bald in die zwei Arme. Links sammelt sich das Wasser aus Fuelbecke und Kuckuckbach, rechts das des Riethahner Bachs. An allen Seiten reicht der Wald bis an die Talsperre heran. Idylle pur. Der Stausee ist heute Trinkwasserspeicher der Stadt Altena, seine Rundwege laden zum Wandern, Spazieren, Joggen ein.
Das war nicht immer so: Die Fuelbecketalsperre war die erste einer ganzen Reihe, die rund um die vorletzte Jahrhundertwende im Märkischen Sauerland entstanden. Die erste echte, große Talsperre mit Buchsteinmauer nach dem sogenannten IntzePrinzip. Die erste, die den Bach im Tal, die Rahmede, kontinuierlich fließen lassen sollte. Wasserbecken und Teiche, in denen Kleinunternehmer Wasser für ihre Hammer- und Walzwerke, ihre Drahtziehereien und Schmieden sammelten, hatte es in der Region hingegen schon seit Jahrhunderten gegeben.
Immerhin hatte sich das Konzept des Wasseraufstauens in der Menschheitsgeschichte immer wieder bewährt: Antike Reiche wie China und Ägypten nutzten es bereits vor Jahrtausenden zur Bewässerung ihrer Landwirtschaft und zur Trinkwasserversorgung. Auch die Römer bauten schon Staudämme. Es scheint, als hätten Regionen den effektiven Umgang mit Wasser zu verschiedenen Zeiten immer wieder auf eine ähnliche Art für sich erfunden. Eigentlich kein Wunder, denn Wasser war und ist das Lebenselixier der Menschen.
Sammelbecken, allerdings in neuen Dimensionen, lautete darum auch ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Zauberformel. Zunächst in Frankreich, wo sich Napoleon III. nach mehrfachen schweren Überschwemmungen z. B. an der Loire und an der Rhone dafür starkmachte, Wasserreservoire anzulegen, um zerstörerische Hochwasser zu verhindern und das kostbare Nass zu speichern. Jenseits der Grenze nahm sich einige Jahrzehnte später Prof. Dr. Otto Intze (1843-1904) diese französischen Bauwerke zum Vorbild, entwickelte jedoch ein eigenes Prinzip zum Bau der Staumauern.
Wusstest du schon, dass die Fuelbecketalsperre bei Altena und die HeilenbeckeTalsperre bei Gevelsberg 1894 die ersten Talsperren im Quellgebiet der Ruhr waren?

Otto Intze außer der Fuelbecketalsperre auch die Fürwiggetalsperre, die Jubachtalsperre, die Glörtalsperre und die Oestertalsperre im Märkischen Sauerland selbst geplant hat?

Intze war Bauingenieur und lehrte seit 1870 als Professor an der Technischen Hochschule Aachen Wasserbau, Baukonstruktion und Baustofflehre. Er wurde schnell zur anerkannten Autorität in Fragen der Wasserkraft bzw. Wasserversorgung sowie zum Begründer der modernen Wasserwirtschaft in Deutschland.
1882 stellte Intze erstmals sein Konzept zur besseren Ausnutzung der Wasserkräfte durch Talsperren auf einer Versammlung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) vor. Es fiel auf fruchtbaren Boden. Schließlich konnten Talsperren Hochwasserschutz mit Wasserkraftnutzung kombinieren. Sie versprachen also nicht nur Schutz vor unerwartetem Hochwasser, sondern auch permanent fließendes Wasser für Triebwerke, das in Zeiten der durchstartenden Industrialisierung dringend benötigt wurde.
Bereits ein Jahr nach Intzes Vortrag bildete sich in Altroggenrahmede, heute ein Stadtteil von Altena, ein Komitee zur Planung einer Talsperre an der Fuelbecke. Intze erhielt im selben Jahr den Auftrag, einen Entwurf zur Wasserbeschaffung zu entwickeln, um die Kleinindustrie am Bachlauf ganzjährig mit Wasserkraft betreiben zu können. Das Tal war bis dahin im Sommer manchmal acht Monate ohne Wasser, in den anderen Monaten drohte immer wieder zerstörerisches Hochwasser bis hinunter zur Lenne.
Intze war es wichtig, im Vorfeld die tatsächlichen Wassermengen wissenschaftlich zu ermitteln, die über das Jahr hier flossen. So entwickelte er zunächst ein System, mit dem sie kontinuierlich automatisch erfasst wurden. Auf dieser Basis konnte er dann berechnen, wie viel Wasser in einem Sammelbecken Platz finden musste. Obwohl diese Vorarbeiten liefen, ergab sich für den Bau der Staumauer jedoch ein Stopp. Es ging ums Geld. Eine Genossenschaft aus Unternehmern im Tal sollte das Projekt finanzieren. Dazu war zwar die Mehrheit der Unternehmer bereit, aber eben nicht alle.
Jahre vergingen, die Pläne lagen in der Schublade, die Positionen änderten sich nicht. 1891 wurde dann nach königlicher Verordnung ein sogenanntes Zwangsgesetz erlassen, das die lokalen Unternehmer – nicht nur hier – zur Mitgliedschaft in einer Wassergenossenschaft verpflichtete. Damit konnte ein Verbund der gewerblichen Anlagen auch gegen den Willen einzelner Beteiligter durchgesetzt werden. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sowohl für Befürworter als auch für die Gegner ein deutlicher Nutzen abzusehen wäre.
Auf dieser Grundlage bildete sich 1893 schließlich die Talsperren-Genossenschaft Füelbecke im Kreis Altena, 1894 begannen die Bauarbeiten am Staudamm der Fuelbecketalsperre. Die Abgabe von Betriebswasser an die Werkbesitzer in der Füelbecke und Rahmede und die Entnahme von Bachwasser zur Ergänzung der Trinkwasserversorgung von Altena waren als Ziele definiert. Schon 1896 war das Absperrbauwerk aus Bruchstein errichtet und wurde in Betrieb genommen. Wie erwartet zeigten sich die Vorteile der ersten Talsperre schnell. Die Betriebe im ganzen Tal profitierten von der kontinuierlichen Wasserzufuhr.

Andererseits wurde auch bald deutlich, dass die Genossenschaft durch die Finanzierung stark belastet wurde und dies kein dauerhaft tragfähiges Modell war. Obwohl es bereits erste Überlegungen zu weiteren Talsperren gegeben und Intze in der Region mögliche Standorte für weitere Stauseen gefunden hatte, kam der Bau weiterer Staumauern ins Stocken.
Eine Lösung entwickelte sich schließlich als die Wasserversorgung für das ganze Ruhrgebiet zur Herausforderung wurde. Die Wasserwerke der Städte und die Industriebetriebe des rheinisch-westfälischen Industriegebiets insbesondere an der Ruhr waren mit dieser Aufgabe überfordert – zum Beispiel, weil manchmal einfach das Wasser fehlte. Da das Quellgebiet der Ruhr zum Teil im heutigen Märkischen Sauerland liegt, war der Talsperrenbau also von großem Interesse. Durch die Gründung des Ruhrtalsperrenereins, in dem neben Betrieben auch die Wasserwerke freiwillige Mitglieder waren, gab es ab 1899 neue Unterstützung für einen Teil der Talsperren – jene im Einzugsgebiet der Ruhr.
Schon bald konkretisierten sich die Planungen für die nächsten Talsperren. Relativ schnell wurde 1904 zwischen Lüdenscheid und Meinerzhagen die erste Versetalsperre, heute Fürwiggetalsperre, fertiggestellt. Sie diente der Wasserversorgung der nahen Betriebe und Lüdenscheids sowie der Versorgung der Wasserwerke an der unteren Ruhr. Die 1904 und 1906 fertiggestellten Stauseen Glörtalsperre bei Schalksmühle und Jubachtalsperre bei Kierspe versorgten die Betriebe im Volmetal sowie gleichfalls die Wasserwerke an der unteren Ruhr. Alle drei waren von Otto Intze geplant.
Für den Bau der Oestertalsperre bei Plettenberg hatten Oestertaler Fabrikanten bereits 1896 eine Genossenschaft gründet. 1899 erhielt Otto Intze auch hier den Auftrag zur Planung der Talsperre.
Wusstest du schon, dass die Fürwiggetalsperre ursprünglich Versetalsperre hieß und beim Bau der neuen Versetalsperre umbenannt wurde?

der Ruhrtalsperrenverein die Vorgängerorganisation des Ruhrverbands ist?
Für den Bau wartete man zunächst auf den Ausbau der Schmalspurbahn, um den kostengünstigen Transport des Materials zu bewerkstelligen. 1903, als die Kleinbahn bis ins Oestertal fuhr, wurde die Baugenehmigung erteilt. Doch der Bau gestaltete sich schwierig: Zwei Bauunternehmen gingen 1904 und 1905 Konkurs. Nachdem auch das dritte Bauunternehmen gescheitert war, entschloss sich die Genossenschaft 1906, den Bau selbst in die Hand zu nehmen. Die Oestertalsperre wurde noch 1906 fertiggestellt, 1907 in Betrieb genommen und versorgte anfangs die Betriebe im Oestertal sowie die Wasserwerke an der unteren Ruhr. Heute ist sie Brauchwasserspeicher und dient der Wasserstandsregulierung der Ruhr.
Auch nach Intzes Tod im Jahr 1906 arbeitete man in der Region weiter nach seinem Prinzip. Dank seines Wasserreichtums wurde das heutige Märkische Sauerland zu einer der talsperrenreichsten Regionen in Deutschland. 1912 wurde die Kerspetalsperre bei Kierspe als Trinkwasserspeicher u.a. für Wuppertal und Remscheid vollendet. Beim Aufstauen des Kerspebachs in einem langen Stausee wurden Orte, Wohnplätze und Pulvermühlen überflutet, deren Besitzer umgesiedelt worden waren. Auch für die Listertalsperre östlich von Meinerzhagen mussten im selben Jahr Orte und Höfe aufgegeben werden. Die Talsperre diente damals der Wasserversorgung der nahen Betriebe und der Versorgung der Wasserwerke an der unteren Ruhr.
Die 1914 fertiggestellte Callerbachtalsperre in Iserlohn mit aufgeschüttetem Staudamm hatte erstmals eine andere Ausrichtung. Sie sollte die Frischwasserzufuhr der neuen Kläranlage sichern und entwickelte sich schnell zum Ausflugsziel, was auch im offiziellen Namen Seilersee zum Ausdruck kam und bereits einen langfristigen Ausblick auf die Zukunft der Stauseen gab.
Da der Wasserbedarf im Ruhrgebiet immer weiter stieg, hatte der Ruhrtalsperrenverein zu jener Zeit als erstes eigenständig finanziertes Projekt die Möhnetalsperre bauen lassen – bei ihrer Eröffnung war sie die größte Talsperre Europas. Ende der 1920er Jahre beauftragte der Verein unter anderem den Bau der neuen Versetalsperre zwischen Lüdenscheid und Herscheid – dem heute größten Stausee des Märkischen Sauerlands.


Anders als die Staumauern nach dem Intze-Prinzip ist das Absperrwerk hier ein Steinschüttdamm. Um Platz für den Stausee zu schaffen, wurden neun Siedlungen aufgelöst und überflutet, deren Reste heute bei niedrigem Wasserstand noch zu erkennen sind.
Die Arbeitskräfte für den Bau des Absperrwerks wurden anfangs im Rahmen des sogenannten freiwilligen Arbeitsdienstes eingestellt, einem öffentlich geförderten Beschäftigungsprogramm für Erwerbslose. 1934 übernahmen die Nationalsozialisten die Kontrolle öffentlicher Einrichtungen, darunter auch von Körperschaften öffentlichen Rechts wie dem Ruhrtalsperrenverein und dem Ruhrverband, der seit 1913 Kläranlagen zur Reinhaltung der Ruhr baute und betrieb. Die beiden Verbände wurden ab 1938 als Verwaltungsgemeinschaft geführt.
Zu dieser Zeit begannen auf den Baustellen Arbeitskräfte zu fehlen. Da dem Bau von Talsperren eine besondere staatspolitische Bedeutung beigemessen wurde, wurde von 1938 an für die Arbeiten an der Versetalsperre eine Dienstverpflichtung ausgesprochen. Diese erlaubte zunächst einen befristeten, ab 1939 einen unbefristeten Einsatz von Arbeitskräften auf der Baustelle, sodass die Arbeiten fortgesetzt werden konnten – bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der den Mangel an Arbeitskräften erneut verschärfte. 1940, während des Zweiten Weltkriegs, begann die Gestapo sogenannte Arbeitserziehungslager einzurichten – das erste war das Arbeitserziehungslager Hunswinkel für den Bau der Versetalsperre.
Am Ufer des Stausees wurde ein Mahnmal zum Gedenken an die Insassen und Verstorbenen des Arbeitserziehungs- und Konzentrationslagers Hunswinkel errichtet. Schautafeln des Ruhrverbands informieren über diese Zeit:
„1940 errichtete die Geheime Staatspolizei (Gestapo) in Zusammenarbeit mit dem Reichstreuhänder der Arbeit in den vorhandenen Baubaracken von Hunswinkel (...) das erste von Polizeikräften bewachte Arbeitserziehungslager der nationalsozialistischen Zeit. In ihm waren bis 1945 insgesamt ca. 5.000 Menschen aus Deutschland und aus 8 anderen europäischen Ländern für jeweils 6-12 Wochen auf engstem Raum untergebracht. Die Gefangenen arbeiteten im Dienst der vom Ruhrtalsperrenverein beauftragten Firma HOCHTIEF am Bau der Versetalsperre. Ca. 550 Häftlinge starben durch Hunger, Misshandlung und Erschießung.“

Hier Weiterlesen





Auf den Mattenschanzen in Meinerzhagen lernen Skispringer fliegen
Seit bald 100 Jahren prägen Skischanzen das Bild im Südosten von Meinerzhagen. In der Anfangszeit, als Skifahren, Langlauf und Rodeln hier ebenfalls noch in den Kinderschuhen steckten, waren sie wesentlich kleiner. Doch mit dem Aufschwung, den der Wintersport bis in die 1960er Jahre in Meinerzhagen nahm, wuchsen auch die Schanzen. Heute sind die Mattenschanzen ein etablierter Wintersportplatz und offizielle Trainingsschanzen des Deutschen Ski-Verbands (DSV). Neben 15 aktiven Athleten trainieren hier Nachwuchsspringerinnen und -springer des Ski-Klubs Meinerzhagen. Und noch immer finden auf den Schanzen Wettbewerbe statt.
8. Oktober 2023, 16 Grad Celsius, der Himmel ist bedeckt, manchmal lässt sich die Sonne blicken. Die Teilnehmer an der 41. Nordwestdeutschen Mattenschanzentour haben Glück: Das Wetter ist perfekt zum Skispringen. Ohne Schnee? Ohne Schnee. Was für nicht Eingeweihte erst einmal ungewöhnlich klingt, ist für die teilnehmenden Skispringerinnen und Skispringer völlig normal. Schließlich wird in diesem Sport das ganze Jahr trainiert. Und Sprungschanzen wie die Meinhardus Mattenschanzen vom Ski-Klub Meinerzhagen bieten diese Möglichkeit. Man landet im Frühjahr, Sommer und Herbst auf robusten Kunststoffmatten.
Drei Schanzen unterschiedlicher Größe erwarten die Springerinnen und Springer an diesem Tag beim Finale in Meinerzhagen: K 12 mit einer Sprungweite von 12 Metern für die Jüngsten zwischen 7 oder 8 und 10 Jahren, K 37 mit 35 Metern für Jungen und Mädchen bis 13 Jahren und K 62 mit 60 Metern für Jugendliche und Erwachsene.
Die Meinhardus Mattenschanzen sind der sechste Stopp der Tour. Hier wird das diesjährige Finale ausgetragen. Die jeweilige Startposition richtet sich nach dem Gesamtergebnis der Sprünge aus Rückershausen, Willingen, Braunlage, Wernigerode und Winterberg.
Mitten im Grünen erheben sich die nebeneinander liegenden Schanzen. Am beeindruckendsten natürlich die K 62, man muss den Kopf in den Nacken legen, um die ermessen, wie weit oben die Startplattform liegt. Doch selbst die K 12 ist größer, als sie von Ferne wirkt. Wer springen will, braucht auch Kondition, um die Türme für jeden Sprung über Pfade auf der Wiese und/oder über Eisenleitern zu erklimmen. Immer mit den Skiern auf der Schulter.
Die Stimmung rund um die Schanzen ist aufgekratzt. Sportlerinnen und Sportler haben Fanclubs mitgebracht, meist ihre Familien. Entsprechend werden alle Sprünge bejubelt. Und – ganz ehrlich – allein der Mut, die Schanzen hinabzusausen, abzuheben und zu landen verdient Dauerapplaus. Eine milde Ahnung von der Höhe der Schanzen verschafft der Blick vom Aussichtsturm, der sich zwischen der K 37 und der K 62 erhebt. Aber eben nur eine Ahnung. Der Blick von der Startplattform der höchsten Schanze herunter, das zeigen Fotos, macht jeden 10 -Meter-Turm im Schwimmbad zum Kinkerlitzchen.
Wusstest du schon, dass sich Meinerzhagen vom frühen 20. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre zu einem Wintersportort entwickelte, der viele Gäste von Rhein und Ruhr hatte?
die große Meinhardus-Schanze auf einen Bau von 1957 zurückgeht (K 50/Sprungweite 50 Meter), der 1964 auf erweitert wurde (K 60/ Sprungweite 60 Meter). Und die Schanze zuletzt im Jahr 2002 an die aktuellen Anforderungen der Fédération Internationale de Ski (FIS) angepasst wurde?
Blick zurück auf die Anfänge: Der Winter-Sport-Club Meinerzhagen, Vorläufer des Ski-Klubs, besteht seit Februar 1911 und geht tatkräftig zu Werke. Angetreten, um „ die Freude und das Interesse an der winterlichen Natur unter Jung und Alt wachzuhalten und neu zu beleben“, baut der Verein in seinem ersten Jahr eine Rodelbahn. Die Anzahl der Mitglieder wächst schnell. Ende 1911 ist der Verein damit beschäftigt, mehrere Skiwege rund um Meinerzhagen und Valbert anzulegen. Verschiedene Ortsgruppen des Skiklubs Sauerland melden sofort ihr Interesse an, sie zu Trainingszwecken zu nutzen.
Der Winter-Sport-Club erkennt die Möglichkeiten, Meinerzhagen weithin bekannt zu machen. Er richtet eine Art Telefon-Service ein, über den er die wichtigsten westdeutschen Tageszeitungen über die aktuellen Schneehöhen informiert. Das erste Sportfest im Februar 1912 wird zum großen Erfolg. Wintersportfreunde reisen aus Orten der näheren und weiteren Umgebung an – Gummersbach, Hagen, Lüdenscheid, Olpe und Wipperfürth.
All das ist keine Selbstverständlichkeit, denn Wintersport ist in diesen Breiten noch längst nicht etabliert. Im Gegenteil treffen die Aktivitäten des Vereins vor Ort durchaus auch auf Skepsis und Spott. Doch nach der positiven überregionalen Resonanz von sportlichen Schneefans legt der Winter-Sport-Club Meinerzhagen im Sommer 1912 einen ersten Sprunghügel an und erweitert die Rodelbahn. Die Beitritte geben dem Verein recht: Mittlerweile kommen die Mitgliedsanträge aus ganz unerwarteten Gegenden: aus Berlin oder Freiburg zum Beispiel.

Und so wird 1913 ein weiteres gutes Jahr für den Verein, auch das Wintersportfest im Februar 1914 wird noch ein Erfolg. Doch dann ändern sich die Zeiten: Im Sommer bricht der Erste Weltkrieg aus. Erst im Februar 1919 finden sich die Mitglieder erneut zusammen und stehen wieder ganz am Anfang: eine Rodelbahn, Skistrecken und eine erste Sprungschanze werden neu angelegt.
Doch Inflation und Nachkriegszeit sind keine guten Voraussetzungen, um an die erfolgreiche Zeit anzuknüpfen. Erst ab 1924 geht es unter einem neuen Vorstand für den Verein wieder aufwärts. Anfang Dezember findet auf einer neu errichteten Schanze vor großem Publikum das erste Springen statt, bei dem die westdeutsche Elite des Sports antritt.
Regionale Zeitungen und die Fachpresse sind voll des Lobes und erheben Meinerzhagen zum lohnenden Wintersportplatz, der weniger überlaufen sei als das sogenannte hohe Sauerland. Gelobt werden neben den unberührten Pisten vor allem die Möglichkeiten für Tourenläufer und – dank einer neuen Übungsschanze für Anfänger und der neuen Schanze – auch für Skispringer.
Einige Jahre später, 1931, schafft Meinerzhagen den Sprung in die erste Reihe der Wintersportorte des Mittelgebirges. Der entscheidende Faktor ist die 35 -MeterSchanze, die den Vorgaben des Deutschen Ski-Verbands (DSV) entspricht. Sogar der damalige Deutsche Meister im Skispringen, Erich Recknagel, springt in Meinerzhagen – und lockt eine Menge an Zuschauern, die selbst die in den Orten des Hochsauerlands deutlich übertrifft. Daneben zeigen auch die Meinerzhagener Sportler des Vereins zunehmend Erfolge: Mehrere Springer nehmen an Deutschen Meisterschaften und internationalen Wettbewerben teil und erreichen gute Platzierungen. Im Lang- und Geländelauf etablieren sich Sportler aus Meinerzhagen ebenfalls.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 endet die Vereinsarbeit des Winter-Sport-Clubs Meinerzhagen in der bisherigen Form. Mehr als zwölf Jahre dauert es, bis die Mitglieder Ende 1945 wieder zusammentreten und einen neuen Vorstand wählen. Nicht nur der Verein muss sich neu erfinden und gründen. Nach dem Krieg ist vieles zerstört und verfallen, darunter die Wintersportanlagen in Meinerzhagen.
Auch in dieser Nachkriegszeit fehlen Baumaterialien und Gelder. Und so baut der Verein, jetzt unter dem Namen Ski-Klub Meinerzhagen, die Sprungschanze in Etappen neu und stellt die restlichen Anlagen bis 1949 fertig. Parallel gründet sich 1948 auch der Skiklub Sauerland neu und veranstaltet erstmals wieder verbandsinterne Wettkämpfe – mit Meinerzhagen als Gastgeber. Da die Schneelage in den anschließenden Jahren nicht optimal ist, verzögert sich der Aufschwung des Wintersports noch etwas. Doch ab 1951/1952 ändert sich dies und die Deutsche Bahn beginnt sogar, Sonderzüge nach Meinerzhagen einzusetzen.
du schon, dass
beide Schanzen nach dem Zweiten Weltkrieg erneuert und wieder in Betrieb genommen wurden?

die drei Schanzen ausschließlich für offizielle
Trainingseinheiten genutzt werden und dort bis heute Wettbewerbe stattfinden?
Die Anzahl der Wintergäste wächst bis 1955 kontinuierlich und stark. Im gleichen Jahr entsteht der Wunsch nach einer weiteren, noch größeren Schanze. Einerseits, um dem Skisprung-Nachwuchs ideale Voraussetzungen zu bieten und andererseits, um die Position als Wintersportort zu festigen. Zwei Jahre dauert es, bis alle Rahmenbedingungen geklärt und alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. So ist beispielsweise ein öffentlicher Weg durch die Schanze mit ihrem 35 Meter hohen Anlaufgerüst überbaut worden. Bis zur Eröffnung vergeht ein weiteres Jahr, weil ausgerechnet der Winter 1957 schneearm bleibt. Doch 1958 ist es vollbracht, Meinerzhagens dritte Schanze – mit Holzkonstruktion – ist in Betrieb.
Doch die Entwicklung bleibt nicht stehen. 1962 baut der Verein die kleine Schanze als ganzjährig nutzbare Mattenschanze mit 30 Metern Sprungweite (K 30) neu. Die Einweihung ist ein großes Event, an dem auch die deutsche Skispringer-Nationalmannschaft teilnimmt. Bereits zwei Jahre später setzt sich Meinerzhagen an die Spitze der Wintersportplätze der Bundesrepublik: Der Ort eröffnet die zu jener Zeit größte Mattenschanze mit 60 Metern Sprungweite (K 60) der Bundesrepublik. Bis 1976 wird sie u.a. für internationale Mattensprung-Wettbewerbe genutzt.
Doch dann ändert die Fédération Internationale de Ski (FIS) ihre Normen und wieder müssen Entscheidungen getroffen werden.

Der nächste Neubau entsteht und wird 1982 eröffnet. Die Mattenschanze hat ein neues Profil und einen Turm mit Stahlanlauf. Neben dem Ski-Klub Meinerzhagen nutzen sie z. B. der DSV und zwischenzeitlich auch die niederländische Nationalmannschaft. Veränderungen bleiben die Regel: 2002 erhält die größte Schanze neue Matten sowie weitere Anpassungen an Anforderungen der FIS. Jahrelang finden hier internationale Damen-Springen statt. Die mittlere Schanze (K 37 ) wird 2007 abgerissen und mit Stahlkonstruktion wieder aufgebaut. Seine jüngsten Modernisierungen nimmt der Verein 2012 und 2013 am Aufsprung-Hang und am Auslauf der mittleren K 37- und der kleinen K 12-Schanze vor. So bleiben die Meinhardus Mattenschanzen auf dem neuesten Stand für verschiedenste Wettbewerbe von Frühling bis Herbst.

Die Springen auf den Meinhardus Mattenschanzen laufen, sie werden den ganzen Tag dauern. Ein Tag ist im Oktober zwar nicht besonders lang, aber für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Altersgruppen vergeht die Zeit so oder so wie im Flug. Alle sausen, ohne zu zögern, den Anlauf hinab und springen vom Schanzentisch ab. Von Kindesbeinen an haben sie es gelernt. Die kleinen, die nicht mehr kleinen und die großen Sportlerinnen und Sportler – erst auf einer kleinen, dann auf einer mittleren und dann auf einer großen Schanze.
Für sie ist Meinerzhagen bis heute ein attraktiver Wintersportplatz. Im Frühling, Sommer und Herbst. Allerdings nicht im Winter. Denn der Schnee reicht inzwischen nicht mehr aus, um die Schanzen zu präparieren. Doch wenn es schneit, dann gibt es rundum noch immer den einen oder anderen Hang zum Rodeln oder zum Skifahren. Und wenn sehr viel Schnee fällt, auch Möglichkeiten zum Langlauf.
heute rund 15 aktive Athleten und regionale Wintersportclubs das Angebot zum Skispringen nutzen? Und der Ski-Klub Meinerzhagen, dem die Schanzen gehören, außerdem intensive Nachwuchsförderung im Skispringen betreibt?
Ein Südhang über der Stadt liefert in Neuenrade süffigen Ertrag
Zu Füßen des steilen Hangs liegt Neuenrade in einer Mulde, die man hier besonders gut überblickt. Die Sonne scheint, doch der Wind weht frisch. Jetzt, im Spätwinter, ist an den 900 Rebstöcken des Weinbergs noch wenig Grün zu sehen. Die Reben halten sich zurück. Als ahnten sie, dass ihnen demnächst zur Erziehung herbe Schnitte bevorstehen. Dabei ist sie natürlich zu ihrem Besten. Denn nur, wenn im Spätwinter oder im frühesten Frühjahr die Schnitte stimmen, ist im Herbst reiche Ernte zu erwarten.


Die Geschichte des Neuenrader Weinbergs beginnt in den Niederlanden. In Aalten, um genau zu sein. Aalten an der deutsch-niederländischen Grenze bzw. die seit 2005 eingemeindete frühere Kleinstadt Dinxperlo ist seit 1984 Partnerstadt von Neuenrade. Und wie es bei Städtepartnerschaften so ist, besuchen sich Vertreter der Städte öfter mal gegenseitig. 2010 war es wieder so weit. Der damalige Bürgermeister Klaus-Peter Sasse besuchte den Kollegen jenseits der Grenze.
Dort wurde als besondere Überraschung unter anderem Wein aus ortseigenem Anbau serviert. Nun muss man wissen, dass Aalten um einiges nördlicher liegt als Neuenrade, und dass es ziemlich flach ist. Dennoch gab es einen Weinberg – oder eher einen Weingarten. Mehr noch: Es gab eigenen wohlschmeckenden Wein aus diesem Weinanbau. Was für eine Idee: Weinbau im Norden, jenseits der klassischen Gebiete! Bei Klaus-Peter Sasse fiel sie auf fruchtbaren Boden.
Kaum zurück in Neuenrade versammelte er Freunde und Bekannte, erzählte ihnen davon und so begann der Gedanke Früchte zu tragen. Schon bald darauf, Anfang 2011 , gründeten sich die Weinbergfreunde. Zunächst waren diese Freunde ohne Weinberg – aber anders als in Aalten gab und gibt es in Neuenrade immerhin Berge. Und scheinbar war der Zeitpunkt genau richtig, denn alles fügte sich bestens zusammen.
Die schwierigste Frage – nach einem passenden Grundstück – löste sich quasi von selbst: Einer der Weinbergfreunde besitzt einen Südhang, der sich nicht wirtschaftlich nutzen lässt. Und was für ein Hang! Steil, aber angrenzend an die Altstadt und mit traumhaftem Weitblick. Ideal für den Weinbau. Mittendrin ein paar alte, schattenspendende Bäume. Perfekt für Pausen mit und ohne Rebensaft.
Wusstest du schon, dass der sonnige Südhang in Neuenrade wahrscheinlich bereits im späten Mittelalter schon von den Mönchen des Klosters Berentrop zum Weinbau genutzt wurde?

Dass sie auf ihrem Weg zum eigenen Wein jedoch noch ganz am Anfang standen, war den Weinbergfreunden durchaus bewusst. Immerhin brauchen junge Weinstöcke bis zum ersten nennenswerten Ertrag mindestens drei Jahre. Und dazu musste erstmal recherchiert werden, welche Rebsorte im manchmal etwas frischen Sauerland überhaupt in Betracht kommt. Nach eigenen Nachforschungen und fachlicher Beratung durch den Weingutbesitzer und Winzer Fritz Georg von Nell in Trier entschieden sich die Weinbergfreunde für zwei robuste Sorten: die fruchtige weiße Solaris- und die kräftige rote Regent-Traube – insgesamt 900 Rebstöcke.
Natürlich war es mit dem Kauf der Reben nicht getan, denn zunächst musste der Hang bearbeitet werden. Für den Verein begann daher 2011 das Kapitel der regelmäßigen Arbeiten am Hang.
Schnell verwandelte der sich unter Hacken, Schaufeln, Hämmern und Rasenmähern in einen Weinberg. Bereits Mitte April war er samt Rebstöcken angelegt.
Dann hieß es erstmal hegen, pflegen – und warten. Jahr für Jahr wurde an den Reben Unkraut entfernt und zwischen den Spanndrähten Gras gemäht. Vor allem wurden die Reben erzogen. Rebenerziehung bedeutet, dass die Reben im Frühjahr nach einem bestimmten Prinzip in Form gebracht werden. Die Weinbergfreunde in Neuenrade hatten sich für den sogenannten Doppelstreckbogen entschieden. Bis auf zwei Triebe werden an jedem Rebstock jedes Frühjahr die Triebe entfernt, sodass die Nährstoffzufuhr fürs Wachstum optimal ist.
In diesen ersten Jahren war Geduld bei den Weinbergfreunden die gefragteste Tugend. Erst 2016 konnte zum ersten Mal eine kleine Menge an Trauben gekeltert werden – mehr als 200 Flaschen Berentroper Klostergarten ergab die Lese. Allerdings nur für den privaten Bedarf, denn die Verordnungen der EU sind streng. Unter diesen Voraussetzungen ist heute das Keltern der Erträge privater Winzer auf Flächen bis zu 1.000 Quadratmetern geduldet. Der Verkauf oder Ausschank der Weine ist untersagt. Bis 2016 durfte jedoch nur der Ertrag von 100 Quadratmetern gekeltert werden.
Zuversichtlich starteten die Weinbergfreunde daher ins Jahr 2017. Hegen, pflegen, schneiden und dem Wein beim Wachsen zusehen. Unkraut entfernen, Gras mähen. Die Eisheiligen überstehen. Viele schöne Pausen mit Ausblick auf dem sogenannten Balkon unter hohen Bäumen. Mitte des Jahres hatten sich die Trauben der Weinfreunde prächtig entwickelt. Prall saßen sie im dichten Weinlaub. Doch dann war es über Nacht mit der Pracht vorbei.
Denn der Weinberg hatte ungebetenen Besuch erhalten. Ein ganzer Schwung Rehe muss es gewesen sein, der sich hier ein nächtliches Gelage gönnte. Den umgebenden Zaun hatte die Herde an einer defekten Stelle überwunden. Vorbei war es mit den prächtigen Trauben, vorbei mit reicher Ernte im Herbst 2017. Ein herber Rückschlag für die Weinbergfreunde.
Ans Aufgeben dachte jedoch niemand. Im Gegenteil: Unter der guten Pflege der Traubenfreunde erholten sich die Reben in den nächsten Jahren. Keiner der 900 Rebstöcke ging verloren und langsam konnte der Ertrag wieder gesteigert werden –obwohl auch Vögel und Wespen sich immer wieder gerne an den süßen Früchten gütlich taten. Das Jahr 2020 wurde schließlich der bisher beste Jahrgang mit rund 600 Flaschen Berentroper Klostergarten. Die Sorten Solaris und Regent wurden gemeinsam zu Neuenrader Rotling gekeltert.
Wie das aktuelle Jahr wird, lässt sich in Momenten, wo noch kräftig eisige Winde wehen, nicht voraussagen. Doch die privaten Weinkeller sind noch gut gefüllt. Und so manche Flasche wird an Wegbegleiter der Weinbergfreunde verschenkt.
Wusstest du schon, dass
die EU seit 2026 das Keltern der Erträge privater Winzer auf Flächen bis zu 1.000 Quadratmetern duldet?

dass die Weinbergfreunde ihren Weinberg zufällig an einem Hang angelegt haben, der im späten Mittelalter schon von den Mönchen des Klosters Berentrop für diesen Zweck genutzt wurde? Erfahren haben die Traubenfreunde das allerdings erst, nachdem sie ihre Rebstöcke bereits gepflanzt hatten. Ein Weinbergfreund, Dr. Rolf Dieter Kohl, ehemaliger Leiter des Kreisarchivs in Altena, stolperte über die Bezeichnungen Winnenberg und Am Wümberg in alten Flurkarten. Seine Recherchen ergaben, dass dies tatsächlich frühere Bezeichnungen für Weinberg sind.
Mehr als wahrscheinlich also, dass sowohl die Mönche als auch die späteren adeligen und bürgerlichen Besitzer des Klosters genau an diesem Hang ab dem 13. Jahrhundert Wein anbauten.

Johann Wolfgang von Goethe

Besonderes Vergnügen bereitet den Weinbergfreunden, ihren Weinberg für Veranstaltungen zu öffnen. Dies ist immer wieder eine willkommene Gelegenheit, mit Besuchern ins Gespräch zu kommen sowie von ihren Erfahrungen mit dem Weinberg und den Reben zu berichten. So finden unter den alten Bäumen von Zeit zu Zeit kleine Konzerte statt.
Zudem beteiligen sie sich jedes Jahr im September an der Aktion Offene Gärten im Ruhrbogen. Gerne würden sie zu diesen Gelegenheiten ihren eigenen Wein ausschenken, doch das ist Privatwinzern mit Flächen unter 1000 Quadratmetern in der EU nicht erlaubt. Der Weinberg in Neuenrade hat 999 Quadratmeter.


In Werdohl laden fünf markante Felsen zum Klettern ein
Werdohl ist immer für Überraschungen gut. Die Lenne fließt hier durch markante Schleifen und formt als W den Anfangsbuchstaben der Stadt vielleicht weltweit einmalig. Das Gelände steigt steil an, bis hoch in die waldigen Hänge zieht sich die Stadt. Tagsüber beeindrucken die an den Bergen klebenden Häuser, bei Dunkelheit werfen sie glitzernde Lichter. Dazwischen winden sich Straßen, wie die Strecke nach Neuenrade. Dass Industrie hier eine lange Tradition hat, sieht man unten an der Lenne. Und doch ist es heute besonders das Lenneufer, das zu Freizeitaktivitäten einlädt: beispielsweise an den fünf steilen Kletterfelsen am Lennebogen.
Treffen sich zwei Ehrenamtler in Werdohl am Lenneufer, auf der früheren Straße nach Altena. Der eine spazierend, der andere laufend. Der Spazierer bleibt stehen und schaut an der schroffen Felswand hoch. Der Jogger gesellt sich zum Spazierer und blickt ebenfalls hinauf, um zu entdecken, was der andere sieht. Lenneplatte nennt sich die Wand, über die die beiden damals ihre Blicke schweifen lassen. Weil sie direkt an der Lenne liegt und weil sie trotz ihrer diagonalen Struktur beinahe eine ebene Fläche bildet. Die Männer schweigen. „ Einfach toll “, sagt dann der Jogger. Der Spazierer nickt, seine Augen tasten den Fels ab. Dann stutzt er plötzlich und deutet nach oben. „ Da sind ja Haken in der Wand! “, sagt er. „ Die sind mir ja noch nie aufgefallen! “
„ Hm“, antwortet der Jogger. „Wahrscheinlich sind sie von den Belgiern.“ „Von den Belgiern? “, fragt der Spazierer. „ Ja, von den belgischen Soldaten, die bis Mitte der 90er in Lüdenscheid stationiert waren. Die haben hier trainiert “, sagt er. „ Ach nee. Das ist ja interessant “, sagt der Spazierer und reicht dem anderen die Hand. „ Ich bin Manfred Hoh, Sprecher vom Bürgerstammtisch Werdohl.“ „ Ach, dann kenne ich Sie sogar aus der Zeitung! Marius Marse von der Freiwilligen Feuerwehr Werdohl“, sagt der Jogger. „ Freut mich“, sagt Hoh und schaut wieder die Felswand hinauf. „ Klettern! “, sagt er und nickt. „ Das wäre doch eine tolle Sache! “ Der andere schaut ihn an. „ Ja! “, sagt Marius Marse und nickt enthusiastisch. Es ist das Jahr 2001. Und so oder so ähnlich wird der gedankliche Grundstein für die Kletterfelsen in Werdohl gelegt.
Mit etwas weniger Engagement hätten sich die Wege der Männer vielleicht wieder getrennt, aber das tun sie nicht. Denn zum einen stellt sich heraus, dass der Jogger und freiwillige Feuerwehrmann Marius Marse auch Mitglied im Deutschen Alpenverein ist, Sektion Gummersbach. Für ihn ist das Gespräch eine Art Steilvorlage für Kletterfantasien. Und Manfred Hoh, als Mitglied des Bürgerstammtischs, liegt sowieso immer daran, seine Heimatstadt Werdohl interessanter zu machen. Und so lassen beide gemeinsam ihren Gedanken freien Lauf. An Ort und Stelle überlegen sie gut gelaunt, was man eigentlich machen müsste, um hier einen Kletterfelsen einzurichten. Wie es eben so ist, wenn eine tolle Idee entsteht.
Wusstest du schon, dass man an einem Teil der Werdohler Felsen noch erkennt, dass sie aus dem Meeresboden entstanden sind? Sie tragen die typischen Rippelmarken, die man aus dem Watt kennt.
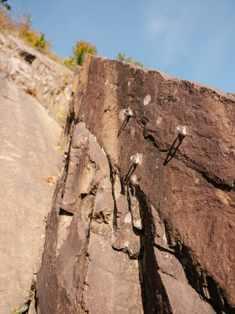

das Klettern aus Naturschutzgründen nur in den markierten Bereichen erlaubt ist? Um den Felskopf zu schützen und zu verhindern, dass sich Steine lösen, ist nur ein seitlicher Ausstieg erlaubt.
Als die Männer später beschwingt nach Hause gehen, hat jeder neben dem Namen des anderen auch zahlreiche Einfälle im Kopf. Und dazu den Vorsatz, sich zu dem Thema mit einigen Menschen auszutauschen. Manfred Hoh berichtet auf dem Bürgerstammtisch vom Gedanken, unten an der Lenne am steilen Hang des Remmelshagen, Kletterfelsen einzurichten. Er erzählt von dem jungen Mann mit seinen Kontakten zum DAV Gummersbach und von dessen Elan angesichts dieses ungewöhnlichen Einfalls. „War da nicht auch mal ein Denkmal oberhalb der Felsen? “, fragt einer aus der Runde. „ Ja“, sagt ein anderer. „ Dort könnte man auch eine Aussichtsplattform einrichten“, sagt ein anderer.
Doch zunächst macht sich die Idee des Kletterfelsens auf den Weg. In den nächsten Monaten finden viele Gespräche dazu statt. Der Bürgerstammtisch setzt sich mit der Stadt in Verbindung. Die freiwillige Feuerwehr und Mitglieder des DAV Gummersbach begutachten die Hänge. Alle zusammen tauschen sich aus, was konkret passieren müsste, um an den attraktiven Felsen Kletterlinien einzurichten. Tatsache ist: Die Idee begeistert so, dass alle an einem Strang ziehen.

Tatsache ist aber auch: Es ist kein Kinderspiel, den Grauwackefelsen zu einem Kletterfelsen zu machen. Die Stadt Werdohl erteilt zwar alle Genehmigungen, doch der Felsen muss geräumt und geputzt werden. Dabei engagiert sich speziell die Jugendfeuerwehr Werdohl. Im Frühjahr 2002 entfernt sie Bäumchen und Gestrüpp aus Felsspalten, reinigt die Wand mit Hochdruckreinigern von Moosen und Flechten, die beim Auf- und Abstieg gefährlich glitschig werden könnten. Als die Wände vorbereitet sind, beginnen Mitglieder des DAV Gummersbach, an der Lenneplatte Haken für die von Fritz Blach entwickelten Kletterrouten zu setzen. Schließlich sind sie gesetzt und der Kletterspaß kann im Sommer 2002 beginnen. Die Schwierigkeitsgrade liegen zwischen 3 und 8.
Der Bürgerstammtisch Werdohl – immer auch auf die praktische Seite konzentriert –setzt sich dafür ein, dass Bänke und Tische aufgestellt sowie Fahrradständer installiert werden. Oberhalb der Lenneplatte entsteht, ebenfalls mit Unterstützung örtlicher Sponsoren, eine Aussichtsplattform mit schönem Blick den Hang hinab und über die Lenne.
dass
an den fünf Werdohler Felsen an der Lenne steile Plattenkletterei auf Reibung und feinen Strukturen möglich ist und du sie heute über 28 Linien von einfach bis schwierig erklettern kannst?
der Klettersteig an der Denkmalwand (Denkmalsteig) wegen losen Gesteins vorerst abmontiert wurde und somit nicht nutzbar ist?

die Plattform oberhalb der Lenneplatte über einen schmalen, steilen Weg erreichbar ist und du mit einem tollen Ausblick belohnt wirst? Das frühere Denkmal auf dem Remmelshagen existiert heute nicht mehr.
Sie ist über einen schmalen Weg am Anfang der Felsen zu erreichen. Somit ist das begehrte sportliche Ausflugsziel in Werdohl mit einigen zusätzlichen Vorzügen geschaffen – und wird nicht nur von den Einheimischen und den Mitgliedern des DAV Gummersbach gerne genutzt. Da hier sogar die Kleinsten ihre ersten Kletterversuche starten können, sind auch Familien regelmäßige Besucher.
Im Laufe der Jahre entsteht jedoch der Wunsch nach weiteren Kletterrouten und größeren Herausforderungen. Da die Lenneplatte bei Weitem noch nicht komplett erschlossen ist, entwickeln die Stadt Werdohl, der Bürgerstammtisch, die Werdohler Feuerwehr und der DAV Gummersbach Anfang 2011 zusammen weitere Linien, über die die Lenneplatte erklommen werden kann. Dieses Mal reichen die Schwierigkeitsgrade bis 7. An der Lenneplatte stehen jetzt 15 Kletterrouten zur Verfügung. Doch damit nicht genug, wird Ende des Jahres 2011 entschieden, zwei östlich benachbarte Felsen ebenfalls zu erschließen: den Lennewächter und die Denkmalwand. Das Team ist inzwischen gut eingespielt und so entstehen weitere Routen, darunter Space Taxi mit Schwierigkeitsgrad 7+ am Lennewächter und der Denkmalsteig mit Schwierigkeitsgrad 8 an der Denkmalwand.
Dies war jedoch nicht der letzte Streich der Partner. Denn einige Jahre später wurden zusätzlich zwei Felsen westlich der Lenneplatte erschlossen: die Neunerplatte und der Lennebrüggler. Es entstanden nochmals neue Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, sodass an den fünf Felsen heute 28 verschiedene Linien geklettert werden können. Damit sind in den letzten Jahren ansehnliche Kletterparcours entstanden, die kostenlos genutzt werden können und sich großer Beliebtheit erfreuen.
Auch ansonsten tat sich viel rund um die Kletterfelsen, beispielsweise im Zuge des Projekts Lennebogen. Der Eschenbestand an der Altenaer Straße musste im Jahr 2020 gefällt werden. Als Ersatz wurden zuletzt junge Bäume gepflanzt, zumeist Arten, die als klimaresistenter gelten. Zudem wurden Bänke und Tische erneuert. Es entstand auch eine Boule-Bahn, die inzwischen ebenfalls mit Bänken und Tisch ausgestattet ist und an der in den Sommermonaten reges Treiben herrscht. Auch die Aussichtsplattform oberhalb der Lenneplatte, die inzwischen etwas in die Jahre gekommen war, wurde renoviert. Heute findest du am neuen Lennebogen auch eine öffentliche WC-Anlage und einen Unterstand als Wetterschutz.
Über den Lennebogen verläuft übrigens auch die Lenneroute – eine Radroute, die von Winterberg über Schmallenberg, Lennestadt, Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena, Nachrodt-Wiblingwerde, Iserlohn-Letmathe und Hagen bis nach Wetter führt. Und so mancher Radler legt hier einen Stopp ein, um zuzusehen, wie emsige Kletterer sich die steilen Hänge hinaufbewegen.
Wusstest du schon, dass die beliebte Lenneroute an den Werdohler Kletterfelsen vorbeiführt und viele Radfahrer hier ein Päuschen einlegen?

Schnupperklettern und Kinderklettern an den Werdohler Felsen Einige Linien an den Werdohler Felsen eignen sich bestens für Einsteiger und Kinder. Zweimal im Jahr gibt es die Möglichkeit zum Schnupperklettern. Zu besonderen Gelegenheiten findet auch spezielles Kinderklettern statt.
Tierischer Tipp: Im Märkischen Sauerland gibt es neben mittlerweile vier Alpakafarmen einige Reiterhöfe, Ziege2go und Kuhkuscheln. Wild kann man in Wildgehege Mesekendahl erleben.

Unterwegs mit den Höhendorf Alpakas vom Hof Hegemann
Man muss sie einfach gernhaben. Friedlich stehen die Alpakas auf einer großen Weide am Hof Hegemann. Der Menschengruppe, die auf sie zugeht, schauen sie freundlich entgegen ohne sich deswegen vom Fressen abhalten zu lassen. Denn neben Schauen und Entspannen ist Fressen mit das Wichtigste in ihrem ruhigen Leben hier im Märkischen Sauerland.
Es ist später Nachmittag an einem dieser schönen Frühsommertage. Heiter bis wolkig, nicht zu heiß, Sonnenschutz dennoch angebracht. Bequeme Laufschuhe an den Füßen, die Kleidung zwiebelmäßig, Hut oder Mütze auf dem Kopf. Am Hof Hegemann in Nachrodt-Wiblingwerde ist eine Alpaka-Wanderung geplant. Vom Gatter aus sind die Tiere auf der Weide zu sehen, ihre Nachbarn sind Ziegen auf der rechten und Pferde auf der linken Seite. Der Besuch des Hofes Hegemann, das erkennt man schnell, wäre ein Erlebnis für sich.
Doch heute geht es um die Alpakas. Obwohl man das so gar nicht sagen kann, denn eigentlich geht es um uns. Um unser Gegenprogramm zum manchmal ganz schön stressigen Alltag, um Entspannung und um Entschleunigung. Und die beginnt bereits, während wir am Gatter stehen und die Tiere beobachten. „ Unsere zwölf Tiere haben alle einen sehr friedlichen Charakter “, berichtet Michael Hegemann, Senior-Chef des Hofs. „ Sie sind perfekt für unsere Wanderungen geeignet.“ Irgendwie sieht man ihnen das an, wie sie da im Grünen stehen, die Köpfe auf ihren langen Hälsen neugierig hin und her bewegen und dann wieder grasen.
Tatsächlich kommen wir schneller in die Entschleunigung als gedacht. Denn für uns gibt es erstmal nichts zu tun, außer zu beobachten „Wir müssen die Alpakas jetzt erstmal zusammenführen und ihnen ihre Halfter anlegen“, erläutert Michael. Die Herde steht inzwischen unter einem Baum in ihrem Gehege. Indem sie eine sicher zehn Meter lange Longe um die Herde spannen, leiten Michael und Malin, eine seiner Mitarbeiterinnen, die Alpakas ganz langsam zu ihrem Unterstand. Dort stürzen sich die Tiere gleich auf das angebotene Futter. Leichtes Spiel für Michael und Malin, sie schließen das Gatter zum Unterstand und wählen in aller Ruhe die Tiere für die Wanderung aus.
Fünf Tiere führen sie schließlich am Halfter, mitten in der Herde, die sich zurück auf die Weide drängelt. Drei weiße, ein dunkles und eins mit dunklem Kopf und hellem Körper. Jetzt geht es also los. Ein bisschen Scheu besteht schon. Auf unserer Seite, nicht seitens der Tiere. Die sind sehr zutraulich, sehr entspannt und ziemlich knuffig. „ Spucken die? “, fragt einer. „ Nein“, antwortet Michael. „Wir haben zwar ein Tier, das manchmal spuckt, wenn es sich bedroht fühlt. Aber das bleibt hier.“ Er deutet mit dem Kopf zur Weide.
Wir machen uns mit den Tieren etwas vertraut. Nehmen sie am Halfter, streicheln ihnen über den Hals. Dann naht der Aufbruch. Den Proviant fürs Picknick tragen wir in unseren Rucksäcken selbst. Alpakas sind keine Lastentiere. In ihrer Heimat Südamerika werden sie für die Wollproduktion gehalten und hier dürfen ihr Leben einfach nur genießen. Und dann geht es los, in einer Hand das Halfter mit dem Alpaka und unter dem anderen Arm die Picknickdecke.
Wusstest du schon, dass
Alpakas in Südamerika schon seit 6000 bis 7000 Jahren domestiziert werden?

die Tiere im Märkischen
Sauerland erst seit ein paar Jahren vertreten sind?

Alpakas wie Schafe einmal im Jahr geschoren werden und ihre Haare zu feinster Wolle weiterverarbeitet werden?
Während das Märkische Sauerland vielerorts von Tälern und steilen Hängen geprägt ist, liegt der Hof Hegemann fast auf einer Hochebene: Die Wege haben keine großen Steigungen, sind angenehm zu laufen. Unser Weg führt uns zunächst über Feldwege, dann geht es hinein in den Sauerländer Laubwald.
Mit einem Alpaka an der Leine ist so eine Wanderung tatsächlich etwas anderes als ein üblicher Spaziergang oder eine Wanderung. Dabei sind wir ja oft in Gespräche vertieft oder wir konzentrieren uns auf die Route, suchen nach dem nächsten Wegweiser, starren auf unser Smartphone. Auf dieser Wanderung ist es anders: Wir führen die Alpakas zwar, aber sie geben das Tempo vor – und das ist gemächlich. Sie schreiten eher, als dass sie gehen. Mit jedem gemeinsamen Schritt schwappt ihre Ruhe mehr auf uns über. Außerdem ist es einfach schön, so ein kuscheliges Wesen neben sich zu spüren.
Wir sind auf unsere Alpakas konzentriert, doch ab und zu rufen wir uns eine Beobachtung zu. Und merken, dass auch die Alpakas untereinander kommunizieren. Von Zeit zu Zeit brummen sie und immer scheint eines der anderen Tiere zu antworten. Wäre interessant zu wissen, was sie sich erzählen. Vielleicht sagt eins „ Mann, habe ich Hunger! “ und ein anderes, weiter vorne, berichtet „ Ich sehe da hinten Gras leuchten.“ Oder ein ängstliches fragt „ Meint ihr, hier gibt‘s Schakale? “, ein mutiges antwortet „ Habe ich hier noch nie gesehen und auch nicht gerochen! “ und ein weiteres sagt „Woher kennst du Schakale, du bist doch in Europa geboren! “ Jedenfalls zaubern sie uns durch ihre drollige Art ein Lächeln aufs Gesicht.
Doch urplötzlich versucht eins der Alpakas, auszubüxen. „ Ho! “ ruft derjenige, der das Tier am Halfter hat. Doch erst der Chef kann das es beruhigen. „ Es hat wahrscheinlich eine ungewohnte Witterung aufgenommen“, erklärt Michael. „Von einem Fuchs vielleicht.“ Weiter geht es für uns alle im gemächlichen Trott unterm hellgrünen Blätterdach über manche Wurzel und manchen Stein. Bis dann tatsächlich nach einiger Zeit am Horizont eine Wiese auftaucht. Nach der angenehmen Kühle des Waldes ist es hier ganz schön warm. Die Alpakas mit ihrem dicken Haar stört das nicht, sie beginnen sogleich zu grasen.


Etwas Ähnliches schwebt uns auch vor, schließlich haben wir unser Picknick dabei. Die Wiese liegt an einem Steilhang, der den Blick in die Landschaft freigibt. Die Sicht könnte zwar klarer sein, doch auch so spürt man die Weite bis zum Horizont. Wir wählen uns ein Plätzchen, breiten unsere Decke aus und schauen, was die einladende Picknickration so hergibt. Die Alpakas bleiben in unserer Nähe: grasend, kauend, brummend, schauend. Wir machen es ihnen nach: wir essen, wir kauen, wir schwatzen und wir schauen. Und erleben zum Abschluss, ganz entspannt, noch einen wunderschönen Sonnenuntergang.
Wusstest du schon, dass Alpakas eine Kamelart sind und sich wie alle Kamele in der Herde am wohlsten fühlen?

Weitere Informationen
Höhendorf Alpakas

Du hast die Wahl. Die inzwischen zwölf Tiere auf dem Hof Hegemann erwarten dich das ganze Jahr zum Beispiel zu folgenden Aktivitäten:

· Alpakawanderungen allein, zu zweit oder für die ganze Familie für die kleine Auszeit in herausfordernden Zeiten
· Gruppenwanderungen mit Alpakas als entspannendes Event für private Anlässe oder Firmenausflüge
· Meet & Greet, um die Tiere einfach mal kennenzulernen
· Motto-Events wie Glühweinwanderungen, St.-MartinsTreffen oder Nikolaus-Besuche für private Gruppen oder Firmenveranstaltungen
Kindergeburtstage mit unvergesslichen Erlebnissen
· Heilpädagogische Angebote

Wusstest du schon, dass Alpakas wegen ihres ruhigen, friedlichen Charakters in Deutschland auch in tiergestützten Therapien zum Einsatz kommen?
Heesfelder Mühle Halver, S. 12-17
Sinnwell, Werner (2015), Die Dorfschulen rund um Halver – Von der Winkelschule zum kulturellen Mittelpunkt, Bell Verlag&Medien
Heesfelder Mühle e.V., www.heesfelder-muehle.de
Heimatverein Halver e.V., www.heimatverein-halver.de
Villa Wippermann Halver, S. 18-23
Heimatverein Halver e.V., www.heimatverein-halver.de
Ulla Turck und Ines Berg als Zeitzeuginnen
Allgemeiner Anzeiger, Archiv 11.7.1996
Archiv Dr. Axel Wippermann, Berlin
Bauernhaus Wippekühl Schalksmühle, S. 24-29
Franz, Karl, Schalksmühle im Wandel der Zeit, in: Der Märker – Heimatblatt für den Bereich der ehem. Grafschaft Mark, 6. Jhrg. 1957, November Heft 11, S. 421-425, Altena 1957
Baukloh, Hermann, Aus dem bäuerlichen Leben unserer Heimat, in: Der Märker –Heimatblatt für den Bereich der ehem. Grafschaft Mark, 6. Jhrg. 1957, November Heft 11, S. 436-437, Altena, 1957
Heimatbund Märkischer Kreis e.V. (Hrsg.), Gemeinde Schalksmühle –Beiträge zur Heimat- und Landeskunde, Altena, 1996
Gundermann, Rita, Der Take-off der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert und seine Konsequenzen für Umwelt und Gesellschaft, in: Agrarmodernisierung und ökologische Folgen: Westfalen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, S. 47-83, Paderborn, 2001
Bruns, Alfred, Zur Agrargeschichte des Südlichen Westfalen, in: Westfälisches
Schieferbergbau- und Heimatmuseum Schmallenberg-Holthausen e.V. (Hrsg.), Bauern im südwestfälischen Bergland, Band 1, S. 11-46, Münster, 2006
Dechenhöhle Iserlohn, S. 44-49
Stefan Niggemann (Hrsg.), Dechenhöhle Erdgeschichten, Müllerdruck, Iserlohn, 2018
Luisenhütte Balve, S. 52-57
Hinz, Frank-Lothar, Die Geschichte der Wocklumer Eisenhütte 1758-1864 als Beispiel westfälischen adligen Unternehmertums, herausgegeben im Auftrag der Freunde der Burg Altena e.V. im Rahmen der Altenaer Beiträge (Band 12) von Rolf Dieter Kohl, Altena, 1977
Maste Barendorf Iserlohn, S. 58-63
Wilhelm Schulte, Iserlohn – Die Geschichte einer Stadt, Iserlohn, 1937
Wilfried Reininghaus, Reinhard Köhne, Berg-, Hütten- und Hammerwerke im Herzogtum Westfalen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Projektinformation der LWL
Städtische Museen Iserlohn
Drahtrollenroute Altena, S. 70-75
Heimatverein Evingsen e.V. WasserEisenLand e.V.
Knopfindustrie Lüdenscheid, S. 82-87
Walter Hostert, Hostert, W.: Geknöpfte Heraldik. Eine Einführung in die Welt der Bilderknöpfe. Lüdenscheider Knopfbuch 1. Teil: Uniformknöpfe: 1. Geknöpfte Heraldik, Lüdenscheid, 1997
Richard Althaus, Knöpfe, Britannia, Zeppeline, in: Lüdenscheid in alter ZeitGeschichte, Bilder, Geschichten, S. 138-147, Lüdenscheid, 1981
Hans Schramm, Die deutsche Knopfindustrie in Geschichte, Volkswirtschaft und Weltwirtschaft, Naunhof-Leipzig, 1921
Peter Herschlein, Der alte Knopf des Dieners, im Blog – Kommission Alltagskulturforschung in Westfalen, online verfügbar unter: www.alltagskultur.lwl.org/de/ blog/der-alte-knopf-des-dieners/, zuletzt abgerufen am 30. November 2023
Gut Rödinghausen Menden, S. 88-93
E. Dössler (Hrsg.), Sauerländische Geschichtsquellen und Forschungen, Band V, Eisenhämmer und Hütten, Iserlohn, 1972
Katja Schlecking, Adelige Unternehmer im geistlichen Staat, in: Westfalen in der Vormoderne, Studien zur mittelalterlichen und vorneuzeitlichen Landesgeschichte, Band 6, Münster, 2010
Franz M. Feldhaus, Zur Geschichte der Drahtseilschwebebahnen, in: Monographien zur Geschichte der Technik, Heft 1, Berlin, 1911
Bleierzgrube Neu Glück Plettenberg, S. 94-99
Johann Diederich von Steinen, Ev. Luth. Pred. zu Frömern ... Westphälische Geschichte mit Kupfern - Das VIII. Stück. Historie der Stadt und des Amts Plettenberg., Lemgo, 1755 - Universitäts- und Landesbibliothek Münster, https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/download/pdf/928762
Anton Overmann, Die Entwickelung der Leinen-, Woll- und Baumwollindustrie in der ehemaligen Grafschaft Mark unter brandenburg-preussischer Herrschaft, Münster (Westfalen), 1909 - Universitäts- und Landesbibliothek Münster,
https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/6341236
Martina Wittkopp-Beine, Wolf-Dietrich Groote, Horst Hassel, Martin Zimmer, Plettenberger Stadtgeschichte Band 4, Von Arbeitswelten Unter- und Übertage, Zimmermann Druck + Verlag GmbH, Balve, 1996
https://www.plettenberg-kultour.de/ http://www.alt-plettenberg.de/
http://plbg.de/chroniken/chronik.htm http://www.plbg.de/bergbau/neuglueck/schantz.htm
https://www.alterbergbau.de/bergwerke/44 -erzbergbau-in-plettenberg
Talsperren Märkischer Kreis, S. 100-105
Otto Intze, Die bessere Ausnutzung der Gewässer und der Wasserkräfte, Auf Veranlassung des Vereins Dt. Ingenieure 1888 in Aachen und Breslau gehaltene Vorträge, Springer, Berlin, 1889
Otto Intze, Entwickelung des Thalsperrenbaues in Rheinland und Westfalen von 1889 bis 1901, Aachen, 1901
C. Wulff, Die Talsperren-Genossenschaften im Ruhr- und Wuppergebiet, Mitteilungen der Gesellschaft für Wirtschaftliche Ausbildung, Neue Folge, Heft 4, Verlag Gustav Fischer, Jena 1908
Der Ruhrtalsperrenverein und die Talsperren des Ruhrgebiets, Zur Erinnerung an die Besichtigung am 29. und 30. Mai 1911 vom Ruhrtalsperrenverein überreicht, Ruhrtalsperrenverein, Essen, 1911
Helmuth Euler, Wasserkrieg : 17. Mai 1943 - Rollbomben gegen die Möhne-, Eder- und Sorpestaudämme, Motorbuch Verlag, Stuttgart, 2007 Ruhrverband, Zeit am/im Fluss – 100 Jahre Ruhrverband, Essen, 2013
Stauanlagenverzeichnis NRW, Stand 13.05.2003
https://www.lwl.org/geodatenkultur/objekt/253777
Meinhardus Mattenschanzen Meinerzhagen, S. 108-113
Günther Brune, Wie Meinerzhagen Wintersportplatz wurde, in Meinerzhagen –Luftkurort und Wintersportplatz im Sauerland, herausgegeben aus Anlass der Fertigstellung der neuen Meinhardus-Schanze, S. 11-31, Meinerzhagen, 1957
Ski-Klub Meinerzhagen, Geschichte unter: https://skiklub-meinerzhagen.de/ verein/ueber-uns/, zuletzt abgerufen am 12. November 2023
Skisprungschanzen-Archiv, Meinerzhagen, unter: https://www.skisprungschanzen.com/DE/Schanzen/GER-Deutschland/NW-Nordrhein-Westfalen/ Meinerzhagen/1021/.htm, zuletzt abgerufen am 12. November 2023
Kletterfelsen Werdohl , S. 120-125
Fritz Blach, Land der tausend Berge – Kletterführer Sauerland, 2013, Halle
Bürgerstammtisch Werdohl

Herausgeber:
Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e.V. | Märkischer Kreis, Bismarckstr. 15, 58762 Altena
Konzeption: Laura Schneider | Herz an Hirn, Hana Beer | FTV, Anja Tröbitz | DICREATE
Text: Sabine Schlüter | Die flotte Feder Layout: Anja Tröbitz | DICREATE
Druck: Märkischer Kreis, Printed in Germany.
www.maerkisches-sauerland.com
Gender-Hinweis:
Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Geschlechter (m/w/d).
Änderungen vorbehalten. Einzelangaben ohne Gewähr.
Stand: Dezember 2024
Fotografen: Michael Kotowski; mit folgenden Ausnahmen:
Linda Nitsch: S.2 (1), S. 48 (1); Stephan Sensen: S. 5 (1) S. 9 (1);
Bernadette Lange: S. 8 (1); Hans Dieter Wurm: S. 8 (1);
MR Fotografie: S. 30 (1), S. 37 (1), S. 38 (2), S. 41 (1), S. 42 (1);
Kreisarchiv des Märkischen Kreises: S. 63 (1), S. 65 (1), S.68 (2), S. 71 (2), S. 80 (1), S. 82 (1), S. 83 (1), S. 84 (1); Heimatverein
Kierspe: S. 76 (1), S. 77 (1), S. 78 (1), S. 79 (1), S. 80. (1);
Sebastian Mark: S. 88 (1), S. 104 (1); Stadt Menden, Museen: S. 92 (1)

www.maerkisches-sauerland.com
Benötigst du Hilfe oder Informationen rund um deinen Ausflug ins Märkische Sauerland?
Dann wende dich für örtliche Informationen als ersten Anlaufpunkt an die touristischen Infostellen. Du vermisst Angebote, Anbieter oder Informationen auf unserer Website? Sende uns dein Anliegen mit entsprechendem Betreff über das Kontaktformular oder an info@maerkisches-sauerland.com.