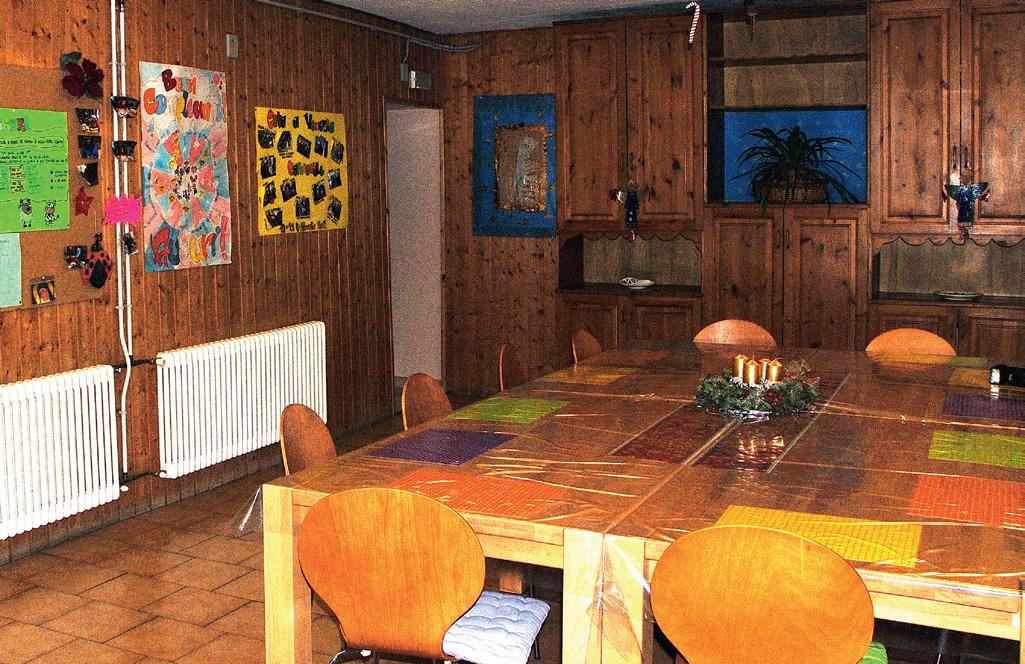8 minute read
Betteln als Arbeit in einer anderen welt Nr.2
I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s so ausschlaggebende Punkte, wie das Erlernen von Fremdsprachen oder die ökonomische Kenntnis hinsichtlich der Orte, weshalb Cortorari das Betteln als Arbeit betrachten. Hinsichtlich der Tätigkeit wird manchmal auch versucht durch gekrümmtes Gehen dem typischen Bild des bettelnden Menschen zu entsprechen. Aufgrund dessen tragen sie beim Betteln außerdem immer dunkle oder
schwarze Kleidung. Umgewandelt in eine andere Persönlichkeit, fernab der gemeinschaftlichen Lebensumstände, wollen sie jedoch nicht von anderen Cortorari-Familien gesehen werden. Um sich wiederzusehen, benötigt es die Heimreise und die traditionell bunten Gewänder.
Advertisement
Julian Kaser
Auch Lena Prossliner berichtet über das Thema „Betteln“ Zwei Artikel über ein Thema, einen Vortrag, hoffentlich inhaltlich so verschieden, dass sie für sich stehen können und sich doch beide ergänzen. Der Ansatz der beiden Artikel wird ziemlich ähnlich sein, denn Julian und ich haben beide Kultur- und Sozialanthropologie studiert und legen daher Wert auf das Hervorheben von Details (die sich in Konzepten bzw. Anschauungsweisen widerspiegeln), durch welche eine Gesellschaft in einem komplexen Hintergrund beleuchtet wird. Diese Anschauungsweisen wurde uns während unseres Studiums wie Mantras wiederholt bzw. eingeflößt. Begging – between Charity and Profession. Reflections on Romanian Roma´s. Begging Activities in Italy, so der Vortrag an der Freien Universität Bozen in Brixen am Mitt
16 woch, den 07/11/2012. Dieser Artikel hält sich strikt an den Vortrag von Catalina Tesar, der durch Ergänzungen von Universitätsprofessorin Elisabeth Tauber zu drei interaktiven, sehr interessanten Stunden wurde. Thema waren die Cortorari-Roma aus Rumänien, über die Catalina Tesar ihr Doktorarbeit verfasst und somit mit ihnen über Monate in deren Dorf gelebt hat. Der Zugang der Forscherin zu den Menschen in diesem Dorf war ziemlich langwierig, da Gadje, nicht-Romas, generell nicht Einlass in die Gemeinschaft der Romas finden. Zehn Jahre hat Catalina dieses Roma Dorf der Cortorari gekannt, bevor sie ihre Feldforschung, also ihren Lebensabschnitt mit der Dorfgemeinschaft, geteilt hat. Diese spezielle Gemeinschaft von Romas werden „Cortorari“ genannt, was sich vom Wort Zelt herleitet. Interes
I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s sant dabei ist, dass sie sich selbst nicht so benennen, sondern der Begriff von den Gadje (nicht-Roma) stammt. Sie selbst bezeichnen sich als „Roma“ und Roma bedeutet auf Romanesch Mensch, d.h. die Definition von Mensch geht von der eigenen Gemeinschaft aus (ethnozentrisches Weltbild). Ein Konzept das weltweit verbreitet ist: das eigene Weltbild und somit Mensch-Sein zu definieren in dem von sich selbst ausgegangen wird um sich gleichzeitig von den Anderen abzugrenzen. Wobei in der Praxis die Grenze zwischen den unterschiedlichen Roma- Gruppen und den so genannten Gadje verschwommen ist: die Ähnlichkeit das Alltagsleben zu strukturieren kann zwischen einer Roma Gemeinschaft und den nicht-Roma Nachbarn (Gadje) größer sein, als bei weit entfernt lebenden Roma Gruppen. Geographisch entfernt lebende Roma-Gruppen haben untereinander oft wenig Ähnlichkeiten. Eine weitere Anmerkung die das Klischee Roma aufbricht ist die Tatsache, dass nicht alle Roma- Gruppen nomadisch sind (so auch die Cortorari). Einige Gemeinschaften sind seit jeher sesshaft, andere halb-nomadisch und wieder andere lebten nomadisch. Anzumerken ist dabei das Handeln der kommunistischen Regierung Rumäniens, die in den 1950er und 1960er Jahren unter anderem durch Deportation zwanghaft die Sesshaftigkeit eingeführte. Um das Betteln der Cortorari Familien in Italien – das das eigentliche Argument der Diplomarbeit und des Vortrags war – zu verstehen, würde uns eine äußerst umfangreiche Einführung in deren gesellschaftliches Leben aufgezeigt, die ich hier kurz wiedergeben möchte. Denn die Summe an Details ist der Zugang zum Verstehen von uns so fremden Lebenspraktiken. Der Zusammenhalt der Cortorari-Gemeinschaft wird durch den Akt der Hochzeit symbolisiert, weswegen es auch keine Lebenspraxis außerhalb der Ehe gibt. Die Cortorarifamilien heiraten untereinander, d.h. es wird kein Ehepartner von außerhalb der Cortorari-Gemeinschaft geehelicht. Als Konsequenz davon wird die Ehe von der Familie arrangiert. Die Hochzeit ist gekennzeichnet durch den Austausch von Geschenken zwischen den Familien, denn die Familie der Frau übergibt mit ihrer Tochter auch noch eine Mitgift. Anhand der Tatsache, dass für die Hochzeit der Töchter Geld aufgebracht werden muss, erklärt sich warum die Geburt von Mädchen weniger erwünscht ist als die von Buben. Da das Heiratsalter zwischen 12 bis 14 Jahren liegt, teilt sich das Leben der Cortorari in Kindheit und Erwachsenenalter. Der Lebensabschnitt der Pubertät, der in unserer post-industriellen Gesellschaft als äußerst wichtig erachtete wird, findet in dieser Gesellschaft keinen Platz. Die bürokratischen Hochzeitspraktiken müssen nicht dem
I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s I n t e r n o s rumänischen Rechtssystem entsprechen. Im Gegenteil, generell wird Wert darauf gelegt Angelegenheiten, Konflikte usw. intern in der Gemeinschaft zu regeln, durch einen Ältestenrat. Sobald Frauen verheiratet sind, tragen sie ein Kopftuch. Für eine Cortorari Frau ist Ehe und die Geburt von Kindern ausschlaggebend, hinzu kommt die moralische Voraussetzung der Jungfräulichkeit vor der Hochzeit, denn diese demonstriert die Ehre der Familie. Priorität in einer Ehe hat es Nachwuchs zu zeugen, erst durch ein Kind wird ein Mann/eine Frau zu einem vollwertigen Mitglied der Cortorari-Gemeinschaft. Der Mann trägt ab der Geburt seines Kindes einen Hut, dieser symbolisiert Respekt und Zugehörigkeit. Zwischen Männern und Frauen im zeugungsfähigen Alter gilt eine strikte Segregation. Ein Merkmal für die Geschlechtertrennung lässt sich an der Nutzung des öffentlichen Raumes erkennen. Diese Trennung würde in unserer Gesellschaft wahrscheinlich als Benachteiligung der Frau gedeutet werden. Hingegen würden die Cortorari-Frauen das anders sehen, da sind sich die beiden Anthropologinnen, Catalina Tesar und Elisabeth Tauber, einig. Dafür spricht, dass Frauen im Alter dem Mann gleichgestellt sind. Durch das enge Verwandtschaftsverhältnis, die das Dorf und somit die Gemeinschaft charakterisiert, gibt es keine Privatsphäre wie wir sie kennen, es gibt keine Trennung zwischen privatem und öffentlichen Leben. Damit einhergehend erklärt sich eine Moralvorstellung in der das Teilen ein Strukturelement der Gemeinschaft wird: nichts gehört ausschließlich einer Person, einer Kernfamilie, genauso wie eine Angelegenheit nicht ausschließlich zwei Personen oder nur die Kernfamilie betrifft. Dieses Teilen, das die Gemeinschaft kennzeichnet, und die durchlässige Nutzung von öffentlichem und privatem Raum sind zwei wichtige Pilaster um die Cortoraris zu verstehen. Die Männer arbeiten als Kupferschmiede, früher wurden die hergestellten Fässer benutzt um den in Rumänien sehr geliebten Pflaumenschnaps zu konservieren, heute finden die Kupferbehälter ihren Absatzmarkt eher unter der urbanen Bevölkerung. Jede Kernfamilie im Dorf begibt sich zudem immer wieder nach Italien um durch Betteln Geld zu erwerben. Es hat Monate gedauert bis sich eine Kernfamilie bereit erklärte Catalina Tesar zum Betteln mit auf die Reise zu nehmen. Keiner wollte die Verantwortung über das Leben der jungen Forscherin übernehmen, denn der zeitlich kurze Abschnitt (maximal 3 Monate) in Italien ist äußerst gefährlich, so wird z.B. im Freien übernachtet. Als sich dann endlich eine Kernfamilie bereit erklärte, gab es für die Forscherin wenig Zeit sich auf diese Reise vorzubereiten, denn die Cortorari planen diese
Fahrt nicht groß im Voraus. Als einzige Vorbereitung kauft man sich schwarze Kleidung, welche im Dorf selbst niemand trägt, bei den Frauen dominieren leuchtende vor allem rote Farbtöne die Alltagskleidung. Dieser Wechsel die traditionellen Kleider mit dem Bettler- Outfit auszutauschen, kann als rituelle Transformation gelesen werden. Noch interessanter wird es, wenn man erfährt, dass niemand im Dorf diesen Wechsel mitbekommen soll. Das geht so weit, dass der Bus die Familie vor der Wohnungstür abholt, denn das Betteln ist mit einem Schamgefühl behaftet. Es wäre peinlich von einer anderen Cortorari-Kernfamilie in schwarzer Kleidung erkannt zu werden, daraus erklärt sich auch die strenge Trennung der Bettel-Gebiete in Italien. Diese physische Entfernung von der Gemeinschaft demonstriert sich nicht nur in der schwarzen Kleidung, sondern auch in der Aufhebung des wichtigsten moralischen Prinzips, nämlich das des Teilens. Das Teilen als Handlung definiert die Gemeinschaft, sobald sich ein Cortorari jedoch geographisch davon entfernt, wird diese Moral hinfällig. „Sharing is what you make a moral person“ so Catalina Tesar und durch die Reise nach Italien verändert sich das bzw. fällt dies weg. Jeder und jede Cortorari muss auf sich selbst schauen, das erbettelte Geld wird nicht geteilt und Aussagen wie groß der Tagesertrag war, werden vermieden. Cortorari bezeichnen Betteln als Arbeit im Unterschied zu den meisten von uns, die es in einem karitativen, hierarchischen Kontext lesen. So muss die Kunst des Betteln erlernt werden und ist, wie Catalina Tesar sehr anschaulich schilderte, eine Schwerarbeit: Betteln ist eine physische- (Frauen knien oft über mehrere Stunden vor Kirchen) und eine psychische Arbeit. Es braucht große Erfahrung zum Betteln, der Körper muss einen gewissen Ausdruck vermitteln z.B. der Gang, der stetig der selbe bleiben muss und es ist eine psychische Anstrengung, da Unterwürfigkeit verkörpert werden muss. Wie in vielen Lebensbereichen der Cortorari gilt auch hier das Prinzip „learning by doing“: die Neuanfänger lernen durch Zuschauen und Nachahmen. Für die Forscherin selbst war das eine harte Lernaufgabe. Und wer im Spätsommer des Jahres 2011 in Brixen einer kleinen, blonden „Roma-Frau“ begegnete, könnte Catalina Tesar gesehen haben. Wie Frau Tauber während des Vortrags vermerkte: Achtung, jetzt kommt das worüber wir bis jetzt gesprochen haben, das weit weg war, ganz nahe an uns heran.
Lena Prossliner