TIPPS
Krebsprävention:
Das raten Fachleute

TIPPS
Krebsprävention:
Das raten Fachleute
Die Aussichten sind besser, als viele befürchten

Hohe Präzision
Personalisierte Strahlentechnik
Velotipp Sagenhafte Tour im Gantrischgebiet
Gesund essen Neue Rezepte von Spitzenköchin Aline Born
Für die meisten Krebserkrankungen kennt man die genauen Auslöser nicht. Die bekannten Ursachen lassen sich in vier grosse Gruppen einteilen:
1. chemische Substanzen (zum Beispiel Tabakrauch, Asbest, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel und viele andere).
2. Viren (zum Beispiel humane Papillomaviren, Hepatitisviren oder HIV).
3. Strahlung (zum Beispiel UV-Strahlung oder Strahlung von radioaktiven Materialien).
4. erblich bedingte veränderte Gene (zum Beispiel bei Brust-, Darm- oder Eierstockkrebs).
Ein wesentlicher Faktor für Krebserkrankungen ist aber vor allem das Alter. Meist entwickeln sich im höheren Alter gesunde Körperzellen ohne bekannten Auslöser zu bösartigen Krebszellen – möglicherweise durch ein Zusammenwirken der oben genannten Ursachen oder einfach durch Zufall.

Das Magazin als Podcast hören.
Sprachen: D/E/F

Krebs ist eine Erkrankung, mit der viele Menschen irgendeinmal konfrontiert sind. Die Heilungschancen sind besser, als gemeinhin angenommen wird. Und
die Aussichten verbessern sich
dank neuen
Behandlungsmethoden und Präzisionsmedizin laufend weiter.
male Betreuung (vgl. Story über Bewegung ab Seite 26 und über Ernährung ab Seite 30).
Immer bessere Heilungschancen
Die Heilungschancen für Krebspatientinnen und Krebspatienten haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das University Cancer Center Inselspital (UCI) vereint das Know-how der Krebsforschung, der Diagnostik, der Therapie und der Nachsorge von Krebserkrankungen unter einem Dach. Expertinnen und Experten vieler Berufsgruppen und Fachgebiete arbeiten am UCI Hand in Hand, um Betroffenen und ihren Angehörigen Leistungen auf höchstem Niveau zu bieten. Dank der universitären Verankerung haben Patientinnen und Patienten direkten Zugang zu den innovativsten und schonendsten Diagnose- und Therapieverfahren.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schlüssel für den Behandlungserfolg. An den Tumorboards im Inselspital bringen Fachleute aus allen wichtigen Disziplinen ihre Expertise ein und beurteilen jeden Fall individuell. Behandelt wird dann an einem von 15 spezialisierten Behandlungszentren (siehe Grafik Seite 9). Das systematische Qualitätsmanagement zahlt sich aus: Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat dem UCI höchste Qualität attestiert und ihm das Zertifikat als anerkanntes onkologisches Zentrum vergeben. Die DKG gilt als europaweit führend in der Vergabe von Zertifizierungen.
Personalisierte Therapien
Warum gerade ich? Die Diagnose Krebs löst bei Betroffenen meist eine Art Schock aus. Ängste und negative Gedanken können die Genesung sehr direkt beeinflussen. Im Inselspital werden Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen deshalb umfassend betreut. Neben der medizinischen Behandlung kümmern sich die ärztlichen Teams und die Pflegenden auch um diese Sorgen. Zusätzliche Unterstützung gibt es von den Care Coordinators, der Sozialberatung, der Psychoonkologie und der Seelsorge (vgl. Story auf Seite 32). Darüber hinaus garantieren weitere unterstützende Angebote eine opti-
Innovationen in der molekularen Diagnostik machen Hoffnung auf weitere grosse Fortschritte in der Behandlung von Krebserkrankungen. Weil jeder Mensch und jeder Tumor andere genetische Merkmale weist, wirken sich Krebstherapien unterschiedlich aus. Mithilfe von molekularen Untersuchungen von Tumorgewebe oder Blut können diese individuellen Unterschiede festgestellt werden. Mit diesen Erkenntnissen lassen sich dann personalisierte Therapien gegen das Tumorwachstum durchführen. Dieser Art der Präzisionsmedizin gehört die Zukunft der Krebstherapie.
Viele Fragen und Wissenslücken sind bei Menschen, die an Krebs erkranken, oft ein wesentlicher Stressfaktor. Wir hoffen, dass wir mit dieser Ausgabe des Insel Magazins dazu beitragen, dass Sie Antworten finden.

Cancer-Survivor-Programm Für die wichtige Nachsorge in guten Händen


Rezepte Kochen mit Aline Born
Aktivität Bewegung ist auch bei Krebs wichtig

Reportage Neu geboren am 6. Juli 2022
Die Zahl 1 von 5
So viele Menschen erkranken in der Schweiz bis zu ihrem 70. Lebensjahr an Krebs. Eine von 16 Personen wird infolge einer Krebserkrankung hospitalisiert.
Neurologie
Erkrankungen des Gehirns wie Demenz, Migräne und Hirnschlag haben weltweit zugenommen.
40 bis 50 Prozent dieser Erkrankungsfälle wären potenziell vermeidbar. Der 2023 veröffentlichte Swiss Brain Health Plan setzt die Schweizer Hirngesundheitsstrategie um. Er ist abgestützt auf die Brain-HealthStrategie, die von der WHO und der European Academy of Neurology im Jahr 2022 lanciert wurde.
In diesem Kontext bietet nun die Universitätsklinik für Neurologie im Inselspital als eine der ersten Kliniken weltweit eine Sprechstunde für Hirngesundheit an. Diese richtet sich vor allem an Patientinnen und Patienten mit Beeinträchtigung der Hirnfunktion, mit genetischer Veranlagung oder mit mehreren Risikofaktoren, welche die Lebensqualität beeinträchtigen. Eine individuelle Beratung, die ganzheitliche Prävention und die Verbesserung der Hirngesundheit stehen dabei im Vordergrund.
2 Leserfrage
3 Editorial
5 Inhaltsverzeichnis / In Kürze
Fokus Krebs
6 Grundlagen Krebs
12 Facts & Figures
14 Interview mit Prof. Dr. Jörg Beyer
16 Reportage: Neu geboren am 6. Juli 2022
20 Porträt: Katja Scherz, Radiologiefachfrau
22 Krebstherapie: Bestrahlung & KI
24 Das sagt die Forschung
Gesundheit
26 Bewegung & Krebs
30 Ernährung & Krebs
32 Behandlungsangebote für Betroffene
34 Cancer Survivor
Aus dem Leben
36 Velotipp: Sagenroute Gantrisch
40 Gesund essen: Rezepte von Aline Born
44 10 Fragen an Wetterfee
Sandra Boner
46 Interview mit Prof. Dr. Beat Roth, Urologie
48 Gesagt: Zitate zum Thema Krebs
49 Kolumne von Dr. Marlen Reusser
Titelbild: Bis zu ihrem 59. Lebensjahr war Esther Sommer kerngesund.
Dann wurde bei ihr aus heiterem Himmel eine sehr aggressive Form eines Lymphoms diagnostiziert. Heute gilt die 62-Jährige als geheilt.
30
Ernährung
Dank richtigem Essen Lebensenergie gewinnen
44
Sandra Boner «Ja nicht Dr. Google fragen!»
46 Urologie
Der neue Direktor und Chefarzt


Fast alle Menschen werden irgendwann in ihrem Leben einmal mit der Diagnose Krebs konfrontiert – sei es persönlich, innerhalb der Familie oder im Freundeskreis. Doch wie entsteht diese Krankheit, die in der Gesellschaft noch immer ein Tabuthema ist? Und was bedeutet die Diagnose?
Text: Thorsten Kaletsch
Krebs ist in den industrialisierten Ländern die zweithäufigste Todesursache nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Unter dem Begriff «Krebs» sind bösartige Tumore im Körper zusammengefasst. Tumore sind Geschwulste, die durch ein unkontrolliertes Zellwachstum entstehen. Verantwortlich dafür sind Veränderungen von genetischen Informationen in der Erbsubstanz DNA, sogenannte Mutationen. Informationen in der DNA bestimmen für jede Zelle, wie sie aussieht und welche Aufgaben sie hat. Eine Veränderung der genetischen Information kann dazu führen, dass sich die Zellen unkontrolliert vermehren – und Krebs entsteht. Dafür sind meist Proteine verantwortlich: Ihre Aufgabe ist es, die Zellen wachsen, altern und absterben zu lassen. Wenn sie durch eine Mutation ihre eigentliche Funktion nicht mehr ausüben, kann es zu einem unkontrollierten Zellwachstum kommen.
Viele Risikofaktoren lassen sich vermeiden Doch warum verändern sich die genetischen Informationen in den Zellen? Die Gründe für die Entstehung vieler Krebserkrankungen sind noch nicht ausreichend bekannt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass in vielen Fällen auch der Zufall die Hand im Spiel hat. Spezielle vorbeugende Strategien gibt es nur für wenige Tumorarten, die aber häufig vorkommen. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liessen sich weltweit 30 bis 50 Prozent aller Krebserkrankungen durch allgemeine Vorbeugungsmassnahmen verhindern. Zu den Risikofaktoren, die zum Entstehen von Krebs beitragen können, gehört insbesondere ein ungesunder Lebensstil. An erster Stelle steht dabei der Tabakkonsum, der für rund 20 Prozent aller Krebserkrankungen verantwortlich ist. Eine ungesunde Ernährung mit wenig Früchten und Gemüse und ein erhöhter Alkoholkonsum zählen genauso zu den Risikofaktoren

«Die Beurteilung von Zellen und Gewebe ist für die Diagnostik von Krebserkrankungen entscheidend. In den letzten Jahren konnten wir zahlreiche molekulare Methoden in die Pathologie integrieren, die eine personalisierte Medizin ermöglichen.»
Prof. Dr. Aurel Perren, Direktor und Chefarzt am Institut für Pathologie der Universität Bern
wie starkes Übergewicht, Bewegungsmangel, für die Haut schädliche UV-Strahlen sowie chronische Infektionen und der Umgang mit Chemikalien. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das höhere Alter mit der rein statistischen Zunahme von zufallsbedingten genetischen Veränderungen.
Die genetischen Veränderungen, die zu Krebs führen, treten meistens erst im Laufe des Lebens auf. Trotzdem sind einige erblich erworben: Rund fünf bis zehn Prozent der Krebserkrankungen sind auf eine angeborene Veranlagung zurückzuführen. Von familiärem Krebs spricht man, wenn die Erkrankungen über Generationen hinweg auftreten und schon junge Angehörige befallen. Wer sich aufgrund seiner Familiengeschichte Sorgen wegen eines erhöhten Krebsrisikos macht, lässt sich am besten zu Früherkennungsmassnahmen und vorbeugenden Behandlungsmöglichkeiten beraten.
Symptome und Warnsignale
Im frühen Stadium rufen Krebserkrankungen in der Regel keine Beschwerden hervor. Danach sind die Symptome unterschiedlich. Ein Tumor kann zum Beispiel auf gesundes Gewebe Druck ausüben und so Schmerzen verursachen oder wichtige Körperfunktionen blockieren. Krebs kann aber auch Substanzen freisetzen, welche die Funktion von Organen beeinträchtigen – dabei spricht man vom paraneoplastischen Syndrom.
Es gibt aber zahlreiche Warnsignale, die auf eine Krebserkrankung hinweisen können: zum Beispiel Farbveränderungen der Haut oder der Schleimhaut, Veränderungen von Leberflecken oder Warzen, Knoten in der Brust oder im Hoden, Vergrösserungen oder Verhärtungen der Lymphknoten in den Achselhöhlen, in der Leiste oder am Hals. Anhaltender oder blutiger Husten, chronische
Hauttumorzentrum

Kopf-HalsTumorzentrum
Lungenkrebszentrum
Sarkomzentrum
GIST-Zentrum
Uro-Onkologie und Prostatazentrum
Hämatoonkologisches Zentrum
Weitere Informationen zu den Behandlungszentren: tumorzentrum.insel.ch
Hirntumorzentrum
Gynäkologisches Krebszentrum
Brustzentrum
Endokrine Tumore ENETS Center of Excellence
Bauchzentrum
GTD-Zentrum
Dysplasiezentrum
Zentrum für Kinder- und Jugendonkologie
Forschung: «Wissen gegen Krebs» heisst der Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Die Journalistin berichtet über persönliche und bewegende Geschichten. Sie bringt eine Person mit einer Krebsdiagnose und ein Gegenüber aus der Forschung zusammen.

Podcast «Wissen gegen Krebs» Stiftung Krebsforschung Schweiz
Beraten und unterstützen: Der Podcast «Leben mit Krebs» besucht die Krebsliga. In vier Ausgaben zeigen die beiden Podcasterinnen, was der Verein alles macht. Die Folgen handeln vom Krebstelefon, von jungen Krebsbetroffenen, von Angehörigen und von administrativen Themen, die die Krebsliga beantwortet.

Podcast «Leben mit Krebs», Krebsliga-Edition
Heiserkeit, zunehmende Atemnot oder unerklärte Schluckbeschwerden können ebenfalls Anzeichen einer Krebserkrankung sein. Daneben können Blut im Stuhl oder Urin sowie ungewöhnliche Blutungen oder anhaltende ungewöhnliche Ausscheidungen aus Mund, Nase, Darm oder Harnröhre auf eine Krebserkrankung hinweisen. Weiter gehören eine anhaltende Appetitlosigkeit und ein unerklärlicher Gewichtsverlust sowie neu auftretende Kopfschmerzen, Seh- oder Hörstörungen und Krampfanfälle zu möglichen Symptomen.
Diagnose und Feststellung des Stadiums Wenn die Ärztinnen und Ärzte bei der Untersuchung den Verdacht auf eine Krebserkrankung haben, verschaffen sie sich mit verschiedenen Verfahren der Bildgebung einen Blick ins Körperinnere. Das kann mit Röntgen, Ultraschall, Computer-Tomografie (CT) oder Magnetresonanz-Tomografie (MRT) geschehen. Zur Bestätigung einer Krebsdiagnose braucht es in den meisten Fällen eine Entnahme (Biopsie) und eine mikroskopische Beurteilung des Gewebes. Danach gibt es Tests zur Feststellung des Stadiums der Krebserkrankung. Dabei geht es einerseits um die Grösse und genaue Lokalisation des Tumors, andererseits auch um dessen Ausbreitung auf andere Körperregionen. Für diese Beurteilung braucht es meist auch Bluttests zur Bestimmung der Funktionstüchtigkeit der Leber,
Nieren und allenfalls auch anderer Organe. Gelegentlich wird die Positronen-EmissionsTomografie (PET) zum Aufspüren von Krebs und seinen Metastasen eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein Verfahren aus der Nuklearmedizin, das mit dem Einsatz einer schwach radioaktiv markierten Aminosäure die Darstellung besonders aktiver Tumoranteile erlaubt.
Die Behandlung von Krebserkrankungen wird im Inselspital jeweils am Tumorboard festgelegt. Tumorboards sind Besprechungen von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten, die sich auf die Behandlung von Tumoren spezialisiert haben. Die Erkrankung jeder Patientin und jedes Patienten wird in all ihren Facetten im Rahmen eines solchen spezialisierten Tumorboards besprochen. Aus den Möglichkeiten der Chirurgie, der medikamentösen Behandlung und der Bestrahlung wird die auf den individuellen Fall angepasste optimale Strategie für das diagnostische oder therapeutische Vorgehen erarbeitet.
Personalisierte Therapien bringen Erfolge In den letzten Jahren machte dabei insbesondere die personalisierte Medizin grosse Fortschritte, die man auch Präzisionsmedizin nennt. Sie ist auf spezielle abnorme Veränderungen in der Erbsubstanz eines Tumors
Neuerkrankungen 1 Sterbefälle
1 Neuerkrankungen geschätzt aufgrund der Daten der Krebsregister; ohne nichtmelanotischer Hautkrebs.
Quellen: NKRS – Neuerkrankungen; BFS – Sterbefälle. © BFS 2023
(Genmutationen) zugeschnitten und wirkt weniger auf den gesamten Körper als beispielsweise eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie.
Weil jeder Mensch andere genetische Merkmale in der Erbsubstanz aufweist, wirken sich auch Krebstherapien unterschiedlich auf Patientinnen und Patienten aus. Bei der personalisierten Medizin werden die individuellen Unterschiede mithilfe von molekular-genetischen Untersuchungen von Tumorgewebe oder Blut festgestellt. Diese bilden dann die Basis für personalisierte Therapien. Es können zum Beispiel Gene sein, die für das Tumorwachstum verantwortlich sind. Indem man diese direkt angreift, kann man das Tumorwachstum verlangsamen oder gar stoppen.
Neben den «klassischen» Verfahren bietet das Inselspital auch alle modernen Therapieverfahren der Krebsmedizin an – etwa neue chirurgische Therapien, zielgerichtete Therapien, Antikörpertherapien, Immuntherapien, zelluläre Therapien, Transplantationen, punktgenaue Strahlentherapien, Hyperthermie sowie neue nuklearmedizinische Therapien mit sogenannten Radiopharmaka.
Innovationen in der Pathologie
Die Beurteilung von Zellen und Gewebe ist für die Diagnostik von Krebserkrankungen
«Für das Aufspüren und Bewerten kleinster Veränderungen im untersuchten Gewebe wurde am Institut für Pathologie der Universität Bern kürzlich eine Weltneuheit entwickelt: ein neuer Arbeitsplatz mit dem Namen ‹Pathojet›.»
2016–2020, altersspezifische Rate, pro 100 000 Einwohnerinnen
und für die Festlegung der Behandlungsstrategien von entscheidender Bedeutung. Die Methoden in der Pathologie, der Gewebemedizin, wurden in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Immer mehr molekulare Hightech-Methoden aus dem Forschungsbereich halten in der Diagnostik Einzug. Mit der Digitalisierung der Gewebeschnittpräparate öffnet sich jetzt auch die Türe für den Einsatz künstlicher Intelligenz, um die Arbeit der Pathologinnen und Pathologen zu erleichtern.
Die zentrale visuelle Beurteilung verschiebt sich immer mehr vom Mikroskop zum Computer. Für das Aufspüren und Bewerten kleinster Veränderungen im untersuchten Gewebe wurde am Institut für Pathologie der Universität Bern kürzlich eine Weltneuheit entwickelt: ein neuer Arbeitsplatz mit dem Namen «Pathojet». Dabei handelt es sich um einen ergonomischen Sitz mit einem breiten Sichtfeld. Er lässt sich intuitiv steuern und erlaubt eine schnellere, ermüdungsfreiere visuelle Beurteilung von Zellausschnitten. «Dank dieser Innovation können wir den interdisziplinären Teams mehr und noch zuverlässigere Informationen zur Verfügung stellen», sagt Prof. Dr. Aurel Perren, Direktor und Chefarzt am Institut. «Dadurch verkürzt sich die Wartezeit für Patientinnen und Patienten, und die Sicherheit wird erhöht.»
Neuerkrankungen 2 Sterbefälle
2 Neuerkrankungen geschätzt aufgrund der Daten der Krebsregister; ohne nicht-melanotischer Hautkrebs.
Quellen: NKRS – Neuerkrankungen; BFS – Sterbefälle. © BFS 2023
Genesung

Durch neue und bessere Diagnose-Möglichkeiten und Behandlungsformen haben sich die Überlebens- und Heilungschancen für fast alle Krebsarten markant verbessert. Ein Mass für die Beurteilung der Überlebenschancen ist die sogenannte 5-Jahres-Überlebensrate. Bei vielen Krebsarten haben Patientinnen und Patienten, welche die ersten 5 Jahre nach der Diagnose überlebt haben, gute Chancen auf eine dauerhafte Heilung. Die absolute Überlebensrate sagt aus, wie viele Prozent der Krebspatientinnen und -patienten nach diesen fünf Jahren noch leben.
Text: Thorsten Kaletsch
Überlebens- und Heilungschancen nach Krebsart
Hodenkrebs 97% Schwarzer Hautkrebs 95%
Schilddrüsenkrebs 92% Prostatakrebs 91%
Dünndarmkrebs 71%
Kehlkopfkrebs 70%
Dickdarmkrebs 68%
Gebärmutterhalskrebs 68%
Multiples Myelom 63%
Blasenkrebs 59%
Mundhöhlen- und Rachenkrebs 58%
Leukämien 54% Eierstockkrebs 46%
23% Krebs von Gallenblase und Gallengang 20%
Bauchspeicheldrüsenkrebs 14%
Zahlen
45 000
So viele Krebsneuerkrankungen werden jährlich in der Schweiz diagnostiziert.
17 200
So viele Sterbefälle pro Jahr gibt es in der Schweiz, die durch Krebs verursacht sind.
450 000
So viele Cancer Survivors gibt es in der Schweiz. Das sind Menschen, die mit einer Krebsdiagnose leben oder vom Krebs geheilt sind.
So gross ist der Anteil der Menschen in der Schweiz, die 5 Jahre nach der Diagnose einer Krebserkrankung noch leben. Bei den Frauen sind es 69 Prozent und bei den Männern 67 Prozent.
So gross ist der volkswirtschaftliche Schaden, den Krebserkrankungen im Jahr 2009 in der Europäischen Union verursachten (Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Oxford und des King’s College London).
Auf einen Blick
Brustkrebs: Bei den Frauen in der Schweiz ist der Brustkrebs mit einem Anteil von 32 Prozent die häufigste Form einer Krebserkrankung.
Prostatakrebs: Bei den Männern betreffen 30 Prozent aller Krebserkrankungen die Prostata. Das Prostatakarzinom ist bei den Männern mit Abstand die häufigste Krebsart.
Lungenkrebs: Die dritthäufigste Krebsart in der Schweiz ist der Lungenkrebs. Auf ihn entfallen 11 Prozent aller Krebserkrankungen bei den Männern und 10 Prozent bei den Frauen.
Dickdarmkrebs: Der Anteil des Dickdarmkrebses an den Krebserkrankungen in der Schweiz beträgt bei den Frauen und bei den Männern je 10 Prozent.
Schwarzer Hautkrebs: Das maligne Melanom macht in der Schweiz bei Männern und Frauen je 7 Prozent aller Krebserkrankungen aus.
Gebärmutterkrebs: Bei Frauen betreffen 5 Prozent aller Krebserkrankungen in der Schweiz den Gebärmutterkrebs.
Blasenkrebs: 4 Prozent aller Krebsneuerkrankungen in der Schweiz entfallen auf den Blasenkrebs.
21 Prozent aller Männer, die in der Schweiz infolge einer Krebserkrankung sterben, sterben an Lungenkrebs. Bei den Frauen sterben 18 Prozent an Brustkrebs.
Frauen
Brustkrebs 18%
Lungenkrebs 17%
Dickdarmkrebs 10%
Bauchspeicheldrüsenkrebs 9%
Eierstockkrebs 5%
Übrige Krebsarten 41% Männer
Lungenkrebs 21%
Prostatakrebs 15%
Dickdarmkrebs 10%
Bauchspeicheldrüsenkrebs 7%
Leberkrebs 5%
Übrige Krebsarten 42%
Krebsbehandlungen werden individuell an jede Patientin und jeden Patienten angepasst. Am Tumorzentrum, dem University Cancer Center Inselspital (UCI), kümmern sich verschiedene Berufsgruppen gemeinsam um die Betroffenen. Geschäftsführer Prof. Dr. Jörg Beyer erklärt, was ihn bei seiner Arbeit besonders bewegt und welche Entwicklungen er erlebt hat.
Interview: Peter Rüegg
Herr Beyer, welche Fälle machen Ihnen besonders zu schaffen?
Wenn Krebs junge Menschen lebensbedrohlich trifft, zum Beispiel Eltern, die eben eine Familie gegründet haben. Oder Behandlungen, bei denen ich rückblickend eine nicht optimale Therapievariante gewählt habe.
Warum bewegt Krebs die Gesellschaft so stark?
Weil Krebs immer noch mit Leiden und vorzeitigem Tod verbunden ist. Und Krebs ist häufig. Fast jede Familie in der Schweiz ist betroffen. Wir alle kennen jemanden.
Am Tumorzentrum wird interdisziplinär gearbeitet. Was bedeutet das? Es sind mehrere medizinische Teilgebiete und Berufsgruppen beteiligt. Verschiedene Fachrichtungen bringen ihr Know-how ein und arbeiten gemeinsam an einem Fall. Als Team sind wir besser.
Pro Jahr treten mehr als 4000 Patientinnen und Patienten mit Krebs neu am Tumorzentrum ein. Jeder einzelne Krebsfall wird an «Tumorboards» besprochen. In diesen
Runden sprechen immer mehrere Spezialistinnen und Spezialisten mit einander. Warum macht man das so?
Krebs ist eine komplexe Erkrankung. Und die Krebsmedizin wird immer spezialisierter, was für andere Lebensbereiche auch gilt. Nehmen Sie den
«Menschen mit Krebs können heute länger und mit besserer Lebensqualität leben.»
Fussball: der Goalie, der Stürmer, der Verteidiger – alle sind Spezialisten auf ihren Positionen. Ein richtig gutes Team werden sie erst, wenn sie die Stärken jedes Einzelnen optimal auf den Platz bringen. In der Krebstherapie kann eine einzige Spezialistin oder ein einziger Spezialist nicht das gesamte Fachwissen einbringen. Das geschieht nur in der Expertenrunde. Hier profitieren alle vom Fachwissen der Anderen. Wichtig ist, dass wir uns treffen, uns
absprechen und erst dann eine Empfehlung abgeben. Letztendlich entscheiden aber die Betroffenen, ob sie der Empfehlung folgen möchten.
Die Krebsmedizin untersucht immer präziser das Erbgut von Krebszellen und ergreift dann gezielt Massnahmen, die auf den Krebs einer Person zugeschnitten sind.
Ja, die Kenntnis der Tumorbiologie wird immer wichtiger.
Werden also in Zukunft alle Patientinnen und Patienten personalisiert behandelt?
Das ist schon heute so. Wir passen jede Therapie an die Betroffenen an, also an Körpergrösse, Gewicht, Alter und Lebenserwartung, Geschlecht, Begleiterkrankungen und Gesundheitszustand ebenso wie an die Krebsart und das Stadium des Krebses. Einbezogen wird auch das soziale Umfeld und vor allem, was die Betroffenen selbst wünschen.
Sind die Therapien heute besser als noch vor zehn Jahren?
Ja, Menschen mit Krebs können heute länger und mit besserer Lebensqualität leben. Es gibt erfolgreichere Thera-
Prof. Dr. Jörg Beyer: «Wir haben in der Schweiz das Privileg, dass wir Expertinnen und Experten in fast allen Bereichen haben –selbst für seltene Probleme.»

pien, mit besserer Kontrolle. Bei vielen Krebsarten sind Heilungen möglich, im Durchschnitt bei knapp einem Drittel aller Erkrankungen. Die Therapien sind zudem verträglicher geworden. Schwere Komplikationen sind viel seltener als früher.
Im Bereich der Diagnostik gab es dank der Bildgebung ebenfalls wichtige Entwicklungen. Wo sehen Sie die grössten Fortschritte?
Für mich an erster Stelle in der Kernspintomografie: Sie macht es möglich, ohne Strahlenbelastung sehr genau in
das Körperinnere zu blicken. Zweitens möchte ich die interventionelle Radiologie erwähnen, bei der Kolleginnen und Kollegen für uns wichtige Gewebeproben aus dem Körperinneren gewinnen, ohne dass dafür ein operativer Eingriff nötig ist. Drittens die PET-CT-Technologie. Damit können wir einen Tumor nicht nur besser erkennen, sondern auch seine Aktivität beurteilen. Das sind für uns wichtige Informationen. Und schliesslich die «Theragnostik»: Dabei werden bei einigen Krebsarten während derselben Sitzung Krebszellen entdeckt und sogleich zerstört.
Wo kann das Tumorzentrum noch besser werden? Bei besonders schutzbedürftigen Menschen. Dazu gehören einerseits junge Erwachsene um die 20 bis 30, die ihr Leben noch vor sich haben. Andererseits alte und sehr alte Menschen Menschen, die möglichst lange selbständig bleiben möchten. Und schliesslich Krebsüberlebende, die mit den Folgeproblemen der Behandlung leben. Auf deren unterschiedliche Bedürfnisse müssen wir noch besser eingehen.

Bis
zu ihrem 59. Lebensjahr war Esther Sommer kerngesund. Dann wurde bei ihr aus heiterem Himmel eine sehr aggressive Form eines Lymphoms diagnostiziert. Chemotherapien schlugen nicht an. Ihre Rettung war eine neuartige Therapie mit körpereigenen, gentechnisch veränderten Immunzellen. Heute gilt die 62-Jährige als geheilt.
Text: Peter Bader
Mittwoch, 6. Juli
Diesen Tag wird Esther Sommer nie mehr vergessen. Sie nennt ihn ihren zweiten Geburtstag. Prof. Dr. Thomas Pabst, Stv. Klinikdirektor und Chefarzt der Universitätsklinik für Medizinische Onkologie im Inselspital, wollte die heute 62-Jährige nicht auf die Folter spannen. Das PET-Röntgen habe keine Zeichen von Restkrankheit mehr gezeigt, teilte er ihr am Telefon mit. Das bedeutete: Die Tumore waren verschwunden. Im Büro, in dem sie arbeitete, hätten sie alle spontan umarmt, erinnert sich Esther Sommer. Aber es war Mittwoch, niemand hatte Zeit, mit ihr diese Erlösung gebührend zu feiern. Das holte sie am darauffolgenden Wochenende nach, mit ihrer heute 26-jährigen Tochter und ihrem Ex-Mann.
«In den Überlebensmodus wechseln» Bis zu ihrer Krebsdiagnose sei sie immer kerngesund gewesen, erinnert sich die in Lyss wohnende Bernerin. Dann stellte sich ihr Leben von einem Tag auf den andern auf den Kopf. Sie habe während der ganzen Behandlung keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen, nicht das Bedürfnis verspürt, sich regelmässig mit jemandem über die Krankheit auszutauschen. «Ich bin eine starke Persönlichkeit und konnte in den Überlebensmodus wechseln. Ich wurde von
meinem innigsten Wunsch angetrieben, so schnell wie möglich in ein normales und gesundes Leben zurückzukehren.»
Dorthin war es, trotz allem, ein langer und beschwerlicher Weg.
Am Anfang steht ein Haushaltsunfall. Esther Sommer stürzt von einem Stuhl, ihr Rücken schmerzt und verfärbt sich grün und blau. Diagnostiziert wird ein eingeklemmter Nerv. Trotz vieler Therapien bessert sich der Zustand des Rückens nicht. Acht Monate später stellt man bei ihr eine Darmentzündung fest. Die Hausärztin macht sich Sorgen wegen der aussergewöhnlichen Schmerzen, die Esther Sommer verspürt, und ordnet ein CT-Röntgen an. Nach einer Biopsie und einem PET-Röntgen wird bei ihr schliesslich ein 7 x7 cm grosses Lymphom unten an der Wirbelsäule diagnostiziert. Dazu muss man wissen: Lymphozyten, die zu den weissen Blutkörperchen zählen, wehren normalerweise Krankheitserreger ab. Im Lymphsystem durchziehen sie den ganzen Körper, um Viren und Bakterien zu bekämpfen. Bei einem Lymphom vermehren sich die Lymphozyten jedoch unkontrolliert und können aggressive Tumore bilden. Bei Esther Sommer wird ein aggressiver Typ eines B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphoms dia-
gnostiziert, eine sehr bösartige Form eines Lymphoms.
«Der Moment der Diagnose war einer von zwei Momenten, in denen ich wirklich Angst hatte», erinnert sich Esther Sommer. Eine Assistenzärztin macht ihr kaum Hoffnung. Professor Markus Borner vom Berner Engeriedspital, bei dem sie in der ersten Zeit in Behandlung ist, macht ihr hingegen Mut und attestiert ihr eine 50-Prozent-Überlebenschance.
Zwei Tage nach der Diagnose beginnt die Therapie. Esther Sommer erhält sechs Zyklen Chemo- und Immuntherapie. Alle drei Wochen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, später am selben Tag. Sie habe alle Therapien im Grossen und Ganzen gut überstanden, blickt sie zurück. Natürlich leidet sie während der Behandlung unter den Nebenwirkungen: Sie habe oft Durchfall gehabt und einen «Panzerbauch». Sie sei häufig schlaflos gewesen, habe sich extra einen TV ins Schlafzimmer gestellt. Zudem habe sie einen metallischen Geschmack im Mund gehabt. Auch muss sie sich nach den Therapien während drei bis fünf Tagen jeweils morgens ein Mittel zum Wiederaufbau der weissen Blut-

«Die CAR-T-Zelltherapie ist ein Meilenstein in der Behandlung von aggressiven Lymphomen. Sie erhöht die Heilungschancen der Patientinnen und Patienten massiv. Zuvor gab es für diese nach einer erfolglosen Chemotherapie oft keine Option auf Heilung mehr – oder nur die Möglichkeit einer hochdosierten Chemotherapie mit Stammzell-Transplantation und massiven Nebenwirkungen. Im Vergleich dazu verläuft die CAR-T-Zelltherapie ausgesprochen schonend.»
Prof. Dr. Thomas Pabst, Stv. Klinikdirektor und Chefarzt Universitätsklinik für Medizinische Onkologie, Inselspital
körperchen spritzen, was bei ihr extreme Knochenschmerzen verursacht. «Beim ersten Mal musste ich mich flach auf den Boden legen und konnte kaum mehr sprechen und atmen.»
Zur Behandlung gehört so auch – nebst vielen anderen Medikamenten – die präventive Einnahme von Schmerzmitteln. Und als ihr die Haare ausfallen, trägt sie eine Perücke. «Ich wollte nicht, dass man auf den ersten Blick erkennt, dass ich krank bin, und dann mitleidig mit mir spricht. Wie gesagt: Ich habe vieles mit mir selbst ausgemacht.»
Die Behandlung schlägt nicht an. Der grosse Tumor verschwindet zwar, allerdings bleiben drei kleine zurück. Eine schlechte Nachricht. Esther Sommer kennt dieses Ergebnis noch nicht, da wird sie vom Sekretariat von Prof. Dr. Thomas Pabst bereits zur ersten Besprechung aufgeboten: Ihr bis dahin behandelnder Arzt, Professor Borner, überweist sie an den Blutkrebs-Spezialisten im Inselspital. Esther Sommer wird davon überrascht und erlebt den zweiten Moment, in dem sie «wirklich Angst hatte»: «Wieder wurde mir schlagartig bewusst, wie endlich das Leben ist.»
Prof. Dr. Thomas Pabst teilt ihr mit, dass fünf weitere Zyklen Chemo- und Immuntherapie und eine zehnmalige Bestrahlung auf sie zukommen. Damit will man Zeit gewinnen, damit sich ihr Gesundheitszustand nicht schnell verschlechtert. Gleichzeitig werde man sie auf die CAR-T-Zelltherapie vorbereiten. Dabei werden körpereigene Immunzellen gentechnologisch so verändert, dass sie gezielt nur noch Krebszellen erkennen und bekämpfen (siehe Box). Am 20. Januar 2022 werden ihr auf der Apherese-Station des Inselspitals Immunzellen entnommen. «Eine ausgesprochen schmerzhafte Prozedur», sagt sie.
Am 14. April 2022 tritt Esther Sommer für einen dreiwöchigen stationären Aufenthalt ins Inselspital zur eigentlichen CAR-T-Therapie ein. Dort werden ihr die veränderten körpereigenen Immunzellen, die sogenannten «Killerzellen», einmalig zurückgegeben. Die Therapie kann hohes Fieber verursachen, manchmal auch vorübergehend zu Verwirrtheit führen. Deshalb ist es wichtig, dass ein hochspezialisiertes, gut trainiertes Team die Patientinnen und Patienten überwacht und schnell eingreifen kann.
Nach Abschluss der CAR-T-Zelltherapie verstreichen zunächst drei Monate, bevor ein erstes PET-Röntgen zur Überprüfung durchgeführt wird. Solange lässt man den CAR-TZellen Zeit, um die Krankheit zu bekämpfen. Am 6. Juli 2022 kommt dann der erlösende Telefonanruf.
Wieder voll leistungsfähig
Da hatte Esther Sommer eigentlich bereits wieder zurück ins Leben gefunden. Während zehn Monaten war sie an ihrem Arbeitsort ausgefallen. Ab dem 1. Juli 2022 nahm sie ihre Arbeit zu 60 Prozent wieder auf, ab dem 1. August arbeitete sie dann wieder Vollzeit. Natürlich habe die Krankheit bei ihr Spuren hinterlassen, sagt sie. Bis heute schlafe
«Ich wurde von meinem innigsten Wunsch angetrieben, so schnell wie möglich in ein normales und gesundes Leben zurückzukehren.»
sie eher schlecht. Der Geschmack von Kaffee habe sich auch verändert, grundsätzlich sei ihr Geruchssinn nicht mehr so gut wie vorher. Und die Angst ist trotz des guten Heilungsverlaufs immer wieder mal präsent: Treten bei ihr Rückenschmerzen auf, versetzt sie das zurück in die Anfänge ihrer Krebserkrankung. Grundsätzlich sei sie aber durch die existenzielle Erfahrung deutlich gelassener geworden. «Ob ich jetzt fünf Kilogramm mehr oder weniger wiege, spielt für mich heute keine Rolle mehr», bemerkt Esther Sommer.
Während der Zeit der Behandlung hat sie viel meditiert. Sie besuchte Yoga-Einzelstunden, spielte nach Möglichkeit Badminton und ging viel spazieren. Für eine gute Energie-Balance begann sie mit regelmässigen Akupunktmassagen, was sie bis heute beibehalten hat. Alle vier Monate muss sie in die Kontrolle. Esther Sommer gilt als geheilt: Sie hat ausgezeichnete Chancen auf eine normale Lebenserwartung.
Esther Sommer gilt heute als geheilt. Sie hat ausgezeichnete Chancen auf eine normale Lebenserwartung.


Bei der CAR-T-Zelltherapie werden Immunzellen gentechnologisch so verändert, dass sie gezielt Krebszellen erkennen und bekämpfen. Dabei werden den Patientinnen und Patienten eigene Abwehrzellen entnommen, im Labor aufbereitet und über eine Infusion wieder zugeführt.
Das Blut besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen Zellen. Ein Teil davon ist eine spezielle Gruppe der weissen Blutzellen: die T-Zellen. Sie sind für die Immunabwehr im Körper zuständig und finden kranke oder defekte Zellen, binden und zerstören sie. Das Problem bei Krebspatientinnen und -patienten: Die T-Zellen sind oft blind für Krebszellen und erkennen sie nicht mehr als Bedrohung. Mithilfe einer gentechnologischen Behandlung können die T-Zellen
im Labor jedoch zu Chimeric-Antigen-Receptor-T-Zellen, kurz CAR-T-Zellen, umgewandelt werden. Sie werden dabei so verändert, dass «chimäre» Antigenrezeptoren auf der Oberfläche gebildet werden. Diese Antigenrezeptoren sind ausschliesslich gegen Oberflächenproteine bestimmter Krebszellen gerichtet. So können die veränderten T-Zellen Krebszellen angreifen und zerstören, während sie gesundes Gewebe in Ruhe lassen.
Das Inselspital ist hierzulande führend in der Anwendung der CAR-T-Zelltherapie. 2019 wurde hier die erste Patientin der Schweiz erfolgreich damit behandelt. Seither wird in der Schweiz jede zweite solche Behandlung im Inselspital durchgeführt.
Esther Sommer war bei Prof. Dr. Thomas Pabst in Behandlung, dem BlutkrebsSpezialisten im Inselspital.Katja Scherz betreut als Radiologiefachfrau seit über 30 Jahren Patientinnen und Patienten an der Universitätsklinik für RadioOnkologie im Inselspital. Im August 2023 wurde bei ihr selbst Brustkrebs diagnostiziert.
Text: Tamara Zehnder

Zusammen mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin ist Katja Scherz an der Universitätsklinik für Radio-Onkologie im Inselspital zuständig für die Planung der Strahlentherapie, für die Bildgebung und die anschliessende Bestrahlung mit einem der hochmodernen Geräte. Ihr Berufswunsch hatte einen familiären Hintergrund: Ihre Mutter erkrankte an Krebs, als Katja 13 Jahre alt war, und verstarb sieben Jahre später. Mit der Ausbildung zur Radiologiefachfrau verarbeitete Katja Scherz das Geschehene.
1991 trat sie ihre Stelle im Inselspital an. Seitdem habe sich die Strahlentherapie – wie auch die Chemotherapie und die Operationstechnik – stark verändert, sagt Katja Scherz. Die Geräte seien komplexer und vielseitiger geworden, Planung und Bestrahlung seien wesentlich präziser – auch dank künstlicher Intelligenz und verschiedenen Verfahren der Bildgebung (siehe auch Story ab Seite 22). «Eine Bestrahlung ist heute nicht mehr das grosse Schreckensgespenst», sagt die 55-Jährige. Nebenwirkungen gebe es nur noch selten, und man kenne die Wechselwirkungen verschiedener Therapien inzwischen viel besser. «Auch die Betreuung ist menschlicher geworden.»
Diagnose Brustkrebs
Im August 2023 wurde bei Katja Scherz im Rahmen des kantonalen Screenings mittels Mammografie Brustkrebs entdeckt. Es war ihre dritte Vorsorgeuntersuchung, bei der man ihr eine nähere Untersuchung empfahl. Schon während des Ultraschalls am Berner Frauenspital erhärtete sich der Verdacht. Das Ergebnis der Stanzbiopsie brachte vier Tage später Klarheit. «Die Zeit der Ungewissheit war am schlimmsten», blickt sie zurück. «Übers Wochenende besuchte ich ausgerechnet noch einen Radio-Onkologie-Kongress. Dabei verfolgte mich nur ein Gedanke: Wie lange lebe ich noch?» Die Therapie habe sie dann erlebt wie einen Aareschwumm: «Der Weg und das Ziel sind klar, nur wie lange es dauert und was man währenddessen erlebt, bleibt ungewiss.»
Sie sei froh, dass ihr Mann und ihre Tochter bei der Eröffnung der Diagnose mit dabei gewesen seien, sagt Katja Scherz. «Meine Tochter ist Pflegefachfrau und freute sich über jeden positiven Wert, der bekannt gegeben wurde.» Sie selbst habe beim Zuhören sehr schnell abgehängt, nachdem klar gewesen sei, dass ihr Mammakarzinom keine Ableger gebildet habe und gut behandelbar sei. «Ich hat-
te sehr viel Glück und die richtigen Leute um mich. Kurz: Ich war am richtigen Ort.»
Zwei Wochen bis zum Therapieabschluss Von der Diagnose bis zum Therapieabschluss dauerte es bei Katja Scherz nur zwei Wochen. Nach einer Bildgebung im MRI wurde sie bereits vier Tage nach der Diagnoseeröffnung operiert, danach erfolgte eine fünftägige Bestrahlung mittels Brachytherapie. Dass es so schnell gehe, sei aber nicht der Regelfall, betont PD Dr. Claudia Rauh, Leitende Ärztin Brustzentrum, Universitätsklinik für Frauenheilkunde im Inselspital: «Brustkrebs ist keine Notfalldiagnose. Unsere Patientinnen können in Ruhe eine Entscheidung treffen.» Normalerweise erfolge die Operation zwei bis drei Wochen nach dem Befund. «Als RadioOnkologie-Fachfrau war Katja aber bereits sehr gut darüber aufgeklärt, was sie erwarten würde, und alle Disziplinen haben in ihrem Fall sehr gut ineinandergegriffen.»
Katja Scherz erinnert sich an die Betreuung im neuen Theodor-Kocher-Haus: «Ich wollte eigentlich nur Patientin sein und auf keinen Fall eine Sonderbehandlung erhalten. Ich merkte aber, dass das für das Personal nicht immer ganz einfach war. Aber die Betreuung war genial, von A bis Z.» Nach Abschluss der Therapie erholte sie sich noch zwei Wochen zuhause und kehrte dann an ihren Arbeitsplatz zurück. Es habe ihr gutgetan, wieder ins bekannte Umfeld zurückzukehren, sagt sie. Um das Risiko eines Rückfalls zu vermindern, absolviert sie nun während fünf Jahren eine Antihormontherapie. Der eingesetzte Aromatasehemmer unterbindet die Östrogenproduktion im Muskel- und Fettgewebe und wirkt zytostatisch, so dass sich allenfalls verbleibende Tumorzellen nicht mehr teilen können. Danach erfolgt eine engmaschige Überwachung im Rahmen der Nachsorge.
Die eigene Erkrankung habe keinen grossen Einfluss auf ihre Arbeit, sagt die Radiologiefachfrau. «Was ich besser nachvollziehen kann, sind die Panikattacken, die einen befallen können. Man hat die Tendenz, jedes Symptom der Krebserkrankung zuzuschreiben, vertraut dem eigenen Körper nicht mehr.» Sie würde sich gerne noch mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten nehmen: «Denn wenn man miteinander redet, kann das vieles relativieren.» Vor ihrer Erkrankung habe sie sich besser abgrenzen können. «Das muss ich jetzt wieder lernen.»

«Das kantonale BrustkrebsScreening rettet Frauenleben. Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser lässt er sich behandeln und desto geringer sind die Nebenwirkungen der Therapie. Das hat auch grossen Einfluss auf die Lebensqualität der Frauen.»
PD Dr. Claudia Rauh, Leitende Ärztin Brustzentrum, Universitätsklinik für Frauenheilkunde im Inselspital
Mit der neusten Generation von Strahlentechnik können Tumore immer schonender behandelt werden. Krebspatientinnen und Krebspatienten profitieren von einer hochpräzisen und personalisierten Strahlentherapie.
Text: Marianne KaiserZur Behandlung von Krebs wird häufig auch das medizinische Verfahren der Strahlentherapie eingesetzt. Dabei konnten in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt werden – unter anderem dank dem Einsatz von Robotern und zunehmend auch von künstlicher Intelligenz (KI). Die Bestrahlung wurde dadurch präziser und gleichzeitig verträglicher. Neben diesen Verfahren, die die Bestrahlungs-Präzision steigern, stehen neuerdings auch innovative Techniken wie die Hyperthermie zur Verfügung, welche die BestrahlungsWirkung erhöhen.
3D-adaptiert durch «Ethos» und Brachytherapie
Seit Sommer 2021 setzt die Universitätsklinik für Radio-Onkologie mit dem «Ethos»-Gerät als Schweizer Pionierin auf KI-unterstützte adaptive Strahlentherapie und hat damit den Weg in Richtung patientenzentrierte, personalisierte Medizin geebnet. Prof. Dr. Daniel Aebersold, Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Radio-Onkologie, beschreibt den Einsatz so: «Eine Behandlung besteht typischerweise aus mehreren Fraktionen (Bestrahlungen), die den Tumor gezielt schädigen und zugleich das gesunde Gewebe maximal schonen sollen.» Allerdings könnten die Organe, insbesondere im Bauch- und Beckenbereich, ihre Position von Tag
zu Tag, manchmal sogar von Stunde zu Stunde leicht verändern, und ihre Grösse könne variieren. Dank dem «Ethos»Gerät lasse sich die Bestrahlung exakt an diese Veränderungen der Lage und an die Grösse der Organe anpassen. Prof. Dr. Daniel Aebersold: «Innerhalb weniger Minuten werden durch 3DBildgebung die genauen geometrischen Verhältnisse von Tumoren und den umliegenden Organen ermittelt und die entsprechende Verteilung der Strahlendosis bestimmt. Mithilfe der KI wird dann sehr schnell ein genaues 3D-Modell erzeugt und ein sehr präziser, tagesaktueller Bestrahlungsplan erstellt.»
Eine weitere Form der Strahlentherapie, die mittels 3D-Bildgebung in jeder Bestrahlung für die aktuelle anatomische Situation optimiert wird, ist die Brachytherapie. Dabei wird eine winzige Strahlenquelle über miniaturisierte Kunststoffschläuche für eine kurze Zeit in den Bestrahlungsbereich eingeführt. Diese sehr schonende Technik wird zum Beispiel bei gewissen Formen von Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs, aber auch bei Lippenkarzinomen eingesetzt.
Robotertechnologie in der Medizin
Eine andere Technologie zur Steigerung der Präzision kommt beim CyberKnife zur Anwendung: Es nutzt eine Kombination aus Robotertechnik und Bildge -
bung, um die Strahlen sehr genau auf den Tumor zu fokussieren und umliegendes gesundes Gewebe zu schonen. Dabei kann der Bestrahlungsroboter selbst kleinste Bewegungen, die während der Bestrahlung auftreten, durch sofortige Korrektur der Einstrahlrichtung kompensieren. Diese Technologie wird insbesondere bei Tumoren eingesetzt, die scharf begrenzt sind und bei denen hohe Einzeldosen gegeben werden können. Man spricht hier auch von einer «Radiochirurgie»: Die Behandlung mit dem CyberKnife ist jedoch keine Operation im herkömmlichen Sinne, da keine

Hochpräzise und personalisiert: Die Bestrahlung mit dem Ethos-Gerät stützt sich auch auf künstliche Intelligenz.

chirurgischen Schnitte gemacht werden. Es handelt sich vielmehr um eine nichtinvasive, hochpräzise Behandlung.
Verbesserte Strahlenwirkung durch Wärme
Wichtig für die Weiterentwicklung der Strahlentherapie ist neben der Erhöhung der Präzision auch die Verbesserung der Wirkung, zum Beispiel bei lokal fortgeschrittenen oder wiederkehrenden Tumoren. Mithilfe der Hyperthermie-Behandlung kann der Tumor mit Mikrowellen lokal auf 39–43°C erwärmt werden. Dadurch werden die Krebszellen empfindlicher für die Wirkung der Bestrahlung, was das Absterben der Tumore fördert. Die Universitätsklinik für Radio-Onkologie setzt Geräte der neuesten Generation ein, die eine individuelle Planung und eine gute Kontrolle der Erwärmung ermöglichen. Dadurch wird eine möglichst schonende Anwendung gewährleistet.
«Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Robotertechnik und Hyperthermie in der Strahlentherapie ist ein Beispiel für die fortschreitende Integration von Hochtechnologie in die Medizin», erklärt Prof. Dr. Daniel Aebersold. «Dabei stehen das interdisziplinäre und personalisierte Festlegen der Behandlungsmassnahmen und die Patientensicherheit stets im Vordergrund.»

«Künstliche Intelligenz und Robotik haben auch in den chirurgischen Disziplinen, namentlich der Neurochirurgie, einen zunehmend grösseren Stellenwert.»
Prof. Dr. Andreas Raabe, Chefarzt und Direktor Universitätsklinik für Neurochirurgie
Bei der 3D-Bildgebung werden dreidimensionale Bilder von Objekten erstellt oder angezeigt. In den medizinischen Bereichen kommen verschiedene Methoden der 3D-Bildgebung zum Einsatz:
Tomografie: Dazu gehören Verfahren wie die Computertomografie (CT) und die Magnetresonanztomografie (MRT), die Querschnittsbilder des Körpers oder von Objekten erzeugen, indem sie Röntgenstrahlen oder Magnetfelder verwenden.
3D-Scanner: Diese Geräte erfassen die Oberfläche von physischen Objekten und erstellen daraus 3D-Modelle. Es gibt zum Beispiel Laser-, Strukturlicht- oder Photogrammetrie-Scanner.
3D-Modellierung und Rendering: Mit Computergrafik-Software werden virtuelle 3D-Modelle von Objekten erstellt. Diese Modelle können dann gerendert werden, um realistische Bilder zu erzeugen.
Stereoskopie: Durch die Aufnahme von zwei leicht unterschiedlichen Bildern und deren Betrachtung durch getönte Brillen oder andere Methoden entsteht ein räumlicher Eindruck.
3D-Visualisierung: Die 3D-Darstellung von CT- oder MRT-Scans ermöglicht eine detaillierte dreidimensionale Betrachtung von Organen oder Geweben, was bei Diagnosen und Behandlungsplanungen hilfreich ist.

Als erstes Spital in der Schweiz führt das Inselspital seit 2019 bei Männern mit metastasiertem Prostatakrebs routinemässig PSMA-Therapien durch. Dabei kommt ein Radioligand zum Einsatz – ein radioaktiv markiertes Peptid (ein kleiner Eiweissbestandteil), das sich an ein Zielprotein auf der Oberfläche einer Zelle bindet. Prostataspezifisches Membranantigen (PSMA) ist ein solches Zielprotein, das auf Zellen des Prostatakrebses besonders häufig vorkommt. In dieser nuklearmedizinischen Therapie werden Liganden gegen PSMA mit einem radioaktiven Metall beladen und in die Blutbahn gespritzt. Mit dem Blut werden sie zu den Herden des Prostatakrebses transportiert, wo sie sich an das PSMA auf der Zelloberfläche der Krebszellen anheften. Auf diese Weise werden die Krebszellen lokal bestrahlt und in ihrem Wachstum gebremst, zum Teil schrumpfen sie sogar. Am Inselspital werden derzeit Radioliganden erforscht, die in Zukunft noch bessere Resultate als bisher verfügbare Präparate erzielen sollen.
Ein internationales Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Biochemie in München und vom Zentrum für Proteinforschung der Universität Kopenhagen hat eine neue Technologie zur Analyse von Krebserkrankungen entwickelt. «Deep Visual Proteomics» stellt Proteinbasierte Informationen zur Verfügung und hilft, Krebserkrankungen unter Auflösung einzelner Zelltypen zu verstehen. Die neue Methodik kombiniert vier verschiedene Technologien: Moderne Mikroskopie liefert hochauflösende Gewebekarten, und mithilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz werden Zellen hinsichtlich ihrer Form, Grösse und Protein-Lokalisierung klassifiziert, wonach einzelne Zellen mittels Laser-Mikrodissektion gesammelt werden. Anschliessend werden tausende von Proteinen innerhalb der Zellpopulationen mittels Massenspektrometrie bestimmt, und mit bioinformatischen Analy sen entstehen Proteinkarten, die bei der Analyse von Krankheiten wie Krebs hilfreich sind.
Am Inselspital wurde im Januar 2019 erstmals in der Schweiz bei einer Patientin mit rezidivierender akuter lymphatischer Leukämie (B-ALL) eine CAR-T-Zell-Therapie durchgeführt. Die damals 25-jährige Patientin ist seither krankheitsfrei geblieben. Die neue Therapie basiert auf körpereigenen, veränderten Immunzellen. Den Erkrankten werden dabei T-Zellen entnommen und ausserhalb des Körpers genetisch so programmiert, dass sie die Krebszellen gezielt und effizient angreifen. Junge Erwachsene mit akuter lymphatischer Leukämie und Erwachsene mit aggressiven Lymphomen oder Myelomen können so behandelt werden, wenn herkömmliche Therapien nicht zur Heilung geführt haben oder versagen. Momentan werden im Inselspital gegen 50 Prozent aller CAR-T-Therapien in der Schweiz durchgeführt. Sie könnten bald auch schon für systemische Autoimmunerkrankungen wie den systemischen Lupus erythematodes (SLE) eingesetzt werden. Es ist eine Therapieform, die an SLE Erkrankten einen möglichen Rückgang der Erkrankung ohne Notwendigkeit, weiter Medikamente einzunehmen, bieten könnte. Das Inselspital nimmt als erstes Zentrum in der Schweiz an einer internationalen Studie zur CAR-T-Zell-Therapie bei SLE teil: Im Februar 2024 wurde hier die erste SLE-Patientin mit dieser neuen Therapieform behandelt.


In der Schweiz erkranken jährlich rund 4500 Menschen neu an Darmkrebs, etwa 1650 sterben daran. Darmkrebs ist die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache weltweit. Jede dritte Person mit Darmkrebs entwickelt im Verlauf der Erkrankung auch Tumore in der Leber (sogenannte Darmkrebs-Lebermetastasen). Diese Tumore wurden in der Vergangenheit durch eine teilweise Entfernung der Leber behandelt. Eine Studie unter Beteiligung eines Forschungsteams des Inselspitals zeigt nun, dass eine gewebeschonende Behandlung mittels Mikrowellen-Sonde eine ebenso hohe Überlebensrate bietet. Die neue Behandlungsform nennt sich Thermoablation. Dabei wird über eine möglichst kleine Einschnittstelle eine Sonde im Tumor platziert. Diese zerstört das Tumorgewebe durch Hitzeeinwirkung (sogenannte Ablation). Für die Studie wurden an drei europäischen Kliniken 98 Patientinnen und Patienten für eine Thermoablation rekrutiert.
8 von 10 Kindern und Jugendlichen werden heute von Krebs geheilt. Junge Überlebende haben jedoch ein erhöhtes Risiko, später kognitive und motorische Probleme zu erleiden. Für eine wirkungsvolle Rehabilitation entwickelt ein Forschungsteam um Prof. Dr. Regula Everts, leitende Neuropsychologin in der Neuropädiatrie am Inselspital, eine spielerische Trainings-App. Im Zentrum steht dabei das Bewusstsein über das eigene Denken und den eigenen Körper. Gesucht werden nun gesunde Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren, die bei der App-Entwicklung dabei sein möchten. Interessierte melden sich über mio-studie@insel.ch.
Eine Studie der Universitätsklinik für Onkologie am Inselspital zeigt für eine neuartige Therapie der akuten myeloischen Leukämie (AML) hervorragende Resultate. Bei dieser Erkrankung des blutbildenden Systems spielen Leukämiestammzellen eine entscheidende Rolle. Der neue Ansatz basiert auf dem Antikörper Cusatuzumab: Nach heutigem Stand der Forschung ist dieser in der Lage, die Neubildung von Leukämiestammzellen aktiv und mit minimalen Nebenwirkungen zu unterbinden. Die zielgerichtete Antikörpertherapie soll dereinst insbesondere bei AML-Patientinnen und -Patienten über 70 Jahre zum Einsatz kommen. Die Strategie, den CD70/CD27-Signalweg zu blockieren, wurde im Labor für Tumorimmunologie am Inselspi tal entwickelt. Das Medikament wurde in Bern getestet und mit der belgischen Firma Argenx weiterentwickelt. Aktuell wird eine randomisierte Studie zum Antikörper Cusatuzumab in Kombination mit der Standard therapie durchgeführt.

«Dank genetischen Gewebeanalysen können wir personalisierte Krebstherapien durchführen. Dadurch sind die Prognosen für Krebspatientinnen und -patienten in den letzten Jahren viel besser geworden.»
Prof. Dr. Adrian Ochsenbein, Direktor und Chefarzt University Cancer Center Inselspital (UCI)
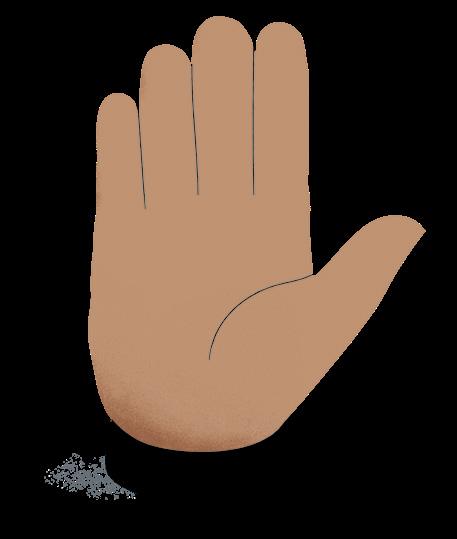

Training im Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi. (Symbolbild)

Krebs und körperliche Aktivität
Körperliche Aktivität stärkt den Körper, die Psyche und das soziale Netzwerk. Diese positiven Effekte sollten sich auch Menschen zu Nutze machen, die an Krebs erkrankt sind.
Text: Tamara Zehnder
«Von körperlicher Aktivität und Sport können alle Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung profitieren. Es gibt nur wenige medizinische Gründe, die körperliche Aktivität im Rahmen der Behandlung kurzfristig einzuschränken.»
Prof. Dr. Matthias Wilhelm, Chefarzt und Ärztlicher Leiter des Zentrums für Rehabilitation & Sportmedizin der Insel Gruppe
Körperliche Aktivität und Sport sind gesund. Wer sich regelmässig bewegt, senkt nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Beschwerden, Diabetes und psychische Probleme. Körperliche Aktivität reduziert nachweislich auch das Risiko, an Krebs zu erkranken – bei gewissen Krebsarten bis zu 50 Prozent. Sport trägt – zusammen mit einer ausgewogenen Ernährung – zu einem gesunden Stoffwechsel und zu einem gesunden Körpergewicht bei. Je weniger fettreiches Gewebe man im Körper hat, desto weniger Hormone werden ausgeschüttet, die das Wachstum von Krebszellen begünstigen. Ein durch Sport gestärktes Immunsystem ist zuverlässiger bei der Bekämpfung von Entzündungszellen und bei der Zellreparatur. Menschen mit einem gesunden Körpergefühl nehmen ausserdem Veränderungen in ihrem Körper früher war, so dass eine allfällige Erkrankung frühzeitig erkannt und behandelt werden kann.
Bleiben Sie fit!
Das Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz empfiehlt gesunden Erwachsenen:
• ein moderates Krafttraining aller grossen Muskelgruppen an zwei oder mehreren Tagen pro Woche
• zusätzliches Ausdauertraining von 150 Minuten pro Woche bei mittlerer Intensität oder 75 Minuten bei hoher Intensität.
Die Krebsliga ermuntert dazu, möglichst täglich mindestens eine halbe Stunde zügig zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Auch sie

empfiehlt, Kraft-, Ausdauer- und Beweglichkeitstraining zu kombinieren, um den gesundheitsfördernden Effekt zu erhöhen.
Sport als Begleittherapie
Diverse Studien zeigen, dass Krebspatientinnen und Krebspatienten die Nebenwirkungen einer Chemotherapie oder einer antihormonellen Therapie besser vertragen, wenn sie regelmässig körperlich aktiv sind. Auch das Risiko für einen Rückfall lässt sich
«Auch das Risiko für einen Rückfall lässt sich bei gewissen Tumoren mit regelmässiger körperlicher Aktivität nachweislich senken.»
bei gewissen Tumoren mit regelmässiger körperlicher Aktivität nachweislich senken. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen zudem davon aus, dass der Verlauf einer unheilbaren Krebserkrankung durch Sport positiv beeinflusst und somit manchmal die Lebenszeit verlängert werden kann. Sport macht nicht nur körperlich fit, er ist auch gut für die Psyche. Wer regelmässig Sport treibt, leidet weniger an depressiven
«Die sechs Wochen Kraft- und Ausdauertraining in der Onko-Reha haben mir gutgetan und Kraft gegeben», berichtet eine 81-jährige Frau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. «Ich habe die Tipps der Physiotherapeutin geschätzt.» Aber sie sei eine Einzelgängerin. Der intensive Austausch der anderen Teilnehmenden habe sie gestört. «Ich möchte die ganzen Geschichten über Krebs nicht hören. Heute trainiere ich deshalb lieber allein.»
Verstimmungen, ist resistenter gegen Stress und Angst, schläft besser und hat ein positiveres Selbstbild.
All diese positiven Effekte helfen, die Herausforderungen einer Krebserkrankung besser zu meistern. Insbesondere die Fatigue, also die dauernde emotionale, geistige und körperliche Erschöpfung, die mit einer Krebserkrankung oder der Therapie einhergehen kann, lässt sich durch regelmässige körperliche Aktivität lindern. Gut gemeinte Ratschläge wie «Du solltest dich schonen und ausruhen» sind für Fatigue-Betroffene nicht hilfreich. Wer kraftlos ist und an Konzentrationsschwierigkeiten leidet, kann durch gezieltes Training – empfohlen sind drei Einheiten pro Woche – die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und das Vertrauen in den eigenen Körper wiederaufbauen.
Wichtiger Teil der Onko-Rehabilitation Bewegungstherapie ist deshalb fester Bestandteil der Onko-Rehabilitation, die bereits während der Therapie beginnen sollte.
Je nach Krebserkrankung, Stadium und Behandlungsphase wird ein Trainingsplan erstellt, der auf die individuellen Voraussetzungen und die Motivation der Betroffenen zugeschnitten ist und die Nebenwirkungen der Therapie mitberücksichtigt.
Hier ist Vorsicht geboten Auf Sport sollte verzichten, wer
• in den letzten 48 Stunden eine Chemotherapie erhalten hat.
• an Gerinnungsstörungen oder Blutungen leidet.
• eine starke Infektion oder ein geschwächtes Immunsystem hat.
• unter Fieber, Übelkeit oder Erbrechen leidet.
• Kreislaufbeschwerden oder Bewusstseinsstörungen hat.
Auch bei Knochenmetastasen und Osteoporose ist erhöhte Vorsicht geboten. Stimmen Sie Ihre sportlichen Aktivitäten immer mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer behandelnden Ärztin ab.
In den regionalen Krebsligen gibt es Krebssportgruppen, die nahtlos an die Bewegungs- und Sporttherapie der onkologischen Rehabilitation ansetzen, so dass Betroffene auch nach der Rehabilitation kontinuierlich ihre Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination verbessern können.
Ratgeber
1. Nicht rauchen
Verzichten Sie auf jeglichen Tabakkonsum. Rauchen ist der wichtigste vermeidbare Krebsrisikofaktor. Rund 90 Prozent aller Lungenkrebs-Fälle werden durch das Rauchen verursacht.
2. Wenig Alkohol
Trinken Sie wenig Alkohol – und nicht täglich. Der völlige Verzicht ist noch besser. Alkohol erhöht das Risiko für Mund-, Rachen-, Kehlkopf-, Speiseröhren-, Brust-, Darm- und Leberkrebs.
3. Viel Bewegung
Bewegen Sie sich täglich während mindestens
30 Minuten. Das senkt das Risiko für Dickdarmund Brustkrebs sowie für Tumore an der Gebärmutterschleimhaut. Bei weiteren Krebsarten wird ein Zusammenhang vermutet (siehe auch Story ab Seite 36).
4. Eine gesunde Ernährung
Meiden Sie kalorienreiche Lebensmittel, die viel Zucker und Fett enthalten. Ideal sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse und Früchte. Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten frisch und möglichst aus regionalen und saisonalen Zutaten zu. Halten Sie den Anteil an rotem Fleisch gering. Das senkt das Risiko für Darmkrebs (siehe auch Story ab Seite 30).
5. Ein gesundes Körpergewicht
Wenn Sie übergewichtig sind, versuchen Sie, Ihr Gewicht zu reduzieren, oder nehmen Sie nicht weiter zu. Das Körpergewicht spielt eine wichtige Rolle bei der Krebsentstehung. Gemäss Studien erhöht starkes Übergewicht das Risiko für mehr als zehn Krebsarten.
6. Guter UV-Schutz
Achten Sie in der Sonne auf ausreichenden Schutz. Verwenden Sie Sonnencrème mit einem hohen UVFaktor und tragen Sie eine Sonnenbrille sowie eine Kopfbedeckung. Die Sonne ist der grösste Risikofaktor für Hautkrebs.

Zu einer gesunden Ernährung gehören frische, saisonale Produkte. Erhältlich zum Beispiel auf dem Berner Wochenmarkt.
Eine optimale Ernährung während der Krebsbehandlung wirkt sich positiv auf den Körper aus: Er wird widerstandsfähiger, und die Krebstherapie wird als verträglicher wahrgenommen. Wichtig dabei: das Erhalten oder Steigern der Muskelmasse und der Körperfunktion.
Text: Marianne Kaiser
Krebs und die damit verbundenen Behandlungen können den Körper stark belasten. Dabei tritt häufig auch eine Mangelernährung auf. Verantwortlich dafür sind verschiedene Faktoren wie der Tumor selbst oder metabolische Veränderungen. Auch Nebenwirkungen der Therapien wie Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Schluckbeschwerden und reaktive Depressionen oder Angstzustände können zu einer Mangelernährung führen.
• G enügend Nahrungsfasern: Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst sind gute Quellen für Nahrungsfasern, die die Verdauung fördern.
• G esunde Fette: Nüsse, Samen, Avocados und fettiger Fisch (wie Lachs) sind gute Quellen für gesunde Fette.
• G enügend Flüssigkeit: Ausreichend Wasser trinken ist wichtig, um den Körper hydriert zu halten. Manchma l kann eine Chemotherapie die Schleimhäute austrocknen, daher ist es besonders wichtig, genügend zu trinken.
• Ausreichend Proteine: Proteine sind wichtig für den Muskelaufbau und die Reparatur des Gewebes. Quellen wie Huhn, Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse sind empfehlenswert.
Tödliche Mangelernährung
Die Mangelernährung kann die individuelle Prognose deutlich verschlechtern. Rund ein Viertel aller Krebspatientinnen und Krebspatienten sterben in der Schweiz an den Folgen der Mangelernährung und nicht unmittelbar an ihrer Krebserkrankung. Es ist deshalb sehr wichtig, periodisch ein Ernährungsscreening durchzuführen, um Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko für Mangelernährung oder mit einer manifesten Mangelernährung rechtzeitig zu identifizieren.
• Portionen und Häufigkeit der Mahlzeiten: Es kann hilfreich sein, kleinere, häufigere Mahlzeiten über den Tag zu sich zu nehmen, falls grössere Mahlzeiten schwer zu verdauen sind.
• Wenig verarbeitete Lebensmittel: Versuchen Sie, stark verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden, die viel Zusatzstoffe enthalten können.
• I ndividuelle Anpassung: Manche Krebstherapien können den Geschmackssinn beeinflussen. Experiment ieren Sie mit verschiedenen Aromen und Texturen, um herauszufinden, was für Sie gut funktioniert.

«Eine frühzeitige, individuelle Anpassung der Ernährung reduziert schwere Komplikationen und die Mortalität und verbessert sowohl die körperliche Leistungsfähigkeit als auch die Lebensqualität bei Krebspatientinnen und -patienten.»
Prof. Dr. Zeno Stanga, Facharzt Ernährungsmedizin Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin und Metabolismus (UDEM)
• Wenig rotes und verarbeitetes Fleisch: Der übermässige Verzehr von rotem Fleisch und verarbeiteten Lebensmitteln, die hohe Mengen an Konservierungsmitteln und Zusatzstoffen enthalten, kann das Risiko für bestimmte Krebsarten erhöhen, insbesondere für Darmkrebs.
• Wenig Alkohol: Übermässiger Alkoholkonsum kann das Risiko für verschiedene Krebsarten wie Mund-, R achen-, Speiseröhren-, Leber- und Brustkrebs erhöhen.
• Kein Tabak: Rauchen verursacht nicht nur Lungenkrebs, sondern auch eine ganze Reihe anderer Krebserkrankungen.
Wohin mit den Fragen, Ängsten und der Ratlosigkeit? Die Diagnose
Krebs ist meist ein einschneidendes Erlebnis, das verunsichern und viele Fragen aufwerfen kann. Begleitend zur Behandlung können
Betroffene am Inselspital deshalb auf ein vielfältiges Unterstützungsangebot zurückgreifen.
Interview: Marianne Kaiser
Die Diagnose Krebs kommt oft unerwartet und kann unterschiedliche Gefühle, Ängste und Fragen auslösen. Was bedeutet die Diagnose genau? Was für eine Behandlung erhalte ich? Wie sehen die Heilungschancen aus, und wie geht es weiter? Fragen über Fragen. Das Inselspital unterstützt Betroffene mit praktischer, psychologischer und seelsorgerischer Hilfe.
Jedem Krebspatienten und jeder Krebspatientin steht eine Cancer Nurse zur Seite. Cancer Nurses sind spezialisierte Pflegefachpersonen, die über das nötige Fachwissen und Einfühlungsvermögen verfügen. Sie bilden eine zusätzliche Brücke zwischen den Patientinnen und Patienten und den medizinischen Fachpersonen und übernehmen Koordinationsaufgaben. Sie nehmen sich Zeit, um zuzuhören, zu informieren und zu beraten – über die Diagnose, die Behandlungsmöglichkeiten, Nebenwirkungen und das persönliche Befinden. Sie ken-
nen die Patientendaten und sind über die geplanten Termine und Behandlungsschritte auf dem Laufenden. Auf Wunsch übernehmen sie die weitere Terminorganisation mit den verschiedenen Stellen.
Psychoonkologie
Psychologische Unterstützung hilft Betroffenen und ihren Angehörigen, die emotionalen, sozialen und psychologischen Herausforderungen, die mit einer Krebsdiagnose und den Folgen der Therapie einhergehen, besser zu bewältigen. Psychoonkologische Fachleute begleiten die Krebsbetroffenen bei allen persönlichen Themen, die sie im Zusammenhang mit der Erkrankung beschäftigen. Sie unterstützen sie zum Beispiel beim Umgang mit einem veränderten Aussehen oder bei der Kommunikation mit Angehörigen und dem Freundeskreis. Auch Gespräche über existenzielle Themen sind möglich. Die psychoonkologischen Betreuungspersonen sind Teil des medizinischen
Behandlungsteams. Je nach Bedarf können Betroffene während der gesamten ambulanten und stationären Behandlungszeit und darüber hinaus begleitet werden.
Das Seelsorgeteam bietet emotionale Unterstützung, spirituelle Begleitung und ein offenes Ohr für Patientinnen und Patienten, Angehörige und das medizinische Personal. Die Seelsorge im Spital kann verschiedene Formen annehmen. Dazu gehören zum Beispiel Gebete, Meditation, Gespräche über Glauben und Spiritualität oder einfach nur ein empathisches Zuhören bei Bedenken und Sorgen – unabhängig von der Weltanschauung und dem religiösen Hintergrund. Auf Wunsch vermittelt das Seelsorgeteam auch Kontakte zu anderen Konfessionen oder begleitet die Suche nach stimmigen Ritualen. Ebenso unterstützt es Krebspatientinnen und Krebspatienten in schwierigen Situationen bei der Entscheidungsfindung.
Die Diagnose Krebs kann Ängste und viele Fragen auslösen. Eine umfassende professionelle Unterstützung ist deshalb wertvoll.

Palliative Care
In der letzten Lebensphase oder bei Erkrankungen, die die Lebenserwartung verkürzen, stehen Betroffene und ihre Angehörigen oft vor herausfordernden Situationen. Häufige Fragen betreffen die Lebensqualität, aber vor allem auch die Vorausplanung: Was kommt auf die Betroffenen zu, welche Erwartungen sind realistisch, was muss vorausgedacht werden? Das interprofessionelle Team der Palliative Care im Spital verfügt zusammen mit den Hausärztinnen und Hausärzten in der Region über viel Erfahrung bei der Beratung und Begleitung. Bei der Palliative Care geht es nicht um das Sterben, sondern darum, aus einer schwierigen Lebenssituation gemeinsam das Beste zu machen. «Möglichst viel Leben trotz schwerer Erkrankung» heisst die Devise. Dafür wird ein Gut- und ein Schlechtwetterplan definiert. Die individuellen Wünsche spielen dabei eine grosse Rolle, aber auch das Bedürfnis nach möglichst viel Sicherheit. Durch eine gemeinsame
«Wie sehen die Heilungschancen aus, und wie geht es weiter? Fragen über Fragen.»
vorausschauende Planung sollen Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen ihren weiteren Weg möglichst selbstbestimmt und mit Vertrauen auch bei «schlechtem Wetter» gehen können. Ein besonderes Angebot ist die Musiktherapie: Musik spricht Menschen unabhängig von Alter, Begabung und kulturellem Hintergrund an. Musiktherapie ist eine ressourcenorientierte, wissenschaftlich fundierte Therapieform, die Betroffene im Umgang mit ihrer Krankheit und bei der Verarbeitung der belastenden Erfahrung individuell unterstützen kann.

«Palliative Care ist nicht der Regen, sondern der Schirm. Es geht hier sehr viel mehr um die Vorausplanung ‹Was machen wir, wenn …› als ums Sterben.»
Prof. Dr. Steffen Eychmüller, Chefarzt Universitäres Zentrum für Palliative Care

Dr. Eva Maria Tinner im Beratungsgespräch mit einem Patienten: Sie hat die CancerSurvivor-Sprechstunde im Berner Inselspital aufgebaut.
In der Schweiz leben rund 6000 Menschen, die im Kindesoder Jugendalter an Krebs erkrankt sind und geheilt wurden. Wirklich gesund sind leider nicht alle.
Text: Tamara Zehnder
Jedes Jahr erkranken in der Schweiz durchschnittlich 250 Kinder unter 14 Jahren an Krebs. Die gute Nachricht: Immer mehr Kinder und Jugendliche überleben. Die 10-Jahres-Überlebensrate ist von 73 Prozent in den Neunzigerjahren auf 87 Prozent gestiegen. Die schlechte Nachricht: 90 Prozent aller Betroffenen sind mit Spätfolgen konfrontiert, die erst Jahre nach der eigentlichen Erkrankung auftreten und die sich erheblich auf ihre Lebensqualität und auf die Lebensdauer auswirken können.
Spätfolgen einer Krebserkrankung
Das Unglückliche daran ist, dass meist nicht die Krebserkrankung an sich verantwortlich ist für die Spätfolgen, sondern deren Therapie. Eine Chemotherapie schädigt potenziell alle Organsysteme, zum Beispiel das Nervensystem, die Nieren oder das Gehör. Eine Bestrahlung kann unter anderem zu einer Schilddrüsenunterfunktion, zu Unfruchtbarkeit und zu einer Schädigung der Gefässwände führen. Am häufigsten zu Schaden kommen Herz und Lunge, was zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall führt. Auch das Risiko für Zweittumore ist erhöht.
Im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne frühere Krebserkrankung ist die Sterblichkeit von Krebsüberlebenden, sogenannten «Cancer Survivors», deutlich erhöht. Abgesehen von den körperlichen Beschwerden leiden Betroffene oft an Konzentrationsschwierigkeiten und Depressionen und an einer chronischen Müdigkeit, der sogenannten Fatigue.

«Die Kinderonkologie versucht, den Betroffenen durch TherapieOptimierung ein gutes Überleben zu ermöglichen und die Nebenwirkungen mit einer Reduktion der toxischen Therapien zu senken. Es ist wichtig, bei Betroffenen und beim medizinischen Personal das Bewusstsein für mögliche Spätfolgen zu steigern.»
Prof. Dr. Rhoikos Furtwängler, Leitender Arzt Kinderonkologie
«Bei ehemaligen Kinderkrebspatientinnen und -patienten setzt der Alterungsprozess 10 bis 20 Jahre früher ein als bei ihren Altersgenossinnen und -genossen. Sie sind also mit 50 etwa gleich krank wie 70-Jährige, stehen aber noch mitten im Leben, haben einen Beruf oder eine Familie», fasst Dr. Eva Maria Tinner die Situation der Cancer Survivors zusammen.
Aufwändige Krebsnachsorge
Dr. Eva Maria Tinner ist pädiatrische Hämato-Onkologin und hat 2018 zusammen mit ihrer ehemaligen Kollegin Prof. Dr. Dr. Maria Wertli die CancerSurvivor-Sprechstunde im Berner Inselspital aufgebaut. Erst mit der steigenden Überlebensrate habe sich die Aufmerksamkeit vermehrt auf die Nachsorge von Krebspatientinnen und -patienten gerichtet, betont sie: «Früher fokussierte man sich auf die Heilung um jeden Preis, während man die Probleme, die durch die Krebstherapie entstehen können, unterschätzt hat.»
In der Schweiz werden ehemalige Kinderkrebspatientinnen und -patienten seit 2007 in der Swiss Childhood
Cancer Survivor Study systematisch untersucht. In enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kinderkrebsregister haben Prof. Dr. Claudia Kühni und Prof. Dr. Nicolas von der Weid am Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) diese national und international einzigartige Kohorten-Studie gestartet. Seither werden mehr als 3500 Überlebende im 5-Jahres-Rhythmus zu ihren Spätfolgen und zur Lebensqualität befragt. Generell berichten die Teilnehmenden von einer guten Lebensqualität; einige schätzen ihre Lebensqualität nach den durchgemachten schwierigen Zeiten sogar höher ein als Gleichaltrige.
Die Langzeitnachsorge-Richtlinien der nordamerikanischen «Children’s Oncology Group» basieren auf Erkenntnissen aus internationalen Studien. Sie geben vor, dass alle erfolgten medizinischen Behandlungen so genau wie möglich dokumentiert werden, wonach dann ein personalisierter Plan für die nötigen Präventivuntersuchungen erstellt werden soll. Die Applikation «Passport for Care» erleichtert das Zusammenstellen der für die Betroffenen relevanten Richtlinien. Mögliche Spätfolgen sollen auf diese Weise so früh wie möglich erkannt und behandelt werden können. Am Inselspital werden nach diesem Prinzip derzeit jährlich rund 30 Cancer Survivors neu in die lebenslange Nachsorge aufgenommen und gemäss Empfehlung dieser Richtlinien betreut.
Gemäss einer Schweizer Studie sind jedoch lediglich 32 Prozent der Childhood Cancer Survivors in eine regelmässige Langzeitnachsorge eingebunden. Sprechstunden wie im Inselspital, die alle notwendigen Disziplinen einbeziehen, bieten nur sieben Spitäler in der Schweiz an. Der Aufwand, der nötig ist, um die Sprechstunden entsprechend den individuellen Bedürfnisse der Survivors zu koordinieren, kann oftmals nur über Drittmittel finanziert werden. In Bern werden die Kosten von der Berner Stiftung für krebskranke Kinder und Jugendliche und vom Verein Bärgüf getragen. Ohne eine spezialisierte Nachsorge besteht das Risiko, dass therapiebedingte Spätfolgen falsch eingeordnet und unzureichend behandelt werden.
 Attraktiver Zwischenhalt auf der Velotour: das Schloss Riggisberg mit seinem Garten.
Attraktiver Zwischenhalt auf der Velotour: das Schloss Riggisberg mit seinem Garten.
 Velotipp
Velotipp
Was geschah mit dem Mann in Hinterfultigen, der im 15. Jahrhundert seine Machtposition ausnutzte? Eine Sage erzählt von seinem Schicksal –sie ist eine von vielen, die sich auf der 64 Kilometer langen Sagenroute im Naturpark Gantrisch per Velo oder E-Bike entdecken lassen.
Text: Martina Hunziker
Fotos: Bern Welcome

Einmal tief durchatmen. Nicht unbedingt, weil der Weg aus dem Rossgraben hinauf nach Hinterfultigen so anstrengend ist – schliesslich helfen die E-Bikes dabei, die Steigung zu meistern. Durchatmen müssen wir vielmehr, weil wir beim Zwischenstopp im Dorf gerade die haarsträubende Sage des brennenden Mannes gelesen haben.
Es waren ungerechte Zeiten, damals im 15. Jahrhundert: Landvögte herrschten über die ländlichen Territorien, liessen Bauern und Gewerbetreibende für sich arbeiten und sackten am Schluss das Geld für die Erträge selbst ein. Aber die Bewohnerinnen und Bewohner von Hinterfultigen waren wehrhaft: Sie räumten ihren Vogt kurzerhand auf ihre eigene Art aus dem Weg. An dieser Stelle dazu nur so viel: Ein Feuer spielte dabei eine wichtige Rolle.
Wir schauen uns um. Wo dieses Feuer damals wohl gebrannt hat? Natürlich sind hier keine Spuren aus diesem lange vergangenen Jahrhundert mehr sichtbar – aber im Kopf spinnt sich die eben gelesene Geschichte noch etwas weiter.
Den Gantrisch immer im Blick Nach Hinterfultigen gelangt sind wir auf der Sagenroute von Schwarzenburg aus. Weitere Einstiege in die Rundtour –oder Ausstiege, wenn die Tour in mehreren Etappen gefahren wird – sind Burgistein und Riggisberg, beide ebenfalls innert 30 Minuten mit Zug oder Postauto ab Bern erreichbar. Auf der 64 Kilometer langen Route erreicht man in regelmässigen Abständen Infostationen, Dörfer, Beizen und Hofläden. Wer Lust auf ein mehrtägiges Abenteu-
er hat, findet unterwegs mehrere schöne Gasthöfe, in denen übernachtet werden kann.
Die Lage des Dorfs Hinterfultigen ist malerisch, auf der einen Seite präsentiert sich die Gantrischkette in voller Pracht, auf der anderen Seite schweift der Blick über das Mittelland bis zum Jura. Ab hier geht es für uns weiter mit einer ersten, rasanten Abfahrt nach Rüeggisberg zur Klosterruine. Die Sagenerzählung ist auch bei diesem Posten nichts für schwache Gemüter: Diesmal geht es um einen kopflosen Mönch. Aber keine Sorge – im weiteren Verlauf der Route erfährt man auch heitere Geschichten. Auf dem Weg durchs Dorf stellen wir unsere E-Bikes kurz ab, um im Lebensmittelgeschäft «Üse Dorfmärit» eine Zwischenverpflegung einzukaufen. Wer den richtigen Wochentag erwischt, kommt sogar in den Genuss von hausgemachten Berlinern (mittwochs), Früchtekuchen (freitags) oder Crèmeschnitten (samstags).
Zum Ursprung des Schwarzwassers Wir radeln weiter, hoch aufs Gschneit, immer mit der thronenden Gantrischkette zu unserer rechten Seite, und dann hinunter nach Riggisberg. Beim Schloss finden wir nicht nur den nächsten Sagen-Posten, sondern auch einen Ort für einen längeren Zwischenhalt: Das Restaurant Brunnen hat eine einladende Gartenterrasse und serviert saisonale, regionale Speisen.
Die Stärkung zahlt sich aus, denn ab Riggisberg geht es hinunter nach Burgistein und Wattenwil und von da langsam, aber stetig durch den Graben


Viele Gelegenheiten für einen Zwischenhalt: sei es an einer Infostation, bei einem Hofladen oder in der Natur.
nach Rüschegg, wo das Schwarzwasser entspringt, ein Nebenfluss der Sense. Bis nach Guggisberg sind es dann noch ein paar bissige Höhenmeter. Die Pause dort ist verdient, und ein kurzer Gang durch das Vreneli-Museum als letzten ErzählOrt lohnt sich. Die restlichen Kilometer zurück nach Schwarzenburg sind eine entspannte Abfahrt, auf der die Gedanken nochmals zur einen oder anderen Geschichte schweifen, die wir an diesem vergnüglichen Tag erfahren haben.

Dauer: 3,5–6,5 Std. reine Fahrzeit, je nachdem ob mit E-Bike oder Velo Strecke: 64 km
Auf-/Abstieg: 1350 m Praktische Infos: E-Bike-Miete ist möglich auf Voranmeldung in Riggisberg, Schwarzenburg, Seftigen und Wattenwil. Div. Restaurants und Hofläden auf der Route (z.T. eingeschränkte Öffnungszeiten).
Markierung: Die Route ist mit der Veloland-Signalisation 99, 74, 4, 37 und 62 ausgeschildert. Die Routenwechsel sind mit dem Logo der Sagenroute Gantrisch signalisiert.
An-/Abreise: Von Bern aus an beliebigen Startpunkt fahren (auch mit ÖV möglich). Kann in Teilstrecken oder ganz zurückgelegt werden.
Bern.com/sagenroute
SAGENROUTE GANTRISCH
Hinter fultigen


Oberbütschel Gschneit
Riffenmatt Parkplat z Rüschegg Kirche
Erlebnisort/Sagen-Posten
Willkommensort
Tavolata mit geröstetem Blumenkohl, Radieschen, Hummus und Peperoni-Chili-Sauce – der Hauptgang des Frühlingsmenüs von Spitzenköchin Aline Born klingt verlockend. Zur Vorspeise gibts eine Erbsensuppe und zum Dessert ein veganes Panna cotta mit Erdbeeren. Wie immer sind die Gerichte für vier Personen berechnet und bestehen aus gesunden, regionalen und saisonalen Produkten.
Text: Thorsten Kaletsch
«Rohe Erbsen sind ein sehr feiner Apéro-Snack – viel gesünder als immer nur Salznüssli», sagt Aline Born beim Zubereiten der Suppe. Sie habe diese «Superidee» in Dänemark kennengelernt. Dann betont sie, dass man Erbsen, Bohnen und Spinat gut auch tiefgefroren kaufen könne. «Oft haben Tiefkühlprodukte mehr Vitamine als frisches Gemüse, das schon ein paar Tage alt ist. Ich jedenfalls habe immer ein paar Packungen als Reserve in der Kühltruhe.»
Für die Suppe verwendet sie neben Erbsen und einer frischen auch eine getrocknete Limette. Diese vor allem im Nahen Osten beliebte Zutat ist inzwischen auch hierzulande vielerorts erhältlich.
Beim Hauptgang kommt Aline Borns absolutes Lieblingsgemüse zum Zug: «Blumenkohl ist so vielseitig – man kann ihn roh essen, im Ofen rösten, Salat oder Püree daraus machen.» Für die Tavolata brauche es zwar ein bisschen Zeit, der Aufwand sei aber überschaubar. Als zusätzliche Beilage (nicht im Rezept) schlägt die Spitzenköchin Kartoffeln vor. Sie hat sich diesmal für «Blaue Schweden» entschieden, eine Pro-Specie-Rara-Sorte. Nach dem Kochen zerdrückt sie diese, damit sie nachher im Backofen mehr Salz und Olivenöl aufnehmen kön-
nen. Den Hummus stellt sie aus Butterbohnen statt aus Kichererbsen her, «weil die Konsistenz cremiger wird und sie mir auch geschmacklich besser gefallen.
Für Suppen und Hummus hat die Bernerin einen speziellen Tipp: Ich bereite meistens grössere Mengen zu und friere einen Teil ein: «So kann man schnell etwas Feines zaubern, auch wenn man mal keine Zeit zum Kochen hat.» Und die Radieschen zum Hauptgang gibt sie gleich mit den Blättern in den Ofen. «Die kann man nämlich auch essen. Und dank dem unterschiedlichen Garpunkt werden sie fast wie Chips.»
Die Erdbeeren zum veganen Panna cotta schmort sie im Ofen. Das mache sie nur, weil der Ofen wegen des Hauptgangs sowieso in Betrieb sei, betont sie. Und weist danach auf den heiklen Umgang mit dem Geliermittel Agar-Agar hin. «Dafür braucht man wirklich eine grammgenaue Waage.» Man könne aber problemlos auch nicht-vegetarische Gelatine verwenden.
Auch diesmal hat sie darauf geachtet, dass die drei Gänge einfach nachzukochen sind. «Ich finde es super, wenn die Leserinnen und Leser meine Rezepte ausprobieren!»
Die Bernerin Aline Born ist gelernte Köchin und diplomierte Hôtelière-Restauratrice HF. Ihr Können verfeinerte sie durch die Zusammenarbeit mit Spitzengastronomen wie Andreas Caminada, Yotam Ottolenghi, Tanja Grandits, Urs Messerli und Domingo S. Domingo. Nach Weiterbildungen zur Barista, KäseAffineuse und Roh-vegan-Spezialistin hat sie das Unternehmen «Nuri» gegründet. Hier stellt sie selbst entwickelte Produkte her, vertreibt Lebensmittel von ausgewählten Lieferanten und bietet Caterings und Koch-Workshops an. Ihre Produkte können über den Nuri-Webshop bestellt werden oder sind am Samstagmorgen auf dem Münstermarkt erhältlich. Aline Born beteiligt sich oft an kulinarischen Pop-ups und ist hin und wieder auch an Märkten ausserhalb von Bern präsent. Für die Herstellung ihrer eigenen Produkte mietet sie sich jeweils in der «Flavour Kitchen» im sitem-Insel-Gebäude ein. nurifood.ch


Zutaten für 4 Personen
1 EL Olivenöl
1 Stk. Zwiebel, gehackt
10 cm Lauchstängel, grob geschnitten
500 g frische, ausgelöste Erbsen oder tiefgekühlte Erbsen
4 dl Gemüsebouillon
1 dl Rahm
1 Stk. getrocknete Limette etwas Salz und Pfeffer
1 Stk. frische Limette
Zubereitung
1. Getrocknete Limette in einer kleinen Pfanne weichkochen, Wasser nicht wegschütten.
2. Zwiebel in Butter andünsten. Erbsen und Lauch dazugeben, kurz mitdünsten, mit Bouillon ablöschen. Aufkochen, ca. 15 Minuten köcheln, bis sie weich sind.
3. Weichgekochte Limette dazugeben. Alles glatt mixen. Mit Salz und Pfeffer und falls nötig mit etwas Limettenkochwasser abschmecken.
4. Mit frischen Limetten servieren.

Hauptgang
Gemüse, ganz im Ofen geröstet
Zutaten für 4 Personen
2 Stk. Blumenkohl, klein
1 Bund Radieschen
5 Stängel Komatsuna-Spinat
30 g Olivenöl
40 g Bratbutter
4 EL Kapern
½ TL Salz
Zubereitung
1. Ofen auf 175 °C vorheizen.
2. Eine grosse Pfanne mit Salzwasser zum Kochen bringen. Den ganzen Blumenkohl mit dem Kopf nach unten in das Wasser geben und je nach Größe 6–9 Minuten kochen lassen. Er sollte fast gar sein.
3. Die Bratbutter und das Olivenöl in einem kleinen Topf zu einem Ölgemisch schmelzen, Kapern und Salz beigeben.
4. Den Blumenkohl aus dem Wasser nehmen und in einem Sieb abtropfen lassen.
5. Radieschen, Komatsuna-Spinat und Blumenkohl in eine flache Auflaufform geben. Das Ölgemisch über das Gemüse giessen und vorsichtig mischen. 20 Minuten rösten.
6. Radieschen und Komatsuna-Spinat herausnehmen und warm stellen. Blumenkohl 10–15 Minuten weiterrösten, bis er goldbraun und knusprig, aber innen noch weich ist.
Dau passen: Kartoffeln oder Sauerteigbrot.
Zutaten für 4 Personen
200 g getrocknete Butterbohnen (über Nacht eingeweicht)
½ TL Natron
75 ml Eiswasser
125 g Tahini
1–1½ TL Kräutersalz, z.B. Trocomare
½ Stk. Knoblauchzehe, geschält und zerdrückt
1¼ Stk. Zitrone (Saft davon)
¼ TL Kreuzkümmel
Zubereitung
1. Butterbohnen abgiessen, mit dem Natron in reichlich Wasser aufkochen. Butterbohnen weichkochen. Aufsteigenden Schaum abschöpfen. Wenn die Bohnen ganz weich sind, abgiessen.
2. Zerdrückte Knoblauchzehe, Butterbohnen, Tahini, Kräutersalz und Zitronensaft in einem Mixer pürieren. Währenddessen das Wasser beigeben. So lange mixen, bis eine cremige, homogene Paste entsteht. Mit Kräutersalz und Kreuzkümmel abschmecken.
3. 30 Minuten stehen lassen, mit etwas Olivenöl und geröstetem Sesam anrichten.
Zutaten für 4 Personen
350 g gegarte Peperoni aus dem Glas
½ Stk. Knoblauchzehe
½–1 TL Chiliflocken
1 EL Ahornsirup
½ TL Kreuzkümmel
1 EL Zitronensaft
3 EL Olivenöl
1 TL Salz
1 TL Paprika
1 Zweig Thymian
Zubereitung
1. Thymianblätter abzupfen und auf die Seite legen.
2. Peperoni aus dem Glas nehmen und abtropfen lassen. Paprika, Knoblauch, Chiliflocken, Ahornsirup, Kreuzkümmel, Thymian, Zitronensaft, Olivenöl und Salz in einen Mixer geben und glatt pürieren.
3. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für 4 Personen
300 g Erdbeeren
1 EL Ahornsirup
1 EL Limoncello
1 EL Orangensaft
Zubereitung
1 EL Zitronensaft
1 KL Vanillezucker
1 Zweig Rosmarin etwas Orangenabrieb
1. Erdbeeren gut waschen, vierteln und beiseitelegen.
2. Alle Zutaten bis auf die Erdbeeren in einer Pfanne miteinander vermischen. Erdbeeren beigeben und mit Deckel verschliessen.
3. Im vorgeheizten Backofen bei 175 °C 12–15 Minuten garen. Rausnehmen und abkühlen lassen.
mit Tonkabohnen
Zutaten für 4 Personen
400 g Kokosnusscrème, z.B. Thai Kitchen Coconut Cream
10 g Tonkabohnenzucker oder ersatzweise Vanillezucker
20 g Zucker
0,75 g Agar-Agar, ersatzweise 1½ Blatt Gelatine eingeweicht Garnitur: etwas Granatapfelkerne, etwas Minze
Zubereitung
1. Kokosnusscrème, beide Zuckerarten und Agar-Agar unter ständigem Rühren aufkochen und 2–3 Minuten köcheln lassen. Masse in Silikonförmchen oder in Gläschen giessen und im Kühlschrank 2 Stunden kühl stellen.
2. Panna cotta aus den Silikonformen stürzen oder im Glas lassen. Mit den Erdbeeren, Granatapfelkernen und (Nuri-) Knuspermüsli servieren. (Für die Variante mit Gelatine alle Zutaten bis auf die Gelatine aufkochen. Gelatine beigeben und glattrühren.)
1. Sie haben vor 5 Jahren eine BrustkrebsErkrankung überstanden. Welches ist die prägendste Erinnerung?
Der Schock bei der Diagnose. Ich habe mich selber wie in einem Film betrachtet und gedacht: Unmöglich, dass das mir passiert!
2. Welchen Ratschlag geben Sie Betroffenen?
Ja nicht im Internet nach Antworten suchen und Dr. Google fragen! Jeder Mensch und jeder Krankheitsverlauf ist anders!
3. Wann waren Sie das letzte Mal im Spital?
Vor einem Monat, als mein Sohn sich beim Handballspielen die Nase gebrochen hatte.
4. Welche «Sünden» gönnen Sie sich?
Ab und zu ein Bier an einem schönen Anlass.
5. Wie achten Sie heute auf Ihre Gesundheit?
Zu wenig! Ich bewege mich viel im Alltag, nehme die Treppe statt den Lift, laufe schnell, habe kein Auto, dafür ein Fahrrad. Und ich trinke jeden Morgen einen Ingwer-Tee – vor allem weil ich ihn gern habe und nicht weil er gesund ist.
6. Wann haben Sie das letzte Mal geweint?
Heute Morgen auf dem Fahrrad wegen dem Fahrtwind. Mir geht es im Moment so gut, dass ich eigentlich nur vor Freude weine.
7. Wie entspannen Sie sich?
Auf dem Sofa, mit einer warmen Decke und einem Buch. Im Moment lese ich «Lichtspiel» von Daniel Kehlmann.
8. Wovon träumen Sie?
Wenn ich nachts träume, dann von Familienferien am Meer. Am liebsten etwas nördlich, in der Bretagne zum Beispiel. Wunschträume habe ich keine.
9. Würden Sie Ihre Organe spenden?
Ja, selbstverständlich. Ich weiss allerdings nicht, ob sie noch gut genug sind.
10. Was passiert, wenn wir sterben?
Unsere Körper bleiben in anderer Form erhalten, im Universum geht nichts verloren. Und in irgendeiner Form leben wir auch weiter – und sei es nur in Erzählungen oder Gedanken jener, die sich an uns erinnern. Ansonsten würde ich gerne auf einer Wolke sitzen und mit meinem verstorbenen Vater jassen.
Sandra Boner (49) arbeitet seit 2002 als Wettermoderatorin beim Schweizer Fernsehen. Als Mädchen wollte sie Krankenschwester werden. Der Tod machte ihr dann aber zu grosse Angst, so dass sie nach dem Gymnasium eine Ausbildung zur Ergotherapeutin absolvierte. Danach arbeitete sie während acht Jahren in einem Schulheim. In dieser Zeit sammelte sie bei einem lokalen Sender erste TV-Erfahrungen. Sie ist Mutter zweier Söhne (13, 14) und lebt mit ihrer Familie in Solothurn.

Beat Roth, neuer Leiter der Universitätsklinik für Urologie im Inselspital: «Am häufigsten behandeln wir Nierensteine. Sie sind die Folge eines zunehmend ungesunden Lebensstils.»

«Für mich ist es ein
Prof. Dr. Beat Roth ist neuer Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Urologie im Inselspital und ordentlicher Professor für Urologie an der Universität Bern. Im Interview spricht er über das Klischee, ein MännerArzt zu sein, über den Zusammenhang zwischen Herz- und Potenzproblemen, seine Forschung zum Blasenkrebs und die Vorzüge des Inselspitals.
Interview: Peter Bader
Herr Roth, was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit als Urologe am meisten?
Beat Roth: Dass ich Patientinnen und Patienten von A bis Z betreuen kann –also von der ersten Konsultation über die Diagnose und die Operation oder Therapie bis zur Nachsorge. Das ist in keiner anderen Disziplin möglich.
Haben Sie deshalb diesen Fachbereich gewählt?
Nein, das war Zufall. Ich brauchte dringend ein Dissertationsthema und fand eines in der Urologie. Danach wollte ich eigentlich gar nicht Urologe werden, die innere Medizin interessierte mich mehr. Als Assistenzarzt verschlug es mich im Spital Olten aber dann doch auf die Urologie-Abteilung, wo es mir den Ärmel reingezogen hat.
Eigentlich, so besagt ein gängiges Klischee, ist der Urologe ein Arzt für Männer. Ist da was dran?
Nein, gut 30 Prozent unserer Patientinnen und Patienten sind Frauen. Die Urologie kümmert sich ja nicht nur um die männlichen Geschlechtsorgane, zum Fachgebiet gehören auch Harnleiter, Harnblase oder Niere.
Was behandeln Sie am häufigsten?
Nierensteine – Tendenz nach wie vor steigend. Genauso wie Fettleibigkeit, Diabetes oder Bluthochdruck sind sie die Folge eines zunehmend ungesunden Lebensstils und einer ungesunden Ernährung. Männer sind deutlich häufiger betroffen, was aber nicht nur auf die Lebensumstände zurückzuführen ist. Das muss auch geschlechtsspezifische Gründe haben, die wir noch nicht kennen.
Sind auch Potenzprobleme häufig?
Ja, wir gehen davon aus, dass bis zu 70 Prozent der Männer solche erektilen Dysfunktionen haben. Häufig sind diese natürlich nur leichtgradig. Im Penis finden sich die gleichen Gefässe wie im Herzen, nur sind sie viel empfindlicher. Wenn sie «verkalken», kann es zu erektilen Problemen kommen. So sind diese häufig Vorzeichen für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Der Urologe muss betroffene Patienten also oft zum Kardiologen schicken. Patienten tun sich allerdings sehr schwer damit, solche Probleme anzusprechen.
Prostatakrebs ist bei Männern die häufigste Krebsart. Für die Vorsorge ist es also wichtig, dass Männer sich trauen und zum Arzt gehen.
Ja, ab 50 Jahren sollte man zumindest zum Hausarzt gehen. Gibt es Verwandte, die an Prostatakrebs erkrankt sind, sollte man es schon ab 45 tun. Weil es im Stadium, in dem man den Krebs noch therapieren könnte, leider keine Anzeichen gibt. Gängige Symptome wie vermehrter Harndrang in der Nacht oder Brennen beim Wasserlösen sind nicht aussagekräftig. Meist ist der Prostatakrebs jedoch wenig aggressiv, nur wenige Betroffene brauchen eine aktive Behandlung in Form einer Operation oder Bestrahlung.
Blasenkrebs, eines Ihrer Spezialgebiete als Forscher, ist deutlich aggressiver.
Ja, Blasenkrebs ist sehr aggressiv. Das häufigste und erste Symptom ist Blut im Urin, in diesem Stadium ist er durchaus noch heilbar. Wachsen die Tumore aber schon in die Blasenwand, können
die Heilungschancen deutlich schlechter ausfallen. Männer sind fast dreimal häufiger betroffen als Frauen.
Wo liegt Ihr Forschungsschwerpunkt?
In den vergangenen Jahren kamen viele neue Therapien zum Blasenkrebs auf den Markt. Allerdings weiss man noch nicht genau, welche Therapien bei welchen Tumorarten und welchen Patientinnen und Patienten am besten wirken. Zu diesem Zweck züchten wir kleine Blasen mit Tumorzellen im Reagenzglas und testen verschiedene Therapien.
Seit 2005 haben Sie immer wieder im Inselspital gearbeitet und hier auch Ihre Ausbildung zum Facharzt absolviert. Geht für Sie mit der Ernennung zum Klinikdirektor Urologie ein Traum in Erfüllung?
Als kleiner Assistent hätte ich das nicht gedacht, es war damals auch nicht mein Ziel. Es ist sicher emotional, für mich ist es ein Nachhausekommen.
Was zeichnet die Urologie-Klinik am Inselspital aus?
Gerade bei der Erforschung und Behandlung des Blasenkrebs hat sie international einen ausgezeichneten Ruf. Zudem profitieren die Patientinnen und Patienten insbesondere mit schweren Erkrankungen von der Expertise anderer Fachrichtungen. Auch erhalten sie bei uns eher Medikamente, die es vorerst nur im Rahmen einer klinischen Studie zur Erforschung neuer Behandlungsmethoden gibt.
«Durch meine Krebserkrankung wurde ich Mitglied in einem Eliteclub, dem ich lieber nicht angehören würde.»
Gilda Radner, US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin (1946–1989)
«Nicht zu verstummen, wenn dir oder anderen Leid geschieht, ist ein wesentlicher Trost.»
Ingrid Streicher, österreichische Buchautorin
«Trost ist, die Dinge so sehen zu wollen, wie sie nicht sind.»
Erhard Blanck, deutscher Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler
«Krebspatienten, die ihr Schicksal nicht akzeptieren, die nicht lernen, damit zu leben, zerstören nur die wenige Zeit, die ihnen noch bleibt.»
Ingrid Bergman, schwedische Schauspielerin (1915–1982)
«Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.»
Cicely Saunders, Begründerin der modernen Hospizbewegung, Pionierin der Palliativmedizin (1918–2005)
«Die Diagnose Krebs hat mir wirklich die Augen geöffnet für die Tatsache, dass jeder daran erkranken kann und dass wir, obwohl wir glauben, die Kontrolle über alles in unserem Leben zu haben, dies nicht tun.»
Sheryl Crow, US-amerikanische Rockmusikerin
«Krebs beginnt und endet mit dem Menschen. Diese eine elementare Tatsache wird bei aller wissenschaftlichen Abstraktion zuweilen vergessen.»
June Goodfield, britische Historikerin und Buchautorin
Was hat Krebs mit gesundem Menschenverstand zu tun? Und warum gibt es heute mehr Krebserkrankungen als vor 100 Jahren? Neben der Forschung und der Weiterentwicklung
der Therapien wäre es sinnvoll, das Augenmerk auf die Basis zu legen – einen gesunden Lebensstil.
Text: Marlen Reusser | Illustration: gavinonline.ch
Der menschliche Körper besteht aus Milliarden von Zellen. Unser gesamtes Gewebe und alle unsere Organe sind aus diesen winzigen Bausteinen aufgebaut. Zellen sind Funktionseinheiten: Im Zusammenschluss übernehmen sie vielerlei Aufgaben. Sie bilden zum Beispiel Haut, einen Fingernagel, einen Muskel oder einen Knochen. Dank dem Erbgut, der DNA, kennen sie ihre Aufgabe: Sie haben die Information, mit welchen Zellen sie sich zusammenschliessen, wann sie sich teilen und vermehren müssen, aber auch, wann sie absterben müssen. Jeder Zelltyp verfügt über spezifische Anweisungen. Das Ganze funktioniert wie ein hochkomplexer Ameisenhaufen.
Für Krebserkrankungen sind immer einzelne Zellen verantwortlich. Dass bei Milliarden von Zellen auch Fehlfunktionen auftreten können, ist nicht verwunderlich. Normalerweise werden die fehlbaren Zellen aber von unserem Immunsystem abgeräumt. Das Immunsystem ist unsere körpereigene Abwehr gegen solche Fehlfunktionen. Wenn sich die entarteten Zellen aber immer stärker verändern und unkontrolliert zu teilen beginnen, können Knoten oder Wucherungen entstehen, die wir als Tumore bezeichnen. Menschen, die Immunsuppressiva nehmen müssen, sind daher einem höheren Risiko ausgesetzt, an Krebs zu erkranken.
In den letzten 100 Jahren haben die Krebserkrankungen weltweit massiv zugenommen. Seit 1970 haben sich zum Beispiel

Dr. Marlen Reusser (32) ist seit 2017 Profi-Radsportlerin. Die Emmentalerin ist Vize-Olympiasiegerin, zweifache Vize-Weltmeisterin und Europameisterin im Zeitfahren und wurde 2020 und 2021 zur Schweizer Radsportlerin des Jahres gewählt.
Empfehlungen
Podcast zu Ernährung und Krebsrisiko
WDR-Podcast «Frag dich fit»
die Zahlen in Deutschland verdoppelt. Und Forschende der Universität Washington gehen davon aus, dass die Krebsdiagnosen in den nächsten 40 Jahren weiter signifikant zunehmen werden. Das hat sicher auch mit der höheren Lebenserwartung zu tun, denn im Alter steigt das Risiko, an Krebs zu erkranken, deutlich an. Aber selbst wenn man diesen Faktor und die bessere Diagnostik aus der Statistik herausrechnet, bleibt die Zunahme frappant.
Dass Krebs dermassen auf dem Vormarsch ist, hat auch mit unserem Lifestyle zu tun. Speziell bei Lungen- oder Dickdarmkrebs gibt es viele Risikofaktoren, auf die wir Einfluss haben – zum Beispiel das Rauchen, den Alkoholkonsum, die Ernährung, aber auch die mangelnde Bewegung. Eine Rolle spielen zudem die Umweltverschmutzung, der Feinstaub und die Gifte, die wir als «Pflanzenschutzmittel» auf unsere Felder bringen.
Ich, die ich auf einem konventionellen IP-Bauernbetrieb aufgewachsen bin, kaufe zum Beispiel bewusst biologische Lebensmittel. Ich tue dies für die Umwelt, aber auch für meine Gesundheit. Denn ich finde es wichtig, dass wir neben der Forschung und der Weiterentwicklung der Krebsbehandlungsformen auch an der Basis ansetzen: Indem wir alle bessere Rahmenbedingungen für mehr Gesundheit und Zufriedenheit schaffen. Das hat für mich viel mit gesundem Menschenverstand zu tun.
Das nächste Insel Magazin erscheint im Herbst 2024.

Gene, Hormone, Immunsystem: Bei Frauen ist vieles anders als bei Männern. Und diese Unterschiede sind entscheidend. Es gibt viele frauenspezifische Leiden und Krankheiten sowie auch Themen wie Schwangerschaft und Geburt. Deshalb ist es wichtig, dass es die Frauenmedizin gibt, die Frauen spezifisch behandelt.
Herausgeberin: Insel Gruppe AG, Bern.
Konzept und Kreation: Stämpfli Kommunikation, Bern. Projektleitung und Koordination: Simon Schmid (Insel Gruppe), Chiara Mori (Stämpfli Kommunikation), Thorsten Kaletsch (textatelier.ch).
Redaktionsleitung: textatelier.ch, Biel.
Fachliche Beratung: Prof. Dr. Daniel Aebersold, Prof. Dr. Jörg Beyer (beide Insel Gruppe).
Redaktion: Marianne Kaiser, Peter Rüegg, Fabienne Schöpfer, Tamara Zehnder (alle Insel Gruppe), Peter Bader, Denise Fricker, Martina Hunziker, Lisa Jakob, Thorsten Kaletsch (textatelier.ch).
Art Direction: Michael Dürig (Insel Gruppe), Benjamin Scheurer (Stämpfli Kommunikation).
Layout: Marc Marbach (Insel Gruppe).
Illustrationen: Alice Kolb, Gavin Patterson.
Fotografie: Pascal Triponez, Janosch Abel (beide Insel Gruppe), Manu Friederich, Michele Di Fede, iStock, Stocksy, Shutterstock.
Gesamtherstellung: Stämpfli Kommunikation, Bern.
Auflage: 125 000 Exemplare.
Erscheint zweimal jährlich.
Kontakt: magazin@insel.ch.
Copyright: Insel Gruppe AG.

«In Notfällen ist kein Platz für Emotionen. Sie kommen danach.»
Severin, Teamleiter Pflege
Unsere Standorte
inselgruppe.ch