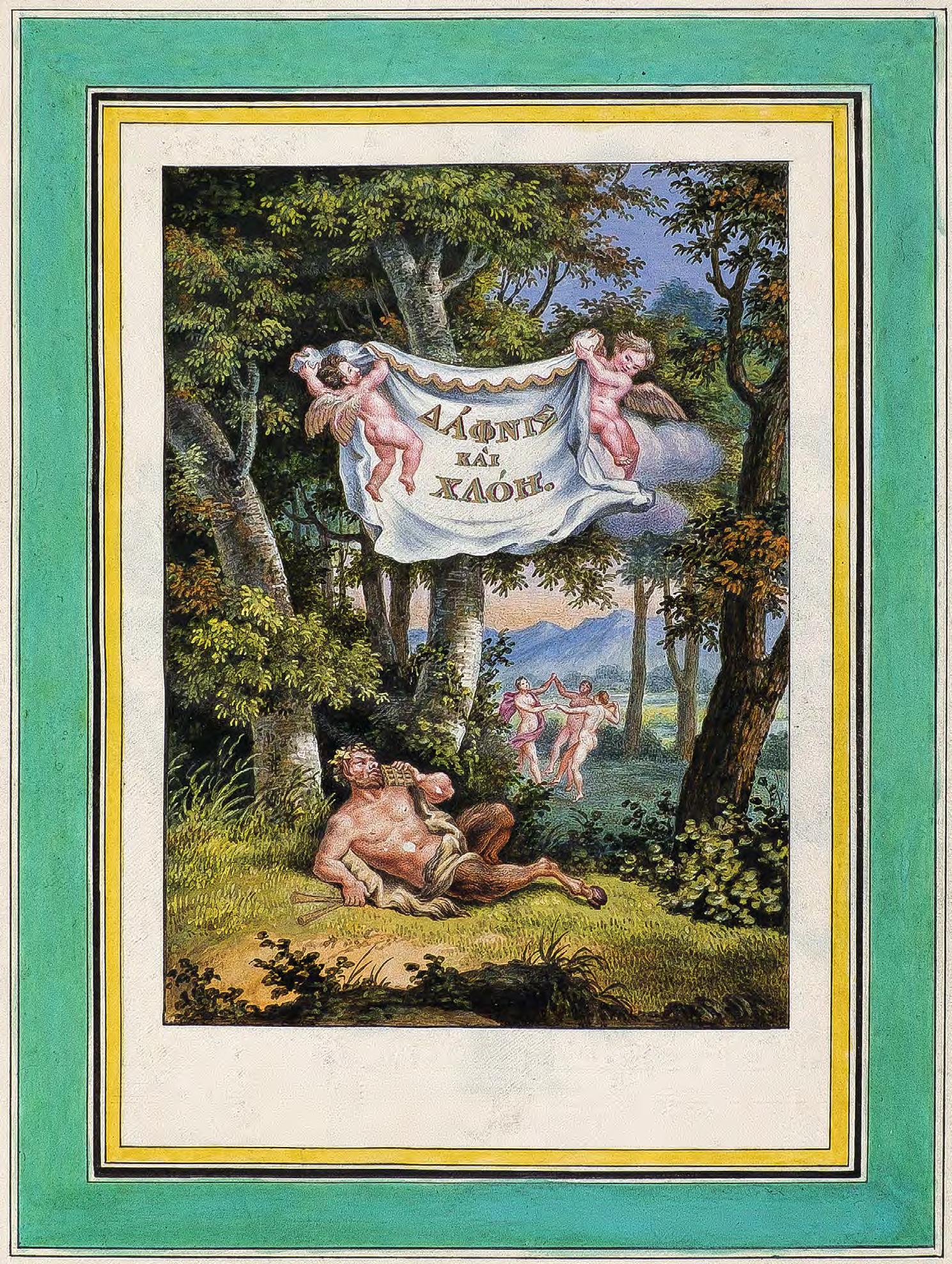Daphnis et Chloé
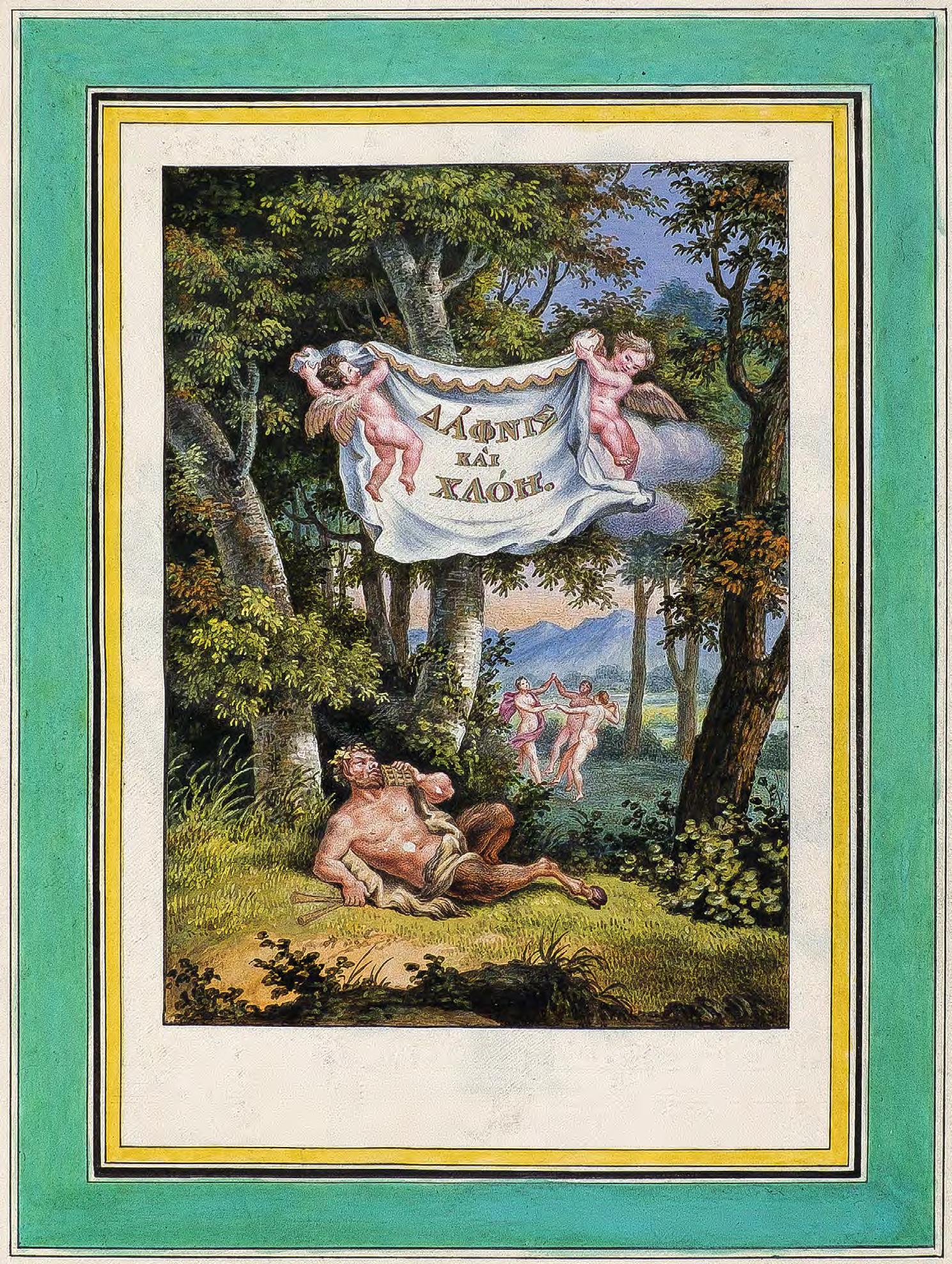


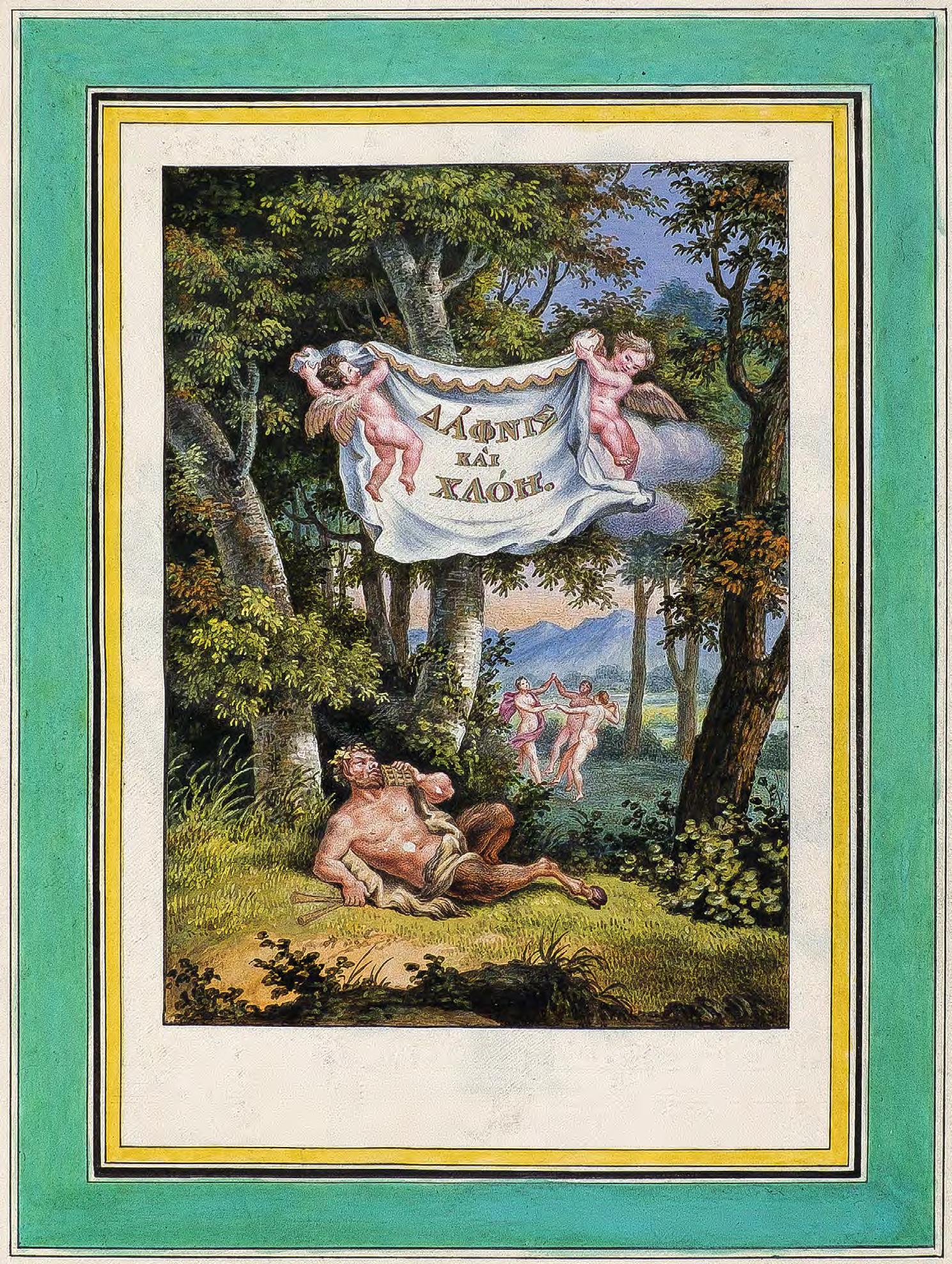

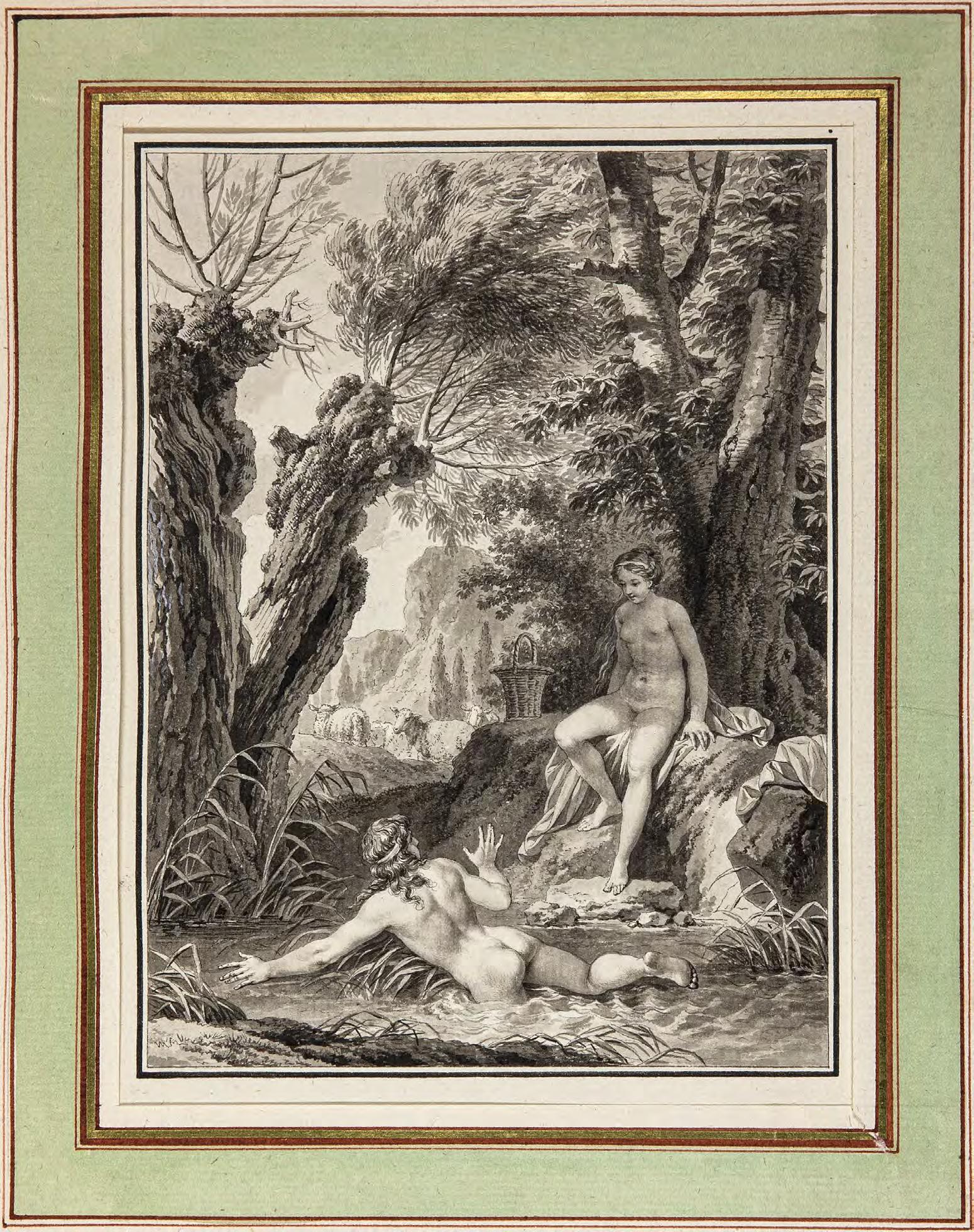
Oder wie ein Katalog der illustrierten Bücher im Frankreich des Dixhuitième aussehen könnte
Katalog lxxxvi
Heribert Tenschert
Heribert Tenschert
Antiquariat Bibermuhle AG
Bibermuhle 1–2 · 8262 Ramsen · Schweiz
Telefon: +41 (52) 742 05 75 · Telefax: +41 (52) 742 05 79
E-Mail: tenschert@antiquariat-bibermuehle.ch www.heribert-tenschert.com
Dieser Band ist Teil des in Arbeit befindlichen Katalogs unserer Sammlung von illustrierten Büchern des 18. Jahrhunderts in Frankreich und steht daher einzeln nicht zum Verkauf.
Cette collection, publiée comme échantillon de notre catalogue de livres à figures du 18e siècle, n'est pas à vendre séparément.
The books in this catalogue which is the forerunner of a multi-volume catalogue of our French illustrated books of the 18th century, are not for sale individually.
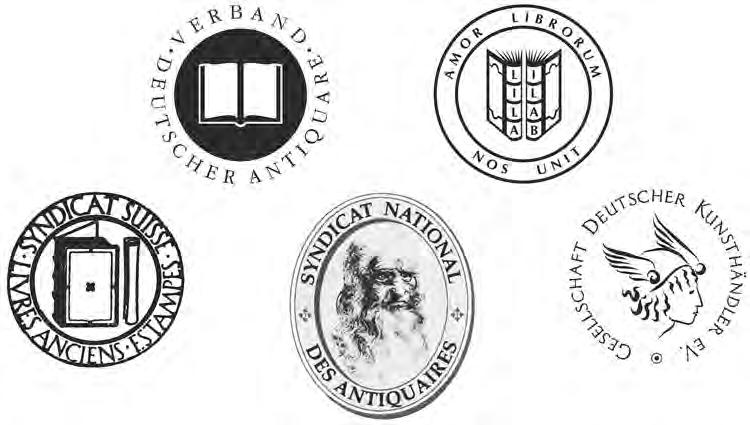
Autoren des Katalogs: Frank Purrmann, Heribert Tenschert, Mitarbeit Maria Danelius Verfasser der Einführung: Frank Purrmann
Layout, Redaktion, Lektorat, Einband: Heribert Tenschert, Maria Danelius Übersetzungen ins Englische: Laura Tenschert; Photos: Viola Hediger Satz und PrePress: LUDWIG:media Gmbh, Zell am See Druck und Bindung: Passavia GmbH & Co. KG, Passau
ISBN: 978-3-906069-35-7
Paradox genug, beginnt die Buchillustration des siècle des lumières in Frankreich vor der Jahrhundertwende mit Ausläufern des holländischen Dunkels: Hierfür stehen die Namen Romeyn de Hooghe und Harrewijn, die ihre stachligen Radierungen über Lafontaine, Boccaccio und Marguerite de Navarre streuen und damit künstlerische Türsteher wie Henri Cause und Konsorten unschädlich machen.
Tatsächlich hatte sich das 17. Jahrhundert, gerade in seinen Spätphasen, nur widerwillig der Illustration ergeben, wenn diese sich nicht sogar im auftrumpfenden Frontispiz nach einem großen Namen erschöpfte, wie Poussin.
Bernard Picart, der einzige ernstzunehmende Protagonist des anhebenden Jahrhunderts, ist zwar in Paris geboren, arbeitet aber den Großteil seines Lebens in Amsterdam, somit die alte Abhängigkeit bezeugend, auch wenn seine Cérémonies et Coutumes religieuses … und die Ausgaben von Boileau, Fénelon, Rabelais noch bis in die 30er Jahre hinein Maßstäbe setzen, von denen sich erst die kommenden Dekaden lösen werden, lustvoll entbunden durch Boucher, Oudry, Cochin.
Da platzt in die „Niemandsbucht“ des zweiten Jahrzehnts, an dessen Ende Watteau, dunkel leuchtendes Versprechen, aus Versehen stirbt, eine Suite von 28 Stichen nach Gemälden des Régent Philippe d’Orleans, mit der fortan die Ausgaben in der Lebenszeit dreier Könige sich überstürzen werden: eingegeben vom spätantiken Liebesidyll des Longus: Daphnis und Chloé.
Die stapelweisen Wortmeldungen zum Thema, ob kunsthistorisch, bibliophil oder bibliographisch, sind seltsam einmütig: man möchte, trotz der chronologischen Evidenz, den Primat des wahrhaften künstlerischen Beginns nicht dieser „hübschen“ Folge gönnen, sondern zählt ein Jahr weiter, da 1719 die Fables des Houdart de la Motte mit den radierten Vignetten von Gillot erscheinen, dem Lehrer Watteaus.
Das scheint mir unangebracht, selbst wenn man die überwältigende WirkungsNachfolge des Longus über achtzig Jahre hin nicht in Rechnung zieht – für sich genommen sehr wohl ein Qualitätswink. Ist es nicht vielmehr so, daß Anschauungen und Überzeugungen, die sich über lange Zeit eingesenkt haben, die Urteilsfähigkeit selbst so unabhängiger Köpfe wie Gordon Ray trüben können?
Wenn aber jemand, von den niederländischen Radierungen mit ihren aufgesetzten, kalten Erregungen oder Picarts verjährtem Barockdonner kommend, unvermittelt auf die 28 Stiche stieß: ob ihm da nicht, durch den Erweis des Anderen, die Möglichkeit einer genuin neuen Auslegung des Druckwerks überhaupt aufgegangen sein mag, weil deren milde überredende Zuständigkeit von nun an nichts Geringeres mehr zuließ?
Die künstlerische Qualität, niemals „neutral“, mißt sich hier nur an sich selbst – da jeder Vergleich fehlt; daher hätte man sich das Anstehen in der Schlange der Nörgler getrost sparen sollen.
Hinzu kommt, daß die Sammler jener Generation nicht dumm waren: wie wäre der ununterbrochene Siegeslauf nicht nur der Ausgabe von 1718, sondern hin zu den unabsehbaren Folgen: 1731, 1745, 1754, 1757 usw., zuletzt noch dem Aplomb der Edition von 1787 sonst möglich gewesen… Nein, Philippe d’Orléans, untertänig gelenkt von Coypel und transformiert von Audran, hatte in seinem Ehrgeiz etwas bereitgestellt, das im Ancien Régime immer noch einmal zu sich kommen konnte, ohne Epochenrest. Tatsächlich bietet sich dem unvoreingenommenen Auge beim Betrachten der Folge Entzückung über die Maßen: das mit Delikatesse gebändigte Clair-Obscur vieler großer Querformate, die liebreiche Parteilichkeit der Figurensetzung gegenüber dem zurückweichenden Kokon der Natur, all die Freiheiten gerade noch zensurverträglicher Nacktheit , die dennoch unsere Urgroßväter nach Sekretierung rufen ließen (während sie im Stillen Nerciat und Chorier lasen, oder gleich de Sade). Vor allem wenn man es mit den frühesten, geradezu ins Relief sinkenden Abzügen zu tun hat, wie dies fast alle unsere Exemplare (III–XVII) bewähren, streift einen der „coup de foudre“, der sich bei Darstellungen wie dem einzigartigen Winterbild oder der Reigenanmut der Weinlese bis zum „süßen Delirieren“ Horazens steigern kann. Zuletzt vernimmt man in der vermeintlichen Beliebigkeit der Formatabfolge das Flüstern eines geheimen Sinns, der die Reihe mit zusätzlicher Bedeutung auflädt.
Und wie glücklich trifft der Geist dieser Bilder den Ton des Hirtenromans, der uns dadurch gänzlich zeitenthoben entgegenkommt: ein leichter Schritt vom zweiten nachchristlichen ins achtzehnte Jahrhundert, ohne Einbußen, aller Fremdheit entkleidet.
Da sich dann im Lauf des Sammelns diese Suite mit typographischer Eleganz, Einbänden von farbgewaltigem Feuer sowie unbefleckter Erhaltung immer überzeugender paarte, die bibliophilen Haupt-Kriterien also unter Beweis gestellt waren, meinte ich angesichts von 90 Exemplaren (und einer Gemälde-Überraschung), einen Katalog ins Werk setzen zu dürfen, wie er hier jetzt vorgelegt wird, bereichert um eine bibliographische Einführung, der Frank Purrmann bei aller historischen Seriosität genügend Hingerissenheit einmischt, daß sie dem Katalog selbst zum würdigen, wenn auch nicht süffigen Auftakt wird. Künftige Bibliographen werden nur zum eigenen Schaden an den hierin und im Katalog gewonnenen Erkenntnissen vorbeigehen.
Man hätte das alles nicht machen müssen, man hätte sich, wie alle anderen, auf das zufällige Exemplar der jeweiligen Ausgabe beschränken können. Das hätte
geheißen, dem amateur die alltägliche, die schale Kost servieren. Da ich, gestehen wir es nur, Sammler auf eigene Eingebung bin, musste mir die diametrale Lösung eher einleuchten: aus der jeweiligen Auflage jene Art übergangsinniger Regenbogenwirkung herauszulocken, in der jedes Detail, jedes Atom die anderen beschwört, konturiert, erhöht. Es findet sich unter den zwölf Exemplaren von 1718 kein einziges, dessen Merkmale ungeteilt bei einem zweiten wiederkehren, jedes trägt in sich sein Ein und Alles, keines ist dem anderen spiegelnd im Weg.
Ähnliches gilt für alle folgenden Editionen, vor allem die von 1745 und 1757, um gegen Ende hin, d. h. 1787 und 1800, bei zwei Abendsternen zu landen, die in der Welt des Dixhuitième so nur einmal existieren: die Nummern LIX–LXI mit drei Folio-Exemplaren auf Pergament, darunter zwei mit nur für diese beiden vergrößert geschaffenen Original-Gouachen, das dritte gar mit allen Originalzeichnungen und den nur dies eine Mal anhand der Gemälde selbst gouachierten Radierungen. Hat man diese Wunderwerke einmal durchstaunt, dann bleiben in uns, wie von einer äußersten Lichterscheinung auf dem Grund unseres Auges, leuchtende Urbilder zurück, ein Kreisel der Farben: birkenlaubgrün, taubenhalsfarben, zwischenein das memlinghafte Inkarnat einer Hirtin bei der Verkündigung aus den Wolken.
Der letzte Gipfel erwächst lange nach den Lauffeuern der Revolution, sieben Jahre nachdem die Geschäftsträger des Schreckens aufhören, die Tode zu zählen, es ist Didots Folio-Ausgabe von 1800 (– ein Embryo des Kommenden, das allerdings das ganz Andere sein wird: Bonnard, genau hundert Jahre später). Mit den Lavis von Le Barbier, augenliebkosend, den ans Geniale tastenden Erkundungen Baron Gérards, vor allem aber mit den drei Jahrhundertleistungen Prud’hons gelangt der Zug der Longus-Ausgaben an sein säkulares Ende, eine Höhle Ali Babas, ausweglos, und für immer. Die ganze Sammlung, wie sie hier nach hellen Freuden und manchen Hängepartien vorgelegt wird, ist, wie man leicht ersieht, ein Herzensding, eine labour of love, die den Anspruch erhebt, anhand eines einzigen Buchs den Gang der Bebilderung im fruchtbarsten Jahrhundert, dem französischen achtzehnten, zu skizzieren, vielleicht sogar ins Relief zu setzen.
Wo sonst, wann überhaupt wäre dergleichen möglich? Solche Überlegungen vor allem haben mich dazu geführt, diesen Versuchsballon unbegleitet, auf eigene Rechnung steigen zu lassen, ihn als echantillon eines Größeren, Ehrgeizigeren, Unmöglichen, in Druck zu geben. Denn jetzt darf heraus, was ich seit mehr als 20 Jahren ankündige. Hier ist nur ein einziger Titel exemplarisch behandelt von dem, was jetzt uns arbeiten und nicht verzweifeln läßt, meine Sammlung von livres à figures des 18. Jahrhunderts.
Eine gargantueske Unterweltsiedlung, die nach 30 Jahren aus dem Limbo ans Licht steigt, gebildet aus mehreren tausend Ausgaben mit doppelt so vielen Bänden, deren vornehmste Eigenschaft ist, daß es sich fast immer um die distinguiertesten Exemplare überhaupt oder zumindest der letzten hundert Jahre handelt.
Wie man in den kommenden Monaten bemerken wird, fehlt in der Sammlung kein einziges auch nur von ferne interessantes Werk, vielmehr sind die bedeutendsten in bis zu 25 verschiedenen Ausführungen (Fermiers Généraux z. B.) einander gegenüber gestellt, die alle Fragen nach Größe, Rang, Vollständigkeit, Druckzuständen, Einbandvarianten etc. bis zur Erschöpfung klären und einer Art buchkünstlerischer Kommunion zuführen werden.
Dieser Longus-Katalog – um zum Schluß eine Andeutung zu inhaltlicher Spannweite und Ausmaß unserer Bestände zu geben – wird darin wohl Band 8 oder 9 bilden.
Geritzt vom Alleinigkeits-Trieb des Bibliophilen, setze ich hierher, daß diese Kollektion wohl den Vergleich mit keiner privaten Sammlung der letzten 200 Jahre scheuen muss, ob nun in ihrer Größe, der Qualität der Exemplare oder – zentral – der Anzahl von Werken mit den Originalzeichnungen. Denn hier sind es mehr als einhundertfünfzig, während Henri Beraldi oder Raphaël Esmerian, die beiden Großmeister dieser Spielart zwischen 1870 und 1970, in ihren Bibliotheken jeweils auf ein Sechstel davon kamen: dazu nur eine erhellende Vergleichszahl. Von den 24 einschlägigenTiteln bei Beraldi ist die Hälfte – zwölf – in unserem Besitz, von den 24 Esmerian-Exemplaren immerhin zehn – eine besonders lautere Blüte findet sich im vorliegenden Band unter Nr. LXII, die acht morgenschönen Lavis von Le Barbier, ein Höhepunkt auch bei Esmerian, der ihnen nicht weniger als neun Tafeln widmet.
Damit wären die Ziele und Umrisse des Zukünftigen abgesteckt, mit dem „Longus“ als erstem Prüf- und Grundstein: wenn mir, in diesen lächerlich ernsten Zeiten, nicht die dira Necessitas ihre Nägel ins Gebälk hämmert, stehen wir Ende 2022 vor zwölf fertigen Bänden, oder sechzehn.
Bibermühle, Zweitausendzwanzig, im Sommer unseres Missvergnügens
H. T.
Ein Jahrhundert Daphnis und Chloe im französischen illustrierten Buch: Einführung . . . .
Katalog: Nummern I– LXXX
S. 11
I und II: Die Ausgabe „Amsterdam“ 1716 ................................ S. 84
III-XIV: Die Regentenausgabe von 1718 ................................... S. 96
XV-XVIII: Vier separate Suiten zur Regentenausgabe ......................... S. 138
XIX-XXIV: Die Ausgabe Paris 1731 ..................................... S. 146
XXV-XXXVI: Die Ausgabe Paris 1745 .................................. S. 164
XXXVII: Die Ausgabe Amsterdam 1750 ................................. S. 200
XXXVIII-XLI: Die Ausgabe In gratiam curiosorum , Amsterdam 1754 .......... S. 204
XLII-XLIX: Die Ausgabe Pour les curieux, Amsterdam 1757 ................. S. 220
L: Die Ausgabe Amsterdam 1764 ....................................... S. 246
LI: Die Ausgabe Lyon 1777 ........................................... S. 248
LII- LV: Die Ausgabe À Londres 1779 ................................... S. 250
LVI: Die Ausgabe A Mithylène 1783 .................................... S. 262
LVII: Der berühmte Bodoni-Druck, Parma 1786 ........................... S. 265
LVIII- LXII und LXIII: Der Didot-Druck von 1787: Paris, Imprimerie de Monsieur, u. a. mit den Original-Lavis von Le Barbier ........... S. 268
LXIV: Illustrationen von Prud’hon, Gérard, Hersent und Albrier: Sechs Tafeln in Zustandsdrucken ........................................ S. 339
LXV- LXIX: Ausgaben in und nach der Revolutionszeit: Lille 1792 sowie Paris 1796, 1798 und 1800 ............................. S. 342
LXX- LXXVIII: Die monumentale Didot-Ausgabe des Jahres 1800 mit den Stichen von Prud’hon und Gérard
S. 353
LXXIX und LXXX: Die Renouard-Ausgabe, Paris 1803 .................... S. 384
Supplement:
Gemälde von Frontier, signiert und datiert 1749 ............................ S. 389
Anhang A–J: Weitere besondere Ausgaben und Exemplare .................... S. 397
Introduction and abridged catalogue descriptions: I – LXXX , A–J .............. S. 413
Übersicht aller Longus-Ausgaben in Französisch, Latein und Griechisch, gedruckt in Frankreich und in den Niederlanden, 1716–1810 .................. S. 433
Literaturangaben .................................................... S. 439
Register

„Man müßte ein ganzes Buch schreiben, um alle großen Verdienste dieses Gedichts nach Würden zu schätzen.“
Daphnis und Chloe im französischen illustrierten Buch des 18.
Jahrhunderts von der Edition du Régent zur Tintenklecksaffäre
Die Geschichte von Daphnis und Chloe zählt heute zum Kanon der bekanntesten Texte des Altertums und hat auch in dem so reichen Genre der Liebesliteratur ihren festen Platz auf dem Olymp der bedeutendsten Werke aller Zeiten gefunden. Doch der Aufstieg zu diesem Rang war ein langer und keineswegs immer geradliniger. Ein wichtiger, im Hinblick auf die zugehörige Bilderwelt sogar entscheidender Teil dieses Weges fällt in jenen Zeitraum von etwa einhundert Jahren, den wir hier anhand unseres Katalogs in 80 außergewöhnlichen Exemplaren vorstellen.
Unser Zeitabschnitt ist jener, in der der Roman endgültig aus der Nische der Gelehrtenliteratur heraustritt und sich ein wesentlich breiteres Publikum, bestehend aus einer die gehobene literarische Unterhaltung suchenden gebildeten Leserschaft, zu erobern beginnt. Die Übersetzung Amyots machte den Zugang zum Werk auch jenseits altsprachlicher Fertigkeiten möglich und setzte lediglich die Bereitschaft voraus, diesen Text in dem schon damals etwas antiquierten Französisch des 16. Jahrhunderts zu lesen. Dieses allerdings verlieh dem sprachlichen Stil seinen besonderen Charme, den Goethe noch zu schätzen wußte, zumal diese exzellente Übertragung selbst schon zu den literarischen Klassikern gezählt werden darf. Die abenteuerlich-amouröse Erzählung von dem im Hirtenmilieu heranwachsenden, sich über viele Hindernisse hinweg immer mehr liebenden, begehrenden und schlußendlich glücklich zusammenfindenden Paar von hoher Abstammung ist offensichtlich bei der Leserschaft im Zeitalter des Spätabsolutismus und der Aufklärung, aber auch noch und gerade in der Revolutionsära, auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Diese Leser erwarteten allerdings nicht nur niveauvolle Lektüre, sondern wollten das Gelesene auch visuell erleben, weshalb die Bebilderung durch Tafeln, Frontispize, Vignetten und weiteren Buchschmuck im 18. Jahrhundert zur Selbstverständlichkeit fast aller Longus-Ausgaben geworden ist. Schon von Beginn an konkurrierten gleich zwei Zyklen miteinander, wobei der eine, verknüpft mit dem Namen des leibhaftigen Regenten von Frankreich, Philippe II . de Bourbon, Duc d’Orléans, natürlich viel größere Popularität erringen konnte und sich gleichsam wie ein roter Faden durch die Ausgaben des 18. Jahrhunderts hindurchzieht, in
der Mitte des Säkulums sogar aufgewertet durch künstlerisch erstrangiges Rahmenwerk und Vignetten, woran Größen wie Eisen und Cochin maßgeblich beteiligt waren. Erst weit in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurde diese Regentensuite allmählich durch Neues abgelöst. Gegen Ende des Jahrhunderts schufen schließlich bedeutende Illustratoren wie Le Barbier, Prud’hon und Gérard wirklich neue Darstellungen, auch hinsichtlich einer auf den seelischen Gehalt der Geschichte abzielenden Interpretation, die darin ihrer Zeit gemäßer waren und so in die Bilderwelt des 19. Jahrhunderts mit einer sich stark verändernden Ausdeutung hinüberführten. Die Faszination für das literarische Sujet und seine Visualisierungsmöglichkeiten nahm dabei keineswegs ab, im Gegenteil, sie sollte bis in die Moderne fortdauern, lag sie doch im Werk, nicht zuletzt im Sprachstil des Longus, bereits begründet, wie es Schönberger in der exzellenten Einführung zu seiner Neuübersetzung so treffend beschreibt: „Vor anderen Schriftstellern zeichnet sich Longos durch seine Bildhaftigkeit aus. Kaum ein Dichter vermag es, dem Leser ein Bild so deutlich und plastisch vor Augen zu führen. Man sieht Lokal und Personen geradezu vor sich … Der Klarheit des Himmels entspricht die Klarheit und Plastik der Darstellung“ [Schönberger, Longos, S. 253]. Die bildhaft-schildernde Sprache ist hierbei nur die eine Seite, die andere ist der Stoff selbst, der unmittelbar vom Wesen des Menschen, seinem Gefühls- und Seelenleben, erzählt und daher geradezu prädestiniert war, Bilder und Bilderfolgen zu evozieren, die sich im Laufe der Geistesgeschichte, der Stile und veränderter Interpretationsweisen entsprechend gewandelt und ein ganzes Spektrum visueller Deutungsebenen durchlaufen haben – der gewaltige Bogen der Inspiration der Kunst durch diesen immer wieder faszinierenden und die Phantasie anregenden Text spannt sich von den Kupferstichen des Crispin de Passe im frühen 17. Jahrhundert bis zu den Photographien eines Karl Lagerfeld in unseren Tagen. Das hier behandelte 18. Jahrhundert ist nur ein Ausschnitt daraus, wenn auch ein sehr wichtiger. Doch was machte den Reiz, die Bedeutung sowie die gleichsam zeitlose Attraktivität und Wirkung dieses antiken literarischen Stoffes aus, und warum hat er gerade im Frankreich des 18. Jahrhunderts eine solche Blütezeit erlebt?
Sehen wir uns zunächst den Inhalt des in vier Bücher gegliederten Romans etwas näher an: Daphnis und Chloe, zwei nach ihrer Geburt ausgesetzte Kinder, die aber aus reichen Familien stammen, werden auf der Insel Lesbos von Hirten großgezogen. Sie wachsen gemeinsam auf, arbeiten und spielen miteinander, teilen alles und bemerken dabei ein ihnen zuvor fremdes Gefühl, das sich als starke Sehnsucht nacheinander herausstellt. Diese Liebesgeschichte des natürlich-naiven Paares ist mit Irrfahrten und Abenteuern angereichert und ausgeschmückt, ein Spannungsbogen äußerer Ereignisse wird aufgebaut, der den inneren, ebenfalls spannungsvollen Prozeß der erwachenden Liebe begleitet und teils widerspiegelt. So verbringt das Paar den Winter in unglücklicher Trennung, und jeder der beiden Jugendlichen wird im Verlauf der Erzählung einmal entführt, um danach umso glücklicher wieder zu dem Anderen zurückzukehren, doch bleiben solche
Abenteuer auf episodische Ereignisse beschränkt, die „unser Liebespaar auf seiner inneren Reise zum Erreichen der wahren Liebe“ nur noch bestärken [ DNP 7, 437]. Es eröffnet sich dabei ein weites Feld für die Idyllik. Am Ende sorgen glückliche Zufälle dafür, daß die wohlhabenden, sozial weit über dem Hirtenmilieu stehenden Eltern gefunden werden – der Vater des Daphnis ist gar Gutsbesitzer – und die beiden heiraten können. Doch geben sie das einfache Hirtenleben nicht ganz auf; die Hochzeit findet in ländlicher Umgebung, wie von beiden gewünscht, vor einer in der Nähe gelegenen Nymphengrotte statt.
Das wohl noch vor der Mitte des dritten Jahrhunderts entstandene Werk schöpft in vielfältiger Weise aus der Literatur des Hellenismus. Das Neue am Roman des Hellenismus aber ist, daß er der Liebe die höchste Bedeutung im Leben des Menschen zuerkannte, demgegenüber alles andere zurücksteht und zweitrangig wird. Weitere Voraussetzungen boten die Novelle und die erotischen Stoffe der hellenistischen Elegie sowie das heroische Epos, vertreten durch Ovid. „Ovid aber hat in allen übrigen nur denkbaren Bezirken alles andere hinter dem Eros zurücktreten lassen; seine Carmina amatoria vermitteln die Überzeugung, neben dem Eros sei alles andere unwichtig. Darin ist Ovid ein Geistesverwandter des Longos, und auch im Raffinement der Darstellung berühren sich die beiden“ [Schönberger, Longos, S. 211]. Was bei Longus von diesen Vorbildern wiederkehrt, „ist zuerst die fast völlige Beschränkung des Stoffes auf die Liebe (neben der Religion), die bei ihm viel stärker als in den übrigen Romanen ausgeprägt ist. Eigentlich novellistische Züge hat sein Werk wenige, doch fällt in seiner Darstellung besonders jene zierliche Anmut auf, die dem griechischen Novellenstil eignet. Elemente elegischer Poesie finden sich gleichfalls; dazu gehören Einzelheiten der Erzählweise, ganz besonders aber erotische Einzelmotive … Besonders eng sind die Beziehungen zu der Neuen Komödie. Ihr wird der Grundplan verdankt: ausgesetzte Kinder finden ihre Eltern. Wie in der Komödie findet sich bei Longos auch eine richtige Peripetie … und am Ende der Handlung stehen gleich zwei Erkennungsszenen mit den bekannten Gnorismata“ [Schönberger, Longos, S. 211 f.]. Als weitere Besonderheit von Daphnis und Chloe ist die Bukolik zu sehen, die das Werk von allen übrigen griechischen Romanen unterscheidet: „Für die Gattung des bukolischen Romans selbst haben wir aber nur Longos als Beispiel. Er hat das Schema des griechischen Romans als Grundlage seiner Erzählung genommen und hat es mit dem Element der Bukolik vertieft und bereichert. Die Darstellung des Hirtenlebens bot Theokrit, seine Erhöhung im Lande Arkadien und die Annäherung an den Mythos hatte Vergil vorgenommen, die Durchdringung mit religiösem Gedankengut war bei Anyte vorgebildet, Erotik und Bukolik verband die ‚Oaristys‘, und die Form der prosaischen Idylle stellte zum Teil die literarische Tradition. Die wunderbar poetische Verschmelzung des Ganzen, die Zusammenfassung zu der neuen Weise des bukolischen Romans, bleibt das nicht geringe Eigentum des Longos“ [Schönberger, Longos, S. 222]. Das aus vielfältigen Quellen und Vorbildern schöpfende Werk ist somit allenfalls vordergründig, was den vorherseh -
baren Ablauf der Geschichte anbelangt, etwas schlicht gestrickt. Der Erzähler verwendet seine literarischen Stilmittel sehr zielgerichtet und differenziert, indem er einerseits über weite Strecken auf Vieles bewußt verzichtet, was die ausgefeilte Rhetorik in der Spätzeit der Antike zu bieten hatte, zugunsten einer dem Thema angemessenen Einfachheit – das sind die Passagen der Erzählung (Narratio), bei denen Longus in Nachahmung der schlichten und einfachen Erzählweise eines Xenophon oder Herodot in einem Modus von Natürlichkeit und Klarheit schreibt – um aber auf der anderen Seite, an jenen Stellen, wo ihm dies angebracht erschien, mit großer Virtuosität das sprachliche Repertoire voll anzuwenden. Dort erfolgt der Einsatz der Rhetorik umso mehr und sehr gezielt: „An den Glanzstellen wendet Longos dann alle die bekannten Künste rhetorischen Prunkes auf, … wenn er mit der hohen Poesie wetteifert, steigert Longus seine Kunst zu wirklichen ‚Edelsteinen, die im goldenen Band der Erzählung gefaßt sind“ [Schönberger, Longos, S. 251]. Jedoch bleibt er reiner, um ihrer selbst willen verwendeter Sprachakrobatik immer fern, denn Longus ging es in seinem Roman um etwas Anderes, das für ihn wesentlich bedeutender als rhetorischer Glanz war, wie Schönberger herausstellt: „Wichtigstes Ziel ist für Longos die ‚Süßigkeit‘ der Darstellung (Glykytes). Alles soll schön, anmutsvoll und ‚süß‘ sein“ [Schönberger, Longos, S. 249].
Den gelegentlichen negativen Urteilen über den Stil des „Sophisten“ Longus zum Trotz: Die sprachlich-literarischen Qualitäten des Textes sind seit seinem allmählichen Bekanntwerden am Beginn der Frühneuzeit anhand des humanistischen Studiums griechischer Manuskripte des Mittelalters zuerst unter einzelnen Gelehrten, dann in einer immer breiteren Leserschaft, erkannt und anerkannt worden. Je nach den Idealen der Zeit hat man einmal diesen, einmal jenen Aspekt des Romans besonders zu schätzen gewußt. Unter den Gelehrten stiegen jedenfalls die Verbreitung und die Kenntnis der Geschichte im Laufe des 16. Jahrhunderts rasch an. Schon Jahrzehnte vor der Editio princeps mit dem von Colombani edierten griechischen Originaltext, 1598 bei Giunta in Florenz erschienen, waren Übertragungen ins Italienische, Französische, Lateinische und Englische erfolgt, die erste Übersetzung überhaupt ist die italienische von Annibale Caro aus dem Jahr 1537. Den Grundstein zum Erfolg von Daphnis und Chloe im französischsprachigen Bereich legte unzweifelhaft Jacques Amyot, der unter anderem für König Franz I. tätige hochgelehrte Humanist und Kleriker, mit seiner fulminanten Übertragung des Textes, die im Jahre 1559 bei Vincent Sertenas in Paris erschienen ist. Sie gilt gemeinhin als die beste aller älteren Übersetzungen und wurde von manchen Beurteilern sogar dem Original selbst vorgezogen. Noch Goethe, der die Geschichte der „Amours pastorales“ sehr schätzte und von dem auch die hier einleitenden Worte stammen [Gespräche mit Eckermann, 9. März 1831] urteilte über sie: „Dieses alte Französisch ist so naiv und paßt so durchaus für diesen Gegenstand, daß man nicht leicht eine vollkommenere Übersetzung in irgendeiner anderen Sprache von diesem Buch machen wird“ [ebenda, 21. März 1831].
Blieben die französischen Editionen des 16. und 17. Jahrhunderts noch sehr wenige, und darunter auch nur vereinzelt illustrierte, allesamt höchst seltene Drucke von geringer Verbreitung, so begann erst im frühen 18. Jahrhundert die eigentliche Blütezeit, in der das Werk in immer neuen Ausgaben, die meisten davon mehr oder weniger reich illustriert, erschienen ist. Mehrere kulturelle und geistesgeschichtliche Entwicklungen mögen dazu beigetragen haben, ganz konkret setzte dieser Aufbruch aber eine veränderte Bewertung der sittlich-moralischen Relevanz des Inhalts voraus. Dies ist nicht verwunderlich, denn aus dem Text sind tatsächlich zwei gegensätzliche Interpretationstendenzen ableitbar – die sich im Übrigen auch in der Geschichte seiner Illustration widerspiegeln: die eine, die das erotische Element als übermächtig ansieht, da der Eros hier ja omnipräsent ist und schicksalhaft zu walten scheint, was, so wurde dann meist unterstellt oder ausgedeutet, mit lockerer Moral, bis hin zur Frivolität einherginge, die andere, die in der Entwicklung des Paares einen natürlichen und vorherbestimmten Weg sieht, paradigmatisch für die menschliche Natur an sich. Und die zudem darauf verweisen konnte, daß aus der naturgegebenen Anziehung zwischen den beiden am Ende eine auch im zivilisatorischen Sinne legitimierte Verbindung hervorgeht, eine Eheschließung. Moralisch wäre dem Verlauf der Geschichte, sieht man von der ohnehin durch die Übersetzer stark gekürzten Verführungsszene des Daphnis durch Lykainion, eine aus der Stadt stammende Frau eines Bauern, einmal ab, mithin nicht viel entgegenzuhalten. Die Verlagerung von der einen Sichtweise zur anderen geschah in Frankreich in der Zeit Ludwigs XIV. Im mittleren 17. Jahrhundert noch als sittlich bedenkliche Schrift eingestuft, galt der Roman schon gegen Ende des Jahrhunderts sogar für junge Frauen als empfehlenswerte Bildungslektüre. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für seine weitere Verbreitung, sollte diese nicht von der Zensur wesentlich behindert oder durch einen Eintrag in den kirchlichen Index eingeschränkt werden, doch ist das noch keine Erklärung für die schließlich erlangte Popularität. Um diese zu verstehen, ist zunächst einmal zu sehen, daß sich der Roman des Longus am Ende des 17. Jahrhundert bereits in seine eigene neuzeitliche Nachfolge eingebettet befand. Als Urbild des Hirtenromans war ihm eine ganze Gattung gefolgt, die sich in Renaissance und Barock so großer Beliebtheit erfreute, daß man von einer Mode sprechen kann. Sie machte „Lope de Vega und Shakespeare zu ihren begeisterten Nachahmern“ und bildete „von Petrarca bis zum Biedermeier den Nährboden einer unerschöpflichen Landidyllik und Schäfersehnsucht“ [ KNLL 10, 580]. Er schwamm also auf der Welle, die er selbst ausgelöst hatte.
Die Thematik und die Kombination der Sujets haben dem Zeitgeschmack und den Erwartungen des Publikums gerade im Spätbarock und Rokoko, mithin dem Zeitalter der Früh- und Hochphase der Aufklärung, vollauf entsprochen. Obgleich von hoher Abkunft, was man gewissermaßen als „adelig“ interpretieren konnte, wächst das Paar im pastoralen, bukolischen Umfeld auf und findet dadurch, jenseits der moralischen Zwänge, die einer jeden zivilisierten Gesellschaft eigen sind, zu einer unschuldigen Liebe, die
selbst dann, als sie schlußendlich in die Sexualität mündet, nichts Verwerfliches kennt. Das Reizvolle und philosophisch Interessante an dieser Geschichte liegt in einem tieferen Sinne darin begründet, daß die Selbsterkenntnis menschlicher Natur hier nicht nur fast ohne das Korsett gesellschaftlicher Erwartungen von statten geht, sondern daß die sittliche Entwicklung, ohne dieses Korsett überhaupt zu benötigen, von selbst zum Guten und Richtigen, im Sinne des von der menschlichen Gesellschaft Erwarteten, finden kann. Eine natürliche Moral scheint die beiden zu leiten, die weder einen Sündenfall vor den Göttern noch den Menschen erleben, sondern trotz vieler Unbilden und Abenteuer auf dem Weg dorthin, gleichsam im Zustand irdisch-paradiesischer Glückseligkeit enden.
Gewürzt ist das Ganze dennoch mit einem Schuß Erotik und Sinnlichkeit, da der Eros hier als permanente Kraft und Spannung zwischen den Geschlechtern wirkt und den Verlauf der Erzählung bestimmt, aber erst am Ende in seine natürliche Erfüllung mündet. Eros ist hier zwar der Spannungsbogen der Handlung, tatsächliche Erotik bleibt dagegen fast außen vor. Aufgeklärt wird nicht über Geschlechtliches, sondern über den Weg des Menschen, für seinen ihm innewohnenden und zwischenmenschlich wirkenden Eros einen moralisch einwandfreien Weg zu finden, der hier sozusagen als der von der Natur vorgegebene erscheint: „Die Grundvoraussetzung unseres Romans ist also nicht das langsame Innewerden des Sexuellen durch Daphnis und Chloe, sondern die Unschuld und Unbefangenheit, mit der die beiden sich immer näher kommen, um erst in legitimer Ehe ihren Bund zu schließen. Die Kinder sind von Anfang an füreinander bestimmt, haben die Sendung, beispielhaft das Walten des Welteros zu zeigen, und durch die Macht dieser Sendung verlieren sie das Allzumenschliche des Durchschnitts, werden töricht im Sinne der Welt“ [Schönberger, Longos, S. 226].
Vergleicht man die Geschichte von Daphnis und Chloe mit der Fülle der ziemlich offen zu Tage tretenden pornographischen Literatur des französischen 18. Jahrhunderts, die an Deutlichkeit kaum etwas ausspart, so mag man in dem Werk des Longus ohnehin eher ein moralisches Erbauungsbuch denn eine verwerfliche Lektüre zu erkennen. Die Grundlage des Handelns der Protagonisten hat Schönberger prägnant in einem Satz zusammengefaßt: „Sie erfüllen ihre Menschenpflicht, so weit man es von Kindern verlangen kann“ [ebenda, S. 227]. Wirkt diese Geschichte, in der die Entwicklung der menschlichen Natur gegen alle Unbilden per aspera ad astra zum Guten, zum sittlichen Ideal, geführt und an deren Ende das Paar mit einem ganz diesseitigen Zustand bescheidenen Glücks belohnt wird, nicht wie ein Lehrstück im Geiste der französischen Aufklärung?
Die Entwicklung zum moralisch gefestigten Menschen, abgeleitet und begründet aus der grundsätzlich positiv gestimmten Natur, das erinnert doch stark an Rousseau, der bezeichnenderweise diesen Stoff ab 1774 als Oper bearbeitet hat, die er leider nicht vollenden hat können. Gleichzeitig bediente die Thematik des Romans natürlich auch und gerade eines der großen Bedürfnisse der Aristokratie im Absolutismus, den Ausbruch aus den Konventionen einer bis ins Letzte reglementierten Gesellschaft, deren
erträumte Flucht aus diesen kulturellen Zwängen in die Ursprünglichkeit der Natur zurückführt. Wie wohltuend mag eine solche harmlose pastorale Liebesgeschichte gewirkt haben, angesichts der alltäglichen Skandale, wie sie die reale französische Aristokratie, vor allem diejenige am Königshof, beherrschten? Und dennoch spielen Herkunft und Stand sowie die Einhaltung sozialer Unterschiede in der Erzählung eine nicht unerhebliche Rolle; die literarischen Stilmittel sind in Bezug darauf auch klar hierarchisierend eingesetzt: „Kunstvoll ist bei Longos die strenge Wahrung des Ethos. Keine Gestalt tut oder spricht etwas, was nicht peinlich genau auf ihren Stand, ihren Charakter, die ihr zukommende Sprechweise und ihr Geschlecht abgestimmt wäre.“ Zum Geburtsadel der Protagonisten tritt dabei noch „der Adel der Guten, Erwählten und Reinen, dem anzugehören weder Stand noch Geburt noch Reichtum oder Armut hindern. Sittliche Vollkommenheit oder angeborenes Verdienst verleihen diesen Adel ebenso wie rechtes, tapferes Menschentum“ [Schönberger, Longos, S. 253 und 242] – es ist dies ein Adel ganz im Sinne der Aufklärung.
Zur generellen inhaltlichen Affinität der aristokratischen, in Teilen und zunehmend auch schon der gebildeten bürgerlichen Leserschaft, gegenüber dieser Literatur gesellt sich eine ästhetische Präferenz. Die besondere Wertschätzung von Longus’ Sprachstil in der Zeit des frühen 18. Jahrhunderts dürfte auch darauf beruhen, daß im Zuge der Querelle des Anciens et des Modernes das Schlagwort von der Simplicité immer noch in aller Munde war. Es wurde von den Anciens als auszeichnendes Charakteristikum der Antike ins Feld geführt, gegenüber dem rhetorisch überladenem Stil der Neueren. Zwar war die Querelle fast schon am Abklingen, als die Blütezeit der Daphnis-und-Chloe- Geschichte im 18. Jahrhundert ihren Ursprung nahm, doch kam es immer noch zum Wiederaufflammen, und just in der Zeit, als sich die ersten Ausgaben schon in Vorbereitung befanden, im Jahre 1714, hat die große Altphilologin und Übersetzerin Anne Dacier eine späte Streitschrift veröffentlicht, gegen eine ihrer Ansicht nach verfälschende Übersetzung Homers durch Antoine Houdar de la Motte. In dieser Abhandlung Des causes de la corruption du goût betonte sie die Dekadenz der Moderne durch deren manierierte Affektiertheit und übermäßige Subtilität, wohingegen sich die Alten durch heroische Simplizität und Nähe zur Natur ausgezeichnet hätten. Eine derartige Simplicité glaubte man in der Zeit der Querelle auch und gerade im literarischen Stil des Longus zu erkennen, und zwar nicht nur im Vergleich zu den Autoren der Neuzeit, sondern auch gegenüber anderen Schriftstellern der griechischen Antike. Wie eng diese Stränge zusammenhängen, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, daß an der Illustration der 1712 erschienenen L’Iliade et l’Odyssée in der Übersetzung Daciers die Künstler Antoine Coypel und Benoît Audran beteiligt waren, dieselben, die wenige Jahre später die Regentenausgabe von Daphnis und Chloe bebildern sollten. Der mit Dacier befreundete Pierre Daniel Huet, selbst wichtiger Parteigänger der Anciens, hatte als junger Mann eine eigene Übersetzung von Daphnis und Chloe begonnen. In seinem Traité de l’origine des romans, der zuerst 1670 erschienen
ist, charakterisierte Huet den Sprachstil des Longus als „simple, aisé, naturel, & concis sans obscurité; ses expressions sont pleines de vivacité & de feu; il produit avec esprit; il peint avec agrément; il dispose ses images avec adresse; les caracteres sont gardez éxactement; les épisodes naissent de l’argument; les passions & les sentiments sont traitez avec une délicatesse assez convenable à la simplicité des bergers“. Eben jene Passage wurde bei der Besprechung der Pariser Edition des Jahres 1716, der ersten Daphnis-und-ChloeAusgabe des 18. Jahrhunderts, im Journal des Sçavans vom 4. Januar 1717, ausführlich zitiert [S. 14 f. – siehe auch Barber, Daphnis and Chloe, S. 30].
Mit der Approbation des Werks als moralisch unbedenkliche Lektüre und der Wertschätzung seines literarischen Stils waren also wesentliche Grundlagen für die Erfolgsgeschichte im 18. Jahrhundert gelegt, der Boden war in jeder Hinsicht bereitet. Die Zeit des Erscheinens der ersten illustrierten Ausgaben des Romans im 18. Jahrhundert fällt denn auch nicht zufällig in die Epoche des Übergangs, die Régence, in dem der pompöse höfische Barock unter Ludwig XIV. einem neuen feineren, intimeren und eleganteren ästhetischen Ideal wich. Mit Herzog Philipp II . von Orléans, der die Regentschaft von 1715 bis zu seinem Tod im Jahre 1723 für den unmündigen Ludwig XV. führte, zog auch ein neuer Stil in Politik und Gesellschaft ein – liberaler und offener, Philosophie, Literatur und Kunst fördernd, wie auch die Salon-Kultur. Daß in eine solche Zeit der literarische Stil des Longus besonders gut paßte, in seiner Ausgewogenheit aus Schlichtheit und Glanz, verbunden mit Geist, Schönheit, Anmut und vor allem jener zitierten „Süße“ und Emotionalität, das versteht sich fast von selbst. Daß nun auch die Zeit für eine entsprechende Illustration des Romans gekommen war, geht damit einher.
Schon Huet hatte die bildhaften Qualitäten der Sprache des Longus erkannt und hervorgehoben. Die eingängigen, die Phantasie anregenden literarischen Bilder und Szenen in Daphnis und Chloe sind in der Tat derart wirkmächtig gewesen, daß sie Künstler vom frühen 18. bis ins 20. Jahrhundert hinein dazu inspiriert haben, immer wieder neue Illustrationen zu schaffen. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, daß der erste große Anlauf zu einer neuen Longus-Illustration, der ziemlich genau in die Zeit unmittelbar vor dem Wechsel des Louis-Quatorze zur Régence fällt, nicht etwa durch die Neuausgabe des Textes angestoßen worden ist, sondern bereits einige Jahre vor dem Druck der neuen Editionen (1716–18) zur Entstehung eines großen, heute leider verlorenen Zyklus von Gemälden geführt hat. Der den Künsten in hohem Maße aufgeschlossene Philipp hatte diese Bilder selbst zusammen mit seinem Mal- und Zeichenlehrer Antoine Coypel, den er 1715 zu seinem „Premier peintre“ ernennen sollte, geschaffen. Vermutlich hatte er eine ältere Longus-Ausgabe in der Amyot-Übersetzung gelesen und war davon derart angetan, daß dieser Impetus ausreichte, einen Zyklus von wohl über 30 Gemälden, einen weiteren mit Tapisserien sowie eine Buchausgabe, illustriert durch die 28 Kupfertafeln umfassende Folge, die Benoît Audran der Ältere nach den Gemälden gestochen hat, hervorzubringen. Wenn sich auch der künstlerische Rang
dieser Werke in Grenzen hält, bedienten sie offenbar doch sehr gut den Zeitgeschmack und lieferten einprägsame Vorstellungen jener Bilder, die Longus mit Worten entstehen lassen hatte. Laut Hans Fürstenberg rechtfertigten die Darstellungen der Suite zwar „wegen ihrer noch etwas unbeholfenen Ausführungen kaum den ungeheuren Erfolg, den das Werk in allen seinen Auflagen das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch gehabt hat“ [Fürstenberg, La gravure, S. 75], doch verdienten die Darstellungen „Anerkennung, weil der Künstler seinen Gegenstand erfaßt und eine persönliche Ausdrucksform für ihn gefunden hat“; man könne sogar „den Longus als die charakteristische Illustration des Régence bezeichnen“ [Fürstenberg, Das französische Buch, 73]. Letzteres ist nur zu unterstreichen. Was Huet lobend am Text des Longus hervorhob, das kann man mit vollem Recht auch über diese Illustrationsfolge sagen: „simple, aisé, naturel, et concis sans obscurité“. Wenn auch künstlerisch nicht auf höchstem Niveau, war sie doch ganz ein Kind ihrer Zeit, geschaffen im Geist von „ libertinism mingled with nostalgia for rustic ataraxia“, wie Robert Morgan sie kurz charakterisierte [Morgan, Bibliographical Survey, S. 2274].
Wahrscheinlich gingen die Entwürfe auf das Jahr 1712 zurück, die Stiche tragen das Datum 1714, und im Jahr 1718 erschien dann die erste Ausgabe mit der sogenannten Suite du Régent. Ihren Erfolg verdankt sie neben der Prominenz des nominellen Schöpfers vor allem der eingängigen Bildsprache Antoine Coypels. Die teils reizvollen, bei den besten Tafeln der Folge sogar durchaus anmutig zu nennenden Illustrationen dürften erheblichen Anteil daran gehabt haben, daß die Amours pastorales de Daphnis et Chloé zu einem der beliebtesten Werke der illustrierten Literatur des Siècle des lumières avancierten. Von nun an war der Roman aus der Buchproduktion in Frankreich nicht mehr wegzudenken, mit einem nicht unbedeutenden Seitenzweig in den Niederlanden, der von Anfang an die französische Hauptlinie begleitet hat; nach etwas zögerlichem Anlauf folgte bald Ausgabe auf Ausgabe, und es wird unser Anliegen im Folgenden sein, dieses bis heute nicht eingehend gesichtete Dickicht ein wenig transparenter zu machen, Zusammenhänge zwischen den Editionen und Illustrationsfolgen aufzuzeigen, bislang nicht identifizierte Drucker zu benennen und den vielen Varianten innerhalb der unterschiedlichen Ausgaben nachzuspüren.
Möglich macht dies die vorliegende Sammlung. Diese einzigartige Zusammenstellung von Spitzenstücken, Unica und Besonderheiten, mit einer Vielzahl und Dichte von Objekten größter Seltenheit und Pretiosität, kann man als einen „trésor du bibliophile“ des 18. Jahrhunderts charakterisieren. Dem Bibliographen aber ist sie eine wahre Fundgrube, die sowohl durch das außergewöhnliche Einzelstück als auch die Vergleichsmöglichkeiten zwischen meist mehreren Exemplaren derselben Ausgabe eine Fülle von Erkenntnissen zuläßt, die der bisherigen Forschung entgangen sind und über die die alten Standardwerke zumeist schweigen. Erst anhand einer solchen Sammlung eröffnen sich viele der Zusammenhänge zwischen den Ausgaben und Illustrationsfolgen, die man nur dann gründlich
herausarbeiten kann, wenn man einerseits aus der Fülle schöpft, andererseits auch das von allem bisher Bekannten Abweichende, Ungewöhnliche, vielleicht nur in einem einzigen Exemplar Existierende vor sich liegen hat, darunter Probedrucke, Verlegerexemplare, Luxusausgaben und Unikate unterschiedlicher Art. In dieser Zusammenschau beginnen sich nun die Umrisse der Geschichte der illustrierten französischen Ausgaben des Longus-Romans im 18. Jahrhundert abzuzeichnen, werden trotz mancher verbleibender dunkler Stellen die wichtigsten Entwicklungslinien deutlich, und das, was zuvor noch mehr oder weniger isoliert stand, kann jetzt durch das Erkennen von Voraussetzungen und Nachfolge in einen Kontext gestellt werden. Dieser Abriß der Editionsgeschichte steht in enger Relation zu unseren Ausführungen zu den einzelnen Katalognummern, so daß sich die Texte oft ergänzen oder hier das Résumé aus den Erkenntnissen gezogen wird, die wir dort anhand einer ganzen Folge von Katalognummern gewonnen haben.

Ein wichtiger Faktor in der Geschichte der Buchkultur des 18. Jahrhunderts ist die zunehmende Konkurrenz auf einem Markt, der sich an erhebliche Wandlungen anzupassen hatte. Bibliophiler Luxus wurde nach wie vor für die zumeist adelige gesellschaftliche Oberschicht hergestellt. Im prunksüchtigen Spätbarock und dem Rokoko, mit seinem extremen Hang nach erlesener Verfeinerung, führte der Wettbewerb um die Gunst der Käufer zu einer zuvor kaum je erreichten Menge an opulent gestalteten Ausgaben, wobei jede die vorhergehende an Fülle und Qualität der Illustration, des Buchschmucks und des drucktechnischen Aufwandes übertreffen wollte. Auf der anderen Seite wurde der Bedarf nach erschwinglicher und dennoch ansprechend produzierter Literatur immer größer; auch und gerade die sich stetig erweiternde bürgerliche Leserschaft wollte in dieser Hinsicht gut bedient werden. Texte, die sich zu „Bestsellern“ eigneten, dazu solche von literarischer Qualität, waren in jedem Fall sehr gesucht und wurden auf den freier werdenden Handelsplätzen dieser Zeit in jeder Hinsicht verwertet, was keineswegs abschätzig gemeint ist. Hat die Konkurrenz unter den Verlegern doch dazu geführt, daß sie das ganze Spektrum buchgestalterischer und -künstlerischer Möglichkeiten auszuloten begannen. Auf der anderen Seite war das 18. Jahrhundert gerade in Frankreich und Holland auch eine Blütezeit verlegerischer Zusammenarbeit. Immer wieder kam es vor, daß mehrere Drucker und Verleger gleichzeitig eine Ausgabe produzierten, das Werk eines Kollegen übernahmen, aufkauften, ihm zuarbeiteten oder man gemeinsam die Herstellung und Vermarktung betrieb. Für diese Situation des Buchmarktes ist die Editionsgeschichte von Daphnis und Chloe ein in jeder Hinsicht aufschlußreiches und interessantes Beispiel. Hierbei ist insbesondere die Interaktion zwischen zweien der wichtigsten europäischen Verlagsmetropolen – Paris und Amsterdam – eine Triebfeder der Entwicklung gewesen. Von den ersten Drucken der Jahre 1716–18 bis weit in die zweite Jahrhunderthälfte spielte sich die Geschichte der französischen Longus-Ausgaben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in Paris und Amsterdam ab, teils in Konkurrenz, teils in Zusammenarbeit der Verleger und Druckereien. Und nicht immer ist eindeutig auszumachen, ob es sich im konkreten Fall um dieses oder jenes handelte – so auch bei den ersten drei Ausgaben, deren Entstehungsgeschichte uns sogleich mit allen wesentlichen Aspekten dieser Gemengelage konfrontiert.
A. Die Pariser und Amsterdamer Ausgaben von 1716/17, die Édition dite du Régent des Jahres 1718 (Nummern I–XIV, dazu Anhang A und B) sowie deren separate Suiten, 1718–24 (Nummern XV–XVIII)
Ein unerwarteter Verlagserfolg und eine Retourkutsche:
Die erste Ausgabe des 18. Jahrhunderts und ihre beiden Nachfolger
Mit den 1716–18 in Paris und Amsterdam erschienenen vier Neuausgaben der Amours pastorales de Daphnis et Chloé , dem spätantiken Hirtenroman des Longus in der Übersetzung des großen französischen Humanisten Amyot, beginnt ein Reigen von etwa 40 illustrierten Editionen, die im 18. Jahrhundert in Frankreich und in den angrenzenden Niederlanden publiziert worden sind. Die Trias der ersten Drucke aus den Jahren 1716 und 1717 ist in Paris wie auch in Amsterdam entstanden. Damit ist generalisierend zusammengefaßt, was man mit Sicherheit von ihnen sagen kann, und wenn man hier überhaupt von einer Trias sprechen darf, dann deshalb, weil alle drei eng miteinander zusammenhängen. Keineswegs handelt es sich jedoch um eine einheitliche Gruppe. Wie wir sehen werden, unterscheiden sich die drei Ausgaben nämlich in mancherlei Hinsicht voneinander, und ihre Druckvermerke täuschen Zusammenhänge vor, die so, wie sie es angeben, gar nicht bestanden haben können.
Nun sind die Impressa dieser Editionen sämtlich zweifelhaft und bis heute ungeklärt, und das ist auch der Hauptgrund, warum die Entstehungsgeschichte der Drucke weitgehend im Dunkeln liegt. Der wahrscheinlich erste der drei aus dem Jahr 1716 firmiert unter der Adresse „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ und wird auf dem Titel als „Nouvelle Édition“ ausgegeben (Anhang A). Was es mit diesen Angaben für eine Bewandtnis hat, werden wir gleich näher betrachten. Im Gegensatz zu den früheren Ausgaben des Romans in der Amyot-Fassung, der Erstausgabe von 1559 und der folgenden der Jahre 1578, 1594, 1596 und 1608, ist diese Neuedition jedenfalls illustriert, demnach ist sie in dieser Übersetzung die erste mit Bildern, bestehend aus einem dekorativen gestochenen Titel und acht Tafeln, die die wichtigsten Ereignisse in eingängigen Szenen darstellen.
Erstaunlicherweise wurde dieses kleine Oktav-Bändchen sogleich als eine der großen Besonderheiten unter den Neuerscheinungen des Vorjahres von zweien der bedeutendsten literarischen Zeitschriften Frankreichs im Januar 1717 ausführlich besprochen. Ein Blick in diese Rezensionen bringt immerhin etwas Licht in die Rezeptionsgeschichte. Und hier zeigt sich Bemerkenswertes: Das eher auf die Unterhaltung des Publikums ausgerichtete Journal Le Nouveau Mercure beließ es nicht bei einer einfachen Besprechung der Ausgabe, sondern lieferte gleich noch eine umfangreiche Nacherzählung des gesamten Inhalts des Romans mit ( Mercure de France, Januar 1717, S. 81–126). Dies sei nötig, denn „les Amours Pastorales de Daphnis & Chloé … sont devenuës trop à la mode, pour ne pas satisfaire à la curiosité des personnes qui ne les ont pas encore lûës.“ Eine frappierende Aussage, der man ein großes Ausrufezeichen und ein noch größeres Fragezeichen hinzufügen möchte. Bei der Auswahl der Literatur für derartige Auszüge richte sich die Zeitung ganz am Geschmack des Publikums aus, wie man ausdrücklich vermerkte, und nur besonders interessante Werke würden in solchen Zusammenfassungen vorgestellt. In diesem Kontext zitiert der Rezensent auch das schon erwähnte Urteil Huets über den Stil des Longus. Wie kam er aber zu der Behauptung, der Roman gehöre bereits zur Literatur „ à la mode“? Meinte er wirklich das Werk oder nur das Genre, dem es angehört? In jedem Fall zeigt der lange Artikel in diesem bedeutenden Periodikum, daß man tatsächlich ein großes Interesse am Roman des Longus ausmachte, erwartete oder zumindest zu wecken hoffte. Man hätte den Inhalt sonst wohl kaum auf immerhin 43 Druckseiten wiedergegeben, wäre man nicht selbst von der Gunst der Leser überzeugt gewesen.
Die andere Rezension, die wir oben schon erwähnten, erschien im noch renommierteren
Journal des Sçavans am 4. Januar 1717 auf den Seiten 14 und 15. Wie in dieser wissenschaftlichen Zeitschrift üblich, sind hier die volle Titelei, das Impressum und sogar Format und Kollation der Neuerscheinung angegeben: „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy. 1716. In 12. pp. 220. Planches IX.“ Betonte der Mercure de France die Popularität des Werks an sich, so stellte das Journal des Sçavans vor allem den philologischen Wert dieser neuen Ausgabe heraus, denn sie unterscheide sich in mehreren Passagen gegenüber der früheren, indem sie Fehlstellen geschlossen habe, insbesondere eine größere im ersten Buch, ergänzt nach der Übersetzung des Marcassus. „En un mot, on n’a rien oublié de ce qui pouvoit orner ce petit volume. La beauté du papier, la netteté des caractères, & surtout l’élégance de plusieurs gravures qui mettent sous les yeux les avantures les plus intéressantes de ces Pastorales, contribueront à les faire lire avec beaucoup plus de plaisir. C’est grand dommage qu’on n’en ait tiré qu’un très-petit nombre d’Exemplaires.“ Außerdem wird hier erwähnt, die alte Amyot-Ausgabe sei inzwischen selten geworden, schon deswegen wäre diese Neuausgabe so wichtig. Sehr interessant ist, daß hier Angaben zur Auflagenhöhe gemacht werden, wenn auch ohne Nennung konkreter Zahlen.
Nun hatte zwar auch der Verleger selbst in seinem „Avis au lecteur“ die neue Ausgabe angepriesen, etwas hochtrabend sicherlich, mit den Worten „tout le monde le souhaite“, doch ist das eher als Verkaufsargument zu werten, denn als echte eigene Überzeugung. Die wohl zutreffende Behauptung in der Rezension, daß nur eine geringe Anzahl von Exemplaren gedruckt worden ist, weist deutlich darauf hin, daß der Verleger in Wirklichkeit davon ausging, nur einen recht bescheidenen Kreis von Lesern zu erreichen. Die Rezensenten hingegen schätzten das Publikumsinteresse sogleich bedeutend größer ein, ja sie zählten das Werk bereits zur Modeliteratur. Der Verleger dürfte kaum mit so positiver Aufnahme gerechnet haben – die erste Ausgabe war, wenn man so will, ein echter Überraschungserfolg. Und hier wird auch der Anlaß erkennbar, warum schon bald weitere Longus-Ausgaben folgen sollten. Doch bevor wir uns den anderen beiden Drucken widmen, ist die Frage zu stellen, wer denn der Verleger der Pariser Ausgabe des Jahres 1716 gewesen ist, der sich hier ganz offensichtlich hinter dem Namen des großen alten Verlagshauses Cramoisy verborgen hat. Offenbar hat er das Richtige zur rechten Zeit veröffentlicht, hat mit den Illustrationen den Geschmack der Leserschaft getroffen und so viel editorische Arbeit geleistet, daß er eine auch wissenschaftlich interessante Neufassung erstellen konnte. Irgendein Winkeldrucker kann er also gewiß nicht gewesen sein.
Zur Klärung dieser Frage haben die Bibliographen bis heute nicht viel anzubieten, daher scheint es an der Zeit, die Problematik näher unter die Lupe zu nehmen. Sucht man in den weltweiten Bibliothekskatalogen nach dem genannten Impressum der Erben von Cramoisy, so wird man nur mit unserer Ausgabe und ihrem Nachfolger des Jahres 1717 fündig, der ein gleichlautendes Impressum trägt. Wer waren also die vorgeblichen Erben des berühmten Pariser Verlagshauses, die ja kaum nur diese beiden Drucke produziert haben dürften?
Der Verlag Cramoisy hatte seine Blütezeit im mittleren bis späten 17. Jahrhundert, als Sébastien Mabre-Cramoisy bis zur Leitung der Imprimerie Royale aufgestiegen war, doch endete sie spätestens 1698 unrühmlich mit der Liquidation des Hauses. Vereinzelt erschienen zwar noch Drucke unter dem Impressum der Witwe Mabre-Cramoisy und anderer Vertreter der Verlegerfamilie zu Beginn des 18. Jahrhunderts, doch wurden die Pressen 1709–15 veräußert. Das Haus der Librairie aux deux cigognes und seine Schriften kaufte im Jahre 1715 der aus einer Limosiner Verlegerfamilie stammende Jean-Joseph Barbou von den Erben der Witwe. Ab diesem Zeitpunkt gab es keine als Verleger tätigen realen Erben Cramoisys mehr, wohl aber einen legitimen Nachfolger. Nun hatte Barbou längst schon Reputation erlangt und veröffentlichte seine Drucke vor und nach der Übernahme weiterhin unter dem eigenen Namen. Indessen hat er aber die Druckermarken des Hauses, in dem er jetzt auch residierte, übernommen, insbesondere jene mit den zwei Schwänen. Unsere Longus-Ausgabe von 1716 trägt auf dem Titel nur eine kleine bescheidene Marke mit drei Blumen, die derjenigen eines Blumenkorbes, wie er vor allem in der Spätzeit des Hauses Cramoisy vorkommt, sehr ähnlich ist.
Es dürfte sich dabei um eine Vignette aus dem Formenschatz Cramoisys handeln, die hier als Druckermarke Verwendung gefunden hat.
War nun Barbou der Drucker unserer Ausgabe? Und warum firmierte er einzig hier unter dem Namen Cramoisy? Aufschluß darüber kann eine sechsbändige Vergil-Ausgabe geben, die Barbou im selben Jahr 1716 publiziert hat. Sieht man dieses ambitionierte Werk durch, so fallen einem sofort Gemeinsamkeiten in der Typographie und Satzgestaltung auf, in Sonderheit aber einige aus typographischen Elementen gestaltete Zierleisten. Ähnlichkeiten finden sich viele, und im fünften Band wird man auf Seite 116 auch mit einer Übereinstimmung fündig, der recht komplex gestalteten ornamentalen Zierleiste über den Notes critiques et dissertations sur le septième livre de l’Enéide, die bis ins Detail jener über der Préface unserer Longus-Ausgabe entspricht. Von großer Ähnlichkeit sind auch die Kopfzierleisten über der Widmung im Longus und am Beginn des zehnten Buchs der Aeneis (Band VI , S. 4). Vergleicht man die Einzelelemente der Zierstücke, so erkennt man, daß sie alle demselben Setzkasten entstammen. Bedeutender als dieser formale Zusammenhang ist aber, daß auch die Vergil-Ausgabe von 1716 Kupfertafeln der Stecherfamilie Scotin enthält; sie sind signiert „G. Scotin major“, nach Thieme/ Becker [ALBK , Bd. XXX , S. 406] ist dies Gérard Jean-Baptiste, der ältere Bruder des ersten Illustrators von Daphnis und Chloe, Jean-Baptiste Scotin. Doch ganz so einfach, wie es scheint, ist die Identifizierung dann doch nicht. In seiner Geschichte des Verlagshauses Barbou, die Paul Ducourtieux 1896 publiziert hat, macht er zur Verlagsübernahme und der Vergil-Ausgabe folgende Angaben: „En 1715, il [JeanJoseph Barbou] acheta, aux héritiers de la veuve Mabre-Cramoisy, avec le fonds de la librairie, la maison que celle-ci occupait, près de l’église Saint-Benoit, et à partir de cette date ses ouvrages porteront l’ancienne marque des Cramoisy et leur enseigne: Aux Cigognes. Le 8 avril 1715, nouvel achat, celui-ci fait à Guérin, comprenant les Pensées édifiantes, de l’abbé de Bellegarde, du Candidatus Juvencii, du Commiri Carmina et du Virgile du P. Catron en six volumes, avec figures. Cet ouvrage avait dû être imprimé par Guérin, auquel Jean-Joseph Barbou avait fourni le papier…“ [S. 289]
Guérin war demnach offenbar der Drucker der Pariser Vergil-Ausgabe von 1716, er hat sie für den Verleger Barbou angefertigt. Dabei arbeiteten beide sehr eng zusammen, bis hin zur Papierbelieferung. Unserem Vergleich zufolge muß Guérin also der Drucker der Daphnis-und-Chloe-Ausgabe gewesen sein, die 1716 unter dem Impressum „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ erschienen ist. Der Name Guérin läßt aufhorchen, wird er doch gewöhnlich im Zusammenhang mit der Longus-Ausgabe des Jahres 1731 genannt. Und wieder hilft der Vergleich der typographisch gesetzten Ornamentleisten weiter. Am Kopf mehrerer der „Notes critiques et dissertations“ zu den einzelnen Büchern der Aeneis im vierten Band befindet sich eine wiederholte Zierleiste, die aus einer doppelten Reihe von Einzelelementen besteht, in horizontaler Spiegelung angeordnet. Nimmt man nur die obere Reihe allein, so ist diese identisch mit der Zierleiste der
Longus-Ausgabe des Jahres 1731, die bezeichnenderweise auch hier oberhalb von „Notes“ erscheint, nämlich den nun erstmalig abgedruckten Anmerkungen des Lancelot zu Longus (allerdings nur in jener Druckvariante, wie sie in dieser Sammlung das Exemplar der Pompadour zeigt, unsere Nummer XXI).
Hier nimmt offenbar eine längere Traditionslinie der Pariser Ausgaben ihren Anfang, die, wie wir noch sehen werden, bis 1745 und selbst darüber hinaus nachverfolgbar ist. Barbou hat die Ausgabe des Jahres 1716 von Guérin drucken lassen, wie er es auch mit anderen Ausgaben dieser Zeit gemacht hat, um sie als Verleger zu vermarkten. Daß er sie unter dem sonst für ihn unüblichen Impressum des übernommenen Verlagshauses Cramoisy herausgebracht hat, mag damit zusammenhängen, daß er vielleicht Schaden für sein Renommee durch diese Art von Literatur befürchtete, bestand sein sonstiges Verlagsprogramm doch weitgehend aus theologischen Schriften und Ausgaben der großen, anerkannten Schriftsteller der Antike, zu denen Longus in dieser Zeit noch nicht unbedingt gezählt werden konnte.
Was aber hat es mit der zweiten Ausgabe des Jahres 1716, deren Druckvermerk lautet „A Amsterdam, Chez les Freres Westin“, für eine Bewandtnis? Stellt man sie dem kollationsgleichen Pariser Druck gegenüber, so wird sofort deutlich, daß es sich hierbei um eine klassische Titelauflage handelt, denn allein der Titel wurde verändert, mit neuem Impressum versehen, sonst ist alles beim Alten geblieben, einschließlich der Stiche und gewisser setzerischer Unebenheiten. Selbst das Druckpapier scheint dasselbe zu sein. Wenn wir also davon ausgehen dürfen, daß die Setzerwerkstatt nicht nach Amsterdam übergesiedelt ist, dann wurde auch dieser Druck in Paris hergestellt, und zwar wohl wiederum durch Guérin für Barbou.
Eine solche Titelauflage läßt sich eigentlich nur verkaufsstrategisch erklären: Der Verleger Barbou suchte, in Paris zu wenige Kaufinteressenten vermutend, noch einen anderen Markt für seine Ausgabe, und natürlich war der neben Paris und London in Europa zu dieser Zeit führende Handelsplatz für Bücher, insbesondere französischsprachige, seine erste Wahl: Amsterdam. Diese Entscheidung hatte wohl auch persönliche Gründe, denn nach Ducourtieux gab es in Amsterdam einen Zweig der Familie Barbou, der aus Händlern und Bankiers bestand [ebenda, S. 70 f.]. Wie es konkret vor sich gegangen ist, daß Jean-Joseph Barbou in dieser Stadt mit seinem Druck Fuß fassen konnte, wissen wir zwar nicht, doch war es natürlich naheliegend, ihn unter dem Impressum des bedeutenden Amsterdamer Verlegers Wetstein anzubieten – „Westin“ ist eine falsche, aber in Frankreich zu dieser Zeit nicht unübliche Schreibweise. Der Druck wurde Wetstein untergeschoben, wir schließen einmal aus, daß es sich hier um eine offizielle Zusammenarbeit gehandelt haben könnte. Unter diesem Impressum war es möglich, die neue Longus-Ausgabe nun in Holland problemlos in den Buchhandel zu bringen – vielleicht auch das ein Grund, warum Barbou bei der Pariser Ausgabe nicht seinen wirklichen Namen genannt hat – er wird den Export nach Holland bereits mit eingeplant haben.
Doch die Reaktion von dort ließ nicht lange auf sich warten, man zahlte in gleicher Münze zurück. Schon im Folgejahr erschien eine Ausgabe, die tatsächlich in Amsterdam gedruckt worden ist, wie wir gleich sehen werden, die aber kurioserweise wiederum das Impressum „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ trägt. Offenbar hat hier ein holländischer Verleger in der gleichen Absicht, allerdings in umgekehrter Richtung gehandelt. Waren doch in Paris nur wenige Exemplare der ersten „Cramoisy“-Ausgabe gedruckt worden, der Bedarf für eine zweite Ausgabe also vorhanden. Was wir über diese dritte Daphnis-und-Chloe-Ausgabe erschließen können, sei hier kurz zusammengefaßt. Sie unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von der ersten. Schon auf dem Titel ist eine andere Druckermarke mit Krone und kräftigem Akanthusornament zu sehen, die ein wenig jenen Signets ähnelt, die Mabre-Cramoisy in früherer Zeit, um 1660/70, verwendet hat. Aber nicht nur der Titel wurde verändert, sondern auch der Text völlig neu gesetzt, doch stimmt die Kollation überein, wenn man von einem absieht: zwischen Vorstücken und Haupttext sind sechs unpaginierte Blätter eingeschoben, die einen Verlagskatalog enthalten, und zwar jenen des Emanuel Du Villard, Buchhändler in der Kalverstraat in Amsterdam. Dieser Katalog, der zahlreiche Schriften verzeichnet, ist ein fester Bestandteil des Drucks, was die Kustode am Ende der Préface belegt. Der Amsterdamer Verleger, Drucker und Buchhändler Du Villard hat hier eine Ausgabe produziert, die ohne jeden Zweifel nicht mit Barbou abgestimmt gewesen ist. Spätestens wenn man die Tafeln betrachtet, erlangt man darüber letzte Sicherheit, liegen diese doch in seitenverkehrten, nicht von Scotin stammenden Nachstichen vor, formal verändert, mit schmalen Rahmen versehen, in anderer Zuordnung zu den Seiten, auch ohne Signaturen, und zudem ist eine Tafel gegen eine andere ausgetauscht worden. Bei Seite sieben ist die Auffindung des Daphnis zu sehen, dafür fehlt die Szene mit Philetas und dem Eroten im Obstgarten. Kurz gesagt: Du Villard lagen die originalen Druckplatten nicht vor – wie sollten sie auch, bei einem Raubdruck! Der Buchschmuck wirkt stellenweise allerdings sogar wie verbessert und bereichert, und einige der ornamental aufwendigeren Bordüren wurden typographisch nachgesetzt oder analog gestaltet. Derartige Bordüren finden sich auch schon in Drucken Du Villards aus dem Jahr 1716, etwa in den Essais de morale des Jean La Placette, beispielsweise am Kopf von Seite XI im ersten Band. Du Villard, der aus Genf gekommen war und erst in diesem Jahr 1716 in Amsterdam in die Buchhändlerzunft aufgenommen worden ist, hatte sich wohl schon zuvor am Formenrepertoire des Pariser Buchdrucks dieser Zeit bedient; er war damit offensichtlich sehr gut vertraut. Und auch die Essais de morale enthalten im vierten Band seinen Bücherkatalog, in dem Du Villard, wie in demjenigen der Longus-Ausgabe, zahlreiche Werke aufführt, mit denen er handelte. Im Jahre 1716 ist jedoch noch kein Longus in seinem Katalog enthalten gewesen, auch keiner eines anderen Hauses.
Mit diesem nicht autorisierten Druck, der ersten tatsächlich in Amsterdam erschienenen Longus-Ausgabe, hat Du Villard den Ursprung einer Linie, die bis in die zweite
Jahrhunderthälfte reichen sollte, begründet. Sie führt weiter zu seinem späteren Geschäftspartner François Changuion, der 1734 eine eigene Ausgabe publizierte, setzt sich dann fort mit Evert Van Harrevelt, der wiederum mit Changuion kooperiert hat und die kaum bekannte Ausgabe von 1749 druckte, welche ihrerseits die Reihe der großartigen Editionen von Jean Néaulme aus der Zeit von 1750–1764 vorbereitete – bis hin zu der späten Ausgabe von 1794, die auch noch ein Amsterdamer Impressum trägt.
Unsere Darstellung der Geschichte der ersten drei Ausgaben, die mit der kuriosen Erkenntnis endet, daß wir es bei der zweiten und der dritten Edition mit einer angeblichen Amsterdamer Ausgabe zu tun haben, die sich aber als Pariser Druck entpuppt, und einer fingierten Pariser Ausgabe, die in Wirklichkeit aus Amsterdam stammt, kann sich so weit auf die ältere Forschung stützen, als auch diese bereits erkannt hat, daß im mindesten der dritte Druck ein falsches Impressum trägt und nicht von einem Pariser, sondern dem Amsterdamer Verleger Du Villard produziert wurde. Dieses Verdienst kommt Jean Marchand zu, der den Sachverhalt als erster in seiner Contribution à la bibliographie de Daphnis et Chloé dargelegt und auf die Verlagsanzeige hingewiesen hat. Auch Isabella Henriette van Eeghen ist in ihrer Geschichte des Amsterdamer Buchhandels zu dem Schluß gekommen, daß Du Villard die Ausgabe von 1717 anhand der Pariser „Cramoisy“-Edition des Vorjahrs nachgedruckt und unter diesem Namen publiziert hat [Bd. I, S. 42 f. und II , S. 233–38].
Die Regentenausgabe des
Nimmt man nach der eingehenden Betrachtung dieser ersten drei Drucke ein gutes Exemplar der zurecht berühmten Édition dite du Régent des Jahres 1718 zur Hand und zieht dann einen Vergleich, so läßt sich der Gesamteindruck in drei Komparativen zusammenfassen: edler, feiner und aufwendiger ist diese neue Ausgabe geraten. Man merkt dem Druck an, daß sich in ihm ein ganz anderer Anspruch manifestieren soll, der ihn nicht nur von seinen Vorgängern dezidiert abzusetzen vermag, sondern auch vom Alltäglichen und Durchschnittlichen gewöhnlicher belletristischer Ausgaben der Zeit. Damit sei allein der Druck charakterisiert, einschließlich des Buchschmucks, ohne jedoch die Tafel-Illustration in diese Wertung zunächst einzubeziehen. Da die Schrift um einiges kleiner ausfällt, konnte der Umfang des Bandes deutlich verringert werden, von 220 auf nur noch 164 Seiten. Indessen bleibt der Text sehr gut lesbar, denn die Typographie ist regelmäßig, klar und scharf; zudem erfolgte der Satz sauber und fehlerlos; es gibt hier keine Ausbrüche, schiefe Zierleisten und die üblichen Setzerfehler, wie sie ty-
pisch für viele der schnell und oberflächlich produzierten Druckerzeugnisse am Beginn des 18. Jahrhunderts sind. Eine routinierte Werkstatt war hier tätig, und diese arbeitete durchgängig mit großer Sorgfalt. Hinzu kommt die Verwendung des Kupferstichs für die Initialen, was man in dieser Zeit nurmehr wirklich besonderen Drucken angedeihen ließ.
Die Kapitalbuchstaben sind hier vor einen feinen Hintergrund aus floraler Ornamentik gesetzt. Gerade anhand derartiger Details merkt man dieser Ausgabe die Noblesse an, mit der sie sich von ihren Vorgängern abhebt. Und doch wird man im Vergleich mit diesen auch eine Reihe von Analogien feststellen können, am besten zu sehen anhand der Zierleisten. Aus sehr ähnlichen Elementen zusammengesetzt, fallen die formalen Lösungen in der Regentenausgabe allerdings gleichmäßiger und feiner aus. Sorgfalt im Detail, Harmonie im Gesamten, das charakterisiert den Druck der Regentenausgabe – als hätte man das noch rohe Formengut der ersten Drucke hier zurechtgeschliffen, aufpoliert und in jeder Hinsicht ansprechender gemacht.
Der Zusammenhang zwischen den Editionen wird allerdings am Beginn des Haupttextes des Romans in unerwarteter Weise deutlich, auf der Eröffnungsseite zum ersten Buch, wo sich zuvor noch eine beliebige ornamentale Kopfzierleiste befunden hatte. Diese wichtige Stelle wird in der Regentenausgabe durch eine liebliche, feine Kopfvignette in Kupferstich ausgezeichnet, die in ihrer bukolischen Motivik auf den Inhalt des Textes vorausweist. Doch nicht nur das macht sie zur Besonderheit, verrät sich in ihr doch ein ganz spezieller Zusammenhang mit den vorhergehenden Ausgaben. Der kleine Stich ist nämlich von Jean-Baptiste Scotin signiert, dem Stecher und wohl auch Entwerfer der ersten Illustrationsfolge. Unter Verwendung der damals neuesten Ornamentform des Régence, dem feinen Bandwerk, gestaltete Scotin hier einen Beitrag, der sich, wenn man die miniaturhafte Darstellung genauer betrachtet, als Übertragung des vormaligen ganzseitigen Kupfertitels in eine Vignette erweist. Die Attribute des Bukolischen sind hier zu sehen, in der Mitte zwei spielende Eroten und, als augenfälligster Hinweis auf die Anknüpfung, links der Hirtenhund und rechts das Schaf, die beide ganz so aussehen wie auf dem vormaligen Titel. Diese Zitate sind sicherlich eine Anspielung auf das Beste, was die früheren Ausgaben zu bieten hatten, und das waren zweifelsohne ihre Kupfertafeln und der zugehörige Titel; für Scotin mag dieser Auftrag ein kleiner Trost dafür gewesen sein, daß seine alte Suite nun der des Regenten weichen mußte. Konnte er doch durch diese Vignette mit seiner Kunst auch in der Neuausgabe präsent sein, und das sogar an prominenter Stelle. Man kann dieses Zitat aber auch dahingegend interpretieren, daß die älteren Ausgaben nun durch Neues und Besseres abgelöst werden, die Vignette ist bloße Reminiszenz. In all dem wird evident, daß die Ausgabe von 1718 keineswegs unvorbereitet entstanden ist. Zumindest die Kenntnis der zwei Jahre zuvor erschienenen Pariser Edition darf in jedem Fall vorausgesetzt werden, selbstredend auch ihrer Illustrationsfolge; davon ausgehend wurde der vorliegende Druck gestaltet. Typographisch stellt er vieles in den
Schatten, was um diese Zeit in Frankreich entstanden ist. Er überzeugt durch außergewöhnliche Formschönheit und Eleganz. Man denke nur daran, wie manche Exemplare im 18. Jahrhundert geradezu veredelt worden sind, pretiöse Bindungen größten Aufwands hat man ihnen angedeihen lassen, darunter Mosaik- und reichste Dentelle-Einbände eines Padeloup oder Lemonnier im frühen und mittleren 18. Jahrhundert wie auch die herrlichen Arbeiten Deromes aus der Zeit um 1785 – Ausdruck der Wertschätzung für ein Druckerzeugnis, dessen Bedeutung und Qualität schon die Zeit erkannt und in entsprechender Weise gewürdigt hat, von den Ergüssen überbordender Pracht, mit denen das 19. Jahrhundert singuläre Exemplare dieser Ausgabe zuweilen versehen hat, ganz zu schweigen.
Daß sich der Drucker nicht verrät, ja der Titel nicht einmal einen Ort angibt, hat die Forschung immer schon damit erklärt, daß diese Ausgabe für Herzog Philipp von Orléans, der sich 1718 bereits im dritten Jahr der Regentschaft von Frankreich befand, persönlich geschaffen worden ist und er an ihrer Entstehung selbst mitgewirkt haben dürfte. Somit lag die Vermutung natürlich nahe, die Ausgabe könne von Antoine-Urbain I. Coustelier gedruckt worden sein, war dieser doch der Libraire-Imprimeur des Herzogs und hat als solcher für ihn insbesondere einige Ausgaben der älteren französischen Dichtung hergestellt. Man findet Coustelier beispielsweise schon im Verkaufskatalog von Guillaume de Bure aus dem Jahr 1786 als Drucker angegeben (ein Exemplar der „Edition originale“ von 1718 ist hier unter der Nummer 1308 verzeichnet). Hingegen führte der große Bibliophile und Buchhändler Auguste-Antoine Renouard, der als einer der Ersten versuchte, den Drucker anhand von Quellen zu identifizieren, das Pariser Verlagshaus Quillau an. Bis heute werden die beiden vorgeschlagenen Drucker in der Literatur, gerade auch in den unzähligen Antiquariatskatalogen, permanent wiederholt und mit Fragezeichen versehen. Die Problematik besteht darin, daß schon im 18. Jahrhundert über diese Frage lediglich spekuliert worden ist. Alleine anhand der Quellenüberlieferung ist sie also kaum endgültig zu klären. Will man hier weiterkommen, muß man auch andere Methoden einbeziehen, etwa diejenigen der analytischen Druckforschung. Wir wollen dies hiermit anregen und auch einen Vorschlag unterbreiten.
Für ein derart schönes Schriftbild, wie es die Regentenausgabe des Jahres 1718 zeigt, unter Verwendung solch klarer Drucktypen und bestimmter satztechnischer Besonder- und Eigenheiten, findet man in dieser Zeit wenig wirklich Vergleichbares. Man sollte vielleicht dort suchen, wo die besten handwerklichen Standards galten und das typographische Niveau am höchsten war. Sicherlich ist das bei den genannten Verlegern Coustelier und Quillau durchaus der Fall gewesen, zumindest bei anspruchsvolleren Drucken, doch in Frage kommen ebensogut die Pressen der Imprimerie Royale. Zieht man etwa die Suite des mémoires de l’Academie Royale des Sciences, ein von der königlichen Druckerei hergestelltes Periodikum, zum Vergleich heran, so wird man dort nicht nur Schrifttypen und eine Gestaltung des Schriftbildes vorfinden, die unserem Druck ganz ähnlich
sind, sondern auch dieselbe Disziplin und Sorgfalt bei der Herstellung. Von 1707–1723 hatte der Pariser Drucker Claude Rigaud die Leitung der Imprimerie Royale inne. Im Druckjahr 1718 erschienen dort die Maximes pour la conduite du prince Michel, roy de Bulgarie. Stellt man hieraus etwa die Seite 7 mit dem Beginn des Avertissement der entsprechenden Seite aus der Regentenausgabe gegenüber, bleibt zu konstatieren, daß sich Schriftbild und Typographie zum Verwechseln ähnlich sehen. Wie bei Bernard in seiner Geschichte der Imprimerie Royale nachzulesen ist, wurden im Jahre 1718 dort nur zwei Werke gedruckt, jene, die wir hier schon erwähnt haben, und damit deutlich weniger als in den vorangehenden und den folgenden Jahren, in denen jeweils mindestens vier Drucke erschienen sind. Die Annahme, daß in diesem Jahr ein weiterer, quasi inoffizieller Druck entstanden sein könnte, erhält auch von der Seite Unterstützung, daß die Zahlungen für dieses Jahr im Verhältnis zu den beiden dokumentierten Drucken recht üppig ausgefallen sind [Bernard, Histoire de l’Imprimerie royale, S. 164 und 268]. Die Vermutung, der Druck könne ein Werk Rigauds und der Imprimerie Royale sein, hat schon Isabella Henriette van Eeghen in ihrer Geschichte des Amsterdamer Buchhandels aufgrund einer alten Notiz in einen Exemplar der Ausgabe von 1717 geäußert (heute in der Universitätsbibliothek von Leiden). Dieser Vermerk soll von der Hand des 1756 verstorbenen Bibliographen Prosper Marchand stammen [Eeghen, Amsterdamse boekhandel, Bd. II , S. 235 und 237]. Unseres Wissens hat das aber zu keinen weiteren Forschungen in diese Richtung geführt. Wir belassen es hier zwar ebenfalls bei dem Hinweis auf diese Erklärungsmöglichkeit, hätten aber schon viel damit erreicht, wenn dies dazu führen würde, endlich gründlicher zu recherchieren, statt in aller Ewigkeit zwei Namen zu wiederholen, um diese dann mit Fragezeichen zu versehen.
Nun ist neben der Identität des Druckers auch der Anteil des Regenten an dieser Ausgabe seit jeher umstritten. Die Illustrationen tragen zwar seinen Namen als entwerfenden Künstler und das Datum 1714, doch von der Herstellung der Ausgabe ist nur wenig Konkretes bezeugt, das meiste von dem, was heute in Bibliographien und Händlerkatalogen zu lesen ist, beruht auf Annahmen, die seit dem späten 18. Jahrhundert kursierten. Der Überlieferung nach sei die Ausgabe von 1718 in nur 250 Exemplaren gedruckt worden, die der Regent in erster Linie als Geschenke für Freunde bestimmt habe, doch wissen wir, wie Barber es zusammenfaßt, mit Sicherheit nicht mehr, als daß diese Ausgabe eng mit seinem Namen verbunden ist: „No explicit contemporary evidence appears to exist confirming the duke’s participation and the extent to which he was personally responsible for the illustration has been doubted, but the close association of the book with him appears to be well established.“ [Barber, Rothschild, Bd. I, S. 211]. Über die Hintergründe ihrer Entstehung ist bis heute kaum etwas bekannt, das auf belegbaren Fakten beruhen würde, was natürlich auch für die Bezüge der verschiedenen frühen Ausgaben untereinander gilt, wie etwa Grivel ganz zurecht betonte: „Mais il est, en réalité, extrêmement difficile de démêler l’histoire des différents tirages et éditions et les notices de
Brunet ou de Cohen ne permettent pas vraiment de s’y retrouver.“ [Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé, S. 38]. Als Beispiel nennt sie das Exemplar im Département des Estampes et de la Photographie der Bibliothèque Nationale, das nachweislich vor 1731 gedruckt worden sein muß, aber bereits die Anmerkungen des Antoine Lancelot enthält, die erst zu späteren Ausgaben gehören, vermutend, es könne sich hierbei um ein Exemplar einer angenommenen ersten Fassung des Jahres 1717 handeln, die nur für den Regenten hergestellt worden sei, doch bleibt auch dies Spekulation.
Charles Nodier merkte schon 1829 an, daß Chastre de Cangé, der erste Kammerdiener des Regenten, der Herausgeber der Ausgabe von 1718 gewesen sein könnte [Nodier, Mélanges, S. 219], immerhin hat sich in seinem Besitz eine Restauflage befunden, die erst 1784 in den Handel gelangt ist. Diese soll eine Vorzugsausgabe auf besserem Papier sein. Hier kann unser Katalog allerdings wenig zur Unterscheidung beitragen, da fast alle unsere Exemplare auf großem und qualitativ hochwertigem Papier vorliegen (eine Ausnahme macht vielleicht die Nummer VIII; hier wurde allerdings ein Exemplar auf kleinem Papier nachträglich durch Anrändern auf Großquart gebracht). Einzelne Exemplare, wie etwa die Nummer X, zeigen immerhin nahezu die maximale Papiergröße, da sie fast nicht beschnitten sind, und diese ist für den Textspiegel des Kleinoktav-Formats sehr beachtlich, ganze 16,6 x 10,7 cm. Antoine Augustin Renouard bemerkte dazu schon 1819: „On n’avoit pas encore remarqué qu’il a été tiré deux sortes d’exemplaires de cette rare et curieuse édition (…) Ce grand papier est aussi plus blanc, et de plus belle qualité“ [Catalogue de la bibliothèque d’un amateur, Bd. III , S. 186; siehe auch Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1157]. Diverse Wasserzeichen weisen auf die Papiermühle hin, klar erkennbar ist eine fünfblättrige Blüte in Kombination mit den Buchstaben A und M, es handelt sich wohl um papier d’Auvergne. Laut Katalog waren es 52 ungebundene und unbeschnittene Exemplare, die 1784 auf der berühmten Pariser Auktion von ArmandPierre-François Chastre de Cangé, Sieur de Billy, dem Sohn des Kammerdieners, zum Verkauf gelangten. Dieser hatte die übriggebliebenen Exemplare der Ausgabe von 1718 geerbt, ausschließlich die besseren, auf großem „papier fin“, wie man annimmt [vgl. Barber, Daphnis and Chloe, S. 36]. Von diesen Exemplaren, unter denen einzelne tatsächlich noch geringe Spuren der ungeschützten einbandlosen Lagerung des 18. Jahrhunderts aufweisen (wie etwa unsere Nummer XIV), sind einige in Meistereinbänden des späten 18. Jahrhunderts überliefert. Eine Reihe davon sind vorzügliche Arbeiten Deromes des Jüngeren, ein von uns erstellter Zensus bekannter Exemplare umfaßt deren 16, davon zwei in unserem Katalog, die Nummern XIII und XIV.
Wenn wir uns jetzt noch dem eigentlichen Kernstück der Regentenausgabe widmen, dem berühmten Kupferstichzyklus, der als Suite du Régent bekannt geworden ist, sowie der mit ihm konkurrierenden Scotin-Folge, so sei zuvor ein kurzer Rückblick auf das gestattet, was dieser erstmalig zu größerer Bekanntheit gelangten Longus-Illustration vorausgegangen ist.
Gute 90 Jahre liegen zwischen der ersten illustrierten Daphnis-und Chloe-Ausgabe, erschienen 1626 bei Toussainct Du Bray in Paris, und ihrer Nachfolge im französischen Sprachraum. Freilich sind die Ausgaben der Jahre 1716–18 mit diesem „Methusalem“ nicht direkt vergleichbar. Zum einen war der Übersetzer des Drucks von 1626 nicht Amyot, sondern Pierre de Marcassus, zum anderen ist die Illustration des Crispin de Passe für diese Ausgabe künstlerisch unbestreitbar erstrangig und steht auf einem weit höheren Niveau als die Zyklen zu Beginn des 18. Jahrhunderts, doch blieb sie ein Solitär und wurde in keiner weiteren Edition wieder aufgenommen. Wie fast alle Ausgaben des 16. und 17. Jahrhunderts hatte auch jene des Jahres 1626 nur geringe Verbreitung erlangt, ist heute ziemlich selten und muß schon zur Zeit ihres Erscheinens lediglich ein kleines, erlesenes Publikum erreicht haben. Aber auch unabhängig von der Buchillustration hat die literarische Vorlage seit dem frühen 16. Jahrhundert Künstler zu herausragenden Darstellungen, ja ganzen Bilderfolgen, angeregt. Exzellente Zeichnungen aus dem frühen 17. Jahrhundert sind etwa von Ambroise Dubois (1543–1624) überliefert, die, so weit erschlossen, einen Freskenzyklus für Schloß Fontainebleau vorbereiteten. Mehrere Gemälde von Paris Bordone, die Paare im bukolischen Umfeld zeigen und bereits aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammen, dürften ebenfalls Daphnis und Chloe darstellen, wenn auch die Bestimmung der pastoralen Liebenden nicht immer einfach und in den seltensten Fällen eindeutig ist. Gerade in der venezianischen Malerei und den von ihr ausgehenden Einflüssen setzte sich diese Tradition bis ins 17. Jahrhundert fort. Thema der Darstellungen ist allerdings nur das Liebespaar, nicht aber die Ereignisse des Romans. Bei dem Bilderzyklus von Crispin de Passe dem Jüngeren zur Pariser Ausgabe von 1626 handelt es sich um Simultandarstellungen mit mehreren Szenen im Hintergrund, die auf vier Kupfertafeln und einem Frontispiz erscheinen. Es lag in der Natur der Sache, daß diese komprimierte Form der visuellen Erzählung kaum zu einer ausgeprägten Ikonographie der Geschichte beitragen konnte.
Keine dieser früheren Illustrationen hat deshalb eine solch eindringliche Wirkung entfalten können, daß man sie sofort mit dem Roman des Longus in Verbindung bringen würde. Das gelang erst den Darstellungen des 18. Jahrhunderts, nicht zuletzt durch die
Ausführlichkeit der Bilderzählung, in Verbindung mit der Eingängigkeit der Bildsprache und natürlich auch die permanente Wiederholung und große Verbreitung. Text und Inhalt von Daphnis und Chloe waren schon im 17. Jahrhundert in ganz Europa weithin rezipiert worden und zumindest unter den Gelehrten gut bekannt, visuelle Umsetzungen des eo ipso nach Illustration verlangenden Stoffs blieben dagegen noch recht selten. Eine wesentlich weiterreichende Rezeption des Romans in Frankreich, in Verbindung mit seiner eigenen Bilderwelt und besonderen Ikonographie, setzte tatsächlich erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein.
Am Ende der Herrschaft des Sonnenkönigs, als sich ein deutlicher Wandel im Geistesund Kulturleben wie auch in den bildenden Künsten in Frankreich bemerkbar machte, war die Zeit offenbar reif dafür, auch den Roman des Longus wieder illustriert erscheinen zu lassen. Dafür mußten erst einmal neue und zeitgemäße Darstellungsformen gefunden werden. Das Erstaunliche ist, daß dann gleich zwei Illustrationszyklen fast zur selben Zeit erarbeitet worden sind. Leider wissen wir von der jeweiligen Entstehungsgeschichte kaum mehr als von derjenigen der zugehörigen Editionen, in denen sie zuerst veröffentlicht worden sind. Daß die eine Suite zwei Jahre vor der anderen im Druck erschienen ist, sagt nicht viel über das tatsächliche zeitliche Verhältnis aus, da für beide eine längere Vorbereitungszeit vermutet werden muß.
Die von Jean-Baptiste Scotin gestochene Folge wurde zuerst in der Ausgabe des Jahres 1716 bei Barbou in Paris publiziert, wie wir bereits gesehen haben. Dieser hatte an die in der Stadt ansässige Stecherfamilie Scotin auch schon andere Aufträge vergeben, insofern war die Zusammenarbeit an sich nichts Neues. Allerdings mußte Scotin hier Szenen illustrieren, für die er kaum direkte Vorlagen heranziehen konnte. Er erledigte diesen Auftrag routiniert, indem er gängige Kompositions- und Bildschemata aus der niederländischen und französischen Malerei des 17. Jahrhunderts für diese Folge adaptierte. Die acht Bildtafeln beschränken sich auf einzelne, besondere Szenen im Verlauf der Geschichte. Eine dichte und kontinuierliche Darstellungsfolge, die gemäß der Erzählung voranschreitet, ohne größere inhaltliche Sprünge, konnte hier gar nicht erst entstehen. Dies ist der fundamentale Unterschied zum Zyklus der Regentenausgabe, der mit seinen 28 Tafeln dafür sorgt, daß sich der Leser zu jeder neuen Episode, die im Roman vorkommt, auch an einem zugehörigen Bild erfreuen kann.
Die Darstellungen sind bei der Regentensuite so eng mit dem erzählten Geschehen verknüpft und an ihm ausgerichtet, daß das Gelesene dem Rezipienten das gesamte Werk hindurch unmittelbar vor Augen geführt wird. Text und Bild sind auf das Engste miteinander in Einklang gebracht, die Vermittlung des Inhalts erfolgt auf beiden Wegen, durch das Lesen und das Betrachten. Hinzu kommt, daß gut die Hälfte der Tafeln doppelblattgroß sind. Sie bringen nicht nur Variation in die Abfolge der Bilder, sondern setzen damit auch gewisse Zäsuren. In dieser Hinsicht erweist sich die Regentensuite, deren
Verhältnis zu ihrem Namensgeber wir unten noch behandeln werden, als ein Wegbereiter der Buchillustration am Beginn des 18. Jahrhunderts. Im vorangehenden Jahrhundert waren viele Ausgaben der Prosa, sieht man von den klassischen, seit langem anerkannten Texten einmal ab, nicht oder nur in geringem Maße illustriert – eine so ausführliche, den Text gewissermaßen begleitende Bebilderung findet man in dieser Zeit selten, sie war im Hochbarock in der Regel der Vorzug der Andachtsbücher und Heiligenviten; nur in Ausnahmefällen kam solches in der Belletristik vor, insbesondere nicht in solcher, deren Ikonographie noch kaum in der Kunst etabliert worden war. Das ausführliche Illustrieren von populärer schöner Literatur fand erst im späten 17. und dann vor allem im 18. Jahrhundert größere Verbreitung und wurde zum Standard, der entsprechende Erwartungen der Leserschaft erfüllte, in Aufwand und Qualität natürlich angepaßt an die jeweilige Käuferschicht. Insofern ist schon dieser erste, rein formal ausgerichtete Vergleich der beiden Suiten durchaus aussagekräftig, steht doch die Folge Scotins für eine ältere Konvention der nur sporadischen Anreicherung des Textes mit Bildern, während die Regentensuite hier eine fortschrittlichere Haltung offenbart, die man natürlich ebenso als Ausdruck von Großzügigkeit verstehen kann und sicherlich auch sollte. Fassen wir hier kurz zusammen, was man von der Entstehung beider Folgen weiß oder vermutet.
Schon bei der zeitlichen Einordnung bewegt man sich kaum auf gesichertem Boden. Die Datierung der ersten Pariser Ausgabe in das Jahr 1716 muß nicht die Entstehungszeit der Scotin-Suite angeben. Zu beobachten ist, daß selbst Exemplare der ersten beiden Ausgaben gewöhnlich Abzüge von mehr oder weniger stark abgenutzten Platten enthalten. Denkbar wäre, daß Scotin seinen Zyklus schon einige Jahre vor dem Textdruck separat veröffentlicht hat, immerhin hat die Folge ja ein eigenes Titelblatt, das stilistisch wesentlich älter wirkt als das Frontispiz, das Coypel 1718 für die Regentenausgabe geschaffen hat. Es könnte daher sein, daß die in einigen der älteren Bibliographien, unter anderem bei Gay und Lemmonyer sowie Hoffmanns Lexikon der griechischen Schriftsteller, angeführte Ausgabe des Jahres 1712, deren Nachweis uns nicht gelang, sich auf das separate Erscheinen von Scotins Suite bezieht, doch ist das nur Spekulation.
Sollte Scotins Stichfolge tatsächlich bis etwa 1712 zurückgehen, dann dürfte sie in einer Zeit entstanden sein, in der auch die Anfänge der Regentensuite vermutet werden können. Doch muß man trotz dieser möglichen zeitlichen Nähe von weitgehender Unabhängigkeit beider Folgen ausgehen. Bezüge zum Regentenzyklus finden sich nur bei zwei Darstellungen Scotins, und diese sind wohl eher zufälliger Art [vgl. Marchand, Contribution, S. 43]. Dennoch ist davon auszugehen, daß Scotin die Illustrationsfolge des Regenten gekannt hat, darauf weist auch eine Anmerkung in der Widmung hin, die den Ausgaben der Jahre 1716/17 vorangestellt ist (siehe dazu den Begleittext zur ersten Ausgabe des 18. Jahrhunderts, Anhang A). Scotin hat die Suite des Regenten jedoch nicht imitiert, und auch umgekehrt kann man nicht davon ausgehen, daß sich die Bilderfindun -
gen des Regenten und Coypels an Scotin orientiert hätten. Im Gegenteil – wir dürfen wohl annehmen, daß die Gemälde, die der Folge des Regenten zugrunde lagen, bereits entstanden waren, bevor ihre beiden Schöpfer den Scotin-Zyklus kennengelernt haben. Das Dunkel, das die Entstehung der Regentensuite umgibt, hat wohl einen wesentlichen Grund darin, daß diese Bilder als ein Teil der Chronique scandaleuse, die den Herzog von Orléans umgab, gesehen worden sind. Unschöne Gerüchte über ihre Entstehung waren bis zu seiner Mutter Liselotte von der Pfalz durchgedrungen: „Mais le fait le plus troublant aux yeux de l’opinion, c’était la publication par le régent de Daphnis et Chloé, avec vingt-huit gravures de lui, signées Philippus. En 1714, il avait commencé ces dessins, d’un crayon amoureux, cependant que, modèle de Chloé, sa fille, certifiaient les renseignés, posait, nue, devant lui. Pendant quatre ans, Philippe avait dissimulé ce trésor, et si aujourd’hui il le livrait au monde, c’est qu’il faisait ainsi, insinuait-on, comme un sorte d’aveu public.“ [Ransan, ?La vie privée, 172]. Was hier noch als moralischer Abgrund geschildert wird, das erlebte alsbald einen glanzvollen Aufstieg und erhielt den ehrenvollen Titel „Édition dite du Régent“. Die Stiche nach den Zeichnungen des Regenten, routiniert ausgeführt von dem Kupferstecher Benoît Audran, tragen das Datum 1714, sind aber wohl bis auf das Jahr 1712 zurückzuführen; dies ist einem Exemplar aus dem Besitz des Jean-Pierre Imbert Chastre de Cangé, premier valet de chambre, zu entnehmen, in dem sich ein autographer Eintrag des Herzogs selbst befindet [siehe dazu Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé, S. 36]. Philipp habe diese Zeichnungen zu seinem Zeitvertreib angefertigt. Nach Zeugnis des Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville schuf er Gemälde nach Entwürfen seines Lehrers Coypel, die dieser dann wiederum retuschiert haben soll. Wieweit die Anteile Coypels und die des Regenten reichen, wissen wir nicht konkret, ebenso verhält es sich mit den Gemälden und ihrem späteren Schicksal. Marianne Grivel hat dazu einiges an Dokumenten und Erkenntnissen zusammengetragen, was wir hier noch um wenige Aspekte ergänzen können. So führt sie an, Coypel habe fünf Gemälde nach Skizzen des Regenten ausgeführt, welche sich in Schloß Bagnolet befanden. Ursprünglich seien die Gemälde sämtlich für St. Cloud bestimmt gewesen, bald aber nach Bagnolet überführt worden. Dem widerspricht allerdings unser Exemplar Nummer LXI , das 1787 nachweislich nach dem Vorbild der Gemälde von St. Cloud koloriert worden ist, was der dortige Concierge auf jeder der Tafeln der gesamten Folge bestätigt hat. Der komplette Gemäldezyklus muß sich also noch in St. Cloud befunden haben. Eben zu dieser Zeit, 1787/88, erschien der Reisebericht des deutschen Schriftstellers Johann Jacob Volkmann, der um 1760 in Paris und der Umgebung unterwegs gewesen ist: „Bagnolet, eine kleine Meile von Paris, seitwärts von Vincennes. Der Herzog Regent von Orléans hatte dieß Landhaus sehr kostbar ausmöbliren lassen. Sein Sohn verkaufte die Kostbarkeiten, und ließ nur das nothwendige darinnen. In dem einen Zimmer sieht man verschiedene Gemälde aus dem Romane: Daphnis und Chloe, von Coypel gemalt. Zwey sehr
mittelmäßige darunter sind von der Hand des Herzog Regenten“ (Johann Jacob Volkmann, Neueste Reise durch Frankreich, Leipzig 1787/88, Bd. I, S. 512, im vierundzwanzigsten Brief; ein Urteil, das vielleicht auf Jean-Aymar Piganiol de la Force zurückgeht).
Diverse Schriftzeugnisse des 18. Jahrhunderts nennen immer wieder die Gemälde von St. Cloud als Vorlagen der Buchillustration: „…vingt neuf Planches gravées par Audran, sur les Desseins originaux de Feu Monseigneur le Duc d’Orléans, Régent de France, conservés à St. Cloud…“, wie es etwa im Verkaufskatalog des Verlegers Néaulme heißt, der die Ausgaben der Jahre 1754 und 1757 unter Verwendung der alten Tafeln gedruckt hat [Catalogue Néaulme 1763/65, Band III , Den Haag 1765, S. 34]. Wir gehen daher davon aus, daß alle Gemälde, die die Vorlage der Kupferstich-Suite bildeten, im Jahre 1787 noch in St. Cloud vorhanden waren. Bei den Gemälden von Bagnolet, die um 1760 in einem Raum, besser wohl: einem Kabinett, des Schlosses zu sehen waren, dürfte es sich dagegen um Darstellungen handeln, die nicht in den Zyklus eingegangen sind, vielleicht kleinere Zweitfassungen oder Entwürfe. Laut Volkmanns Urteil konnte man anhand der Qualität deutlich die Hände des akademischen Lehrers Coypel und seines herrscherlichen Schülers unterscheiden; beide waren daran beteiligt und hatten die Aufgabe unter sich aufgeteilt. So können wir es wohl für den gesamten Zyklus vermuten. Auch Tapisserien wurden nach diesem Zyklus gefertigt. In der Zusammenschau mit den Kupferstichen läßt dies ein Urteil über den Stil der Bilder zu: „Les tapisseries et les illustrations de Benoît Audran pour l’édition de 1718 du roman de Longus permettent de se faire une idée du style de ces ouvrages: ce celui, affaibli, d’Antoine Coypel“ [Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé, S. 37]. Dem ist generell zuzustimmen, wenn auch die teils überaus harte Kritik an den Schwächen der Darstellungen, die von Portalis und Beraldi bis Gordon Ray reicht, wohl doch etwas übertrieben sein dürfte. Einer derart schwachen Bilderfolge wäre kaum ein solcher Erfolg beschieden gewesen, da hätte selbst der hohe Name nicht viel geholfen. Die Illustration des Regenten mag viel Naives und Ungelenkes an sich haben, in der Komposition das Mittelmaß kaum überschreiten, ihre Figuren mehr theatralisch denn lebensvoll präsentieren, um doch damit einen Ton zu treffen, der die Erwartungen des damaligen Publikums, vorsichtig gesagt, zumindest nicht enttäuscht hat. Und das war dem Regenten bewußt – ein Mann seines Ranges hätte sich kaum durch die unter seinem Namen erfolgte Veröffentlichung einiger ungelenker Zeichnungen der Lächerlichkeit preisgegeben. Das Gegenteil war der Fall: der Regent war fraglos stolz auf diesen Zyklus. Das illustrierte Buchprojekt war von ihm gewollt und Coypel allem Anschein nach damit beauftragt worden, die Ausgabe zu produzieren, weshalb er dazu abschließend das Frontispiz anfertigte, das das Datum 1718 trägt und sein invenit. Der erfahrene Künstler Coypel sorgte also für einen entsprechenden qualitativen Standard, auch wenn dieser nicht der höchste war und von vergleichsweise mäßiger Originalität bei der Bild-Erfindung. Jede der Szenen wurde immerhin in ein landschaftliches Umfeld eingebettet, das man als gängig und erprobt bezeichnen kann, fußend auf niederländischen und französischen Traditionen des 17. Jahrhunderts. Das besondere Merkmal
dieser Darstellungen ist allerdings ihre eingängige, leicht faßliche visuelle Sprache, die den Betrachter auf den ersten Blick erkennen läßt, um was es in dieser Szene geht und welcher emotionale Ausdruck hier vorherrscht; Rätselhaftes und Dunkles bleiben ausgespart, man verliert sich nicht im Detail, obwohl es auf manchen der Tafeln durchaus einiges zu entdecken gibt, das die Lust am Betrachten anregt.
Die Tafeln wurden eventuell bereits 1716 gestochen, laut Signatur nach Vorlagen des Jahres 1714 („Philippus inv[enit] et pinxit 1714“). Angeblich gab es auch Abzüge avant la lettre und, einer autographen Notiz im Exemplar des Chastre de Cangé zufolge, schon im Jahr 1717 Probedrucke. Die Édition du Régent ist dann im Folgejahr 1718 erschienen [Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé, S. 38 f., und Barber, Daphnis and Chloe, S. 31–35]. Fast zur selben Zeit sind somit, weitgehend unabhängig voneinander, zwei illustrierte Fassungen des Longus-Romans in der Übersetzung Amyots entstanden. Diese bezeichnen den Beginn einer von nun an kontinuierlichen Erscheinungsfolge illustrierter Ausgaben des Werks, darin liegt ihre große Bedeutung, weniger in gehobener künstlerischer Qualität.
Als abschließende Anmerkung zu den beiden Illustrationenszyklen der Ausgaben der Jahre 1716–18 sei hier noch auf die erotische Kuriosität der sogenannten Petits pieds eingegangen. Ihre erste Erfindung geht wohl auf Scotin zurück, sie ist die Tafel zu Seite 133 der Ausgabe von 1716. Dort jedoch wird geschildert, und das scheint bislang allen Bibliographen entgangen zu sein, wie Lykainion Daphnis verführt: dieses Paar ist hinter dem Gebüsch zu erahnen, die Unschuld der Chloe bleibt hier noch unberührt. Die Tafel Scotins führt gedanklich das weiter, was im Text – zumindest in den bis 1810 bekannten Fassungen – nur angedeutet wird. Die Fassung des Regenten oder Coypels zu dieser Szene ist wesentlich dezenter, hier berührt Lykainion den Daphnis lediglich zärtlich am Kinn. Als sich jedoch die Amsterdamer Verleger Van Harrevelt und Néaulme um 1750 zu einer Neuauflage mit dem Scotin-Zyklus entschlossen haben, setzten sie die entsprechende, hier seitenverkehrt nachgestochene Tafel bezeichnenderweise an den Schluß des Textes – und machten damit ein anderes Paar aus den beiden: hier sind die sich Vergnügenden tatsächlich Daphnis und Chloe (vgl. unsere Nummer XXXVII –desgleichen bei einer späten Variante aus dem Jahr 1777, dort sogar als Frontispiz einer Duodezausgabe mit den sichtbaren Köpfen des Paares, unsere Nummer LI).
Daß dem Regentenzyklus letztendlich ein wenig das „Salz in der Suppe“ fehlte, mögen ja nicht wenige Leser gedacht haben – reagiert hat darauf der Graf Caylus, selbst Verfasser galanter Erzählungen, Kunstkenner und Kupferstecher. Er hat die wesentlich dezentere Fassung Scotins im Jahre 1728 in eine geradezu frivol-kapriziöse Form verwandelt. Da diese Tafel, die einzige mit tatsächlicher Erotik, die die Füße des Paars beim Liebesakt zeigt, viel freier und, man möchte fast sagen „augenzwinkernd“ mit diesem Thema umgeht, hat sie erheblich größere Verbreitung und Bekanntheit erlangt als Sco -
tins künstlerisch überzeugendere erste Version. Sie war als Ergänzung zur Ausgabe des Regenten bestimmt, angeblich zurückgehend auf einen eigenen Entwurf Philipps, der aber zurückbehalten worden war [siehe dazu zusammenfassend unter Anführung vieler der teils obskuren Schriftquellen auch Eeghen, Amsterdamse boekhandel, Bd. II , S. 233–38].
Der Kupferstich des Grafen, der gut ein Jahrzehnt nach Erscheinen der Regentenausgabe deren Illustrationszyklus um eine Tafel bereicherte, hat eine solche Popularität erlangt, daß man ihn nicht nur vielen Exemplaren der Ausgabe von 1718 noch nachträglich einzufügen pflegte, sondern ihn zudem in mehr oder weniger gelungenen Nachstichen über das ganze Jahrhundert hinweg wiederholte, um ihn auch jüngeren Ausgaben beizugeben. Die Vorzeichnung des Grafen hat sich in einem Exemplar der Ausgabe von 1718, das sich in Chantilly befindet, erhalten [Catalogue Paillet 1865–85, die Nummer 249, eines jener Exemplare des Chastre de Cangé]. Die Kupfertafel wurde in der Folgezeit gleichsam zum festen Bestandteil der Suite – ein Treppenwitz geradezu, ist sie doch von spöttischem Charakter, fast schon wie eine Parodie oder ein bissiger Kommentar, der die gleichsam omnipräsente moralische Integrität der Bilder des Regenten gehörig zu untergraben versucht. Jedoch: Caylus versah seine Tafel mit dem Titel Conclusion du Roman , was klar darlegt, um wen es sich bei diesen beiden Akteuren handelt, von denen man nur die „kleinen Füße“ sieht, nämlich die Protagonisten selbst – und die sind am Ende schließlich glücklich verheiratet. Vom Waldesdickicht ist der Schauplatz hier in die Nymphengrotte, den von Longus geschilderten Ort der Hochzeit, verlegt, an deren Wänden man ein stehendes Liebespaar im Relief erkennt, wohl eines aus der Mythologie, sogar ein Bett steht hier zur Verfügung und ein schützender Vorhang. Daß dieser nun von spielenden, neckischen Eroten etwas für den Betrachter gelüftet, dazu die Szene mit einer Fackel ausgeleuchtet wird, das setzt, im wahrsten Sinn des Wortes, eine erotische Groteske an das Ende der sonst so biederen Folge. Mit dieser Caprice des Grafen hält auch der freiere Geist einer neuen Epoche Einzug in den Regentenzyklus; obwohl dieser nur ein Jahrzehnt zurücklag, gehörte er doch schon einer anderen Generation an. Der Amsterdamer Verleger Néaulme hat allerdings die Entscheidung, die Fassung Scotins an das Ende zu setzen, anläßlich seiner zweisprachigen Ausgabe des Jahres 1754 revidiert: Hier dient diese Tafel, eine, nebenbei bemerkt, künstlerisch hervorragende Neuanfertigung, die wohl von Charles Eisen stammen dürfte, erneut zur Illustration der Verführung des Daphnis durch die Lykainion; die Einfügung an der richtigen Stelle gewährleistet die hinzugefügte Tafelnummer XXII . Die Umstellung erfolgte mit Bedacht, integrierte Néaulme die Scotin-Tafel hier doch in die Regentensuite – und eliminierte gleichzeitig die Fassung des Grafen Caylus, die ihm ohne Frage zu unwürdig für seine höchst anspruchsvolle Ausgabe erschien. Und denkt man jetzt, alle Varianten durchgespielt zu haben, kommt am Ende doch noch eine neue hinzu: In die monumentale Ausgabe, die Didot und Lamy 1787 erscheinen ließen, mit einem neuen Zyklus,
den Martini unmittelbar nach dem Vorbild des originalen Gemäldezyklus geschaffen hat, wurde doch tatsächlich die Version des Grafen Caylus wieder aufgenommen, jedoch die Numerierung Néaulmes beibehalten. Und so erscheint die frivolere Petit pieds-Fassung ausgerechnet hier, in einer Ausgabe, die mit Absicht die entsprechende Verführungspassage Lykainion-Daphnis gekürzt hat (mit Sternchen im Text und einer Fußnote auf Seite 105). Die Tafelzählung und inhaltliche Zuordnung konnte indessen viele Erstbesitzer und ihre Buchbinder nicht daran hindern, das Paar wieder eigenmächtig auszutauschen und die Tafel an das Ende des Bandes zu setzen.
Fünf Jahre nach dem Erscheinen der Regentenausgabe ist ihr Namensgeber verstorben, sein Zeichenlehrer und künstlerischer Berater, Antoine Coypel, schon im Jahr zuvor, 1722. Dessen Sohn, Charles-Antoine, erbte vom Vater die durch Benoît Audran gestochenen Kupferplatten – und ergriff die Gelegenheit beim Schopf, diese als separate Suite zu veröffentlichen. Mehr als ein eigenes Titelblatt, das er lediglich in gestochener Kursivschrift ohne weitere Verzierungen fertigte, und das gründliche Reinigen und Auffrischen der Platten war dazu nicht vonnöten. Die bekannte und populäre Suite konnte er durch diese Separatausgabe gewinnbringend für sich nutzen, ohne dafür mit einem Verleger an einer Neuausgabe des Werks zusammenarbeiten zu müssen. Bei dieser Einzelausgabe wurden die Kupfer mit Hilfe starker Pressen auf dickes Bütten-Papier von größerem Format gedruckt, so daß die querrechteckigen Illustrationen nicht wie im Buch senkrecht gefalzt werden mußten. Viele Exemplare hat der jüngere Coypel von der Suite allerdings kaum angefertigt – sie ist außerordentlich selten; in den Verkaufskatalogen des 18. und 19. Jahrhunderts kann man gelegentlich Exemplare antreffen, teils mit reduzierter Tafelzahl, was wohl der Rücksichtnahme auf Befindlichkeiten der Familie der Herzöge von Orléans geschuldet ist. Offenbar wurden aus einem Teil der Auflage zwei Tafeln absichtlich entfernt, weil ihre Sujets zu anrüchig erschienen, so jedenfalls hat es Péreire [Notes, S. 60 f.] dargestellt. In unserem Katalog enthält die Nummer XV nur 26, die Nummer XVI aber alle 28 Tafeln der Suite; bei den Nummern XVII und XVIII handelt es sich dagegen wohl um Abzüge, die bereits vor der Neuausgabe von 1724 angefertigt worden sind, aber wir können nicht sagen, von welchem der beiden Coypel sie stammen.
Es sollte drei Jahrzehnte dauern, bis im Jahre 1754 von den originalen Kupferplatten erneut Abzüge für eine Buchausgabe von Daphnis und Chloe angefertigt wurden – dann aber wie Edelsteine gefaßt, in schönstem Rahmenwerk des Rokoko, geschaffen von zweien der besten Illustratoren ihrer Zeit, Cochin und Eisen.
B. Die Ausgaben von 1731, 1745, 1749/50 sowie 1764: Variantenreiche Drucke zwischen Tradition und Neuerung
(Nummern XIX-XXXVII , L und Anhang C)
Ausgabe von 1731 und ihre beiden
Nach Coypels und des Regenten Tod kam es über ein Jahrzehnt zu keiner weiteren Edition von Daphnis und Chloe in Frankreich, wenn man von dem Abdruck der separaten Suiten einmal absieht. Ein erster Nachfolger ist die wiederum ohne Ort und Drucker, sicherlich in Paris erschienene Ausgabe des Jahres 1731. Diese wurde durch den Buchhändler Guérin le Jeune, Quay des Augustins, verkauft, jedoch „ d’impression étrangère “, wie in der Suite de la clef nachzulesen ist (Bd. XXX , August 1731, S. 107). Im selben Monat zeigte das Journal des Sçavans den Sethos des Terrasson als Neuerscheinung bei Guérin an; in der kurzen Besprechung dazu heißt es: „Le même Guérin a achevé une jolie Edition des Amours Pastorales de Daphnis & Chloe. 1731. Petit in-8°.“ Wir dürfen wohl davon ausgehen, daß Guérin der Verleger und Händler war, für den ein oder mehrere Drucker gearbeitet haben. Da wir aufgrund einiger Indizien bereits für die erste Pariser Ausgabe des Jahres 1716 Anlaß hatten, Guérin als Drucker zu vermuten, bestätigt sich diese Hypothese hiermit offenbar, nur daß Guérin jetzt als Verleger auftrat und den Druck von Kollegen ausführen ließ. Der Vergleich von Typographie und Buchschmuck, insbesondere der Kopfzierleisten, spricht für sich – man kann daran unmittelbar nachvollziehen, wie diese aus dem alten Formengut der Ausgabe von 1716 entnommen und in den Druckvarianten über mehrere Schritte umgeformt wurden, während der Schriftsatz und die Gestaltung der Kapitelanfangsseiten mittels queroblonger Kopfvignetten eindeutig nach dem Vorbild der Regentenausgabe erfolgte.
Die Ausgabe von 1731 ist um einen textkritischen Anhang mit Anmerkungen erweitert: Notes sur les amours de Daphnis et Chloé , 20 römisch paginierte Seiten umfassend. Diese stammen von Antoine Lancelot, während der Text selbst von Camille Falconet herausgegebenen worden ist [Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. II , Sp. 533; zudem merkt er an, daß Lancelot schon die Ausgabe von 1718 betreut habe und macht diverse Angaben zu den Druckern. Den Hellenisten Lancelot als Verfasser der Anmerkungen nennt auch Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé, S. 42; in Anmerkung 13 schreibt sie von einem Exemplar aus dem Besitz des Duc d’Aumale mit Marginalien von Lan-
celots eigener Hand]. Daß diese Anmerkungen schon früher entstanden und ihr Abdruck bereits für die Ausgabe von 1718 geplant gewesen sei, wie Grivel postuliert, ist durchaus möglich. Zu einem tatsächlichen Bestandteil des Drucks werden sie indessen erst in der Ausgabe des Jahres 1731. Man kann dies an dem nun ergänzten Schlußsatz des Avertissement erkennen, der auf die Notes verweist. In der Ausgabe des Jahres 1718 kommt er noch nicht vor. Das erste Mal ist dieser Satz in unserem Exemplar XIX zu finden, das zwar noch den Titel von 1718 enthält und dem die Notes weiterhin fehlen, das aber bereits den Schriftsatz der Ausgabe von 1731 zeigt – ein Exemplar des Verlegers aus dem Arbeitsprozeß. Die Anmerkungen Lancelots waren hier noch kein Bestandteil des Drucks und mussten erst gesetzt werden. Daher kommt der Annahme ihrer handschriftlichen Überlieferung einige Wahrscheinlichkeit zu. Es sind Exemplare der Ausgabe von 1718 bekannt, die wohl aus dem Umfeld des Regenten stammen und die Notes in Manuskriptform enthalten, wie beispielsweise das 1863 in Paris versteigerte aus der Bibliothek Leopold Double, ursprünglich im Besitz von Pixérécourt [Catalogue Double 1863, Nr. 199: „…avec des notes copiées sur l’exemplaire du savant Lancelot, et très-importantes pour l’intelligence du texte. Ces notes, d’une écriture calligraphiée avec le plus grand soin, sont attribuées à Chastre de Cangé, célèbre bibliophile du siècle dernier.“]
Über die Notes hinaus bringt die Ausgabe des Jahres 1731 allerdings nicht viel Neues; Ebert urteilte daher abschätzig: „Bloss die Exemplare auf Pergament sind geschätzt. Die Kupferstiche sind von denen des Regenten verschieden, und dieselben wie in Paris 1717“ [Ebert, ABL , 12243]. Er kannte offensichtlich nur Exemplare, die die Suite Scotins enthielten; doch wurde alternativ auch die Regentenfolge verwendet, je nach Vorliebe und Vorhandensein, wie Péreire schrieb: „On a donc dû graver à nouveau toute de suite pour celle [édition] de 1745, tandis que l’on a utilisé quelques suites de Coypel dans des exemplaires de 1731, en place de celle de Scotin“ [Péreire, Notes, S. 61]. In die Ausgabe von 1731 wurde bevorzugt die Scotin-Folge als Illustration eingebunden, aber keineswegs ausschließlich. Sie war offensichtlich noch häufiger und einfacher zu bekommen als die des Regenten. Fraglich ist, ob für diese Ausgabe von seiten des Verlegers überhaupt eine Illustration in Form von Kupfertafeln obligatorisch vorgesehen war, oder ob lediglich beim Vorliegen eines der beiden Zyklen dieser auf Wunsch des Besitzers in das jeweilige Exemplar mit hineingenommen worden ist. Die angegebenen Seiten, bei denen die Kupfertafeln eingebunden werden sollten, zeigen jedenfalls, daß sie sich auf die alten Ausgaben von 1716/17 und 1718 beziehen. Interessant ist insbesondere, daß der ScotinZyklus zwar in mehreren Plattenzuständen nachweisbar ist (alleine bei uns mindestens drei verschiedene), aber hierbei die Seitenzahlen nicht verändert oder entfernt worden sind. Der Regentenzyklus wurde aufgrund der nicht stark differierenden Seitenzahlen (164 gegenüber 159 bei der Ausgabe von 1731) gewöhnlich an den numerisch richtigen Stellen eingebunden, allerdings „verrutscht“ der inhaltliche Zusammenhang gegen Ende ein wenig, so daß diese Tafeln erst einige Seiten nach dem Inhalt erscheinen. Die letzte
doppelblattgroße Tafel, Nopces de Daphnis et de Chloé zu Seite 162, geht ohnehin über die Paginierung hinaus. In unserem Exemplar Nummer XX fehlt sie. Dagegen sind in unserem Pergament-Exemplar alle Tafeln des Regentenzyklus vorhanden; nur die beiden letzten wurden abweichend von der Paginierung eingebunden (Nummer XXIV).
Unser Probedruck zur Ausgabe von 1731 enthält die komplette Regentensuite, die der Verleger offenbar bevorzugt hat. Hier sind die letzten sieben Tafeln mit Differenzen zur Paginierung eingebunden. Die kolportierte Annahme, bei der Separatausgabe der Suiten durch den jüngeren Coypel 1724 seien zwei der Platten zerstört worden, weshalb sie in der Ausgabe von 1731 gewöhnlich fehlen, ist mit Sicherheit unzutreffend. Die Platten standen für die Ausgabe von 1754 wieder sämtlich zur Verfügung, von ergänzenden Nachstichen ist nicht auszugehen. Nur wurden in der Zeit zwischen 1724 und 1754 offenbar keine neuen Abzüge von den Platten mehr angefertigt, weshalb die früher gedruckten und unabhängig von Buchausgaben gehandelten Suiten allmählich sehr rar geworden sind. Laut Lewine [Illustrated books, S. 322] und Cohen/De Ricci [Guide de l’amateur, S. 651] gehören zur Ausgabe von 1731 die acht Tafeln nach Scotin, zusätzlich das Frontispiz. Das von Nodier angeführte Prachtexemplar enthält dagegen die Regentensuite in „premières épreuves“ [Nodier, Mélanges, S. 219]. Das Exemplar der Pompadour, die Nummer XXI unseres Katalogs, weist die gesamte Scotin-Folge in recht kräftigen, guten Abzügen auf, der Plattenzustand ist zwischen die beiden Suiten unserer Nummer II einzuordnen.
Aber nicht nur hinsichtlich der Illustration sind Unterschiede feststellbar. Von der Ausgabe des Jahres 1731 existieren zudem zwei klar unterscheidbare Druckvarianten, differierend nicht nur in einzelnen Zierformen, sondern der gesamte Text wurde bei generell analoger Gestaltung in einer leicht voneinander abweichenden Type und in gering unterschiedlicher Größe der Druckform in zwei verschiedenen Fassungen neu gesetzt. Es handelt sich hier wohl um eine édition roulée, eine Ausgabe, die gleichzeitig bei zwei oder mehreren Druckern erschienen ist, im Frankreich dieser Zeit eine nicht unübliche Praxis. Die Kennzeichen der beiden Varianten können anhand unserer Exemplare benannt werden: In dem der Madame Pompadour (Nummer XXI) besteht die Kopf-Zierleiste des Avertissement aus einer Reihung typographisch gesetzter Blätter mit Stielen in SForm, und diese Reihe weist einen markanten Fehler auf, denn das dritte Zierzeichen von rechts ist verkehrt herum gesetzt (man vergleiche dazu die Zierleiste auf Seite 107 der Ausgabe von 1716, wo diese Formen alternierend angeordnet sind). Die Kopf-Zierleiste der Préface de Longus besteht in dieser Variante A („Variante Pompadour“ von uns genannt) aus vier stilisierten Herzformen und Blättchen. Bei den Holzschnitt-Initialen erscheinen die Buchstaben jeweils vor einer Querschraffur, umgeben von spärlichen Blattranken. Der Druck ist recht klar und sauber.
Unser Exemplar Nummer XX , und das bei Cohen/De Ricci zitierte PergamentExemplar, unsere Nummer XXIV, setzen sich durch folgende Unterschiede davon ab:
Am Kopf des Avertissement ist hier eine Fleuronleiste zu sehen (in der Mitte eine vierblättrige Blüte, davon ausgehend, quer nach links und rechts ausgerichtet, je fünf kelchartige Blüten, wohl Tulpen, rechts die letzte angeschnitten). Die Kopfzierleiste über der Préface besteht aus kleinen quadratischen Motiven (je ein Punkt im Strahlenkranz), 17 in Reihe. Die Zierleisten am Beginn der Notes unterscheiden sich ebenfalls, sind kleiner, zurückgenommener als im Exemplar Pompadour. Der Text ist gegenüber diesem insgesamt ein wenig kleiner gesetzt. Zudem sind vier der fünf Holzschnitt-Initialen in dieser Druckvariante historisiert: Die Holzschnitt-Initiale „L“ ist zwar ähnlich der „Variante Pompadour“, aber doch leicht abweichend gestaltet, die „M“-Initiale am Textbeginn zeigt vor stilisierter Landschaft einen Baum und die strahlende Sonne; das „E“ erscheint auf Seite 33 vor einer kleinen Dorfansicht, das „M“ auf Seite 77 vor einer Landschaft mit Bäumen und das „S“ auf Seite 117 vor einer Landschaft mit Baum und Zelt. Die Kupferstich-Vignetten liegen in beiden Exemplaren dieser Variante B in wesentlich klarerem Abdruck vor als beim Exemplar Pompadour, der anderen Variante [siehe auch Péreire, Notes, S. 62]. Daß die Variante B die spätere sein muß, erweist ein korrigierter Fehler: die vertauschte Paginierung der Seite 97. Dieser Fehler ist in der Variante A noch vorhanden. Wie wir anhand unseres Exemplars Nummer XIX beweisen können, das noch einen Drucktitel von 1718 enthält, sonst aber bis auf den Anmerkungsanhang exakt der Variante A entspricht, knüpft letztere an die Regentenausgabe von 1718 an. Auch für die nächste Ausgabe sollte es kennzeichnend bleiben, daß sie in Fortführung der Überlieferung von Text, Satz und Illustration der Vorgänger in mehreren Varianten erschienen ist.
Die Druckvarianten der Ausgabe von 1745 und ihre Amsterdamer Ableger der Jahre 1749/50
Erneut ohne Nennung von Drucker und Ort erschien im Jahre 1745 eine sicherlich in Paris publizierte Ausgabe, deren Verlegerin die Witwe des Antoine-Urbain Coustelier gewesen sein könnte. Das Haus Coustelier nennt beispielsweise Antoine Péricaud [Notes, Bd. 12, S. 95, Anmerkung 1]. Diese Ausgabe schließt zwar eng an ihre Vorgängerin an, findet aber endlich Lösungen für die Problematik der Illustration und der kaum mehr vorhandenen Abzüge der früheren Zyklen: Einerseits erreichte man dies durch einen seitenrichtigen Nachstich der Regentensuite, andererseits durch die Aufnahme neuer Illustrationsbestandteile, sprich: Vignetten, deren hohe Zeit in der französischen Buchillustration längst gekommen war. Ein freudiger Anlaß zu dieser ambitionierten Neuausgabe des royal illustrierten Liebesromans könnte die Hochzeit des gerade
sechzehnjährigen Dauphins Louis Ferdinand de Bourbon mit Maria Teresa von Spanien am 27. Februar 1745 gewesen sein.
Die Ausgabe von 1745 übernimmt prinzipiell den Satz der Variante A von 1731, dennoch wurde der gesamte Text neu gesetzt, mit einigen kleinen Veränderungen und Korrekturen. Schon der Drucktitel weist eine augenfällige Korrektur auf, der Punkt hinter Chloé ist weiter unten plaziert, nun in Höhe der Serife an der Basis des é , während er sich zuvor deutlich darüber befand (genau umgekehrt verhält es sich mit der nämlichen Form am Kopftitel der Notes). Außerdem ist der Fehler in der Kopfzierleiste des Avertissement jetzt korrigiert, um nur zwei auffällige, leicht nachvollziehbare Unterschiede anzuführen. Daß am Satz des Titels Veränderungen vorgenommen worden sind, läßt sich auch anhand unserer Nummer XXIX , einem Prachtexemplar im Mosaikeinband von Padeloup, ablesen. Dort erscheint der Druck recht unscharf und vor allem zum Teil in etwas kleinerer Type, der Name Daphnis , sonst deutlich größer als derjenige der Chloé gesetzt, hat hier annähernd dieselbe Schriftgröße – ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung, doch unter allen unseren Exemplaren der Oktavfassung nur an diesem nachweisbar, was allerdings bei einer der Quartvarianten dann wieder aufgenommen worden ist (die „Übergangsfassung“, wie bei unserem Exemplar Nummer XXXII vorliegend).
Die Kupferstiche wurden für die Ausgabe von 1745 komplett neu gestochen, nicht nur überarbeitet, wie Péreire das in seinen Notes von 1926 [S. 59] entschieden und völlig richtig aufklärt: „ce sont des copies trompeuses, gravées à nouveau, même le frontispice de Coypel“; auch stellt Péreire die wesentlichen Unterschiede zwischen der ursprünglichen und der nachgestochenen Folge so klar heraus, daß es eigentlich zu keiner Verwechselung mehr kommen sollte [Notes, S. 64–70]. Diese neuen Tafeln zeigen trotz ihrer engen Orientierung an den Originalen sehr deutliche Spuren von Vergröberung, insbesondere bei den dargestellten Personen. Wirklich neu hinzugekommen, allerdings von ganz anderem qualitativen Rang, sind die Culs-de-lampe des Charles-Nicolas Cochin d. J. und die Kopfvignetten. Von den Initialen wurden die dritte, vierte und fünfte durch neue ersetzt. Zu dieser Ausgabe ist demnach ebenfalls keine wirklich neue Tafelfolge erschienen, doch wurde die Regenten-Suite, einschließlich des Frontispiz’ mit dem Datum 1718 und der Petits pieds-Tafel, so gut wie möglich reproduziert. Inzwischen waren originale Folgen aus der Zeit um 1714–18 wohl kaum mehr zu bekommen, und die Kupferplatten, im Besitz von Charles-Antoine Coypel verblieben, standen für weitere Abzüge nicht mehr zur Verfügung, was sich erst nach seinem Tod 1752 ändern sollte. Daher kam man 1745 nicht umhin, den Zyklus nachzustechen. Bedauerlich, daß man einen Cochin offenbar nicht dafür gewinnen konnte oder wollte, eine neue Fassung der gesamten Suite zu schaffen.
Von der Ausgabe des Jahres 1745 gibt es auch eine Version in Quart, und diese gleich in mehreren Varianten. Nun könnte man davon ausgehen, wie es die bisherigen Biblio -
graphen in der Regel auch darstellen, die Quartausgabe des Jahres 1745 sei lediglich ein Abdruck auf größerem Papier. Tatsächlich wird die dem Kleinoktav-Format gemäße Größe des Schriftspiegels beibehalten, doch schon ein Blick auf die Lagensignaturen zeigt: Aus Achter- werden tatsächlich Viererlagen. Das fordert dazu heraus, die beiden Fassungen genauer zu vergleichen. Nimmt man dazu unsere Exemplare Nummer XXXI und XXXIII zur Hand, so wird man feststellen, daß sich außer der Lagensignatur nichts verändert hat. Es ist der identische Druck, nur auf großem Papier, unsere Druckvariante 1745/B(4°). Ganz anders verhält es sich dagegen bei unserer Nummer XXX: Bereits der Satz des Titels zeigt die ersten Abweichungen gegenüber 1745/A(8°) und 1745/B(4°). In dieser Quartfassung, nennen wir sie Variante 1745/C(4°), ist der Akzent beim Namen Chloé viel spärlicher, und der Punkt sitzt jetzt fast an der Basis des Buchstabens. Erstaunlicherweise ist die Schrift noch ein wenig verkleinert, anstatt vergrößert, als wollte man dadurch das Papier noch breitrandiger erscheinen lassen. Am Beginn des Avertissement wird es für den Druckforscher besonders interessant: Dort findet sich zwar dieselbe Form der Holzschnitt-Initiale, wenn auch verkleinert, neu angefertigt, aber die Kopfzierleiste erweist sich als Abwandlung der Variante B der Ausgabe von 1731, und zwar jener über der Préface. In der Quartvariante von 1745 sind Avertissement und Préface bei ebenfalls verändertem Textumbruch neu gesetzt. Genauso der eigentliche Text des Romans – schon der Beginn erhält ein ganz neues Erscheinungsbild, der erste Abschnitt umfaßt auf Seite 1 nur noch fünf statt sieben Zeilen in Oktav, und die Holzschnitt-Initiale (wie auch alle folgenden) ist durch eine typographische ersetzt worden. Die Seitenzahl ist mit 159 jedoch in beiden Varianten dieselbe. Die Diskrepanz zwischen den Seitenzahlen der Tafeln (bis 162) und des Drucks bleibt auch hier unkorrigiert, vielleicht weil man die Authentizität der alten Illustrationsfolge suggerieren bzw. ihre Form in keiner Weise verändern wollte.
Der Neusatz des Textes hat an wenigen Stellen auch zur Korrektur von Fehlern geführt, einer davon sei hier genannt: Auf der Seite XX der Notes findet sich in der siebten Zeile von unten der Fehler: „Oure que cette expression…“ in der Oktav-Fassung, berichtigt dagegen in der Quart-Fassung: „Outre que cette expression…“. Damit ist das zeitliche Verhältnis beider Drucke klargestellt. Man muss allerdings anmerken, daß dieser Fehler bereits in der Druckvariante B der Ausgabe von 1731 korrigiert worden war, so daß die Quartversion von 1745 auch ein Abkömmling der Fassung B von 1731 sein könnte, oder man Teile beider Überlieferungsstränge in dieser Fassung vereinte.
Wenn man nun glaubt, sämtliche Varianten vorliegen zu haben, dann überrascht einen unser Exemplar Nummer XXXII: Variante 1745/B*(4°). Dieses durchgehend reglierte Exemplar war offensichtlich eines jener, an denen der Verleger die Änderungen zwischen den beiden oben angeführten erprobt hat: Der Titel ist in alter Form übernommen, doch schon beim Avertissement trifft man auf die erste Änderung, eine Kopfzierleiste mit doppelter Sternchenreihe, die keine der anderen Fassungen zeigt; sie überzeugte
wohl letztendlich nicht. Die Holzschnitt-Initiale liegt noch in alter Form vor, ebenso wie alle anderen Initialen hier noch vorhanden sind, die zweite bis fünfte aber in ähnlicher Form nachgeschaffen. Über der Préface scheint die Zierleiste noch dieselbe wie in der Variante 1745/B(4°) zu sein, doch wurde sie nachahmend erneuert. Die Reihenfolge der gestochenen Kopfvignetten wurde verändert und die Culs-de-lampe von Cochin hier nicht eingedruckt. Der Haupttext ist in der Variante 1745/B*(4°) in einer anderen Type gesetzt, doch mit denselben Umbrüchen. Der Fehler Oure (Outre) auf Seite XX ist bereits korrigiert. In dieser Fassung plante man, am Ende die Titelvignette nochmals als Cul-de-lampe einzudrucken, was man dann aber in der Endfassung wieder aufgab.
Offensichtlich hat man von dieser „Zwischenfassung“ einige wenige Exemplare gedruckt, um sie in besonderer Weise zu Unikaten zu machen: mittels Reglieren, mehrfarbig patronierten Textrahmen und sogar Vignetten sowie durch das Kolorieren der Tafeln. Diese sind ganz besondere Exemplare, von Bibliophilen immer schon gesucht und bis heute zu sehr hohen Preisen gehandelt (unsere Nummer XXXVI). Gewöhnlich ist noch das leere Blatt der ersten Lage, zu der sonst nur noch der Titel gehört, bei den Quartfassungen mit eingebunden worden, sonst wurde es gewöhnlich weggelassen. Für die Quartausgabe fand zum Teil das bekannte qualitätvolle Holland-Papier mit Pro-Patria -Wasserzeichen, das seit etwa 1700 auch in Frankreich für größere Formate gebräuchlich war, Verwendung.
Die Satzvarianten und verschiedenen Ansätze zu neuer buchkünstlerischer Gestaltung bei dieser Ausgabe lassen evident werden, wie groß der Wille gewesen ist, den mittlerweile bei einer breiteren Leserschaft beliebten Roman des Longus in eine neue, dem Werk angemessenere Form zu überführen. Die Brüche und Gegensätze zwischen Überliefertem und Neuem waren hier aber nicht harmonisiert, ein echter Einklang und eine rundum überzeugende Lösung noch nicht gefunden worden. Dies sollte die große Aufgabe werden, die erst nach der Jahrhundertmitte zu einem Höhepunkt der französischholländischen Buchkultur des 18. Jahrhunderts geführt hat.
Ein Abkömmling der „Zwischenfassung“ des Drucks von 1745 in Quart, Variante 1745/B*(4°), ist unter dem Datum 1750 „A Amsterdam“ erschienen (unsere Nummer XXXVII), wie wir nachweisen konnten, bei dem dort ansässigen bedeutenden Verleger Jean Néaulme. Von diesem Druck sind auch in das Vorjahr 1749 datierte Exemplare bekannt, dazu noch eine späte Ausgabe von 1764 (unsere Nummer L), die laut Impressum ebenfalls ein Druck von Néaulme ist, nun aber aus seiner Dependance in Den Haag.
Ferner erschien im Jahr 1763 noch eine Londoner Ausgabe in der englischen Übersetzung des James Craggs mit Stichen nach Scotin, die mit „I. Taylor“ signiert sind [vgl. Riquier, The early modern transmission, S. 27]. Auch diese dürfte von den Amsterdamer Drucken der Jahre 1749/50 abhängig sein.
Der Text der besagten Variante des Jahres 1745, einschließlich der Holzschnitt-Initialen, wurde in die Ausgabe von 1750 übernommen (der Fehler Oure ist hier allerdings korrigiert), und auch die Zierleisten entsprechen denjenigen dieser Fassung, doch nun rückübersetzt ins Kleinoktav-Format (!), mit den entsprechenden Bogensignaturen. Damit nicht genug: Zu Ehren kommt nun wieder der alte Zyklus des Scotin, und zwar in Anknüpfung an die Amsterdamer Ausgabe von 1717, wie in dieser seitenverkehrt nachgestochen und mit Rahmen versehen, als wolle man damit den Zitatcharakter betonen.
Die Platten für die vier Kopfvignetten standen dem Drucker nicht zur Verfügung; stattdessen hat er sich Abzüge auf dünnem Papier beschafft und diese eingeklebt. Dasselbe gilt auch für die Titelvignette, ein Flötenspieler in ornamentaler Rankenlaube; woher dieser Stich stammt, konnten wir nicht ermitteln. Sehr reizvoll und neu ist dagegen ein Frontispiz, das den Titel des Werks in einer großen Rocaille-Kartusche zeigt, umgeben von reicher Ornamentik. Der ebenfalls neu gesetzte Drucktitel enthält den Zusatz „Avec Figures par un Eleve de Picart“. Augenscheinlich wurden die Kupferstiche in einem Abklatschverfahren hergestellt, denn Plattenränder sind nirgends zu sehen. Die bereits im Jahr zuvor erschienene Ausgabe enthält auch schon diese nachgedruckten Tafeln; damit ist sie die erste in dieser Form in Amsterdam erschienene. Ein Nachweis findet sich in Adrien Richers Essai sur les grands événemens par les petites causes, tiré de l’histoire, Amsterdam 1758, in der angehängten Händleranzeige des Verlegers dieser Zeitschrift, Van Harrevelt (Catalogue des livres nouveaux, S. 2, der Untertitel hier ebenfalls mit der umschreibenden Nennung des Illustrators Avec figures par un élève de Picart). Ob die Ausgabe von 1749 tatsächlich von Harrevelt produziert ist, oder ob er sie nur als Händler vertrieben hat, läßt sich anhand dieser Anzeige zwar nicht mit Sicherheit entscheiden, doch wäre es eine plausible Erklärung für das unmittelbare Erscheinen beider Ausgaben hintereinander, daß Néaulme diesen Druck von Van Harrevelt übernommen und alsbald im eigenen Verlag nachgedruckt hat. Dabei wurde lediglich der Titel neu gesetzt, also eine Titelauflage hergestellt, die aber etwas größere Verbreitung als der erste Druck erlangt hat.
Mit Van Harrevelt haben wir ein bislang unbekanntes Glied in der Kette der Verleger der Amsterdamer Daphnis-und-Chloe- Ausgaben gefunden, kooperierte er doch mit Changuion, dem Drucker der Ausgabe von 1734, und Changuion hatte wiederum als Mitarbeiter bei Emanuel Du Villard begonnen; dieser aber war, wie oben dargestellt, der tatsächliche Verleger der frühen Ausgabe von 1717 mit dem fingierten, von der Pariser Erstausgabe übernommenen Druckvermerk Chez les Héritiers de Cramoisy. Sollten unsere Annahmen zutreffen, dann reicht die Tradition der Amsterdamer Drucke also bruchlos
von den Anfängen um 1717 bis zu den großen beiden Ausgaben des Jean Néaulme von 1754 und 1757, ja sogar noch darüber hinaus. Alle diese Amsterdamer Editionen waren eng mit der Pariser Linie verknüpft.
Noch einmal neu aufgelegt wurden diese mittels der reproduzierten Scotin-Folge illustrierten Ausgaben von 1749/50 im Jahre 1764, nach dem Druckvermerk, der natürlich auch fingiert sein könnte, ein Erzeugnis der Offizin Jean Néaulme in Den Haag. Und selbst jetzt, fast zwanzig Jahre später, hat immer noch die Druckvariante der Pariser Ausgabe von 1745 – 1745/B*(4°) – Pate gestanden: Erstaunlich ist insbesondere, daß der typographische Buchschmuck der Ausgabe von 1764 nun tatsächlich das in den Druck überführt, was in dieser Variante nur einigen ausgewählten Exemplaren durch eingemalte Ornamentik zuteil geworden war – sind doch die umrankten Stäbe hier als gesetztes Rahmenwerk wieder aufgegriffen worden, wie sie etwa unsere Nummer XXXVI , selbstverständlich um ein Vielfaches prächtiger von Hand in Deckfarben ausgeführt, bereits 1745 zeigte. Vielleicht ist in diesem Rückgriff ein Hinweis darauf zu sehen, daß die Ausgabe von 1764 tatsächlich bei Néaulme erschienen ist. Das Frontispiz der Ausgabe von 1750 ist für diejenige von 1764 jedenfalls nachgestochen worden, der Titel lautet jetzt wieder „Les amours pastorales…“ (statt nur „Amours de…“), die Titelvignette und die Kopfvignetten wurden nun von der Platte eingedruckt, anstatt nur montiert, und neue Holzschnitt-Initialen hergestellt. Trotz anderer Drucktypen, insbesondere gänzlich veränderter Überschriften, wurden der Satzspiegel und der Umbruch weitgehend beibehalten. Eine kleine Änderung tritt erst ab Seite 143 auf, durchgehend bis zum Ende des Haupttextes auf Seite 159, doch die Notes erhielten wiederum einen übereinstimmenden Umbruch. Die Tafeln wurden nach Scotins Suite gedruckt, auch hier in der seitenverkehrten Neufassung, aber von bereits sehr abgenutzten Platten.
In den Ausgaben von 1749 und 1750, von denen die letztere als Druck des großen Verlegers Néaulme nachgewiesen werden kann, manifestiert sich der Wille, eine anspruchsvolle Neuausgabe des auch in den Niederlanden sehr geschätzten Longus-Romans herzustellen. Das Vorgehen der Verleger beruhte zu dieser Zeit noch darauf, eine der damals jüngsten Pariser Druckfassungen, nämlich eine der Quart-Varianten des Jahres 1745, nachzusetzen, dazu den seitenverkehrten Scotin-Zyklus des Amsterdamer Drucks 1717 wieder aufleben zu lassen und das Ganze um eigene Zutaten, wie das Frontispiz, zu ergänzen. Das Ergebnis ist eine zwar ansprechende, aber etwas uneinheitliche Ausgabe, der noch eine stringente Gestaltungsidee fehlt. Eine Konzeption, die zu den Glanzleistungen der Buchillustration im 18. Jahrhundert gehören sollte, konnte Néaulme erst in dem Moment schaffen, als es ihm gelang, die originalen Druckplatten der Regentensuite zu erwerben – davon nun im folgenden Abschnitt.
Diese beiden Neuausgaben sind ein Kuriosum in der Geschichte der gesamten Buchillustration: Ein vierzig Jahre alter Illustrationszyklus wird unter Beibehaltung seiner ursprünglichen Darstellungen völlig neu in Szene gesetzt – und dies mittels der nicht oder nur sehr wenig veränderten ersten Druckplatten! Zwar kennen wir ähnliche Fälle bei der älteren Bibelillustration oder bestimmten Totentanzfolgen, für ein Werk der Belletristik ist ein derartiger Vorgang aber schon etwas sehr Ungewöhnliches. Verändert wurden die Kupferplatten Audrans allerdings bei ihrer längst nicht mehr zutreffenden Zuordnung der Tafeln zu den Seiten – stattdessen wird die Folge nun mit laufenden Nummern versehen. Sicherlich wurden auch die Bildfelder noch geringfügig überarbeitet und gereinigt, um die Drucke aufzufrischen. Die berühmte Regentenfolge, deren Platten auch weiterhin das Datum 1714 tragen, wird also 1754 neu herausgegeben – und dazu hat man sich einiges einfallen lassen, weder Aufwand noch Kosten noch Mühe gescheut, ein wahrhaft meisterlich gestaltetes Werk der Buchillustration hervorzubringen. Es begann damit, daß der international tätige Kunsthändler Pierre-Charles-Alexandre Helle den Plattensatz für den Verleger Néaulme erwerben konnte [Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé, S. 39]. Als dieser einige Jahre zuvor seine kleine, aber durchaus anspruchsvolle Ausgabe von Daphnis und Chloe herausbrachte, mußte er sich noch mit mäßigen Kopien nach dem alten Scotin-Zyklus behelfen. Nun hielt er also die Möglichkeit in Händen, mit der originalen Regentensuite eine ganz besondere Ausgabe herzustellen – und er nutzte sie.
Statt die Tafeln wie bisher als unmittelbare Textillustration bestehen zu lassen, wurden sie jetzt über aufwendiges Rokoko-Rahmenwerk in vermittelnde Beziehung zum Betrachter gebracht: Auf der einen Seite werden durch diese Präsentation ihre Kostbarkeit und der Charakter als Werke der bildenden Kunst unterstrichen, ja richtiggehend thematisiert, auf der anderen Seite wird dem Betrachter dadurch auch klargemacht, daß er in diesen Bildern Objekte dargeboten bekommt, die, wie die Textfassung auch, selbst schon eine Geschichte und editorische Tradition haben und jetzt in neuer Form aufbereitet werden. Als Bild im Bild werden die Szenen distanziert dargeboten, eine neue Darstellungsebene fügt sich vermittelnd ein, insbesondere da die neu hinzugekommenen Rahmenbordüren nicht bloßes Ornament sind, sondern landschaftliche und figürliche Räumlichkeit andeuten, in der das Bild, das eine eigene rechteckig-schlichte Einfassung erhalten hat, einen Rahmen, der wie eine feste, greifbare Leiste wirkt, als Gegenstand seinen Platz gefunden hat.
Unser alter Illustrationszyklus ist nun endgültig in der Bildästhetik des Rokoko angekommen; es wird wirksam, was Hermann Bauer als die ästhetische, anti-illusionistisch wirkende Grenze des style rocaille bezeichnet hat, eines seiner hauptsächlichen Charakteristika: „Die Rocaille ist von ‚mikromegalischer‘ Struktur. Das heißt: In ihr prägt sich entschieden eine Grundmodalität des Rokoko aus, nämlich künstlich eine Spannung innerhalb der Realitätsgrade zu erzeugen. Diese Realitätsgrade sind Ornament-Modus und Bild-Modus. Untrennbar verquickt, einander stets aufhebend, changierend, sich gegenseitig in der Schwebe haltend, erzeugen sie den Eindruck einer Ironie, die letztlich ein Spiel mit den Kunstmöglichkeiten, mit der Kunst schlechthin ist. Diese Grundmodalität der Forme Rocaille, ihre mikromegalische Struktur, ist eine kritische Form, in der der Stil sich wie kaum anderswo ‚demaskiert‘“. „Das Ornament der Rocaille greift in das Bildgefüge des Gerahmten ein (…) Da gleichzeitig das Ornament Ornament bleibt, nie voll in die Bildgegenständlichkeit wechselt, ergibt sich eine entscheidende Konsequenz: Das Bild, das Gerahmte, wird in seiner Dimensionierung abhängig von den objektiven Dimensionen des Rahmenornaments (…) Das Kunstwerk im extremen Rocaille-Rahmen verfällt der mikromegalischen Struktur der Rocaille.“ [Bauer, Rocaille, S. 21 und 62]. Gerade hier, wo das innere gerahmte Bild einer anderen Epoche, dem Hochbarock, mit seinen illusionistisch-perspektivischen Kompositionsprinzipien angehört, wird dieser von Bauer beschriebene Effekt besonders wirksam. Und er führt dazu, daß vom Gesamtbild nun deutlich mehr Augenreiz ausgeht als von den einzelnen Tafeln zuvor, weil hier ein permanentes unaufgelöstes Spannungsverhältnis zwischen den Bildebenen vorhanden ist, was besonders bei den rundum eingefaßten hochformatigen Tafeln zum Tragen kommt.
Die Culs-de-lampe des Cochin hatten den neuen Stil bereits am Rande eingeführt, doch war es dadurch in der Ausgabe von 1745 zu einem harten Bruch, statt zu einem echten ästhetischen Wandel gekommen. Jetzt gelingt es, und das ist ein großartiger Wurf, nicht nur die Vignetten Cochins zu integrieren, die man sich auch gleich erlaubt, doppelt abzudrucken, sondern man findet auch die Lösung, um den alten Regentenzyklus wieder aufleben zu lassen und ihn in ein neues Zeitalter hinüber zu retten. So erhalten die Rahmen der Regententafeln zusätzlich die Aufgabe, zwischen den alten und den neuen Illustrationsprinzipien der Vignetten und ihrer ganz eigenen Bildästhetik zu vermitteln. Keine Geringeren als Charles Eisen, Charles-Nicolas Cochin der Jüngere und Simon Fokke, der aus Amsterdam stammte, hat Néaulme dazu herangezogen, nur mit den besten Kräften konnte dieses Vorhaben umgesetzt werden. Für die griechisch-lateinische Parallelausgabe wurde eine neue Textedition erstellt, philologisch betreut von dem gleichfalls in Amsterdam ansässigen, in griechisch-lateinischen Übersetzungen erfahrenen Arzt Johann Stephan Bernard (oder Bernhard), einem Freund des Gräzisten Johann Jacob Reiske und Verfasser einiger Werke zur Medizin, unter anderem zum griechischen Schrifttum, insbesondere Theophanes Nonnos.
Selbst bei einer derart sorgfältigen Herausgabe haben sich allerdings Satzfehler eingeschlichen – zum Vorteil der heutigen Druckforschung: Von der Ausgabe des Jahres 1754 lassen sich zwei Teilauflagen unterscheiden, die eine in Kleinquart, die andere auf großem Papier. Das merkte schon Hoffmann in seinem Lexikon der griechischen Literatur an, ebenso Ebert [Hoffmann, Literatur der Griechen, S. 531; Ebert, ALB , 12.227]. Immerhin war die Ausgabe auf großem Papier doppelt so teuer wie die normale (25 gegenüber 50 holländischen Gulden), was auf extreme Seltenheit, schon zur damaligen Zeit, hindeutet. Überprüft man beide näher, so stellen sie sich als Druckvarianten heraus: Im Satz selbst findet sich auf Seite 51 der „Normalausgabe“ „Liber Cecundus“ in der Seitenüberschrift, korrigiert bei der größeren Druckvariante, die also die spätere von beiden ist. Auch eine Rahmung sämtlicher Textseiten mittels doppelter Perlstabbordüren ist hier hinzugekommen, was sich in der folgenden Ausgabe von 1757 wiederfindet. Nun ist von der großen Variante nur ein einziges Exemplar nachweisbar, unsere prachtvoll durch den Hofbuchbinder Louis Douceur gebundene Nummer XLI . Erstaunlicherweise sind hier auch die Tafeln durch den Stecher Fokke leicht weiterentwickelt worden. Die nach Eisens Entwürfen hinzukomponierten Rahmen, bei denen sich jetzt an mehreren Fokkes Signatur findet, wo sie in der kleineren Ausgabe noch fehlte, hat dieser bei den Querformaten an den Rahmenlinien des inneren Bildfeldes wohl nach eigenen Ideen behutsam durch Ornament ergänzt, offenbar um die Übergänge fließender zu gestalten; eine allerdings nicht ganz glückliche und recht zaghafte Lösung, die vermutlich nicht gefiel und deshalb wieder verworfen worden ist. Wir finden sie nur noch ein einziges Mal wieder: In unserer Nummer XLVI , ein in besonderer Weise zusammengestelltes, unikales Exemplar, wurde dieser von Fokke abgewandelte Rahmen für einen Probedruck des Frontispizes, also ein Hochformat, verwendet. Freigestellt sieht man die Ornamentform nur hier wirklich, da sie sich bei den Querformaten mehr oder weniger mit dem Bildfeld überschneidet. Hier ist sie eine durchaus interessant wirkende Zierform; dennoch wurde diese Idee nicht weiterverfolgt.
Abschließend sei zu dieser Ausgabe noch vermerkt, daß sie zwar nachweislich in Amsterdam entstanden ist, doch das Pariser Impressum keineswegs willkürlich gewählt worden ist, zielte Néaulme doch mit Sicherheit darauf ab, auch und gerade in der französischen Hauptstadt einige Käufer dafür zu finden. Er arbeitete daher, wie wir belegen konnten, mit mindestens einem Pariser Buchhändler zusammen, Jean-Baptiste-Claude Bauche, in dessen Verlagskatalog, der dem Dictionnaire mytho-hermétique, Paris 1758, beigebunden ist, dieser sowohl die Ausgabe von 1754 als auch eine andere in Duodez angeboten hat.
Ausgabe von
Drei Jahre nach der griechisch-lateinischen Ausgabe, die nur in sehr kleiner Auflage erschienen ist, legte Néaulme mit einer volkssprachlichen Neuausgabe nach, natürlich nicht einfach nur in der bekannten Amyot-Fassung. Wie bei der altsprachlichen Ausgabe von 1754 zielte der Verleger auch hier auf einen Textvergleich ab, nun aber dadurch, daß er der schon damals klassischen französischen Übersetzung von Amyot eine aktuelle gegenüberstellte, jene des Antoine le Camus. Ob es ein Zufall ist, daß Néaulme hier wiederum einen philologisch gebildeten Arzt zum Zuge kommen ließ? Vielleicht kannten sich Bernard und Le Camus, und der Letztere könnte durchaus von Bernard empfohlen worden sein.
Die Ausstattung der vorhergehenden Ausgabe wurde bis auf eine kleine, allerdings recht interessante Variante vollständig übernommen – variatio delectat: Wohl um ein wenig Abwechslung in den auf die Dauer etwas eintönigen Doppelabdruck der Kopfund Schlußvignetten Eisens und Coypels zu bringen, tauschte man die Motive hier gegeneinander aus, so daß am Ende jeweils zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in nur einzelner Ausführung abgedruckt worden sind, statt alle paarweise (in welcher Form die neue Anordnung erfolgte, ist in der Beschreibung unserer Nummer XLII dargelegt). Diese reizvolle Abwandlung, eine sehr ähnliche Darstellung dort erscheinen zu lassen, wo man eigentlich dieselbe erwartet hätte – zumal es sich bei den jeweils ersten und letzten Vignettenpaaren auch so verhält – spricht ein weiteres Mal für die buchkünstlerische Gestaltungsfreude des großen Verlegers.
Dieser hat es auch bei der Erstellung des Drucksatzes gewöhnlich nicht mit der ersten Fassung bewenden lassen. Wiederum wurden Teilauflagen in kleinerem und größerem Quartformat hergestellt, die sich auch als Druckvarianten zu erkennen geben: Die Exemplare auf großem Papier unterscheiden sich von den gewöhnlichen nicht nur durch den jetzt verdoppelten Perlstabrahmen um den Schriftspiegel; auch in den Satz des Textes selbst ist korrigierend eingegriffen worden. Ein Kennzeichen davon ist, daß die Seite 48 bei der großen Variante fehlerhaft mit 84 paginiert wurde – hier war also die große Druckvariante zuerst da, der Fehler wurde später bei der Produktion der kleineren Teilauflage erkannt und richtiggestellt.
Die Idee, den alten Regentenzyklus in zeitgemäße Rahmen zu setzen, hat ihrerseits eine Nachfolge gefunden, doch lag wiederum über ein Vierteljahrhundert dazwischen, so daß sich mittlerweile nicht nur der Ornamentstil, sondern auch die ästhetischen Prinzipien der Buchillustration stark verändert hatten. Das Nachvollziehen dieses Wandels, der mehr ist, als nur eine Änderung von Stil und Geschmack, unter Beibehaltung unserer
altbekannten Darstellungen aus der längst vergangenen Régence, die gewissermaßen der konstante Kern sind, um den sich alle diese Bestrebungen herum entwickeln, im Kommen und Gehen verschiedener Moden, macht einen besonderen Reiz aus, wenn wir uns nun den Ausgaben „À Londres 1779“ zuwenden.
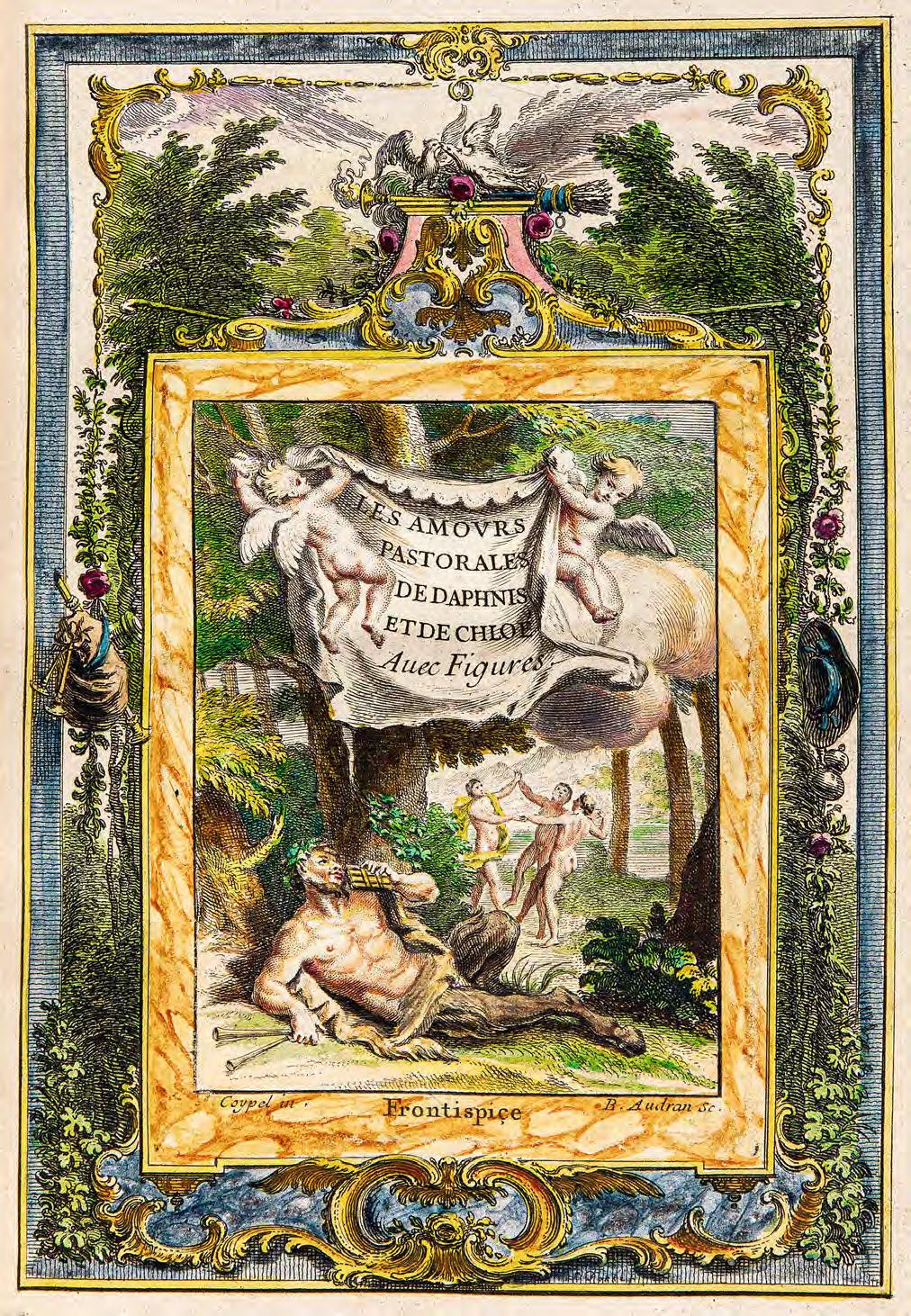
D. „A
Einzug
Goût grec –
Die unter diesem Impressum in zwei Ausgaben, Quart und Oktav, die erstere noch in Varianten, erschienenen Drucke knüpfen an die damals schon über zwanzig Jahre zurückliegenden Amsterdamer Ausgaben der Jahre 1754 und 1757 an. Dazwischen sind nur Editionen erschienen, die in der Geschichte der illustrierten Longus-Ausgaben des 18. Jahrhunderts von minderer oder randständiger Bedeutung sind: London 1763, Den Haag 1764, Bouillon 1776, diese bei der Imprimerie de la Société Typographique, die Tafeln hier mit dem Regentenzyklus in den eher geringwertigen Nachstichen des Géraud Vidal (Anhang G), sowie unsere kleine bibliophile Lyoneser Ausgabe des Jahres 1777 (Nummer LI).
Am großen Vorbild der Amsterdamer Drucke orientiert sich die Quartausgabe von 1779. Das läßt sich zumindest über die Idee sagen, den Regentenzyklus in neuem Rahmenwerk zu präsentierten. Doch schon bei der Zusammenstellung der Tafelfolge wird deutlich, daß hier von Néaulme nicht mehr als die generelle Idee übernommen wurde, ist hier doch wieder die Petits-pieds-Tafel in der Caylus-Fassung vorhanden, und zwar am Ende der Suite, also so, wie das bei den Ausgaben der ersten Jahrhunderthälfte üblich gewesen ist. Auch die Vorlage für den Satz des Textes stammte wohl aus der Zeit vor 1750 – wahrscheinlich wurde dafür eine der Quart-Varianten des Jahres 1745 herangezogen. Dafür gibt es ein Indiz: Zwar wurden bei allen Drucken des Jahres 1779 das Avertissement, die Préface und der Haupttext analog zu den Ausgaben von 1731 und 1745 abgedruckt, jedoch nicht die Notes des Lancelot am Ende. Nun lautet aber der letzte Satz des Avertissement in der Druckvariante, die in unserem Exemplar Nummer LIII vorliegt: „On en rendra compte dans les Notes“. Entweder plante man die Notes noch in die Ausgabe aufzunehmen, oder, was wahrscheinlicher ist, es wurde hier ein Verweis versehentlich nachgesetzt, der sich auf etwas bezieht, was man längst gestrichen hatte. In den anderen Druckvarianten von A Londres 1779 hat man den Fehler erkannt und diesen letzten Satz getilgt. Er weist jedoch auf eine Textvorlage hin, die die Notes enthielt, und dafür kommt nur eine der beiden Ausgaben der Jahre 1731 und 1745 in Frage. Den Experimenten mit Paralleltexten in den beiden großen Ausgaben von Néaulme ist man hier nicht gefolgt, man kehrte zum Altbewährten zurück, das heißt, zu den bekannten Ausgaben der Amyot-Übersetzung mit ihren seit 1718 üblichen Vorstücken.
Eben dies gilt auch für den Illustrationszyklus, nämlich die Regentensuite mit der Caylus-Ergänzung. Indessen waren die originalen Kupferplatten nicht verfügbar, und so wurde ein seitenverkehrter Nachstich angefertigt, dessen Schöpfer sich nicht nur große Freiheiten erlaubte, sondern auch vieles erheblich vergröberte. Betrachtet man nur die Darstellungen ohne Rahmen, müßte man eigentlich von minderwertigen Arbeiten sprechen, doch fällt das Gesamtbild, das sich aus den Szenen mit der aufwendigen Einfassung ergibt, erstaunlich harmonisch, ja richtiggehend prächtig aus, weswegen man über viele Schwächen im Detail hinwegsehen mag. Drei der Tafeln (diejenigen zu den Seiten 30, 43 und 97 in der Quart-Ausgabe) tragen eine Signatur „Groux“. Dieser Stecher, der auch an der Illustration der 1780 à Londres erschienenen Contes et nouvelles en vers von La Fontaine beteiligt gewesen ist, war Charles Jacques Groux [Thieme/Becker, ALBK . Bd. XV, S. 114]. Von ihm ist nur sehr wenig bekannt; er arbeitete hauptsächlich als Kartuschenstecher und ist bereits in den 1750er Jahren in Paris nachweisbar, immerhin für den bekannten Landkarten-Verleger Vaugondy. Später scheint er seine Tätigkeit in den Bereich der Buchillustration ausgeweitet zu haben, doch war er auch zur Entstehungszeit unserer Ausgaben noch für Vaugondy tätig.
Selbstverständlich müssen wir bei unserer Ausgabe von einem fingierten Druckort ausgehen. Hinweise auf den tatsächlichen Ort und Verleger existieren allerdings ausreichend, so daß die sichere Identifizierung möglich wird. Außer der besagten Beteiligung des in Paris tätigen Stechers liefert vor allem der typographisch und in Holzschnitt hergestellte, meist recht feine Buchschmuck einige Indizien: So findet sich die Titelvignette der Quartausgabe, ein Bauernhaus in dörflicher Umgebung, ebenfalls auf Seite 89 der bei Valade und Laporte 1779 in Paris erschienenen Ausgabe von Les éclipses des Roger Joseph Boscovich. Dieselbe Holzschnitt-Kopfvignette, bestehend aus zwei zusammengebundenen Zweigen, kann man in unserer Oktavausgabe am Beginn des ersten Buches (Seite 9) und in den Étrennes à la noblesse des Jahres 1780, gleichfalls erschienen bei Valade in Paris, antreffen, hier am Textbeginn nach dem Kalendarium. Hinzu kommen typographische Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten bei der Gestaltung von Titeln sowie Anfangs- und Schlußseiten. Wir gehen davon aus, daß Valade auch die Contes de J. Bocace, Ausgabe à Londres 1779, verlegt hat. Sie sind mit Kupferstichen des Géraud Vidal illustriert, über die Cohen/De Ricci urteilen, sie seien verglichen mit den Vorlagen „légèrement réduites et gravées médiocrement“. Die Boccaccio-Ausgabe ist unseren Drucken, insbesondere der Oktav-Fassung, so eng verwandt, auch in den Formen des Buchschmucks, den typographischen Zierleisten und Holzschnitt-Vignetten, daß wir diese Ausgabe ebenfalls mit Sicherheit als eine Publikation aus dem Hause Valade annehmen können. Dieser Verleger, der in jener Zeit auch für Cazin arbeitete, hat offenbar versucht, mit mittelmäßigen Kräften die künstlerisch hochrangigen Ausgaben der populären und bedeutenden französischen illustrierten Werke seiner Zeit nachzudrucken und an deren Erfolg anzuknüpfen; diese mit meist zweitrangigen Nachstichen ausge -
statteten Editionen erschienen dann vielfach unter dem Druckort London und anderen fingierten Impressa.
Allerdings gelang Valade bei unserer Daphnis-und-Chloe- Ausgabe erheblich mehr als eine bloße Nachahmung, trotz einiger Schwächen bei der Reproduktion der Regentensuite. Aufgrund des starken Wandels in Geschmack und Mode sahen Verleger und Stecher sich gezwungen, in jedem Fall das Rahmenwerk, das Eisen den Tafeln des Regenten hatte angedeihen lassen, durch zeitgemäße Formen zu ersetzen, sprich: in den in dieser Zeit in voller Blüte stehenden Goût grec zu übertragen. Was hätte es auch Naheliegenderes geben können, als eben jene Stilformen, in denen man im späten 18. Jahrhundert diejenigen aus der Zeit des Longus zu erkennen glaubte (was sicherlich zum Teil auch zutreffend ist, wenn man es nicht zu genau nimmt), zur Illustration seines großen Romans einzusetzen? In ihrer konsequenten Fortführung der editorischen Tradition und der Transformation in den vermeintlich historisch richtigen Ornamentstil besteht die große Besonderheit und Bedeutung dieser Ausgabe, darin ist sie ein interessantes Zeitzeugnis und ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Illustration unseres Werks. Die vormalige Leichtigkeit ist jetzt allerdings dahin, die Formen sind fest gefügt und klar, zwar durchaus noch zierfreudig, aber dies allein aus dem Ornamentrepertoire des Goût grec, wie es etwa Jean-Charles Delafosse entworfen hat. Nun stellen sich die Rahmen nicht mehr in Kontrast zu den Bildern, was im Rokoko graduell der Fall gewesen ist, im Gegenteil, sie ergeben zusammen mit diesen eine visuelle Einheit – die Bildtafel wird gewissermaßen zum Monument im Rahmen, der sie zum eigentlichen künstlerischen Objekt macht und der vor allem auszeichnend und bedeutungsschwer wirken soll. Die Gesamtheit aus Rahmen und Bild wird wahrgenommen, als wäre sie „aus einem Guß“ gefügt, unter Aufhebung der Gegensätze: sehr schön zu sehen vor allem in unserem kolorierten Exemplar, der Nummer LV, wo die übergreifende Farbigkeit von Bild und Rahmen dies zusätzlich deutlich unterstreicht. Führten die Rokoko-Bordüren der 1750er Jahre ein Eigenleben, das dem eigentlichen Bildcharakter in mancher Hinsicht zuwider lief und den Realitätsgehalt der Szenerie in Frage stellte, so nehmen die frühklassizistischen Rahmen eine dienende und hervorhebende Funktion gegenüber dem Bild ein und präsentieren es dem Betrachter. Auch hier wird durch die Rahmen eine Distanz aufgebaut, aber in anderer Art, darauf abzielend, das Bild quasi museal, in seiner Eigenschaft als Kunstwerk, in Szene zu setzen. Der Verleger und seine Illustratoren haben damit den Schritt in eine neue Bildästhetik folgerichtig unternommen, eine weitere wichtige Stufe in der Illustration des Longus-Romans – immer noch mit dem alten Regentenzyklus im Mittelpunkt. Aber auch das sollte noch nicht der Endpunkt dieser Traditionsline sein. Wie schon angedeutet, erschien die Ausgabe „A Londres 1779“ in mehreren Varianten, was hier noch etwas genauer darzulegen ist: Zunächst einmal ist zu konstatieren, daß die Oktav- und die Quartfassung zwei verschiedene Ausgaben sind, nicht nur Varianten in Teilauflagen. Nur im Quartformat werden die Nachstiche der Regentenfolge von den
Rahmenbordüren eingefaßt, und nur dort sind auch alle Textseiten von doppelten Leisten gerahmt. Zudem unterscheiden sich die Holzschnitt-Vignetten: Bei der Quartfassung ist auf dem Titel ein Gehöft mit einem Bauern unter einem Baum zu sehen, die Oktavfassung enthält dagegen zierliche florale Vignetten. Der Textsatz weicht stark voneinander ab, wenn auch mit Gemeinsamkeiten, etwa derselben Zierschrift für den Namen Chloé auf dem Titel. Echte Druckvarianten treten indessen bei der Quartausgabe auf, ablesbar am Ende des Avertissement (man vergleiche unsere Nummern LIII und LV, Vertreter beider Varianten): Dort wurden unterschiedliche Holzschnitt-Schlußvignetten eingedruckt, und in unserem Exemplar LV wurde zudem, wie schon erwähnt, der überflüssige letzte Satz weggelassen, der sich auf die nicht vorhandenen Notes bezieht. Die Exemplare Nummer LIII und LIV sind demnach die früher gedruckten, die zweite Quartvariante dürfte auf diese folgen, die Oktavausgabe als letzte hergestellt worden sein. Die Form der Tafeln spricht ebenfalls für diese Abfolge: Für die Oktavausgabe war das Rahmenwerk zu groß, mußte also wegfallen. Die 13 querformatigen Tafeln der Oktavausgabe hat man wieder als doppelseitige Faltkupfer auf Stegen montiert, aber in unserem Exemplar sind ihre seitlichen Ränder angesetzt, was sich damit erklärt, daß man sie bereits auf Papier für die Quartausgabe vorgedruckt hatte, welches aber ein wenig zu klein für die Doppelseiten der Oktavausgabe ausgefallen ist. Bei dieser Oktavausgabe, die auch auf weniger feinem Papier gedruckt worden ist, kann man mit Recht von einer reduzierten, vereinfachten Zweitfassung sprechen – doch wurden auch diese Exemplare von hochrangigen Käufern erworben, wie unsere Nummer LII aus dem Besitz der Gräfin von Provence, Gattin des späteren König Ludwigs XVIII . von Frankreich, beweist. Der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen, auch in Hinblick auf unser nächstes Kapitel, ist eine Kleinausgabe im Format 18°, die nicht in unserem Katalog vorhanden ist, gedruckt à Londres 1780 , auch sie ein Produkt des Verlegers Valade, gleich erkennbar am Schriftbild, wie auch an den typischen Holzschnitt-Vignetten – eine weitere, nun ganz an das Taschenformat angeglichene, stark vereinfachte Ausgabe, deren Illustration sich auf das Frontispiz beschränkt. Im Gegensatz zu mehreren der im Folgenden vorzustellenden Editionen ist dieser Druck lediglich klein, jedoch kaum bibliophil, obwohl ihn noch Cohen und De Ricci für einen Cazin gehalten haben.
Hätte das Sujet eigentlich sehr gut zum kleinen Buchformat gepaßt, so standen dem doch die Maße der Kupferstichfolgen zunächst entgegen. Eine geringere Größe als das Kleinoktav der ersten Ausgaben war mit den Suiten Scotins und des Regenten kaum möglich. Die Tendenz ging in gegenteiliger Weise immer mehr in Richtung Quart und sogar bis hin zu Folianten, um das Falten der querformatigen Tafeln zu vermeiden. Wollte man die Amours pastorales in einem der in der Zeit eigentlich so beliebten Kleinformate drucken, erforderte dies auch eine veränderte Illustration, und so verwundert es nicht, daß es gerade bei solchen Editionen auch zu Versuchen mit neuer, substantiell anderer Bebilderung kam, allerdings erst im letzten Viertel des Jahrhunderts.
Ein schönes Beispiel dafür ist unsere Nummer LI , ein Lyoneser Faux Cazin , erschienen in drei Varianten im Jahre 1777. Diesen hat Corroënne einer Reihe zugeordnet, die er unter dem Notnamen „Collection lyonnaise des petits formats in-24“ führt. Hier wurde auf einen Zyklus verzichtet, stattdessen erhielt die Ausgabe lediglich eine dem Taschenformat angemessene, sehr galante Neufassung von Scotins Petits pieds, die in aufreizender Weise auch die Köpfe der Liebenden zeigt. In solcher Form kommt die Darstellung einzig bei diesem feinen Lyoneser Druck vor.
Die Pariser Sedez-Ausgabe des Jahres 1783, unsere Nummer LVI , ist eine der ersten des 18. Jahrhunderts, die sich von den hergebrachten Folgen formal und auch ikonographisch wirklich löst. Kurioserweise liegt sie bei uns mit der beigebundenen Regentensuite und daher auf (sehr) großem Papier vor, obwohl sie einen viel kleineren Textspiegel aufweist und ihre eigentliche Illustration fast schon wie ein Kontrastprogramm zu dieser Suite wirkt. Das Naiv-Liebliche wird hier vermieden, mit Vignetten, die erst auf den zweiten Blick ihren Bezug zum Thema offenbaren, einem an Attributen ziemlich überladenen Porträt des Autors der Neuübersetzung, François-Valentin Mulot, und einer ein wenig grotesk anmutenden Allegorie der unschuldigen Liebe des Paares als Frontispiz. Entstanden ist diese Kleinausgabe in bewußter Abkehr von den tradierten Fassungen des 18. Jahrhunderts; Text und Illustration sollten sich nicht aus dem Bekannten herleiten, sondern in überraschender und unerwarteter Weise neue Pfade beschreiten, zumindest für den französischen Leser des 18. Jahrhunderts, der mit Daphnis et Chloé sicherlich sogleich die Prosa Amyots und die Bilderwelt des Regenten assoziierte. Offen-
sichtlich traute der Verleger aber der eigenen Kühnheit nicht so ganz, weshalb er auch einen Abdruck im Oktavformat herstellen ließ – wie hier vorliegend – in den man sich dann wieder die vertrauten Bilder einbinden lassen konnte. Der Sonderweg der neuen Illustration fand natürlich auch keine Nachfolge – für den heutigen Betrachter sind diese Darstellungen jedoch eine erfrischende Innovation, gerade die Vignetten sind Kleinode von Esprit und Geschmack.
In der Revolutionszeit kam es zwar zu einigen starken Wandlungen in der LongusIllustration, doch ist keinesfalls ein abrupter oder gar völliger Bruch mit der Tradition feststellbar, was sich alleine schon im Erscheinen mehrerer Ausgaben mit dem alten Regentenzyklus bis zum Jahr 1796 zeigt. Die wesentlichen Entwicklungen, von denen unten noch die Rede sein wird, fanden zwar im größeren Format statt, doch sind auch einzelne nicht unbedeutende Kleinausgaben mit neuen, an die veränderten Ideale in Stil und Ikonographie angepassten Bildern erschienen.
Darunter war die Duodezausgabe des Jahres 1795, erschienen bei Patris und Devaux in Paris, aufgrund ihrer Illustrationsfolge die wohl bedeutendste und populärste (Anhang J). Auch wenn Portalis die fünf von Louis Binet entworfenen Tafeln als „figures bien mesquines“ [Portalis, Dessinateurs, Bd. I, S. 10] bezeichnet, erfüllen sie doch vollauf ihren Zweck und bedienen die Augenlust des betrachtenden Lesers hinlänglich. Der als Entwerfer und Stecher tätige Binet ist bekannt für seine zahlreichen Illustrationen zu den Werken des Restif de la Bretonne. In dem erzählerisch ausschmückenden Stil, mit dem er dessen Werke bebildert hat, sind auch die Tafeln zur Daphnis-und-Chloe- Ausgabe gehalten, künstlerisch sicherlich nicht erstrangig und etwas schwülstig, dafür aber reich an Erfindung und Freude an der detaillierten Szenenschilderung, wie etwa dem Bad in der Nymphengrotte, der Entführung der Chloe durch die Jünglinge von Methymna und dem Opfer an Pan. Gestochen wurden sie von Jacques Auguste Blanchard. Zwar enthält unser Katalog diese Ausgabe nur mit einem falschen Satz von Tafeln, doch wurde der ganze Zyklus unserer kleinen und höchst seltenen Didot-Ausgabe des Jahres 1800 beigebunden (Nummer LXIX). Interessant ist, daß die Patris-Ausgabe einen Reihentitel „2.e vol. de la collection“ trägt, auf dessen Rückseite auch der zweite Verleger, Devaux, genannt ist. Es handelt sich hierbei um die von Corroënne so bezeichnete „ Collection de Patris“, eine Reihe mit Ausgaben beliebter Literatur der Zeit, der jeweils ein Frontispiz und fünf Tafeln als Illustration beigegeben sind, die allerdings kaum mehr als ein halbes Duzend Bändchen umfaßt haben dürfte, neben unserem Werk unter anderem Thompsons Saisons (Band I), die Amours de Psyché und La mort de Abel . Diese Ausgabe knüpft insofern an jene von 1783 an, als ihr Text gleichfalls in der Übersetzung des François-Valentin Mulot vorliegt.
Anklang bei der Leserschaft fand ebenfalls die Ausgabe aus dem sechsten kalendarischen Revolutionsjahr, 1798, ein Druck in Sedez, illustriert im Zeitgeschmack mit fünf Tafeln nach Entwürfen des Pariser Historienmalers und Illustrators Nicolas-André Monsi-
au, gestochen von Dupréel und Pauquet, deren Darstellungen eine dezidiert bürgerliche Adaption der Thematik sind. Keine Nacktheit, nichts Anzügliches oder Zweideutiges –gezeigt wird in vier Szenen ausschließlich ein immer in züchtige antike Gewänder gekleidetes Paar, das den untadeligen Weg zu seiner rechtmäßigen Verheiratung findet. Ihr gesitteter, vorbildhafter Habitus läßt diese zeittypischen Illustrationen für den heutigen Betrachter arg moralisierend erscheinen, vor der Langeweile bewahrt sie jedoch Monsiaus reizvolle und einfühlsame Darstellungsweise, zudem eröffnet das originelle Frontispiz die Folge mit einer anmutigen Szenerie der Hirtentiere, die sich um einen Brunnen mit der Pansbüste scharen, als Einstimmung des Lesers auf die eigentlich bukolische Thematik. In unserem Katalog ist die Ausgabe in Kleinoktav vorhanden (Nummer LXVII), deren Illustrationen, von der Größe des Papiers abgesehen, dieselben sind, allerdings wurden in die größere, auf Velin gedruckte Ausgabe bevorzugt frühere Zustände der Tafeln eingebunden. In unserer Nummer LXVIII liegen drei lose Suiten in verschiedenen Zuständen vor, die dokumentieren, wie unterschiedliche Exemplare der Oktavausgabe auf Wunsch des Käufers illustriert werden konnten: in eau-forte pure, avant la lettre und im Endzustand, der hier im Kolorit der Zeit und mit montierten Goldrahmen zusätzlich prächtig aufbereitet worden ist.
Unter den Ausgaben im kleinen Format dürfen auch jene nicht vergessen werden, die im letzten Viertel des Jahrhunderts im Rahmen besonderer, meist umfangreicher Reihen publiziert worden sind, insbesondere jene, die zu der von François-Ambroise Didot im Auftrag des jüngeren Bruders des Königs, Charles Comte d’Artois, gedruckten Collection d’ouvrages français, en vers et en prose gehört. Diese 64 Bände umfassende „Taschenbibliothek“ erschien 1780–84 und kann zu den ersten Meisterleistungen der Didot-Typographie im kleinen Format gezählt werden. Eine Illustration wurde ihr nicht beigegeben. Ebenso verhält es sich mit dem Abdruck des Longus-Textes in der MulotÜbersetzung, der 1785 im Rahmen der Reihe Bibliothèque universelle des dames erschienen ist. Beide sind Zeugnisse für die in dieser Zeit schon selbstverständliche Einbeziehung des Longus-Romans in den Kanon der klassischen Literatur, die man sowohl zur Bildung als auch zur Unterhaltung gelesen hat. Die zur Zeit Ludwigs XIV. „ad usum Delphini“ zwischen 1670–98 gedruckte Reihe griechischer und lateinischer Klassiker enthielt dagegen noch keinen Daphnis-und-Chloe-Band. Als Nummer VI fand der Longus zudem Eingang in die Reihe Bibliothèque des romans grecs, traduits en français , die der Pariser Verleger Guillaume 1797 in zwölf Duodezbänden herausgebracht hat. Hier hat man sich die Ausgabe des Jahres 1731 zur Vorlage genommen und daher auch die Notes des Lancelot am Ende mit abgedruckt. Sogar in eine Reisebibliothek wurde das Werk aufgenommen: die Bibliothèque portative du voyageur, erschienen 1801–04 in Paris bei Fournier, und zwar in der Übersetzung des Amyot. Aus dieser Reihenausgabe besaß auch Goethe, der bekanntlich im Gespräch mit Eckermann empfohlen hatte, man
möge den Roman mindestens einmal im Jahr lesen und von Amyots Übersetzung sehr angetan war, den Longus-Band in seiner Bibliothek.
Im Jahre 1800 erschien die letzte bedeutende kleinformatige Ausgabe in unserem Zusammenhang (Katalognummer LXIX). Sie ist ein Kuriosum, nicht zuletzt deshalb, weil sie die kleine Schwester der monumentalen großformatigen „Jahrhundertausgabe“ aus dem Hause Didot ist. Wie der Reihentitel L’ Ornement des petites bibliothèques. Collection précieuse, en petit format, des plus jolis romans, et autres ouvrages choisis en vers et en prose anzeigt, war geplant, mit dieser Longus-Ausgabe eine besonders feine kleine belletristische Reihe zu initiieren. Zustande gekommen ist sie leider nicht, doch wirkt der vorliegende Druck wie ein Muster für kleinformatige Typographie in klassizistischer Antiqua. Das dürfte wohl der Hauptgrund für die Entstehung dieses im gerade erst entwickelten Stereotypieverfahren angefertigten Drucks gewesen sein: einen Prototypen zu schaffen für künftige Kleinausgaben. Tatsächlich ist diese Schrift auch im sehr klein gesetzten Normaltext so gut lesbar, so bestechend klar und wohltuend für die Augen, daß sie ihren Zweck in jedem Fall erfüllt. Das Experimentelle ist unserem Exemplar indessen ablesbar: Es ist unbeschnitten, durchgehend regliert und enthält die Tafeln des Binet, statt der sonst üblichen Monsiau-Folge.

Daphnis und Chloe in der Konkurrenz zweier Hauptmeister der Typographie (Nummern LVII – LXIV und LXX– LXXVIII)
Der wohl bedeutendste Impuls für die Geschichte der französischen Editionen von Daphnis und Chloe im ausgehenden 18. Jahrhundert, der sogar bis in die Zeit des Empire fortwirken sollte, erfolgte erstaunlicherweise von außen, durch die berühmte griechische Ausgabe, die Bodoni 1786 hatte erscheinen lassen (unsere Nummer LVII). Dieses prächtige Druckwerk, das Bodoni als Leiter der herzoglichen Druckerei zu Parma unter Verwendung einer viel bewunderten griechischen Drucktype produziert hat, setzte auch in Frankreich neue Maßstäbe. Zuvor hatte sich Bodoni allerdings gegen einige Kritik an seiner griechischen Schrift, die bezeichnenderweise aus Frankreich kam, zur Wehr setzten müssen; in seinem 1785/86 veröffentlichten Brief an den Marquis de Cubière berief er sich darauf, seine Schrift sei exakt von den Drucktypen Estiennes kopiert, mit denen dieser schon im 16. Jahrhundert griechische Texte gesetzt hatte. Ist es also verwunderlich, daß Bodoni, den diese Angriffe sehr trafen, als Perfektionist, der er war, mit einer Demonstration seines ganzen Könnens reagierte? Zumal es sich bei seinen Kritikern um Franzosen gehandelt hatte, wird auch dies ein wesentlicher Beweggrund dafür gewesen sein, daß sich Bodoni nun ein in Frankreich beliebtes Werk der griechischen Literatur aussuchte, um seine Kunstfertigkeit als Typograph vorführen zu können: Was lag da näher als der Roman des Longus?
Wir brauchen zu dieser überragenden Ausgabe, diesem Meilenstein der Schriftkunst und Buchgestaltung, nicht viele Worte zu verlieren, darüber ist genug gesagt worden. Sie fällt in eine Zeit der Konkurrenz der Großmeister und Neuerer der Schriftkunst im Zuge der Entwicklung der klassizistischen Antiqua. Auf Caslon und Baskerville in England folgten die Pariser Verleger- und Druckerfamilie Didot und der Italiener Bodoni, der mit Argusaugen beobachtete, welche Entwicklungen die Schriftkunst in Frankreich und anderen Ländern nahm, insbesondere bei den schwierigen griechischen Typen, die man gegen Ende des Jahrhunderts immer mehr benötigte, um entsprechend dem sich steigernden Interesse an der klassischen Literatur Griechenlands Texte in adäquater und schöner Form in der Originalsprache setzen zu können. Die Familie Didot, insbesondere François-Ambroise und sein Bruder Pierre-François, war hierfür ein Wegbereiter und kam im Zuge dieses Ringens um die Form mehrfach auf Longus zurück, beginnend mit der Dutens-Ausgabe des Jahres 1776. Dieser folgte schon zwei
Jahre später, 1778, der zweisprachige griechisch-lateinische Druck, dessen sorgfältige neue griechische Textedition der berühmte Gräzist Jean-Baptiste Gaspard d’Ansse de Villoison besorgt hatte. Abgesehen von wenigen Holzschnitt-Vignetten ist sie nicht illustriert, es handelt sich um eine kommentierte, textkritische Ausgabe, die sich bewußt an den „Lector eruditus“ wendet.
Diese Ausgabe diente wiederum Bodoni als Grundlage seines Drucks von 1786, er hat die Textfassung Villoisons übernommen. Insofern bringt Bodoni nichts Neues hinsichtlich des Longus-Textes, von der lateinischen Einführung zu den erotischen Büchern der Antike einmal abgesehen. Der Impetus für Bodonis Neuausgabe kam natürlich nicht so sehr von der Philologie her und noch weniger von der Illustration, die hier nur die Rolle einer Beigabe spielt – für Bodoni ging es darum, seine Meisterschaft als Typograph griechischer wie lateinischer Texte unter Beweis zu stellen. In Frankreich rief seine Großtat sogleich eine deutliche Reaktion hervor, wenn wir die Longus-Ausgabe des Folgejahres 1787 als solche interpretieren dürfen.
Pierre-François Didot, damaliger Leiter der Imprimerie de Monsieur, der Druckerei des Bruders des Königs, sah sich offenkundig genötigt, diese Herausforderung unmittelbar zu parieren, und so erschien schon im Folgejahr eine Ausgabe, die ihrerseits versuchte, alle bisherigen Longus-Editionen zu überragen. Nur war Bodoni auf dem Gebiet der griechischen Typographie einstweilen nicht zu schlagen – das sollte erst 15 Jahre später der Sohn des François-Ambroise Didot, Pierre Didot, mit seiner nur in einigen wenigen Exemplaren hergestellten griechischen Ausgabe des Jahres 1802 (als Beiband in unserer Nummer LXXIV enthalten) versuchen – Pierre-François Didot setzte auf eine andere Karte, die Bodoni nicht ausgespielt hatte: die Illustration und die lange, bedeutende Tradition einer wohlbekannten Bilderfolge. Selbstverständlich wäre es nicht opportun gewesen, jetzt noch einmal die alten Platten der Regentensuite hervorzuholen, so diese überhaupt noch zur Verfügung gestanden hat. Für eine echte Neuausgabe brauchte man etwas deutlich Besseres, bisher nie Gesehenes, und doch in der alten Traditionslinie Stehendes. So kam man auf die Idee, den Zyklus, der in Form der Gemälde von der Hand des Herzogs und Coypels noch in Schloß St. Cloud zu sehen war, ein weiteres Mal mittels gestochener Bildtafeln zu reproduzieren, und nicht nur das: auch seine Farbigkeit erstmals in authentischer Weise wiederzugeben. Unser Exemplar Nummer LXI ist das exzeptionelle Zeugnis dieses Vorgangs, der in der Geschichte der Buchillustration seinesgleichen sucht. Doch bevor wir darauf näher eingehen, soll diese besondere Ausgabe von 1787 kurz vorgestellt werden.
Erschienen ist sie bei Pierre-Michel Lamy, der sie im Auftrag von Louis Stanislas Xavier herstellte, dem Bruder König Ludwigs XVI ., selbst viel später als Ludwig XVIII . König von Frankreich. Der Druck zeigt schon auf den ersten Blick, in seinem gesamten Erscheinungsbild, in der edlen typographischen Gestaltung, im Verzicht auf allen
unnötigen Zierat wie auch in der enormen Großzügigkeit des Schriftbildes und der Titelseiten, daß er unmittelbar unter dem Eindruck von Bodoni entstanden ist. Schon die Normalausgabe dieser Traduction nouvelle ist in jeder Hinsicht eine Besonderheit, von der graphischen und drucktechnischen Gestaltung höchsten Anspruchs, bis zum verwendeten Papier, dem gerade erst entwickelten Velin. Das Format in Großquart steht einem Schriftspiegel gegenüber, der normalem Quart entspricht, also wie ein Druck auf großem Papier wirkt, nur daß sich dies über die gesamte Auflage erstreckt. Dazu die Zweiteilung, von der die Bibliographen schreiben, die Ausgabe sei in zwei Teilen in einem Band erschienen; jedoch bildet sich das weder in den Lagensignaturen noch den Seitenzahlen ab. Es gibt nur eine inhaltliche Aufteilung in die vier Bücher des Longus mit den entsprechenden Zwischentiteln. Und doch wurde ein Haupttitel für den zweiten Band, der die Bücher zwei bis vier umfaßt, gedruckt, außerhalb der Lagenzählung, wie der Titel zum ersten Band auch – das Einbinden erfolgte also bei Bedarf, insbesondere im Fall von physischer Aufteilung in zwei Bände, was in unserer Sammlung bei den Nummern LIX und LX der Fall ist. Erforderlich war die Trennung insbesondere bei Exemplaren auf Pergament und mit zusätzlicher Ausstattung. Die Anfertigung des optionalen Titels zum zweiten Band weist damit bereits auf den Umstand hin, daß der Verleger geplant hatte, derartige „besondere“ Exemplare herzustellen.
Die Ausgabe von 1787 ist getragen von der Idee der Erneuerung bei möglichst enger Anknüpfung an die Tradition. Neu ist in jedem Fall die Übersetzung, in Ablösung der klassischen, aber sprachlich antiquierten Amyot-Fassung durch die Übertragung des Philologen Jean François Debure-Saint Fauxbin, bekannt für seine Boethius-Ausgabe, die 1783 ebenfalls bei Lamy in Paris erschienen ist, herausgegeben unter dem Pseudonym „Johannes Eremita“. Im Gegensatz zu den meisten anderen Versuchen neuer LongusÜbersetzungen des 18. Jahrhunderts wurde die seine immerhin von den meisten Rezensenten und Bibliographen kaum mit abwertender Kritik bedacht. Zur neuen Übersetzung gesellt sich nun auch die Renovatio der Illustration – in beiden Fällen ging man gewissermaßen an die Quellen zurück. Der Titel vermerkt das explizit: „Avec figures nouvellement dessinées “ .
Wie wir anhand unseres Exemplars Nummer LXI belegen können, wurde der gesamte Zyklus des Regenten nicht nur nach den originalen Gemälden in Schloß St. Cloud abgezeichnet, sondern man beauftragte sogar einen farbkundigen Koloristen, der direkt anhand der Vorbilder Muster angefertigt hat. Auf diese Weise entstand eine neue Suite du Régent, nicht in billig produziertem Nachstich, wie er genügend in Umlauf war, sondern anhand der Originale approbiert – zu den näheren Umständen dieses Vorgangs siehe die ausführliche Beschreibung unseres Exemplars. Jedes Bild ist dort mit der Bestätigung versehen, daß es mit dem Urbild übereinstimmt. Im Gegensatz zu Audran, dem Stecher der Suite von 1718, dem man wohl nur Zeichnungen vorgelegt hatte, arbeitete der Graphiker der Didot-Ausgabe von 1787, Pierre-Antoine Martini, direkt nach den
Gemälden, weshalb bei seinen Radierungen auch weit größere Bildausschnitte zu sehen sind, Teile der Gemälde also, die der Zyklus der ursprünglichen Regentenausgabe noch nicht zeigte. Die Farbmuster hatten indessen den Zweck, kolorierte Exemplare in einer bestimmten kleinen Anzahl als Vorzugsausgabe herzustellen. Soweit bekannt, wurden zwölf Exemplare komplett auf Pergament gedruckt und mit gouachierten Radierungen versehen; dies belegt Antoine-Augustin Renouard in seinem Katalog von 1819 [Bd. III , S. 188]. Er spricht dort davon, daß Lamy für diese Ausgabe, „exécutée avec grand appareil“, die Stiche des Regenten hat abzeichnen lassen (was sicher so nicht stimmt, sondern die Gemälde), um Abzüge auf Pergament für zwölf Exemplare, „ornés de gravures peintes ou plutôt fortement enluminées“, anfertigen zu können, die er dann sehr teuer verkaufte. Eines davon ist das durch den Concierge de St. Cloud bestätigte Exemplar, das unstrittig vor den Gemälden koloriert worden ist („avec un soin tout particulier“), während man für die elf anderen Illuminatorinnen angestellt habe, die diese Arbeit im Atelier durchführten („onze autres exemplaires par des enlumineuses“). Wir wissen heute aber, daß zwölf Exemplare auf Pergament gedruckt wurden, doch nur zehn davon erhielten illuminierte Radierungen; die restlichen beiden hat man zu ganz besonderen Vorzugsexemplaren veredelt, indem ihnen vergrößerte Suiten aus Originalgouachen beigegeben wurden. Es handelt sich hierbei um die Exemplare Forbes und Galitzin, beide in unserem Katalog, unter den Nummern LIX und LX [vgl. auch Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Bd. I, Sp. 655]. Renouard hat in seinen Katalogen nicht immer ganz korrekt zwischen Exemplaren mit kräftig kolorierten Radierungen und Originalgouachen unterschieden, weshalb es nicht leicht ist, die Anzahl der Exemplare anhand seiner Angaben exakt zu ermitteln. So führte er etwa im Verkaufskatalog der Sammlung Lamy von 1807, dem Nachlaß des Verlegers unserer Ausgabe, unter der Nummer 3836 vier Exemplare auf, beschrieben als „imprimé sur vélin, avec les 29 sujets peints en miniature, aussi sur vélin“, von denen wohl nur zwei Exemplare gemalte Gouachen enthielten, die anderen beiden aber gouachierte Radierungen. Kehren wir von diesen sehr raren Luxusexemplaren nochmals zur Normalausgabe zurück, die auch ohne Sonderanfertigungen ihren Ruhm redlich verdient hat. Die klassisch schöne Type, die bis heute berühmte klassizistische Didot-Antiqua, genannt Didone, die fast ohne Verzierungen auskommende Buchgestaltung in vollkommener harmonischer Ausgewogenheit – das mise en page, quasi ein Muster und Vorbild für die Buchkünstler und „Layouter“ aller folgenden Zeiten, sowie die „superbe impression sur papier vélin d’Annonay“, die schon die Zeitgenossen rühmten, all das macht diese Ausgabe zu einem würdigen Gegenstück zu Bodonis großem Wurf im Jahr zuvor. Was das Papier betrifft: Das in England entwickelte Velinpapier, das durch Étienne Montgolfier 1777 in Frankreich eingeführt und verbessert worden war, wurde zuerst in Annonay in der Auvergne produziert; die Imprimerie de Monsieur hat es unter der Leitung von Pierre-François Didot als eine der ersten verwendet, zunächst nur für besondere Publikationen.
Für das Haus Didot war diese große Longus-Ausgabe noch immer nicht die letzte, wieder wurde das Streben nach erneuter Steigerung zur vollendeten Form gemäß den Idealen der klassizistischen Buchgestaltung sehr deutlich spürbar, als Pierre Didot, der als „Didot l’aîné“ bekannte Sohn von François-Ambroise Didot, seinen, wir möchten fast sagen „Jahrhundert-Longus“ im Jahre 1800 produzierte (Nummern LXX- LXXVIII), nachdem er schon mit Vergil- und Horaz-Ausgaben 1798/99 sein Können unter Beweis gestellt hatte. Didot schuf hier eine repräsentative französische Ausgabe in der AmyotÜbertragung und illustriert mit dem Zyklus von Prud’hon und Gérard (siehe dazu unten): monumental und von bleibendem, zeitlosen Charakter, breitrandig auf Großquart abgedruckt, eine Großzügigkeit, die ihre Entsprechung in Satz und Schriftbild findet, alles bestimmt von Monumentalität und Würde. Zur selben Zeit produzierte das Haus Didot noch einen kleinen Begleiter in Sedez (unsere Nummer LXIX), ein Gegenstück in der Größe, doch in demselben Geist gestaltet.
Bald danach muß Pierre Didot dann die Planung einer erneuten griechischen LongusAusgabe begonnen haben; er nahm offenbar die Herausforderung um die Herstellung der schönsten griechischen Schrifttype wieder auf – seit Bodoni war lediglich eine griechischlateinische Ausgabe in Deutschland erschienen (Zweibrücken 1794) – und druckte 1802 ein in Form und Stil entsprechendes Pendant zu seiner französischen Ausgabe des Jahres 1800, das auch dieselben Illustrationen wie diese Edition enthalten sollte. Diese griechische ist eine der seltensten Longus-Ausgaben überhaupt; wie schon Hoffmann in seinem bibliographischen Lexikon der Griechen angibt [S. 532], wurden lediglich 27 Exemplare auf großem Velinpapier hergestellt (in unserer Sammlung die Nummer LXXIV, dort der Ausgabe von 1800 beigebunden) und weitere zwei auf Pergament. Tatsächlich ist es Didot gelungen, hier ein Schriftbild zu erzeugen, das an Ebenmaß jenes von Bodoni noch übertrifft, wenn auch dieses reizvoller und lebendiger erscheint, doch fällt Didots Type regulärer, einheitlicher, harmonischer, wenn man so will: klassischer aus, so daß es ihm auch hier gelingt, ein zeitlos schönes Muster zu schaffen, das seine Vorbildhaftigkeit niemals verlieren wird. Am Ende hat das Haus Didot bei Longus mit Bodoni mindestens gleichziehen können, auf dem Gebiet der Typographie – und auf dem Feld der Illustration eröffnete es gar einen neuen Horizont.
G. Die Longus-Illustration am Ausgang des 18. Jahrhunderts: Vom Ende einer großen Tradition und dem überfälligen Durchbruch des Neuen
Wie wir gesehen haben, wurde die Illustration der französischen Ausgaben von Daphnis und Chloe fast über das gesamte 18. Jahrhundert hinweg vom Zyklus des Regenten beherrscht, während der kleinere Begleiter des Scotin eine untergeordnete Rolle gespielt und nach der Jahrhundertmitte auch keine echte Nachfolge mehr gefunden hat, von einzelnen Ausnahmen abgesehen. Die Schöpfer der Regentensuite haben sicherlich nicht erahnen können, welch durchschlagende Wirkung, vor allem auch Nachwirkung, ihre Bilderfindungen haben würden. Von den Neuauflagen, erneuten Präsentationen, Wandlungen und Nachschöpfungen haben wir hier manches berichten können, auch von künstlerischen Spitzenleistungen und schlichter Imitation. Selbst in Deutschland erschien ein Ableger, erhielt doch die bei Voß in Berlin 1765 publizierte deutsche Übersetzung einen Kupfertitel mit einem – allerdings miserablen – Stich nach Coypel.
Im letzten Jahrhundertviertel wurde der Bedarf nach der Regentensuite vor allem von dem künstlerisch sehr bescheidenen, aber doch zweckdienlichen Nachstich der gesamten Folge, einschließlich von Frontispiz und Conclusion du roman , aus der auf Reproduktion spezialisierten Stecherwerkstatt des Géraud Vidal bedient. Vermutlich entstand diese Suite um 1775. Die Tafeln Vidals wurden teils auch in frühere Ausgaben nachträglich eingebunden. Regulär mit der ganzen Folge in der Fassung Vidals ausgestattet wurde unseres Wissens zuerst die Ausgabe von 1776 aus der Imprimerie de la Société Typographique in Bouillon (Anhang G). Der Versuch, die Regentenausgabe von 1718 zu imitieren, führte hier immerhin zu einer durchaus reizvollen Neuschöpfung der gestochenen Kopfvignette am Textbeginn, die Scotins Motiv der spielenden Eroten wieder aufgreift. Über die Motivation dieser auf die Literatur der Aufklärung spezialisierten Verlagsanstalt auch belletristische Texte zu drucken schreibt Raymond Birn: „Tout en publiant des éditions attrayantes, en plusieurs volumes, de J. J. Rousseau, Voltaire, Diderot et Crébillon fils pour orner les bibliothèques des collectionneurs, elle [la Société] aimait surtout à éditer des romans bon marché, dans la veine des grands ‚contes philosophiques‘ du siècle.“ [Birn, Le livre prohibé, S. 340].
Erstaunlich ist, daß der Regentenzyklus , ein Bildwerk des Ancien Régime par excellence, auch in der Revolutionszeit keineswegs sein alsbaldiges Ende gefunden hat; weitere mit seinen Tafeln illustrierte Ausgaben erschienen 1792 in Lille und noch 1796 in Paris
(die Nummern LXV und LXVI), wobei jene aus Lille, die wiederum den von Vidal reproduzierten Zyklus enthält, auch insofern an die Ausgabe Bouillon 1776 anknüpft, als hier ebenfalls am Schluß eine paginierte Buchbinderanweisung zur Positionierung der Tafeln mit abgedruckt wurde.
Gleichermaßen interessant wie selten ist die einzige in Versailles gedruckte Ausgabe, 1784 bei Sévère-Dacier, Libraire de MM. les Gardes du Corps du Roi , erschienen (Anhang H); hier ist der Regentenzyklus auf fünf Tafeln reduziert, dazu das Frontispiz und die Conclusion du roman; man hat sich also mit einer kleinen Auswahl aus der Suite beschieden, weil der Nachstich des Gesamten wohl doch zu aufwendig erschien. Weitere zehn Jahre später erhielt auch sie einen Nachfolger, eine ebenfalls kleinformatige „Amsterdamer“ Ausgabe des Jahres 1794, mit sechs Tafeln aus der Regentensuite, dazu Frontispiz und Conclusion du roman , alles in ziemlich anspruchslosen Nachstichen (Anhang I). Offenbar ist letztere ein nicht autorisierter Nachdruck der Versailler Ausgabe; die Tafeln sind deshalb ein weiteres Mal völlig neu gestochen worden, teils abweichend von ihrem Vorgänger. Künstlerisch sind alle diese späten Tascheneditionen nur noch ein Nachhall, doch einen Bedarf beim Publikum bedienten auch sie. Editionsgeschichtlich interessant sind sie allemal, und manche unter ihnen haben selbst für den Bibliophilen noch einen gewissen Reiz.
Die große Traditionslinie aber fand ihren eigentlichen würdigen Schluß- und Gipfelpunkt in dem Martini-Zyklus zur Ausgabe des Jahres 1787, insbesondere in den verschiedenen farbigen Fassungen, die uns heute die verlorenen Originalgemälde ersetzen. Die Verleger Lamy und Didot werden es sicherlich ebenfalls so gesehen haben: Eine abermalige Fortsetzung dieser Überlieferungslinie hätte nurmehr zu Niedergang oder endgültiger Ermüdung geführt. Ein Verleger, dem es um tatsächliche Buchkunst ging, konnte nach 1787 mit der Regentenfolge nicht mehr viel anfangen. Daher waren Lamy und vor allem die Familie Didot in der Folgezeit wesentlich um die Bereitung der Wege für eine neuartige Illustration bemüht und öffneten sich in diesem Zug selbst für jüngere Zeichner und Maler mit innovativen künstlerischen Auffassungen und Stilen, die etwas ganz Anderes zu bieten hatten als die naive, recht schlichte Bilderzählung des Regenten, die lediglich von Szene zu Szene fortschreitet, immer sehr eng an den Text angelehnt. Die Ausdeutung der Geschichte, nicht als Schilderung von Ereignissen, sondern als ein Durchlaufen von Stadien seelischer Entwicklung der beiden Protagonisten, das ist das im Kern Neue, das ein Le Barbier, Prud’hon und Gérard in die Illustration einbringen, jeder auf seine Weise, aber letztendlich darauf abzielend, daß es in dieser Erzählung gerade auch um die Psyche und das Wesen des Menschen geht, den aufbrechenden Eros in der Adoleszenz, die Spannung und die Attraktion zwischen den Geschlechtern. Darum benötigen diese Zyklen auch längst nicht mehr so viele Tafeln wie noch der Regent, denn hier werden die entscheidenden Entwicklungsmomente in wenigen Darstellungen
auf den Punkt gebracht. Im Zuge einer empfindsamen Protoromantik rückt dabei das Seelenleben der handelnden Personen in den Mittelpunkt, die äußerlichen Ereignisse spielen in diesen Folgen nur noch eine Nebenrolle. Auf den ersten Blick wird das schon daran deutlich, daß der Betrachter viel mehr auf die Personen hingelenkt wird; sie erscheinen jetzt größer und präsenter gegenüber dem landschaftlichen Hintergrund, der sie mehr umfängt und einbettet, als ihnen nur eine weite Bühne und Staffage für die Szenerie zu bieten. Der geschützte Ort, der nötig ist, damit sich das zaghaft in Gang kommende Gefühlsleben der Liebenden entwickeln kann, wird nun zu einem zentralen Bildthema. Etwa zehn Jahre zuvor ist dieser Gedanke – im Frontispiz zur Ausgabe von 1783 – bezeichnenderweise noch als spätbarocke Allegorie visualisiert worden.
Hinzu kommt die Lichtstimmung, das Spiel mit Schatten und Dunkelheit, mit dem besonders Prud’hon sehr differenziert und effektvoll arbeitet, wenn die Szene etwa in einem Hain weitgehend im Schatten liegt, wie bei der Auffindung des Daphnis, wo nur einzelne Sonnenstrahlen durchdringen und den nackten Körper des Kindes grell beleuchten, oder auch in Gérards wunderbarer Szene mit den drei Nymphen vor dem schlafenden Daphnis unterhalb eines Dachfensters, durch das das Mondlicht einfällt, so daß es die Körper der Frauen umspielt und sehr sinnlich und präsent erscheinen läßt. Der Betrachter ist unmittelbarer Zeuge eines ganz intimen Moments, und dieses Intime wird natürlich auch auf das Erotische ausgedehnt, das nun immer breiteren Raum einnimmt. Bereits Prud’hons Badeszene in der Nymphengrotte hat deutlich voyeuristische Züge: Mit Daphnis betrachten wir den nackten Körper der Chloe, bei dem wiederum das Licht zu einer immens sinnenfreudigen Schilderung eingesetzt ist, und das vor dunklem Hintergrund. Gerade diese Szene hat im 19. Jahrhundert ungezählte Nachfolge gefunden, von der Romantik über die Salonmalerei bis zur anbrechenden Moderne – ein Künstler hat versucht, den nächsten an betörender erotischer Intensität zu übertreffen, man denke an die Fassungen eines Louis Hersent, François-Louis Français, Gustave Courtois, Harold Speed, Luigi Rossi und Paul Emile Bécat, um nur einige zu nennen. Diese Ausdeutung und Behandlung der Thematik begann im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, das 19. Jahrhundert fügte dem im Wesentlichen nur neue Variationen hinzu; erst Künstler der Moderne, wie Bonnard, Sintenis, Maillol und Chagall, teils auch schon manche Illustratoren des Jugendstils, sollten hier zu substantiell neuen Interpretationen gelangen. Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Thematik schließt alle Gattungen ein, und natürlich spielte die Ölmalerei im 19. Jahrhundert die Hauptrolle, doch wurde die Geschichte auch immer wieder in den graphischen Künsten und der Buchillustration zur Vorlage genommen. Soviel nur als Ausblick. Voraus ging diesen Neuerern hingegen nicht viel, wenn wir alleine die Geschichte der illustrierten Ausgaben des Romans in Betracht ziehen; lediglich die erwähnten Kleinformate zeigten da und dort eigenständige Ansätze, doch geschah das teils schon gleichzeitig mit der Entstehung der neuen Zyklen und hatte auch keinen wirklichen Einfluß mehr auf sie. So hat etwa der mit deut-
lich romantischem Einschlag angereicherte klassizistische Stil, in dem Gérard illustriert, nur wenig mit dem bürgerlichen Klassizismus eines Monsiau gemein. Die neuen Formen der Illustration sind denn auch nicht als immanentes Entwicklungsmoment aus der bisherigen Darstellungstradition zu erklären, sondern allein dadurch, daß jetzt Künstler herangezogen wurden, die von außen neue Impulse einbringen und sich der Thematik vor dem eigenen schöpferischen Horizont annehmen. Natürlich kennen sie alle die früheren Bilderwelten genau – aber sie lösen sich bewußt davon. Von den drei erstrangigen Künstlern, die sich von ca. 1793–98 der Daphnis-und-Chloe-Thematik annehmen sollten, hatte mit Ausnahme von Le Barbier keiner diese zuvor bearbeitet. Sie wurden von einem ambitionierten Verleger mit der Aufgabe konfrontiert, ihren Beitrag zu einem buchkünstlerischen Prestigeprojekt zu erbringen.
Le Barbier – Prud’hon –
„großen Kunst“ im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts
Dieser Verleger war Pierre Didot, der sich zusammen mit seinem Bruder Firmin um die Buchkunst des Klassizismus in Frankreich wie kaum ein anderer verdient gemacht hat, die Standards setzte und die Typographie zu ungeahnten Höhen führte. Sollte die Illustration damit Schritt halten, brauchte man die entsprechenden Künstler von Rang, nicht nur versierte Handwerker: „Émule de Bodoni à Parme et de Boydell à Londres, Didot s’employa à faire de l’édition française la première en Europe, s’assurant le soutien du gouvernement (…) et la collaboration des premiers artistes du pays. David dirigea l’illustration de trois de ses principales publications, le Racine, le Virgile et l’Horace, dits ‚du Louvre‘, où Didot avait ses presses: c’était faire revivre, il en était conscient, les prestigieuses éditions de la Typographie royale sous Louis XIV. Les élèves de David (Girodet et Gérard entre autres) y prirent part. A une typographie redessinée par Firmin Didot, selon les canons les plus purs de l’épigraphie romaine, correspondaient la clarté du dessin davidien et la rigueur de la taille des burinistes Tardieu ou Godefroy. Comme l’écrivait Pierre Didot: ‚Le simple est du vrai beau la plus parfaite image‘“ [Prud’hon ou le rêve du bonheur, S. 117].
Eine Neuedition von Daphnis und Chloé wurde im Hause Didot wohl schon zu Beginn der 1790er Jahre ins Auge gefaßt. Geplant war in jedem Fall eine große Ausgabe, die mindestens im Quart-, wenn nicht sogar Folioformat zu denken ist. Als Illustrator war zunächst ein bewährter Künstler vorgesehen, der Historienmaler Jean-Jacques François Le Barbier l’aîné. Der Auftrag dazu dürfte ihm 1793 von Didot erteilt worden sein [vgl. Barber, Daphnis and Chloe, S. 48]. Aus nicht überlieferten Gründen schei-
terte das Projekt, doch angesichts der bereits gefertigten Fragmente und Entwürfe läßt sich erahnen, daß es hier zu einem ganz besonderen Höhepunkt in der Geschichte der Buchillustration hätte kommen können. Nebst Tafeln sollten auch Vignetten sowie die Bordüren der Eröffnungsseiten von Le Barbier gefertigt werden; mit diesen Entwürfen setzte er zu einem wahren Höhenflug an – ein erfahrener Meister gestaltet hier, souverän geht er mit einer Fülle von Ideen und originellen Neuschöpfungen an die Arbeit, in dem erkennbaren Willen, der Edition durch diese Illustration unverwechselbaren Charakter zu verleihen. Vielleicht war eben dies dem Verleger dann doch ein bißchen zu viel des Guten, denn damit hätte der Illustrator – und nicht der Typograph – der Ausgabe seinen Stempel aufgedrückt, hätte der Bildschmuck die erhabene Simplicité des Drucks an die zweite Stelle treten lassen, wenn nicht gar etwas substantiell Anderes geschaffen – ein von der Freude am dekorativen, bildnerischen und ornamentalen Gestalten geprägtes Buch, aber sicherlich kein Monument unter dem Primat der Schriftkunst, wie es Didot vorschwebte. Le Barbier wäre demnach den ästhetischen Grundsätzen des Verlegers in die Quere gekommen, zumal sein Stil eo ipso schon von Zügen geprägt war, die retrospektiven Charakter haben und sich nicht so recht von der Ikonographie und Ästhetik des mittleren Jahrhunderts zu lösen vermochten. Als sich die Diskrepanz zwischen Illustrator und Verleger anhand der fortgeschrittenen Entwurfstätigkeit abzeichnete, wurde die Zusammenarbeit offenbar recht abrupt beendet. Nur so ist es vorzustellen und erklärbar, daß Didot, dem die hohe künstlerische Qualität dieser Arbeiten kaum entgangen sein dürfte, sich gegen Le Barbier entschieden hat: Er sah die Gefahr, die davon für seine eigenen Gestaltungsabsichten ausging.
In unserem Exemplar Nummer LXII kommen wir den Planungen Le Barbiers sicherlich am nächsten, denn es enthält nicht nur die bekanntgewordenen ausgeführten Radierungen nach seinen Vorlagen, sondern auch originale Lavis für acht Tafeln, die eindrucksvoll verdeutlichen, daß Le Barbier unter den Zeichnern seiner Zeit zu den Größten gezählt werden darf. Die Gestaltung der Eröffnungsseiten der ersten drei Bücher mit den projektierten Kopfvignetten und Textrahmen zeigt dagegen unser Exemplar Nummer LXXVII; während diejenige zum ersten Buch bereits als Radierung ausgeführt wurde, sind hier auch Le Barbiers bislang nicht publizierte originale Lavis für die Bücher zwei und drei enthalten. Hier offenbaren sich zwei Aspekte seiner Kunst geradezu exemplarisch, zum einen der rückwärtsgewandte Zug, zum anderen die Originalität der Bilderfindung: Die Vignette zum zweiten Buch mit einem Rokoko-Amor über einem Wölkchen und diejenige zu Buch drei, wo ein karpfenartiger bizarrer Fisch auf dem Trockenen zu sehen ist. Zu letzterer ist der Text noch angedeutet – wahrscheinlich ist sie eine der spätesten Erfindungen des Meisters für dieses Projekt. Ein großer Fisch, an Land geworfen, tot oder gerade am Verenden – mit Daphnis und Chloe hat das zwar insofern zu tun, als es sich um den toten Delphin am Meeresufer handeln könnte, in dessen Nähe Daphnis einen Schatz finden wird, aber sollte es sich hier nicht vielmehr
um eine Anspielung auf des Künstlers eigene Situation handeln? Le Barbier, die Flußbarbe (Barbus), oder sind vielleicht sogar die Barbus damit gemeint, jene radikale Schülergruppe von Jacques-Louis David um Pierre-Maurice Quay?
Le Barbier war ein Freund von Gessner und hatte für die Illustration seiner Idyllen bereits die Zeichnungen geliefert, darunter auch zu der Dichtung Daphnis aus dem Jahr 1754 – das Detienne-Exemplar der französischen Werkausgabe mit den Originalzeichnungen Barbiers befindet sich in unsererem Besitz. Wahrscheinlich ist Didot durch diese ebenfalls hervorragenden Arbeiten auf ihn aufmerksam geworden, wenn Barbier auch die Reputation als Historienmaler und Mitglied der Académie des Beaux-Arts schon hinreichend dafür qualifiziert hätte, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Immerhin hatte Le Barbiers Stil den Epochenübergang zum Klassizismus in Frankreich mitgeprägt, und seine Naturwiedergabe und Porträtkunst befanden sich auf sehr hohem Niveau. Heute ist es nur schwer möglich, sein Longus-Projekt wirklich zu rekonstruieren, da man nicht einmal genau weiß, wie viele Drucke nach den Zeichnungen gefertigt worden sind. Sieurin nennt die beachtliche Anzahl von 20, die aber kaum je vereint wurden [Sieurin, Manuel, S. 139]. Unsere Exemplare bieten zur Kenntnis des Geschaffenen und der Vorstellung, wie das vollendete Projekt vielleicht hätte werden können, eine seltene Gelegenheit.
Gleichzeitig mit oder in direktem Anschluß an Le Barbier begann der Maler und Zeichner Pierre Paul Prud’hon mit ersten Entwürfen. Seine Tätigkeit für Pierre Didot war durch Léger Didot und dessen Schwager Bernardin de Saint-Pierre vermittelt worden; bereits in der zweiten Jahreshälfte 1793 bezog Prud’hon ein gutes Gehalt für seine Arbeiten. Aber obgleich sich Didot für ihn entschieden hatte, war seine Position gefährdet, weil der große Jacques-Louis David, dem in künstlerischen Angelegenheiten die Leitung im Hause Didot oblag, sich gegen ihn ausgesprochen hatte: „Le choix de Prud’hon était celui de Didot; David le récussa, et obtint gain de cause. Prud’hon n’eut, des trois grands classiques, que le frontispice allégorique du Racine, et les six autres planches dont il donna le dessin appartiennent au pastoral Daphnis et Chloé, que completa Gérard, et aux érotiques Œuvres de Bernard, qu’il assuma seul, allant jusqu’à en graver lui-même l’ultime illustration, la célèbre Phrosine et Mélidore. Voilà les camps bien définis…“ [Prud’hon ou le rêve du bonheur, S. 117].
Obgleich er vorzügliche Illustrationen lieferte, die ihm viel Anerkennung von allen Seiten einbrachten, hat ihm das Haus Didot nur eine sehr begrenzente Anzahl von Aufträgen überlassen. Für Daphnis und Chloe konnte er lediglich drei Tafen beisteuern, obwohl er schon die Entwürfe für den gesamten Satz gezeichnet hatte. Was er aber anfertigte, waren Meisterwerke der Buchillustration die eine eigene Ausgabe allemal verdient hätten: „Les planches pour Didot, on le verra par les deux livres conservés où furent reliés ses stupéfiants et précieux dessins originaux, le Daphnis de Longus et L’art d’aimer de
Bernard, par leurs dessins préparatoires ou par les gravures qui en résultèrent, Phrosine et Mélidore ou Virginie, suffiraient à placer Prud’hon au rang des maîtres.“ [Prud’hon ou le rêve du bonheur, S. 118]. Im Gegensatz zu Le Barbier entließ ihn das Haus Didot aber nicht sogleich wieder – sein letzter größerer Beitrag als Illustrator war die berühmte Tafel zur Ausgabe von Paul et Virginie des Jahres 1806.
Aufgrund seiner Freundschaft mit Robespierre hatte Prud’hon Paris verlassen müssen und lebte von 1794–96 in der in der Franche-Comté, wo Barthélemy Roger 1795/96 begonnen hatte, Radierungen nach seinen Zeichnungen zu Daphnis und Chloe anzufertigen, die er dann in Paris vollendete. Im Salon des Jahres 1796 stellte Prud’hon bereits die drei zur Publikation bestimmten Zeichnungen aus. Die Kritik nahm sie mit lebhafter Diskussion auf und bemängelte Verstöße gegen die Regularien Davids. Heute werden diese Arbeiten Prud’hons zu den Hauptwerken der Buchillustration der Zeit um 1800 gezählt und geschätzt, gerade weil sie, in Abkehr von dem strengen Reglement Davids, einen wesentlichen Beitrag im Übergang zur Ästhetik des 19. Jahrhunderts geleistet haben. Insbesondere die Badeszene kann man als ein Schlüsselwerk betrachten: „Le bain de Daphnis et Chloé, où culmine l’art de Prud’hon, est ‚une évocation arcadienne (…) dans une atmosphère de tendresse naïve exempte de toute lascivité‘ (Fossier). Le sourire à la fois amoureux et narquois de Daphnis devant l’hésitation de Chloé … qui trempe un pied craintif dans l’eau, la danse frénétique des trois nymphes, ajoutent une touche d’humour à ce pur poème du bonheur innocent.“ [Ebenda].
Doch anstatt Prud’hon die gesamte große Ausgabe des Jahres 1800 illustrieren zu lassen, beschränkte Didot seinen Beitrag auf drei Tafeln. Die anderen sechs wurden dem später als Porträtist zu großem Ruhm gelangten Baron François Gérard überlassen, einem Schüler und ehemaligen Assistenten von Jacques-Louis David. Dieser hatte sich als künstlerischer Leiter offensichtlich durchgesetzt und dem noch recht jungen Gérard zu diesem Auftrag verholfen, den er im Jahre 1798 annahm; auch Gérard zeichnete mehr als die sechs Szenen, die schließlich als Radierungen in die Ausgabe eingegangen sind. Das New Yorker Metropolitan Museum bewahrt noch eine Ideenskizze von seiner Hand auf, die für eine weitere Szene gedacht war; hier sollte Daphnis stürmisch auf Chloé zulaufen – das glückliche, jubelnde Ende der Geschichte, dort, wo sonst die frivolen Petits Pieds zu sehen waren. Im Stil sind diese Arbeiten noch deutlich an seinem früheren Lehrer David orientiert, wenn auch schon mit einer eigenen Note, deutlich mehr Sentiment zulassend, bei sehr feiner Erfassung der jeweiligen Stimmung. Auch wenn beide Künstler, Prud’hon und Gérard, in der Zeit gegeneinander ausgespielt worden sind und die spätere Kritik dann gewöhnlich ersterem die Krone gegeben und kaum ein gutes Haar an seinem Widersacher gelassen hat – vergleicht man die Arbeiten heute unbefangen miteinander, so kann man nicht umhin, den beiden ein ähnliches Qualitätsniveau bei unterschiedlichem künstlerischen Ausdruck zuzugestehen – ihre Illustrationen stehen geradezu exemplarisch für zwei Richtungen der Kunst an der Schwelle zwischen
Klassizismus und Romantik. Zudem sind die Arbeiten jeweils charakteristische Beispiele für eine bestimmte Stilphase innerhalb ihres Oeuvres, im Falle von Gérard war dies „une période de renouvellement des sources d’inspiration dans l’atelier de David; période très fructueuse pour Gérard qui a exposé Psyché au Salon de 1798. Avec les dessins pour Daphnis et Chloé, il s’oriente vers un héllenisme plus pathétique et il ajoute un sens de décor naturel, un goût intimiste tout à fait étrangers aux conceptions de David et encore plus à celles des ‚Barbus’.“ [Moulin, Daphnis et Chloé dans l’oeuvre de Gérard, S. 108].
Gérard hatte also schon hier begonnen, einen eigenen, sehr persönlichen Stil zu entwi kkeln, der, wiewohl noch stark von seinem Lehrer und anderen Strömungen dieser Zeit geprägt, bereits seine unverwechselbare Handschrift zeigt.
Interessant ist ferner, daß Gérard die Daphnis-und-Chloe-Thematik fast zwei Jahrzehnte später wieder aufgegriffen hat, in diesem Fall als Gemälde, das er in mehreren Fassungen in den Jahren 1824–27 ausführte, als der Einfluß Davids längst am Abklingen war. Zu dieser Zeit sollte er das Thema dann in ganz eigener Weise behandeln, was Monique Moulin hinlänglich dargestellt hat und für uns hier nur so weit von Interesse ist, als sich auch bei ihm die Buchillustration im Auftrag des Hauses Didot als wichtige Gelenkstelle in der Stilentwicklung der Zeit erweist.
Am Übergang in das folgende Säkulum sollte ein weiterer Verleger seinen wichtigen Beitrag zu unserem Thema leisten, auch er ein Förderer der Kunst und großer Bibliophiler, aber ebenso ein von der Altphilologie Faszinierter und unermüdlicher Forschergeist: Antoine-Augustin Renouard.
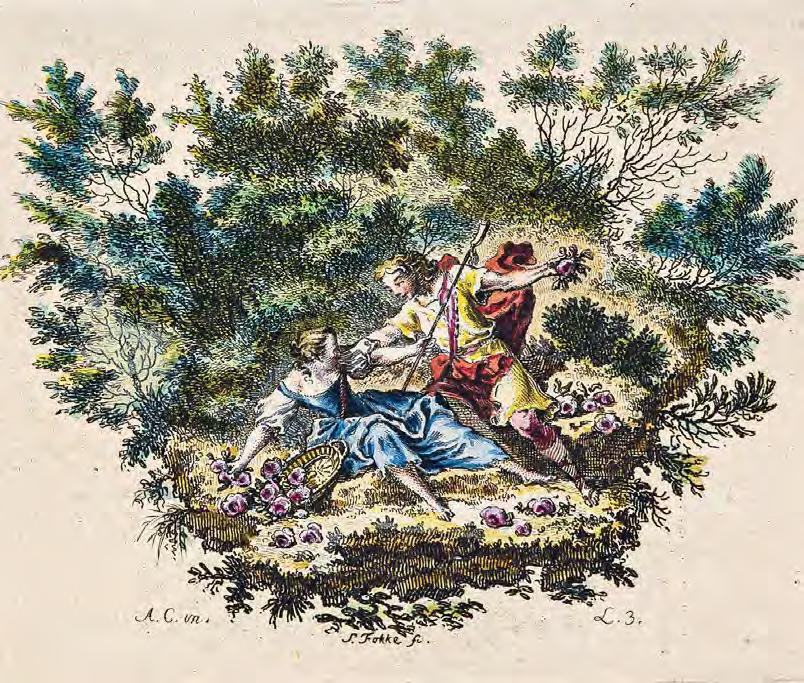
Während sich besonders das Haus Didot in der Blütezeit des Klassizismus und der Altertumsverehrung mit aller Kraft darum bemühte, seinen Textausgaben der griechischen und lateinischen Antike die entsprechende monumentale Form zu verleihen und für Typographie und Illustration die in diesem Sinne besten Lösungen zu finden, nahm auch die altphilologische Quellenforschung erneuten Aufschwung. Man wollte nicht nur die bekannten Texte in immer besseren wissenschaftlichen Editionen publizieren, sondern sich auch neue, bislang unbekannte Zugänge zur Überlieferung erschließen. Was Longus anbelangt, sind hier zwei Namen von zentraler Bedeutung: Der Verleger AntoineAugustin Renouard und der Hellenist und Publizist Paul-Louis Courier de Méré. Renouard, der aus einer Pariser Stoffhändlerfamilie stammte, war ein großer Bibliophiler, der sich zunächst in der Revolution hervortat und politische Funktionen ausübte. Aufgrund seiner radikalen Haltung wurde er während des Thermidoraufstands verhaftet und nach der Entlassung im Dezember 1794 von höheren politischen Ämtern ausgeschlossen. Fortan konzentrierte er sich auf die Tätigkeit als Verleger und Buchhändler. Zu den Erzeugnissen seines Verlages gehören viele Ausgaben antiker Texte in präzisen, mit großer Sorgfalt hergestellten Drucken, oft geschaffen in Zusammenarbeit mit hervorragenden Illustratoren.
Der Roman des Longus scheint es Renouard ganz besonders angetan zu haben. Nicht nur, daß er ältere Ausgaben in vielen Drucken besaß, darunter herausragende Luxusexemplare, wie seinen Katalogen zu entnehmen ist – das wohl prominenteste Beispiel ist unsere Nummer LXI , eines der großartigsten Exemplare unserer Sammlung. Er trug auch ein enormes Wissen zur Editionsgeschichte des Textes zusammen, und im Jahr 1800 brachte er selbst eine italienische Longus-Ausgabe in der Übertragung des Annibale Caro von 1537 heraus, der frühesten Longus-Übersetzung überhaupt, die er reich kommentierte und die sein philologisches Interesse bezeugt. Eine besonders schöne Ausgabe der französischen Amyot-Übertragung in kleinerem Format folgte dann 1803, mit einem Discours préliminaire, einer Zusammenfassung der bisherigen Übersetzungs- und Editionsgeschichte, die bis in das Druckjahr reicht. Diese Neuausgabe, die auch Teile der Verführungsszene des Daphnis durch die Lykainion enthält, übernommen aus der
Caro-Übersetzung, aber von Amyot bewußt weggelassen, druckte Renouard auf Bütten und Velin.
Der Verleger wußte auch die Illustrationskunst Prud’hons zu schätzen, weshalb er sich für seine italienische Ausgabe des Jahres 1800 eine reizvolle Radierung mit einer Zweitfassung der Badeszene von Daphnis und Chloe durch Barthélemy Roger anfertigen ließ, wesentlich kleiner als die Darstellungen der gleichzeitigen Ausgabe Didots.
Am Ende dieser bibliophilen Ausgabe von 1803 findet sich Renouards Druckermarke, die viel über ihn verrät, denn es ist eine Nachahmung derjenigen der Aldus-Presse, womit sich sein keineswegs bescheidener Anspruch stolz präsentiert und er auf die große Tradition verweist, in der er seine Verlegertätigkeit gesehen hat. Seinem Vorbild Aldus hat er in dieser Zeit wichtige bibliographische Grundlagenforschung gewidmet, die Annales de l’imprimerie des Aldes erschienen in demselben Jahr 1803. Renouard verwendete dieses Signet, dessen Formen als Druckermarke er in den Annales ausführlich beschrieb, ebenfalls für sein Exlibris. Die Aldinen waren offenkundig der Maßstab für Renouards eigene verlegerische Tätigkeit, insbesondere für seinen feinen Longus-Druck des Jahres 1803. Daher vergab er den Druckauftrag auch an Charles Crapelet, einen bedeutenden Typographen, geschätzt für die Eleganz und Reinheit seiner Schriften. Doch mit dem Erscheinen dieser vorbildlichen Edition, die bedeutend handlicher ausgefallen ist als die großen Didot-Produktionen, war die Geschichte dieser Ausgabe noch nicht beendet.
Und hier tritt Paul-Louis Courier auf den Plan. Ein bedeutender Gelehrter, eifrig und begierig nach neuen Erkenntnissen, wie Renouard von philologischem Forscherdrang getrieben und als politischer Publizist mit ähnlich progressiven Ansichten. Doch war er mit Renouard, trotz vielerlei Korrespondenz, nicht wirklich befreundet. Nachdem es Courier 1809 gelungen war, sich aus seinen militärischen Dienstverpflichtungen zurückzuziehen, konnte er sich ganz der Handschriftenforschung in Italien widmen. Schon 1807 hatte er in der Biblioteca Medicea Laurenziana in Florenz ein Manuskript des Longus-Romans entdeckt, eine mittelalterliche Abschrift, die vollständig und in recht guter Erhaltung war – eine wissenschaftliche Sensation bahnte sich an. Renouard, der 1810 zusammen mit seinem Sohn ebenfalls auf der Suche nach bisher unbekannten Schriftquellen in Richtung Italien unterwegs war, begegnete Courier mehr oder weniger zufällig auf dem Weg zwischen Luzern und Mailand, woraufhin sie die Reise gemeinsam fortsetzten. Courier erzählte ihm von seinen Florentiner Fund, und Renouard sah nun die Gelegenheit, die erste vollständige gedruckte Longus-Ausgabe zu schaffen – mit der ungekürzten Verführungsszene der Lykainion. Courier ließ Renouard den Jüngeren, Augustin-Charles, damit beginnen, den fehlenden Text zu kopieren, doch hat ihm dessen Handschrift angeblich nicht zugesagt, so daß er die Textabschriften schließlich eigenhändig durchführte. Wie es nun genau vor sich ging, daß ausgerechnet diese Textstelle bei der Arbeit in der Bibliothek durch einen großen Tintenfleck erheblich verunreinigt
wurde, wissen wir bis heute nicht – die Vorwürfe, vor allem seitens des lokalen Bibliothekars, waren hart, Courier dagegen beteuerte seine Unschuld, die Tinte sei versehentlich auf das originale Manuskriptblatt geraten. Dennoch – die Sensation geriet zur Katastrophe, vor allem für Courier persönlich, der sich statt des Entdeckertriumphes mit heftigen Beschuldigungen konfrontiert sah, man unterstellte gar die absichtliche Zerstörung. Nachträgliche Reinigungsversuche fruchteten nicht, machten, im Gegenteil, alles noch schlimmer. Noch Ebert vermutete über den Hergang, es sei leider wahrscheinlich „dass es mit schändlicher Vorsetzlichkeit geschehen“, wie er in seinem etwa zehn Jahre später erschienenen Bibliographischen Lexikon schrieb [Ebert, ABL , 12.235], womit er allerdings auch nur die üblen Gerüchte aufgegriffen haben dürfte, die in Italien über Courier kursierten. Diese Verleumdungen gingen so weit, daß man Courier unterstellte, diese Textstelle absichtlich mittels einer unauslöschlichen Tinte geschwärzt zu haben, um alleine im Besitz jener Textstelle sein zu können.
Für Courier weitete sich diese Angelegenheit zur veritablen Affäre aus, als deren Konsequenz er Publikationsverbot erhalten und aus Italien ausgewiesen werden sollte [ausführlich dazu: Barber, Daphnis and Chloe, S. 57–60]. Immerhin: Der Text war bereits abgeschrieben, und damit lag nun erstmalig der komplette Longus in der Überlieferung des Mittelalters vor, ohne Kürzungen und Auslassungen neuzeitlicher Übersetzer und Editoren. Auf dieser Grundlage und unter Heranziehung der Übersetzung Amyots veröffentlichte Courier 1810 eine französische Neuausgabe, einschließlich jener neu aufgefundenen Textpassage, die er gleichfalls im Stil Amyots in altes Französisch übertrug. Da wir mit Courier unseren Gang durch die Editionsgeschichte abschließen und seine Entdeckung, die in alle folgenden Longus-Ausgaben eingehen sollte, in unserem Zusammenhang nur noch eine Marginalie darstellt (von der aber gleich noch die Rede sein wird), wollen wir diese Sache hiermit auf sich beruhen lassen und nur das Urteil über ihn und seine Lebensleistung in den wohlabgewogenen Worten Goethes zitieren, der im Gespräch mit Eckermann am 21. März 1831 darlegte: „Courier ist ein großes Naturtalent (…), das Züge von Byron hat sowie von Beaumarchais und Diderot. Er hat von Byron die große Gegenwart aller Dinge, die ihm als Argument dienen, von Beaumarchais die große advocatische Gewandtheit, von Diderot das Dialektische, und zudem ist er so geistreich, daß man es nicht in höherm Grade sein kann. Von der Beschuldigung des Tintenflecks scheint er sich indeß nicht ganz zu reinigen; auch ist er in seiner ganzen Richtung nicht positiv genug, als daß man ihn durchaus loben könnte. Er liegt mit der ganzen Welt im Streit, und es ist nicht wohl anzunehmen, daß nicht auch etwas Schuld und etwas Unrecht an ihm selber sein sollte.“ Einen Tag vorher äußerte er sich enthusiastisch über den Roman folgendermaßen: „Man müßte ein ganzes Buch schreiben, um alle großen Verdienste dieses Gedichts nach Würden zu schätzen (…) Das ganze Gedicht verrät die höchste Kunst und Kultur. Es ist so durchdacht, daß darin kein Motiv fehlt, und alle
von der gründlichsten, besten Art sind (…) und ein Geschmack und eine Vollkommenheit und Delikatesse der Empfindung, die sich dem Besten gleichstellt das je gemacht worden.“
Vielleicht waren Diskrepanzen im Zuge der „Tintenklecksaffäre“ der Grund, warum Courier die erste Komplettausgabe von 1810 nicht naheliegender Weise an Renouard übertragen hat, sondern diese selbst und auf eigene Kosten in Florenz in einer heute kaum mehr auffindbaren Minimalauflage herstellen ließ. Noch zu Anfang des Jahres war Renouard von Courier als Verleger vorgesehen gewesen, wie er in einem Brief vom 8. Februar 1810 an den befreundeten Monsieur Clavier in Paris schrieb: „C’est Renouard qui se charge de l’impression du Longus. Il a, dit-il, des gens capables, de cette besogne. Dieu le veuille! et s’il dit vrai, avril ne se passera point que vous n’en ayez le premier exemplaire.“ [Courier, Oeuvres complètes, S. 302 f.]. Aber es kam anders, Renouard erhielt den Auftrag nicht. Während dieser noch in Paris auf die Zusendung der Textpassage wartete, änderte Courier seine Meinung. Schon im Februar 1810 druckte Piatti in Florenz die erste vollständige Longus-Ausgabe überhaupt. Am 3. März des Jahres kündigte Courier Renouard in einem Schreiben an, daß er ihm die in Florenz bereits fertiggestellte Ausgabe zusenden werde, es sei nicht anders möglich, das ursprüngliche gemeinsame Vorhaben eine Schnapsidee gewesen, der Fund müsse am Ort seiner Entdeckung erscheinen, Renouard werde das schon einsehen: „Je vous envoie par la poste la traduction complète imprimée ici. Cela ne se pouvait autrement. Notre première idée était folle. Le morceau déterré devait paraître à sa place, et je crois, que vous en conviendrez.“ [Ebenda, S. 430]
Courier knüpfte durch das Erscheinen der Ausgabe in Florenz letztendlich an die lokale Tradition an, auch das war wohl ein Beweggrund für ihn, ist dort doch die editio princeps des Longus gedruckt worden. Seine Ausgabe widmete er der ältesten Schwester Napoleons, Élisa Bonaparte, Statthalterin der Toskana, die in Florenz residierte. Die wenigen Exemplare waren nach eigener Aussage nur für den Freundeskreis bestimmt. Die bisher ungedruckte Passage der Verführungsszene findet sich auf den Seiten 16–22. Als Ergänzung einiger zuvor erschienener Editionen, darunter der Regentenausgabe und derjenigen von Renouard aus dem Jahr 1803, wurden diese Blätter unpaginiert mit dem Kopftitel „Fragment de Daphnis et Chloé, découvert dans un manuscript grec de Longus, dans la Bibliothèque Laurentinae, à Florence“ separat abgedruckt. Ihnen fehlt ein Impressum; in den heutigen Bibliothekskatalogen wird dieser Druck gewöhnlich als Publikation Couriers aus dem Jahr 1810 geführt. Vergleicht man jedoch die Schrifttypen und das Schriftbild der Ausgabe von 1803 mit den Einlageblättern, dann wird sofort deutlich, daß es sich hier nur um ein Verlagserzeugnis Renouards handeln kann, gefertigt in erster Linie zur Ergänzung seiner eigenen letzten Ausgabe, wenn er auch Editionen in kleinen Formaten anderer Verleger mit anführt und die Seitenzahlen, wo die Blätter dort einzubinden sind. Durch die Möglichkeit, sie in verbliebene (oder nachgedruckte?) Exemplare seiner Ausgabe des Jahres 1803 einzusetzen, sollte sich sein Bestreben nach
einem vollständigen Longus doch noch erfüllen, wenn auch als Ergänzung, die immerhin in den beiden vorliegenden Exemplaren der abschließenden Ausgabe dieser Sammlung enthalten ist. Vergleicht man genauer, so bemerkt man, daß von diesen Einlageblättern wiederum (mindestens) zwei Fassungen existieren, denn sie unterscheiden sich in unseren beiden Exemplaren gering im Satz. Eine editorische Note am Ende legt die Positionierung fest, die in unserem Exemplar Nummer LXXX tatsächlich der Vorgabe entspricht: „Ce fragment remplit la lacune qui existe vers le milieu du Livre premier, pag. 15 de l’édition grecque et latine de Schaefer, Lipsiae, 1803, in-12; pag. 14 de l’édition françoise, dite du Régent, 1718, in-8; pag. 25 de celle de M. Didot l’ainé, an VIII (1800), in-18 et in-12; pag. 18 de celle de M. Renouard 1803, in-18 et in-12.“
In all dem drückt sich eine immense Wertschätzung aus, die auch noch jedem einzelnen wiedergewonnenen Wort des Longus entgegengebracht wurde. Wie viel Courier selbst die Amours pastorales bedeuteten, insbesondere in der Übersetzung Amyots, das brachte er in einem Schreiben vom 10. März 1810 an das befreundete Ehepaar Clavier in Paris zum Ausdruck, verbunden mit einer klaren Aufforderung zur Lektüre. Wir geben ihm hier – in einer deutschen Übertragung von 1829 – das Schlußwort:
„Amyot war einer der Väter des tridentinischen Conciliums; alles was er schrieb ist ein Glaubensartikel. Sträuben Sie sich nun noch länger seinen Longus zu lesen! In der That, es giebt keine bessere Lectüre; es ist ein Buch um es unmittelbar nach dem Catechismus Ihren Demoiselles Töchtern in die Hände zu geben.“ [Courier, Denkwürdigkeiten und Briefe, Bd. II , S. 43].
So endet ein großes Jahrhundert Editionsgeschichte von Longus’ faszinierendem Roman, mit einem unschönen Tintenfleck und einer ruinierten Handschrift, aber auch mit der wiedergewonnenen kompletten Fassung dieser Geschichte, die zu diesem Zeitpunkt längst ein fester, von vielen hochverehrter Teil der überlieferten literarischen Schätze des Altertums geworden war. Von der Zeit um 1710, als Philipp von Orléans und sein Lehrer noch an den Gemälden arbeiteten, die wie kaum eine andere Vorlage in der Geschichte der Buchkunst die Illustration eines literarischen Stoffes über ein Jahrhundert hinweg prägen sollten, bis zum Jahr 1810, als dank des Forschergeistes von Philologen und Bibliophilen die erste komplette Übersetzung des Romans erscheinen konnte: Diese rund einhundert Jahre Editionsgeschichte von Daphnis und Chloe erlauben einen tiefen Einblick in das Wesen der französischen Buchkultur. Meisterwerke, ja Monumente der Schriftkunst stehen neben einfach produzierten Nachdrucken, hervorragende künstlerische Leistungen erstrangiger Illustratoren mediokren Nachstichen gegenüber – und Antipoden begegneten sich zuweilen auch auf allerhöchstem Niveau: Der Niederländer Néaulme spielte die volle Zierfreudigkeit des Rokoko und des Vignettenwesens für seine Editionen der Jahrhundertmitte aus, während die Didots, im Wettstreit mit Bodoni, in ihren von maximaler Schlichtheit und Formschönheit der Type bestimmten Drucken
der Schriftkultur der Antike so nahe wie möglich zu kommen trachteten und im gleichen Moment der Illustrationskunst des kommenden Jahrhunderts die Bahnen bereiteten. Daneben wirkten viele weniger bekannte, teils bis heute unerschlossene Verleger, die mit ihren Ausgaben, immer wieder auch durch ausgewählte Neuerungen in Übersetzung und Illustration, Perlen der Buchkunst hervorbrachten, die besonders schillernden darunter im kleineren Format. Weder der politisch-gesellschaftliche Wandel noch derjenige der Geschmäcker und Vorlieben setzten den illustrierten Editionen dieser anmutigen, leicht lasziven, aber immer wieder berührenden und inspirierenden Geschichte ein Ende; über die Zeit von Revolution und Klassizismus hinaus führte die Linie ins 19., dann sogar ins 20. Jahrhundert weiter, sie sollte noch viele Ausgaben erleben und Meisterwerken als Vorlage dienen – die klassische Moderne verdankt ihr einige ihrer reizvollsten Schöpfungen, man denke nur an Chagall, Bonnard und Maillol, aber auch an die Ballettmusik eines Maurice Ravel.
Anhand der französischen illustrierten Bücher von der Régence bis zum Empire läßt sich die erste große zusammenhängende Phase dieser weitreichenden Entwicklung ablesen. Zugleich sind diese Druckwerke ein spezielles Zeugnis und besonderer Teil einer außergewöhnlichen Blütezeit der Buchkultur und -illustration, die Max Sander als die „dritte große, unsterbliche Periode des gedruckten Buchs“ bezeichnet hat. Dieser Katalog ist, bei allen Glanzstücken, die in ihm vorgestellt werden, lediglich der Auftakt zu dem, was unser eigentliches Vorhaben ist und schon bald folgen wird: Ein generelles Verzeichnis der illustrierten Bücher des französischen 18. Jahrhunderts, vorgestellt anhand einer exquisiten, in dieser Form und diesem Umfang mit vollem Recht einmalig zu nennenden Sammlung. Daraus haben wir hier einen ersten Abschnitt präsentiert, der in nuce einen Blick auf das Gesamte eröffnen möge.
Das Postludium dieses Reigens illustrierter Longus-Ausgaben im französischen 18. Jahrhundert bildet, der vornehmlich bibliophil orientierte Leser möge es hinnehmen, ein Gemälde, immerhin ein ganz vorzügliches (Anhang K). Ziemlich genau in der Mitte des Jahrhunderts entstanden, reflektiert es die Popularität unserer Thematik im Monumentalen, angeregt sicherlich auch von der Buchillustration der ersten Jahrhunderthälfte, den Vignetten Cochins und der Regentensuite. Dieser Imagination ungetrübter arkadischer Glückseligkeit sei unsere abschließende Betrachtung zur inspirierenden Wirkung des Longus-Romans auf die bildenden Künste gewidmet.

1716-1803
Das schönste bekannte Exemplar
In einem Einband von Boyet, dazu die Kupfer von 1718 –Aus dem Besitz der Comtesse de Verrue und André Langlois
I Longus. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Ecrites en Grec par Longus, & Traduites en François par Amiot. Avec figures. Nouvelle édition. Amsterdam, Westin [d. i. wohl Paris, Guérin für Barbou,] 1716.
Mit gestochenem Titel und 8 Kupfertafeln von J.-B. Scotin. – Beigebunden: 1 Frontispiz und 28 Kupfertafeln (davon 13 doppelblattgroße als Faltkupfer auf Stegen) zur Ausgabe von 1718, von B. Audran nach dem Regenten Philippe d’Orléans.
6 Bl., 220 S., 1 weißes Bl. (Titel in Schwarzund Rotdruck, Widmung „A Monsieur I.*. *.*.“, „Avis du libraire au lecteur“, „Préface“ und Haupttext; in den Vorstücken drei handschriftliche Blätter zusätzlich eingebunden).
Kollation: π6 A–S 6 T 3 . Klein-Oktav (157 x 92 mm).
Olivbrauner geglätteter Maroquineinband der Zeit auf fünf Bünden mit kräftiger heraldischer Rückenvergoldung aus zwei alternierenden Stempeln mit Löwe und Rautenmuster, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung, kleinen Sternen an den Überschneidungen und Wappensupralibros; Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze, Ganzgoldschnitt und Lesebändchen, wohl von L.-A. Boyet.
In einem prachtvollen Exemplar hochrangiger Provenienz liegt hier die erste illustrierte Ausgabe des 18. Jahrhunderts von Longus’ Roman in der überragenden Übersetzung Amyots vor. Zu einer bibliophilen Kostbarkeit und einem ganz besonderen Unikat wird dieses durch die Vereinigung gleich
beider Illustrationszyklen dieser Zeit, der zur Ausgabe gehörenden, künstlerisch sehr reizvollen kleinen Folge des Jean-Baptiste Scotin und Audrans vollständiger Suite des Regenten . Dazu kommt noch das in feinster Kalligraphie auf drei in den Vorstükken zwischengebundenen Blättern ergänzte Avertissement zur Ausgabe des Jahres 1718 mit einigen Bemerkungen zum Werk und seiner Editionsgeschichte. Hier wurden also, wenn man so will, zwei Ausgaben in einem einzigen Exemplar vereint.
Geschaffen wurde dieses für eine der größten bibliophilen Damen der Zeit: Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes, Comtesse de Verrue (1670–1736), durch Alexandre Dumas weithin auch als „Dame de Volupté“ bekannt. Die Comtesse, die in bedeutenden Literaten- und Philosophenkreisen verkehrte, auch Voltaire persönlich kannte, war eine exzellente Bücher- und Kunstkennerin, die über umfangreiche Sammlungen verfügte. Der Einband trägt nicht nur ihr Wappensupralibros (Olivier, Manuel, Nr. 799) auf beiden Deckeln, sondern auch der Rücken ist mit ihren heraldischen Figuren dekoriert. Einbände in dieser Gestaltungsart, speziell für die Comtesse gefertigt, müssen einstmals das Erscheinungsbild ihrer Bibliothek geprägt haben. Zu ihr als Sammlerin vergleiche man die umfangreichen Artikel von Clément de Ris (Les Amateurs d’Autrefois, S. 153–182) und Ernest Quentin-Bauchart (Les femmes bibliophiles, Bd. I, S. 409–429), sowie die Ausführungen von Guigard (Nouveau armorial, Bd. I, S. 206 f.): „Verrue, … l’une des plus ravissantes perles de ce splendide écrin du XVIII e siècle. […] Sa bibliothèque était surtout remarquable parmi tant de remarquables choses: un diamant serti d’or. Sous l’ébène délicatement fouillée se pressaient, non sans coquetterie, dixhuit mille volumes d’un choix exquis, la plupart habillés par les meilleurs artistes de l’époque“; unter den jüngeren Publikationen über

ihre Bibliothek sei noch auf den 2003 erschienenen Essay von Béatrice Mairé hingewiesen.
Daß sie eine ebenso große Leserin wie Bibliophile war, bezeugen nicht nur die zeitgenössischen Quellen, sondern auch das vorliegende, mit größter Sorgfalt und Raffinesse zusammengestellte Exemplar. Der überaus dekorative Einband ist zwar überwiegend aus den Motiven des Wappens der Eignerin ornamental verziert, doch findet sich ein Hinweis, nach dem er mit gewisser Sicherheit als eine Arbeit von Luc-Antoine Boyet identifiziert werden kann. So gehört der nach links gewandte heraldische Löwe zwar als „gemeine Figur“ zum Wappen, doch läßt sich dieser Stempel auch im Repertoire von Boyet, dem Relieur de l’Imprimerie
royale, nachweisen (siehe etwa die Nr. 65 im zweiten Teil des Katalogs der Esmerian-Bibliothek, Paris 1972); weiterhin sehr charakteristisch für die Ornamentik Boyets sind im Besonderen die kleinen viertelkreisförmig gebogenen Blättchen in den vier Ecken der Rückenkompartimente.
Die sehr seltene Ausgabe, die von den meisten Bibliographen nicht erfaßt worden ist und von der nur recht wenige Exemplare bekannt sind, trägt den Druckvermerk des großen Amsterdamer Verlegers Wetstein in falscher, in der Zeit in Frankreich jedoch nicht unüblicher Schreibweise, was auf einen nicht autorisierten Druck schließen läßt; als ihr tatsächlicher Erscheinungsort ist Paris anzunehmen. Vergleicht man den vorliegenden Druck mit der
Longus-Ausgabe, die im selben Jahr 1716 „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ erschienen ist, so stellt sich alsbald heraus, daß es sich bei ersterem um eine Titelauflage handelt, also um dieselbe Ausgabe, die bei völliger Übereinstimmung des Textsatzes und der Illustration lediglich ein anderes Titelblatt erhalten hat, mit dem offensichtlich fingierten Amsterdamer Impressum. Der zuerst als Erbe des berühmten Pariser Verlagshauses Cramoisy firmierende Verleger gibt sich nun als Wetstein in Amsterdam aus. Wie wir vermuten, handelte es sich bei ihm um Jean-Joseph Barbou, der 1715 tatsächlich den Cramoisy-Nachlaß einschließlich des Verlagshauses, die Librairie aux deux cigognes, erworben hatte. Barbou arbeitete zu dieser Zeit mit dem Pariser Drucker Guérin zusammen, aus dessen Haus auch die Longus-Ausgabe des Jahres 1731 stammt. Im Jahr 1717 ist noch ein weiterer Druck mit der Verlagsangabe „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ erschienen. Diese zwar kollationsgleiche, aber typographisch abweichend gesetzte Ausgabe enthält die Kupferstiche Scotins seitenverkehrt und ohne Stechersignatur – man vergleiche dazu die Ausführungen von Barber (Daphnis and Chloe, S. 32) und den aufschlußreichen Artikel von Jean Marchand von 1961 (Contribution, S. 39–43). Marchand hat erstmalig darauf hingewiesen, daß der Druck des Jahres 1717 mit dem wiederholten Pariser Cramoisy-Impressum in Wirklichkeit in Amsterdam erschienen ist, da dieser einen Verlagskatalog des dort ansässigen Emanuel Du Villard, Buchhändler in der Kalverstraat, enthält. Die Ausgabe von 1717 ist der tatsächliche Amsterdamer Longus-Erstdruck des 18. Jahrhunderts, von dem eine ganze Reihe weiterer in Amsterdam gedruckter Editionen ausgehen sollte, die sich nahezu über das gesamte Jahrhundert erstreckt. Zur Geschichte der Pariser Erstausgabe des Jahres 1716 und zu dem Amsterdamer Du Villard-Druck von 1717 vergleiche man unsere editionsgeschicht-
liche Einführung sowie die Anmerkungen zu den Exemplaren dieser Ausgaben in Anhang A und B.
Die Qualität des Scotin-Zyklus’ ist beachtlich, in manchen Darstellungen derjenigen der Regentenfolge sogar überlegen. Schon Charles Nodier urteilte darüber sehr souverän in den seinen Mélanges von 1829, wo er zu der vorliegenden Ausgabe des Jahres 1716 unter anderem schrieb: „…les figures valent tout au plus celles du Régent…“ und: „cette édition, écrasée par le succès de celle du Régent, a fourni aux éditions suivantes la piquante idée du sujet des Petits pieds, qui est traité toutefois dans celle-ci avec cent fois plus d’esprit et de naïveté“ (Nodier, Mélanges, S. 220).
Worauf Nodier hier anspielte, ist die Tatsache, daß sich unter den acht Kupfern Scotins auch die erste Version der sogenannten Petits Pieds findet, welche man früher erst in der Fassung des Grafen Caylus von 1728 zu kennen meinte. Diese kleine erotische Caprice ist hier gleichsam noch im Waldesdickicht verborgen. Was allerdings kaum je bemerkt worden ist: Die Version Scotins zeigt trotz der prinzipiellen motivischen Übereinstimmung gar nicht Daphnis und Chloe – dargestellt ist hier vielmehr die Verführung des Daphnis durch Lykainion. Dementsprechend ist diese Tafel auch jener Textpassage zugeordnet und steht nicht am Ende, wie das bei dem Stich des Comte de Caylus, der sich ausdrücklich auf die beiden Protagonisten bezieht, der Fall ist. Motiviert war die Darstellung Scotins sicherlich durch Textergänzungen der Übersetzung Amyots, der bekanntlich gewisse delikate Stellen gekürzt hatte. Wie im Vorwort deutlich herausgestellt, ist diese Passage in den neuen Ausgaben der Jahre 1716/17 durch Übernahmen aus anderen Übertragungen, die hierin nicht so streng gewesen sind, ergänzt worden – die neue Liberalität unter dem Regenten machte es wohl möglich, hier in Text und Bild ausführlicher zu werden – dennoch
verbargen die Verleger und Drucker immer noch ihre wahren Namen.
Der Gedanke, beide Illustrationsfolgen in einem einzigen Exemplar zu vereinen, mag auch dadurch inspririert gewesen sein, sie dem unmittelbaren Vergleich auszusetzen – eine Konkurrenz, die vorsichtig gesagt, nicht gerade zu Ungunsten Scotins ausgeht. Der Regent mag die dichtere, auch szenisch eingängigere Suite geschaff en haben, Scotin dagegen eine exquisite kleine Folge, die nur ausgewählte Handlungsmomente, diese dafür aber in bewährter künstlerischer Qualität und in der Routine der Buchillustration dieser Zeit sehr ansprechend zur Anschauung bringt.
Wenn Quentin-Bauchart (Les femmes bibliophiles, Bd. I, S. 417) von den Büchern der Comtesse sagt, „presque tous ont malheureusement souff ert de l’humidité et nous n’en connaissons qu’un très petit nombre qui soient arrivés jusqu’à nous dans un état de conservation à peu près irréprochable“, so ist es als große Auszeichnung hervorzuheben, daß unser Exemplar, abgesehen von einer kleinen Reparatur im weißen Außenrand von B4 und geringer, altersbedingter Bräunung, makellos und breitrandig, vor allem aber der meisterliche Einband eine Augenweide und nahezu neuwertig erhalten ist.
Provenienz: J. B. d’A. de Luynes, Comtesse de Verrue (1670–1736); Versteigerung ihrer Bibliothek vom 17. Juni bis 31. Juli 1737, Catalogue von G. Martin, S. 125, Nr. 282 de l’Inventaire, zweite Position: 26 Livres, ein enorm hoher Preis. Schließlich im Besitz von André Langlois, mit seinem grünen Maroquin-Exlibris und einliegendem Bibliothekszettel mit einigen seiner Angaben zum Exemplar –zu Langlois vgl. den Artikel von Arthur Rau in Book Collector 1957, S. 127–142, hier S. 140.
Bibliographie: Péreire, Notes, S. 62 f. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 314. Portalis/Beraldi,

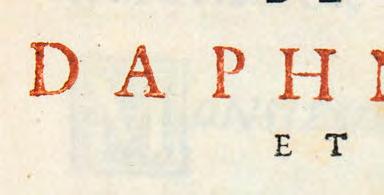
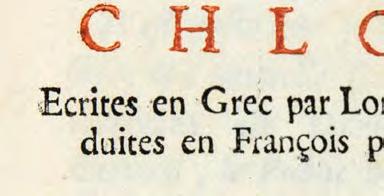
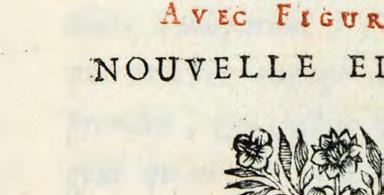
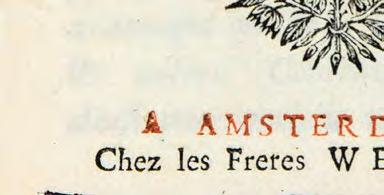
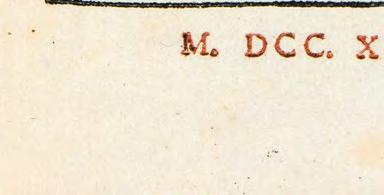
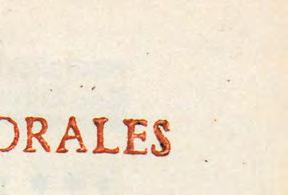
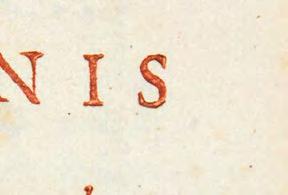
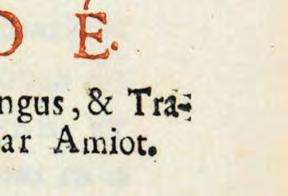

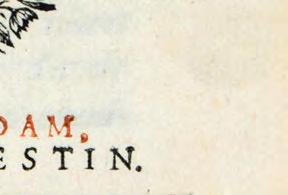
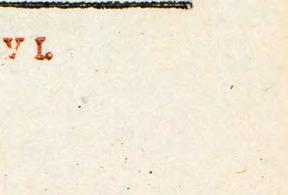
Les graveurs, Bd. III , S. 535 (Jean-Baptiste Scotin). Barber, Daphnis and Chloe, S. 31 f. Marchand, Contribution, S. 42. Gay/Lemonnyer, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, Bd. I, Sp. 183 (führen in diesem Kontext Editionen der Jahre 1712, 1716, 1717 und 1722 an(!). Eeghen, Amsterdamse boekhandel, Bd. II , S. 233 (Anm. zu Nr. 119, Ausgabe Paris 1717). Quérard, La France littéraire, Bd. V, S. 351 (mit falschem Jahr 1712). –Cohen/De Ricci erwähnen unsere Ausgabe nicht, lediglich die Kupfer von Scotin zur Ausgabe von 1731, S. 651. – Nicht bei Brunet, Lewine, Sander, Ray, Rahir und Boissais/Deleplanque.
Exemplar im DentellePrachteinband mit zwei unterschiedlichen Zuständen der Stichfolge Scotins
II [Longus. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Ecrites en Grec par Longus, & Traduites en François par Amiot. Avec figures. Nouvelle édition. Amsterdam, Westin, (d. i. wohl Paris, Guérin für Barbou,) 1716].
Mit gestochenem Titel und 8 Kupfertafeln von J.-B. Scotin, alle in jeweils zwei Zuständen.
5 (statt 6) Bl., 220 S. (Widmung „A Monsieur I.*. *.*.“, „Avis du libraire au lecteur“, „Préface“ und Haupttext; es fehlt der typographische Titel).
Kollation: π2–6, A–S6 T 2 (ohne π1).
Klein-Oktav (156 x 90 mm).
Weinroter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit reicher floraler Rückenvergoldung, teils im Pointilléstil, und goldgeprägtem Titel („Amour de Daphnis“) im zweiten Kompartiment von oben, Deckel mit breiter Dentellebordüre und großem Wappensupralibros, Steh- und Innenkantenvergoldung, Brokatpapiervorsätzen, grünem Seidenbändchen und Ganzgoldschnitt, wohl von A.-M. Padeloup.
Außerordentlich dekorativ gebundenes Exemplar der ersten illustrierten Ausgabe des 18. Jahrhunderts, mit bester Provenienz. Durch das zusätzliche Einbinden der Stichfolge von Jean-Baptiste Scotin in einem abweichenden, sehr frühen Zustand, erhält es unikalen Charakter. Sind die ursprünglich zum Exemplar gehörigen Kupfertafeln, wie auch in anderen Exemplaren anzutreffen, von erkennbar benutzten Platten gedruckt, so stehen diesen hier bedeutend frischere, gratigere und kräftigere Abzüge gegenüber. Durch ihre ein wenig geringere Blattgröße wird deutlich, daß sie ursprünglich
aus einem anderen Zusammenhang stammten, vielleicht aus einem etwas stärker beschnittenen Exemplar oder einer eigenständig erschienenen Stichfolge. Betrachtet man die Kupfer vergleichend im Detail, so fallen mancherlei Unterschiede auf, die nicht nur von der unterschiedlichen Abnutzung zeugen, sondern deutlich werden lassen, daß die Platten stark überarbeitet worden sind. Dies offenbart sich am deutlichsten in einigen Partien des Himmels und der Landschaft: wird der Himmel bei den abgenutzten Platten durch regelmäßig übereinander liegende Horizontallinien charakterisiert, gibt es bei den frischeren Aussparungen, aber auch stärker schraffierte Stellen, was zu einem kontrastreicheren Gesamtbild führt; ebenso sind die Wiesen und Gräser in dieser Fassung sehr viel akzentuierter ausgearbeitet und fügen dadurch den Sujets einige Lebendigkeit hinzu. Weiterhin sind die Physiognomien der Personen oft wesentlich deutlicher zu erkennen, wirken frischer, lebendiger, ansprechender.
Die Unterschiede sind so groß, daß zwischen beiden Zuständen mit Sicherheit mehrere Bearbeitungszustände anzunehmen sind, was teils sogar den visuellen Ausdruck und den Charakter der Darstellungen verändert hat; sie wirken im kontrastreicheren Zustand erheblich akzentuierter und detailreicher. Zwei Erklärungen sind hierfür denkbar: Entweder zeigt uns dieser Zustand eine Frühfassung oder eine, die aus der Überarbeitung und Auffrischung der Platten hervorgegangen ist. In dieser Fassung erweist sich in jedem Fall die anschauliche Qualität der Stichfolge Scotins in ganz besonderer Weise. Dieser Zustand war bislang nicht bekannt und erweitert dadurch unsere Kenntnis von dem zweiten bedeutenden Daphnis-und-Chloe-Zyklus des frühen 18. Jahrhunderts neben dem des Regenten. Dies sollte man auch deshalb würdigen, weil zwischen den beiden ersten Illustrationsfolgen ein
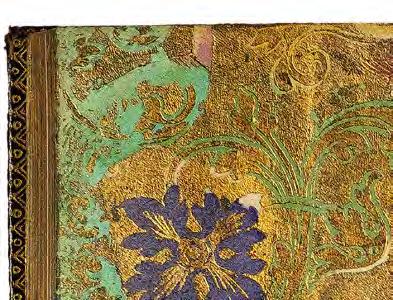
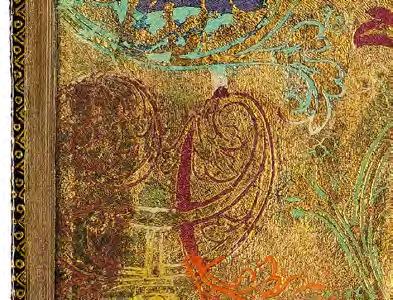





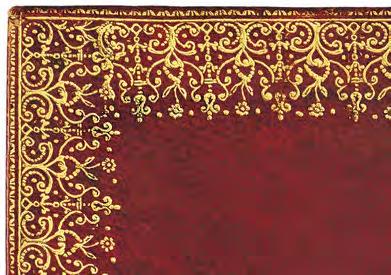

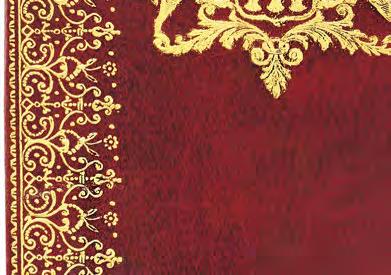
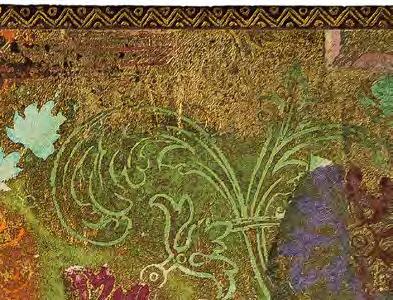



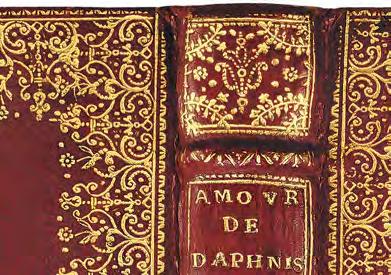
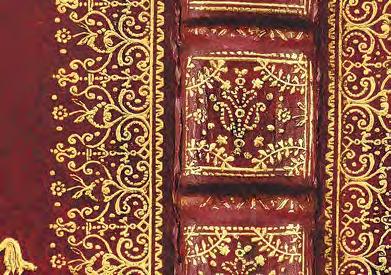
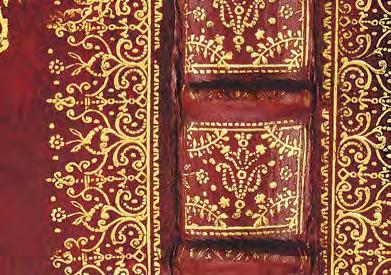

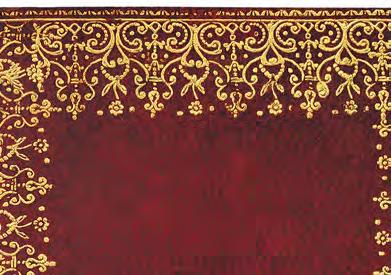

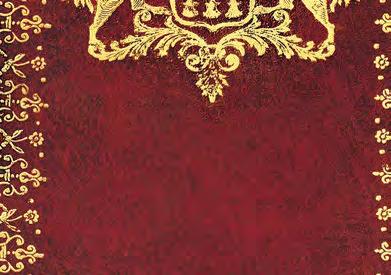

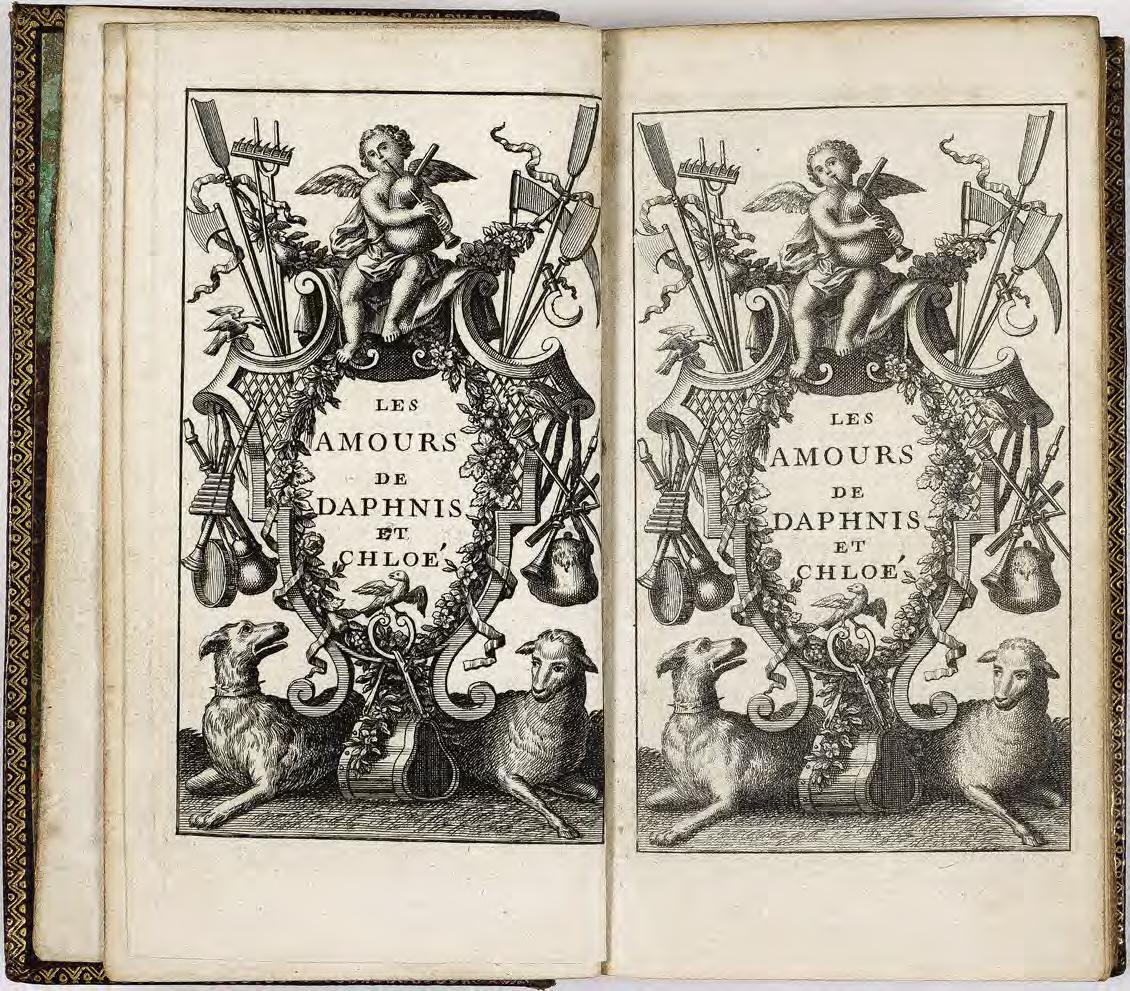
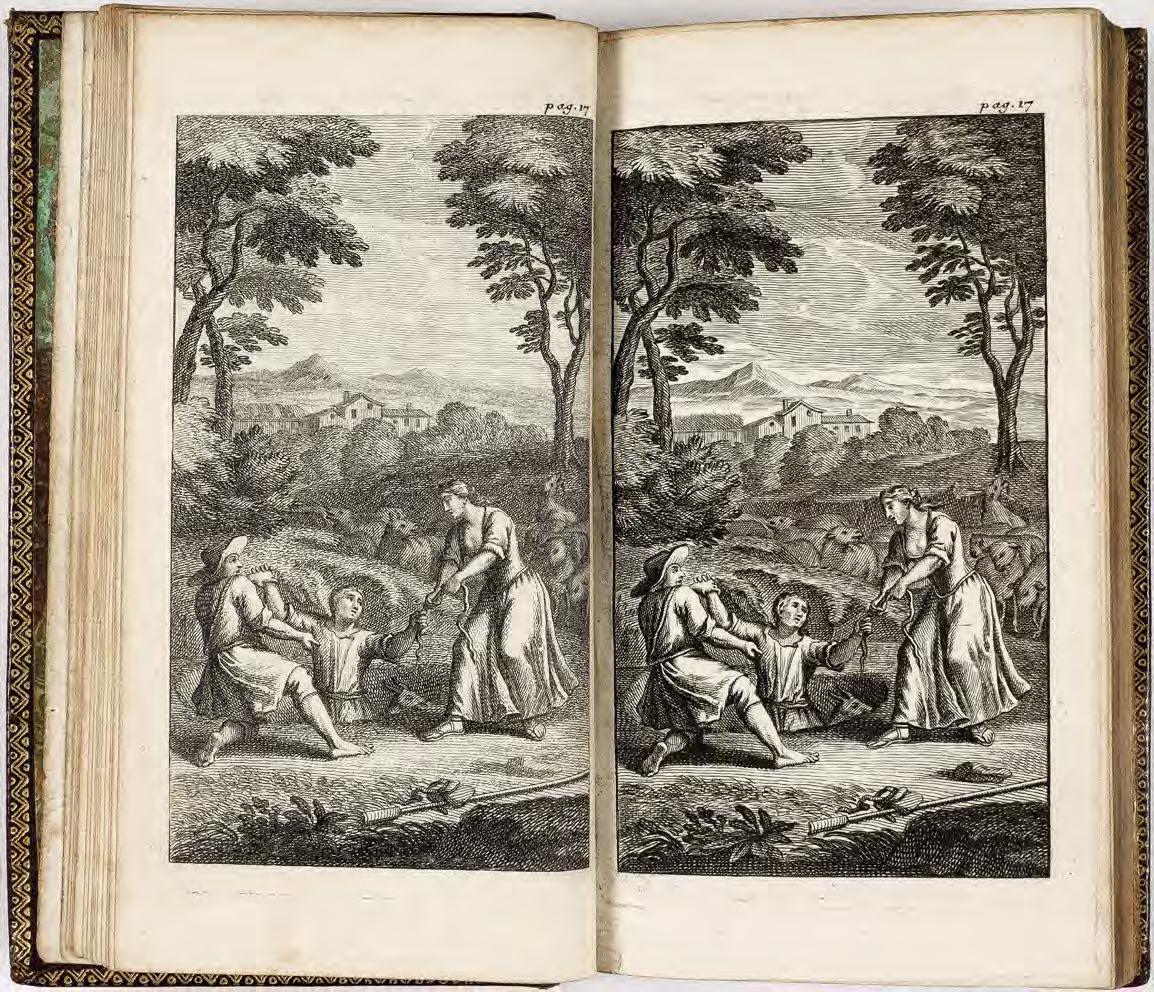
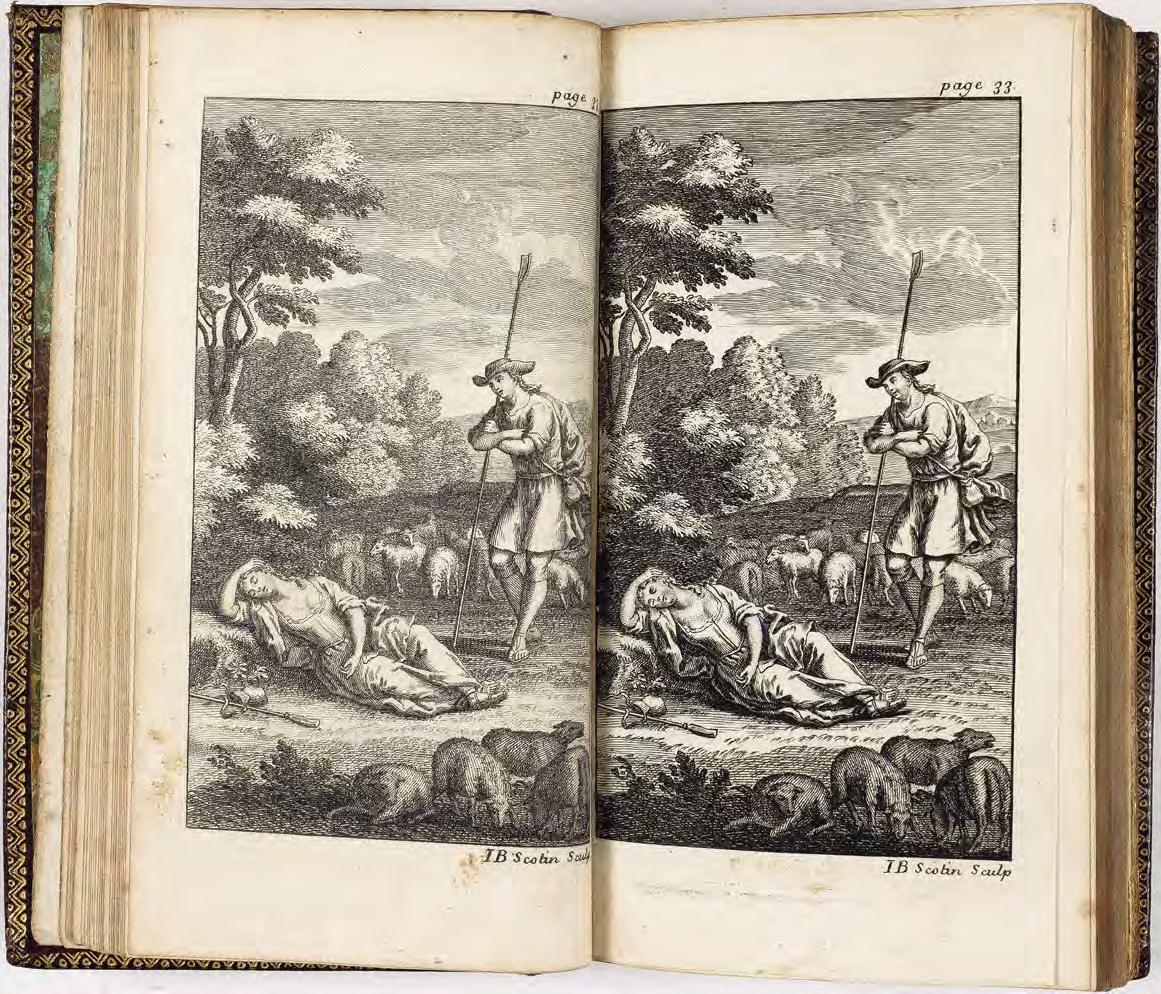
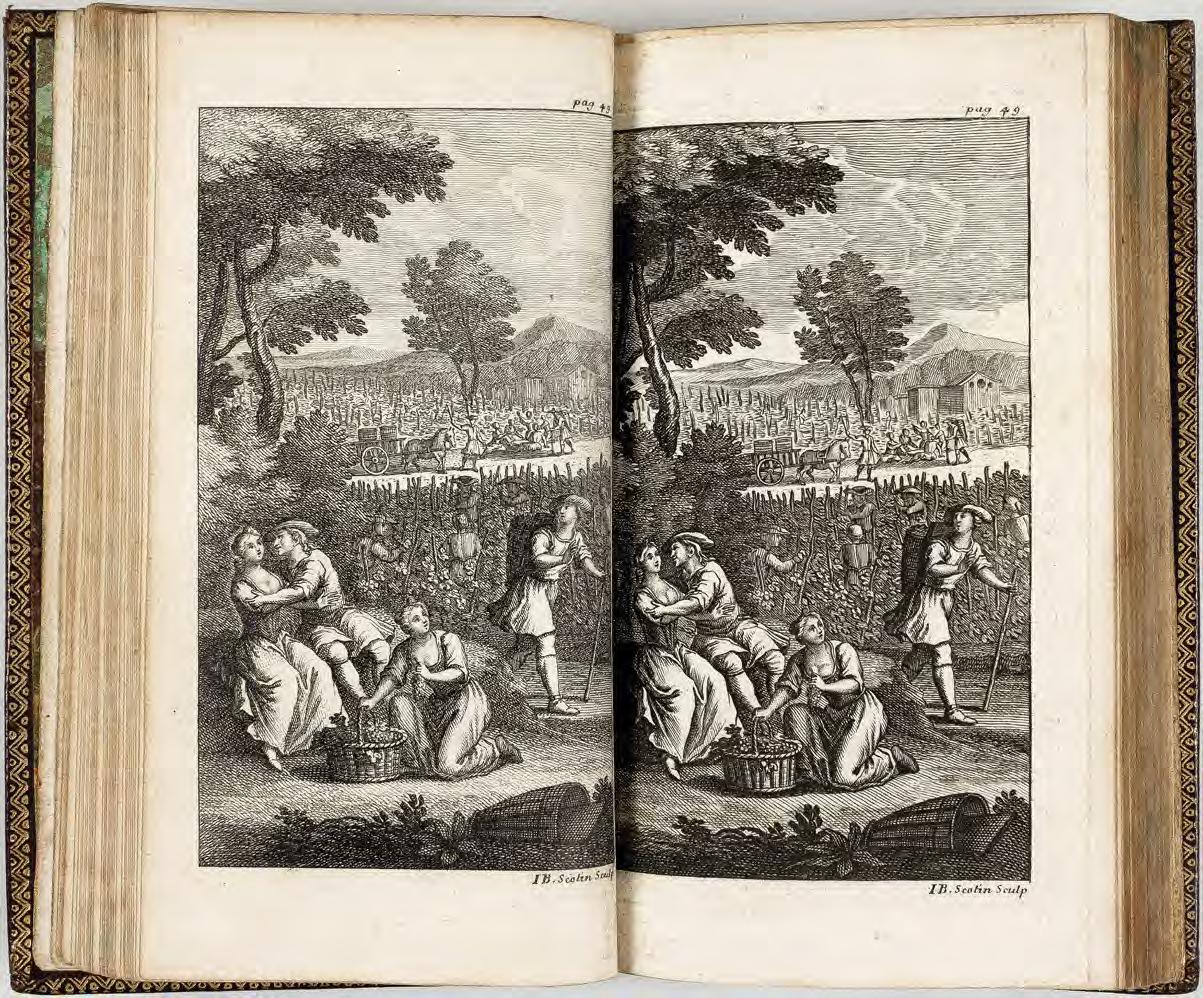
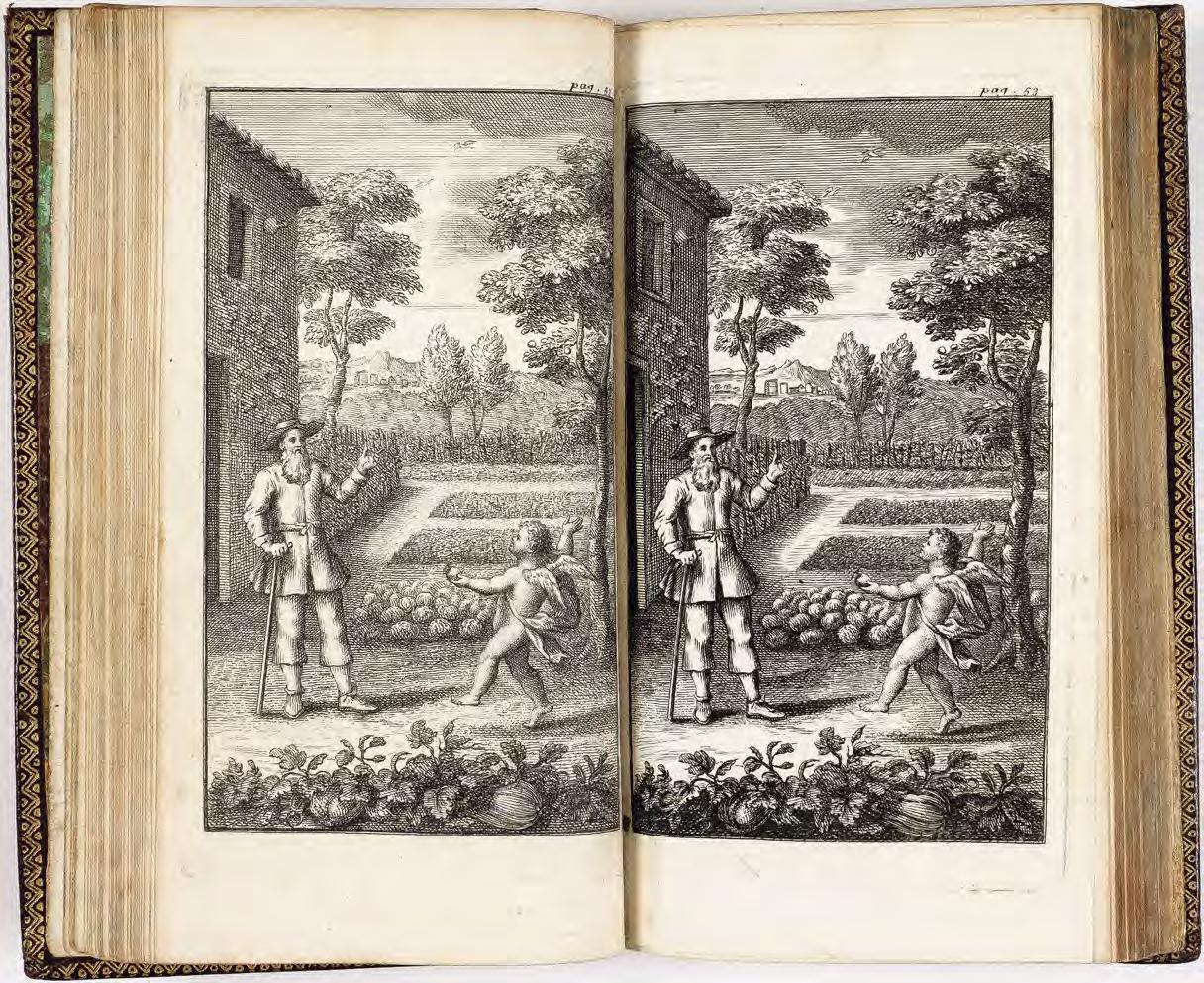
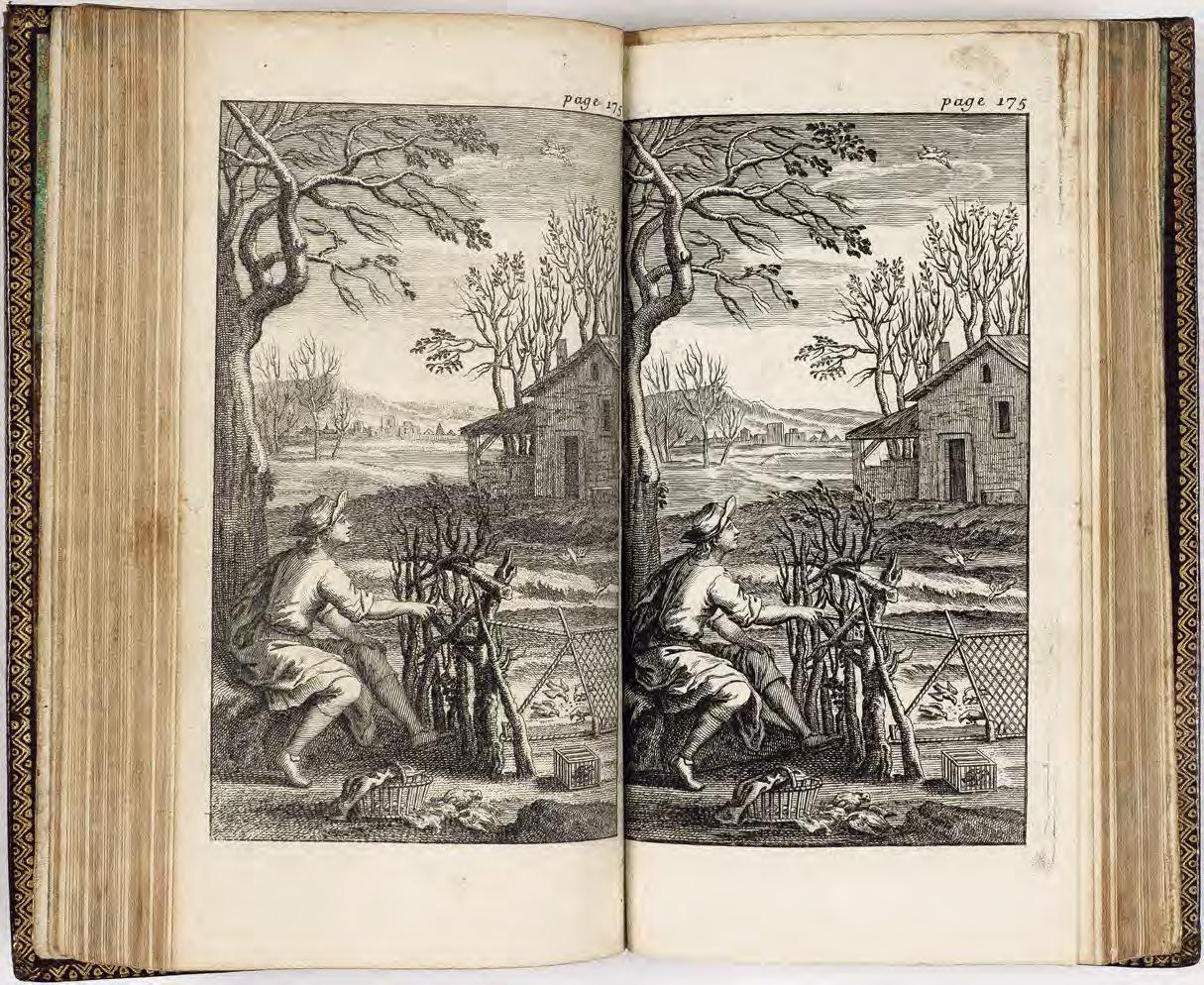
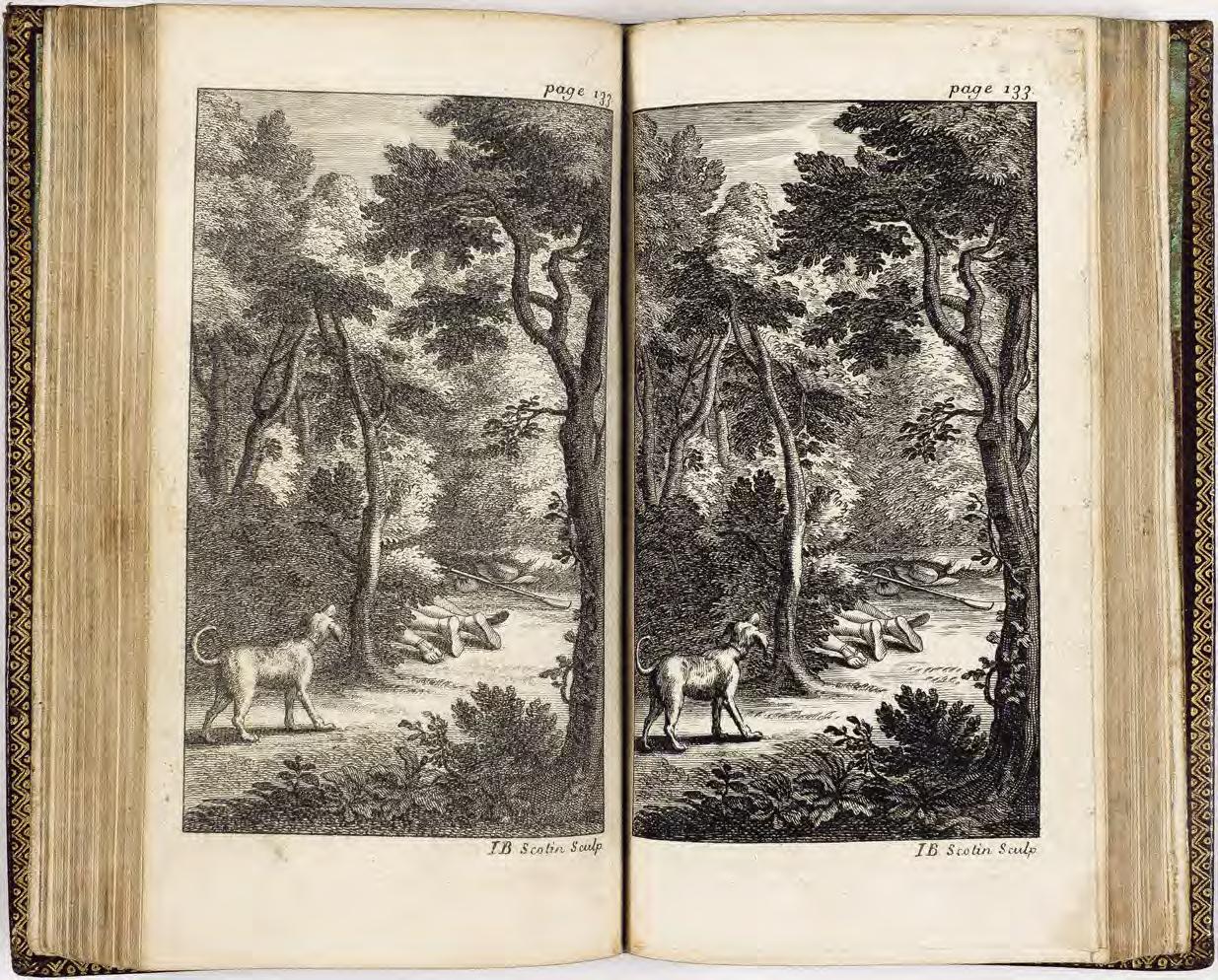

unausgesprochenes Konkurrenzverhältnis anzunehmen ist, das künstlerisch in mancher Hinsicht Scotin für sich entschieden haben dürfte, gerade wenn man die hier vorliegende Fassung mit einbezieht. Wann die zusätzliche Suite dem Exemplar beigebunden worden ist, wissen wir nicht. Doch war es schon im frühen 18. Jahrhundert unter den Bibliophilen durchaus üblich, mit den apart im Handel kursierenden Stichen und Stichfolgen besondere Exemplare zu bereichern oder solche dadurch erst entstehen zu lassen (vgl. Barber, Daphnis and Chloe, S. 32). Die Tatsache, daß schon die Exemplare der ersten Ausgabe die Kupferstichfolge gewöhnlich von bereits bearbeiteten und recht ausgedruckten Platten enthalten, könnte darauf hindeuten, daß Scotin diese Folge früher angefertigt und eigenständig publiziert hatte, doch liegt die Entstehungsgeschichte völlig im Dunkeln.
Daß es sich hier um ein herausragendes Exemplar einer besonderen Sammlung handeln muß, erweist schon ein Blick auf den prachtvollen Einband. Ein Verkaufsvermerk der Zeit auf dem Vorsatz besagt, das Exemplar sei bei der Versteigerung der Sammlung des Trésorier général des Etats de Bretagne, Jean-Baptiste-Simon Boyer, Sieur de La Boissière (1690–1763), im Jahre 1763 in Paris veräußert worden. Boyer gehörte der Noblesse de robe an und war ab 1720 königlicher Schatzmeister der Bretagne (vgl. Thierry Claeys, Dictionnaire biographique, S. 366). Berühmt geworden ist er nicht zuletzt für seine exquisite Musikbibliothek (siehe auch Laurence Decobert, La bibliothèque musicale de Jean-Baptiste-Simon Boyer de La Boissière, Turnhout 2015).
Der splendide Einband kann wohl als Arbeit des königlichen Hofbuchbinders von Ludwig XV.,
Antoine-Michel Padeloup (1685–1758), genannt Padeloup le jeune, identifiziert werden, mit dessen bekanntem Stempelrepertoire auf dem Rükken und den Deckeln (siehe Barber, Rothschild, W.Cat. 419, und Farbabbildung S. 789, hier ein sehr ähnlicher Einband, gleichfalls zu einer Ausgabe von Daphnis und Chloe, Paris 1716). Das Wappen auf dem Einband ist allerdings dasjenige der Familie Montguyot in der Champagne: zwei Schlüssel flankieren eine stilisierte Palme, darunter drei Muscheln (vgl. Rietstap, Armorial général II , 253, und Planches II , Tafel 236). Wahrscheinlich handelt es sich um Antoine (1698–1776) oder Adrien François de Montguyot (1695–1783). Sein außergewöhnliches Supralibros, das ohne die übliche Einfassungslinie auskommt, hat der neue Besitzer wahrscheinlich bald nach Erwerb in der Auktion des Jahres 1763 dem Einband aufprägen lassen. Ebenfalls bemerkenswert sind die herrlichen Brokatpapiervorsätze (vgl. Kopylov, Papiers dorés d’Allemagne, 19) mit reliefierten Blüten und Akanthusranken, umrahmt von einem Vierpaß auf Goldgrund, patroniert in violett, orange, rosa, gelb und hellgrün. Besonders hervorzuheben sind die gelben kleinen Brunnen, für die wir keinen Vergleich gefunden haben. Wie die meisten Buntpapiere dieser Art ist dieses vermutlich in Augsburg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hergestellt worden.
Der Einband nur gering bestoßen, eine der zusätzlichen Tafeln mit kleiner alter Hinterlegung im Rand, vereinzelt ein wenig stockfleckig, sonst sauber und wohlerhalten.
Bibliographie wie zu Nummer I; zur Provenienz siehe: Catalogue Boissière 1763, Nr. 1108 (für ein Exemplar der Ausgabe von 1731 gehalten).
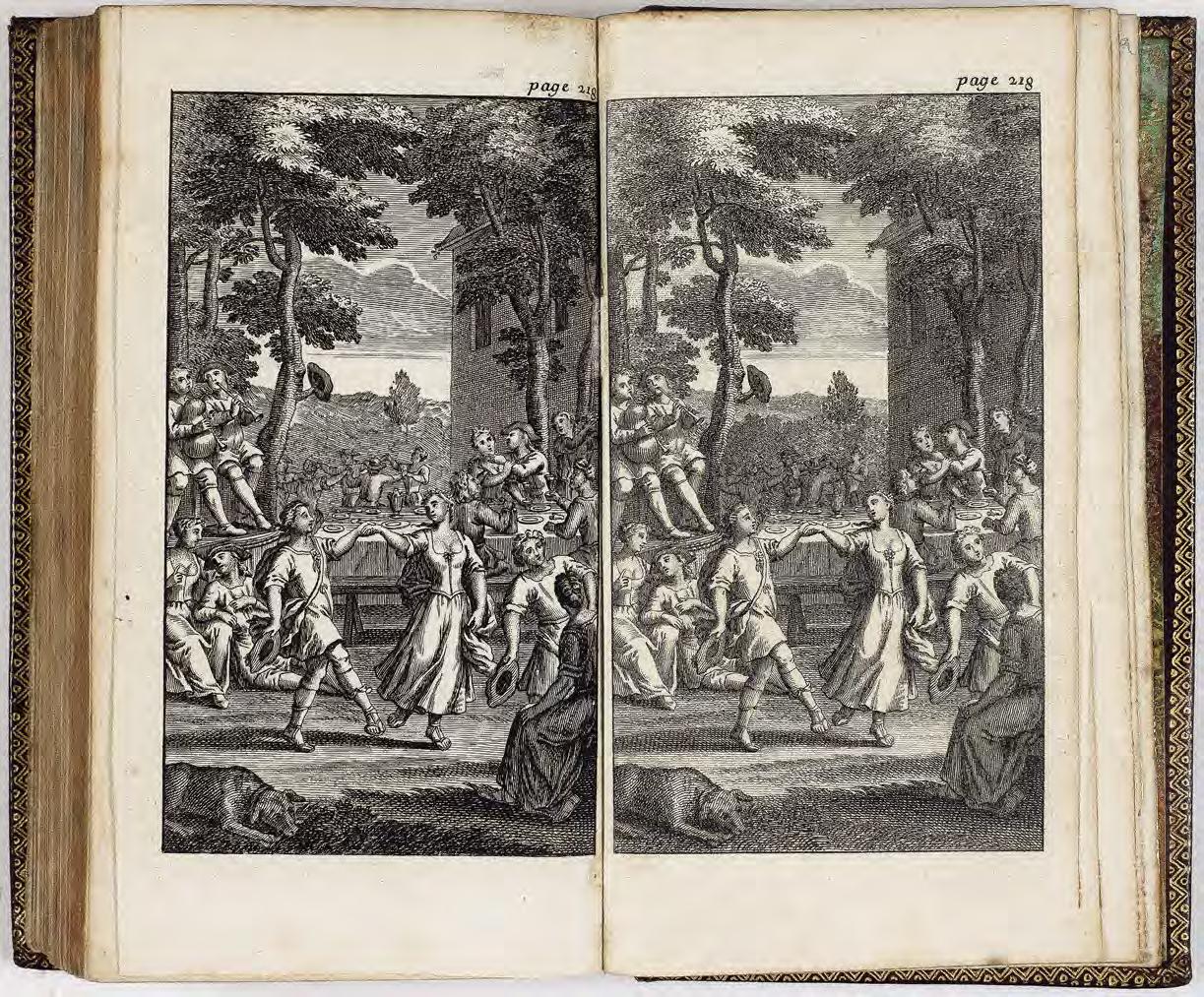
Die 28 Kupferstiche der Regenten-Ausgabe in Originalgröße
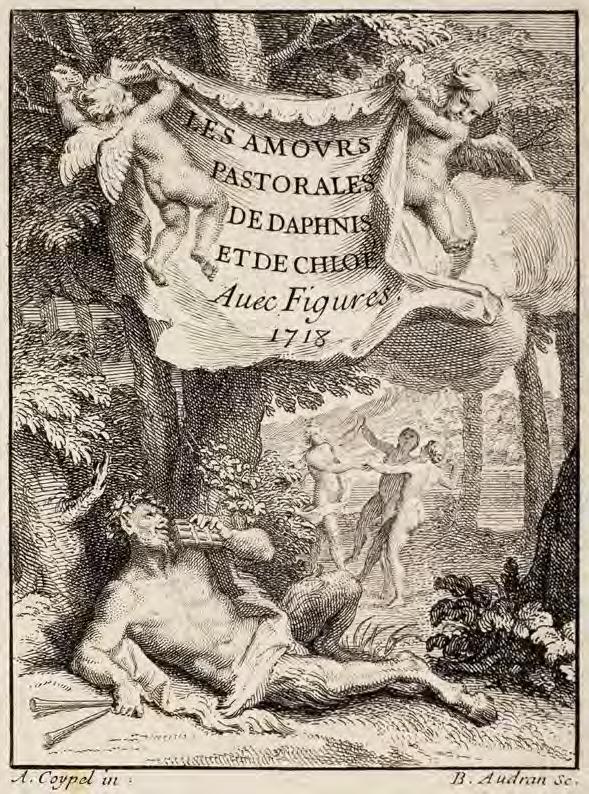
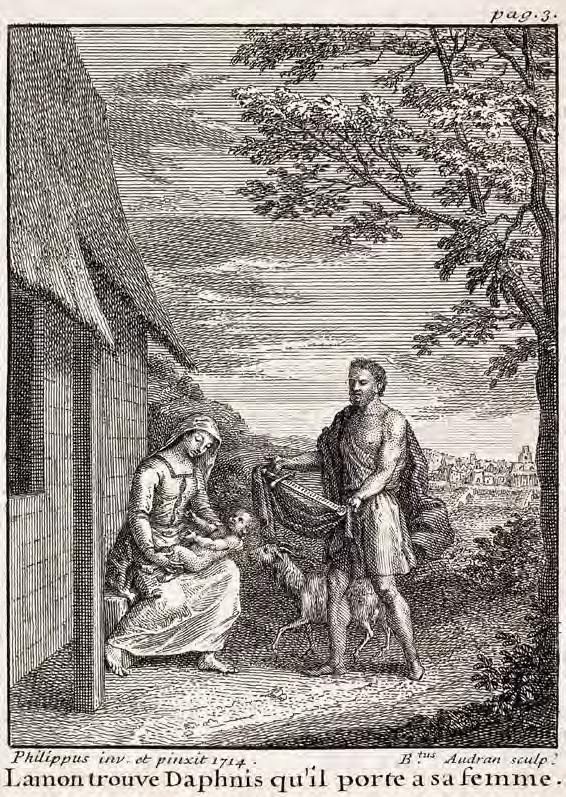
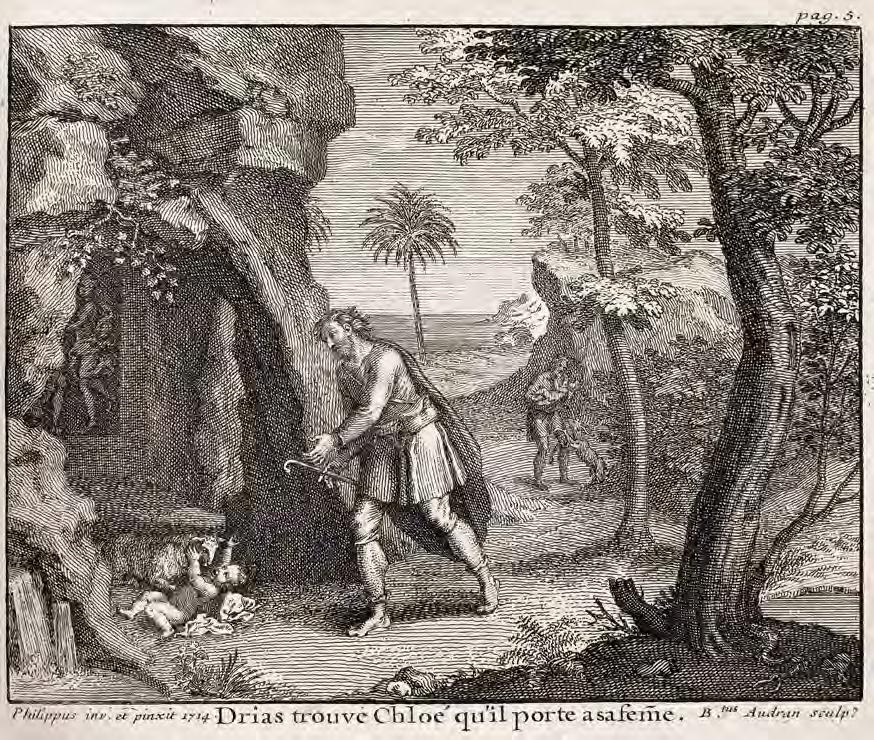
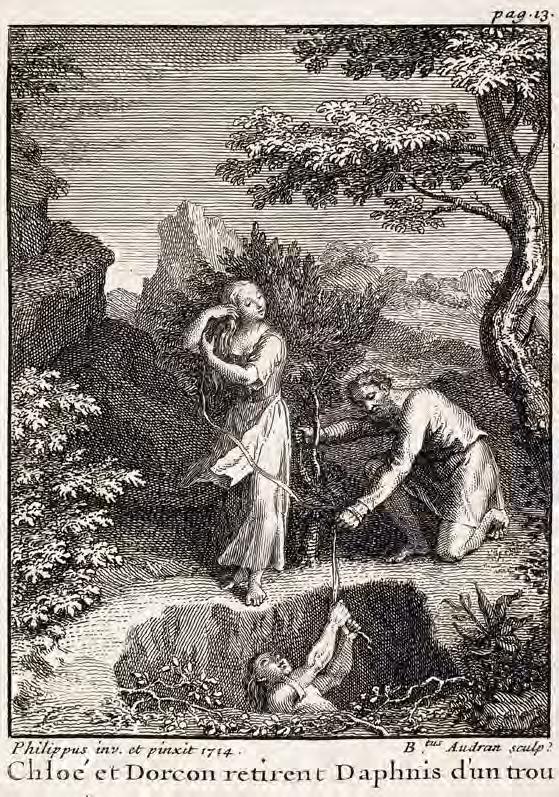
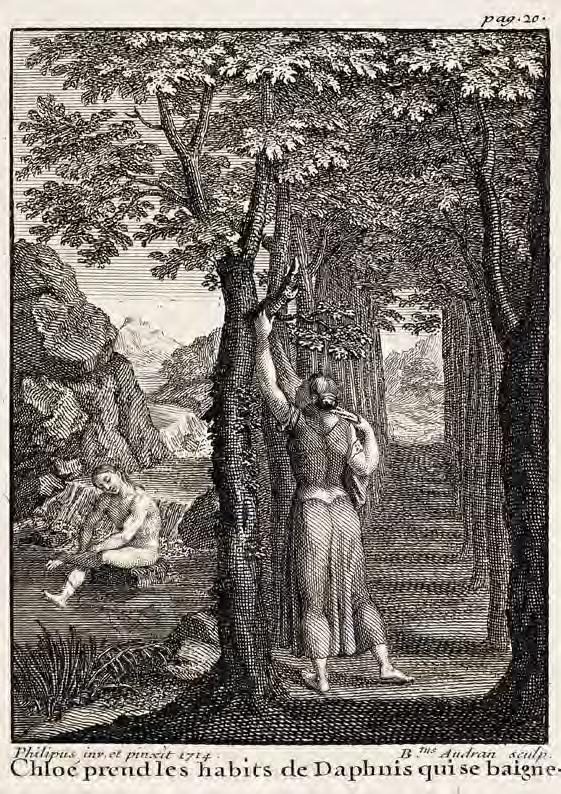
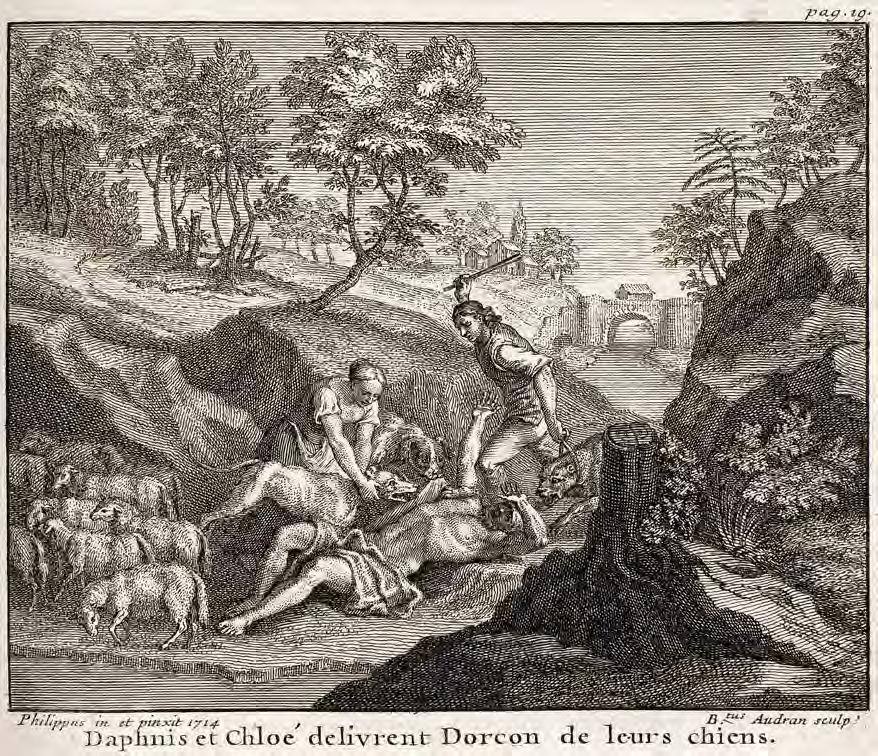
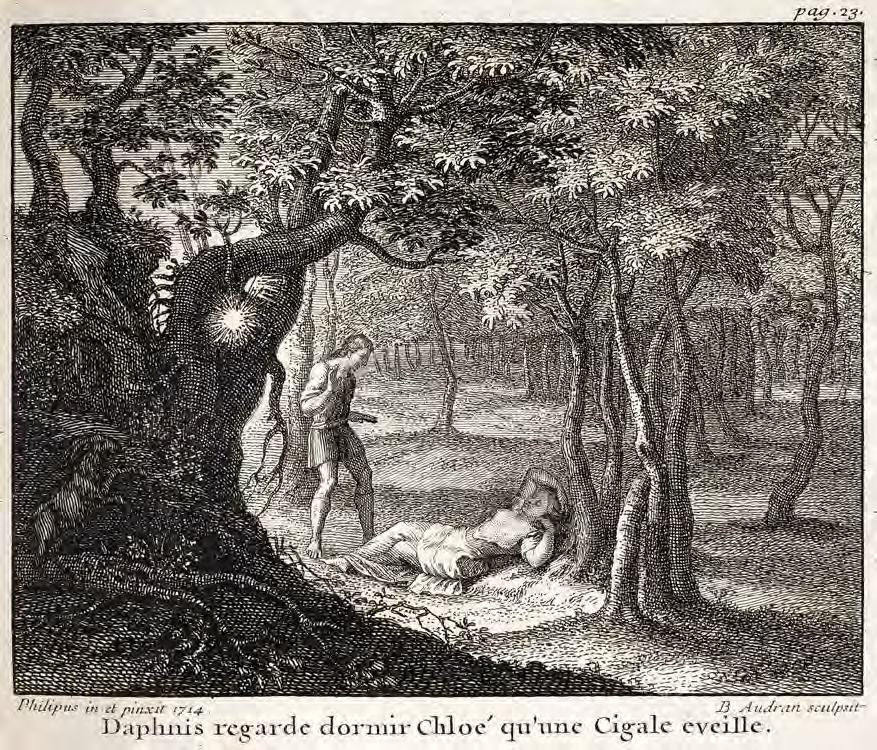
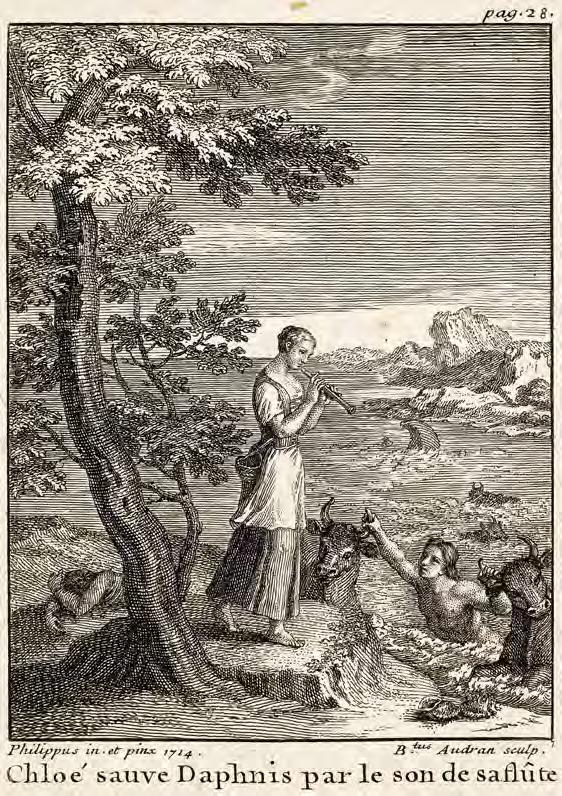
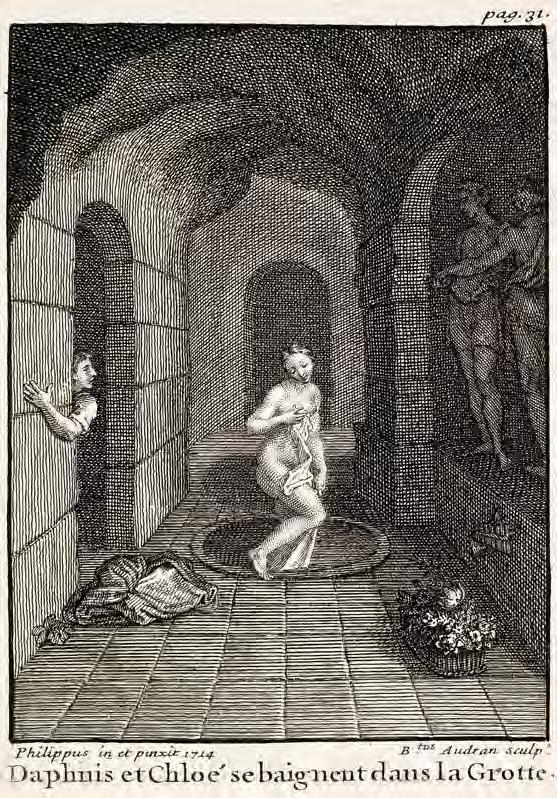
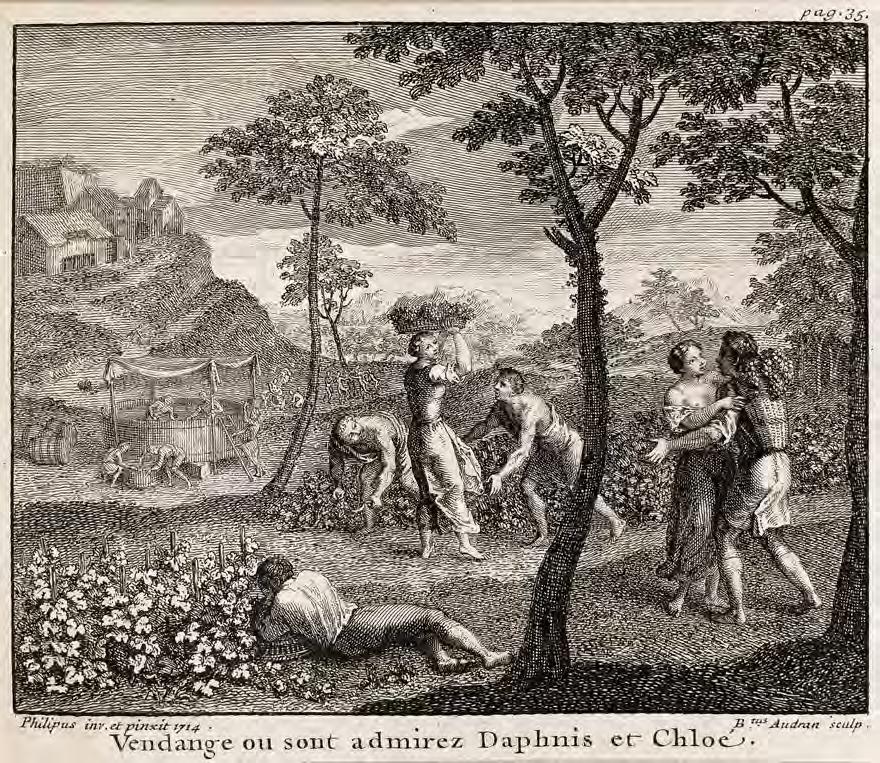

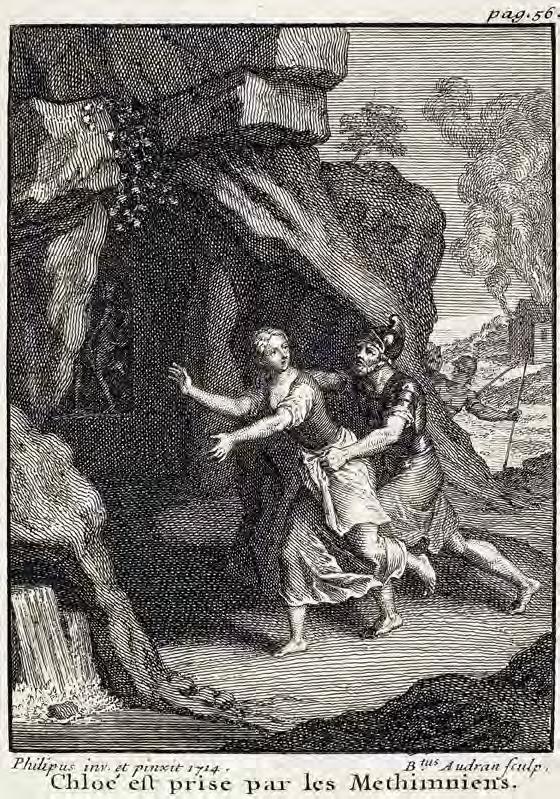
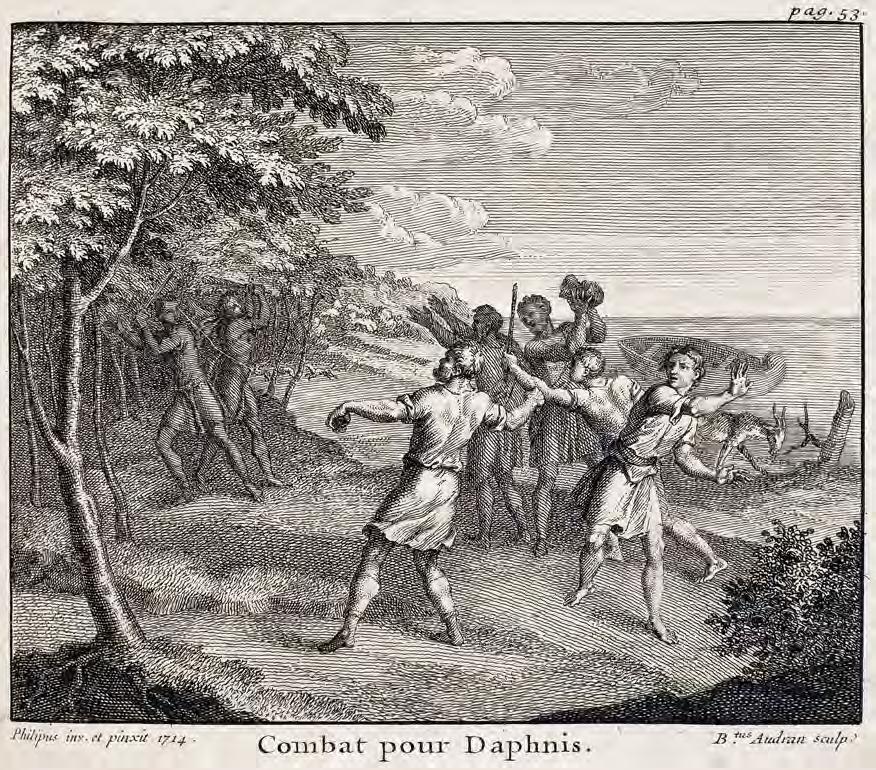
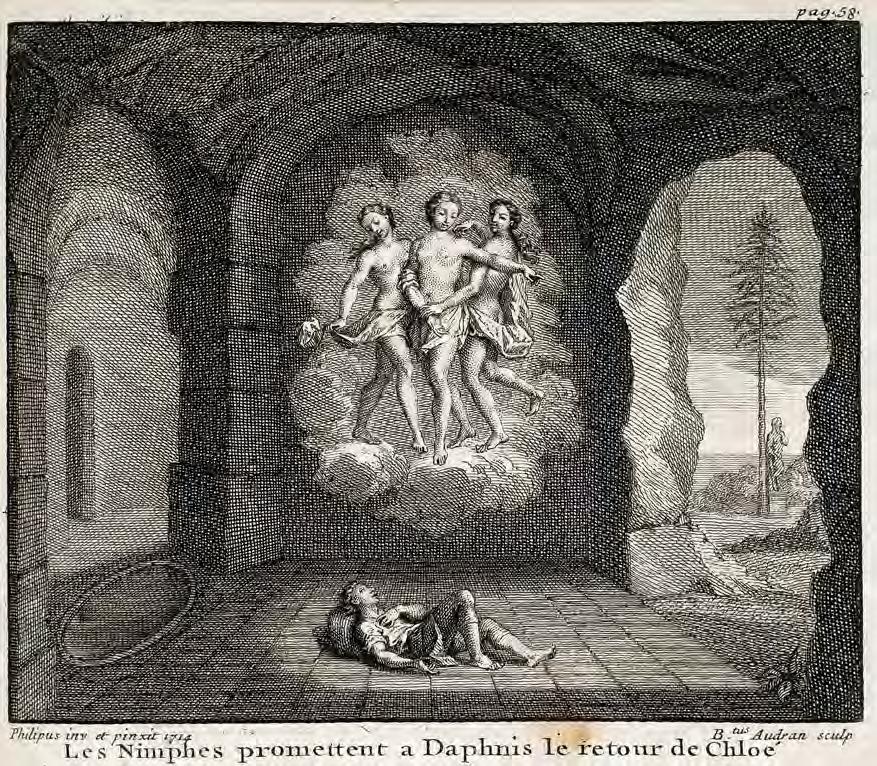

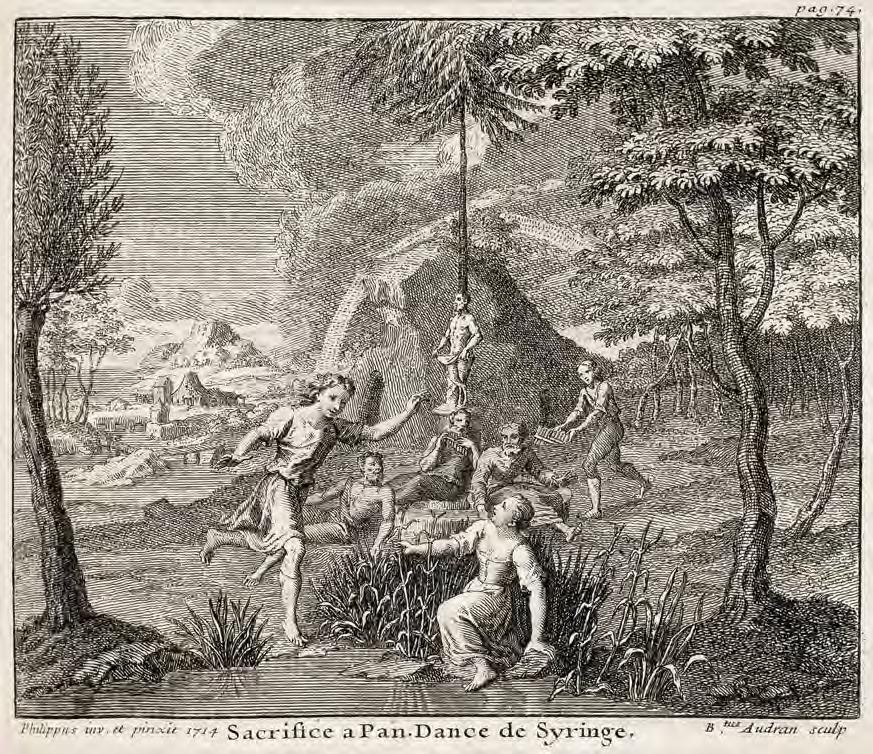
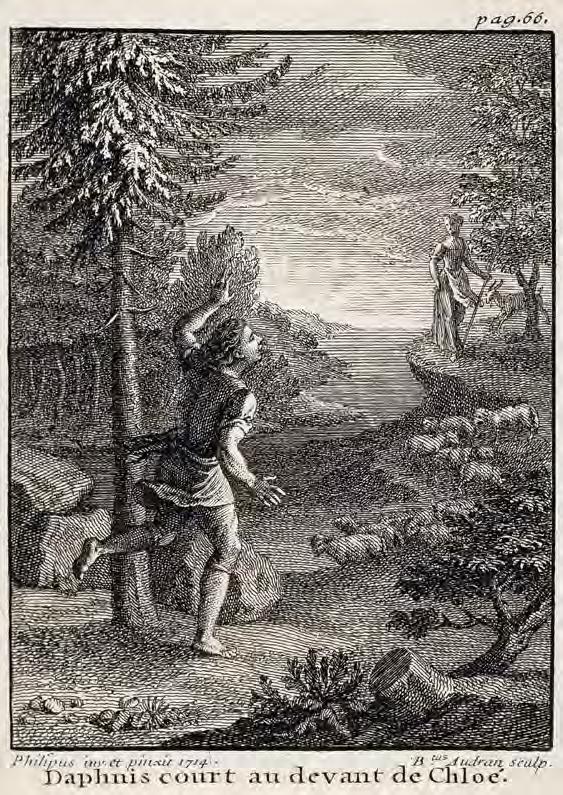
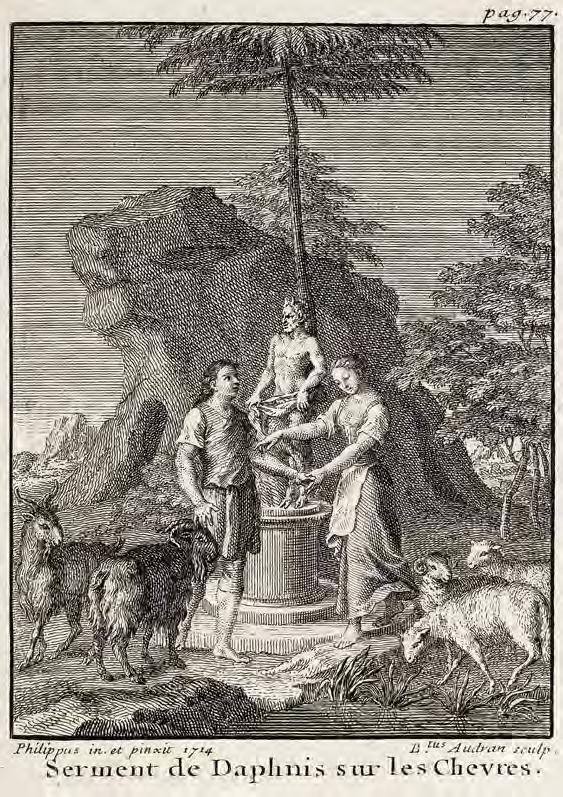
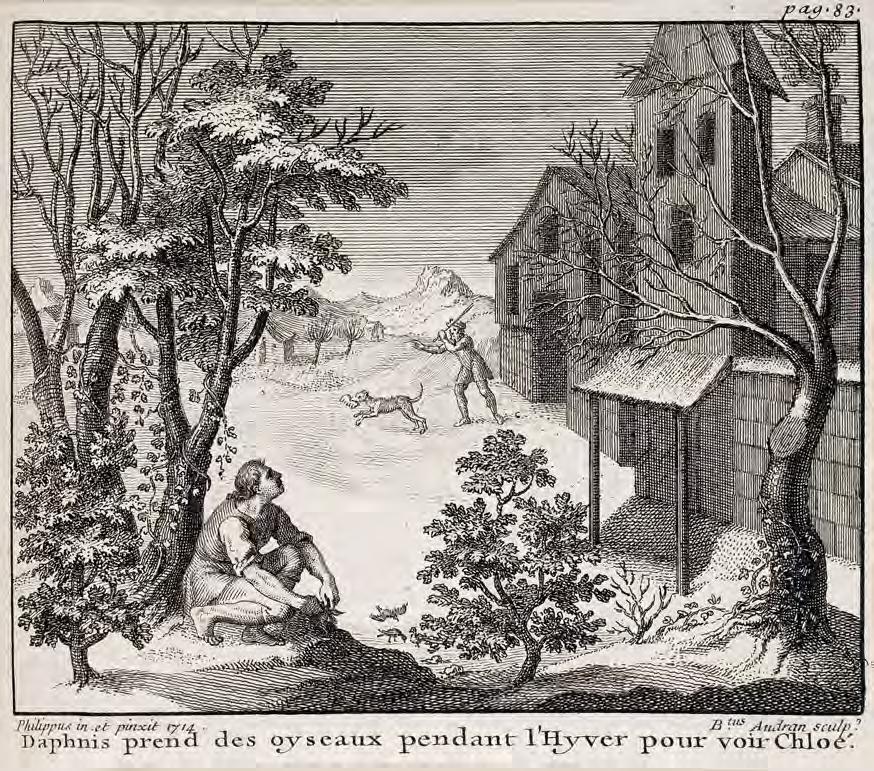
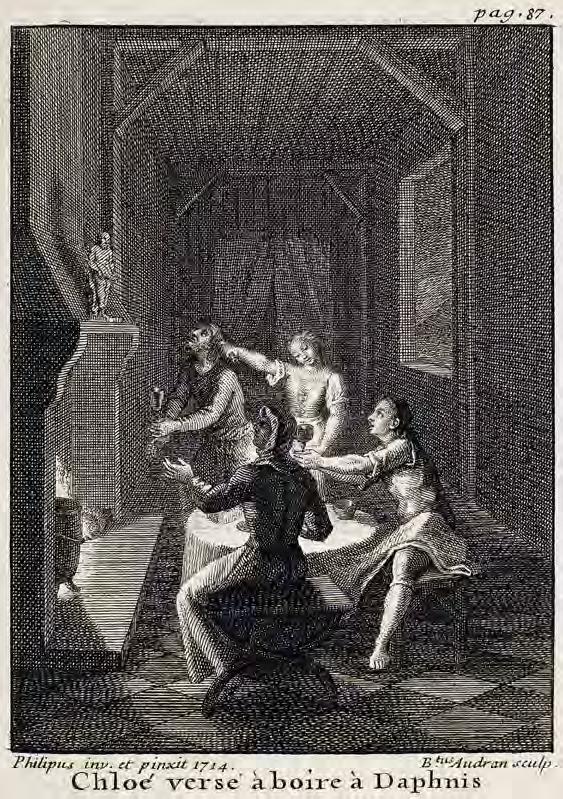
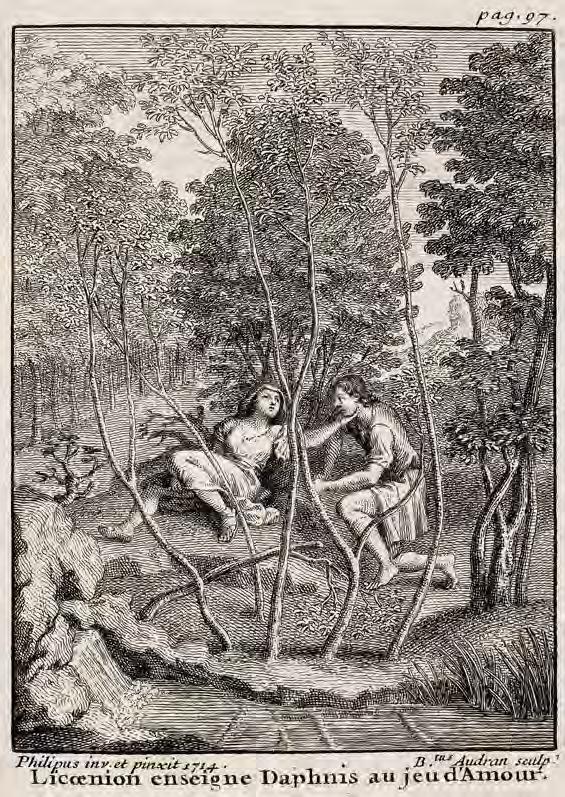


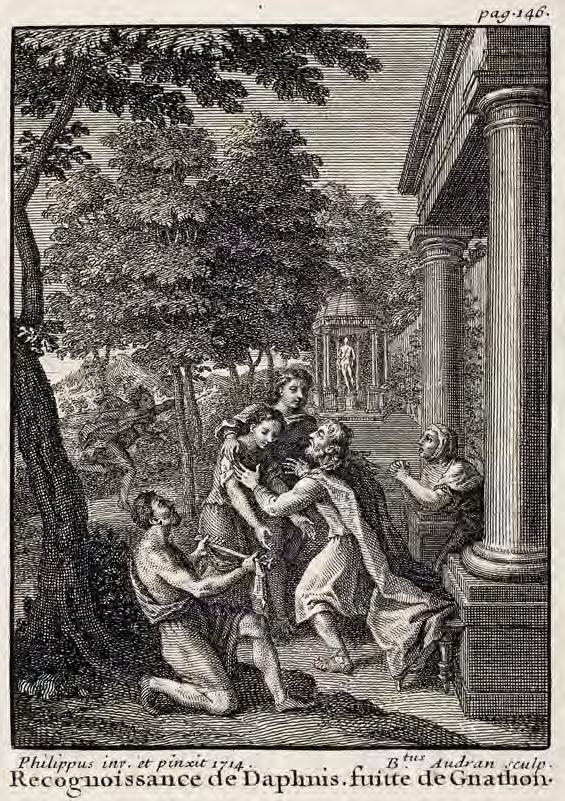

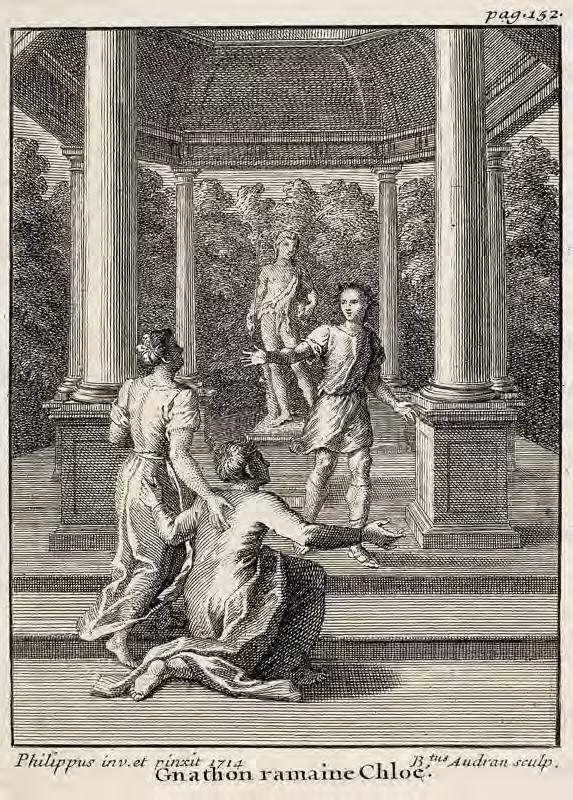

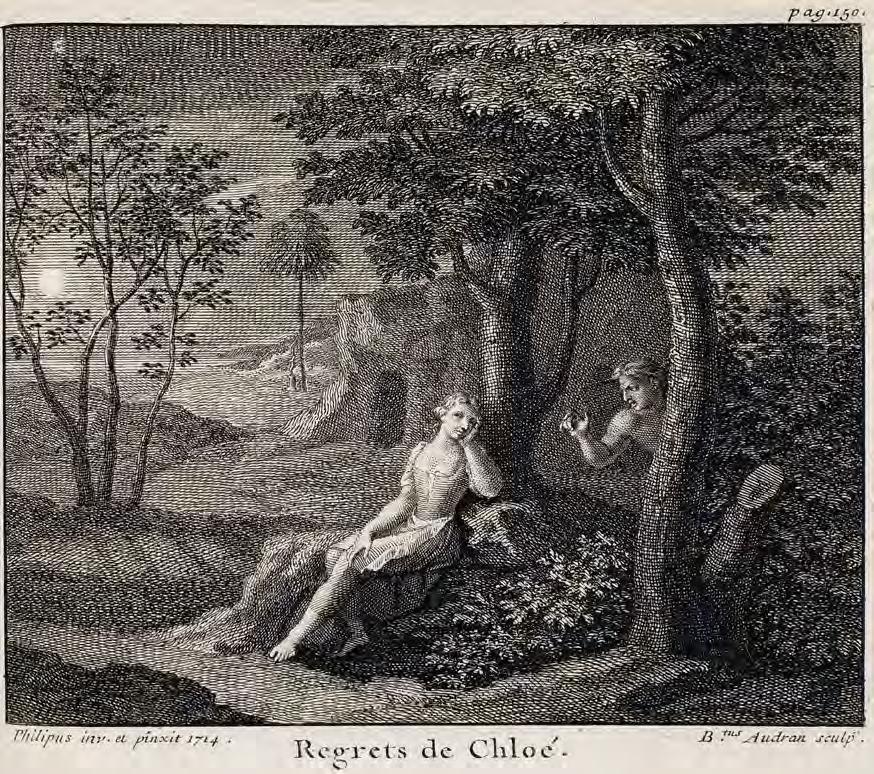

Das Exemplar von Guy Pellion der „Édition dite du Régent“ –
Sehr breitrandig und mit bukolischer Rückenverzierung
III [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Bl., 164 S. (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . („Préface“ inmitten des „Avertissement“ gebunden: π2 ππ 2 π2).
Klein-Oktav (163 x 101 mm).
Weinroter Maroquineinband des mittleren 18. Jahrhunderts (wohl zwischen 1730–1750), der glatte Rücken zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben der Titel auf olivgrünem Maroquinschildchen, die anderen mit einem bukolischen Trophäenstempel als Strauß, bestehend aus Pfeilen im Köcher, Fackel, Taubenpaar und „Houlette“, umgeben von feinen rankenartigen Einzelstempeln, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung und kleinen Blütenstempeln an den Überschneidungen; Stehkantenfilete, Innenkantenvergoldung aus zwei Zierleisten, großformig angelegte Marmorpapiervorsätze, Ganzgoldschnitt, von oder in der Art des J.-A. Derome.
Dieses vorzügliche Exemplar der ersten mit der sogenannten Suite du Régent ausgestatteten Ausgabe des Jahres 1718 enthält zusätzlich die Conclusion du Roman , oder auch Petits pieds benannte
Kupfertafel, die man dem Grafen Caylus zuschreibt und die erst 1728 entstanden ist. Manchem besseren Exemplar der früher erschienenen Drucke pflegte man sie noch beizubinden, weshalb sie gewöhnlich von den Bibliographen als obligater Teil der Illustration aufgeführt wird. Unser Exemplar war dieser Bereicherung allemal wert, ist es doch sehr breitrandig, und die berühmte Stichfolge liegt hier in so tiefen, gratigen Abzügen vor, daß noch jeder Halbschatten als eigenes Phänomen realisiert ist und die Abstufung der Helldunkelwerte so differenziert ausfällt, daß den Bildern Tiefe und Räumlichkeit verliehen ist, wie man sie in späteren Abzügen kaum mehr antrifft. Zum verwendeten Papier und der Existenz von Exemplaren in verschiedener Größe und Qualität bemerkte schon 1819 Antoine-Augustin Renouard: „On n’avoit pas encore remarqué qu’il a été tiré deux sortes d’exemplaires de cette rare et curieuse édition (…) Ce grand papier est aussi plus blanc, et de plus belle qualité“ (Renouard, Catalogue 1819, Bd. III , S. 186; siehe auch Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1157). Die neben seiner Größe beachtlich gute Papierqualität unseres Exemplars, ein festes, sehr helles, in der Linienstruktur feines Bütten, ist evident; man kann es daher der sehr geringen Teilauflage mit dem besseren Papier zuordnen. Diverse Wasserzeichen weisen auf die Papiermühle hin, klar erkennbar ist eine fünfblättrige Blüte in Kombination mit den Buchstaben A und M.
Bis heute ist fraglich, ob der Regent Philippe d’Orléans diese Ausgabe, die seinen Namen trägt („édition dite du Régent“) selbst initiiert hat; sie sei, so bekunden schon Quellen der Zeit, in nur 250 Exemplaren erschienen, die er in erster Linie als Geschenk für Freunde bestimmt habe. Die Herstellung im Auftrag des Regenten könnte natürlich eine Erklärung dafür sein, warum ein Impressum gänzlich fehlt. In der Literatur wurden




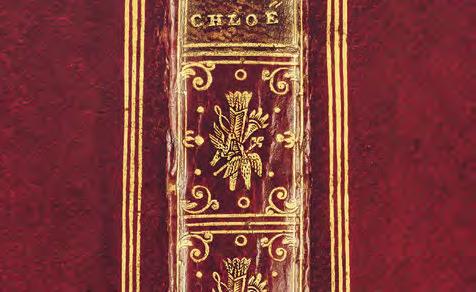
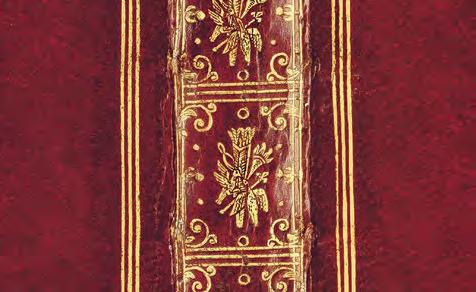
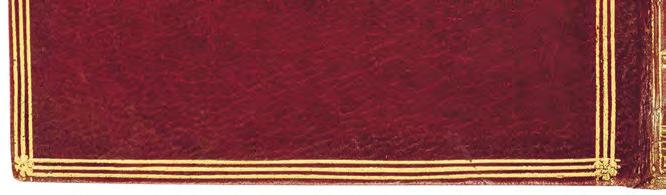
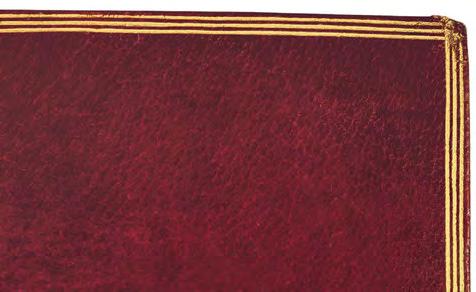



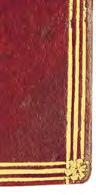
bislang fast immer die beiden Pariser Verlagshäuser Quillau und Coustelier als die in Frage kommenden Drucker dieser Ausgabe ins Feld geführt, so auch bei Cohen/De Ricci. Renouard, der wohl zuerst den Drucker zu identifi zieren versuchte, führte nur Quillau an, doch ohne eine Quelle dafür zu nennen. Der andere mögliche Drucker, AntoineUrbain I. Coustelier (gestorben 1724), war immerhin Libraire-imprimeur des Duc d’Orléans und hat für ihn zahlreiche Werke der älteren französischen Dichtung gedruckt.
Barber hält es deshalb für wahrscheinlicher, daß der Auftrag des Regenten zur Herstellung der Ausgabe an Coustelier gegangen ist (Daphnis and Chloe, S. 36). Ein schlagkräftiger Beweis für die Urheberschaft fehlt allerdings bislang. Wir halten es aufgrund von Vergleichen indessen für wahrscheinlicher, daß diese Ausgabe ein Druck der Imprimerie Royale ist, die zu dieser Zeit von Claude Rigaud geleitet wurde. Diese Hypothese stützt sich auch auf eine Quelle der Zeit, einen handschriftlichen Vermerk, der von dem Bibliographen
Prosper Marchand (1678–1756) stammen dürfte (dazu ausführlich im Einführungstext).
Hervorzuheben ist der schöne Einband unseres Exemplars, der einen zur Thematik passenden, mit bukolischen Motiven verzierten Rücken aufweist. Man kann ihn wohl in den Derome-Umkreis einordnen (Barber, Rothschild, zeigt unter Roll 3 und 4 ähnliche Stempelformen, eine davon aus dem Repertoire von Nicolas-Denis Derome, dem Sohn des Jacques-Antoine Derome). Die Vorsätze in schönem papier marbré („Türkisch Marmor“) mit kräftigen Farben und großen floralen Motiven.
Provenienz: Das Exemplar entstammt der famosen Sammlung des Pierre Guy-Pellion (1845–1910), eine Bibliothek „composée dans le but de rassembler, comme en un musée rétrospectif, les éditions originales de toutes les œuvres illustres ou charactéristiques de nôtre literature“ (Catalogue GuyPellion 1882, Vorwort – siehe auch: Fontaine, Les gardiens de Bibliopolis, Bd. II , S. 287–90); verso des fliegenden Vorsatzes das gestochene WappenExlibris. Das Exemplar wurde am 8.2.1882 unter der Nr. 539 für 590.– Goldfrancs verkauft. –Bibliothèque d’un Amateur de Dijon, 2001, Nr. 25. Abgesehen von schwachen Fingerflecken auf den ersten Blättern, ein sehr schönes Exemplar.
Bibliographie: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, S. 648–651. Péreire, Notes, S. 62–63. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 314. Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, S. 514. Boissais/Deleplanque, Le livre à gravures, S. 114. Portalis/Beraldi, Les graveurs, Bd. I, S. 47 (zu Benoit I. Audran, sehr abwertend gegenüber der Illustrationsfolge: „Si l’on peut s’exprimer ainsi, c’est un livre de bibliophile, non iconophile“). Barber, Daphnis and Chloe, S. 32–36. Brunet, Manuel, Bd. III, Sp. 1157 f. Ebert, ABL , 12242. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 533. Quérard, La France littéraire, Bd. V, S. 351. Gay/Lemonnyer, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, Bd. I, Sp. 183 f. (zählen als „réimpressions“ Ausgaben der Jahre 1731, 1734, 1745, 1750, 1764, 1772, 1776, 1777, 1780, 1792, 1796 und 1797 auf). Lewine, Illustrated books, S. 321 f. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1221. Ray, The French Illustrated Book, Nr. 2 (S. 10 f., mit völlig falscher Bewertung der abgebildeten Zeichnung der Petits pieds, die die Version Scotins zeigt). Fürstenberg, Das französische Buch, S. 72 f. und S. 133–137. Fürstenberg, La gravure, S. 75. Fürstenberg, Das Buch als Kunstwerk, Nr. 3. Garnier, Coypel, S. 38. Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé, S. 35 ff. Garnier-Pelle, Antoine Coypel and the Regent, S. 85 ff.
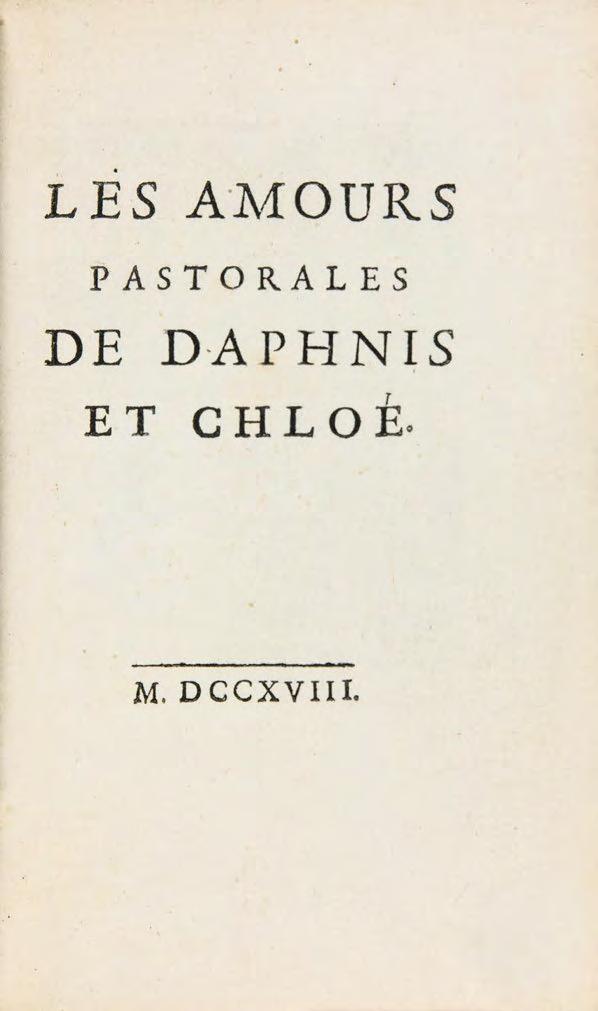
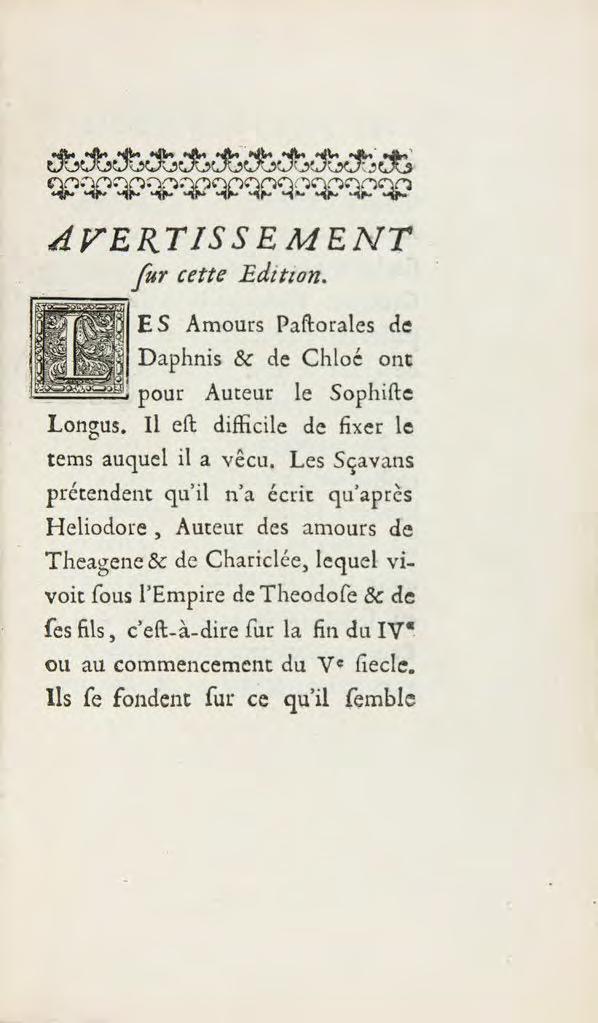
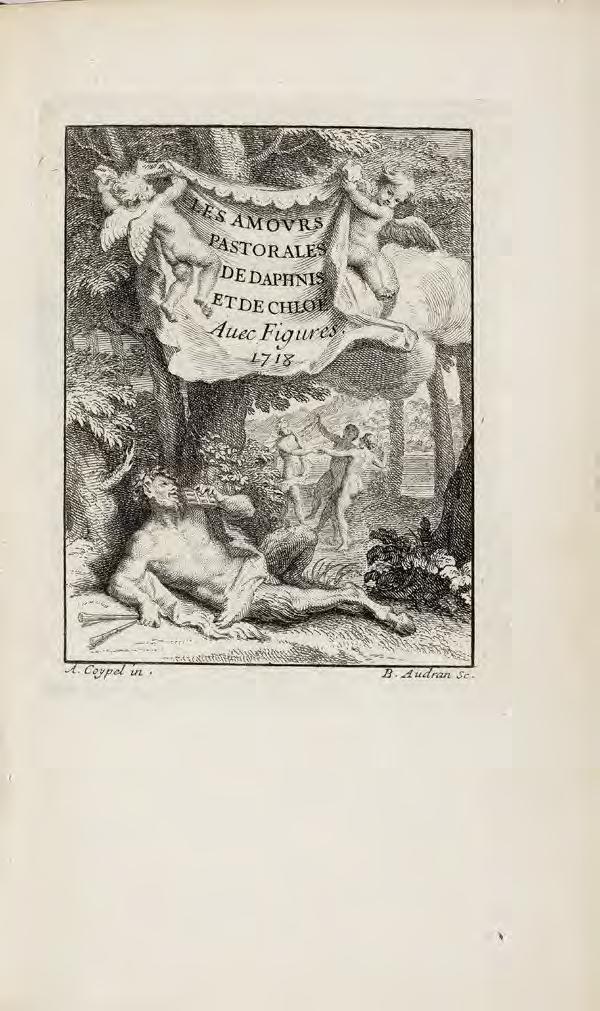
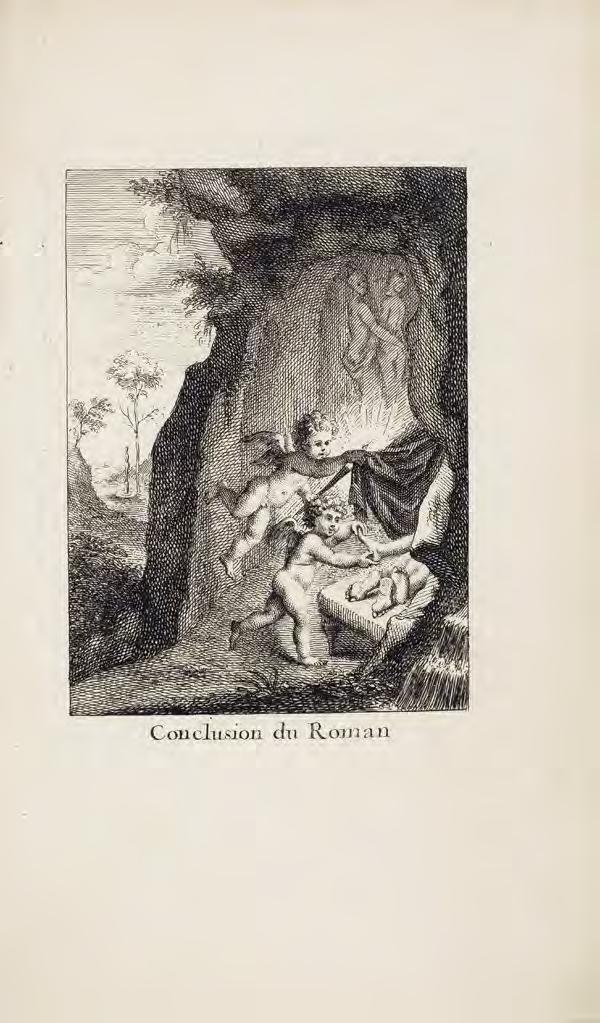
Das Exemplar Tissot-Dupont in nachtgrünem Maroquin
IV [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Bl., 164 S. (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . Klein-Oktav (155 x 97 mm).
Französischer nachtgrüner Maroquineinband des späten 18. Jahrhunderts (wohl um 1780/90) mit reicher Vergoldung, der glatte Rücken in sieben Kompartimente geteilt, davon vier mit Stempeln zweier schnäbelnder Tauben im Blattkranz, im zweiten von oben rotes Maroquin-Rückenschild mit Titel, unten zwei Abteilungen mit bogiger Kettenvergoldung im Rautenmuster, die Deckel gerahmt von einer geraden Kettenglied-Bordüre, bestehend aus jeweils zwei alternierend angeordneten Elementen und mit Sonnenradstempeln in den Ecken, von diesen schräg nach innen ausgehende Eckfleurons in Form von Blumenstempeln mit Blattzweigen; Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, dunkelrosa gemusterte Kleisterpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt, im Stil von J. A. Derome père, eventuell von A.-P. Bradel, in Halblederschuber.
Ein vorzügliches Exemplar der ersten mit den berühmten Stichen der Regentensuite illustrierten Ausgabe, dazu noch die „Conclusion du Roman“
betitelte Kupfertafel der Petits pieds, die dem Grafen Caylus zugeschrieben wird und wohl erst 1728 entstanden ist. Wie bei der vorgehenden Nummer liegt auch hier ein Exemplar auf größerem und besserem Papier vor, das mit diesem übereinstimmende Wasserzeichen aufweist. Der Einband, würde man ihn nur vom Rücken mit seinen zierlichen Täubchen her beurteilen, wäre in der Art der beiden Deromes, aber die Bordüre der Deckel ist eigenartig und paßt in kein Schema. Barber weist zwei Einbände mit einer fast identischen Kettengliedbordüre nach (Rothschild, Pal 61), die in diesen Fällen zur Verzierung der Rücken benutzt wurde. Bei einem dieser Einbände (W. Cat. 194), der früher N.-J. Derome zugeschrieben wurde, aber aller Wahrscheinlichkeit nach von seinem Neffen Bradel stammt, wurden die Deckel mit einer Bordüre aus Ähren und Perlen geschmückt, wie wir sie auf unserem Exemplar Nummer X finden, das wiederum mit Bradels Firmenetikett versehen ist.
Provenienz: Exlibris „Bibliothèque de Lucien Tissot-Dupont“, der große französische Bibliophile der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Sohn des Firmengründers Simon Tissot Dupont. Die Auktion seiner Bibliothek fand in Genf bei Kundig am 5./6.11.1948 statt, unser Exemplar war dort die Nr. 173, verkauft für 800,– sfr. Danach französischer Privatbesitz (vente am 30. März 2001, Nr. 45).
Das Exemplar ist gut erhalten und nahezu flekkenfrei: unterer weißer Rand von Blatt A1 professionell mit altem Papier angerändert und die erste Seite gereinigt – Schäden, die wohl von der längeren Lagerung ohne Einband im 18. Jahrhundert herrühren.
Die bibliographischen Referenzen wie bei unserer Nummer III .


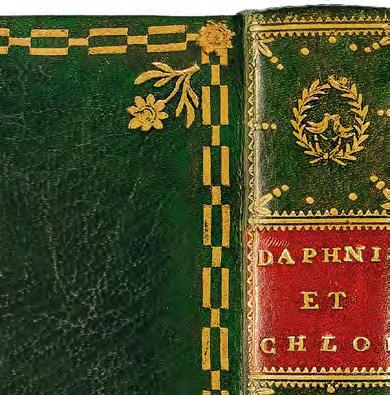



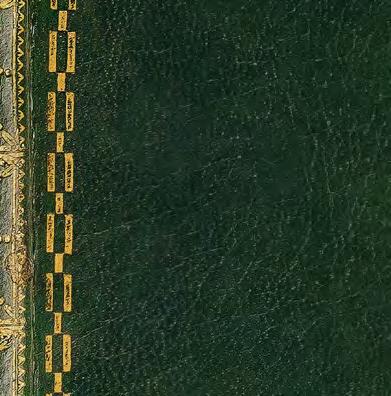
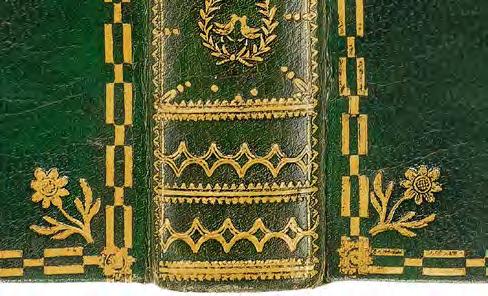




In einem Einband von Derome Le Jeune oder Bradel
V [Longus.] Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Bl., 164 S. (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . Klein-Oktav (155 x 97 mm).
Roter französischer Maroquineinband um 1780 auf glattem Rücken, die sechs Kompartimente in Kastenvergoldung mit stilisiertem Blütenstempel im Zentrum, im zweiten von oben der Titel in Goldprägung, Deckel mit breiter Rahmenvergoldung, bestehend aus einer äußeren Fleur-de-lis-Bordüre, einer Kette aus sich abwechselnden Sternen und Kreuzen, diese eingefaßt von doppelten Fileten mit runden Eckstempeln, sowie einer inneren Perlstabbordüre; Steh- und Innenkantenvergoldung, Vorsatz in türkisfarbenem Tabis, mit Ganzgoldschnitt, von Derome le Jeune oder A.-P. Bradel .
Ein sehr schönes, edel wirkendes Exemplar in einem charakteristischen Einband des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts, ebenfalls aus der Teilauflage auf besserem, größeren Papier. Der Einband stammt entweder von Derome le Jeune oder aber von seinem Neffen und Nachfolger Alexis-Pierre Bradel, der zunächst für die Witwe Deromes tätig war. Derome le Jeune ist insbesondere in seiner späten Phase bekannt für elegante Rollenvergoldungen. Auch der glatte Rücken ist kennzeichnend für seine späten Arbeiten, und Bradel setzte diesen Stil konsequent fort. Wir finden unter den französischen signierten Einbänden aus der Sammlung Mortimer L. Schiff einen ganz ähnlich gearbeiteten (Schiff Collection, Bd. II , Nr. 133) mit exakt denselben Rollenstempeln, der von der Witwe Deromes und Bradel signiert ist.
Provenienz: Mit dem Exlibris des Erotica-Sammlers Karl Ludwig Leonhardt (1922–2007), zuvor Martin Breslauer, mit dessen eigenhändigem Kollationsvermerk, monogrammiert „M. B.“, siehe Breslauer-Katalog 101, Januar 1970, Nr. 275: $ 840; auf dem fliegenden Vorsatz gegenüber dem Frontispiz ganzseitig in feiner Schrift ausführliche bibliographische Bemerkungen zur Ausgabe in französischer Sprache.
Von wenigen Stockflecken in den Rändern abgesehen, sehr dekoratives Exemplar in einwandfreier Erhaltung.
Bibliographie wie bei unserer Nummer III .

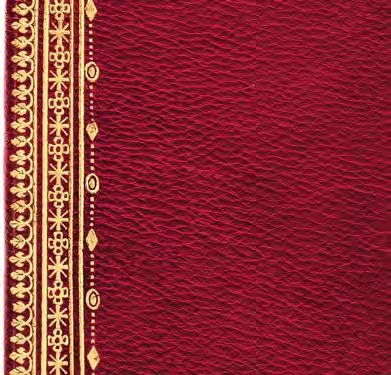
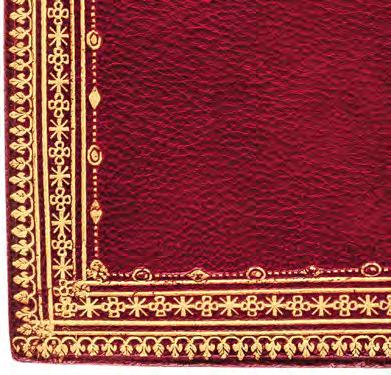
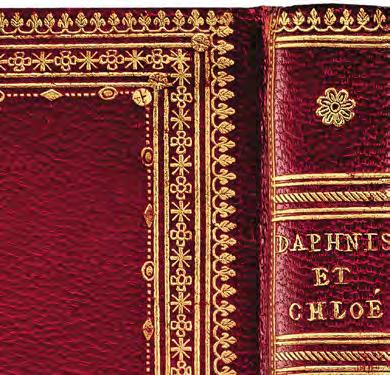
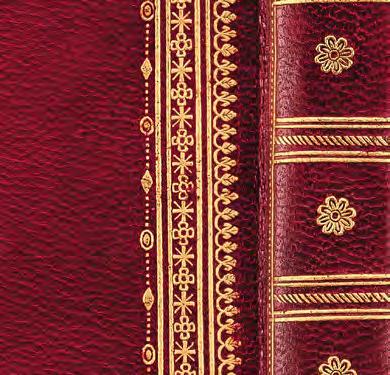
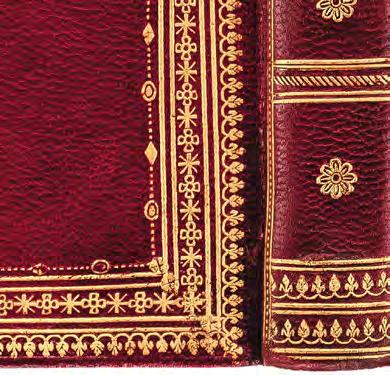
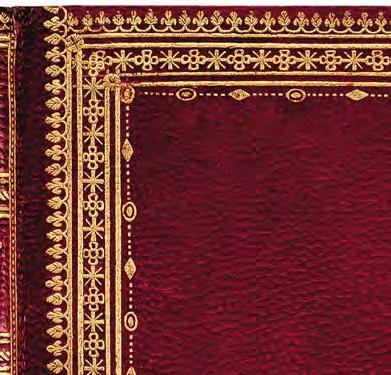
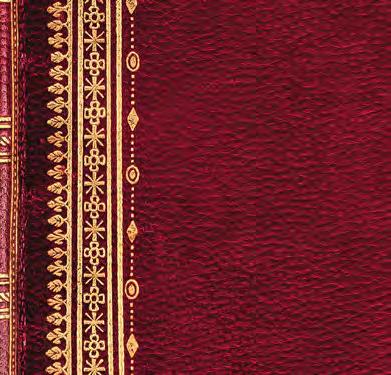
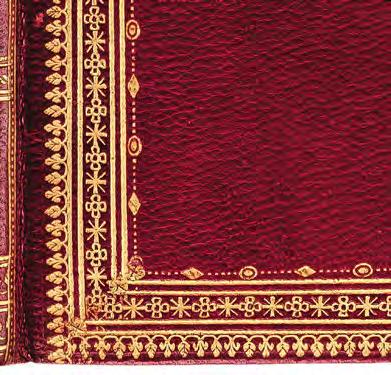
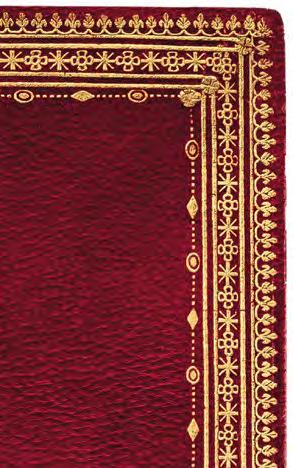
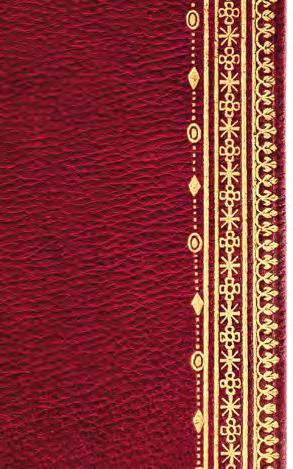

In doubliertem roten Maroquin der Zeit, gebunden wohl von Boyet
VI [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Bl., 164 S. (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 .
Klein-Oktav (160 x 101 mm).
Weinroter französischer Maroquineinband des 18. Jahrhunderts (wohl um 1730), Rücken zu sechs Kompartimenten auf fünf echten Bünden mit Kastenvergoldung aus Doppelfileten, im zweiten von oben der Titel in Goldprägung, Deckel mit zweifacher Filetenrahmung und kleinen Blütenstempeln über den Überschneidungen; Stehkantenfilete, doubliert in ziegelrotem Maroquin mit breiter Zierbordüre, fliegenden Marmorpapiervorsätzen, Ganzgoldschnitt und grünem Seidenlesebändchen, wohl von L.-A. Boyet.
Ein vorzügliches Exemplar mit gratigen, tiefen und sehr sauberen Abdrucken der Kupfer, auf dem guten und großen Papier der besseren Teilauflage sowie in einem doublierten Maroquineinband, der offensichtlich von einem der großen Binder der Zeit, sehr wahrscheinlich Luc-Antoine Boyet, bald nach Erscheinen in dessen charakteristischer Art hergestellt wurde. Während das Äußere, ähnlich wie wir es von den „reliures jansénistes“ kennen, ornamental zurückgenommen und in schlichter Noblesse gehalten ist, allein durch die Rahmung der Fileten akzentuiert, zeigt sich innen Prachtentfaltung durch sehr schöne, farblich gegenüber den äußeren Deckeln eine Nuance hellere Maroquin-Doublüren, die von einer Bordüre in hübscher Floralornamentik gerahmt werden. Diese Gestaltungsart folgt einem bei Boyet üblichen Gestaltungsschema (man vgl. etwa im Esmerian-Katalog, Paris 1972, Bd. II , Nr. 68), und auch der Vergleich der ornamentalen Stempel der Innenkantenvergoldung weist in dieselbe Richtung (siehe Barber, Rothschild, Cdr 7, nachgewiesen an einem Einband von Boyet, der exakt in das Jahr 1723 datiert werden kann: W.Cat. 427).
Provenienz: Exlibris des Buchhändlers Théophile Belin: In dessen Katalog von 1906 wurde das Exemplar als Nummer 682 für 1.200.– Goldfrancs angeboten. Erworben aus Schweizer Privatbesitz. In den Rändern minimal fleckig, sonst einwandfreie Erhaltung.
Bibliographie wie bei unserer Nummer III .


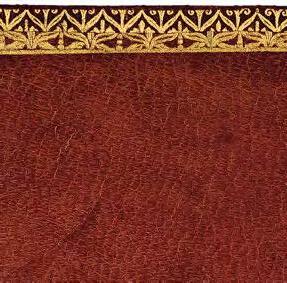






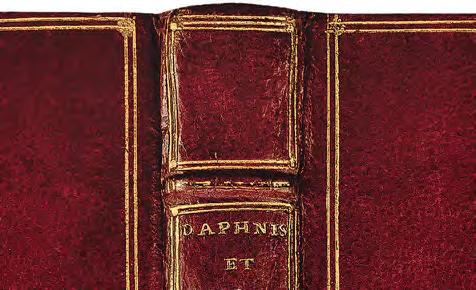

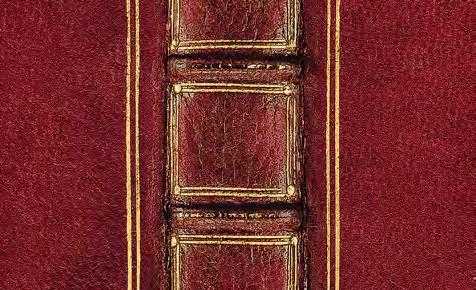


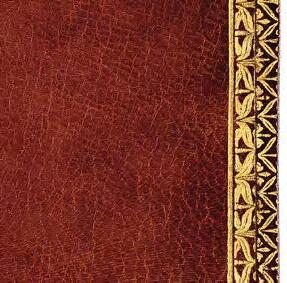
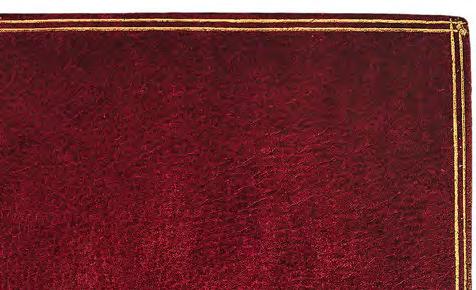


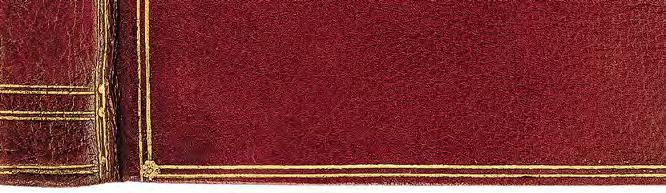

Das berühmte von Cohen zitierte Exemplar
La Bedoyère – Lebeuf de Montgermont, im Prachteinband und auf unbeschnittenem „papier fin“
VII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Bl., 164 S. (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . Klein-Oktav (170 x 109 mm).
Smaragdgrüner geglätteter Maroquineinband um 1870 auf fünf echten Bünden mit reicher Rückenvergoldung, darunter einem Blütenkorb als zentralem Kompartiment-Stempel, Deckel mit breiter, an den Ecken einschwingender Dix-huitième-Rahmenvergoldung aus meist floralen Einzelstempeln, Fileten und Perlstabmotiven; dichte Stehkantenvergoldung mit Zickzack-Band, Doublüren aus maroquin citron mit großer Einzelstempelvergoldung „à la dentelle“ in feinster Louis-Quinze-Ornamentik, doppelten Marmorpapiervorsätzen und Ganzgoldschnitt, signiert Trautz-Bauzonnet.
Dies ist eines der von Cohen und De Ricci gewürdigten, wenigen wirklich herausragenden Exemplare der Ausgabe von 1718. Wie alle unsere vorhergehenden Exemplare zählt es zu der besseren
Teilaufl age auf blütenweißem papier fi n; hier haben wir jedoch den heute höchst seltenen Zustand vorliegend, daß das Papier nahezu unbeschnitten erhalten ist, vom Buchbinder nur ebarbiert (= berauft), mit zahlreichen témoins, die noch den rohen Papierrand anzeigen, trotz des nach außen vereinheitlichenden Goldschnitts. Alleine der untere unbedruckte Rand des Papiers mißt volle fünfeinhalb Zentimeter, also gut ein Drittel der Höhe des Gesamtbuchblocks.
Unser Exemplar hatte ein nicht untypisches Schicksal: Zweifelsohne stammt es aus jenem 52 Restexemplare umfassenden Bestand auf dem besseren und großen Papier in rohen Lagen, den Renouard in seinem Katalog von 1819 noch erwähnt, veräußert aus der berühmten Sammlung Chastre de Cangé de Billy, in deren Versteigerung des Jahres 1784. Um 1790 kam es in die Hände von Bozerian, dem beherrschenden Buchbinder der Zeit. Dieser band es, folgt man der kurzen Beschreibung im La Bédoyère-Katalog von 1862, in „ mar(oquin) bl(eu) à compart(iments), dent(elle), doubl(é) de moire, mors de mar(oquin) tr(anches) dor(ées)“, also einen Luxuseinband erster Güte. Das genügte aber einem der typischen Exponenten der Bibliophiles de 1875 , Adrien-Louis Lebeuf de Montgermont, nicht. Der damals gültigen Überzeugung von der Minderwertigkeit von Bozerian-Einbänden folgend, ließ er – wohl schon bald nach 1862 – den alten Einband beseitigen und von Georges Trautz, dem Bindergott jener Zeit, einen allerdings wunderschönen doublierten Einband mit reicher historisierender Vergoldung dafür schaffen (trotzdem hätten wir den früheren Band gern einmal gesehen!). Ein in jeder Hinsicht superbes Bibliophilen-Exemplar, in makellosem Zustand. Provenienz: Chastre de Cangé de Billy 1784, Nr. 598, double: 63 frs.; Bozerian; La Bédoyère, vente I, 1862, Nr. 1356: frs. d’or 260.–;
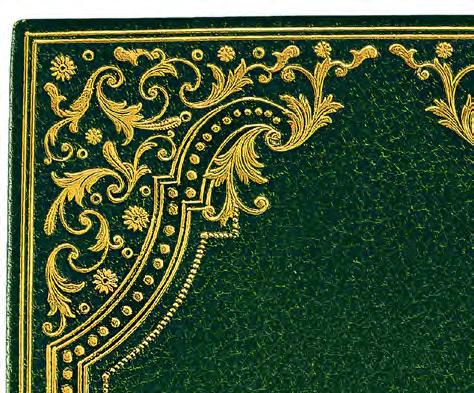

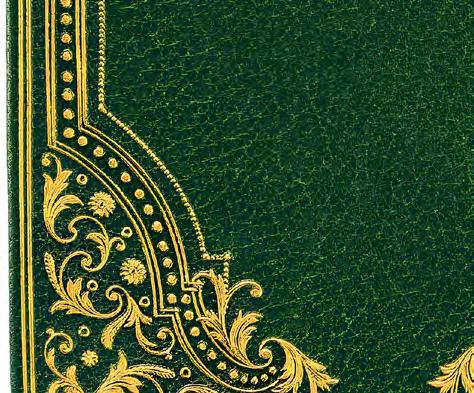


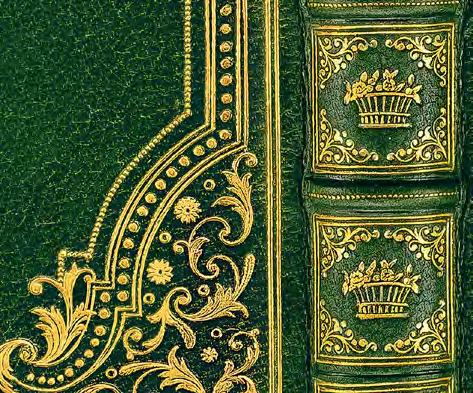
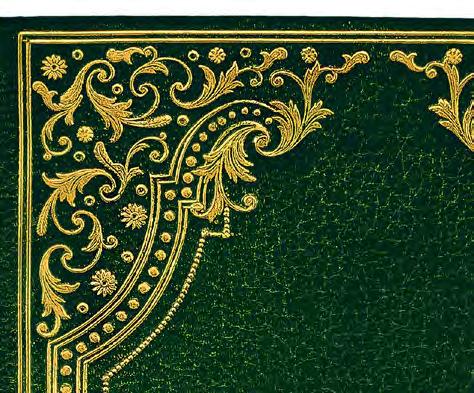

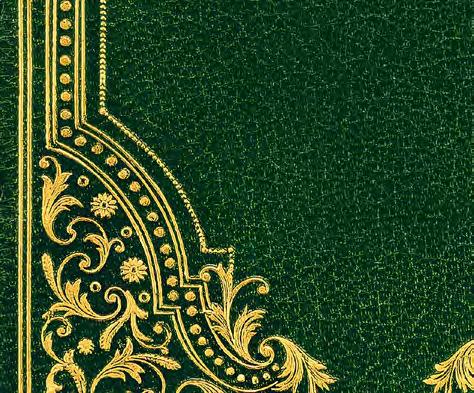
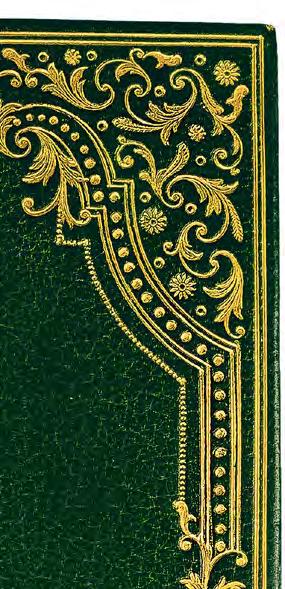
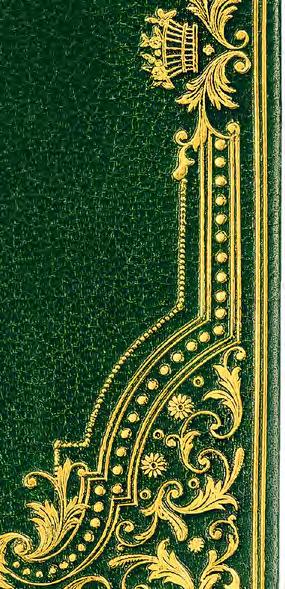
Adrien-Louis Lebeuf de Montgermont (Catalogue 1876, Nr. 640: 2.600 frs. or); Rouquette; Schweizer Privatbesitz: Adrian Flühmann.
Die Kupferstiche in frischen, gratigen, kontrastreichen Abdrucken von unverbrauchten Platten. Insbesondere auch die nicht zur Audran-Suite gehörige Darstellung der Petits pieds liegt hier in einem außergewöhnlich schönen gratigen Frühabzug vor.
Bibliographie unter unserer Nummer III . Die Erwähnung unseres Exemplars bei Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, auf Seite 651. Zu Lebeuf de Montgermont siehe J.-P. Fontaine, Les Gardiens de Bibliopolis I, 2015, S. 380–385: Es gibt zwei Brüder: Adrien-Louis, der 1876 starb und Alfred-Louis (1841–1918), dessen Auktionen 1911 bis 1913 für Aufsehen sorgten.
Das auf Gross-Quart angeränderte
Exemplar des Armand-Jérôme
Bignon, in veau fauve von Derome
VIII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroße) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Bl., 164 S. (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 .
Klein-Oktav (126 x 802 mm), allseitig angerändert auf Groß-Quart (276 x 208 mm).
Heller französischer Kalbledereinband des mittleren 18. Jahrhunderts (ca. 1760), Rücken auf fünf erhabene Bünde, die sechs Kompartimente vergoldet mit zentralem Sonnenblumen-Stempel, Titel goldgeprägt auf rotem Maroquinschildchen im zweiten Kompartiment, Deckel in dreifachem Filetenrahmen, im Zentrum beider Deckel großes Wappen-Supralibros in hochovaler Einfassung; doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, großformig gemusterte Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt, von N.-D. Derome le Jeune.
Das Exemplar ist eigentlich eine Unmöglichkeit: ein Büchlein in Klein-Oktav mit allen fast 180 Seiten so anrändern zu lassen, daß nicht nur die Faltkupfer plan eingebunden werden konnten, sondern auch ein geradezu gravitätischer, vom Format her eher noch dem 17., oder auch dem ausgehenden 18. Jahrhundert angemessener Quartband aus jenem bijou wurde!
Obwohl der Band unter den anderen Exemplaren der frühen Ausgaben derart herausfällt, hat er hier doch seine Stelle. Der Grund für diese Umarbeitung dürfte – neben dem unschätzbaren Vorteil der ungefalteten Einbindung der größeren querformatigen Kupfer natürlich – folgender sein: Was hier ursprünglich vorlag, war ein schlichtes Exemplar der „Normalausgabe“, also ein Druck auf kleinem Papier, deutlich kleiner als die anderen Exemplare der Ausgabe von 1718 in unserem Katalog. Zudem fehlten ihm offensichtlich die Tafeln. In diesem Zustand gegen 1760 vorgefunden, hat man beschlossen, das Gewöhnliche, ja Minderwertige, zum höchst Besonderen zu erheben. Beim Format hatte man dabei wohl die großen Papiere der Ausgaben von 1745–1757 im Sinn, zu dieser Zeit war das außergewöhnliche Format für bessere oder gar unikale Exemplare längst zur beliebten Möglichkeit der Veredelung geworden. Die Faltung der größeren Kupfer war zu dieser Zeit kaum noch opportun. Diese wurden, dem festen Papier, das kaum aus dem frühen 18. Jahrhundert stammen dürfte, und den recht kräftigen Plattenrändern nach zu urteilen, in der Zeit um 1760 von den originalen Druckplatten erneut in hervorragender Qualität abgezogen.
So gelang es, ein Exemplar herzustellen, das im Format mit den Vorzugsexemplaren der jüngsten Ausgaben der Zeit mithalten konnte, dazu die Kupfer der alten Suite gewissermaßen im Originalzustand enthielt – einschließlich der Petits pieds – und diese auch noch ohne Falz eingebunden. Nachdem die Ausgaben der Zeit die alte Suite in der Regel mit aufwendigen Bordüren ausstatteten, ist dies als ein editionshistorischer Rückblick zu verstehen, eine Reverenz an die ursprüngliche Regentenausgabe von 1718. Die breiten weißen Ränder verleihen den Druckseiten und der Illustration ausgesprochen großzügige Wirkung, und die Noblesse
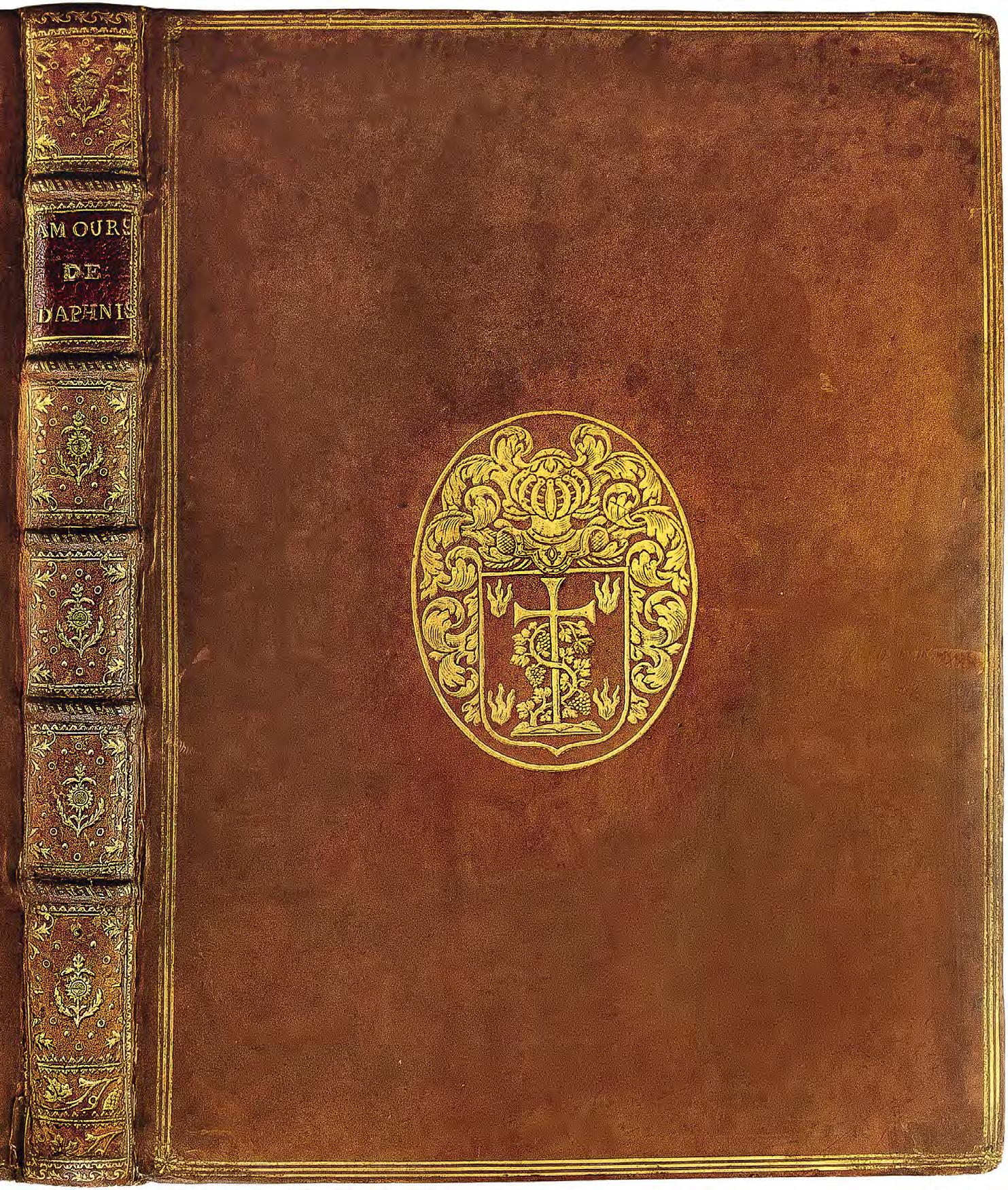
des Einbands mit dem prächtigen Supralibros verstärkt diese zusätzlich. Derome le jeune hat hier seines Amtes gewaltet und als seine „Signatur“ den bekannten Sonnenblumenstempel gesetzt, der nur ihm gehört (siehe Barber, Rothschild I, Fl 69–71; sehr ähnlich auch Roll 5 für die Innenkantenbordüre).
Provenienz: Die Frage, wer um 1760 die Möglichkeit und das historische Verständnis hatte, ein solches Exemplar herzustellen, es sogar mit den originalen Kupfern im entsprechenden Format versehen konnte, beantwortet die Identifikation des Supralibros. Es handelt sich um das Wappen der renommierten Familie Bignon, die eine Reihe der wichtigsten Bibliothekare der Bibliothèque Royale stellte: hier war dies Armand-Jérôme, geboren 1711 in Paris, ebenda gestorben 1772. Außer seinem Amt als „Bibliothécaire du Roi“, das er von 1741–1770 ausübte, bis für ihn sein Sohn nachrückte, war er Staatsrat, Kommandeur, Profoß und königlicher Zeremonienmeister, Mitglied der Académie Française und der Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Guigard (Nouveau
armorial, Bd. II , S. 61) schreibt zwar, daß alle seine Bücher in rotes Maroquin gebunden gewesen seien, aber er kann das Exemplar auch geerbt oder geschenkt bekommen haben. Für die letztere Annahme spricht, daß das Familienwappen hier in einer älteren Form vorliegt, nämlich in derjenigen seines Großonkels Jérôme II . Bignon (1627–1697), der ebenfalls königlicher Bibliothekar gewesen ist (Olivier, Manuel, Nr. 868; sein eigenes Wappensupralibros verzeichnet Olivier unter der Nummer 871). Offenbar handelte es sich also um ein Geschenk innerhalb der Familie. Die Verwendung der älteren Wappenform korrespondiert mit dem ebenfalls älteren Druck und der gesamten historischen Attitüde, die hinter der Herstellung dieses Exemplars stand. – Auf dem vorderen Spiegel ein romantischer Stahlstich, Genre Johannot, mit nicht zu entziffernder Inschrift und Datierung 1844 oder 1849.
Leichte Beschabungen auf den Deckeln, die Gelenke ein wenig brüchig, innen tadellos erhalten. – Zu den Bibliographien siehe unter unserer Nummer III .

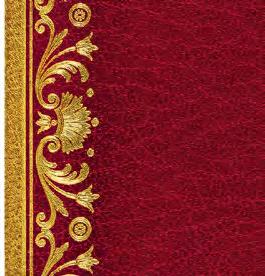
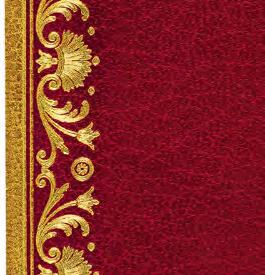





Das Exemplar der Sammlungen
Robert Hoe – Lefrançois –Miribel – Flühmann
In einem atemberaubenden
Mosaikeinband von Marius Michel
IX [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Bl., 164 S. (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: ππ2 π 4 A–K 8 L 2 („Préface“ vor Titel und „Avertissement“ eingebunden). Klein-Oktav (163 x 103 mm).
Hellbrauner französis cher Maroquineinband des späten 19. Jahrhunderts (ca. 1890) im Stil des Jacques-Antoine Derome, Rücken auf fünf erhabenen Bünden, die Kompartimente mit reicher Vergoldung und mehrfarbigen Maroquin-Mosaikauflagen, Deckel in reichster all-over-Vergoldung, MaroquinAuflagen in Form von Akanthusranken und weiteren stilisierten vegetabilen Ornamenten in Gelb, Rot, Orange, Oliv- und Dunkelgrün; doppelte Stehkantenfi leten, doubliert mit hellrotem Maroquin in breitem Bordüren-Rahmen aus stilisierten Blüten und Garben, grünen fliegenden Seidenvorsätzen, tripliert mit Marmorpapier und Ganzgoldschnitt sowie dreifarbigem Lesebändchen, signiert Marius Michel, in Leder-Steckschuber.
Dies ist ein endgültiges, an ornamentaler Zier kaum mehr überbietbares Exemplar, das die prachtliebende Bibliophilie des fi n du siècle in Orientierung an den Glanzleistungen der Buchbinderkunst des 18. Jahrhunderts, aber in durchaus eigener schöpferischer Fortentwicklung, geschaff en hat. Der mosaizierte Einband ist von solcher Schönheit wie Komplexität, daß es Marius Michel hier gelingt, dem alten Vorbild ein ebenfalls vollendetes Meisterwerk an die Seite zu stellen, das in diesem Vergleich bestehen kann – sicherlich einer der beachtlichsten Einbände kleineren Formats, den die französische Buchbinderkunst des späten 19. Jahrhunderts im historisierenden Stil hervorgebracht hat. Der Einband orientiert sich an Vorbildern des Jacques-Antoine Derome (auch genannt „Derome Père“), man vergleiche bei Michon die Tafeln XXVII-XXXIII , vor allem den nahezu identischen Einband zu Tutti i trionfi aus der MacCarthyJames de Rothschild-Sammlung (Michon, Les reliures mosaïquées, Tafel XXVII; Picot, Catalogue Rothschild 1884, Bd. I, Nr. 1028, mit Abb. des Derome-Etiketts).
Marius Michel (eigentlich Henri-François-Victor Michel, 1846–1925) gehörte zu den bedeutendsten Buchbindern im Frankreich des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der auch in neueren Formen, beeinfl ußt vom Jugendstil, gearbeitet hat. Mit diesem Einband, dessen unmittelbares Vorbild er in seinem eigenen Werk über die französische Einbandkunst 1880 publiziert hatte (Michel, La reliure française, die Tafel 18 mit Deromes Einband zu Tutti i trionfi von 1559), schuf Michel geradezu eine Hommage an den älteren Meister. Das Exemplar ist von denkwürdiger Provenienz: Die erste greifbare ist die unvergleichliche Sammlung von Robert Hoe, dem bedeutendsten ame-
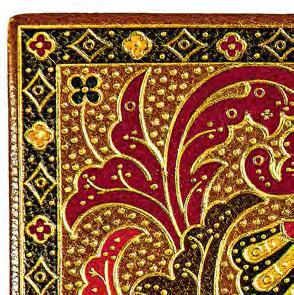
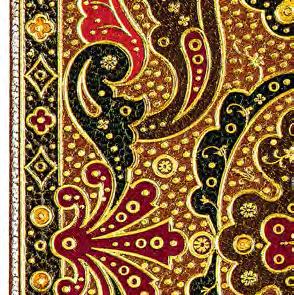
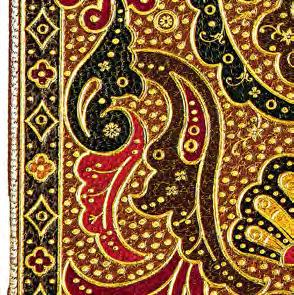





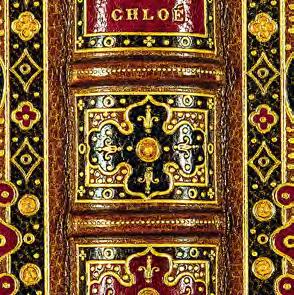
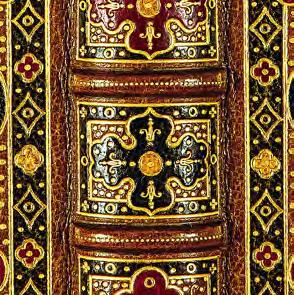
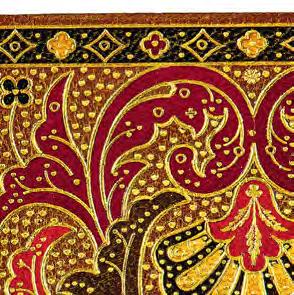


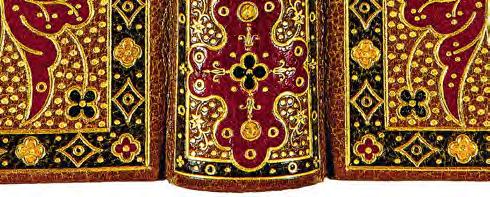
rikanischen Büchersammler überhaupt. Neben seinem Exlibris belegt auch der Eintrag im Privatkatalog den Besitz des Bandes (Hoe, Privatkatalog, 1903–1909, Bd. III: Books printed in foreign languages after 1600, Nr. 137) sowie der Versteigerungskatalog seiner Bibliothek (Catalogue of the Library of Robert Hoe 1911/12, Tl. II , 1912, Nr. 253: $ 450.–, mit der Bemerkung „large paper“). Danach war das Exemplar im Besitz von Francisque Lefrançois, dem Nachfolger Edouard Rahirs (Catalogue Nr. 21, 1939, Nr. 45: frs. 17.500.–, mit Abbildung auf einer Tafel),

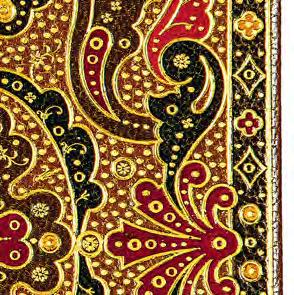
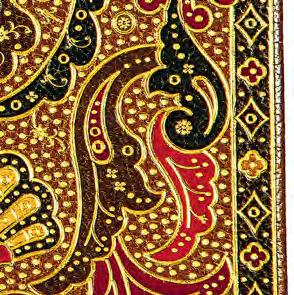

später in der Sammlung G. de Miribel, versteigert in der Pariser Auktion vom 4. 6. 1993: Vente Miribel 1993, Nr. 72: 48.000 frs. plus Aufgeld; zuletzt in der Sammlung A. Flühmann.
Aus der kleinen, auf großem und besserem papier fi n gedruckten Teilaufl age stammend, ist das Exemplar überaus breitrandig, nahe am unbeschnittenen Zustand, fast fl eckenlos, mit allen Kupferstichen, auch der Conclusion du Roman , in frischen, kräftigen, gratigen und sauberen Abdrucken.
Bibliographie siehe unter unserer Nummer III .
Von Cohen zitiertes, nahezu unbeschnittenes Exemplar aus den Sammlungen Caillard und Graf Lignerolles, in einem Einband von Bradel
X [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Blätter, 164 Seiten (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . Klein-Oktav (166 x 107 mm).
Nachtblauer französischer Maroquineinband um 1785 auf glattem Rücken zu sechs Kompartimenten in Kastenvergoldung und zentralem hochovalen Medaillonstempel, goldgeprägtem Titel im zweiten von oben, Deckel mit breiter Rahmenbordüre aus einer von Fleurs-de-lis und doppelten Fileten eingefaßten girlandenartigen Rolle aus Ähren- und Perlensträngen, die sich in einer Blüte kreuzen (vgl. Barber, Rothschild, Roll 105 und W.Cat. 194); Stehund Innenkantenvergoldung, doubliert mit roséfarbenem Tabis und den entsprechenden fliegenden Vorsätzen sowie Ganzgoldschnitt, auf dem Vorsatz das Etikett von Alexis-Pierre Bradel .
Ein vorzügliches Exemplar in einem von maßvoller Eleganz geprägten Meistereinband. Die späte, dem Zeitgeschmack des Louis-seize entsprechende
Bindung dokumentiert die besondere Geschichte eines Teils der Auflage der 1718 gedruckten Ausgabe. Unser Exemplar gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zu den 52 ungebundenen und unbeschnittenen Exemplaren, die 1784 auf der Auktion von Chastre de Cangé de Billy verkauft wurden. Dessen Vater, Jean-Pierre-Gilbert Imbert Chastre (ca. 1680–1746), der erster Kammerdiener des Dauphin war, erbte die übriggebliebenen Exemplare der Ausgabe von 1718, und zwar die besseren, auf großem papier fin – und hinterließ sie wiederum seinem Sohn.
Im Auftrag des Diplomaten, Lavater-Übersetzers und großen Bibliophilen des 18. Jahrhunderts, Antoine-Bernard Caillard (1737–1807), wurde dieses Exemplar von Bradel meisterhaft sur brochure mit einigen témoins gebunden – unter Erhalt der fast vollen Blattgröße. Der Einband ist ein besonders schönes und typisches Werk Bradels, doch ist das dekorative Hauptmotiv, die Bordüre aus geflochtenen Halmen und Perlensträngen, eine charakteristische Ornamentform der Zeit um 1770–90, bereits auf Einbänden von Derome le Jeune zu finden: im Katalog von Mortimer L. Schiff sind gleich fünf davon verzeichnet (Schiff Collection, Bd. I, Nrn. 45, 60, 63, 64 und 65). Bradel hat den Stempel von Derome offensichtlich in sein Formenrepertoire übernommen.
Provenienz: Aus der Bibliothek des Antoine Bernard Caillard, der dieses Exemplar wohl 1784 auf der Auktion von Chastre de Cangé de Billy gekauft hat (1810 wurde es unter der Nummer 1552 auf der vente von Caillards Bibliothek in Paris für 73,– Goldfrancs versteigert). Erst im Jahr 1894 taucht das Exemplar wieder in der Auktion des Grafen Lignerolles (Catalogue Lignerolles 1894/95, zweiter Teil, Nr. 1745) auf, wo es für 1200,– Goldfrancs verkauft wurde.
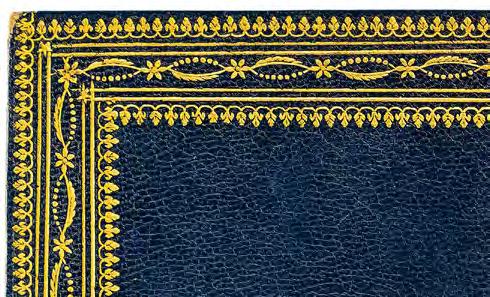
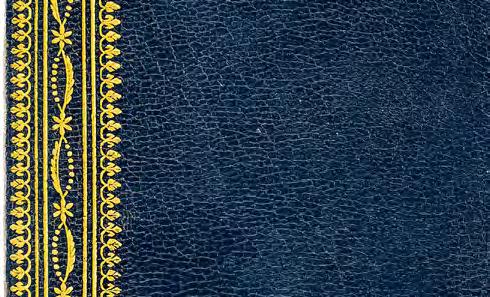
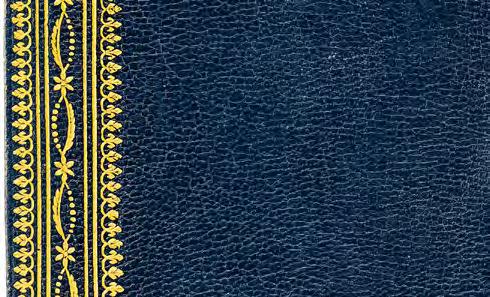

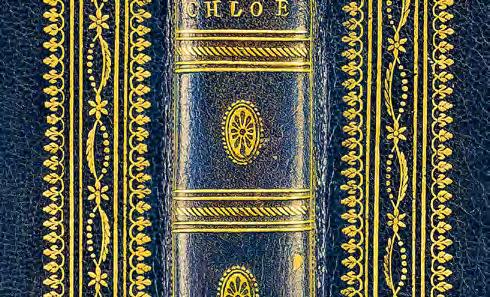
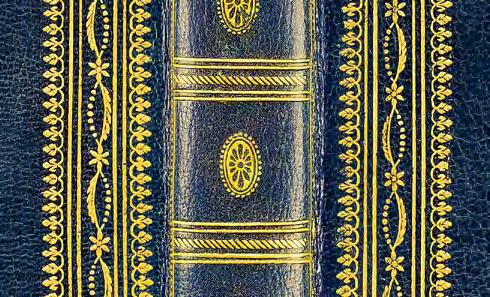

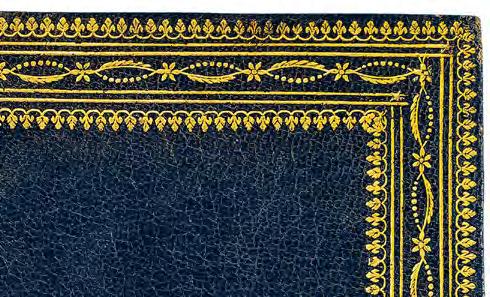
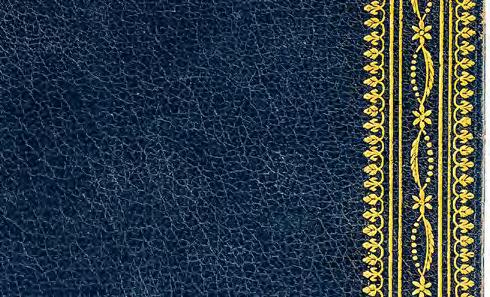
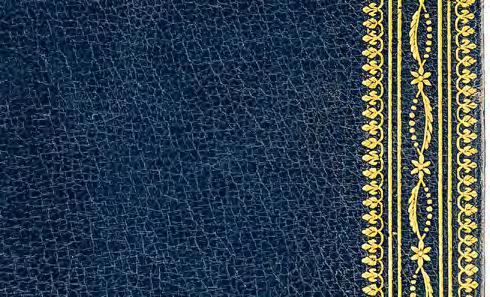


Wenn man vom lediglich minimal geblaßten Rükken absieht, befi ndet sich das Exemplar in einem exzellenten Zustand. Das merklich feste Papier ist makellos erhalten, und, wie es bei den Exemplaren auf dem besseren Paptier gewöhnlich der Fall zu sein scheint, sind auch die Kupferstiche von noch
unverbrauchten Platten angefertigt worden und liegen in entsprechender Qualität vor.
Für die bibliographischen Referenzen vergleiche man unsere Nummer III; das vorliegende Exemplar ist bei Cohen/De Ricci auf Seite 651 zitiert.
Das Exemplar der Sammlungen Paillet – Hoe – Salomons in einer buchbinderischen „tour de force“ von Cuzin
XI [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans, einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Blätter, 164 Seiten (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . Klein-Oktav (163 x 101 mm).
Zitronenfarbener französischer Maroquineinband des späten 19. Jahrhunderts (ca. 1885–90), Rü kken auf fünf erhabenen Bünden mit MaroquinAuflagen, blauem Maroquin-Rückenschild mit Titel-Goldprägung in dreifacher Kastenrahmung im zweiten Kompartiment von oben, Deckel überzogen mit einem All-over-Muster aus reichster Vergoldung und verschiedenfarbigen Maroquinauflagen in Form von Vierpässen mit Rundungen und Spitzen, diese ihrerseits mit pointillé-vergoldeten Floralornamenten verziert; Steh- und Innenkantenvergoldung mit Zickzack- und Dent-de-rat-Leisten, doubliert in königsblauem Maroquin mit reichster Rokoko-Dentellevergoldung samtschwarzen Maroquin-Intarsien im Binnenfeld, fliegende Vorsätze mit Blattgold (!) belegt und Ganzgoldschnitt, signiert Cuzin, in rotbrauner Maroquin-Schatulle.
Dies ist ein Exemplar, dem man in jeder Hinsicht Vollkommenheit attestieren darf, verbindet sich in ihm doch ein bestens erhaltenes illustriertes Werk des 18. Jahrhunderts mit höchster Buchbinderkunst des neunzehnten. Fast schon wie selbstverständlich ist das Papier in anmutigem Elfenbeinton flekkenfrei und hell und die Kupferstiche sind von höchst ansprechender, frischer Qualität, wie sie allein frühesten Abzügen eigen ist. Doch der Einband Cuzins – des handwerklich wie künstlerisch größten Schöpfers unter den bedeutenden französischen Buchbindern seiner Zeit – fügt der Perle erst ihre prunkvolle, feinst und virtuos gearbeitete Fassung hinzu. Eugène Paillet hat dieses Prachtexemplar als erster entgegennehmen dürfen, und es muß auch für jeden seiner Nachfolger eine Ehre gewesen sein, dieses Buch zu besitzen. Im Katalog der Sammlung Paillet, Bibliothèque d’un Bibliophile 1865–1885, den Henri Beraldi verfasst hat, finden wir das Exemplar übrigens noch nicht, weshalb der Einband zwischen 1885 und 1890 zu datieren ist, also ein Spätwerk des großen Meisters sein muß; allerdings besaß Paillet ein Exemplar einer Sedez-Longus-Ausgabe von 1798, das Cuzin in rotes Maroquin gebunden hat (Nr. 402). Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine immer noch, und in vielerlei Hinsicht zu Unrecht, despektierlich angesehene Epoche, hat auf dem Gebiet des Bucheinbandes ganz besondere Leistungen hervorgebracht, gerade in der Auseinandersetzung mit den großen Vorbildern aus dem 18. Jahrhundert. Wir haben hier eines der überragenden Beispiele für eine derartige konsequente historistische Ausrichtung vorliegen. Das unverkennbare Vorbild, der Mosaikeinband im „décor à répétition“, also jener Form, in der Padeloup
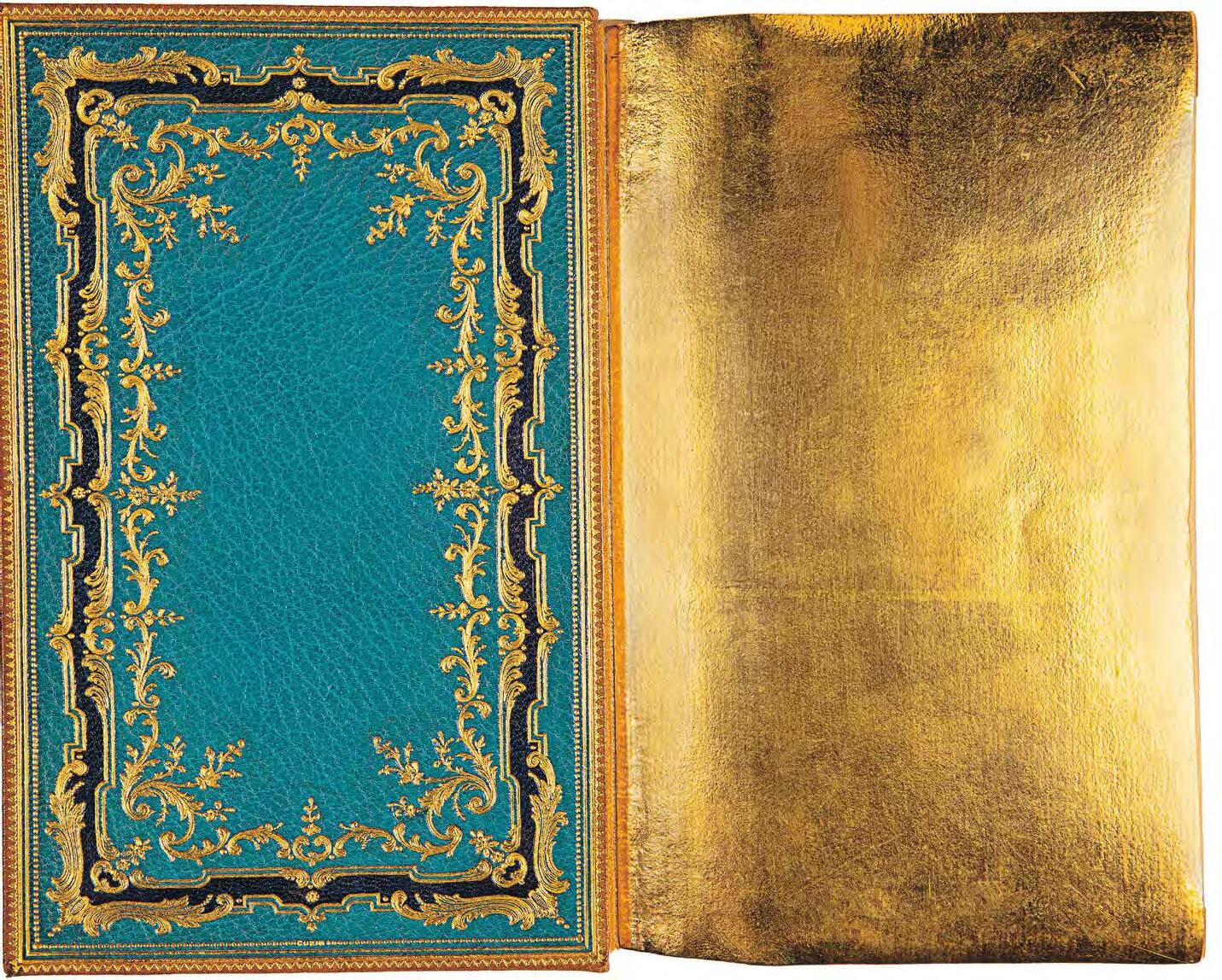
der Jüngere Arbeiten höchsten schöpferischen Anspruchs geschaffen hat, wird auf der einen Seite bis ins kleinste Detail nachempfunden – wir vermuten sogar, daß ein Exemplar der Sammlung Ferdinand de Rothschild (Les offices de la Toussaint, Paris 1720; Barber, Rothschild, W.Cat. 572) unmittelbar Pate gestanden haben könnte, auch dieses übrigens in einer braunen Maroquin-Schatulle des 19. Jahrhunderts – auf der anderen Seite wird hier versucht, den alten Meister durch das Raffinement
höchst ausgereifter Mittel in technischer Hinsicht noch zu übertreffen. Handwerkliches
Können auf seinem Zenith tritt der künstlerischen Idee ebenbürtig an die Seite, ein erlesenes Werk zu erschaffen. Man soll und kann nur staunen, wenn man dieses prachtvolle Buch in Händen hält. Von außen wie das Schmuckkästchen eines kunstfertigen Goldschmieds erscheinend, eröffnet sich dem Betrachter im Inneren schon auf den Doublüren feinstes Louis-quinze-Ornament, an einen Plafond
eines vornehmen Pariser Adelspalais erinnernd. Doch als wäre die Eleganz der Zierformen allein nicht genug, wird auch noch eine schwarze Maroquinintarsie in das Binnenfeld zwischen die feinen und höchst unregelmäßigen Formen eingepaßt, künstlerisch zur Kontrastierung des Goldglanzes dienend, aber im eigentlichen Sinne die stolze eigentliche Signatur des Buchbinder-Virtuosen, der hierin alle Register zieht. Die mit echtem Blattgold belegten Vorsätze fügen dem noch eine nimbusartige Aura des überzeitlich Kostbaren hinzu – wir sind hier in einer Zeit, die der Sucht nach Prachtentfaltung, Raffinement und künstlerischer Delikatesse dem Ancien Régime in nichts nachsteht, im Gegenteil, die sogar zu nochmaliger Steigerung ansetzt.
Provenienz: Der einmalige Einband wurde von Francisque Cuzin (1836–1890) offensichtlich für Eugène Paillet gefertigt, das unerreichte Vorbild aller Sammler der Illustrata des 18. Jahrhunderts; jedenfalls findet es sich in Paillets zweiter Auktion 1902, (Catalogue vente Paillet, Tl. II , 1902, Nr. 125: 5.100.– frs. d’or). Damals ging es an den noch bedeutenderen Sammler Robert Hoe, auf dessen Versteigerung in Tl. I, 1911, es unter der Nr. 2073 925.– Dollar brachte, den Durchschnittspreis eines schönen, reich illustrierten Stundenbuch-Manuskripts. Auf dieser Auktion
erwarb es der englische Sammler Sir David Salomons, dessen Exlibris sich samt Katalog-Eintrag (£ 240.–) auf den Vorsätzen findet. In Salomons’ privatem Katalog der Broomhill Library ist das Buch („Erotic“) unter Nr. 3141 verzeichnet; auf der Salomons-Auktion bei Christie’s, 1986, war es die Nr. 88 (£ 6.480.– an Fleury).
Die Kupferstichfolge der Suite du Régent liegt hier in wunderbar kontrastreichen und sauberen Abdrucken auf großem papier fin vor. Aus puristischen Gründen mag man die spätere, nicht zur Ausgabe gehörige Conclusion du Roman genannte Kupfertafel des Comte de Caylus, die sonst eigentlich allen Exemplaren auf besserem Papier beigebunden worden ist, absichtlich entfernt haben. – Auf dem Vorsatz montierter Katalogausschnitt von Salomons 1916. – Von hervorragender, impeccabler Gesamterhaltung.
Literatur: Cohen-De Ricci, Sp. 651) zitieren das nahezu identisch gebundene Exemplar der Sammlung Daguin (Teil II , 1904, Nr. 522: 4.020,–frs.), das später bei Mortimer Schiff war, Sale III , 1938, Nr. 1967, mit Abbildung des Rückens auf Tafel 93. Zu den weiteren bibliographischen Referenzen siehe unsere Nummer III . – Als exemplarisch für das Schaffen Cuzins abgebildet ist unser Einband bei Fléty, Tafel XIV.
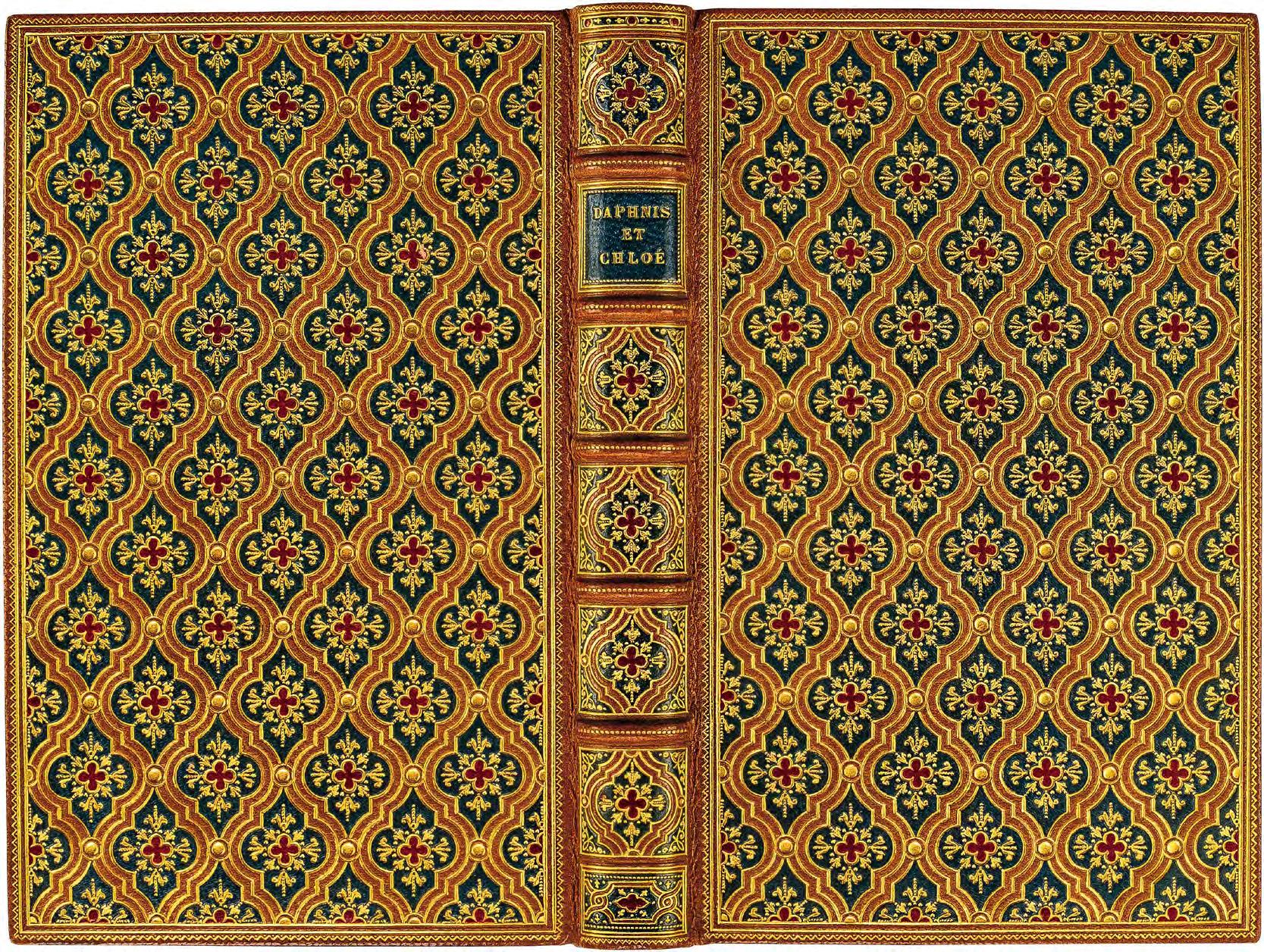
Exemplar in sehr hübschem Rokoko-Einband mit üppiger Dentelle-Bordüre und bukolischen Motiven
XII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Blätter, 164 Seiten (Titel, „Avertissement“, „Pré face“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . Klein-Oktav (158 x 102 mm).
Rotbrauner französischer Maroquineinband der Mitte des 18. Jahrhunderts (wohl um 1750/60), glatter Rücken zu sechs Kompartimenten mit Kastenvergoldung, im zweiten davon der Titel auf olivgrünem Maroquinschildchen, die anderen mit einem Blütenstempel, umgeben von feinen rankenartigen Einzelstempeln, kleinen Ringen und Punkten, Deckel in Umrahmung aus zwei Fileten und äußerer Dent-de-rat-Leiste sowie sehr breiter goldgeprägter Dentellebordüre aus Einzelstempeln, in den Ecken bukolische Motive: schnäbelnde Tauben über Köcher, mit Pfeilen Amors und einer Fackel, dazu je zwei Blütenkränze; Stehkantenfilete und reiche ondulierende Blütengirlande für die Innenkantenvergoldung, feste und fliegende Vorsätze in coelinblauer gewässerter Seide doubliert, Ganzgoldschnitt, wohl von L.-F. Lemonnier.
Ein in jeder Hinsicht mustergültiges Exemplar der berühmten Ausgabe von 1718 in einem reizvollen, sehr prächtigen, motivisch reichen Dentelle-Einband aus der Zeit Ludwigs XV., auf dem besseren und großen Papier gedruckt, mit hervorragenden, frischen Abzügen der Kupfer, nahezu fleckenlos und einwandfrei erhalten. Die Gestaltungsart der schönen Bordüren der Einbanddeckel läßt an den großen Buchbinder des mittleren 18. Jahrhunderts, Louis François Lemonnier, gestorben 1776, denken – man vergleiche etwa den Einband unseres Télémaque, das Exemplar des Duc de Chartres. Ähnliche Formen finden sich jedoch auch im Schaffen von Louis Douceur und NicolasDenis Derome – erkennbar etwa anhand der höchst charakteristischen Ornamentform einer Leiste mit runden und spitzen Elementen im Wechsel, entstanden durch zwei sich überschneidende Halbkreise, hier gleich doppelt am unteren Abschluß des Rückens eingesetzt, ein Motiv Deromes, das später auch noch sein Nachfolger Bradel verwendet hat (Barber, Rothschild, Pal 48, und W.Cat. 371).
Das Exemplar ist ein sehr schönes Beispiel für das harmonische Zusammenspiel eines bedeutenden illustrierten Drucks aus der Régence mit einem feinen Rokoko-Einband, der als Reliure parlante durch seine Motivik schnäbelnder Tauben in Verbindung mit bukolischen Symbolen die Geschichte und ihre Illustration in delikater Weise aufgreift.
Provenienz: Keinerlei Spuren der Vorbesitzer; auch durch die oft unspezifische Art der Beschreibung in den Katalogen des 18. und 19. Jahrhunderts in keinem davon auszumachen – zuletzt in einer französischen Privatsammlung.
Alle bibliographischen Referenzen bei unserer Nummer III .
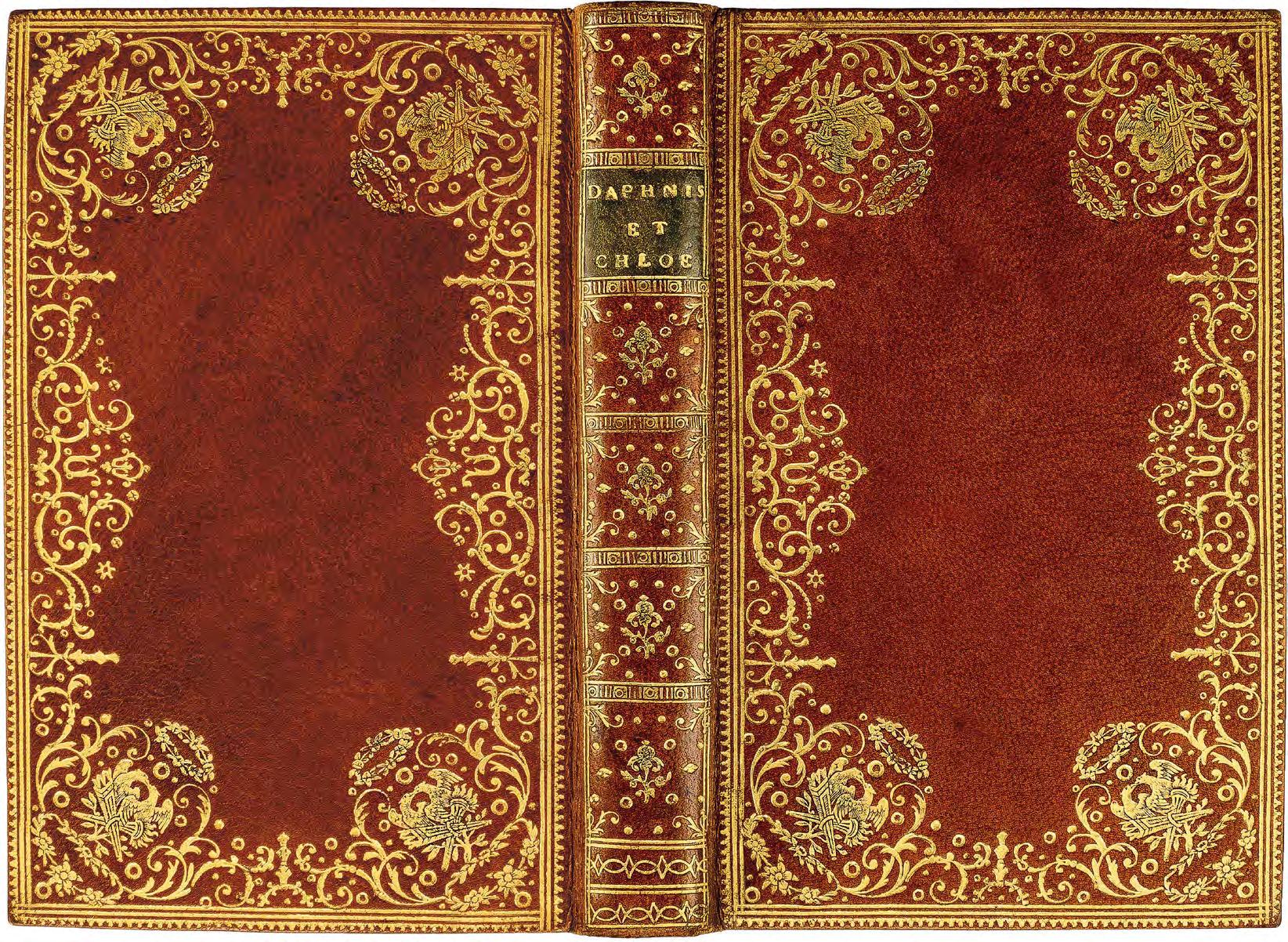
Das unvergleichliche Exemplar der Sammlungen
Delbergue-Cormont – Henri Bordes – Mme Porgès, zitiert von Cohen
XIII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Blätter, 164 Seiten (Titel, „Avertissement“, „Pré face“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . Klein-Oktav (162 x 101 mm).
Roter französischer Maroquineinband des späten 18. Jahrhunderts (ca. 1784/85), der Rücken auf fünf erhabenen Bünden, reichste Vergoldung in den Kompartimenten mit Lyra-Einzelstempeln, zu denen sich entflammte Herzen gesellen, im zweiten von oben olivgrünes Maroquin-Titelschild, die Deckel mit intrikater, sehr elaborierter Dentelle-Bordüre in Gold à fond pointillé d’or und besonderen Einzelstempeln: doppelte Herzen, vom Pfeil durchbohrt, unter einem Kranz, einzelne Herzen, zwei Hände im Freundschaftsbund, Lyren usw.; Stehkantenfilete, breite Innenkantenvergoldung aus stilisierten Blütengirlanden, Vorsätze bezogen mit hellblauer gewässerter Seide, Ganzgoldschnitt, von Derome le Jeune, in Halbleder-Schuber.
Das überragende Exemplar gehört zu einer kleinen Serie von exquisiten Einbänden, die der große Buchbinder Nicolas-Denis Derome (1731–1790) für die Restauflage der Regentenausgabe um 1784/85 herum in Varianten, aber stilistisch mit nur geringen Abweichungen, geschaffen hat. Sie stammen sämtlich aus jenem Bestand der Ausgabe von 1718, der in der Auktion des Chastre de Cangé de Billy 1784 veräußert worden ist. Derome erreicht hier den Gipfel der Meisterschaft im Vergolden mit graziösen Emblem-Einzelstempeln. Die bekannten Exemplare dieser Serie (wir geben unten den Versuch eines Zensus’) werden auch heute noch geradezu in Gold aufgewogen, siehe das – weder so grandios erhaltene noch mit so vielen Stempeln verzierte – Exemplar der Sammlung Michel Wittock, das auf der Auktion des Jahres 2004 immerhin € 37.600.– kostete (die Nr. 139 im zweiten Teil). Unter diesen zu den beachtlichsten Leistungen des ganzen französischen Buchbinderhandwerks zählenden Prachteinbänden, von denen wir 16 Exemplare ausfindig machen konnten, gehört unserer zu den am schönsten und feinsten ausgearbeiteten. In ihm manifestiert sich das unerhörte Können Deromes und die ganze Raffinesse der Buchbinderkunst im spätesten Rokoko, motivisch inspiriert von der in der Zeit so beliebten Hirtenthematik. – Makellos erhalten.
Provenienz: Aus der Bibliothek des Maître Delbergue-Cormont, versteigert in Paris, 9.–11. April 1883 (Nr. 165, für 1.080.– Goldfrancs, ursprünglich bei der Librairie Rouquette für 2.400.–Goldfrancs erworben); gekauft von dem großen Marchand-Amateur Henri Bordes, der es 1897 für 1.660.– Goldfrancs wieder veräußerte (Catalogue Bordes 1897, Nr. 50; sein rotes, für diesen
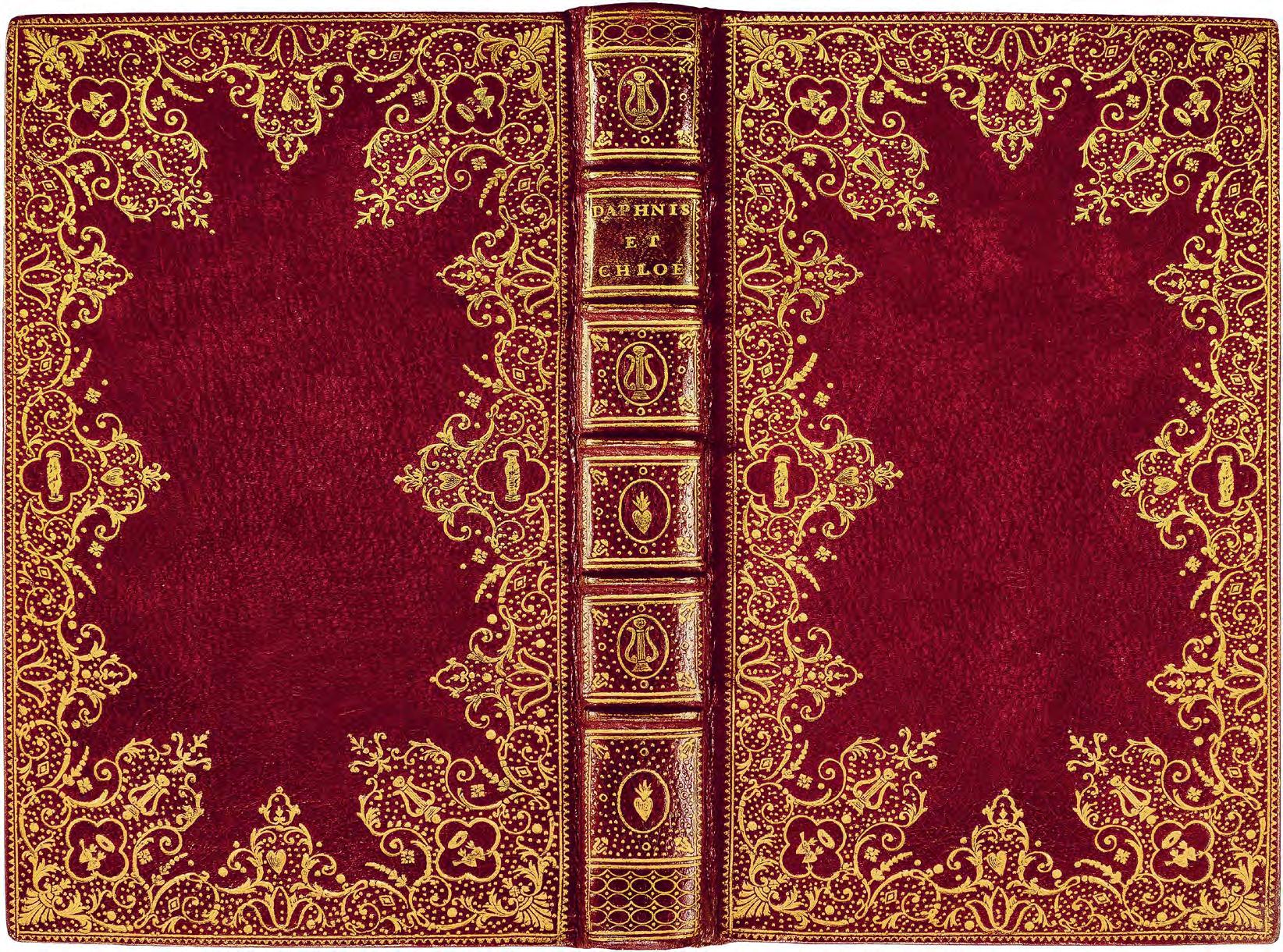

Einband wie geschaffenes, vergoldetes MaroquinEx libris auf dem vorderen Vorsatz). Damals wird es die legendäre Madame Porgès, geborene RoseAnne Wodianer (1854–1937), die aus Wien stammende Gattin des berühmten Sammlers Jules Porgès, erworben haben, da es in ihrem Privatkatalog von 1906 unter der Nr. 245, abgebildet auf Tafel 32, auftaucht. Danach war es in verschiedenen französischen Privatbibliotheken.
Bibliographische Referenzen wie bei unserer Nummer III; Cohen und De Ricci zitieren dieses Exemplar (Seite 650).
Zensus der uns bekannt gewordenen Exemplare der Ausgabe von 1718 in vergleichbaren DeromeEinbänden um 1784–85:
1) H. Tenschert, rotes Maroquin (diese Nr. XIII)
2) H. Tenschert, apfelgrünes Maroquin, Exemplar De Bure-Portalis-Danyau-Roederer-HirschWeiller (unsere Nr. XIV)
3) Rotes Maroquin, Exemplar Brunet-GrésyMercier-Mosbourg-Montgermont-Rahir-P. MayG. Hupin-M. Wittock
4) Rotes Maroquin, Exemplar Mortimer SchiffAbraham Simon Wolf Rosenbach
5) Rotes Maroquin, Exemplar Guyot de VilleneuveEsmerian-de Marre
6) Rotes Maroquin, Exemplar Lazard (1967, 41)
7) Rotes Maroquin, Exemplar S. Guggenheim (1993)
8) Rotes Maroquin, Exemplar Descamps-Scrive (1925, 177)
9) Rotes Maroquin, Exemplar Scaniecki (1974)
10) Rotes Maroquin, Exemplar Pearson (III , 1916)
11) Rotes Maroquin, Exemplar Zierer (1963)
12) Rotes Maroquin, Exemplar Hurn Court (1950, I, 84)
13) Rotes Maroquin, Exemplar Bonnasse (vente Alde 2008, Nr. 68)
14) Rotes Maroquin, Exemplar Güttler-Fürstenberg-Schäfer (Bibliothek Otto Schäfer – Europäische Einbandkunst, 1992, Nr. 108, hier Padeloup zugeschrieben)
15) Rotes Maroquin mit kleinen grünen Auflagen, Exemplar P. Sourget (Cat. XIII , Nr. 137)
16) Rotes Maroquin, Exemplar Lardanchet (Katalog 1/2017, Nr. 22).
17) Rotes Maroquin, Exemplar Ferdinand de Rothschild (W. Cat. II , Nr. 451, Abb. S. 790)
Das von Cohen zitierte Exemplar aus den Sammlungen
De bure – Portalis – Danyau –
Roederer – Hirsch – Weiller in fulminantem grünen Maroquin von Derome Le Jeune
XIV [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Wohl Paris, Imprimerie Royale,] 1718.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur), einer gestochenen Kopfvignette von J. B. Scotin und sechs gestochenen Initialen, ca. fünf Zeilen hoch.
6 Bl., 164 Seiten (Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π4 ππ 2 A–K 8 L 2 . Klein-Oktav (160 x 100 mm).
Apfelgrüner französischer Maroquineinband des späten 18. Jahrhunderts (um 1785) auf glattem Rücken zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben der goldgeprägte Titel auf einem dunkelroten Maroquinrückenschild, die übrigen gefüllt mit Punkten und Sternen, im Zentrum jedes Kompartiments das in ein Medaillon eingerahmte entflammte Herz, Deckel mit breiter Dentelle-Vergoldung à fond pointillé d’or, darin kleine und größere entflammte Herzen sowie zwei von einem Lorbeerkranz umschlossene schnäbelnde Vögel, das feingliedrige Rankenwerk schließt sich in den Ecken jeweils in einer kleinen Palmette zusammen; Stehkanten mit Perlstabbordüre, Innenkantenvergoldung als florale Bordüre, lachsfarbene Tabisvorsätze sowie Ganzgoldschnitt von Derome le Jeune.
Unser zweites jener berühmten, mindestens 16 von Derome le Jeune überaus prachtvoll gebundenen Exemplare, der aus der Auktion des Chastre de Cangé de Billy stammenden Teilauflage auf großem und besserem Papier, 1784 in rohen Lagen versteigert. Sehr schön zeigt sich beim genauen Vergleich der Formen, daß Derome seine Einbände selbst im Fall exakt übereinstimmender Aufgabenstellung keineswegs in Serie produziert hat, sondern jedem Exemplar mittels individueller Einzelstempel sein ganz eigenes Gepräge, seine unterscheidbare Charakteristik, verliehen hat. Jeder Käufer sollte sein unikales Bravourstück erhalten, das sich von den anderen Einbänden unterscheidet, nicht zuletzt auch durch seine Farbigkeit. Von den uns bekannten 16 Exemplaren wurde lediglich dieses eine in das erlesene maroquin vert pomme gebunden, eine Farbe, die im Zusammenspiel mit der Vergoldung eine ausgesprochen edle Wirkung ausstrahlt. Zuerst nachzuweisen ist es bei dem Pariser Sammler und Antiquar Jean-Jacques de Bure, im Verkaufskatalog seiner Bibliothek von 1853. Zur Bestimmung nach den verwendeten Stempeln beachte man insbesondere die unverwechselbare Ornamentform einer Leiste mit runden und spitzen Elementen im Wechsel, entstanden durch zwei sich überschneidende Halbkreise, hier am unteren Abschluß des Rückens eingesetzt. Dies ist ein Motiv Deromes, das später auch noch sein Nachfolger Bradel verwendet hat (Barber, Rothschild, Pal 48 und W.Cat. 371).
Provenienz: Eines der 52 Exemplare von Chastre de Cangé de Billy, die 1784 versteigert wurden. Bei de Bure findet es sich 1853 mit der Bemerkung „Très bel exemplaire relié par Derome“ (Catalogue de Bure 1853, Nr. 834). Auf einer der Auktionen der Bibliothek des Barons Portalis erzielte es am 30.11.1878, 1.380.– Goldfrancs, Nr. 80); später im Besitz von Georges Danyau,
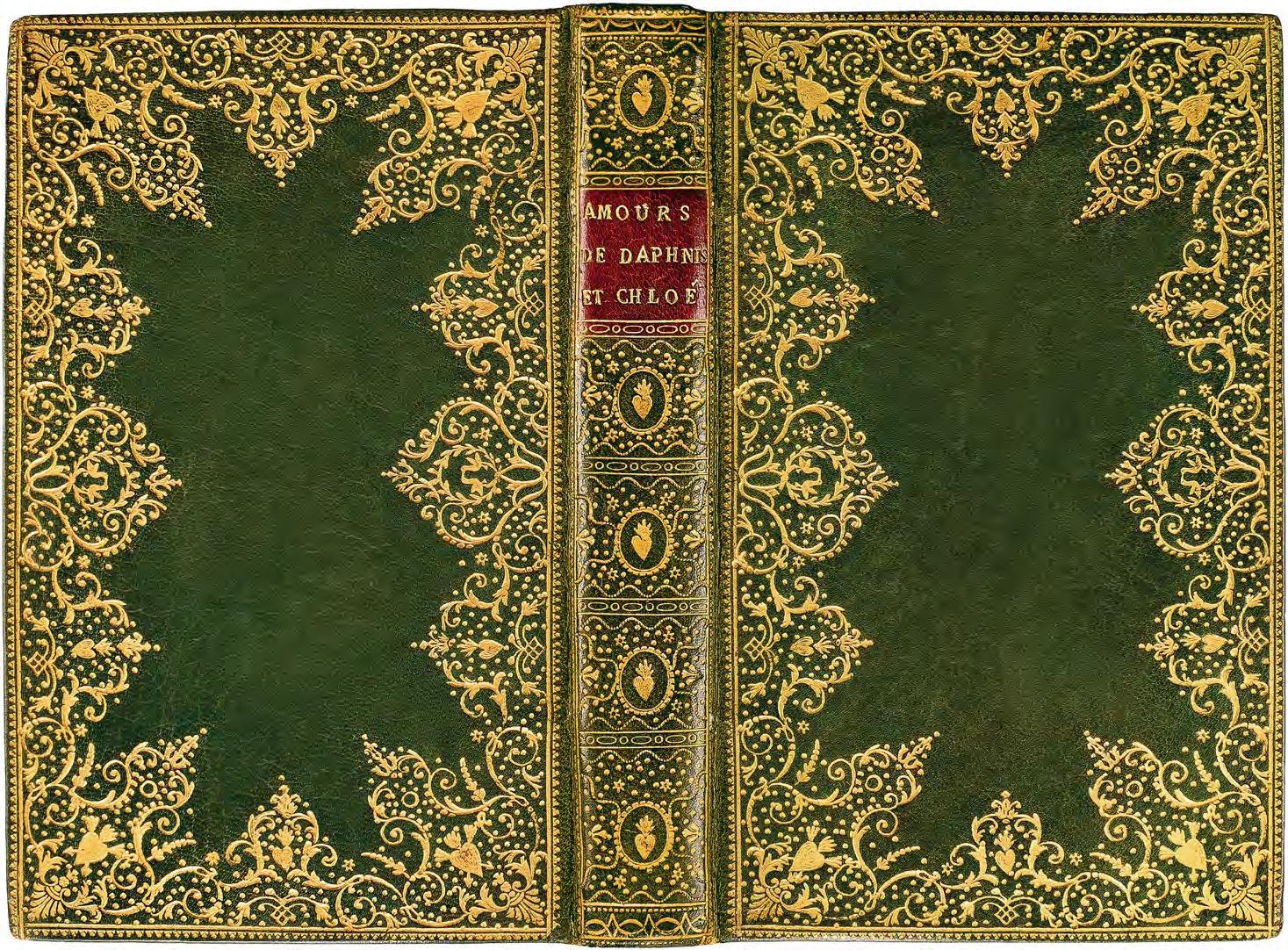
Louis Roederer, Dr. Rosenbach und Robert von Hirsch (in der Auktion Nr. 10 von Nicolas Rauch, 1. Dezember 1954, die Nr. 56: sfr. 8.000,– plus Aufgeld); zuletzt bei Paul Louis Weiller auf der Auktion am 8. April 2011 (Kat. IV, Nr. 688: € 10.500,–). Aus französischem Privatbesitz erworben.
Auch wenn die ungebundene Lagerung des 18. Jahrhunderts am unteren, damals offenbar über
längere Zeit ungeschützt offenliegenden Rand des Blattes A1 eine Spur mit leichter Dunkelung und einzelnen Flecken hinterlassen hat, ist das Exemplar nicht zuletzt aufgrund dieses besonderen Papiers, von wenigen minimalen Fleckchen abgesehen, tadellos erhalten.
Die bibliographischen Referenzen wie bei unserer Nummer III; Cohen und De Ricci, Seite 651, zitieren unser Exemplar.
Die höchst seltene 1724 erschienene Separat-Ausgabe der Suite von 1718
XV Estampes des amours pastorales de Daphnis et Chloé [de Longus] gravées en 1718. et mises aujour en 1724. par Charles Coypel Ecuyer. peintre du Roy, directeur des Tableaux et des dessins du cabinet de sa Majesté, et pr. Peintre de S. A. S. Monseigneur le Duc Dorleans.
Gestochener Titel der Neuausgabe, datiert 1724, gestochener Titel der Ausgabe 1718 von B. Audran nach A. Coypel und 26 Kupfertafeln von B. Audran nach dem Regenten Philippe d’Orléans (davon 12 querrechteckige in größerem Format; ohne die beiden in der Druckausgabe von 1718 erschienenen Tafeln zu den Seiten 95 und 97).
Quart (191 x 138 mm).
Halbledereinband des späten 19. Jahrhunderts auf fünf falschen Bünden mit rotem vergoldeten Rückenschild, Deckel mit farbig passendem Kleisterpapierbezug, gesprenkelter Schnitt.
Die wohl einzige Separatausgabe der Tafelfolge mit einem eigens dafür geschaffenen Titel, die sich dadurch erklärt, daß der Sohn des Antoine Coypel, Charles-Antoine (1694–1752), die Kupferplatten in seinem Besitz hatte und nach dem Tod seines Vaters (1722) und des Regenten (1723) als separate Suite veröffentlichte. Das Titelblatt, das nur die gestochene Kursivschrift ohne bildliche Darstellung aufweist, gibt über die Urheber der Suite von 1718 und ihren Herausgeber des Jahres 1724 nicht viel Auskunft, lediglich so viel, daß „Charles Coypel Ecuyer“, „peintre du roy“ etc. diese 1724 veröffentlicht habe. Nach dem Datum und dem Vornamen Charles war es also der Sohn Antoine Coypels, doch schmückt er sich hier sowohl mit dem an den Vater verliehenen Adelstitel als auch
dessen Ämtern; Charles-Antoine ist erst im Jahre 1747 zum Premier peintre du Roi aufgestiegen; zwar war er 1722 als Nachfolger seines Vaters zum ersten Maler des Duc d’Orléans ernannt worden, doch starb dieser schon im Folgejahr. Sicher sind es nicht nur merkantile Gründe, warum er diese Titel angab, tragen doch die Tafeln alle die Signatur des Régent, und das bedurfte für den Herausgeber natürlich einer Rechtfertigung. Diese Titel und Amtsbezeichnungen hat Coypel allerdings auch sonst in der Zeit offiziell geführt, wir konnten sie etwa in Heiratskontrakten naher Verwandter aus den 1720er Jahren, in denen er als Trauzeuge auftrat, ausmachen. Die bekannte und populäre Illustrationsfolge, deren Kupferplatten er aus dem Besitz seines Vaters geerbt hatte, wußte er durch diese separate Suite gewinnbringend für sich zu nutzen, ohne dazu mit einem Verleger an der Neuausgabe des Romans zusammenarbeiten zu müssen, um von diesem mit einem Honorar abgespeist zu werden. Auf die Befindlichkeiten der Familie der Herzöge von Orléans mußte er allerdings Rücksicht nehmen, wohl insbesondere auf den nachfolgenden Sohn. Daher könnte es sein, daß aus einem Teil der Auflage zwei Tafeln mit Absicht entfernt worden sind, weil das gewünscht oder erwartet worden ist, so jedenfalls hat es Péreire dargestellt. Die Sujets beider Stiche erschienen wohl etwas zu offen: Jener zu Seite 95, mit der Legende „ Licoenion écoute Daphnis et Chloé qui cherchent remède d’Amour“, und derjenige zu Seite 97, betitelt „ Licoenion enseigne Daphnis au jeu d’Amour “. Es mag sein, daß die Zensur nur gerade die besseren Exemplare betroffen hat, andere enthielten, wie schon in Katalogen des 18. Jahrhunderts nachweisbar, die volle Tafelanzahl der Regentensuite, doch sind insgesamt zu wenige Exemplare erhalten geblieben, um sich auf dieser Basis ein fundiertes Urteil bilden zu können.
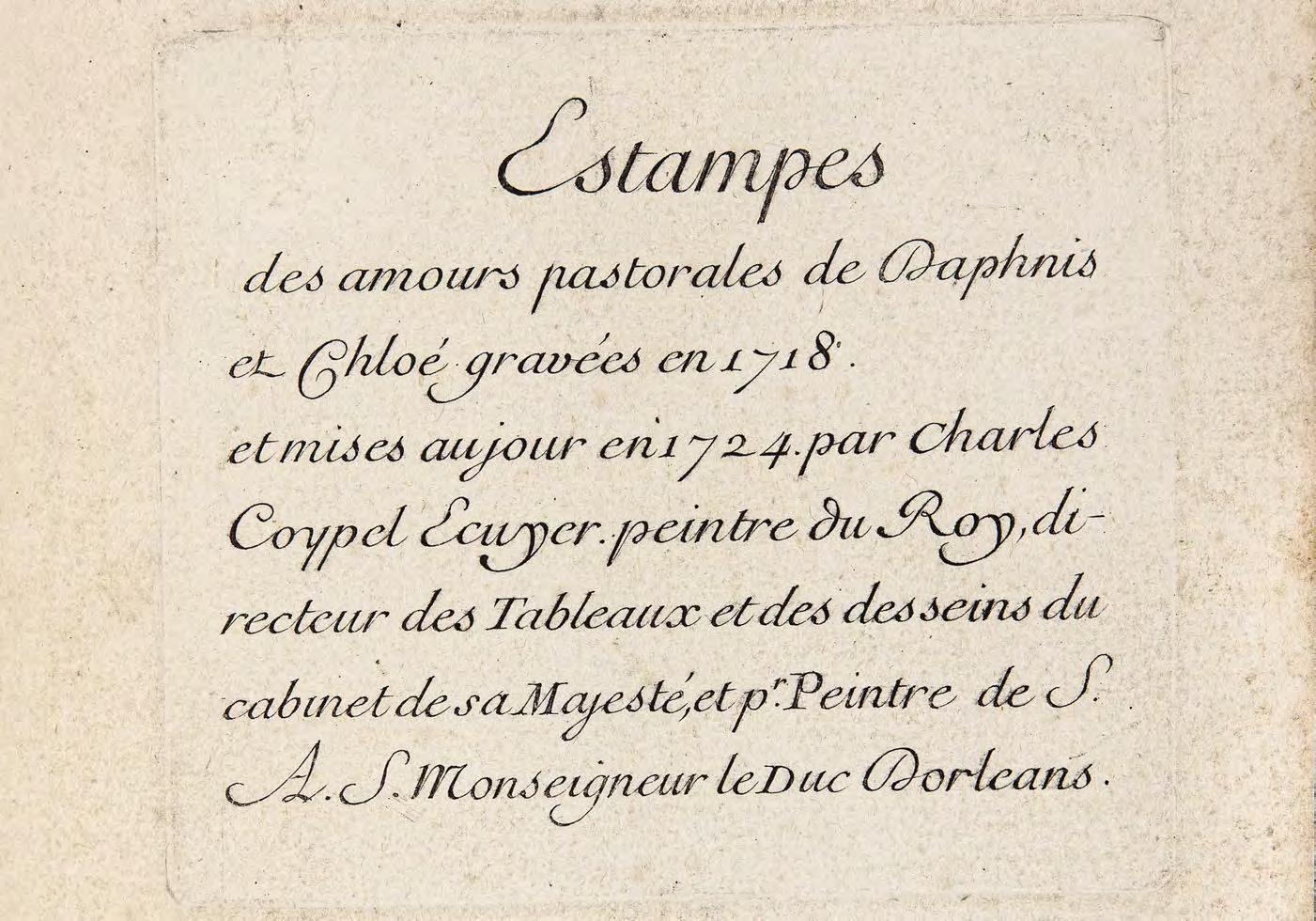
Bei dieser Einzelausgabe wurden die Kupfer auf sehr starkes Bütten von größerem Format gedruckt, so daß die querrechteckigen Illustrationen nicht wie im in den kleinformatigen Buchausgaben senkrecht gefalzt werden mußten. Der oben zitierte Drucktitel ist so selten, daß Péreire ihn nur nach dem Exemplar von Edouard Rahir zitieren konnte, er ist gleichwohl in zwei der hier vorgestellten Quart-Exemplare vorhanden. In alten Verkaufskatalogen kann man ebenfalls einzelne Exemplare mit diesem Titel antreffen, darunter der des Londoner Buchhändlers Thomas Payne (Catalogue Payne 1798, Nummer 1208, ein Exemplar in blauem Maroquin); auch die Verkaufskataloge des Verlegers Néaulme von 1755 und 1763
enthielten ein Exemplar, dieses mit 30 Tafeln und im Prachteinband in rotem Maroquin (Catalogue Néaulme 1755, Nr. 370, und 1763, Bd. III , Nr. 419).
Unser Exemplar auf sehr kräftigem, festen Papier, in das sich die Platten stark eingetieft haben. Die Abzüge sind außergewöhnlich gut, kontrastreich, differenziert und frisch, die die qualitativen Vorzüge, aber auch gewisse Schwächen dieser Darstellungen besonders deutlich werden lassen; ein sehr gutes, nahezu völlig fleckenfreies Exemplar.
Literatur: Péreire, Notes, S. 60 f. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 314. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1221 (Anmerkung).
Exemplar André Langlois, mit 28 Kupfern und auf grossem Papier
XVI Estampes des amours pastorales de Daphnis et Chloé [de Longus] gravées en 1718. et mises aujour en 1724. par Charles Coypel Ecuyer. peintre du Roy, directeur des Tableaux et des desseins du cabinet de sa Majesté, et pr. Peintre de S. A. S. Monseigneur le Duc Dorleans [sic!].
Gestochener Titel der Neuausgabe, datiert 1724, gestochener Titel der Ausgabe 1718 von B. Audran nach A. Coypel und 28 Kupfertafeln von Audran nach dem Regenten Philippe d’Orléans (davon 13 querrechteckige in größerem Format).
Quart (208 x 147 mm).
Apfelgrüner Pergamenteinband der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit rotem Maroquin-Rückenschild, Rotschnitt.
Dies ist das superbe Exemplar der Sammlung André Langlois, auf größerem, blütenweißen Papier. Es hat gegenüber dem in der vorigen Nummer beschriebenen den nicht zu unterschätzenden Vorteil, ganz komplett zu sein, also die in einigen Suiten fehlenden Kupfer zu den Seiten 95 und 97 ebenfalls aufzuweisen; überdies wurden vor alle Stiche Serpentes aus besonderem dünnen, qualitätvollen
Büttenpapier eingebunden, was den nahezu makellosen Zustand der Blätter erklärt. Diese Schutzpapiere stammen aus der bedeutenden Papiermühle Iohannot aus Annonay (mit 1770 datierten Wasserzeichen: „Fin de Johannot d’Annonay“), von der auch Didot in Paris seine ersten Velinpapiere bezogen hat. Um diese Zeit wird unser Zyklus diesen sehr soliden Einband bekommen haben. Die Plattenabdrucke sind derart kräftig und das Papier so stark, wie man das gewöhnlich erst bei Tiefdrucken vom Anfang des 19. Jahrhunderts vorfindet. Hier wurde mit besonderem Aufwand daran gearbeitet, ein mustergültiges Exemplar dieser Suite herzustellen. Offensichtlich sind auch etwaige moralische Skrupel hintangestellt und die 28 Stiche in ihrem vollen Umfang veröffentlicht worden.
Provenienz: Mit dem grünen Exlibris und eingeklebtem Bibliothekszettel von André Langlois auf dem fliegenden Vorsatz – zu ihm siehe den bei Nr. 1 zitierten Artikel.
Erstes Blatt minimal fleckig im Außenrand, ansonsten ein perfektes Exemplar in einem dafür sehr passend erscheinenden grün gefärbten Pergamentband.
Zu den bibliographischen Referenzen siehe die vorhergehende Nummer.
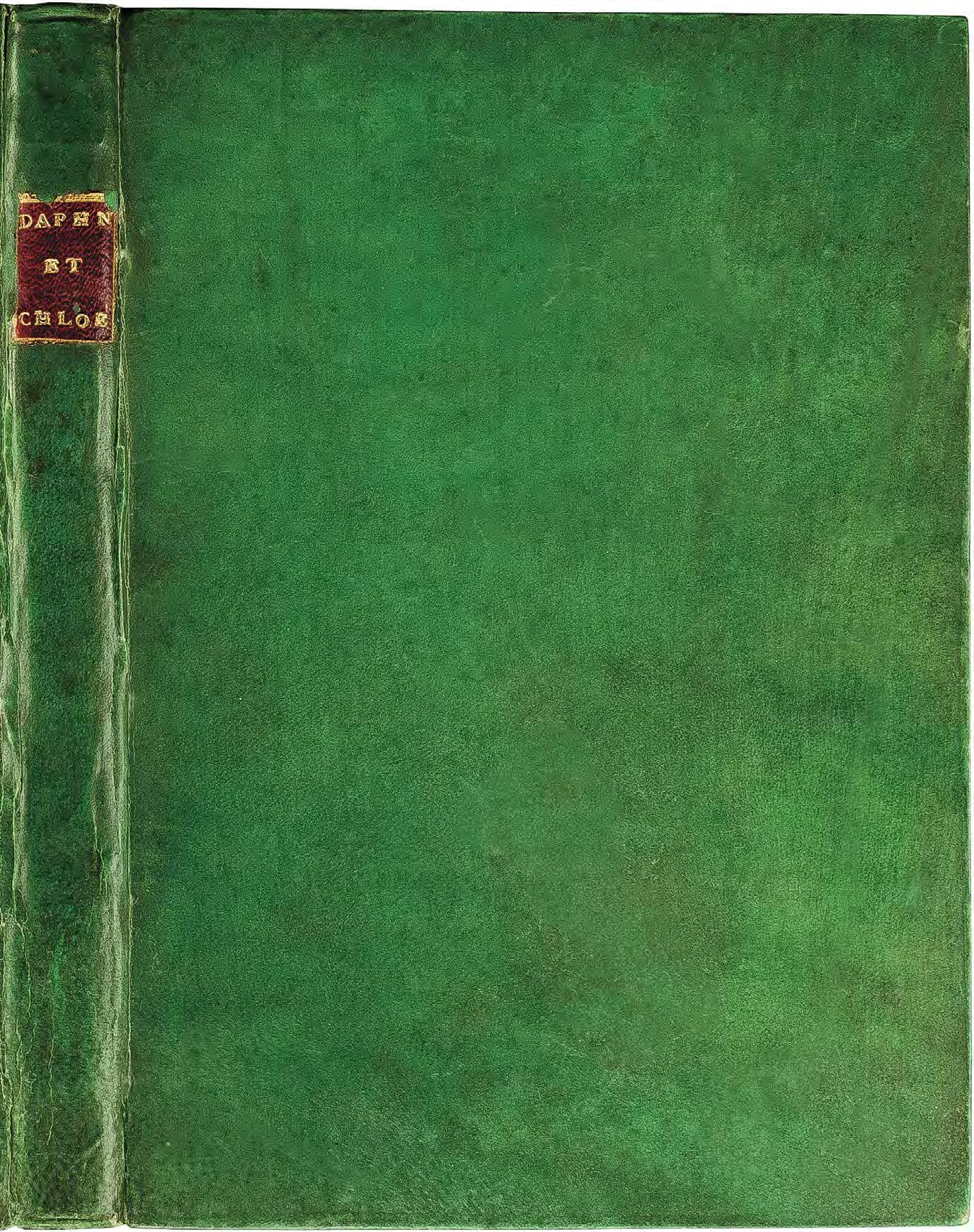
Eine frühe Separat-Suite in Quer-quart
XVII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Avec Figures. Ohne Ort und Drucker [wohl Paris, um 1720].
Die „Regentensuite“ separat: Gestochener Titel von B. Audran nach A. Coypel und 28 Kupfertafeln von B. Audran nach dem Regenten Philippe d’Orléans (davon 13 querrechteckige in größerem Format).
Klein-Querquart (162 x 198 mm).
Marmorierter Kalbledereinband mit grünem Maroquinrücken um 1780 auf fünf falschen Bünden zu sechs Kompartimenten mit ornamentaler, teils floraler Rückenvergoldung und rotem goldgeprägten Maroquinrückenschild, Deckel mit Kettenrahmung aus goldgeprägten Rauten und Ovalen, eingefaßt von doppelten Fileten, mittig ein großes rotes Maroquinschild mit dem goldgeprägten Titel; Steh- und Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Ein weiteres Exemplar der Regentensuite, welches sich aber von den beiden vorangehenden dadurch unterscheidet, daß es auf weit dünnerem Bütten und nicht so kräftig abgedruckt ist; der Zustand ist damit so, wie man ihn für gewöhnliche Abzüge des frühen 18. Jahrhunderts erwarten würde: die Qualität der Drucke ein wenig schwankend, von leicht flauen bis zu recht kräftigen Abdrucken, aber nie so scharf, tief und kontrastreich, wie das bei den beiden vorhergehenden Separatsuiten der Fall ist. Hier ist zudem der gestochene Titel von 1724 nicht vorhanden, die Kupfersuite Audrans nach dem Regenten mit allen 28 Tafeln jedoch vollständig und das Format abweichend. Daraus kann man folgern, daß wir hier die Suite in einem Abdruck noch vor der Neuausgabe durch den jüngeren Coypel vorliegen haben. Auf die Herstellung
solcher Separatfolgen vor 1724, teils wohl zum Zweck besonderer Geschenke, läßt eine Notiz schließen, die durch die Goncourts überliefert ist, ein Tagebucheintrag des Marquis de Calvière vom 10. März 1722, zitiert bei Péreire wie auch Reynaud: „M. Coypel premier peintre de Mr. le Régent me donna de la part de ce prince les estampes gravées d’après les Tableaux de Daphnis et Chloé peints par S. A. R.“ Der Marquis war ein großer Kunstliebhaber und Sammler; eine derartige separate Suite durch den Regenten zu erhalten, war sicherlich keine alltägliche Angelegenheit, sondern ein besonderer Gunsterweis.
Anhand dieses Abzugs wird zudem deutlich, daß Coypels Sohn die Platten zu seiner Neuausgabe von 1724 zwar nicht tiefgehend bearbeitet, jedoch zumindest gründlich gereinigt haben dürfte, um dann auf besseren Papieren und mit Hilfe erheblich stärkerer Pressen wieder sehr gute und kontrastreichere Abzüge zu erhalten. Da die Druckplatten offensichtlich nicht weiter beschädigt, sondern nur etwas abgenutzt waren, hat dies ausgereicht, sie wieder in frischen Zustand zu versetzen. Und das wäre dann auch die Erklärung für die guten Abzüge der Amsterdamer Drucke von 1754 und 1757: Sie setzen diese Auffrischung voraus, nachdem offenbar zwischen 1724 und 1754 von den originalen Platten keine Abzüge mehr angefertigt worden sind – zumindest nicht im Rahmen einer weiteren Neuausgabe. Weitere derartige, um 1718/20 gedruckte und im kleinen Querquart-Format überlieferte Exemplare können nicht nachgewiesen werden, somit scheint dieses einzigartig.
Provenienz: Auf dem fliegenden Vorsatz Exlibris „Sammlung Peter Klima –693“.
Durchgehend etwas, die ersten Tafeln stärker stockfleckig.
Literatur: Péreire, Notes, S. 60 f.


Unikales Quer-Folio-Exemplar:
Sammlungen Jamot und Zierer
XVIII „Longus. Les Amours Pastorales / de Daphnis et de Chloé / Suite du Régent / gravée par Audran / 1718“ [Kalligraphischer Titel].
Die „Regentensuite“ separat: Gestochener Titel von B. Audran nach C. Coypel und 26 Kupfertafeln von B. Audran nach den Gemälden des Regenten Philippe d’Orléans (ohne die beiden – zensierten – Kupfer zu den S. 95 und 97 der Textausgabe).
Beigebunden drei Blätter, einseitig beschrieben, mit den „Notes d’un amateur“ (M. Péreire) aus dem
Bulletin du Bibliophile des Jahres 1923 (= Péreire, Notes, S. 60–62).
Quer-Folio (ca. 265 x 350 mm)
Dunkelblauer Maroquineinband der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf fünf echten Bünden, die sechs Rückenkompartimente mit Titel und ornamental-floraler Vergoldung, Deckel mit vielfältiger Fileten-Vergoldung und opulenten Akanthus-Eckstücken, Innenkantenfileten, grünen Moiré-Doublüren und -Vorsätzen, dazu Marmorpapiervorsätze, Ganzgoldschnitt, in Halblederschuber; signiert: G. Cretté Succ. de Marius Michel .

Das Auftauchen dieses superben Exemplars ist eine bibliographische Sensation, da über die vergangenen 300 Jahre kein weiteres seinesgleichen verzeichnet worden ist. Man könnte sich vorstellen, daß Coypel ein einziges auf dieses „größte“ Papier drucken ließ, um eventuell etwas Ähnliches herzustellen wie Armand-Jérôme Bignon (siehe unsere Nummer VIII). Das unbeschnittene Papier in der ganzen Folio-Größe verleiht den Abzügen die Aura von unmittelbaren, ohne jede weitere Bearbeitung aus der Druckwerkstatt kommenden Erzeugnissen, und die Kupfer liegen in so kräftigen, sauberen, man möchte fast sagen: beispielhaften
Abzügen vor, als hätte man hier ein Muster und Vorbild für alle Zeiten erschaffen wollen. Wie dem auch sei, die wunderbare Kuriosität gereicht diesem Katalog zur Ehre, sie zeigt, wie die Bibliophilie immer schon Kobolz schlug, auch dort, wo man es nicht für möglich hätte halten wollen. Die Erhaltung des Exemplars ist makellos (ein winziger Einriß im ersten Blatt unten repariert).
Das Exemplar stammt aus der Bibliothek Paul Jamot (nicht in seiner Auktion der 40er Jahre) und der Sammlung des großen Bibliophilen Daniel Zierer (Vente Paris, 6.–7.11.1968, Nr. 115: Frs. 10.000,–).
Das Exemplar Delaleu – Pichon: Ein bislang unbekannter Druckzustand, dazu in einem prächtigen Einband von Laferté
XIX [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot. Paris, Guérin und wohl Coustelier veuve,] 1718 [i. e. ca. 1731].
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel (datiert 1718), 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur, ein seitenrichtiger Nachstich, wohl aus der Zeit um 1750), vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Blätter., 159 Seiten (Titel, „Avertissement“, „Pré face“ und Haupttext).
Kollation: π 1 a4 A–K 8 (alle Seiten mit doppeltem Tuscherahmen und in Rot regliert).
Klein-Oktav (157 x 98 mm).
Nachtblauer französischer Maroquineinband um 1750/60 auf fünf Bünden zu sechs Kompartimenten, der goldgeprägte Titel im zweiten Kompartiment von oben, die übrigen mit kleinen, von Pfeilen durchbohrten, entflammten Herzen in der Mitte, umgeben von je sechs floralen Ornamentstempeln, dazu Pointillé-Vergoldung, Deckel mit Fileteneinfassung, daran ornamentale Zierleisten, innen breite, kräftige Dentellebordüre mit Blumen- und Pflanzenstempeln, darunter Birnen, Eicheln und Akanthusblätter, in den Ecken je eine Blüte im Kreis, in der Mitte der Bordüren jeweils ein größeres, von Pfeilen durchbohrtes entflammtes Herz, im Zentrum der Deckel je eine Rosette, zusammengefügt aus kleinen Einzelstempeln, Pointillé in Form
größerer Punkte und Ringe; Stehkantenfileten, breite florale Innenkantenbordüre, Vorsätze in hellgelbem Tabis sowie Ganzgoldschnitt; wahrscheinlich von P.-A. Laferté.
In einen vorzüglichen Einband und von bester Provenienz haben wir hier ein Exemplar vorliegen, das tiefe Einblicke in die Editionsgeschichte unseres Werks gewährt, in die fast völlig im Dunkeln liegende Zeit zwischen der Regentenausgabe und ihrer nächsten Nachfolge. Wir können dieses Exemplar mit vollem Recht als missing link bezeichnen, denn es ist das entscheidende, bislang unbekannte Bindeglied zwischen der Ausgabe von 1718 und der Edition des Jahres 1731, an die wiederum diejenige von 1745 anknüpfen wird, mit Ausstrahlungen bis weit in die zweite Jahrhunderthälfte. Durchgehend mit handgezeichneten Textrahmen und roter Reglierung versehen, haben wir es hier zweifellos mit einem Verlegerexemplar zu tun, einem Probedruck, der unmittelbar vor der Ausgabe von 1731 entstanden sein muß. Dieser trägt noch den Titel von 1718, entspricht sonst aber bereits ganz der Ausgabe von 1731, und zwar jener Druckvariante, die wir im Exemplar der Pompadour vorliegen haben, unsere Nummer XXI , in übereinstimmender Kollation und mit allen ihren Merkmalen, selbst den charakteristischen Fehlern, wie etwa dem umgedrehten Zeichen in der Kopfzierleiste des Avertissement und den vertauschten Ziffern bei der Paginierung von Seite 97. Mit diesem Exemplar ist also die Ausgabe des Jahres 1731 vorbereitet worden. Nun enthält letztere aber auch die Notes des Antoine Lancelot, welche hier noch fehlen. Doch verrät sich die Vorbereitung der Neuausgabe gerade in dieser Hinsicht durch ein wichtiges Detail: Am Ende des Avertissement ist hier bereits der Verweis „On en rendra compte dans les Notes“ gesetzt, obwohl diese noch gar nicht vorhanden sind.
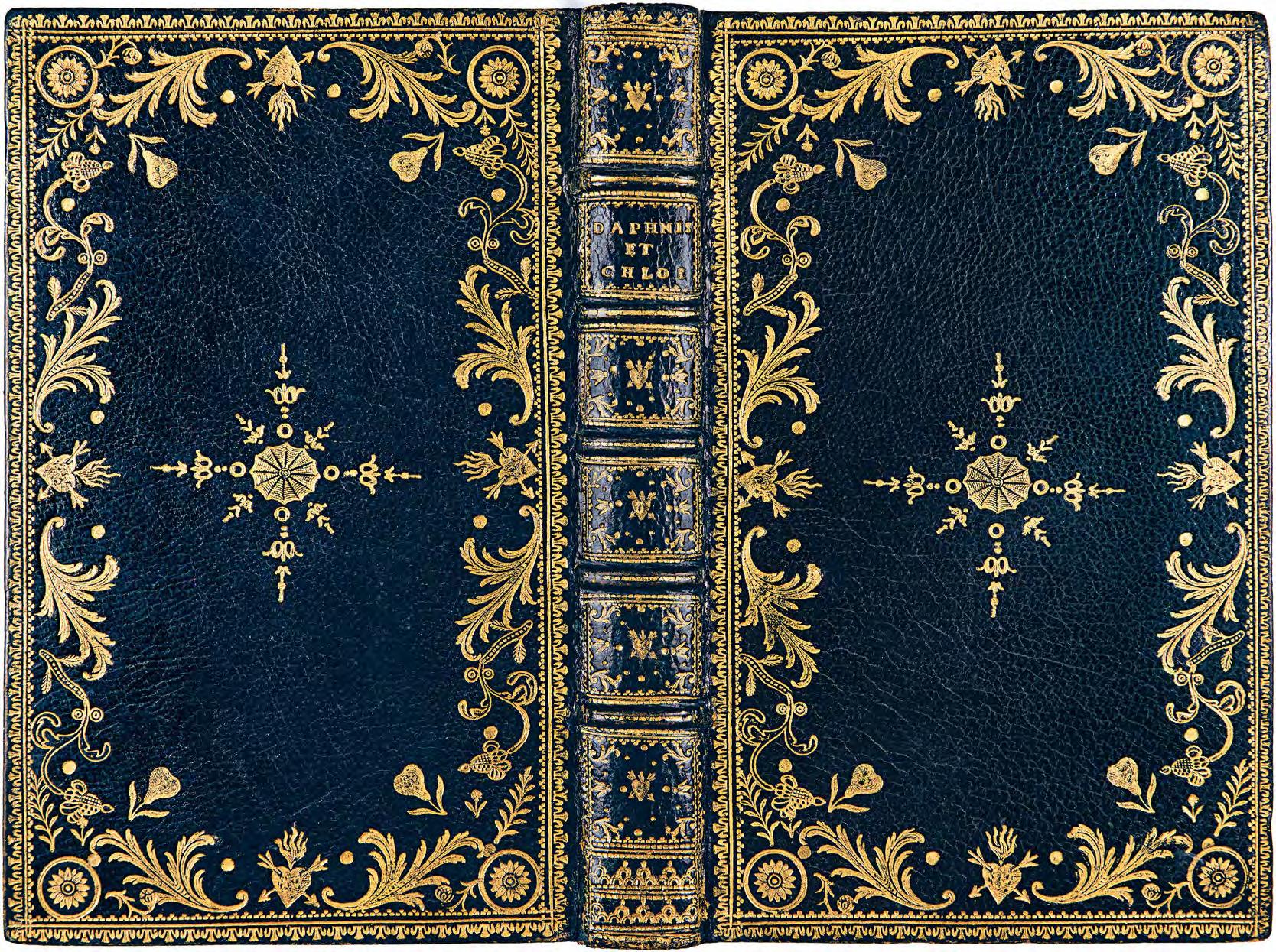
Weder der neue Titel noch die Notes waren zu diesem Zeitpunkt schon gedruckt, doch der Textsatz stand bereits fest – und ist offenbar auch nicht mehr geändert, ja nicht einmal mehr durchgesehen worden, was die Fehler erweisen. Da die Variante Pompadour direkt an den hier vorliegenden Zustand anknüpft, war sie also die frühere der beiden Druckvarianten der Ausgabe von 1731. Vorliegt zweifellos eines der höchst seltenen Arbeitsexemplare des Verlegers, das, wiewohl noch in unfertigem Zustand, aufbewahrt worden ist, nicht zuletzt wohl wegen seiner dekorativen Textrahmen, die ihm auszeichnenden Charakter verleihen. Leider hat der Verleger die an sich reizvolle Idee in der endgültigen Form wieder fallengelassen. Bei der Betrachtung des Drucktitels und dem Vergleich mit dem Originaldruck von 1718 fällt auf, daß der Titel unseres Exemplars zwar versucht, denjenigen von 1718 zu imitieren, nicht aber unter Verwendung der originalen Typen, sondern in deutlich vergröbertem Druck. Der feine Satz von 1718 stand hier nicht zur Verfügung. Für den Druck und die Textgestaltung der endgültigen Titelseite der Ausgabe von 1731 hat man sich schließlich nicht an die Ausgabe von 1718 gehalten, die tatsächliche Vorlage war der Pariser „Cramoisy“-Druck des Jahres 1716. Lediglich bei der Reduktion auf den Werktitel und die Jahreszahl scheint man sich an der Ausgabe von 1718 orientiert zu haben. Bereits anhand des Titels offenbaren sich die beiden Quellen der Neuausgabe von 1731.
Daß dieses Exemplar die Regentensuite enthält, würde man bei dem 1718 datierten Titel erwarten, für ein Exemplar der Ausgabe von 1731 ist dies jedoch etwas Besonderes, wurde doch in die meisten dieser Drucke die Scotin-Folge eingebunden. Auch deshalb ist unser Exemplar aufschlußreich, besagt es doch, daß der Verleger die Regentenfolge offenbar bevorzugt hat. Hier liegt sie in disparaten
Drucken vor, manche sind kräftig, andere etwas flau; es dürfte sich in jedem Fall um Abzüge handeln, die bereits vor der Separatsuite des Jahres 1724 angefertigt worden sind. Da auch die Tafeln gerahmt und regliert worden sind, ist davon auszugehen, daß der Verleger sie in der vorliegenden Weise in seine Ausgabe einzubeziehen dachte. Das Problem war allerdings, daß die Anzahl verfügbarer Suiten immer geringer wurde, weshalb dann doch die kleinere Folge des Scotin in die meisten Exemplare Eingang gefunden hat. Die hier ebenso vorhandene Tafel der Petits pieds stammt allerdings nicht aus der Zeit, sondern es handelt sich sicherlich um eine Zutat aus der Zeit der Bindung, ein Nachstich, der deutlich grober als das Original des Grafen Caylus ausfällt.
Der Einband ist ein unmittelbarer Verwandter zu jenem unserer Nummer XXXIII , ein Exemplar der Ausgabe von 1745, und von uns dem großen Buchbinder Pierre-Antoine Laferté (gestorben 1769) zugeschrieben. Wiewohl der kleinere Einband dieses Exemplars nicht ganz an die Feinheit des Quartbandes der Nummer XXXIII heranreicht, steht er ihm stilistisch doch sehr nahe; die Verwendung zweier übereinstimmender, motivisch zentraler Stempel, das große Akanthusblatt und die Eichel, zeigt indessen an, daß es sich hier in jedem Fall um dasselbe Atelier handeln muß, das die Einbände hergestellt hat, beide ungefähr in der Zeit um 1750/60. Die Benutzung individueller Einzelstempel, die auf den Inhalt des Werks verweisen, das entflammte Herz in zwei verschiedenen Größen, das doppelt von Pfeilen durchbohrt wird, zeichnet diesen Einband in besonderer Weise aus, dazu das sehr originelle Mittelstück, eine florale Rosette mit einem Spinnennetz in der Mitte. Einzelne Rahmen mit Papierbrüchen infolge von Tintenfraß, gelegentlich ein wenig stockfleckig im Rand.

Dieses außergewöhnliche Exemplar, dessen editionsgeschichtliche Bedeutung bisher nicht erkannt worden ist, hatte zwei Vorbesitzer von Rang: Im 18. Jahrhundert gehörte es dem Pariser Notar Guillaume Claude Delaleu (gestorben 1774), der ab 1753 auch königlicher Sekretär gewesen ist. Seine umfangreiche, erlesene Bibliothek wurde 1775 versteigert (Catalogue Delaleu 1775, Nr. 950: „mar. bl. doublé de tabis“, frs. 96). Auf dem Vorsatz sein großes gestochenes Wappen-Exlibris in Rocaille-Kartusche. Wahrscheinlich wurde der Einband in seinem Auftrag gefertigt. Der zweite ermittelbare Besitzer war der große Bi-
bliophile Baron Jérome-Frédéric Pichon (1812–1896); sein goldgeprägtes Maroquin-Schildchen mit dem Motto aus Psalm 142 „Memor fui dierum antiquorum PS . CXLII .“ findet sich auf dem vorderen Spiegel. In den Jahren 1897/98 wurde seine herausragende wie umfangreiche Sammlung durch Leclerc und Cornuau verkauft (Catalogue Pichon 1897/98, Bd. I., Nr. 968, für 905 frs. + Aufgeld).
Ein editionsgeschichtliches Dokument von Rang, in sehr dekorativem Meistereinband des mittleren 18. Jahrhunderts und aus bedeutender Provenienz.
Die Ausgabe von 1731 in prachtvollem Maroquin mit breiter Dentelle-Bordüre, Augsburger Brokatpapiervorsätzen und der Suite von 1718
XX [(Longus). Les amours pastorales de Daphnis et Chloé (traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, Guérin und wohl Coustelier veuve,) 1731].
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718 (hier den typographischen Titel von 1731 ersetzend) und 27 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite nach dem Regenten Philippe d’Orléans (ohne die letzte Tafel), vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf historisierten Holzschnitt-Initialen.
4 (statt 5) Bl., 159, XX Seiten („Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot; ohne den Drucktitel).
Kollation: [fehlt: π 1] a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (155 x 96 mm).
Weinroter französischer Maroquineinband des frühen 18. Jahrhunderts (ca. 1731–1735), Rücken auf fünf Bünden zu sechs Kompartimenten, mit reichster, sehr feiner Pointillé-Vergoldung der Kompartimente in stilisierten Floralmotiven, im zweiten von oben der Titel in Goldprägung auf olivgrünem Maroquin-Titelschild, Deckel mit breiter, aus mindestens drei Einzelmotiven gebildeter Dentelle-Bordüre (Bourbonlilien, Blüten, entzündete Herzen etc.); Stehkantenfilete, Innenkantenvergoldung und prachtvolle Bronzefirnispapier-Vorsätze, signiert
„ CAES: MAI: Anno. i. 1724“; vielleicht von Padeloup le jeune.
Superbes, so gut wie fleckenfreies Exemplar der Ausgabe von 1731 in einem exquisiten Einband der Zeit, der an die Art von Padeloup dem Jüngeren erinnert. Die einschlägigen Bibliographien führen zur Ausgabe von 1731 gewöhnlich den Scotin-Zyklus als Illustration an. Tatsächlich ist diese Ausgabe aber in (mindestens) zwei Druckvarianten hergestellt worden, die beide ohne eigens dafür angefertigte Tafeln auf den Markt gekommen sind. Offensichtlich kursierten in dieser Zeit noch genügend Exemplare der Folgen Scotins und des Regenten, daß jeder, der es wollte und es sich leisten konnte, die gewünschten Kupferstiche einbinden ließ, um damit ein Exemplaire truffé zu erzeugen. Unserem Exemplar hat man die Suite der berühmten Ausgabe von 1718 gegönnt, unter Auslassung der letzten Tafel „Nopces de Daphnis et Chloé“.
Der schöne und solide Einband, vergleichbar auch den Arbeiten von Du Seuil oder Boyet, ist makellos erhalten (siehe die Nummern 79 und 80 im Esmerian-Katalog II , weiterhin: Barber, Rothschild, W.Cat. 245 und 419, letzterer zugeschrieben an Padeloup le jeune). Hervorzuheben sind weiterhin die entzückenden 1724 datierten Bronzefirnispapiervorsätze des Joseph Friedrich Leopold (1668–1727) aus Augsburg (vgl. dazu Haemmerle, Buntpapier, S. 205–207, Nrn. 111–137).
Das Exemplar ist auf einem etwas stärkeren Bütten gedruckt als das der Pompadour, unsere folgende Nummer, der anderen Druckvariante der Ausgabe von 1731; das Papier ist gut, griffig und fest, lediglich die Seiten mit den „Notes“ des Antoine Lancelot sind dünner. Die Abzüge der Kupfer sind gut und früh, vielleicht mit ein klein wenig Farbüberschuß gedruckt.
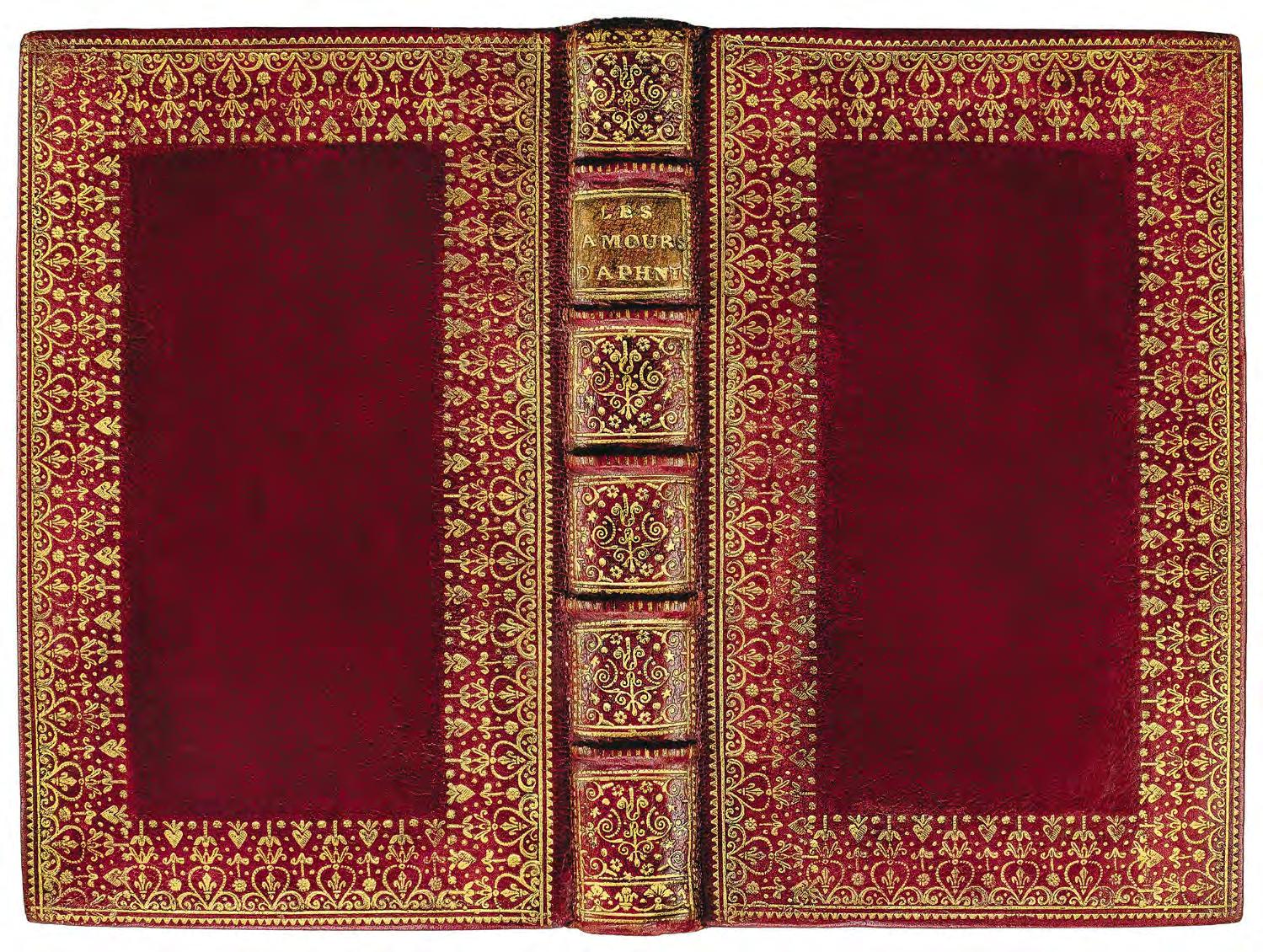
Dies ist ein prachtvoll gebundenes, bestens erhaltenes und zudem mit der Suite von 1718 zusätzlich ausgestattetes Exemplar der Ausgabe von 1731, das sich vor allem durch zeitliche Einheitlichkeit auszeichnet. Der Einband von großer Solidität war in diesem Typ schon um 1680–1700 denkbar (sie -
he etwa unseren Katalog Biblia Sacra , Nr. 63 und unseren Katalog à compartiments, passim), die herrlichen, kostbar anmutenden Vorsatzpapiere vollenden den kostbaren Gesamteindruck. Provenienz nicht ermittelbar. – Die bibliographischen Referenzen unter der folgenden Nummer.
Das Exemplar der Madame de Pompadour
XXI [Longus.] Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, Guérin und wohl Coustelier veuve,] 1731.
Mit gestochenem Titel und acht Kupfertafeln von J. B. Scotin (zur Ausgabe von 1716), gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX Seiten (Titel in Rot und Schwarz, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π 1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (157 x 98 mm).
Marmorierter französischer Kalbledereinband des 18. Jahrhunderts (wohl um oder bald nach 1745) auf glattem Rücken mit Fileten- und Stempelvergoldung in sechs Kompartimenten, im zweiten von oben der Titel auf rotem Maroquinschildchen, die anderen mit stilisierten, sehr feinen Blumenzweigen und Eckfleurons, Deckel in dreifacher Filetenrahmung mit Blütenstempeln an den Überschneidungen und dem großen Wappen-Supralibros der Pompadour; Stehkantenfilete, gemusterte Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Die Pompadour hatte, ausweislich ihres Katalogs von 1765, zwei Exemplare verschiedener Longus-Ausgaben in ihrem Besitz, davon ist diese die frühere, das andere Exemplar war eines aus der Ausgabe der „curieux“ von 1757. Unseres ist einwandfrei und fast fleckenlos erhalten, die Kupfer liegen in sehr guten, kontrastreichen Drucken vor, weit besser und gratiger als in den meisten Exemplaren der beiden frühen Ausgaben mit der ScotinSuite aus dem Jahr 1716 – man vergleiche etwa
unsere Nummer I. Die Erklärung dafür ist in der Editionsgeschichte zu finden.
Von der Ausgabe des Jahres 1731 existieren zwei klar unterscheidbare, doch kollationsgleiche Druckvarianten, die nicht nur in einzelnen Zierformen differieren, sondern man hat den gesamten Text beider Fassungen bei analogem Aufbau der einzelnen Seiten in einer leicht unterschiedlichen Type mit gering abweichender Größe der Druckform bzw. des Schriftspiegels jeweils eigens gesetzt. Es handelt sich also um eine sogenannte édition roulée, eine Ausgabe, die gleichzeitig bei zwei oder mehreren Druckern, die mehr oder weniger abhängig voneinander arbeiteten, erschienen ist, in Frankreich eine durchaus übliche Praxis. Keine der beiden Varianten wurde aber von den jeweiligen Druckern bzw. Verlegern mit zugehörigen Kupfertafeln versehen, noch ist für diese Ausgabe ein neuer Zyklus entstanden; daher sind auch Exemplare ohne Tafeln und Kupfertitel als komplett anzusehen. Zur Auswahl für eine (nachträgliche) Illustration mit Tafeln stand die Regentensuite und die Stichfolge Scotins; beide konnten zu dieser Zeit noch bei Bedarf nacherworben und mit eingebunden werden. Dies ist die schlüssige Erklärung dafür, daß wir hier den Scotin-Zyklus in einem Zustand vorliegen haben, der denjenigen vieler Exemplare der früheren Ausgaben deutlich überlegen ist. Vergleicht man unsere Nummer II , in die gleich zwei Folgen in unterschiedlichen Bearbeitungs- und Qualitätszuständen der Platten eingebundenen wurden, so wird deutlich, daß wir hier einen dritten Zustand vor uns haben, der zwischen diese beiden einzuordnen ist. Offensichtlich handelt es sich bei diesen besseren und früheren Zyklen um Zustände, die noch vor der ersten Buchausgabe von den Platten abgezogen worden sind und apart in den Handel gelangten. Es war zweifelsohne gang und gäbe, spätere Ausgaben, die
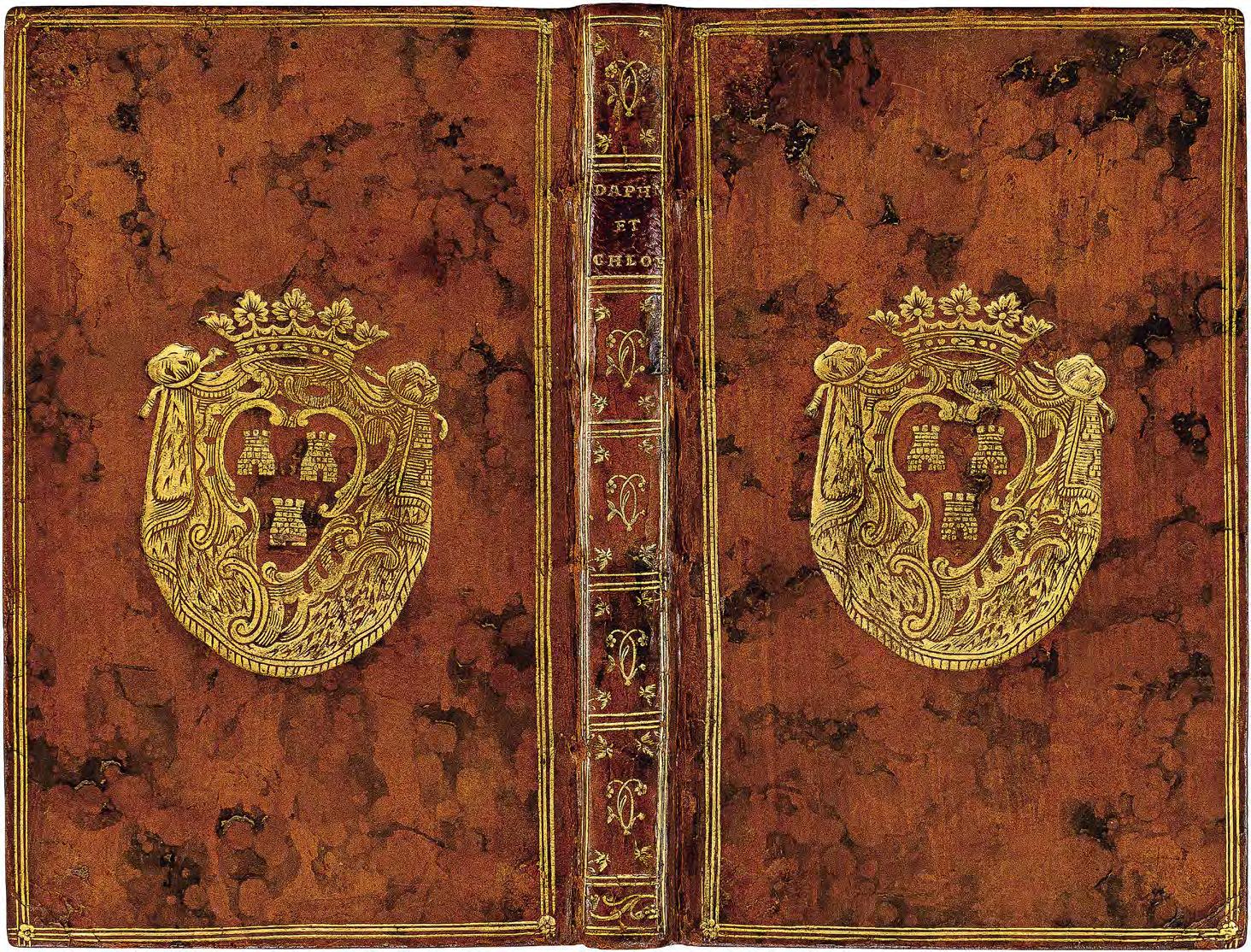
ohne Illustration erschienen sind, nachträglich mit diesen frühen Separatabzügen auszustatten. Das erklärt die nur scheinbare Diskrepanz, warum ältere Ausgaben zuweilen Abdrucke von erkennbar abgenutzten und mehrfach bearbeiteten Platten enthalten, während manche der jüngeren frühere Plattenzustände zeigen und eine höhere drucktechnische Qualität. Genau das ist bei dem Exemplar der Pompadour, die sich für den Scotin-Zyklus entschieden hatte, der Fall.
Die vorliegende war von den beiden leicht unterschiedlichen Druckvarianten die zukunftsweisende, weil auf ihrer Grundlage die Ausgabe von 1745
entstehen sollte. Hier sei daher kursorisch auf die Unterschiede eingegangen, die bisher nur Péreire erkannt und erwähnt hat: Beide sind sofort durch die völlig unterschiedlichen Kopf-Zierleisten beim Avertissement voneinander absetzbar. Die Druckvariante A (diejenige unseres Exemplars, die Variante Pompadour) zeigt hier Blätter mit Stielen in S-Form, wobei ein Fehler auftritt (das dritte Zeichen von rechts ist verkehrt herum eingedruckt), der schließlich in der Ausgabe von 1745 korrigiert werden wird. Die Kopf-Zierleiste des Préface de Longus besteht aus vier stilisierten Herzformen und Blättchen. Bei unseren beiden Exemplaren Nummer XX und dem auf Pergament gedruckten
Nummer XXIV, der Druckvariante B zugehörig, erscheint dagegen am Kopf des Avertissement eine Fleuronleiste (in der Mitte eine vierblättrige Blüte, davon ausgehend, quer nach links und rechts ausgerichtet, je fünf kelchartige Blüten, wohl Tulpen, rechts die letzte angeschnitten). Die Kopfzierleiste über der Préface besteht hier aus kleinen quadratischen Motiven (ein Punkt im Strahlenkranz), insgesamt 17 in Reihe. Die Zierleisten am Beginn der Notes unterscheiden sich ebenfalls, sind kleiner, zurückgenommener als im Exemplar Pompadour. Außerdem differiert die Form der Holzschnitt-Initialen (siehe dazu auch die Ausführungen zur Nummer XXIV). Der Text von Variante B ist überhaupt etwas kleiner gesetzt und von weniger klaren Drucktypen, das Papier ist dagegen, zumindest bei unserem Exemplar, der Nummer XX , kräftiger.
Die Variante Pompadour zeigt in den Formen ihrer Zierleisten deutliche Bezüge zur ersten Ausgabe des 18. Jahrhunderts, Paris 1716, die, wie wir begründet annehmen können, von Guérin für den Verleger Barbou gedruckt worden ist. Derartige formale Zusammenhänge sind darüber hinaus mit der Pariser Vergil-Ausgabe von 1716 auszumachen, die als Zusammenarbeit Barbous mit Guérin nachgewiesen ist (vergleiche unsere Einführung). Mehrere Quellen der Zeit geben an, daß Guérin die Longus-Ausgabe von 1731 vertrieben hat, so das Journal des Sçavans im August 1731: „…Guérin a achevé une jolie Edition des Amours Pastorales de Daphnis & Chloe…“, allerdings soll sie in einem anderen Haus gedruckt worden sein. Nach Barber (Daphnis and Chloe, 37) hat Jacques Guérin 1731 eine permission tacite für die Ausgabe erhalten, die Publikation wurde demnach gestattet, doch durfte das (richtige) Impressum nicht genannt werden. Guérin hatte 1729 die Witwe des Verlegers Antoine-Urbain Coustelier geheiratet; vielleicht erklärt die parallele Produktion der
Ausgabe in beiden Häusern die Druckvarianten; dann dürfte die Pompadour-Variante A bei Guérin, Variante B aber im Hause Coustelier hergestellt worden sein.
Der bestens erhaltene, nur gering beriebene Einband im Stil des J.-A. Derome Père ist von verhältnismäßig schlichter Noblesse, zwar nur mit glattem, sparsam und sehr zierlich vergoldetem Rücken, dafür aber mit dem sehr prachtvollen und kräftigen Supralibros, das im Zentrum die drei Türme zeigt, auf beiden Deckeln, also dem Wappen, das ihr im Juli 1745 anläßlich der Erhebung zur Marquise verliehen worden war – einer der typischen und bekannten Pompadour-Einbände für Bücher in kleinerem Format. Sehr schönes, flekkenfreies Exemplar auf fein geripptem Papier, mit dem Wasserzeichen „Manufactur“ (siehe auch unsere Nummer XXVI).
Provenienz: Das Exemplar ist wohl bald nach 1745 für die Mätresse Ludwigs XV., Madame (= Marquise) de Pompadour, gebunden worden; in ihrem Auktionskatalog (Catalogue Pompadour 1765) war es die Nr. 1471, verkauft für 6.15 frs. Seither war es in wechselnden, meist wohl französischen Privatsammlungen, die leider mangels Exlibris oder Einträgen nicht namhaft zu machen sind (Quentin-Bauchart, Les femmes bibliophiles, Bd. II , zitiert es nicht).
Bibliographische Referenzen:
Cohen/De Ricci, Sp. 651/52. Péreire, Notes, S. 62 f. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 314 f. Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, S. 514. Boissais/Deleplanque, Le Livre à gravures, S. 115. Portalis/Beraldi, Les graveurs, Bd. III , S. 535. Barber, Daphnis and Chloe, 37. Lewine, Illustrated books, S. 322. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1222. Gay/Lemonnyer, Bd. I, Sp. 183 f.
Vollständig angerändertes
Exemplar mit der Regentensuite auf Papier im Quart-Format
XXII [Longus.] Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, Guérin und wohl Coustelier veuve,] 1731.
Mit zwei gestochenen Titeln, der eine von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, der andere von J.-B. Scotin zur Ausgabe Paris 1716, 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Regenten Philippe d’Orléans sowie der „Petits pieds“ genannten Kupfertafel in der Fassung von J.-B. Scotin, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX Seiten (Titel in Rot und Schwarz, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot; Text und Tafeln durchgehend in Rot regliert).
Kollation: π 1 a4 A–L 8 M 2 Klein-Oktav, allseitig angerändert auf Quart (219 x 172 mm).
Dunkelgrüner Maroquineinband um 1760/70 auf fünf Bünden zu sechs Kompartimenten, der goldgeprägte Titel auf rotem Maroquin-Rückenschild im zweiten von oben, die übrigen jeweils mit einem Granatapfel im Zentrum, gerahmt von Kastenvergoldung mit beidseitigem Dent-de-rat-Besatz, kleinen Blumen in den Ecken und Vögeln an den Seiten, die Deckel mit Rahmenvergoldung aus Fileten mit äußerer Dent-de-rat-Reihe, daran eine Folge aus doppelten Segmentbögen, der innere in Pointillé, in den Segmenten kleine flatternde Vögel zwischen je zwei Goldpunkten, die Deckelbordüre nach innen mit reicher Dentelle-Vergoldung aus verschiedenen gereihten meist floralen Einzelstempeln, darunter
Granatäpfel, Blumen und Sterne; Stehkantenfilete mit Dent de rat, Innenkantenbordüre mit Blattund Blütenmotiven im Wechsel, Augsburger Brokatpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Dieses ist eines jener äußerst seltenen, ganz besonderen Exemplare, für dessen Illustration ein auf größerem Papier gedruckter Zyklus mit den Tafeln des Regenten zur Ausgabe von 1718 zur Verfügung stand. Schon im mittleren 18. Jahrhundert hat man erkannt, welch große Rarität hier vorliegt und deshalb, wie im Falle unseres Exemplars Nummer VIII , weder Kosten noch Mühe gescheut, das gesamte Buch auf das vorhandene Quartformat der Tafeln zu bringen, indem nun jede der kleinen Textseiten in einen breiten Rahmen integriert worden ist. Zugute kommt das insbesondere den querformatigen Tafeln, die ohne Falze ihre volle gemäldeartige Wirkung entfalten können. In der Tat merkt man den Kompositionen so einen Nachklang von dem an, was sie einst waren – Gemälde mit Landschaften, die sich an niederländischen und italienischen Traditionen orientieren. Auch im 18. Jahrhundert müssen solche breitrandigen Exemplare der Regentensuite nur in äußerst wenigen Exemplaren vorgelegen haben. Sie könnten aus einer Separatauflage stammen, die parallel zur oder nach der Buchausgabe veröffentlicht worden ist, immerhin liegt hier auch der gestochene Titel Coypels von 1718 in diesem Format vor, doch ist dazu nichts weiter bekannt.
Um aus diesem Exemplar eine noch größere Besonderheit zu machen, hat man es weiterhin getrüffelt und mit dem Titel der Scotin-Suite bzw. der Buchausgabe des Jahres 1716 versehen, der allerdings ebenso durch Anrändern auf Quartgröße gebracht werden mußte. Überraschenderweise ist aus diesem Zyklus auch die Petits-pieds- Darstellung in der Fassung Scotins übernommen worden, angerändert und an der richtigen Textstelle ein-
gebunden, die Seite 96, die das Stelldichein von Daphnis und Lycaenion schildert – es war also eine kundige Hand am Werk (die Seitenzahl 133 auf der Tafel ist hier ohne Belang, sie bezieht sich auf die Pariser Erstausgabe). Die andere Petits-piedsTafel, Conclusion du roman des Grafen Caylus, ist dagegen nicht vorhanden. Auch dieser Druck liegt in der Variante A, derjenigen des Pompadour-Exemplars, vor.
Der in einer besonderen und sehr charakteristischen Gestaltungsart gefertigte Einband ist vor allem durch die Komposition seiner Deckelbordüre einer Gruppe ähnlicher Arbeiten zuzuordnen, deren verbindendes Motiv die Reihung flacher Segmentbögen ist, die sich nach innen leicht wölben und so eine wellenartige Basis für eine Bordüre bilden, die sich vollkommen aus Einzelstempeln aufbaut und nicht mit einer Rolle geprägt worden ist. Diese Dentelle-Vergoldung ist daher nicht so fein und regelmäßig wie viele der Rollenstempel ihrer Zeit, dafür aber individuell, mit vielen kleinen Variationen und minimalen Abweichungen gestaltet, was ihren besonderen Reiz ausmacht. Neben Granatäpfeln, Blumen, Sternen, Goldringen und -punkten findet sich hier auch das Motiv eines kleinen Vogels, der ganz unscheinbar bereits im Rahmenwerk der Rückenkompartimente auftauchte, an den Deckeln jedoch unterhalb der Segmentbögen erscheint, hier in voller Figur, mit sehr spitzen, weit ausgebreiteten Flügeln. Dies ist nicht der Derome-Vogel, wiewohl auch er gefangen ist, unter den Bögen, sich also gewissermaßen ebenfalls im Käfig befindet. Sieht man ganz genau hin, erkennt man, daß unter den jeweils letzten Segmenten der Längsseiten bei den Ecken ein anderer Vogelstempel verwendet wurde, ein sitzendes Küken oder vielleicht auch eine schwimmende Ente. Diese Buchbinderwerkstatt verfügte demnach über ein gewisses größeres Repertoire
an Formen und Varianten. Der Einband unserer Nummer XXVI stammt vielleicht auch aus dieser Werkstatt, er ist kompositionell nahe verwandt, aber mittels anderer Motive gestaltet. Der Gruppe können noch andere Einbände zugeordnet werden, darunter auch einer aus der Sammlung Mortimer L. Schiff (Schiff Collection Bd. I, Nr. 85), der das Etikett des Buchbinders Bargeas aus Bergerac trägt. Hier sind es jeweils kleine Herzen, die unter den Segmentbögen von je zwei Ringen flankiert werden. Die Verwandtschaft ist eng, doch für eine Zuschreibung unseres Einbandes an Bargeas fehlen weitere aussagekräftige Vergleiche. Barber dokumentiert das Segment-Motiv ebenfalls, doch ist dieser Einband keinem bestimmten Atelier zugeordnet (Barber, Rothschild, Roll 114). Ein Indiz, das auch für Bargeas sprechen könnte, ist die Verwendung von dünnem und sehr feinem fliegenden Vorsatzpapier mit 1742 datiertem Wasserzeichen Limosin fin , also aus einer Papiermühle, die ebenfalls im südwestfranzösischen Raum tätig war. Das Papier der Spiegel und der äußeren fliegenden Vorsätze ist dagegen ein Brokatpapier in der Art oder von dem Augsburger Georg Christoph Stoy, etwa aus der Zeit um 1720 (vgl. Haemmerle, Buntpapier, S. 112, Abb. 99).
Provenienz: Die älteren Besitzer sind nicht zu erschließen, doch findet sich auf dem vorderen Vorsatzpapier ein interessanter Vermerk: „No. 697. Bis.“ Wir haben in einem Bestandskatalog der Stadtbibliothek in Genf einen Eintrag ausfindig gemacht, wo unter der Nummer 697 ein Exemplar einer anderen Longus-Ausgabe verzeichnet ist (Catalogue de la bibliothèque publique de Genève, Bd. III , Genf 1879, S. 1365), so daß das Exemplar sich zeitweise in dieser Bibliothek befunden haben könnte, zumal der letzte Besitzer, Jean-François Chaponnière (1919–2005), aus Genf stammte.
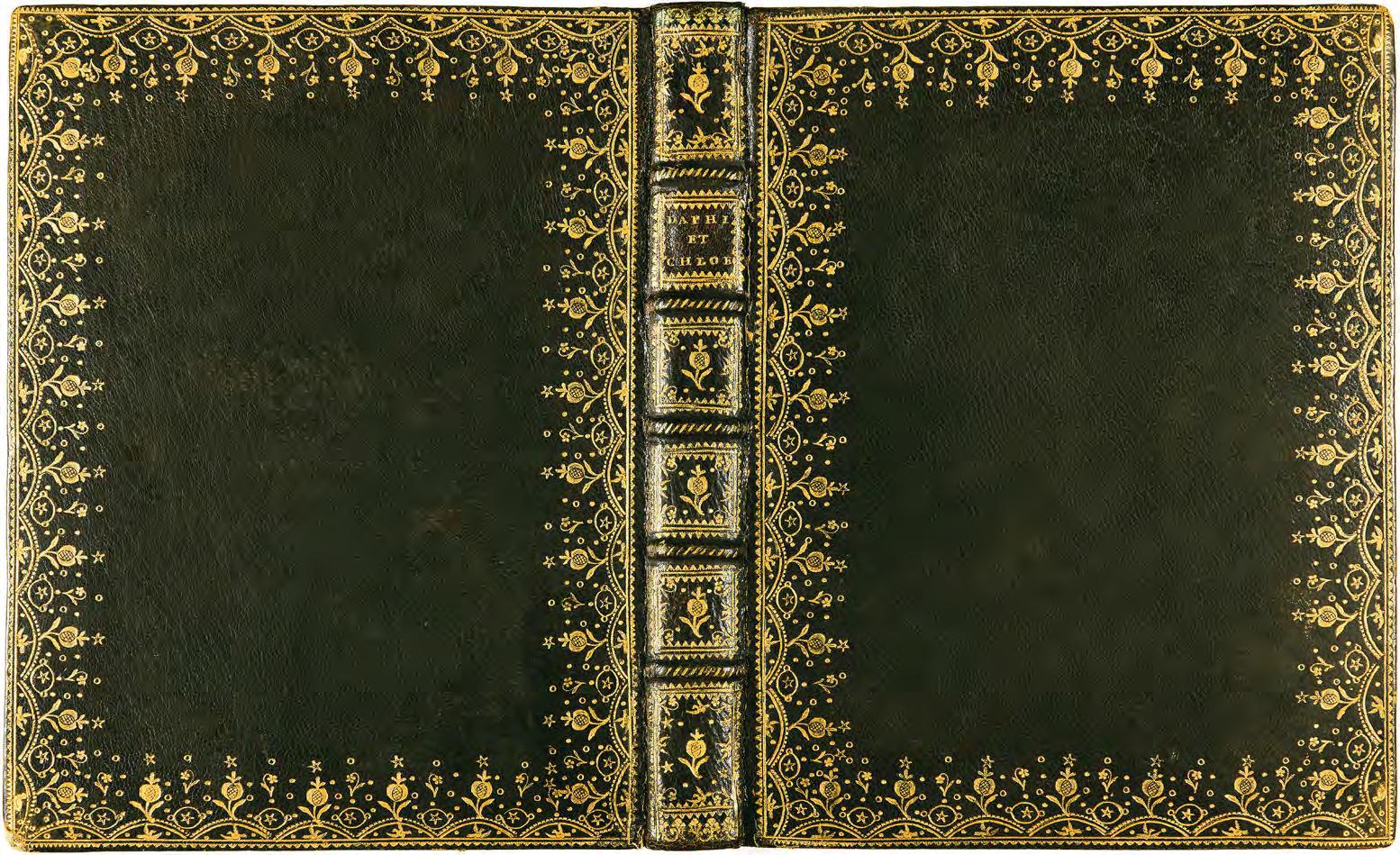
Regliertes Exemplar in einem prächtigen Mosaikeinband im Stil des Atelier des petits classiques
XXIII [Longus.] Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, Guérin und wohl Coustelier veuve,] 1731.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Regenten Philippe d’Orléans sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, signiert „Vidal direx[it]“, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX Seiten (Titel in Rot und Schwarz, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot; Text und Tafeln durchgehend in Rot regliert).
Kollation: π 1 a4 A–L 8 M 2 Klein-Oktav (158 x 97 mm).
Dunkelroter französischer Maroquineinband um 1770/80 auf fünf Bünden zu sechs Kompartimenten, der goldgeprägte Titel auf schwarzem Maroquin-Rückenschild im zweiten von oben, die anderen mit jeweils einer zentralen, auf der Spitze stehenden Vierpaß-Intarsie im Wechsel in dunkelgrünem sowie zitronenfarbenem Maroquin und verziert mit je fünf kleinen Goldpunkten und -kreisen, in den Ecken florale Motive in Pointillé, am Fuß eine zierliche florale vergoldete Bordüre über Maroquin-citron-Einlage, Einfassung des Rückens mittels Kastenvergoldung, die Deckel mit doppelter Filete, nach außen Dent-de-rat-Besatz, innen breite Bordüre aus gereihten Vierpässen, die vier an den Ecken liegend und in Maroquin-citron intarsiert,
die Vierpässe entlang der Kanten auf die Spitze gestellt, blütenartig und teils in Pointillé ausgeführt, dazwischen Goldpunkte und Ringe, im Zentrum eine stark geschwungene Zierkartusche nach venezianischer Art, die Einlegearbeit in dunkelgrünem Maroquin, vollständig von feinen goldenen Linien eingefaßt, die Binnenform mit ebenso stark geschwungenen Aussparungen, diese im Fond des roten Maroquins, in der Mitte eine kleine Kreisscheibe als Intarsie in Maroquin-citron, das ganze Mittelstück verziert mit feiner Ornamentik à petits fers; Stehkantenfileten, schmale florale Innenkantenbordüre, die Vorsätze mit Bronzefirnispapier in Punkt- und Sternchen-Muster aus der Augsburger Manufaktur des Johann Wilhelm Meyer sowie Ganzgoldschnitt, im Stil der Mosaikeinbände des sogenannten „Atelier des petits classiques“.
Dieses prachtvoll gebundene und herausragend schöne Exemplar der Ausgabe von 1731 eröffnet interessante Einblicke in die Entwicklungsgeschichte der französischen Mosaikeinbände des 18. Jahrhunderts. Wiewohl man den Dekor eindeutig der von etwa 1720 bis um 1740 tätigen, von Michon als L’atelier des petits classiques bezeichneten Buchbinderwerkstatt zuordnen kann, ist dieser Einband mit Sicherheit nicht von dieser geschaffen worden, sondern von einem in der zweiten Jahrhunderthälfte tätigen Meister, der den Stil erneut aufgegriffen, ja nachgeahmt hat. Man könnte ihm den Notnamen Nachfolger des Atelier des petits classiques geben. Es muß sich dabei um einen Buchbinder von hohem künstlerisch-handwerklichen Rang handeln, der zwei besondere Charakteristika des Schaffens der älteren Werkstatt übernommen hat: das langgestreckte Mittelstück mit seiner stark gewundenen Kontur und die in vielen Varianten eingesetzte Leitform des Vierpasses, oder auch Kleeblattes, aus der die Rückenornamente und die Deckelbordüren gebildet werden.
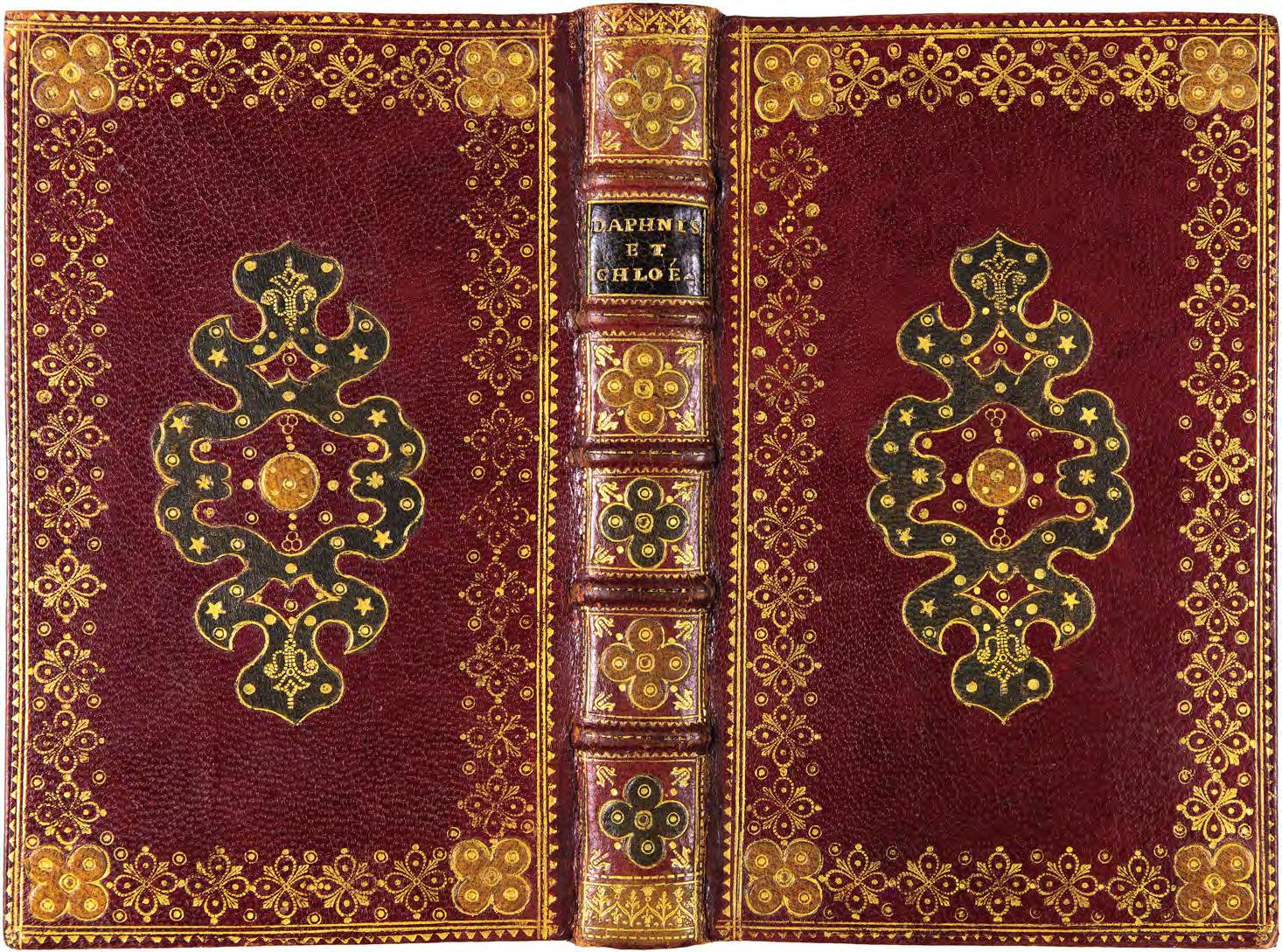
Unterschiede zwischen der ersten Werkstatt und ihrem einige Jahrzehnte später tätigen Nachfolger zeigen sich vor allem anhand der wesentlich kräftigeren Formenverwendung des früheren (man vergleiche in unserem Katalog Mosaik-Einbände die Nummern 2 und 3) gegenüber der dem Zeitstil gemäß weit grazileren, allerdings schon ein wenig eklektizistisch wirkenden Handschrift des späteren Ateliers. Belegen können wir diese Hypothese dadurch, daß in unserem Exemplar die Tafel mit den Petits pieds in der Fassung des Géraud Vidal vorliegt, die frühestens in der Ausgabe Bouillon 1776 nachgewiesen werden kann und zweifelsohne für diese Edition, im Rahmen eines kompletten
seitenverkehrten Nachstichs der Regentensuite, geschaffen worden ist. Da diese Tafel in unserem Exemplar vom Buchbinder mit eingebunden worden ist und sicher nicht nachträglich hinzugefügt wurde, zumal sie ebenfalls die Reglierung aufweist, die das ganze Exemplar erhalten hat, muß das Binden also erst nach Entstehung dieser Tafel erfolgt sein, also frühestens um die Mitte der 1770er Jahre. Die Hinzufügung der Petits pieds in der Fassung Vidals diente wohl dem gelegentlichen Ersatz für die Fassung des Comte Caylus, die nicht immer zur Hand war; denn wir finden diese Tafel auch bei einem unserer Exemplare der Ausgabe von 1745 (Nummer XXVI).
Damit können wir, in Ergänzung zu Michon, ein zweites, deutlich später tätiges Buchbinderatelier, das Mosaikeinbände in diesem venezianischen Stil angefertigt hat, erkennen und von dem früheren unterscheiden. Ein sehr enger Verwandter unseres Einbandes fand sich vor einigen Jahren im französischen Handel, eine zweibändige, im Jahr 1700 gedruckte Ausgabe der Oeuvres von Marot, hier in schwarzem Maroquin mit Intarsien in Citron und Rot. Der Vergleich dieser Einbände zeigt sehr schön, wie dieses Atelier mit einem verhältnismäßig geringen Motivschatz seine Einbände durch einfallsreiche Varianten in der Kombination von Stempelformen und farbigen Intarsien immer wieder neu und reizvoll gestaltet hat.
Bei dem vorliegenden Druck handelt sich um die Variante A der Ausgabe von 1731, der auch das Pompadour-Exemplar angehört, mit allen Erkennungsmerkmalen, die wir benannt haben. Der große Unterschied zu diesem Exemplar liegt jedoch in der Illustration: Ist dort die Scotin-Suite eingebunden, so findet sich hier der ganze Regentenzyklus in seiner Urfassung von 1714/18 mit dem 1718 datierten Frontispiz.
Die Tafeln liegen in sauberen und kräftigen Abdrucken vor, die sich nur anhand geringer, sehr feiner Unterschiede von Kupfern in Exemplaren der originalen Regentenausgabe unterscheiden, was wohl auf die minimalen Überarbeitungen und Säuberungen durch Charles-Antoine Coypel in den 1720er Jahren zurückzuführen ist.
Ein vorzügliches, fast fleckenloses Exemplar, geadelt durch seinen farbenprächtigen Einband wie auch die feine Reglierung in Rot, gedruckt auf Bütten mit dem Wasserzeichen „Manufactur“.
Provenienz: Ältere Exlibris entfernt, davon noch leichte Spuren auf dem vorderen Spiegel, vorhanden nur das Exlibris von Ludovic Froissart, dessen Bibliothek im Januar 1977 veräußert worden ist, sowie dasjenige des letzten Besitzers Jean-François Chaponnière (1919–2005), dessen Bibliotheksversteigerung im November 2019 bei Sotheby’s in Paris stattgefunden hat (Nr. 136).
Michon, Les reliures mosaïquées, S. 49 f. und Nr. 76. Tenschert, Katalog LXXXIV, à compartiments, S. 12–17. – Alle Angaben zur Bibliographie der Ausgabe von 1731 unter unserer Nummer XXI .
Das von de Ricci zitierte Exemplar auf Pergament in doubliertem Maroquin mit der Regentensuite, aus den Sammlungen
Dent – Hanrott – Crozet –
Baudelocque – de Lassize –
Guntzberger – Portalis – R. Hoe –L. Gougy
XXIV [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, Guérin und wohl Coustelier veuve,] 1731.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran nach dem Regenten Philippe d’Orléans, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf (davon vier historisierten) Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX Seiten (Titel, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π 1 a4 A–L 8 M 2 (auf Pergament gedruckt und in Rot regliert).
Klein-Oktav (157 x 97 mm).
Dunkelroter französischer Maroquineinband des 18. Jahrhunderts (ca. 1731–1735), der Rücken auf fünf erhabenen Bünden mit Filetenrahmen, die sechs Kompartimente bis auf das titeltragende mit reichster ornamental-floraler Vergoldung, teils in Pointillé, Deckel mit breiter Dentelle-Bordüre aus verschiedenen Einzelstempeln, darunter Muscheln in verschiedener Ausprägung, ornamentalen Blüten in Pointillé-Vergoldung, Sternen etc.; Stehkantenvergoldung, doubliert mit olivgrünem Maroquin in weiterer Dentelle-Bordüre, fliegende rosa Seidenmoiré-Vorsätze, Ganzgoldschnitt, von L.-A. Boyet oder A.-M. Padeloup , in Maroquin-Steckschuber.
Eine der höchsten Verwirklichungen von Bibliophilie, in der vom Druck und dem Material, über die Illustrationen, bis hin zum unvergleichlich schönen Einband, alles von Beginn an vom Willen zur Perfektion durchdrungen war und diesen bis heute ungeschmälert beglaubigt: ein Höhepunkt auch dieses Katalogs. Für den vorliegenden Pergamentdruck nach der Druckvariante B der Ausgabe von 1731 wurden nicht die acht Kupfer von Scotin, sondern das Frontispiz und die 28 Kupfertafeln nach den Gemälden des Régent in Abdrucken auf Papier eingebunden. Die schönen Rokoko-Vignetten mit spielenden Eroten stehen jeweils zu Beginn der vier Bücher; sind diese Kupferstich-Vignetten gewöhnlich ohnehin in klarerem Abdruck als bei der Druckvariante A vorhanden, so gewinnen sie auf Pergament zusätzlich an Leben. Zudem sind hier, in der Druckvariante B, vier der fünf Holzschnitt-Initialen historisiert. Während die erste, das „L“, ähnlich der Variante A gestaltet ist, also lediglich mit spärlichen Blattranken über Querschraffur, sind die übrigen Initialen mit reizvollen miniaturhaften Landschaften verziert.
Unser Exemplar, von staunenswerter Erhaltung innen wie außen, ist auf ein penibel regliertes feines, aber nicht durchschlagendes Pergament gedruckt, das wohl vom Lamm stammt. Der Einband ist von jener souverän meisterlichen Solidität, die der Baron Pichon den besten Einbänden für den Grafen Hoym nachrühmt, welche er nicht Padeloup, sondern Augustin du Seuil zuschreibt: der vorliegende hat allerdings noch mehr Ähnlichkeit mit den Einbänden des berühmten Luc-Antoine Boyet, so daß er hier diesem gegeben wird, nicht ohne ein kleines Fragezeichen (vgl. den Katalog Esmerian, Teil II , Nr. 67 und 68 – zur Ähnlichkeit mit Padeloup-Einbänden siehe Barber, Rothschild, W.Cat. 419, letzterer zugeschrieben an Padeloup le jeune, hier ist vor allem die Gestaltung
der Rückenkompartimente sehr ähnlich, allerdings erinnern die gebogenen Blätterzweige in den vier Ecken doch sehr an die Art Boyets).
Provenienz: Eventuell befand sich das Exemplar im 18. und frühen 19. Jahrhundert in der Sammlung des marchand amateur J. Chardin, wie van Praet (Praet, Livres imprimés sur vélin, Bd. IV, S. 244, Nr. 368) angibt, aber wenn wir seinen Eintrag wörtlich nehmen, besaß das Chardin-Exemplar keine Kupfer, wie dasjenige der Bibliothèque Royale (sozusagen der nicht um Tafeln angereicherte Normalzustand dieser Ausgabe): in den drei französischen Chardin-Katalogen 1806, 1811 und 1824 findet sich das Exemplar nicht, allerdings gab es 1819 bei Sotheby’s eine Auktion „The Chardin Collection“, deren Katalog uns nicht vorliegt, aus dem sich John Dent bedient haben könnte. Sicher ist jedenfalls, als erster nachweisbarer Besitzer, John Dent; in dessen Auktion 1827 bei Evans, London, wurde es im Teil I versteigert (Catalogue Dent 1827, Nr. 1352 für £ 3.3.0 an Thorpe). Dann war es kurze Zeit im Besitz von Ph. Hanrott, auf dessen zweiter Auktion 1833 es wieder in den Handel kam (Catalogue Hanrott 1833, Nr. 2202, für £ 3.19.0 an Techener). Der Sammler-Händler Crozet (Nachfolger der Debure) besaß es; in seiner zweiten Pariser Auktion 1841 wurde es für 73 Goldfrancs verkauft (Catalogue Crozet 1841, Bd. II , unter Nr. 1748). Sodann: E. Baudelocque, Auktion 1850 (Catalogue Baudelocque 1850, Nr. 1129: frs. 61,50). Hubert de Lassize, Auktion 1862 (Catalogue Lassize 1862, Nr. 674: frs. 330.–). H. Guntzberger, Auktion 1872, (Catalogue Guntzberger 1872, Nr. 4: frs. 1.160.–). Baron R. Portalis, Auktion 1882, (Catalogue Portalis 1882, Nr. 64: zurückgezogen); derselbe: Auktion 1889 (Catalogue Portalis 1889, Nr. 205: frs. 600.–). Robert Hoe, der wohl bedeutendste amerikanische
Büchersammler: Auktion II , New York (Catalogue of the Library of Robert Hoe 1911/12, Bd. II , Nr. 2088: $ 190.00). Lucien Gougy, Auktion I, Paris 1934, (Bibliothèque Gougy 1934–1936, Tl. I, Nr. 499: frs. 3.150.–).
Von der Luxusausgabe auf dem schönen, nicht zu dünnen Pergament sind wohl insgesamt vier oder fünf Exemplare abgezogen worden:
1. Das Exemplar Garnier – MacCarthy (nicht im Cat. 1817) – Nodier (Auktion 1844, Nr. 777) –Cigongne (Katalog 1861, Nr. 1786) – Duc d’Aumale, Chantilly, in zitronenfarbenem Mosaikeinband von Padeloup, enthaltend ebenfalls die Suite von 1718.
2. Das vorliegende.
3. Das erste Exemplar der Bibliothèque nationale de France: ohne Kupfer! (Van Praet, Livres imprimés sur vélin, Bd. IV, S. 244, Nr. 368; V, S. 376; VI , S. 106).
4. Das zweite Exemplar der Bibliothèque nationale de France?: mit den Kupfern von Scotin (Van Praet IV, S. 244, Nr. 367); sowie eventuell:
5. wenn es sich nicht um die Nummer 2 handelt, das Exemplar Chardin, zitiert bei Van Praet IV, S. 244, Nr. 368.
Unser Exemplar, das ein ebenbürtiges nur in Chantilly hat, ist größer als die beiden BnF-Exemplare (beide 153 mm hoch), innen wie außen fleckenlos erhalten, die Kupfer sind im schönstem Zustand der Gratigkeit – es ist wie die Verwirklichung eines bibliophilen Traumes, ausführlich zitiert von Cohen und De Ricci (Sp. 652).
Bibliographische Referenzen siehe unter unserer Nummer XXI .
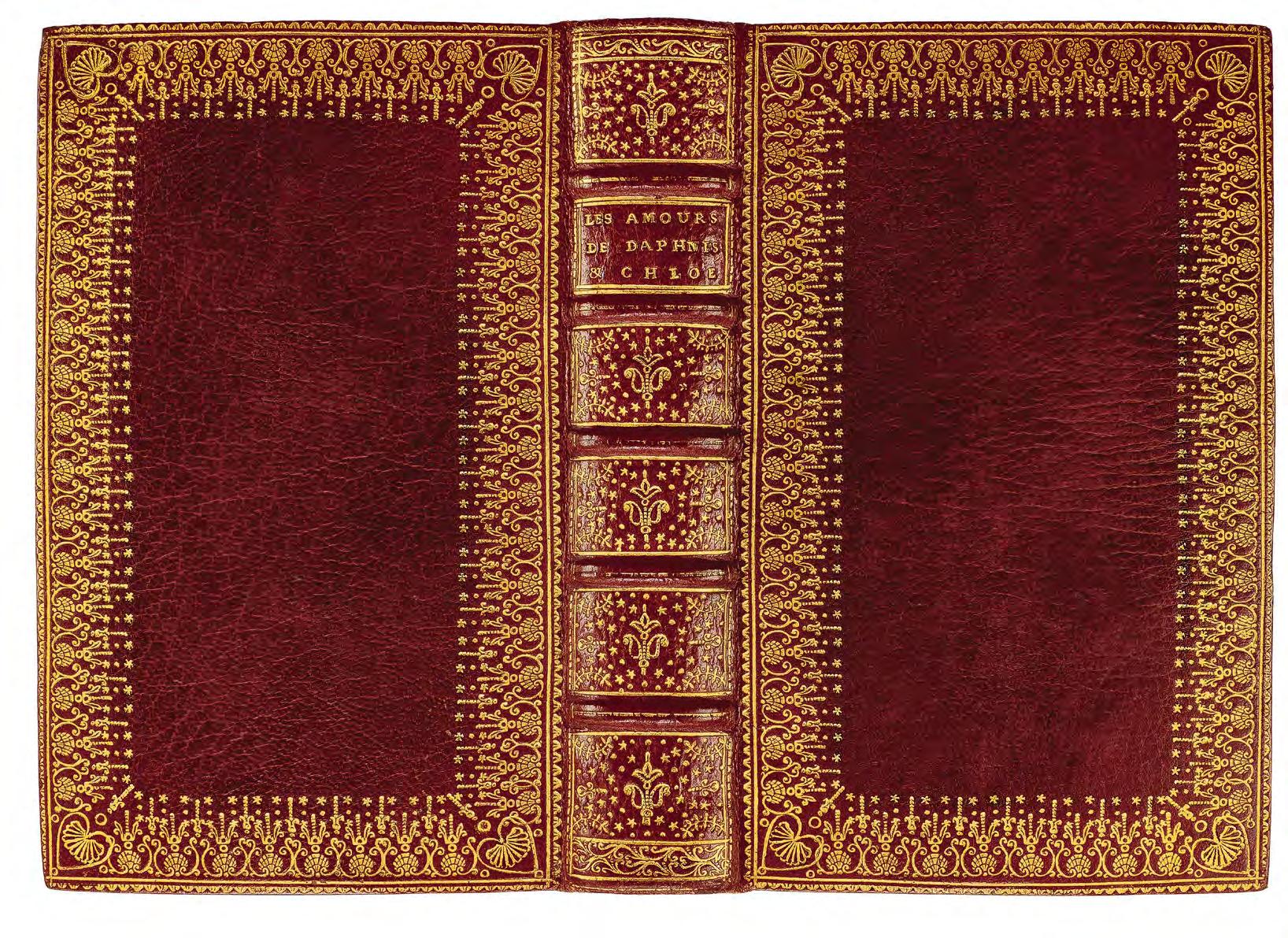
Die Variante in Klein-Oktav der Ausgabe von 1745, mit Cochins Vignetten
XXV [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 29 (davon 13 gefaltete doppelblattgroße) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans mit der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur und Bezeichnung), alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π 1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (154 x 94 mm).
Blonder Kalbledereinband der Zeit auf glattem Rücken, die sechs Rückenkompartimente mit floralornamentaler Vergoldung, Deckel in schwarz geprägtem Filetenrahmen, Stehkantenfilete, Marmorpapiervorsätze, Rotschnitt.
Ein gutes Exemplar der Kleinoktav-Ausgabe von 1745, für die man, wie wir seit Rahir (1924) und vor allem von Péreire (Notes, 1926, S. 59 ff.) wissen, sowohl die gesamte Suite der Stiche nach dem Regenten von 1718 (insgesamt 30, den datierten Titel und die Petits pieds eingeschlossen) als auch die Titel- und die vier Kopfvignetten von 1731 neu hat stechen lassen. Da sich die Kupferplatten der Regentensuite noch im Besitz des jüngeren Coypel befanden und erst 1752, nach seinem Tod, wieder
in Gebrauch kamen, war die Illustration mittels neuer Stiche erforderlich geworden. Man kann die neuen Kupfer recht leicht von den Originalen unterscheiden, da der Stich nicht so fein wie diese ausgeführt wurde, insbesondere die Köpfe wirken derber, die Schraffuren sind kräftiger geraten, gitterartiger gesetzt, viele Details wurden verändert, manchmal gar ein wenig anders interpretiert, und nicht zuletzt unterscheiden sich Größe und Positionierung der Stechersignaturen von der Vorlage –aber immer unter Beibehaltung der alten Datierung und Autorschaft: „Philippus invenit et pinxit 1714“. Dem Käufer, der nicht in der Lage war zu vergleichen, wurde natürlich suggeriert, hier das Original in bester Abdruckqualität vor sich zu haben. Darüber hinaus hat der Verleger dieser Ausgabe, welche die Pompadour-Variante (A) von 1731 mit nur sehr geringen Veränderungen im Schriftsatz wiederholt, allerdings auch neue Illustrationen angedeihen lassen.
Die Vignetten von 1731 wurden nachgestochen, aber nicht an denselben Stellen eingedruckt, sondern ausgetauscht. Als echte Neuerung kamen die vier entzückenden Schlußstücke des Charles-Nicolas Cochin hinzu. Und hier entsteht, nach guten drei Jahrzehnten der Daphnis-und-Chloé-Illustration des 18. Jahrhunderts, tatsächlich ein substantielles Novum, es manifestiert sich hierin nicht allein ein anderer Stil – eine veränderte Ästhetik setzt der alten naiv-erzählerischen Folge von Abbildungen traumhaft-flüchtig anmutende Rokoko-Szenerien entgegen. Die vier Culs-de-lampe Cochins des Jüngeren markieren fast schmerzlich den scharfen Epochenbruch in der Buchillustration der Zeit; mit den Werken dieses großen Mannes wird den heiter-harmlosen Bildern aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Kunst gegenübergestellt, die erahnen läßt, was Buchillustration jenseits bloßer szenischer Bebilderung zu leisten vermag.
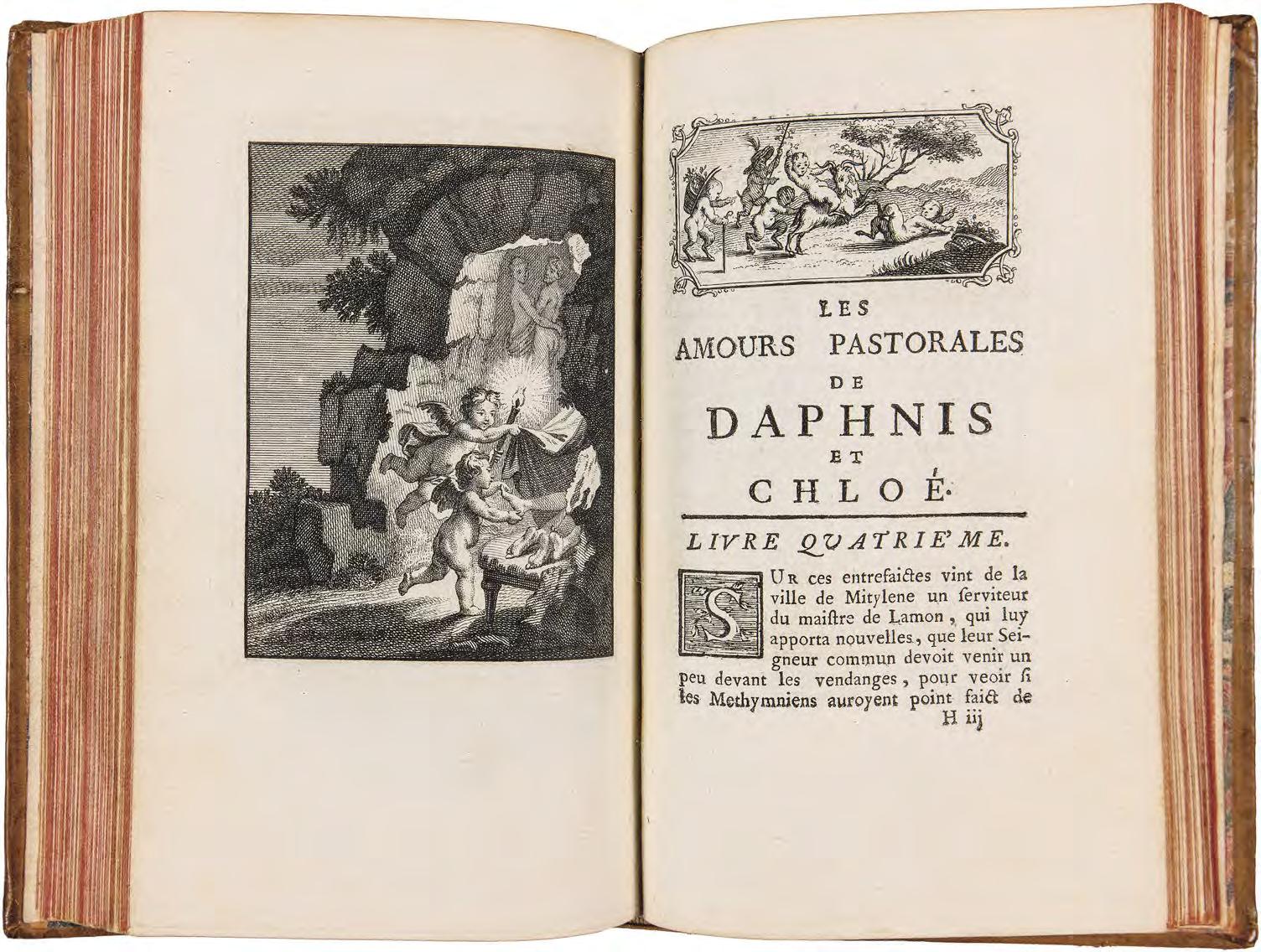
Ausgerechnet diese wundervollen Vignetten fehlen jedoch in den Quart-Ausgaben unerklärlicherweise oftmals; nämlich dann, wenn die entsprechenden Exemplare noch von Hand dekoriert werden sollten, durch Kolorit der Tafeln, eingemalte Rahmen und Reglierung (siehe unten, die Nummern XXXII , XXXIV, XXXV und XXXVI).
Der ungenannte Verleger der Ausgabe war wohl das Haus Coustelier, das mit einiger Sicherheit bereits an derjenigen von 1731 mitgewirkt hatte. Wie schon Portalis und Beraldi schreiben, arbeiteten Coustelier und Cochin um das Jahr 1745 eng zusammen; Cochin „avait dessiné une agréable série de vignettes“, um mehrere Werke des Verlegers zu illustrieren (Portalis/Beraldi, Bd. I, S. 515).
Dieses Exemplar ist sehr gut erhalten, nahezu flekkenfrei, nur vereinzelt mit ganz leichtem Wasserrand und in einem hübschen veau fauve-Einband der Zeit.
Bibliographische Referenzen:
Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 651/52. Péreire, Notes, S. 61–70. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 315 f. Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, S. 514. Barber, Daphnis and Chloe, 38. Ray, The French Illustrated Book, S. 10 f. Michel, Cochin et le livre illustré, Nr. 51. Lewine, Illustrated books, S. 322. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1223. Quérard, La France littéraire, Bd. V, S. 351. Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1158. Ebert, ABL , 12242 (fälschlich als Nachdruck der Ausgabe von 1718).
Exemplar der Ausgabe von 1745 in einem hübschen Maroquineinband der Zeit mit Dentelle-Vergoldung
XXVI [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 gefaltete doppelblattgroße als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, alles in Nachstichen gegen 1745, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, signiert „Vidal direx[it]“, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π 1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (152 x 96 mm).
Roter französischer Maroquineinband der Zeit auf glattem Rücken, die sechs Kompartimente mit floraler Vergoldung und hellbraunem MaroquinRückenschild im zweiten von oben, Deckel mit Rahmenvergoldung aus Fileten mit äußerem Dentde-rat-Besatz, einer Reihung aus doppelten Segmentbögen und Dentelle-Vergoldung aus verschiedenen stilisierten, unverbunden gereihten floralen Stempeln; Stehkantenfilete, Innenkantenbordüre, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Ein sehr dekorativ gebundenes Exemplar der Normalausgabe von 1745 mit der neu gestochenen Illustrationsfolge des Regenten, nach dem Erstdruck aus dem Jahr 1718. Wie so oft, wurde auch
hier der Nachstich des vormaligen Kupfertitels vor das neue Titelblatt gebunden, um den Anschein einer früheren Ausgabe zu evozieren, jedoch sind die liebreizenden Schlußvignetten nach Nicolas Cochin das untrügliche Zeichen der Ausgabe von 1745. Interessant ist hier, daß die Petits pieds seitenverkehrt nachgestochen sind, mit der alten Betitelung Conclusion du Roman und der Stechersignatur Vidal direx[it] versehen; in dieser Form wird die Tafel tatsächlich von Cohen (Guide de l’amateur, 4. Auflage, 1880, Sp. 283) für die Ausgabe von 1731 (!) angeführt, doch de Ricci erwähnt diesen Stecher – es handelt sich um den Reproduktionsgraphiker Géraud Vidal – als Illustrator diverser Werke der zweiten Jahrhunderthälfte gelegentlich, wobei seine Arbeiten als „médiocre“ qualifiziert werden, von unserer Tafel läßt sich kaum Besseres sagen. Hat man eine Seite zuvor die vorzügliche Vignette Cochins gesehen, mag man beim Umblättern kaum glauben, daß sich Illustration von derart disparater Qualität in einem einzigen Band vereint. Doch ist auch dieser Aspekt Teil der Editionsgeschichte von Daphnis und Chloe im 18. Jahrhundert. Tatsächlich stammt die Tafel aus einer sehr späten Ausgabe mit Nachstichen der Regentenfolge, man vergleiche etwa unsere Nummer LXV aus dem Jahr 1792. Die Tafel, schlechter erhalten und auf anderem Papier gedruckt als die anderen, ist demnach eine spätere Ergänzung.
Im Gegensatz zu anderen Exemplaren dieser Ausgabe scheint dieses auf einem etwas dünneren Papier gedruckt, was entweder auf qualitative Unterschiede innerhalb der Normalausgabe hinweist oder aber das Resultat der ungleichen, individuellen Vorgehensweise des Buchbinders ist, der dieses Exemplar womöglich stärker geleimt oder gepresst hat. Jedenfalls besitzen alle verwendeten Papiere der Normalausgabe das Wasserzeichen Manufacture Royale F. Der hübsche Einband ist eine charakteristische Ar-

beit des mittleren 18. Jahrhunderts, insbesondere die separierte Anordnung von Einzelstempeln überwiegend floraler Motive, die in der Zusammenschau ein höchst dekoratives, reizvolles Gesamtbild ergeben, großzügiger wirkend als manche der aus Rollenstempeln gebildeten, oft sehr dichten Bordüren. Eine derartige Gestaltung mit ähnlichen Stempeln findet man in dieser Zeit an einigen Einbänden, darunter Barber, Rothschild, W.Cat. 556 und 448, letzterer sogar mit einer exakt überreinstimmenden Gestaltungsform, der schmalen Rückenbordüre, dort am Kopf, hier am Schwanz auftretend (Pal. 119); das Segment-Motiv der Deckel ist bei Barber ganz ähnlich, ohne Zuschreibung, unter Roll 114 angeführt.
Provenienz: Das Titelblatt weist einen Besitzerstempel mit ligiertem Monogramm „ AWGR“ auf, überstiegen von einer neunzackigen Krone (Grafenkrone), wohl eines Angehörigen des Hauses der Comtes de Renesse (vgl. Lugt, Les marques de collections, 1209). – Zuletzt in der ErotikaSammlung Karl Ludwig Leonhardt (1922–2007).
Ein bis auf den Kupfertitel und wenige kleine Fleckchen schönes, sauberes Exemplar mit kontrastreichen Abzügen der Kupferstiche. Das Blatt mit der Lagensignatur K1 mit einer unauffällig restaurierten Stelle im weißen Rand.
Zu den bibliographischen Referenzen siehe unsere Nummer XXV.
Das Exemplar der Sammlungen Cousin und Tolstoi, in herrlichem Dentelle-Einband der Jahrhundertmitte
XXVII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 gefaltete doppelblattgroße als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π 1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (161 x 97 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf glattem Rü kken zu sechs Kompartimenten mit reicher floraler Vergoldung und grünem Maroquin-Rückenschild im zweiten von oben; Deckel mit ausnehmend breiter, an den Ecken und der Mitte stark ausgreifender Dentellevergoldung in Einzelstempeln (Akanthus und Blüten in einigen Varianten); Stehkantenfilete, Innenkantenvergoldung, großgemusterte Marmorpapiervorsätze und Goldschnitt, wohl von R.-F. Fétil oder L. Douceur.
Ein besonders schönes Exemplar der Oktav-Ausgabe, gedruckt auf besserem Papier, in einem perfekten Einband mit prächtigster ausladender Dentelle-Vergoldung, unter Verwendung recht kräftiger, aber höchst elegant zusammengefügter Formen, die dem Gesamtbild rhythmischen Schwung und
Eleganz verleihen, in der Art eines Louis Douceur oder René-François Fétil. Barber führt mehrere Einbände von sehr ähnlichem Formenrepertoire und Gestaltungscharakter an (Barber, Rothschild, insbesondere W.Cat. 502, von René-François Fétil, und W.Cat 577, von Louis Douceur, beide mit einer fast identischen Form der Eckfleurons, Dct 15 und 16, wobei Nummer 16, der für Fétil belegte Stempel, unserem wohl noch ein klein wenig näherkommt). Dem Kreis herausragender meisterlicher Einbände der Jahrhundertmitte ist unser Exemplar aufgrund seiner in jeder Hinsicht überzeugenden Gestaltung der Deckel ohne weiteres zuzuordnen, nur der Rücken bleibt etwas beliebig.
Außer durch Schönheit und makellose Erhaltung ist das Exemplar auch noch durch seine Provenienz geadelt: Es weist das ellipsoide Exlibris des Schriftstellers und Bibliophilen Charles Cousin auf, mit den Devisen „C’est ma toquade“ bzw. „Jean s’en alla comme il était venu“, und wurde auf seiner publizitätsumrauschten Auktion 1891 für 259.– Goldfrancs verkauft (Catalogue Cousin 1891, Bd. I, Nr. 568; allerdings stahl ihm unser Exemplar Nummer XXIX – dort die Nummer 567 – die Schau). Später war es dann im Besitz des Fürsten Michail Michailowitsch Tolstoi, der in Odessa in einem neoklassizistischen Palais residierte, noch heute als das „Haus der Gelehrten“ bekannt, ein bedeutendes Monument der Stadt. Sein gestochenes Exlibris trägt am unteren Rand die Ortsbezeichnung Odessa. Von den sowjetischen Rumtscherod, die von Januar bis März 1918 die Stadt regierten, wurde unser Exemplar konfisziert und sozusagen der Volksbildung anheimgestellt, indem man es der öffentlichen Bibliothek der Stadt übertrug, die ihm am 25. Januar 1918 ihren Stempel auf die Titelrückseite setzte (Inventarnummern-Stempel zudem auf dem Vorsatz und dem letzten Textblatt).
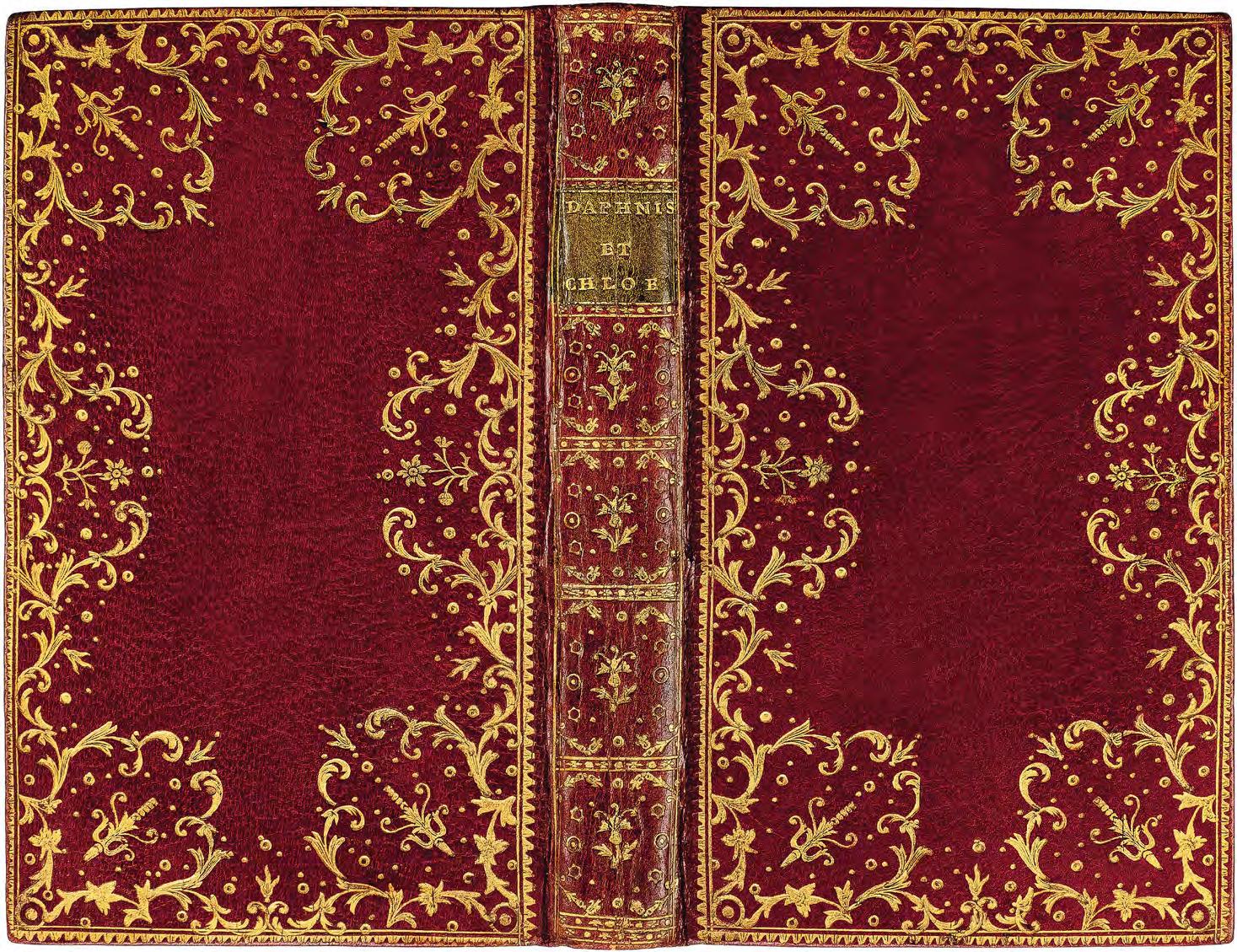
Offensichtlich hat es dies aber problemlos überstanden, zumal die Menschen in Odessa 1918 sicherlich andere Sorgen und Interessen hatten, als sich einen alten französischen Longus-Druck aus der Stadtbibliothek zu entleihen. Mit der Flut beschlagnahmten russischen Adelsbesitzes kam es dann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in den westlichen Handel. Zuletzt deutscher Privatbesitz.
Wenn man die folgenden Exemplare nicht veranschlagt, müßte man wohl bereits bei diesem schönen Stück von einer bibliophilen Erfüllung reden, der lediglich die keineswegs immer mit eingebundenen Petits pieds fehlen.
Die bibliographischen Referenzen bei unserer Nummer XXV.
Exemplar mit dem Wappen von Ludwig XV. – ein Geschenk für Madame Du Barry?
XXVIII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 gefaltete doppelblattgroße als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl. 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (163 x 98 mm).
Roter französischer Maroquineinband der Zeit auf glattem Rücken, die sechs Kompartimente mit üppiger floraler Vergoldung, im zweiten von oben grünes Maroquin-Rückenschild mit dem goldgeprägten Titel, Deckel mit feiner Dentelle-Vergoldung: Filete mit äußerem Dent-de-rat-Besatz, Akanthusblätter, Blüten, Rhomben in den Ecken und Pointillé-Vergoldung, mittig das goldgeprägte WappenSubralibros König Ludwigs XV. von Frankreich; Stehkanten-filete, Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Dieses besonders schöne Exemplar erhält seinen Adel durch den Einband von außergewöhnlicher Feinheit und höchster Provenienz: Das goldgeprägte Wappen auf den Deckeln – zwei gegenläufig in
sich verschlungene „L“, darüber eine Krone mit Bourbonenlilien – weist auf König Ludwig XV. hin (siehe Barber, Rothschild, Bd. I, Ohr/Tlw 2494 a-g, allerdings keine dieser Formen unserer exakt entsprechend). Da dieses Exemplar nicht eindeutig seiner Bibliothek zugewiesen werden kann, gehen wir davon aus, daß es sich um ein Geschenkexemplar handelt. Die Ornamentik der Deckel wirkt so grazil, als wäre sie von einem Kalligraphen mit dem Schwung der Zeichenfeder aufgebracht, besonders das rautenförmige Netzmotiv in den Ecken und an den Seiten, das sich aus kreuzenden Linienschwüngen ergibt und seitlich in feinen Akanthus übergeht. Nun gehören diese Motive zwar zur gebräuchlichen Ornamentik des Louis-quinze, doch sind sie als Vergolderstempel nicht so einfach nachweisbar (die bei Barber, Rothschild, Dcr 20–27, dokumentierten Formen zeigen dieses Liniennetz immer in eine feste Rahmenform eingefügt, was hier nicht der Fall ist). Indessen offenbart der Rücken einen höchst interessanten Hinweis: Die vier kleinen gebogenen Blättchen in den Ecken eines jeden Kompartiments finden eine exakte Entsprechung in einem Einband von der Hand Louis Redons, des Buchbinders der Comtesse du Barry (vgl. Barber, W.Cat. 159; Gruel, Manuel de reliures, S. 146).
Im Catalogue des livres de Madame Du Barry à Versailles, 1771 , hrsg. von P. L. Jacob, Paris 1874 findet sich auf S. 94eine Longus-Ausgabe, deren Wert einschließlich Bindung 20 Francs war, ein sehr hoher für die Zeit: handelt es sich dabei um unser Exemplar? Das sehr breitrandige Exemplar mit nur wenigen Stockflecken. Das vordere Gelenk etwas lädiert, das untere Kapital mit restauriertem Einriß. Davon abgesehen traumhaft schön, ein Ensemble, das die verfeinerte, intime Seite des französischen Rokokos repräsentiert.
Zu den bibliographischen Referenzen dieser Ausgabe siehe unsere Nummer XXV.

Das schönste bekannte Exemplar der Oktav-Ausgabe, in einem signierten Mosaik-Einband à répétition von Padeloup, aus den Sammlungen
Cousin – Van Zuylen – Schiff –Sicklès – Rothschild
XXIX [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 gefaltete doppelblattgroße als Faltkupfer auf Stegen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl. 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (158 x 96 mm).
Mittelbrauner Maroquineinband der Zeit auf glattem Rücken mit dunkelrot intarsiertem, goldgeprägten Rückentitel, die übrigen, in Maroquin citron eingelegten, durch Fileten und gestrichelte Linien abgegrenzten fünf Rückenfelder dekoriert mit Vogel-Stempeln und Goldpunkten, mittig abwechselnd dunkelbraun und dunkelrot intarsierte quadratische Rauten mit von je vier Goldpunkten umgegebenen Einzelstempeln, auf den Deckeln Dekor à répétition: quadratische goldgerahmte Rauten, jeweils eine Reihe in Maroquin citron und eine abwechselnd in Dunkelgrün und Dunkelrot, mit identi-
schem Blumenstempel, außen dreifache Rahmung in Goldprägung; Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung mit floraler Bordüre, Bronzefirnispapiervorsätze mit Punkt- und Sternchen-Muster sowie Ganzgoldschnitt von A.-M. Padeloup; in Holzschatulle mit rotbraunem Maroquinbezug, Rücken in Buchoptik mit fünf „Bünden“ und goldener Titelprägung, Schließmechanismus, gepolstert und mit brauner Moiréseide bezogen, „Made by Riviere & Son“.
Auch wenn der Erstbesitzer unseres noblen Exemplars nicht zu ermitteln ist, dürfte er doch aus dem hohen Adel oder höfischen Umfeld stammen. Es handelt sich bei diesem Mosaikeinband immerhin um ein Werk von Antoine-Michel Padeloup (1685–1758), der auf der Rückseite des Vorsatzblattes sein zweites bekanntes Etikett mit der Aufschrift: „Relié par Padeloup Relieur du Roy, place Sorbonne à Paris“ einklebte. Die seit etwa 1720 auftretenden Einbände dieses Typs mit décor à repetition entstanden überwiegend bis 1740; aus der Zeit bis 1730 stammen fünf bei Michon beschriebene Longus-Exemplare von 1718 (vgl. Michon, Les reliures mosaïquées, S. 95 f., und Barber, Rothschild, Bd. I, S. 222). Der vorliegende Einband ist also ein Spätling, was sich auch in einem „style très different“ (ebda., S. 30) ausdrückt: Das sonst verspieltere Quadratrautenmuster wird hier formal streng und geometrisch exakt durchgehalten, aufgelockert nur durch die abwechslungsreiche Farbigkeit in Citron, Dunkelrot und Olivgrün sowie die reiche Vergoldung. Das Vorsatzpapier mit dem charakteristischen Muster kleiner goldener Sterne konnten wir für den Augsburger PapierHersteller Johann Wilhelm Meyer nachweisen.
Der vorliegende Druck zeigt eine seltene Titelvariante, bei der die Namen der Protagonisten in gleicher Größe gesetzt sind, wobei der Name Daphnis deutlich verkleinert wurde.
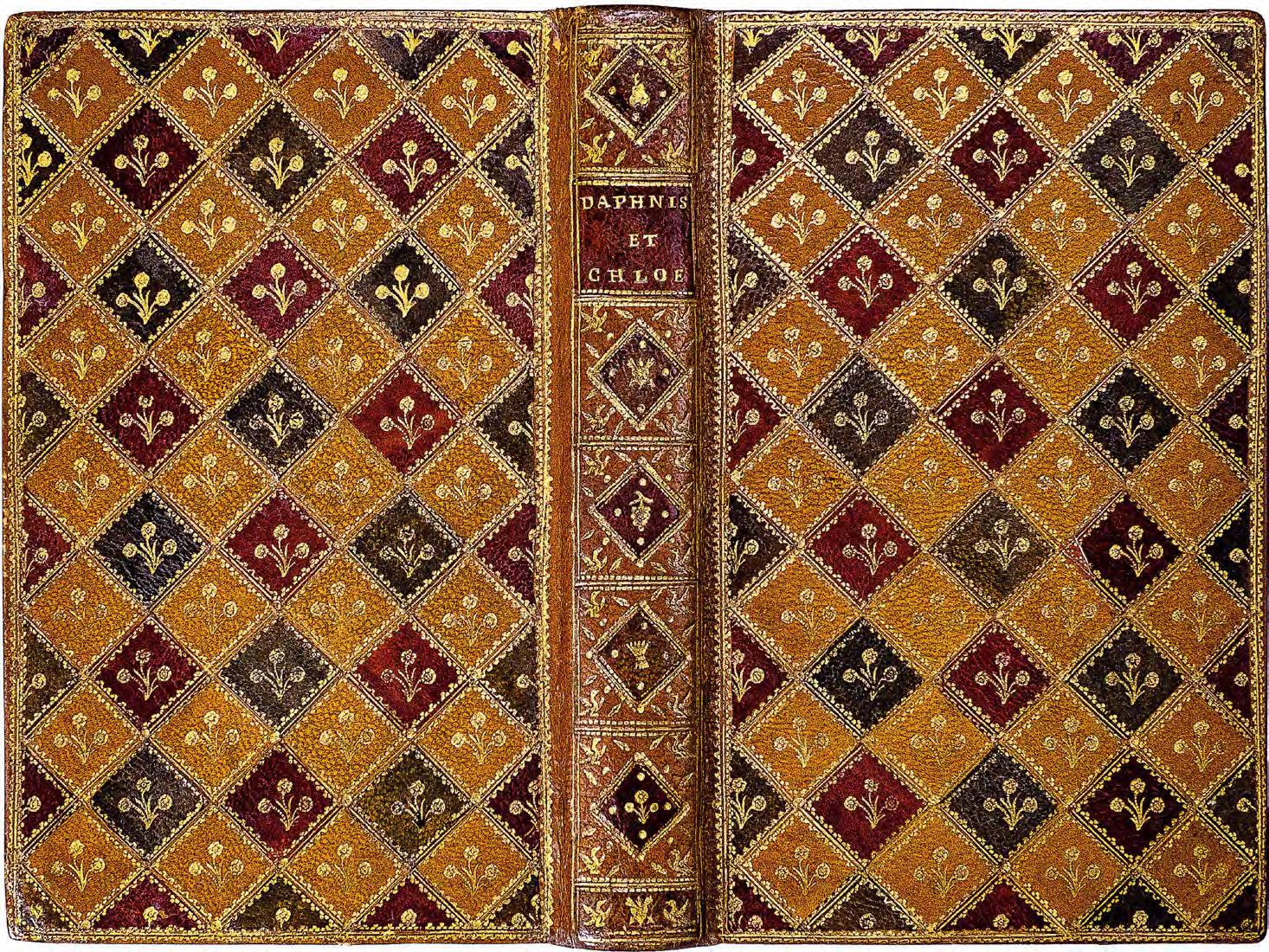
Die „diskrete“ Einbandgestaltung gibt keinerlei Hinweis auf den ersten Eigner. Dafür verewigte sich eine Reihe bedeutender Bibliophiler aus späteren Zeiten mit ihren Exlibris. Den Anfang macht Charles Cousin, auf dessen BibliotheksVersteigerung am 6.4.1891 das Buch als Nr. 567 (Catalogue Cousin 1891, Bd. I; 1.560,– Goldfrancs) verkauft wurde. Auf ein Besitzerzeichen verzichtete Baron Étienne van Zuylen van Nijevelt van de Haar; auf seiner Auktion bei Sotheby’s vom 21./22.3. 1929 war das Buch die Nr. 243 (£ 360,–an Michelmore), mit Tafelabbildung. Auf ihn folgten Mortimer L. Schiff (Catalogue 1938, Bd. III , Nr. 1969, £ 120,–) und Daniel Sicklès (Auktion
11.12.1945, Bibliothèque de M. Daniel Sicklès 1945, Nr. 17: frs. 150.100); danach kam das Buch in die „Bibliothèque d’un amateur“, die am 22./23.10.1959 in Paris versteigert wurde: Als Nr. 28 wurde es dort für nicht weniger als 1.400.000 frs. zugeschlagen. Das jüngste Exlibris ist das des Bankiers Alain de Rothschild (1910–1982).
Siehe die erschöpfende Beschreibung in unserem Katalog LXXXIV à compartiments, Nr. 68, wo auch die Literatur zum Einband gegeben wird..
Für die Bibliographien zur Ausgabe siehe unsere Nummer XXV.
Eines der seltenen Exemplare auf grossem Papier, gebunden in Maroquin der Zeit
XXX [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und einer Holzschnitt-Initiale.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π1 a4 A–Y 4 Z2 . Klein-Quart (197 x 145 mm).
Weinroter Maroquineinband, wohl des späten 18. Jahrhunderts, auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit reicher Rückenvergoldung, im zweiten von oben der goldgeprägte Titel auf grünem Maroquinschild, alle anderen Kompartimente mit aufgesprungenem Granatapfel im Zentrum, umgeben von kleineren Blütenstempeln und eingefaßt von einer Zackenbordüre, Deckel mit dreifachem Filetenrahmen und Blütenstempeln über den Überschneidungen; doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Die mit den liebreizenden Schlußvignetten Nicolas Cochins ausgestattete Ausgabe von 1745 wurde nicht nur im bekannten Oktav-Format, sondern auch im splendiden Klein-Quart gedruckt, welches
höchst selten zu finden ist. Die Wirkung des großen Papiers bezüglich Text und Bild ist kaum zu überschätzen: erstmalig gesteht man hier jeder einzelnen Illustration, auch den querformatigen Tafeln, eine eigene Seite zu; dabei erlangt der Text des antiken Hirtenromans durch die eminente Breitrandigkeit die ihm gebührende grazile Anmut. Die Exemplare auf „großem Papier“ erfuhren schon immer ganz besondere Wertschätzung, zumal jetzt auch die großen Kupfer ohne Falz betrachtet werden konnten, doch ist dies nicht der einzige Grund. Überall spürt man die Sorgfalt, mit der diese Ausgabe hergestellt worden ist. Der gesamte Text ist dazu neu gesetzt worden, nicht einfach nur von den Oktav-Druckstöcken auf Quart abgedruckt, er erscheint in neuem Satz mit anderen Textumbrüchen und der Lagenzählung in Quart. Besseres Papier und neue Drucktypen erlaubten ein schärferes, präziseres Schriftbild, und das, obwohl die Schriftgröße teils sogar verkleinert worden ist. Nebenbei bemerkt: es wurden sogar noch einzelne Fehler im Text korrigiert. Wir haben hier eine echte Druckvariante vorliegen, die eine deutliche Verbesserung gegenüber der Oktavausgabe darstellt und die deshalb zeitlich ein wenig später anzusetzen ist.
Der elegante Einband, wohl eine Arbeit aus der Zeit um 1770/80, ist nahezu neuwertig erhalten. Die schlichte Deckelgestaltung mit dreifacher Filetenrahmung bei reicher Vergoldung des Rückens steht einem Derome-Typus nahe. Barber verzeichnet immerhin das Rankenmotiv am unteren Kapital (Rothschild, Pal 113, mit einem wenig anderen Ausschnitt aus demselben Rollenstempel), dessen Auftreten er im späten 18. Jahrhundert nachweist, woran sich unsere Datierung orientiert. – Der Buchblock nur an vereinzelten Stellen mit kleinen Stockflecken, insgesamt ein höchst repräsentatives Exemplar von bester Erhaltung.
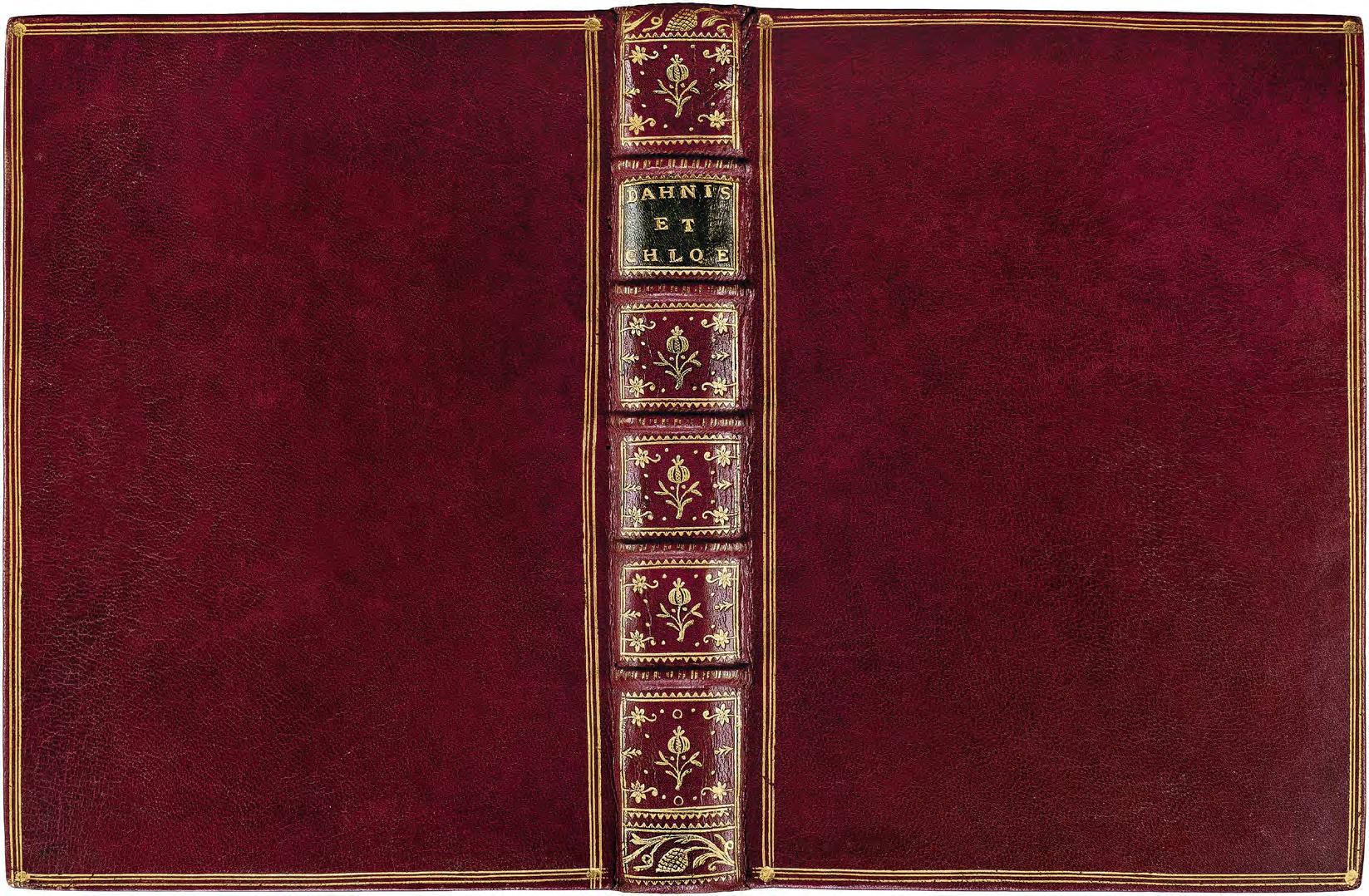
Exemplar von Paul May auf grossem Papier in rotem Maroquin mit Blumenbordüre
XXXI [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π1 a4 A–Y 4 Z2 .
Klein-Quart (200 x 157 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf glattem Rü kken zu sechs Kompartimenten mit stilisierten Blumenstempeln, im zweiten von oben der goldgeprägte Titel, Deckel mit floraler Dentelle-Bordüre, bestehend aus einer äußeren Fleur-de-lis-Bordüre, doppelten Fileten und einer breiten Blumengirlande, zusammengesetzt aus zartgliedrigen Bögen, aus denen edelweißartige Blumen emporwachsen, teils in Pointillé-Vergoldung, in den Ecken je ein Rad aus Akanthusblättern, flankiert von je einer Distel; doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenbordüre, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt, möglicherweise von P.-A. Laferté.
Ein herausragend schönes Exemplar mit einer so interessanten wie seltenen Dentelle-Bordüre, aus einer Reihe von verschiedenen Blumen und Pflanzen zusammengesetzt. Die Fleur-de-lis-Bordüre
(Barber, Rothschild, Roll 30), wie auch einen der Stempel, welcher auch auf dem nahe verwandten Einband unseres Exemplars Nummer XXXIII zu finden ist, können wir bei Barber unter den distelartigen Blumenstempeln nachweisen (Barber, Rothschild, Fl 84); eine eindeutige Zuschreibung ist aber leider nicht möglich. Ein identisch vergoldetes, jedoch wesentlich schlechter erhaltenes Exemplar, findet sich im Katalog Maigret/De Broglie (18.11.2008, Nr. 100, mit farbiger Abbildung). Fliegende Vorsätze aus Bütten, unter anderem mit Pro patria -Wasserzeichen.
Vorliegend nochmals eines der geschätzten wie seltenen Exemplare der Ausgabe von 1745 auf großem Papier, und zwar in jener Druckvariante, die sich gegenüber derjenigen in Oktav nur anhand der Bogenzählung, die auf Quartlagen umgestellt worden ist, unterscheidet. Im Gegensatz zu der zweiten Druckvariante in Quart, in der unser Exemplar XXX vorliegt, ist hier der Text nicht neu gesetzt worden, dementsprechend wurden auch sämtliche Holzschnitt-Initialen übernommen.
Provenienz: Auf dem Vorsatz befindet sich das von einem Wolf und einem Stier gehaltene Wappen des Lord Thomas Barrett-Lennard Dacre (1717–1786; vgl. Cokayne/Gibbs, The complete Peerage, Bd. IV, 1916, S. 15 f.) mit dem Motto: „Pour bien desirer“. Darunter das runde Maroquin-Exlibris des Inhabers der Bank Lippmann, Rosenthal und & Co. und bedeutenden holländischen Bibliophilen Paul May (1869–1940), auf dessen Auktion das Exemplar 1956 in Zürich (Bibliothek Paul May 1956, Nr. 135; mit Abbildung auf Tafel IX) für 1.200 sfr. verkauft wurde.
Das vordere Gelenk und die unteren Kanten minimal berieben; Ränder einiger Seiten leicht stockfleckig. – Zu den bibliographischen Referenzen siehe unsere Nummer XXV.

Exemplar des Grafen Calenberg auf grossem Papier gebunden in Maroquin olive mit Dentelle, wohl von Derome le Jeune – ein Probedruck des Verlegers
XXXII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette (als Cul de lampe am Ende wiederholt), vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π* (leer) π1 a4 A–Y 4 Z2 (alles in Rot regliert).
Klein-Quart (202 x 155 mm).
Dunkelolivgrüner Maroquineinband der Zeit, der Rücken auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit reicher Vergoldung, im Zentrum jeweils ein nach links schauender Vogel mit ausgebreiteten Flügeln, umschlossen von filigranen Ranken, Deckel mit zweifacher Filetenrahmung, Dentellebordüre von Rollenstempeln mit teils floralen Motiven, mittig das von zwei Löwen getragene Wappen der Grafen Calenberg; doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, Goldpapiervorsätze und fliegende Vorsätze aus roséfarbenem Tabis, Ganzgoldschnitt, wohl von Derome le Jeune.
Von den ohnehin recht wenigen Exemplaren auf großem Papier gibt es einzelne, die von Hand regliert wurden. Die mit feinen roten Linien durchzogenen Seiten bilden ein Ideal an Harmonie und Ebenmaß: „[…] in an exemplaire reglé, such as this, the hand-drawn lines mitigate what might otherwise be an excess of margin.“ (Ray, The French Illustrated Book, S. 11). Nun dürfte das Reglieren, wiewohl ästhetisch von ganz eigener Wirkung, in diesem Exemplaren noch einen anderen Grund gehabt haben: Ist doch anhand mehrerer Kriterien, wie Schriftsatz, Form des Buchschmucks, Fehlerkorrekturen im Text etc., davon auszugehen, daß solche Exemplare die Zwischenoder Übergangsstufe unserer beiden Druckvarianten in Quart darstellen, die in unseren Exemplaren Nummern XXX (endgültige Fassung) und XXXI (erster Zustand in Quart) belegt sind. Es dürfte sich hier also um ein Verleger-Exemplar handeln, ein vorübergehender Probezustand, der das Experimentieren belegt. Wir können quasi dem Verleger über die Schulter sehen, wie er Neues erprobt: Ornamente für den Buchschmuck, eine andere Drucktype, die Wiederholung der Titelvignette mit den beiden Täubchen am Ende – ein durchaus reizvoller Einfall – und manches mehr. Die Vignetten Cochins, die in früheren Fassungen schon vorlagen, denn die Oktavvariante mit den Vignetten geht denen im Quartformat in jedem Fall voraus, siehe unsere Einleitung zur Editionsgeschichte, wurden hier aus ungeklärten Gründen nicht eingedruckt, vielleicht weil man plante, sie wieder herauszulassen (Ray verzeichnet ebenfalls ein Exemplar ohne die Schlußvignetten) – auch in der Zeit mag es schon bewußt geworden sein, daß sie bereits eine andere künstlerische Auffassung, eine neue „Mode“, präsentieren und daß im Aufeinandertreffen der alten wie der neuen Illustrationsprinzipien ein recht harter Bruch spürbar wird.
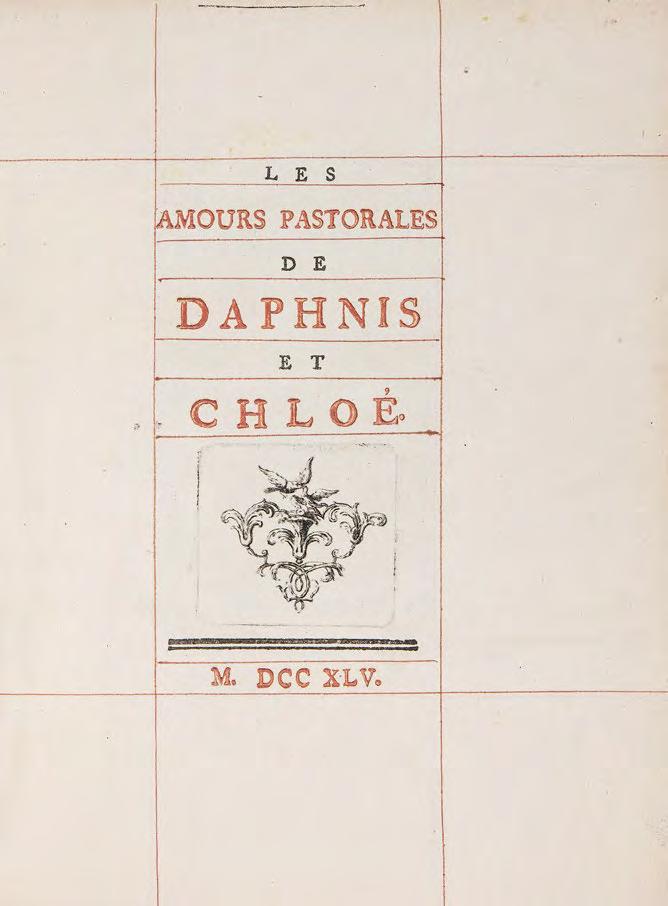
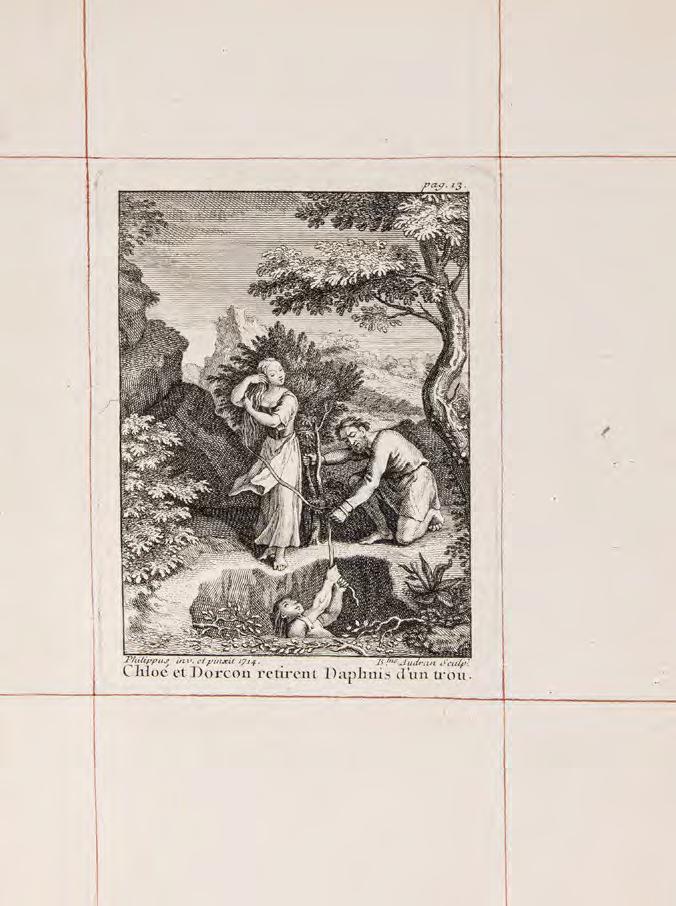
Die Tafeln der alten Regentensuite von 1718, die man extra gegen 1745 neu hat stechen lassen, liegen dementsprechend sämtlich in gratigen Abzügen vor. Der Einband ist von solider Ausführung und Vornehmheit, bei gewisser ornamentaler Zurückhaltung, aber von vorzüglichem Geschmack, konzentriert auf das prangende Supralibros im Hochoval. Der anmutige kleine Vogel-Stempel auf dem Rücken wird traditionell Derome le Jeune zugeschrieben, was sich bei etlichen Exemplaren durch Signatur oder Etikett auch bestätigt; nichtsdestoweniger weist Barber, ebenso wie Arnim (Bibliothek Otto Schäfer – Europäische Einbandkunst, S. 139), darauf hin, daß auch andere Buchbinder mit ähnlichen Motiven gearbeitet haben. Allerdings läßt sich insbesondere bei dem nach links schauendenVogel im Rankenkäfig, wie wir ihn hier sehen, davon ausgehen, daß Derome tatsächlich den Einband gestaltete. Barber verzeichnet einen sehr ähnlichen Stempel (Barber, Rothschild,
Cb 4), der ebenfalls Derome zugeschrieben wird (S. 272 f., mit weiterführenden Informationen zum caged bird).
Provenienz: Aus der Sammlung des Grafen Heinrich von Calenberg (1685–1772), Kämmerer des Kaisers und Kammerherr des Kürfürsten von Sachsen, der im Laufe seines Lebens eine kleine, jedoch nicht unbedeutende bibliophile Sammlung zusammentrug. 1773 wurde das Exemplar auf seiner Auktion in Brüssel für 4,– Goldfrancs versteigert (Catalogue Calenberg 1773, Nr. 882); erst 1934 taucht es wieder auf, in der Auktion von Lucien Gougy, einem bekannten Pariser Antiquar und Verleger, und wird für 4.600 Fr. verkauft (Bibliothèque Gougy 1934–1936, Bd. I, Nr. 500, mit Abbildung).
Einband und Buchblock befinden sich in vortrefflichem Zustand. – Bibliographische Referenzen unter unserer Nummer XXV.




Schlussvignetten Cochins zu Nr. 30, 31 und 33
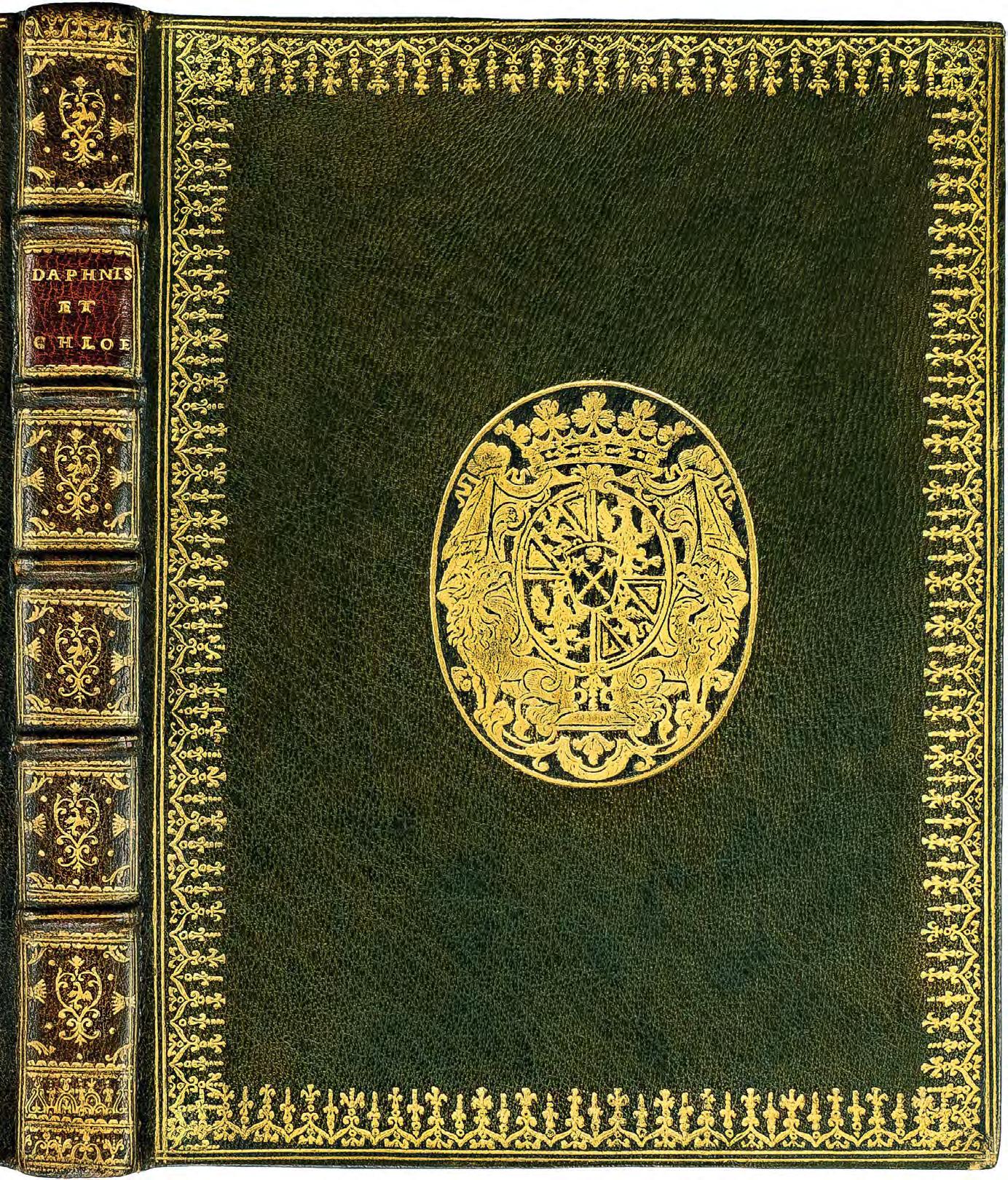
Exemplar auf grossem Papier
In nachtblauem DentelleMaroquin, vermutlich von Laferté
XXXIII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation : π* (leer) π1 a4 A–Y 4 Z2 . Klein-Quart (195 x 157 mm).
Nachtblauer Maroquineinband der Zeit auf glattem Rücken, unterteilt in sechs Kompartimente, rotes Maroquinrückenschild mit dem goldgeprägtem Titel im zweiten Kompartiment von oben, die übrigen mit zentralem Granatapfelmotiv und kleinen floralen Ornamentstempeln, Deckel mit Fleurs-delis-Bordüre (Barber, Rothschild, Roll 30), zweifacher Filetenrahmung sowie Dentellebordüre mit vielfältigen Blumen- und Pflanzenstempeln, darunter Disteln (ebenda, Fl 84), Eicheln, Lilien und Akanthusblätter; doppelte Stehkantenfileten, florale Innenkantenbordüre, Marmorpapiervorsätze sowie Ganzgoldschnitt, vermutlich von P.-A. Laferté.
Ein wunderschönes Exemplar in einem prachtvollen und sehr interessanten Einband, der nicht mit
dem klassischen Spitzenmuster, sondern mit einer floralen Rahmenvergoldung versehen ist und vermutlich aus der Hand von Pierre-Antoine Laferté – „eine der vergessenen Größen des achtzehnten Jahrhunderts“ stammt (Fürstenberg, Das französische Buch, S. 173). Unser Exemplar Nummer XXXI erinnert nicht nur in seiner Gesamtkomposition (die verschiedenen Blüten, die kleine Bögen bilden, die Akanthusräder in den Ecken) sehr an diesen Einband, es wurde auch mit demselben Distelstempel und der Fleurs-de-lis-Bordüre geschmückt. Im Katalog von Emile Solacroup (Catalogue Solacroup 1925, Nr. 71, mit Abbildung) finden wir eine zweibändige Horaz-Ausgabe, 1733–37, in von ihm signierten Einbänden, die nicht nur dem Stil unseres Exemplars entsprechen, sondern auch zum Teil mit denselben Stempeln versehen sind: die Lilie, die Distel, die floralen Bögen und die symmetrischen Akanthusblätter. Auch beim Horaz im Katalog von Lucien Gougy (Bibliothèque Gougy 1934–1936, Bd. I, Nr. 465, mit Abbildung) findet der Distelstempel Verwendung.
Vorliegend ein Exemplar der ersten Druckvariante in Quart, wie unser Exemplar Nummer XXXI (siehe auch unsere Einführung zur Editionsgeschichte). Ist es ein Zufall, daß beide Exemplare sehr ähnlich gestaltete Einbände erhalten haben?
Provenienz: Mit dem Exlibris von Pierrepont Cromp E. A. P. (1732–1797); über dem Wappen der Kopf eines Greifvogels und die Motti: „Esperance“ und „Adversis major, par secundis“. Reverend Pierrepont Cromp (auch: Crompe), of Newnham, Gloucestershire, geboren in Wrensten Court, Kent County, war mit Elizabeth Tilghman (1741–1803) verheiratet, die das Manor von Frinsted an die Familie Cromp brachte. – Zuletzt deutscher Privatbesitz.

Rücken minimal berieben, sonst vortrefflich erhaltenes, breitrandiges und insgesamt sauberes Exemplar, auf gutem Pro-Patria -Bütten gedruckt; die Tafel vor Seite 83 mit blassem Wasserfleck, dieser aber größtenteils im weißen Rand verlaufend. Schönes Exemplar in der seltensten aller Maroquinfarben. – Die bibliographischen Nachweise bei unserer Nummer XXV.
Regliertes Exemplar auf grossem Papier, in herrlichem bemalten weissen Kitzleder, aus den Sammlungen Ripault –Bishop – Hauck
XXXIV [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π* (leer) π1 a4 A–Y 4 Z2 (alles in Rot regliert).
Klein-Quart (203 x 154 mm).
Weißer Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit reichster Vergoldung und Bemalung, jedes Kompartiment mit zentraler goldgerahmter Blüte, umgeben von geome-
trischen, ebenfalls goldgerahmten Elementen, braunes Maroquinschild mit goldgeprägtem Titel im zweiten Kompartiment von oben, die Deckel mit komplexer, sehr kräftiger Bordüre, bestehend aus Akanthusblättern, Blüten, Herzen, Granatäpfeln, Sternen etc., mittig ein stilisiertes Bäumchen in einer Vase mit mehreren Blüten, darauf sitzend vier große und fünf kleine Vögel, die üppige Vergoldung zusätzlich mit intensiv leuchtenden Farben, Rot, Orange, Gelb, Blau und Grün komplettiert; doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, doubliert in seegrünem Tabis, Goldpapiervorsätze, Ganzgoldschnitt sowie rotes Seidenlesebändchen; in moderner Halbleder-Kassette.
Gewiss einer der exquisitesten Einbände dieser ganzen Sammlung, der sowohl mit fast schon verschwenderischer Verwendung edelster Materialien wie mit außergewöhnlichem buchbinderischen Können und Originalität beeindruckt. Elfenbeinfarbenes Kitz, strahlendes Gold und leuchtende Farben vereinigen sich hier zu einem Glanzstück der Buchbinderkunst. Es sind von dieser Ausgabe lediglich drei weitere Einbände dieser Art bekannt: Das Exemplar Sardou-Greffulhe, bei dem mit Gold und Farbe weitaus sparsamer umgegangen wurde (Catalogue Sardou 1909, Nr. 164: „curieuse reliure bien conservée“, Cat. Greffulhe 1937, Nr. 74: frs. 30.000,–), das Exemplar Bishop-Lucien-
Graux, welches im Vergleich zu unserem Exemplar größere Abriebstellen aufweist (ursprünglich aus dem Besitz der Duchesse de Berry, im Verkaufskatalog ihrer Bibliothek, dem Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny, Paris 1836, war das Exemplar die Nr. 991), ehemals ebenfalls in unserer Sammlung, und unsere Nr. XXXV. Ähnliche Einbände, auch auf elfenbeinfarbem Maroquin, aber meist unter Verwendung nochmals kräftigerer, im Bereich der Bordüren sogar flächendekkender Ornamentik, waren eine Spezialität von Lemonnier dem Jüngeren, in dessen Werken auch Vögel ein häufiges Motiv sind (vgl. Gruel, Manuel historique, S. 124, und Damascène Morgand, Livres dans de riches reliures, Nr. 171b).
Bei unserem Einband sind lediglich die Gelenke und unteren Kanten minimal berieben und nur ganz vereinzelt kleine abgeplatzte Stellen bei den Malereien vorhanden. Innen weiß und fast fleckenfrei. Auf besonders festem Hollandpapier gedruckt und sauber in Rot regliert. –Obgleich das Exemplar zu der Druckvariante gehört, welche die Erst- und nicht die Übergangsfassung repräsentiert, sind auch hier die Seiten regliert, die Schlußvignetten aber eingedruckt, nicht jedoch die wiederholte Titelvignette am Ende. Dies läßt darauf schließen, daß wir hier ein Verlegerexemplar in der frühesten Fassung vorlie -
gen haben, bei dem Schriftspiegel und Positionierung der einzudruckenden Kupfer erprobt worden sind, mithin wohl einer der ersten Drucke der Ausgabe von 1745. Daß die Petits pieds in diesem Exemplar nicht enthalten sind, könnte darauf hindeuten, daß man anfänglich geplant hatte, sie überhaupt nicht in die Illustration dieser Ausgabe aufzunehmen.
Provenienz: Unsere nachweisbare Provenienzkette beginnt mit Armand Ripault, auf dessen Auktion das Exemplar 1924 in Paris versteigert wurde (Bibliothèque Ripault 1924, Nr. 426, mit Abbildung: frs. 13.600,– plus Aufgeld). Sein Exlibris mit dem Motto „D’esperer servira“ findet sich auf dem Vorsatz, ebenso das von Cortlandt F. Bishop; die Auktion seines französischen Buchbestandes fand 1948 in New York statt, wo das Exemplar für $650,– verkauft wurde (Cortlandt F. Bishop Library 1948, Nr. 181). Zuletzt auf der Auktion von Cornelius J. Hauck bei Christie’s N. Y. (Hauck Collection 2006, Nr. 436 = $22.800,–).
Europäische Privatsammlung.
Insgesamt ein Höhepunkt der französischen bibliophilen Produktion der Zeit und mit Gewißheit eines der schönsten Exemplare dieser Ausgabe.
Für die Bibliographien zur Ausgabe siehe unsere Nummer XXV.


Regliertes Exemplar aus den Sammlungen Gruel und Burrus, auf grossem Papier und in schönstes bemaltes weisses Kitzleder gebunden
XXXV [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette (wiederholt am Schluß), vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π* (leer) π1 a4 A–Y 4 Z2 (alles in Rot regliert).
Klein-Quart (202 x 154 mm).
Weißer Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden mit reichster Vergoldung und Bemalung, jedes Kompartiment mit zentraler goldgerahmter sechsblättriger roter Blüte, umgeben von vier roten Scheiben mit goldenem Blütenstempel in der Mitte, eingefaßt von Kastenvergoldung doppelter Fileten, dunkelrotes Maroquinschild mit goldgeprägtem Titel im zweiten Kompartiment von oben, Deckel mit kräftiger Bordüre in Form eines wellenartig umlaufenden breiten dottergelben Bandes, außen Filete mit Zackenbesatz, die Zwischenräume von Band und Filete in Korallrot mit Goldringen in den Zwickeln, zum Binnenfeld nach innen ausgerichtet Kelch- und Blütenmotive, in den Ekken größere, mit doldenartigen Blüten in Rot, mittig eine stilisierte dunkelgrüne Rankpflanze mit sieben Zweigen in einer Vase und Blüten in Rot und Orange, alle Farbflächen mit den leuchtenden, hellen Farben Rot, Orange, Gelb und Grün zusätzlich von vergoldeten Konturlinien eingefaßt; Stehkantenvergoldung in Form ornamentaler Leisten, Innenkantenvergoldung als Zickzack-Bordüre, Vorsätze aus Bronzefirnispapier mit Sternenmuster, Ganzgoldschnitt sowie grünes Seidenlesebändchen; in moderner blauer Maroquin-Kassette.
Ein besonders reizvoll und mit erheblichem handwerklichen Aufwand gebundenes Exemplar, das durch seine schöne Übereinstimmung des Prachteinbandes mit dem Inhalt und der Form des Drucks einen derart individuellen Charakter erhält, daß man es unter der Vielzahl dekorativ gebundener Longus-Exemplare, die uns aus dem 18. Jahrhundert überliefert sind, bestimmt nicht wieder vergessen wird. Auch hier liegt eine Quartvariante mit durchgängiger, wohl verlagsseitig ausgeführter Reglierung vor, und der von formaler Eigenständigkeit und Erfindungsreichtum geprägte Einband à grand décor peint, in entfernter Orientierung an Vorbildern des 16. Jahrhunderts, ist ein besonderes Meisterstück der Binderkunst des mittleren 18. Jahrhunderts. Wiewohl es sich nicht um einen echten Mosaikeinband handelt, da hier keine Auflagen oder Intarsien Verwendung fanden, entspricht das Erscheinungsbild doch einem solchen, erinnernd an Arbeiten eines Lemonnier des Jüngeren und Derome. Von einiger Ähnlichkeit ist das Exemplar Sardou-Greffulhe-Seilern. Das chamoisgrundige Augsburger Goldfirnispapier auf den Vorsätzen dürfte aus der ersten Jahrhunderthälfte stammen (vergleiche Haemmerle, Buntpapier, S. 74, Nr. 63). – Die Druckvariante
ist jene für besondere Exemplare zu erwartende Zwischenfassung, die sicherlich nicht in den Handel kamen, sondern nur vom Verleger benutzt worden sind (eines der Kennzeichen: die Kopfzierleiste mit doppelter Sternchenreihe beim Avertissement).
Von vorzüglicher Erhaltung, abgesehen von einer kleinen, gut restaurierten Bezugsfehlstelle auf dem Vorderdeckel und geringen Rissen am vorderen Gelenk. Die Vorsätze ein wenig berieben, innen nur sehr leicht, in den breiten weißen Rändern, stockfleckig. Sauber in Rot regliert, die Kupfer, darunter auch die Petits pieds, in schönen tiefschwarzen Abdrucken von frischen Platten.
Provenienz: Das Exemplar wurde 1935 aus dem Besitz der Buchbinderfamilie Gruel veräußert; dann befand es sich in der Sammlung von Maurice Burrus (1882–1959), dem bekannten Philatelisten und Politiker aus dem Elsaß, dessen 1938 datiertes Exlibris auf dem Vorsatz.
Ein bibliophiles Unikum.
Die bibliographischen Angaben wie bei unserer Nummer XXV.

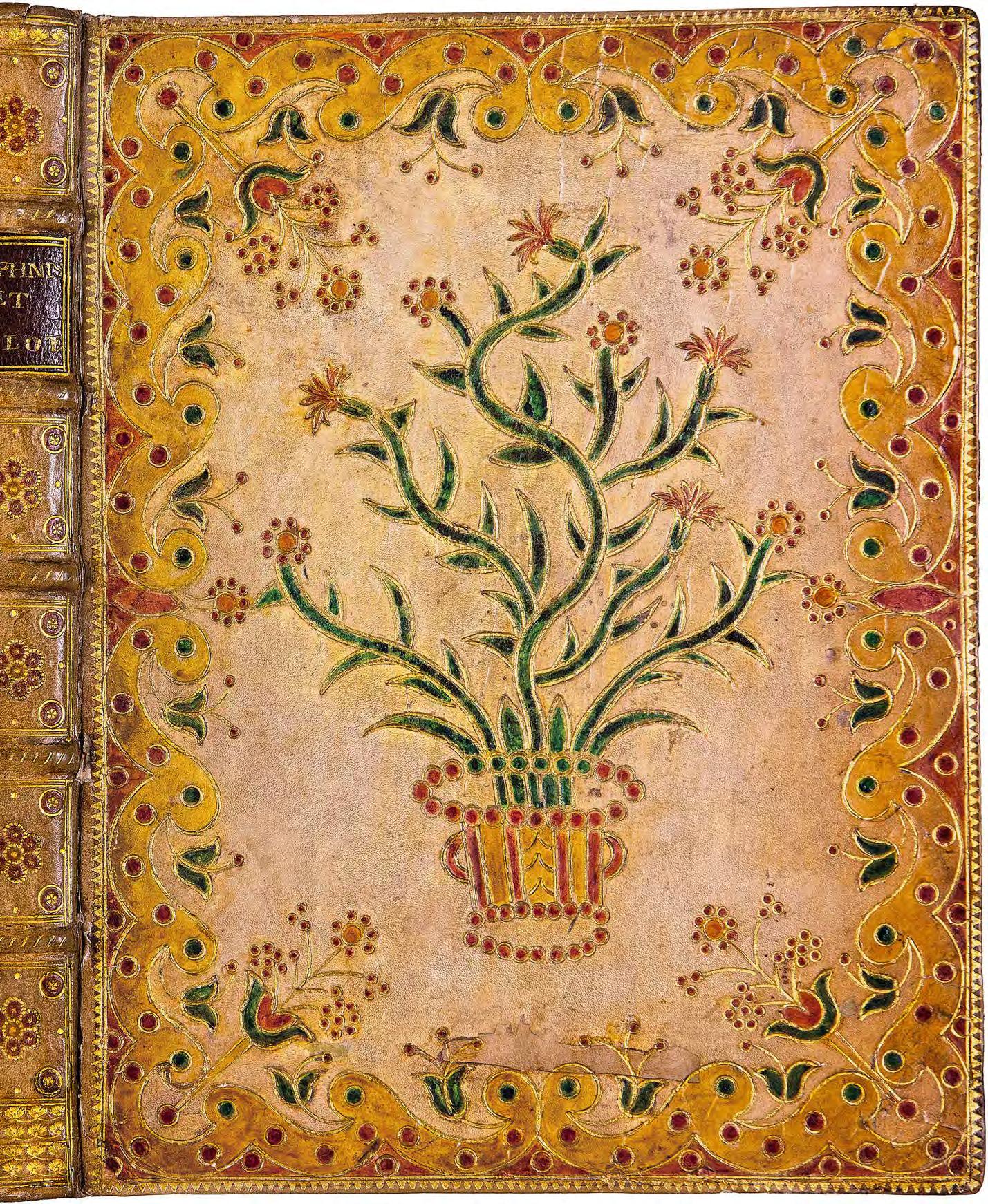
Exemplar mit illuminierten Tafeln, von Louis Douceur in Maroquin mit prächtiger individualisierter Dentelle gebunden – aus der Sammlung De Redé
XXXVI [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette (als cul de lampe am Ende wiederholt), vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen, mit Ausnahme der Initialen sämtlich illuminiert.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π1 a4 A–Y 4 Z2 (alles in Rot regliert und mit Rahmenbordüren in Schablonenmalerei).
Klein-Quart (202 x 152 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden mit üppigster Rokoko-Vergoldung: Rücken bestehend aus sechs von Goldfileten eingefaßten Kompartimenten, im zweiten von oben das olivgrüne Maroquinschild mit dem goldgeprägtem Titel, die anderen Kompartimente mit zentralem Schäfchen (seitlich, nach links) und Hirtenspaten (Houlette) in den Ecken, Deckel mit äußerer Rollenvergoldung (Filete mit Bortenmotiv nach außen) sowie sehr elaborierter Dentellebordüre aus mannigfaltigen Blüten- und Pflanzenstempeln, darunter außerordentlich filigrane und feingeschwungene
Akanthusblätter, distelartige Blüten und Girlanden aus Wiesenblumen, dazwischen Pointillé-Elemente, in den Eck- und Mittelstücken je ein ruhendes bzw. ein gehendes Schaf, dazu kleine mit Schleifen verzierte Hirtenspaten; zweifache Steh- und Innenkantenvergoldung, seegrüne Tabis-Vorsätze, ebensolches Seidenlesebändchen sowie Ganzgoldschnitt, von L. Douceur, Vergoldung evtl. von Plumet.
Ein in jeder Hinsicht unvergleichliches Exemplar, ein Probedruck des Verlegers, der hier mittels durchgehender Illumination zur bibliophilen Kostbarkeit veredelt worden ist, zusätzlich überhöht mit einem Einband, dessen Gestaltung vollkommen auf den Inhalt abgestimmt ist. Wie später auch für La Fontaines Fabeln und die Éloge de la folie schnitt Louis Douceur auch für den Longus eigene Stempel mit bukolischen Motiven, darunter das ruhende und das gehende Schäfchen (Barber, Rothschild, Dst 17 und 18) sowie den Hirtenstab (Dst 28). Diese Stempel und die in den Ecken verwendete Palmette (Dcr 17) finden sich auch auf dem in nachtblaues Maroquin gebundenen und mit Douceurs Etikett versehenen Exemplar W.Cat. 422 und auf dem Einband des Exemplars Mortimer Schiff in der Ausgabe von 1757 (Catalogue Mortimer L. Schiff 1938, Bd. I, Nr. 282). Desgleichen zeigt unser allerdings noch wesentlich elaborierteres Exemplar Nummer XLI die Schäfchen-Stempel; dieses ist mit Douceurs Etikett versehen. Möglich allerdings, daß die Vergoldung von Plumet ausgeführt wurde (Hinweis von E. Aguirre, mit Dank).
Die Illumination, die mit Sicherheit auf Initiative des Verlegers betrieben worden ist, entstand offensichtlich in der Absicht, eine winzige Anzahl von Einzelexemplaren einer nur als Übergangsstufe existierenden Druckvariante zu buchkünstlerischen Zimelien aufzuwerten. Jede Textseite und jede Tafel ziert eine in Rosa, Grün und Gold patronierte
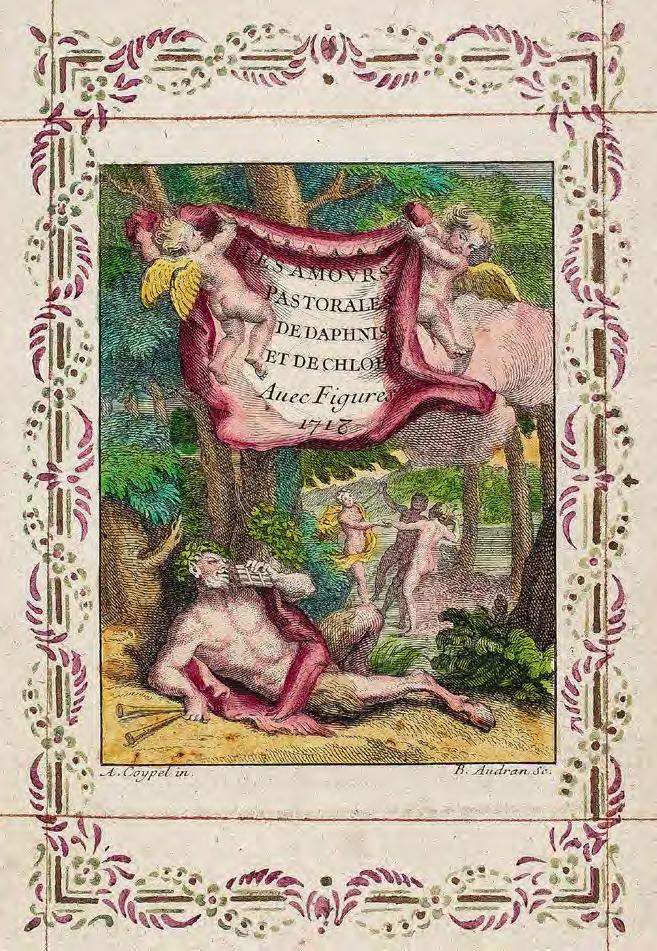
Bordüre. Die Tafeln selbst sind sämtlich in vielen verschiedenen und fein abgestuften Farbnuancen in Gouache koloriert und erhalten so den Charakter kleiner Gemälde, vielleicht eine Reminiszenz an den Gemäldezyklus von der Hand Coypels und des Regenten. Darüber hinaus enthält unser Exemplar fünf in denselben Farbtönen wie die Bordüren patronierte Vignetten, die einen Blumenkorb zeigen, am Ende des Avertissement und auf den Seiten 32, 76, 116 sowie 159 in teils differierender Form.
Ein sehr ähnlich gestaltetes Exemplar wie unseres, und doch so weit durch Kolorierungsunterschiede abweichend, daß die Individualität beider nicht in Frage gestellt zu werden braucht, befand sich in der Bibliothek William Foyle, versteigert in London im Juli 2000 (Library of William Foyle, Bd. II , Nr. 225, für 9400 Pfund).
Innen wie außen von sehr schöner Erhaltung, minimale Abriebstellen an den Unterkanten; innen einige wenige leicht fingerfleckige oder angestaubte
Stellen. Wie in allen Exemplaren dieser seltenen Druckvariante fehlen hier Cochins Culs-de-lampe, anstelle derer sich auf der letzten Seite jedes Abschnitts je eine der patronierten Blumenvasen befindet. Wie in dieser Druckvariante üblich, ist hier die gestochene Titelvignette auf der letzten Seite als Schlußvignette wiederholt, beide in geringer Abweichung koloriert.
Provenienz: Mit dem Exlibris von Alexis de Redé, dem zeitweiligen Mitbesitzer des Hôtel Lambert (1922–2004); versteigert auf der Sotheby’s-Auktion in Paris am 15.12.2005 (Collection du Baron De Redé, Nr. 38 für € 9.000,–). Danach französischer Privatbesitz .
Dies dürfte, in der Addition aller auszeichnenden Elemente, das wohl schönste Exemplar dieser Ausgabe sein.
Die bibliographischen Nachweise der Ausgabe unter unserer Nummer XXV.
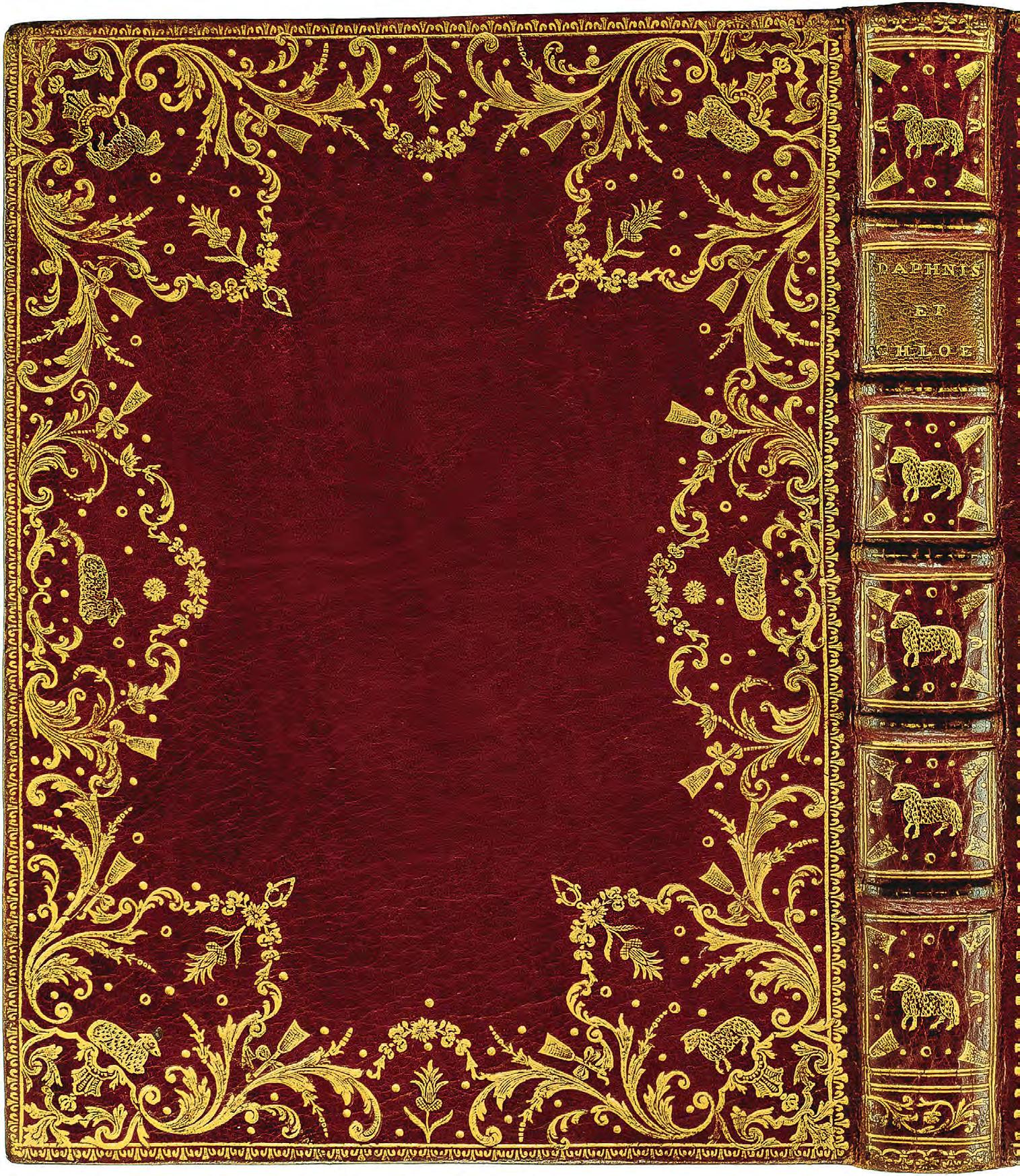
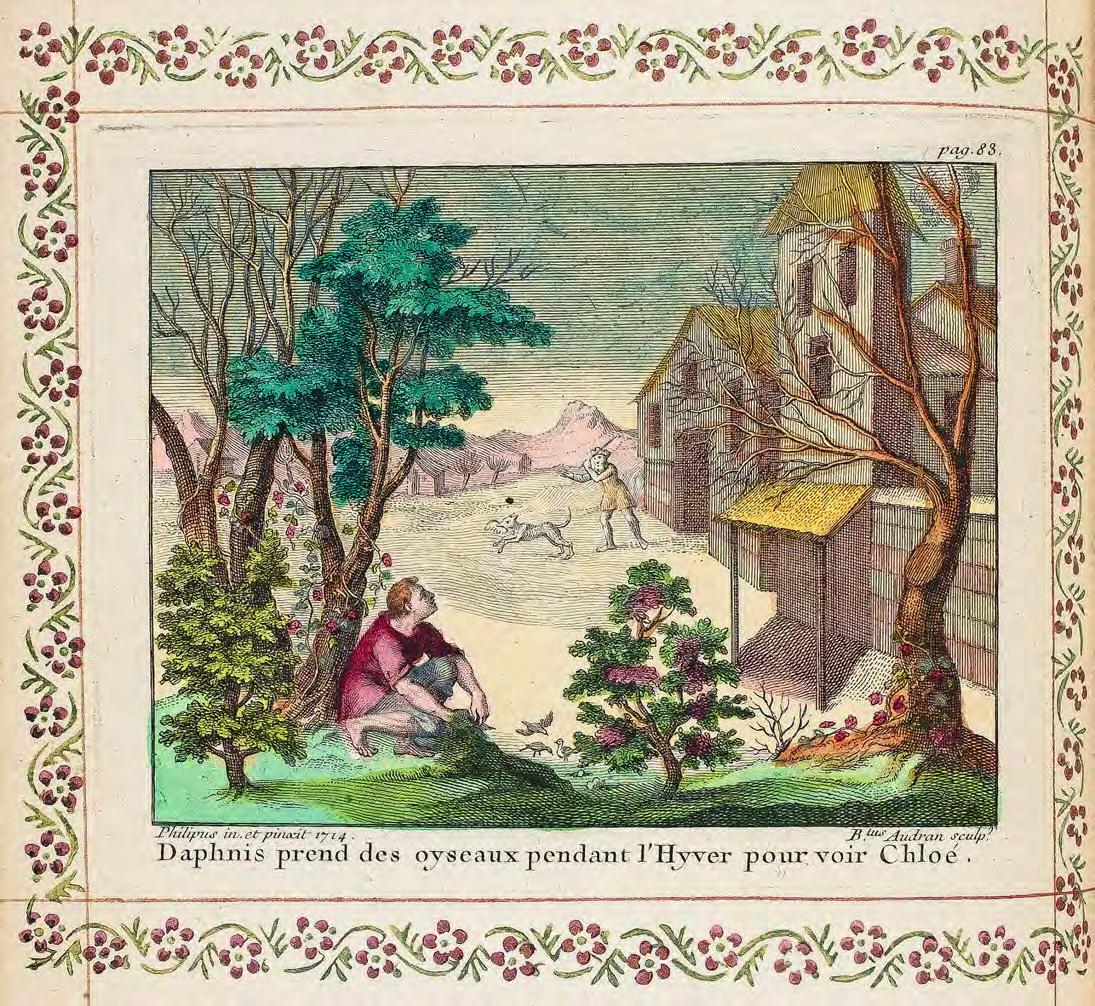
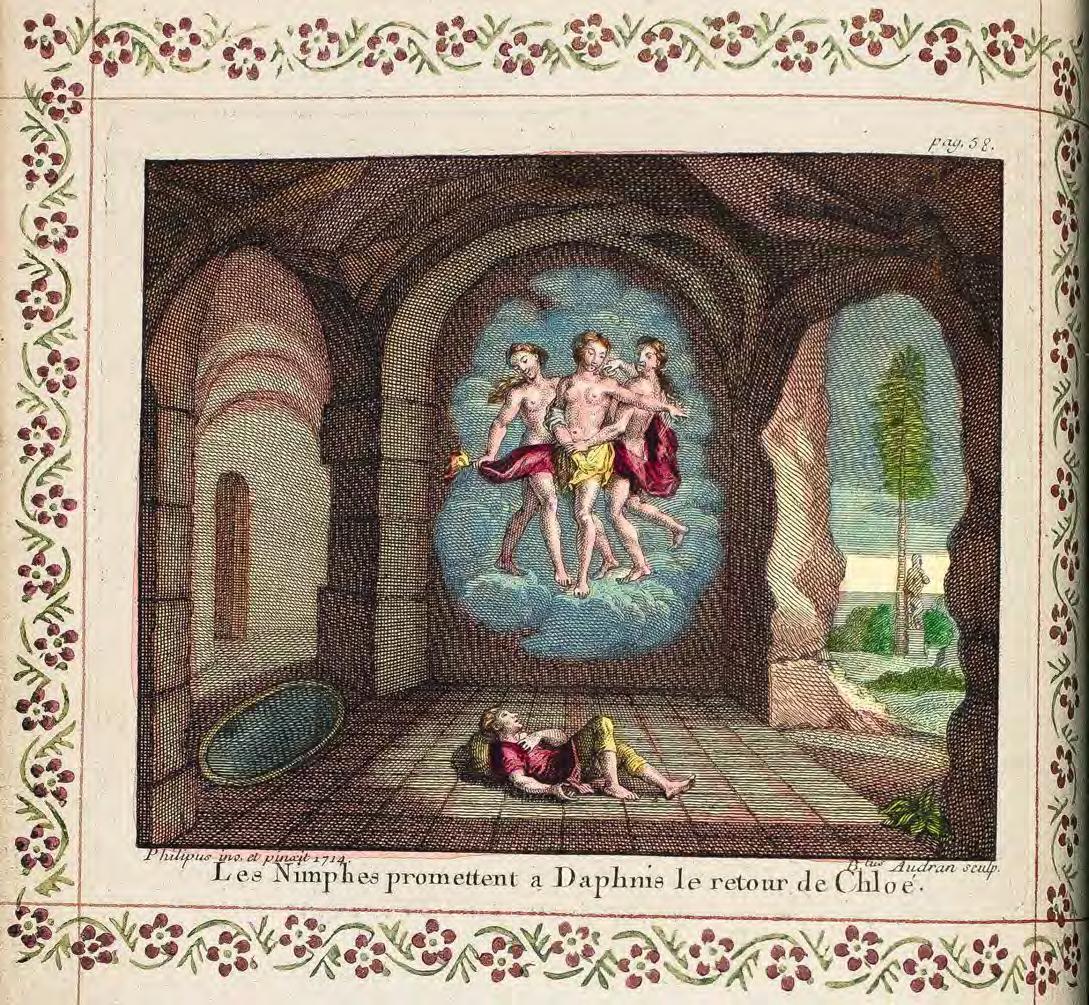
Illuminiertes Exemplar aus den Sammlungen
Sir Robert Abdy und Otto Schäfer –In nachtblauem Maroquin von Douceur und Plumet
XXXVIa [LONGUS]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans, sowie der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus, alles in Nachstichen gegen 1745 und illuminiert, gestochener Titelvignette (als Cul de lamp am Ende wiederholt), vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
1 leeres Bl., 5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π2 a4 A–Y 4 Z2 (alles in Rot regliert und mit Rahmenbordüren in Schablonenmalerei). KleinQuart (199 x 156 mm).
Nachtblauer Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden mit reicher individualisierter Dentelle-Vergoldung, der Rücken mit sechs von doppelten Fileten eingefaßten Kompartimenten, im zweiten von oben rotbraunes Maroquinschild mit goldgeprägtem Titel, die anderen mit zentralem Schäfchen (seitlich, nach links) und Hirtenspaten in den Ecken, beide Kapitale mit schmaler Rankenbordüre, Deckel mit doppeltem Filetenrahmen und Rattenzahn nach außen, innen üppige Dentellebordüre aus Ranken- und Blütenstempeln mit Akanthusblättern und Girlanden, dazwischen Pointillé und kleine Ringe, in den Ecken je ein ruhendes und gehendes
Schaf im Wechsel über Bandwerkornament, dazu kleine mit Schleifen verzierte Houletten; Stehkanten mit Doppelfilete, florale Innenkantenbordüre, ziegelrote Tabis-Vorsätze, Seidenlesebändchen sowie Ganzgoldschnitt, wohl von L. Douceur, vielleicht in Zusammenarbeit mit Plumet als Vergolder.
Dieses durch seine besondere Schönheit und Provenienz ausgezeichnete Exemplar ist ein Gegenstück zu unserem vorherigen von gleichem Rang, allerdings mit gewissen Unterschieden, die ihm eigenen Charakter verleihen. Wir sehen hier dieselben Illuminatoren am Werk, die akribisch jede Seite und Tafel mit Hilfe von Schablonen mehrfarbig einfassen und die Blumenkorb-Vignetten einmalen – der schlagende Beweis für die verlagsseitige Ausgestaltung dieser seltenen Druckvariante, die nur als Übergangsstadium existierte und dem Verleger als buchkünstlerisches Experimentierfeld diente. Der Tafel-Kolorist arbeitete jedoch etwas anders als der des Redé-Exemplars, mit einer veränderten Palette und teils ganz anderer Farbwahl, durchaus in leuchtender, frischer Farbigkeit, aber dezenter, nicht so kraftvoll im Auftrag. Seine Absicht lag erkennbar in der harmonischen Abstimmung auf das Rahmenwerk, denn die durchgehend dominierenden Rot- und Grüntöne stimmen auffällig eng mit den Farben der Bordüren überein und harmonieren perfekt. Im Gegensatz zum Redé-Exemplar wurden hier die Kopfvignetten ausgelassen und verblieben im schwarz-weißen Druck. Auch bei diesem meisterlichen Einband ist trotz ähnlicher Motive und Formen etwas Unverwechselbares entstanden. Auf dem edlen Nachtblau wirkt die Vergoldung besonders strahlend und kraftvoll, und die vollendete Komposition der eleganten, teils sehr feinen Ornamentformen tritt wie ein schwereloser, glanzvoller Reigen hervor. Wie beim Redé-Exemplar trägt auch dieser Einband

die Handschrift von Louis Douceur, mit dessen extra für Longus gefertigten Stempeln, doch halten wir es aufgrund der großen stilistischen Nähe zum Vergolderstil der Pariser Buchbinder-Dynastie Plumet für möglich, daß hier eine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Die Familie hat vom 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert gewirkt (Thoinan 377 f.). Plumet-Einbände des mittleren 18. Jahrhunderts zeichnen sich besonders durch ihre individuellen und sehr feinen Dentelleformen aus. Nach Thoinan waren Jacques-Louis und Louis-Valentin die beiden in dieser Zeit wichtigsten Meister der Familie. Die genauere Erforschung ihres Werks – durch Eric Aguirre – steht noch aus, vor allem die Unterscheidung zum Stil Douceurs und Le Monniers, der jeweils sehr ähnlich ist. Die Familie Plumet hat offensichtlich mit beiden Kollegen eng zusammengearbeitet.
Von vereinzelter geringer Fleckigkeit (auf dem gestochenen Titel und Blatt B4) abgesehen, vorzüglich erhalten. – Wie in dieser Druckvariante üblich, ist hier die gestochene Titelvignette auf der letzten
Seite als Schlußvignette wiederholt, beide nicht koloriert. – Als marginale bibliographische Nachbemerkung sei noch darauf hingewiesen, daß die letzte Lage Z2 (die Seiten XVII-XX der Notes) im Druck die Signatur M trägt, was natürlich auch für die anderen Exemplare dieser Variante gilt.
Die Provenienz können wir bis auf das Bulletin Morgand (56, 1903, Nr. 43170: 1.000 Goldfrancs) zurückverfolgen; von der berühmten Sammlung des Sir Robert Abdy, Baronet of Albyns in Essex (1896–1976), zeugt das Exlibris auf dem vorderen Vorsatz (Katalog der Versteigerung 1975 in Paris, Nr. 211), im selben Jahr dann bei Tenner in Heidelberg (Auktion 106, Nr. 1340, für den beachtlichen Preis von 6000 Mark), darauf in der Sammlung Otto Schäfer, bei Sotheby’s 1995 (Part II , Lot 132) versteigert. Zuletzt Schweizer Privatsammlung: Bonham’s, 29.7.2020, Nr. 41.
Die bibliographischen Nachweise der Ausgabe unter unserer Nummer XXV.

Die sehr seltene Ausgabe von 1750 mit neu gestochenen Kupfern nach Scotin
XXXVII [Longus]. Amours de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet]. Aves figures par un élève de Picart. Amsterdam [Jean Néaulme] 1750.
Mit gestochenem, unsignierten Frontispiz, acht unsignierten Kupfertafeln, alle in seitenverkehrten Stichen nach der Suite von J. B. Scotin, unsignierter gestochener montierter Titelvignette, vier unsignierten gestochenen montierten Kopfvignetten und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (150 x 95 mm).
Hellbrauner Kalbledereinband der Zeit auf fünf Bünden zu sechs Kompartimenten mit floraler Rü kkenvergoldung und rotem Lederrückenschild mit goldgeprägtem Titel im zweiten Kompartiment von oben; Stehkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Rotschnitt.
Eine editionsgeschichtlich höchst interessante, in den älteren Bibliographien nicht nachweisbare Ausgabe. Der Druck ist, wie wir belegen konnten, bei dem großen Amsterdamer Verleger Jean Néaulme erschienen. Es handelt sich um eine Titelauflage der noch selteneren, kaum mehr auffindbaren Ausgabe des Vorjahrs, für die wir Evert Van Harrevelt nach einer Anzeige als Verleger erschließen konnten. Harrevelt arbeitete wiederum zeitweise mit François Changuion zusammen, dem Drucker der Amsterdamer Ausgabe des Jahres 1734; und Changuion war ein ehemaliger Mitarbeiter des Emanuel
Du Villard, der 1717 die erste Amsterdamer Longus-Ausgabe des 18. Jahrhunderts produziert hatte.
Editionsgeschichtlich sind die Editionen von 1749/50 Ableger der Pariser Quart-Ausgabe von 1745, und zwar jener mittleren Variante, wie sie etwa bei unserer Nummer XXXII vorliegt. Allerdings wurde sie neu mit den im Gegensinn nach Jean-Baptiste Scotin gestochenen Kupfertafeln illustriert, orientiert an der seitenverkehrten Folge in der frühen Amsterdamer Ausgabe von 1717, deren fingiertes Impressum „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ lautet (also derjenigen des Emanuel Du Villard, vergleiche auch die Ausführungen zur Nummer I sowie unsere editionsgeschichtliche Einführung). Die Darstellungen wurden indessen ganz neu gestochen und mit einer ornamentalen Rahmung versehen. Der Titel verrät uns nur, daß die Tafeln, die in sehr kräftigen Abzügen vorliegen, von einem „Schüler Picarts“ stammen; wahrscheinlich sollte so der Eindruck vermittelt werden, es handle sich um eine neue Illustrationsfolge und nicht um eine Wiederauflage der – im Vergleich zu den Bildern des Régent – weit weniger populären Suite Scotins. Während man die Seitenzahlen der Regentensuite auch nicht angeglichen hat, nicht einmal bei den nachgestochenen Suiten von 1745, sind die Tafeln hier den neuen Textstellen zugeordnet, und die ursprünglichen Stechersignaturen Scotins wurden zur Gänze weggelassen. Da man nirgends einen Plattenrand erkennen kann, dürfte es sich um Drucke handeln, die durch ein Abklatschverfahren hergestellt worden sind, wie man es etwa bei den Werken der Maria Sibylla Merian kennt. Solche Abzüge sind eine große Besonderheit, die erhebliches technisches Können erfordern. Dies wiederum ist nur einem erfahrenen Drucker zuzutrauen. Daß dieser der bekannte Jean Néaulme aus Amsterdam gewesen ist, verraten die Nova Acta eruditorum des Jahres 1756 (S. 299) anläßlich
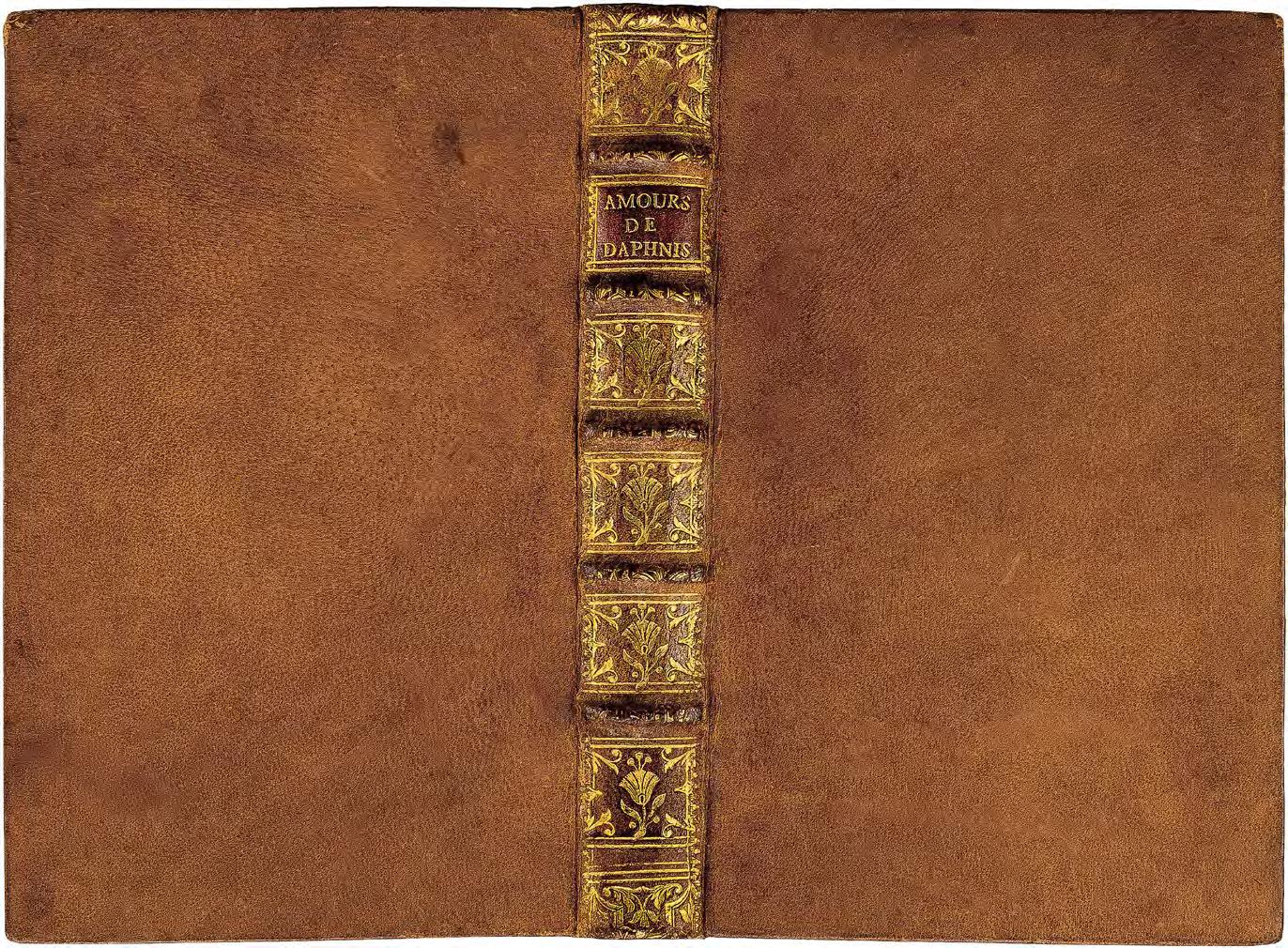
ihrer Rezension der bedeutenden und erstrangig illustrierten zweisprachigen Ausgabe des Jahres 1754, die ebenfalls von Néaulme stammt. Die Wiederaufnahme der seitenverkehrten Scotin-Folge ist sicherlich als Anknüpfung an die örtliche Tradition zu erklären. Erst als es Jean Néaulme nach dem Tod von Charles-Antoine Coypel (1752) gelungen war, die originalen Platten der Regentensuite zu erwerben, konnte er auch Ausgaben mit dieser Folge drucken. Dennoch haben die Ausgabe von 1749 und ihre Titelauflage von 1750 eine eigene Nachfolge gehabt; weitere Editionen erschienen in den Jahren 1764 und 1773, beide in Den Haag, dem zweiten Firmensitz von Néaulme und unter seinem Namen. Es ist indessen fraglich, ob sie tatsächlich von ihm publiziert worden sind, oder ob sie lediglich sein Impressum tragen.
Neben den einmontierten Kopfvignetten der Ausgaben von 1731 und 1745 finden wir hier zusätzlich ein hübsches, bisher unbekanntes Frontispiz im zeitgemäßen Rokoko-Stil und eine ebenfalls unbekannte Titelvignette, die auch montiert worden ist.
Der Band stammt aus der Bibliothek des Herzogs Wilhelm in Bayern, Kloster Tegernsee.
Wohlerhaltenes und schönes Exemplar, ein Rarissimum unter den Longus-Ausgaben.
Literatur: Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 315. Riquier, The early modern transmission, S. 27 (führt drei Auflagen an: Amsterdam 1749 und 1750 sowie London 1764, nicht jedoch die Ausgaben bei Néaulme, Den Haag 1764 und 1773).
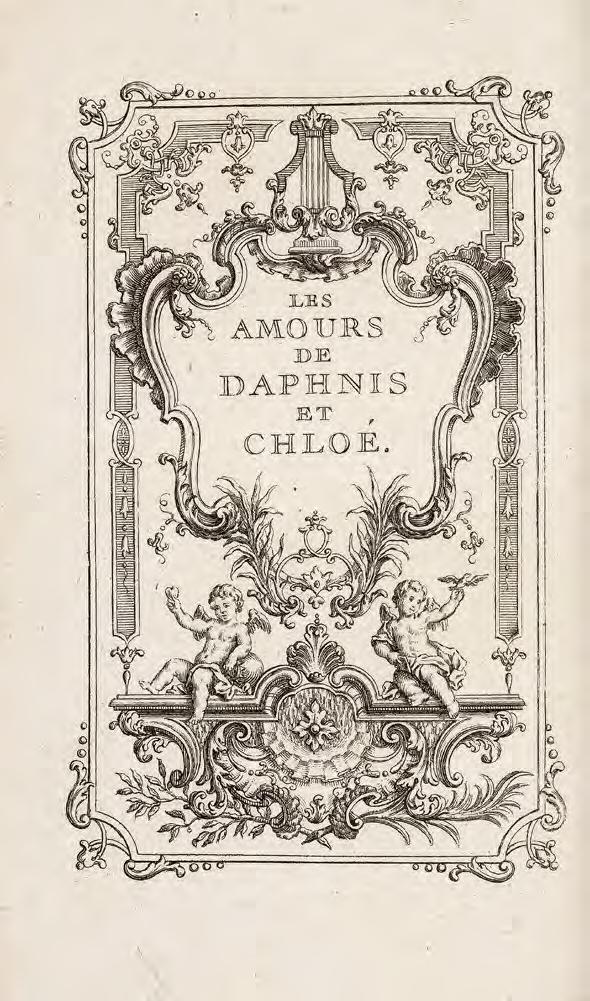
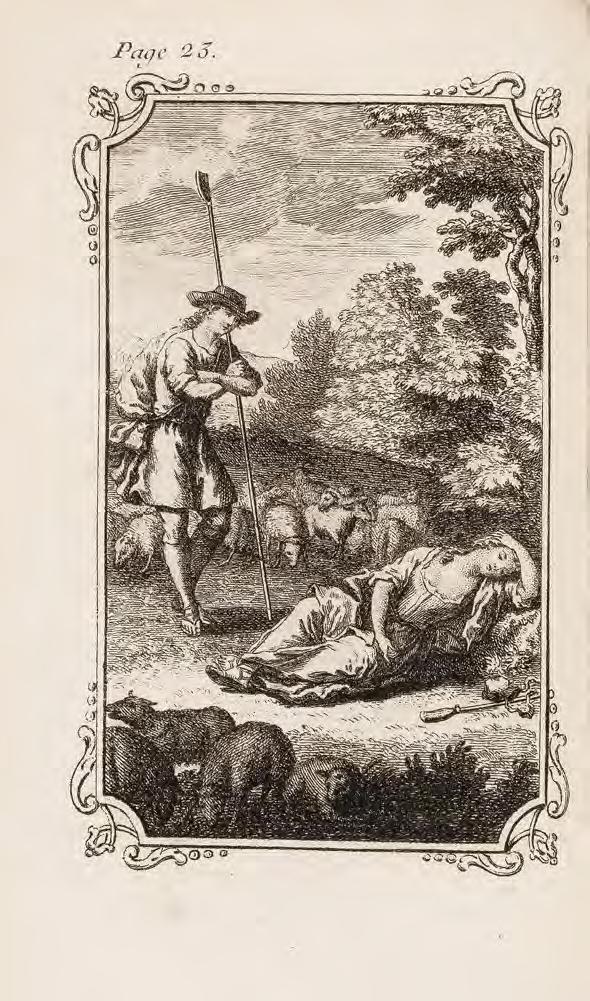

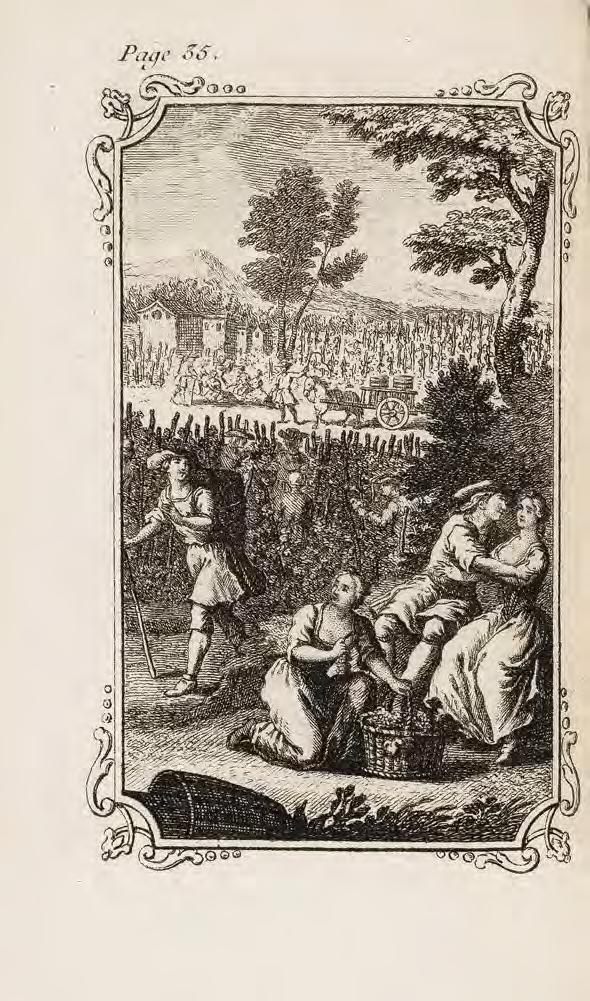
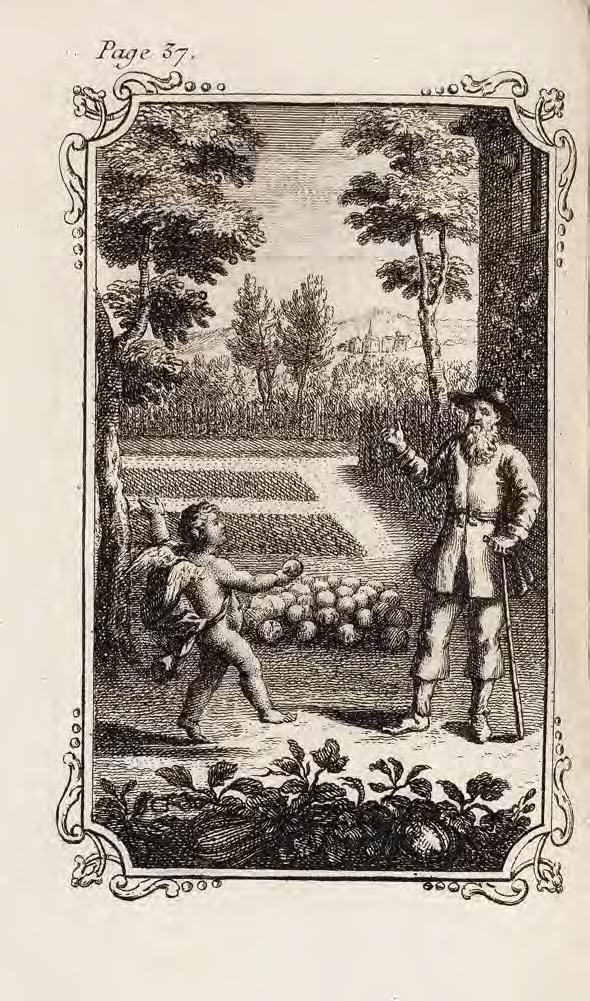


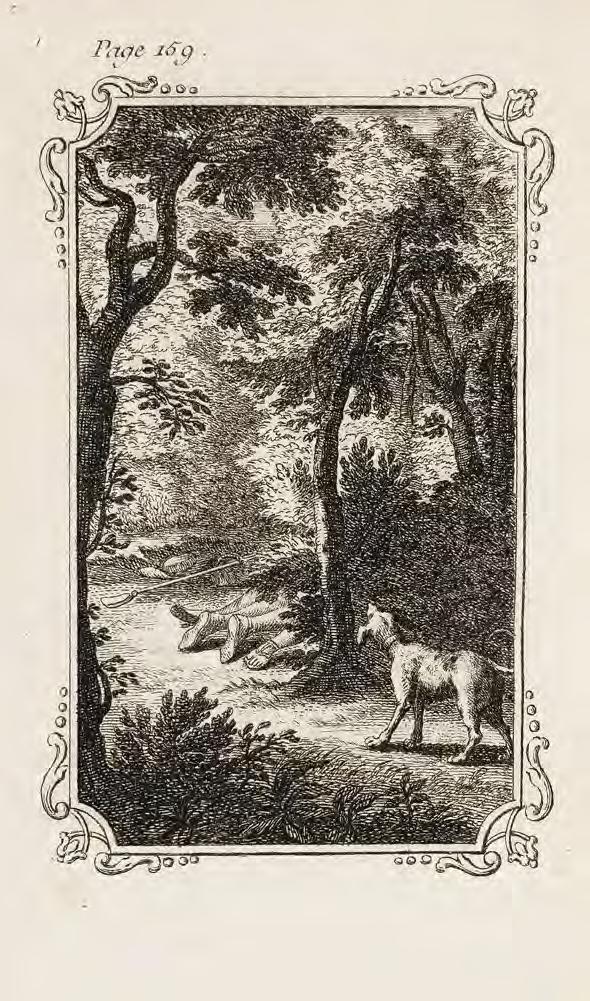
Das Exemplar Bordes de Fortage der Ausgabe von 1754 – mit den vignetten von Eisen und Cochin
XXXVIII LONGUS. Pastoralium, de Daphnide et Chloë, libri quatuor. Graece et latine. Editio nova, una cum emendationibus unicis inclusis [cura J. St. Bernardi]: Distincta viginti novem figuris aeri incisis a B. Audran, juxta delineationes Celsiss. Ducis Aurelian. Philippi; et tabula ab A. Coypel delineata: Accedunt alia ornamenta, partim ab A. Cochin, partim a C. Eisen, adornata, & a Simone Fokke in aes eleganter incisa. „Lutetiae Parisiorum, In gratiam curiosorum“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1754.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Regenten Philippe d’Orléans sowie einer Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von unsignierten Kupferstichbordüren von zweiter Platte (wohl von S. Fokke nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (vier Motive in zweifacher Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.N. Cochin d. J. (vier Motive in zweifacher Ausführung), gestochener Titelvignette (wiederholt als Schlußvignette des Vorworts) und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
175 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Prooemium“ und Haupttext).
Kollation: A-Y 4 .
Klein-Quart (198 x 153 mm).
Olivgrüner Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabene Bünde mit floraler Rückenvergoldung und rotem Maroquinrückenschild mit goldgeprägtem Titel; Deckel mit dreifacher Filetenrahmung, Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung (Zickzackband), Marmorpapiervorsätze, Ganzgoldschnitt und rostrotes Seidenbändchen.
Eines der Hauptwerke der französischen Buchillustration des mittleren 18. Jahrhunderts in einem exzellenten Exemplar bester Provenienz. – Die vorliegende erste griechisch-lateinische LongusAusgabe des 18. Jahrhunderts wurde laut Titel in Paris „in gratiam curiosorum“ gedruckt – unter diesem Beinamen ist sie auch bekannt – doch berichten bereits die Nova Acta eruditorum des Jahres 1756 (S. 297–299), daß es sich bei dem ungenannten Verleger um keinen Geringeren als Jean Néaulme in Amsterdam handelte. Derselbe hatte sich schon 1750 an einer Neuausgabe mit dem Text der Amyot-Übersetzung versucht, dem er zu dieser Zeit aber nur einen eher minderwertigen Nachstich der Scotin-Folge als Illustration beizugeben vermochte (unsere Nummer XXXVII). In der Zwischenzeit hatten sich die Verhältnisse für Néaulme, der selbst ein großer Bibliophiler und Sammler gewesen ist, jedoch entscheidend verändert. Nun gelang es ihm, eine vorzügliche Neuausgabe vorzulegen, deren Absicht auf den ersten Blick evident wird: zielte er doch darauf ab, die bisherigen Editionen von Daphnis et Chloé , zumindest diejenigen des 18. Jahrhunderts, in den Schatten zu stellen und in jeder Hinsicht, auch mittels einer philologisch orientierten neuen Textausgabe, zu übertreffen. Am Anfang dieses ambitionierten wie gewagten Unternehmens stand der Erwerb des kompletten Satzes der originalen Kupferplatten der Regentensuite aus dem Nachlaß des Charles-Antoine Coypel, der 1752 verstorben ist. Alles Weitere war das Resultat einer verlegerischen Tour de force – zusammen mit hervorragenden Kräften seiner Zeit, wie den Illustratoren Eisen und Fokke: „Cette Edition est sans contredit la plus belle de toutes celles qui ont paru de cet Auteur; aussi n’a-t on rien épargné pour la rendre parfaite. Les Caractères dont on s’est servi, tant pour le Texte que pour la Version, sont d’une grande beauté, & le Papier est très-blanc & très-fort (…) Nous ne craignons pas
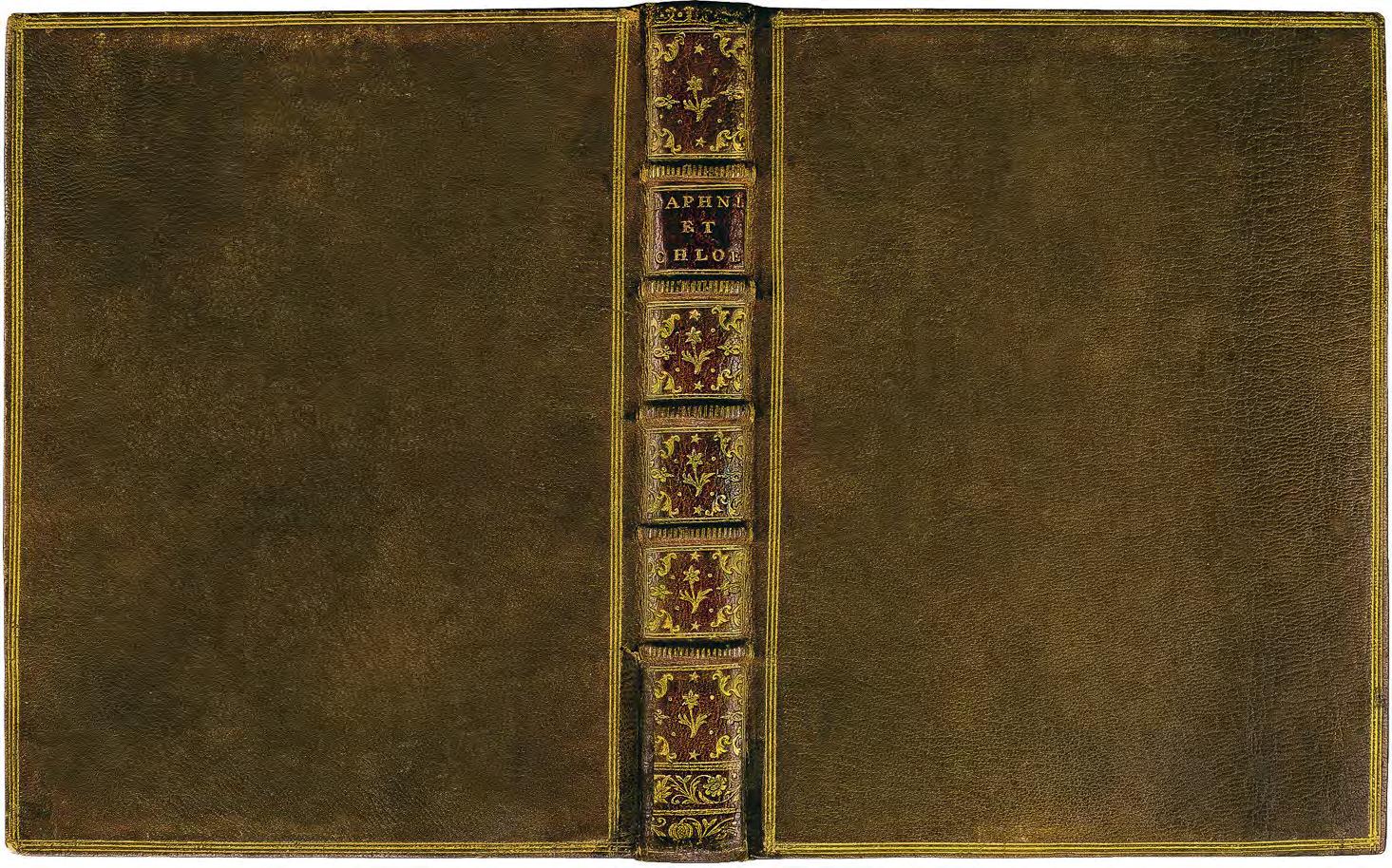
de dire que cette Nouvelle Edition est aussi exacte que belle; outre ces Ornements, elle est encore enrichie de vingt neuf Planches gravées par Audran, sur les Dessins originaux de Feu Monseigneur le Duc d’Orléans, Régent de France, conservés à St. Cloud, d’un Frontispice dessiné par Coypel; de Culsde Lampe & de Vignettes de Cochin & d’Eisen, le tout gravé par le Célèbre Fokke.“ (Aus dem Verkaufskatalog von Néaulmes Sammlung, Catalogue d’une nombreuse collection de livres, Bd. V, Den Haag 1765, S. 34).
An Stelle der bislang produzierten Unterhaltungslektüre zur Zerstreuung der mehr oder weniger gelangweilten Damen der gehobenen Gesellschaft, denen nach gelegentlich erträumten Eskapaden in bukolische Gefilde und pastoraler Liebelei zumute war, erscheint jetzt eine Ausgabe von literarischphilologischem Anspruch, Griechisch und Latein,
im Paralleltext angeordnet. Der Druck ist großzügig, das Schriftbild klar, und der griechische Text enthält viele alternative bzw. verbesserte Lesarten diverser Wörter, die in eckigen Klammern beigefügt sind – eine zumindest ansatzweise textkritische Edition. Nach Ebert handle es sich zwar nur um einen „treuen Abdruck des fehlerhaften Texts von Moll“, doch erhalte sie Wert durch die scharfsinnigen Konjekturen des Herausgebers. Eine deutsche Kritik des Jahres 1777, die auch unsere Ausgabe erwähnt, läßt an Molls Textedition und seinen Anmerkungen, ursprünglich geschaffen für eine Ausgabe des Jahres 1660, allerdings kein gutes Haar. Moll habe sich der guten Ausgabe des Jahres 1605 von Gottfried Jungermann bedient, jedoch „zu dem geraubten Gute eine ungeheure Menge von grammatikalischen Kleinigkeiten und vielen andern Unrath“ gemischt. Die Ausgabe „von Paris 1754.
In 4.“ zeichne sich allerdings, neben der „typographischen Pracht“, durch „einige Verbesserungen“ aus, „welche mit Haken eingeschlossen in den Text eingerückt sind.“ (Neue Philologische Bibliothek, Bd. III , Leipzig 1777, S. 32, aus der ausführlichen Rezension zu der in Leipzig bei Junius 1777 erschienenen griechischen Ausgabe des Benjamin Gottlieb Lorenz Boden, S. 31–45).
Vom erotisch angehauchten bijou indiscret ausgehend, wird hier der Schritt vollzogen, Daphnis et Chloé wieder, wie das bis weit in das 17. Jahrhundert der Fall gewesen ist, als einen Text zu präsentieren, der in den Kanon der im Original lesenswerten Literatur der klassischen Antike gehört. Nun allerdings nicht in erster Linie auf eine aus Gelehrten bestehende Leserschaft abzielend, denn diese legte auf derartige Formen des Buchschmucks und Illustration sicherlich keinen besondern Wert, sondern vielmehr auf den altphilologisch interessierten Laien, den gebildeten adeligen oder bürgerlichen Dilettanten, der die ästhetischen, bibliophilen Werte in den Vordergrund rückte. Der Verleger begnügte sich daher längst nicht damit, die alte Regentensuite lediglich in Abzügen von etwas überarbeiteten Kupferplatten neu zu präsentieren – es ging ihm zweifelsohne darum, für diese Ausgabe eine in jeder Hinsicht zeitgemäße Lösung zu finden, die den mittlerweile klar verfeinerten und in ihrer künstlerisch-ästhetischen Ausrichtung deutlich modifizierten Formen der Buchillustration und des Buchschmucks des Louis-quinze entsprach. Dabei sollten auch die mittlerweile gut 40 Jahre alten Darstellungen des Regenten und seines Lehrers Coypel gebührend einbezogen werden, und zwar so, daß keine wahrnehmbaren Brüche zwischen den veralteten und den neuen Auffassungen auftraten. Daß dies gelungen ist, darf als beachtliche Leistung dieses umsichtigen und kunstsinnigen Verlegers gewertet werden.
Die Konzeption gestand jeder Tafel der Regentenfolge eine eigene Seite zu, also ohne Falze für die querformatigen Bilder – eine grundsätzliche Entscheidung, die das Buchformat von vorneherein auf die Quartgröße festlegte. Diesen Luxus, den man sich bisher nur bei Vorzugsausgaben geleistet hatte, wendete man nun auf die gesamte Auflage an (dies waren, wie die älteren Bibliographen übereinstimmend angeben, nur 125 Exemplare; so Hoffmann und Ebert). Hatte man knapp zehn Jahre zuvor Cochin mit der Gestaltung von Schlußvignetten für die vier Bücher des Hirtenromans beauftragt, tritt nun ein weiterer großer Künstler auf den Plan, der zu diesem Zeitpunkt noch am Beginn seiner Karriere stand: Charles Eisen. Cochin und Eisen hatten die Kunst des Kupferstechens gemeinsam bei Le Bas erlernt und arbeiteten immer wieder einmal zusammen, beispielsweise an der Lucrez-Ausgabe, die ebenfalls 1754 erschienen ist und mit der Eisen erstmals größere Bekanntheit erlangte. Für den Longus hat Eisen die grazilen Kopfvignetten entworfen. Besonders hervorzuheben ist seine Illustration zum dritten Buch: „his version of the famous winter bird-catching scene is about the only one to show the young couple together, whereas other illustrators treat the winter as a time for separation and melancholy” (Barber, Daphnis and Chloe, S. 39).
Eine weitere große Bereicherung erfährt die Ausgabe durch die separat gestochenen Rokoko-Rahmen, die jede der Tafeln des Regenten schmükken: die hochformatigen Kupferstiche rahmt eine Bordüre aus Rocaille-Elementen mit einem schnäbelnden Taubenpaar im Zentrum; die querformatigen Stiche werden von einer Kopf- und Schlußvignette umschlossen, die Schafe, Ziegen, Hirtenstab, Panflöte und andere bukolische Symbole zeigt. Dem Betrachter dieser ausnehmend feinen Rahmen wird deutlich, „daß hier einer der
geschmackvollsten Dekorateure am Werke ist, den das achtzehnte Jahrhundert hervorgebracht hat“ (Fürstenberg, Das französische Buch, S. 90). Eisen, und nicht Simon Fokke, dem die Entwürfe auf dem Titelblatt addiziert werden, war aller Wahrscheinlichkeit nach der Schöpfer dieser Bordüren; man vergleiche hierzu auch die drei Jahre zuvor erschienene L’Éloge de la folie, zu der Eisen die Tafeln und die Rahmen entworfen hatte. Fokke war jedoch der ausführende Stecher, wie im Katalog von 1765 ausdrücklich angegeben.
Nicht minder fragwürdig erscheint die Zuschreibung der Schlußvignetten, deren Motive mit den Vignetten von Cochin, die wir bereits aus der Ausgabe von 1745 kennen, identisch sind, hier aber die Signatur „A. C. inv.“ tragen und auf der Titelseite Antoine Coypel zugewiesen werden. Der tatsächliche Schöpfer offenbart sich in der linken unteren Ecke der Schlußvignette zum ersten Teil, wo „Cochin“ zu lesen ist – nur sehr zart, als hätte jemand in ungenügender Weise versucht, den Namen des Urhebers zu tilgen. Tatsächlich handelt es sich bei diesen Vignetten um minimal vergrößerte, seitenverkehrte und ins Querformat übertragene Nachstiche von Cochins Vignetten der Ausgabe von 1745, ausgeführt von Fokke, doch, das läßt sich aufgrund ihrer hohen Qualität behaupten, sicherlich zurückgehend auf Entwürfe von Cochin. Dessen Signatur sollte wohl zunächst noch als Ausweis seiner Urheberschaft erscheinen, doch hat man sich dann anders entschieden und versucht, diese höchst eleganten und anmutigen Bilderfindungen Coypel unterzuschieben, wohl der Nähe zum Regenten wegen.
Bemerkenswert und meist unerkannt geblieben ist ebenfalls, daß man dieser Ausgabe eine sehr reizvolle, qualitativ hochrangige Neuanfertigung nach der ursprünglichen Fassung der Petits Pieds in der Version von Scotin beigegeben hat, also die Dar-
stellung des Paares im Waldesdickicht. Selbst De Ricci erkennt die Version nicht und spricht lediglich in den Anmerkungen zur Ausgabe von 1757 von einer von der Original-Ausgabe (1718) abweichenden Version der Petits Pieds (vgl. Sp. 653), allerdings ohne dabei den Bezug zu Scotin herzustellen, da ihm wohl weder die Ausgabe von 1716 (diese ist gar nicht erst verzeichnet), noch die vorliegende Ausgabe, die offenbar nur nach Brunet zitiert wurde, vorlag. Reynaud bezieht sich in seiner Anmerkung allerdings auf die Version von Scotin: „dans cette édition 1754, cette figure porte le n° 22, le sujet est quelque peu modifié, la scène se passe sous les arbres avec, au premier plan, un chien en arrêt qui aboie, entre lui et les personnages, un chapeau et une houlette“ (Sp. 317). Überhaupt erscheint es uns nicht angemessen, diese bisher vernachlässigte Version als bloßen Nachstich zu bezeichnen. Vielmehr handelt es sich um die schönste aller bekannten Fassungen, zumal sie selbst im Vergleich mit Scotins Original erheblich an Feinheit und Zartheit gewinnt und gegenüber der von Caylus gezeichnetenVersion viel naturhafter und unverbildeter wirkt. Letztlich wurde hier Caylus, dessen Tafel sonst immer der Regentensuite zugeordnet worden war, gegen einen verbesserten Scotin getauscht; so etwas brachte nur ein großer Künstler wie Eisen zustande. Man beachte übrigens auch die veränderte Positionierung der Tafel zum Text, die immerhin den „Austausch“ der dargestellten Frauen zur Folge hat (Näheres in unserer Einführung zur Edition von 1718).
Insgesamt gesehen ist die Pracht und künstlerische Vollendung dieser Buchillustration aus Tafeln und Vignetten allen vorherigen Ausgaben des Werks nicht nur überlegen, sie führt es auch erstmals konsequent in das neue Zeitalter des Rokoko, in der Buchillustration auch siècle de la vignette genannt, hinüber. Die herrlichen, durch ihre
Verdoppelung noch gesteigerten Vignetten Eisens und Cochins entfalten hier ihre bezaubernde Wirkung in ungewöhnlicher Weise. Aber Einblicke in das Wesen der Illustrationskunst des Rokoko eröffnen in Sonderheit die Neufassungen der Tafeln der alten Regentenfolge mit ihren exzellenten Rocaillerahmen. Bestätigen sie doch, was über den Rokokostil als „kritische Form“ festgestellt worden ist: Die Rocaille bildet, wie das Hermann Bauer in Anlehnung an Michalski so treffend formuliert hat, eine ästhetische Schranke, „eine Grenze, die anti-illusionistisch wirkt. Gleichzeitig jedoch ist sie selbst bereits Bild, saugt als Rahmen die Realität des dahinterliegenden Bildes an sich nach vorne und versetzt damit den Betrachter in eine eigene Bildwelt, die zwischen ihm und dem Abbild liegt … Das Kunstwerk im extremen Rocaille-Rahmen verfällt der mikromegalischen Struktur der Rocaille. Es wird mit dem Unwirklichkeitsakzent dargeboten, in ästhetische Distanz gerückt, dem Theater vergleichbar…“ (Bauer, Rocaille, S. 62). Wo ließe sich das besser ablesen als hier, wo die RokokoRahmen tatsächlich auf eine traditionelle perspektivisch-illusionistische Bildauffassung einer hochbarocken Bilderfolge treffen? Daphnis und Chloe sind mit der Ausgabe von 1754 in der Tat in einer neuen Epoche angekommen – das eigentliche Wunder ist, daß es gelang, bei diesem Übergang den alten Bilderzyklus und seine ungezwungene Erzählfreundigkeit zur Gänze zu bewahren.
Provenienz: Mit dem Exlibris von Philippe-Louis Bordes de Fortage (1846–1924), auf dessen Auktion im Jahre 1919 unser Exemplar für 470,– Fr. verkauft wurde (Dezember 1919, Nr. 120). Bordes de Fortage, der dank des väterlichen Erbes imstande war, sein Leben dem „culte des lettres et des arts“ zu widmen, war Ehrenpräsident der Socitété des Bibliophiles de Guyenne.
Der Einband mit leichten Abriebstellen an den Bünden und Kanten; der Buchblock meist sehr sauber. Die Stiche liegen in schönen kraftvollen Abzügen vor.
Die erste Longus-Ausgabe aus der zweiten Hälfte des dix-huitième , deren editionsgeschichtliche Bedeutung in dem gelungenen Brückenschlag zwischen der erprobten Illustrationskunst des beginnenden 18. Jahrhunderts und den neuen Strömungen des siècle de la vignette liegt.
Bibliographische Referenzen: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 652. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 316. Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1155. Ebert, ABL , 12227. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 531. Michel, Cochin et le livre illustré, Nr. 51 (zur Ausgabe von 1745, erwähnt hier nur die Kopien Fokkes in der Ausgabe des Jahres 1757). Salomons, Eisen, S. 129 f. Barber, Daphnis and Chloe, S. 38. Lewine, Illustrated books, S. 322. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1254.
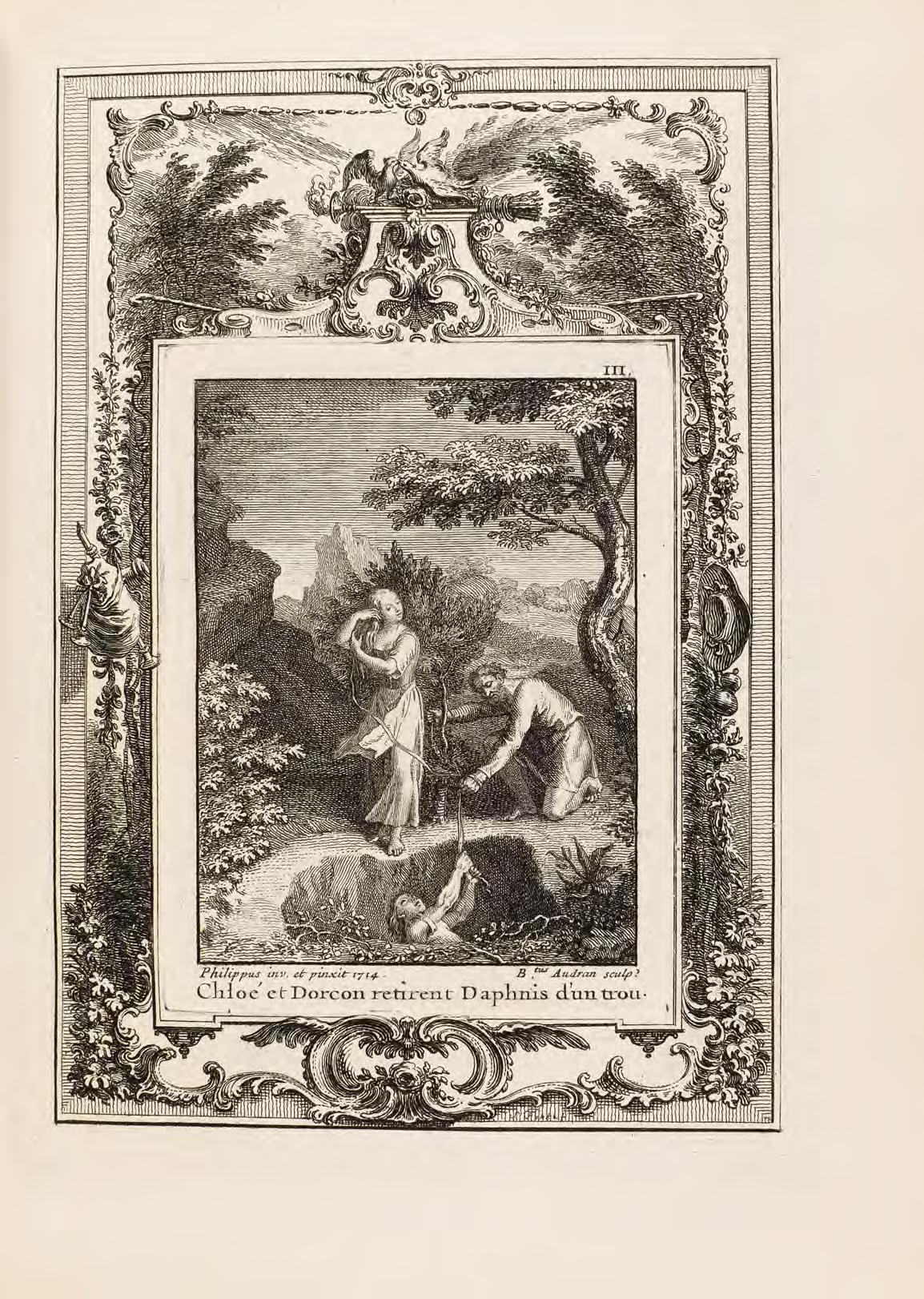
In smaragdgrünem Maroquin von Derome
XXXIX LONGUS. Pastoralium, de Daphnide et Chloë, libri quatuor. Graece et latine. Editio nova, una cum emendationibus unicis inclusis [cura J. St. Bernardi]: Distincta viginti novem figuris aeri incisis a B. Audran, juxta delineationes Celsiss. Ducis Aurelian. Philippi; et tabula ab A. Coypel delineata: Accedunt alia ornamenta, partim ab A. Cochin, partim a C. Eisen, adornata, & a Simone Fokke in aes eleganter incisa. „Lutetiae Parisiorum, In gratiam curiosorum“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1754.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie einer Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von unsignierten Kupferstichbordüren von zweiter Platte (wohl von S. Fokke nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (vier Motive in zweifacher Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.N. Cochin d. J. (vier Motive in zweifacher Ausführung), gestochener Titelvignette (wiederholt als Schlußvignette des Vorworts) und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
175 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Prooemium“ und Haupttext).
Kollation: A-Y 4 . Klein-Quart (197 x 152 mm).
Dunkelgrüner Maroquineinband um 1770 auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit floraler Rückenvergoldung, in der Mitte jeweils ein Zweig mit Granatapfel, der goldgeprägte Titel im zweiten Kompartiment von oben, Deckel mit dreifacher Filete und Blütenstempeln an den Überschneidungen; doppelte Stehkantenfileten, Innen kantenvergoldung (Schraffurbordüre in alternierender Stärke), Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt, von N.-D. Derome le Jeune.
Ein weiteres wohlerhaltenes und repräsentatives Exemplar der gesuchten Ausgabe mit den reizvollen reichen Rokokoillustrationen, in der auch die Tafeln nach dem Regenten dem Zeitgeschmack angepaßt wurden, hier in einem Einband von edlem smaragdgrünen Maroquin, dessen Färbung im Lauf der Jahrhunderte nichts an Tiefe und Leuchtkraft eingebüßt zu haben scheint. Dieser prächtige Einband kann durch die zentrale Form seiner Rückenvergoldung, eine Ranke mit aufgesprungenem Granatapfel, als eine Arbeit des Nicolas-Denis Derome (1731–1790) identifiziert werden (Barber, Rothschild, Fl 57, W.Cat. 21, mit Derome-Schildchen, und 151, beide als Rückenmotiv, zusätzlich am unteren Kapital eine doppelte Akanthus-Bordüre, Pal 84, diese gelegentlich auch an Einbänden von Lemonnier nachweisbar).
Ein erfreuliches Exemplar einer der schönsten illustrierten Ausgaben des mittleren 18. Jahrhunderts; lediglich die Ecken sind leicht bestoßen, innen fleckenfrei und bestens erhalten. – Bibliographie siehe vorhergehende Nummer.

Das Exemplar Chartraire –
Unikale Variante ohne die Bordüren, in rotem Maroquin, wohl von Fétil
XL LONGUS. Pastoralium, de Daphnide et Chloë, libri quatuor. Graece et latine. Editio nova, una cum emendationibus unicis inclusis [cura J. St. Bernardi]: Distincta viginti novem figuris aeri incisis a B. Audran, juxta delineationes Celsiss. Ducis Aurelian. Philippi; et tabula ab A. Coypel delineata: Accedunt alia ornamenta, partim ab A. Cochin, partim a C. Eisen, adornata, & a Simone Fokke in aes eleganter incisa. „Lutetiae Parisiorum, In gratiam curiosorum“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1754.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie einer Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (vier Motive in zweifacher Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.N. Cochin d. J. (vier Motive in zweifacher Ausführung), gestochener Titelvignette (wiederholt als Schlußvignette) und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
175 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Prooemium“ und Haupttext).
Kollation: A-Y 4 . Klein-Quart (203 x 152 mm).
Weinroter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit floraler Rückenvergoldung, in der Mitte jeweils ein aufgesprungener Granatapfel, umgeben von kleineren Ornamentstempeln, schwarzes Maroquinrü kkenschild mit dem goldgeprägten Titel im zweiten Kompartiment von oben, im untersten Kompartiment schwarzes Maroquinschild mit Erscheinungs-
Ort „Hagae Comitum“ und dem Jahr 1754, darüber ein Maroquinschild mit der goldgeprägten Wappenfigur (Turm) des Besitzers; Deckel mit dreifacher Filetenrahmung und kleinem Blütenstempel an den Überschneidungen, Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung sowie Marmorpapiervorsätze und ganzseitiger Goldschnitt, wohl von R.-F. Fétil .
Dies ist das einzige für uns nachweisbare Exemplar ohne die gestochenen Bordüren, die Simon Fokke wohl nach Charles Eisen als Einfassung der Tafeln der Regetensuite gestochen hat. Vermutlich handelt es sich um eine Sonderanfertigung im Auftrag des Erstbesitzers, des Grafen Chartraire. Denkbar wäre etwa, daß dieser die Wirkung der bloßen Kupferstiche des Regenten mit breitem weißen Rand dem Zusammenstoß unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen und Stile – dem Spätbarock und Rokoko –, die den eigentlichen Reiz dieser Ausgabe ausmachen, vorzog und er sich deshalb die Tafeln vor dem Bordürendruck einbinden ließ. Eine andere Erklärung wäre die Möglichkeit, daß wir es hier mit einer Erstfassung zu tun haben, die noch vor dem Beschluß, die Tafeln mit Bordüren zu versehen, gedruckt worden ist, gewissermaßen ein Probedruck, dem eine besondere Ästhetik eigen ist, die sich nur in diesem einen Exemplar manifestiert. In jedem Fall gehört es zu einer früheren Teilauflage (oder Druckvariante), die an dem noch unkorrigierten Fehler „Liber Cecundus“ am Kopf von Seite 51 zu identifizieren ist.
Bei dem schönen Einband mit der den Wünschen des Besitzers angepaßten Gestaltung durch drei Rükkenschilder könnte es sich um eine Arbeit von René-François Fétil handeln. Geboren in den 1720er Jahren und wohl um 1799 gestorben, vielleicht ein Schüler des Antoine-Michel Padeloup, war Fétil als Buchbinder und -händler in Paris tätig. Seine Handschrift verrät sich in dem kleinen Detail des grazilen Rankenornaments in den vier Ecken der
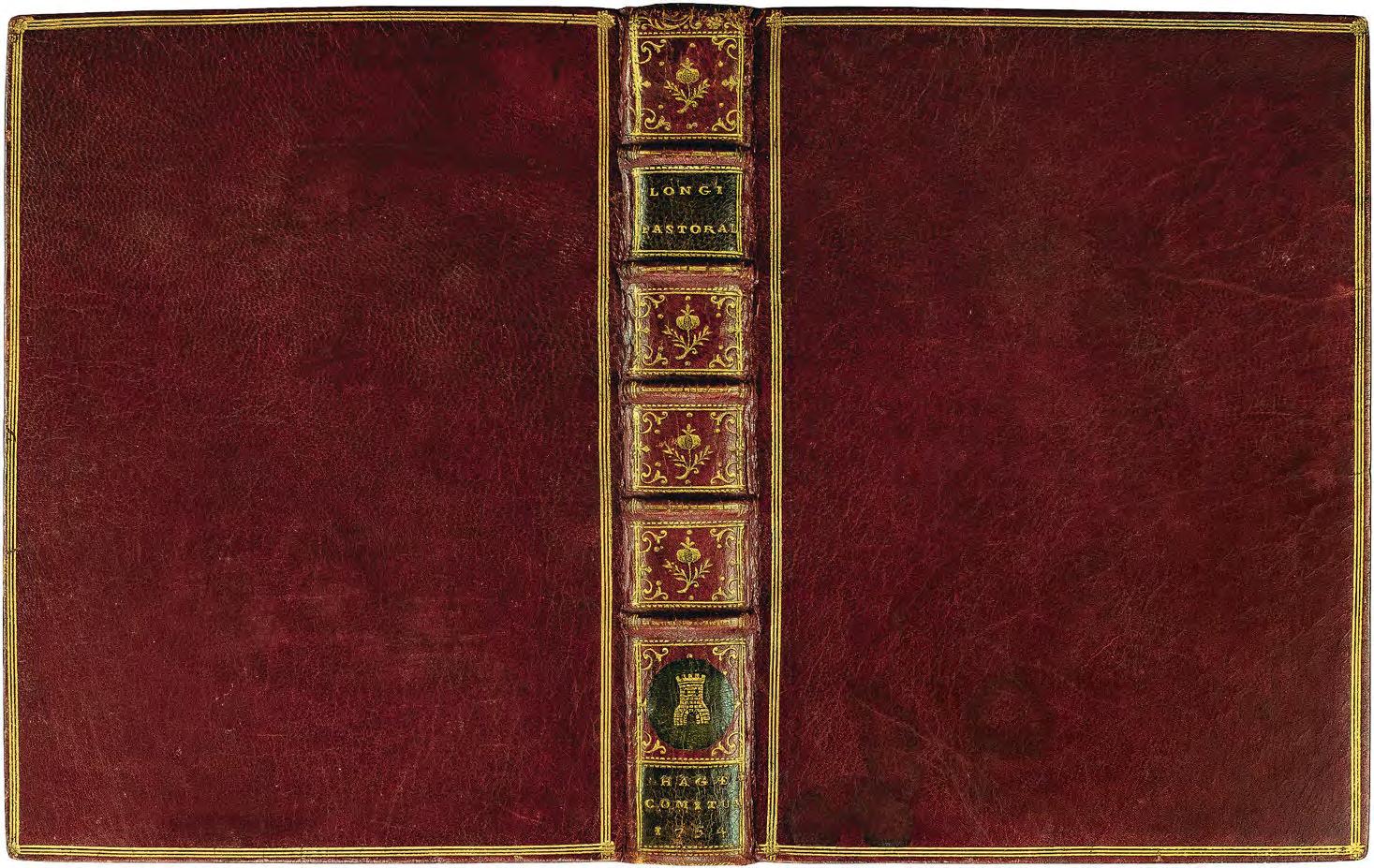
Rückenkompartimente, nachgewiesen bei Barber (Rothschild, SP 34, W.Cat. 502, mit Fétil-Etikett, dieser Einband ist in die späten 1760er Jahre zu datieren). Höchst interessant ist indessen das untere Rückenschild, welches als Erscheinungsort Den Haag nennt, hatte dort doch der Verleger Néaulme eine Dependance, obwohl das Werk nachweislich in Amsterdam, seinem hauptsächlichen Verlagsort erschienen ist. Obwohl inkorrekt, ist dies also ein zeitgenössischer Verweis auf den richtigen Verleger.
Provenienz: Das schwarze Maroquinschild auf dem Rücken des Einbands weist auf die französische Adelsfamilie Chartraire hin. Der goldgeprägte Turm mit fünf Zinnen, zwei Fenstern und Tor entspricht der Wappenfigur des Grafen von Montigny, François Chartraire (1692–1728); vermutlich ist dessen Bibliothek auf seinen Sohn Jean-François-Gabriel-Bénigne Chartraire de Bourbonne (1713–1760) übergegangen, der auch die le -
gendäre, aus mehr als 35.000 Bänden bestehende Bibliothek seines Schwiegervaters, des Präsidenten des Parlaments von Bourgogne, Jean Bouhier (1673–1746), erbte und diese durch seine eigene reiche Sammlung bibliophiler Ausgaben des Dixhuitième ergänzte.
Abgesehen von einem Fleck auf dem Vorderdekkel und leichten Beschabungen an den Kanten, befindet sich der Einband in einem guten Zustand. Das Papier leicht gebräunt und fast fleckenfrei; die Kupfer liegen in frischen Abzügen vor.
Interessante Sonderanfertigung aus bedeutender Provenienz.
Literatur: Guigard, Nouveau armorial, Bd. II , S. 127 (zur Familie Chartraire). – Kein Nachweis eines Drucks ohne Bordüren, die allgemeinen bibliographischen Referenzen zur Ausgabe unter unserer Nummer XXXVIII .




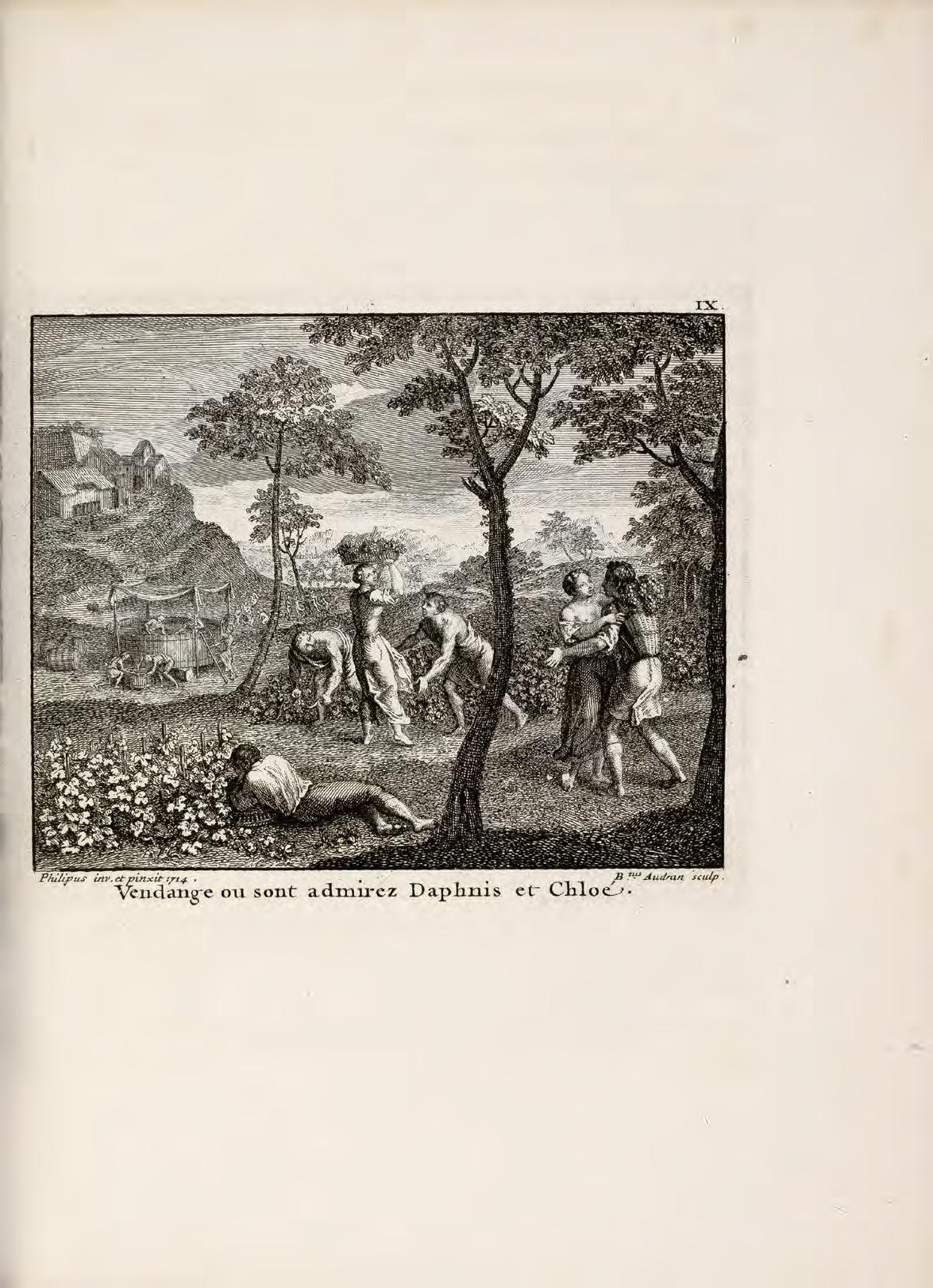
Das vielleicht einzige Erhaltene
Exemplar einer Druckvariante auf grossem Papier, von L. Douceur in rotes Maroquin mit individualisierter Dentelle gebunden
XLI LONGUS. Pastoralium, de Daphnide et Chloë, libri quatuor. Graece et latine. Editio nova, una cum emendationibus unicis inclusis [cura J. St. Bernardi]: Distincta viginti novem figuris aeri incisis a B. Audran, juxta delineationes Celsiss. Ducis Aurelian. Philippi; et tabula ab A. Coypel delineata: Accedunt alia ornamenta, partim ab A. Cochin, partim a C. Eisen, adornata, & a Simone Fokke in aes eleganter incisa. „Lutetiae Parisiorum, In gratiam curiosorum“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1754.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie einer Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (vier Motive in zweifacher Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.N. Cochin d. J. (vier Motive in zweifacher Ausführung), gestochener Titelvignette (wiederholt als Schlußvignette) und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
175 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Prooemium“ und Haupttext, alle Seiten von doppelten typo graphischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: A-Y 4 . Quart (282 x 221 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, mit floraler Rückenvergoldung, braunem Maroquinrückenschild
mit dem goldgeprägtem Titel im zweiten von oben, in den übrigen Kompartimenten mittig eine stilisierte Distel, umgeben von kleineren Blumenornamenten, Deckel mit außergewöhnlich elaborierter, intrikater Dentellevergoldung, bestehend aus einer äußeren Kette aus kleinen c-förmigen Elementen und einer einfachen Filete, im Inneren bilden etliche Pflanzen-, Muschel- und Ornamentstempel ein besonders tiefes und üppiges Spitzenmuster, von Akanthusgirlanden und Pointillé-Elementen gerahmte Sonnenblumen wachsen diagonal aus den Ecken empor, seitlich die für dieses Werk geschnittenen Stempel: das stehende und das liegende Schäfchen, die kleine Hirtenschaufel und der Dudelsack; Ganzgoldschnitt und Vorsätze aus seeblauen Tabis, auf der letzten Seite das Etikett von L. Douceur, Vergoldung von Plumet?
Das einzige uns bekannte Exemplar auf großem Papier in einem atemberaubenden Einband von Louis Douceur. Der Relieur du Roi , der auch vielfach für die Pompadour gearbeitet hat, war bekannt für seine einzigartigen, handwerklich wie künstlerisch auf höchstem Niveau gestalteten Einbände. Die eigens für den Longus geschnittenen Stempel verwendete er für mindestens vier Exemplare verschiedener Ausgaben, wobei sich der besonders entzückende Dudelsack nur auf unserem findet: bekannt sind uns zwei Einbände der Ausgabe von 1745 (eines davon in unserer Sammlung, das andere in der Sammlung Rothschild) sowie ein Intarsieneinband der Ausgabe von 1757, zuletzt Sammlung Mortimer Schiff. (Laut Auskunft von Monsieur E. Aguirre im Juni 2020 stammt die Vergoldung von Plumet). Das vorliegende Exemplar – von ausnehmender Qualität und makelloser Erhaltung – schließt diese zeitliche Lücke. Ganz besonders erstaunlich ist jedoch, daß die Existenz dieses Exemplars nie schriftlich vermerkt wurde und keinerlei Provenienzhinweise gegeben sind.
Nun handelt es sich hier nicht einfach nur um einen Abdruck der Kleinquartausgabe auf großem Papier, sondern um eine tatsächliche Druckvariante, die sowohl im Satz als auch bei den Tafeln gewisse Unterschiede aufweist. Auf den ersten Blick auffällig wird das anhand der Rahmung sämtlicher Textseiten mittels doppelter Perlstabbordüren, die auch deshalb interessant sind, weil wir dieselbe Form der Textrahmung, aber auf eine einfache Bordüre reduziert, in der folgenden Ausgabe von 1757 wiederfinden. Tatsächlich beschränkte sich die Arbeit des Verlegers nicht auf diesen verzierenden Zusatz; offenbar wurde der gesamte Druck nochmals auf Fehler durchgesehen, wobei etwa jener auf Seite 51 der kleineren Ausgabe „Liber Cecundus“ in der Seitenüberschrift bei der größeren Druckvariante korrigiert worden ist. Aber auch die Platten mit dem Regentenzyklus und den sicherlich nach Eisens Entwürfen hinzukomponierten Rahmen sind vom Stecher Fokke erneut überarbeitet worden. An einigen findet sich jetzt seine Signatur, wo sie in der kleineren Ausgabe noch fehlte. Merkwürdig ist hier vor allem Fokkes Versuch, bei den Querformaten der Regentensuite Änderungen an den Rahmenlinien des inneren Bildfelds vorzunehmen, offenbar um die Übergänge fließender zu gestalten und weil man es wohl als unbefriedigend empfunden hat, daß die Bildfelder dort nicht auch seitlich ornamental eingefaßt werden. Auch dieser Versuch ist durch das Bildverständnis des Rokoko, das geradezu nach Rahmenornament verlangt, motiviert.
Das sehr starke, blütenweiße Papier von bester Qualität läßt den Druck außergewöhnlich intensiv und kontrastreich wirken, eminent breite Ränder vervollkommnen den bibliophilen Genuß. Das Exemplar befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Bedenkt man, daß allenfalls einzelne Dru kke von dieser Variante hergestellt worden sind und
ein solcher hier in einem Einband von geradezu betörender Pracht vorliegt, eine Spitzenleistung des Hofbuchbinders Louis Douceur, ja der ganzen Epoche, individuell angefertigt mit Motivik, die auf den Inhalt des Werks Bezug nimmt, dann kommt man nicht umhin, hier als Besitzer und Auftraggeber eine Persönlichkeit höchsten Ranges zu vermuten.
Dieses bisher unbekannte unikale Exemplar der höchst seltenen Druckvariante auf großem Papier in einem fulminanten Einband von Louis Douceur ist fraglos das bedeutendste dieser Ausgabe.
Referenzen: Die Druckvariante auf großem Papier ist bibliographisch kaum erfaßt und bekannt geworden; Hoffmann merkt in seinem Lexikon der Literatur der Griechen immerhin an, daß von der zweisprachigen Auflage des Jahres 1754 insgesamt 125 Exemplare gedruckt worden seien, „von denen die schlechteren 25 holl. Gulden, die auf gr. Pp. aber 50 holl. Gulden kosten“ (Literatur der Griechen, S. 531) – die Abwertung hätte er eigentlich in Anführungszeichen setzen müssen – sind doch auch die Drucke in kleinerem Format alles andere als „schlecht“; erstaunlich ist aber, daß die großen Drucke gleich doppelt so teuer ausfallen, was nicht zuletzt auf deren extreme Seltenheit hindeutet: man darf also vermuten, daß diese Variante in einer Kleinstauflage einiger weniger Exemplare erschienen ist, von denen in heutiger Zeit offenbar nur noch unseres bekannt ist. Im frühen 19. Jahrhundert befand sich ein Exemplar in der königlichen Bibliothek zu Dresden, deren Katalog davon spricht, der Text sei „durch eine typographische Doppelverzierung eingefasst“ (Falkenstein, Königliche Bibliothek zu Dresden, S. 544), ein anderes besaß der Verleger Néaulme selbst (Catalogue Néaulme 1765, Bd. V, Nr. 143: „Charta Maj. In 4“ und „rare. en Gr. Papier“). – Bibliographie zur Ausgabe unter unserer Nummer XXXVIII .
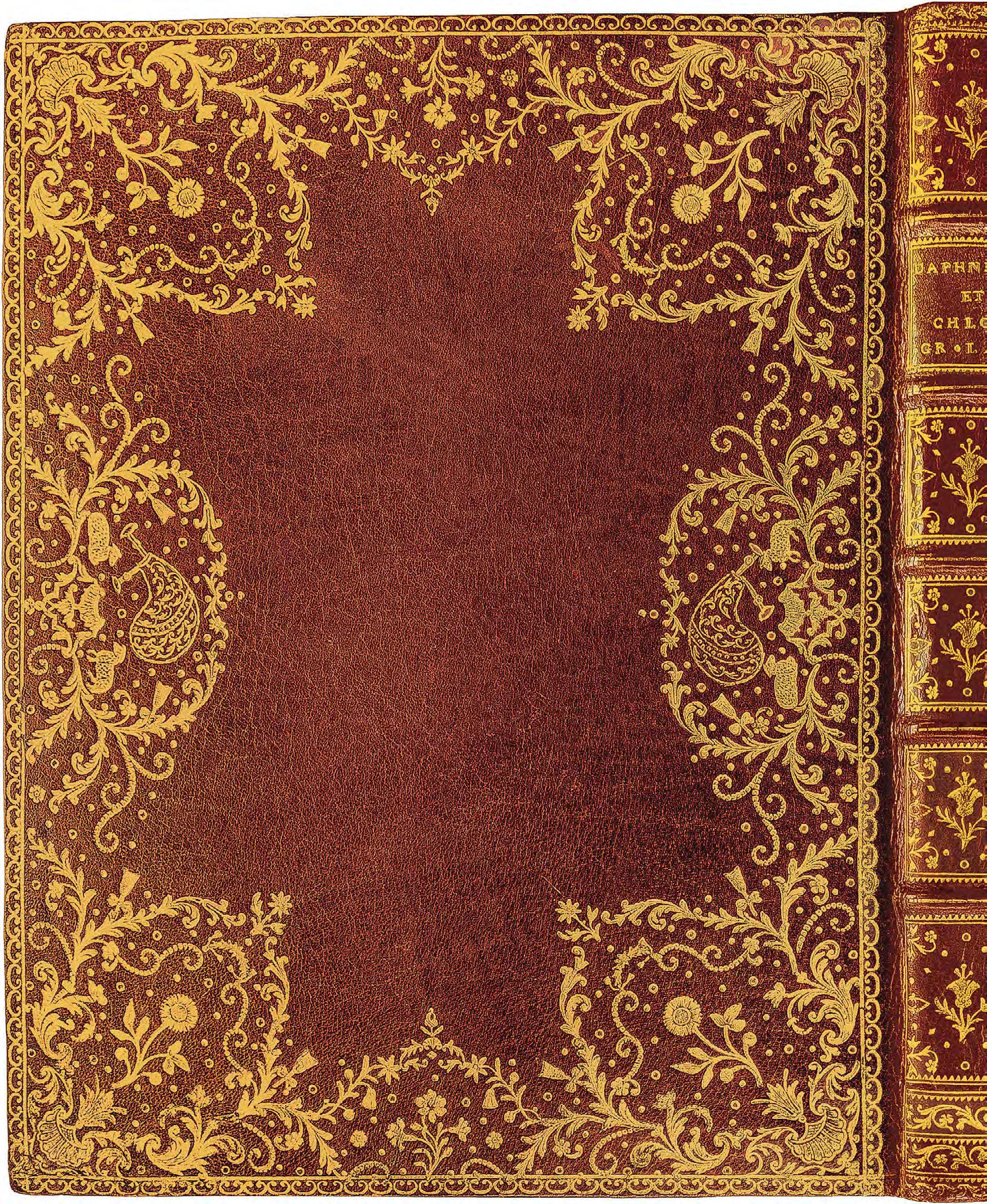
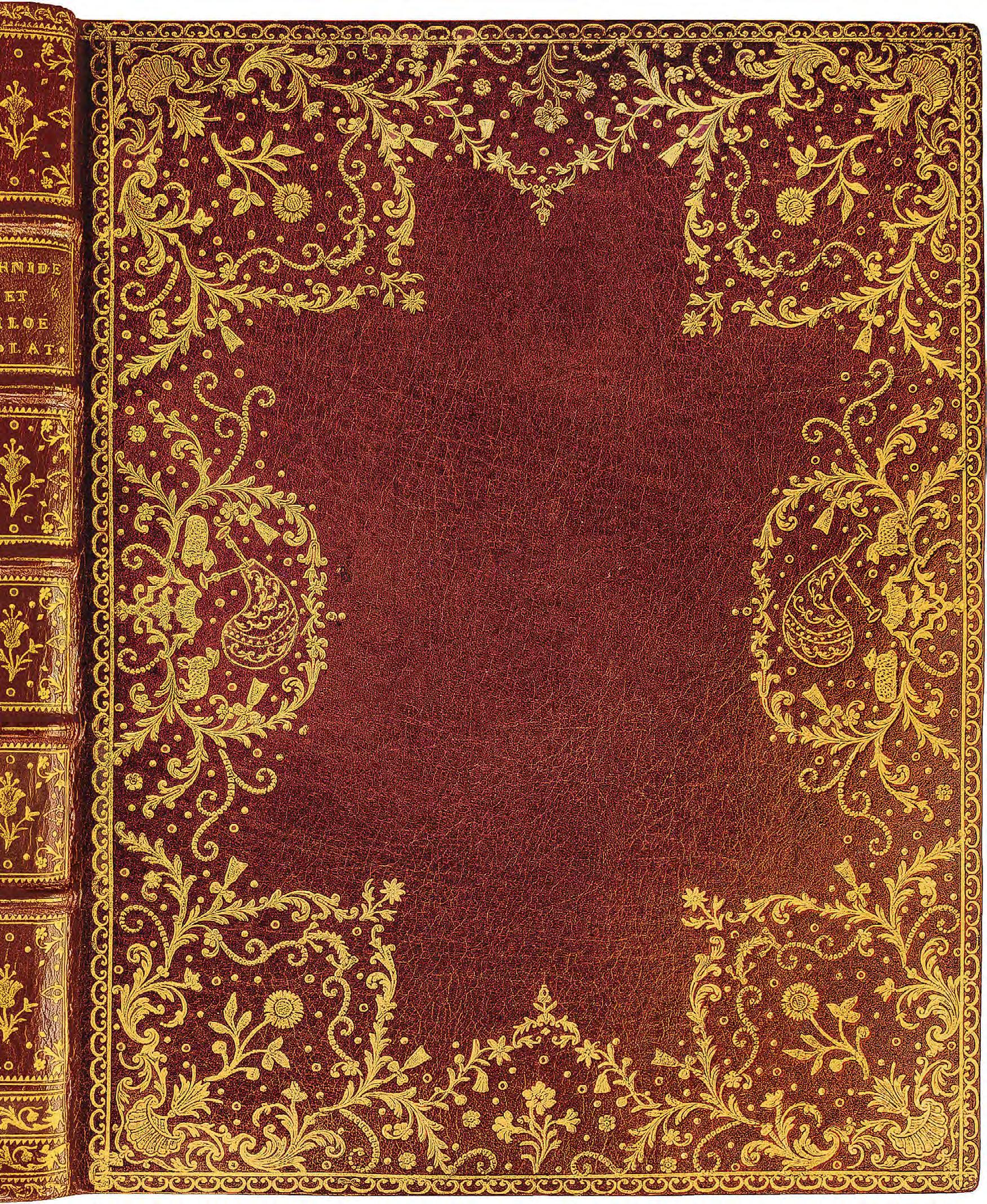
Exemplar der Ausgabe von 1757 in Maroquin der Zeit
XLII LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 27 (statt 28, davon 12 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.-N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3 Klein-Quart (200 x 150 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit floraler Rückenvergoldung mit je einer Blume im Zentrum sowie dunkelgrünem Maroquinrückenschild mit
dem Titel im zweiten Kompartiment von oben, die Deckel mit dreifacher Filetenrahmung und Eckfleurons; doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Hatte der große in Amsterdam und Den Haag tätige Verleger Jean Néaulme (1694–1780) drei Jahre zuvor bereits eine griechisch-lateinische Ausgabe, die ganz neue Qualitätsmaßstäbe setzte, auf den Markt gebracht, wenn auch nur in sehr kleiner Auflage, so legte er jetzt mit einer volkssprachlichen Neuausgabe nach. Und wiederum hatte er es sich zweifelsohne zum Ziel gesetzt, den Buchmarkt um eine Besonderheit reicher zu machen: Der klassischen französischen Übersetzung von Jacques Amyot, die zu diesem Zeitpunkt fast schon 200 Jahre maßgebend, aber sprachlich entsprechend veraltet war, stellt die Ausgabe von 1757 eine modernisierte, anonym veröffentlichte Übertragung von Antoine le Camus (1722–1772) gegenüber. Dem antiken Werk über „la candeur et l’ingénuité de deux coeurs, lorsqu’ils ne sont pas corrompus par les préjugés ou par l’affectation du sentiment“ (zitiert nach Barber, Daphnis and Chloe, S. 39) eine zeitgemäße Form verleihen – dies war das erklärte Ziel des Mediziners und Verfassers der „Médecine de l’esprit“ (1753). Die beiden Übersetzungsvarianten werden hier in zwei unterschiedlichen Typen, kursiv und gerade, einander gegenübergestellt und jeweils von einer Perlstabbordüre gerahmt (siehe unsere Nummer XLI).
Obwohl die Ausstattung der vorhergehenden Ausgabe vollständig übernommen wurde, stoßen wir hier auf eine bisher unentdeckte Kuriosität. Wie wir wissen, schuf Charles Eisen zu jedem der vier Teile eine Kopfvignette; diese Vignetten wurden bereits in der griechisch-lateinischen Ausgabe jeweils doppelt eingedruckt. Auch in der vorliegenden Ausgabe finden wir die gleichen Motive für den ersten und zweiten Teil, doch zu Beginn des dritten Teils sehen wir auf der
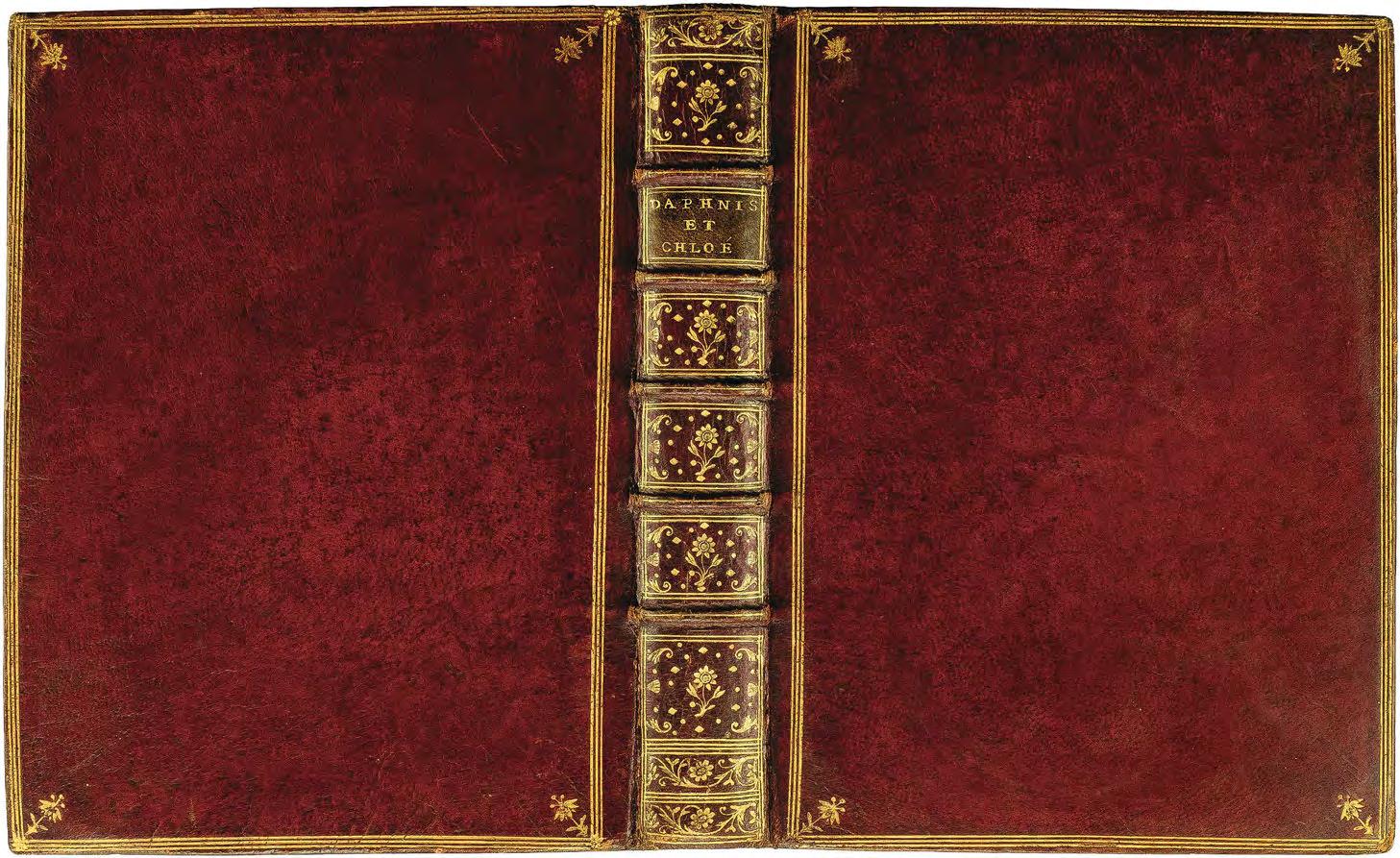
linken Seite die berühmte Winterszene und auf der rechten Seite die Vignette, die eigentlich dem vierten Teil zugeordnet wird. Im vierten Teil wird diese Vignette nochmals wiederholt, dort wieder nach dem vormaligen Schema. Ein solcher Tausch fand auch bei Cochins Schlußvignetten statt: am fin du livre second finden sich zwei verschiedene Vignetten, von denen die rechte am Ende des dritten Teils wiederholt wird. Dieses neue Arrangement der Kupferplatten scheint den Bibliographen bisher entgangen zu sein. Lediglich bei De Ricci finden wir eine vage Notiz, die auf dieses Phänomen hinweist: „8 vignettes par Eisen et 8 culs-de-lampe par Cochin (3 sont répétés)“. Offenbar war es dem Verleger mittlerweile zu monoton geworden, die Stiche doppelt nebeneinander abzudrucken, weshalb nun diese kleine reizvolle Variation ins Spiel kam, eine sehr ähnliche Darstellung dort erscheinen zu lassen, wo man eigentlich dieselbe erwartet hätte – zumal es sich bei den jeweils ersten und letzten Vignettenpaaren auch
so verhält und sie noch der doppelten Anordnung von 1754 folgen.
Ein dekorativ gebundenes Exemplar mit schöner Rückenvergoldung, vereinzelt mit kleineren Abriebstellen; innen in geringem Maße stock- und fingerfleckig. Die Tafel vor Seite 157 („Licoenion écoute Daphnis et Chloé qui cherchent remede d’Amour“) fehlt. – Keine Hinweise zur Provenienz.
Bibliographische Referenzen: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 653. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 317. Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, S. 515. Boissais/Deleplanque, Le Livre à gravures, S. 115. Lewine, Illustrated books, S. 322. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1226. Barber, Daphnis and Chloe, S. 39. Quérard, La France littéraire, Bd. V, S. 351. Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1158.
Ebert, ABL , 12244. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 533.
Exemplar mit sämtlichen Kupfern in schönem Kolorit der Zeit
XLIII LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen. – Sämtliche Kupferstiche im Kolorit der Zeit.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3 Klein-Quart (200 x 156 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf glattem Rü kken mit floraler Rückenvergoldung in sechs Kompartimenten, dunkelgrünem Maroquinrückenschild im
zweiten von oben, im Zentrum jedes Kompartiments eine Blume, umgeben von Kastenvergoldung und floralen Ornamenten, Deckel mit dreifacher, sich in den Ecken kreuzender Filetenrahmung; Steh- und breite Innenkantenvergoldung mit einer BandwerkBordüre mit Blüten und Blättern, seeblaue TabisVorsätze und Ganzgoldschnitt.
Auch hier handelt es sich um ein Exemplar mit sehr schöner, kräftiger Rückenvergoldung. Dazu kommt die große Besonderheit, daß hier sämtliche Tafeln und die Vignetten sehr fein und nuanciert koloriert wurden, und das sicherlich schon zur Entstehungszeit. Diese Kolorierung überdeckt die Kupferstiche nicht, sondern verleiht ihnen eine anmutige Farbigkeit, die lebendig und nuanciert wirkt. Interessant ist, daß zwischen den Rahmenbordüren und den älteren Darstellungen eine leichte Differenzierung gemacht wird, die bezeichnend für die Bildauffassung der Zeit ist, sind doch die Szenerien dezenter und zurückhaltender farbig gefaßt als das Rahmenwerk, bei dem vor allem die goldenen Rocaillekartuschen markant hervortreten. Dadurch erscheint die Bordüre mehr im Vordergrund, deutlich näher am Betrachter, während die Szenerie graduell nach hinten abgerückt wird. Es ist dies ein Mittel der ausdifferenzierenden Bildästhetik des Rokoko, daß die eigentliche Darstellung in gewisse Distanz zum Betrachter gebracht und mit einem Unwirklichkeitsakzent (Michalski) versehen wird (vergleiche die Ausführungen zu unserer Nummer XXXVIII). Dennoch gibt es hier auch gegenteilige Tendenzen, die erst der Kolorist in die Darstellungen eingebracht hat; dies betrifft etwa die hie und da anzutreffende Interpretation der Bildgegenstände durch die Farbe, mit der er einige Details realistischer herausgearbeitet hat, wie etwa auf Tafel V, wo der Leib Dorcons von den Bißwunden der Hunde blutig übersät ist, was man im Kupferstich selbst so nicht erkennt.
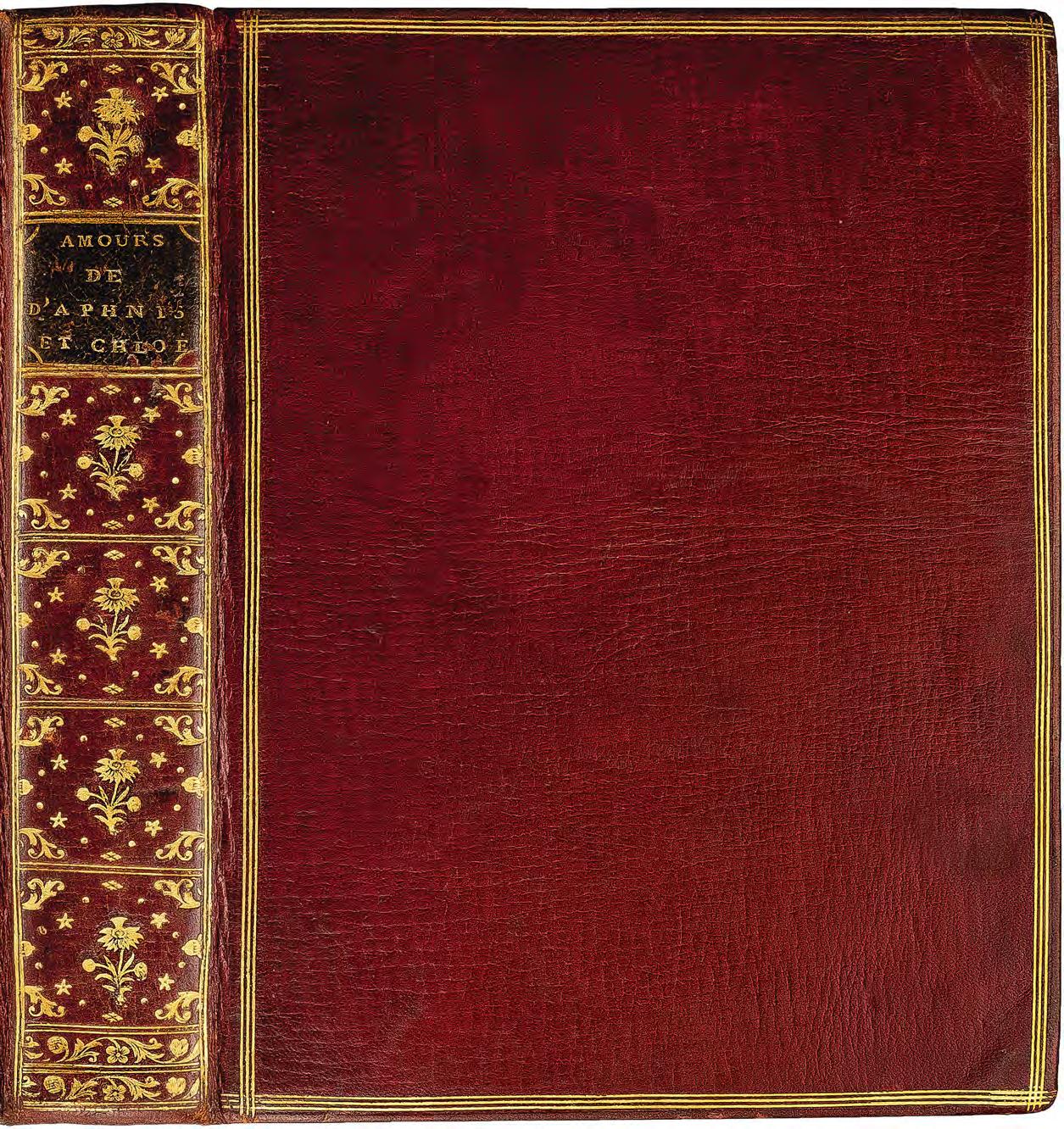
Der kolorierte Kupfertitel ist aufgezogen, der Druck auf schönem, sehr festen Papier, das nur stellenweise leicht fingerfleckig erscheint. Das Ganze in einem hübschen Einband der Zeit, mit nur minimalen Abriebstellen.
Eines der sehr wenigen Exemplare dieser Ausgabe im Kolorit der Zeit (ein weiteres Beispiel ist unsere Nummer XLVI; darüber hinaus ist uns kein weiteres bekannt geworden).
Bibliographie zur Ausgabe siehe Nummer XLII .
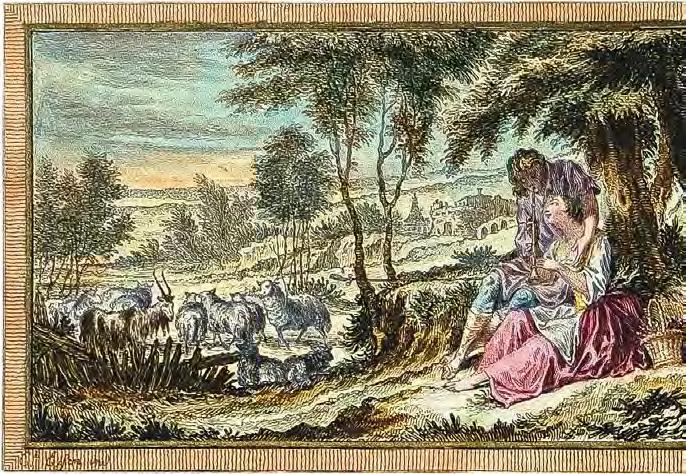


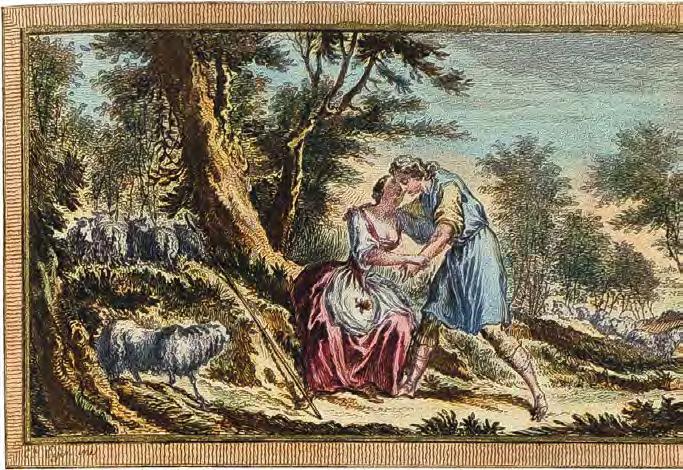

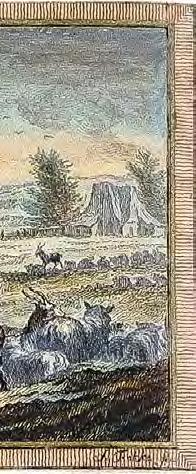
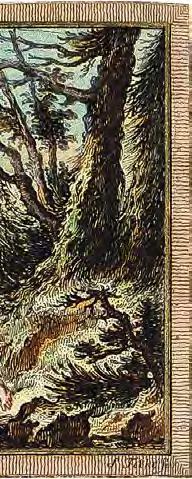






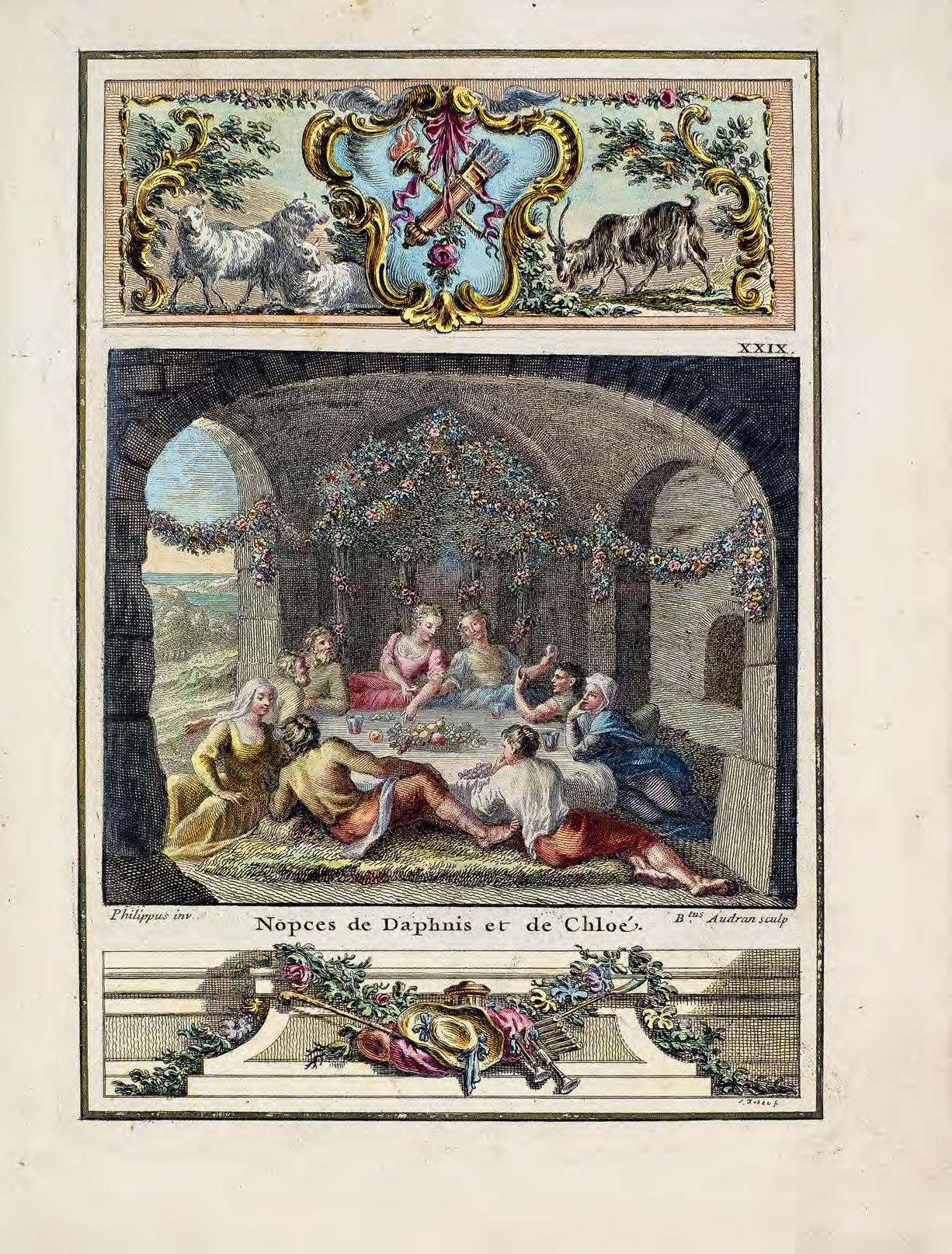
Tadellos erhaltenes Exemplar in schönem weinroten
Dentelle-Einband
XLIV LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3 Klein-Quart (196 x 153 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden mit floraler Rückenvergoldung und olivgrünem Maroquinrückenschild im zweiten Kompartiment von oben, Deckel mit äußerer Dent-de-ratBordüre sowie doppelter Filetenrahmung und einem Dentellemuster, zusammengesetzt aus zahlreichen Akanthus-, Ranken- und Blütenstempeln; doppelte Stehkantenfileten und Innenkantenvergoldung, großformige Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt, wohl von N.-D. Derome le Jeune.
Prächtiges und reizvolles, nahezu makellos erhaltenes Exemplar in einem meisterlich gearbeiteten Einband mit herrlicher Dentelle-Vergoldung. Diese hervorragende Arbeit stammt wohl von NicolasDenis Derome oder aus seinem näheren Umkreis, darauf deuten Übereinstimmungen von Stempelmotiven hin (für die Innenkantenvergoldung siehe Barber, Rothschild, Roll 4, mit zwei DeromeBeispielen). – Kein Provenienzhinweis. – Gute Abzüge der Kupfer auf schönem, kräftigem, fleckenfreiem Papier. – Bibliographie zur Ausgabe siehe unsere Nummer XLII .

Das Exemplar Mirabeau – Ripault –
Cortlandt F. Bishop in apfelgrünem Maroquin
XLV LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3
Klein-Quart (198 x 146 mm).
Leuchtend apfelgrüner Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit ornamentaler Rückenvergoldung, bestehend
aus einer Raute aus Pointillé-Elementen sowie einem zentralen querovalen Medaillon mit kleinem Kreuz im Zentrum, im zweiten Kompartiment von oben dunkelrotes Maroquinrückenschild mit dem goldgeprägten Titel, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung und Fleurons an den Überschneidungen, mittig das Wappen des Comte de Mirabeau; doppelte Stehkantenfileten und Innenkantenvergoldung, rosa Kleisterpapier-Vorsätze und Ganzgoldschnitt.
Ein prächtig gebundenes Exemplar mit exquisiter Provenienzkette. – Auf dem tiefgrünen Maroquineinband prangt das goldgeprägte Wappen eines der bedeutendsten Wegbereiter der französischen Revolution: Honoré Gabriel de Riqueti, Comte de Mirabeau (1749–1791). Wie schon sein Vater war auch er ein großer Bibliophiler und Büchersammler. Die im Januar 1792, nach seinem plötzlichen Tod im Vorjahr, versteigerte Bibliothek umfaßte 2854 Lose (der Katalog erschien noch 1791 bei Rozet und Belin in Paris), unter denen sich nicht nur alle wesentlichen Werke aus den Bereichen der Naturwissenschaft, Politik, Recht und Geschichte, sondern auch eine große Sammlung von Bibliographien und Bibliothekskatalogen sowie zahlreiche dem Buchdruck und der Typographie gewidmete Werke befanden. Unser Exemplar war eine von fünf zwischen 1718 und 1787 erschienenen unterschiedlichen Ausgaben von Daphnis und Chloe in Mirabeaus Besitz, das für 31 Livres versteigert wurde (Catalogue Mirabeau 1791/92, Losnummer 526). In diesem Katalog hat man seine Sammlung folgendermaßen charakterisiert: „Le projet de cette homme si célébre étoit de réunir les meilleures et les plus belles éditions de tous les bons ouvrages; il recherchoit sur-tout les exemplaires en grand papier, et vouloit joindre le luxe de l’amateur au goût épuré de l’homme de lettres“ (aus dem Vorwort, Seite I). Im frühen 19. Jahrhundert hat sich das Exemplar wohl in
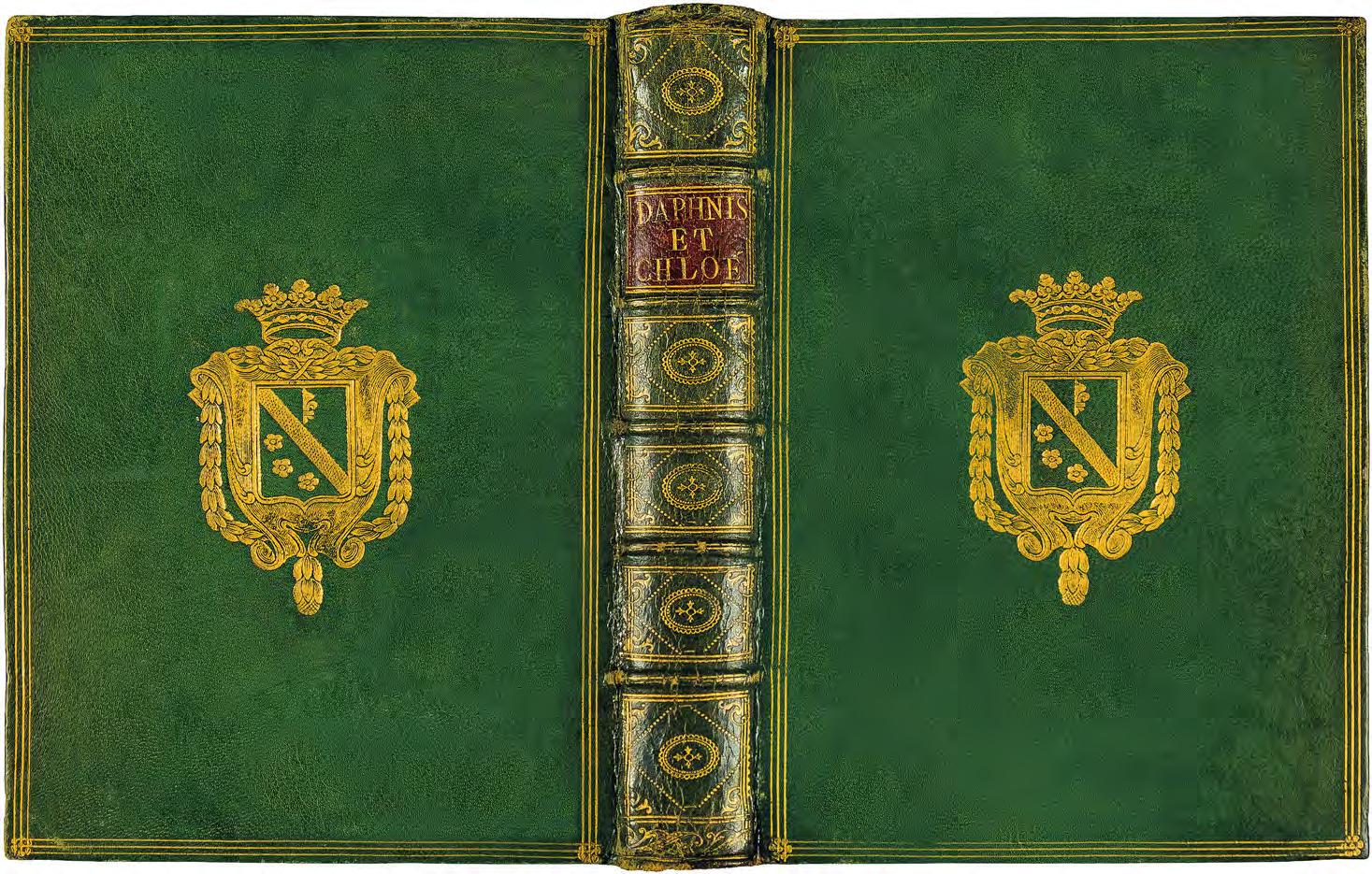
englischem Besitz befunden; ein handschriftlicher Eintrag lautet: „The Gift of my worthy friend Dr. Shuter“, womit der für die East India Company tätige britische Botaniker Dr. James Shuter gemeint sein dürfte. Einem Angehörigen der Familie Eaton gehörte das Exemplar wohl im mittleren 19. Jahrhundert (sein gestochenes Exlibris auf dem vorderen Spiegel). Es dürfte sich dabei um den Bankier Stephen Eaton handeln, ab 1810 Miteigentümer der Stamford Bank. Wesentlich später, wohl im letzten Drittel des Jahrhunderts, ging es in den Besitz von Armand Ripault über, in dessen Katalog von 1924 wir das Exemplar im zweiten Teil unter der Nummer 429 wiederfinden (Bibliothèque Ripault 1924: frs. 6.300,–plus frais). Danach erscheint es 1948 in Cortlandt F. Bishops Sale unter der Losnummer 183:
$ 310,–; zuletzt befand es sich im Besitz von PaulLouis Weiller (1893–1993), dessen Exlibris sich auf dem Recto des vorderen fliegenden Vorsatzes findet: seine Auktion 1998, Nr. 55: frs. 43.000,–plus frais. Spuren mehrerer entfernter Exlibris lassen auf eine Reihe weiterer Besitzer schließen. Aus französichem Privatbesitz erworben.
Der Einband, der sich neben Mirabeaus Wappenprägung durch eine außergewöhnliche Rückendekoration aus geometrischen Elementen auszeichnet, weist an den Kapitalen, Ecken und Kanten leichte Bereibungen auf; innen sind lediglich die ersten Seiten in den Rändern etwas gebräunt. Olivier bildet unser Exemplar sogar als Muster für Riquetti de Mirabeau ab (Olivier, Manuel, Tafel 29). Bibliographie siehe unsere Nummer XLII .
Unvergleichlich Illuminiertes
Exemplar aus den Sammlungen
Robert Hoe und Cortlandt F. Bishop –mit allen Tafeln in doppelter Ausführung
XLVI LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent
Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.-N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen. – Sämtliche Kupferstiche in außerordentlich nuanciertem Kolorit der Zeit. –Zusätzlich eingebunden: Alle 29 Tafeln der Suite ohne die Bordüren und nicht koloriert und eine – die einzige in dieser Form nachweisbare – Variante des gestochenen Titels mit veränderten Bordüren.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3 Klein-Quart (193 x 145 mm).
Marmorierter Kalbledereinband um 1780/90 mit dunkelrotem glatten Maroquinrücken, unterteilt in sechs Kompartimente, im zweiten von oben ein schwarzes Maroquinschild mit dem goldgeprägten Titel, in den übrigen mittig je ein Medaillon mit einer stilisierten, leicht querovalen Blüte, in den vier Ecken jeweils eine gering kleinere runde Blüte, Unterteilung der Kompartimente durch schmale florale Bordüren und wellenförmige Fileten, die Deckel mit einer goldgeprägten Mäander- und einer Lorbeerbordüre; Steh- und Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze sowie Ganzgoldschnitt von J. Dahmen aus Amsterdam.
Ein bibliophiles Unikat hervorragender Provenienz, das einzige Exemplar mit sämtlichen Tafeln in doppelter Ausführung: Jeder kolorierten Tafel mit der Rahmenbordüre Eisens folgt eine ohne Kolorit und ohne die Rahmenbordüre. Das Frontispiz liegt sogar in dreifacher Ausführung vor: die erste koloriert mit der Bordüre für die hochformatigen Tafeln (so wie wir sie auch aus den anderen Exemplaren kennen), die zweite nicht koloriert, aber mit der Bordüre für die querformatigen Tafeln und die dritte ohne Kolorit und Bordüre. Die mittlere der drei Fassungen ist eine einzigartige Form, die wir sonst nicht nachweisen konnten. Die Bordüren Eisens für die querformatigen Tafeln der Regentensuite bestehen genaugenommen aus zwei Vignetten, ober- und unterhalb der Darstellung – ihnen fehlt also ein seitlicher ornamentaler Abschluß.
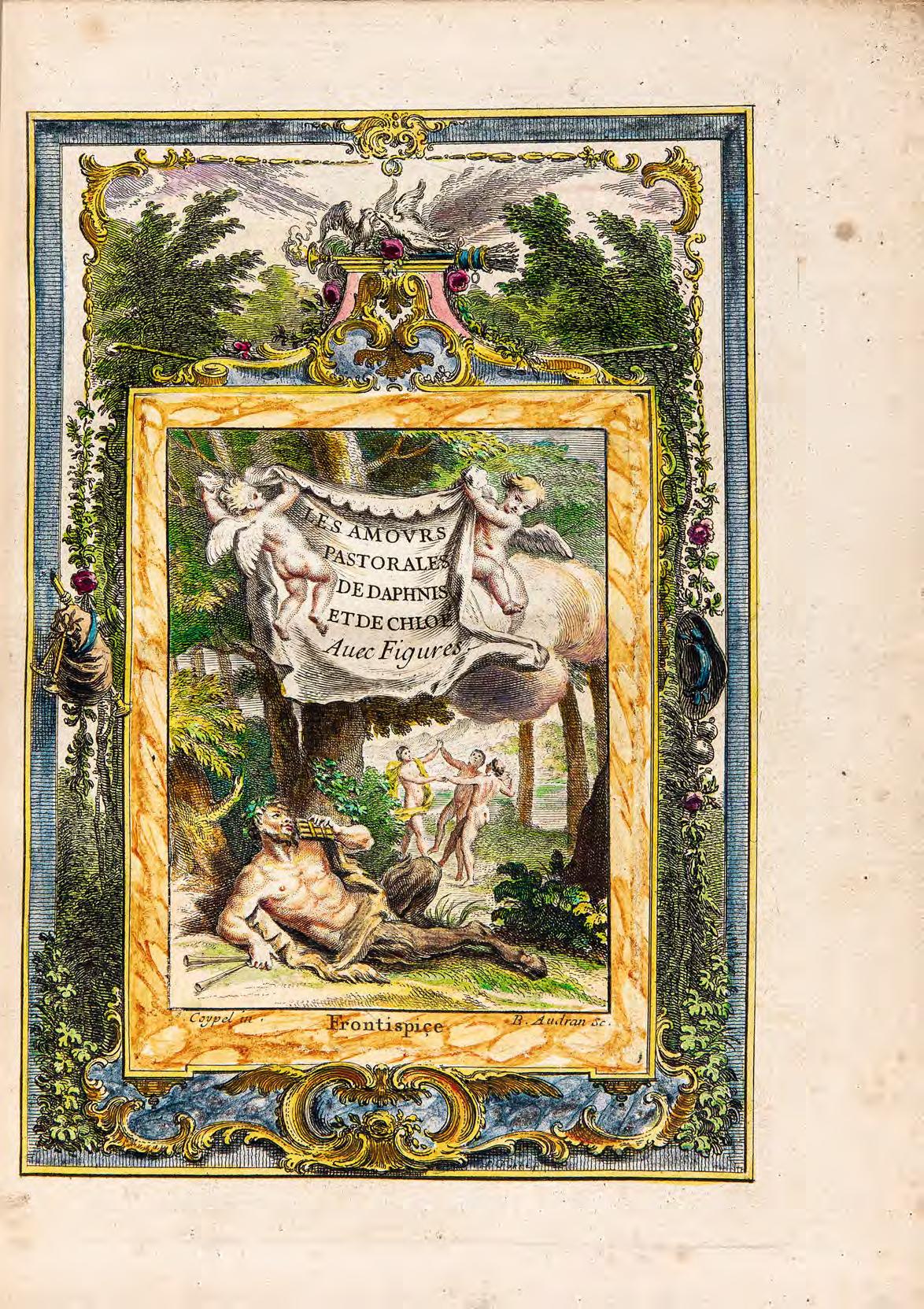
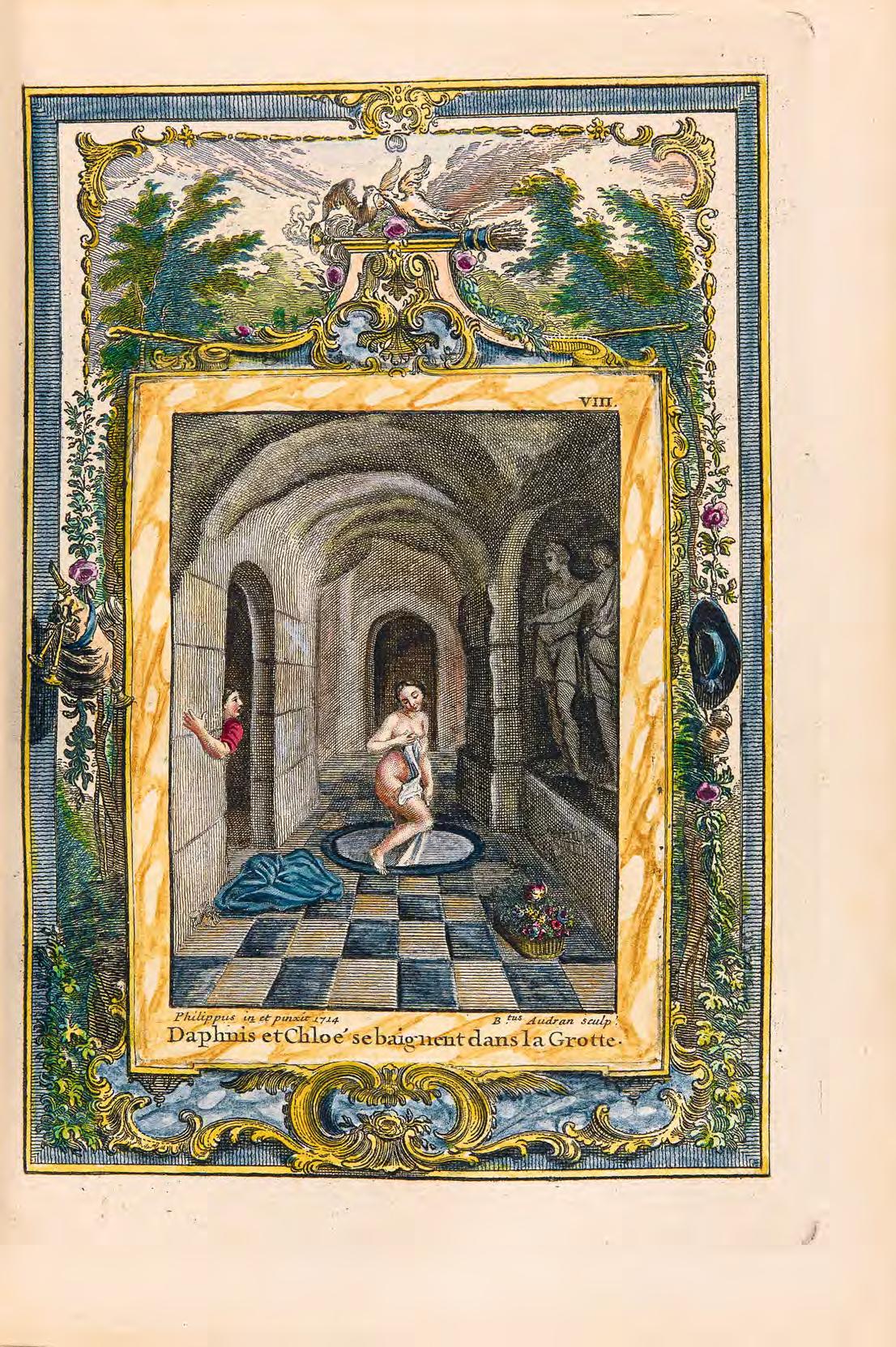

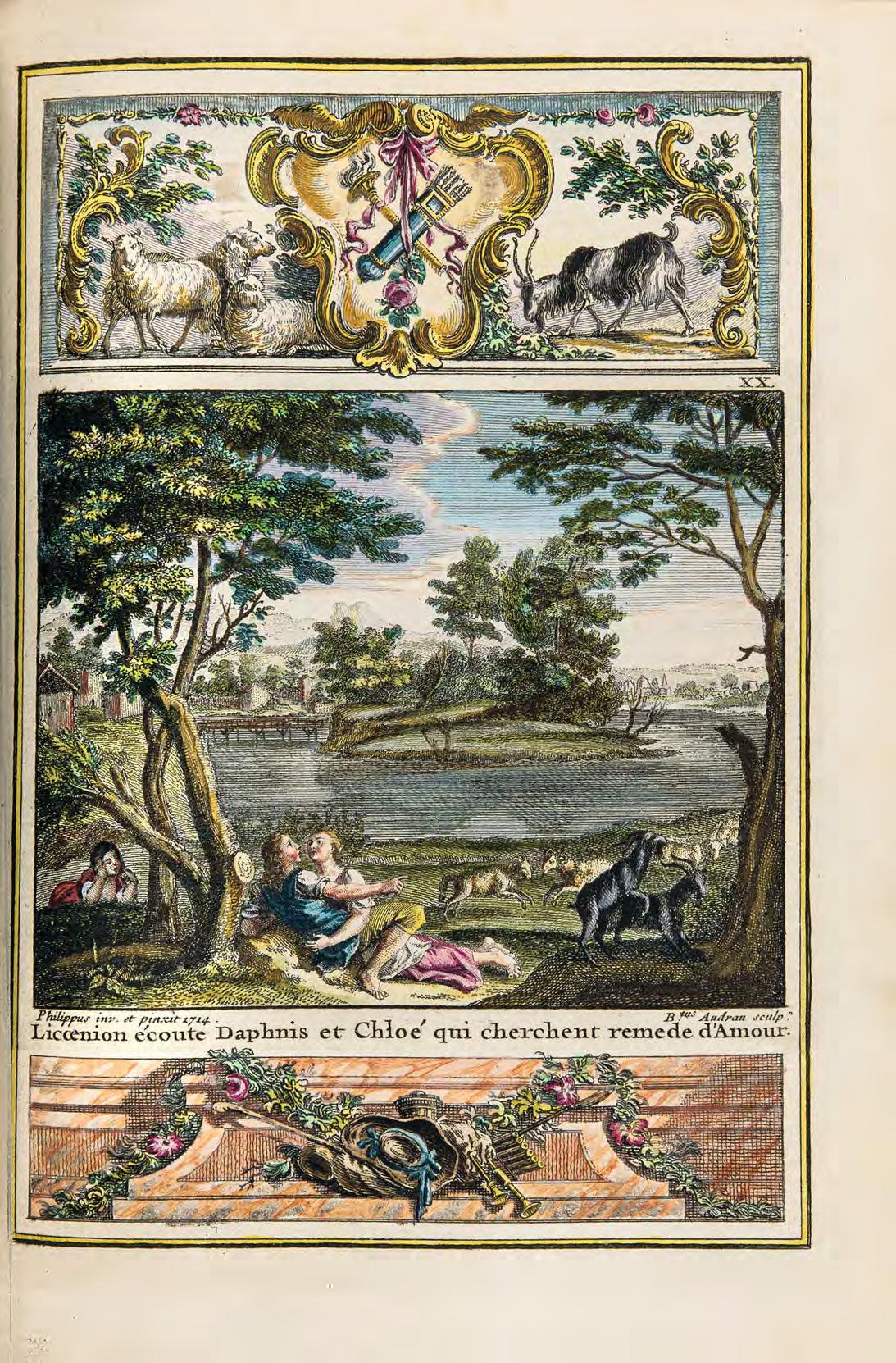
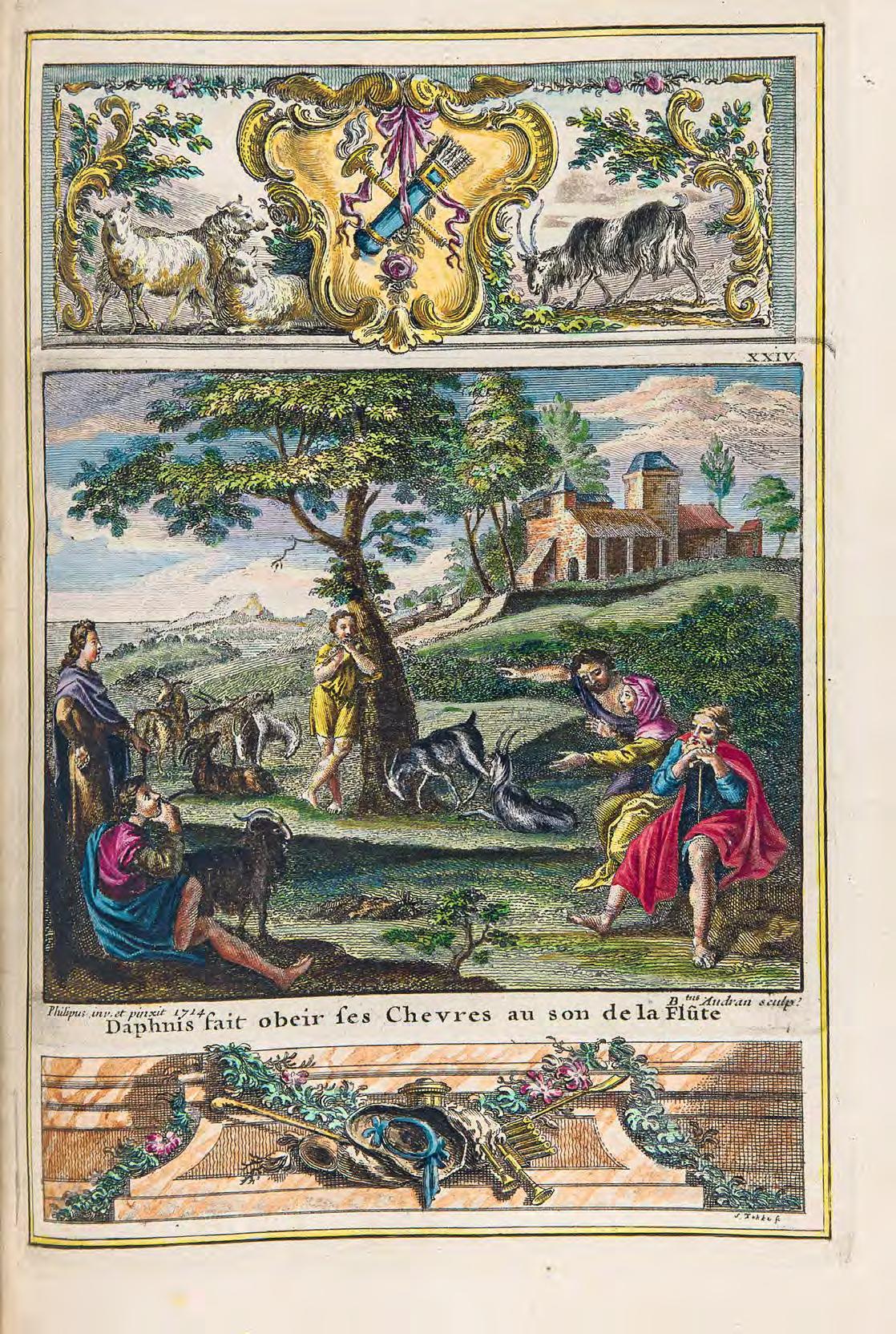
Diesem „Mangel“ hat der Stecher Fokke abzuhelfen versucht, wie unser Exemplar Nummer XLI zeigt, und zwar durch eine Leiste, die im oberen Bereich aus Objekten besteht, die wie eine Reihe fallender Pflanzensamen aussehen und nach unten hin immer kleiner werden, bis sie in eine Linie übergehen. Diese Leiste an die querformatigen Tafeln anzusetzten, führte jedoch zu keiner überzeugenden Lösung, im Gegenteil, aufgrund der dabei entstehenden Überschneidungen, eher zu einer Beeinträchtigung. Die Kombination mit einer hochformatigen Tafel, wie hier dem Frontispiz, zeitigte dagegen ein wesentlich besseres Ergebnis, da die Ornamentform nun freigestellt ist und das eingefaßte Bild viel mehr Platz erhält. Dennoch ist auch dieser Druck offensichtlich nur ein Experiment gewesen, eine verworfene Übergangsform, von der wir hier wohl das einzige Zeugnis vorliegen haben. Nicht einmal in diesem Exemplar gibt es eine weitere Tafel in dieser speziellen Form.
Das Kolorit in diesem Exemplar ist von exzeptioneller Qualität: leuchtend frische Farben und eine ungewöhnlich phantasievolle und variationsreiche Ausführung. Die unzähligen Schattierungen der Landschaftsdarstellungen erscheinen ebenso mit Bedacht gewählt wie das Inkarnat der Figuren. Besonders hervorzuheben sind die farbenprächtigen Gewänder sowie die unterschiedliche Gestaltung der Bordüren. Bei den Hochformaten ist besonders interessant: die Bilder erscheinen hier in marmorierten Rahmen, ausgezeichnet durch Gelb, Orange- und Rottöne. Sie erhalten dadurch eindeutig Bild-im-Bild-Charakter, der äußere Rocaille-Ornamentrahmen ist demnach ihre eigentliche Präsentationsebene, in die sie eingegliedert sind.
In dieser Zusammenstellung ist unser Exemplar einzigartig. Es ist nicht auszuschließen, daß hier ein Verlegerexemplar vorliegt, in dem verschiedene Möglichkeiten der Illustration wie Muster gegenübergestellt werden. Dafür spricht, daß auch der fast nicht bekannt gewordene Buchbinder Dahmen aus Amsterdam stammte, so wie der Verleger Néaulme (ein einziger Nachweis für ihn findet sich im französischen Buchhandel der jüngeren Zeit, eine 1792 erschienene Ausgabe von Janinets Vues des plus beaux édifices et particuliers de la ville de Paris , die Dahmen in grünes Maroquin gebunden hat, ebenfalls mit Ornamentik à la grecque). Dahmen hat offenbar das ursprüngliche Exemplar, gebunden in rotem Maroquin, mit neuen Deckeln versehen.
Das Exemplar befand sich in der Bibliothek des größten amerikanischen Bibliophilen Robert Hoe (Catalogue of the Library of Robert Hoe 1911/12, Bd. III, Sale am 15. April 1912, Nr. 2016, für 110 $), danach in der ebenfalls herausragenden Sammlung Cortlandt Field Bishop, in dessen Sale II, 1938 es unter der Nummer 1351 angeboten worden ist (Cortlandt F. Bishop Library 1938/39, Bd. II, 1938). Ein weiteres Exlibris „Blatner“ vielleicht von dem Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Josef Blatner (1895–1987), einem eifrigen Sammler von Kunstgegenständen.
Die Gelenke alt restauriert und etwas fragil, Tafeln und Text in den Rändern leicht fleckig.
Ein Exemplar mit unikaler Ausstattung, hinreißendem Kolorit und bibliophiler Historie.
Für die bibliographischen Referenzen zur Ausgabe siehe unter Nummer XLII .


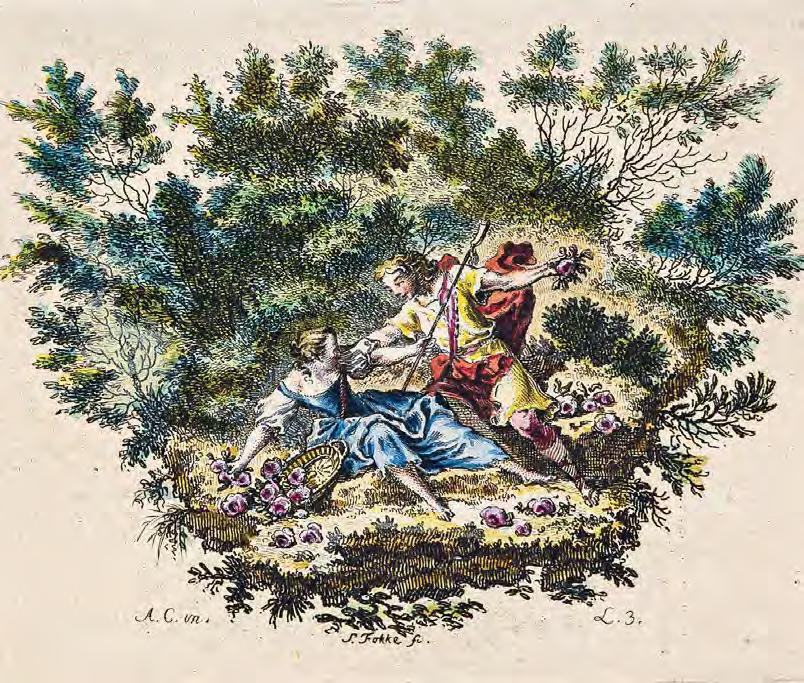

Exemplar Pavée de Vendeuvre auf grossem Papier
XLVII LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.-N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von doppelten typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3 Klein-Folio (265 x 212 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben dunkelgrünes Maroquinrückenschild mit dem goldgeprägtem Titel, in den übrigen ein
Blumenstempel, umgeben von floralen Elementen, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung und kleinen Rundstempeln an den Überschneidungen, mittig ein goldgeprägtes Wappen-Supralibros; doppelte Stehkantenfileten und Innenkantenvergoldung (Zickzackband mit Palmetten), Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Dies ist eines der sehr seltenen Exemplare der Pour-les-curieux-Ausgabe von 1757 auf großem Papier, eine extra angefertigte Teilauflage in Druckvariante, bei der alle Seiten des Haupttextes von einer doppelten, anstatt nur einer einfachen Perlstabbordüre gerahmt werden. Ein Satzfehler bei der Paginierung der Seite 48 (hier: 84) beweist, daß man die große Fassung zuerst hergestellt hat, denn in der Kleinquart-Normalauflage ist dieser Fehler korrigiert. Wir können davon ausgehen, daß Néaulme nur eine sehr kleine Anzahl von Exemplaren auf diesem großen, besonders guten, festen Papier gedruckt hat, bevor er den Rest der Auflage mit korrigiertem Satz und reduzierten Textrahmen herstellen ließ. In seinem Berliner Katalog des Jahres 1763 (Catalogue Néaulme 1763, Band V, S. 12, Nr. 12) ist damals schon, gerade einmal sechs Jahre nach dem Erscheinen, das Angebot eines in rotem Leder gebundenen Exemplars auf großem Papier mit dem Vermerk „Ouvrage devenu rare“ versehen. Daß sich diese Exemplare mit der doppelten französischen Übersetzung von Amyot und Antoine le Camus, in Paralleltext gegenübergestellt, aufwendig unter Verwendung der alten Platten der Regentensuite illustriert und dann noch in einer derart großzügigen Weise gedruckt, breitrandig und auf gutem Papier, großer Beliebtheit erfreuten, mag kaum verwundern, zumal der Verleger die Auflage mit Sicherheit sehr knapp gehalten hat. Schon damals waren diese teure Kostbarkeiten für ein erlesenes bibliophiles Publikum.
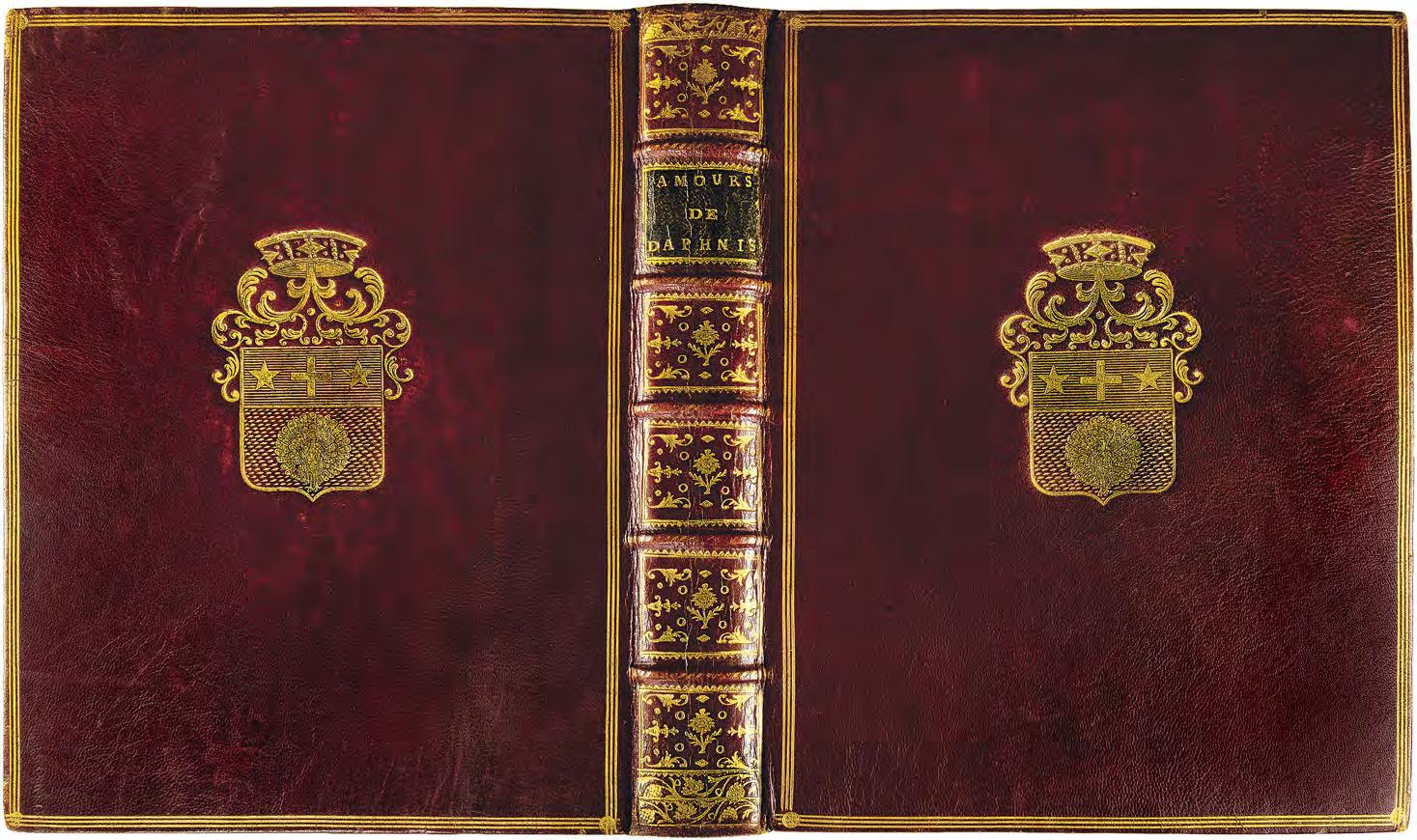
Der schöne, meisterlich gefertigte Einband wirkt vor allem durch seine kräftige Rückenvergoldung mit dem Motiv der Weinranke am unteren Kapital (Barber, Rothschild, Pal 113), hier sogar verdoppelt, und einem Stempel mit dahlienartiger Blume in der Mitte sowie Ranken in den Ecken der Kompartimente (sehr ähnlich: Barber, Rothschild, Sp 10, datiert zwischen 1764 und 1777). Das Supralibros ist nachträglich, wohl im mittleren 19. Jahrhundert, auf beide Deckel des Einbands, der aus der Zeit um 1760/70 stammen dürfte, geprägt worden.
Provenienz: Das goldgeprägte Wappensupralibros des Einbands mit einem von zwei Sternen flankierten Kreuz und radschlagendem Pfau im Feld darunter verweist auf die bedeutende Bibliothek des Pair de France, Guillaume Pavée de Vendeuvre (1779–1870).
Der Einband an den Kanten gering berieben, die Kupferstiche alle in hervorragenden, sehr kräftigen und präzisen Abzügen, innen sauber und frisch erhalten.
Bibliographie unter Nummer XLII vermerkt.
Das Exemplar Langlois –
Auf Grossem Papier, in Maroquin
XLVIII LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.-N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von doppelten typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3 Klein-Folio (279 x 217 mm).
Ziegelroter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben olivfarbenes Maroquinrückenschild mit dem goldgeprägtem Titel, die übrigen
Kompartimente mit einem zentralen Eichelmotiv, umgeben von Ornamenten, darunter an beiden Seiten kleine aufgesprungene Granatäpfel; Deckel mit dreifacher Filetenrahmung und kleinen Fleurons an den Überschneidungen, doppelte Stehkantenfileten und Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Hervorragendes Exemplar in nahezu unberührtem Zustand, innen wie außen tadellos erhalten. Eines der extrem seltenen Exemplare auf großem Papier aus jener Teilauflage der Ausgabe von 1757 in einer Druckvariante, die sich vor allem durch die doppelten Perlstabrahmen um den Haupttext von der kleineren Normalausgabe abhebt. Diese bibliographisch bisher nicht erfaßte Variante ist, wie wir nachweisen konnten, der kleineren Fassung vorausgegangen (siehe die vorherige Nummer). In diesem Fall liegt ein Exemplar von außergewöhnlicher Größe vor, der untere weiße Rand ist volle sieben Zentimeter breit, der seitliche fast sechs. Diese Großzügigkeit im Verbund mit der besonderen Papierqualität trägt dazu bei, daß der Buchschmuck und die Illustration sowie das in zwei Typen gesetzte Schriftbild zur vollen Geltung kommen.
Anhand dieses Exemplars wird vollends deutlich, daß man diese Ausgabe mit Recht als eines der größten Meisterwerke der Buchillustration des mittleren Dix-huitième bezeichnen darf. Die große Sorgfalt, die insbesondere beide Ausgaben des Jean Néaulme auszeichnet – man betrachte nur, wie die Kupferstiche den Textseiten so gegenübergestellt sind, daß die Textrahmen exakt den Plattenrändern der jetzt auf die volle Größe des Textfeldes abgestimmten Tafeln entsprechen – verleiht gerade diesem Exemplar einen ganz besonderen buchkünstlerischen Reiz, der paradigmatisch für die ästhetischen Ideale dieser Epoche steht.
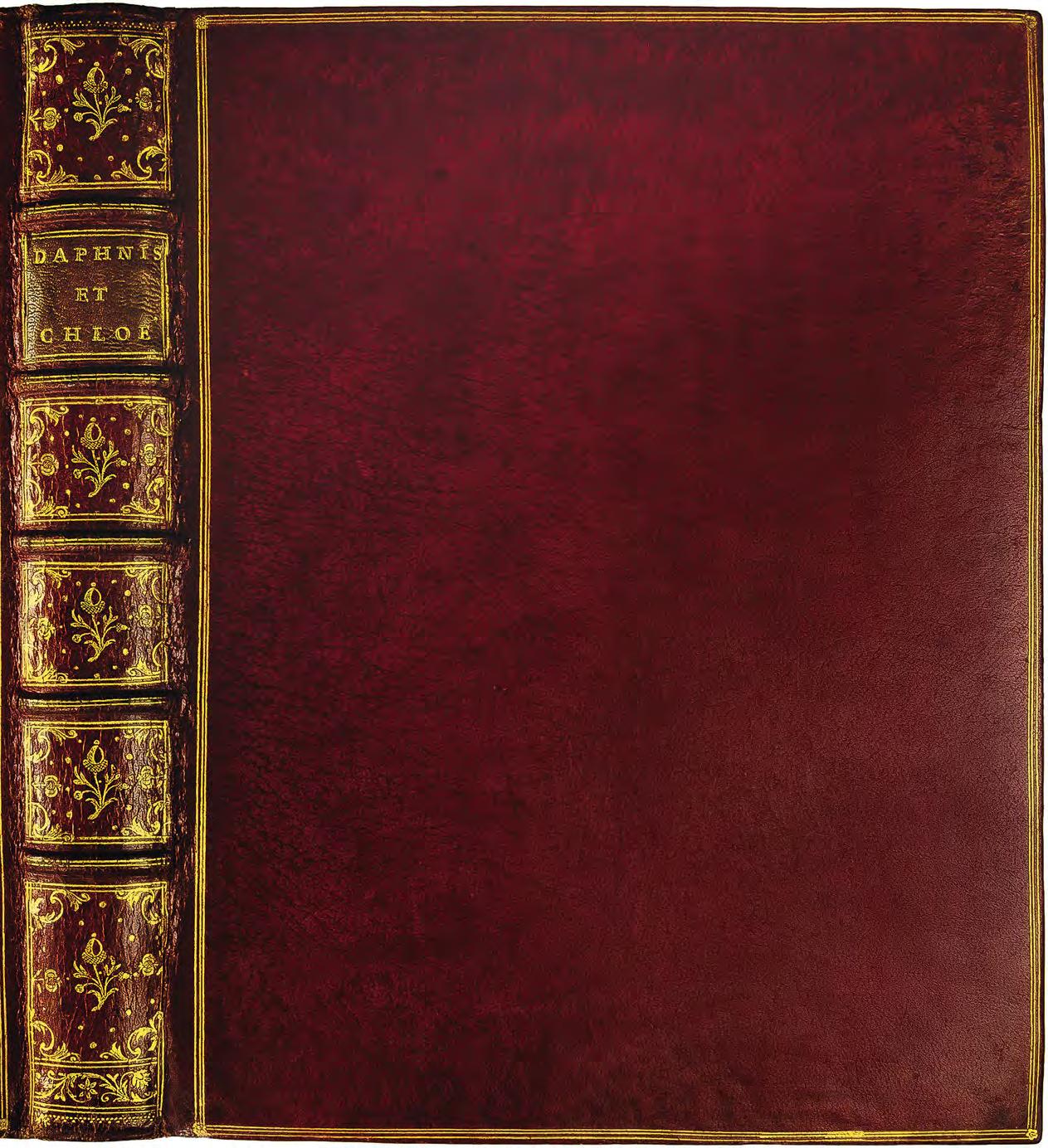
Hinzu kommt der Einband, bestechend durch seine leuchtende, vergleichsweise helle Rotfärbung, die das schöne Narbenmuster des Maroquins noch durchscheinen läßt. Unter den Stempeln des Buchbinders findet sich der bei Barber, Rothschild, unter Roll 11 (b oder c) verzeichnete Rollenstempel für die Innenkante. – Kräftiger Druck auf starkem, fast fleckenfreien Hollandpapier, alle Kupferstiche in vorzüglichen und gratigen Drucken.
Provenienz: Aus der legendären Bibliothek des André Langlois, mit seinem Exlibris in rotem Maroquin auf dem Vorsatz – siehe Anmerkung zu ihm unter Nr. I.
Exzellent gebundenes und erhaltenes Exemplar mit bedeutender Provenienz.
Für die bibliographischen Annotationen zur Ausgabe siehe Nummer XLII .
Das von Cohen zitierte Exemplar der Mme. de La Borde – DelbergueCormont – Vicomte de Janzé und Henri Bonnasse, in olivgrünem Maroquin
XLIX LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), 8 gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), 8 gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.-N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und 10 historisierten HolzschnittInitialen.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von doppelten typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3
Klein-Folio (269 x 211 mm).
Olivgrüner Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben hellbraunes Maroquinrückenschild mit dem goldgeprägten Titel, die übrigen mit floraler Rückenvergoldung, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung und kleinen Blütenstempeln an den Überschneidungen; doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Sur grand papier de Hollande avec double encadrement (Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 654) – in diesem Zustand sind nur sehr wenige Exemplare der Ausgabe von 1757 bekannt geworden, eine große Besonderheit, der man dann gewöhnlich auch qualitativ entsprechende Einbände angedeihen ließ. Der sehr schöne, solide Einband in olivgrünem Maroquin trägt ein charakteristisches Motiv der Rückenvergoldung aus der Zeit um 1760/70, eine kräftige Distelblüte im Zentrum der von doppelten Fileten gerahmten Kompartimente (ähnlich derjenigen bei Barber, Rothschild, unter Fl 74 klassifizierten, hier mit einem 1767/68 datierten Beispiel, W.Cat. 287).
Daß die Prachtexemplare dieser geradezu legendären bibliophilen Kostbarkeit von einem hochrangigen Besitzer zum nächsten gingen, ist fast schon eine Selbstverständlichkeit, auch wenn sich diese Linien nicht immer bruch- und lückenlos nachvollziehen lassen. In unserem Fall sind wesentliche Eckpunkte der Provenienz gut nachzuvollziehen, und das Exemplar wurde sogar von Cohen und De Ricci zitiert.
Die erste Besitzerin war die Madame Adélaïde Suzanne de la Borde, geborene de Vismes (1753–1832), Ehefrau des Fermier général und Autors der „Choix des chansons“, Jean-Benjamin de La Borde (1734–1794). Ihr gestochenes Exlibris „Bibliotheque de Madame de la Borde“ (Meyer-Noirel, Répertoire général, L0414) in der Form einer
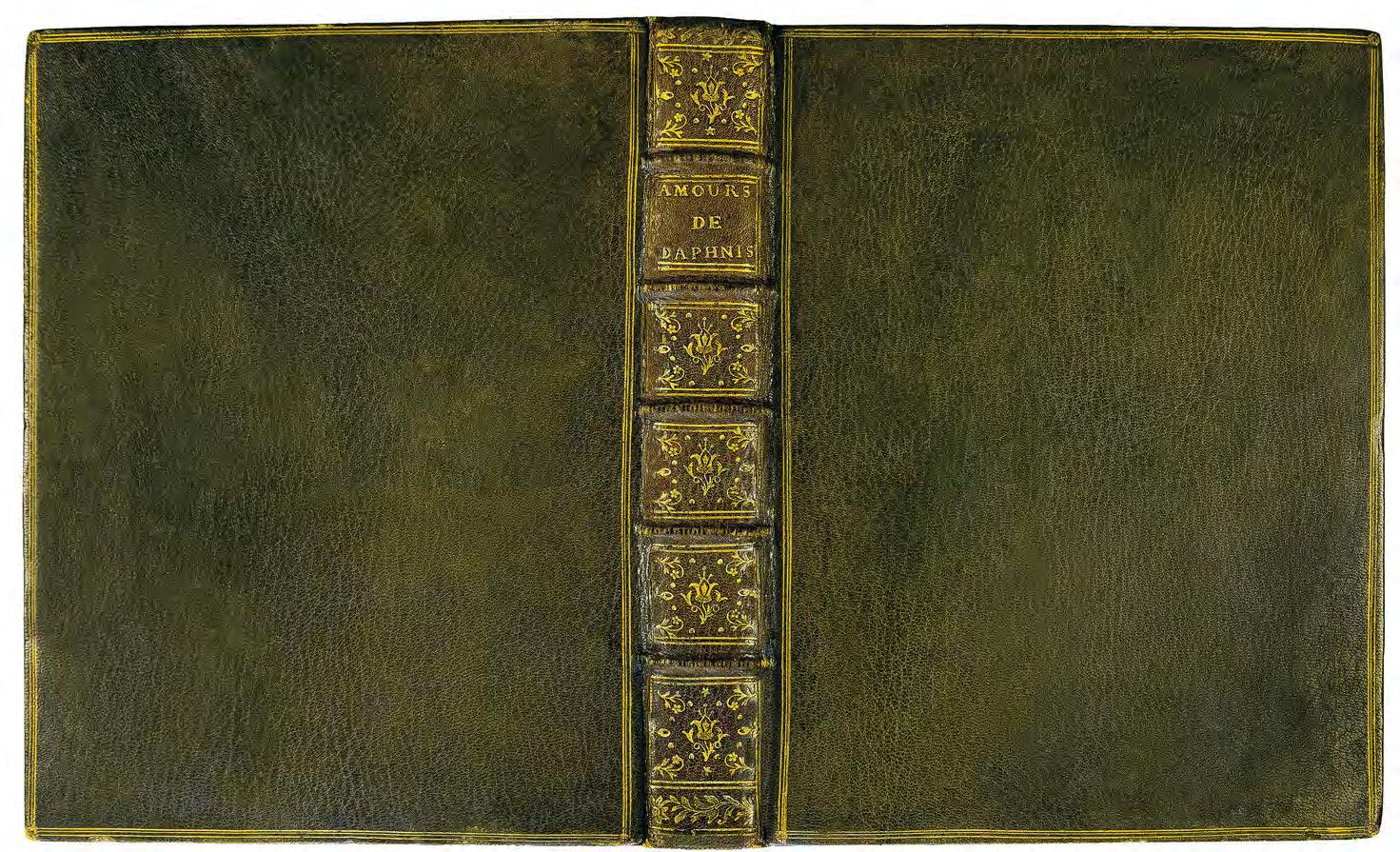
Visitenkarte prangt auf dem vorderen Spiegel (solche Exlibris werden seit dem späten 18. Jahrhundert in Frankreich üblich, siehe Jammes, Les exlibris typographiques). Der Band kam wohl im frühen 19. Jahrhundert nach England und verblieb dort wohl in weiblicher Hand: das Exlibris von Colin Campbell Baillie mit der Devise der bedeutenden Familie Baillie „Quid clarius astris“ gehörte wahrscheinlich einer Nachfahrin von James Baillie (1737–1793), unsterblich geworden durch das um 1784 entstandene Familienporträt von Thomas Gainsborough. Dieser Baillie hatte sowohl eine Gattin als auch Tochter dieses Namens, doch dürfte keine der beiden als Besitzerin unseres Exemplars in Frage kommen. Es ging an diese Dame als Schenkung über, denn wir finden auf dem fliegenden Vorsatz die handschriftliche Eintragung „Colin Campbell Baillie / July 25th 1855/ from / J. B. W.“ Aus dieser Zeit dürfte ihr in Stahlstich ausgeführtes Exlibris stammen (zur Familiengeschichte siehe: Bulloch, Baillie of Dunain, S. 35 f. – al-
lerdings ist nicht eindeutig bestimmbar, welche von mehreren Damen, die diesen Namen trugen, die Eignerin unseres Exemplars war). Im Jahre 1883 taucht es dann in der Pariser Auktion von Delbergue-Cormont auf, wo es für 180 fr. verkauft wird (Catalogue Delbergue-Cormont 1883, Nr. 166); erneut zum Verkauf gelangte es am 24. April 1909 als Los 450 auf der Auktion des Vicomte de Janzé (Catalogue Janzé 1909, für 201 fr.). Die letzte bekannte Station war die berühmte Bibliothek des Bankiers Henri Bonnasse (1899–1984).
Ecken und Kanten des Einbandes mit leichten Bereibungen, innen nur an wenigen Stellen leicht fleckig. – Auf starkem Holland-Büttenpapier mit Wasserzeichen (eine Bourbonenlilie und ein versales D), die Kupfer in sehr guten, klaren und kräftigen Abdrucken.
Insgesamt ein ausgezeichnet erhaltenes, bei Cohen und De Ricci zitiertes Exemplar mit imposanter Provenienzkette.
Exemplar der Seltenen Ausgabe von 1764 mit den neu gestochenen Tafeln nach Scotin
L [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet]. Avec figures. Den Haag, Jean Néaulme, 1764.
Mit gestochenem unsignierten Frontispiz, acht unsignierten Kupfertafeln, seitenverkehrte Nachstiche der 1716 veröffentlichten Suite von J. B. Scotin, unsignierter gestochener Titelvignette, vier unsignierten gestochenen Kopfvignetten und fünf HolzschnittInitialen.
5 Bl. 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“ und „Préface“, „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (160 x 96 mm).
Marmorierter Kalbledereinband der Zeit auf glattem Rücken, unterteilt in sechs Kompartimente, braunes Rückenschild mit goldgeprägtem Titel im zweiten Kompartiment von oben, die übrigen Kompartimente mit floraler Rückenvergoldung in Filetenrahmen; Stehkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Rotschnitt.
Eines der außerordentlich seltenen Exemplare der Ausgabe von 1764, die, wie auch unser Exemplar von 1750 (Nummer XXXVII), mit den im Gegensinn gestochenen Tafeln Scotins, einschließlich der ornamentalen Rahmung, versehen wurden. Die Ursprünge dieser seitenverkehrten Suite liegen in der Amsterdamer Ausgabe des Emanuel Du Villard aus dem Jahr 1717, firmierend unter „Les Héritiers de Cramoisy“. Als neues Element hinzu kommt in dieser über weite Strecken satzgleichen Ausgabe eine Textbordüre in Form eines mit einem Band umwundenen Stabs mit kleinen Ornamenten
in den Ecken und an den Seiten. Ein derartiges Motiv als Rahmenbordüre ist uns bereits im Jahre 1745 begegnet – bei jenen Exemplaren auf großem Papier, die wir als eigene Druckvariante identifizieren konnten (siehe etwa unsere Nummer XXXVI). Hier allerdings von Hand eingemalt und nur als Auszeichnung weniger besonderer Exemplare gedacht. Wie wir zeigen konnten, ist die Ausgabe von 1750 – und damit auch die vorliegende von 1764 – von dieser Druckvariante von 1745 direkt abhängig. Erstaunlicherweise wird erst jetzt, in diesem spätesten Ableger dieses Strangs, die Idee der Textrahmen mittels eines umrankten Stabes wieder aufgenommen, wenn auch nur in einer sehr reduzierten Form. Überhaupt ist die Ausgabe von 1764 reicher an Buchschmuck als ihre Vorgängerin von 1750; am Ende der „Préface“ findet man gar eine kleine Holzschnitt-Vignette mit einem Profil-Porträt, das vielleicht den Autor Longus darstellen soll. Das Frontispiz ist ein ziemlich exakter Nachstich desjenigen von 1750 (den Unterschied bemerkt man vor allem daran, daß der Accent aigu bei „ Chloé“ nun hinter den Buchstaben e verrutscht ist). Titel- und Kopfvignetten wurden ebenfalls übernommen, hier jedoch tatsächlich von den Platten eingedruckt, statt nur montiert. Gegenüber der Ausgabe von 1750 fällt auf, daß die Tafeln wesentlich schwächer im Druck erscheinen, wie von bereits stark abgenutzten Platten. Der Amsterdamer Verleger Néaulme hat sich im Jahr 1763 vom Geschäft zurückgezogen. Ausgaben, die nach 1764 unter seinem Namen erschienen sind, gelten gewöhnlich als fingiert. Ob unsere Ausgabe nun zu seinen spätesten Werken zählt oder ihm untergeschoben wurde, ist nicht leicht zu entscheiden. Im Jahr zuvor war noch ein weiterer Druck erschienen, der in diese Ausgaben-Filiation gehört und von größter Seltenheit ist, hier wieder mit dem Titelzusatz „Avec figures par un élève de Picart“, aber dem Impressum
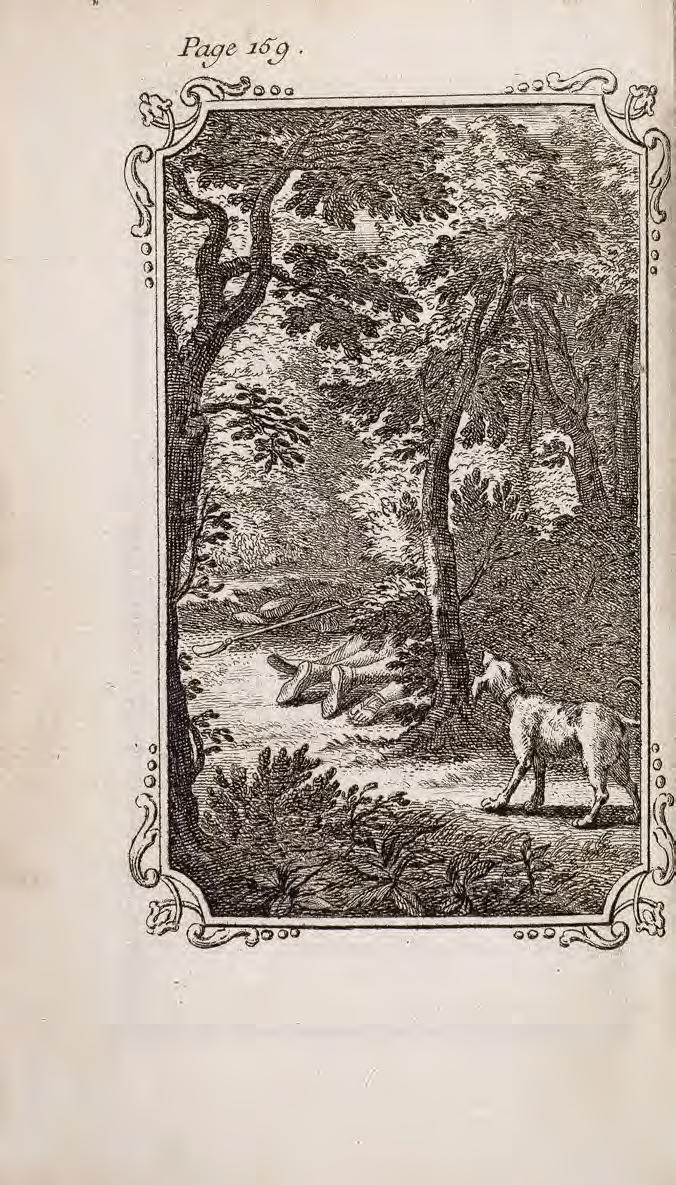
„Londres, chez J. Knox, 1763“; die von einem „I. Taylor“ stammenden Tafeln sind freie Wiederholungen nach Scotin.
Es ist diese eine der spätesten nachweisbaren Ausgaben, die den Scotin-Zyklus noch einmal zur Illustration des Longus-Romans heranziehen. Sollte sie wie die beiden höchst anspruchsvollen Dru kke der Jahre 1754 und 1757 von Jean Néaulme stammen, war sie wohl als eine Art einfache Version gedacht, doch ist sie heute fast noch seltener als die ohnehin schon sehr raren Flaggschiffe dieses Verlegers.
Provenienz: Mit dem Exlibris von Dr. Louis Ribadeau-Dumas (1876–1951), einem Arzt und Verfasser mehrerer medizinischer Schriften.

Die Gelenke ein wenig berieben, vereinzelt wenig fleckig, sonst wohlerhalten.
Gutes Exemplar einer höchst seltenen Ausgabe .
Zu den Referenzen vergleiche unsere Nummer XXXVII , die Amsterdamer Ausgabe von 1750; weiterhin Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 654. Boissais/Deleplanque, Le Livre à gravures, 116. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1227. Lewine, Illustrated books, S. 322. Einige der Bibliographen führen noch eine weitere Ausgabe von 1773 in diesem Kontext an, wahrscheinlich ein abermaliger Nachdruck in Filiation der Ausgaben von 1749/50, doch dürfte hier das Néaulme-Impressum mit Sicherheit fingiert sein.
Kaum bekannter Lyoneser
„ faux Cazin“ mit einer neufassung der Petits Pieds
LI [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot]. Ohne Ort und Drucker [= Lyon] 1777.
Mit gestochenem Frontispiz von N. de Launay (nicht signiert, wohl nach C.-P. Marillier, in Anlehnung an J.-B. Scotin).
6 Bl., 142 S. (Vortitel, Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: a 6 A-L6 M 6 (letztes leer).
Duodez (111 x 55 mm).
Dunkelroter Maroquineinband der Zeit auf glattem Rücken zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben grünes Maroquinrückenschild, Kastenvergoldung mit zentralem Blumenmotiv in drei Kompartimenten, im obersten slowakisches Kreuz mit Krone, Deckel mit dreifacher Filete; einfache Steh- und Innenkantenfilete, nachtblaue Buntpapiervorsätze, blaues Seidenlesebändchen sowie Ganzgoldschnitt.
Anmutiges, dekorativ gebundenes Exemplar einer wenig bekannten Lyoneser Duodez-Ausgabe, die bei der auf ein Frontispiz beschränkten Illustration einen eigenen Weg beschreitet. Laut Vorwort im Kern die Übersetzung von Amyot, verglichen mit derjenigen von Pierre de Marcassus und an einigen Stellen verbessert, wobei die Fehler in Amyots Übersetzung auf die verderbten Manuskripte zurückgeführt werden.
Der Druck wurde zwar immer wieder Cazin zugewiesen, ist aber definitiv nicht von ihm. Vielmehr handelt es sich um den Teil einer Reihe, die von 1777–1792 in Lyon erschienen ist und die Corroënne mit dem Notnamen „Collection lyonnaise des petits formats in-24“ versehen hat. Der Longus erschien hierin in drei Varianten: mit Firmierung
und mit unserer Kollation (von Corroënne als Variante A geführt), dann wie unser Druck, nur mit der Angabe des Jahres (Variante B) und schließlich mit Firmierung, aber im Umfang von 172 Seiten (Variante C). Übrigens waren das Vorbild der Lyoner Drucke – und damit der „Großvater“ der Cazin-Drucke – die von Couret de Villeneuve in Orléans gedruckten Klassikerausgaben. Dies läßt sich aus dem Vorwort zur l’Hymne au soleil von 1779 schließen, das Coroënne zitiert und in dem es heißt, daß der Drucker „depuis vingt ans“ die besten antiken und modernen Autoren in diesem Format gedruckt habe (S. 29).
Das von Cohen als „très jolie imitation de la gravure des petits pieds“ apostrophierte Frontispiz wird von Corroënne näher beschrieben: „Deux amoureux l’un sur l’autre à demi cachés par le feuillage auprès du monument dans un site agreste, au sein de la forêt, chapeau et bâton de pasteur à leurs petits pieds nus sur le bord du ruisseau, planche double en passerelle à plat vers la gauche avec cette légende: ‚Tout se passa à l’ordinaire‘.“ Portalis und Beraldi weisen es, noch unter den für Cazin ausgeführten Arbeiten, Nicolas de Launay (1739–1792) zu, der es nach Marillier angefertigt haben soll. Wiewohl Marillier hierzu die Vorlage entworfen haben könnte: zurück geht es letztendlich doch auf Scotins Fassung von 1716, allerdings mit der –man muß es schon so nennen – frechen Variante, daß hier auch die Köpfe des Liebespaars zu sehen sind, und zwar in intensives Küssen vertieft, was sich nicht einmal der Comte Caylus in seiner Version erlaubt hatte. Diese Fassung kommt einzig in diesem kleinen, sehr feinen Lyoneser Druck vor.
Sehr gut in der Hand liegendes Bändchen, der Titel mit Stempel „Colloredo“; eventuell handelt es sich dabei um Rudolph Joseph Colloredo (1705–1788), der auf Schloß Opotschno die sogenannte „Jüngere Bibliothek“ aufbaute.
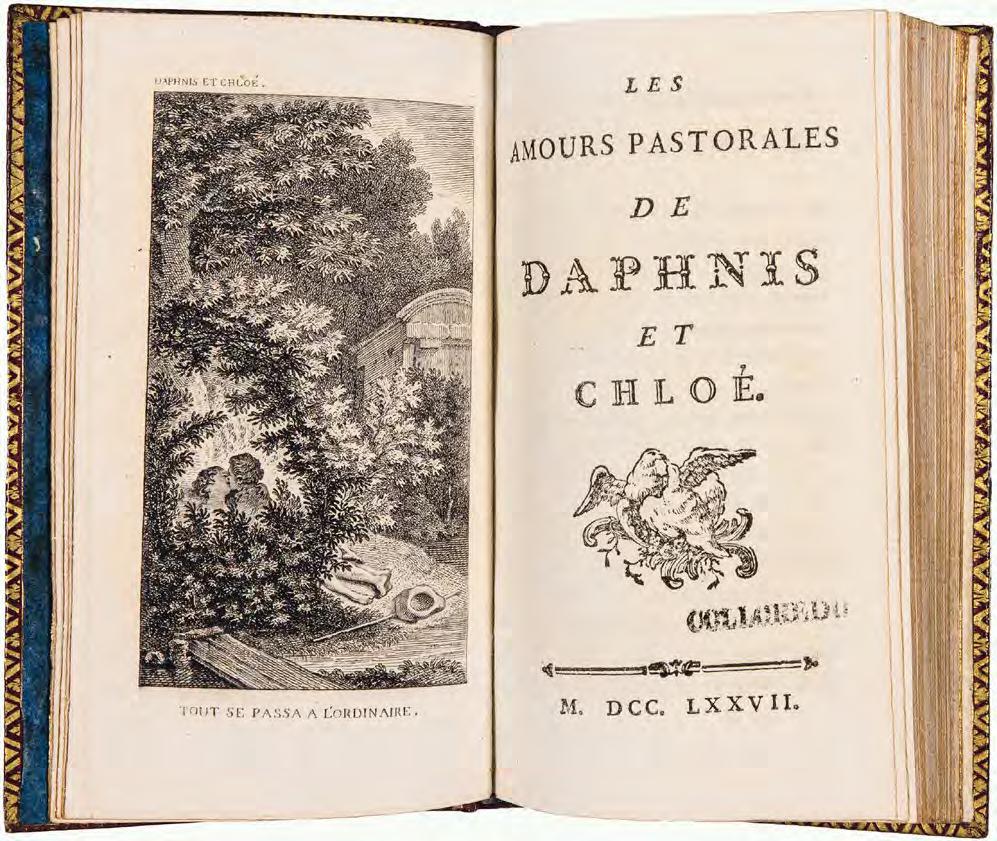
Referenzen: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, S. 654. Corroënne, Petits joyaux bibliophiliques, Première série: S. 66 f. Ders., Manuel du Cazinophile, S. 29. Fontaine, Cazin, S. 197 (unter Faux Cazins). Reynaud, Notes supplémentaires, S. 318. Portalis/Beraldi, Les graveurs, Bd. II , S. 552. Lewine, Illustrated books, S. 322. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1229 (beide „Cazin“). J.-P. Fontaine, Cazin, 2012, S. 197, unter Faux Cazins.
Die Ausgabe von 1779 in Klein-Oktav –Schönes Exemplar aus dem Besitz der Maria Josepha von Savoyen, Gattin König Ludwigs XVIII. von Frankreich
LII LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, escrites en Grec par Longus, & translatées en François par Jacques Amyot. „À Londres“ [d. i. Paris, Valade,] 1779.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel (datiert „Londres 1779“), 28 Kupfertafeln (davon 13 doppelblattgroß als Faltkupfer auf Stegen) nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Petits Pieds“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus (sämtlich in unsignierten seitenverkehrten Nachstichen), Titel- und Schlußvignette in Holzschnitt.
2 Bl., 176 Seiten (Vortitel und Titel, S. I- VIII: „Avertissement“ und „Préface“, Haupttext: S. 9–176).
Kollation: π2 A-L 8 . Klein-Oktav (165 x 103 mm).
Nachtgrüner Maroquineinband der Zeit auf glattem Rücken zu sechs Kompartimenten, rotem Rü kkenschild mit dem goldgeprägten Titel im zweiten von oben, die übrigen mit floraler Rückenvergoldung, Deckel mit drei verschieden starken Fileten und zentralem montierten Supralibros auf rotem Maroquin; Stehkantenfilete, Innenkantenvergoldung, dunkelblaue Kleisterpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Dies ist die seltene kleine Ausgabe, bei der es sich wohl um den spätesten der unter dem fingierten Impressum „À Londres“ im Jahre 1779 erschienenen Drucke in Quart und Oktav handelt. Die Bibliographen vermuten gewöhnlich Paris als den
tatsächlichen Druckort, im Verkaufskatalog der Sammlung des Verlegers Lamy, publiziert 1807 von Antoine-Augustin Renouard, der ein koloriertes Exemplar der Quart-Fassung verzeichnet, ist jedoch „Dijon“ angegeben (Catalogue Lamy 1807, Nr. 3834). Woher Renouard diese Information hatte, ist nicht zu ermitteln. Einige Indizien lassen uns auf den Pariser Verleger Valade schließen, der um 1780 zuweilen das Impressum „A Londres, et se trouve à Paris, chez Valade“ führte. Der zu dieser Zeit von Valade in mehreren seiner Drucke verwendete Buchschmuck findet sich sowohl in unserer Oktav- als auch der Quartausgabe wieder, und auch typographische Vergleiche, die gerade bei den Titelseiten Übereinstimmungen bis ins Detail zeigen, erweisen zweifellos, daß Valade der Drucker der Ausgabe „A Londres“ 1779 gewesen sein muß (siehe dazu auch unsere Ausführungen zur Editionsgeschichte).
Für die vorliegende Ausgabe wurden alle Tafeln des Régent sowie die Petits Pieds von Caylus (vormals mit der Betitelung „Conclusion du Roman“, die nun aber fehlt) im Gegensinn neu gestochen, was teils mehr, teils weniger gut gelungen ist. Strahlen manche dieser Nachstiche noch eine märchenhafte Naivität aus, die zur Geschichte des Longus durchaus paßt, sind andere, künstlerisch gesehen, nur noch ein ferner Nachklang der Originale. Vorliegt die seltene Kleinoktav-Ausgabe, bei der die Bild- und Textrahmen der gleichzeitigen „A Londres“-Quartausgabe fehlen.
Der sehr dekorative Einband mit prächtigem Supralibros zeigt als zentrales Motiv der Rückenkompartimente eine Blume mit drei Blüten in verschiedenen Öffnungszuständen, ein Einzelstempel, der so fast identisch im Repertoire des königlichen Buchbinders Pierre-Paul Dubuisson vorkam (Barber, Rothschild, Fl 115). Unser Einband wird wohl aus der Nachfolge seiner Werkstatt stammen.

Provenienz: Das Wappen auf dem Einband ist jenes der Marie-Joséphine Louise, Comtesse de Savoie (1753–1810), Tochter des Königs von Sardinien-Piemont und Herzogs von Savoyen, Ehefrau des Grafen Louis Stanislas Xavier de Provence und späteren Königs Ludwig XVIII . von Frankreich und Navarra. Zusammen mit ihm flüchtete sie am 21. Juni 1791 aus Frankreich, der gleichen Nacht, in der auch König Ludwig XVI . mit seiner Familie den mißglückten Fluchtversuch unternahm. Die Wirrungen der Revolution und der Siegeszug Napoleons zwangen die beiden, in den kommenden 19 Jahren in immer wieder wechselnden Städten Europas Zuflucht zu suchen. 1807 kamen sie schließlich im Hartwell House in Aylesbury bei Oxford unter, wo Ludwig, weil es ihm von den Briten untersagt wird, den Königstitel zu
führen, als Comte de Lille residierte. Seine Frau starb 1810 im englischen Exil, nur vier Jahre, bevor Ludwig den Thron bestieg.
Der Druck auf zart bläulichem Papier ist fast flekkenfrei erhalten. Auch der Einband befindet sich in ausgezeichneter Erhaltung mit lediglich einer kleinen abgeplatzten Stelle an der unteren Ecke der Stehkante.
Schön gebundenes Exemplar einer gesuchten Ausgabe aus namhaftem Besitz.
Literatur: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, S. 654. Reynaud, Notes supplémentaires, S. 318. Lewine, Illustrated books, S. 324 (Anm.: „Exists also in 12mo, without borders“). Sander 1230. –Zum Wappen der Gräfin von Provence siehe Guigard, Nouveau armorial, Bd. I, S. 98.
Exemplar der Quartausgabe von 1779 mit Louis-seizeRahmenbordüren und in Maroquin Citron von Derome
LIII LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, escrites en Grec par Longus, & translatées en François par Jacques Amyot. „À Londres“ [d. i. Paris, Valade,] 1779.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel (datiert „Londres 1779“), 28 Kupfertafeln (davon 13 querformatige) nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Petits Pieds“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus (sämtlich in unsignierten seitenverkehrten Nachstichen, alle eingefaßt in Kupferstichbordüren von zweiter Platte) sowie einigen Vignetten in Holzschnitt.
2 Bl., 182 Seiten (Vortitel und Titel, S. I- VI: „Avertissement“ und „Préface“, S. [7]-182: Haupttext).
Kollation: π2 A-Z4 (letztes Bl. leer). Klein-Quart (213 x 163 mm).
Zitronenfarbener Maroquineinband der Zeit auf glattem Rücken zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben das Rückenschild mit goldgeprägtem Titel, die übrigen mit floraler Rückenvergoldung, im Zentrum jeweils ein aufgesprungener Granatapfel, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung; Stehund Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt, wohl von N.-D. Derome. Sehr dekoratives und gut erhaltenes Exemplar einer besonderen Ausgabe am Epochenwendepunkt. – Die „A Londres“-Ausgabe des Jahres 1779 wurde in Klein-Oktav und Quart gedruckt. Wiewohl die Bibliographen, abgesehen vom Format, zwischen beiden meist nicht weitergehend unterscheiden, handelt es sich doch um zwei ganz verschiedene, in der Kollation und Lagenzählung
abweichende Drucke, nicht nur um übliche Druckvarianten. Irreführend ist auch die pauschale Angabe „auf großem Papier“ für die Quartausgabe, denn diese weist nicht nur einen größeren Schriftspiegel als die Klein-Oktavausgabe auf, sondern auch die Lagen sind dem Papierformat gemäß gezählt. Eine gewisse Berechtigung gibt es indessen dennoch, hier von „großem Papier“ zu sprechen, aber aus einem etwas anderem Grund – der Schriftspiegel dieser Ausgabe ist eher derjenige einer gewöhnlichen Oktav- denn einer Quartausgabe. Für die Wahl des Quartformats dürfte auch nicht so sehr der Satz des Textes eine Rolle gespielt haben, sondern die Präsentation der Bilderfolge, die durch ihr von eigenen Platten eingedrucktes Rahmenwerk die Quartgröße tatsächlich zwingend erforderte. Und hier sind wir an einem höchst interessanten Entwicklungsvorgang angelangt: Ist diese Ausgabe doch ganz offensichtlich in Nachfolge, vielleicht auch noch in Konkurrenz, zu den Amsterdamer Editionen der Jahre 1754 und 1757 geschaffen worden, also jenen Ausgaben, bei denen der alte Regentenzyklus erstmals aufwendige Rahmenbordüren erhalten hatte, in dieser Zeit natürlich noch im Stil des Rokoko. In unserer Ausgabe werden die Nachstiche dieser Folge nun in neuem Stil gerahmt und präsentiert, dem Frühklassizismus des Louis-seize. Mag sich an der grundlegenden Idee, den alten Zyklus in zeitgemäßen Einfassungen und Ornamenten zu präsentieren, auch nicht viel geändert haben: Das Erscheinungsbild ist ein völlig anderes geworden, wirken doch die Bilder hier so, als wären sie in eine festgefügte Rahmenarchitektur eingesetzt, fast schon im Sinne einer musealen Zurschaustellung, und nur durch den angehängten Zierat wird dieser Eindruck wieder etwas gemildert. In den über 20 Jahre zurückliegenden „Rokoko-Ausgaben“ war die Absicht eine ganz andere, nämlich das spielerische Einfassen der Darstellungen durch Rahmenwerk,
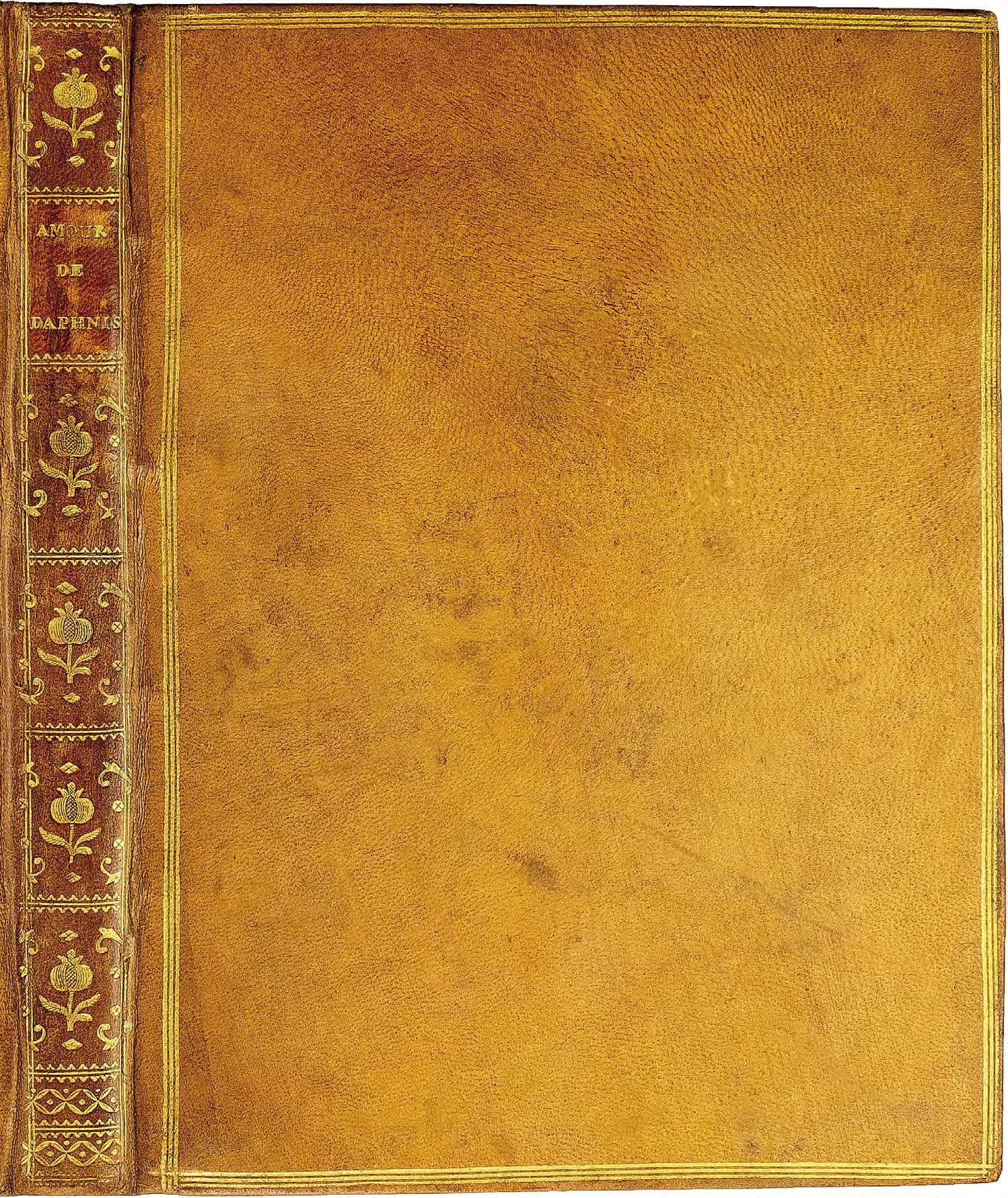
das zuweilen ein beträchtliches Eigenleben entfaltete, die Darstellungen ergänzte, in ihrem Sinngehalt erweiterte, aber auch von ihnen ablenkte. Die „ästhetische Schranke“, die diese Rokokorahmen zwischen Bild und Betrachter legten (vergleiche unsere Nummer XXXVIII), wird jetzt wieder aufgehoben, ja sogar in das Gegenteil gewendet, indem das Rahmenwerk des Klassizismus der Präsentation der Bilderfolge dient, also zum Betrachter vermittelt, wie ein Fenster, durch das dieser Einblick erhält. In der vorliegenden Quartausgabe des Jahres 1779 wurde der alte Regenten-Zyklus (zusammen mit dem Kupfertitel Coypels und der Petits pieds-Darstellung des Grafen Caylus) ein weiteres Mal dem Zeitgeschmack entsprechend aufbereitet und neu präsentiert – jetzt in dem seit etwa 1760 allgegenwärtigen, von Cochin kritisierten, Goût grec – ein in der Geschichte der Buchillustration sehr seltener, wenn nicht einmaliger Vorgang, der aber für die Wandlungen der Ästhetik, des Bildverständnisses und der Kunsttheorie im 18. Jahrhundert sehr bezeichnend und aussagekräftig ist.
Alle querformatigen Tafeln erhielten einen Rahmen, dessen Spitze mit den Attributen des Hirten – Dudelsack, Hut und Hirtenstab – garniert ist; am unteren Ende prangt der mit Blumengirlanden geschmückte Kopf eines Widders, ein typisches Motiv des Frühklassizismus, übernommen von antiken Vorbildern, wie man sie insbesondere im Hellenismus – wenn man so will: dem Stil der Entstehungszeit des Romans – vorfindet. Auf einigen Tafeln wird diese Bordüre auch gespiegelt. Sieben der hochformatigen Tafeln sind von einer Büste des Gottes Pan, umgeben von üppigen
Weinreben, bekrönt, dazu unten symbolische Motive: ein schnäbelndes Taubenpaar auf einem Weidenkorb, darin die Panflöte, darüber die Houlette, gerahmt von einer Blütengirlande; die übrigen Tafeln mit einer profilierten Rahmung, an den Ecken durch „Ohren“ akzentuiert, unten mit angehängter Blütengirlande, oben mit großem Lorbeerkranz und Bändern. Zudem sind alle Textseiten von einer Doppelfilete gerahmt.
Der Einband in warmem honiggelben Farbton mit dem dekorativen Rückenmotiv des geöffneten Granatapfels in recht kräftiger Form. Dieses Motiv ist im 18. Jahrhundert weit verbreitet, doch findet sich unter den zahlreichen Nachweisen derartiger Stempel bei Barber (Sammlung Rothschild) keiner, der exakt damit übereinstimmt. Am unteren Kapital fand jedoch ein horizontales Band (Rollenstempel) doppelte Verwendung, das Barber verzeichnet (PAL 44) und mehrfach als Stempelform des Nicolas-Denis Derome (1731–1790) identifiziert hat.
Leicht berieben und wenig fleckig, wohlerhalten, innen ebenfalls nur stellenweise ein wenig gebräunt und fleckig. Das feine, aber recht feste Büttenpapier weist das Wasserzeichen eines großen Wappens mit zwei flankierenden fünfzackigen Sternen auf. Besonders interessant ist die dritte Lage C, wo jedes Textblatt von einer ornamentalen Wasserzeichen-Bordüre gerahmt wird, in dieser Form sehr ungewöhnlich und von größter Seltenheit, aber offenbar ein Charakteristikum der gesamten, oder zumindest eines Teils der Auflage, jedoch nicht bei der Fassung in Oktav.
Bibliographie wie bei der vorigen Nummer.
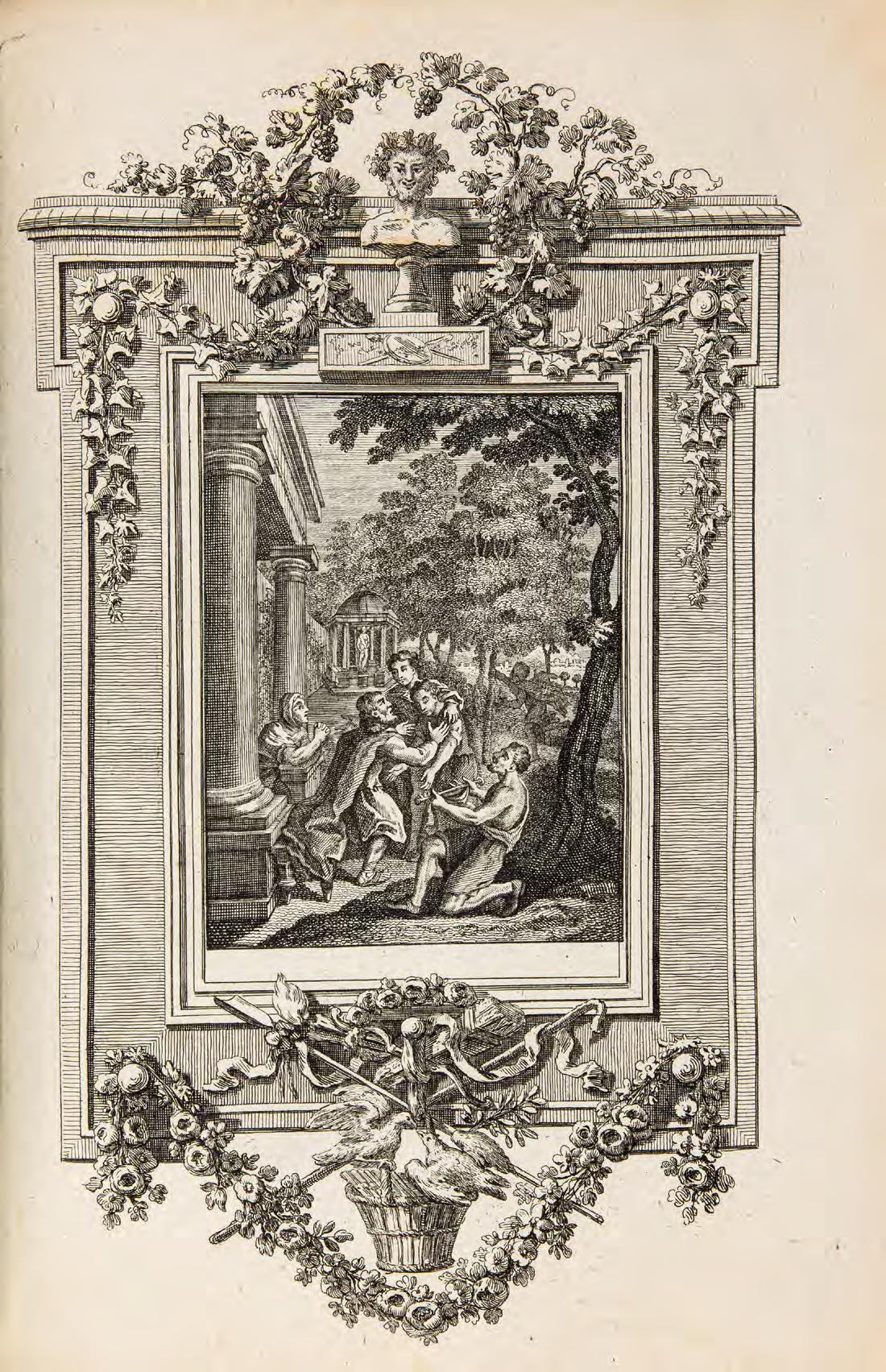
Die Quartausgabe „A Londres 1779“ in rotem Maroquin
LIV LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, escrites en Grec par Longus, & translatées en François par Jacques Amyot. „À Londres“ [d. i. Paris, Valade,] 1779.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel (datiert „Londres 1779“), 28 Kupfertafeln (davon 13 querformatige) nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Petits Pieds“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus (sämtlich in unsignierten seitenverkehrten Nachstichen, alle eingefaßt in Kupferstichbordüren von zweiter Platte) sowie einigen Vignetten in Holzschnitt.
2 Bl., 182 Seiten (Vortitel und Titel, S. I- VI: „Aver tissement“ und „Préface“, S. [7]-182: Haupttext).
Kollation: π2 A-Z4 (letztes Bl. leer). Klein-Quart (214 x 149 mm).
Bordeauxroter Maroquineinband der Zeit auf glattem Rücken zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben der goldgeprägte Titel, die übrigen mit floraler Rückenvergoldung, im Zentrum jeweils eine Blume, umgeben von je sechs kleinen Ringen, eingefaßt von Kastenvergoldung mit Fleurons in den Ecken, die Deckel mit dreifacher Filetenrahmung, an den Überschneidungen kleine Blütenstempel, dazu Eckfleurons in Form einer Lilie; Stehkantenvergoldung mit Doppelfileten, Innenkantenvergoldung mit floraler Bordüre, nachtblaue Buntpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Ein weiteres dekorativ und in der Zeit gebundenes Exemplar dieser besonderen Ausgabe in der Quart-Fassung mit den Rahmenbordüren im Louis-seize-Stil. Der Einband mit schöner Rückenvergoldung und dreifachen Deckelfileten, ähnlich dem vorherigen Exemplar gestaltet. Wie dieses gehört es ebenfalls jener frühesten Druckvariante an, die durch den am Ende des Avertissement stehengebliebenen Satz „On en rendra compte dans les Notes“ ihre Abhängigkeit von einer früheren Ausgabe erweist, die die Notes noch enthielt (wohl derjenigen von 1745). In der späteren Variante, unsere Nummer LV, ist dieser Satz dann getilgt, gleichzeitig ist die Schlußvignette durch eine andere ersetzt worden.
Ein bemerkenswertes Kuriosum ist, daß auch in diesem Exemplar die Blätter der Lage C von einer ornamentalen Wasserzeichen-Bordüre gerahmt werden. Ist diese Form an sich schon sehr ungewöhnlich und selten, so wirft die Wiederholung in derselben Lage die Frage auf, inwieweit der Papierhersteller die Auszeichnung dieser einen Lage als sein spezielles Firmenmerkmal eingesetzt hat. Die Provenienz ist nicht ermittelbar. – Von einer kleinen Wurmspur bis zum Anfang der Lage D und leichter Fleckigkeit in den Rändern abgesehen, ein schönes, in der Zeit gut gebundenes Exemplar jener erstmals konsequent im Stil des Frühklassizismus gestalteten Ausgabe, die durch ihr Rahmenwerk den alten Darstellungen des Régent monumentalen Charakter verleiht.
Bibliographie unter Nummer LII .

Prächtig koloriertes Exemplar der Quartausgabe in einer unbeschriebenen Druckvariante
LV LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, escrites en Grec par Longus, & translatées en François par Jacques Amyot. „À Londres“ [d. i. Paris, Valade,] 1779.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel (datiert „Londres 1779“), 27 Kupfertafeln (statt 28; davon 13 querformatigen) nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der „Petits Pieds“ genannten Kupfertafel nach A.-C.-Ph. Comte de Caylus (sämtlich in unsignierten seitenverkehrten Nachstichen, alle eingefaßt in Kupferstichbordüren von zweiter Platte und prachtvoll altkoloriert) sowie einigen Vignetten in Holzschnitt.
2 Bl., 182 Seiten (Vortitel und Titel, S. I- VI: „Avertissement“ und „Préface“, S. [7]-182: Haupttext).
Kollation: π2 A4 -Y 4 Z3 (e s fehlt das Blatt mit der Lagensignatur P 1 = S. 113/114, durch sauber kalligraphierte Handschrift alt ersetzt). Klein-Quart (215 x 164 mm).
Roter Maroquineinband der Zeit auf glattem Rü kken, dieser mit All-over-Vergoldung aus ca. 250 kleinen Rhomben in Einzelstempeln, von einer goldgeprägten Doppelfilete gerahmt, im oberen Bereich olivgrünes Maroquinschild mit dem goldgeprägten Titel, Deckel mit dreifacher Filetenvergoldung in verschiedenen Stärken; Steh- und Innenkantenvergoldung, königsblaue Kleisterpapier-Vorsätze, Ganzgoldschnitt und rostrotes Seidenlesebändchen.
In diesem besonderen Exemplar der Quartausgabe wurden sämtliche Tafeln und Bordüren mit einem ausnehmend schönen Kolorit versehen: Kontrastreich schillernde Farben mit dem Fokus auf der warmen Seite der Palette: von Flieder- und Rosa-
tönen, über Orange und Bordeaux, dazu kräftige Grün- und Blautöne, in den Darstellungen der Suite auch Erdfarben und für einige Hervorhebungen sogar Gold. In der Gesamtwirkung wird dadurch ein außerordentlich satter Farbklang erzielt, der an die Wirkung von Gemälden denken läßt. Die Farbigkeit verdeutlicht nun auch die Funktion des Rahmenwerks: besonders schön ist dies anhand der hochformatigen Tafeln zu sehen, wo der äußere Rahmen wie aus rotem geäderten Marmor erscheint, – also dauerhaften und sehr monumentalen Charakter besitzt – an den man ephemeren Schmuck in Form von Blüten und Früchten angehängt hat. Der innere Rahmen besitzt dagegen eine für Gemälde übliche Form: Vergoldet und farbig gefaßt, mit Zierleisten und Kehle profiliert. Durch ihre Kolorierung wird somit noch evidenter, welche Aufgabe den von eigenen Platten gedruckten Rahmenbordüren zukommt: es ist die dezidierte Präsentation der einzelnen Darstellungen der Regentensuite als Werke der Malerei.
Gegenüber unserem unkolorierten Exemplar Nummer LIII fällt die Änderung am Ende des Avertissement auf, mit neuer Holzschnitt-Schlußvignette und der Weglassung des überflüssigen Schlußsatzes. Hier liegt demnach die spätere der beiden Quart-Varianten des Jahres 1779 vor.
In unserem Exemplar wurde das Blatt mit der Lagensignatur P1 zusammen mit der Tafel vor der Seite 113 entfernt und in zeitgenössischer Handschrift ersetzt. – Stellenweise leicht fleckig.
Das sauber ausgeführte, leuchtende und prachtvolle Kolorit hat auch den Vorteil, die teils mangelnde Qualität der Nachstiche nicht nur zu überdecken, sondern sie wie miniaturartige Malereien erscheinen zu lassen. Dieses Exemplar einer eher weniger bedeutenden Ausgabe gerät dadurch zu einem kleinen bibliophilen Juwel.
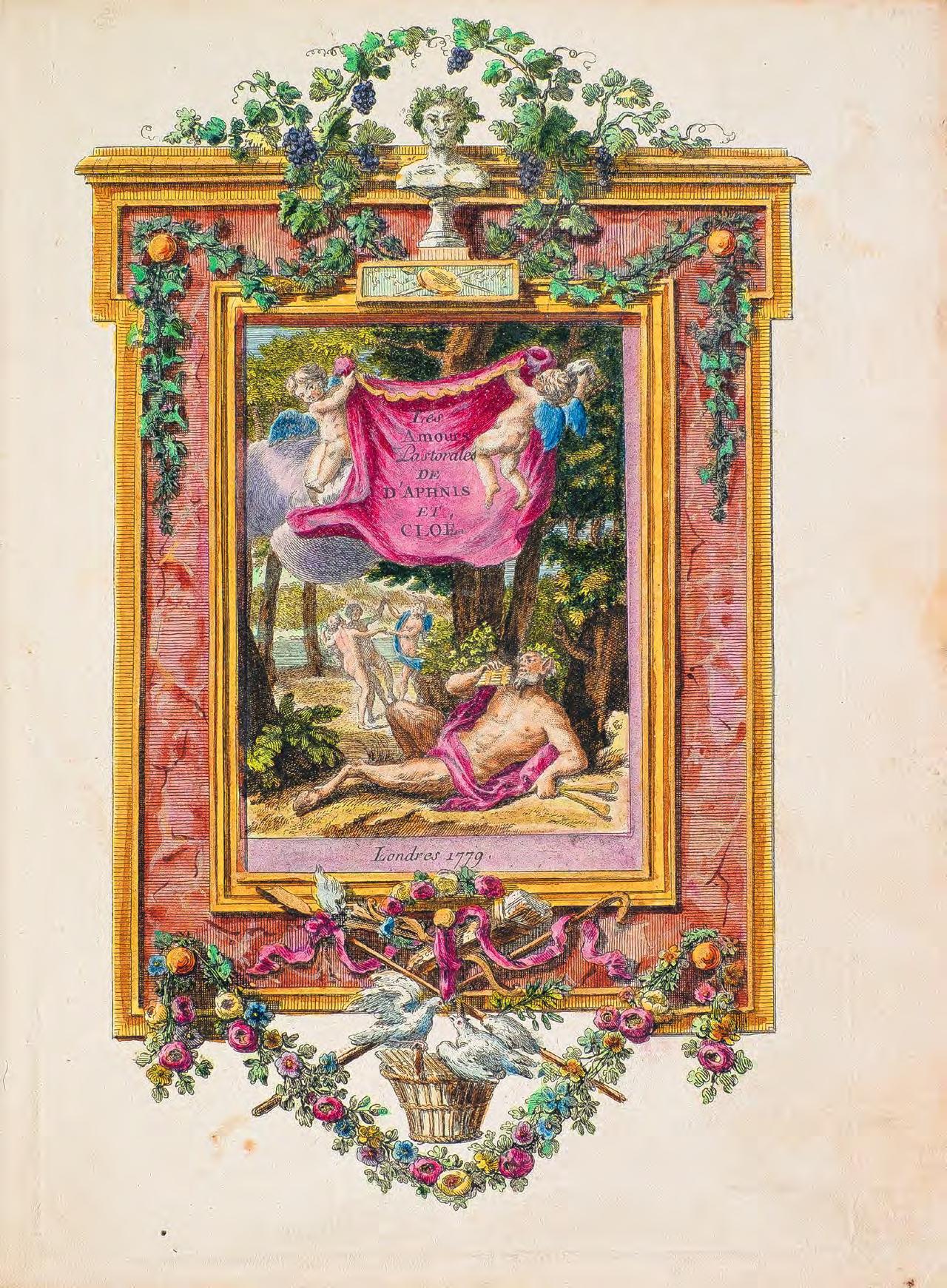

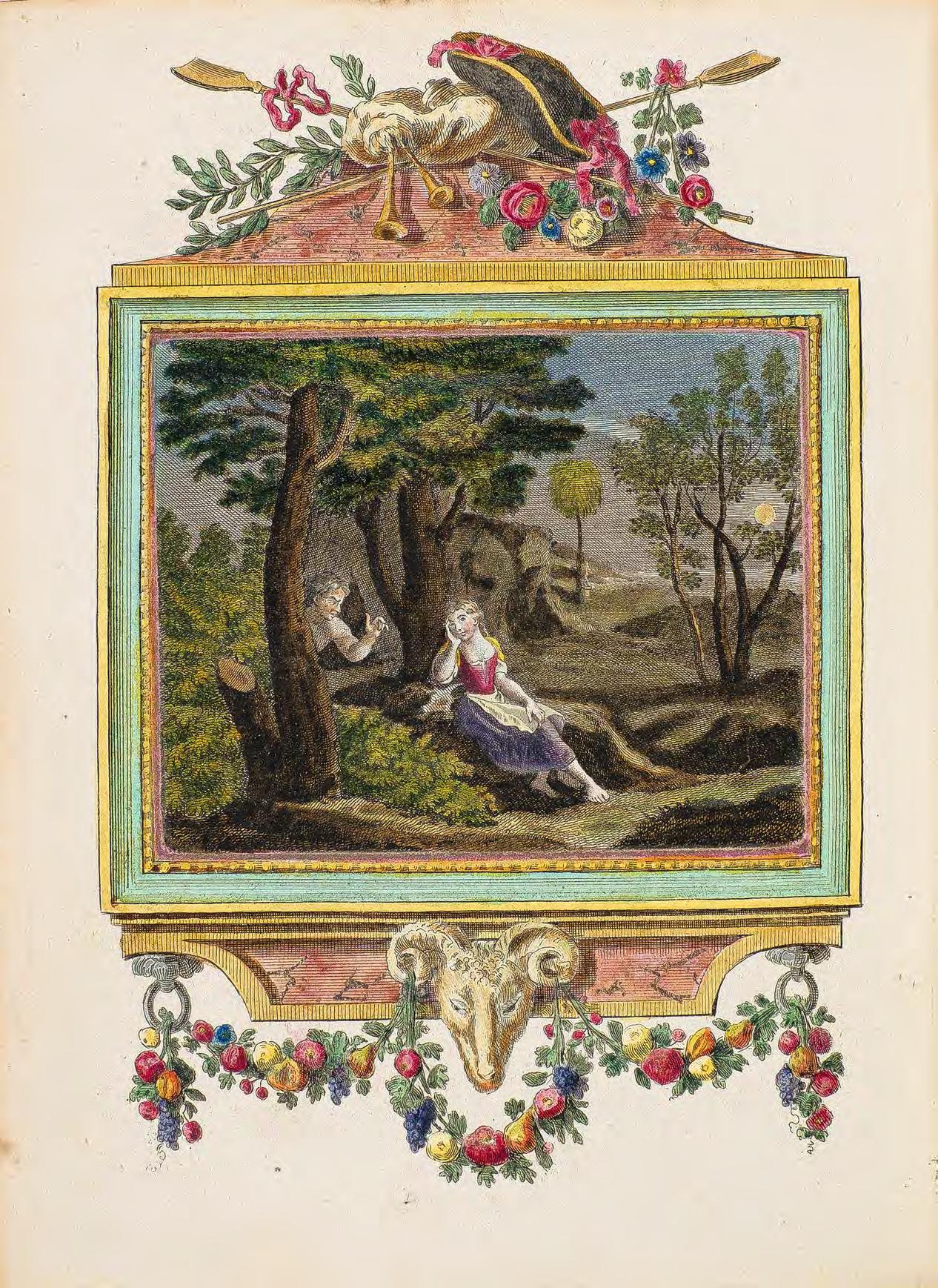
Die Pariser Sedezausgabe von 1783 –
Eines der seltenen Exemplare auf grossem Papier mit der originalen Regentensuite zusätzlich
LVI [Longus]. Les amours de Daphnis et Chloé. Traduction de 1782 [par F. V. Mulot]. „A Mithylène“ [d. i. Paris, Moutard,] 1783.
Mit zwei Kupfertafeln (ein allegorisches Fronzispiz und ein Porträt des Übersetzers), signiert von F.-A. David (davon eine nach J. B. C. Robin), sowie vier gestochenen Kopf- und sechs Schlußvignetten (eine in zweifacher Ausführung). – Zusätzlich eingebunden die Regentensuite mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Régent Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin.
XII, 228 Seiten (4 Blätter zwischengebunden), 2 Blätter (das letzte leer; Vor- und Hauptitel, „Préface du traducteur“, „Préface de Longus“, Haupttext S. [5]-269 sowie ein Blatt „Table“, die vier Zwischentitel unpaginiert und ohne Lagenzählung einzeln zwischengebunden).
Kollation : a 6 A-O 8 P 4 [das letzte leer; zwischengebunden: π 4].
Sedez, auf Papier im Format Groß-Oktav (204 x 126 mm).
Hellbrauner Kalbledereinband (Veau havane) der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben goldgeprägtes dunkelbraunes Maroquinschild, in den anderen unterschiedliche zentrale Motive: eine Krone, zwei entgegensetzte Sichelmonde und ein Herz, umgeben von kleineren floralen Elementen, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung, Blütenstempeln an den Überschneidungen und großem goldgeprägten Wappen-Supralibros; Stehkantenfilete, Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze sowie Ganzgoldschnitt.
Ein unikales Exemplar einer besonderen Ausgabe: Im Jahre 1783 ließ der Pariser Verleger Nicolas-Léger Moutard anonym eine kleinformatige Ausgabe in einer neuen französischen Übersetzung von Daphnis und Chloe drucken, nachdem bereits im Jahre 1777 eine Ausgabe in Duodez, die allerdings nur ein Frontispiz enthielt, in drei Varianten erschienen ist (unsere Nummer LI). Diese ohne Nennung eines Verlegers in Lyon publizierte Ausgabe wurde wie die vorliegende immer wieder zu Unrecht dem legendären, auf Kleinformate spezialisierten Reimser Drucker Hubert Cazin zugeschrieben. Illustriert wurde die vorliegende Pariser Ausgabe in ganz neuartiger und eigenwilliger Weise, mit etwas karg, teils fast ins Skurrile gehenden Kopf- und Schlußvignetten sowie zwei Kupfertafeln, von denen die eine den Übersetzer FrançoisValentin Mulot (1749–1804), die andere eine Allegorie zeigt. Der Druck erfolgte im Sedezformat, doch gibt es einzelne besondere Exemplare, die auf Hollandpapier in Groß-Oktav abgedruckt wurden – wie hier vorliegend.
In dieser Ausgabe wird der Rückzug ins Intime, Feine, Unspektakuläre den großen aufwendigen Inszenierungen bewußt entgegengesetzt. Die Vignetten sind sehr klein gehalten und wirken auf den ersten Blick ein wenig spröde, den Betrachter dadurch allerdings zum genaueren Hinsehen richtiggehend auffordernd. Denn erst dann offenbaren sie ihren eigentümlichen Reiz, der durchaus dem Zeitgeschmack der Übergangsepoche zwischen ausgehendem Rokoko und Frühklassizismus entspricht. An der Art Cazins orientiert, trägt diese Ausgabe den Charakter des Erlesenen und Besonderen, was Brissart-Binet in seiner Cazin-Bibliographie (angelehnt an Cohen, doch nicht mehr bei De Ricci, unter falscher Zuschreibung an den Reimser Verleger) ausdrücklich hervorhebt: „Cette édition est remarquable par la beauté des
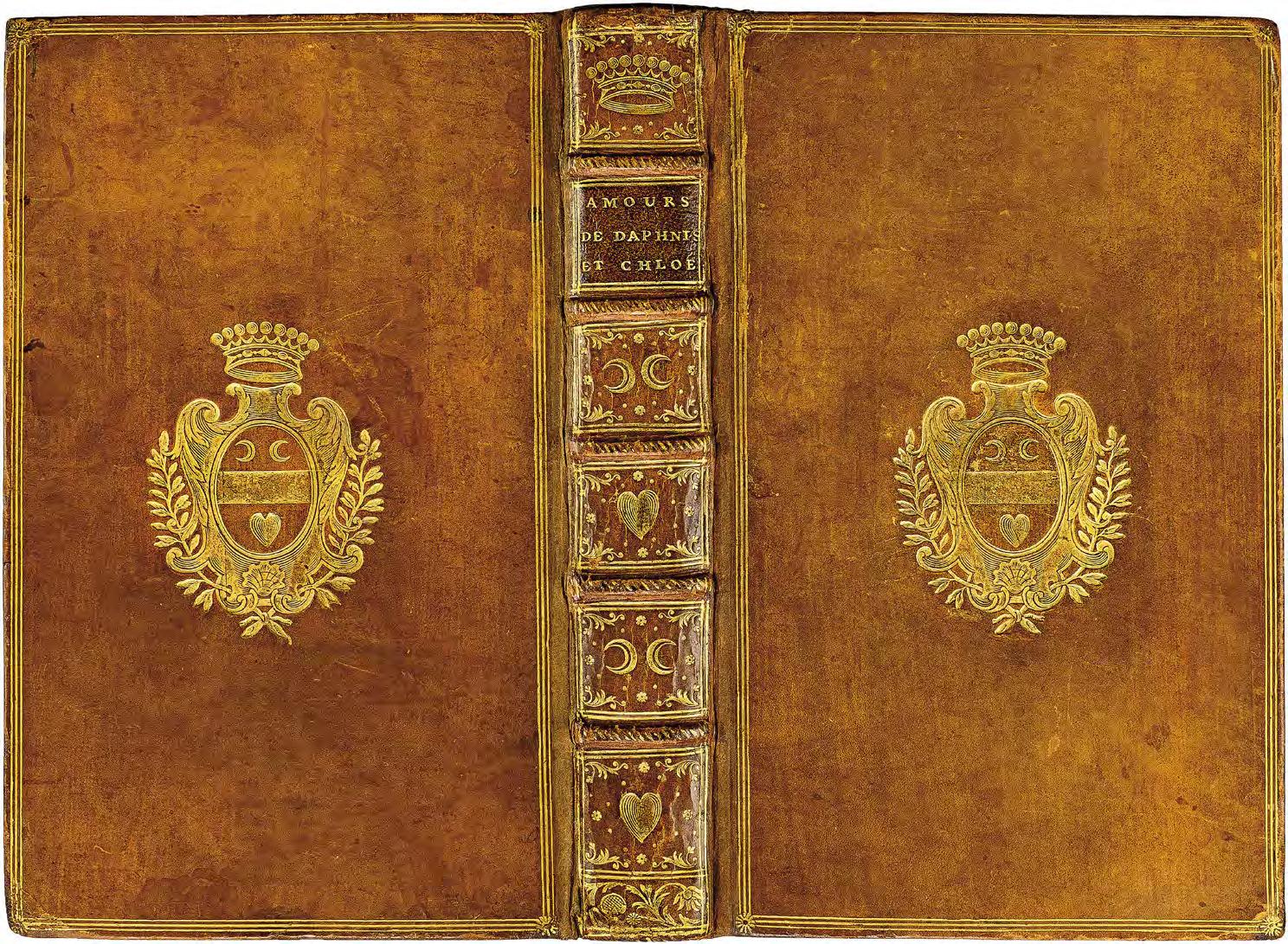
marges, la correction, l’élégance de l’impression et les charmantes vignettes têtes de pages placées à chaque livre …“ Als Frontispiz dient eine Tafel mit kleinem Kupferstich – eigentlich in der Größe einer Vignette – signiert mit David als Stecher und Robin als Zeichner (oft falsch gelesen, zum Beispiel bei Brissart-Binet: „Robia“), bei denen es sich um François-Anne David (1741–1824) und Jean Baptiste Claude Robin (1734–1818) handelt. Dargestellt ist, wie die personifizierte Innocence in Gestalt einer nackten Frau die Liebe von Daphnis und Chloe mittels einer Wolke vor den „regards lascifs du Dieu de Lampsaque“ schützt, eine in diesem Zusammenhang neu hinzutretende Darstellung, die den Aspekt der natürlichen Unschuld der Liebe und die Geborgenheit in der Abgeschieden-
heit der Natur allegorisch thematisiert. Hier wird zum ersten Mal seit den Folgen des Regenten und Scotins eine wirklich andersartige Ikonographie in die Illustration dieser Geschichte aufgenommen. Als Werk des nicht akademisch ausgebildeten Historien- und Porträtmalers Robin ist diese Darstellung nachgewiesen von Bénard (Cabinet Paignon Dijonval 1810, S. 317, Nummer 9096), wobei in der vorliegenden Fassung des Stichs der Name des Stechers noch fehlte. Dieser, FrançoisAnne David (1741–1824), hat später nochmals mit dem Übersetzer unserer Ausgabe, FrançoisValentin Mulot (1749–1804), zusammengearbeitet, für den er die Illustration zu dem mehrbändigen Opus Le Museum de Florence geschaffen hat, das ab 1787 erschienen ist.
Das gegenüber dem Beginn der Préface du traducteur eingebundene Porträt Mulots wurde ebenfalls von David gestochen, ohne Angabe eines Entwerfers, der David vielleicht selbst gewesen ist. David stellt das Profilbildnis Mulots im Tondo und auf hohem Sockel durch die Attribute der sieben freien Künste, wie Bücher, Schreibfeder, Äskulapstab, Palette und Lyra, ganz in den Kontext der Gelehrsamkeit. Dieses reizende, trotz seiner geringen Größe sehr reich ausstaffierte Porträt fehlt fast immer (Brissart-Binet: „manque à presque tous les exemplaires“). Mulot begründet im Vorwort, warum er es gewagt hat, der verdienstvollen Übersetzung Amyots eine neue entgegenzustellen. Seine Fassung wurde noch einmal abgedruckt, in der Ausgabe Paris 1795, auch diese mit neuen Illustrationen (von Blanchard nach Binet).
Nun ist unser Exemplar nicht nur auf großem Papier gedruckt, es enthält zusätzlich auch wieder den gesamten Regentenzyklus mit allen Tafeln, einschließlich Frontispiz und der Petits Pieds. Man erkennt unschwer, daß es sich um Abzüge jener Tafeln handelt, die Néaulme für seine Ausgaben von 1754 und 1757 verwendet hat, hier natürlich ohne die Rahmenbordüren, das heißt also: Mit Ausnahme der neu, wohl von Eisen, nach dem Vorbild Scotins geschaffen Petits Pieds-Version liegt hier ein Abzug der gesamten Suite von den originalen Platten von 1714/18 im Zustand der 1750er Jahre vor. Der Erstbesitzer des Bandes hat sich wohl doch nicht von der vertrauten Bilderwelt lösen können, weshalb er von dieser Ausgabe ein Exemplar auf großem Papier wählen mußte, denn nur ein solches war groß genug, die Suite integrieren zu können. Die leichte Fleckigkeit dieser Tafeln, im Gegensatz zum übrigen Druck, und das unterschiedliche Papier zeigen indessen an, daß hier
tatsächlich eine ältere Suite Verwendung gefunden hat, und es sich nicht etwa um eine verlagsseitige Produktion mittels eines Neuabdrucks handelt.
Provenienz: Das Wappen auf den Deckeln sowie die Wappenfiguren, zwei Mondsicheln, Herz und eine Grafenkrone, die auch den Rücken zieren, verweisen auf eine französische Adelsfamilie. In Frage kommen die Blouet de Camilly (siehe Guigard, Nouveau armorial, Bd. I, S. 239), allerdings führen diese auch einen Löwen als Wappenfigur, den man kaum weggelassen hätte, weshalb es wahrscheinlicher ist, daß es sich hier um das ähnliche Wappen der Famile Jouve aus dem Languedoc handelt (siehe Rietstap, Armorial général, Planche III , Nr. 1), ebenfalls ein bedeutendes, weit verzweigtes Geschlecht. Der Einband wurde jedenfalls individuell für die Bibliothek der Familie angefertigt.
Ein eminent breitrandiges, repräsentativ gebundenes Exemplar mit den beiden Tafeln und den Vignetten in sehr guten Abdrucken, dazu der Regentenzyklus zusätzlich eingebunden. Reynaud zitiert wohl unser Exemplar in Notes supplémentaires, Sp. 318.
Bibliographische Referenzen: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, 654 f. Lewine 324. Barbier, Anonymes et pseudonymes, 611. Boissais/Deleplanque, Le Livre à gravures, S. 116. Quérard, La France littéraire, Bd. V, S. 361. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 533. Schweiger, HcB, Bd. I, S. 192. Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1160. Ebert, ABL , 12245 (angemerkt unter der Ausgabe von 1787, zur Übersetzung). Brissart-Binet, Cazin, S. 105. Fontaine, Cazin, S. 207 (unter Faux Cazins). Lewine, Illustrated books, S. 324. Sander Nr. 1231.
Der berühmte Bodoni-Druck von 1786 – Sehr breitrandiges Exemplar in einem
grobnarbigen roten englischen
Maroquin-Einband der Zeit
LVII Longos. Lóngou Poimenikon ton katà Dáphnin kài Chlóen bíbloi téttares cum proloquio de libris eroticis antiquorum. Parma, Ex Regio Typographeio, 1786.
Mit gestochenem Porträt-Medaillon auf dem Titel und gestochener Textvignette von G. Cagnoni nach G. Locatelli.
2 Bl., S. I- VIII, 2 Bl., S. IX-LXXIII S., 1 Bl., 164 S. (Titel, 1 Blatt Widmung „Viro amplissimo Iosepho Nicolao Azara“, Vorwort „Typographus lectori S.“, zwischengebunden zwei Blätter Widmung „Eruditissime Vir“, „Proloquium de libris eroticis antiquorum“, Vortitel und Haupttext auf Griechisch).
Kollation: π2 1 4 π 2 2–84 9 6 a-u 4 x 2 . Groß-Quart (299 x 223 mm).
Grobnarbiger, sattroter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Doppelbünden mit Perlstableisten, am Fuß datiert „Parmae 1786“, Deckel mit einfachen Fileten; Stehkantenvergoldung, Innenkantenvergoldung mit Stabfileten, Marmorpapiervorsätze sowie Ganzgoldschnitt, gebunden von Henry Walther.
Die einzige, höchst berühmte Bodoni-Ausgabe in der Originalsprache mit ihrem prachtvollen Druck der klassischen griechischen Type, vorliegend in einem Exemplar von adäquater Bindung, handwerklich meisterlich, doch zurückhaltend, in schlichter Eleganz des Ornaments. Das Proloquium in Antiqua, die Widmung in einer der Handschrift angenäherten Kursive. Letztere ist gerichtet an den Entwerfer des Textkupfers, Giuseppe Locatelli
(im Stich „Joseph Lucatelli“; 1751–1828), der sich bei Mengs in Rom gebildet hatte. Das Kupfer zeigt einen von Locatelli entworfenen Gedenkstein für Mengs, an dem der lorbeerbekrönte Apoll mit der Lyra in der Hand lehnt, eine Reminiszenz an das berühmte Deckengemälde von Mengs in der Villa Albani in Rom. Diese Widmung erinnert zugleich an die hohe Wertschätzung, die Bodoni Mengs als einem der wichtigsten Wegbereiter des Klassizismus entgegengebracht hat. Der Stecher war Domenico Cagnoni, welcher laut Thieme und Becker schon seit 1775 für Bodoni tätig war (ALBK , Bd. V, S. 357). Die runde Titelvignette zeigt ein Profilbildnis der Polymnia , der Muse der Hymnendichtung.
Diese Bodoni-Ausgabe wird von allen Bibliographen bewundert, Brunet beschreibt sie zurecht als „belle édition“. Sie enthält eine Einleitung von Paulus Maria Paciaudius (1710–1785), der seit 1761 Bibliothekar beim Herzog von Parma tätig war, „de libris eroticis antiquorum“, in dem die klassischen griechischen erotischen Texte besprochen und ihre Ausgaben bibliographiert werden (einschließlich der französischen Übersetzungen); dieser Aufsatz wurde von den Erotik-Bibliographen schändlicherweise nie ausgewertet (vermutlich wegen mangelnder Sprachkenntnisse).
Die lateinisch-griechische Longus-Ausgabe von Bodoni ist noch seltener als die im selben Jahr erschienene italienische Übersetzung, die mehrere Neuauflagen erfuhr. Schon im Katalog Renouard von 1854 wird sie als „très-rare“ bezeichnet, was mithin darauf zurückzuführen ist, daß die gesamte Auflage gerade einmal 170 Exemplare betrug (Renouard, Catalogue 1854, Nr. 1890). Im Wettstreit der großen Meistertypographen dürfte sie auf Didots Ausgaben der Jahre 1776 und 1778 reagieren: „A Greek pastoral novel with
such overtones was bound to be popular in Neoclassical times and the interest shown in the text from the late 1770s is notable. Guillaume De Bure, the learned Paris bookseller and bibliographer, promoted first Louis Dutens’s 1776 edition of the Greek text, printed in only 200 copies by François Ambroise Didot, and the the great Villoison annotated quarto of 1778, likewise printed by Didot. This was the text which Bodoni chose for his quarto Greek edition of 1786 … Bodoni’s role however streched beyond that of launching Daphnis and Chloe once more onto the fine book market for, simultaneously, he produced the first edition of Annibale Caro’s sixteenth-century Italian translation which had remained in manuscript until then. This work, destined to run into many editions subsequently, was however treated by Bodoni in the same manner as the Greek text, that is it was printed in a carefully limited edition and has all the hallmarks of a private collector’s piece.“ (Barber, Daphnis and Chloe, S. 45 f.).
Didot sollte das auf seine Weise beantworten – bereits im Folgejahr erschien seine mit neuen Tafeln nach den Gemälden des Regenten und in der Neuübersetzung des Jean François DebureSaint Fauxbin produzierte Ausgabe, gleichfalls ein Markstein in der Geschichte der Typographie (siehe Nummern LVIII- LXIV). Ihre Konkurrenz trugen Bodoni und Didot wohl mit Vorliebe anhand von Longus-Editionen aus.
Das Exemplar hat englische Provenienz: Der erste und einzig ermittelbare Vorbesitzer war Michael Woodhull (1740–1816), ein großer englischer Bibliophiler, bekannt als Euripides-Übersetzer, dessen umfangreiche und bedeutende Bibliothek erst 70 Jahre nach seinem Tod zum Verkauf kam (Catalogue Woodhull-Severne 1886, Nr. 1588).
Gebunden wurde es in Woodhulls Auftrag in London bei dem 1824 verstorbenen Buchbinder Henry Walther mit dessen charakteristischen verzierten Doppelbünden und der ebenfalls bei allen seinen Einbänden anzutreffenden Angabe von Druckort und -jahr in Goldprägung am Schwanz.
Unser Exemplar, gebunden für einen skrupulösen Bibliophilen, ist äußerst breitrandig (die Ränder sogar stellenweise noch ébarbé , also mit dem unregelmäßigen Büttenrand) und so gut wie fleckenfrei erhalten.
Literatur: Brooks, Edizioni Bodoniane, S. 314. Lama, Bodoni, Bd. II , S. 40 und S. 109 (zu Locatelli). Weiss, Katalog Bodoni, 83. Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1155. Ebert, ABL , 12231. Graesse Trésor de livres rares, Bd. IV, 254. Barber, Daphnis and Chloe, S. 46–48. Ramsden, London Book Binders, S. 144 und Tafel XXV. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 531 f. Schweiger, HcB, Bd. I, S. 191. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1233.
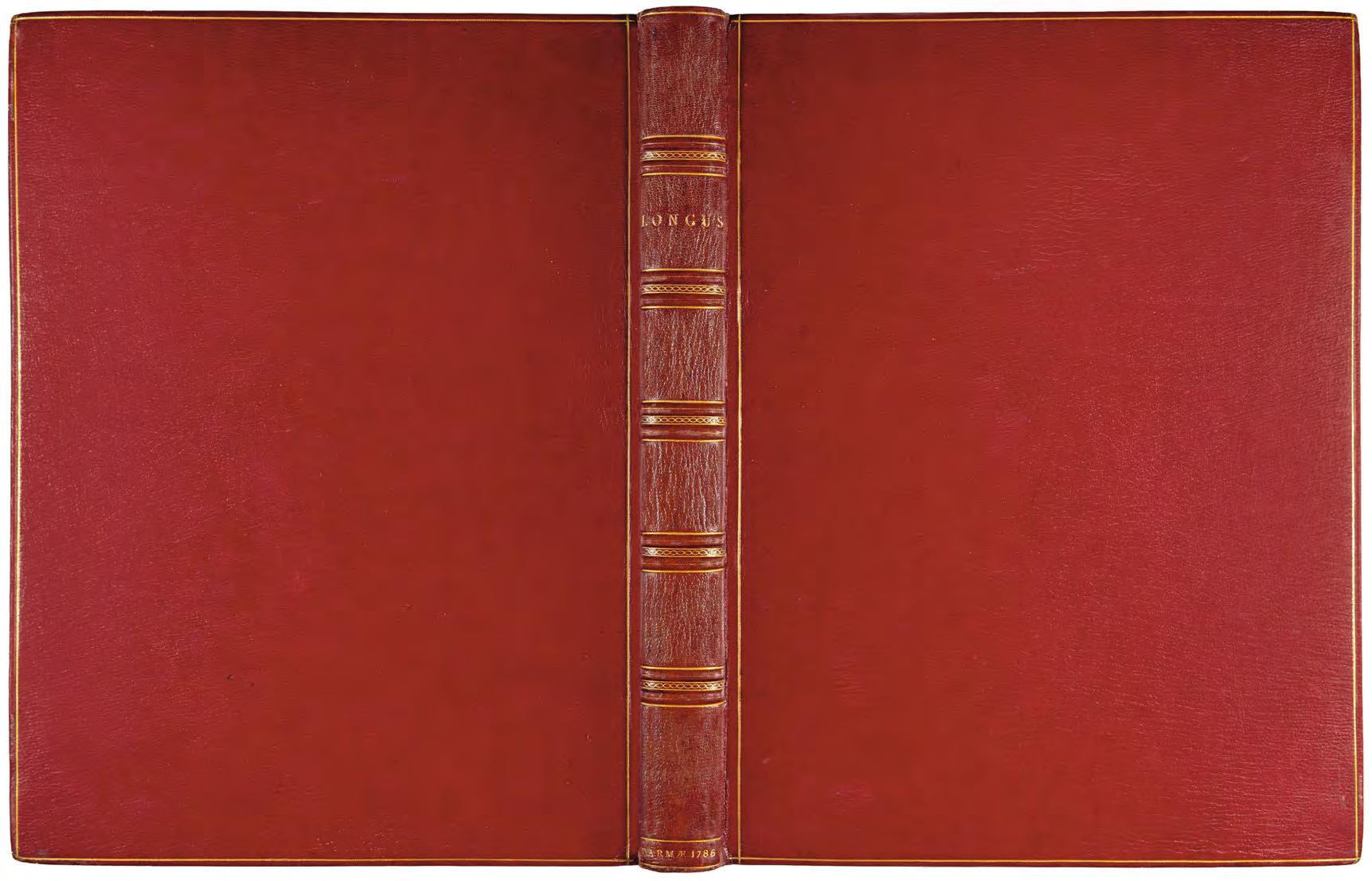
Das überaus reich getrüffelte
Exemplar Emmanuel Martin –Rahir – Salomons mit den gouachierten, auf Pergament gedruckten Radierungen Martinis, in einem einband von Capé
LVIII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduction nouvelle [von J.-F. Debure-Saint Fauxbin], avec figures nouvellement dessinées sur les peintures de M. le Duc d’Orléans, Régent. Zwei Teile in einem Band. Paris, Imprimerie de Monsieur [= Pierre-François Didot] für Lamy, 1787.
Mit 29 Radierungen von P.-A. Martini nach den Gemälden des Régent (einschließlich der „Petits pieds“ nach dem Comte de Caylus), auf Pergament gedruckt, gouachiert und mit farbigen Rahmen versehen, dazu eine weitere Suite aller 29 Radierungen, diese in Sepia gedruckt. – Zusätzlich eingebunden: Zwei Selbstporträts von A. Coypel am Anfang, davon eine Originalzeichnung in schwarzer Kreide auf blauem Papier, datiert 1715 (100 x 71 mm), und eines in Kupferstich von J. B. Massé; als Frontispiz eine gouachierte Originalzeichnung auf Pergament nach A. Coypels Frontispiz von 1718, ein Kupfertitel zur Daphins-et-Chloé-Folge nach J.-J. F. Le Barbier von F. Ribault, datiert 1794, ein Blatt mit Kopfvignette avant la lettre nach Le Barbier sowie insgesamt 15 Kupfertafeln nach Le Barbier (davon sechs eaux-fortes pures, acht épreuves avant la lettre und eine Tafel avec la lettre) mit acht unterschiedlichen Motiven; dazu die Suiten von Prud’hon (drei) und Gérard (sechs), insgesamt in 18 Abzügen avant la lettre (davon vier auf Chinapapier, fünf eaux-fortes pures, wovon eines mit der Legende aber ohne Text sowie eine
Tafel avant le nom des artistes), mit neun unterschiedlichen Motiven; weiterhin vier Tafeln nach A.-J. Desenne (in Kupferstich von J. A. Blanchard in drei Zuständen: eau-forte pure, avant und avec la lettre und eine Lithographie von C. Motte) mit zwei Motiven, dazu eine Originalzeichnung von Desenne in Kohle und Tinte, wohl der Entwurf für die lithographische Fassung; drei Kupfertafeln von Larcher nach L. Hersent (davon zwei eaux-fortes pures und eine avant la lettre) mit einem Sujet; zwei Tafeln von Larcher nach J. Albrier (avant la lettre auf Chinapapier und eau-forte pure) mit einem Sujet; zwei Kupfertafeln nach Boucher (avant und avec la lettre) mit einem Sujet sowie ein nicht signierter gestochener Rahmen mit bukolischen Motiven (beigelegt).
VIII S., 1 Bl., 175 Seiten (typographischer Titel, „Préface“, „Avant-Propos“, hier nach dem ersten Zwischentitel A1 eingebunden, und Haupttext).
Kollation: a4 A1 *1 A2–4 B-Y 4 . Folio (325 × 240 mm).?
Roter Maroquineinband um 1850 auf fünf erhabenen Doppelbünden zu sechs Kompartimenten, diese mit kartuschenartigen Ornamenten, von Kastenvergoldung eingefaßt, im zweiten von oben der goldgeprägte Titel, Deckel mit Fileten- und Bogensatzvergoldung in intrikater Entrelacs-Manier, mittig auf dem Vorderdeckel intarsiert eine Miniatur in Grisaille auf Porzellan, leicht hochrechteckig und mit abgeschrägten Ecken, nach dem Gemälde „Le Tireur“ aus dem Zyklus von L. Hersent, eingefaßt von goldfarben ornamentierten Metallrahmen (130 x 113 mm); Stehkantenfilete, breite Innenkantenvergoldung in Form eines Mäanderbandes, Vorsätze in königsblauem Tabis, Goldschnitt, signiert an der unteren Kante des Rückens von C. F. Capé.
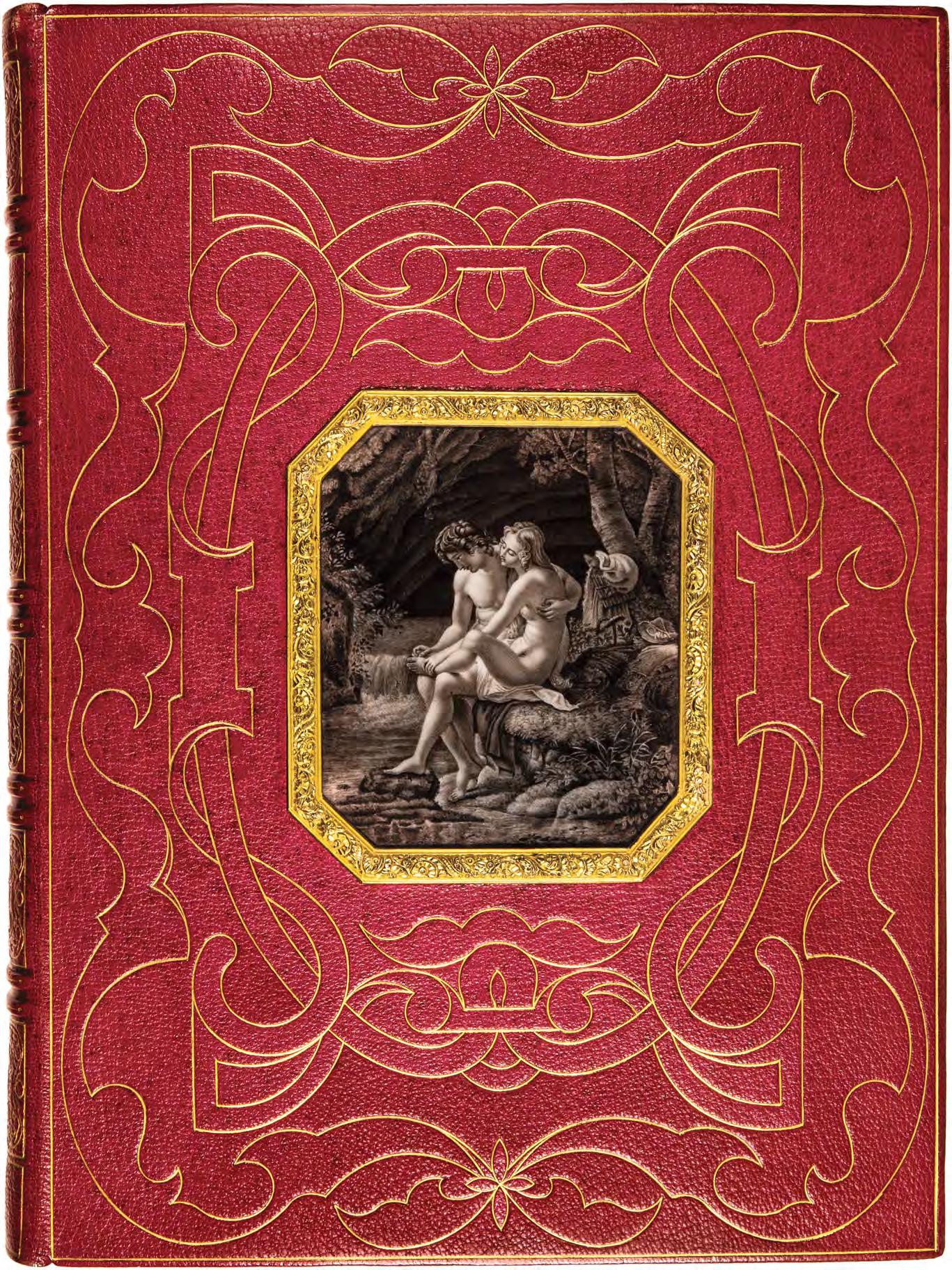

Wir eröffnen den Reigen hervorragender Exemplare der an sich schon vorzüglichen Neuausgabe, die 1787 bei Didot und Lamy in Paris erschienen ist, mit einem ganz besonderen, das in einem Band die ältere Darstellungstradition, also den Regentenzyklus in der Neufassung des Pierre-Antoine Martini (1739–1797), mit den bedeutendsten der neueren Fassungen der Daphnis-und-Chloe-Thematik zu vereinen. Unter den Beigaben finden sich selbst Originalzeichnungen, zurückgehend bis auf Antoine Coypel, von dem ein feines Selbstporträt enthalten ist. Dieses unikale, in seiner Bilderfülle unvergleichliche, dazu noch exzellent gebundene Exemplar enthält die Essenz der gesamten Longus-Illustration des 18., in der Zusammenstellung eines Connaisseurs des 19. Jahrhunderts, der hier Illustrationen von teils großer Seltenheit vereint hat.
Neben der zur Ausgabe gehörenden Bildausstattung der Martini-Folge nach der alten Regentensuite, die hier doppelt vorliegt, einmal brillant miniaturhaft auf Pergament gouachiert und in einer zweiten Ausführung in Form von Radierungen in Sepia, die wie feine Federzeichnungen wirken, wurden dem Exemplar so viele zusätzliche Tafeln beigegeben, daß es geradezu musealen Charakter erhält. Von den eher naiv-unschuldigen Schilderungen der einzelnen Szenen, wie sie der alte Regentenzyklus repräsentiert, über die anmutigen, teils auch erotischen Interpretationen des hohen und späten Rokoko (Boucher und Le Barbier), bis hin zu Illustrationen, die in ihrem Ausdrucksgehalt schon in die Frühromantik hineinreichen (François Gérard, Pierre Paul Prud’hon, Alexandre-Joseph Desenne und Louis Hersent).

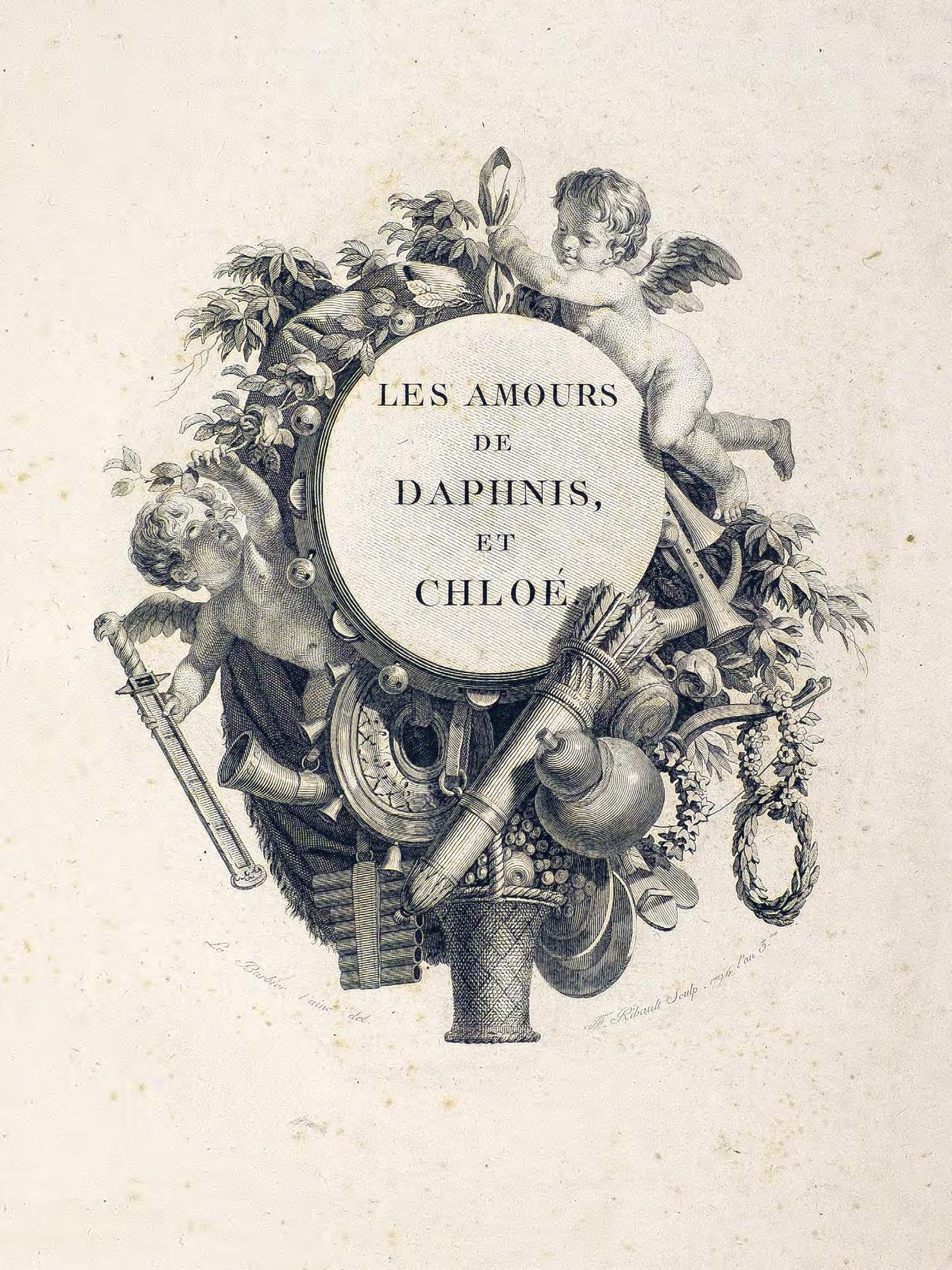
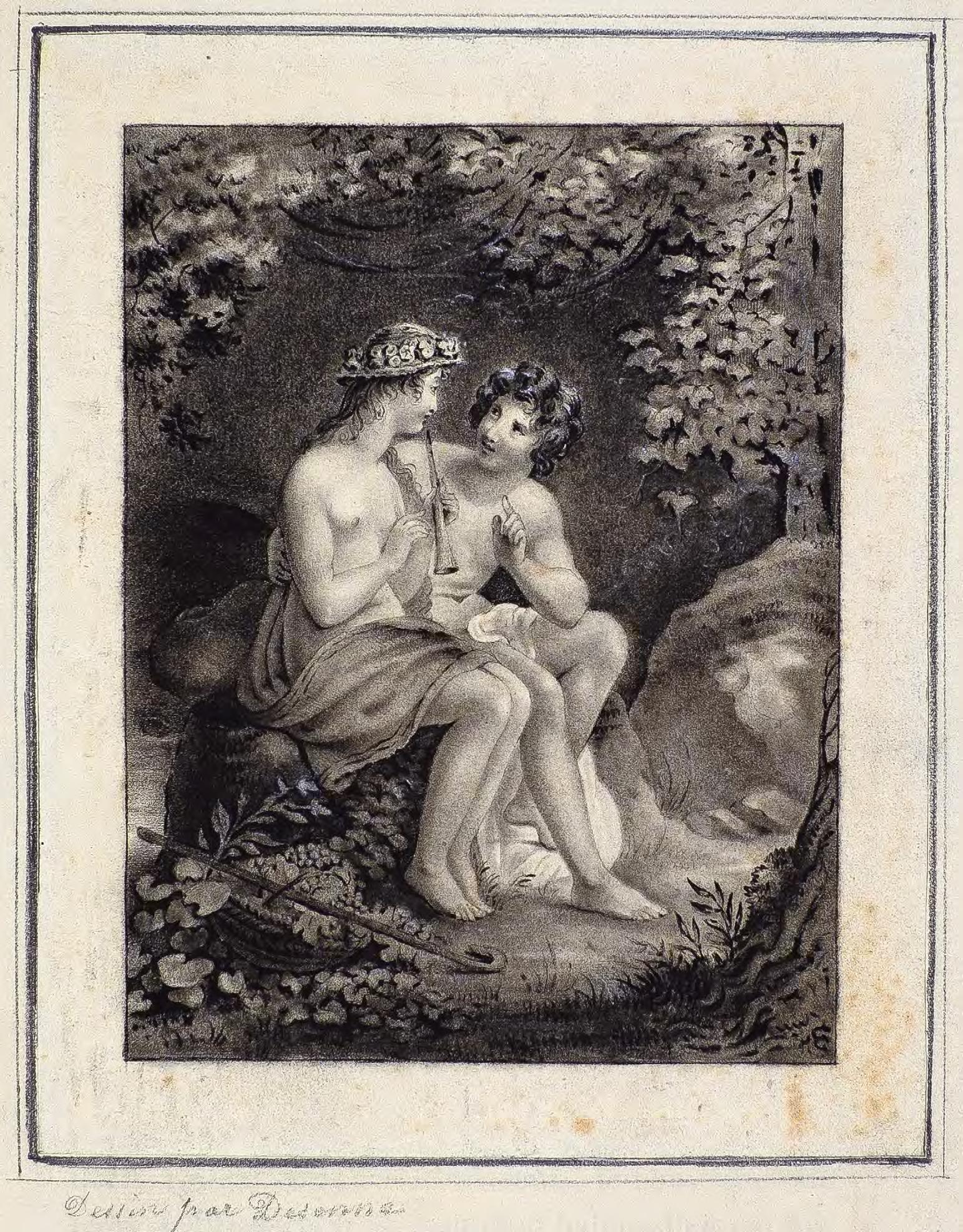
Hinzu kommt, daß viele der Radierungen in mehreren Zuständen vorhanden sind, die derselben Darstellung sehr unterschiedlichen Ausdruck verleihen.
Zum Zeitpunkt seiner Bindung hat man diesem Exemplar offenkundig alles angedeihen lassen, was sich an Besonderheiten der Illustrationsgraphik zu diesem Thema finden ließ: Insgesamt 53 graphische Blätter und drei Zeichnungen, die zusätzliche Suite Martinis nicht mitgezählt. So wird das Blättern in unserem Exemplar zu einem beeindruckenden Gang durch die Geschichte der Bilderwelt von Daphnis und Chloe.
Eine große Besonderheit inmitten der verschwenderischen Fülle der Beigaben sind die zahlreichen Abzüge der herrlichen Illustrationen von Jean-Jacques François Le Barbier l’aîné (1738–1826) in verschiedenen Zuständen (bis auf eine Ausnahme alle avant la lettre, sechs Tafeln in eau-forte pure): „…by 1793 a larger, quarto or folio, edition was commissioned from Le Barbier, a well-known historical painter and a friend of Gessner. This edition in fact never appeared although the sketches, proofs and engravings for it survive” (Barber, Daphnis and Chloe, S. 48). Der Grund für dieses Nichterscheinen wird vielleicht in Le Barbiers eigentümlichem Stil liegen, der sich noch nicht gänzlich von der Tradition des Rokoko zu lösen vermochte, aber durchaus neue Ansätze zeigt, die sich vor allem auf antike Vorbilder beziehen – „from the first he was devoted to the antique“ (Ray, The French Illustrated Book, S. 76) – und die klassizistische Epoche mit einleiten: „Although they [= his illustrations] remain much in the rococo tradition they do show an improved awareness of nature and a greater sensibility in their portrayal of the characters” (Barber, loc. cit.). In jedem Fall stellen die acht Tafeln Le Barbiers, dazu ein Kupfertitel und eine Kopfvignette, eine wundervolle Interpretation
zu Daphnis und Chloe dar, und es ist sehr zu bedauern, daß diese nie in einer eigenen Ausgabe veröffentlicht wurden. „Les caractères principaux des dessins de Lebarbier sont la pureté, la correction, un soin extrême, la recherche de la forme noble et d’une harmonieuse composition. Ils sont toujours finement dessinés à la plume et rehaussés dans les ombres de sepia ou d’encre de Chine.“ (Portalis, Les Dessinateurs, Bd. I, S. 332 f.). Die Abzüge sind von enormer Seltenheit; nie konnten sämtliche Illustrationen Le Barbiers aus dieser Folge zusammengetragen werden, so daß man nur mutmaßen kann, wie viele Sujets ursprünglich angefertigt worden sind. Sieurin geht davon aus, daß es 20 gewesen sein müssen: „Je pense qu’il devait y avoir 20 estampes. 10 dessins de cette collection ont figuré dans la vente la Bédoyère. C’est d’après ces dessins et les gravures en ma possession, que je trouve le chiffre de 20 pièces; je n’ai pu en réunir plus de 9 sujets, qui sont plus ou moins avancés, les autres n’ayant pas été commencés.“ (Sieurin, Manuel, S. 139).
Damit jedoch nicht genug: das Exemplar enthält außerdem die gesamte Suite von Prud’hon und Gérard, ebenfalls in vielfältigen seltenen Zuständen und Probedrucken – avant la lettre, eau-forte pure, auf Chinapapier, ein Abzug sogar vor dem Druck der Künstlernamen, darüber hinaus Abzüge zweier Illustrationen Desennes und einer von Hersent, der auch als Vorlage für die Porzellanmalerei auf dem Vorderdeckel diente.
Die eigentlich zu dieser Ausgabe gehörenden Radierungen, die Martini au trait nach den Gemälden des Régent angefertigt hat, wurden wenige Male auf Pergament abgezogen (vgl. Van Praet, Livres imprimés sur vélin, Bd. IV, S. 245), prachtvoll in satten, leuchtenden Farben gouachiert und einzelnen Luxus-Exemplaren beigebunden. Dieses ist eines davon, und es ist mit Sicherheit das am
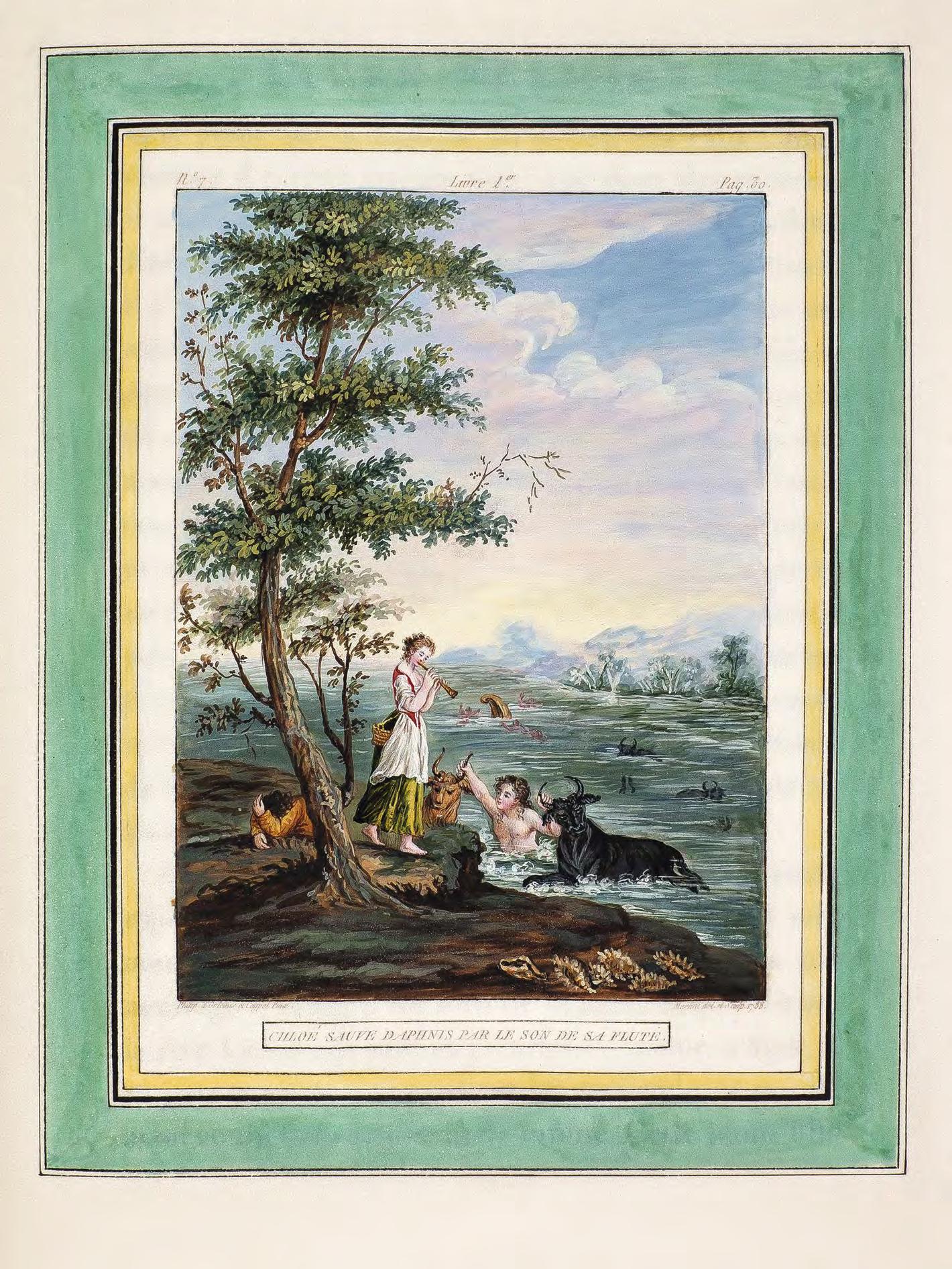
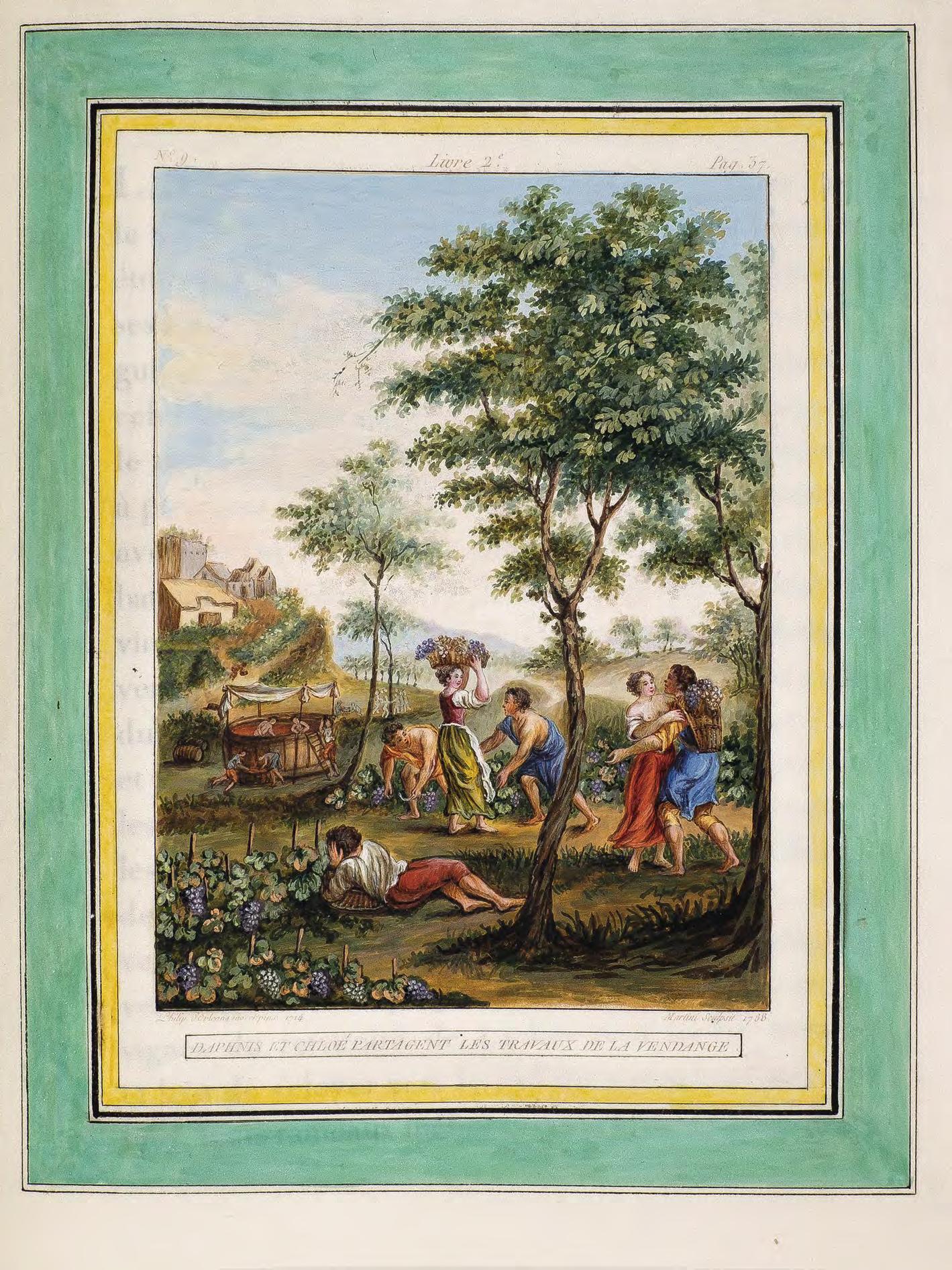
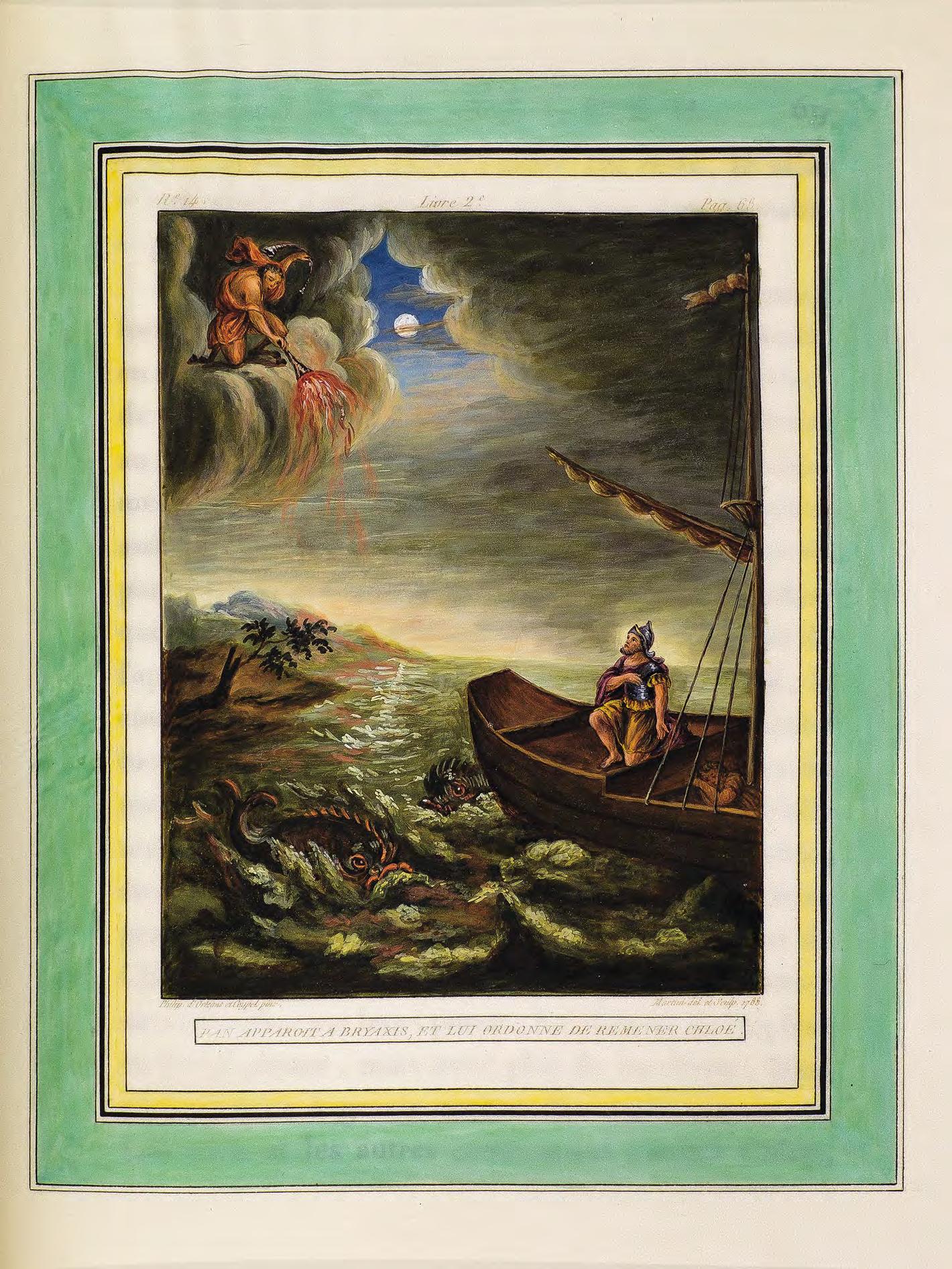
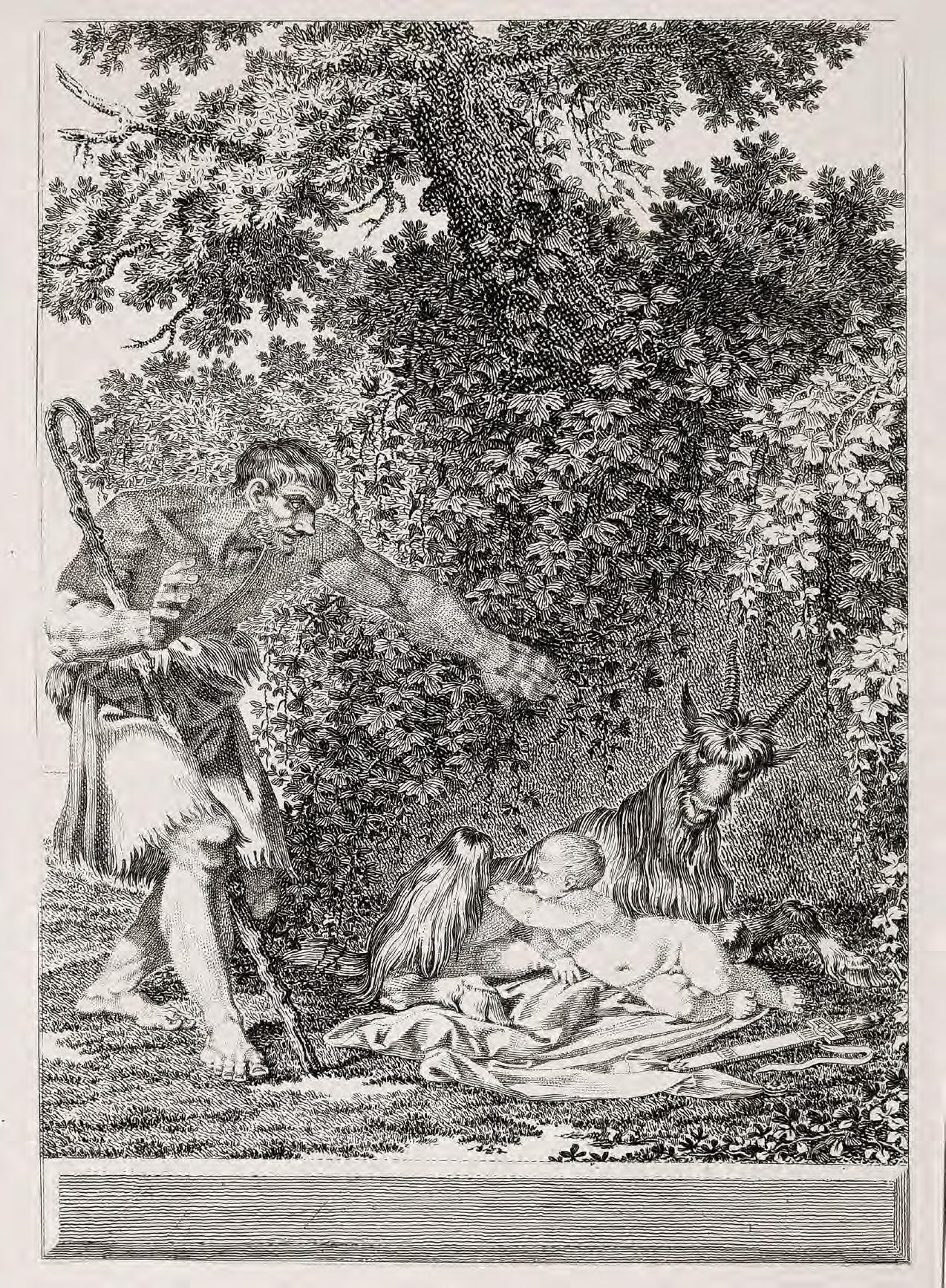


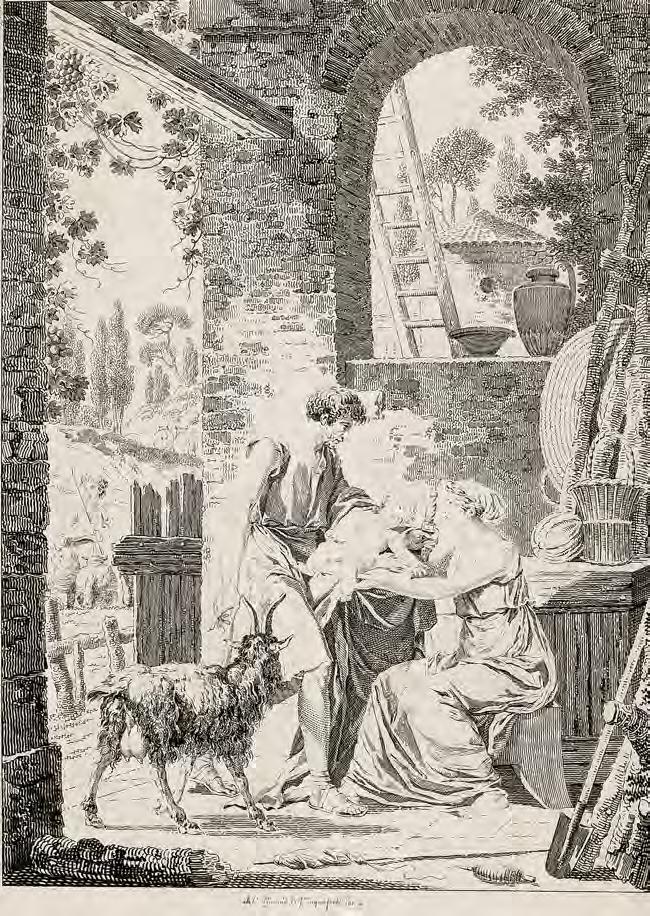
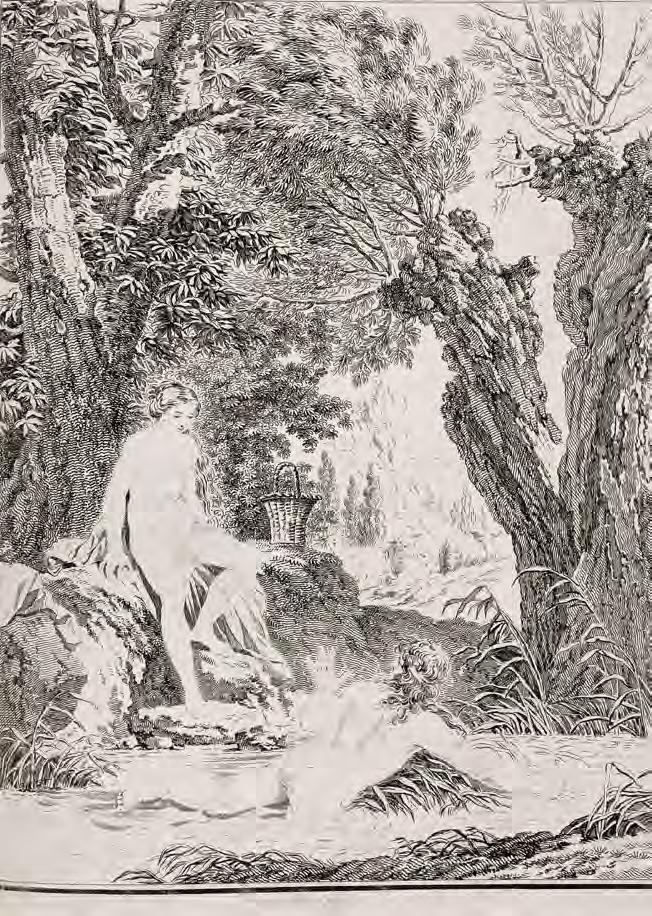
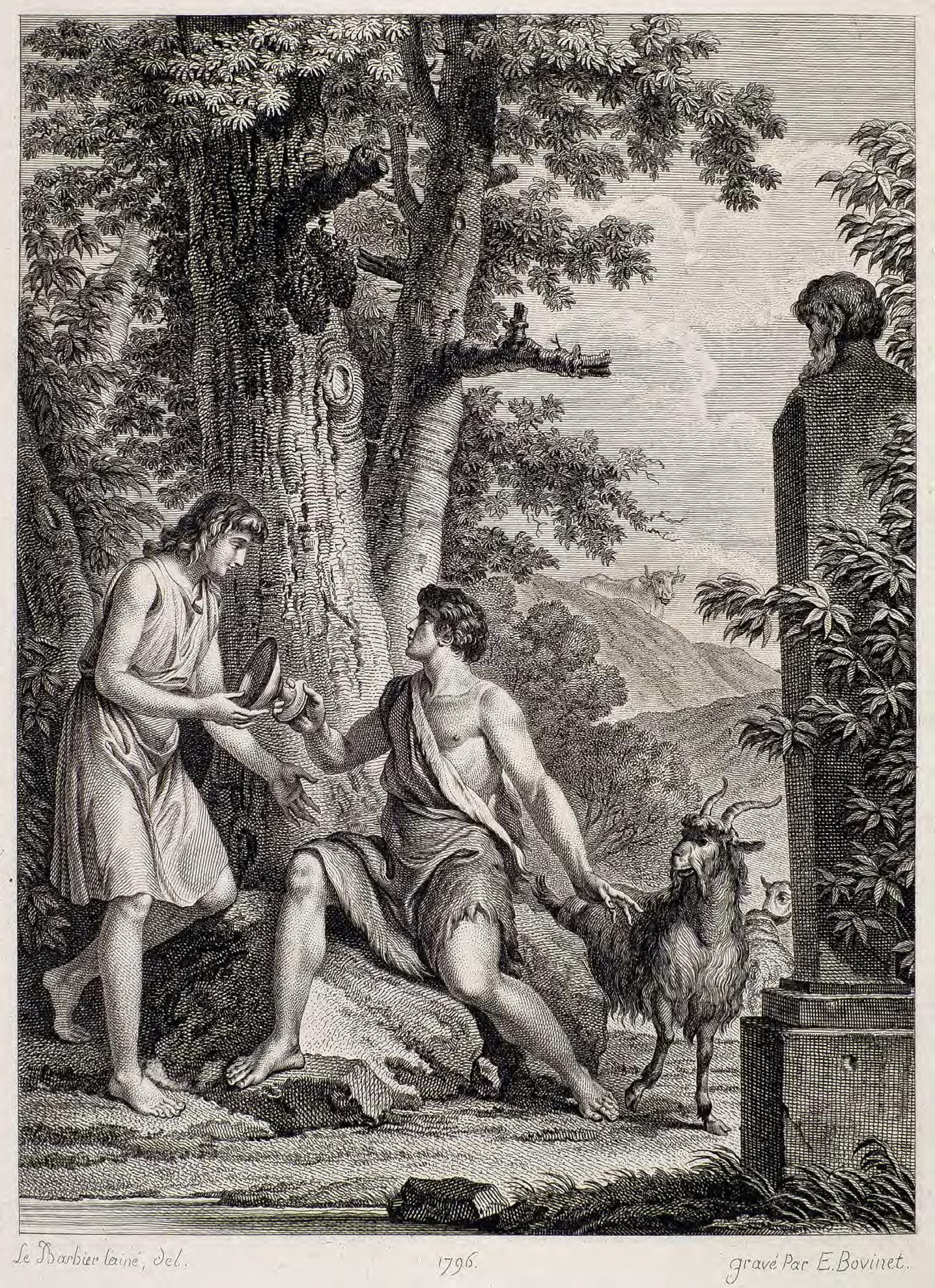

reichsten ausgestattete. Jede der 29 Tafeln wurde mehrfach in Lichtgrün, Schwarz und Gelb gerahmt. Bemerkt sei noch, daß acht Tafeln zwar mit dem Rahmen für die Legende ausgestattet wurden, dieser aber ohne Text geblieben ist. Auf diesen Tafeln fehlt auch die Angabe des Teils und der Seite, lediglich die Nummer der Tafel wurde handschriftlich eingetragen. Unmittelbar auf die Regentensuite bezieht sich der alte gestochene Titel Coypels von 1718, von einem unbekannten Meister in eine Miniatur von prachtvoller Leuchtkraft eiweißgehöhter Farben umgesetzt; die Eroten halten hier das Tuch mit dem Titel auf Griechisch.
In die Zeit des Regenten und der nach ihm benannten Ausgabe von 1718 weist vor allem die Ausstattung am Anfang des Exemplars zurück. Neben einigen schönen Porträtkupfern Philipps und seines Zeichenlehrers Coypel ist eine kleine Originalzeichnung von der Hand des Letzteren mit einem Selbstporträt im Halbprofi l nach rechts höchst bemerkenswert (100 x 71 mm). Sie zeigt den Meister in noch jüngeren Jahren, im Arbeitsgewand des Malers, mit einer Mütze auf dem Kopf und ohne Perücke, mit rasiertem Haupt. Der Blick, zur Seite aus dem Bild in die Ferne schweifend, hat bei freundlichem Gesichtsausdruck etwas Visionäres. Auch wenn sie nicht signiert ist, so ist diese vorzügliche kleine Studie dem Meister selbst gewiß zuzuschreiben, der zweifelsohne richtigen Überlieferung folgend.
Weiterhin zu Beginn, vor dem ersten Buch, ist eine Zeichnung zu jener Szene eingebunden, die Daphnis und Chloe beim Musizieren auf der Flöte zeigt; diese liegt hier auch als Kupferstich und Lithographie vor. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Entwurf des Zeichners, des Historienmalers Alexandre-Joseph Desenne (1785–1827), Sohn eines Buchhändlers und Illustrator zahlreicher klassischer Werke der französischen Literatur
dieser Zeit. Die gekonnte Kohlezeichnung scheint die gegenüber eingebundene lithographische Fassung in ihren fein diff erenzierten Hell-Dunkelwerten unmittelbar vorzubereiten.
Der Druck des Textes ist auf einem besonderen Papier erfolgt; schon in Verkaufskatalogen ist von einer „superbe impression sur papier vélin d’Annonay“ die Rede. In England erfunden, ist das Velinpapier durch Étienne Montgolfi er 1777 in Frankreich eingeführt und verbessert worden; in Annonay in der Auvergne wurde es produziert, und die „Imprimerie de Monsieur“ – die Druckerei des Bruders von König Ludwig XVI ., dem späteren Ludwig XVIII . – die zu dieser Zeit von PierreFrançois Didot (Didot le jeune) geführt wurde, hat es als eine der ersten für besondere Publikationen verwendet. Das feste Velin unseres Drucks erweist sich als ideales Pendant zu dem für die gouachierten Tafeln verwendeten sehr feinen, blütenweißen Pergament.
Die vorliegende Ausgabe war natürlich eine solche Besonderheit. Wiederum für das Königshaus entstanden, wurde der Text in einer neuen, zeitgemäßen Übertragung des Philologen Jean François Debure-Saint Fauxbin (1741–1825) vorgelegt, die Regentensuite zwar neu gestochen, aber in so enger Anlehnung an die Vorlage, daß deren Bilderfi ndungen bestimmend blieben. Druck und Ausstattung sind in jeder Hinsicht von großzügigem und aufwendigem Duktus, was nicht zuletzt das große Papierformat, größer als das aller bisherigen Ausgaben, zum Ausdruck bringt.
Von Charles-François Capé (1806–1867) wurde das Exemplar mit einem imposanten, makellos erhaltenen Maroquineinband à la Grolier versehen, dessen Vorderdeckel eine entzückende Miniatur auf Porzellan nach dem um 1820 entstandenen Gemälde des Louis Hersent (1777–1860) schmückt.











Provenienz: Das von Cohen zitierte Exemplar befand sich zuerst im Besitz Emmanuel Martins, auf dessen Auktion es 1877 für 900,– Goldfrancs verkauft wurde (Collection Martin 1877, Nr. 375).
Danach taucht es nacheinander in den Katalogen Alfred Piets (6.5.1891, Nr. 271, verkauft für 1520,– Goldfrancs) und Edouard Massicots (Catalogue Massicot 1903, Nr. 579, versteigert für 3.100,– Goldfrancs) auf, erworben von Edouard Rahir, der es an David Lionel Salomons (Catalogue Salomons 1916, Nr. 3147) für 132,– £ verkaufte. Zuletzt mit farbiger Abbildung in der Salomons-Auktion von Christie’s, Juni 1986, die Nummer 92: £ 7.560,–.

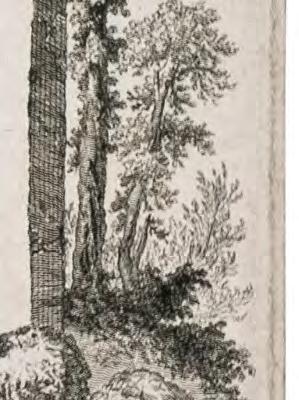

Die Textseiten sowie die Tafeln Martinis in einwandfreiem Zustand, die Tafeln nach Le Barbier und zum Teil auch die nach Prud’hon und Gérard etwas stockfl eckig.
Ein musée imginaire der Longus-Illustration des 18. Jahrhunderts.
Literatur: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 655 zitiert unser Exemplar, ebda. Sp. 658 zu den Illustrationen Le Barbiers. – Sieurin, Manuel, S. 139 ebenfalls zu Le Barbier. – Für die allgemeinen bibliographischen Referenzen zur Ausgabe von 1787 siehe unter der folgenden Nummer.
Komplett auf Pergament gedrucktes Luxus-Exemplar mit einer zusätzlichen Suite von um ein Drittel vergrösserten Gouachen nach Martini
LIX [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduction nouvelle [von J.-F. Debure-Saint Fauxbin], avec figures nouvellement dessinées sur les peintures de M. le Duc d’Orléans, Régent. 2 Bände. Paris, Imprimerie de Monsieur [= Pierre-François Didot] für Lamy, 1787.
28 Original-Gouachen auf Pergament nach den Gemälden des Régent, jeweils um ein Drittel gegenüber den Radierungen vergrößert, zusätzlich eingebunden; mit 25 (statt 29) Radierungen von P.-A. Martini nach den Gemälden des Regenten, auf Pergament gedruckt, gouachiert und mit farbigen Rahmen versehen. – Zusätzlich eingebunden.
VIII S., 1 Bl. (zwischengebunden), S. [1]-[82]; 1 Bl., S. [83]-175 (typographischer Titel, „AvantPropos“, hier nach dem Haupttitel (a 1) eingebunden, „Préface“ und Haupttext, am Beginn von Band II, vor Seite 83, Titelblatt zum zweiten Band außerhalb der Lagenzählung. – Es fehlt das Blatt mit der Lagensignatur S3 (Seiten 141/142).
Kollation: a 1 *1 a 2–4 A-K 4 L 1 ; π1L 2–4 M-Y 4
Groß-Quart, gedruckt auf Pergament im Format Royal-Folio (374 x 257 mm).
In zwei rote Maroquineinbände der Zeit auf fünf doppelten Bünden zu sechs Kompartimenten gebunden, drei Kompartimente mit dem goldgeprägtem Titel, der Bandangabe in römischen Ziffern sowie dem Druckort und -jahr, die übrigen mit einer goldgeprägten Amphore, Deckel mit Fileten- und Bogenvergoldung: vier sich teils überlagernde Goldrahmen mit Eckfleurons; doppelte Stehkantenfileten, Innenkanten mit goldgeprägtem Mäanderband, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Dies ist eines von nur zwei bekannten Exemplaren mit einer zusätzlichen Suite der um ca. ein Drittel von 13,7 x 10,5 cm auf 18 x 13,5 cm vergrößerten Tafeln Martinis nach den Gemälden des Regenten in Original-Gouachen. Meisterhaft auf bestes Kalbspergament gemalt, wirkt jede Darstellung so monumental, als wäre sie selbst ein Gemälde. Darin dürfte auch die Intention des Illustrators gelegen haben: Der Regentensuite, die von Philippe d’Orléans unter der künstlerischen Ägide seines Lehrers Coypel ursprünglich als Gemäldezyklus zur Ausstattung von Schloß St. Cloud geschaffen worden war, auch in Form der Buchillustration möglichst viel von der Wirkung der herrscherlichen Ölgemälde zurückzuverleihen. Die satte, kräftige Farbigkeit der Deckfarben erreicht dieses Ziel durchaus, zudem gewinnen die Bilder gegenüber den graphischen Darstellungen durch ihre farbperspektivische Wirkung viel an Tiefe und Atmosphäre. Der Regentenzyklus erscheint dadurch, etwa siebzig Jahre nach seiner Entstehung, präsenter denn je, selbst wenn diese Darstellungen, was gerade bei den Landschaften ersichtlich wird, unverkennbar Kinder ihrer Zeit, des ausgehenden 18. Jahrhunderts, sind.
Nun enthält unser Exemplar, als eines der zwölf auf Pergament gedruckten Vorzugsexemplare mit den, wie wir annehmen dürfen, auf Veranlassung des Verlegers kolorierten Tafeln, den Zyklus auch in einer anderen Farbfassung, was geradezu wie eine Einladung zum Vergleichen wirkt. Man geht davon aus, daß die Tafeln Martinis zwölfmal auf Pergament abgezogen und von sogenannten Enlumineuses gouachiert wurden. Bekannt sind neben diesem noch das Exemplar Renouard, das sich auch in unserer Sammlung befindet (unsere Nummer LXI), gleichfalls unser Exemplar des Prinzen Galitzin, das auch die Petits pieds enthält (Nummer LX). Weiterhin befindet sich ein Exemplar in der
Bibliothèque nationale de France (Praet, Livres imprimés sur vélin, Bd. IV, S. 245, Nr. 370; hier sind zusätzlich die Exemplare des Duc d’Abrantès, verkauft 1816, und Mac-Carthy Reagh mit angeführt). Gleich vier Exemplare werden im Nachlaß des Druckers Lamy zitiert (vergleiche unsere Nummer LXI), und ein weiteres, das aus dem Besitz König Ludwigs XVIII . stammen soll (was einige Wahrscheinlichkeit besitzt, immerhin ist diese Ausgabe ja in der für ihn tätigen Druckerei erschienen) gelangte 2015 in den Handel. Bei dem Exemplar, das unter der Nummer 362 in der Bibliotheca Parisiana 1791 in London zum Verkauf kam, der exquisiten Sammlung des Generals Antoine Marie Paris d’Illins (1746–1809), muß es sich um ein besonders schönes gehandelt haben, gebunden in einem Derome-Einband mit Seidenvorsätzen (Bibliotheca Parisiana, London 1791, S. 77), möglicherweise handelte es sich hierbei um unsere Nummer LX , da nicht auszuschließen ist, daß Fürst Golofkin das Exemplar der Parisina erworben hatte. Hier wird in der Beschreibung deutlich, daß diese Pergamentexemplare in der Zeit als echte Preziosen gesehen worden sind, denen man höchste Wertschätzung entgegenbrachte: „A work unequalled for the beauty of its typographical execution on vellum. This copy was chosen leaf by leaf, as well as the drawings, from all that were done.“
Die zwölf Suiten auf Pergament wurden jedenfalls von verschiedenen Buchmalerinnen koloriert, denn auch im Vergleich zum Exemplar Martin sehen wir deutliche Unterschiede bei der Farbwahl, der Detailhaftigkeit und der künstlerischen Qualität; die Kolorierung der Tafeln in diesem Exemplar erreicht im unmittelbaren Vergleich nicht ganz das Niveau der Suiten bei Martin und Renouard. Vielleicht war das der Grund für den Erstbesitzer, eine weitere Suite in Auftrag zu geben – oder gar selbst anzufertigen – die alle anderen in Größe
und vielleicht auch Qualität übertreffen würde, in intensivem Kolorit und hoher Kunstfertigkeit ausgeführt. Wie dem auch sei – dieses Exemplar wurde dadurch zu einem der prächtigsten und außergewöhnlichsten in der Geschichte der gesamten Longus-Illustration. Zudem ist es ein interessantes Zeugnis der Sittengeschichte am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert: Hervorzuheben ist, daß in der großen Suite auf die Darstellung von Nacktheit weitgehend verzichtet worden ist. Vergleicht man die beiden Suiten, entdeckt man zahlreiche Unterschiede. So erhält Daphnis im Bade beispielsweise ein großes Tuch, um seinen Körper zu bedecken, und die entblößten Brüste der schlafenden Chloe verschwinden in der großen Darstellung unter einem züchtigen Kleid. In der Tafel 26 wurde sogar auf Daphnis selbst verzichtet. Die ihrem Geliebten nachträumende Chloe ist hier allein im Wald zu sehen, während Daphnis in der radierten Fassung immerhin hinter einem Baum hervorlugt. Auch darf er auf Tafel acht nicht mehr die badende Chloe betrachten, hier bleibt der Türbogen auf der linken Seite leer. Zu erkennen ist indessen, daß diese Stellen nachträglich verändert worden sind, jedoch in denselben Farben und in übereinstimmendem Pinselduktus, so daß man wohl von der Hand des ursprünglichen Miniaturisten ausgehen darf.
Bemerkt werden muss auch, daß drei Tafeln nur in der vergrößerten Variante vorliegen, von denen zumindest zwei ein heikles erotisches Sujet haben: Chloe im Bade, das Fest zu Ehren des Gottes Pan und Daphnis und Chloe, die hier zwar noch züchtig beieinander liegen, doch werden ihre Tiere bereits dabei gezeigt, was den beiden noch versagt ist. Da in der Radierung explizit ein kopulierendes Ziegenpaar dargestellt ist, wurde diese entfernt, während die Ziege in der großen Fassung alleine bleibt, die Übermalung ist auch hier deutlich zu

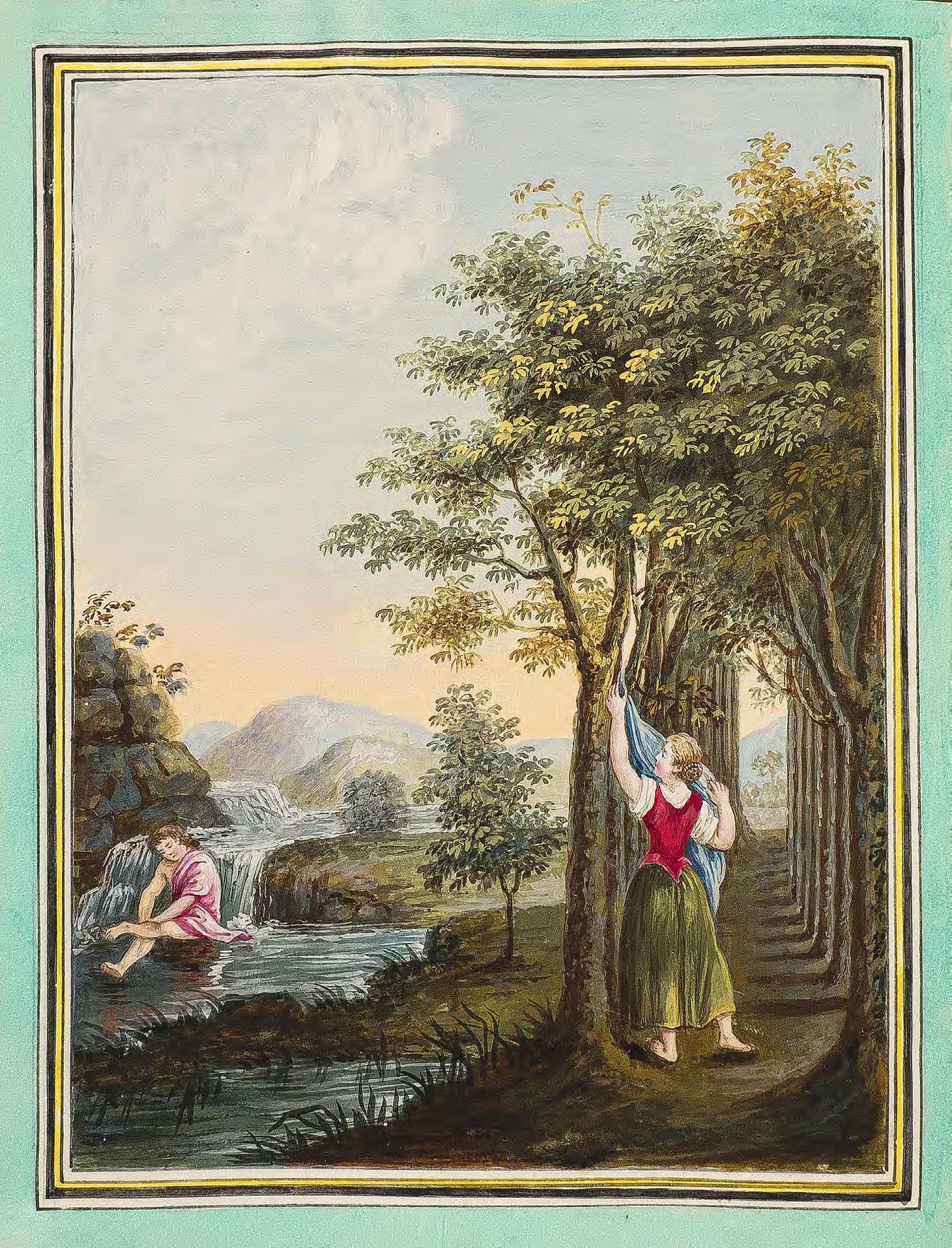
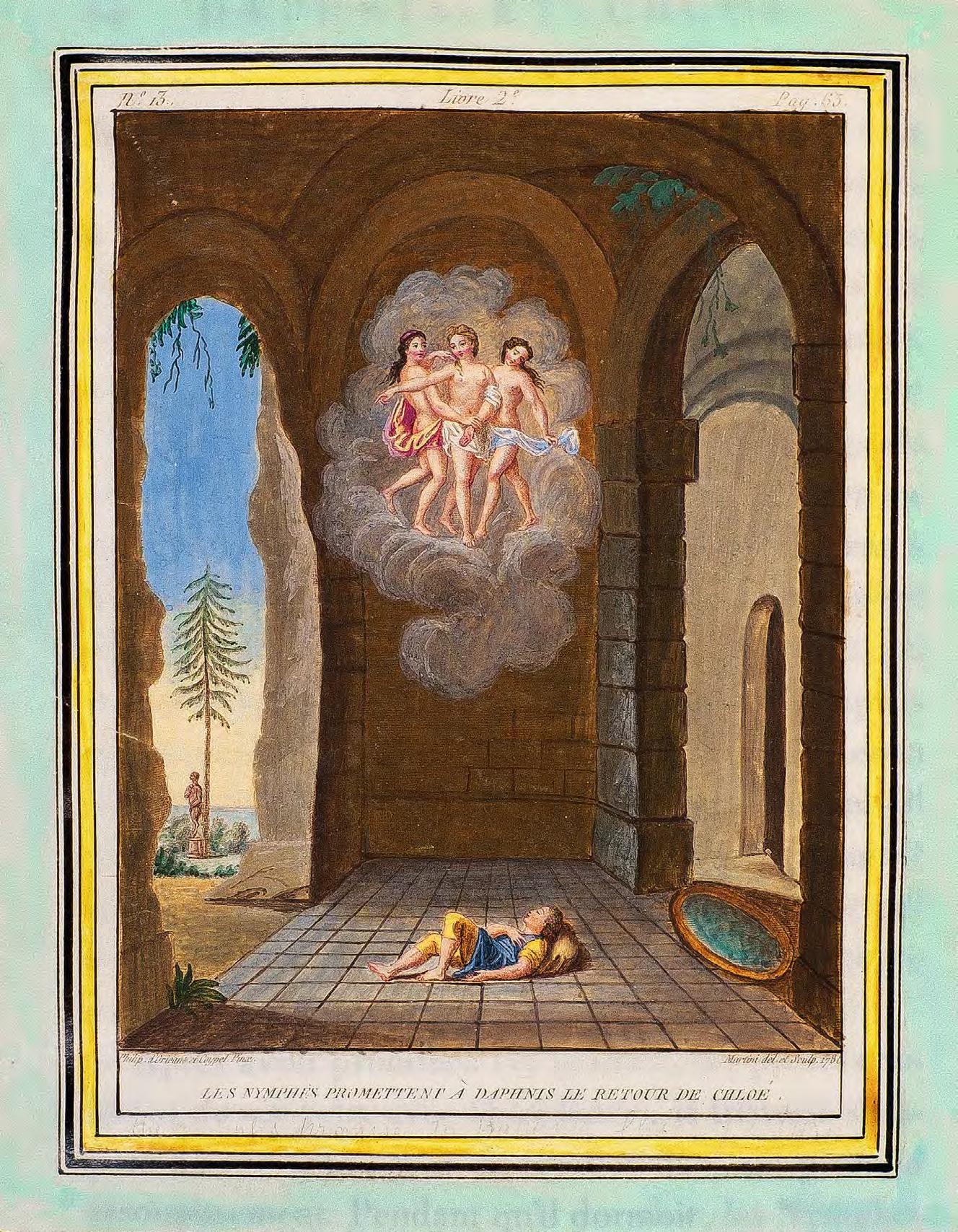
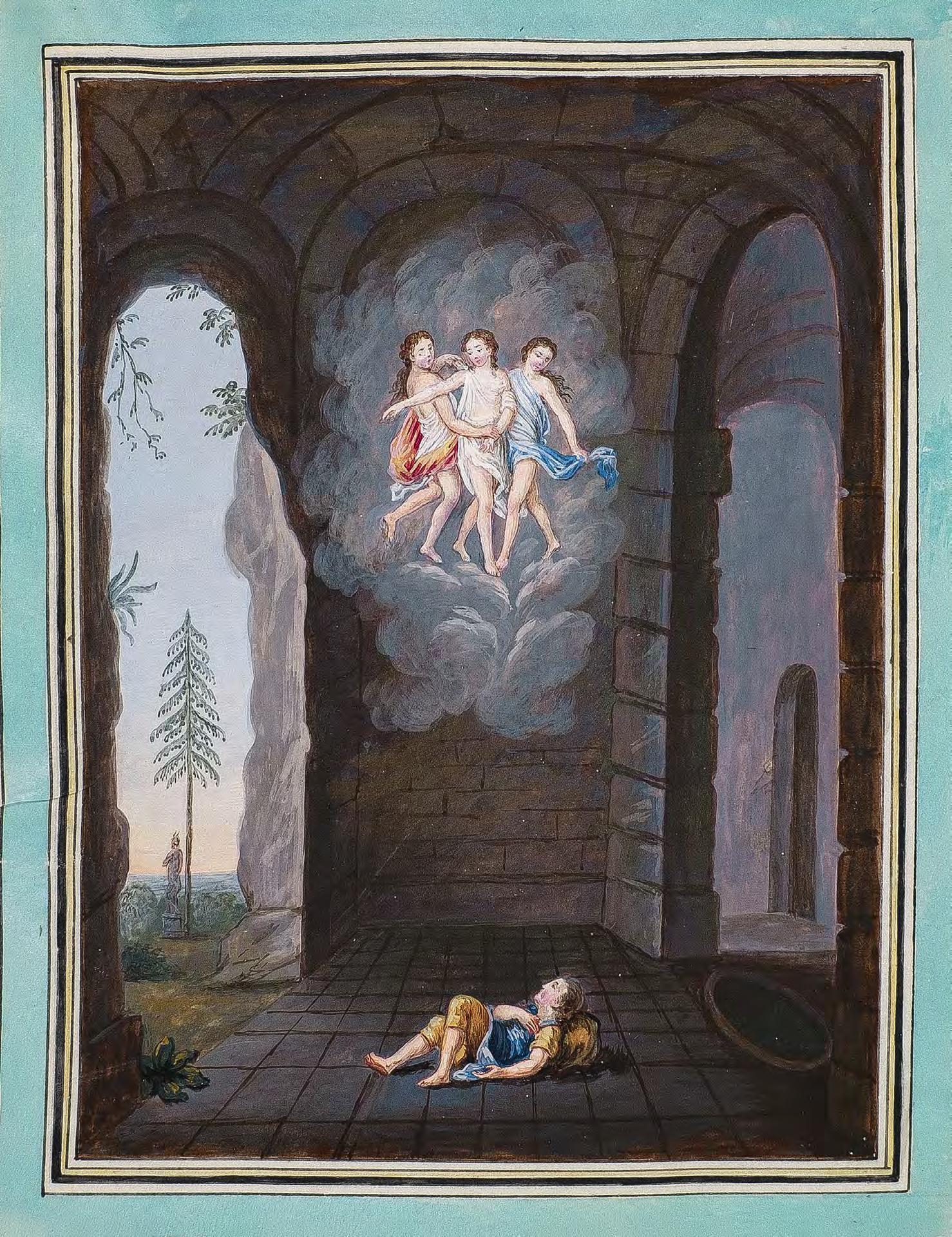
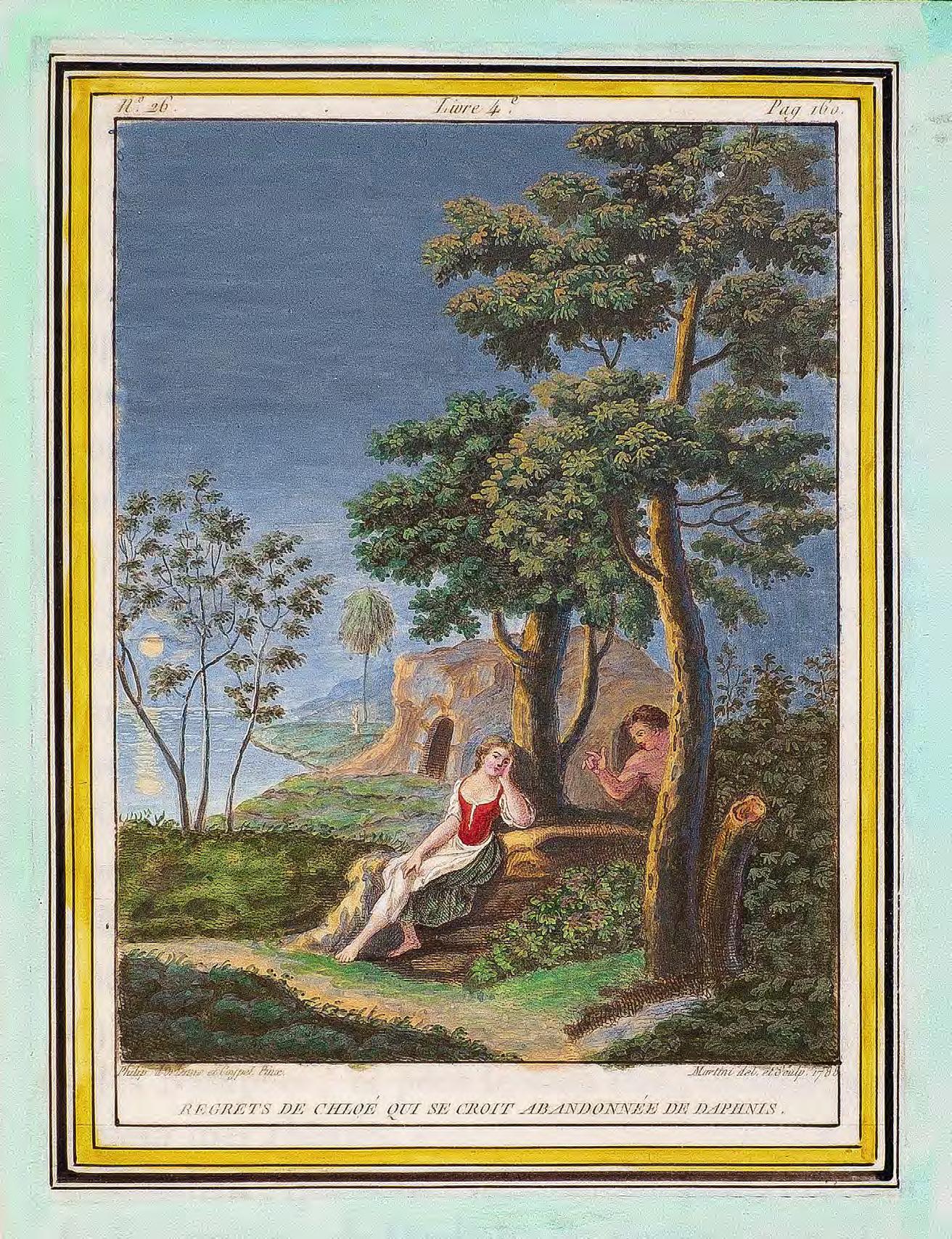

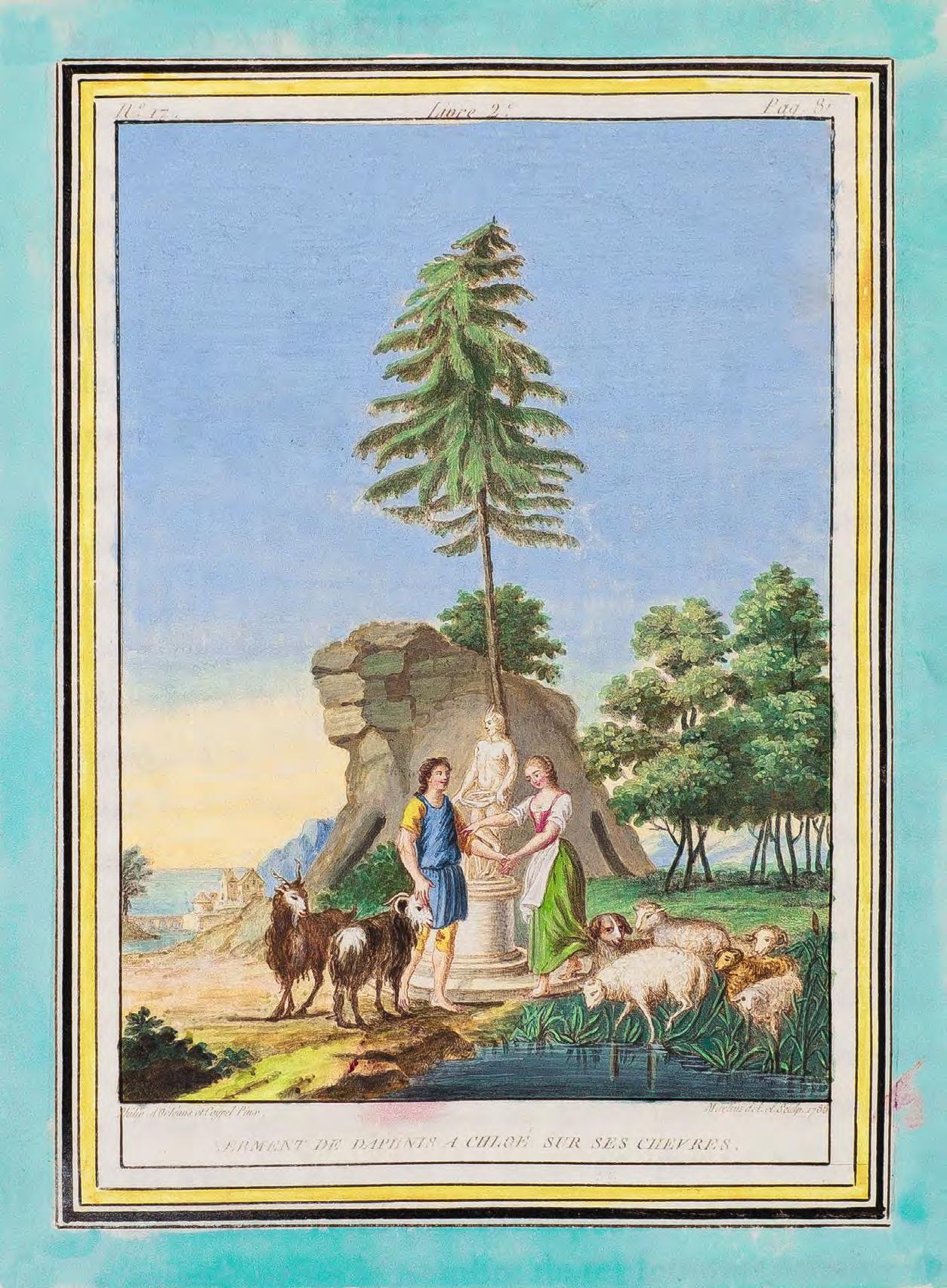

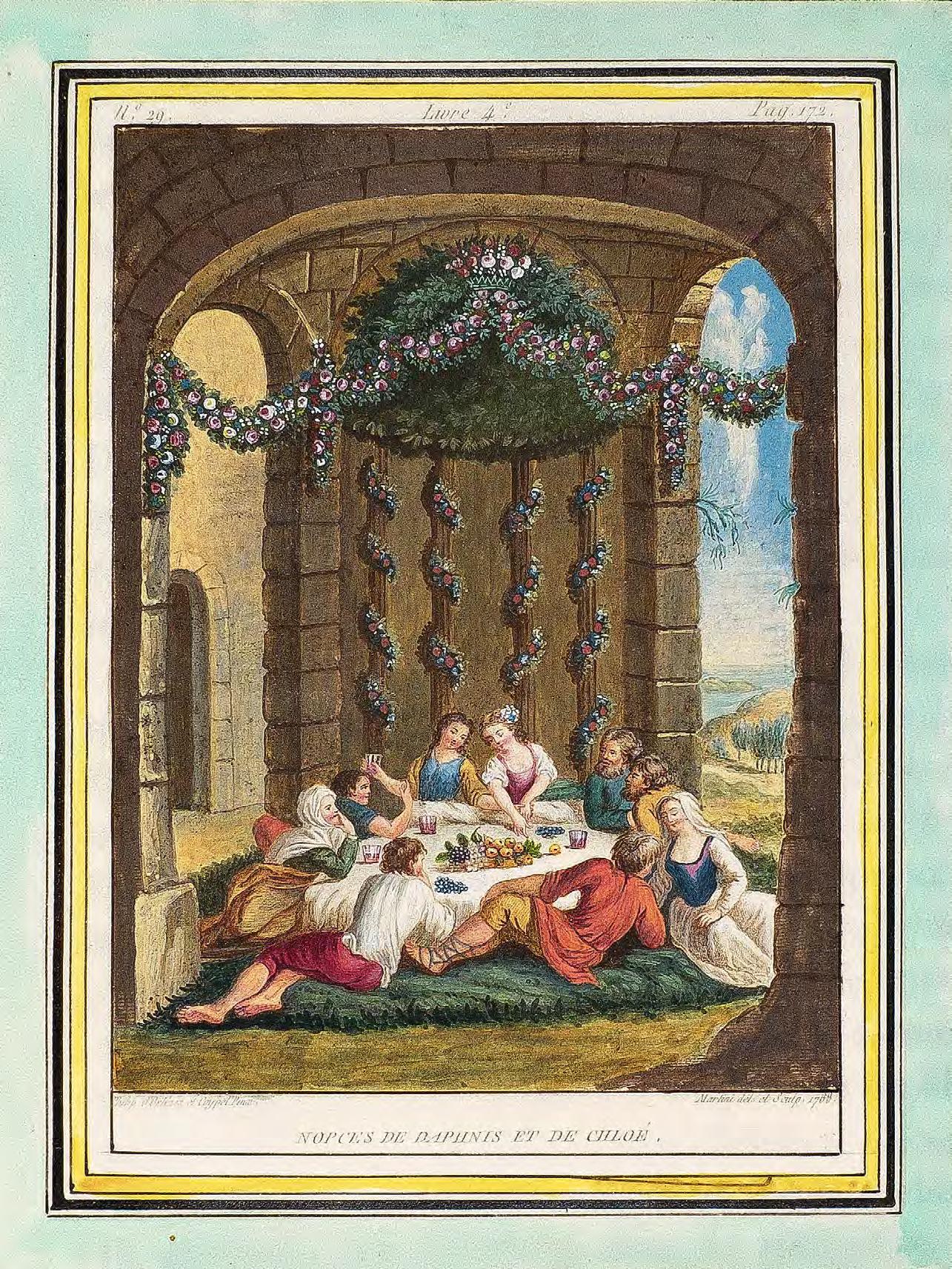
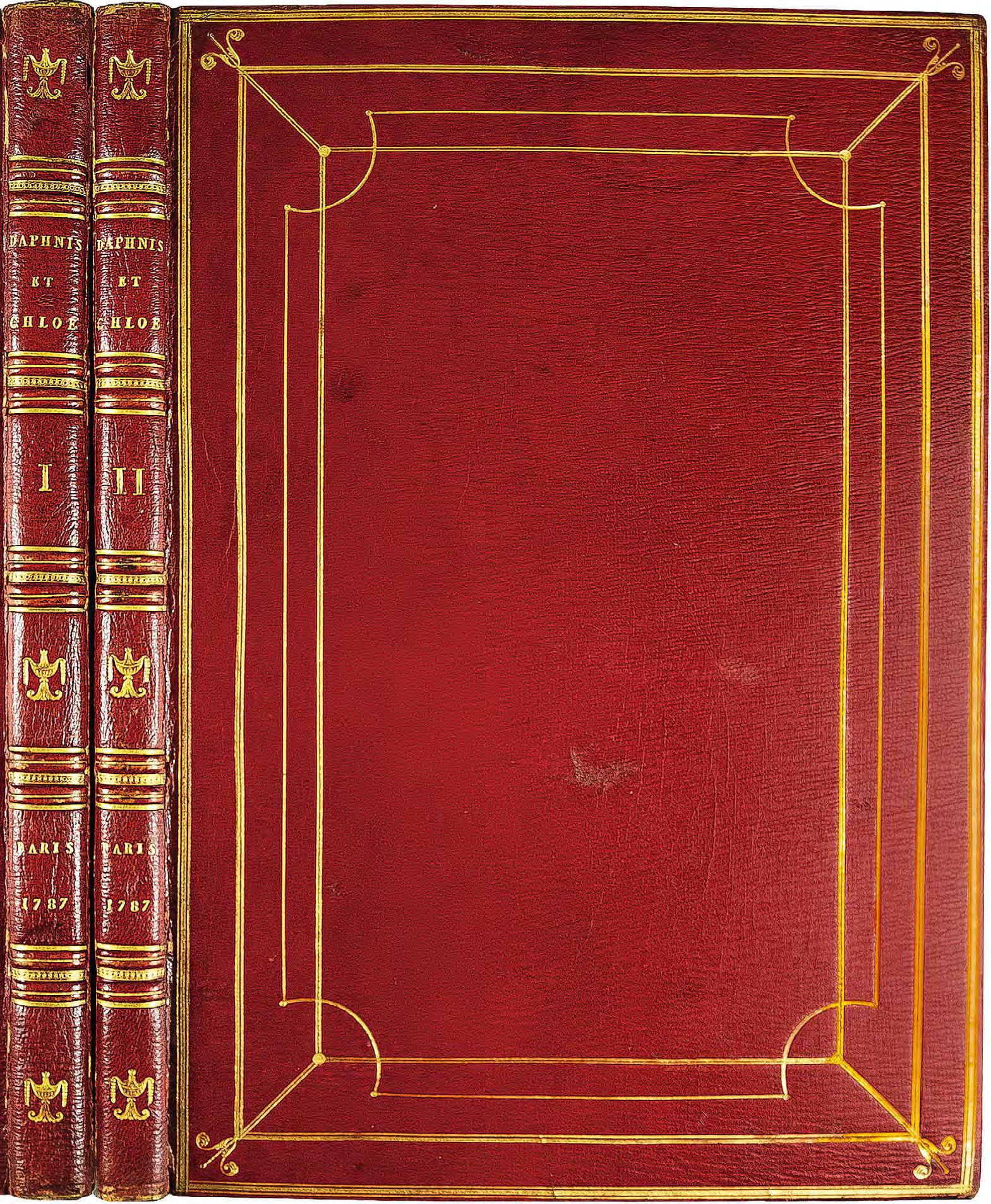
sehen – alles Anstößige wurde eliminiert. Und natürlich sind deshalb auch die Petits Pieds, die in dieser Ausgabe die Nummer 22 der Folge bilden, in beiden Suiten nicht enthalten; sie waren sicher einmal vorhanden, wurden aber entfernt, weil dies ein Auftraggeber oder Besitzer aus moralischen Gründen abgelehnt hat. Vermutlich waren sie bei den Seiten 142/143 eingebunden – und beim Entfernen der Tafel wurde leider das Textblatt gleich mit extrahiert (vielleicht sogar mit Absicht, um auch die anstößige Textpassage loszuwerden). Hier waren offensichtlich Besitzer am Werk, deren Moralvorstellungen recht rigide waren. Im Übrigen sind nur die Standardtafeln mit Legende, Seitenund Tafelnumerierung ausgestattet.
Der Druck auf starkem, strahlend weißen Pergament könnte schöner und breitrandiger nicht sein, zudem ist dieses Exemplar mit einer Höhe von 37,4 cm (Buchblock) bedeutend größer als alle anderen bekannten Exemplare dieser Ausgabe. Der untere weiße Rand ist über zehn Zentimeter breit, an Großzügigkeit ist dies kaum überbietbar, fast schon verschwenderisch zu nennen, angesichts dieses teuren Materials. – Die Blätter des ersten Bandes sind leicht gewellt und auf der letzten Seite im weißen Randbereich befindet sich ein größerer, aber unscheinbarer Fleck. Auf den Seiten 145 und 162 hat der Rahmen der gegenüberliegenden Tafel einen leichten Abklatsch hinterlassen, die Tafel 18 (Winterszene) weist in der großen Variante kleinere Farbausbrüche auf.
Provenienz: Der erste Besitzer unseres Exemplars dürfte der englische Forschungsreisende, Maler und Publizist James Forbes (1749–1819) gewesen sein. Sein gestochenes Wappenexlibris mit der Devise der aus Schottland stammenden Familie Forbes of Forbesfield, „Grace me Guide“, findet sich in der Mitte des vorderen Spiegels. Seine vierbändigen, nach eigenen Zeichnungen illustrierten „Oriental memoirs“ erschienen 1813 in London. Vergleicht man seinen Illustrationsstil für dieses Werk mit den Gouachen, so erscheint es durchaus möglich, daß er der Schöpfer des großen Zyklus’ in unserem Exemplar gewesen ist, wofür insbesondere die ausgezeichnete Landschaftsdarstellung in vielen der Tafeln spricht, allerdings auch gewisse Schwächen bei der Physiognomie der Figuren. Im Kopf des Dorcon auf Tafel V vermag man gar ein Selbstporträt von Forbes zu erkennen, vergleicht man ihn mit dem Porträt des Autors in den „Oriental memoirs“. Auch ist in dieser schottisch-protestantischen Familie eine merkliche Zurückhaltung bei der Darstellung von Nacktheit mit Sicherheit anzunehmen. Die Frage ist nur, ob der spätere Besitzer des Werkes hierin nicht noch strenger war – und ihm die Entfernung der „anstößigen“ Tafeln zugeschrieben werden muß: es ist dies der Enkel von James Forbes, Charles-Forbes-René, Comte de Montalembert (1810–1870), Politiker, Historiker, Gelehrter und von 1831 an Pair de France, zum Mitglied der Académie française ernannt 1851.
Charles de Montalembert gehörte dem liberalen Katholizismus in Frankreich an, zu dessen wichtigsten Theoretikern er zählt; er ist unter anderem der Verfasser von „Die Mönche des Abendlandes“. Aufgewachsen ist er im Hause seines Großvaters mütterlicherseits, besagtem James Forbes, bis zu dessen Tod im Jahre 1819 im Londoner Ortsteil Stanmore. Danach lebte er in Paris. Damit läßt sich der Weg unseres Exemplars aus dem späten 18. in das frühe 19. Jahrhundert verfolgen.
Ein weiteres, für uns aber nicht erschließbares Exlibris mit dem Monogramm „ MG “ aus der Zeit um 1900 wurde von der Pariser Graphik-Firma Agry hergestellt. Sein Motiv, die Eule über einem Buch mit der Devise „Oportet studuisse“, wurde später von der Biblioteca Sormani, der Stadtbibliothek von Mailand, übernommen, nachdem der Gewinner eines Design-Wettbewerbs 1905 dieses Exlibris offensichtlich als seine eigene Schöpfung ausgegeben hatte. Unser Exlibris ist aber nicht das viel gröber gezeichnete Mailänder (vgl. Gelli, Ex libris italiani, S. 304), das man nur als Abklatsch von diesem bezeichnen kann, sondern wohl dasjenige einer französischen Privatbibliothek – denkbar wäre ein Nachfahre des Charles de Montalembert, vielleicht sein Enkel, der Politiker Geoffroy de Montalembert (1850–1926).
Die imposanten, kräftig quergenarbten Maroquineinbände aus der Zeit um 1790/1800 sind insgesamt gut erhalten, mit nur kleinen Abriebstellen an den Gelenken und Deckeln.
Wiewohl man sich an den Stil Bozerians oder Lefèvres erinnert fühlt – deren Art zeigt sich insbesondere in der Verwendung von sich überschneidenden Fileten- und Segmentbogenformen sowie der einzeln stehenden Amphoren als Stempel der Rückenkompartimente – ist es, durch die Provenienz bedingt, doch denkbar, daß es sich hier um eine Arbeit eines englischen Buchbinders handelt. Sollte dies zutreffen, dann können die Einbände wohl als Werke des großen Londoner Buchbinders Roger Payne (1738–97), vielleicht auch als Arbeiten von Henry Walther identifiziert werden, die in eben dieser Art vergoldeten, sehr nah am stilistischen Repertoire ihrer gleichzeitigen Pariser Kollegen.
Trotz der starken Konkurrenz durch mehrere andere herausragende Exemplare das vielleicht schönste Exemplar dieser Ausgabe, zugleich ein interessantes Dokument der Sittengeschichte und von bester Provenienz.
Bibliographische Referenzen: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 655 (falsches Erscheinungsjahr: 1777). Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 319. Fürstenberg, Das französische Buch, S. 104. Portalis/Beraldi, Les graveurs, Bd. III , S. 30–34 (zu Martini). Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1159. Gay/Lemonnyer, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, Bd. I, Sp. 184 f. Ebert, ABL , 12245. Lewine, Illustrated books, S. 324. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 533.
Das von Cohen/De Ricci erwähnte
Exemplar Galitzin:
Auf Pergament, mit einer prachtvollen Suite aus vergrösserten Originalgouachen, ergänzt durch gouachierte Radierungen Martinis
LX [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduction nouvelle [von J.-F. DebureSaint Fauxbin], avec figures nouvellement dessinées sur les peintures de M. le Duc d’Orléans, Régent. 2 Bände. Paris, Imprimerie de Monsieur [= PierreFrançois Didot] für Lamy, 1787.
Mit 25 Original-Gouachen auf Pergament nach den Gemälden des Regenten, jeweils um ein Drittel vergrößert, und vier Radierungen von P.-A. Martini nach den Gemälden des Régent (datiert 1788), auf Pergament gedruckt, gouachiert und mit farbigen Rahmen versehen; zusammen die komplette Regentensuite, einschließlich der „Petits pieds“ genannten Darstellung nach dem Grafen Caylus, in zusammen 29 Tafeln.
VIII S., 1 Bl. (zwischengebunden), S. [1]-[82]; 1 Bl., S. [83]-175 (typographischer Titel, „AvantPropos“, hier nach dem Haupttitel a 1 eingebunden, „Préface“ und Haupttext, am Beginn von Band II, vor Seite 83, das Titelblatt zum zweiten Band außerhalb der Lagenzählung).
Kollation: a 1 *1 a 2–4 A-K4 L 1 ; π1L 2–4 M-Y 4
Gedruckt auf Pergament im Format Royal-Folio (364 x 263 mm).
In zwei rote Maroquineinbände der Zeit auf fünf doppelten unechten Bünden zu sechs Kompartimenten gebunden, das zweite und vierte Kompartiment mit dem goldgeprägten Titel und der Bandangabe in römischen Ziffern, die übrigen Kompartimente mit einer goldgeprägten Hirtenflöte und einer Blume im
Wechsel, Kapitale mit floralen Bordüren, die Deckel mit Mäanderbordüre, eingefaßt von Perlstäben, die sich an den Ecken kreuzen, die quadratischen Überschneidungsfelder mit je einer Rosette, im Zentrum ein Sonnenrad, die Mittelfelder der Deckel mit schwarzbraunem, leicht durchscheinendem Lack bemalt; Stehkantenvergoldung als Zickzackband mit kleinen Keilen, Innenkanten mit goldgeprägter Bordüre in der Form eines stilisierten dorischen Kymas, Vorsätze aus hellblauem Tabis, diese auf den Spiegeln mit vergoldeten Rahmenbordüren in Form eines Girlandenbandes mit Blüten und feinen Blättern, Ganzgoldschnitt, der Rücken des ersten Bandes signiert „Rel. P. Bozerian“.
Dies ist das zweite bekannte Exemplar mit den etwa um ein Drittel auf 18 x 13,5 cm vergrößerten Tafeln in Form gouachierter Miniaturen, komplett auf feinem Kalbspergament im Großfolioformat hergestellt. Im Gegensatz zur vorhergehenden Katalognummer liegt hier die komplette Suite als Zusammenstellung aus Gouachen und kolorierten Radierungen vor, beide in derselben Art von Einfassungen präsentiert, die den Eindruck gerahmter Gemälde vermitteln sollen. Die Miniaturen unseres Exemplars mögen bei der Figurendarstellung gewisse Schwächen, die vielleicht teils durch die Vorlagen bedingt sind, aufweisen – die Landschaften und gelegentlichen Interieurs der Gebäude sind allerdings erstklassig gemalt. Ihre besondere Qualität beruht auf der malerischen Atmosphäre, in der sich selbst feinste Nuancen von Lichtstimmungen verschiedener Tageszeiten ausdrücken, geradezu meisterlich gerät die Wiedergabe der Luftperspektive, die den Bildern unerhörte Tiefe und Räumlichkeit verleiht, in Verbindung mit dem sehr gekonnten, routinierten Aufbau der Bildebenen. Mittels detailreicher und feiner Wiedergabe der Objekte des Vordergrunds, vor allem der Pflanzen, Blumenbouquets, blühenden Wiesen, Bäumen

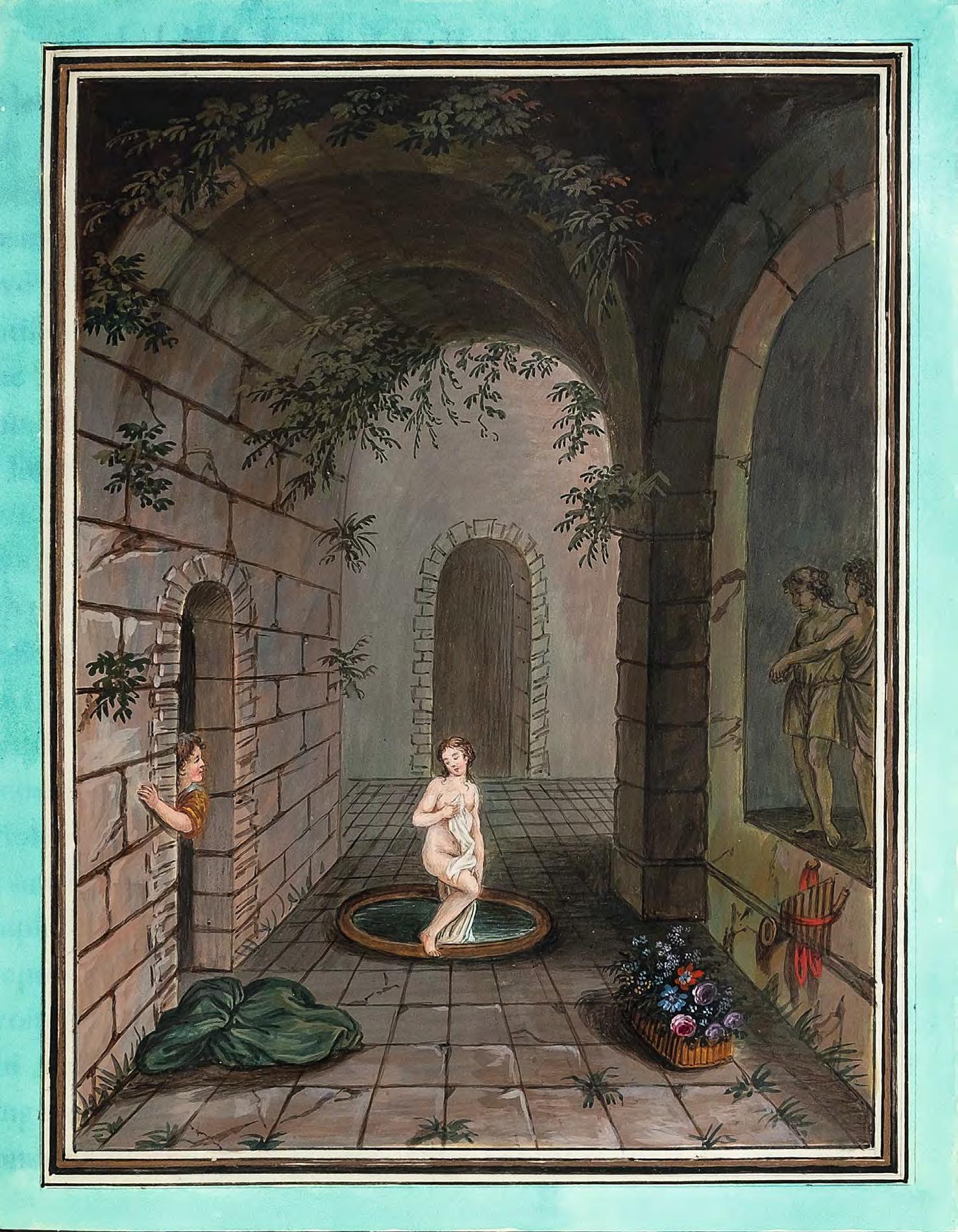
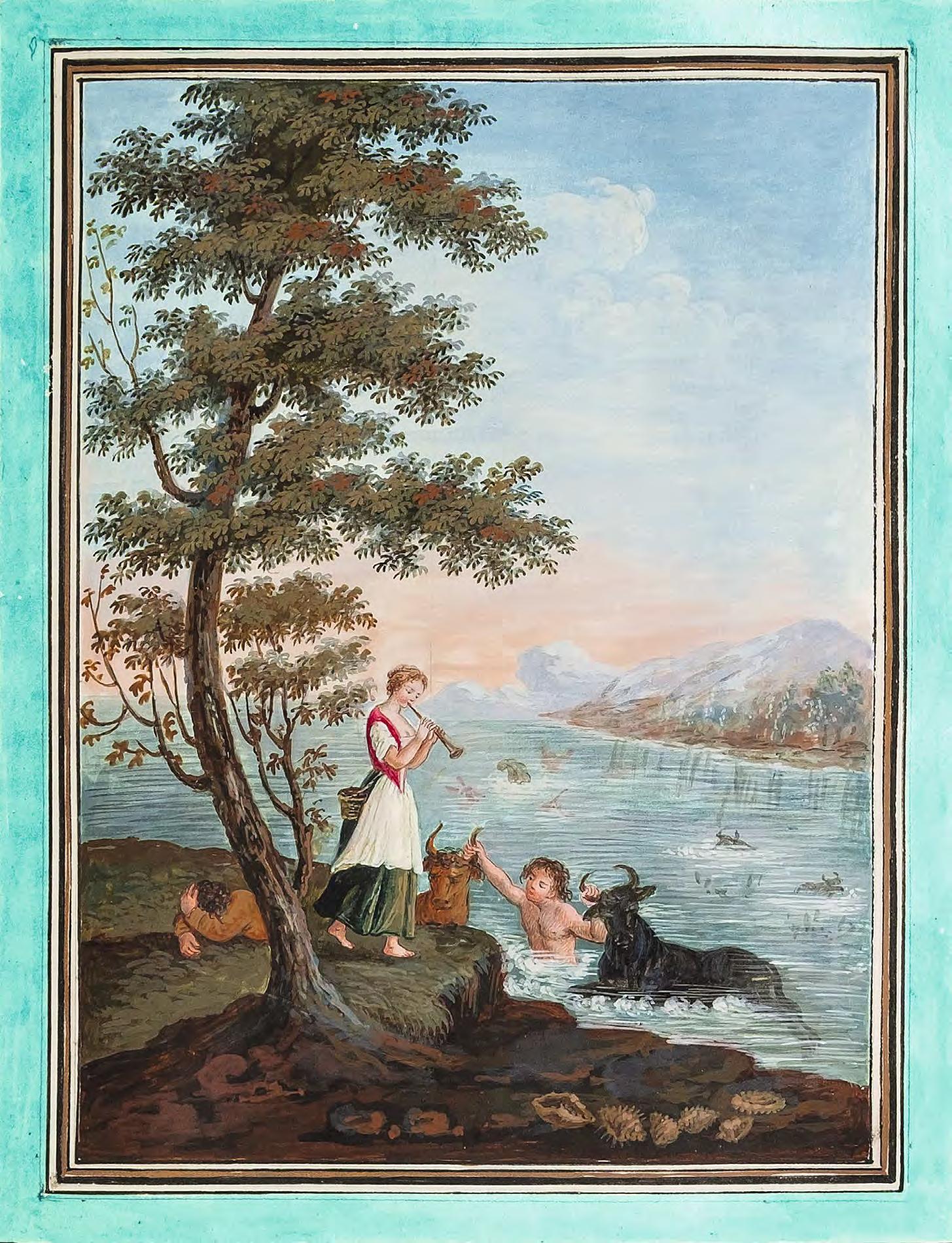

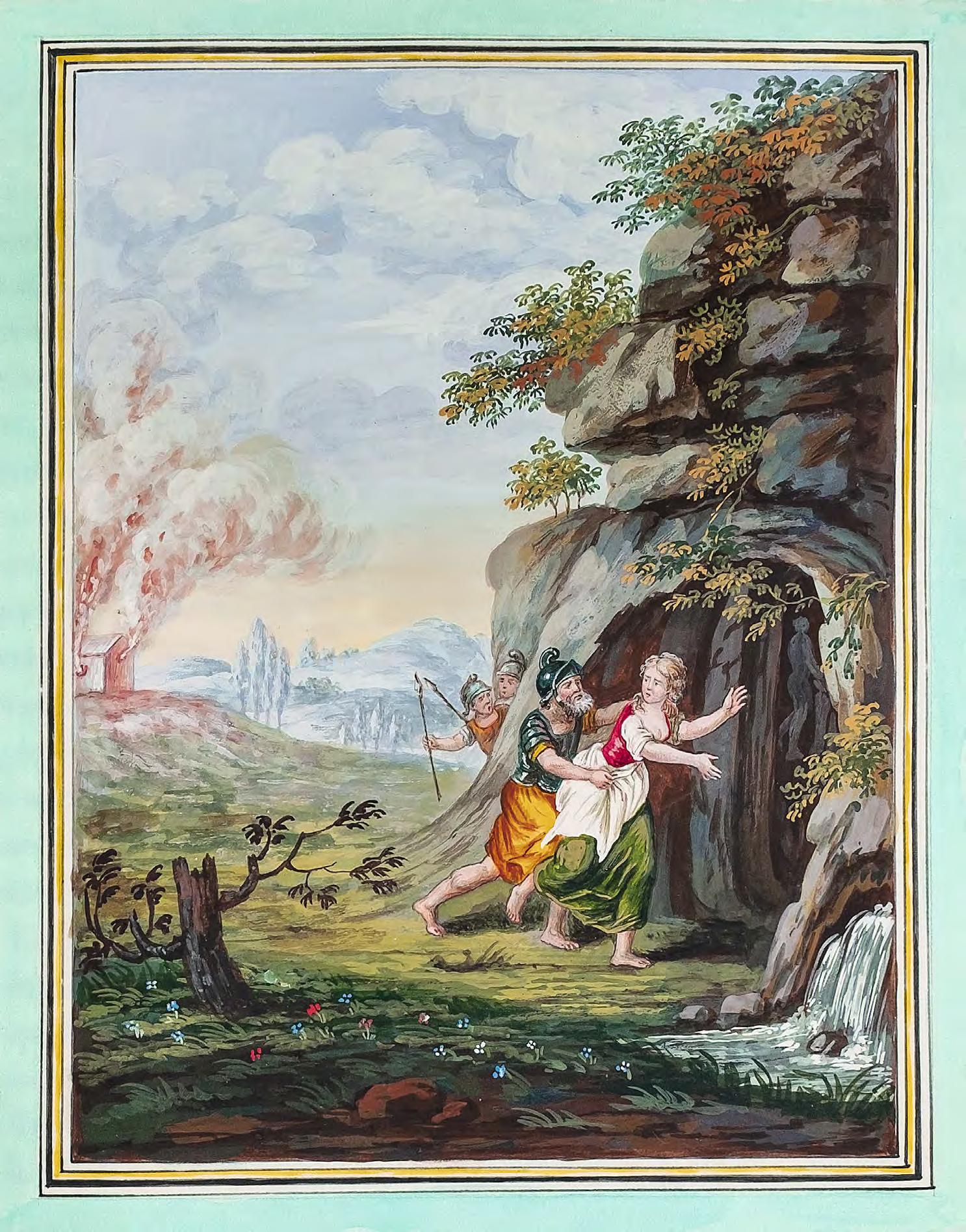

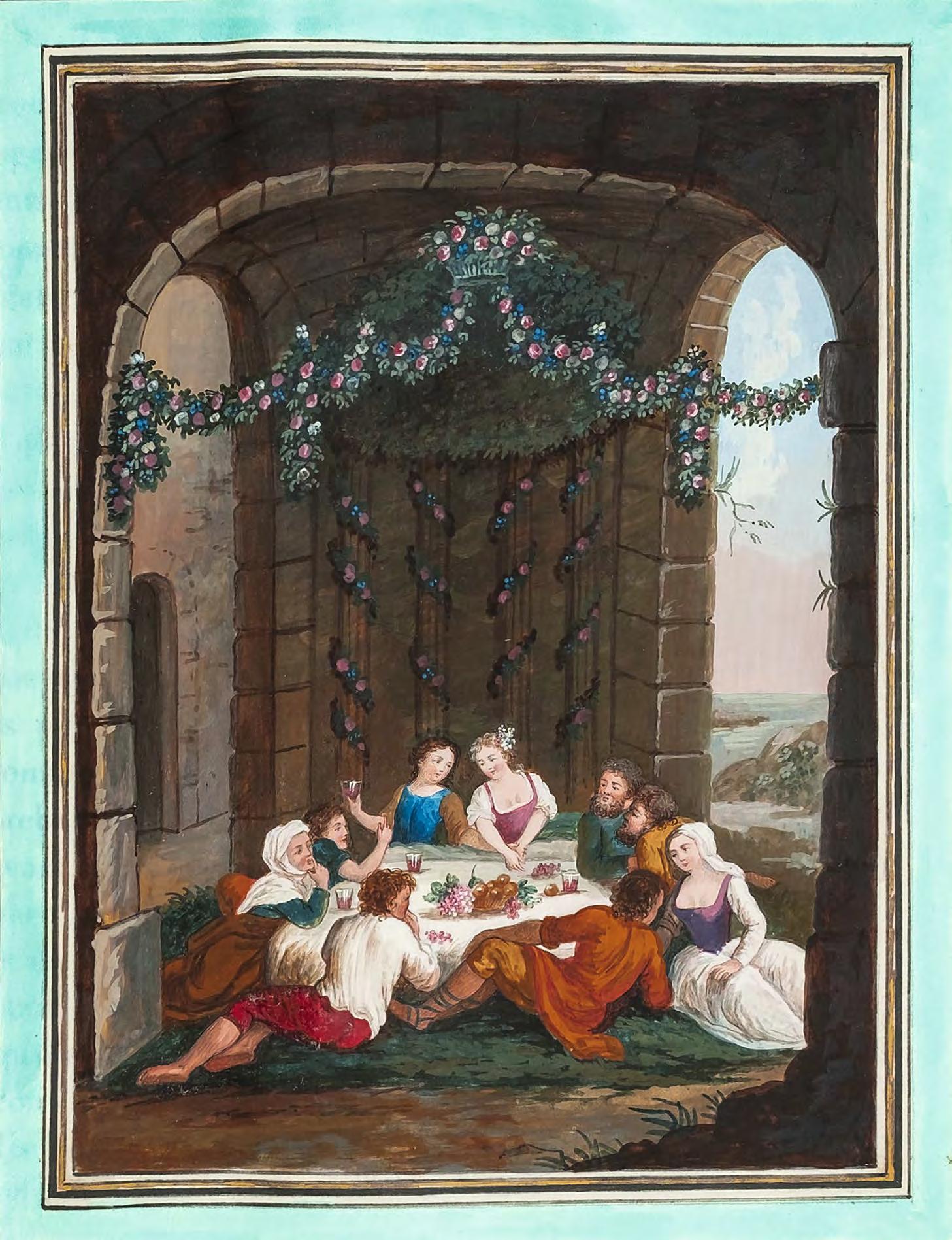
und Sträuchern, wird ein deutlicher Kontrast zu den oft dunstigen Mittel- und Hintergründen erzeugt, der eine starke Tiefenwirkung hervorruft. Die Farbkomposition ergibt einen satten, vollen Klang, wobei die Personen gewöhnlich wesentlich heller als ihre Umgebung gezeigt werden und dadurch hervorgehoben sind.
Nun ist dies auch bei anderen Exemplaren mit kolorierten Radierungen und Originalgouachen der Fall; was die Miniaturen in diesem Exemplar allerdings besonders auszeichnet, ist die nochmalige Steigerung der Kontrastwirkung durch eine differenzierte Verwendung von Blautönen in Verbindung mit Schattierungen durch Erdfarben. Der Hinzugewinn an Bildtiefe und Atmosphäre beruht nicht zuletzt auf dieser dunkel gestimmten Palette, die den meisten der Bilder eine Wirkung verleiht, wie man sie eher bei einem Ölgemälde erwarten würde, also durch lasierenden Farbauftrag. Das Bad der Chloe ist ein solches Beispiel, der Raum wird hier zu einem stimmungsvoll-düsteren Gewölbe, und die Grotte der Petits pieds scheint gar in eine frühromantische Küstenlandschaft eingebettet – ausgerechnet diese Rokoko-Caprice –im Fernblick zeigt sich hier das letzte Abendrot über dem dunstigen Meer, schöner hat man die altbekannte Darstellung niemals gesehen, oder auch der Traum der Chloe in einer vom Mond erhellten Szenerie, die trotz der vielen Blau- und Brauntöne gar nicht düster wirkt, sondern als Idyll, leicht melancholisch, doch voller Anmut.
Dieser Künstler war als Landschaftsmaler sogar noch versierter als derjenige unseres vorangehenden Exemplars Nummer LIX , der in dieser Disziplin ohnehin schon ein beachtliches Niveau erreicht hat. Eine Vielzahl kleiner, aber bedeutender Unterschiede erweist indessen, daß die beiden Suiten sicher nicht von einer Hand stammen können. Vergleicht man etwa den Schattenschlag der
drei Bäume im linken Mittelgrund beim Traum der Chloe, so fällt auf, daß der Miniaturmaler des Galitzin-Exemplars die Schatten gemäß der Lichteinstrahlung des Mondes radial fallen läßt, während sie in unserem ersten Exemplar in etwas diffuser Form parallel angeordnet sind, den Gesetzen der Optik widersprechend. Die übereinstimmende Form und Farbigkeit der Rahmen sowie die einheitliche Größe von Bildfeldern und Rahmen erweist jedoch, daß beide Maler nach denselben Vorgaben arbeiteten, allerdings mit gewisser Freiheit bei der Detaildarstellung und Farbwahl.
Diese beiden Pergamentexemplare mit ihren vergrößerten Gouachen markieren einen Gipfelpunkt im Nachleben des Regentenzyklus und dem Eifer, ihn in immer neuen, noch ansprechenderen, noch prachtvolleren Formen zu präsentieren. Mit dem vorliegenden Exemplar erreicht dieses Bemühen einen Zenith, der dann auch nicht mehr überboten werden wird; alles, was später noch nach der Suite von 1714/18 gefertigt werden wird, kommt über den faden Nachklang nicht hinaus und ist lediglich Wiederholung. Dem Werk des Regenten wird in diesen beiden Exemplaren quasi ein Denkmal gesetzt, und so war es von Didot und Lamy von vornherein sicherlich auch intendiert. Die Miniaturisten arbeiteten mit einiger Wahrscheinlichkeit direkt für die Verleger, vielleicht in Hinblick auf ausgewählte Auftraggeber oder zu beschenkende Persönlichkeiten. Aber warum stellte man dann keinen ganzen Zyklus in Miniaturmalerei her, warum sind die Tafeln zu den Seiten 94, 102, 106 und 146 als kolorierte Radierungen eingebunden? Als Ersatz für fehlende Teile eines ursprünglichen Ganzen sind sie kaum anzunehmen, vielmehr dürften diese vier Tafeln mit Absicht in den Zyklus integriert worden sein, hatte man doch mittels der Radierungen Martinis schon die Farbigkeit der Originalgemälde ins Buch übertragen,

sozusagen das olympische Feuer an der einen authentischen Flamme entzündet, um es dann zu vervielfältigen – man vergleiche unsere Nummer LXI – und das dokumentieren auch die vier stark deckend kolorierten Tafeln in diesem Exemplar, die in ihrer Erscheinung und Farbwirkung den Miniaturen nicht nachstehen, nur ist ihre Palette in helleren Tönen gehalten. Vielleicht verstehen sich diese vier radierten Tafeln als besondere Reverenz an den ebenfalls druckgraphischen Regentenzyklus, worauf man nicht ganz verzichten wollte.
Damit bleibt unsere Katalognummer LIX allerdings das einzige Exemplar mit allen 28 gegenüber den Radierungen vergrößerten Gouachen, also dem gesamten Regentenzyklus, jedoch ohne seine anstößige spätere Ergänzung, die hier, bei Galitzin, wiederum vorhanden ist. Die Provenienz aus zwei erstrangigen Sammlungen russischer Adeliger der Zeit um 1800, die nur Besonderes, Luxuriöses enthielten, erweist die hohe Wertschätzung, mit der diesen Exemplaren in der Zeit begegnet worden war.
Die ganz aus dem dokumentierten Formenrepertoire von Bozerian geschaffenen prachtvollen Meistereinbände sind im griechischen Stil gehalten.
Ihre Erscheinung wurde nicht ursprünglich , wohl anfangs des 19. Jahrhunderts, durch das dunkle Lackieren der Deckel verändert, was durchaus zu ihrem Charakter paßt, doch war für die Dekkel ursprünglich der Farbton hellroten Maroquins bestimmend, gerahmt von einer breiten dekorativen Bordüre im griechischen Stil. Die einzelnen Formen können nahezu alle in Culots BozerianMonographie nachgewiesen werden, die Mäanderbordüre der Deckel (Roulette 22) mit Perlstab (Roulette 14) und Sonnenrad (Fers seuls 14), die Signatur des Rückens (Signatures 1), die Kapitalbordüren (Palettes 11 und 12), die Innenkantenvergoldung (Roulette 18), selbst die Bordüre auf
den Seidenvorsätzen (Roulette 41); insgesamt ist die Deckelgestaltung sehr ähnlich dem Einband einer bei Didot 1785 gedruckten lateinischen Bibel (Cat. 10).
Das Exemplar ist im zweiten Privatkatalog des Prinzen Michel Petrovich Galitzin (auch Golitsyn, 1764 – ca. 1835) verzeichnet, (Cabinet Galitzin, Moskau 1820, S. 59). Schon im Vorwort heißt es dort, dieser Katalog enthalte „exemplaires uniques et sur vélin des belles et correctes éditions de Didot, et quelques uns des ces exemplaires sont enrichis de dessins originaux de Gérard, Chaudet etc.“ (S. II).
Diese Sammlung, berühmt insbesondere für ihre prachtvollen Handschriften des Spätmittelalters, wurde bereits im März 1825 bei Dufart in Paris versteigert, also noch zu Lebzeiten des Prinzen (Catalogue Galitzin 1825), unser Exemplar unter der Nummer 107: „Exemplaire imprimé sur vélin, décoré de 29 miniatures ajoutées“, der erzielte Preis waren 505 Francs, der Einband wurde fälschlich als Arbeit Deromes bezeichnet. Es dürfte sich um dasselbe Exemplar handeln, welches 1798 schon im Katalog des Grafen Golowkin auftauchte (Catalogue Golowkin 1798, Nr. 375), auch entspricht es der Beschreibung im Paris d’Illins-Katalog von 1791. Diese Moskauer Sammlung war ebenfalls eine legendäre Adelsbibliothek von hohem Rang, in der sich viele unikale Exemplare befanden. Der Einband ist hier mit „Bradel“ angegeben, was aber nicht viel besagt, das Exemplar an sich ist nach seiner Illustration beschrieben, „Imprimé sur vélin, avec 29 miniatures d’après Coypel“; sicherlich handelt es sich um unseres. Nach 1825 verliert sich die Spur bis ins 20. Jahrhundert. In der Ausstellung „Dix Siècles de Livres Français“, die in Luzern im Musée des Beaux-Arts im Jahre 1949 stattfand, wurde das Exemplar der Öffentlichkeit präsentiert (Nr. 189, das Etikett auf dem fliegenden Vorsatz des ersten Bandes). Aus französischem Privatbesitz erworben.

Vorsätze und Titelseiten beider Bände ein wenig gebräunt, die Rückseiten der jeweils letzten Blätter etwas stärker, sonst makellos erhalten und sehr sauber, die durch Serpentes aus feinstem Bütten geschützten Miniaturen, von winzigen Bereibungen abgesehen, in einwandfreier Erhaltung.
Ein Meisterwerk der französischen Buchkunst des späten 18. Jahrhunderts mit berückenden OriginalGouachen in größerem Format.
Literatur: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 655 (Erwähnung unseres Exemplars). –Bibliographie unter unserer Nummer LIX).
Ad Fontes:
Das Renouard-Gancia-BoisrouvrayExemplar mit dem gouachierten Regentenzyklus
auf Pergament, mit allen Originalzeichnungen Martinis und im Intarsieneinband von Lortic
LXI [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduction nouvelle [von J.-F. Debure-Saint Fauxbin], avec figures nouvellement dessinées sur les peintures de M. le Duc d’Orléans, Régent. Zwei Teile in einem Band. Paris, Imprimerie de Monsieur [= Pierre-François Didot] für Lamy, 1787.
Mit 29 originalen Federzeichnungen in brauner Tusche auf Pergament von P.-A. Martini und den danach gefertigten 29 Radierungen, auf Pergament gedruckt und gouachiert nach den Gemälden des Regenten, alle 58 Blätter doppelt gerahmt in Rot und mit starkem Papier angerändert, um auf das Folioformat des Drucks zu kommen.
VIII S., 1 Bl. (zwischengebunden), Seite [1][82]; 1 Bl., Seite [83]-175 (typographischer Titel, „Avant-Propos“, nach dem Haupttitel (a 1) eingebunden, „Préface“ und Haupttext, am Beginn von Teil II (zwischen den Seiten 82 und 83) Titelblatt zum zweiten Band außerhalb der Lagenzählung.
Kollation: a 1 *1 a 2–4 A-K4 L 1 π 1 L 2–4 M-Y 4
Auf Pergament im Format Royal-Folio gedruckt (368 x 267 mm).
Zitronenfarbener Maroquineinband um 1860 auf fünf Bünden mit reichstem Renaissance-Dekor auf dem Rücken, in Linien- und Stempelvergoldung, dazu Maroquin-Intarsien à la fanfare in Rot mit floraler Vergoldung und in Grün (Bourbonlilien), Deckel mit schmalen Intarsien aus rotem Maroquin als doppelte Rahmung, eingefaßt von Fileten, an den Ecken große Fleurons in Pointillé-Vergoldung;
Stehkantenvergoldung, Doublüren in dunkelgrünem Maroquin mit üppigster, äußerst feiner DentelleVergoldung aus Einzelstempeln, in den vier Ecken eingelegt rote Maroquin-Ovale mit Rosenstempeln, Maroquinfalze, dreifache Marmormapier-Vorsätze, Ganzgoldschnitt, signiert Lortic; in Steckschuber.
Dies ist das bedeutendste unter den unikalen Exemplaren der Ausgabe von 1787, vielleicht sogar unter allen Longus-Ausgaben des 18. Jahrhunderts: Ganz auf bestes Kalbspergament in großem Folioformat gedruckt und ausgestattet mit den 29 Originalvorzeichnungen des Pierre-Antoine Martini, dazu weiteren 29, gleich Originalen gouachierten Radierungen nach den Gemälden des Régent. Gebunden in einen Intarsieneinband von Lortic, der seinesgleichen sucht und der in der Vergoldung der Spiegel, die als ein Hauptwerk des großen Buchbinders gesehen werden müssen, kulminiert. Seinem bibliophilen Rang entspricht die Provenienz: nacheinander war es in den Bibliotheken Antoine-Augustin Renouard, des Duc de Chartres und des Comte Guy de Jacquelot du Boisrouvray.
Selbst für das prachtliebende 18. Jahrhundert stellt dieses Buch ein Summum dar, in der Vereinigung nobelsten Materials, des Ausnahme-Formats und aller Originalzeichnungen, die der Illustration als Vorlage dienten, dazu einer unikalen Suite von überaus fein gouachierten Radierungen, die sich sehr deutlich von den elf anderen Sets der kolorierten Radierungen auf Pergament unterscheiden, wie dies ein Zeitzeuge, der große Pariser Bibliophile, Verleger und Händler Antoine-Augustin Renouard (1765–1853), der erste Besitzer des Bandes, in seinem Katalog von 1819 belegt: „ Pour cette édition exécutée avec grand appareil, Lamy fit copier au trait et en in-4. les gravures dites du Régent, afin d’en faire peindre des épreuves pour douze exemplaires qu’il imprima sur vélin: et il vendit fort
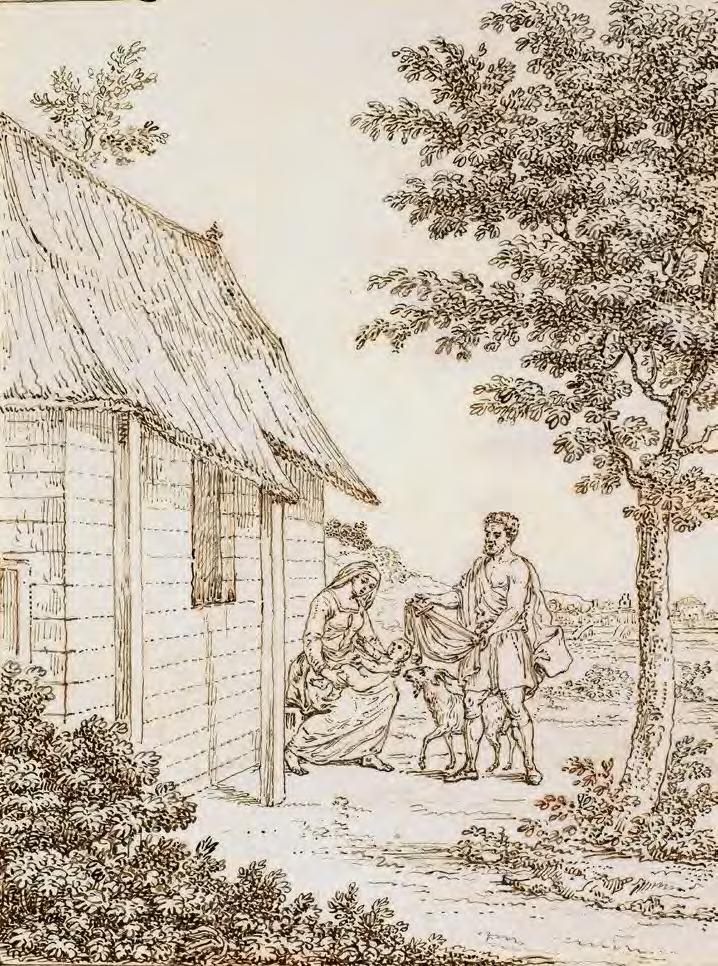
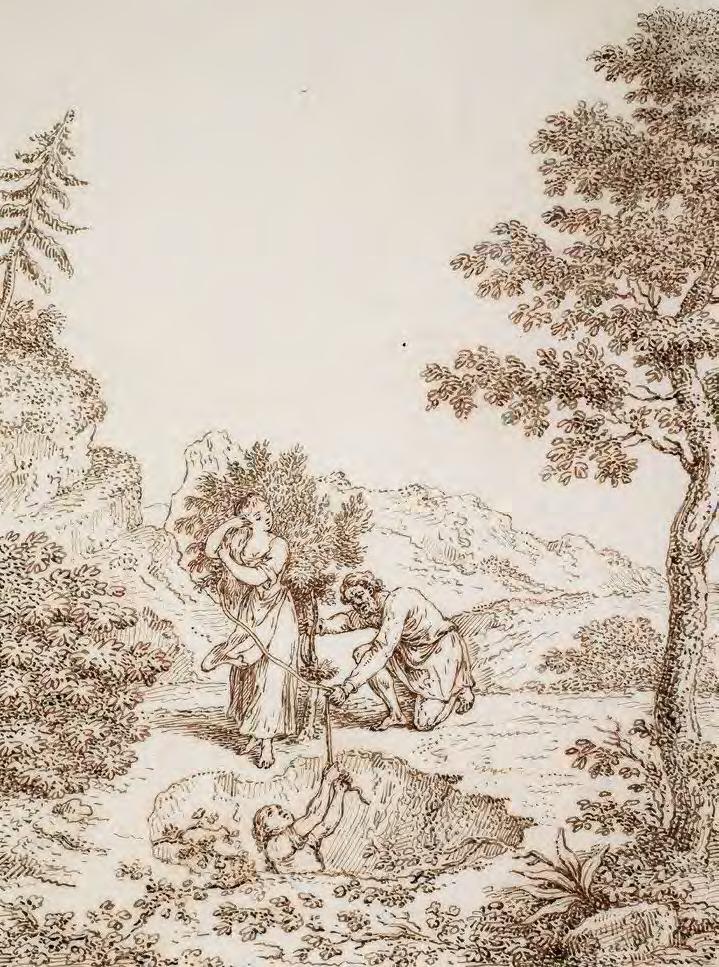

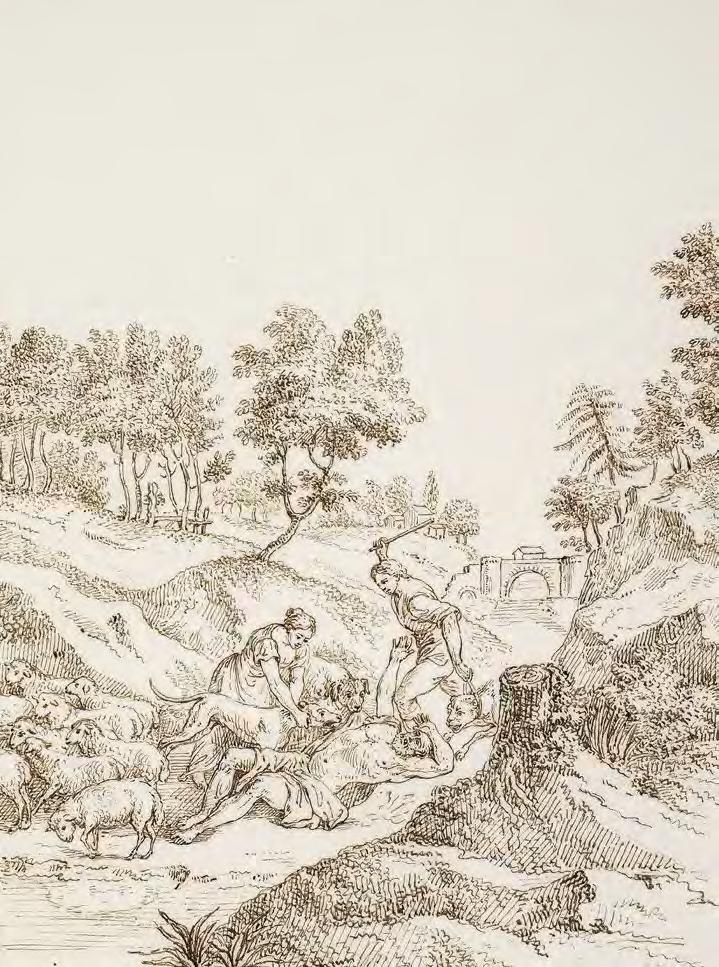
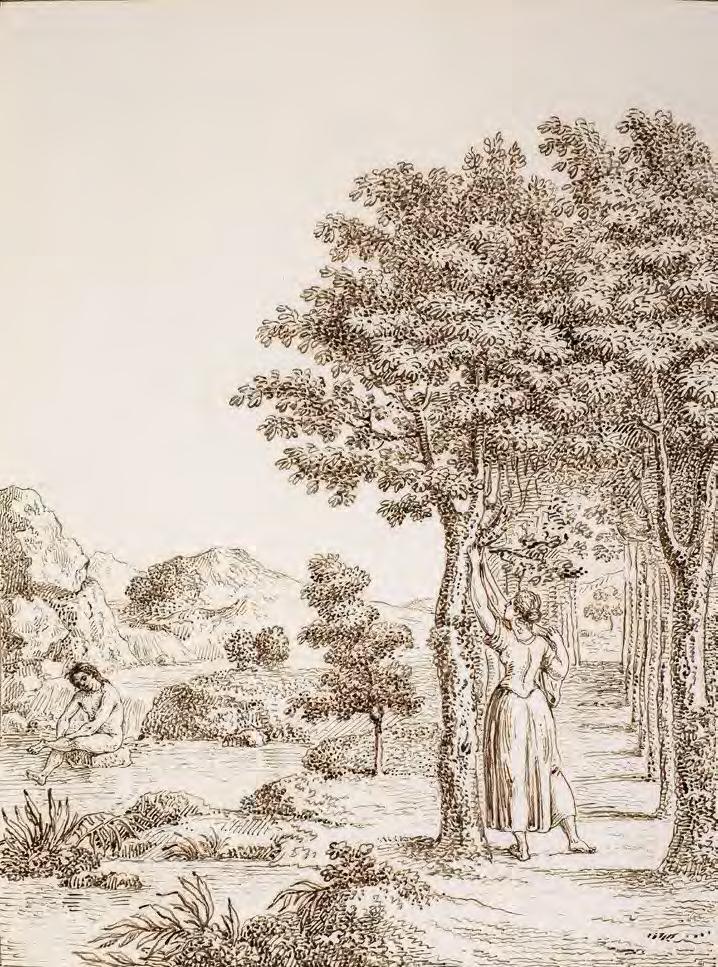
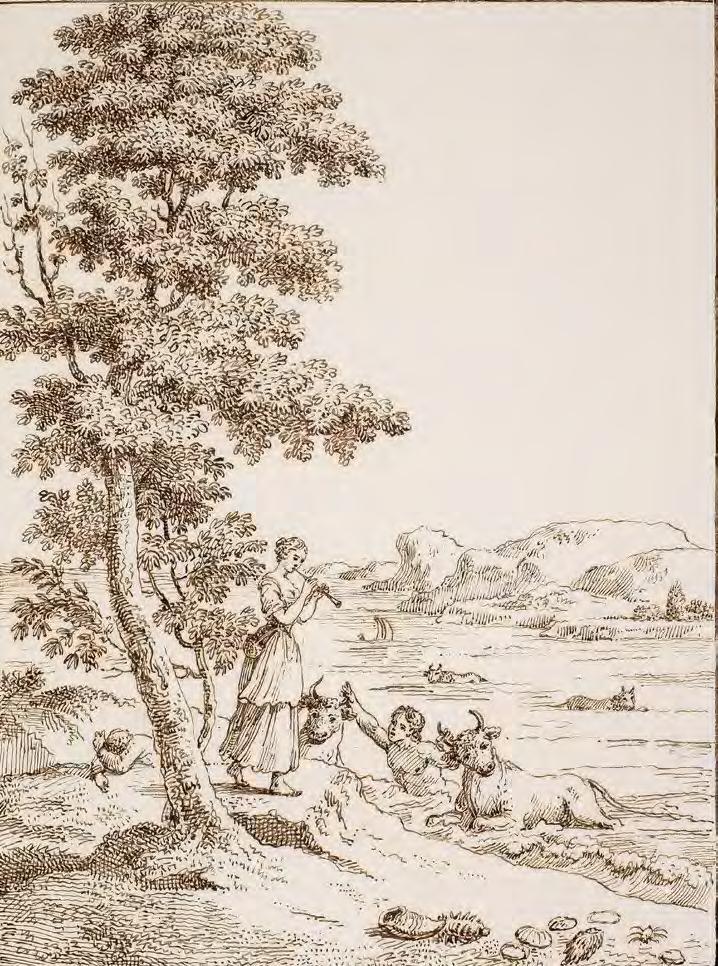
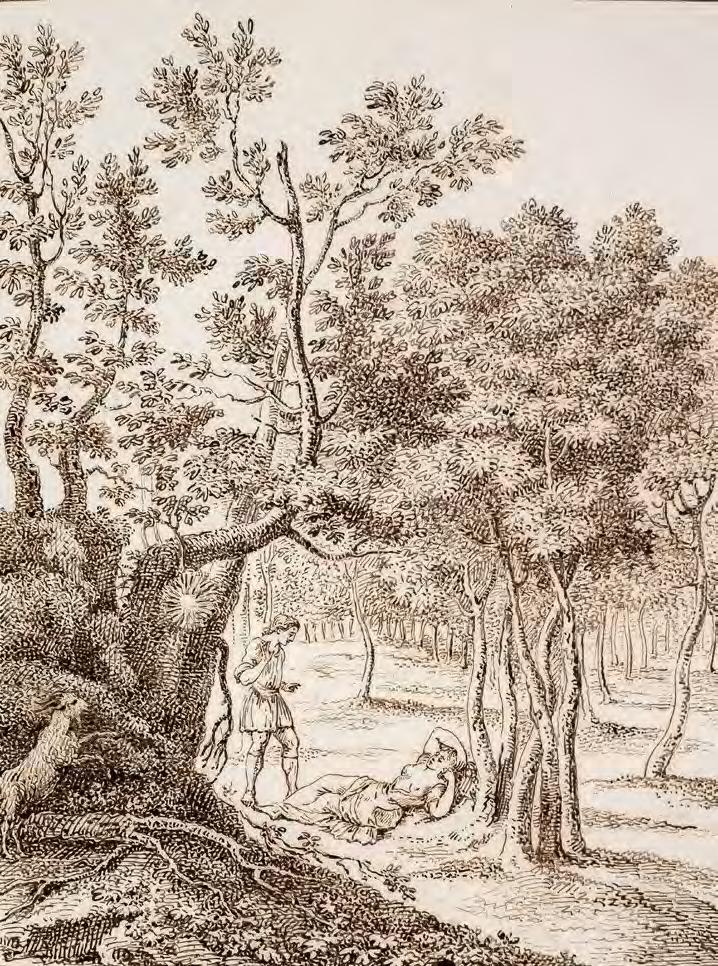
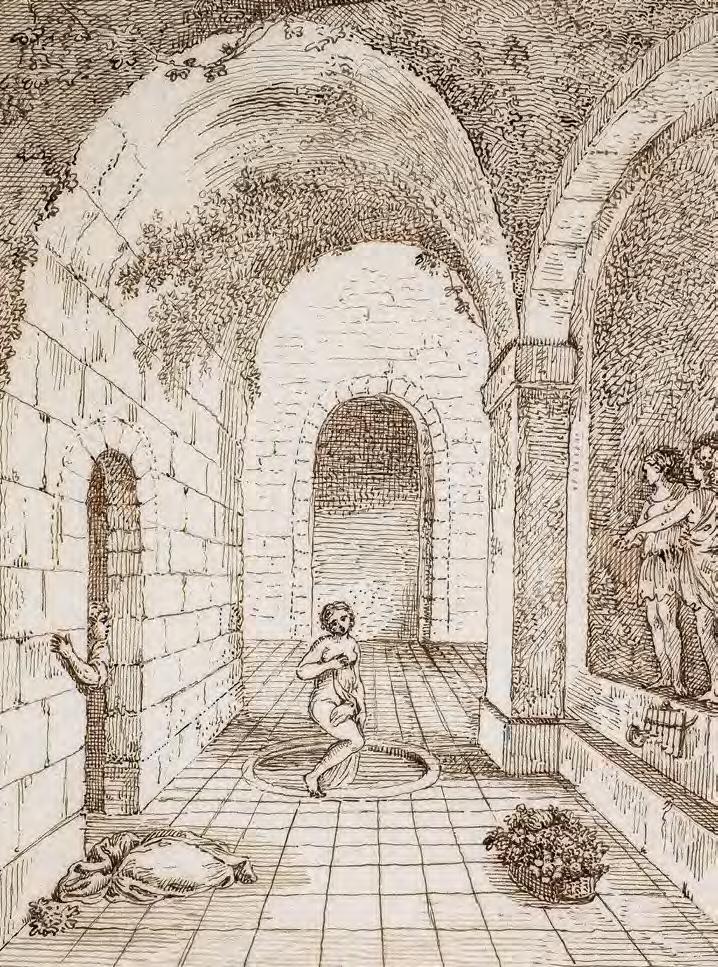
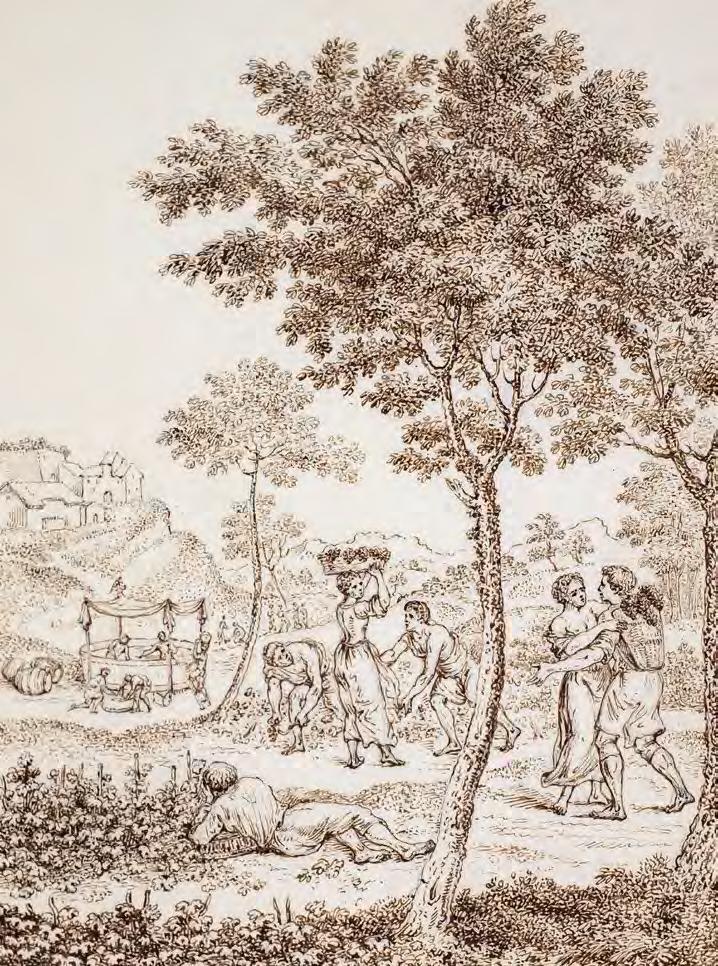

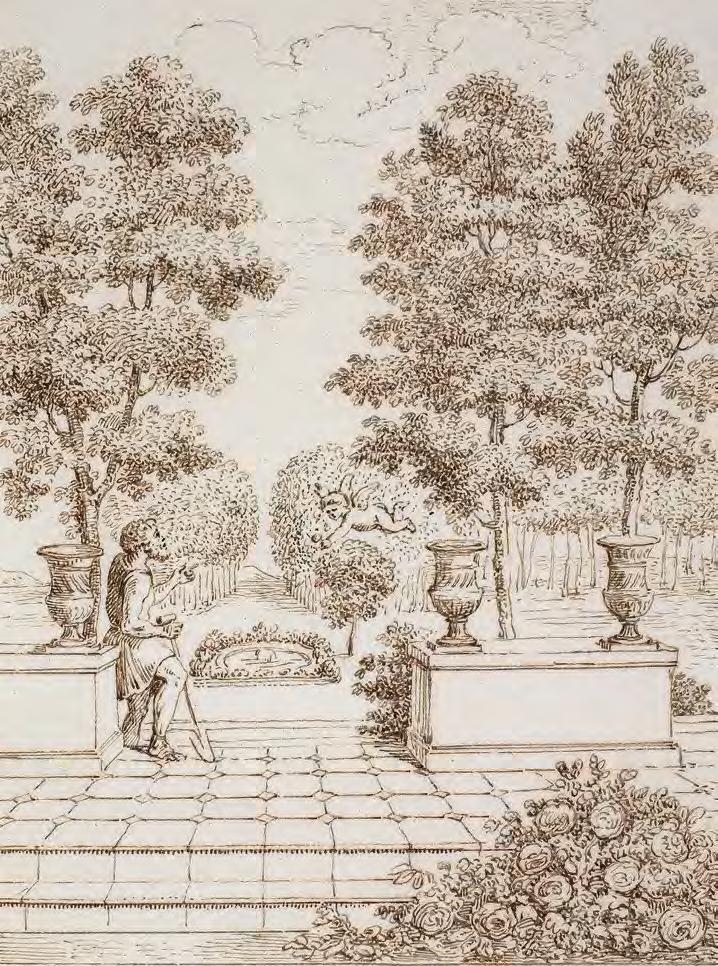

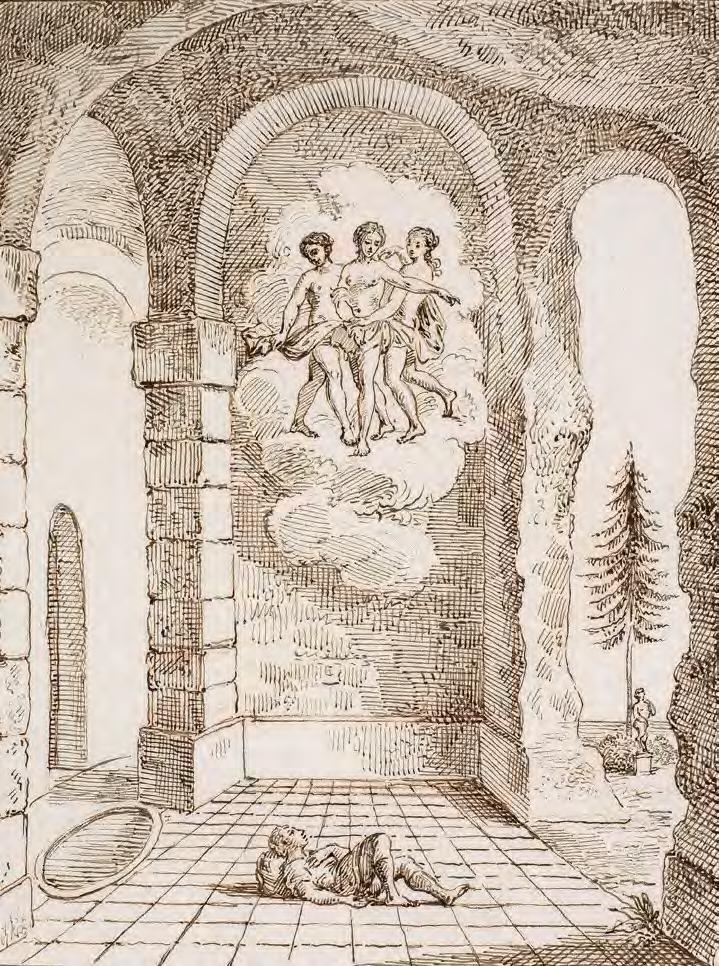
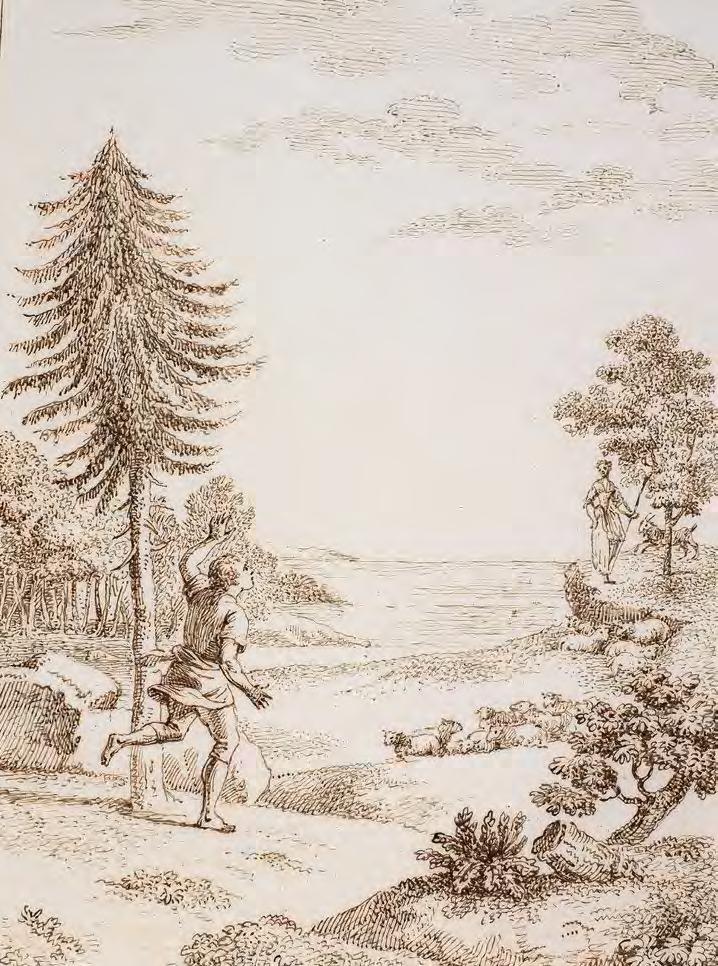
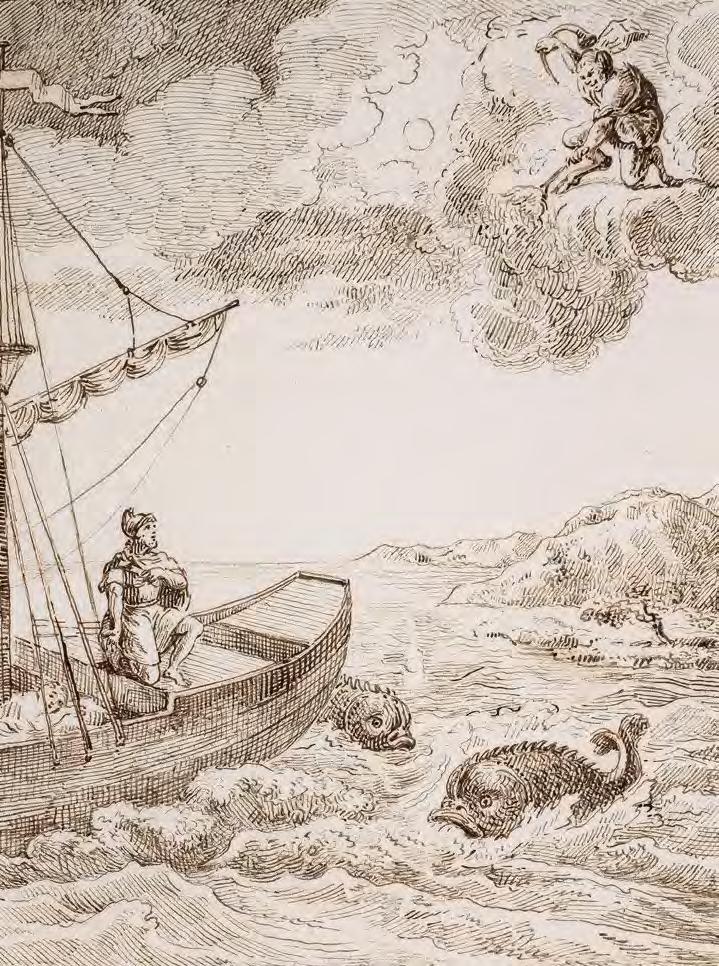
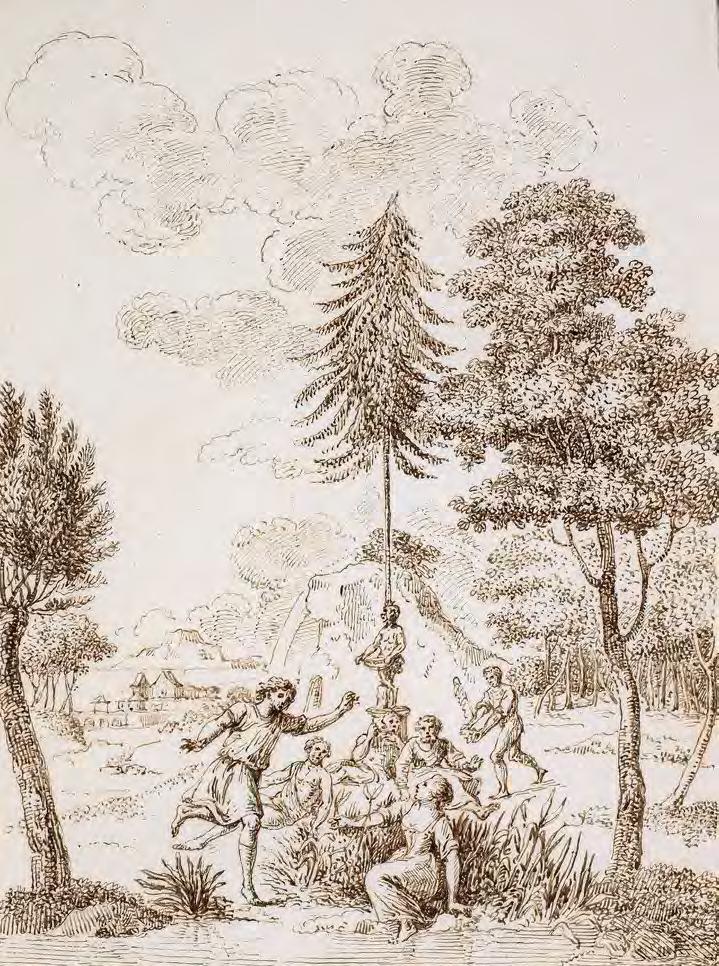


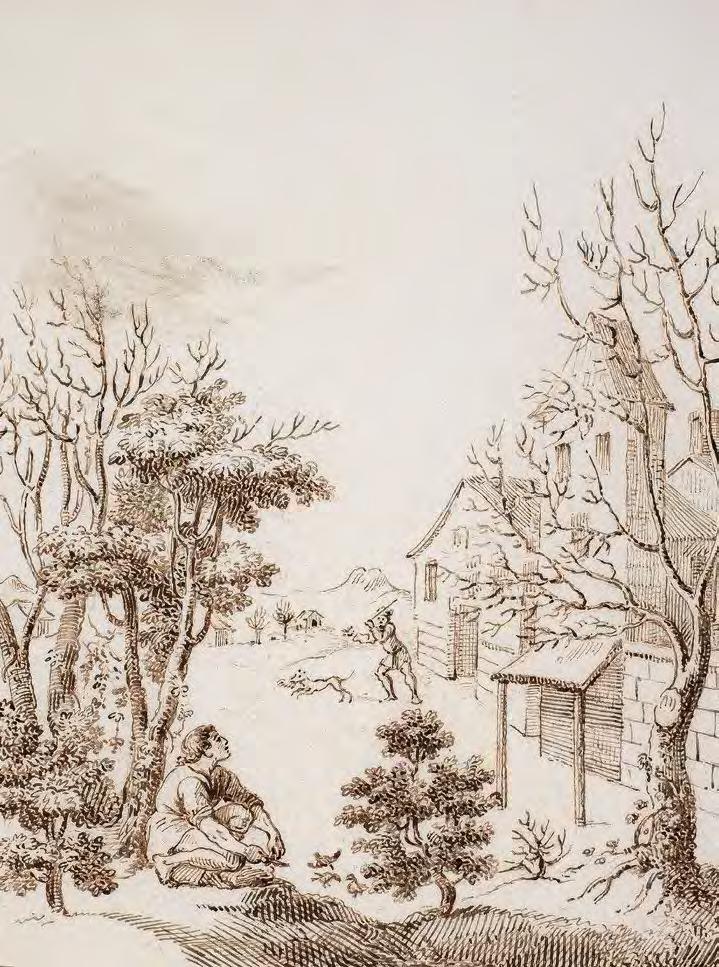
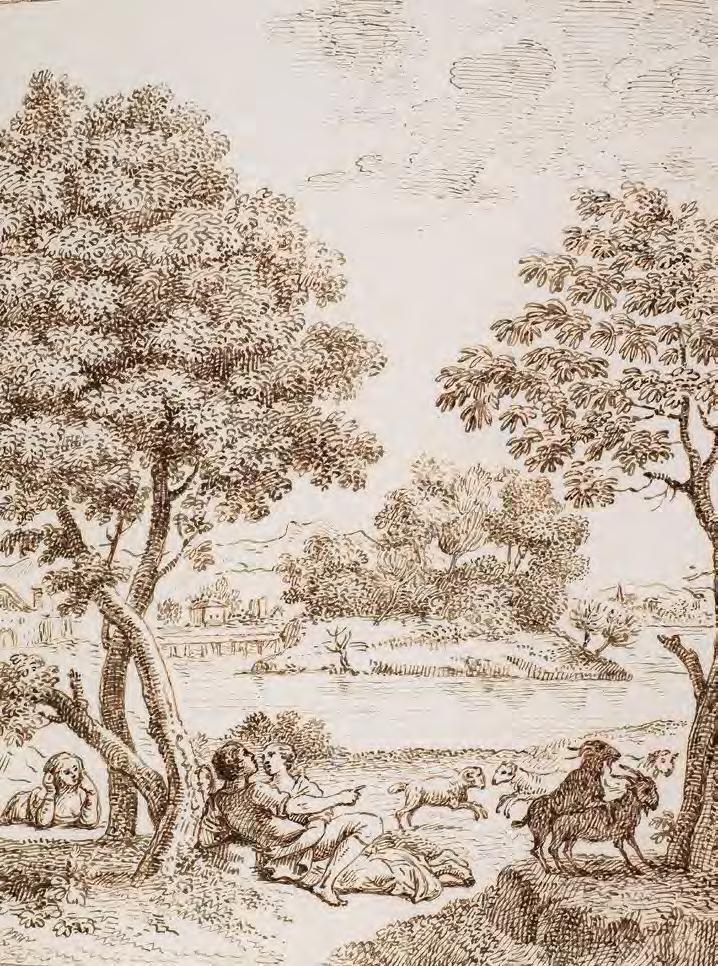
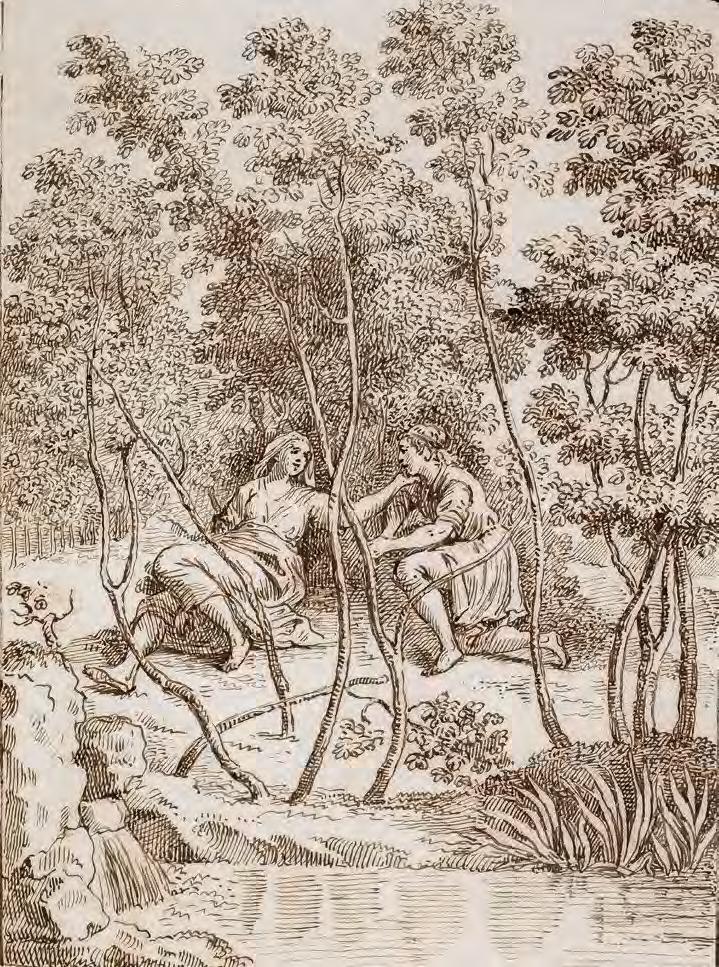
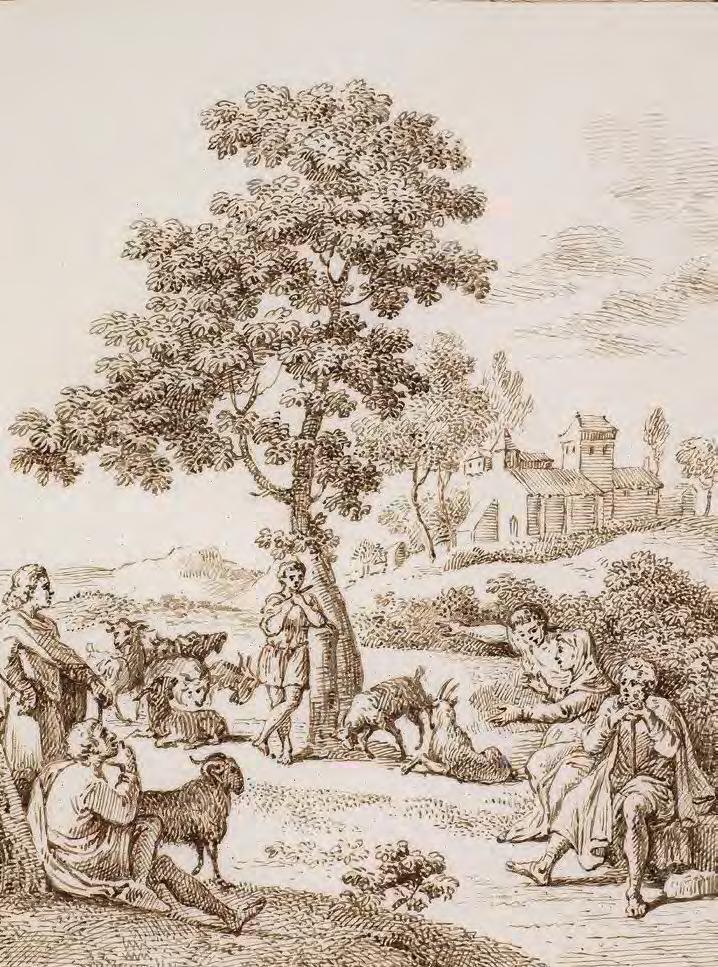


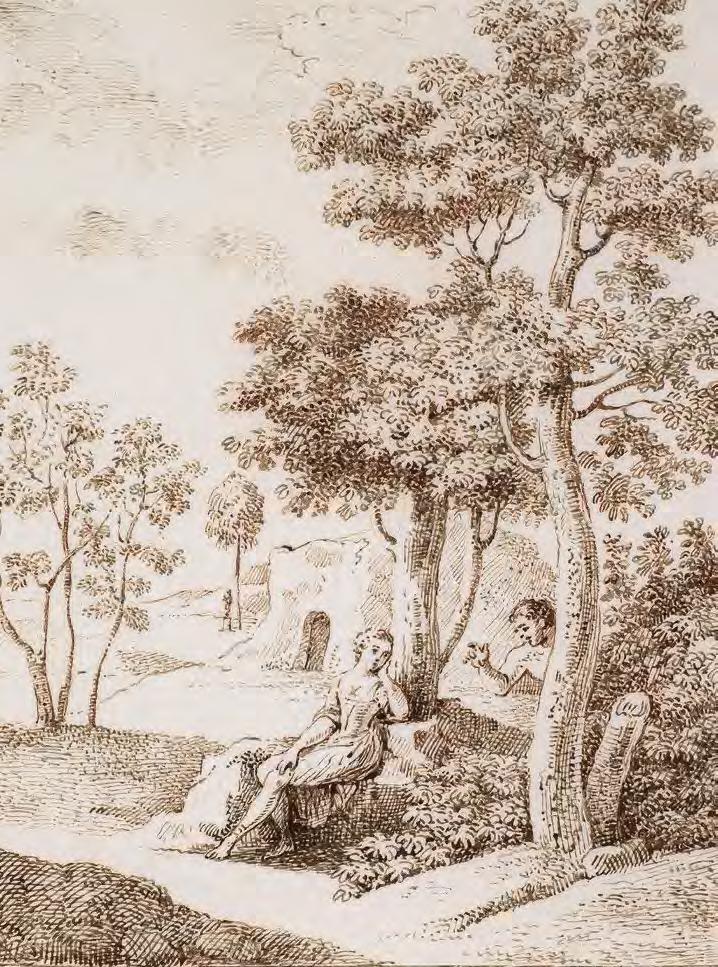
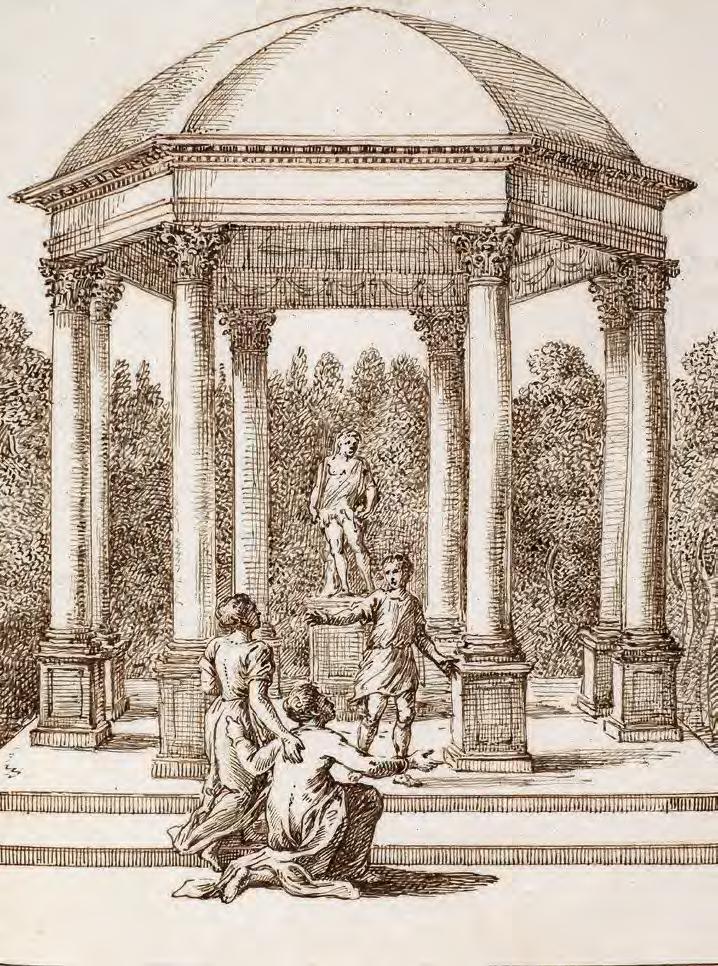

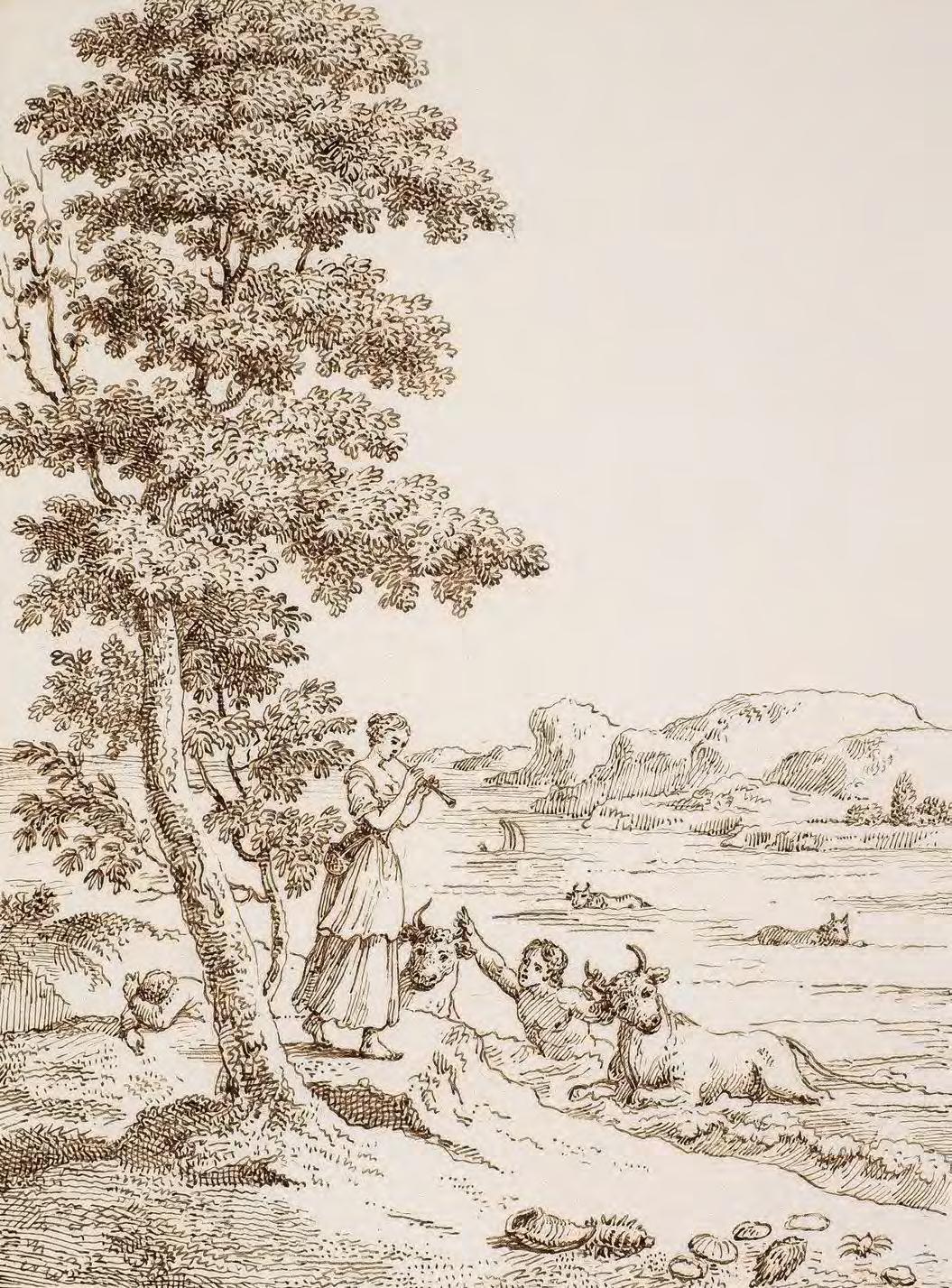

cher ces volumes ainsi ornés de gravures peintes ou plutôt fortement enluminées. Cet exemplaire, dont le texte et les figures sont reliés séparément (heute nicht mehr, siehe unten), est unique sous plus d’un rapport. Le texte a été choisi sur plusieurs; le volume de figures contient 1°. les vingt-neuf dessins faits à la plume par Martini; 2°. les gravures de ces dessins peintes, non pas comme celle des onze autres exemplaires par des enlumineuses, mais d’après les tableaux originaux et avec un soin tout particulier. Au bas de chacune de ces pièces destinées à servir de modèles pour peindre les autres exemplaires, est écrit par le gardien de ces tableaux: ‘Certifié le dessin ci-dessus conforme à l’original, Boizard’ “. (Renouard, Catalogue 1819, Bd. III , S. 188).
Der Text Boizards lautet etwas anders, nämlich: „ Je certifie que le dessein cy dessus est conforme à l’Original. Boizard .“ Tatsächlich springt die Superiorität der Gouachen unseres Bandes, verglichen mit weiteren Exemplaren (darunter das von Cohen und De Ricci erwähnte von Emmanuel Martin in diesem Katalog, unsere Nummer LVIII), ins Auge; sie sind auch in der Lage, die für diesen Roman zentralen jahreszeitengemäßen Stimmungen zu evozieren, echten Gemälden ähnlich, was jene weitgehend vermissen lassen. In summa ist dies das unvergleichlich kostbarste und schönste Exemplar einer singulär aufwendigen LongusAusgabe des 18. Jahrhunderts, und damit vielleicht aller Zeiten (denn Bonnard oder Maillol kann man damit nicht vergleichen).
Unser Exemplar präsentiert die Didot-Ausgabe von 1787, wenn man so will, in statu nascendi: Es enthält die originalen Zeichnungen nach der Regentensuite, und zwar in einer Form, die über den bekannten Illustrationszyklus hinausgehend bei vielen der Darstellungen größere Bildfelder zeigt, als das bisher der Fall war, wenn man zum Beispiel jetzt Bäume, die vorher angeschnitten waren, mit
ihren vollen Kronen zu sehen bekommt. Könnte es sein, daß Martini nicht einfach den alten Stichzyklus wieder abgezeichnet hat, sondern, ad fontes gewissermaßen, die Originalbilder im Schloß St. Cloud selbst? Und die hier eingebundenen Radierungen die ersten kolorierten sind, und zwar, wie Renouard es ja bezeugt: „d’après les tableaux originaux “? „Tableaux“ dürfte hier für Gemälde stehen, nicht für Zeichnungen. Daher die handschriftliche Bestätigung unter jeder der Tafeln, sie seien farblich „ conforme à l’Original“. Sollte diese Vermutung zutreffen, dann wären wir hier dem wirklichen, in den Gemälden geschaffenen Regentenzyklus näher denn je. Eben dies ist für eine Ausgabe, die schließlich von detr Druckerei des Bruders des Königs geschaffen worden ist, mehr als nur naheliegend, es ist evident.
Aufschluß darüber gibt der bislang in diesem Zusammenhang unbeachtete Katalog, den Renouard bereits 1807 für den Verkauf der Sammlung der Bibliothek des Druckers unserer Ausgabe, Lamy, publiziert hat. Dort wurde die gezeichnete Folge Martinis separat unter der Nummer 3835 angeboten, zusammen mit 29 „peintures sur vélin“, die von einem gewissen Boischegrin stammen: „Les dessins de Martini ont servi pour l’exécution des gravures au trait qui se trouvent dans l’édition suivante; et les peintures de Boischegrin sont les modèles d’après lesquels ont été faites les miniatures qui décorent les exemplaires imprimés sur vélin. Chacune de ces peintures est certifiée conforme au tableau original, par Boizard, concierge de la galerie de Saint-Cloud.“ Jener Boizard, der als garde-meuble et concierge du château de St. Cloud bezeugt ist, war also der Vermittler zu den Originalen Coypels und des Regenten, die zu dieser Zeit noch unbeschadet im Schloß hingen. Er bestätigte die Übereinstimmung, insbesondere diejenige der Farbigkeit, auf jedem einzelnen Blatt. Was
Renouard allerdings in diesem früheren Katalog noch als miniatures bezeichnet, waren in Wirklichkeit die Umrißradierungen, deren Plattenränder man ja auch in unserem Exemplar überall klar erkennt, die jener Boischegrin demnach miniaturartig koloriert hat. Doch wer war dieser Maler, den kein Künstlerlexikon kennt? Lediglich ein militärisches Jahrbuch (Annuaire de l’état militaire de France pour l’année 1819 , Straßburg 1819, S. 563) erwähnt, daß ein Mediziner diesen Namens, dessen Vornamen Fleurus lautete, am 24. August 1809 in das Hospital von Metz als Pharmacien sous-aidemajor, eingeteten ist, also ein Apotheker in militärischen Diensten. Sollte es sich hierbei um unseren Koloristen handeln, dann war er ein Farbkundiger, aber kein bildender Künstler an sich. Ihm hat man immerhin den Zutritt zum Schloß gewährt.
Damit ist unser Exemplar dasjenige Bildzeugnis der Epoche, welches dem tatsächlichen Gemäldezyklus auch in seiner ursprünglichen Farbigkeit am nächsten kommt. Das macht seinen eigentlichen und unschätzbaren Wert aus – ein kultur- und kunstgeschichtliches Dokument ersten Ranges. In der folgenden Nummer 3836 dieses Katalogs von 1807 dürfte sich zudem die Rohform des Textes unseres Exemplars vorgefunden haben: Vier Exemplare, alle auf Pergament gedruckt. Einem von diesen hat Renouard die beiden separaten Suiten von Martini und Boischegrin zugeordnet, indem er beide Bände separat in Halbmaroquin binden ließ, bis sie schließlich, mittels der ganzen Kunstfertigkeit des großen Buchbinders Lortic, in unserem Exemplar zur Einheit gefunden haben. Was hier noch als Beobachtung anzufügen ist: Von den 29 Zeichnungen Martinis sind 16 seitengleich wie der Druck ausgerichtet, der aber gegenüber der ersten Regentensuite Audrans aus dem Jahr 1714 seitenverkehrt orientiert ist. Wenn man davon ausgehen darf, daß Audrans Suite die Ge -
mälde im Gegensinn abbildet, erscheinen sie also in der Ausgabe von 1787 wieder seitenrichtig, was bedeutet: selbst in dieser Hinsicht authentisch. Die übrigen 13 spiegelverkehrt ausgerichteten Zeichnungen Martinis dokumentieren demnach den Prozeß der Umorientierung nach dem Vorbild der Gemälde aus St. Cloud.
Der Einband Lortics, von dem großen SammlerHändler Gancia in den frühen sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Auftrag gegeben, wird dem vom Inhalt gesetzten Anspruch gerecht: Die unfaßbar reiche Glanzentfaltung im Gold der Doublüren beweist, daß er sich der Singularität des Stückes bewußt war. Angesichts dessen kann man dem Wort Edmond de Goncourts nur noch zustimmen: „Mais, pour moi … Lortic, sans conteste, est le premier des relieurs.“
Zum Zeichner der Originale und Stecher der Folge, Pierre-Antoine Martini (1739–1800) vergleiche man Portalis, Dessinateurs, S. 387–389, wo unser Exemplar auf S. 389 aufgeführt ist, zitiert nach dem Angebot der Librairie Auguste Fontaine, die es 1875 für 8.000,– Goldfrancs(!) zum Verkauf anbot – der Eintrag findet sich dort unter der Nummer 1367 (Catalogue Fontaine 1875).
Die Erhaltung des Buches ist innen neuwertig, außen makellos bis auf einige unwesentliche Bereibungen der Stehkanten und der Bünde.
Provenienz: Das Exemplar, das direkt auf den Drucker dieser Ausgabe, Lamy, zurückgeht, wurde auf dessen Auktion 1807, Nr. 3835 und 3836a, von dem bedeutenden Verleger und noch größeren Sammler Renouard erworben, der es in zwei Halbmaroquinbände (die Originale gesondert) binden ließ und in seinem vierbändigen Katalog von 1819 verzeichnet. Es war dann die Nr. 1898 in der Versteigerung von Renouards Bibliothek durch Potier im November 1854 (Renouard Catalogue
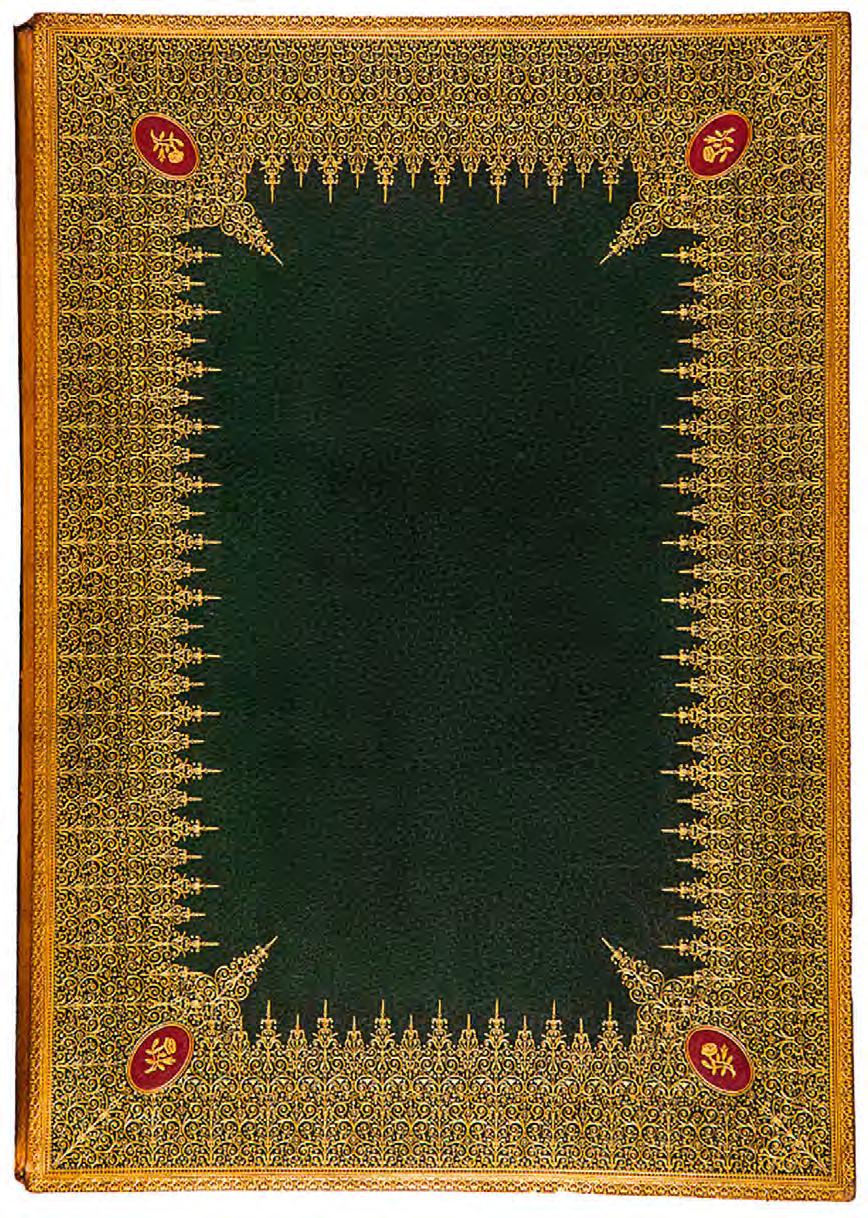
1854). Der ebenso renommierte marchand amateur Gancia erwarb es damals und ließ es vierzehn Jahre später wieder versteigern: 27. April – 2. Mai 1868, Nr. 712 (mit besonderer Hervorhebung im Vorwort, S. XII , der eigentliche Eintrag auf Seite 118), nun schon in Maroquin von Lortic gebunden („Chef d’oeuvre de reliure de Lortic“ und „La Reliure a couté 800 fr.“). 1875 wird es, wie schon erwähnt, im Katalog von Auguste Fontaine für 8.000,– Francs angeboten. Danach besaß es der Duc de Chartres. Dessen Bibliothek wurde in den fünfziger Jahren durch einen Pariser Antiquar aufgelöst, und so kam das Exemplar in
die exquisite Sammlung des Grafen und der Gräfin du Boisrouvray. Aus ihrem Besitz wurde es am 16. Oktober 1989 von Sotheby’s Monaco versteigert (frs. 345.000,–). Erworben von Librairie Valette, wird das Exemplar aus ihrem Katalog 11 im September 1990 unter Nr. 38 für frs. 650.000,–verkauft. Erworben aus Schweizer Privatbesitz –Adrian Flühmann.
Literatur: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 655, zitieren unser Exemplar ausführlich. – Für die bibliographischen Angaben zur Ausgabe von 1787 siehe unsere Nummer LIX .
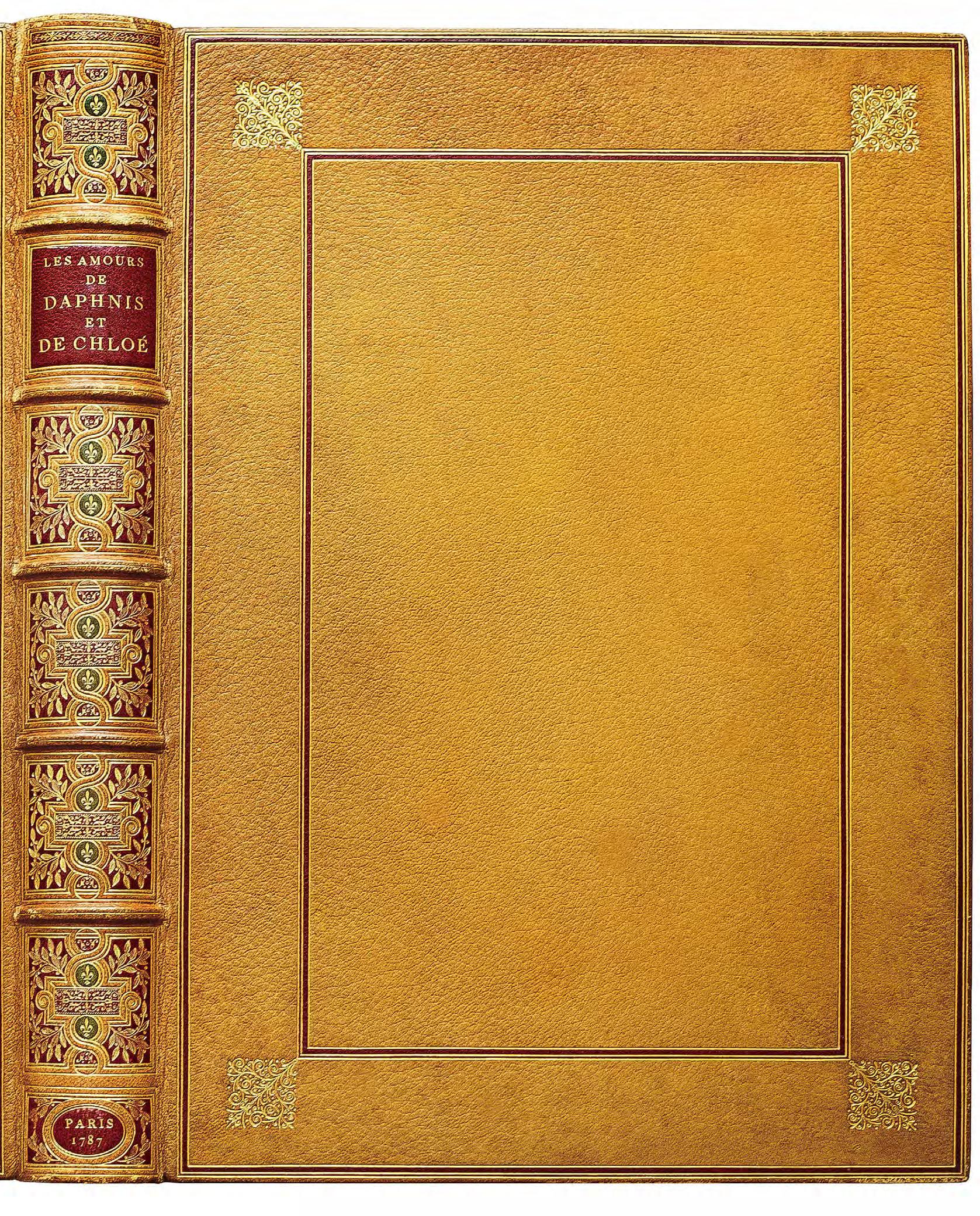
Das Exemplar Esmerian mit acht Originalzeichnungen und der umfangreichsten und schönsten Sammlung der Illustrationen von Le Barbier
LXII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduction nouvelle [von J.-F. Debure-Saint Fauxbin], avec figures nouvellement dessinées. Zwei Teile in einem Band. Paris, Imprimerie de Monsieur [= Pierre-François Didot] für Lamy, 1787.
Gestochener Titel in zwei Zuständen (beiliegend), ein gestochenes Frontispiz (beiliegend), eine gestochene Kopfvignette (beiliegend) und 22 Tafeln (teils beiliegend, teils eingebunden), davon acht originale lavierte Tuschezeichnungen von J.-J. F. Le Barbier sowie je sieben in eau-forte pure und avant la lettre, von verschiedenen Stechern, alle nach Le Barbier.
VIII, 175 S. (typographischer Titel, „Préface“ und Haupttext; ohne die beiden Blätter außerhalb der Lagenzählung: „Avant-Propos“ und Titel des zweiten Bandes).
Kollation: a4 A-Y 4
Groß-Quart, gedruckt auf Papier im Folio-Format (340 x 259 mm).
Nachtblauer quergenarbter Maroquineinband im Stil der Zeit um 1800 auf fünf doppelten Bünden zu sechs Kompartimenten; im zweiten von oben der goldgeprägte Titel, im dritten: „Originaux de Le Barbier“, in den übrigen Kompartimenten eine Hirtenflöte, die doppelten Bünde mit Filetenvergoldung, roten Maroquinintarsien mit einem goldgeprägten Ankerkettenmuster, Deckel mit Fileten- und Bogenvergoldung: ein äußerer Filetenrahmen, darinnen ein kleinerer Rahmen mit halbrunden Einbuchtungen an allen vier Seiten, überlagert von einer Raute, an allen Eckpunkten je ein kleiner gold-
gerahmter Kreis mit einer roten Maroquin-Intarsie; Stehkanten mit Perlstabverzierungen, breite Innenkantenvergoldung mit Weintrauben und -blättern, doubliert mit fuchsiafarbenem Seidenmoirée, Ganzgoldschnitt; signiert „Huser“.
Dies ist die Sammlung mit den meisten der erhaltenen Illustrationen Le Barbiers zu Daphnis und Chloe, darunter die acht bestechend schönen Lavis , eingebunden unter Passepartout, in Grün und Gold gerahmt, sowie zahlreiche Zustandsdru kke – jeder Abzug der nie vollständig erschienenen Suite ist von äußerster Seltenheit und war und ist unter Bibliophilen ein meist unerreichbarer Traum: „Ceux qui ont tenu entre les mains cette suite rarissime s’accordent à y vanter la beauté de la gravure et la pureté du dessin“ (Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, S. 658).
Die Zeichnungen, von denen zwei signiert und in die Jahre 1795 sowie 1797 datiert sind, offenbaren das ganze künstlerische Potential des JeanJacques François Le Barbier, den man gewöhnlich nur „Le Barbier l’Aîné“ genannt hat, geboren in Rouen 1738 und 1826 in Paris gestorben. Vor allem die Landschaften sind von außerordentlicher Schönheit in ihrem Bildaufbau, der präzisen Wiedergabe jeden Details, der reizvollen Lichtstimmungen und Perspektiven, mit geringen Abstrichen gilt dies auch für die Personendarstellung und die Dramaturgie. Diese Folge von Originalen, die man ohne weiteres zu den Höhepunkten der französischen Zeichenkunst aus der Zeit um 1800 zählen darf, in einem Exemplar vereint zu sehen, ergänzt um die sonst nie in diesem Umfang anzutreffenden graphischen Blätter, noch dazu vielen in mehreren frühen Zuständen, aus diesem nie in Gänze realisierten Zyklus, ist ein weiteres Rarissimum der Daphnis-und-Chloé-Illustration des 18. Jahrhunderts.
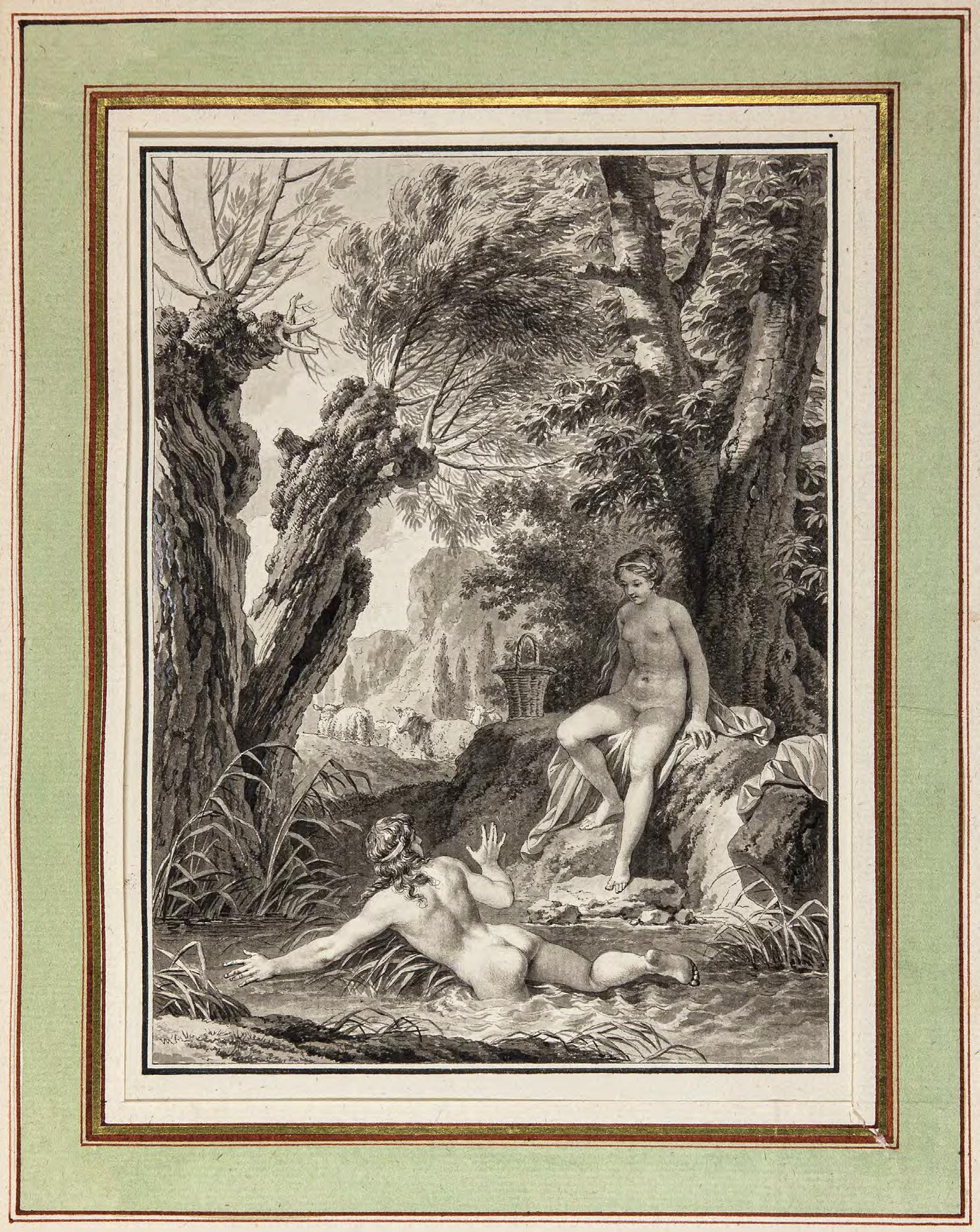
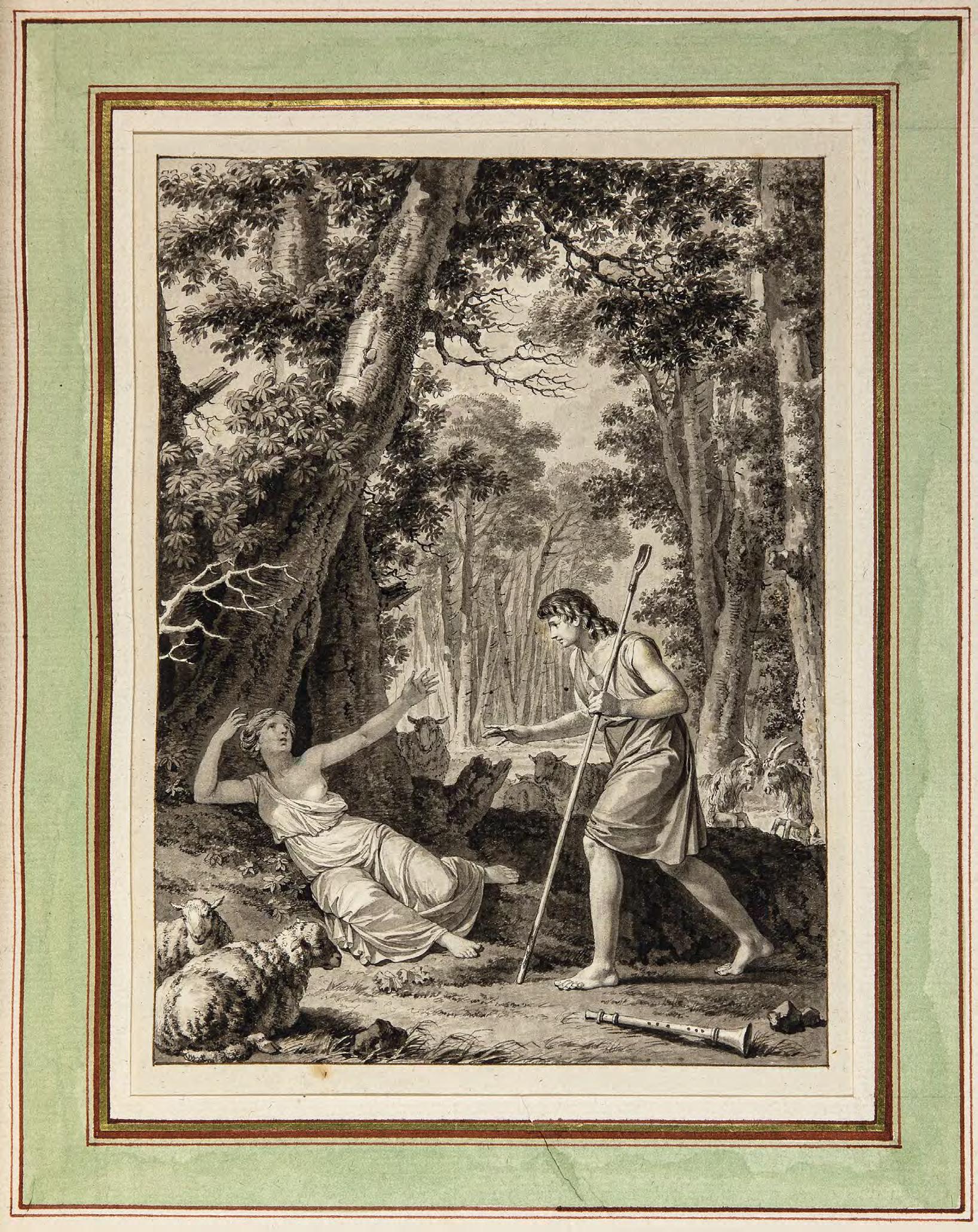

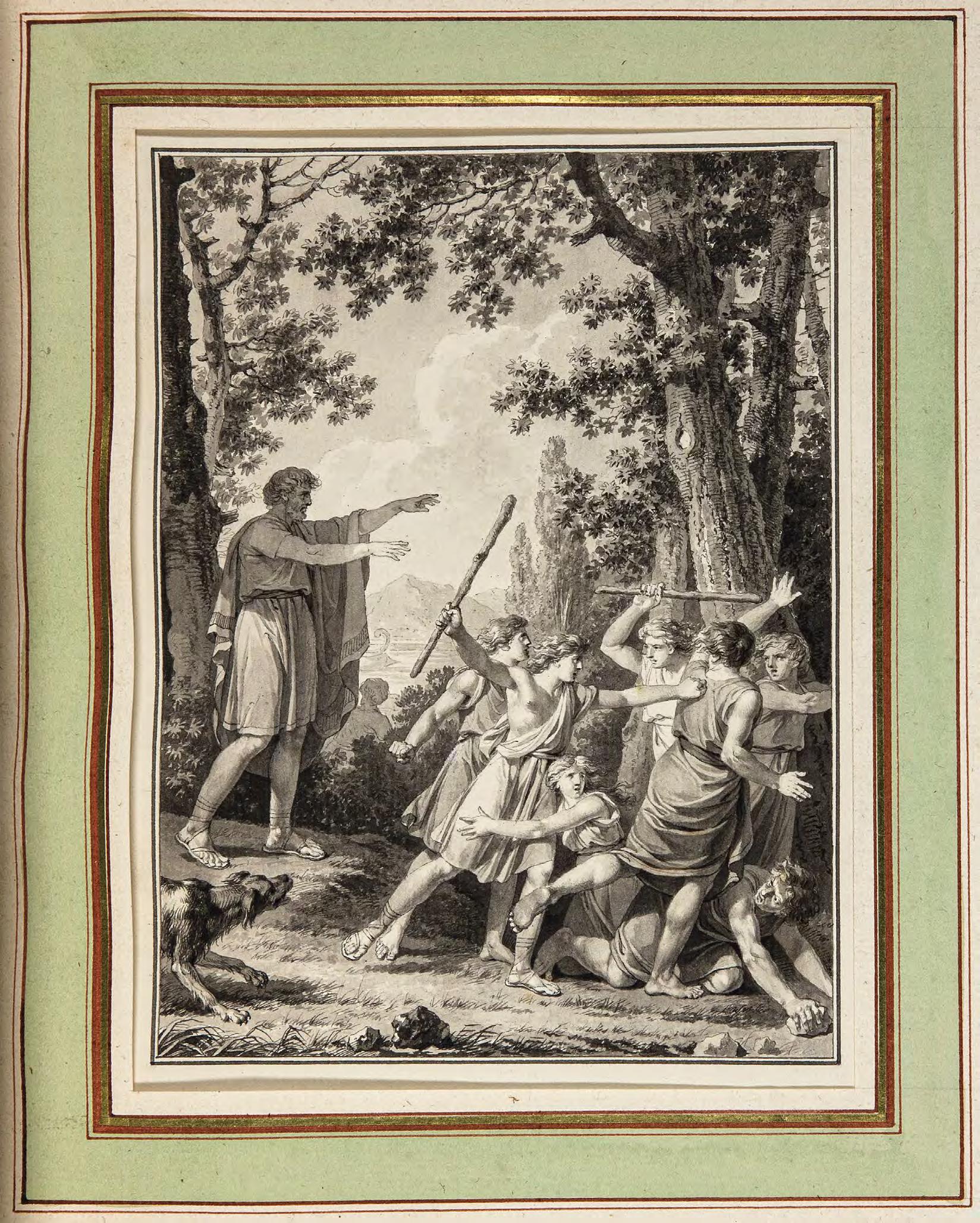
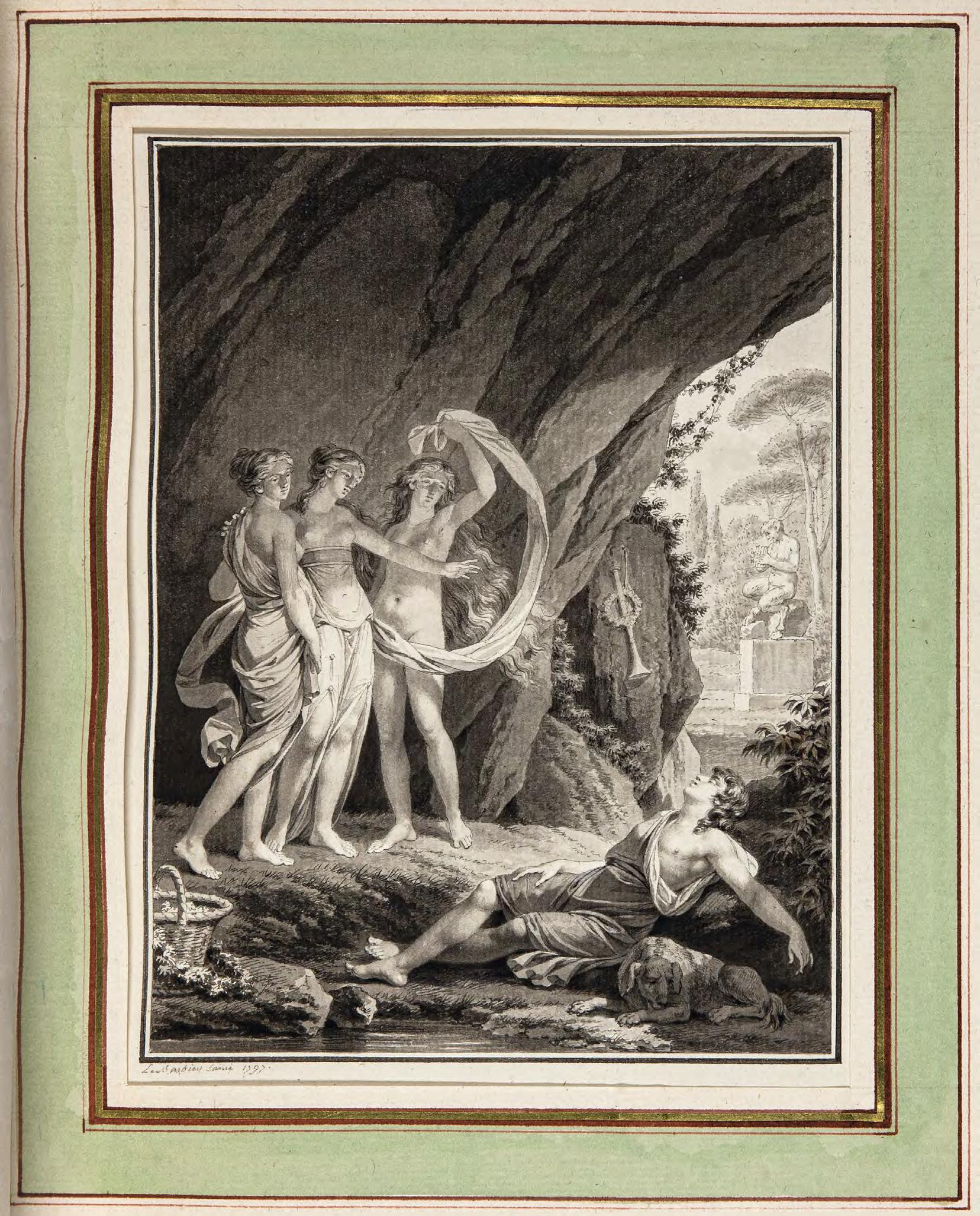


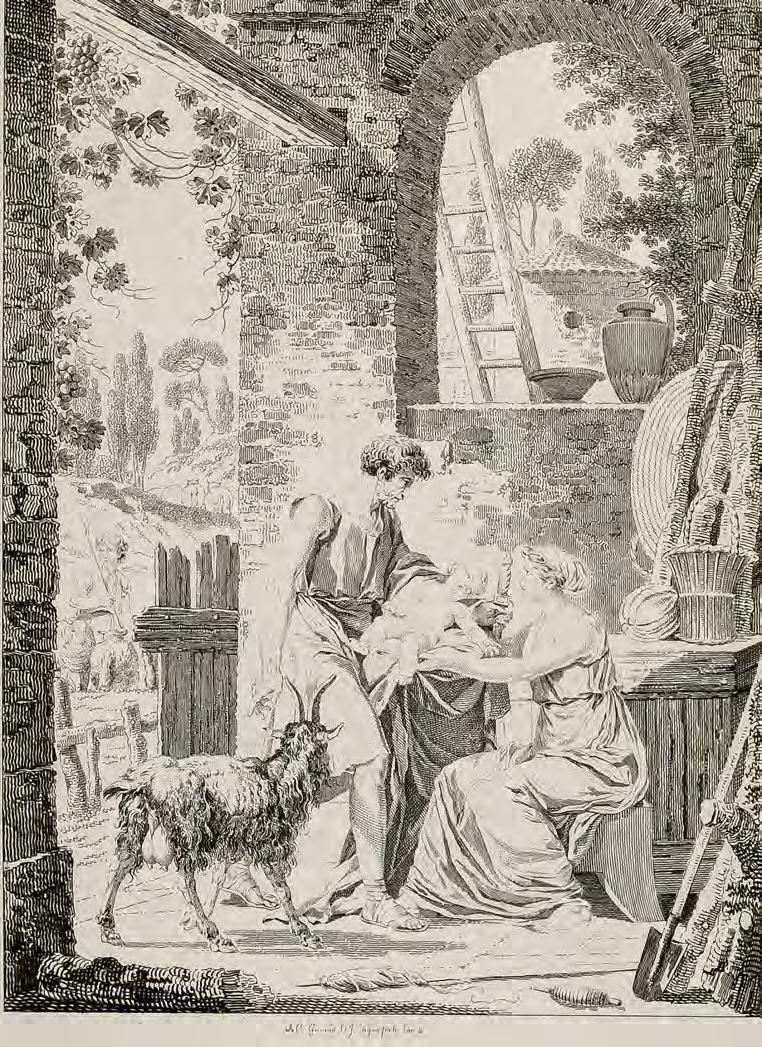
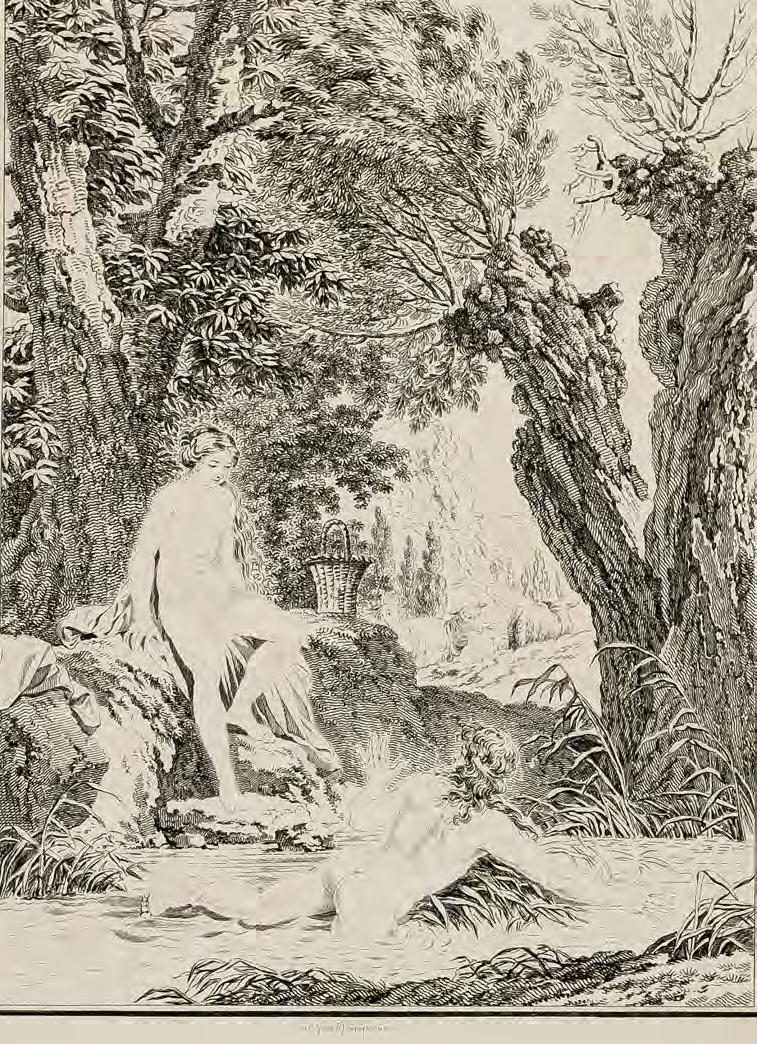
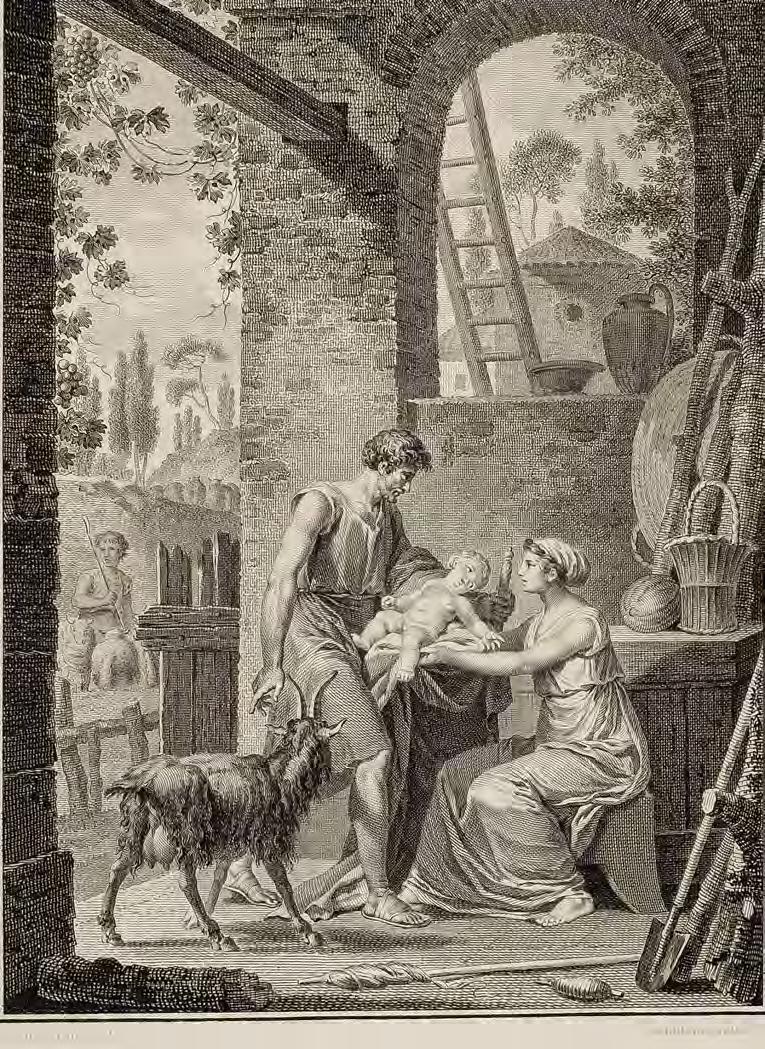
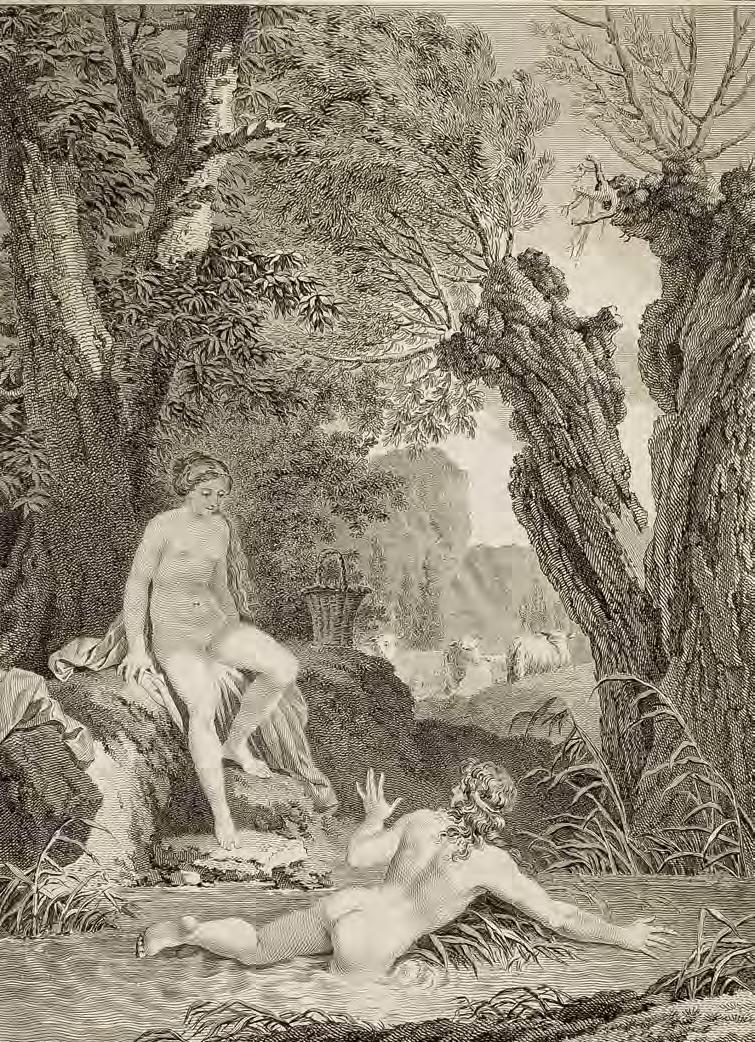
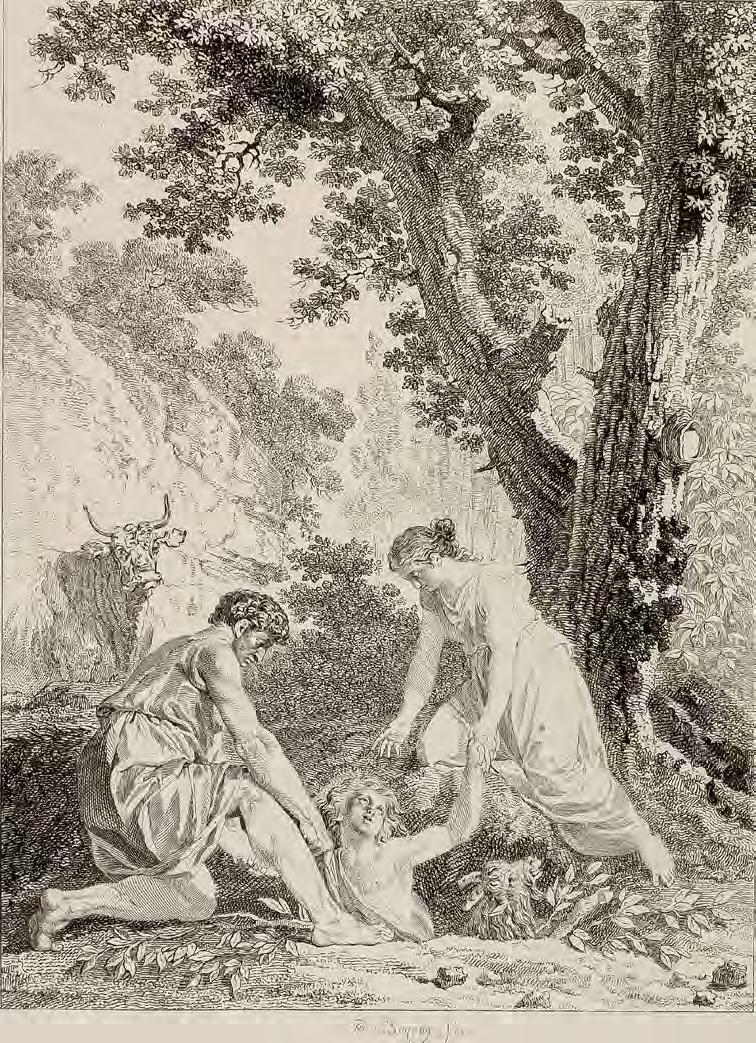

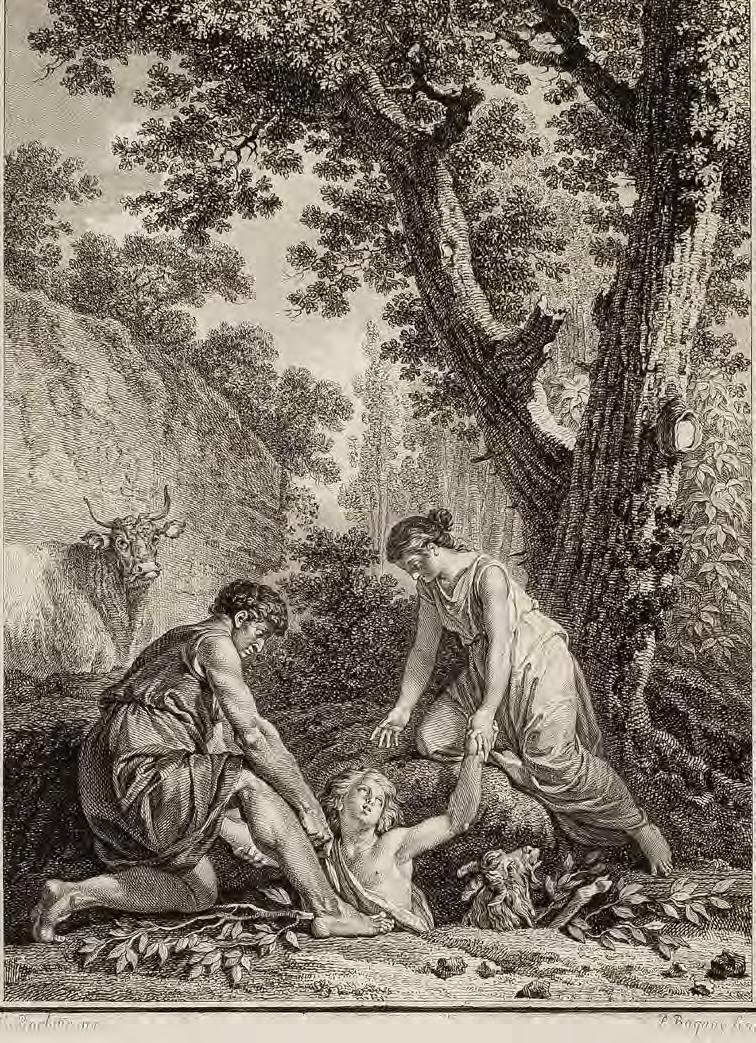
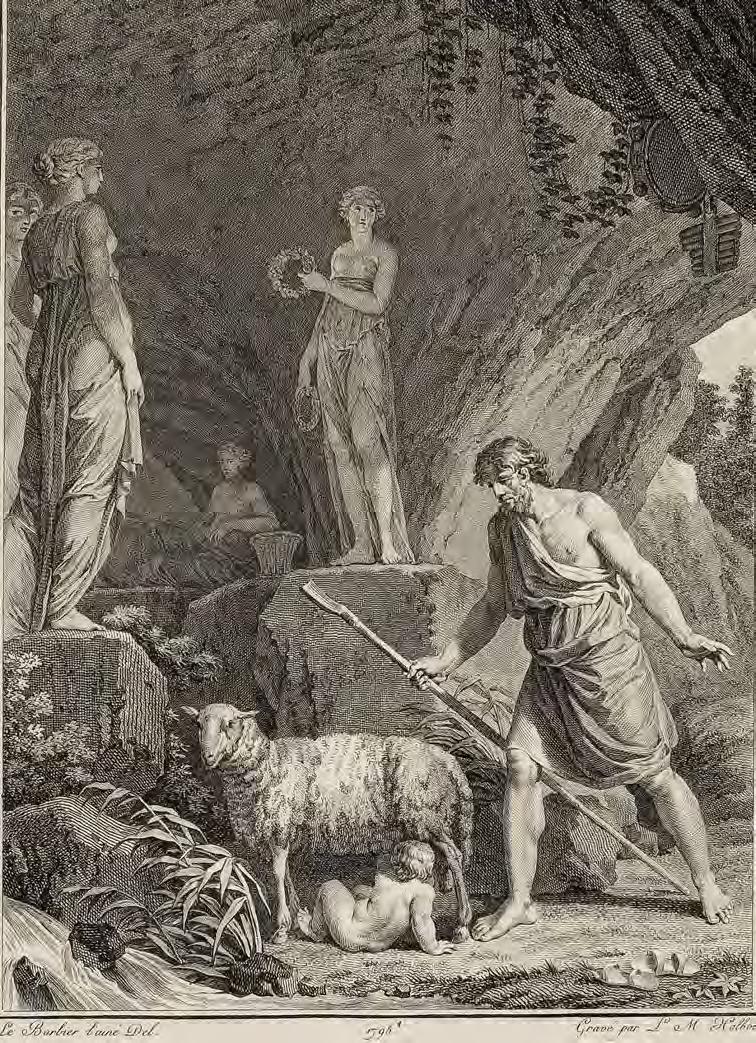
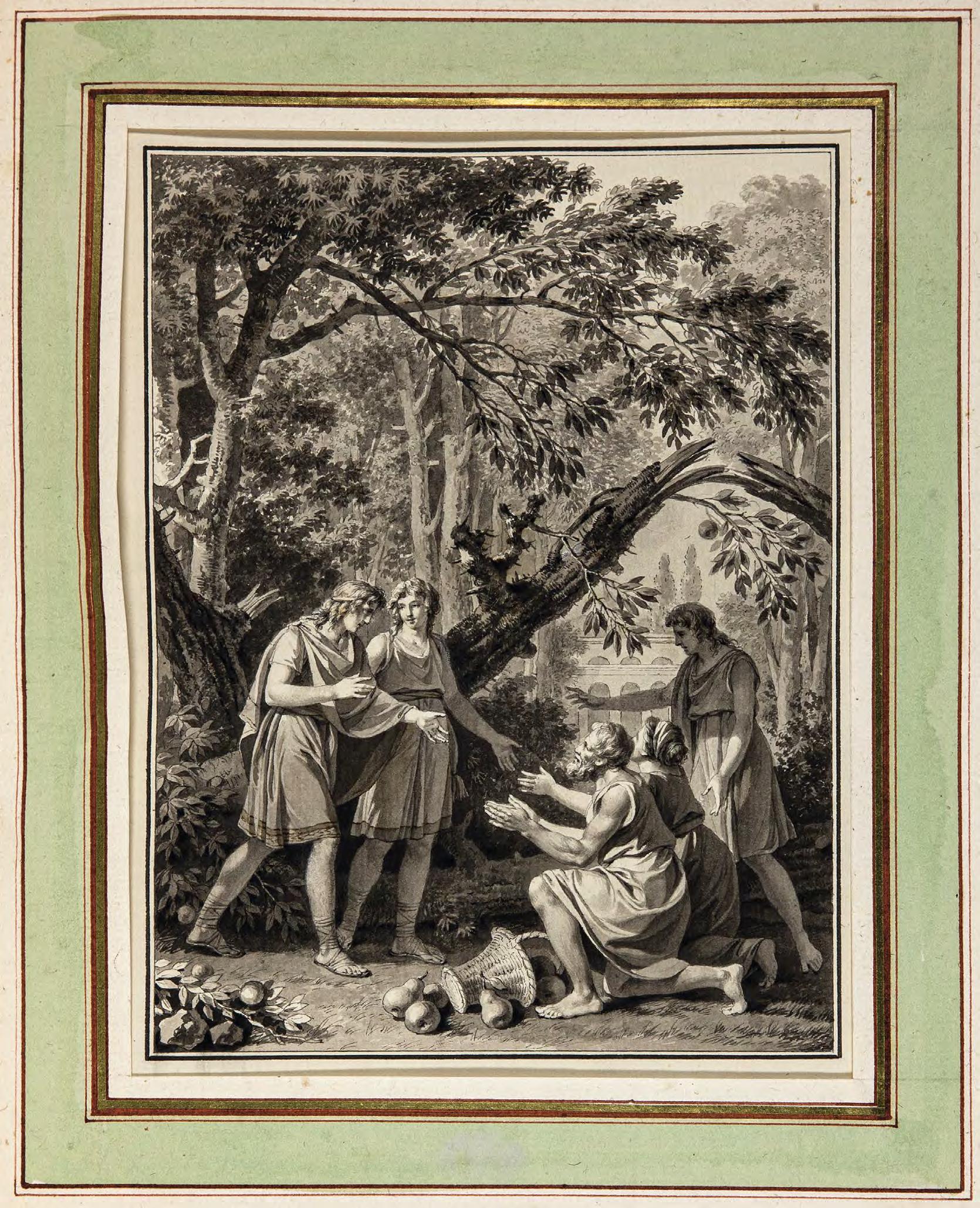
Der als Historienmaler bekannte Le Barbier hat sich dem Sujet mit diesem Zyklus bereits zum zweiten Mal gewidmet, nachdem er schon für Salomon Gessners literarische Fassung der Daphnisund-Chloe-Thematik Zeichnungen angefertigt hatte, nach denen Stiche für Gessners Werkausgabe entstanden sind. Le Barbier und Gessner waren miteinander bekannt und standen im Briefwechsel. Le Barbiers zweite, vorliegende Fassung übertrifft die erste jedoch deutlich. Man merkt ihr an, daß die erneute Beschäftigung und Auseinandersetzung zu einer nochmaligen qualitativen Steigerung geführt hat, die alles bisher dazu Geschaffene in den Schatten stellt. Exakter und kompakter als Esmerian könnten wir die Sujets und Zustände der vorhandenen Tafeln wohl nicht aufführen, darum sei seine Auflistung an dieser Stelle zitiert (Bibliothèque Esmerian 1972–74, Bd. III , 1973, Nr. 59):
A – Deux enfants ailés jouant autour d’un tambourin sur lequel est gravé le faux-titre. Grand fleuron du faux-titre gravé par Ribault, An III – 1794, en double épreuve, avant la lettre et avec la lettre (2 figures).
B – La chèvre allaitant Daphnis. Grande vignette en-tête gravée par Ribault. An III, 1795. Épreuve sans texte (1)
C – Lamon apporte Daphnis nouveau-né à Myrtale. Frontispice gravé par Pelicier. Eau forte pure (1).
D – Lamon apporte à Myrtale Daphnis nouveauné, et aussi les ornements et la chèvre. Planche p. 4, à l’état d’eau-forte pure, gravé par Giraud le jeune (An II). A l’état définitif [sur chine], terminé par Dambrun (2).
E – Dryas découvre la brebis allaitant Chloé dans la caverne dédiée aux nymphes. Pp. 6 et 7, à l’état d’eau-forte pure, gravé par Pauquet, à l’état définitif, terminé par Halbou. 1795 (2).
F – Chloé et le Bouvier aident Daphnis à sortir de la fosse. P. 14, à l’état d’eau-forte pure et à l’état définitif, gravé par Bacquoy (2).
G – Chloé nue regarde Daphnis se baignant dans la rivière. Pp. 22 et 23. Dessin original de Le Barbier. État d’eau-forte pure, gravé par Giraud le jeune, an IV et deux épreuves de l’état définitif, non signé (4).
H – Chloé réveillée par l’hirondelle porsuivant la cigale, Daphnis riant de la frayeur de Chloé. P. 24. Dessin original de Le Barbier. État d’eau-forte pure inscrit: „Sepsay sage par Le Grand“? (2).
I – Philetas s’entretient avec Daphnis et Chloé. pp. 40 & 41. Dessin original de Le Barbier, signé et daté 1795. État d’eau-forte pure et état terminé, par Trière (3).
J – Daphnis et Chloé s’embrassant couchés au pied d’un chêne. P. 50. État d’eau-forte pure par Le Mire, 1797, (1).
K – Dryas et Lamon venant au secours de Daphnis en lutte avec le mitylénien. Pp. 56 & 57. Dessin original de Le Barbier (1).
L – Trois nymphes apparaissant à Daphnis endormi dans la grotte. Pp. 62 et 63. Dessin original de Le Barbier. Signé et daté, 1797. (1).
M – Dryas introduit Daphnis dans sa famille où il retrouve Chloé. Pp. 92 et 93. Dessin original de Le Barbier (1).
N – Lamon approprie le parc de son maître. P. 130. Dessin original de Le Barbier (1).
O – Lamon se jetant aux pieds de son jeune maître avec Myrtale et Daphnis. Pp. 138 et 139. Dessin original de Le Barbier (1).
P – Daphnis offrant une coupe à astyle. P. 140 Épreuve de l’état défintif par Bovinet. (1796) (1).
Der Einband des in Paris tätigen Georges Huser (1879–1961) ist eine Meisterleistung der modernen, in jeder Hinsicht stil- und materialgetreuen
Nachschöpfung eines Vorbilds der Zeit um 1800. In Auftrag gegeben wurde er von Raphaël Esmerian, der die Zeichnungen in ein Exemplar der Ausgabe von 1787, das zuvor wohl keine Tafeln enthalten hatte, binden ließ. Ganz dezent hat man dafür auf dem Titelblatt die dem Zweck nicht mehr entsprechende Textzeile „sur les peintures de M. le Duc d’Orléans, Régent“ ausgekratzt. Le Barbiers Entwürfe dürften wohl, zumindest anfänglich, im Auftrag Pierre Didots entstanden sein und waren offenbar für die Ausgabe des Jahres 1800 bestimmt, doch haben den Auftrag dann Prud’hon und Gérard erhalten. Mit der Ausgabe von 1787 stehen sie in keinem direkten Zusammenhang.
Das Vorbild für diesen Einband stammte übrigens aus Esmerians eigener Bibliothek; man findet es mit Abbildung im zweiten Band des Katalogs unter der Nummer 125. Dieser Einband ist wohl bald nach 1800 entstanden, und auch er enthält schon „doublures et gardes de tabis rose“.
Provenienz: Die acht Originalzeichnungen Le Barbiers erschienen erstmals in dessen Auktionskatalog 1826, wo sie interessanterweise nicht versteigert wurden; trotzdem müssen sie wenig später in den Besitz des Henri Huchet, Comte de La Bédoyère (1782–1861) gelangt sein, auf dessen Vente 1862 die Zeichnungen für 399,– Goldfrancs von Capé erworben wurden (Catalogue La Bédoyère 1862, Nr. 277). Damals waren auch noch die beiden Vorzeichnungen zu den Kopfvignetten dabei, die jetzt in unserer Nummer LXXVII eingebunden sind. 1947 wurden sie dann auf der New Yorker Auktion eines Teils der Sammlung von Daniel Sickles angeboten (Collection Sickles 1947, Nr. 155, für 3.500,– $ zugeschlagen).
16 der hier beiliegenden Tafeln stammen aus der Bibliothek von Charles Scheffer und sind in seinem Pariser Auktionskatalog 1880 unter Los 206 zu finden – für 1605,– Goldfrancs konnte der bedeutende Antiquar Damascène Morgand sie akquirieren und an Olry-Roederer (Erbe des berühmten Louis Roederer) verkaufen. Roederers Bibliothek wurde ca. 1924 von Dr. Rosenbach übernommen. Beide Sets, die Zeichnungen als auch die Abzüge, fanden letztlich ihren Weg in die legendäre Bibliothek Raphaël Esmerians und konnten dort vereinigt werden. Pierre Berès kaufte das Exemplar auf der 1973er Auktion für 85.000,– Francs; auf der dritten Auktion von Berès, am 16.12.2005 (Collection Berès 2005, N° 357) wurde es für 72.000,– € zugeschlagen. Aus französischem Privatbesitz erworben.
Nachtrag: Vier weitere Original-Lavis von Le Barbier (Lamon trouve Daphnis; Drias trouve Chloé; Chloé et Dorcon retirent Daphnis d’un trou ; Licaenion enseigne Daphnis au jeu d’amour) waren Nr. 5687 im Bulletin mensuel 10, 1879 von Morgand : „Vendu“. Sie entsprechen den hier zitierten Stichen C, D, F und J (letzteres im EsmerianKatalog missdeutet) – ob sie einmal auftauchen?
Unikales Exemplar mit der reichsten Ausstattung dieser wundervollen Suite von Le Barbier, einschließlich seiner Originalzeichnungen – vereint in einem unbeschnittenen Exemplar, vortrefflich gebunden und innen wie außen makellos erhalten.
Literatur: Bibliothèque Esmerian 1972–1974, Bd. III , 1973, S. 48 ff., beschreibt dieses Exemplar ausführlich. Cohen/De Ricci Sp. 658, zitiert die Suite unseres Exemplars; Portalis, Dessinateurs, S. 335, die Originalzeichnungen.
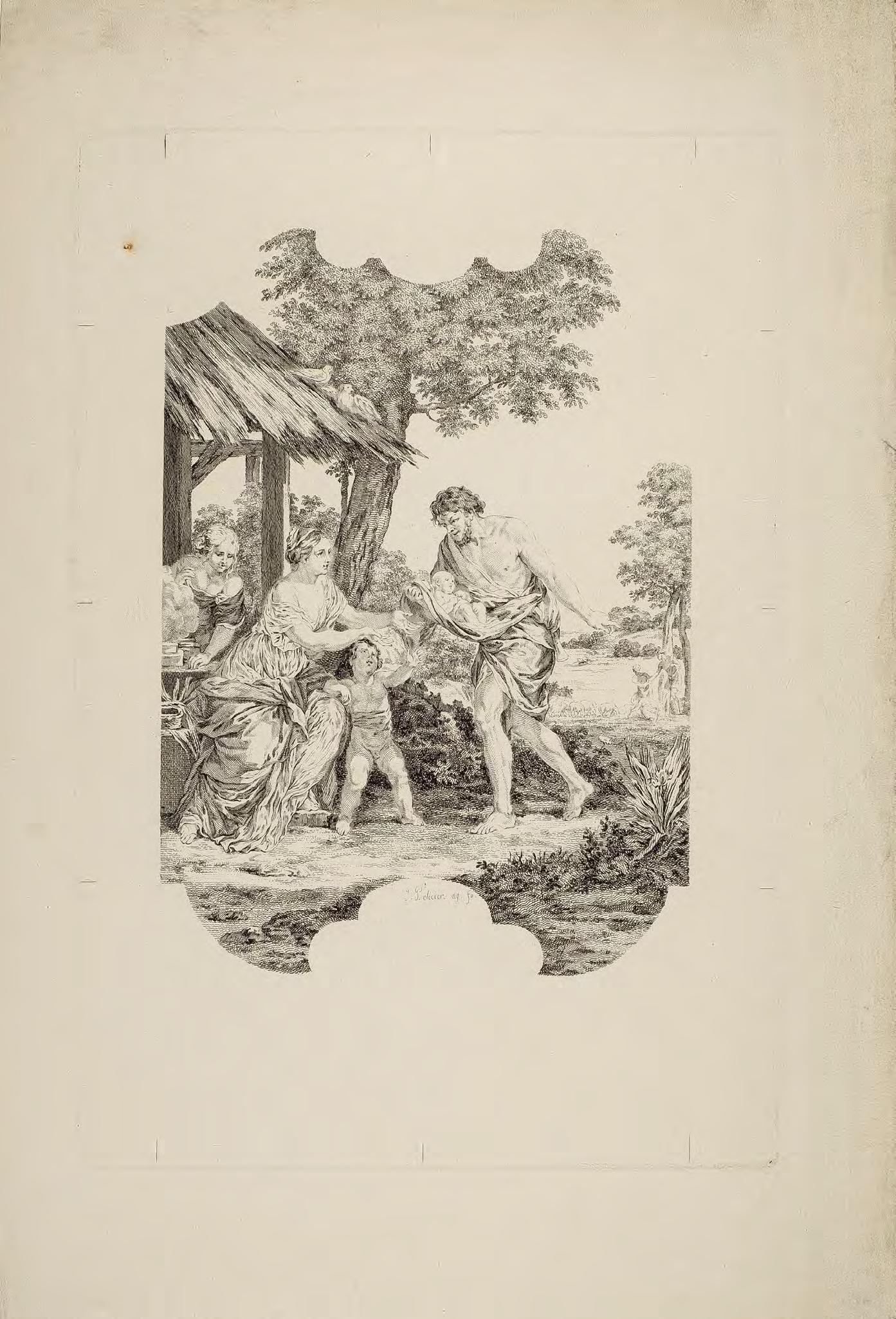
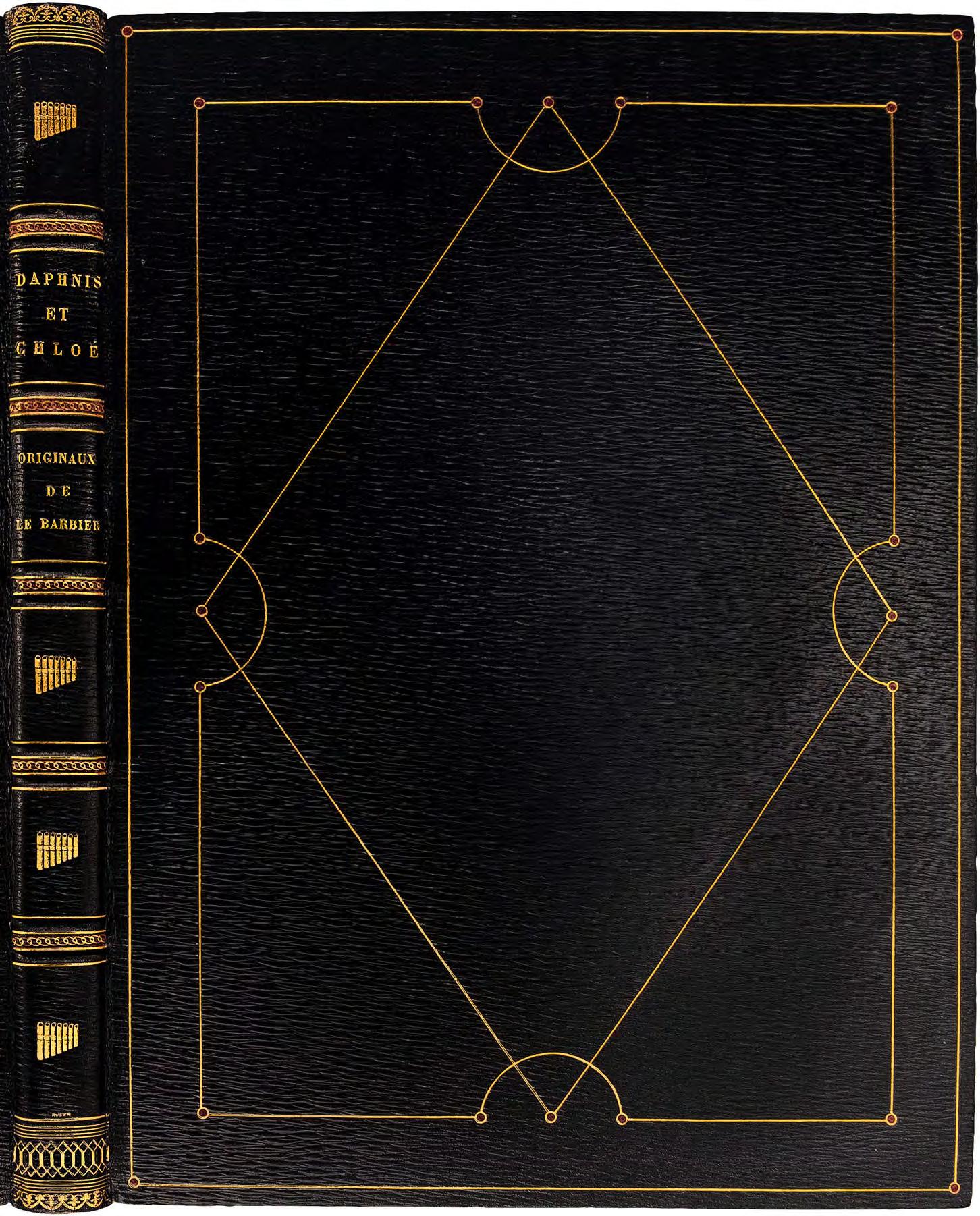

Sechs Tafeln in eau-forte pure aus dem Besitz Hans Fürstenbergs
LXIII Sechs lose Tafeln mit Zustandsdrucken und in eau-forte pure nach F. Gérard (dreifach), P. P. Prud’hon, L. Hersent und J. Albrier; alle avant la lettre.
Drei der Tafeln zeigen Daphnis und Chloe im Bade in der Version nach Prud’hon, Hersent und Albrier; dazu drei Tafeln nach Gérard. – Eine kleine Sammlung seltener Abzüge, die sich in der Sammlung Fürstenberg befand.
Außerhalb des Plattenrandes meist leicht gebräunt.
Die Radierungen Martinis in Sepia sowie die Tafeln Prud’hons und Gérards avant la lettre
LXIV [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduction nouvelle [von J.-F. Debure-Saint Fauxbin], avec figures nouvellement dessinées sur les peintures de M. le Duc d’Orléans, Régent. Zwei Teile in einem Band. Paris, Imprimerie de Monsieur [= Pierre-François Didot] für Lamy, 1787.
Mit 29 Radierungen von P.-A. Martini nach den Gemälden des Régent (einschließlich der „Petits pieds“ nach dem Comte de Caylus) gedruckt in Sepia, datiert 1788. – Zusätzlich eingebunden: Die Suiten nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), insgesamt neun Tafeln avant la lettre, gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy.
VIII S., 1 Bl. (zwischengebunden), 175 S. (typographischer Titel, „Avant-Propos“, hier nach dem Haupttitel a 1 eingebunden, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: a 1 *1 a 2–4 A-Y 4 Groß-Quart (327 x 238 mm).
Marmorierter Kalbledereinband der Zeit auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, goldgeprägtes Rückenschild im zweiten von oben, in den übrigen je ein zentrales goldgeprägtes querovales Medaillon mit malteserkreuzartiger Figur in der Mitte, Rahmen und Grund in Rot und Grün wechselweise intarsiert, Deckel mit dreifacher kräftiger Filetenrahmung; doppelte Stehkantenfilete, florale Innenkantenbordüre, Marmorpapiervorsätze und Ganzgoldschnitt.
Knapp 70 Jahre, nachdem der Régent Philippe d’Orléans unter Anleitung Coypels seine Gemälde und Zeichnungen zu Daphnis und Chloe geschaffen
hatte, sind diese noch immer nicht aus der Illustration des Hirtenromans wegzudenken. Für die Ausgabe von 1787 hat Pierre-Antoine Martini die gesamte, 28 Szenen umfassende Folge nach den Gemälden sowie die Petits Pieds nach der Fassung des Grafen Caylus neu gezeichnet und gestochen. Davon abgesehen, daß die Originalplatten schon abgenutzt, wenn überhaupt noch verfügbar waren und alle bisherigen Nachstiche qualitativ deutlich hinter der ursprünglichen Fassung zurückgeblieben sind, hatte sich natürlich auch der Geschmack erheblich gewandelt. Vielleicht hat man die Kupfer vom Beginn des 18. Jahrhunderts mittlerweile als zu „barock“ empfunden, in Martinis Version, als Umrißradierungen en bistre, wirken sie jedenfalls edler als je zuvor, gleich zarten, feinlinigen Federzeichnungen, manchmal fast ein wenig skizzenhaft, dabei immer noch von großem Reichtum im Detail, doch nicht überladen. Auch wurden die Größen durch Martini vereinheitlicht, er eliminierte die Querformate, indem er diese in hochformartige Bildkompositionen übersetzte. Die vorliegenden Radierungen in Bister sind als das ideale Pendant zur typographischen Gestaltung konzipiert und passen hervorragend zu dem klaren Schriftbild dieser prächtigen klassizistischen Antiqua. Die Breitrandigkeit unseres Exemplars bringt das besonders schön zum Ausdruck, großzügig, aber nicht übertrieben, so daß Text und Bild in einem ausgesprochem guten Verhältnis zur Papiergröße stehen.
Zusätzlich enthält dieses Exemplar die Suiten von Gérard und Prud’hon avant la lettre; jede Tafel ist von dünnem Büttenpapier geschützt, auf dem die Bilderklärungen auf Griechisch, Latein und Französisch gedruckt wurden. Entnommen wurden die altsprachigen Texte wohl aus der griechisch-lateinischen Didot-Ausgabe des Jahres 1778, die Seitenangaben beziehen sich allerdings auf die höchst seltene griechische Ausgabe des Jahres 1802, für
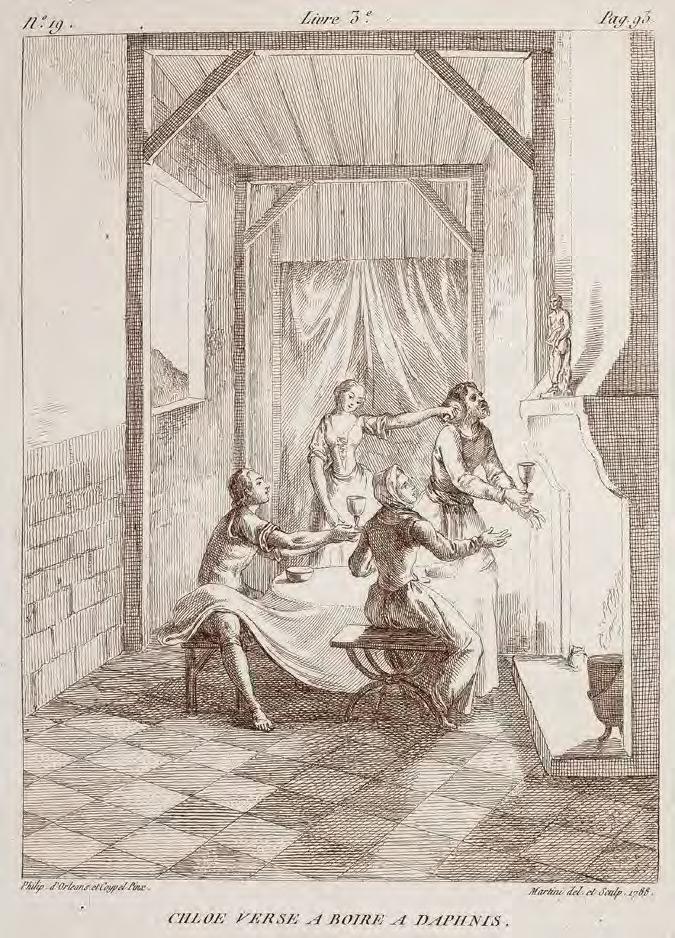
die diese Schutzblätter extra angefertigt worden sind (siehe unsere Nummer LXXIV, wo sie allerdings fehlen).
Wahrscheinlich englischer Provenienz, mit modernem Exlibris auf dem vorderen Spiegel, die Buchstabenligatur wohl auflösbar als „Fritz Castle“, vielleicht ein Verwandter des britischen Litera -
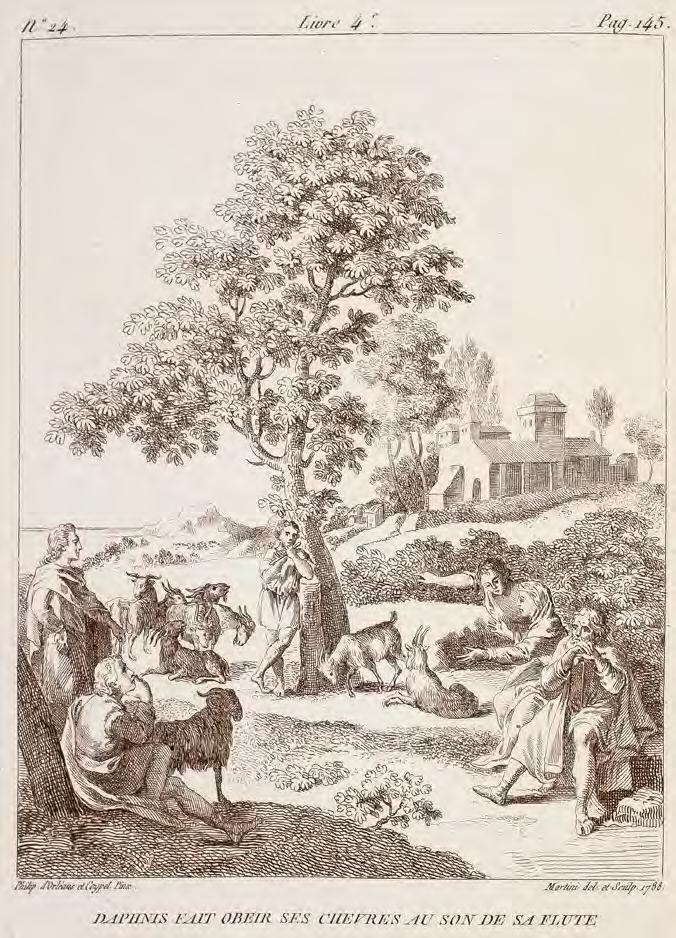
tenpaares Agnes und Egerton Castle, letzterer bekannt als Verfasser der English Book-Plates, die hierzu aber leider keine Auskunft geben.
Eines der höchst seltenen Exemplare mit den Abzügen Martinis en bistre.
Zur Bibliographie siehe unsere Nummer LIX .
Seltene späte Ausgabe mit der Regentensuite aus dem ersten Kalenderjahr der Revolution
LXV Longus. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Escrites en Grec par Longus, et translatées en François par Jacques Amyot. Lille, C. F. J. Lehoucq, 1792.?
Mit gestochenem Titel von G. Vidal nach A. Coypel und 29 Kupfertafeln nach der Regentensuite, einschließlich der Petits Pieds, ebenfalls von G. Vidal, alles in Nachstichen im Gegensinn.
XII, 211 Seiten (Vortitel, Titel und „Avertissement“, Haupttext und „Avis au relieur“ am Ende, S. 209–211), gedruckt auf bläulichem Papier.
Kollation: π 2 a4 A-Z4 Aa-Cc4 π 2 Oktav (176 x 117 mm).
Brauner Halbledereinband des 20. Jahrhunderts auf vier Bünden mit goldgeprägtem Rückentitel, blindgeprägten Fileten und Marmorpapierbezug auf Deckeln und Vorsätzen sowie Kopfgoldschnitt (oxydiert).
Hat man die große Reihe hervorragender Editionen und der sich vielfach auf sehr hohem künstlerischen Niveau bewegenden Leistungen ihrer Illustratoren gesehen, so wird die Enttäuschung angesichts dieser Ausgabe kaum ausbleiben können. Und dennoch hat auch sie das Interesse des Bibliographen, wenn nicht sogar des Bibliophilen, verdient. Ein Longus-Druck aus Lille, mitten in der Revolution erschienen, und dann auch noch mit dem alten Regentenzyklus versehen, ist in jedem Fall etwas Besonderes, zumal wir davon ausgehen dürfen, daß diesem eine der alten Ausgaben aus der Zeit zwischen 1718 und 1745 zugrunde lag. Hinweise in diese Richtung geben bestimmte Gestaltungsmerkmale, wie etwa der Anfang des ersten Buches mit der Kopfvignette (hier als einfaches
Feston in Holzschnitt) und der Trennungslinie oberhalb der Überschrift Livre premier (hier verdoppelt). Unmittelbar vorausgegangen ist ihr eine Ausgabe mit dem Regentenzyklus in derselben Fassung Vidals, die 1776 in Bouillon bei der Imprimerie de la Société Typographique erschienen ist, diese mit übereinstimmender Kollation und ebenfalls einer Avis au relieur am Schluß, allerdings in anderer Type gesetzt (vergleiche Anhang G).
Editions- und kulturgeschichtlich ist diese Wiederaufnahme der alten Illustrationsfolge und Textausgabe über ein dreiviertel Jahrhundert und die gravierenden Umbrüche hinweg als Kuriosum anzusehen. Die Tafeln des Régent wurden ebenso übernommen und erfreuten sich auch auf dem Höhepunkt der Revolution einer offenbar ungebrochenen Popularität.
Natürlich lagen die originalen Druckplatten hier nicht mehr vor, so daß man einen Nachstich in Auftrag geben mußte; es fand sich auch ein nicht unbedeutender Kupferstecher, der in der Reproduktionsgraphik routiniert war, Géraud Vidal (1742–1801), doch zeigt die sehr mittelmäßige Ausführung, die schon Cohen ebenso wie Lewine („indifferent plates copied from those of the Regent”) kritisierten, daß der Auftrag wohl nur von Vidals Werkstatt ausgeführt worden ist, daher auch das „direxit“ in der Stechersignatur. Die Tafeln wirken in der Tat, gerade im direkten Vergleich mit dem Vorbild, ziemlich ungefüge, doch sind sie immerhin auf festem Papier gedruckt und liegen in kräftigen, sauberen Abzügen vor. Auch läßt der schöne breitrandige Druck auf blauem unbeschnittenen Büttenpapier über einiges hinwegsehen, zumal das Exemplar in gutem Erhaltungszustand vorliegt.
Referenzen: Cohen/De Ricci Sp. 655. Quérard Bd. V, S. 351. Lewine S. 324. Sander Nr. 1234.



Die höchst seltene ausgabe des Jahres 1796, die wohl späteste mit der alten Regentensuite –in einem kolorierten Exemplar
LXVI Longus. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Escrites en grec par Longus, et translatées en François par Jacques Amyot. Edition enrichie des planches originales, dessinées et gravées par Philippe d’Orléans, Régent de France. Paris, Debarle, Imprimeur-Libraire, 1796.
Mit gestochenem Titel von B. Audran nach A. Coypel, datiert 1718, und 29 (davon 13 doppelblattgroße, hier hochformatig abgedruckte) Kupfertafeln von B. Audran, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans mit der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (hier ohne Signatur und Bezeichnung), alles in Drucken von den Nachstichen gegen 1745 und im Kolorit der Zeit um 1800.
2 Bl., 152 S. (Vortitel, Titel, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Avis au relieur“).
Kollation: π 2 A–I 8 K4 . Oktav (18,9 x 11,7 mm).
Marmorierter Kalblederband der Zeit auf glattem Rücken zu sechs Kompartimenten mit ornamentaler Kastenvergoldung, Deckelbordüre mit Filete und filigraner Ornamentleiste; Stehkantenfilete, Marmorpapiervorsätze, marmorierter Schnitt und türkisfarbenes Lesebändchen.
Die vorliegende Ausgabe ist bibliographisch kaum bekannt und ein besonderes Kuriosum: Bereits in der Direktoriumszeit erschienen und in Paris gedruckt, nicht in einer kleineren Stadt, wie unsere Nummer LXV, die 1792 in Lille erschienen ist, wiederholt sie nochmals den vollen Zyklus der Regentensuite, einschließlich Frontispiz und
Petits pieds – und zwar seitenrichtig sowie mit den alten Signaturen des Regenten und seines Stechers Audran, dazu der Jahreszahl 1714 auf den Tafeln (das Frontispiz mit Datum 1718). Es handelt sich hier, vergleicht man die bei Péreire (Notes 1926, S. 64–70) genannten Kriterien, um einen Abzug derjenigen Platten, die für die Ausgabe von 1745 geschaffen worden sind und die ihrerseits die Regentensuite möglichst exakt zu kopieren versuchten. Dem Verleger Debarle, sonst für politische Publikationen und Zeitschriften bekannt, muß es gelungen sein, die für die Ausgabe von 1745 gefertigten Platten der gesamten Suite zu erwerben. Die so entstandene Neuauflage ist der späteste Ableger der édition dite du Régent von 1718 mit einer Filiation des originalen Zyklus’, den wir kennen, von Reproduktionen neuerer Zeit einmal abgesehen. Darin liegt die Bedeutung dieser Ausgabe. Daß die Tafeln verbindlich zur Publikation gehören, erweist nicht nur der Untertitel (Edition enrichie des planches originales, dessinées et gravées [sic!] par Philippe d’Orléans), sondern auch die mitpaginierte Buchbinderanweisung am Ende mit den für sie vorgesehenen Einbindestellen.
Das recht dekorative, aber etwas summarische und durchaus naiv anmutende Kolorit aus der Zeit der Publikation verleiht den Darstellungen vollends den Charakter dessen, wie man sie in dieser Epoche bereits angesehen haben dürfte: Als gleichsam märchenhafte Bilderwelt einer längst vergangenen Zeit.
Die Provenienz nicht ermittelbar, der Einband etwas berieben, innen stellenweise leicht fleckig.
Referenzen: Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 319. Sander 1233 (Anmerkung; angeblich ein Nachdruck der Ausgabe von 1787, was jedoch unsinnig ist).

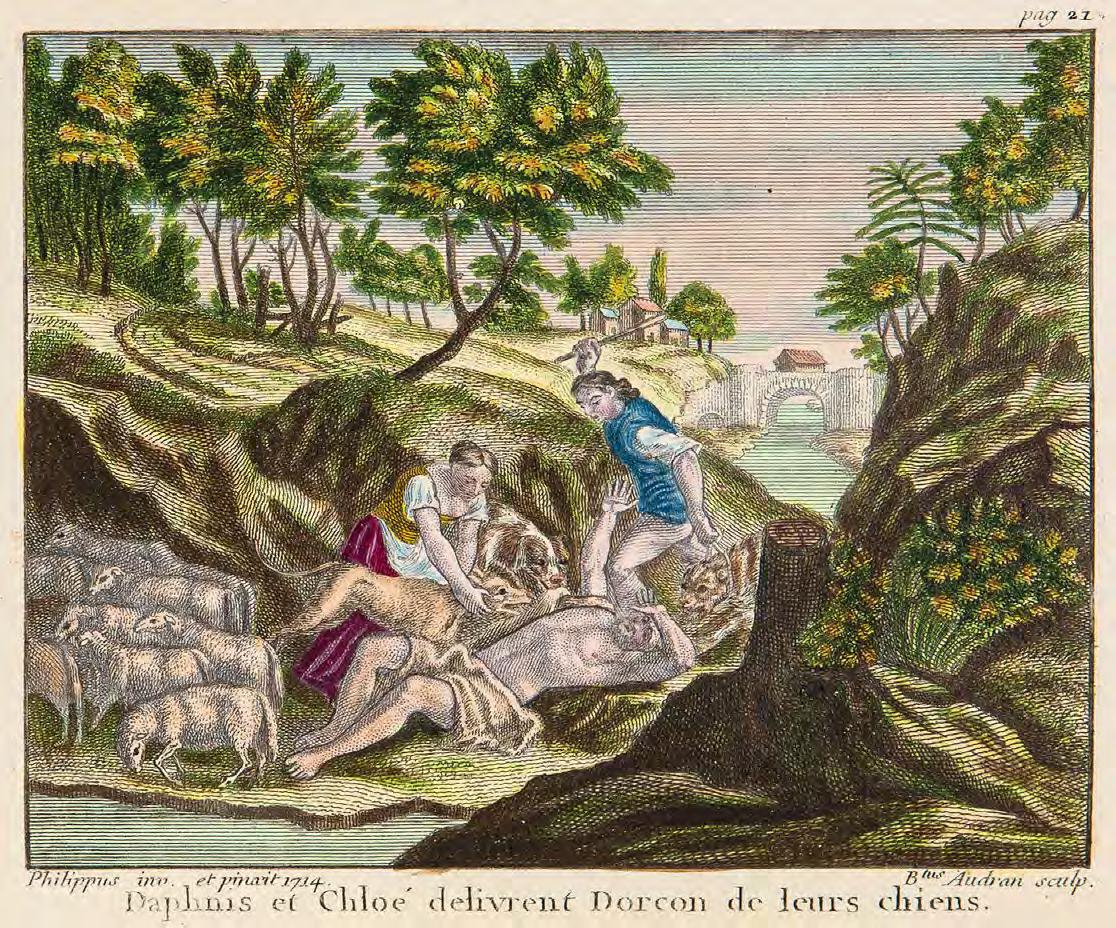
Exemplar Ripault mit den Kupfertafeln Monsiaus
avant la lettre in marmoriertem Kalbleder der Zeit
LXVII [Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Traduction nouvelle, par Pierre B** [Blanchard]. Avec quatre jolies figures dessinées par Monsiau, et gravées par Pauquet et Dupréel. Paris, [Suret für] Maradan [et] Desenne, „ An VI de la République“ [= 1798].?
Mit gestochenem Frontispiz und vier Kupfertafeln nach N.-A. Monsiau, gestochen von J.-B.-M. Dupréel (das Frontispiz sowie drei der Tafeln) und J. L. C. Pauquet (eine Tafel); alle avant la lettre.
XI, 169 Seiten.
Kollation: π2 a4 1–10 8 11 4 12 1 Klein-Oktav (149 x 100 mm).
Marmorierter Kalbledereinband der Zeit auf glattem Rücken zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben rotes Maroquinschild mit dem goldgeprägten Titel, die übrigen jeweils mit dichter, sehr feiner Vergoldung um ein zentrales Ringmotiv, mit floralen Elementen, teils in Pointillé, Deckel mit goldgeprägter Mäanderbordüre; Stehkanten in Pointillévergoldung, Innen kanten mit Schraffurbordüre, türkisfarbene Marmor papiervorsätze, grünes Seidenlesebändchen und Ganzgoldschnitt, im Stil des Jean-Claude Bozerian .
Die Ausgabe im sechsten Jahr des Revolutionskalenders wurde von dem Pariser Historienmaler und Illustrator Nicolas-André Monsiau (1754–1837) mit vier hübschen Tafeln und einem Frontispiz ausgestattet. Sie erschien in zwei Formaten, wovon diese die gesuchtere ist, weil es sich um eine Art Vorzugsausgabe handelt. Neben der Ausgabe in Sedez wurden einige Exemplare sur papier
vélin – wie hier vorliegend – gedruckt, de format petit in-8 carré, avec les figures avant la lettre et les eaux-fortes (so Cohen und De Ricci). Vermutlich wurden diesen Exemplaren in Klein-Oktav entweder die Tafeln in Ätzdruck oder im Zustand vor der Schrift beigegeben – letztere enthält unser Exemplar.
Die Illustration ist erkennbar in einer Form gehalten, die ganz den Wertvorstellungen bürgerlicher Moral entspricht, ohne jeden Anflug des Lasziven oder der Verspieltheit des Hirtenlebens im Spätbarock und Rokoko. Am Schluß führt Daphnis seine züchtig zu Boden blickende Chloé ins Brautgemach, von Musikanten und Tänzern geleitet. Ein durch und durch bürgerliches Paar, dessen geistiger Adel sich in Sittsamkeit widerspiegelt, hat gerade geheiratet, ein Blick hinter die Kulissen wird hier niemandem gestattet, die Anzüglichkeit der Petits Pieds scheint in weiteste Ferne gerückt, eine größere Distanz ist kaum denkbar. Anmut besitzen diese reizvollen Tafeln dennoch, alleine schon das Frontispiz, das eine Ansammlung von Hirtentieren um einen Brunnen zeigt, über der Quelle die Inschrift „Daphnis et Chloé“, darüber, als eine steingewordene Reminiszenz der Bukolik, die Büste Pans oder eines Satyrs. Substantielle ikonographische Neuerungen, die nicht nur Variation blieben, kamen bei der Bebilderung des Longus-Romans im späten 18. Jahrhundert offenbar bevorzugt in Kleinausgaben zum Tragen, man denke an diejenige von Moutard, Paris 1783, unsere Nummer LVI , oder die kleine Didot-Ausgabe aus dem an VII , illustriert durch Tafeln von Blanchard nach Binet, unsere Nummer LXIX .
Die Übersetzung stammt von dem Verleger und Herausgeber Pierre Blanchard (1772–1856), der in der Revolution als „Platon Blanchard“ oder „P. B**“ seine ersten literarischen Meriten, darunter auch als Übersetzer, erworben hat.
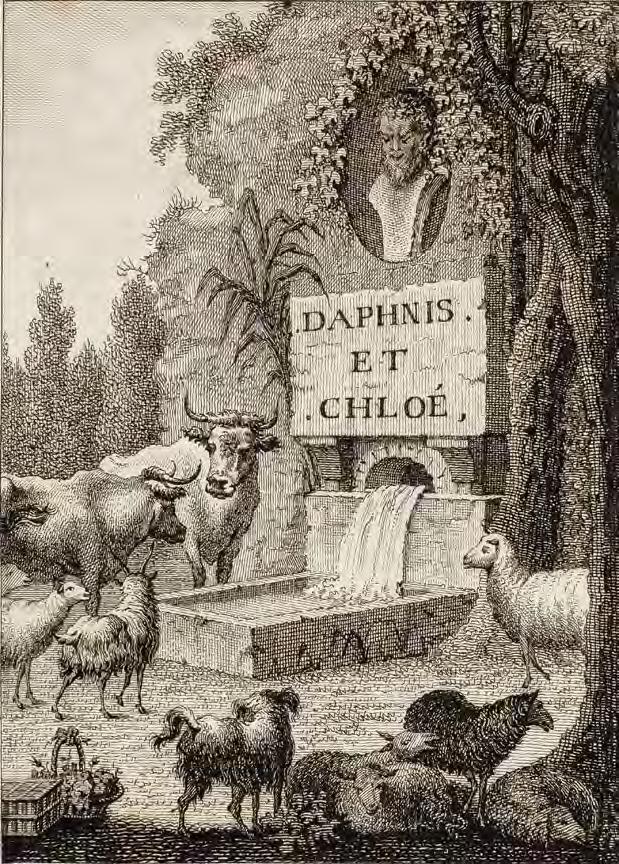
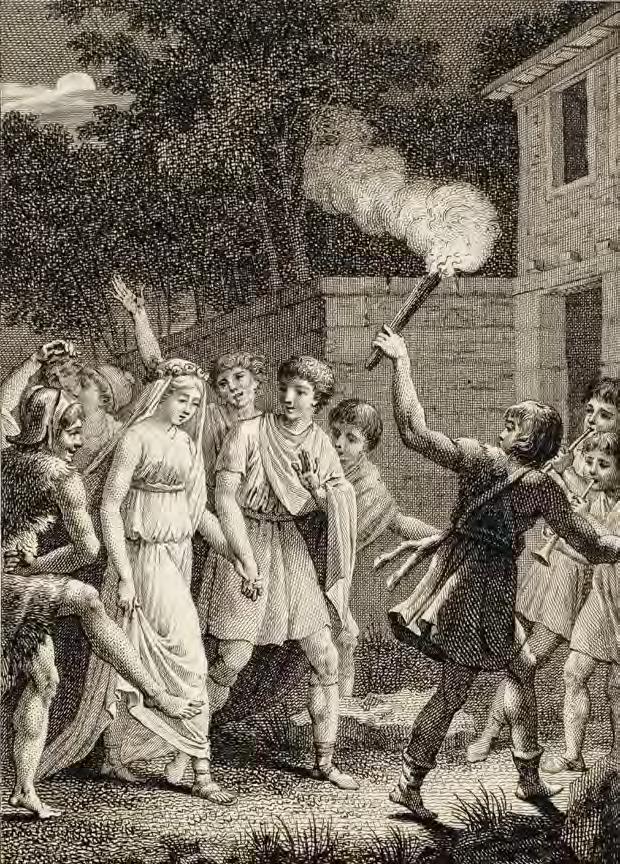
Laut Impressum im sechsten Revolutionsjahr gedruckt, könnte die Datierung in die Jahre 1797 oder 1798 fallen, doch wurde das Erscheinen im Prairial des Jahres, also Mai oder Juni 1798, im dritten Supplément der Gazette Nationale angezeigt, weswegen wir davon ausgehen dürfen, daß der Druck im Frühjahr 1798 entstanden ist.
Provenienz: Exlibris Ripault mit seiner Devise „D’espérer servira“ (in seinem Auktionskatalog, Bibliothèque Ripault 1924, Teil II , die Nummer 430: frs. 580,– Zuschlag).
Cohen/De Ricci Sp. 655. Barbier, Anonymes et pseudonymes, Nr. 21997. Portalis/Beraldi, Les graveurs, Bd. II , S. 92 (zu Dupréel). Portalis, Dessinateurs, S. 422. Gay/Lemonnyer Bd. I, Sp. 185. Lewine, Illustrated books, S. 324. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1236. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 534.
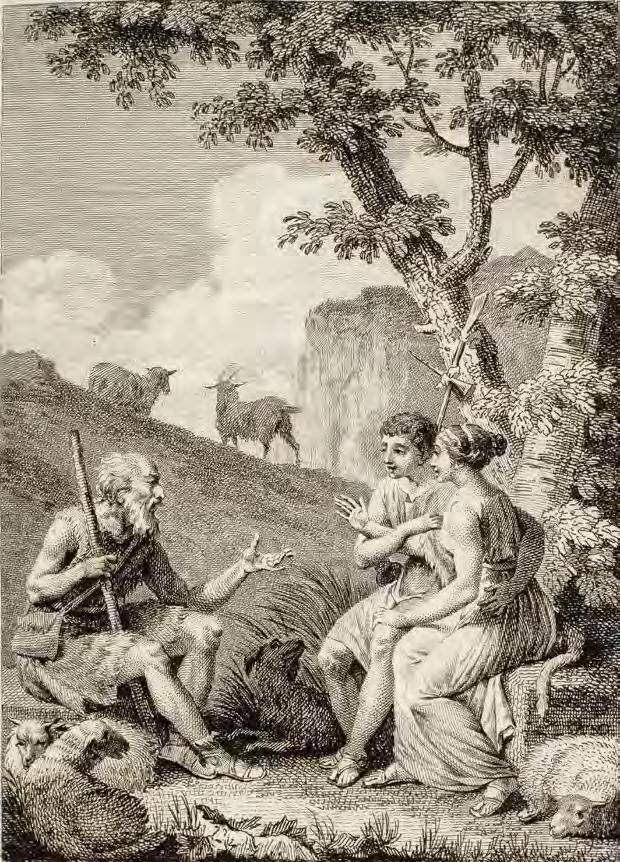
Drei separate Suiten Monsiaus:
Eau-forte pure – Avant la lettre –Koloriert
LXVIII Drei Suiten in losen Blättern zur Daphnis et Chloé-Ausgabe Paris, „An VI de la République“ [1798].
Jeweils mit gestochenem Frontis piz und vier Kupfertafeln nach N.-A. Monsiau, von J.-B.-M. Dupréel (das Frontispiz sowie drei der Tafeln) und J. L. C. Pauquet (eine Tafel): eine Suite in eauforte pure, eine avant la lettre sowie eine im Endzus tand und im Kolorit oder Farbstich der Zeit.
Oktav (155 x 102 cm)
Die reizvollen Täfelchen nach den Entwürfen Monsiaus wurden in bevorzugte Exemplare teilweise im Zustand avant la lettre und als eaux-fortes eingebunden, wie Cohen und De Ricci schreiben (Guide de l’amateur, Sp. 655), insbesondere in jene in Kleinoktav. Hier liegen sie in einer Papiergröße vor, die diesem Format entspricht; die drei Suiten waren also zur Ausstattung solcher Exemplare gedacht.
Jene in Ätzdruck zeigen einen sehr frühen Zustand, bei dem selbst die Stechersignaturen noch fehlen, die im Zustand vor der Schrift entsprechen den Tafeln in unserem Exemplar Nummer LXVII , und die sehr dezent, durchscheinend und fein, zweifellos in der Entstehungszeit kolorierten repräsentieren den idealen Endzustand: Beschnitten bis auf die Einfassungslinie, auf Trägerpapier montiert, von einem schmalen aufgeklebten Rahmen in Goldpapier gerahmt, dazu von einem ebenso breiten, auf den Träger gemalten grünen Rahmen mit schwarzen äußeren Linien eingefaßt. In dieser Form erinnern die Tafeln stark an Einlageblätter für Stammbücher und entsprechen damit ganz dem Zeitgeschmack der bürgerlichen Empfi ndsamkeit. Die sittsam anmutigen Darstellungen verlangten geradezu nach einer solchen Aufbereitung der Folge.
Ränder aller Tafeln ein wenig gebräunt und leicht stockfl eckig.
Höchst seltene Zusammenstellung dreier außergewöhnlicher Zustände der bedeutenden späten Illustrationsfolge.
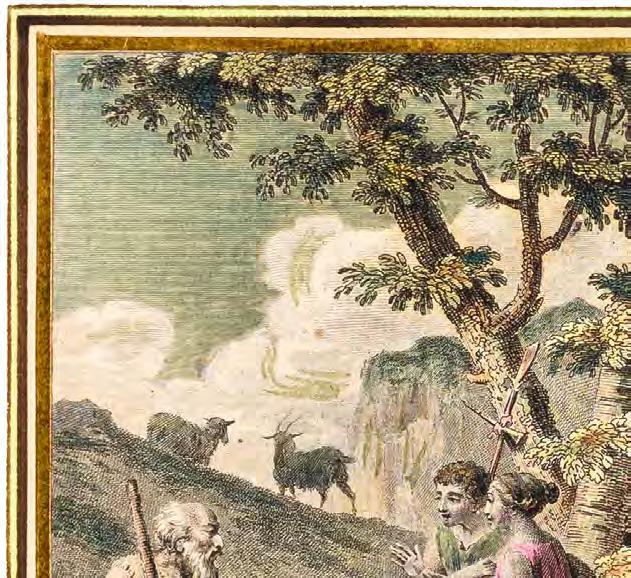
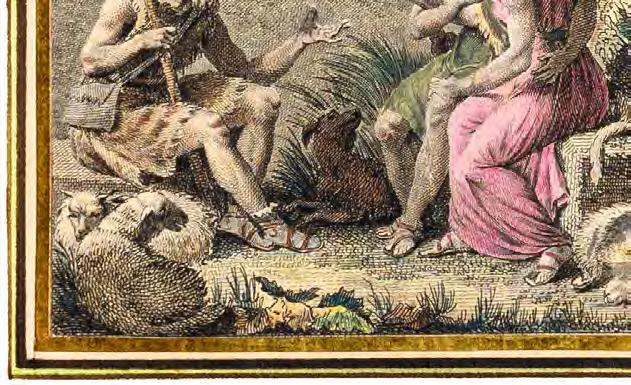

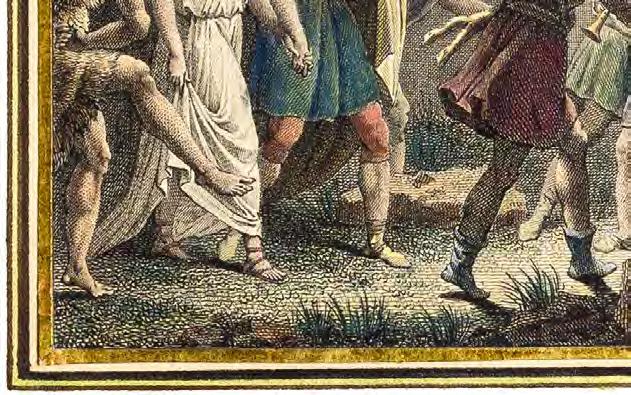
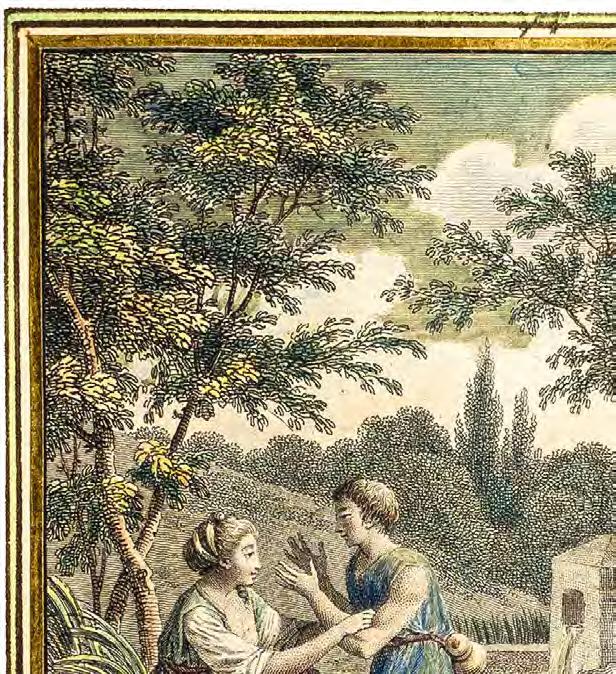
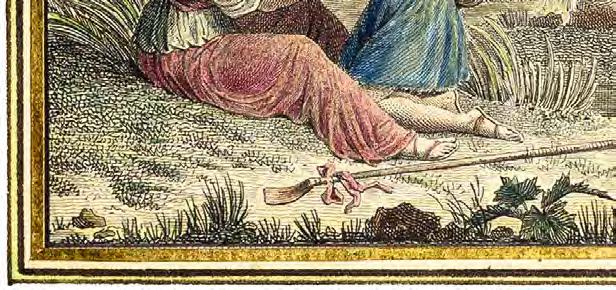
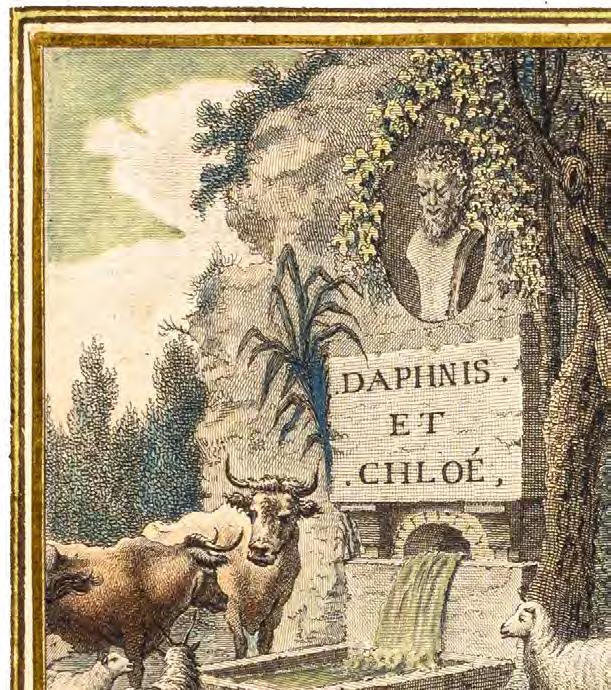

Ein Longus-Experiment Didots im Taschenformat: Regliertes Exemplar auf grossem Papier und in Stereotypiedruck –mit den Kupfertafeln nach Binet und vier Lichtdrucken
LXIX Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, P. Didot l’ainé, au Palais National des Sciences et Arts. L’an VIII (= 1799/1800).?
Mit fünf Kupfertafeln von J. A. Blanchard nach L. Binet. – Zusätzlich eingebunden vier Heliogravüren nach den Kupfertafeln von P. P. Prud’hon. VIII, 214 S. (Reihentitel, Titel, „Préface“ und Haupttext, sämtlich rot regliert und unbeschnitten). Kollation: π2 1–186 (letztes leer) Sedez, Papier im Format Klein-Oktav (140 x 94 mm).
Roter Halbmaroquineinband der Zeit um 1880 auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit floraler Rückenvergoldung im Stil des mittleren 18. Jahrhunderts, goldgeprägtem Titel sowie Verlegernamen mit Jahr im zweiten und dritten Kompartiment von oben, Deckel mit Filetenvergoldung und Buntpapierbezug; Marmorpapiervorsätze, grünes Seidenbändchen und Kopfgoldschnitt, signiert „David“.
Eine sehr seltene Ausgabe mit den entzückenden Kupferstichen von Binet. Zusätzlich wurden in das Exemplar wesentlich später vier gut dazu passende, in einem Lichtdruckverfahren hergestellte Reproduktionen eingebunden, die vier Kupfertafeln nach Prud’hon zeigen. Diese besondere Longus-Ausgabe sollte wohl eine Reihe eröffnen unter dem Titel: „L’Ornement des petites bibliothèques. Collection précieuse, en petit format, des plus jolis romans, et autres ouvrages choisis en vers et en prose.“ So
lautet jedenfalls der volle vorgebundene Reihentitel. Offenbar ist es bei dieser einen Ausgabe geblieben, was in der Literatur bislang fast keine Beachtung gefunden hat. Warum unser Exemplar nicht die fünf Tafeln enthält, die Cohen und De Ricci angeben, nämlich jene Stiche nach Nicolas-André Monsiau, die auch die Ausgabe von 1798, unser Exemplar Nummer LXVII , enthält, sondern die Suite nach Zeichnungen von Louis Binet, die eigentlich in die Pariser Ausgabe des Jahres 1795 gehört, entzieht sich unserer Kenntnis. Denkbar ist, daß der Verleger mit verschiedenen Illustrationsmöglichkeiten experimentierte, die in dieser Zeit im kleinen Format zur Verfügung standen. Dafür spricht, daß derartige reglierte Exemplare oft jene Arbeitsexemplare der Verleger sind, die aus dem Stadium der Formfindung stammen. Insofern ist es ohne weiteres denkbar, hier ein Exemplar vorliegen zu haben, bei dem die endgültige Illustration noch nicht feststand, nur die Anzahl der Tafeln, die ja in beiden Fällen dieselbe ist. Reynaud schreibt in seinen Nachträgen zu Cohen/De Ricci (Notes supplémentaires, Sp. 319), die Ausgabe sei ohne Illustration erschienen, was wahrscheinlich auch so gewesen ist. Laut van Praet (Livres imprimés sur vélin, Bd. II , Nr. 435) wurden auch Exemplare auf Pergament hergestellt, darunter eines, das die Regentensuite enthalten hat und sogar mit dessins originaux. Auch das würde den von uns angenommenen experimentellen Charakter bestätigen, die für diese Ausgabe adäquate Illustration zu finden. Vorbild für Didots Edition im kleinen Format waren die Klassikerausgaben, die er für den Buchhändler Bleuet gedruckt hat (vgl. Fürstenberg, Das französische Buch, S. 118).
Die Sedezausgabe entstand als Pendant zur gleichzeitigen Quartausgabe als eine Art Seitenstück, ein feiner, kleiner Begleiter des repräsentativen Flaggschiffs. Darüber hinaus ist sie einer der

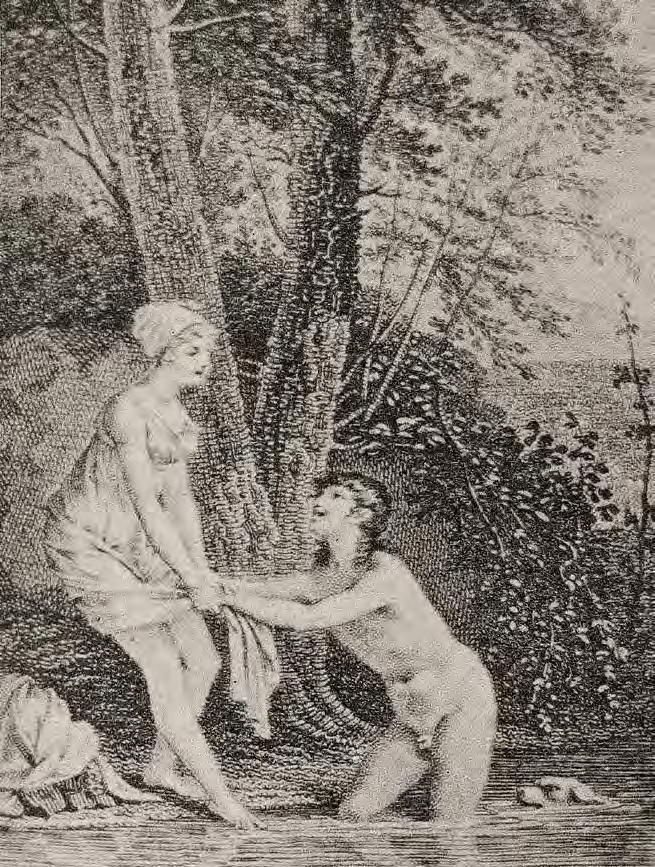

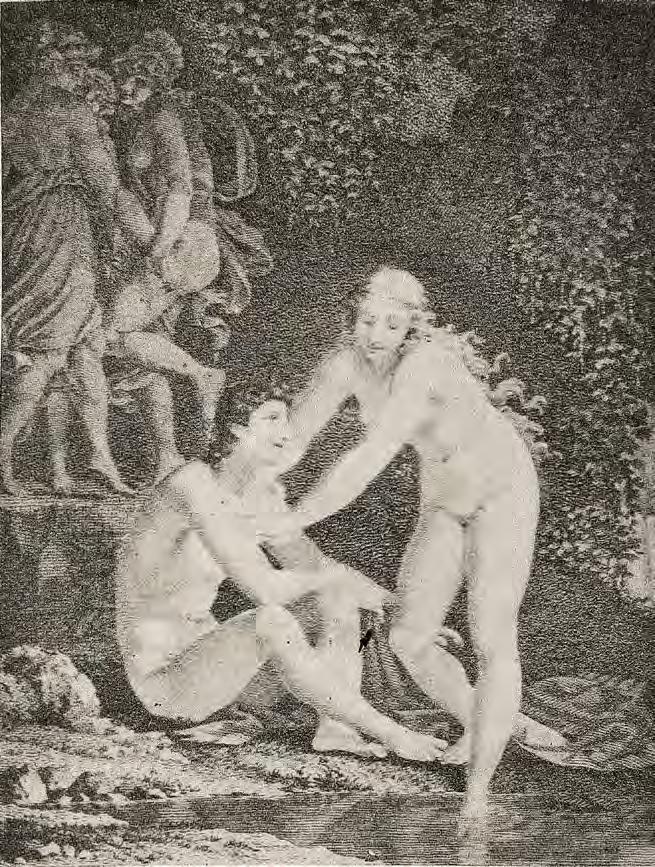
ersten Didot-Drucke, die im Verfahren der Stereotypie hergestellt wurden, einer Technik, bei der die in beweglichen Lettern gesetzten Druckseiten mit Hilfe von Matrizen und Abgüssen von diesen in einer Metalllegierung zu kompletten Buchdruckplatten umgeformt werden. Dieses Druckverfahren hat die Familie Didot nicht erfunden, es gab einige Vorläufer und Versuche im 18. Jahrhundert, doch sie hat es um das Jahr 1800, gleichzeitig mit Stanhope in London, zu einer gängigen Technik weiterentwickelt, die große Verbreitung erlangt hat. Diese kleine Longus-Ausgabe gehört zu den frühesten Zeugnissen des Einsatzes dieser Technik.
Hübsches, bestens erhaltenes Exemplar, in dem alle Textseiten regliert und unbeschnitten sind. –Die wohl in Heliogravüre nach Photographien hergestellten Tafeln wurden dem Exemplar sicherlich gleichzeitig mit dem Einband, also um 1880, beigebunden, als dieses Edeldruckverfahren erfunden worden ist. Der Buchbinder, dessen abgekürzter Vorname in der Signatur nicht mehr lesbar ist, war wohl Bernard David (1824–1895), ein Schüler unter anderem von Lortic und Gruel (vgl. Fléty, Dictionnaire des relieurs, S. 53).
Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 656. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 319. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1236, Anmerkung zur Ausgabe Paris 1798: „Autre édit. avec les mêmes figg. De Monsiau et le frontisp. Par Dupréel de l’Imprim. De P. Didot l’aîné, l’an VIII (1800), in-18.“ Portalis, Dessinateurs, Bd. I, S. 10 (zu Binet und der Ausgabe 1795). Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1159. Monglond, La France révolutionnaire et impériale, Bd. V, Sp. 160/61. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 534.

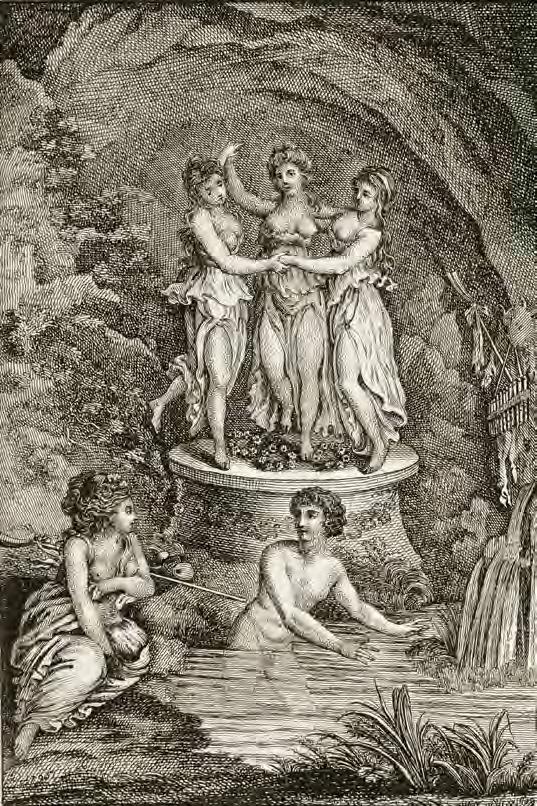
Die monumentale Ausgabe von 1800, in rotem Halbmaroquin von Allô
LXX Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy; alle avant la lettre.
VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext).
Kollation : π4 1–25 4 Quart, auf Papier im Format Folio (316 x 238 mm).
Roter Halbmaroquineinband um 1870 auf fünf Bünden zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben der goldgeprägte Titel, am unteren Kapital Erscheinungsort und -jahr, die übrigen Kompartimente mit reicher ornamentaler Goldprägung, im Zentrum zwei von einem Pfeil durchbohrte Herzen in Medaillonform, darüber ein Kranz, umgeben von feinstem Rankenornament; Deckel mit doppelten Fileten, Marmorpapiervorsätze und Kopfgoldschnitt, fliegendes Vorsatz links oben geprägt „Allô“.
Vorzügliches Exemplar im Meistereinband aus der mit den brillanten Kupfertafeln Prud’hons und Gérards ausgestatteten Ausgabe, erschienen bei Pierre Didot. Diese Ausgabe, das darf bei der Würdigung ihrer hervorragenden Illustratoren nicht übersehen werden, ist zunächst einmal ein Meisterwerk der Typographie, ein Zeugnis äußerst großzügiger Buchgestaltung, die in bereits längerer Auseinandersetzung mit dem Schaffen Bodonis zu dieser gleichsam zeitlos-monumentalen Form gefunden hat, einer Jahrhundertausgabe würdig. Zugleich ist sie ein anschauliches Zeitzeugnis des besonders strengen, fast völlig auf Ornament verzichtenden
Stils der Druckkunst im Empire, ein Höhepunkt, ganz den Idealen verpflichtet, die die Druckerfamilie Didot schon früher formuliert hatte – und die natürlich nach einer adäquten Form der Illustration verlangten: „Didot, whose 1784 Epître sur le progrès de l’imprimerie had looked forward to a break with the ornamental tradition of the eighteenth century and to the introduction of a new, simpler, style, had chosen his artists with care.“ (Barber, Daphnis and Chloe, S. 49).
Pierre Paul Prud’hon (1758–1823), der eigentlich nur aus Armut seine ersten Aufträge als Buchillustrator annahm, ist, seiner geringen Anzahl von Illustrationen zum Trotz, als „the outstanding book artist of the turn of the century“ zu würdigen (Ray, The Art of the French Illustrated Book, S. 130). Daphnis et Chloé war nach dem Zyklus zu Bernards Oeuvres, erschienen 1797, sein zweites Projekt für Didot, und obwohl sich insbesondere seine von eigener Hand gefertigte Radierung zu Phrosine et Mélidore großer Beliebtheit erfreute, durfte er zum Longus nur die ersten drei Sujets beisteuern, während Gérard sein Können auf sechs Tafeln unter Beweis zu stellen vermochte. Der Grund dafür mag vielleicht darin liegen, daß David, der wie kein zweiter Einfluß auf die Künstler und die ästhetischen Maßstäbe seiner Zeit ausübte und die Familie Didot in künstlerischen Dingen beriet, Prud’hons Werke nicht genügend zu schätzen wußte, da dieser seinen theoretischen und praktischen Lehren in mancher Hinsicht widersprach.
Prud’hon sollte erst später zu seinem verdienten Ruhm kommen, doch finden wir hier einen frühzeitigen Beweis für sein enormes Talent, dem schon Portalis und Beraldi hohe Anerkennung zollten: „Qui ne connaît, dans le Daphnis et Chloé de Didot, les trois vignettes du Chevrier, du Bain et la Cigale? Sans parler de leur mérite comme composition, ce sont
les plus parfaites qu’ait produites l’art de la gravure au pointillé. Jamais Prud’hon ne fut mieux rendu.“ (Portalis/Beraldi, Les graveurs, Bd. III, S. 396); Ray führt das noch weiter aus: „Two of Prud’hon’s three designs for this book are undisputed masterpieces. In the first, Daphnis … taking advantage of the occasion, insinuates his hand into Chloe’s bossom, from which he withdraws the pretty grasshopper (p. S. 29).
In the second, Chloe leads Daphnis to the cavern of the Nymphs … and … herself washes his handsome body (p. 38). The harmless sensuality of first love had never been so winningly conveyed, even by Prud’hon himself”. Für die Illustrationen Gérards findet Ray allerdings weniger wohlwollende Worte: “…the figures seem rigid, the compositions posed, and the atmosphere cold” (ebenda).
So wahr Rays Worte über Prud’hon sind, so verkehrt sind sie in Bezug auf Gérard, dessen Werke heutzutage nicht umsonst zu den höchstbezahlten aus der Zeit um 1800 gehören. Seinen Illustrationen wohnt eine unvergleichliche Noblesse und Anmut inne, die Ray fälschlicherweise als Kühle und Steifheit interpretiert.
Ein edles Exemplar in einem Einband des Pariser Meisters Charles Allô (1824–1890), der um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein Atelier in der Rue Dauphine besaß, danach in der Rue du FourSaint-Germain arbeitete. Bei der prächtigen Rükkenvergoldung lehnt Allô sich deutlich an den Stil der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an, das
Motiv der vom Pfeil durchbohrten Herzen zeigt beispielsweise unser Exemplar Nr. XIII (Derome, um 1785).
Provenienz: Mit dem Exlibris von Antoine Bordes, dem Neffen des bedeutenden Bibliophilen und Sammlers Henri Bordes aus Bordeaux. Aus dessen Nachlaß hat Antoine einen Teil seiner exquisiten Bibliothek geerbt.
Die ersten Lagen sind minimal stockfleckig, davon abgesehen ein schönes, sauberes Exemplar, gedruckt auf großem papier vélin , das im unbeschnittenen Zustand immens breite Ränder hat.
Bibliographische Referenzen zur lateinischen Quart-Ausgabe des Jahres 1800: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 656 f. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 320. Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, S. 515. Boissais/Deleplanque, Le Livre à gravures, S. 116. Portalis/Beraldi, Les graveurs, Bd. III , S. 396 (zu Prud’hon), und S. 405, zu Roger. Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1158 f. Ebert, ABL , 12246. Gay/Lemonnyer, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, Bd. I, Sp. 184. Vicaire, Manuel de l’amateur, Bd. V, Sp. 384. Monglond, La France révolutionnaire et impériale, Bd. V, Sp. 159. Lewine, Illustrated books, S. 325. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1237. Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 532 (gibt als Format fälschlich Oktav an).
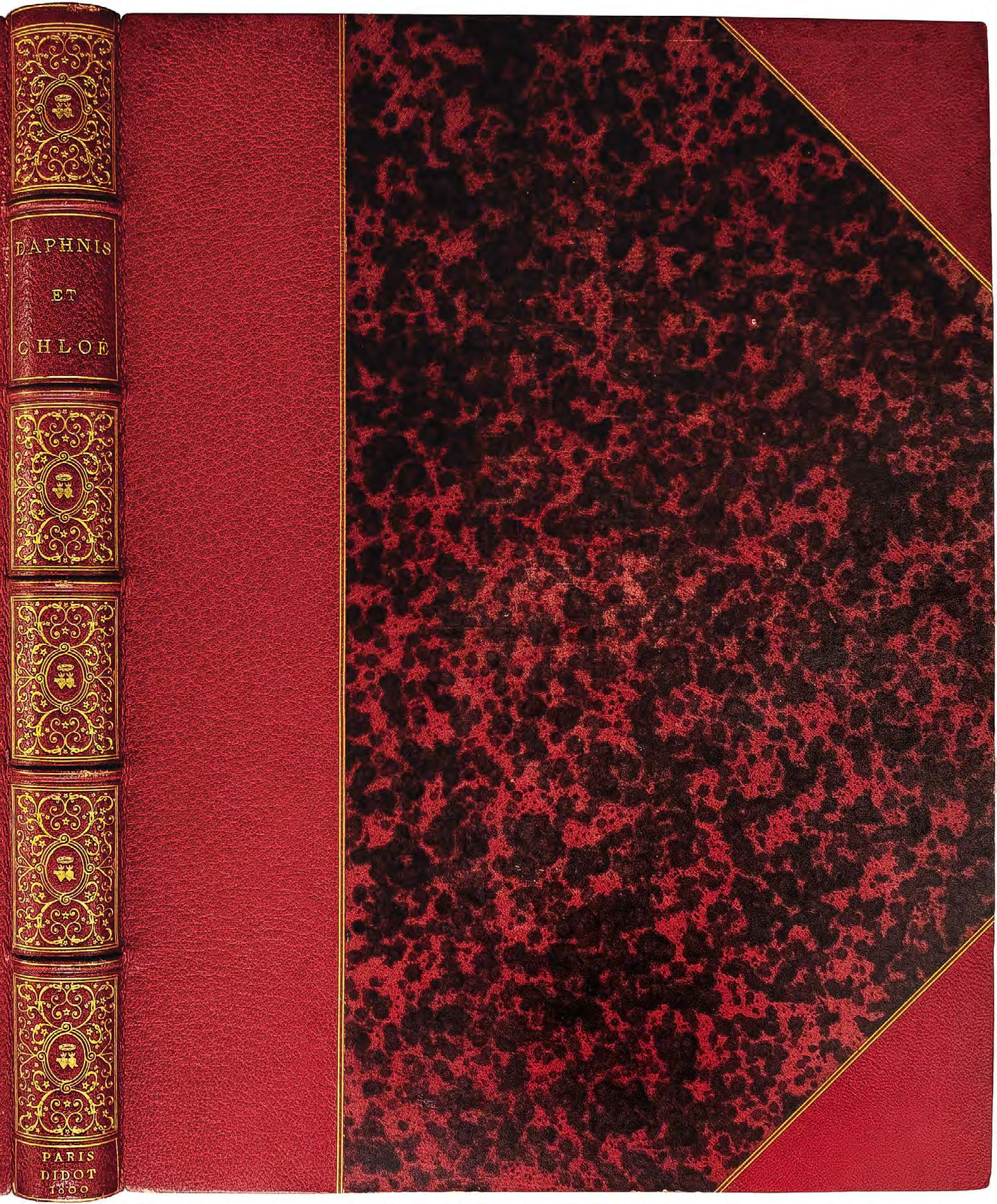
Exemplar in orangefarbenem Halbmaroquin von Cuzin, mit dem äusserst Seltenen Original-Umschlag und unbeschnitten
LXXI Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy; alle avant la lettre.
VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext). – Der Original-Vorderumschlag beigebunden.
Kollation : π4 1–25 4 Quart, auf Papier im Format Folio (320 x 240 mm).
Orangefarbener Halbmaroquineinband der Zeit um 1870 auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, im zweiten von oben der goldgeprägte Titel auf einem bordeauxfarbenen Maroquinschild, im dritten ein moosgrünes Maroquinschild mit den Erscheinungsdaten und ornamentaler Vergoldung, die übrigen Kompartimente reich im Pointilléstil vergoldet, mittig je eine kleine Intarsie in Form eines Vierpasses, abwechselnd in rotem und grünem Maroquin; Deckel mit Fileten, breiten Maroquinecken und marmoriertem Buntpapierbezug, Marmorpapiervorsätze, Seidenlesebändchen und Kopfgoldschnitt, signiert Cuzin .
Dieses schöne Exemplar ist gebunden in einer der seltensten Maroquinfarben und zudem mit dem kaum auffindbaren Vorderumschlag ausgestattet. Aber nicht nur dessen bloßes Vorhandensein ist von Bedeutung, der Umschlag offenbart bei näherer Betrachtung auch noch Interessantes. Zwar wieder-
holt er wie üblich das Titelblatt, doch mit bezeichnenden Abweichungen: indem zu seiner Gestaltung die volle Papiergröße ausgeschöpft wird, sind hier sämtliche Typen, ja selbst die kalligraphierte Vignette, deutlich vergrößert. Hätte man aus dem Buchblock bei rigider Beschneidung auch ein handliches normales Quartformat herstellen können, in dem selbst die Radierungen noch Platz gefunden hätten, so erweist sich anhand dieses Broschurtitels, daß das der Verleger so gerade nicht vorgesehen hat. Das Großquart-Format ist als solches intendiert, es soll wirken wie ein „Druck auf großem Papier“: eine Großzügigkeit, die ihre Entsprechung in Satz und Schriftbild findet, insbesondere das in einer größer kaum vorstellbaren Type gesetzte Vorwort des Longus gibt der Ausgabe eine ungemein würdevolle Eröffnung. Ein herrliches Beispiel für die Didone, die im Hause Didot entwickelte klassizistische Antiqua. Diese Schrift benötigt zur Entfaltung ihrer ganzen Wirkung Raum, interlinear, wie auch hinsichtlich der sie umgebenden Ränder. Der Broschurtitel, den der Buchbinder gewöhnlich vor sich liegen hatte, bevor er seine Arbeit begann, gab diesem also vor, wie der Verleger Schnitt und Bindung wünschte, und das heißt hier vor allem: so großzügig wie möglich.
Es ist schier unglaublich, daß im selben Jahr „An VIII “ bei Didot zwei Ausgaben dieses Textes gedruckt worden sind, deren Schriftbild sich noch dazu gleicht, die aber in zwei derart extrem unterschiedlichen Formaten und Schriftgrößen produziert wurden. Pierre Didot, den man den Älteren nennt, war hier offenbar bestrebt, mustergültige Drucke für verschiedene Formate vorzulegen. Und Weiteres sagt uns der Broschurtitel auch noch: „Édition ornée de gravures d’après les dessins de Prudhon et Gérard“, was darauf hindeutet, daß die Illustration erst nach Anfertigung des Textdrucks festgelegt worden ist. Deshalb fehlt sie wohl auf

dem Drucktitel noch, während sie der sicherlich als Abschluß produzierte Broschurtitel nennt.
Die schönen, gratigen Abzüge liegen auch hier sämtlich avant la lettre vor. Gerade in diesen sauberen und tiefschwarzen, die Darstellung in ihren vollen Hell- und Dunkelwerten in bester Form wiedergebenden Drucken erweist sich die immense Qualität der Werke beider Illustratoren.
Als Meisterwerk des großen Buchbinders Cuzin, bezeugt durch die Stempelsignatur an der linken oberen Ecke des fliegenden Vorsatzes, erweist sich der Einband insbesondere in seiner Rücken-
motivik à la fanfare, in feinster, sehr dichter Flächengestaltung unter reicher Verwendung der Pointillé-Technik, dazu mit verschiedenfarbigen Maroquin-Intarsien, die durch ihren spitzen Umrisse Akzente setzen.
Abgesehen von einer kleinen Fehlstelle auf dem Vorderdeckel (im Buntpapier), tadellos und flekkenfrei erhalten, der Vorbesitz nicht ermittelbar. –
Unbeschnittenes Exemplar in der vollen Papiergröße.
Für die bibliographischen Angaben siehe unsere vorangehende Nummer.
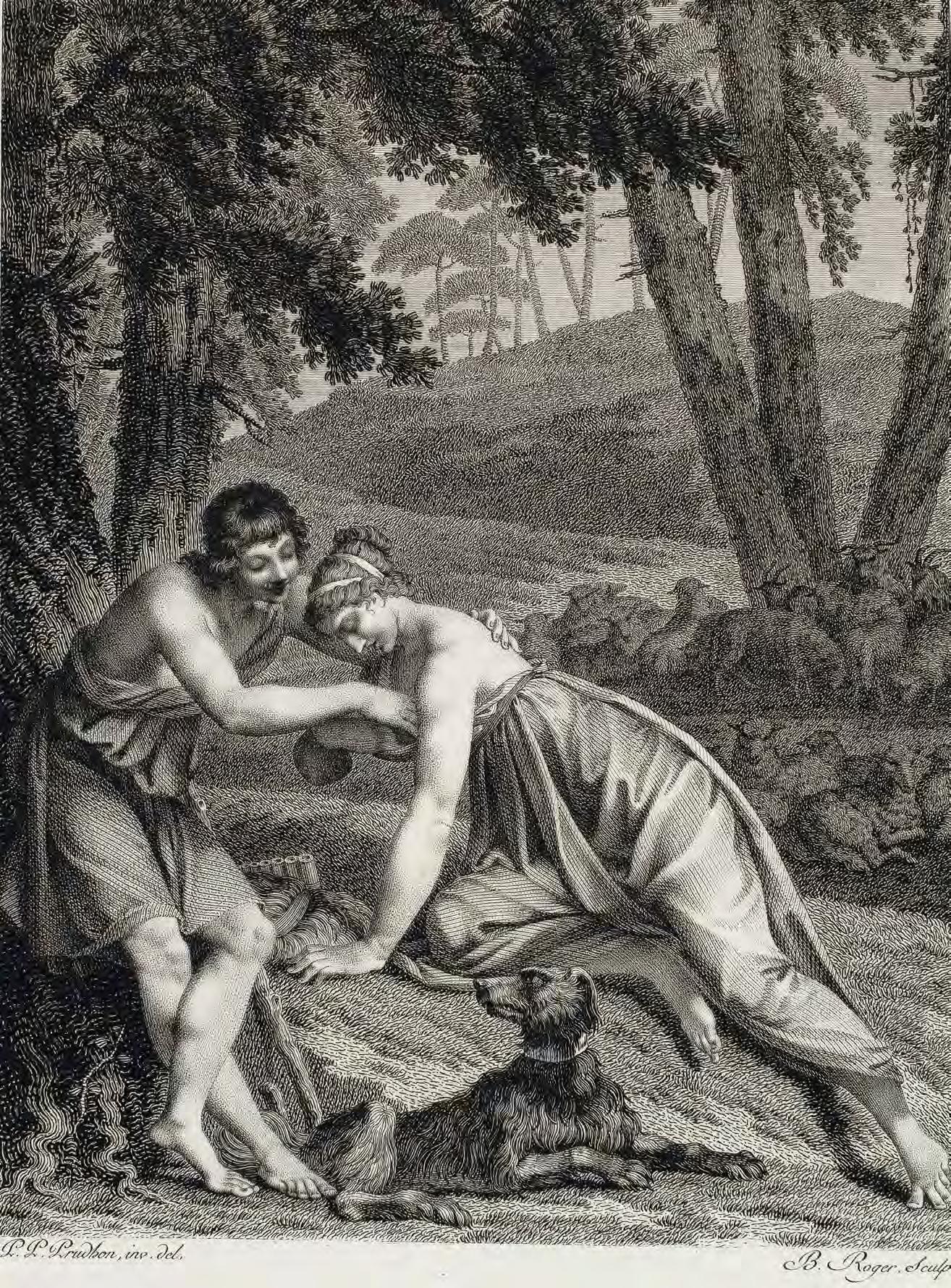

Das Exemplar des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen im ersten bekannten Einband mit einem Etikett von G. F. Krauss
LXXII Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy; alle avant la lettre.
VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext).
Kollation : π4 1–25 4 Quart, auf Papier im Format Groß-Quart (302 x 226 mm).
Roter Halbmaroquineinband der Zeit auf glattem Rücken zu sieben Kompartimenten, unterteilt mittels friesartiger Bänder mit schmalen und breiten vertikalen Elementen im Wechsel, alle Kompartimente von perlstabartigen Goldpunktreihen gerahmt, im zweiten und fünften je ein grünes Maroquinschild mit dem goldgeprägten Titel und dem Namen des Übersetzers, die anderen Kompartimente reich vergoldet, zentral das ligierte Monogramm des Albert von Sachsen-Teschen („ AS “), umgeben von einer Aureole; Deckel mit kleinen Maroquinecken und rotem Papierbezug, Marmorpapiervorsätze, Lesebändchen aus blauem Tabis, der fliegende Vorsatz gestempelt: „G. F. Krauss, Relieur à Vienne“. Dieses Exemplar stammt aus der bedeutenden Bibliothek von einem der größten Kunstsammler des 18. und frühen 19. Jahrhunderts: Herzog Albert von Sachsen-Teschen (1738–1822) hat nicht nur eine der größten Graphiksammlungen der Welt
zusammengetragen, sondern auch eine der prächtigsten Bibliotheken Europas aufgebaut, die insgesamt 25.000 Bände umfaßte. Der Herzog und seine Frau Marie Christine blieben kinderlos, daher ernannte er Erzherzog Karl von ÖsterreichTeschen zu seinem Erben, über den die gesamte Sammlung schließlich in den Besitz von Friedrich von Österreich-Teschen (1856–1936) gelangte.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Erzherzog Friedrich durch das Habsburgergesetz enteignet, wodurch sein Wiener Wohnsitz und die Albertina samt ihrer gigantischen Sammlung, die Teil einer Stiftung waren (Erzherzog-Friedrich-Fideikommiß), an den österreichischen Staat übergingen. Die Bibliothek allerdings befand sich in seinem Privatbesitz und durfte nicht enteignet werden. Sie wurde letztendlich auf Auktionen veräußert und so in alle Winde zerstreut (herzlichen Dank).
Albert von Sachsen-Teschen ließ einige der besten Buchbinder für sich arbeiten, die die Bände seiner Bibliothek einheitlich mit prächtiger Rückenvergoldung und seinem Monogramm ausstatteten, doch leider sind die wenigsten Bände signiert. Tatsächlich ist dies eines der wenigen bekannten Exemplare mit dem Etikett des bedeutenden Wiener Buchbinders Georg Friedrich Krauss. „The fact that Krauss worked for Duke Albrecht, now documented by the above binding, has so far remained unknown, and our reproduction will enable the identification of other bindings from the duke’s library” (Katalog Martin Breslauer). Ein weiteres Exemplar mit dem Krauss-Etikett besitzt die Bayerische Staatsbibliothek in München (im Katalog Außen-Ansichten: Bucheinbände aus 1000 Jahren , Wiesbaden 2006, Nr. 82), die es ebenfalls bei Breslauer erworben hat.
Provenienz: Aus der Bibliothek des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen mit seinem Monogramm auf dem Buchrücken, auf dem Vorsatz das
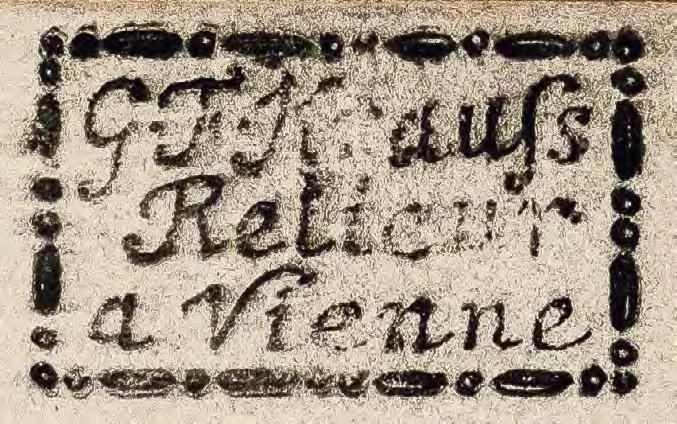
Exlibris des Wiener jüdischen Industriellen Oscar L. Ladner (1873–1963), der eine kostbare Bibliothek und eine umfangreiche Kunstsammlung besaß, mit Datum 1916, sowie ein modernes Exlibris mit dem Monogramm „R. D.“ Letzter Provenienznachweis: Catalogue Martin Breslauer 110, 1990, Nr. 167.
Alle Tafeln avant la lettre auf blütenweißem Papier gedruckt und mit den serpentes. – Die bibliographischen Referenzen unter unserer Nummer LXX .
Ein Exemplar in makelloser Erhaltung aus einer der bedeutendsten Bibliotheken der Zeit.
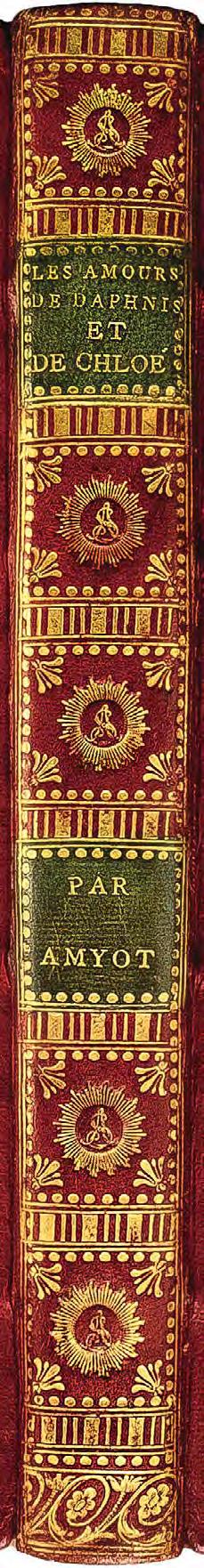
Exemplar mit drei
Originalzeichnungen in einem Meistereinband von René Kieffer
LXXIII Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy; alle avant la lettre. – Zusätzlich eingebunden: Eine Originalzeichnung nach P. P. Prud’hon und zwei Originalzeichnungen nach F. Gérard, alle drei in schwarzer Kreide mit Weißhöhungen auf graublauem Papier, weiterhin zwei Lithographien auf China von F. Noel und C. Motte, beide nach A.-J.- Desenne, und eine Kupfertafel auf China von J. P. Larcher nach L. Hersent.
VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext – unbeschnitten).
Kollation : π4 1–25 4 . – Dazu je drei von Kieffer vorne und hinten eingebundene Vorsatzblätter mit Wasserzeichen „Annonay M. L. C.“ Quart, auf Papier im Format Groß-Quart (318 x 240 mm).
Dunkelgrüner Maroquineinband der Zeit um 1900 auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, davon fünf mit reicher Kastenvergoldung in Kombination von geometrischen und floralen Formen, ein Kompartiment mit dem goldgeprägten Titel, eingerahmt von doppelten Fileten, am Fuß der Erscheinungsort und das -jahr in goldgeprägten Lettern; Deckel mit üppigster Vergoldung: äußere Einfassung mit Doppelfieten, daran eine breite ornamentale Bordüre mit Eckfleurons sowie doppelte innere Fileten, die sich jeweils in den Ecken kreuzen, mittig eine rautenförmig verlaufende Kette aus Lilien-
blüten, in den Ecken durch je ein Ornamentstück verbunden, das aus Rauten, Lorbeer und anderen Elementen besteht, die Ketten zudem überlagert von zwei längeren Querrechtecken, ihrerseits von Doppelfileten gerahmt und ausgefüllt von einem floralen Bordürenmuster, breite Innenkantenbordüren mit insgesamt vier Fileten und zwei Eckfleurons, grüne Marmorpapiervorsätze und Kopfgoldschnitt; signiert Réne Kieffer, in Halbmaroquinschuber.
Ein herausragendes Exemplar, das nicht nur mit allen Tafeln Gérards und Prud’hons im frühen Avant-la-lettre-Zustand ausgestattet ist, sondern dem auch noch drei Originalzeichnungen beigegeben worden sind, gefertigt offenbar als vorbereitende Skizze zu den Lavis der beiden Künstler –die eine nach Prud’hon, die anderen beiden nach Gérard. Es ist anzunehmen, daß diese drei Zeichnungen, wenn nicht von den Künstlern selbst, von einem der Radierer oder einem anderen künstlerisch versierten Mitarbeiter Didots stammen, der die Skizzen beider Künstler getreu kopierte, um die graphische Illustration des Werks zu veranschaulichen. Daher sind sie im Gegensinn ausgerichtet, spiegelverkehrt gegenüber den Entwurfszeichnungen, die erhalten und bekannt sind, aber seitenrichtig zu den Graphiken. Wir befinden uns hier in einem wichtigen Zwischenstadium des Illustrationsprozesses, bei dem die teils sehr freien ersten Entwürfe in konkrete Vorlagen übergeführt werden; erst solche waren für den Stecher umsetz- und reproduzierbar. Sehr schön ist das etwa anhand der Badeszene nachvollziehbar. Das gegen 1793 entstandene Original Prud’hons, das sich heute in Chantilly, im Musée Condé befindet (Inv. DE 497), wirkt noch erheblich freier, skizzenhafter, als unsere Zeichnung, die bereits die Formen, insbesondere die Umrisse der Personen, schärfer erfaßt, anordnet und so die Wirkung der Darstellung veranschaulicht, wie sie in der graphischen
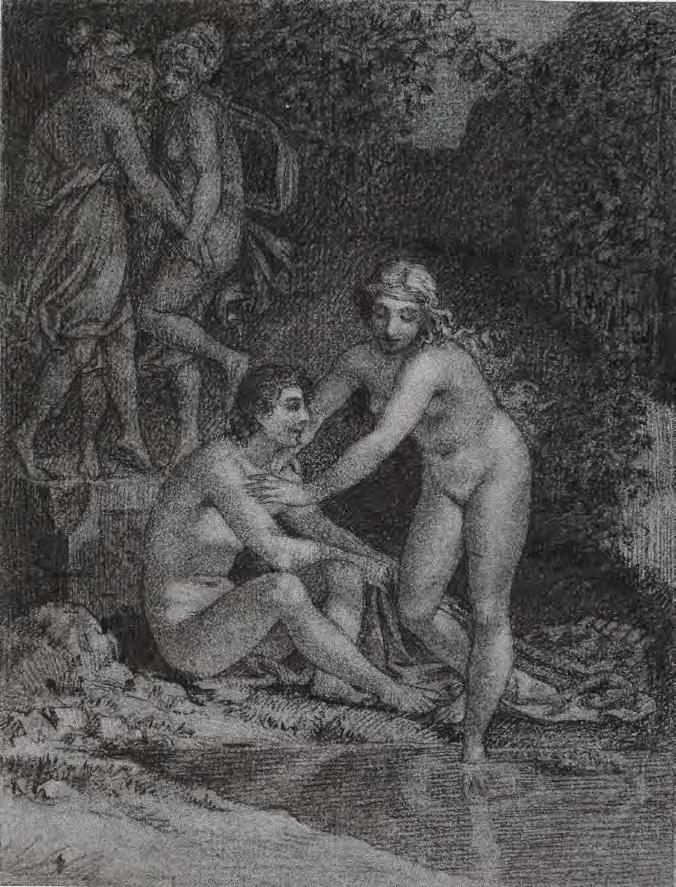
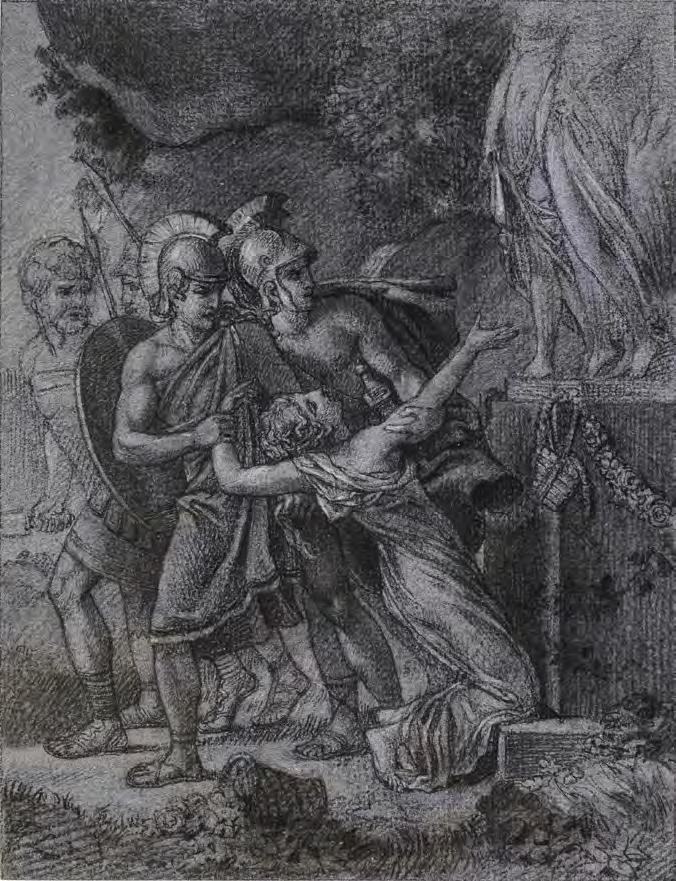
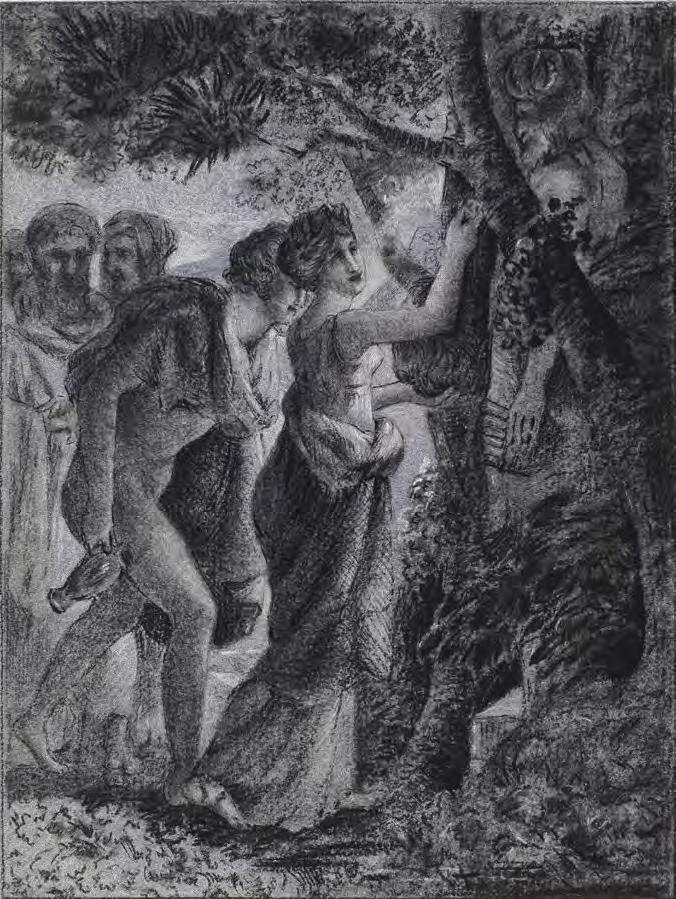
Umsetzung schließlich entstehen soll. Eine für den Radierer reproduzierbare Vorlage ist die vorliegende Zeichnung aber noch nicht, denn diese wurde dann nochmals seitenrichtig nach den Skizzen gezeichnet, wiederum wesentlich genauer, jetzt auch in den Details, etwa des Hintergrunds, deutlich konkreter und exakter.
Unsere Zeichnungen, die noch viel vom Geist der ursprünglichen Entwürfe bewahren, zeigen auf jeden Fall sehr schön und aufschlußreich, wie wichtig doch die Beziehung zwischen Zeichner und Kupferstecher ist: im Falle Gérards fügten die Stecher den virtuosen Vorlagen noch eine Nuance der kühnen Anmut zu, die Gérards Werke so anziehend machen. Die Zeichnung nach Prud’hon enthüllt indessen die ganze Genialität seiner Vorlage. Seine Interpretation von Daphnis und Chloe im Bade zeigt das Ideal einer jungen, ersten Liebe und kann in einer Ausführung auf Kupfer nur an Liebreiz und Schmelz verlieren, aber nichts hinzugewinnen. Gordon Ray dazu: „The harmless sensuality of first love had never been so winningly conveyed, even by Prud’hon himself” (The French Illustrated Book, S. 130).
Alle drei Zeichnungen wurden auf gleichartigem Papier und in derselben Technik angefertigt. Die vorliegenden Fassungen sind noch verhältnismäßig weit von den Drucken entfernt, was insbesondere anhand der Konzentration auf die figürlichen Motive zu beobachten ist, während landschaftliche und dekorative Vorder- und Hintergründe hier noch recht wenig ausgearbeitet sind; die Bildausschnitte sind auch weiter gefaßt, als das bei den Druckfassungen der Fall ist. Dennoch dürften sie als Probestücke für den Druck gedient haben und aus einem späteren Stadium der Entwurfstätigkeit hervorgegangen sein. Die als Druckvorlagen dienenden Originalentwürfe von den Händen der beiden Künstler befinden sich sämtlich in einem Ex-
emplar, das die Bibliothèque Nationale in Paris seit 1956 besitzt; es handelt sich hierbei um einen Druck der seltenen griechischen Ausgabe von 1802, eines der wenigen Vorzugsexemplare auf Pergament. Monique Moulin hat diese Zeichnungen in einem interessanten Essay publiziert und die Arbeiten Gérards in sein Werk eingeordnet.
Wie Portalis und Beraldi bemerken, gibt es von der Tafel Le Bain auch frühe, sehr seltene Zustandsdrucke, „une premier état très estimé, avec une tablette ombrée dans le bas, qui ne porte pas d’inscription. La tablette a été sensuite supprimée.“ Diese Fassung findet sich auch auf einer der originalen Vorzeichnungen, die sich heute in der BnF befinden. Man sieht daran, wie diese Idee erst in einen späten Entwurfsstadium auftaucht, dann in die Radierung übernommen wird, um alsbald wieder aufgegeben zu werden. Diese Schrifttafel ist weder auf unserer Zeichnung noch der Radierung vorhanden.
Der tadellos erhaltene Einband, von Réne Kieffer verschwenderisch vergoldet, ist an sich mit recht traditionellen Ornamentformen dekoriert, doch zeigen sich vor allem bei den Deckeln neue Gestaltungsideen, die über den Historismus hinausweisen. Kieffer erreicht diese Lösung aus alten Bahnen insbesondere durch Formgegensätze: Blockhaftes und Festes wird mit Fragilem und Feinem kombiniert, statt geschmeidiger Übergänge stellt er hier kontrastreiche Überlagerungen von Formen her, während eigentlich zusammengehörige, aber getrennt auftretende Elemente teils über weite leere Flächen hinweg miteinander in Beziehung treten.
Die Zeichnungen und Tafeln aufgezogen, einige Blätter leicht stockfleckig, sonst ein wohlerhaltenes, prächtig gebundenes Exemplar.
Bibliographie unter unserer Nummer LXX .
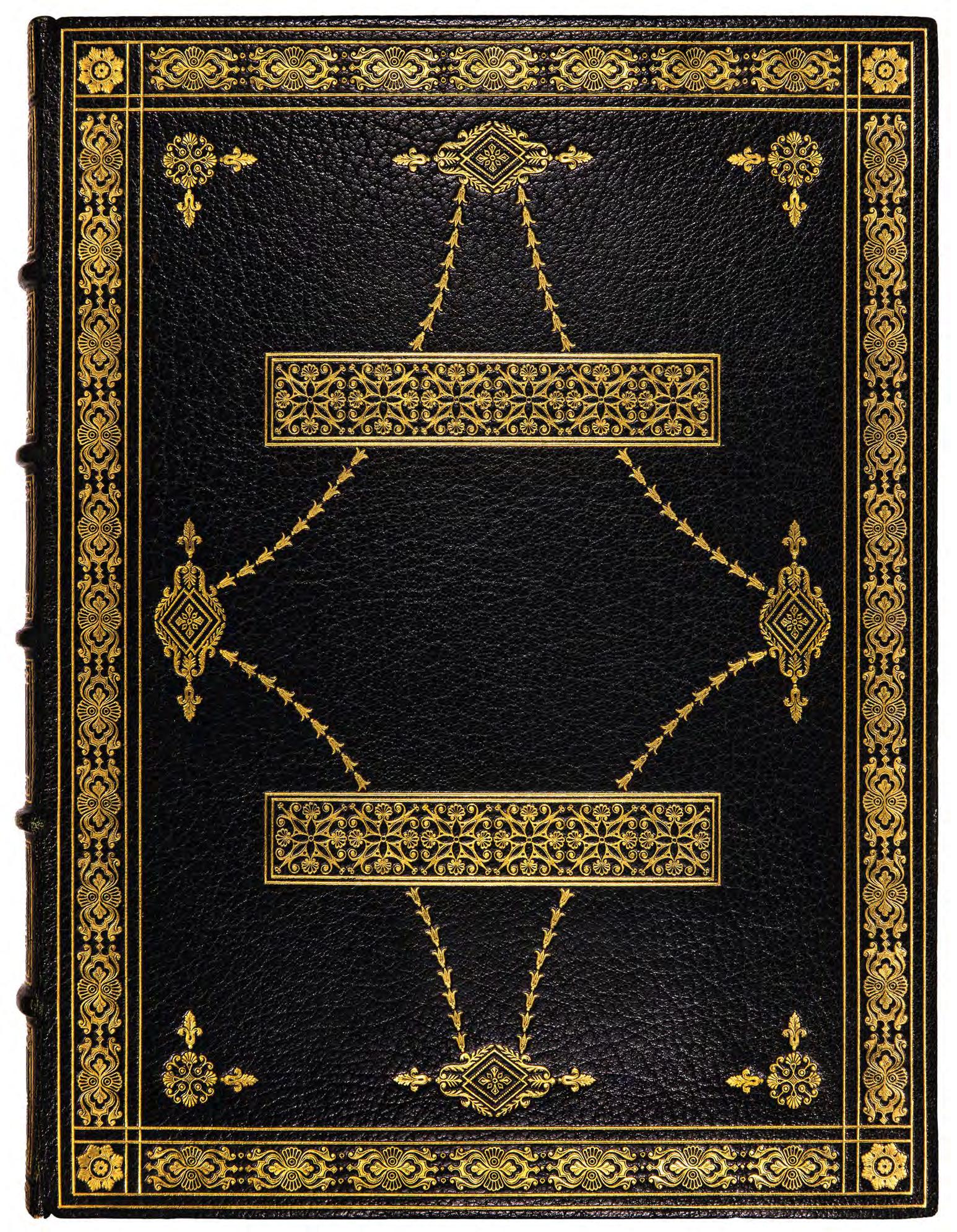
Exemplar mit der sehr seltenen
Didot-Ausgabe des griechischen Textes aus dem Jahr 1802 in petrolblauem Maroquin von Allô
LXXIV Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800. –
Daran: Longos. Poimenika ta kata Daphnin kai Chloen. (Griechisch). Paris, Petrus Didot, natu major (P. Didot l’aîné), XI. = 1802.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy; alle avant la lettre.
Zwei Ausgaben in einem Band:
I. VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext).
Kollation : π4 1–25 4 .
II. 2 Bl., 133 S. (Vortitel, Titel, Prooemion des Longus, S. 1/2, und Haupttext, S. 5–133).
Kollation : π2 1–17 4 (das letzte leer).
Quart, auf Papier im Format Folio (310 x 232 mm).
Petrolblauer Maroquineinband um 1870 auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten, davon fünf mit reicher ornamentaler Kastenvergoldung, mittig zwei bekränzte und von einem Pfeil durchbohrte Herzen und ein Kompartiment mit dem goldgeprägten Titel, eingerahmt von Doppelfileten, am Fuß Erscheinungsort und -jahr in goldgeprägten Lettern; Deckel mit dreifacher Filetenrahmung, doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenbordüren in floraler Ornamentik im Stil des 18. Jahrhunderts, dazu Dent-de-rat- und Pointillévergoldung, Marmorpapiervorsätze, Ganzgoldschnitt und Lesebändchen (in Grün, Rot und Gelb); signiert von Allô, in Halbmaroquinschuber.
Ein von seiner Provenienz her zwar nicht nachzuweisendes, allerdings meisterlich gebundenes Exemplar in einem Farbton von exquisiter kühler Noblesse. Neben der bekannten Ausgabe des Jahres 1800 in der französischen Übertragung enthält es auch den griechischen Originaltext, der in einer viel selteneren Ausgabe im Jahre 1802 erschienen ist. Diese beiden Didot-Ausgaben wurden auf einem exzellenten festen Velinpapier gedruckt, das auch nach über 200 Jahren noch makellos und frisch erscheint. Wie bereits Hoffmann in seinem bibliographischen Lexikon der Griechen angibt, wurden lediglich 27 Exemplare auf großem Velinpapier hergestellt, weitere zwei in verschiedenen Formaten auf Pergament. Die Verbesserungen am griechischen Text in der Fassung des Villoison seien nur „Conjecturen des Herausgebers“; dieser war allerdings kein Geringerer als der große Gelehrte Adamantios Korais (1748–1833), der als Literaturwissenschaftler Entscheidendes für die griechische Sprachfrage geleistet hat und für einen Ausgleich und Mittelweg zwischen antiker Hochsprache und Volkssprache plädierte. Die kleine Auflagenhöhe der Ausgabe zeigt an, daß es sich nur um einen für wenige Kenner und Liebhaber hergestellten Druck handelt, der dem Verleger selbst ein hohes Anliegen gewesen sein muß und eine Herausforderung: Noch einmal auf Bodoni zu antworten, um eine griechische Type zu erschaffen, die abermals klarer, eleganter und einheitlicher wirkt –auch das gelang Didot hier überzeugend. Zwar erscheint das Schriftbild Bodonis von 1786 durch die größere Kursive lebendiger und interessanter, doch besticht Didot durch ein kaum mehr zu überbietendes Gleichmaß, ohne alle Manierismen, die man ja Bodoni gelegentlich vorgehalten hat. Dies ist das griechische Pendant zur lateinischen Didone, der berühmten klassizistischen Antiqua der Druckerfamilie. Vielleicht hat Didot auch dafür den Rat und das Urteil von Korais herangezogen.

In diese Edition hat man gewöhnlich die neun Tafeln, die auch die französische Ausgabe des Jahres 1800 enthält, mit eingebunden, da sie in diesem Exemplar allerdings bereits einmal vorhanden waren, hat man auf sie in der griechischen Fassung verzichtet, sie mußten ja nicht doppelt erscheinen.
Der von Allô signierte, makellos erhaltene Einband zeigt nicht nur die ganze Formschönheit eines Werkes, das von der Hand eines an alten Vorbildern bis ins Detail geschulten Meisters stammt, der künstlerisch und handwerklich auf dem Zenit seiner Zeit stand, sondern auch einen Farbton, der seinesgleichen sucht, ein ganz außergewöhnlich strahlendes Blau. Wie auch bei unserem Exemplar LXX verwendete Allô einen Stempel – die von einem Pfeil durchbohrten Herzen (siehe unser Exemplar XIII; Barber, DST 26) – den wir von den Einbänden des Derome le Jeune kennen und der vermutlich über Bradel in seine Werkstatt
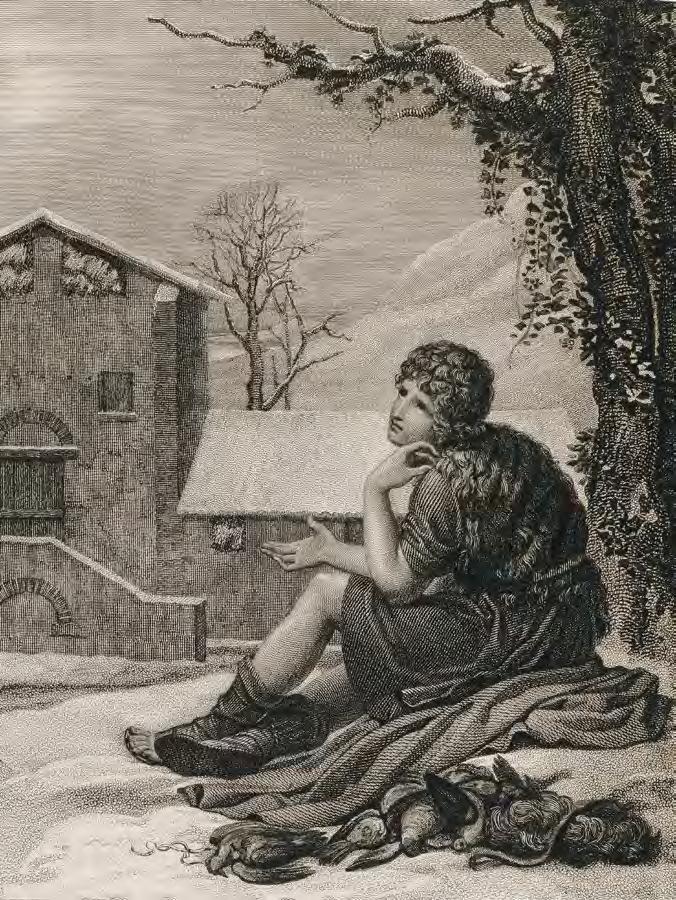
gelangt ist, sollte er ihn nicht mit größter Präzision nachgefertigt haben.
Referenzen zur griechischen Ausgabe von 1802 (für die französische Ausgabe des Jahres 1800 siehe unsere Nummer LXX):
Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, S. 657. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 320. Ray, The French Illustrated Book, S. 130 (Nr. 76A). Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1156. Quérard, La France littéraire, Bd. V, S. 350: „Le prix primitif de cette édition était de 120 fr.“. Vicaire, Manuel de l’amateur, Bd. V, Sp. 385. Ebert, ABL , 12233. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1237, Anmerkung (erwähnt die Ausgabe von 1802, verschweigt aber, daß der Text griechisch ist). Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 532. – Ein Exemplar im Catalogue Richard, de Lyon (1885, Nr. 217, mit allen neun Tafeln avant la lettre).
Exemplar aus der Bibliothek Langlois, in einem Empire-Einband von Bozerian
LXXV Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy; alle avant la lettre.
VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext).
Kollation : π4 1–25 4 Quart, auf Papier im Format Folio (313 x 230 mm).
Kirschroter quergenarbter Maroquineinband der Zeit auf fünf erhabenen Doppelbünden zu sechs Kompartimenten, davon fünf mit Filetenvergoldung und zentralem goldgeprägten Stempel, der ein Arrangement aus Dudelsack und Hirtenstab zeigt, zwischen den Doppelbünden eine goldgeprägte Bordüre auf schwarzem Grund, der goldgeprägte Titel im zweiten Kompartiment von oben, Deckel mit mehrfacher Filetenvergoldung, die sich in den Ecken kreuzt, breiten floralen Bordüren und Eckfleurons; wellenförmige Stehkanten- und Innenkantenvergoldung, fliederfarbenes Vorsatzpapier und Ganzgoldschnitt, signiert „Rel. P. Bozerian“.
Ein überaus dekoratives Exemplar aus einer der bedeutendsten Privatbibliotheken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, derjenigen von André Langlois, dessen rotes Maroquinexlibris mit dem zugehörigen Eintragung auf dem Vorsatz zu finden ist. Zwischen 1932 und 1964 ist es dem Sammler und Bibliophilen gelungen, die neben Esmerian
wohl wichtigste Bibliothek illustrierter Werke zusammenzustellen (siehe den unter Nr. I zitierten Artikel von A. Rau).
Jean-Claude Bozerian der Ältere (1762–1840), der als einer der ersten die Mode und den Geschmack des Empire in seinen Bucheinbänden mit Konsequenz verwirklichte, hat dieses Exemplar überaus kunstvoll und elegant in leuchtend kirschrotes Chagrinleder gebunden. „Die reiche Dekoration der Rücken, […] die falschen Doppelbünde mit eingelegten Farbstreifen, die massive Qualität der Deckel wie auch die Feldereinteilung durch sich überschneidende Goldlinien – das alles finden wir in Frankreich bei dem Älteren Bozerian zum ersten Male. Damit waren die neuen Grundformen der Einbandkunst gegeben.“ (Fürstenberg , Das französische Buch, S. 178). In Culots Monographie über den Buchbinder lassen sich die verwendeten Dekorationsformen unseres Einbands geradezu mustergültig nachweisen: Roulette 44 für die Deckelbordüre, 16 für die Innenkante, Palettes 8 ist die Bordüre am unteren Kapital und Signatures 1 der Signaturstempel. Die Gestaltung der Deckel insgesamt, mit Ausnahme der äußeren, in unserem Fall sehr kräftigen Filete, stimmt fast exakt überein mit dem bei Culot abgebildeten Einband Nr. 26, eine Pariser Milton-Ausgabe; auch der Rücken dieses Einbandes ist in analoger Art zu unserem dekoriert, wobei der zentrale Motivstempel bei uns, der Thematik angepaßt, ein Tropaion mit Hirtensymbolik ist, und bei der Bordüre am Kapital fand, von Culots Beispiel abweichend, Palettes Nr. 7 Anwendung. Der Einband ist tadellos erhalten, wenige Blätter minimal stockfleckig.
Literatur: Fürstenberg 1929, S. 178 (zu Bozerian). – Für die bibliographischen Referenzen zur Ausgabe siehe unsere Nummer LXX .
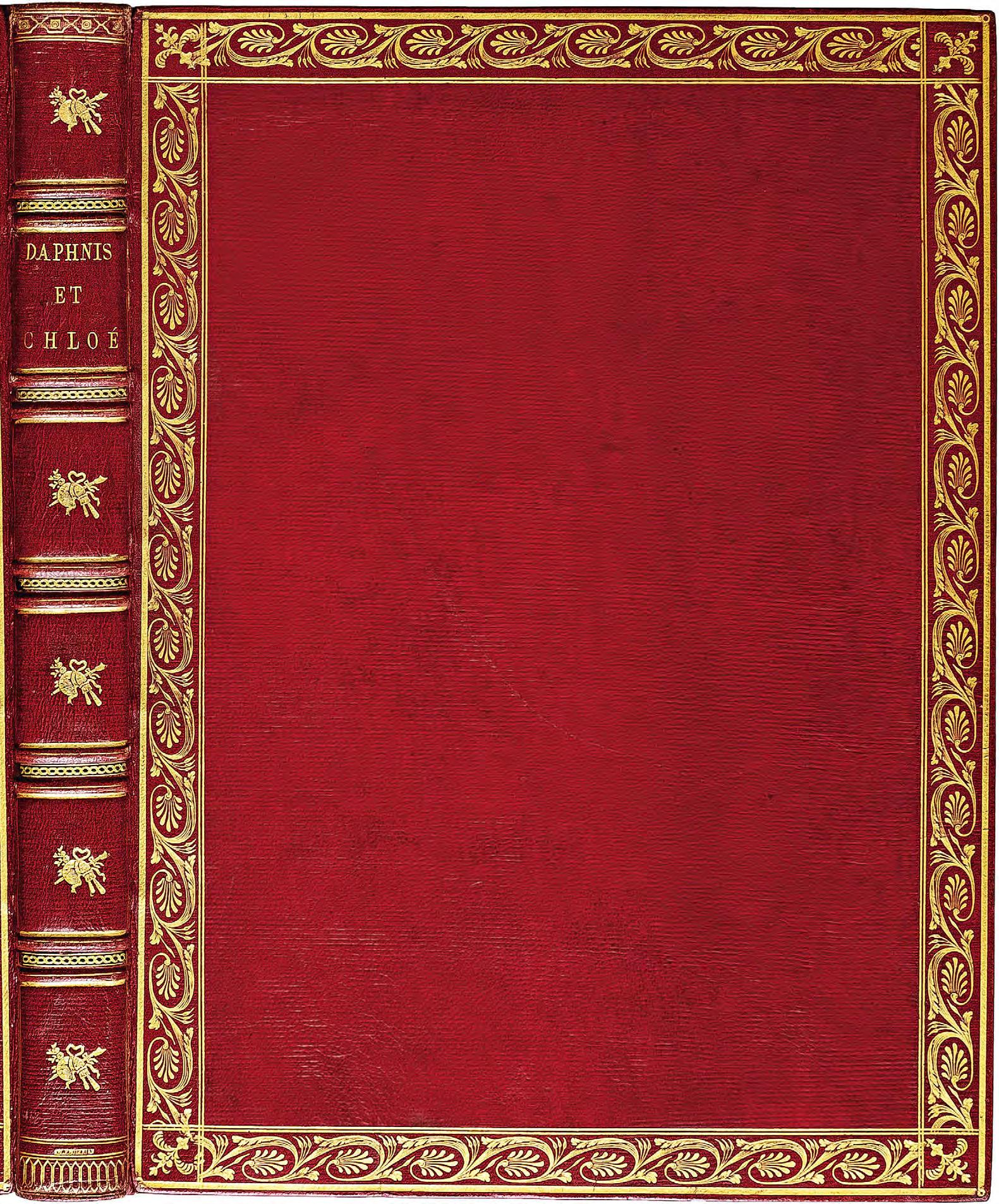
Mit der Suite du Régent auf grossem Papier und in doubliertem Einband
LXXVI Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy, teils avant la lettre. –
Zusätzlich in Querausrichtung eingebunden die „Regentensuite“ der Ausgabe von 1718 (datiert 1714): Gestochener Titel von B. Audran nach A. Coypel und 26 (statt 28 Kupfertafeln von B. Audran nach dem Régent Philippe d’Orléans.
VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext – zweiseitig unbeschnitten).
Kollation: π4 1–25 4 Quart, auf Papier im Format Groß-Quart (312 x 241 mm).
Rotbrauner Maroquineinband der Zeit um 1870/80 auf fünf erhabenen Bünden, unterteilt in sechs Kompartimente, der goldgeprägte Titel im zweiten von oben, die übrigen mit ornamentaler Kastenvergoldung, Deckel mit dreifacher Filetenvergoldung; Stehkantenfilete, doubliert mit nachtblauem, reich vergoldetem Maroquin, fliegende Vorsätze aus nachtblauem Moiré und Kopfgoldschnitt.
Dieses Exemplar vereinigt die erste bedeutende und für das gesamte 18. Jahrhundert prägende Kupferstichserie für Daphnis und Chloe nach den Gemälden des Régent mit den Illustrationen zweier großer Künstler, die den Umbruch vom 18. zum 19. Jahrhundert entscheidend beeinflussten.
Die 26 von 28 Tafeln (auf zwei der schlüpfrigen Sujets hat man hier wieder einmal verzichtet) sowie das Frontispiz der Suite nach dem Regenten, die erstmals in der Pariser Ausgabe des Jahres 1718 erschien (vergleiche unsere Nummern III ff.), wurden auf großes Papier gedruckt und – damit man den sehr seltenen originalen Zustand nicht verändern mußte – diesem Exemplar hochkant beigebunden. Es handelt sich damit aller Wahrscheinlichkeit nach um einen separaten Abzug der Suite, vielleicht ähnlich dem unseres unikalen Exemplars Nummer XVIII auf noch weit größerem Papier. Die Tafeln nach Prud’hon und Gérard liegen teils avant (fünf), teils avec la lettre (drei) vor, unter einer Tafel steht nur der Titel des Werks.
Der nicht signierte Einband, dessen Rücken dekorativ im Stil des 18. Jahrhunderts vergoldet ist, zeigt seine volle, überraschende Pracht allerdings erst, wenn man die Deckel öffenet: Die äußerst reichen, feinen Vergoldungen in sehr eleganter Ornamentik der Doublüren, angelehnt an das Louisquinze, können nur das Werk eines bedeutenden französischen Meisters aus der Zeit nach der Mitte des 19. Jahrhunderts sein, die Harmonie aus dunklen Blautönen und der leuchtenden Goldornamentik ist überwältigend. Leider bleibt uns neben dem Buchbinder auch der Auftraggeber dieses ungewöhnlichen Exemplars verborgen, sowie alle späteren Eigner.
Die ersten und die letzten Tafeln aus der Regentensuite sind teils stärker gebräunt (bedingt durch eine offenbar längere ungeschützte Lagerung), doch der Großteil der Tafeln und Textseiten sowie der elegante Einband sind tadellos erhalten. –Für die Literatur angaben zur Ausgabe siehe unsere Nummer LXX .

Superb ausgestattetes Exemplar mit zwei Originalzeichungen von Le Barbier in einem atemberaubenden Mosaik-Einband von Maylander
LXXVII Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy; alle avant la lettre. – Zusätzlich eingebunden: Zwei Originalzeichnungen als Entwürfe für gestochene Titel mit Kopfvignetten und Textrahmen, in lavierter Tusche auf festem Bütten, nicht signiert, aber zweifelsohne von J.-J. F. Le Barbier, in unterschiedlichen Graden der Ausarbeitung, ein Frontispiz nach Le Barbier, gestochen von J.-F. Ribault, in zwei Abzügen (gedruckt auf Chinapapier, avec la lettre und avant la lettre), beide unter Passepartouts mit farbigen Rahmen, eine Kopfvignette nach Le Barbier, gestochen von Ribault, avant la lettre (lose eingelegt), zwei Kupfertafeln nach Le Barbier avant la lettre und vor Abdruck der Stechersignatur, einn eauforte-pure nach Le Barbier sowie 29 gouachierte Kupfertafeln von P.-A. Martini nach den Vorlagen des Regenten, inklusive der Petits Pieds nach dem Comte Caylus, alle mit breiten farbigen Rahmen.
VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext).
Kollation : π4 1–25 4 Quart, auf Papier im Format Folio (306 x 239 mm)
Elfenbeinschwarzer quergenarbter Maroquineinband der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf glattem Rücken mit reicher Mosaizierung in Orange
und verschiedenen Rottönen sowie Vergoldung; mittig auf dem Rücken zwei spindelförmige mosaizierte Elemente, eingerahmt von runden weinroten Maroquinschildern mit dem goldgeprägten Titel und den Namen der Illustratoren „Prudhon“ und „Le Barbier“, abschließend auf beiden Seiten ein reich mosaizierter Vierpaß, die Deckel mit sechsfacher Filetenrahmung in verschiedenen Breiten und Abständen, Eckfleurons auf allen vier Seiten, mittig drei vertikale Reihen mit je sieben spindelförmigen, reich mosaizierten und vergoldeten Elementen: das Motiv des Rückens, hier in horizontaler Ausrichtung, die Farben des verwendeten Maroquins in komplementärer Weise kombiniert; Stehkantenvergoldung mit doppelten Fileten und Schraffurmuster, breite Innenkantenbordüren und weinrote Moiré-Vorsätze sowie Ganzgoldschnitt; signiert „E. & A. Maylander“. Dieses Prachtexemplar ist ausgestattet mit der kompletten Suite, die Martini nach den Gemälden des Regenten gestochen hat und die hier mit einem ganz exzeptionellen Kolorit versehen wurde: die hellen, aber intensiven Gouachefarben dekken die darunterliegenden Kupferstiche gänzlich ab, doch im Vergleich zu den anderen kolorierten Suiten Martinis aus unserer Sammlung (siehe die Ausgabe von 1787) versucht der Künstler dieser Suite einerseits durch eine auf die lichten Töne reduzierte Farbskala, andererseits durch einen großflächigen, aber äußerst sorgfältigen Farbauftrag die Wirkung von Miniaturen zu evozieren. Diese Helligkeit in Verbindung mit dem flächenhaften Farbauftrag erinnert an die Wirkung von Wandteppichen, welche hier für die Kolorierung tatsächlich als Vorbild gedient haben könnten, hatte man doch im frühen 18. Jahrhundert nach den Entwürfen und Gemälden des Regenten auch einen ganzen Zyklus von Tapisserien hergestellt.
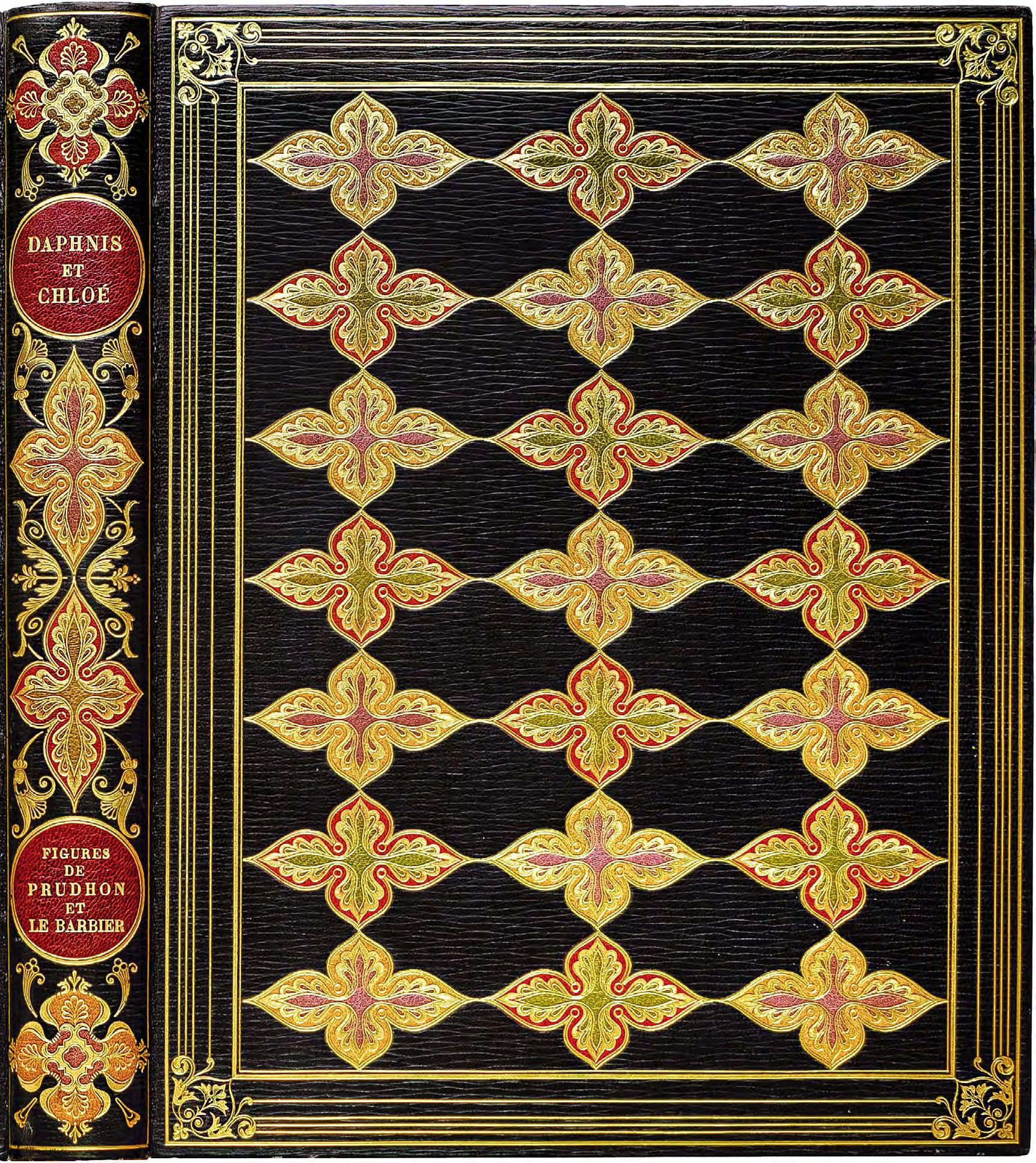
Neben den Stichen Martinis finden sich die zur Ausgabe gehörenden Illustrationen Prud’hons und Gérards, aber auch mehrere Abzüge aus der nie erschienenen und deshalb sehr gesuchten Suite Le Barbiers. Dieser unerhörte Reichtum wird nur noch von den beiden Originalzeichnungen Le Barbiers übertroffen: dabei handelt es sich um zwei Kopfvignetten, zu denen uns keine Abzüge bekannt sind. Diese beiden Zeichnungen, zusammen mit dem Titelblatt zum ersten Teil des Romans mit der ausgeführten Kopfvignette, die den von einer Ziege gesäugten Daphnis zeigt, dem aber noch die Schrift dieses Zwischentitels fehlt (die Tafel hier lose beiliegend), lassen erahnen, was für eine großartige Buchillustration Le Barbier für Daphnis und Chloe geplant hatte. Zu dieser sollten nicht nur Tafeln gehören – von denen ja auch nur ein Teil zur Ausführung gelangt ist – sondern ebenso Vignetten mit Textrahmen aller vier Zwischentitel, aber wohl noch einiges mehr an Buchschmuck, der nie angefertigt worden ist.
Unser Exemplar mit der Radierung und den beiden Entwürfen für die Zwischentitel zeigt indessen ganz deutlich, wo die Arbeit von Le Barbier steckengeblieben ist: Konnte nach dem ersten Entwurf bereits radiert und ein Probedruck angefertigt werden, so liegt der Titel zum zweiten Buch nur im Entwurf vor, allerdings in sehr sauberer und vollendeter Zeichnung; zu einer solchen ist es beim dritten Titel immerhin noch für die Vignette gekommen, ein auf dem Land liegender karpfenartiger Fisch, gemeint ist allerdings wohl der tote Delphin, in dessen Nähe Daphnis einen Schatz findet (siehe dazu auch im Einführungstext), eine exzellente Arbeit, doch blieb der Entwurf für die Schrift auf einige Hilfslinien und in Bleistift angedeutete Buchstaben beschränkt. Hier ist die Stelle, an der Le Barbier die Arbeit abgebrochen hat, aus welchen Gründen auch immer. Bei der Zeichnung
zum zweiten Titel erweist sich der konservative Zug im Schaffen Le Barbiers, wenn er um 1795 noch einen kleinen Eroten mit Pfeil und Bogen zwischen Täubchen auf den Wolken zeigt, liebreizend und dem Thema angemessen, doch so auch schon in der Mitte des Jahrhunderts denkbar und stilistisch dem Rokoko verpflichtet. Der Vergleich mit der ausgeführten signierten Radierung zum Titel des ersten Buchs beweist indessen, daß die vorliegenden Zeichnungen von keinem anderen als Le Barbier stammen können: sie entsprechen den beiden Vignetten-Vorzeichnungen bei La Bedoyère, siehe hier Nr. LXII zu den acht großen Lavis.
Solch ein unvergleichlich reich ausgestattetes Exemplar verdient eine würdige Bindung. Der farbenprächtige Mosaik-Einband ist orientiert an einem Vorbild aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, geschaffen von dem Buchbinder Vogel. Er stammt aus den Bibliotheken von Beraldi und DescampsScrive, nachgewiesen im zweiten Teil des Katalogs von Descamps-Scrive, Paris 1925, mit Abbildung, Los 76. Damit haben wir einen wahrscheinlichen terminus post quem für unseren Einband, ausgeführt im Pariser Hause Maylander, hier schon mit der Signatur, die den Sohn André (1901–1980) mit einbezieht („E. & A. Maylander“). Die Farben des verwendeten Maroquins verhalten sich dabei komplementär zueinander: ein Element aus rotem und grünem Maroquinleder wechselt stets mit einem aus gelbem und violettem ab, so daß eine Art Schachbrettmuster entsteht – zusammen mit dem Goldglanz erreicht dies vor dem sattschwarzen Grund eine fulminante Gesamtwirkung.
Einband und Buchblock sind makellos erhalten, die Kupferstiche liegen in exzellenten Abzügen vor. –
Ein extraordinär gebundenes und unvergleichlich ausgestattetes Exemplar in perfekter Erhaltung –einer der vielen Höhepunkte dieser Sammlung.


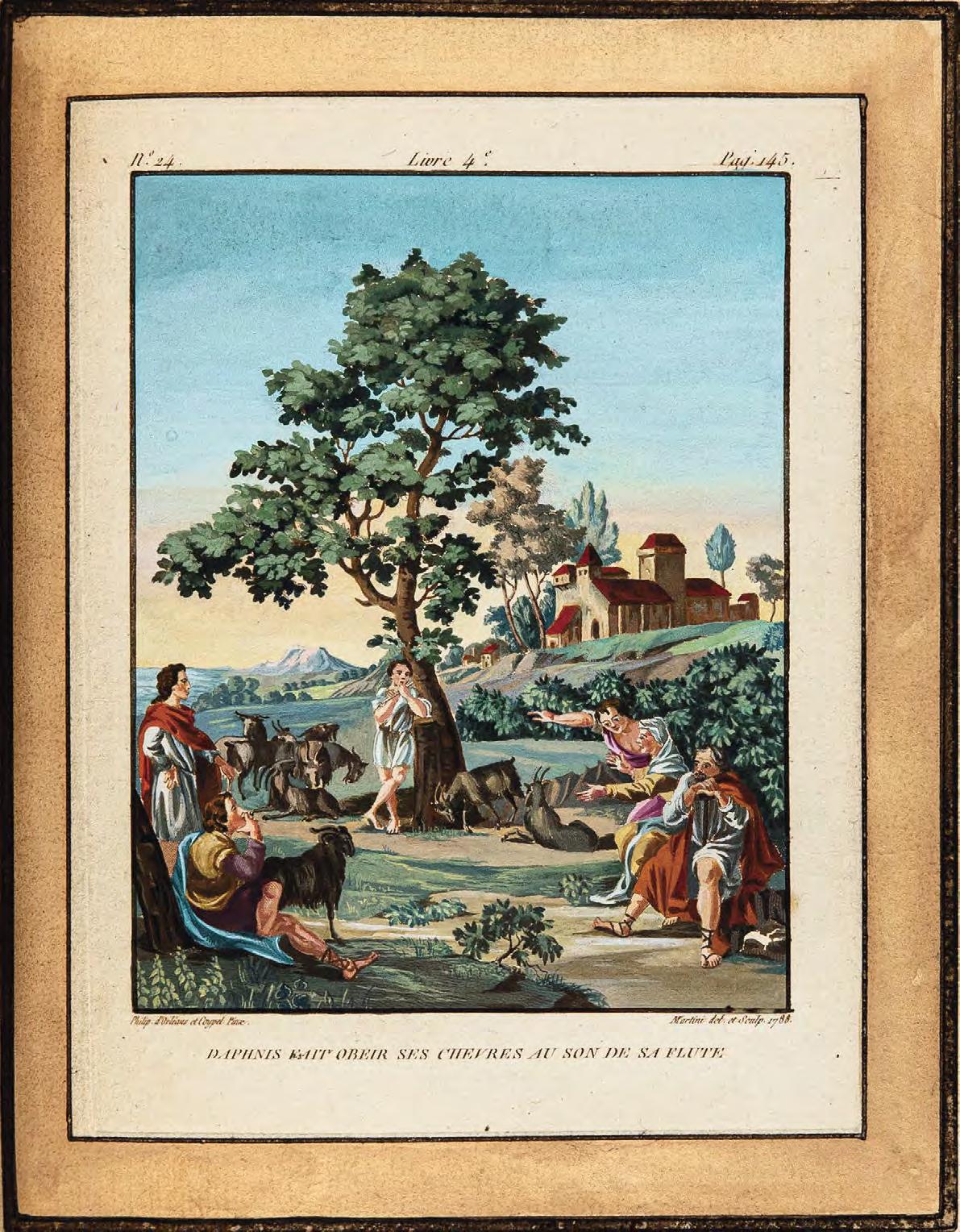
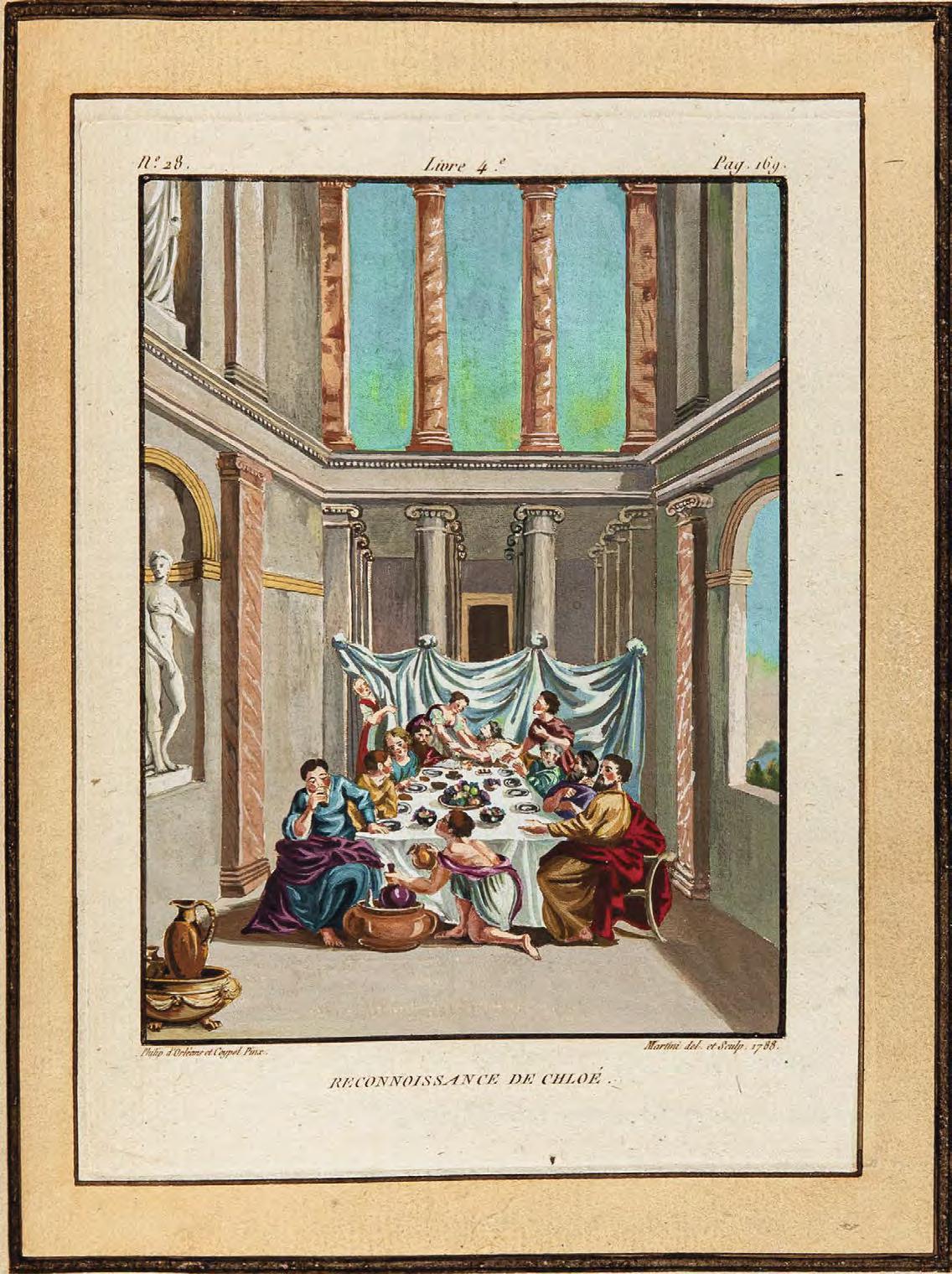
Das von Cohen/De Ricci
erwähnte Exemplar
Martin – Descamps-Scrive
Eines von zwei auf Pergament mit den Tafeln auf China, im Kathedraleinband von Simier
LXXVIII Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Traduites du Grec de Longus par Amyot. Paris, Imprimerie de P. Didot l’aîné, au Palais des sciences et arts. An VIII. 1800.
Mit neun Kupfertafeln nach P. P. Prud’hon (drei) und F. Gérard (sechs), gestochen von B. J. F. Roger, H. Marais, J. Massard und J. Godefroy; alle avant la lettre und auf China, die Serpentes aus feinem Bütten mit aufgedrucktem dreisprachigen Beitext (aus der griechischen Didot-Ausgabe des Jahres 1802).
VIII, 200 Seiten (Vortitel, Titel, Préface de Longus und Haupttext).
Kollation: π4 1–25 4 Quart, auf Pergament im Format Groß-Quart gedruckt (325 x 242 mm).
Nachtblauer quergenarbter Maroquineinband um 1830 im Stil à la cathédrale auf vier breiten Bünden zu fünf Kompartimenten, im zweiten von oben der goldgeprägte Titel, im vierten die goldgeprägte Inschrift „Exemplaire sur peau de vélin“, beide Kapitalkompartimente mit reicher, dichter ornamentaler Vergoldung, im mittleren Kompartiment eine hochovale Kartusche aus drei Fileten, darin florale Blindprägung mit Paßformen, außen von Doppelfileten mit kleinen Eckfleurons eingefaßt, Dekkel mit reicher Gold- und Blindprägung, gerahmt von einfacher Filete, darin eine goldgeprägte Bordüre mit kräftigen Eckfleurons, untereinander mit achtfachen, sehr feinen Fileten verbunden, innen ein weiterer Filetenrahmen, in dessen Ecken fächerar-
tig blindgeprägte Viertelkreise, nach innen durch ein breites, von zwei Fileten begrenztes umlaufendes, teils gebogenes Band abgeschlossen, in der Mitte ein solches Band kreisförmig, ein blindgeprägtes Kathedralfenster in gotischen Formen einschließend, im Zentrum ein goldgeprägter Vierpaß; Stehkanten mit goldgeprägter Schraffur, breite Innenkantenvergoldung mit einer Bordüre im Stil des 18. Jahrhunderts, innen breite Filete mit Blütenstempeln an den Ecken, fuchsiafarbene Glanzpapier- sowie Pergamentvorsätze; mit Etikett und doppelt signiert „Simier Relieur De Roi“, Halbmaroquinschuber.
Dieses in seiner Form einzigartige Exemplar ist eines der beiden auf Pergament gedruckten Exemplare der Didot-Ausgabe des Jahres 1800. Das frühe 19. Jahrhundert hat das höchst Seltene dann endgültig zum Unikat erhoben: Die bis dahin wohl fehlenden Tafeln wurden in Drucken auf China eingefügt, und zwar in hervorragenden Abzügen, dazu mit dreisprachig, griechisch, lateinisch und französisch, bedruckten Seidenpapieren versehen, die, wie ihre Seitenzahlen erweisen, zur griechischen Didot-Ausgabe des Jahres 1802 gehören (unsere Nummer LXXIV, vergleiche auch unser Exemplar Nummer LXIV der Ausgabe von 1787); zum Schutz wurden weiterhin leere Pergamentblätter beigebunden und das Ganze dann mit einem überaus edlen, in der Formenfülle eher zurückhaltenden, aber anspruchs- und geschmackvoll dekorierten Kathedraleinband versehen. Ursprünglich hatte das Exemplar sogar noch einige interessante Beigaben mehr enthalten, worüber der Katalog der Sammlung Martin von 1877 Auskunft gibt, darunter Originalzeichnungen, doch wurden diese im späten 19. Jahrhundert, wohl im Bestreben nach Purismus, wieder entfernt. Das zweite Exemplar auf Pergament war im Dezember 1872 in der Auktion Emile Gautier, Nr. 574: „un des deux exx. imprimée sur peau vélin. Les neuf figu-
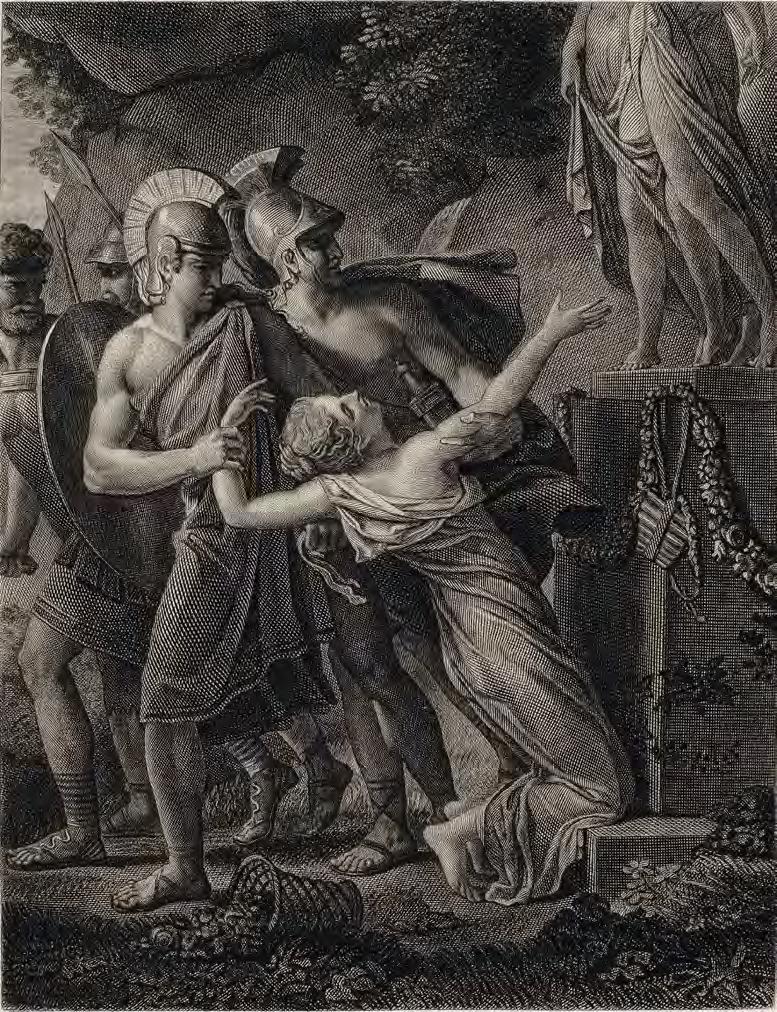
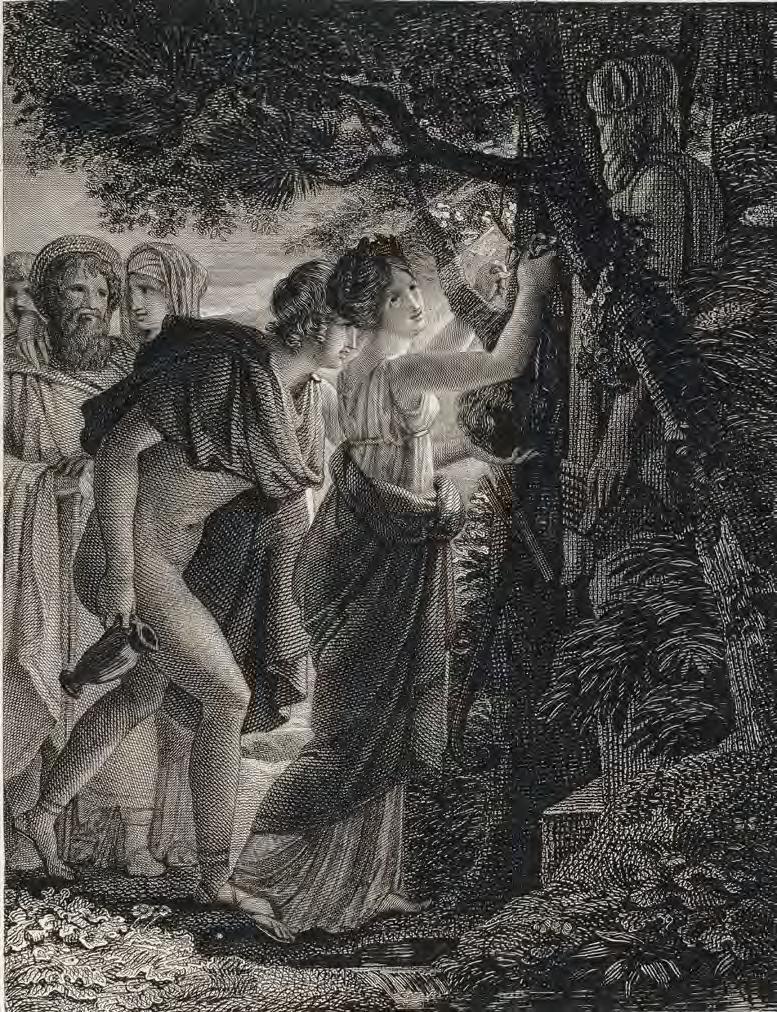
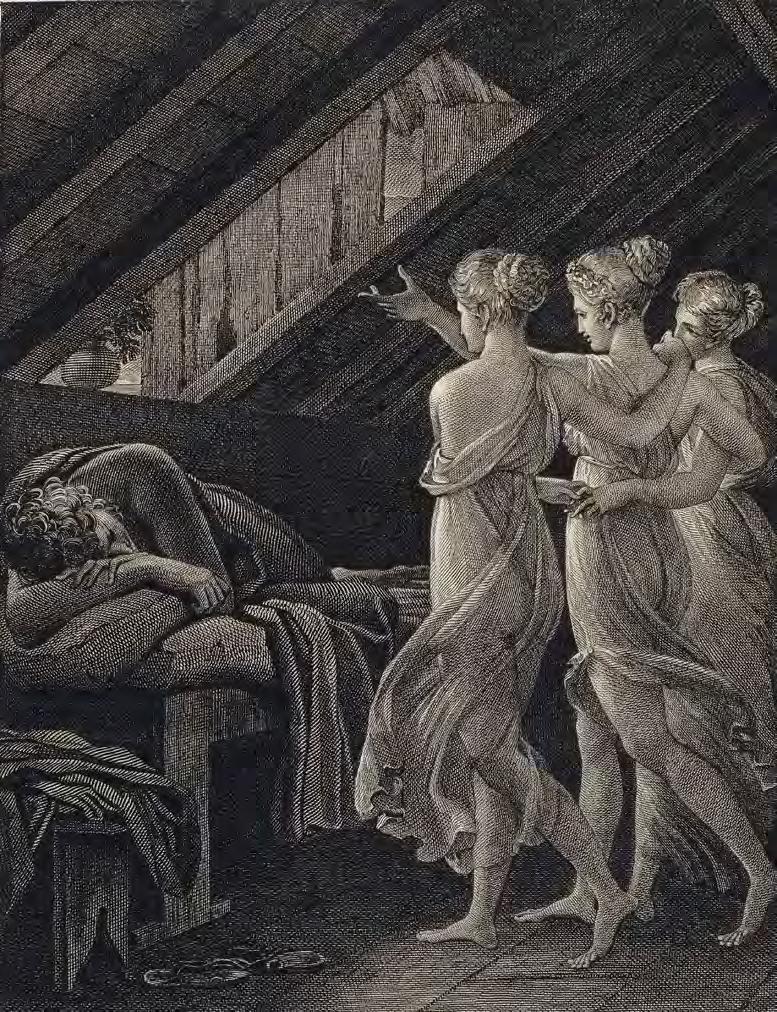

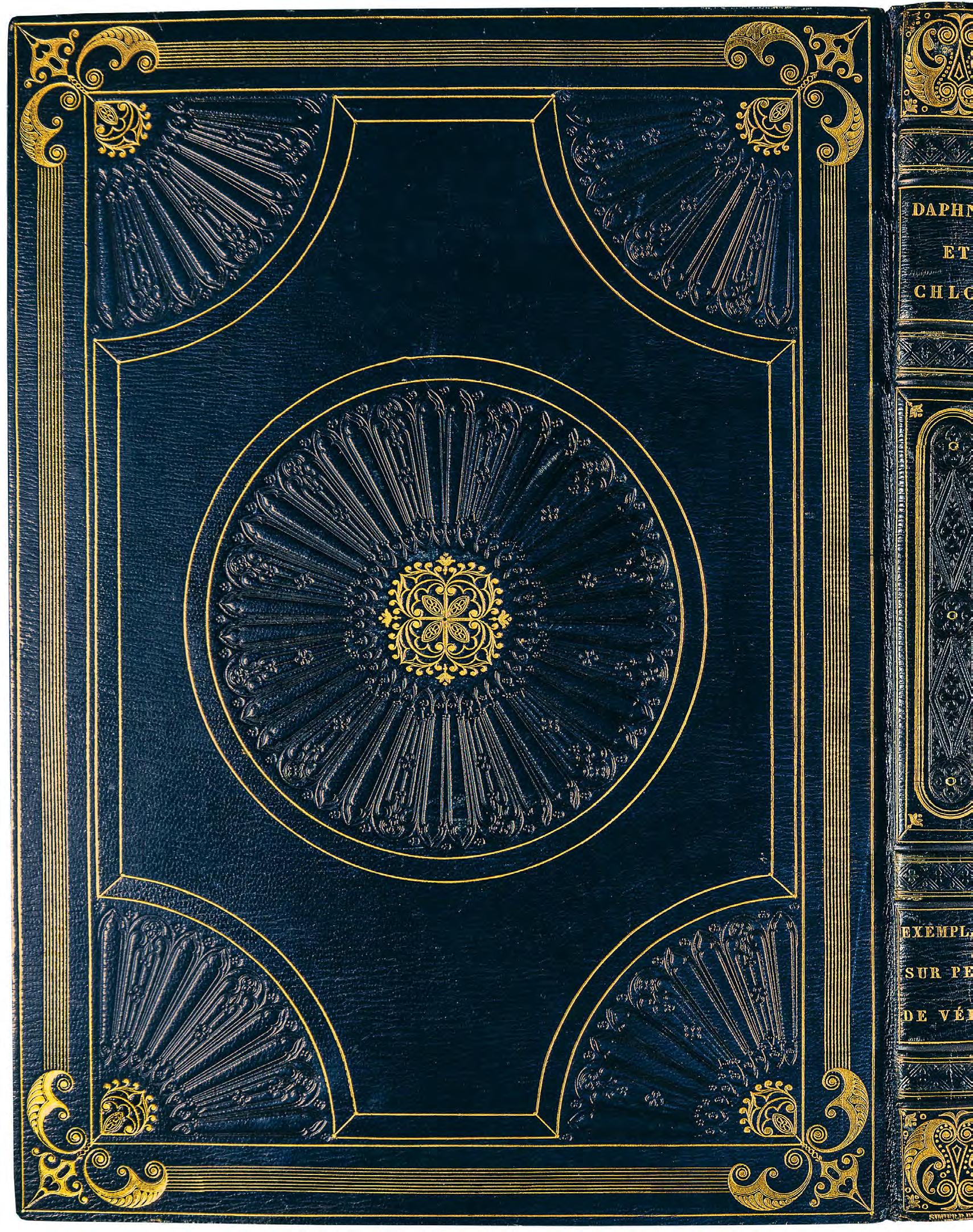
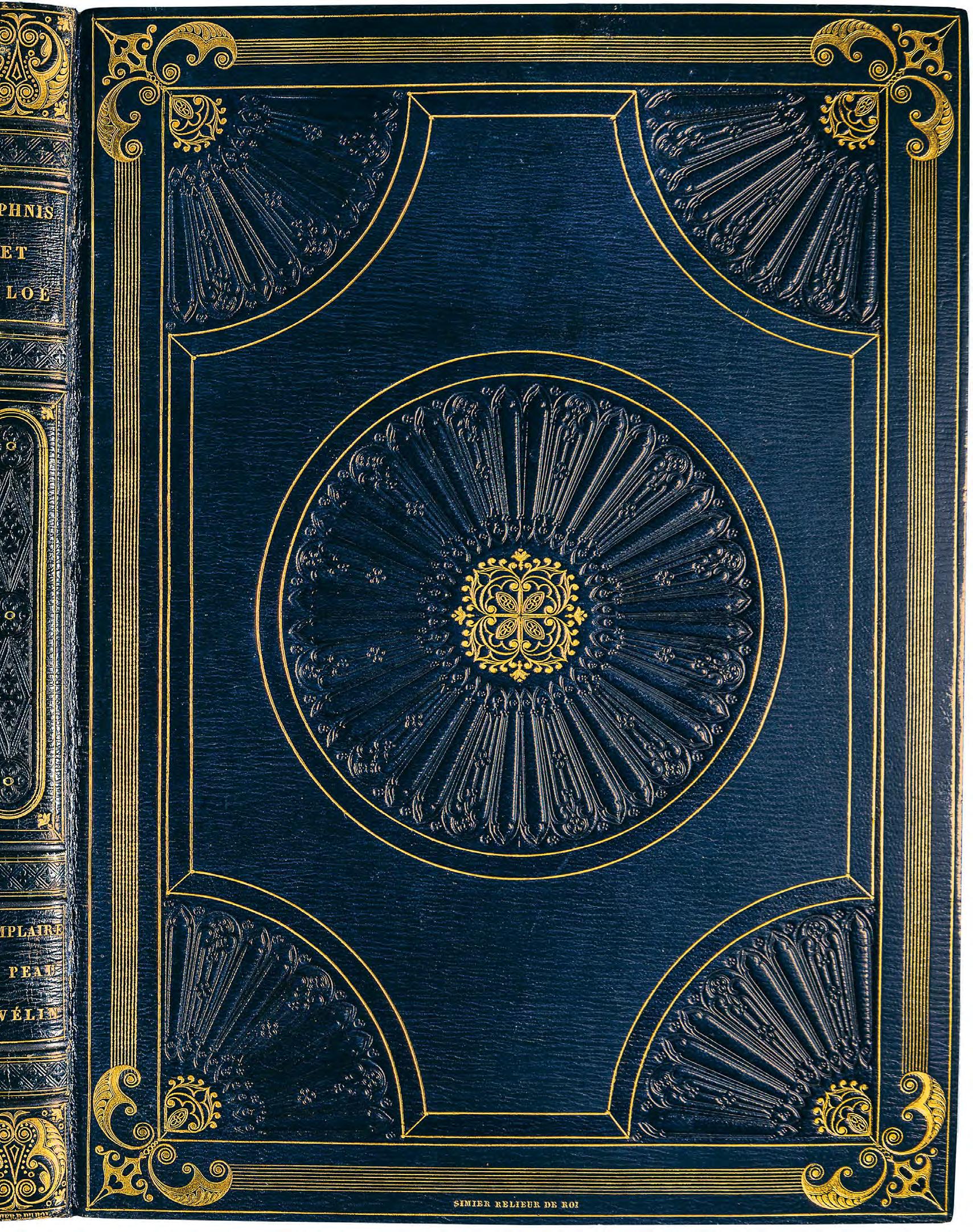
res de Gérard et Prudhon avant la lettre, sur papier de chine sont fixées sur peau vélin.“ Es war in einem neueren maroquin citron-Einband gebunden, der Katalog gibt versehentlich als Erscheinungsjahr an VI an.
Der Einband ist ein Meisterwerk des großen René Simier (1772–1843), „relieur du Roi“ seit 1818, einer der in dieser Zeit führenden Buchbinder. Der sonst zuweilen ausufernde Kathedralstil beschränkt sich hier auf die Ornamentik von Fensterrosen und einigen gotischen Paßformen, sehr stilvoll abgestimmt auf die übrige Ornamentik. Im Zusammenwirken der Vergoldung mit der Blindprägung entsteht ein harmonischer Gesamtklang, der allerdings vor allem bei den Eckfleurons der Deckel und den Kapitalen einen Zug der Phantastik und des Grotesken erhält, womit er sich vom gängigen Formenvokabular der vorangehenden Empirezeit deutlich abhebt.
Provenienz: Nachgewiesen in der Vente der Bibliothek Emmanuel Martin 1877, verkauft für 600 fr., damals noch angereichert mit diversen anderen Tafeln (Collection Martin 1877, Nr. 377:
„On peut regarder cet exemplaire comme unique en cette condition“). Zwanzig Jahre später findet es sich im Katalog des Barons Franchetti, dessen Sammlung im März 1898 verkauft worden ist. Unter der Nummer 105, hier nur noch mit den Tafeln, die zum Druck gehören, ist es für 2000 Goldfrancs verkauft worden, wohl an René Descamps-Scrive, dessen blaues goldgeprägtes Exlibris den vorderen Vorsatz ziert. Beim Verkauf seiner berühmten wie vorzüglichen Bibliothek (Bd. I, Nr. 179) erzielte es einen Preis von 15.000 fr. Danach im Besitz von Georges Wendling (Exlibris entfernt). Zuletzt Sammlung G. Rossignol, Paris.
Die Tafeln der Zyklen von Prud’hon und Gérard liegen in sehr sauberen, kräftigen und kontrastreichen Abzügen vor, durch die besondere Papierqualität nochmals an Intensität gewinnend. Eine leichte Stockfleckigkeit beschränkt sich auf Ränder und Seidenpapiere.
Unser Exemplar zitiert bei Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 657: „Un deuxième exemplaire sur vélin en maroquin bleu de Simier avec les figures sur Chine volant, 600 fr. vente E. Martin (n. 377)“.
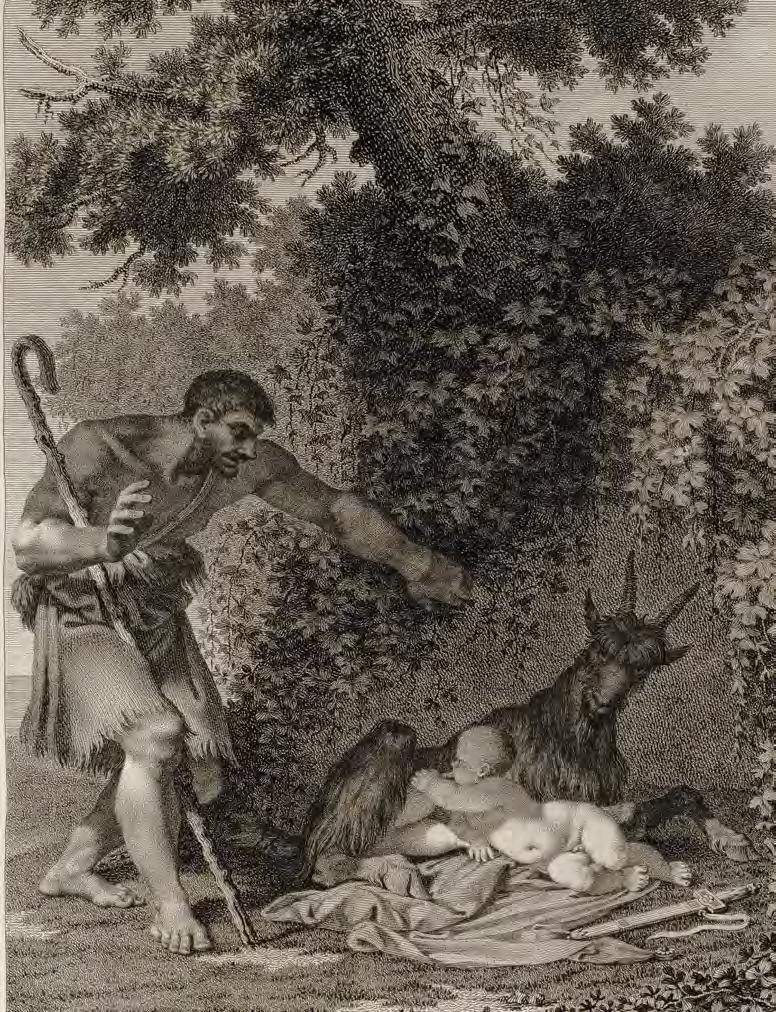

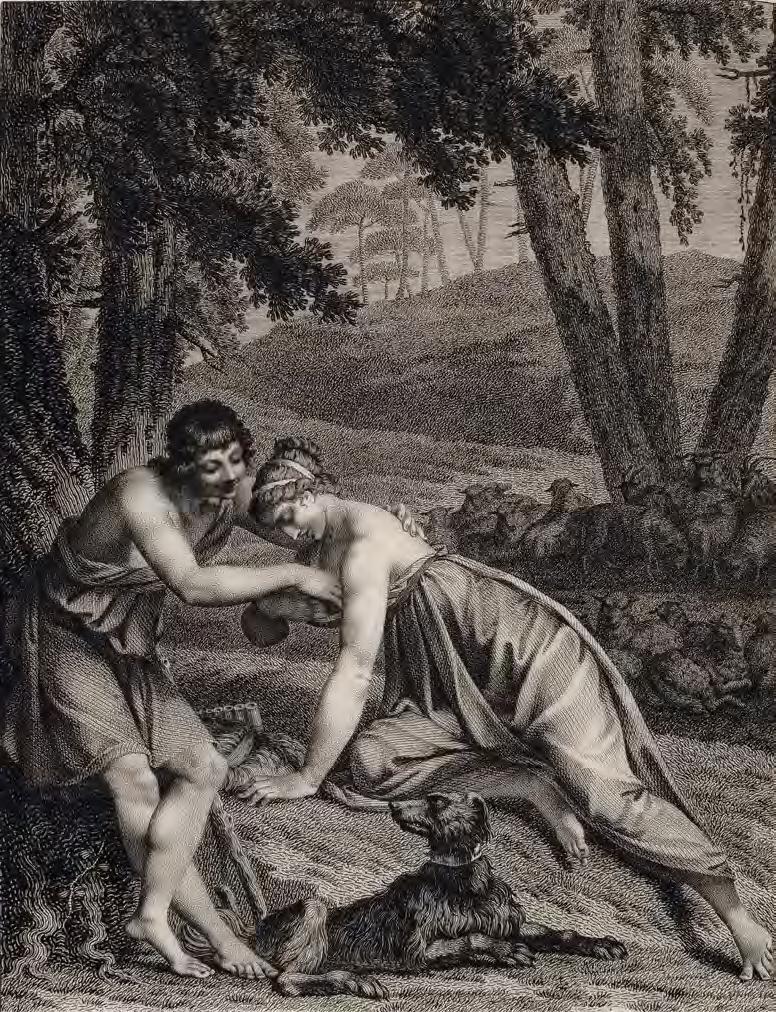

Die Ausgabe von 1803 in Orangefarbenem Maroquin von Gruel und aus dessen Bibliothek
LXXIX Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé, traduites du Grec de Longus par J. Amyot. Paris, [Crapelet für] A.-A. Renouard, XII – 1803.
Mit Frontispiz von B. Roger nach P. P. Prud’hon, einer gestochenen hochovalen Porträt-Vignette von A. de St.-Aubin auf dem Titelblatt und Holzschnitt-Druckermarke am Ende.
2 Bl., XVI, 171 S. (Vortitel und Titel, „Discours préliminaire“, „Préface de Longus“ und Haupttext, dazu Insertion nach S. XVI: 4 Bl., „Fragment de Daphnis et Chloé“, gedruckt nach der Ausgabe Florenz 1810).
Kollation: π2 a 6 b2 1–14 6 15 2 (zusätzlich: π4 zwischen b2 und 11).
Duodez, auf Papier im Format Oktav (174 x 101 mm).
Orangefarbener Maroquineinband um 1880/90 im Stil des mittleren 18. Jahrhunderts auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit floraler Rückenvergoldung sowie dem goldgeprägten Titel und den Erscheinungsdaten im zweiten und dritten Kompartiment von oben, Deckel mit reicher goldgeprägter Dentelle im Stil von Lemonnier; Stehkantenvergoldung in Pointillé, Innenkantenvergoldung in Form einer zierlichen floralen Bordüre, Marmorpapiervorsätze, dreifarbiges Seidenlesebändchen sowie Ganzgoldschnitt, fliegender Vorsatz gestempelt: „Gruel“.
Schönes breitrandiges Exemplar auf Bütten in einem exquisiten Meistereinband, der ganz im Stil der Buchbinderkunst des Louis-quinze gestaltet ist.
Die gesuchte Ausgabe mit einer weiteren, vorher nicht veröffentlichten Kupfertafel nach Pierre Paul
Prud’hon, die den nackten Daphnis zeigt, wie er eindringlich versucht, die zögernde leichtbekleidete Chloé zu überreden, mit ihm zu baden. Der Druck ist mit großer Sorgfalt ausgeführt und enthält erstmalig ein Porträt des Amyot, das als Titelvignette erscheint, eine Reverenz des Verlegers an den großen Übersetzer des 16. Jahrhunderts, dessen Übertragung zuweilen sogar dem Originaltext selbst vorgezogen worden ist. In Bezug zu dieser Zeit stellt sich auch der bibliophile Verleger selbst mit einer in Holzschnitt ausgeführten Dru kkermarke in Form der Aldinen.
In unser Exemplar ist vor das Vorwort des Autors das vier nichtpaginierte Blätter umfassende „Fragment de Daphnis et Chloé, découvert dans un manuscript grec de Longus, dans la Bibliothèque Laurentinae, à Florence“ eingefügt, eine Ergänzung, die aus den Forschungen des Hellenisten und Publizisten Paul-Louis Courier (1772–1825) an einem Manuskript in der Biblioteca Laurenziana in Florenz hervorgegangen ist und in den Kontext von dessen Longus-Ausgabe des Jahres 1810 gehört. Courier hatte sich dabei wohl etwas zu intensiv mit der Originalhandschrift beschäftigt, denn er wurde im November 1809 beschuldigt, das Manuskript durch verschüttete Tinte verunstaltet zu haben (die sogenannte Tintenklecksaffäre). Dennoch konnte im September des Folgejahres seine Herausgabe der ersten vollständigen griechischen Fassung von Daphnis et Chloé in Florenz erfolgen. Dem Verleger unserer Ausgabe, Antoine-Augustin Renouard (der auch der erste Besitzer unseres unikalen Exemplars Nr. LXI war), schilderte er in einem Brief vom 20. September 1810 seinen Standpunkt in dieser überaus heiklen Angelegenheit, in der er sich unschuldig fühlte (anonym publiziert als Lettre à Mr. Renouard … sur une tache faite à un manuscript de Florence, Tivoli 1810). Dessen ungeachtet, ließ er die Florentiner
Neuausgabe von Daphnis und Chloe 1810 auf eigene Kosten in nur 60 Exemplaren drucken, wobei er das Supplement (die Seiten 16–22 dieser Ausgabe) in das alte Französisch Amyots übertrug, damit kein Stilbruch entstünde; diese vier Blätter wurden auch ohne Paginierung gedruckt, um sie in ältere Ausgaben, insbesondere in die vorliegende, einfügen zu können (siehe Biographie universelle, Bd. XXV, S. 21 f., Hoffmanns Lexikon der griechischen Autoren, S. 534, und Blignières, Essai sur Amyot, S. 146 f.). Diese Insertion ist wohl nur gelegentlich geschehen, immerhin lag die Ausgabe schon sieben Jahre zurück. Unsere beiden Exemplare enthalten diesen Zusatz, allerdings an unterschiedlichen Stellen eingebunden. Renouard, dem Courier eigentlich zugesagt hatte, ihm den Druck der ersten vollständigen Longus-Ausgabe komplett zu überlassen, doch dieses Versprechen dann rasch gebrochen hat (man vergleiche die entsprechenden Ausführungen in unserem Einführungstext), konnte immerhin die Textergänzung drucken, wie er das in seinem Verkaufskatalog des Jahres 1819 bezeugt, in dem er mit Stolz von seiner Ausgabe des Jahres 1803 berichtet: „Revue avec soin sur plusieurs éditions, et notamment sur la première, de 1559, cette jolie réimpression peut être regardée comme la meilleure de toutes, et le fragment que j’y ai ajouté la rend aussi la plus complète.“ (Renouard, Catalogue 1819, Bd. III , S. 187).
Provenienz: Auf dem Vorsatz das gestochene Exlibris des großen Buchbinders Léon Gruel (1841–1923) mit der Devise „In labore fructus“, dazu handschriftlich mit Tinte das Monogramm „L. G.“ und die Nummer 984. Gruel hat das Exemplar demnach für seine eigene Sammlung gebunden.
Das sehr breitrandige Exemplar lediglich gering beschnitten, was man an einigen témoins sehen kann. Nur in den Rändern gelegentlich leicht
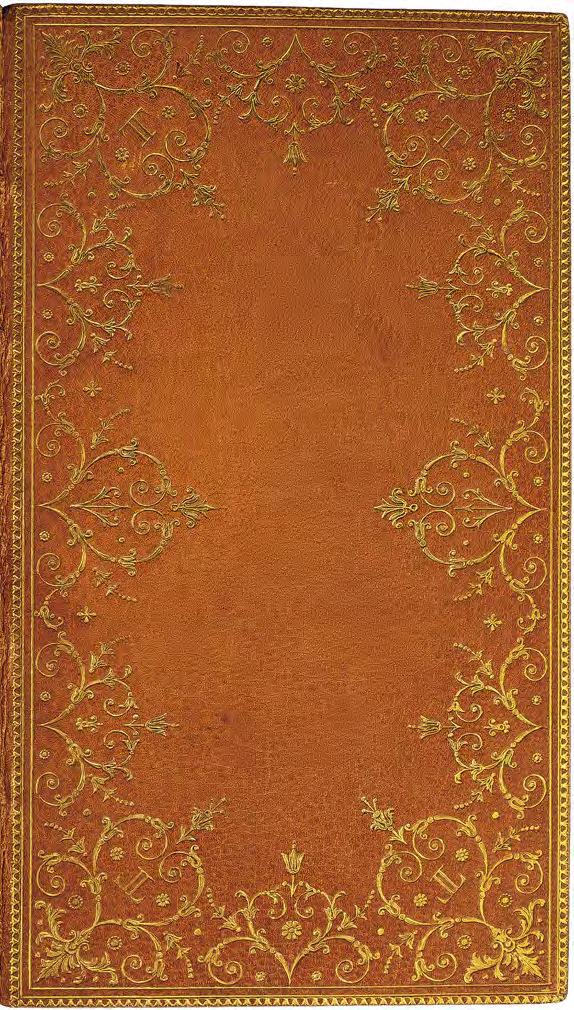
stockfleckig, der Einband mit vereinzelten kleinen Flecken.
Referenzen: Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, Sp. 657; Barber, Daphnis and Chloe, S. 49–52 und 57–60 (ausführlich zur Entdeckung der fehlenden Textfassung und der Tintenklecksaffäre, mit Abbildung des verunstalteten Manuskripts auf Seite 59). Quérard, La France littéraire, Bd. V, S. 351. Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1159. Ebert, ABL , 12246 (in der Anmerkung zur Ausgabe Didot, 1800). Hoffmann, Literatur der Griechen, Bd. I, S. 534. Vicaire, Manuel de l’amateur, Bd. V, Sp. 385. Monglond, La France révolutionnaire et impériale, Bd. VI , Sp. 164. Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, S. 515. Lewine, Illustrated books, S. 325.
Das Exemplar Beraldi in grünem Mosaik-Einband von Capé und mit Probedrucken von Prud’hon
LXXX Longus. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé, traduites du Grec de Longus par J. Amyot. Paris, (Ch. Crapelet für) A.-A. Renouard, XII – 1803.
Mit Radierung von B. Roger nach P. P. Prud’hon (eigentlich das Frontispiz, hier in zwei Zuständen vorliegend: avant la lettre und eau-forte pure), einer gestochenen hochovalen Porträt-Vignette von A. de St.-Aubin auf dem Titelblatt und HolzschnittDruckermarke am Ende. – Zusätzlich eingebunden: Zwei Probedrucke der Porträt-Vignette auf einer Tafel, hier als Frontispiz (davon eine auf aufgewalztem China), eine Kupfertafel mit dem Bildnis des Daphnis von A. Leroy nach A. Deveria, bei Blaisot in Paris, sowie eine Radierung nach Gérard, avant la lettre.
2 Bl., XVI, 171 S. (Vortitel und Titel, „Discours préliminaire“, „Préface de Longus“ und Haupttext, dazu Insertion zwischen den Seiten 18 und 19: 4 Bl., „Fragment de Daphnis et Chloé“, gedruckt nach der Ausgabe Florenz 1810).
Kollation: π2 a 6 b2 1–14 6 15 2 (zusätzlich: π4 zwischen 2 3 und 24).
Smaragdgrünes Maroquin um 1850 auf fünf erhabenen Bünden zu sechs Kompartimenten mit reicher floraler Rückenvergoldung und dem goldgeprägten Titel im zweiten von oben, Deckel mit dreifachem Filetenrahmen mit Dent-de-rat-Besatz sowie Perlstab, reicher goldgeprägter Dentelle in allen vier Ecken sowie einem rhombenförmigen Ornament aus Ranken in der Mitte, zentral eine rote ovale Maroquineinlage mit goldgeprägter Rose; doppelte Stehkantenfileten, Innenkantenvergoldung, Marmorpapiervorsätze, dreifarbiges Seidenlesebändchen sowie Ganzgoldschnitt, signiert „Capé“.
Das Exemplar Beraldi in einem exzellenten Einband von Capé, zusätzlich ausgestattet mit Probedrucken avant la lettre sowie einem eau-forte pure nach Prud’hon, ähnlich dem bei Cohen und De Ricci erwähnten Exemplar in grünem Maroquin von Cuzin, wie dieses auf Velinpapier gedruckt (denkbar wäre sogar, daß hier irrtümlich der falsche Buchbinder angegeben wurde und unser Exemplar gemeint ist). Wie dem auch sei – unseres ist in jedem Fall eines der schönsten Exemplare dieser ohnehin seltenen Ausgabe.
Die Edition von 1803 steht zwar noch in der Tradition des 18. Jahrhunderts, aber nicht zuletzt durch den retrospektiven „Discours préliminaire“ am Anfang und die Illustration mit der Hervorhebung und besonderen Würdigung des Übersetzers Amyot durch das Porträt als Titelvignette setzt sie einige neue Akzente. Auch diesem Exemplar sind die sehr seltenen vier, im Jahr 1810 publizierten Blätter beigefügt, mit der Ergänzung nach dem in Florenz aufgefundenen Fragment, übersetzt im Stil des Amyot durch ihren Entdecker Paul-Louis Courier; diese konnten naturgemäß nur noch einer Restauflage beigebunden werden. .
Der prachtvolle, mit großer Feinheit gefertigte Einband von Charles François Capé (1806–1867) ist ein Meisterwerk in Anlehnung an Vorbilder des mittleren 18. Jahrhunderts. Interessant ist dabei, wie eine lediglich leichte Stilisierung und geringfügige Abwandlung des alten Formenguts, trotz der insgesamt analogen Anwendung desselben, dazu führt, daß man dieses Werk auf den ersten Blick als Schöpfung des 19. Jahrhunderts erkennt – und anerkennt – ebenbürtig in Geschmack, handwerklichem Können und schöpferischer Originalität.
Provenienz: Exlibris von Henri Beraldi auf dem fliegenden Vorsatz, auf dessen Versteigerung V, 1935, Nr. 113 es für 1.300,– frs versteigert worden ist.
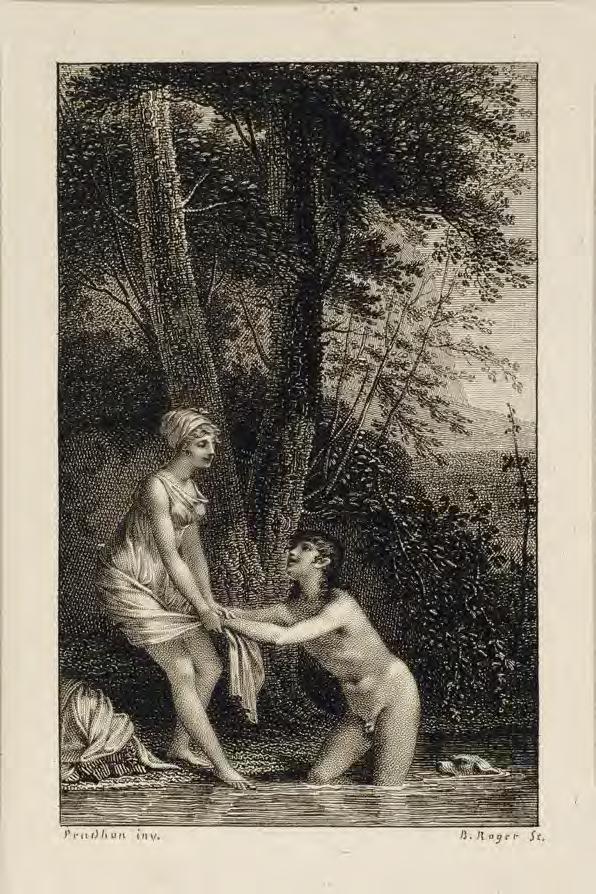
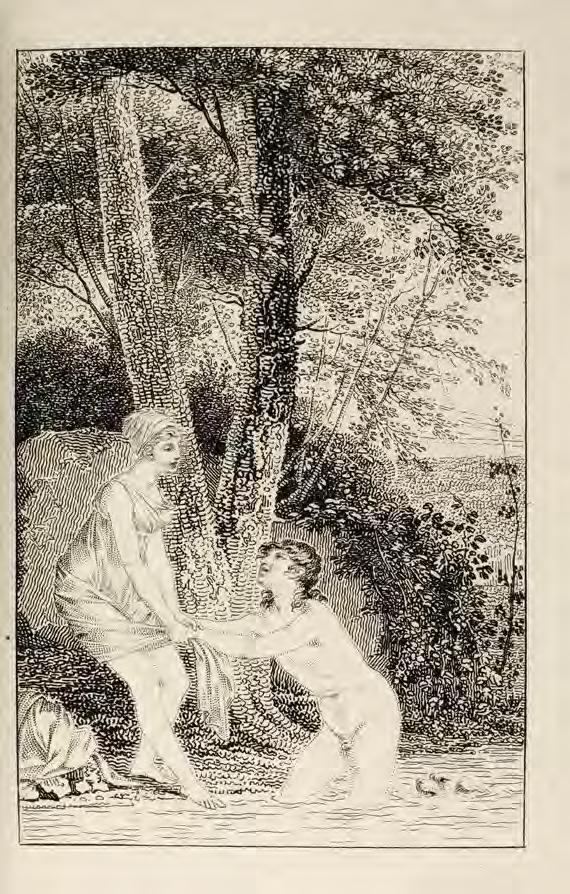
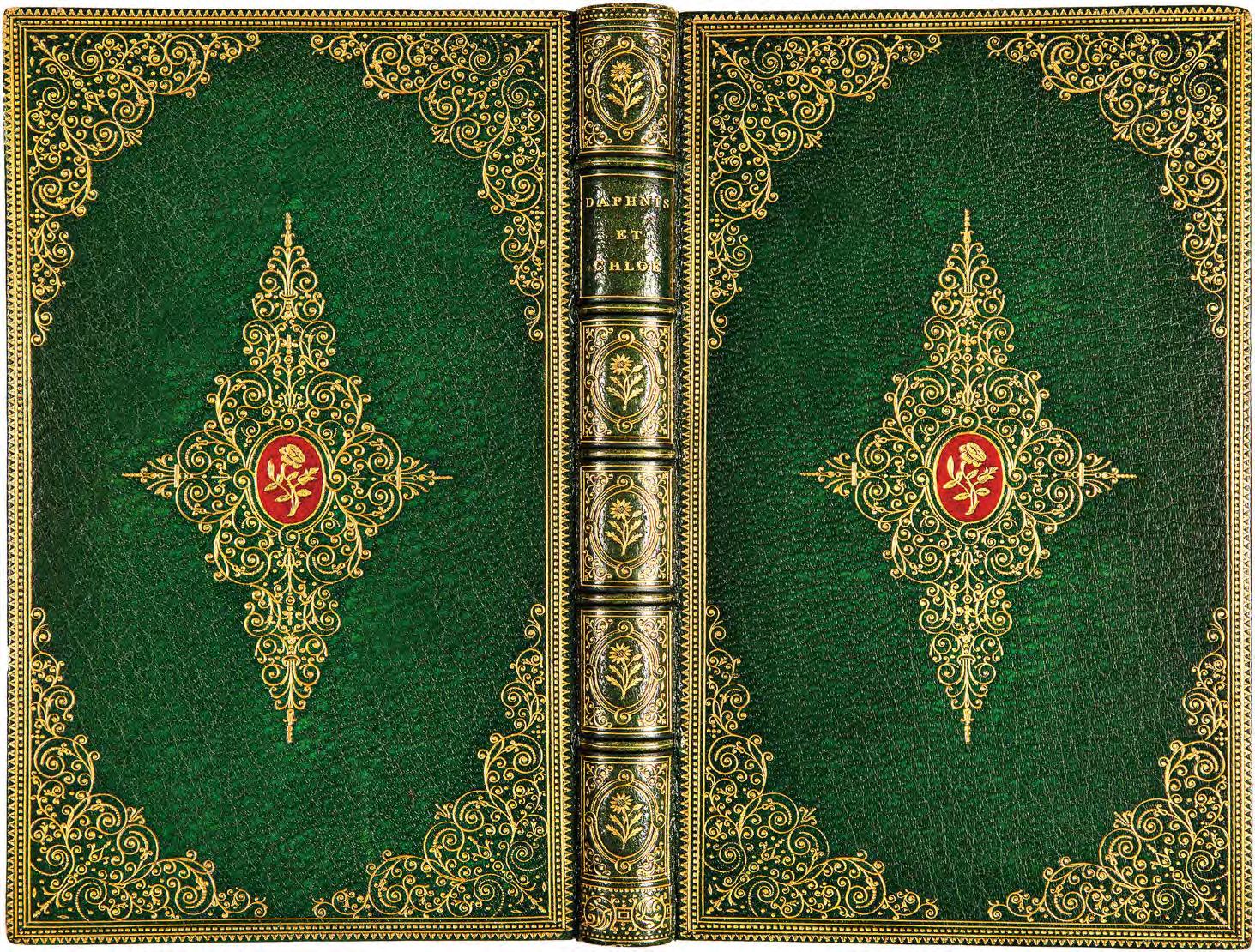
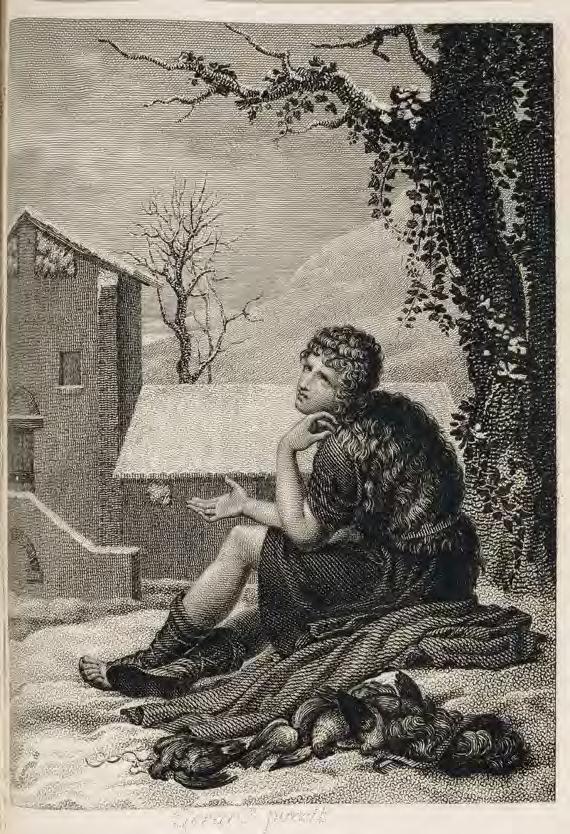

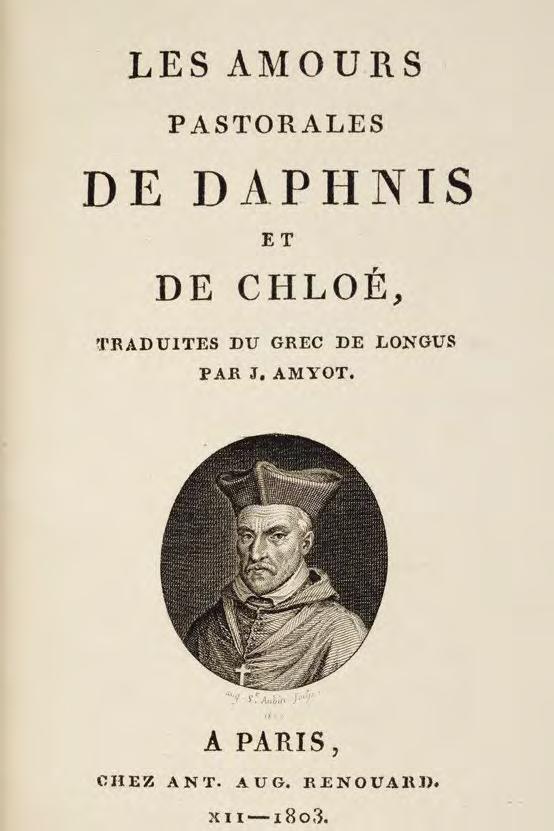
Das einzige signierte Gemälde eines grossen, nun wieder entdeckten Meisters
Frontier, Jean-Charles (Paris 1701–Lyon 1763). Junges Liebespaar in pastoraler Landschaft: Daphnis und Chloé. Ölgemälde auf Leinwand. Signiert und datiert 1749 (auf dem Felsen in der Bildmitte).
98 x 145 cm.
In klassisch-strenger Komposition angelegt, nur leicht nach Links gerückt, sehen wir im Zentrum dieses reizvollen Gemäldes ein junges Paar in idyllischem Umfeld, fast entblößt von seinen wallenden Gewändern, umgeben von drei Gruppen mit Eroten und eingebettet in eine Landschaft, die im Vordergrund Züge von wilder Natur trägt, nach hinten aber immer mehr den lieblichen Ausdruck eines weiten Landschaftsparks annimmt. Der pastorale Kontext wird durch die beiden Gruppen im Vordergrund an den unteren Bildecken verdeutlicht, wo links ein liegender Erot mit dem Hirtenstab eine kleine Schafherde bewacht, während rechts drei Eroten mit dem Hirtenhund spielen.
Erst in der Ferne wird blaß im dunstigen Licht ein Zeichen der Zivilisation erkennbar, zwei typische antike Ruinen, wie sie gewöhnlich in südlichen Landschaften erscheinen. Dem lichten Ausblick entspricht die ebenso helle, in den Farben aber kräftigere Gruppe des Liebespaares, zusammen mit den über ihnen schwebenden beiden Eroten, die eine Lyra tragen, über einer rosigen Wolkenbank. Diese hell erleuchtete Mittelpartie des Bildes wird eingefaßt von dunklen Randbereichen mit Wäldern, abgestorbenen Bäumen und Felsen. Indem sie der zentralen Gruppe einen festen, einfassenden Gegenpart bieten, wird der Eindruck von Abgeschiedenheit, aber auch Geborgenheit inmitten der Wildnis hervorgerufen. Die Liebenden sind
an diesem einsamen Ort allen störenden Blicken entzogen, und die Eroten – Personifikationen der sich regenden Gefühle und des zu erwartenden Geschehens entflammter Liebe – sind vollauf damit beschäftigt, alle nur möglichen Störungen von diesem jungen Paar fernzuhalten. Letzteres ist im Bildzentrum geradezu inszeniert, betont durch Licht und Farben, die sprechende Gestik der Hände und ein gewisses Spannungsmoment, das zwischen beiden besteht, nicht zuletzt aber durch die Komposition.
Dieser Bildaufbau, der wirkt, als wäre er einem Lehrbuch akademischer Malerei entnommen, ist mittels zweier Dreiecksanordnungen gestaltet, die jeweils ihre Basis an der unteren Bildkante haben und sich bis zu den Rändern erstrecken, wobei das eine Dreieck seine Spitze am Kopf der Chloé findet, während seine Seitenlinien über ihren rechten Arm und den Rücken des Daphnis hinab verlaufen; damit rückt der Schwerpunkt der Komposition insgesamt ein wenig zur linken Seite, was jedoch seinen Ausgleich findet durch das zweite, größere und überfassende Dreieck, dessen Spitze in der nach oben gestreckten Hand des linken Eroten der schwebenen Gruppe zu sehen ist. Diese ist, kontrapunktisch zur ersten, gegenüber der Mittelsenkrechten leicht nach rechts gerückt. Auch in ihrer Bewegungsrichtung sind beide Gruppen gegenläufig, das Liebespaar nach links, das Erotenpaar nach rechts. Im Gesamten gleichen sie sich jedoch aus, betonen dadurch die Bildmitte und führen den Blick des Betrachters vom Vordergrund gleichermaßen in die Bildtiefe und die Höhe, ausgehend von den Gruppen an den unteren Bildecken, über das Liebespaar, bis hinauf zu den schwebenden Eroten. Diese Harmonie, die bis ins Kleinste und Feinste ausbalanciert erscheint, wird jedoch von einigen spannungsvollen Momenten so angereichert, daß ein Ablauf, eine kleine Erzählung entsteht,
vielleicht sogar der Augenblick einer entscheidenden Wendung.
Indessen ist das Sujet dieses Gemäldes nicht auf Anhieb eindeutig zu bestimmen; die allgemeine Thematik des Liebespaars in pastoraler, bukolischer Landschaft ist seit der Renaissance weit verbreitet, insbesondere unter den Venezianern des 16. Jahrhunderts, und wir kennen zahlreiche literarische Vorwürfe, die in ähnliche Darstellungen umgesetzt wurden, Paris und Oinone zum Beispiel. Grund genug, uns das Gemälde näher anzusehen, um möglichen Aufschluß über die Identität dieses Paares zu erlangen. Die sehr jungen Liebenden werden inmitten einer ländlichen Idylle gezeigt, nahe eines stillen Gewässers, an dessen fernem Ufer im Hintergrund das dunstige Licht der untergehenden Sonne zu sehen ist. Der bühnenartige Vordergrund, in dem sich die Szene abspielt, ist eine Hirtenlandschaft mit alten, teils morschen Bäumen an den Bildrändern, in der Mitte eine Lichtung, wobei Felsen ein natürliches Lager für die Liebenden abgeben. Diese haben allerdings nicht so recht die Liebe im Sinn, wie ihre Gesten zeigen, weisen doch beider Hände etwas besorgt und achtsam unter anderem auf die zu hütenden Schafe. Nun ist es nicht die Art von Göttern und Heroen, sich beim Schäferstündchen um Schafe oder andere Nebensächlichkeiten zu sorgen – Paris und Oinone lebten als Hirt und Hirtin zusammen, Jupiter verführte als Hirt verkleidet die Mnemosyne, um nur zwei davon anzuführen –doch die bekannten Darstellungen dieser Paare klammern gewöhnlich das Hüten der Schafe aus, die Liebenden bleiben auf sich selbst konzentriert. Dieses Paar dagegen widmet offenbar seine Gedanken noch dem Wohl der Tiere, also ihren Aufgaben und Pflichten. Vergleichen wir das Gemälde Frontiers mit einer nahe verwandten Darstellung, der Verführung der Mnemosyne durch den als
Schafhirten verkleideten Jupiter in der Fassung des Jacob de Wit von 1727, heute im Rijksmuseum in Amsterdam, so fällt trotz einiger Gemeinsamkeiten bei der Ikonographie und der Darstellungsform, die sogar bis ins Detail gehen – dieselben Farben der Gewänder und ganz ähnliche Frisuren der Protagonisten, dazu die Eroten, die das Geschehen nach Kräften zu fördern versuchen – vor allem eines ins Auge: der unterschiedliche Habitus des Paares zueinander, das, obgleich gemeinsam den Hirtenstab umklammernd, keinen Blick mehr für etwas anderes als das jeweilige Gegenüber hat. Das ist in unserem Gemälde noch nicht der Fall. Die junge Frau senkt hier den Blick, die Gesten beider weisen nach außen, der innere Einklang ist in diesem Moment nicht ganz gegeben. Noch scheinen Ablenkungen, Scham und die ihnen obliegenden Pflichten die Gefühle der Liebe zu überlagern und zu hemmen. Und hier kommt die kleine Schar von Eroten ins Spiel. Ihre Aufgabe ist es, alle derartigen Ablenkungen von dem Paar fernzuhalten: Gleich drei kümmern sich vorne in der rechten Ecke um den unruhigen Hirtenhund, links wacht ein weiterer mit der Houlette in der Hand über die ohnehin geruhsam liegenden und weidenden Schafe, und im Himmel trägt das schwebende Erotenpaar eine Lyra, die es allerdings hinter einem Tuch verbirgt. In diesen beiden kleinen Liebesgöttern wird reflektiert, daß das menschliche Paar noch nicht zueinander gefunden hat, ist doch das Tuch trennend zwischen ihnen, so daß der eine im Schatten bleibt, der andere aber im Licht, die Bewegung strebt zudem auseinander. Die verdeckte Lyra, von der man nicht weiß, ob sie enthüllt oder verhüllt wird, ist in jedem Fall das Symbol für die Musik, und diese war schon im Mittelalter in den Liebesgärten präsent, sie gehört zum Ambiente, zum Ort und Geschehen der Liebe selbst. Da aber das Hirtenmilieu an sich keine Lyra kennt, allenfalls Flöten und Sackpfeifen, ist


dieses edle Instrument der Götter hier als Symbol der noch nicht zum Durchbruch gelangten, verborgenen Liebe zu verstehen – noch ist es verhüllt, aber im nächsten Moment kann oder wird es erklingen. Nicht gespielt von dem Jüngling, der sich seiner Auserwählten widmen wird, sondern als Begleitung, von einem der Eroten. Doch so weit ist es hier noch nicht gekommen. Daß solches vielleicht bevorstehen könnte, darauf deutet eine kleine spielerische Geste hin: hält doch der eine Erot aus diesem „himmlischen Paar“ dem anderen das Tuch vor das Gesicht, den Blick auf das Menschenpaar verdeckend.
Eigentlich unnötig: Obgleich nur spärlich bekleidet, haben die beiden den wahren Eros offensichtlich noch nicht entdeckt, auch wenn sie sich im Geiste schon begehren mögen. Wiewohl hier eigentlich ein arkadischer, idealer locus amoenus amoris vorhanden wäre, müssen doch auch hier alle Ablenkungen entfernt und die Sorge um die Herde beruhigt werden, dann erst ist zu hoffen, daß die sinnliche Liebe die beiden wirklich entflammt. Und das ist der wichtigste Grund, warum wir davon ausgehen dürfen, daß die beiden keine anderen als Daphnis und Chloe seien können. Ihre Liebe ist nicht die heftige, zuweilen rücksichtslose Leidenschaft, wie man sie von Mars, Venus, Paris, Apoll und anderen Göttern und Helden kennt, sie ist ein zartes Pflänzchen zweier völlig unerfahrener junger Menschen, und die Eroten versuchen ihr Bestes, ihnen den Weg zum Glück zu bereiten.
Jean-Charles Frontier gehört zu den großen Unbekannten der französischen Malerei des 18. Jahrhunderts. Wir wissen zwar manches von seiner Vita, auch daß er von den Zeitgenossen als bescheidener Mensch und hochtalentierter Künstler geschätzt worden ist (Rosenberg, S. 362) – das Problem liegt in der mangelhaften Kenntnis seines
Œuvres, bestehend aus Gemälden und zahlreichen Zeichnungen. Seine Bescheidenheit mag wohl ein Grund dafür gewesen sein, daß er kaum signiert hat. In unserem Ölbild dürfte sein einziges signiertes Werk auf dem Gebiet der Malerei vorliegen. Auch bei den Zeichnungen, von denen man eine größere Gruppe aufgrund stilistischer Übereinstimmungen zusammenstellen konnte, finden sich gewöhnlich keine Signaturen. Daß Frontier im Fall unseres Gemäldes ausnahmsweise doch einmal seine Signatur angebracht hat, noch dazu an recht prominenter Stelle, und nicht üblicherweise am unteren Bildrand, spricht dafür, daß er dieses Werk in besonderer Weise schätzte oder daß es eine herausragende Position in seinem Schaffen eingenommen hat. In der Tat dürfen wir es unter seine bedeutendsten Schöpfungen einordnen, so weit sein Gesamtwerk bis heute erschlossen ist. Dieses gesicherte Werk wird zukünftig sicherlich als Anhaltspunkt für weitere Zuschreibungen dienen können. Daß sein Gesamtwerk weit umfangreicher sein muß, als heute bekannt, dafür spricht schon die Vita des Malers, der immerhin Professor an der Pariser Kunstakademie gewesen ist, an einigen Salon-Ausstellungen teilgenommen hat, 1754 nach Lyon übersiedelte und dort 1757 eine Zeichenschule zur Ausbildung der Entwerfer der Seidenindustrie gegründet hat. Seine Lehrzeit absolvierte Frontier bei dem Pariser Maler Claude-Guy Hallé, 1733–39 war er Stipendiat an der Académie de France in Rom. Im Jahre 1744 wurde er an der Pariser Akademie als Historienmaler aufgenommen und zum Peintre du Roi erhoben. Er erhielt eine Reihe kirchlicher Aufträge, malte aber auch profane und mythologische Themen, beispielsweise zur Ausgestaltung von Räumen, wie wir aus Quellen wissen. Professor an der Akademie wurde er 1752. Aus demselben Jahr wie unser Gemälde stammt eine Heilige Familie, die sich heute in der Church of the Annunciation, Oka, Quebec,
befindet. Das Problem der Zuordnung überlieferter Gemälde und Zeichnungen beschreibt Pierre Rosenberg in seinem Aufsatz über die Gruppe seiner Düsseldorfer Zeichnungen, der zusammenfaßt, was wir von Frontier heute noch wissen.
Geschult hat sich Frontier zuerst an den großen Meistern der italienischen Renaissance, indem er in seiner Ausbildungszeit Kopien nach ihnen fertigte, insbesondere schätzte er Raffael und, was im 18. Jahrhundert noch ungewöhnlich war, auch Giovanni Bellini. Unsere Daphnis und Chloe-Darstellung ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die konsequente Umsetzung dieser Vorbilder in den Malstil des 18. Jahrhunderts; die Anlehnung an die großen Renaissance-Meister wird vor allem daran erkennbar, wie hier der Bildaufbau, ausgehend von einer strengen geometrischen Disposition, spannungsvoll und variationsreich entwickelt wird, belebt durch leichte Asymmetrien in der Anordnung der Figurengruppen, die auch alle unterschiedlich gestaltet sind. Man glaubt hier fast eine Art Musterbeispiel für die Umsetzung der seit der Renaissance gültigen Kunsttheorie, ausgehend von den Schriften Albertis, vor sich zu haben: Nach dieser entsteht das Vergnügen, diletto, an der historia aus der Verbindung von Fülle, copia, und Mannigfaltigkeit, varietas. Wichtig ist dabei aber immer die Angemessenheit der Wahl der Mittel für die Darstellung, die die Würde, dignitas, wahrt, und diese resultiert wiederum aus der moderaten Verwendung von Fülle und Mannigfaltigkeit. Eben diese Normen sind in unserem Bild wie in einem Lehrstück erfüllt. Das große Vorbild, das hier durchscheint, ist der Gott des französischen Akademismus, Nicolas Poussin. Die Klarheit der Linie, bei der das Primat der Zeichnung trotz des an manchen Stellen leicht ins Diffuse gehenden Kolorits immer bestimmend bleibt, geht deutlich auf die Tradition der Poussinisten zurück. Könnte es sein, daß
unser Gemälde als eine Art Probestück geschaffen worden ist? Die Richter und Juroren hätten jedenfalls kaum Anlaß gehabt, an diesem Bild etwas zu monieren, das den Regeln akademischer Kunst zuwiderliefe.
Zur Entstehungszeit des Gemäldes war die vier Jahre zuvor gedruckte Pariser Ausgabe von 1745 in Frankreich die aktuelle und verbreitete Fassung des Longus-Romans. Sie enthält neben einem Nachstich der Regentensuite auch die schönen Vignetten Cochins, und in diesen könnte eine gewisse Anregung für unser Gemälde gelegen haben, sind sie doch aus einem ähnlichen Geist geschaffen. In beiden Fällen wird das Liebespaar fast zeitlos in idyllischer Landschaft gezeigt, keiner besonderen Szene der Erzählung zuzuordnen, eher ein Stimmungsbild in der Art „Schäferidylle mit Liebespaar“ als Teil der Textillustration zu sein. Das haben die Vignetten mit dem Gemälde Frontiers gemein, und auch der Habitus der Figuren ist den Stichen Cochins verwandt, hinausgehend über den bloßen Zeitstil. Vergleicht man dagegen die Gemälde-Fassung von François Boucher, entstanden 1743 (heute in der Wallace Collection in London), mit dem Werk Frontiers, so wird ein großer Abstand, nicht nur zwischen zwei Meistern und Fassungen, sondern zweier Richtungen deutlich. Während Frontier wesentlich gemäßigter und zurückhaltender, sprich: akademisch-strenger, bleibt und den Aspekt des Unschuldigen, Zarten, Vorsichtigen in den Mittelpunkt rückt, bekommt die Szene bei Boucher etwas Ekstatisches, Aufreizendes, gemalt in geradezu glühenden Farben. Obwohl Chloé dort nur einer Erzählung des Daphnis lauscht, ist sie in inniger Hingabe dargestellt, die visuell erfahrbare Intimität zwischen den beiden ist hier das Bildthema, wenn auch nicht körperlich, so doch in der Haltung des Paares zueinander. Das Gemälde von Frontier wahrt dagegen vollauf
die Contenance, bleibt den Grenzen der dignitas verpflichtet, die Nacktheit ist hier eine natürliche und Erotik ist nur ansatzweise vorhanden. Darin ist die Fassung Frontiers dem Geist der unschuldigen, zaghaften Liebe, die Longus beschreibt, weit näher als Boucher, für den der literarische Vorwurf zum Anlaß einer expliziten, ausschweifenden Darstellung von Sinnesfreude wird. Ein Maler wie Frontier, obgleich talentiert, meisterlich in der Anwendung der Regeln und von Originalität und Inventionskraft, geriet in der Nachwelt, die das Akademische oft als blasse und erstarrte Regelhaftigkeit verschmähte und dem „genialen“ Verstoß gegen die Form den Vorzug gab, rasch in Vergessenheit. Dieses Gemälde könnte dazu beitragen, diesen bedeutenden Maler nicht nur wiederzuentdecken, sondern auch seine Position in der französischen Malerei des mittleren 18. Jahrhunderts genauer zu bestimmen, als das bisher der Fall gewesen ist. Wenn auch im Schatten eines Boucher
stehend, ist seine Version von Daphnis und Chloe in der französischen Malerei des 18. Jahrhunderts sicherlich eine derjenigen, die den Intentionen der gleichzeitigen Buchillustration am nächsten kommen – es ist denkbar, daß etwa ein Charles Eisen sich an diesem Bild orientiert hat, als er um 1752/54 seine lieblichen Vignetten für die „Pour les curieux“- Ausgaben entworfen hat. Darüber können wir nur spekulieren. Angesichts unseres Gemäldes können wir Pierre Rosenberg jedoch in jedem Fall zustimmen, wenn er über die Düsseldorfer Zeichnungen Frontiers urteilt: „Frontier deserves greater recognition among his generation, which included one of the most dazzling groups of artists ever known in France.“
Literatur: AKL XLV, 456 f. Thieme/Becker XII , 529. Pierre Rosenberg, Jean-Charles Frontier: Drawings in Düsseldorf. In: Master drawings, hrsg. von der Master Drawings Association New York, 41, 2003, Bd. 4, S. 359–377.
Anhang A
Der erste Druck der ersten Ausgabe des 18. Jahrhunderts
LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Ecrites en Grec par Longus, & Traduites en François par Amiot. Avec figures. Nouvelle édition. „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ [d. i. wohl Paris, Guérin für Barbou,] 1716.
Mit gestochenem Titel und 7 (statt 8) Kupfertafeln von J.-B. Scotin.
6 Bl., 220 S., 1 weißes Bl. (Titel in Schwarzund Rotdruck, Widmung „A Monsieur I.*. *.*.“, „Avis du libraire au lecteur“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π6 A-S6 T 3 . Klein-Oktav (165 x 91 mm).
Dunkelbrauner Ledereinband der Zeit auf fünf Bünden zu sechs Kompartimenten mit Rückenvergoldung teils in Pointillé, das rote Rückenschild im zweiten von oben, und Marmorpapiervorsätzen.
Dies ist eines der sehr seltenen Exemplare mit dem ersten Druck der französischen Erstausgabe des 18. Jahrhunderts. Noch im selben Jahr 1716 folgte ihm eine Titelauflage unter dem Impressum „Amsterdam, Westin“ (unsere Nummern I und II). Beide Auflagen sind mit einiger Sicherheit als Drucke von Guérin in Paris zu identifizieren, der Verleger war wohl Jean-Joseph Barbou, welcher 1715 den Nachlaß des besonders während des mittleren 17. Jahrhunderts zu hoher Reputation gelangten Hauses Cramoisy aus dem Besitz der Erben gekauft hatte. Die Suite des Jean-Baptiste Scotin gehörte von Anfang an zum Druck, sie ist ein fester Bestandteil der Ausgabe und keine optionale Beigabe, wie auch schon vermutet worden ist. Die Stecherfamilie Scotin arbeitete in dieser Zeit nachweislich mit Barbou zusammen,
illustrierte beispielsweise dessen Vergil-Ausgabe des Jahres 1715. Die Stiche liegen hier in recht guten, wenn auch nicht so kräftigen Drucken vor, wie man das eigentlich für eine Erstausgabe erwarten möchte.
Vielen älteren Bibliographen war diese Ausgabe gar nicht bekannt, das Impressum zu entschlüsseln, ist kaum je versucht worden.
Mit der vorliegenden Pariser „Neuausgabe“ von 1716 wird die große Folge der französischen illustrierten Longus-Editionen des 18. Jahrhunderts eröffnet. Zu verdanken ist dies laut Dedikation einem „Monsieur I.*.*.*.“, der dem Verleger oder Herausgeber den Anstoß dazu gegeben und viel zum Gelingen beigetragen habe: „C’est Vous qui m’avez engangé à l’entreprendre, et c’est à vôtre bon goût qu’on est redevable des avantages qu’elle a sur toutes les autres. Content d’avoir choisi pour modelle un exemplaire où la version d’Amiot se trouvoit sans alteration“. Der Ungenannte habe unter anderem Ergänzungen und Vervollständigungen des Textes initiiert, darunter die Schließung „d’une Lacune qui se trouve assez heureusement restituées dans la Version posterieure, sans parler de quelques passages qu’Amiot n’a pas jugé à propos de traduire“. Der Herausgeber hat deshalb von der „Version de ce grand homme“ (i. e. Amyot) abweichen müssen, beispielweise wurde die erwähnte Lücke nach der Übersetzung des Pierre de Marcassus ergänzt. Die folgende, höchst interessante Passage macht dann auch noch deutlich, daß der Herausgeber bereits die Gemälde (und vielleicht auch schon die Stiche) des Philipp von Orléans gekannt haben muß, spricht er doch von einer Persönlichkeit höchsten Ranges , die sich mit diesem Thema zum Zeitvertreib beschäftigt habe, aber man sehe aus Rücksichtnahme und Respekt, auch angesichts des delikaten Inhalts der Geschichte, davon ab, diesen mit Namen zu nennen: „Et d’ailleurs une histoire
amoureuse dont le sujet a occupé dans des momens de délassement une main comme celle que le Respect m’empêche de designer, est au dessus de tout ce que l’on en pourroit dire.“
Überaus interessant ist dabei die Anmerkung: „C’est par le même motif que l’on n’a pas fait graver les Estampes de cette Edition, d’après les Peintures que l’on désigne icy“, was ja nur so zu deuten ist, daß man aus demselben Grund, also dem Respekt gegenüber dieser Persönlichkeit, davon abgesehen habe, die Stiche für die vorliegende Ausgabe nach gewissen Gemälden anzufertigen. Damit können eigentlich nur der Regent und sein zusammen mit Coypel geschaffener Gemäldezyklus zur Daphnis-und Chloe-Thematik gemeint sein. Im Avis du libraire au lecteur heißt es weiterhin, daß dies eine Edition nouvelle sur la version d’Amiot sei, es mehrere unterschiedliche Versionen dieses Werks in verschiedenen Sprachen gebe und der Bischof von Avranches, M. Huet, „un Prélat très illustre n’a pas fait difficulté d’avoüer dans un de ses Ouvrages qu’il avoit en dessin dans la jeunesse d’en donner une nouvelle Version “, was wohl als Hinweis auf die Anerkennung des Werks durch eine prominente geistliche wie auch intellektuell federführende Persönlichkeit der Zeit zu werten ist, nicht aber so verstanden werden darf, daß Huets unvollendete „Jugendsünde“ einen Einfluß auf die vorliegende Fassung gehabt hätte.
Es fehlt die Tafel mit den Petits pieds. Wenig flekkig und gebräunt, der Einband etwas beschädigt. –Bibliographie siehe unsere Nummer I.
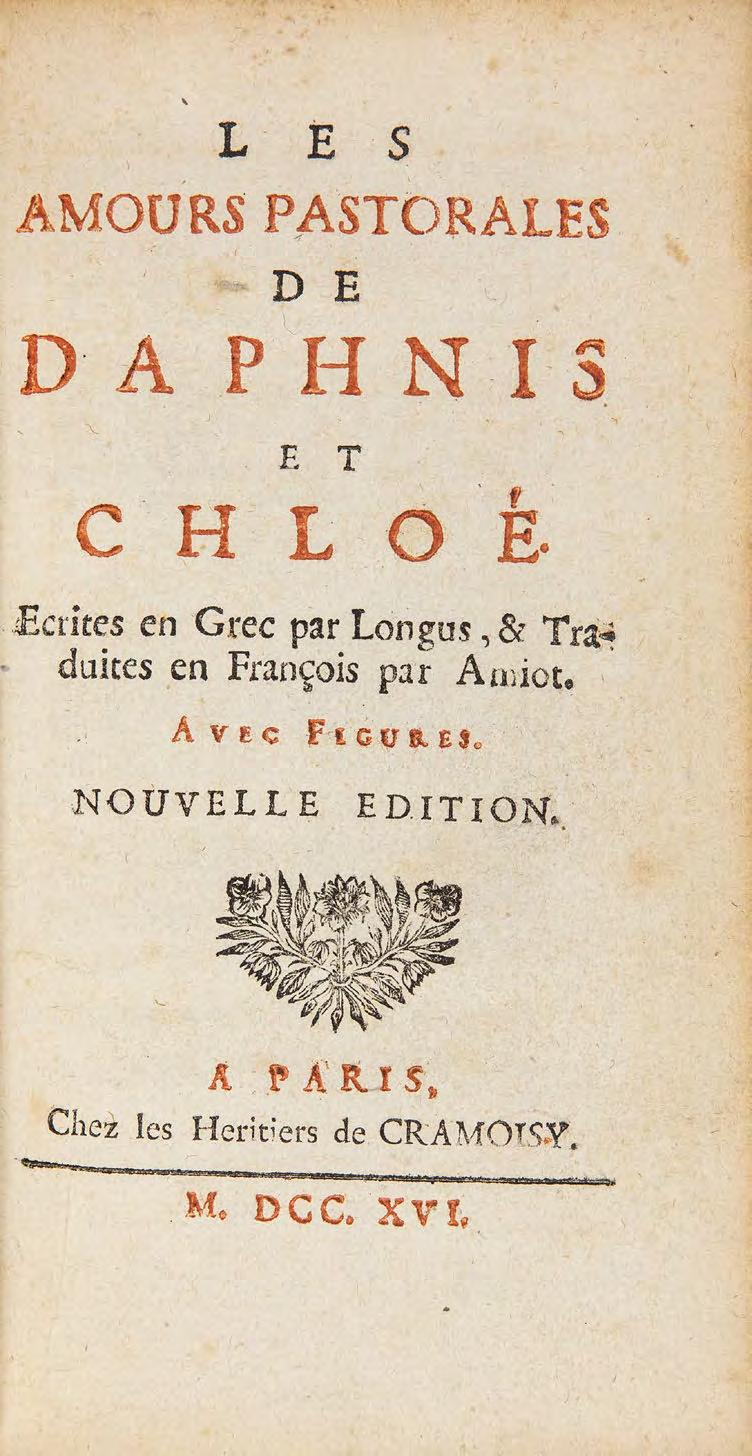
Anhang B
Der erste Amsterdamer Druck des 18. Jahrhunderts
LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Ecrites en Grec par Longus, & Traduites en François par Amiot. Avec figures. Nouvelle édition. „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ [d. i. Amsterdam, Emanuel Du Villard,] 1717.
Mit gestochenem Titel und acht Kupfertafeln (der Titel und sieben der Stiche im Gegensinn nach J.-B. Scotin, dazu ein weiterer Stich, nicht nach Scotin, aber in dessen Art ausgeführt, alle ohne Signaturen).
1 Bl., 220 S., 11 Bl. (Titel in Schwarz- und Rotdruck, Haupttext, Widmung „A Monsieur I.*. *.*.“, „Avis du libraire au lecteur“, „Préface“ und Händlerkatalog des E. Du Villard auf vier Blättern – die Vorstücke hier an das Ende gebunden).
Kollation: [ *1] A-I12 K2 *2–12 . Klein-Oktav (140 x 83 mm).
Hellbrauner Maroquineinband des späten 19. Jahrhunderts auf vier unechten Bünden zu fünf Kompartimenten mit hellgrün gesprenkeltem Rückenschild und horizontalen Fileten an den Bünden und den Kapitalen, Deckelfileten in Blind- und Goldprägung, Doublüren in dunkelgrünem Maroquin mit breiter Bordüre in Goldprägung im Stil des späten 18. Jahrhunderts sowie Marmorpapiervorsätzen.
Mit dieser Ausgabe beginnt die zweite große Linie der französischen Longus-Drucke des 18. Jahrhunderts – die Amsterdamer. Dieser Strang ist, wie sein Ursprung klar erweist, ein unmittelbarer Ableger der Pariser Produktion, dazu einer, der sich als sehr fruchtbar und zu eigenständiger Entwicklung fähig erweisen sollte. Zweifelsohne handelt es sich hier um einen nichtautorisierten
Nachdruck der ersten Pariser Ausgabe, deren Impressum einfach übernommen und mit neuer Jahreszahl versehen worden ist, dazu eine opulentere Titelvignette, die sich aber im Stil an jene des Hauses Cramoisy aus dem 17. Jahrhundert anlehnt. Schon daran wird die Kennerschaft dieses Verlegers deutlich, der weit mehr als ein gewöhnlicher Nachahmer oder Raubdrucker gewesen ist, zumal er sich durch seinen zum Druck gehörenden, nicht nur optional eingebundenen Händlerkatalog klar zu erkennen gibt: Emanuel Du Villard, Buchhändler in der Kalverstraat in Amsterdam. Die zur Illustration verwendete Stichfolge entspricht einschließlich des Kupfertitels jener der Pariser Erstausgabe, natürlich seitenverkehrt nachgestochen, allerdings unter Austausch einer Darstellung gegen eine andere: Bei Seite sieben kam die Auffindung des Daphnis hinzu, dafür wurde die Szene mit Philetas und dem Eroten im Obstgarten eliminiert, was wohl durch eine dem Publikum gefälligere Szenenauswahl motiviert war. Der Textspiegel des Vorbildes wurde zwar beibehalten, mit dementsprechend übereinstimmender Seitenkollation (die Lagenkollation weicht indessen ab), doch wurde der ganze Text dazu natürlich neu gesetzt. Es zeigt sich das Bemühen, das Vorbild an Klarheit und Sorgfalt, auch durch feinere Zierformen beim Buchschmuck, noch zu übertreffen. Besonders deutlich wird das zu Beginn der Widmung, wo eine schöne Holzschnitt-Vignette mit Früchtekorb am Kopf erscheint und größerer Platz in der Seitenmitte frei bleibt, der wohl für den doch nicht mehr erfolgten Eindruck eines Kupferstichs freigehalten worden ist.
Du Villard war alles andere als ein Winkeldrucker, der nur einen billigen Nachdruck produzieren wollte, sondern ein aufstrebender Verleger und Händler. Er reagierte offensichtlich darauf, daß Barbou den Erstdruck seinerseits in einer Titelauflage mit
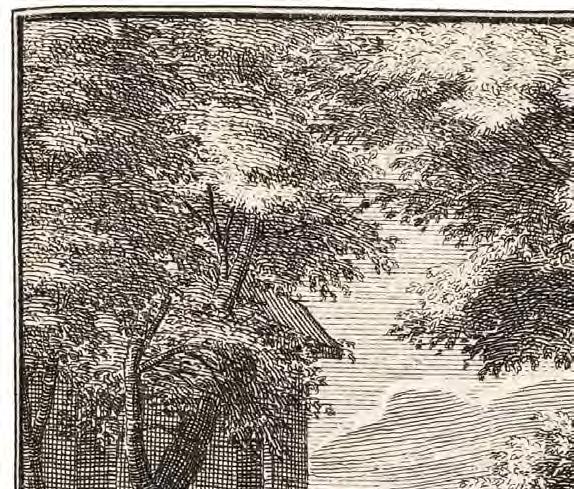


fi ngiertem Amsterdamer Impressum hatte erscheinen lassen. Die sorgfältige Herstellung und der Vertrieb des Drucks durch diesen ja nicht unbedeutenden Amsterdamer Verleger ist sicherlich ein wesentlicher Grund für die erhebliche und andauernde Beliebtheit des Longus-Romans, die durch seine Ausgabe in der Stadt ausgelöst worden ist.
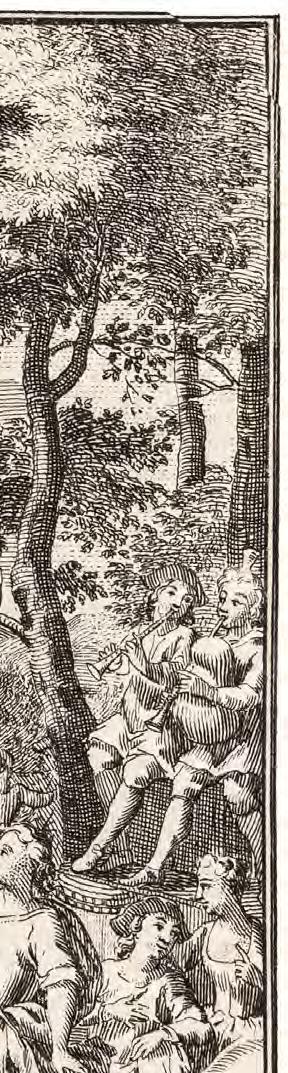
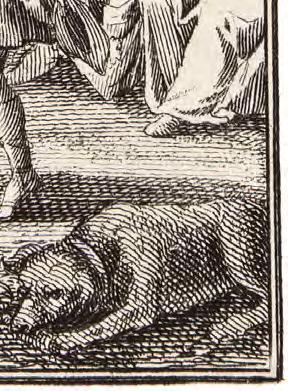
Schönes, sauberes Exemplar in einem durchaus anspruchsvollen Einband des Späthistorismus.
Bibliographische Referenzen: Péreire, Notes, S. 62 f. Marchand, Contribution, S. 42. Eeghen, Amsterdamse boekhandel, Bd. II , S. 233–38 (Nr. 119).
Anhang C
Die Ausgabe von 1745 mit Cochins Vignetten in der Klein-Oktav-Variante
[Longus]. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé [traduit du grec par J. Amyot et éd. par C. Falconet. Paris, wohl Coustelier,] 1745.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, datiert 1718, und 29 (davon 13 gefaltete doppelblattgroße) Kupfertafeln, die Suite des Regenten Philippe d’Orléans mit der „Conclusion du Roman“ genannten Kupfertafel von A.-C.-Ph. Comte de Caylus (ohne Signatur und Bezeichnung), alles in Nachstichen gegen 1745, gestochener Titelvignette, vier gestochenen unsignierten Kopfvignetten, vier großen Schlußvignetten von Ch.-N. Cochin d. J. und fünf Holzschnitt-Initialen.
5 Bl., 159, XX S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Avertissement“, „Préface“, Haupttext und „Notes sur les amours de Daphnis et Chloé“ von A. Lancelot).
Kollation: π 1 a4 A–L 8 M 2 . Klein-Oktav (153 x 94 mm).
Hellbrauner Kalbledereinband der Zeit auf glattem Rücken, die sechs Rückenkompartimente mit floral-ornamentaler Vergoldung, Deckel in dreifachem Filetenrahmen, Stehkantenfilete, Marmorpapiervorsätze, Ganzgoldschnitt.
Ein weiteres gutes und vollständiges Exemplar der Kleinoktav-Ausgabe von 1745, man vergleiche unsere Nummer XXV, in einem hübschen, nur gering beriebenen Einband in veau fauve.
Anhang D
Exemplar der Pour les curieuxAusgabe im originalen, unbeschnittenen Zustand und mit allen Tafeln
LONGUS. Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé. Double traduction du Grec en François, de Mr. Amiot et d’un Anonime, mises en paralelle, et ornées des Estampes originales du fameux B. Audran, gravées aux dépens du feu Duc d’Orléans, Régent de France, sur les tableaux inventés & peints de la main de ce grand Prince, avec un Frontispice de Coypel & autres Vignettes & Culs de lampe, gravée par D. Focke sur les dessins de Cochin & de Eysen. „A Paris. Imprimées pour les curieux“ [d. i. Amsterdam, Jean Néaulme,] 1757.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel, 28 (davon 13 querformatigen) Kupfertafeln nach dem Regenten Philippe d’Orléans sowie der Tafel mit den „Petits Pieds“ nach J.-B. Scotin, alle eingefaßt von Kupferstichbordüren von zweiter Platte (einige signiert von S. Fokke, wohl nach Ch. Eisen), acht gestochenen Kopfvignetten von S. Fokke nach Ch. Eisen (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), acht gestochenen Schlußvignetten von S. Fokke nach Ch.-N. Cochin d. J. (zwei Motive in zweifacher, eines in dreifacher und eines in einzelner Ausführung), gestochener Titelvignette und zehn historisierten Holzschnitt-Initialen.
VIII, 269 S. (Drucktitel in Schwarz und Rot, „Préface du dernier traducteur“, „Introduction de l’auteur“ und Haupttext, alle Seiten von typographischen Perlstabrahmen eingefaßt).
Kollation: *4, A-Z4, Aa-Kk4, Ll3 Klein-Quart (208 x 164 mm).
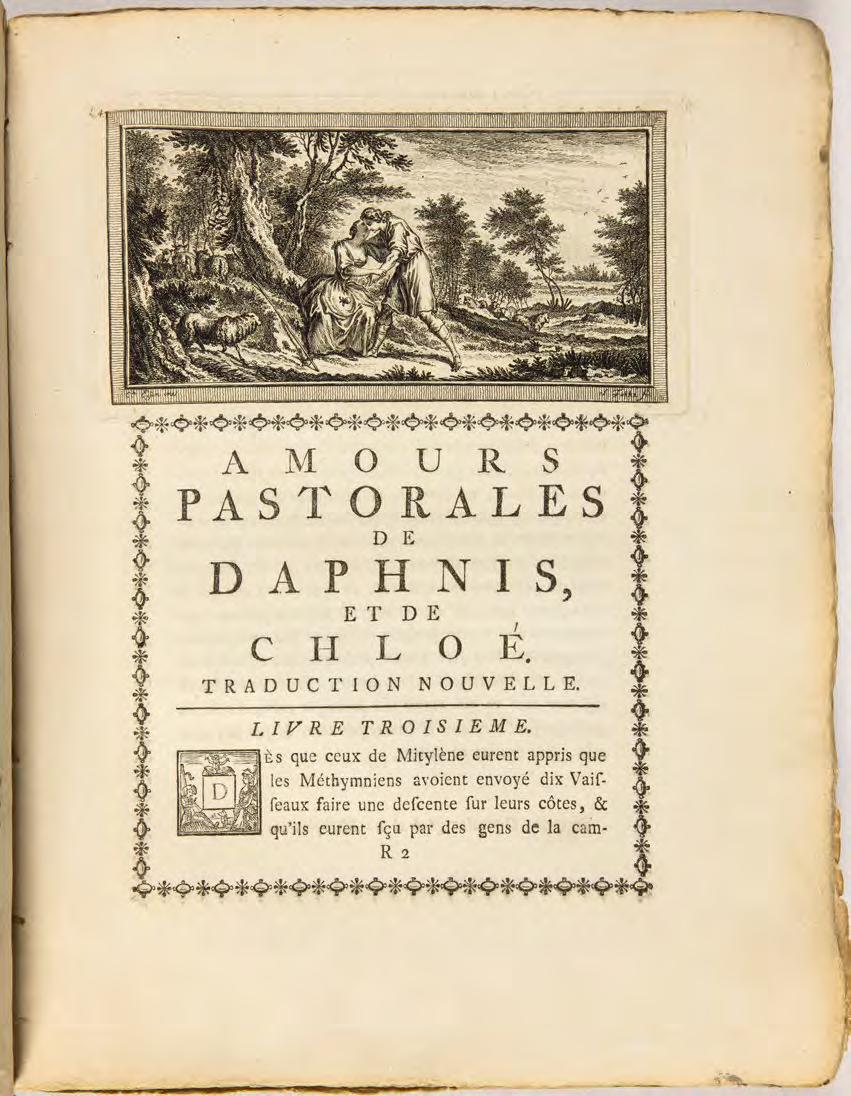
Schlichter Pappeinband der Zeit um 1800 mit Kiebitzmarmor-Papierbezug, der obere Rücken mit großem Etikett, darauf die Nennung von Autor, Titel, Ort und Jahr in sauberer Handschrift.
Zu unserer Reihe prächtiger Exemplare der Amsterdamer Pour les curieux-Ausgabe von 1757 gesellt sich hier eines, das zunächst ungebunden blieb, dann, in etwas späterer Zeit, einen Interimseinband erhalten hat, der nur solange zum Schutz gedacht war, bis das Exemplar eine wirklich gebührende Bindung erhält. Dies ist dann allerdings nicht mehr erfolgt, doch versetzt uns dieser Umstand in die äußerst seltene Lage, auch einmal ein unbeschnittenes Exemplar mit der vollen Papiergröße in Händen halten zu können. Die Höhe beträgt hier immerhin fast 21 Zentimeter, bei den
meisten Exemplaren verbleibt sie unter 20, und auch die Breite übertrifft diejenige beschnittener Exemplare um einen guten Zentimeter oder mehr. Diese unbeabsichtigte Großzügigkeit kommt der anschaulichen Wirkung der Darstellungen und des gerahmten Textspiegels sehr entgegen, und es wäre von großem Vorteil, diese auch ohne Verringerung zu erhalten, sollte sich doch noch ein Buchbinder dem Exemplar annehmen.
Unbeschnittenes Exemplar, auf sehr festem Bütten, die Kupfer in guten, sauberen Abdrucken, Textseiten leicht gebräunt und fleckig, das Frontispiz mit Eckabriß im unbedruckten Rand, der Einband etwas berieben und bestoßen, kleinere Bezugsschäden. – Zur Bibliographie siehe unsere Nummer XLII .
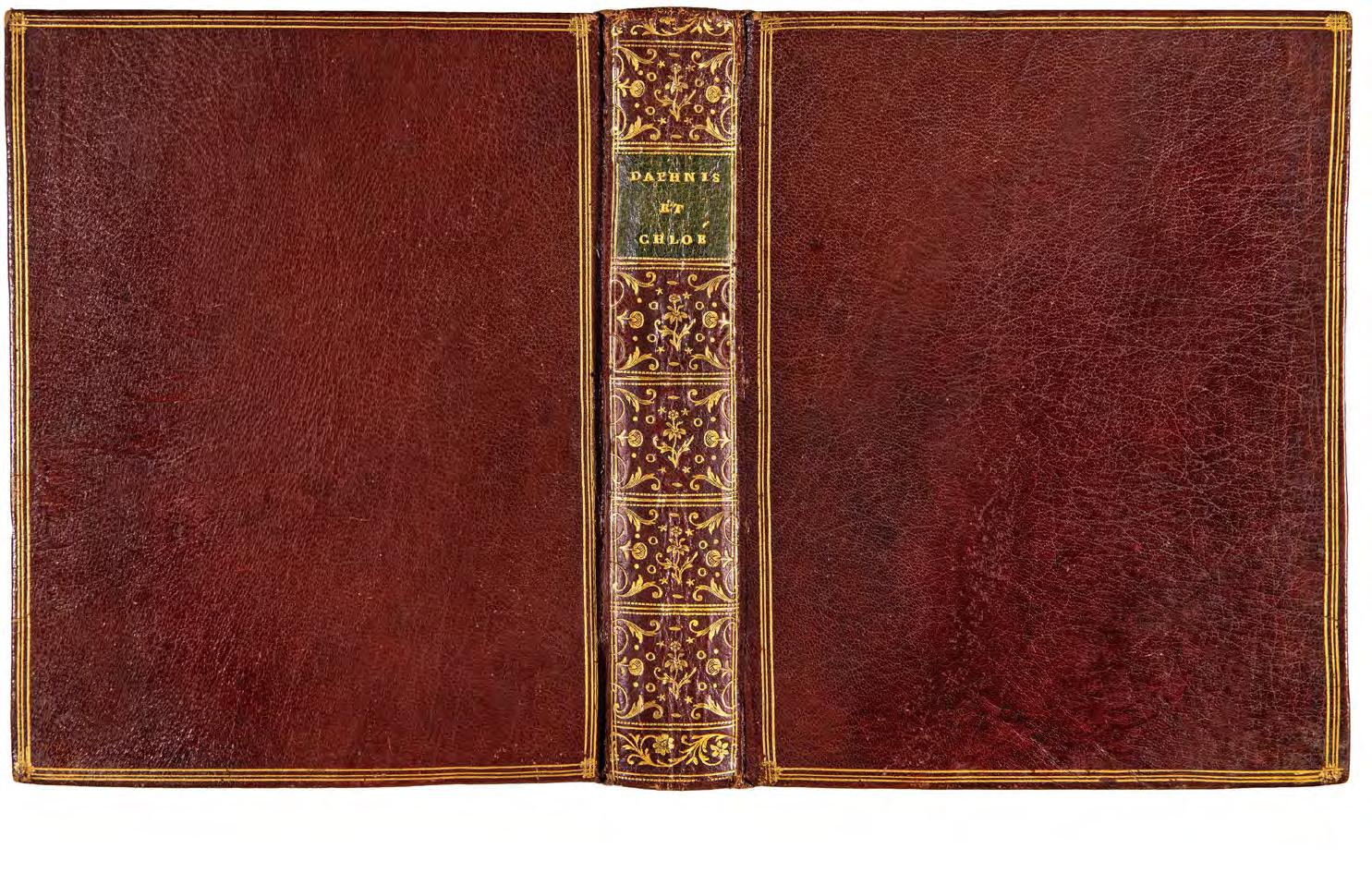
Anhang E
Ein weiteres Exemplar der Pour les curieux-Ausgabe, komplett, mit allen Tafeln, gebunden in veau fauve. – Ecken und Kanten stärker bestoßen, die Gelenke und Kapitale etwas lädiert, innen nur gering fleckig und wohlerhalten.
Anhang F
Nochmals die Pour les curieux-Ausgabe, nun aber in einem prächtigen roten Maroquineinband mit reicher floraler Rückenvergoldung dreifachen Dekkelfileten und Marmorpapiervorsätzen, sehr ähnlich unserem kolorierten Exemplar dieser Ausgabe die Nummer XLIII .
Anhang G
Die sehr seltene Ausgabe der Société Typographique de Bouillon von 1776 in einem reglierten
Exemplar
Longus. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, escrites en Grec par Longus, et translatées en François par Jacques Amyot. Bouillon, Imprimerie de la Société Typographique, 1776.?
Mit gestochenem Titel von G. Vidal nach A. Coy pel (ohne Jahreszahl) und 29 Kupfertafeln (davon 13 doppelblattgroße als Faltkupfer auf Stegen) nach der Regentensuite, einschließlich der Petits Pieds, alle in Nachstichen im Gegensinn von G. Vidal, sowie gestochener, nicht signierter Kopfvignette.
XII, 211 Seiten (Vortitel, Titel und „Avertisse ment“, „Préface“, Haupttext und „Avis au re lieur“ am Ende, S. 209–211, Text und Tafeln durchgehend in Rot regliert).
Kollation: π2 a4 A-Z4 Aa-Cc4 π 2 . Oktav (165 x 92 mm).
Bordeauxroter Maroquineinband der Zeit auf fünf sehr flachen unechten Doppelbünden zu sechs Kom partimenten, im zweiten von oben dunkelgrünes Ma roquin-Rückenschild mit goldgeprägtem Rückentitel, breiten Horizontalfileten an den Bünden und flächen deckendem Kettengliedmuster mit Pointillé in den Kompartimenten, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung und kleinen Blüten über den Überschneidungen; schraffierte Steh- und Innenkantenvergoldung, Marmorpapierbezug auf Deckeln und Vorsätzen, grünes Lesebändchen sowie Ganzgoldschnitt.
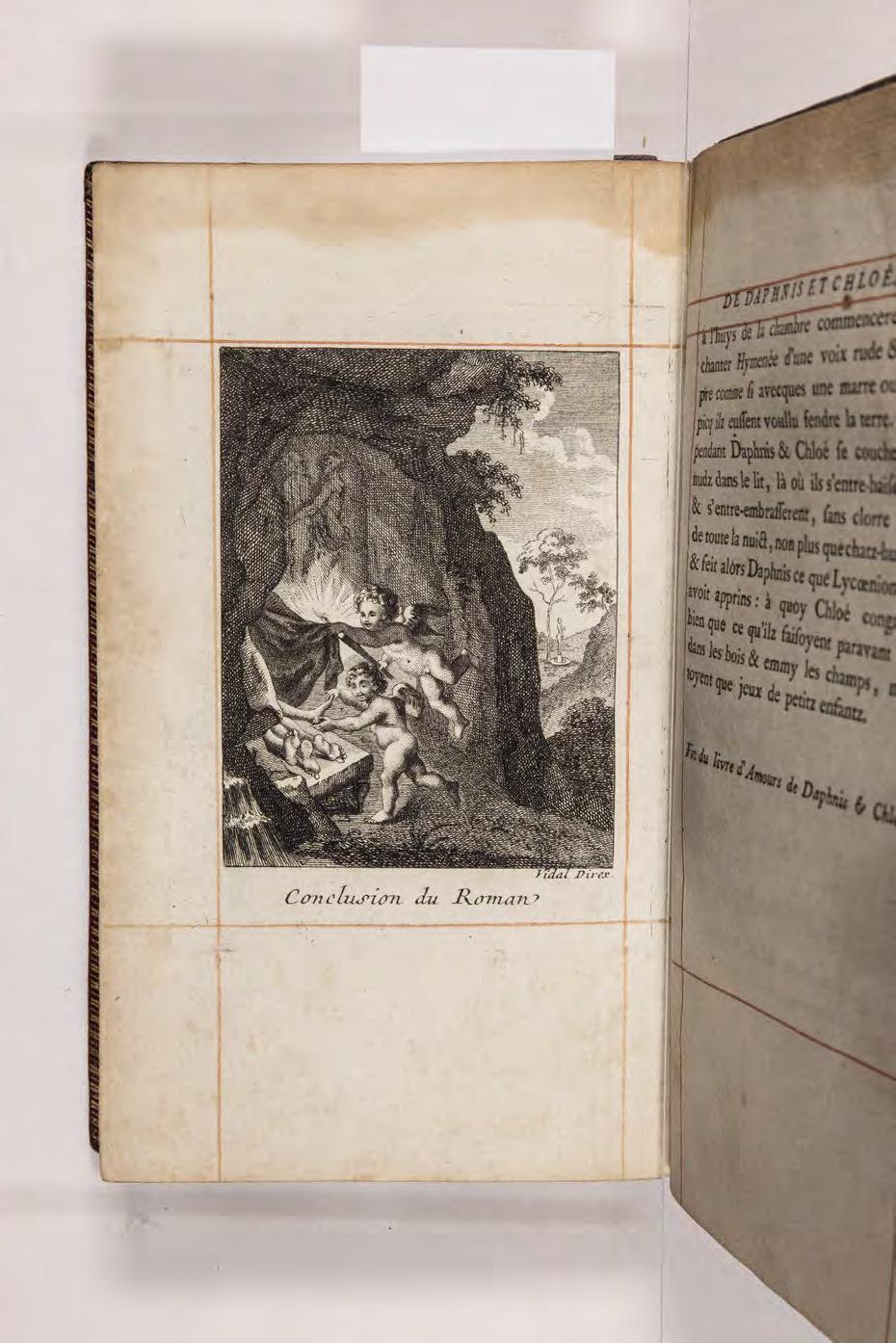
Wohl die früheste französische Longus-Ausgabe des 18. Jahrhunderts, die weder in Paris noch Amsterdam (oder Den Haag) erschienen ist, sondern in der Provinz, im französisch-belgischen Grenzgebiet, der bekannten Stadt an der Semoise, die zentrum. Das war in erster Linie dem Journali sten Pierre Rousseau (1716–1785) aus Toulouse zu verdanken; dieser hatte hier 1768 die Société Typographique de Bouillon gegründet, die allmählich in ganz Europa Bekanntheit erlangte und Schriften aus unterschiedlichen Gebieten, vornehmlich aber Politik, Wissenschaft und Philosophie, im Programm hatte. Darunter finden sich allerdings auch einzelne literarische Klassiker, wie der vorliegende. Dieser Longus wurde getreu der Regentenausgabe von 1718 gedruckt und illustriert, allerdings (fast) nur mittels Nachstichen von mäßi-
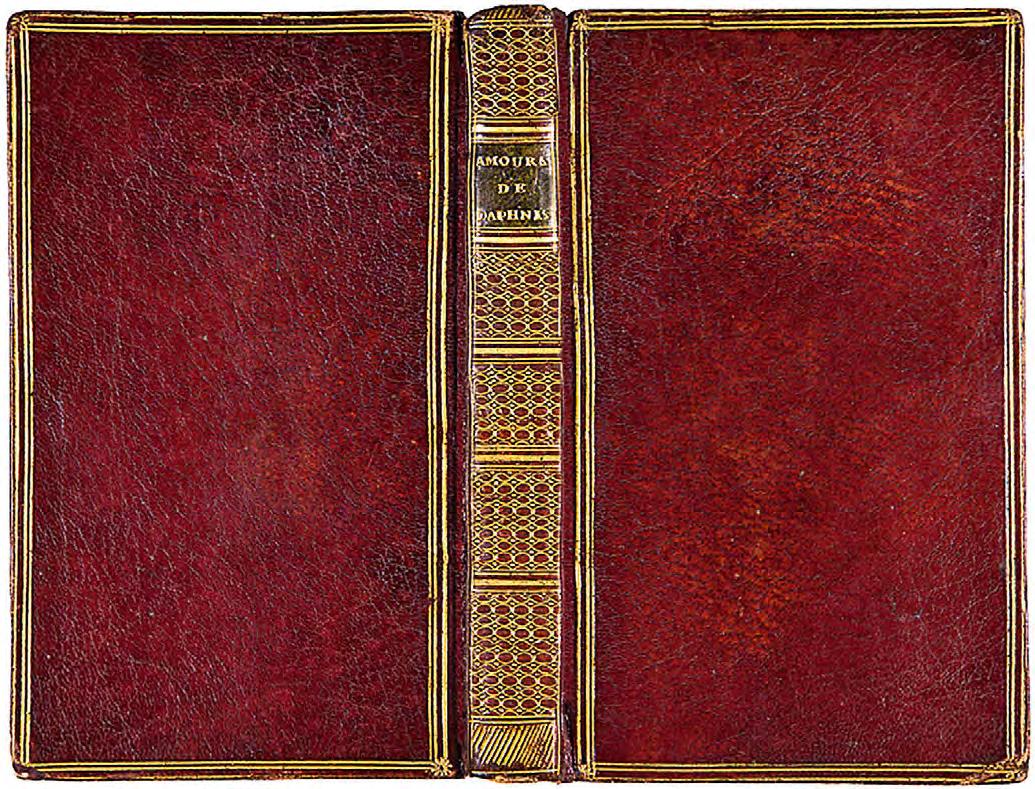
ger Qualität, die in einer Werkstatt für Reproduktionsstich unter Leitung des Géraud Vidal (1742–1801) entstanden sind. Eine Ausnahme macht nur die reizende Vignette am Textbeginn, die diejenige von Scotin in der Ausgabe von 1718 ersetzt, durchaus originell und sehr ansprechend, zeigt sie doch anhand eines Puttenpaares die gerade noch unschuldigen „jeux des petits enfants“ und ist somit das kindliche Gegenstück zu den Petits pieds des gereiften Paares am Ende.
Warum diese eigentlich dem Aufklärungsgedanken verpflichtete, auf philosophische und politische Literatur sowie enzyklopädisches Schrifttum spezialisierte Verlagsgesellschaft den Longus-Roman gedruckt hat, ist nicht bekannt. Daß es zwar eine gewisse inhaltliche Affinität der Aufklärung zu diesem Stoff geben könnte, haben wir in unserem Einführungstext dargelegt, eine andere Erklärungsmöglichkeit ist jedoch näherliegender und viel profaner, nämlich daß der Druck vornehmlich aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte, um mit den Einnahmen das eigentliche Kerngebiet zu finanzieren, dessen Verkäufe sicherlich nicht so lukrativ gewesen sind. Ein kollationsgleicher Nachdruck
dieser Ausgabe erschien übrigens noch 1792 in Lille beim Verleger Lehoucq, ebenfalls mit den Kupfern Vidals nach der Regentensuite illustriert (unsere Nummer LXV). Auch dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß man selbst eine mit Nachstichen illustrierte, nachgedruckte Regentenausgabe bis zum Ende des Jahrhunderts immer noch gewinnbringend vermarkten konnte, weil die Nachfrage offenbar erheblich war.
Ein regliertes Exemplar, in den breiten Rändern etwas fleckig und gebräunt, gegen Ende ein Blatt mit kleinem, alt restaurierten Randausriß. – Die Kupfer in recht kräftigen, sauberen Abdrucken.
Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur, S. 654. Reynaud, Notes supplémentaires, Sp. 318. Lewine, Illustrated books, S. 323. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1228. Catalogue des livres imprimés par la société typographique de Bouillon, Bouillon 1781. – Zu Pierre Rousseau und der Société typographique de Bouillon vgl. Sgard, Dictionnaire des journalistes, Bd. II , S. 879–882, zum Stecher Vidal siehe PortalisBeraldi, Les graveurs, Bd. III , S. 614–616.
Anhang H
Die einzige Ausgabe mit Druckort Versailles und die erste mit einer reduzierten Suite nach dem Regenten
Longus. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, escrites en Grec par Longus, & translatées en François par Jacques Amyot. [Orléans, RouzeauMontaut für] Sévère Dacier, „Libraire de Mrss. les Gardes-du-Corps du Roi“ in Versailles, 1784.
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel (ohne Jahreszahl) und sechs Kupfertafeln nach der Regentensuite, einschließlich der Petits Pieds, alle in nicht signierten seitenrichtigen Nachstichen.
2 Bl., 200 Seiten (Vortitel, Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π2 A-Q6 R 4 18° (127 x 74 mm).
Marmorierter Kalbledereinband der Zeit mit glattem Rücken, durch Kastenvergoldung in sechs Kompartimente unterteilt, im zweiten von oben dunkelgrünes Rückenschild mit goldgeprägtem Titel „Amours de Chloé“, am Fuß Rankenbordüre, Ränder mit Blattwerk, im Zentrum der Kompartimente kleine Rauten; Stehkantenfileten, dunkelblaue Vorsatzpapiere, grünes Lesebändchen, gesprenkelter Schnitt.
Eine höchst interessante, zugleich sehr seltene Taschenausgabe des Longus-Romans mit der großen Besonderheit der zumindest teilweisen Beibehaltung der Illustration des Regenten, die sich eigentlich, vor allem wegen ihrer querformatigen Stiche, nur schlecht für kleine Ausgaben adaptieren ließ, wollte man das unbeliebte Falten der Tafeln vermeiden. Die vorliegende Edition präsentiert eine neue Lösung für dieses Problem, die allerdings durch Reduktion und gewisse Einbußen erreicht
wird. Aufmerken lassen auch Drucker und Druckort. Daß der in der Rue du Vieux Versailles ansässige Händler und Verleger Sévère Dacier sich als Libraire de Messieurs les Gardes du Roi bezeichnet, heißt natürlich noch lange nicht, daß er diese, in Orléans von einem Drucker, der im Dienste von König und Bischof stand, produzierte Ausgabe speziell für Angehörige der königlichen Leibwache bestimmt habe. Vielmehr dürfen wir davon ausgehen, daß seine Käuferschaft bevorzugt aus dem Umfeld des königlichen Hofes in Versailles kam, und hier sind insbesondere Hofdamen als Lesepublikum anzunehmen. Eine solche könnte die erste Besitzerin unseres Exemplars gewesen sein; darauf gibt der Einband immerhin einen kleinen Hinweis: der Rückentitel nennt hier die Chloé, statt wie sonst üblich Daphnis.
Die Vermutung einer „Damenausgabe“ bestätigt sich auch inhaltlich: Bei der Konzeption dieser illustrierten Fassung, die erstmalig die Regentensuite in stark reduzierter Form enthält, hat man sich auf sechs durchgehend hochformatige und seitenrichtige Tafeln beschränkt. Das hatte zur Folge, daß vor allem in der Mitte des Werks zahlreiche Darstellungen der alten Suite entfallen sind; geblieben sind nur die Auffindungen des Daphnis (S. 10) und der Chloé (S. 12), der Raub der Kleider des badenden Daphnis durch Chloe (S. 32), die Winterszene (S. 108), das von der Lycaenion belauschte Paar (S. 120) und die Petits Pieds (hier wieder als Conclusion du roman bezeichnet, zu S. 200 – diese Tafel fehlt allerdings bezeichnenderweise in nicht wenigen Exemplaren). Auffällig ist allerdings, daß die Verkleinerung der Folge die etwas „anstößigen“ Tafeln gar nicht so sehr betroffen hat, abgesehen von der Verführung des Daphnis durch die Lycaenion, vielmehr aber jene, die die abenteuerlichen Erlebnisse schildern. Die „Romantik“ sollte also erhalten bleiben, während die „Spannung“
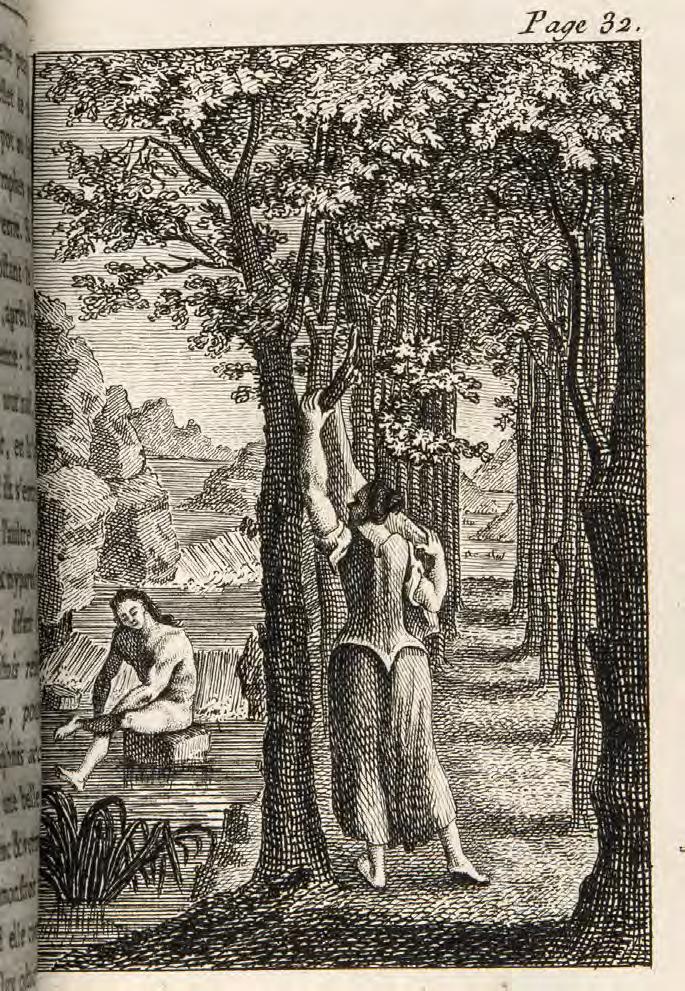
zurückgenommen worden ist – ein abermaliger kleiner Hinweis auf eine Damenausgabe, allerdings sind hier bereits solche Damen vorauszusetzen, die keinen Anstoß an gewisser Freizügigkeit nahmen. Die querformatigen Tafeln, darunter die Winters zene, wurden für diese Ausgabe nicht nur kopiert, sondern bei der Umsetzung ins Hochformat in ver änderte Kompositionen übergeführt, allerdings mit einigen Schwächen, in der Qualität die Stiche der Vidal-Werkstatt kaum übertreffend, manche eher noch darunter anzusetzen. Die seitenrichtige Re produktion könnte durchaus mittels abermaliger Orientierung an Kopien entstanden sein, die im Gegensinn vorlagen.

also jeweils wohl ohne die Petits Pieds, die allein Reynaud anführt).
Die letzte Ausgabe des 18. Jahrhunderts mit einem Amsterdamer Impressum, zugleich die zweite mit einer reduzierten Regentensuite
Longus. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, escrites en grec par Longus, & translatées en françois par Jacques Amyot. „A Amsterdam“, 1794?
Mit gestochenem Titel nach A. Coypel (seitenrichtig und ohne Jahreszahl) und sieben Kupfertafeln nach der Regentensuite, einschließlich der Petits Pieds, alle in nicht signierten Nachstichen im Gegensinn.
2 Bl., 200 Seiten (Vortitel, Titel, „Avertissement“, „Préface“ und Haupttext).
Kollation: π2 A-O6 Q8 R 2 18° (125 x 79 mm).
Dunkelgrüner geglätteter Kalbledereinband der Zeit mit glattem Rücken, durch Perlstabvergoldung in sechs Kompartimente unterteilt, im zweiten von oben rotes Rückenschild mit goldgeprägtem Titel „Amours de Daphnis“, im Zentrum jedes Kompartiments ein Sonnenrad-Motiv, am Fuß kleine Ranke, Deckel mit feiner floraler goldgeprägter Bordüre; Stehkantenfileten, schraffierte Steh- und Innenkantenvergoldung, Marmorpapierbezug auf Deckeln und fliegenden Vorsätzen, rotes Lesebändchen sowie Ganzgoldschnitt.
Obgleich sie sich zwar nur als neugesetzter, sonst aber kollationsgleicher Nachdruck der zehn Jahre zuvor erschienenen Versailler Edition zu erkennen gibt, überrascht die vorliegende, höchst seltene Ausgabe doch noch beim Vergleich der Illustrationen. Diese stimmen nämlich nur zum Teil mit dem früheren Druck überein. Bei genauerer Betrachtung erweist sich die spätere Folge als Variante mit bezeichnenden Unterschieden. So wurde das Frontispiz bei seitengleicher Ausrichtung nachgestochen, und die neue Ausgabe enthält sieben Tafeln, statt nur sechs, wie das bei der Versailler der Fall ist. Diese sind: Die Auffindung des Daphnis (S. 10) und der Chloé (S. 12), die Rettung des Daphnis aus dem Meer durch Chloes Flötenspiel (S. 41), die Entführung der Chloé durch die Methymnier (S. 74), die Winterszene (S. 108), die Verführung des Daphnis durch die Lycaenion (S. 122) und die Petits Pieds (als Conclusion du roman bezeichnet, zu S. 200). Unter den vier thematisch übereinstimmenden Tafeln sind wiederum anhand der Winterszene besonders schön die Unterschiede beider Fassungen ablesbar, setzt der Stich der Ausgabe von 1794 doch die Versailler Version voraus, die Tafel ist nach derjenigen aus der Versailler Ausgabe also seitenverkehrt reproduziert worden, jedoch mit viel Freiheit im Detail, die ihr ein eigenes Gepräge verleiht.
Einband und Vorsätze ein wenig berieben, innen nur gering fleckig, die Kupfer in guten Abzügen. Referenzen: Reynaud Sp. 319.
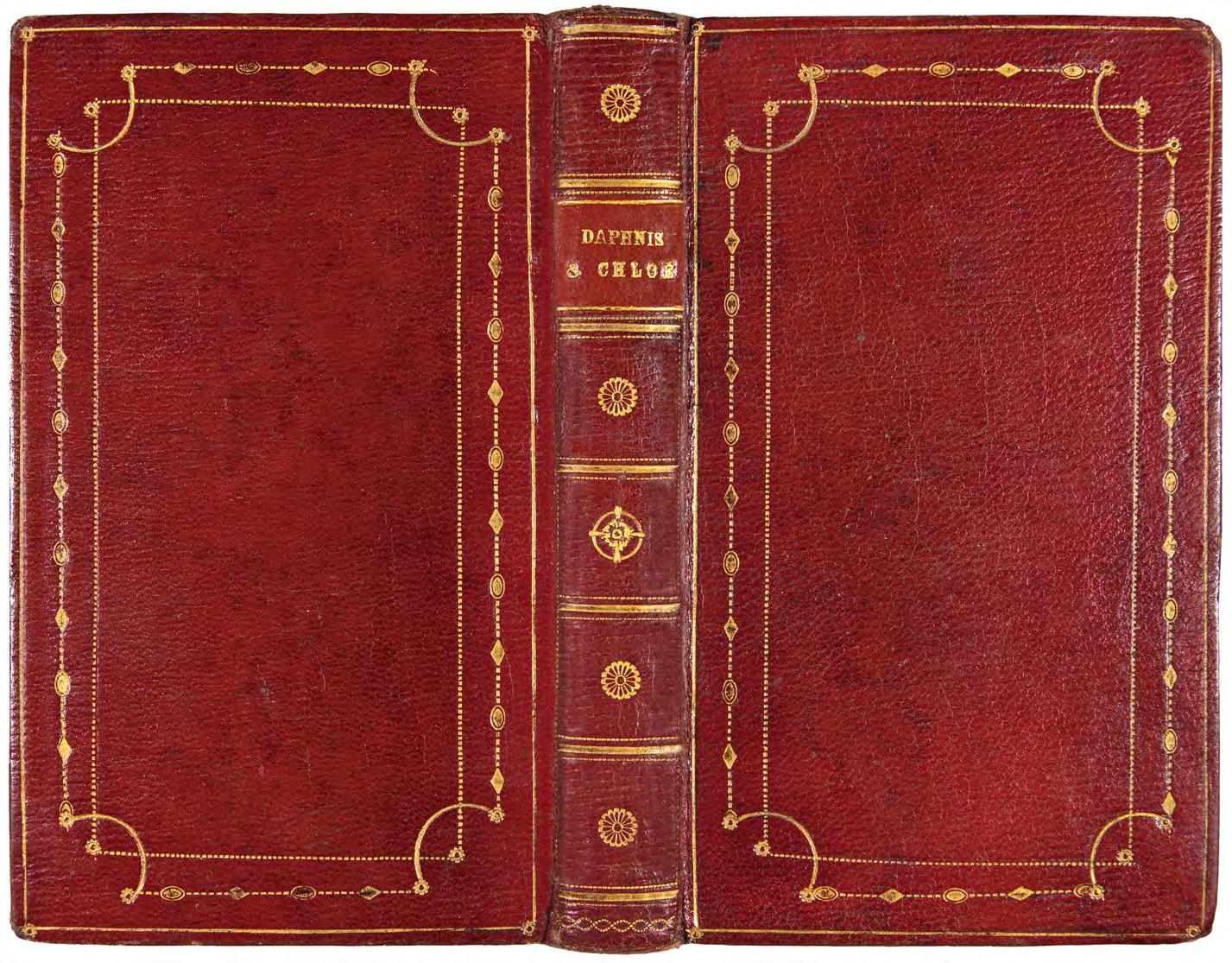
Der Patris-Druck des Jahres 1795 mit einem falschen Tafelsatz von Binet, in einem Einband im style Bozerian [LONGUS.] Les amours de Daphnis et Chloé. Nouvelle édition. Avec figures dessinées par Binet et gravées par Blanchard. Paris, Imprimerie de Patris [et Devaux], 1795.?
Mit gestochenem Frontispiz und fünf Kupfertafeln von J. A. Blanchard nach L. Binet (fälschlich jene zu La Fontaines „Les Amours de Psyché et de Cupidon“, erschienen bei Patris in Paris 1796).
2 Bl., VI, III, 176 S., 1 Bl. (Vortitel mit dem Reihentitel, Titel, „Préface du traducteur“, „Préface de Longus“, Haupttext und „Table“).
Kollation: π2 1–15 6 16 4 16° (132 x 80 mm).
Roter quernarbiger Maroquineinband der Zeit mit glattem Rücken, abgeteilt in sechs Kompartimente durch je eine breite, von zwei Pointillé-Bändern eingefaßte Filete, im zweiten von oben neues rotes Rückenschild mit goldgeprägtem Titel „Daphnis & Chloé“, im Zentrum der Kompartimente je ein Blütenstempel, der mittlere größer, von einem Ring
eingefaßt, am Fuß dünnes Flechtband in Pointillé, Deckel mit dreifacher Filetenrahmung, teils in Pointillé und als Perlstab, an den Ecken überschneidende Kreissegmente mit nach innen weisenden Bögen; Stehkantenvergoldung in Perlstab, Innenkanten mit Mäanderband, olivgrüne Tabisvorsätze, rotes Lesebändchen und gesprenkelter Schnitt, von oder im Stil des J.-C. Bozerian .
Dieses hübsche Exemplar der Patris-Ausgabe ist eine Kuriosität, weil sein Mangel – nämlich einen falschen Tafelsatz zu enthalten – auf eine wenig bekannte Tatsache hinweist: Diese Ausgabe ist als Teil einer kleinformatigen Reihe erschienen, die sogenannte Collection de Patris , wie Corroënne sie getauft hat, die nur einige Bändchen mit belletristischen Werken umfaßt; alle diese Ausgaben sind mit einer kleinen Suite von Tafeln illustriert, die Jacques Auguste Blanchard nach Louis Binet gestochen hat. Hier hat man offenbar, und das wahrscheinlich schon im Verlag, zwei Liebesgeschichten miteinander verwechselt, und so geriet die Folge zu La Fontaines Les amours de Psyché et de Cupidon in unser Exemplar. Immerhin hat man das recht breitrandige, ebarbierte Exemplar dennoch für wert befunden, mit einem hübschen Einband im klassizistischen Zeitstil versehen zu werden, der vielleicht sogar vom großen Bozerian selbst stammt, weist er doch mindestens drei seiner Stempel auf: Culot, Bozerian, Palettes 2 (Flechtband am Fuß), Fers seuls et combinés 3 (Rückenrosette) und Roulettes 20 (Innenkanten). Die Motivik des Deckels findet sich allerdings in ganz ähnlicher Form bei signierten Einbänden von Tessier und Zezzio (Schiff Collection, Bd. I, Nr. 88 und II , Nr. 160).
Der Text liegt in der Übersetzung Mulots vor, der Ausgabe Paris 1783 folgend. Der Verleger Patris hat sich zwar von der Taschenausgabe seines Kollegen Moutard dazu anregen lassen, den LongusRoman in dieser Version in seine kleinformatige Reihe zu übernehmen, doch ersetzte er die ohnehin etwas eigenwillige und uneinheitliche Illustration der Moutard-Ausgabe durch eine ganz neue, von allen bisherigen Bebilderungen unabhängige Folge. So entstand hier eine reizvoll illustrierte Taschenedition, die, ohne jede Abhängigkeit von der Regentenausgabe auskommend, zu einer eigenen Form gefunden hat. Sieht man von den noch viel weiterreichenden und ambitionierteren Illustrationsbestrebungen des Hauses Didot, die in dieser Zeit schon im Gange, aber noch nicht vollendet waren, einmal ab, kommt der Patris-Ausgabe immerhin das Verdienst zu, längst überfällige Neuerungen in die alte Bildertradition des Longus-Romans eingebracht zu haben.
Der Entwerfer der Tafeln, Louis Binet, hat die Darstellungen in der ihm eigenen Art gestaltet, sehr ausschmückend, teils ins Schwülstige gehend, doch immer sehr erzählerisch, dramatisch empfunden und von detaillierter Szenenschilderung. Der ganze Zyklus von Blanchard nach Binet findet sich in unserer kleinen Didot-Ausgabe des Jahres 1800 (Nummer LXIX) eingebunden.
Cohen/De Ricci Sp. 656. Reynaud Sp. 319 (erwähnt eine am Titel unterscheidbare Druckvariante). Boissais/Deleplanque, Le livre à gravures, S. 116. Lewine, Illustrated books, S. 324. Sander, Die illustrierten französischen Bücher, Nr. 1235. Portalis, Dessinateurs, Bd. I, S. 10. Corroënne, Manuel du Cazinophile, S. 36.
“The Pinnacle of Art, Intellect, and Taste”
From the Edition du Régent to the inkblot affair –a century of Daphnis and Chloe in the French illustrated book
The story of Daphnis and Chloe is one of the most famous and most popular texts of love literature from antiquity. In this catalogue we present you 80 exceptional copies, printed in France and the Netherlands between 1716 and 1803. Right from the outset, there were two illustration cycles that competed with one another: the cycle published in 1718 under the name of the regent of France, the Duc d’Orléans, runs like a thread through the editions. It was not until well into the second half of the century that this “Regent suite” was gradually replaced with works by some of the most important artists of the time, whose illustrations paved the way for the imagery of the 19th century.
The triad of the first prints from 1716 and 1717 originated in Paris as well as in Amsterdam. The one that was likely the first of these was published “À Paris, chez les Héritiers de Cramoisy”. The man behind the large old publishing house was Jean-Joseph Barbou, who had bought it in 1715. His printers was the House of Guérin, who also published the 1731 edition. The second edition of 1716, “À Amsterdam, Chez les Freres Westin”, contains a fictitious imprint, and was, like the first, printed in Paris (our numbers I and II). This was followed in 1717 by the third edition, this one actually published in Amsterdam, but curiously it contained the Paris imprint of the first edition again – here a Dutch publisher, Emanuel Du Villard, acted the other way round. While the first two editions were illustrated with the cycle
by Jean Baptiste Scotin, this third edition included inverted engravings without a signature. With the first Longus edition of the 18th century actually published in Amsterdam, Du Villard laid the foundation of a line that was to extend well into the second half of the century. The so-called “Amsterdam edition” leads from François Changuion, who published his own edition in 1734, to Evert Van Harrevelt, who not only printed the little-known 1749 edition but also prepared the series of great editions by Jean Néaulme from 1750–1764, through to the late edition published in 1794.
The famous Édition dite du Régent of 1718 (III –XIV) is more elegant, more refined, and more elaborate than its three predecessors. This edition was certainly created for the Duke Philipp of Orléans himself, and he was particularly involved in the illustration cycle that is named after him and bears the design date 1714. These illustrations were created by the regent together with his drawing teacher and artistic consultant, Antoine Coypel. The “Regent edition” might have been printed by Antoine-Urbain I. Coustelier, the duke's Libraire-imprimeur. Another possible printer is Quillau, as well as the Imprimerie Royale, which was mentioned by Isabella van Eeghen. According to various sources, the edition of 1718 was printed in only 250 copies, including those on better paper. Coypel's son, Charles-Antoine, inherited the printing plates from his father and published some good impressions of them in 1724 as a separate suite; this is of great rarity (XV and XVI).
The successor to the 1716–18 editions is the edition of 1731 (XX–XXIV), which was published without a location or printer, and was expanded for the first time with the critical appendix by Antoine
Lancelot. This edition favoured the Scotin suite, and there are two distinguishable print variants, with the entire text set in two different versions. They can be easily distinguished by the decorative fillets as well as the shape of the woodcut initials.
The year 1745 saw the publication of an edition, again without mention of location or printer, the publisher of which was probably the widow Coustelier. This edition closely follows one of the variants from 1731, but it contains unreversed engravings after the Regent's suite, supplemented with vignettes, including the masterful Culs-de-lampe by Charles-Nicolas Cochin d. J. (XXV–XXXVI). There is also a large paper in-quarto version of the 1745 edition, of which there are several variants, as can be seen in the numbers XXXI –XXXIII in this catalogue, as well as a transitional version, where the very rare prints were heightened and made unique through ruling and illumination (our nos. XXXVI and XXXVIa).
A descendant of that transitional version from 1745 was published À Amsterdam by Jean Néaulme in 1750 (XXXVII). This edition again contains the Scotin cycle from 1717, produced using transfer prints, as well as an attractive Rocaille frontispiece. But the full display of the great publisher’s book art ambitions would only be seen a few years later, in the two editions of 1754 and 1757, according to the imprint published in Paris, but actually published in Amsterdam (XXXVIII –XLIX). Néaulme had acquired the then fortyyear-old plates of the Regent Suite, and provided them with an elaborate Rococo framing, with the help of the greatest contributors: Charles Eisen, Charles-Nicolas Cochin the Younger and the engraver Simon Fokke from Amsterdam. The 1754 impression is a new Greek-Latin edition; the
1757 edition contrasts the Amyot version with a new translation by Antoine le Camus. Two partial editions can be distinguished from the 1754 print, one in small quarto, the other, extremely rare, on large paper. The edition from 1757 contains a remarkable variation: In order to bring a little variety into the double imprint of the head and end vignettes by Eisen and Coypel, the motifs were partly replaced.
The idea to furnish the old Regent cycle with contemporary frame borders was succeeded in the edition “À Londres 1779”, here with Louisseize ornamentation, in the greek manner (LII –LV). Two editions were published under this imprint, in quarto and octavo formats, the larger in variants. Since the original copper plates from 1718 were not available, Charles Jacques Groux created an inverted, considerably coarser copy of the Regent cycle. The publisher was Valade in Paris, known for his collaboration with Cazin. Only in the quarto edition are the plates from the Regent cycle framed by borders and all text pages framed by double-filletted borders.
Bibliophile editions in duodecimo or even smaller formats were only printed in the last third of the century. A nice example is the Faux Cazin from Lyon, 1777, published in three variants (LI), or the Paris sixtodecimo edition of 1783 (LVI), which also digresses from traditional suites in its iconography, or the Duodez edition of 1795, by Patris in Paris, with pretty plates after Louis Binet, or the Maradan sixtodecimo edition from 1798 (LXVII), illustrated in bourgeois contemporary style based on designs by Nicolas-André Monsiau, and the rare Duodez edition of 1800 by Didot in the newly developed stereotype process (LXIX).
The period from 1785 leading up to the augmented edition of 1810 was shaped by the great typographers Bodoni, Didot and Renouard as well as the cycles by Le Barbier, Prud'hon and Gérard, who set new standards in Longus illustration. Probably the most important impulse came from Italy in the form of the famous Greek edition by Bodoni in 1786 (LVII). The large publishing family of Didot responded to this typographic challenge by once again referring back to the Regent cycle for the edition printed in 1787. All 28 scenes from the original paintings were rendered in new etchings and even miniatures (LVIII –LXII and LXIV). Our collection documents this immense effort that includes luxurious copies on vellum, some even with enlarged original gouaches (LIX and LX), as well as the copy that contains the reproduction of the paintings, certified at St. Cloud, together with all original drawings by Martini (LXI) – and with that, the potential of the old Regent cycle was definitively exhausted. This great Longus edition was however by no means the last for the House of Didot: in 1800, Pierre Didot published his “Century Longus” (LXX– LXXVIII) in the most beautiful classical Antiqua font, and illustrated with the cycle created by Prud'hon and Gérard: monumental and timeless. An equally representative Greek edition followed two years later, with the same illustrations, one of the rarest Longus editions ever (LXXIV).
As we have seen, in the last decade of the century, funded by the House Didot, the art of Jean-Jacques François Le Barbier, Pierre Paul Prud’hon, and François Gérard thus became part of the illustrious history of Longus illustration – representing the highest quality book art of the time. The new edition from 1800 had probably already been planned at the beginning of the 1790s, and Le
Barbier provided some early drafts. Even though the project failed, the impressions, drawings and fragments that had already been produced, hint at what might have been a pinnacle in the history of book illustration – we present it in two copies that also include ten extraordinary original drawings (LXII and LXXVII). The project was probably abandoned due to differences between the publisher’s artistic ideals and Le Barbier’s approach to the task of illustration. It must have been around this time that Prud'hon began his first drafts. Although he provided excellent illustrations, which earned him recognition from all sides, the House of Didot only let him contribute three plates. The remaining six plates of this collaborative suite were designed by Gérard, a favorite of David, who later achieved great fame as a portraitist.
In 1800, Antoine-Augustin Renouard, who had a particular interest in Daphnis et Chloé, published an Italian edition with the 1537 translation by Annibale Caro. A particularly fine edition of the Amyot version in smaller format followed three years later. Renouard also appreciated Prud'hon’s abilities, which is why he had a second version of the bath scene made, this one smaller than the one for Didot, but of a stunning beauty. Our brief outline of the history of Longus editions closes with the discovery of the previously missing passages of Lykainion’s seduction scene, which Paul-Louis Courier discovered in the Laurentian Library in 1807 – a discovery surrounded by scandal however, because Courier, in the process of copying the text, ruined the original source with a blotch of ink. Courier's first complete edition appeared in Florence in 1810, where the editio princeps had been printed; he had the newly found text passage translated into old French in the style of Amyot. Renouard, who missed out on the print job, was
able to print the new passage as an insert titled »Fragment de Daphnis et Chloé, découvert dans un manuscript grec de Longus, dans la Bibliothèque Laurentinae, à Florence«, to be added to his edition from 1803, which can be seen in two copies in our collection (LXXIX and LXXX). Thus a great century of Longus editions comes to an end with the rediscovered, complete version of the story, which by this time had long become a fixed, highly revered part of the literary treasures of antiquity.
Summaries of the catalogue descriptions in English
I. The extremely rare „Amsterdam“ edition, a copy with a new title page of the first illustrated edition of Daphnis and Chloé in the 18th century, which was also printed in Paris in 1716. This copy is perhaps the most beautiful known, and was owned by one of the most important female bibliophiles, the Comtesse de Verrue, and later owned by André Langlois. The binding in olive green morocco, probably created by Luc-Antoine Boyet, bears the coat of arms of the Comtesse. The copy combines the two major illustration cycles: the print series of Jean-Baptiste Scotin and the so-called „Regent Cycle“ of the Paris 1718 edition. – This unique copy, which is elevated even further by its special provenance, is truly a bibliophilic treasure. – Slightly browned, otherwise flawless and with wide margins, the stunning binding in near-mint condition.
II Another copy of the rare 1716 impression, with a luxury dentelle binding and of notable provenance. What makes this especially remarkable is that Scotin’s illustration series is included twice: one is a fresh, high-contrast print from heavily revised plates, the other is printed from slightly older, more worn plates. The magnificent binding, created for the Trésorier général des Etats de Bretagne Jean-Baptiste-Simon Boyer, Sieur de La Boissière, is reminiscent of the work of Padeloup le jeune. The coat of arms on the cover is that of the Montguyot family in Champagne and was probably added a little later. Splendid bronze varnish endpapers, probably from Augsburg, and of the first half of the 18th century. – The printed title page is replaced by the engraved title; the binding slightly scuffed, some staining, otherwise well preserved.
III The first of our copies from the „Regent“ edition of 1718, containing the famous illustration cycle by Benoît Audran after the Regent of France, Philippe d’Orléans, along with the „Petits pieds“ by Count Caylus. The wine-red morocco binding from the mid-18th century has bucolic attributes in the style of the J.A. Derome on the spine. This excellent copy with very wide margins and exquisite impressions of the engravings comes from the collection of the great bibliophile Pierre Guy-Pellion, sold in Paris in 1882. – Cleanly restored tear in the white margin of leaf A8 and faint finger stains on the first few pages, otherwise a very beautiful copy.
IV The copy once owned by Lucien Tissot-Dupont, and like almost all of our copies of the „Regent“ edition from 1718, on larger and finer paper. The binding, in night green morocco and in the style of the two Deromes, probably comes from their successor Bradel. – Excellent condition and practically free of stains (lower white margin of leaf A1 professionally repaired with old paper, the first page cleaned).
V A gorgeous copy of the „Regent“ edition in a distinctive binding from the last quarter of the 18th century, also from the partial edition on better paper. The binding was made by either Derome le jeune or Bradel. From the Erotica collection of Karl Ludwig Leonhardt, previously owned by Bernard Breslauer. – Aside from a few foxing marks in the margins, a very decorative copy in perfect condition.
VI Excellent copy on large paper with high-contrast impressions of the copper plates. In a lined morocco binding, probably by Luc-Antoine Boyet; the outside cover is ornamentally restrained, while the interior’s beautiful doublures with attractive floral ornamentations are of sheer splend -
our. – Bookplate by bookseller Théophile Belin, sold in Paris in 1906. – Minimally stained in the margins, otherwise in perfect condition.
VII One of the truly stellar copies of the 1718 edition, praised by Cohen and De Ricci, in a magnificent Trautz-Bauzonnet binding around 1870, on uncut » papier fin «, from the collections of La Bédoyère and Leboeuf de Montgermont. Sold as one of the 52 unbound copies from the estate of the Chastre de Cangé de Billy in 1784, and luxuriously bound shortly thereafter in blue morocco by Bozerian. After La Bédoyère’s sale in 1862 that binding was nevertheless replaced by this splendidly finished chef-d’œuvre with gorgeously gilt doublures. By all accounts a superb bibliophile’s copy in pristine condition. – The copper engravings appear in fresh, high-contrast impressions from fresh plates.
VIII A copy of the 1718 edition, already unique due to its size: here is a copy on normal small paper missing the plates which was entirely remargined later, bringing it to this large quarto size. It was further provided with a set of exquisite illustrations printed from the original plates. – In a mid-18th century French calf leather binding with a sunflower stamp by Derome le jeune; it includes the supralibros coat of arms of the renowned Bignon family, who provided a number of the most important royal librarians, here Armand-Jérôme (1711–1772), as well as the same coat of arms in an older variant, that of his great-uncle Jérôme II . Bignon (1627–1697). – Slight scratches on the lids, the joints a bit brittle, the inside perfectly preserved.
IX The copy from the Robert Hoe library, afterwards owned by F. Lefrançois (Rahir’s successor), and later part of the Miribel and Flühmann collections. Its inlaid binding, created around 1890 by Marius Michel, represents one of the pin-
nacles of the art of bookbinding. A definitive, near unparalleled specimen, it is based on the model of Derome the Elder’s famous binding for the „Tutti i trionfi“ edition from the MacCarthy-Rothschild collections. – On large and better papier fin , with very wide margins, in almost uncut condition, near-spotless, with all copper engravings in fresh and vigorous prints.
X Almost uncut copy of the „Regent“ edition from 1718, bound by Alexis-Pierre Bradel (with his label), from the Caillard and Lignerolles collections. An excellent copy in a master binding characterized by its restrained elegance. Probably commissioned by the great bibliophile Antoine-Bernard Caillard of Bradel, it was bound sur brochure with masterly skill, while preserving almost the full sheet size. Sold in the auction of Count Lignerolles in 1894. – The spine is minimally faded, otherwise in excellent condition, the copper engravings are fresh, from unused plates.
XI An outstanding copy in a magnificent binding by the great Francisque Cuzin, made for the leading collector of 18th century livres à figures, Eugène Paillet. Sold to Robert Hoe, in whose 1911 auction it brought the price of an average manuscript book of hours; acquired there by Sir David Salomons. – Cuzin’s model were the inlaid bindings by Padeloup the younger, featuring décor à répétition , probably a copy from the original binding in the Rothschild collection, like lot IX .
XII An equivalent to our previous number, but now in a masterly binding in red-brownish morocco, from the beginning of the second half of the 18th century. The covers feature a very wide gold-embossed, individually stamped dentelle border with bucolic motifs, the doublures of cerulean blue watered silk, perhaps by Louis Fran -
çois Lemonnier. – The engravings are fresh, almost spotless and in perfect condition.
XIII Outstandingly beautiful copy from the series of bindings created by Nicolas-Denis Derome around 1784/85 for several of the 52 copies from the remaining stock of Chastre de Cangé de Billy, which were sold in 1784. These magnificent bindings, of which we were able to verify no less than 17, are among the most remarkable achievements of French bookbinding craft (see our census), and our copy is one of the finest and most beautifully elaborated. – From the estate of the auctioneer and collector Delbergue-Cormont, sold in 1883, acquired by Henri Bordes, and in 1897 by the legendary Madame Porgès-Wodianer. – In perfect condition.
XIV The second of the famous copies in our collection magnificently bound by Derome le jeune, this one in particularly sublime apple green morocco (vert pomme), which is unique in this group of works. By using individual stamps, Derome has given each copy its distinguishable characteristics. This copy, cited by Cohen / De Ricci, also had a number of illustrious previous owners: sold at the sale of the famous collector and bookseller JeanJacques de Bure in 1853, then at the Portalis auction in 1878, later with Georges Danyau, Robert Schuhmann and Robert von Hirsch, most recently Paul Louis Weiller.
XV The extremely rare separate edition of the „Regent“ suite, a new edition by Charles-Antoine Coypel, published in 1724 with its own engraved title using the original plates. The copperplate prints are on very strong laid paper in a larger quarto format, which meant the rectangular illustrations in landscape format no longer had to be folded. Our copy with 26 plates, without the two plates on pages 95 and 97 published in the 1718 edition, has the prints very strongly im-
pressed. They are exceptionally good, high-contrast, nuanced and vigorous, the copy almost free from stains. Modest half leather binding from the late 19th century.
XVI A second copy of the separate edition of the „Regent“ suite from 1724, complete with all 28 plates, the engraved title from 1718 and a new engraved one from 1724 in writing letters. The copy, bound in apple green vellum of the second half of the 18th century, comes from André Langlois' large collection of illustrated French books of the 18th century. All engravings with handmade serpentes dated 1770, on laid paper from the important Iohannot paper mill. First leaf minimally stained in the outer margin, otherwise an immaculate copy of this suite.
XVII The complete separate „Regent“ suite in small landscape quarto with all 28 plates. Probably a copy that predates the new edition by the younger Coypel. The platemarks are fainter than in the prints from 1724, and the quality of the prints fluctuates. A suite made likely before the new edition, which otherwise is not known to exist in this form, so this copy may be unique. – Some foxing throughout, especially on the first few plates.
XVIII A bibliographical sensation: perhaps the only copy printed by Coypel on »largest« paper with the separate „Regent“ suite in landscape folio size (265 x 350 mm!). No other copy of this kind has been found to date. The copper engravings here are so vigorous and clean as if the aim was to create a perfect model for all time. Dark blue morocco binding of the first half of the 20th century, signed „G. Cretté Succ. de Marius Michel“. – From the libraries of Paul Jamot and Daniel Zierer. – Immaculately preserved.
XIX The Delaleu-Pichon copy: a hitherto unknown state proof, of the highest provenance, and furthermore superbly bound. This unique copy, which is dated 1718, was used to prepare the edition of 1731, and therefore represents a missing link between the editions. The Notes of Antoine Lancelot are still missing here. Furnished with handdrawn text frames and red ruling, this is undoubtedly a sample print for the 1731 edition. Bound in midnight blue morocco around 1750/60, probably by Pierre-Antoine Laferté. – From the collection of the Parisian notary Guillaume Claude Delaleu (1775) and the great bibliophile Baron Jérome Pichon. – A few of the frames show some paper brittleness caused by an inkwell, and there’s occasional light foxing in the margin.
XX Splendidly bound copy of the 1731 edition, containing the 1718 suite, excellently preserved. The contemporary binding is reminiscent of the style of Padeloup the Younger, with rich dentelle borders on the covers, as well as endpapers made of bronze varnish paper by Joseph Friedrich Leopold from Augsburg, dated 1724. This copy contains the „Regent“ cycle, instead of the one by Scotin, but misses the last plate. The title page was deliberately replaced by the engraved frontispiece of the 1718 suite in order to predate the copy, which was common practice with early Longus editions.
XXI Madame de Pompadour’s copy, one of two known Longus editions in her possession, in perfect condition and near immaculate. The copperplates, in this case the suite by Scotin, are very good, high-contrast prints, far better than in the first edition of 1716, probably in a printing state that was sold separately before the book’s first edition. The well-preserved marbled calfskin binding in the style of Derome père, from around
1745/50, is of simple noblesse, and was bound for the marquise with her coat of arms.
XXII Completely remargined copy with the „Regent“ suite on quarto paper, also containing the two engraved titles of the suites by Coypel (1718) and Scotin (1716), as well as the petits-pieds illustration by Scotin. A „Regent“ suite printed on large paper is a rarissimum, which is why (as in the case of our copy VIII) no effort was spared to make the rest of the book match the quarto format of the plates. Bound around 1760/70 in olive green morocco and decorated with several beautiful individual stamps, comparable to a binding in the Mortimer L. Schiff collection, which bears the label of the bookbinder Bargeas from Bergerac.
XXIII An exceptionally beautiful, ruled copy of the 1731 edition in a magnificent dark red morocco binding with differently coloured onlays. The décor is undoubtedly indebted to the bookbinding workshop Atelier des petits classiques, which was operating between 1720 and 1740, but this binding was created by a master who was active in the second half of the century, who picked up on their particular style, but was himself a bookbinder of considerable artistic rank. The endpapers with bronze varnish paper are from the Augsburg workshop of Johann Wilhelm Meyer. The „Regent“ cycle from 1718 and its frontispiece are bound in. The impressions are clean and vigorous. – An excellent and almost spotless copy.
XXIV A peerless copy of the 1731 edition, which marks one of the bibliophilic highlights of this catalogue: one of probably only four copies printed on vellum (parchment), featuring the complete „Regent“ suite and ruled by hand throughout. The binding, both splendid and delicate, is in the style of Padeloup, Du Seuil or Boyet, with a rich dentelle border on both covers and doublu-
res in olive-green morocco with a different border. The sequence of this copy’s previous owners as cited by Cohen-de Ricci is of first rank, including the collections of Dent, Hanrott, Crozet, Baudelocque, De Lassize, Guntzberger, Portalis, Hoe, and Gougy.
XXV The octavo variant of the 1745 edition, with the re-engraved „Regent“ suite from 1718 and the four delightful final vignettes by CharlesNicolas Cochin, as well as Rococo sceneries that appear dreamlike and fleeting. The unnamed publisher of the edition was probably the house of Coustelier. – Good copy, almost free of stains, only very occasional very light water staining, in a pretty veau fauve binding of the time with a flat spine.
XXVI A very decorative copy of the 1745 octavo edition with a newly engraved illustration sequence after the Regent. The re-engraving of the title copperplate was bound in ahead of the new title page to evoke an earlier edition, but the end vignettes after Cochin unmistakably identify the edition. The copy includes the petits pieds in an inverted re-engraving by Géraud Vidal from around 1775. Pretty morocco binding of the time with dentelle gold tooling in a loose arrangement of individual stamps. The title page contains an owner's stamp with the entangled monogram » AWGR« and a count's crown: a member of the House of the Counts de Renesse. – Except for the copperplate title and a few small stains, this is a beautiful, clean copy with high-contrast prints of the engravings.
XXVII A wonderful copy of the octavo edition in an outstanding dentelle luxury binding with rather bold yet elegantly combined decorative shapes, created by one of the leading masters of the time, probably René-François Fétil or Louis Douceur. Even the copy’s eventful history could not deprive it of its beauty: until 1891 it was in the
possession of the writer and bibliophile Charles Cousin, then in the collection of Prince Tolstoy in Odessa – it even survived intact the seizure by the Soviet Rumcherod in early 1918, hence the small Russian stamps on the endpapers.
XXVIII Copy with the coat of arms of Louis XV – a gift to Madame Du Barry? Certainly one of the most beautifully bound copies of the small octavo edition of 1745, containing the supralibros of King Louis XV on the covers. Since there is no account of it in his library, it must have been intended as a gift. The designs on the gilt spine point towards Louis Redon, the bookbinder of the Comtesse du Barry, the king's favorite mistress. –Very wide margins, with slightest foxing, the front joint a little damaged, the lower headband with a restored tear. Apart from that, a wonderfully beautiful ensemble, which represents the refined, intimate side of French Rococo.
XXIX The most beautiful of all known copies of the octavo edition from 1745: a signed inlaid décor à répétition binding by Antoine-Michel Padeloup, bearing the second of his known labels. A late work by the master, in a somewhat rigid style, leavened however by the variety of colours: citron, dark red, and olive green. The title occurs in a very rare print variant. – Of high-ranking provenance: Charles Cousin, Baron Étienne van Zuylen van Nyevelt, Mortimer L. Schiff, and Daniel Sicklès; auctioned in the „Bibliothèque d’un amateur“ auction in Paris in 1959, then owned by banker Alain de Rothschild. – The endpapers are lightly glue-shaded, some light foxing, otherwise clean, with copperplates in vigorous prints.
XXX The first of our copies of the 1745 edition in the luxurious quarto size, which constitutes its own print variant. Crucially this meant that the plates with the larger illustrations could now be
included without being folded, and that the text is framed by extremely wide margins. The very wellpreserved burgundy morocco binding with decorative gold tooling on the spine (pomegranates) is in the style of Derome the younger. – Scattered light foxing, overall a highly representative specimen in excellent condition.
XXXI This is the copy of the great Dutch banker-bibliophile Paul May, with a particularly decorative floral border on the covers of the red morocco binding, perhaps created by the gifted bookbinder Laferté. Another one of those rare and highly esteemed copies of the 1745 edition on large paper, a print variant which differs from the one in octavo format only in the number of sheets. One previous owner was Lord Thomas BarrettLennard Dacre. – The front joint and the lower edges are minimally rubbed; the margins on some pages slightly foxed.
XXXII The copy once owned by Count Heinrich von Calenberg, treasurer of the Emperor and chamberlain of the elector of Saxony, in a very elegant green morocco binding featuring his coat of arms on the covers. The spine showing the „caged bird“ tool, with the bird looking to the left, leads us to attribute the binding to Derome le jeune. One of the very few copies on large paper, which, as is the case here, are ruled by hand with fine red lines. This version forms an intermediate stage to the two quarto print variants, which are documented in our copies nos. XXX (final version) and XXXI (first variant). – Lucien Gougy is documented as a later owner. – In perfect condition.
XXXIII This luxury binding in that rarest of all morocco colours, the very dark „night blue“, is –like the binding of no. XXXI – certainly a work by Pierre-Antoine Laferté. Both copies belong to the very rare first quarto print variant of the 1745 edition.
It contains the ex-libris of Pierrepont Cromp E. A.P. of Newnham, Gloucestershire. – Spine minimally faded, otherwise an excellently preserved, wide-margined and overall clean copy on laid paper.
XXXIV One of the most exquisite bindings of this entire collection, created using the finest materials and a marvellous display of exceptional bookbinding skill and originality: ivory-coloured kid leather, with rich ornamental and figurative gold tooling, painted with bright colours to evoke morocco onlays: quite simply a highpoint of 18th century French book art. This is probably the publisher’s sample copy of the first print variant. The lack of the petits pieds indicates that they weren’t originally intended to be part of the edition. – Superb provenance: from Armand Ripault to Cortland F. Bishop to Cornelius J. Hauck.
XXXV A second copy in ivory-coloured kid leather (all in all there are only four copies known), also gilt and painted, partly with similar subjects as our no. XXXIV, but of a different character, somewhat lighter and more extensively ornamented, elegant and playful. Bound in is one of the very rare copies of the transitional variant edition, ruled and with the title vignette repeated at the end. In excellent condition, with a tiny but wellrestored blemish on the front cover, slight foxing in the wide margins, the copperplates printed in deep black. From the estate of Léon Gruel, the bookbinder, sold in 1935, then in the collection of Maurice Burrus, the famous bibliophile from Alsace.
XXXVI The last and utmost highlight of our copies of the 1745 edition: Bound by Louis Douceur (tooling and finishing by Plumet?) in red morocco leather, using individual stamps with bucolic motifs, including resting and walking sheep, as well as a shepherd's staff. The copy features con-
temporary, finely graded and nuanced wash colouring of all the plates; additionally, each text page and plate is framed by a stencilled border. – In very nice condition; the interior has a few slightly finger-stained or dusty spots. As in all copies of this rare print variant, Cochins culs-de-lampe are missing, but instead stencilled flower vases have been painted in. – Collection of Alexis de Redé. XXXVIa: second copy in dark blue morocco.
XXXVII A copy of the „Amsterdam 1750“ edition, which is a rarissimum among the Longus editions of the 18th century. This one was arguably made for the Amsterdam publisher Jean Néaulme. Here the Scotin suite was apparently reproduced by way of a transfer print of the first 1717 Amsterdam edition, which was itself laterally reversed. New additions include a lovely engraved title with a Rocaille frame and several mounted vignettes, some of which were taken from previous editions. –From the library of Duke Wilhelm of Bavaria, Tegernsee Abbey.
XXXVIII An excellent copy of prestigious provenance of one of the main works of mid-18th century French book illustration. The famous as well as rare bilingual Greek-Latin edition In gratiam curiosorum , Amsterdam 1754, was created with the support of the great illustrators Eisen, Cochin and Fokke, and was printed with the old original plates from the „Regent“ cycle of 1718, as well as a new version of the petits pieds, probably by Eisen after Scotin’s model. Bound in a suitably noble contemporary olive green morocco binding, the copy was owned by Philippe-Louis Bordes de Fortage, a well-known private scholar and bibliophile from Bordeaux. – The binding shows slight abrasion marks on the raised bands and edges; the body of the book mostly very clean, the engravings in beautiful, vigorous prints.
XXXIX Outstanding copy of the bilingual, brilliantly illustrated edition from 1754, bound around 1770 by Nicolas-Denis Derome, in elegant emerald green morocco, with the gilt spine showing a tendril with a burst open pomegranate used by Derome. The corners are slightly scuffed, the interior is stain-free and well preserved, the binding shows almost no fading. – Excellent specimen, without known provenance.
XL The only copy we’ve been able to verify that does not contain the engraved borders surrounding the plates, presumably custom-made on behalf of the first owner, the Count Chartraire, or a test print for the publisher Néaulme. Bound beautifully in a contemporary burgundy morocco binding, perhaps a work by René-François Fétil, a bookbinder and dealer active in Paris and probably an assistant of Antoine-Michel Padeloup. – The binding has a stain on the front cover and slight scratching on the edges, the paper is slightly browned, but almost free of stains, the copperprints are most vigorous.
XLI Almost unknown print variant of the Amsterdam edition from 1754 on largest paper, and probably the only copy surviving thus. Additionally, it has been adorned with a breathtaking binding of the highest artistic level by Louis Douceur, who was the King’s bookbinder, but the tooling may be, as in n° XXXVI , by Plumet. This is one of four copies from various editions on which Douceur (and/or Plumet) used individual stamps that were specifically cut for the Longus novel, while the particularly delightful image of a bagpipe can only be found on this copy. – Printed on strong, bright white paper of the best quality, with wide margins, this copy is in excellent condition; obviously it was owned and commissioned by a per-
son of the highest rank. By all odds, the finest copy of this edition.
XLII The Amsterdam edition pour les curieux of 1757 in two juxtaposed French translations: the classic one by Jacques Amyot, as well as a modernized one by the medical doctor and writer Antoine le Camus. It contains all the features of the 1754 edition, but the head engravings by Charles Eisen have been arranged in a slightly different way. –Handsomely bound specimen with beautifully gilt spine, minimally rubbed in a few places, slightly foxed and finger stained inside. The plate before page 157 is missing.
XLIII One of the very rare specimens with magnificent illustrations in contemporary colouring; we only know of one other coloured copy of this edition, number XLVI in this catalogue. – The title is mounted, the rest of the impressions on beautiful, very strong paper, in some places slightly finger-stained. In a lovely red contemporary morocco binding with a flat spine featuring floral gold tooling.
XLIV Very beautiful, almost immaculately preserved copy in a masterfully crafted binding with gorgeous dentelle tooling: an excellent work by either Nicolas-Denis Derome or from his circle, as indicated by the stamp motifs. – Good prints of the copperplates on beautiful, strong paper free from stains.
XLV A lavishly bound copy in apple green morocco, made for the Comte de Mirabeau, who paved the way for the French Revolution and was a great bibliophile. Also of otherwise exquisite provenance, such as the collections of the botanist James Shuter, the Eaton banking family from Thrapston in Northamptonshire, as well as the famous libraries of Armand Ripault and Cortlandt F. Bi-
shop, and most recently Paul-Louis Weiller. The precious binding shows the Mirabeau coat of arms on the covers; slight rubbing, the margins of the first pages are slightly browned.
XLVI An illuminated copy from the collections Cortlandt F. Bishop and Robert Hoe and a bibliophilic one-of-a-kind: all plates are in duplicate, one in illuminated state and framed with Eisen’s borders, followed by an uncoloured and unframed version; the frontispiece is even present in three versions, with one unique variant otherwise unknown to us. Bound in marbled calf leather around 1780/90 with flat dark red morocco spine, this is probably a reworking of an older binding, and bears the label of the Amsterdam bookbinder J. Dahmen. Most likely this book is a publisher's copy in which different illustration options are juxtaposed like prototypes. – The joints show signs of old restoration and are somewhat fragile; the plates and text pages here and there stained in the margins, the colouring is the brightest and finest one can imagine.
XLVII One of the very rare copies of the 1757 edition on large, particularly fine, strong paper, a custom-made print variant, in which all pages of the main text are framed not just by a single, but a double bead and reel border. As early as 1763 the catalogue of the publisher Néaulme marked the edition ouvrage devenu rare . Copies of this large paper edition were expensive treasures for a select book loving audience. Bound in a beautiful, masterfully crafted contemporary red morocco binding with strong gold tooling on the spine. The coat of arms added later on refers to the important library of the Pair de France, Guillaume Pavée de Vendeuvre (1779–1870). – The binding slightly rubbed at edges, the copper engravings all in ex-
cellent, very vivid and sharp impressions, the interior fresh and clean.
XLVIII This excellent copy from the library of André Langlois is in an almost untouched condition, and one of the extremely rare copies on large paper from the partial edition of the 1757 printing, which stands out from the smaller normal edition in part due to the double bead and reel borders around the main text. This is an exceptionally large copy, the lower white margin measuring a full seven centimetres, the outer one almost six. The contemporary binding is in brick-red morocco with a richly gilt spine, impressive by its luminous and rather bright red colour, while still featuring the morocco’s beautiful grain pattern. – Flawless preservation inside and out.
XLIX The large print variant of the 1757 edition, a splendid copy with a magnificent binding and a remarkable chain of provenance: after being owned by Madame Adélaïde Suzanne de la Borde, wife of the Fermier général and author of the »Choix des chansons«, the copy came to England into the family Baillie of Dunain, before it was sold at the 1883 Delbergue-Cormont auction in Paris and at the Vicomte de Janzé auction in 1909; afterwards it was in the famous library of the banker Henri Bonnasse. – Bound in contemporary olive green morocco, the corners and edges with some slight rubbing, the interior is minimally stained, the impressions are very good, clear and sharp.
L One of the extraordinarily rare copies of the 1764 edition with the plates of Jean-Baptiste Scotin’s suite engraved in reverse, which refers to the 1717 Amsterdam edition by Emanuel Du Villard. Text and composition, however, can be traced back to the 1745 Paris edition. The 1764 edition is one of the last verifiable prints of the Longus novel that uses the Scotin cycle as illustrations.
Bound in a contemporary marbled calfskin binding with a flat spine, the joints are a little rubbed, some occasional slight staining on the inside, otherwise well preserved.
LI Little-known duodecimo edition from Lyons, pocket-sized, which was previously thought to be published by Cazin. The actual publisher is still unknown. A lovely, decoratively bound specimen in contemporary red morocco with a flat spine, containing a frontispiece based on Scotin's version of the petits pieds, but a unique and quite frivolous variant, where the couple's heads are visible. The title with the stamp »Colloredo« possibly refers to the Imperial Prince Rudolph Joseph Colloredo (1705–1788), who established the so-called »Younger Library« at Opocno Castle.
LII Pretty copy with significant provenance of the edition that appeared in 1779 under the fictitious imprint À Londres, here the rare smaller version. In reality, this is an edition by the Parisian publisher Valade, who produced editions in octavo as well as in quarto size. The very decorative contemporary night green morocco binding, perhaps by Pierre-Paul Dubuisson, showing the stately coat of arms of the Comtesse de Savoie (1753–1810), wife of the Count Louis Stanislas Xavier de Provence and later King Louis XVIII of France. –Printed on delicate bluish paper, almost free of stains, the binding with a small chipped area at the lower edge.
LIII Very decorative and well-preserved copy of the quarto edition À Londres 1779, which marks a turning point in 18th century French Longus illustration, with its frames in the style of Goût grec, the predominant taste of the Louis XVI epoch, which were printed from in-house plates. The decorative spine of the warm honey-yellow coloured binding features a sturdy pomegranate, akin to
the one used by Nicolas-Denis Derome. – Slightly rubbed and stained, but well preserved, only slightly browned and stained inside.
LIV
Another copy of this special edition in quarto, with the frame borders in the style of Louis XVI . The contemporary burgundy morocco cover with beautiful gold tooling on the spine and triple fillets, similar to the previous copy. Both were part of the earliest print variant that includes the sentence On en rendra compte dans les Notes, which was accidentally left in at the end of the Avertissement (although the notes were no longer printed here). – Apart from a small worm track through to the beginning of quire D and some slight staining in the margins, a very nice specimen.
LV One of the very rare, coloured copies of the fourth edition from 1779, with the plates and borders in exceptionally beautiful colouring in highcontrast, vibrant colours, the overall impression is that of an extraordinarily saturated colour tone evoking the effect of paintings, perhaps reminiscent of the original St. Cloud cycle. – The leaf with the quire signature P1 and the plate before page 113 were both removed, the text was replaced in contemporary manuscript. – Slightly stained in places.
LVI The rare Parisian 16mo edition from 1783, a unique copy. Anonymously published by the Paris publisher Moutard, formerly attributed to Cazin, this edition was illustrated in a completely new and idiosyncratic way, with a new translation by François-Valentin Mulot. A few special copies like the present one were printed on large octavo Holland paper, and additionally include the „Regent“ suite with all the copperplates printed from the original 1718 plates. Very wide-margined, in a prestigious calfskin binding with a Count's coat
of arms, all the plates and vignettes in very good quality impressions; this edition cited by Reynaud.
LVII The famous Bodoni edition in the original language, printed 1786 in Parma with the classical Greek type, a particularly beautiful copy elegantly bound by the London bookbinder Henry Walther († 1824) on behalf of the great English bibliophile Michael Woodhull (1740–1816: see Severne Sale 1886, n° 1585). – Our copy has extremely wide margins, in places still preserving the uncut edges of the laid paper (ébarbé), and almost free of stains.
LVIII Of the Didot-Lamy edition, Paris 1787, this one is a very richly truffled copy with a wellknown provenance. Peerless in its abundance of images, an excellently bound copy that contains the whole range of the entire Longus illustration from the 18th to the early 19th century: the older tradition of illustration with the „Regent“ cycle in the version by Pierre-Antoine Martini, coloured with wash and printed on vellum , plus the most significant illustrations of the newer versions. Among the additions are even original drawings, dating back to Antoine Coypel, with a fine self-portrait. So much additional material was added to this copy that it almost has an museum-like character, including plates after François Gérard, Pierre Paul Prud'hon, Le Barbier, Alexandre-Joseph Desenne and Louis Hersent, many of the etchings also in several states, a total of 53 graphic leaves, with three drawings, as well as an additional Martini suite. Inserted in an immaculately preserved morocco binding in the style of Grolier by CharlesFrançois Capé, with a delightful porcelain painting on the front cover after a model by Louis Hersent from around 1820. – This copy, cited by Cohen, was owned by Emmanuel Martin, Alfred Massicot, Edouard Rahir, and most recently Sir David Lionel Salomons. – The text pages as well as the
Martini plates in perfect condition, the plates after Le Barbier and partly also the ones after Prud’hon and Gérard somewhat foxed.
LIX This is the first of only two known vellum copies containing a unique original wash suite based on the Regent's paintings, enlarged by about a third (the other copy thus adorned is n° LX in this catalogue). Every one of the masterful gouaches on vellum looks as monumental as a painting. In addition, the copy contains 25 of the 29 Martini etchings based on the Regent's paintings, printed on vellum, coloured with gouache and presented in coloured frames. – The first owner was probably the English explorer, painter, and publicist James Forbes (1749–1819). It is possible that he also was the one who created the larger cycle. The work was later owned by his grandson, Charles, Comte de Montalembert (1810–1870), the politician, historian, scholar, who became Peer of France in 1831. Perhaps it was he who removed the »indecent« plates, and had the parts containing nudity discretely overpainted. The two volumes are bound in straight-grained morocco of the period around 1790/1800, in the style of Bozerian or Lefèvre, and are generally well-preserved, with only the slightest rubbing. – One of the three most beautiful copies of this edition (the others being n° LX and LXI), as well as an interesting document of moral history, and of the best provenance.
LX The famous, highly significant Galitzin copy (as cited by Cohen and De Ricci), the second known copy of the Didot-Lamy edition from 1787 on large folio vellum throughout, also with enlarged original wash miniatures. Here the complete suite consists of 25 gouache paintings and four coloured etchings. The landscapes and occasional interiors of the buildings are superbly reproduced, with an excellent scenic atmosphere and image
depth that would otherwise be found only in oil paintings. Two volumes in magnificent master bindings from the tool repertoire of Bozerian in the Greek style, the inner surface of the covers being painted dark. Endpapers and title pages of both volumes a little browned, the backs of the last few leaves slightly more so, otherwise flawlessly preserved and very clean, the miniatures protected by inserted sheets (serpentes) of the finest laid paper, in most sparkling and perfect condition.
LXI This is the most significant and finest of the folio vellum copies of the 1787 edition (each one unique in itself), perhaps of all Longus editions of the 18th century, because it contains not only the 29 original drawings by Pierre-Antoine Martini , but also 29 etchings after the paintings of the Regent, coloured with wash. All 29 are certified by the garde-meuble et concierge of Castle St. Cloud, by the name of Boizard. He thereby attests that every single plate matches the original painting. This copy therefore is the epoch’s most faithful reproduction of the painting cycle, arguably identical to the original colours. It is a first-rate document of cultural as well as art historical importance, and a key work of the French Longus illustrations. Printed entirely on the best calfskin vellum in large folio size, it was in the eternally famous collection of A. A. Renouard; rebound around 1860 by Lortic in lemon-coloured morocco leather with the richest Renaissance decor, plus doublures in dark green morocco with extensive dentelle gold tooling and inlay, for the bookseller-collector Gancia. In the 20th century it belonged to Count Boisrouvray.
LXII The most extensive, beautiful, unique collection of original drawings and illustrations by Le Barbier for Daphnis and Chloe, brought together in one copy of the 1787 edition by the great bibliophile Raphaël Esmerian. The 22 plates
include eight original wash ink drawings , and seven etchings in eau-forte pure and avant la lettre states respectively. This is the only collection in existence with so many illustrations by Le Barbier for Daphnis and Chloe. The eight captivatingly beautiful lavis are bound in under a mat, two are signed and dated 1795 and 1797. Furthermore, the copy contains several state proofs; every single print of this suite, which was never published in its entirety, being exceedingly rare. The dark blue morocco binding by the Parisian bookbinder Georges Huser is a masterpiece of modern reproduction, true in style and material to its model from around 1800.
LXIII A small collection of rare prints from the fund of the famous Fürstenberg Collection: six loose plates with state proofs and in pure etching, as well as three plates after Gérard and one each after Prud’hon, Hersent and Albrier, all avant la lettre . Three of the plates show the scene of Daphnis and Chloe in the bath. – Only the blank margins are slightly browned or foxed.
LXIV Another unique copy of the edition from 1787, containing the very rare outline etchings en bistre of the „Regent“ suite in Martini’s version, with the etchings by Prud’hon and Gérard in the avant la lettre state. – Good, wide-margined copy in a contemporary marbled calfskin binding.
LXV One of the latest editions of the „Regent“ suite, published in Lille during the Revolution in 1792, a very rare reprint of the edition published in Bouillon in 1776 by the Imprimerie de la Société Typographique, which also contains the cycle of Vidal's later engravings. – Brown half leather binding from the 20th century, well preserved.
LXVI The latest known offshoot of the Regent's edition from 1718 with a filiation of the original set of illustrations, printed in 1796 with the plates created for the 1745 edition. The publisher Debarle, otherwise known for political publications and magazines, must have been able to acquire this suite. Our copy contains the plates in contemporary colouring. Bound in contemporary marbled calf leather binding with a smooth spine, slightly rubbed, interior in some places slightly stained.
LXVII The »Monsiau Edition«, published by Maradan and Desenne in the sixth year of the revolutionary calendar (1798), with new illustrations, designed by the Parisian history painter and illustrator Nicolas-André Monsiau: four charming plates and a frontispiece. It appeared in two sizes, of which this larger one, printed on wove paper, is the more sought-after, with the plates as pure etchings or in the avant la lettre state. – Marbled calfskin binding in the style of Bozerian.
LXVIII Monsiau’s plates for the Paris 1798 edition in three different states: eau-forte pure, avant la lettre and in the final state with contemporary colouring, intended for the small octavo edition. Each with engraved frontispiece and four copperplates by Dupréel and Pauquet, after Monsiau. All are unmounted, with binding marks on one side of the page, margins slightly browned and slightly foxed. – Very rare set of this significant late illustration sequence.
LXIX This sixtodecimo edition by Didot was created in 1800 as a small counterpart to the concurrent quarto edition as one of the first Didot prints in the stereotype process, being one of the earliest examples of use of this technology. A lovely, well-preserved copy, in which all text pages are ruled and uncut. The suite, which was based on drawings by Louis Binet, actually belongs to
the Parisian Patris edition of 1795, and was bound in, along with four later plates made in heliogravure after photographs (!). The bookbinder was Bernard David (1824–1895), a former assistant of Lortic and Gruel.
LXX An excellent copy in a masterly binding by Charles Allô in contemporary red half-morocco from around 1870 – with Pierre Didot's »Edition of the Century«, a major work of classicistic typography, with brilliant plates by Prud’hon and Gérard. It is a prime example of extremely generous, monumental book design and the corresponding illustration, which is also at the highest artistic level. A fine copy with splendid gold tooling on the spine. Printed on large, wide-margined wove paper, the first quires minimally foxed.
LXXI Another exceptionally beautiful copy of the 1800 Paris edition, bound by Cuzin in an orange half-morocco binding from around 1870, with small, differently coloured morocco onlays on the spine. In addition, the copy contains the hardto-find front wrapper, where the title is printed in noticeably larger font, indicating the paper size intended by the publisher. The plates from the series by Prudhon and Gérard are present in beautiful, sharp avant la lettre impressions, the binding with Cuzin’s stamp signature.
LXXII A particularly magnificent specimen from the celebrated library of one of the greatest collectors of all time, Duke Albert of SaxonyTeschen, bound by the legendary Viennese court bookbinder Georg Friedrich Krauss, who was active in the first quarter of the 19th century. The red half-morocco binding bears his stamp. Bindings by Krauss with this stamp are of excessive rarity. The richly gilt spine shows the duke's monogram. All plates are avant la lettre, with serpentes, and very
clean – a copy in perfect condition from one of the most important libraries of the time.
LXXIII A special, unique copy of the Didot edition from the year 1800, which contains the suite by Prud'hon and Gérard in the early avant la lettre state, as well as three original drawings, which were apparently produced immediately relating to the designs, one after Prud'hon, the other two after Gerard. These three drawings were presumably made by one of the etchers in order to demonstrate the graphic illustration of the work. Signed master binding by Réne Kieffer: richly gilt dark blue morocco from around 1900. – The drawings and plates are mounted, some leaves are slightly foxed, otherwise a well-preserved, luxurious specimen.
LXXIV A copy of exquisite cool noblesse, masterfully bound in petrol blue morocco by Charles Allô, with the scarce, welcome peculiarity that it not only contains the 1800 edition of the French translation, but also the infinitely rarer edition of 1802 with the original Greek text. Both Didot editions were printed on excellent wove paper, which is preserved in flawless condition. The nine plates, which also appear in the Greek edition, are included once only, as part of the French edition. The immaculately preserved and exceedingly beautiful binding is based on old models.
LXXV A very decorative copy, bound by JeanClaude Bozerian the Elder most elegantly in bright cherry-red straight-grained morocco. It comes from the library of André Langlois, who in the middle of the 20th century, along with Esmerian, was probably the most important collector of illustrated works of the 18th century. The central stamp on the spine is a tropaion of shepherd symbolism. The binding is in perfect condition, few leaves are minimally foxed.
LXXVI A unique copy that unites the „Regent“ suite of the 1724 Paris edition with the significant series by Gérard and Prud’hon from around 1800. The „Regent“ suite, which is missing two of the »indecent« plates, is printed on large paper here, a very rare state of separate impressions. Some of the plates after Prud'hon and Gérard are avant la lettre (five), some avec la lettre (three), and beneath one plate there is only the title. The first and last plates from the Regent's suite partly browned, the majority of the plates and text pages as well as the elegant binding, redbrown morocco from around 1870/80 with rich gold tooling, in perfect condition.
LXXVII A distinguished copy, richly truffled: in addition to the Prud'hon and Gérard etchings included in the edition, this copy contains the entire suite by Martini based on the paintings of the Regent in a particularly beautiful, nuanced colouring, as well as several prints from the unpublished suite by Le Barbier. The crowning glory are two original drawings by Le Barbier, both designs for the oblong head engravings. They are part of the planned four opening pages of the novel’s chapters, of which only the first is known as having been etched. In a signed deep black morocco leather binding from the first half of the 20th century, with rich onlays in orange and different shades of red turkey by the Parisian master binder Maylander. –Perfectly preserved, one of the – many – highlights of this collection.
LXXVIII The copy from the libraries of Emmanuel Martin, Baron Raimondo Franchetti, and René Descamps-Scrive, cited by Cohen and De Ricci. One of only two known copies on vellum, with the nine Prud’hon and Gérard plates printed on China paper, and bound in a signed midnight blue morocco binding in the style à la cathédrale , a
masterpiece by the great René Simier. – The plates in very sharp, vivid and high-contrast prints, with protective silk papers from the Greek edition of 1802, printed in three languages.
LXXIX Renouard’s rare edition from 1803: a splendid copy, bound by the great bookbinder Léon Gruel in orange morocco for his own library in the style of the middle of the 18th century (with his bookplate). Also included here is an inserted quire which, after Paul-Louis Courier's discovery of the complete Longus manuscript in 1810, was printed by Renouard to supplement older editions. This wide-margined copy was only minimally cut. – Occasionally slightly foxed in the margins, very decorative binding.
LXXX A marvellous specimen once owned by Henri Beraldi, bound in emerald green inlaid morocco by Charles François Capé at the middle of the 19th century. Containing two extremely rare proofs of Prud'hon’s masterpiece, the frontispiece avant la lettre and eau-forte pure , and two proofs of the portrait, as well as an etching after Gérard, avant la lettre . This copy too includes the four extremely rare leaves published in 1810, with the supplement of the fragment found in Florence. –One of the finest copies of this rare edition.
Painting Frontier, Jean-Charles (Paris 1701Lyon 1763). Two young lovers in a pastoral landscape: Daphnis and Chloe. Oil painting on canvas. Signed and dated 1749 (on the rock in the centre of the picture). 978 x 1447 mm. – This is the only known signed painting by the nearly forgotten (and unjustly so) master Frontier, composed entirely according to academic rules and perfectly balanced. The details depicted create a narrative that hints at an imminent moment of change. A small group of cupids tries to keep all distractions away from the young lovers at the centre, who are con-
cerned about their animals. Up in the sky, two cupids are holding a lyre, which they are still hiding behind a cloth: a symbol of the love between the protagonists, which, while hinted at, has not yet fully manifested itself. – Jean-Charles Frontier is one of the great unknowns of French painting in the 18th century. We know a few things about his life, but his oeuvre has barely been explored so far. This confirmed work will certainly serve as a guide for further attributions in the future. Frontier was a professor at the Art Academy in Paris, and took part in a number of salon exhibitions, before he moved to Lyon in 1754, and founded a drawing school there in 1757 to train designers in the silk industry. He received a number of orders from the church, but also painted secular and mythological subjects, his great role model obviously being Nicolas Poussin. Frontier’s painting is committed to the limits of decency, the nudity portrayed is natural and any eroticism is merely hinted at. Not only is this painting apt to contribute to the rediscovery of this important painter, but it may also help to further determine the role he played in French painting in the mid-18th century. In view of this work, we can only agree with Pierre Rosenberg when he writes about the work of Frontier: »Frontier deserves greater recognition among his generation, which included one of the most dazzling groups of artists ever known in France.«
Appendix A The French first edition of the 18th century, probably printed by Guérin for the publisher Jean-Joseph Barbou in Paris, who had bought the famous Cramoisy publishing house in 1715. Jean-Baptiste Scotin’s suite was part of it from the beginning and is an integral part of the edition. It is included in this edition with the exception of the petits pieds. This edition heralds the great series of French illustrated Longus editions of the 18th
century. – A bit stained and browned, the binding slightly damaged.
Appendix B The first 18th century Longus printed in the Netherlands, which commences the second major line of Longus editions: the Amsterdam edition, a direct offshoot of the Parisian prints, and one that would prove to be very fruitful, developing distinctly and independently. The unauthorized reprint comes from Emanuel Du Villard, whose publishing catalogue is a part of this print. The sequence of engravings, including the copperplate title, was copied and inverted from the first edition in Paris, and two illustrations were swapped. – Nice, clean copy in a light brown morocco binding in the style of late Historicism, dark green morocco doublures with a wide border in gold, as well as marbled endpapers.
Appendix C Another good and complete copy of the small octavo edition from 1745, with Cochin's four large culs-de-lampe in a pretty, only slightly rubbed binding in veau fauve with floral-ornamental gold tooling, covers with triple fillet frames, marbled endpapers and gilt edging.
Appendix D One of the extremely rare uncut copies of the Amsterdam Pour les curieux edition of 1757 in full paper size, almost 21 centimetres tall, while most known copies are under 20cm. –Complete and with all the plates, printed on very strong laid paper, the copperplate impressions are good and clean, the text pages slightly browned and stained, the frontispiece has a torn corner in the unprinted margin, the simple cardboard binding from around 1800 a little bit rubbed and scuffed.
Appendix E Another complete copy of the Amsterdam Pour les curieux edition from 1757, bound in veau fauve . – Corners and edges bumped, the
joints and headband somewhat damaged, the inside only slightly stained and well preserved.
Appendix F One more copy of the Pour les curieux edition of 1757, in a magnificent red morocco binding with rich floral gold tooling on the spine, triple fillet borders on the covers, and marbled endpapers, very similar to our coloured copy of this edition, number XLIII .
Appendix G The rare 1776 edition of the Société Typographique de Bouillon , which was founded in 1768 and primarily published writings on politics, science and philosophy. This Longus was made after the model of the „Regent“ edition from 1718, but with lower quality copperplate prints from a workshop for reproduction engravings under the direction of engraver Géraud Vidal. – Ruled copy, decoratively bound in red morocco with richly gilt spine, somewhat stained and browned in the wide margins, towards the end a leaf with a small tear in the margins, with an old repair. – The plates in fairly bold, clean impressions.
Appendix H Very rare pocket book edition of Longus’ novel in 1784, the only one printed in Versailles, probably intended for the environment of the royal court, especially for the court ladies. The Regent's suite is limited to six plates, all in portrait format and unreversed. In the middle of the work, numerous illustrations have been omitted, while the petits pieds are included (missing from most copies). For this edition, the landscape format panels were converted and modified into portrait format. – Clean and pretty copy in a marbled calfskin binding of the period with a smooth spine, corners slightly bumped, the front pastedown with traces of a removed bookplate.
Appendix I The last edition of the 18th century with the Amsterdam imprint, datable 1794, newly typeset, but otherwise with the same collation, after the Versailles edition published ten years earlier. The illustrations only partially match the previous print: the frontispiece and the seven plates, instead of only six, were re-engraved. Four of the plates have the same subject matter, they were inverted from the Versailles edition. – Contemporary dark green smooth calfskin, binding and endpapers slightly rubbed and bumped, only moderately stained inside, the copper engravings in good impressions.
Appendix J Nice copy of the »Patris edition« from 1795, which however has bound in a wrong suite belonging to La Fontaine's Les amours de Psyché et de Cupidon , but equally engraved by Jacques Auguste Blanchard after Louis Binet. This mix-up points to the fact that the edition is part of a small-format series, the so-called Collection de Patris; these prints are all illustrated with a small suite of plates by these two artists, and the two love stories were simply confused. The correct cycle can be found in our small edition of Didot from 1800 (number LXIX). – Wide-margined, nearly uncut copy in a red cross-grained morocco binding of the time with smooth spine, perhaps by Bozerian or in his style.
1716–1810 (einschliesslich einiger direkt abhängiger Drucke anderer Länder und Sprachen)
Nr. Jahr (laut Impressum * = im Katalog) Impressum und/ oder Ausgabenbezeichnung
1 1716 * Paris, „Chez les Héritiers de Cramoisy“.
Druckort (wie angegeben oder erschlossen)
Verleger/ Drucker (wie angegeben oder erschlossen)
Paris. (Guérin für Jean-Joseph Barbou, beide erschlossen).
Format Auflagen, Varianten, Besonderheiten und bibliographische Anmerkungen sowie Ergänzungen
Klein-8° Erste Ausgabe des 18. Jahrhunderts in Frankreich, mit dem Scotin-Zyklus illustriert (Kupfertitel und 8 Tafeln). – Reynaud Sp. 314. – Nicht bei C/ DR , Sander und Lewine. – Für eine bei Quérard und in anderen älteren Bibliographien angeführte Nouvelle édition, Paris 1712, kann kein Nachweis erbracht werden.
2 1716 * Amsterdam, „Chez les Frères Westin“ (Paris, erschlossen). (Guérin für Jean-Joseph Barbou, beide erschlossen).
3 1717 * Paris, „Chez les Héritiers de Cramoisy“.
(Amsterdam, erschlossen).
(Emanuel Du Villard, über Verlagsanzeige erschlossen).
Klein-8° Titelauflage der Pariser Ausgabe von 1716, mit dieser bis auf das Impressum übereinstimmend und mit der originalen Scotin-Suite illustriert. – Gay/Lemonnyer I, 183. –Nicht bei C/ DR , Sander und Lewine.
Klein-8° Amsterdamer Nachdruck der Pariser Ausgabe von 1716. – Mit dem Scotin-Zyklus in seitenverkehrtem Nachstich, eine Tafel ausgetauscht (hinzugekommen die Tafel zu Seite 7, dafür fehlt diejenige zu Seite 53). –Gay/Lemonnyer I, 183. Reynaud Sp. 314. – Nicht bei C/ DR , Sander und Lewine. – Ein Nachdruck mit den Kupfern in holländischer Sprache erschien 1744 in Amsterdam und Alkmaar unter dem Titel: De herderlyke liefde-gevallen, van Daphnis en Chloé.
4 1718 * Ohne Ort und Drucker. –„Édition dite du Régent“, die sogenannte „Regentenausgabe“ (Paris). (Vermutlich die Imprimerie Royale in Paris).
5 1724 * „Mises au jour par Charles Coypel Ecuyer“. – Die Separatausgabe der Regentensuite. (Paris). CharlesAntoine Coypel.
6 1731
* Ohne Ort und Drucker. -Nachfolger der Regentenausgabe von 1718.
(Paris). (Guérin und wohl Coustelier veuve).
Klein-8° Die erste Ausgabe mit dem Regentenzyklus von Audran nach Coypel und dem Regenten Philipp von Orleans. – Eine Teilauflage auf großem und besserem Papier. – C/ DR 648–651.
4° Alle 28 Tafeln der Regentensuite in den Abzügen des Sohnes von Antoine Coypel, mit einem Kupfertitel, datiert 1724, in gestochener Schrift; meistens unter Auslassung zweier „anstößiger“ Tafeln. – Péreire 60. Reynaud Sp. 314.
Klein-8° Erschienen in zwei Varianten, unterscheidbar u. a. anhand der Zierformen. Guérin ist als Verleger bezeugt, aber von anderem Drucker ausgeführt. – C/ DR 651 f.
Nr. Jahr (laut Impressum * = im Katalog)
Impressum und/ oder Ausgabenbezeichnung
7 1734 Amsterdam, François Changuion.
Druckort (wie angegeben oder erschlossen)
Verleger/ Drucker (wie angegeben oder erschlossen)
Amsterdam. François Changuion.
Format Auflagen, Varianten, Besonderheiten und bibliographische Anmerkungen sowie Ergänzungen
Klein-8° Seltene Ausgabe, ein Nachdruck der Edition „Paris 1717“ (= Amsterdam). Changuion war ein ehemaliger Geschäftspartner Emanuel Du Villards. – Mit dem Scotin-Zyklus in der seitenverkehrten Fassung und ausgetauschter Tafel. – Gay/Lemonnyer I, 184.
8 1745 * Ohne Ort und Drucker. -Neuauflage der Regentenausgabe, nun mit nachgestochenem Zyklus und den Vignetten Cochins. (Wohl Paris). (Coustelier, überliefert).
9 1749 Amsterdam, ohne Drucker. – Die erste der kleinen Amsterdamer Ausgaben der Jahrhundertmitte. Amsterdam. (Evert Van Harrevelt, erschlossen nach Verlagsanzeige).
10 1750 * Amsterdam, ohne Drucker. Amsterdam. (Jean Néaulme, belegt).
11 1751 Ohne Ort und Drucker. – Nachdruck der Ausgabe von 1745, jedoch mit der ScotinFolge.
12 1754 * „Lutetiae Parisiorum, In gratiam curiosorum“. – Die griechisch-lateinische „Curiosorum“Ausgabe.
13 1757 * Paris. – Die „Pour les curieux“-Ausgabe in doppelter französischer Übersetzung.
14 1763
(Paris?). (Nicht erschlossen).
8° und 4°In mehreren Fassungen erschienen: Oktav und Quart, letztere wiederum in Varianten. – Kolorierte Vorzugsexemplare manchmal in einer „Übergangsvariante“, ohne die Vignetten. – C/ DR 652.
Klein-8° Kaum bekannter Vorgänger der Ausgabe von 1750, äußerst selten. – Abhängig von einer Druckvariante des Jahres 1745, mit den Notes von Lancelot und Nachstichen der Scotin-Suite (Aves figures par un élève de Picart). – Nicht bibliographisch nachweisbar.
Klein-8° Titelauflage der Ausgabe von 1749. Sehr selten. Drucker und Ort belegt in: Acta Eruditorum, 1756, S. 299. – Reynaud Sp. 315.
Klein-8° Sehr seltener Druck, vielleicht aus Paris (oder Amsterdam), mit den Notes von Lancelot. Titelvignette übereinstimmend mit der Ausgabe von 1745. – Sander 1224.
(Amsterdam, belegt).
(Jean Néaulme, belegt).
(Amsterdam, belegt).
London. – Ausgabe in englischer Übersetzung, mit dem Scotin- Zyklus im Nachstich (daher hier verzeichnet).
(Jean Néaulme, belegt).
Klein-4° (und GroßQuart in Druckvariante).
Klein-4° (und Quart als Druckvariante)
London J. Knox. 8°
Die berühmte Ausgabe mit den Neudrukken von den Originalplatten der Regentensuite, erstmals im Rahmenwerk von Eisen und Fokke und mit den Vignetten von Cochin und Eisen. Drucker und Ort nachgewiesen in: Acta Eruditorum , 1756, S. 299. –C/ DR 652 f.
Drucker und Ort in Katalogen der Zeit belegt. – Wie die Ausgabe von 1754 in Paralleltext, nun in den Übersetzungen durch Amyot und Antoine le Camus. –C/ DR 653 f.
Übertragen ins Englische von James Craggs, die Stiche signiert I. Taylor, wahrscheinlich Isaak I. Taylor (1730–1807), Kupferstecher in London.
Nr. Jahr (laut Impressum * = im Katalog)
Impressum und/ oder Ausgabenbezeichnung
15 1764 * Den Haag, Néaulme.
Druckort (wie angegeben oder erschlossen)
Verleger/ Drucker (wie angegeben oder erschlossen)
Den Haag Jean Néaulme (zweifelhaft).
16 1773 Den Haag, Néaulme. Den Haag (vielleicht fingiert).
171776 Paris, Didot und Debure. – Die erste griechische Didot-Ausgabe.
18 1776 * Bouillon, Imprimerie de la Société Typographique.
19 1777 * Ohne Ort und Drucker. – Lyoneser Faux Cazin .
20 1778 Paris, Didot und Debure. – Erste griechisch-lateinische Didot-Ausgabe.
Néaulme (wohl fingiert).
Paris. FrançoisAmbroise Didot und GuillaumeFrançois Debure
Bouillon Société Typographique de Bouillon (Pierre Rousseau).
(Lyon, erschlossen). Nicht bekannt, sicher kein Cazin.
Paris. FrançoisAmbroise Didot Didot und Guillaume-François Debure.
Format Auflagen, Varianten, Besonderheiten und bibliographische Anmerkungen sowie Ergänzungen
Klein-8° Sander 1274. – Nachdruck der Ausgaben Amsterdam 1749/50. Wie diese mit dem seitenverkehrten Nachstich der Scotin-Folge in Rahmenbordüren, aber neu gesetzt und mit Textrahmen versehen. – C/ DR 654.
Klein-8° Ein satzgleicher Nachdruck der Ausgabe Den Haag 1764, auch mit der Suite nach Scotin, aber mit reicher verzierten Textrahmen und anderer Titelvignette (Vogelnest). – Sander 1227. Reynaud 315.
12° Hrsg. von Louis Dutens. – Nur mit Holzschnitt-Vignetten verziert. – Auflagenhöhe 200 Exemplare. – Hoffmann 531. Jammes 74.
Klein-8° Wohl die erste Ausgabe mit dem Nachstich der Regentensuite durch Géraud Vidal. –Die Société Typographique de Bouillon war zwischen 1768 und 1788 tätig. –C/ DR 654.
16° (oder 24°)
8° (auch 4°)
In drei Varianten nachweisbar. – Das Frontispiz in neuer Fassung der Petits pieds nach Scotin. – Von Corroënne der Reihe Collection lyonnaise des petits formats in-24 zugeordnet. – C/ DR 654.
Zweisprachige Ausgabe mit Paralleltext, hrsg. von Jean Baptiste Caspar d’Ansse de Villoison, in zwei Bänden. – Die griechische Textfassung hat Bodoni in seine Ausgabe von 1786 übernommen. – Mit HolzschnittVignetten verziert. – Hoffmann 531. Jammes 75.
21 1779 * „A Londres“, ohne Drucker. (Paris, erschlossen). (Valade, erschlossen). 8° / 4°In zwei Ausgaben erschienen: Oktav und Quart, die Quart-Fassung zuerst und in weiteren Varianten. Drucker und Ort durch Vergleich erschlossen. – Mit Nachstich der Regentenfolge, eingefaßt in Louis-seize-Rahmenwerk (nur in der Quart-Variante). –C/ DR 654 (nur die 4°-Fassung, für die kleine Fassung ohne Rahmenwerk): Reynaud Sp. 318 und Sander 1230.
22 1780 Die „A Londres“Ausgabe im Taschenformat (Faux Cazin).
(Paris, erschlossen). (Valade, erschlossen). 16° Nur mit einem Frontispiz nach Coypel illustriert. – Fontaine 200 (unter Faux Cazins). C/ DR 654.
Nr. Jahr (laut Impressum * = im Katalog)
Impressum und/ oder Ausgabenbezeichnung
23 1780 Paris, Didot. – Teil der Reihe: „Collection d’ouvrages français, en vers et en prose, imprimée par ordre du Comte d’Artois“
24 1781 Paris, Pissot und Barrois. – Ausgabe in italienischer Übersetzung.
25 1783
* „A Mithylène“, ohne Drucker. –Neue Ausgabe in der Übersetzung durch Mulot.
26 1784 * Versailles, Dacier. – Wohl ein Nachdruck aus der „Collection du comte d’Artois“, Paris 1780.
27 1785 Paris, ohne Drukker. – Bd. IV der Reihe „Bibliothèque universelle des dames. Cinquième classe, Romans“.
28 1787 * Paris, „Imprimerie de Monsieur“ für Lamy.
Druckort (wie angegeben oder erschlossen)
Verleger/ Drucker (wie angegeben oder erschlossen)
Paris. FrançoisAmbroise Didot
Format Auflagen, Varianten, Besonderheiten und bibliographische Anmerkungen sowie Ergänzungen
18°
Paris. Nicolas Pissot und Pierre-Théophile Barrois.
(Paris, erschlossen). (Moutard, erschlossen).
Versailles. Orléans, J. M. RouzeauMontaut, für Jean-Baptiste SévèreDacier in Versailles.
Paris. (Poinçot, erschlossen).
Aus der 64 Bände umfassenden Reihe, gedruckt 1780–84 im Auftrag des Comte d’Artois, jüngerer Bruder König Ludwigs XVI . und späterer König Karl X., wohl als Gegenstück zu der Reihe In usum Delphini. – Nicht illustriert. – Brunet II , 137. Radziwill, Kat. 1865, Nr. 923.
8° und 4°Erste in Frankreich gedruckte Ausgabe in der Übertragung durch Gasparo Gozzi von 1766. – In Quart- und Oktavformat erschienen. – Nicht illustriert. – Schweiger I, 192.
16° Erste Ausgabe in der Übersetzung des François-Valentin Mulot. – Mit neuer Illustration (Frontispiz, Porträt und Vignetten), eine Teilauflage in Oktav wurde zusätzlich mit der Regentensuite illustriert. –C/ DR 654 f.
18° Mit der reduzierten Regensuite; es sind auch Exemplare mit sechs Tafeln, einschließlich der Conclusion du roman , bekannt. – C/ DR 655: „ frontispice et 5 figures non signées“
Paris. Pierre-François Didot und PierreMichel Lamy.
18° Wurde auch als Cazin geführt, der Verleger nach einer Ankündigung im Mercure de France, November 1785, erschlossen. – Bildet den 10. Teil der Bibliothèque und enthält neben den Amours de Daphnis et Chloé in der Übersetzung von Mulot, S. 163–430, auch die Amours d’Ismène et d’Isménias. – Nicht illustriert. – Hoffmann 533. Quérard V, 351.
Groß-4° Text in der Neuübersetzung des Jean François Debure-Saint Fauxbin, die Tafeln in Umrißradierungen nach dem Regentenzyklus neu angefertigt durch Pierre-Antoine Martini (datiert 1788). – Teilauflagen in großem Format (Royal-Folio, teils auf Pergament) und mit kolorierten Radierungen, dazu zwei bekannte Exemplare auf Pergament mit vergrößerten Miniaturen. –C/ DR 655.
Nr. Jahr (laut Impressum * = im Katalog)
Impressum und/ oder Ausgabenbezeichnung
29 1792 * Lille, Lehoucq. –Wohl die zweite Ausgabe mit der Regentensuite im Nachstich von Vidal.
30 1794 * Amsterdam, ohne Drucker. – Sicherlich nichtautorisierter Nachdruck der Ausgabe Versailles 1784.
31 1795 * Paris, Patris. – Erste Ausgabe mit den Tafeln nach Binet, zugleich die dritte in der Übersetzung des François-Valentin Mulot.
Druckort (wie angegeben oder erschlossen)
Verleger/ Drucker (wie angegeben oder erschlossen)
Lille. Charles François Joseph Lehoucq
(Frankreich, wohl Paris?).
(Unbekannt).
Paris. CharlesFrobert Patris und (Jean-Baptiste?) Devaux.
32 1796 * Paris, Debarle. Paris. Debarle (-Dubosquet).
33 1797 (An V) Paris, Guillaume. –Nachdruck der Ausgabe von 1731 mit den Notes, erschienen in einer Reihe griechischer Romane.
34 1798 (An VI)
* Paris, Maradan und Desenne. –Neue Ausgabe in der Übersetzung durch Blanchard.
35 1799/ 1800 (An VIII) * Paris, „Didot l’ainé“. – Seltene Didot-Ausgabe im Taschenformat.
Paris. Guillaume und Gide.
Format Auflagen, Varianten, Besonderheiten und bibliographische Anmerkungen sowie Ergänzungen
8°
Nachdruck der Regentenausgabe mit dem Nachstich der Folge durch Géraud Vidal, wohl anknüpfend an die Ausgabe Bouillon 1776. – C/ DR 655.
16° Taschenausgabe mit unsigniertem Nachstich der Regentenfolge, reduziert auf das Frontispiz, sechs Tafeln (alle im Hochformat) und die Conclusion du roman. – Reynaud Sp. 319. Van Eeghen II , S. 238.
16° Mit fünf Tafeln von Jacques Auguste Blanchard nach Louis Binet. – Enthält einen Reihentitel; die gesamte Reihe als Collection de Patr is bei Corroënne geführt. – Text in der Übersetzung Mulots, nach der Ausgabe Paris 1783. – Barbier, Anonymes et pseudonymes, 611. C/ DR 656.
8° Die letzte Ausgabe mit der Regentensuit e. –Reynaud Sp. 319. Sander 1233, Anm. (sieht darin einen Nachdruck der Ausgabe von 1787 – unbegründet).
12° Die Nummer VI der Reihe Bibliothèque des romans grecs, traduits en français. – Nicht illustriert. – Hoffmann 534.
Paris. Suret für ClaudeFrançois Maradan und Victor Desenne. 16° und Klein-8° Ausgabe in der Neuübersetzung von Pierre Blanchard, illustriert mit vier Kupfertafeln nach Nicolas-André Monsiau, die Tafeln teils in unterschiedlichen Zuständen (avant la lettre und eaux fortes). – C/ DR 656.
Paris. Pierre Didot. 16° Frühdruck der Stereotypie, illustriert mit der Suite von Monsiau. – Reihentitel: L’Ornement des petites bibliothèques. Collection précieuse, en petit format, des plus jolis romans, et autres ouvrages choisis en vers et en prose (nicht fortgeführt). – C/ DR 656.
Nr. Jahr (laut Impressum * = im Katalog)
36 1800 (An VIII)
Impressum und/ oder Ausgabenbezeichnung
* Paris, „Didot l’aîné“. – Die „Jahrhundertausgabe“ des Hauses Didot im Großformat.
37 1800 (An IX) Paris, Renouard. –Italienische Ausgabe in der Übersetzung Annibale Caros.
38 1802 * Paris, „Petrus Didot, natu major“. – Die dritte griechische DidotAusgabe.
391802 (An X)
Paris, J. B. Fournier, „père et fils“.
Druckort (wie angegeben oder erschlossen)
Verleger/ Drucker (wie angegeben oder erschlossen)
Format Auflagen, Varianten, Besonderheiten und bibliographische Anmerkungen sowie Ergänzungen
Paris. Pierre Didot.4° (oder Groß-4°)
Paris. AntoineAugustin Renouard.
Monumentale Ausgabe, (meist) auf Papier im Format Großquart gedruckt, typographisches Meisterwerk in der klassizistischen Didot-Antiqua. – Illustriert mit neun Tafeln, davon drei nach Prud’hon und sechs nach Gérard. – C/ DR 656. Jammes 92.
8° Erste Longus-Ausgabe von Renouard, mit einigen Kommentaren und Anmerkungen versehen. – Die Übersetzung Caros von 1537 war zuerst bei Bodoni 1784 in Parma erschienen. – C/ DR 657.
Paris. Pierre Didot.4° (oder Groß-4°)
Paris. JeanBaptiste Fournier.
8° (auch 12°)
40 1803 Paris, Didot. Paris. Pierre Didot. 4°
Gegenstück zur großen französischen Ausgabe des Jahres 1800 in griechischer Schrift, gleichfalls illustriert mit den neun Tafeln nach Prud’hon und Gérard. – Nur in 27 Exemplaren gedruckt. – Hoffmann 532. Reynaud Sp. 320. Jammes 94.
Gehört zur Bibliothèque portative du voyageur. – Ein Exemplar dieser Ausgabe besaß Goethe (Goethes Bibliothek, Nr. 1306).
Laut Hoffmann und Quérard ein Band der Bibliotheca classica Latina sive collectio auctorum classicorum latinorum (Collection des auteurs classiques français et latins), ursprünglich gedruckt von François Ambroise Didot in usum Delphini. –Hoffmann 534. Quérard V, 351.
41 1803 (An XII) * Paris, Renouard. –Erste Ausgabe bei Renouard in der Amyot-Übersetzung.
Paris. AntoineAugustin Renouard (gedruckt von Charles Crapelet). 12° (oder 8°)
42 1809 Paris, H. Agasse et Arthus Bertrand.
43 1810 „A Florence chez Piatti“. – Französische Ausgabe mit der erstmaligen „traduction complète d‘après le manuscript de l‘abaye de Florence“ durch Paul-Louis Courier.
Paris. Henri Agasse und Arthus Bertrand. 8°
Florenz. Guglielmo Piatti. 8°
Renouards erste Ausgabe der Amyot-Übersetzung. – Es gibt Exemplare, denen nachträglich die bislang fehlende Textstelle aus dem von Courier in Florenz aufgefundenen Manuskript beigebunden wurden (vier Blätter: „Fragment de Daphnis et Chloé“). – Illustration: Frontispiz nach Prud’hon und auf dem Titel hochovale Portrait-Vignette von Augustin de Saint-Aubin. – C/ DR 657.
Lateinische Übersetzung, übertragen von Philippe Petit-Radel. Laut Lewine (325) mit einer Falttafel nach Le Barbier.
Literatur- und Quellenangaben
Barber, Daphnis and Chloe
Barber, Giles, Daphnis and Chloe. The markets and metamorphoses of an unknown bestseller. London 1989 (= The Panizzi Lectures 1988)
Barber, Rothschild
Barber, Giles, The James A. Rothschild Bequest at Waddesdon Manor, the National Trust. Printed Books and Bookbindings. 2 Bde. Aylesbury 2013
Barbier, Anonymes et pseudonymes
Barbier, Antoine-Alexandre, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes composés, traduits ou publiés en français, avec les noms des auteurs, traducteurs et éditeurs. 2. Ausgabe. 4 Bde. Paris 1822–27.
Barbier/Juratic/Mellerio, Dictionnaire des imprimeurs
Barbier, Frédéric, Sabine Juratic und Annick Mellerio, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et gens du livre à Paris, 1701–1789. Bd. I: A-C. Genf 2007
Bauer, Rocaille
Bauer, Hermann, Rocaille. Zur Herkunft und zum Wesen eines Ornament-Motivs. Berlin 1962
Bénézit, Dictionnaire critique
Bénézit, Emmanuel, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays. Nouvelle édition. 14 Bde. Paris 1999
Bernard, Histoire de l’Imprimerie royale
Bernard, Auguste, Histoire de l’Imprimerie royale du Louvre. Paris 1867.
Bibliothek Otto Schäfer – Europäische Einbandkunst Europäische Einbandkunst aus sechs Jahrhunderten. Beispiele aus der Bibliothek Otto Schäfer. Bearb. von Manfred Arnim. Schweinfurt 1992
Biographie universelle
Biographie universelle ancienne et moderne. 52 Bde. und 33 Supplemente. Paris 1811–47
Birn, Le livre prohibé
Birn, Raymond, Le livre prohibé aux frontières: Bouillon. In: Roger Chartier und Henri-Jean Martin, Histoire de l’édition française. Bd. II: Le livre triomphant 1660–1830, Paris 1984, S. 334–341
Blignières, Essai sur Amyot
Blignières, Auguste de, Essai sur Amyot et les traducteurs français au XVIe siècle. Paris 1851
Bogeng, Die großen Bibliophilen
Bogeng, Gustav Adolf Erich, Die großen Bibliophilen. Geschichte der Büchersammler und ihrer Sammlungen. 3 Bde. Leipzig 1922.
Boissais/Deleplanque, Le livre à gravures
Boissais, Maurice und Jacques Deleplanque, Le Livre à gravures au XVIIIe siècle, suivi d’un Essai de bibliographie, Paris 1948
Brissart-Binet, Cazin
Brissart-Binet, Charles Antoine, Cazin. Sa vie et ses éditions. Reims 1863.
Brooks, Edizioni Bodoniane
Brooks, Hugh Cecil, Compendiosa bibliografia di edizioni Bodoniane. Florenz 1927.
Brunet, Manuel
Brunet, Jacques-Charles, Manuel du libraire et de l’amateur de livres. 5. Ausgabe. 6 Bde. und 3 Supplemente. Paris 1860–80.
Bulloch, Baillie of Dunain
Bulloch, Joseph Gaston Baillie, A History and Genealogy of the Family of Baillie of Dunain, Dochfour and Lamington. Green Bay 1898
Cioranescu, Dix-huitième siècle
Cioranescu, Alexandre, Bibliographie de la littérature Française du dix-huitième siècle. 3 Bde. Paris 1969/70.
Claeys, Dictionnaire biographique
Claeys, Thierry, Dictionnaire biographique des financiers en France au XVIIIe siècle. Paris 2011
Cohen, Guide de l’amateur
Cohen, Henry, Guide de l’amateur de livres à vignettes et a figures du dix-huitième siècle. 4. Auflage. Paris 1880
Cohen/De Ricci, Guide de l’amateur
Cohen, Henri, und Seymour de Ricci, Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIII e siècle. 6. Auflage. 2 Bde. Paris 1912.
Cokayne/Gibbs, The complete Peerage
Cokayne, George Edward und Vicary Gibbs, The complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom. 2. Ausgabe.
14 Bde. 1910–98
Corroënne, Petits joyaux bibliophiliques
Corroënne, Petits joyaux bibliophiliques, Première série: Livres bijoux précurseurs de Cazin, Paris 1894
Corroënne, Manuel du Cazinophile
Corroënne, A., Manuel du Cazinophile. Le petit-format à figures. Paris 1878
Courier, Denkwürdigkeiten und Briefe
Courier, Paul-Louis, Denkwürdigkeiten und Briefe. Aus dem Französischen (übersetzt von F. Gleich).
2 Bde. Leipzig 1829.
Courier, Oeuvres complètes
Courier, Paul-Louis, Oeuvres complètes. Nouvelle édition augmentée d’un grand nombre de morceaux
inédits, précédée d’un essai sur la vie et les écrits de l’auteur, par Armand Carrel. Paris 1837
Culot, Bozérian
Culot, Paul, und Andrée Rey, Jean-Claude Bozérian. Un moment de l’ornement dans la reliure en France. Bruxelles 1979
Culot, Le décor néo-classique
Culot, Paul, Le décor néo-classique des reliures françaises au temps du Directoire, du Consulat et de l’Empire. Dictionnaire des relieurs ayant exercé en France c. 1790- c. 1820. Brüssel 2015
Damascène Morgand. Livres dans de riches reliures Damascène Morgand. Livres dans de riches reliures des XVI e , XVII e, XVIII e et XIX e siècles. Paris 1910
Debure, Bibliographie instructive
Debure, Guillaume François, Bibliographie instructive, ou, traité de la connoissance des livres rares et singuliers. 7 Bde. und 3 Supplemente. Paris 1763–1782.
DNP
Der Neue Pauly. Enzyklopa die der Antike. Hrsg. von Hubert Cancik und Helmuth Schneider. 12 Bde. Stuttgart und Weimar 1996–2003.
Ducourtieux, Les Barbou
Ducourtieux, Paul, Les Barbou, imprimeurs: Lyon-Limoges-Paris (1524–1820). Limoges 1896
Ebert, ABL
Ebert, Friedrich Adolf, Allgemeines bibliographisches Lexikon. 2 Bde. Leipzig 1821–30.
Eckermann, Gespräche mit Goethe
Eckermann, Johann Peter, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 3 Bde. Leipzig und Magdeburg 1836–48
Eeghen, Amsterdamse boekhandel
Eeghen, Isabella Henriette van, De Amsterdamse boekhandel 1680–1725. 5 Bde. Amsterdam 1960–1978
Falkenstein, Königliche Bibliothek zu Dresden
Falkenstein, Constantin Karl, Beschreibung der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Dresden 1839
Fléty, Dictionnaire des relieurs
Fléty, Julien, Dictionnaire des relieurs français ayant exercé de 1800 à nos jours. Paris 1988
Fontaine, Cazin
Fontaine, Jean-Paul, Cazin, l’éponyme galvaudé. Paris 2012
Fontaine, Les Gardiens de Bibliopolis
Fontaine, Jean-Paul, Les Gardiens de Bibliopolis. Cent soixante portraits pour servir à l’histoire de la bibliophilie. 2 Bde. Paris 2015–18
Fürstenberg, Das Buch als Kunstwerk
Fürstenberg – Das Buch als Kunstwerk. Französische illustrierte Bücher des 18. Jahrhunderts aus der Bibliothek Hans Fürstenberg. Stuttgart 1965
Fürstenberg, Das französische Buch
Fürstenberg, Hans, Das französische Buch im 18. Jahrhundert und der Empirezeit. Weimar 1929
Fürstenberg, La gravure
Fürstenberg, Hans, La gravure originale dans l’illustration du livre français au dixhuitième siècle. Die Original-Graphik in der französischen Buch-Illustration des achtzehnten Jahrhunderts. Hamburg 1975
Garnier, Coypel
Garnier, Nicole, Antoine Coypel (1661–1722). Paris 1989
Garnier-Pelle, Antoine Coypel and the Regent Garnier-Pelle, Nicole, Antoine Coypel and the Regent. In: The Orléans Collection. Hrsg. vom New Orleans Museum of Art. New Orleans 2018, S. 85–95
Gay/Lemonnyer, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour
Gay, Jules, und Jules Lemonnyer, Bibliographie des ouvrages relatifs a l’amour, aux femmes et au mariage. 4. Ausgabe. 4 Bde. Paris und Lille 1894–1900
Gelli, Ex libris italiani
Gelli, Jacopo, Gli ex libris italiani. Guida del raccoglitore. 2. Ausgabe. Mailand 1930
Goethes Bibliothek
Goethes Bibliothek. Katalog. Bearbeitet von Hans Ruppert. Weimar 1958
Graesse, Trésor de livres rares
Graesse, Johann Georg Theodor, Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. 8 Bde. Dresden 1858–69
Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé
Grivel, Marianne, Le Régent et Daphnis et Chloé. In: Cahiers Saint-Simon, Nr. 34, 2006, S. 35–50
Gruel, Manuel de reliures
Gruel, Léon, Manuel historique et bibliographique de l’amateur de reliures. Paris 1887
Guigard, Nouveau armorial
Guigard, Joannis, Nouveau armorial du bibliophile. 2 Bde. Paris 1890
Haemmerle, Buntpapier
Haemmerle, Albert, Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. München 1961.
Hoffmann, Literatur der Griechen
Hoffmann, Samuel Friedrich Wilhelm, Bibliographisches Lexicon der gesammten Litteratur der Griechen. 2. Auflage. 3 Bde. 1838–45
Jacq-Hergoualc’h, Le Barbier
Jacq-Hergoualc’h, Michel, Jean-Jacques François Le Barbier l’aîné. In: Revue de l’art 176, 2012, Bd. II , S. 51–62
Jammes, Les Didot
Jammes, André, Les Didot. Trois siècles de typographie et de bibliophilie, 1698–1998. Paris 1998
Jammes, Les exlibris typographiques
Jammes, André, Les exlibris typographiques. Paris 1950
Kindlers Neues Literatur Lexikon. Neuausgabe, hrsg. von Walter Jens. 22 Bde. München 1988–1998
Kopylov, Papiers dorés d’Allemagne
Kopylov, Christiane F., Papiers dorés d’Allemagne au siècle des lumières. Paris 2012
Lama, Bodoni
Lama, Giuseppe de, Vita del cavaliere Giambattista Bodoni tipografo italiano. 2 Bde. Parma 1816
Laveissière, Prud’hon et la gravure
Laveissière, Sylvain, Prud’hon et la gravure. In: Huitièmes rencontres internationales du Salon du Dessin, 11 et 12 avril 2013, Bd. II , Paris 2013, S. 73–83
Lestringant, Daphnis et Chloé
Lestringant, Frank, Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Fortunes d’une traduction de Jacques Amyot. In: Fortunes de Jacques Amyot. Actes du Colloque international (Melun, 18.-20. April
1985), présentés par Michel Balard. Paris 1986, S. 237–257
Lewine, Illustrated books
Lewine, Jacob, Bibliography of eighteenth century art and illustrated books. London 1898.
Lugt, Les marques de collections
Lugt, Frits, Les marques de collections de dessins et d’estampes. 2 Bde. Amsterdam und Den Haag 1921–1956
Marchand, Contribution
Marchand, Jean, Contribution à la bibliographie de Daphnis et Chloé; les éditions de 1716 et 1717. In: Bulletin du Bibliophile 1961, S. 39–43
Meyer-Noirel, Répertoire général
Meyer-Noirel, Germaine, Répertoire général des ex-libris français des origines à l’époque moderne, 1496–1920. 20 Bde. Nancy 1983–2011
Michel, Cochin et le livre illustré
Michel, Christian, Charles-Nicolas Cochin et le livre illustré au XVIIIe siècle. Genf 1987
Michel, La reliure française
Michel, Marius, La reliure française depuis l’invention de l’imprimerie et jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. 2 Bde. Paris 1880
Michon, La reliure française
Michon, Louis-Marie, La reliure française. Paris 1951
Michon, Les reliures mosaïquées
Michon, Louis-Marie, Les reliures mosaïquées du XVIIIe siècle. Paris 1956.
Monglond, La France révolutionaire
Monglond, André, La France révolutionaire et impériale. Annales de bibliographie méthodique et
description des livres illustrés. 2. Ausgabe. 10 Bde. Genf 1976–87
Morgan, Bibliographical Survey
Morgan, John Robert, Longus, „Daphnis and Chloe“: a bibliographical survey, 1950–1995. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Bd. 43, 3 (1997), S. 2208–2276
Moulin, Daphnis et Chloé dans l’oeuvre de Gérard
Moulin, Monique, Daphnis et Chloé dans l’oeuvre de François Gérard (1770–1837). In: Revue du Louvre, 33, 1983, S. 100–109.
Neue Philolog ische Bibliothek
Neue Philologische Bibliothek. 4 Bde. Leipzig 1776–1778
Nodier, Mélanges
Nodier, Charles, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque. Paris 1829
Nova acta eruditorum
Nova acta eruditorum anno MDCCLVI publicata. Leipzig 1756
Olivier, Manuel
Olivier, Eugène, Manuel de l’amateur de reliures armoriées francaises. 30 Bde. Paris 1924–38
Péreire, Notes
Péreire, Maurice, Notes d’un amateur sur les livres illustrés du XVIIIe siècle. Paris 1926
Péricaud, Notes
Péricaud, Antoine, Notes et documents pour servir a l’histoire de Lyon. 13 Bde. Lyon und Roanne 1838–67
Poplin, Les animaux de Daphnis et Chloé
Poplin, François, Les animaux de Daphnis et Chloé (Pastorale de Longus). In: Bulletin de la Société
Nationale des Antiquaires de France, Paris 2012, S. 49–54
Portalis, Dessinateurs
Portalis, Roger, Les dessinateurs d’illustrations au dix-huitième siècle. 2 Bde. Paris 1877
Portalis/Beraldi, Les gravures
Portalis, Roger, und Henri Beraldi, Les gravures du dix-huitième siècle. 3 Bde. Paris 1880–82.
Praet, Livres imprimés sur vélin
Praet, Joseph Basile Bernard van, Catalogue des livres imprimés sur vélin de la bibliothéque du roi. 4 Bde. Paris 1824–28
Prud’hon ou le rêve du bonheur
Prud’hon ou le rêve du bonheur. Hrsg. von Sylvain Laveissière. Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 23 septembre 1997 – 12 janvier 1998. New York, The Metropolitan Museum of Art, 2 mars –7 juin 1998. Paris 1997
Quentin Bauchart, Les femmes bibliophiles
Quentin Bauchart, Ernest, Les femmes bibliophiles de France. 2 Bde. Paris 1886
Quérard, La France littéraire
Quérard, Joseph Marie, La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres. 12 Bde. Paris 1827–64.
Rahir, La Bibliothèque de l’amateur
Rahir, Edouard, La Bibliothèque de l’amateur. Guide sommaire à travers les livres les plus estimés. 2. Ausgabe. Paris 1924.
Ramsden, London Bookbinders
Ramsden, Charles, London Bookbinders, 1780–1840. London 1956.
Ransan, La vie privée
Ransan, André, La vie privée du Régent. Paris 1938.
Ray, The French Illustrated Book
Ray, Gordon N., The Art of the French Illustrated Book, 1700 to 1914. 2 Bde. New York 1986
Reynaud, Notes supplémentaires
Reynaud, Henry-Jean, Notes supplémentaires sur les livres à gravures du XVIIIe siècle. Lyon und Genf 1955
Rietstap, Armorial général
Rietstap, Johannes Baptista, Armorial général. 2 Bde. Gouda 1884–87
Riquier, The early modern transmission
Riquier, Kirsten, The early modern transmission of the ancient Greek romances: a bibliographic survey. In: Ancient Narrative, Bd. 15, Groningen 2018, S. 1–34
Ris, Les Amateurs d’Autrefois
Ris, L. Clément de, Les Amateurs d’Autrefois. Paris 1877
Salmon, Gérard
Salmon, Xavier, François Gérard, portraitiste.
Peintre des rois, roi des peintres. Château de Fontainebleau, 29 mars – 30 juin 2014. Paris 2014
Salomons, Eisen
Salomons, Vera: Charles Eisen. London 1914
Sander, Die illustrierten französischen Bücher
Sander, Max, Die illustrierten französischen Bücher des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1926.
Schiff Collection
Schiff Collection – French signed bindings in the Mortimer L. Schiff collection. Hrsg. von Seymour de Ricci. 4 Bde. Paris und New York 1935.
Schönberger, Longos
Schönberger, Otto, Longos. Hirtengeschichten von Daphnis und Chloe. 5., verbesserte Auflage. Düsseldorf, Zürich 1998 (= Sammlung Tusculum)
Schweiger, HCB
Schweiger, Franz Ludwig Anton, Handbuch der classischen Bibliographie. 2 Tle. In 3 Bdn. Leipzig 1830–34
Sgard, Dictionnaire des journalistes
Sgard, Jean (Hrsg.), Dictionnaire des journalistes, 1600–1789. 2 Bde. Oxford 1999
Sieurin, Manuel
Sieurin, Jacques, Manuel de l’amateur d’illustrations: Gravures et portraits pour l’ornement des livres français et étrangers. Paris 1875
Standen, Le Barbier
Standen, Edith Appleton, Jean-Jacques-François Le Barbier and two revolutions. In: Metropolitan Museum Journal, 24, New York 1989, S. 255–274
Tenschert, Katalog Mosaik-Einbände des 18. Jahrhunderts
Tenschert, Heribert, „à compartiments“. Mosaik-Einbände des 18. Jahrhunderts aus Frankreich. Ramsen 2019 (= Heribert Tenschert, Katalog LXXXIV)
Thieme/Becker, ALBK
Thieme, Ulrich, und Felix Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907–50
Thoinan, Les Relieurs
Thoinan, Ernest, Les Relieurs français (1500–1800). Paris 1893
Vicaire, Manuel de l’amateur
Vicaire, Georges, Manuel de l’amateur de livres du 19e siècle. 1801–1893. 8 Bde. Paris 1894–1920
Weiss – Katalog Bodoni Weiss – Giambattista Bodoni. Opera Typographica MDCCLXIX- MDCCCXXXIX . Katalog des Antiquariats Weiss & Co., München. München 1926
Kollektions-, Auktions- und Händlerkataloge, Sammler- und Provenienznachweise
Baudelocque – Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de M. E. B*** [Baudelocque]. Paris 1850 (Catalogue Baudelocque 1850)
Belin – Catalogue d’un joli choix de livres rares et précieux (Librairie Theophile Belin). Paris 1906. (Catalogue Belin 1906)
Beraldi – Bibliothèque Henri Beraldi. 5 Bde. Paris 1934–35 (Bibliothèque Beraldi 1934/35)
Berès – Pierre Berès. 80 ans de passion. 1–6 vente. 6 Bde. Paris (Bergé) 2005 (Collection Berès 2005)
Berry – Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny … de Madame la Duchesse de Berri. Paris 1836 (Catalogue Berry 1836)
Bibliotheca Parisiana – Bibliotheca Parisiana. A catalogue of a collection of books, formed by a gentleman in France. London 1791 (Bibliotheca Parisiana, London 1791)
Bibliothèque d’un Amateur – Bibliothèque d’un amateur. Vente 27 octobre 1959. Paris 1959 (Bibliothèque d’un amateur, Paris 1959)
Bishop – The Cortland F. Bishop Library Sale Catalogue. Part 1–4. 4 Bde. New York 1938/39 (Cortland F. Bishop Library 1938/39)
Bishop – The Magnificent French Library formed by the late Cortland F. Bishop. The Property of Mr. and Mrs, Shirley Falke, Lenox, Massachusetts, to be sold by their order(New York, Kende Galleries). New York 1948 (Cortland F. Bishop Library 1948)
Boissière – Catalogue des livres de feu M. de la Boissière trésorier général des Etats de Bretagne. Paris 1763 (Catalogue Boissière 1763)
Boissière – Decobert, Laurence, La bibliothèque musicale de Jean-Baptiste-Simon Boyer de La Boissière. In: Collectionner la musique. Érudits collectionneurs. Turnhout 2015, S. 260–308 (Decobert, La bibliothèque musicale de Boyer de La Boissière)
Bordes – Catalogue des beaux et bons livres anciens et modernes de la vente faite à Paris le 15 février 1897 (Porquet libraire). Paris 1897 (Catalogue Bordes 1897)
Bordes de Fortage – Catalogue de la bibliothèque de M. Ph.-L. de Bordes de Fortage. 3 Bde. Bordeaux (Monuastre-Picamilh) 1924–1927 (Catalogue Bordes de Fortage 1924)
Breslauer – Martin Breslauer Catalogue 110. Fine Books and Manuscripts in fine Bindings from the Fifteenth to the present Century. Followed by Literature on Bookbindings. New York 1990 (Catalogue Martin Breslauer 110)
Chastre de Cangé – Catalogue des livres du cabinet de feu M. Chastre de Cangé de Billy. Paris 1784 (Catalogue Chastre de Cangé 1784)
Caillard – Catalogue des livres rare et précieux de la bibliothèque de feu M. Ant. Bern. Caillard. Paris 1810 (Catalogue Caillard 1810)
Calenberg – Catalogue d’une très-riche collection des livres … de feu S. E. le Comte de Calenberg. Brüssel 1773. (Catalogue Calenberg 1773)
Crozet – Catalogue des livres composant le fonds de librairie de feu M. Crozet, libraire de la bibliothèque royale publié avec des notes littéraires et bibliographiques de M. M. Ch. Nodier, G. Duplessis et Leroux de Lincy. 2 Bde. Paris 1841 (Catalogue Crozet 1841)
Cousin – Catalogue de livres et manuscrits la plupart rares et précieux provenant du Grenier de Charles Cousin. 2 Bde. Lille 1891 (Catalogue Cousin 1891)
Debure – Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, de la bibliothèque de feu M. J. J. De Bure. Paris 1853. (Catalogue Debure 1853)
Delaleu – Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Delaleu, secretaire du roi, et notaire a Paris. Paris 1775 (Catalogue Delaleu 1775)
Delbergue-Cormont – Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, composant le cabinet de M. D*** C***. Paris (Porquet) 1883 (Catalogue Delbergue-Cormont 1883)
Dent – Catalogue of the splendid, curious, and extensive library of the late John Dent … Sold by auction by Mr. Evans. 2 Tle. London 1827 (Catalogue Dent 1827)
Descamps-Scrive – Bibliothèque de M. René Descamps-Scrive. 3 Bde. Paris 1925 (Bibliothèque Descamps-Scrive 1925)
Double – Catalogue de la bibliothèque de M. Léopold Double. Paris 1863 (Catalogue Double 1863)
Esmerian – Bibliothèque Raphaël Esmerian. 5 Tle. Paris 1972–1974 (Bibliothèque Esmerian 1972–74)
Fontaine – Catalogue de livres anciens et modernes, rares et curieux de la Librairie Auguste Fontaine. Paris 1875 (Catalogue Fontaine 1875)
Foyle – The Library of William Foyle. 3 Bde. Christie’s Sale 6348. London 2000 (Library of William Foyle 2000)
Galitzin (Golitsyn) – Notice de manuscrits, livres rares et ouvrages sur les sciences, beaux arts etc., tirée du Cabinet de Son Excellence le Prince M. Galitzin. Mise en ordre par G. de Laveau. Moskau 1820 (Cabinet Galitzin 1820)
Galitzin (Golitsyn) – Catalogue d’un choix précieux de manuscrits et de livres, la plupart sur vélin, provenant d’une des plus belles bibliothèques de l’Europe. Paris 1825 (Catalogue Galitzin 1825)
Gancia – Bibliothèque de M. G. Gancia. Catalogue de livres rares et de manuscrits précieux composée en partie de livres de la première bibliothèque du cardinal Mazarin. Paris (Bachelin Deflorenne) 1868 (Bibliothèque Gancia 1868)
Genf – Catalogue de la bibliothèque publique de Genève. 9 Bde. Genf 1875–99 (Catalogue de la bibliothèque publique de Genève)
Golowkin – Catalogue des livres de la bibliothèque du Cte. Alexis de Golowkin, Leipzig 1798 (Catalogue Golowkin 1798)
Gougy – Bibliothèque de M. Lucien Gougy, ancien libraire. Avant-propos de Louis Barthou. 5 Tle. Paris 1934–1936 (Bibliothèque Gougy 1934–36)
Guntzberger – Catalogue de la bibliotheque française de M. Guntzberger. Paris 1872 (Catalogue Guntzberger 1872)
Guy-Pellion – Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de M. P. G(uy-) P(ellion), Paris 1882 (Catalogue Guy-Pellion 1882)
Hanrott – Catalogue of the splendid, choice, and curious library of P. A. Hanrott … Sold by auction by Mr. Evans. 5 Tle. London 1833 (Catalogue Hanrott 1833)
Hauck – The History of the Book. The Cornelius J. Hauck Collection. Christie’s Sale 1769. New York 2006 (Hauck Collection 2006)
Hoe – Catalogue of Books forming the Library of Robert Hoe. 15 Bde. New York 1903–1909 (Hoe, Privatkatalog, 1903–09)
Hoe – Catalogue of the Library of Robert Hoe of New York: Illuminated manuscripts, incunabula, historical bindings, early English literature, rare Americana, French illustrated books, eighteenth century English authors, autographs, manuscripts, etc. 4 Bde. New York 1911/12 (Catalogue of the Library of Robert Hoe 1911/12)
Janzé – Catalogue de la bibliothèque de feu M. le vicomte F. de Janzé. 2 Bde. Paris (Leclerc) 1909 (Catalogue Janzé 1909)
La Bédoyère – Catalogue des livres rares et précieux, imprimés et manuscrits, dessins et vignettes composant la bibliothèque de feu M. le comte H. de La Bédoyère. Paris 1862 (Catalogue La Bédoyère 1862)
Lamy – Catalogue des livres, manuscrits et imprimés, des peintures, dessins et estampes du ca -
binet M. L[amy] … dont la vente se fera lundi 11 janvier 1808, et jours suivants. Paris (Renouard) 1807 (Catalogue Lamy 1807)
Lassize – Catalogue des livres en partie rares et précieux composant la bibliothèque de M. H. D. L[assize]. Paris 1862 (Catalogue Lassize 1862)
Lebeuf de Montgermont – Catalogue de livres rares et précieux imprimés et manuscrits composant la bibliothèque de M. L. de M*** [Montgermont].
Paris 1876
(Catalogue Lebeuf de Montgermont 1876)
Lefrançois – Lefrançois, Francisque, Livres d’occasion anciens et modernes, Catalogue Nr. 21. Paris 1939 (Lefrançois, Catalogue Nr. 21, 1939)
Lignerolles – Catalogue des livres rares et précieux manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de feu M. le comte de Lignerolles. 4 Bde. Paris 1894/95
(Catalogue Lignerolles 1894/95)
Maigret/De Broglie – Manuscrits et livres précieux. Vente aux enchères publiques, Paris Hôtel Drouot, salle 9, mardi 18 novembre 2008 à 14h30. Commissaire priseur Thierry de Maigret. Paris (Emmanuel de Broglie) 2008 (Maigret/De Broglie, Catalogue 2008)
Martin – Collection de M. Emm. Martin. Livres rares et précieux anciens et modernes. La plupart illustrés par les plus grands artistes du XVIIIe et du XIXe siècle. Paris 1877 (Collection Martin 1877)
Massicot – Catalogue de la bibliothèque de feu
Mr. E. Massicot. Paris 1903 (Catalogue Massicot 1903)
May – Bibliothek Paul May, Amsterdam. Zweiter Teil: Almanache, französische illustrierte Bücher des XVII . und XVIII . Jahrhunderts. Zürich (Laube) 1956 (Bibliothek Paul May 1956)
Mirabeau – Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Mirabeau l’ainé … dont la vente se fera … le lundi 9 Janvier 1792 et jours suivans. Paris (Hôtel de Bullion) 1791 (Catalogue Mirabeau 1791/92)
Miribel – Bibliothèque d’un amateur [G. de Miribel]: Très beaux livres anciens. Vente à Paris, Drouot Richelieu, le vendredi 4 juin 1993 (Vente Miribel 1993)
Néaulme – Catalogue d’une belle collection de livres et d’estampes, propre à former une bibliothèque des plus estimables. Amsterdam, Den Haag und Berlin 1755 (Catalogue Néaulme 1755)
Néaulme – Catalogue d’une nombreuse collection de livres. 5 Bde. Amsterdam und Berlin 1763 (und zweite Ausgabe in 6 Bdn., Den Haag 1765) (Catalogue Néaulme 1763/65)
Paignon Dijonval – Cabinet de M. Paignon Dijonval. État détaillé et raisonné des dessins et estampes dont il est composé … à l’usage des artistes et des amateurs. Rédigé par M. Bénard. Paris 1810 (Cabinet Paignon Dijonval 1810)
Paillet – Bibliothèque d’un Bibliophile 1865–1885 [Sammlung Eugène Paillet, herausgegeben von Henri Beraldi], Lille 1885 (Catalogue Paillet 1865–85)
Paillet – Catalogue de la bibliothèque de feu M. Eugène Paillet, président de la Société des amis des li-
vres. Deuxième partie. Paris (Librairie Damascène Morgand) 1902 (Catalogue Paillet 1902)
Payne – A Catalogue of a Valuable Collection of Books in Various Languages. London 1798 (Catalogue Payne 1798)
Pichon – Catalogue de la bibliothèque de feu M. le baron Jérôme Pichon. 3 Bde. Paris (Librairie Techener) 1897–98 (Catalogue Pichon 1897/98)
Pompadour – Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Madame la Marquise de Pompadour. Paris 1765 (Catalogue Pompadour 1765)
Porges-Wodianer – Les livres de Madame J. Porges. Paris 1906 (Katalog Porges 1906)
Portalis – Catalogue de beaux livres anciens illustrés principalement du XVIIIe siècle provenant de la bibliothèque de M. le baron R. P*** [Portalis]. Paris 1882 (Catalogue Portalis 1882)
Portalis – Catalogue de livres rares la plupart reliés en maroquin ancien provenant de la bibliothèque de M. le baron R. P**** [Portalis]. Paris 1889 (Catalogue Portalis 1889)
Radziwill – Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de M. le Prince Sigismond Radziwill. Paris 1865 (Catalogue Radziwill 1865)
Rahir – La bibliothèque de feu Édouard Rahir, ancien libraire. 6 Bde. Paris (Lefrançois) 1930–38 (Bibliothèque Rahir 1930–38)
Redé – Collection du Baron De Redé provenant de L’Hotel Lambert (Sotheby’s, Paris, 16 et 17 mars 2005). 2 Bde. Paris 2005 (Collection De Redé 2005)
Renouard – Renouard, Antoine-Augustin, Catalogue de la bibliothèque d’un amateur, 4 Bde. Paris 1819 (Catalogue Renouard 1819)
Renouard – Catalogue d’une précieuse collection de livres, manuscrits, autographes, dessins et gravures composant la bibliothèque de feu M. Antoine-Augustin Renouard. Paris und London 1854 (Catalogue Renouard 1854)
Richard (de Lyon) – Catalogue de livres rares et précieux. Paris 1885 (Catalogue Richard de Lyon 1885)
Ripault – Bibliothèque du Dr Armand Ripault. 2 Bde. (Première partie. Livres rares et précieux dans tous les genres. Seconde partie. Livres illustrés des XVIIIe et XIXe siècles, livres illustrés contemporains). Vente du 7 au 9 février 1924, 9 rue Drouot. Paris (Leclerc) 1924 (Bibliothèque Ripault 1924)
Rothschild – Picot, Emile, Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James de Rothschild. 5 Bde. Paris 1884–1920 (Catalogue Rothschild 1884)
Salomons – Catalogue of the Library at Broomhill, property of Sir David Lionel Salomons, 6. Auflage. Tunbridge Wells 1916 (Catalogue Salomons 1916)
Salomons – French illustrated books and almanacs from the library of Sir David Salomons … sold at Christie’s Great Rooms on Wednesday 3 December 1986. London 1986 (Catalogue Salomons 1986)
Sardou – Catalogue de la bibliothèque de feu M. Victorien Sardou, … de l’Académie française [Paris, Hôtel Drouot, 25–27 mai 1909]. Première partie. Livres anciens … livres aux armes de personnages célèbres; livres illustrés du XVe au XVIIIe siècle, recueil de costumes, etc. Paris 1909 (Catalogue Sardou 1909)
Scheffer – Catalogue de livres précieux … de suites de gravures avant la lettre et eaux-fortes et de pièces rartes sur l’hisoire de France. Paris (Labitte) 1880. (Catalogue Scheffer 1880)
Schiff – Catalogue of a Selected Portion of the famous Library formed by the late Mortimer L. Schiff of New York City. 3 Bde. London (Sotheby’s) 1938 (Catalogue Mortimer L. Schiff 1938)
Sickles – Bibliothèque de M. Daniel Sickles. Précieux manuscrits à miniatures, beaux livres illustrés du XVIIIe siècle, beaux livres illustrés modernes dans d’importantes reliures mosaïquées, ouvrages sur les beaux-arts, éditions originales. Paris (Drouot) 1945 (Bibliothèque de M. Daniel Sickles 1945)
Sickles – Modern French illustrated books … with a complete collection of Vollard publications … rare XV-XIX century books collected by Daniel Sickles. New York (Parke-Bernet Galleries) 1947 (Collection Sickles 1947)
Solacroup – Choix de livres provenant de la bibliothèque de M. E. S. [Antoine Emile Solacroup]. Catalogue de vente aux enchères d’une bibliothèque les 26, 27 et 28 février 1925 à l’Hôtel des Commissaires-Priseurs. Paris (Carteret) 1925. (Catalogue Solacroup 1925)
Verrue – Catalogue des livres de feue Madame la Comtesse de Verruë. Paris (Gabriel Martin) 1737. (Catalogue des livres de la Comtesse de Verrue 1737)
Verrue – Mairé, Béatrice, Les livres de la comtesse de Verrue à Meudon ou les péripéties d’une bibliothèque de Campagne. In: Revue de la Bibliothèque nationale de France, Nr. 12, 2003, La Reliure, S. 47–52 (Mairé, Les livres de la comtesse de Verrue)
Woodhull – Catalogue of the Extensive and Valuable Library Collected at the End of the Last and Beginning of the Present Century by Michael Woodhull. London (Sotheby, Wilkinson & Hodge) 1886 (Catalogue Woodhull 1886)
Register
Unika und Rarissima:
I, II , VIII , XV, XVI , XVII , XVIII , XIX ,
XXII , XXXII , XL , XLI , XLVI , XLVII ,
XLVIII , LVI , LVIII , LIX , LX , LXI , LXII , LXIV, LXIX , LXXI , LXXIII , LXXIV, LXXVI , LXXVII , LXXIX , LXXX
Exemplare auf Pergament oder mit den Tafeln auf Pergament gedruckt:
XXIV, LVIII , LIX , LX , LXI , LXXVIII
Exemplare mit Originalzeichnungen und/oder Originalgouachen:
LVIII , LIX , LX , LXI , LXII , LXXIII , LXXVII
Mosaik- und bemalte Einbände:
IX , XI , XXIII , XXIX , XXXIV, XXXV, LVIII , LXI , LXII , LXXI , LXXVII , LXXX
Exemplare mit kolorierten (aquarellierten oder gouachierten) Illustrationsfolgen:
XXXVI , XXXVIa, XLIII , XLVI , LV, LVIII , LIX , LX , LXI , LXVI , LXVIII , LXXVII
Personenregister
Künstler (K): Illustratoren, Stecher, Zeichner und Maler
Buchbinder und doreurs (B)
Drucker, Verleger und Verlagshäuser (D)
Eigentümer und Händler (E): Besitzer, Sammler, Händler und Auktionatoren
Albert von Sachsen-Teschen, Herzog von Teschen (E – 1738–1822) LXXII
Albrier, Joseph (K – 1791–1863) LVIII , LVIII , LXIII
Allô, Paul Charles (B – 1824–1890) LXX , LXXIV
Atelier des petits classiques, Nachfolge (B – tätig im mittleren 18. Jh.) XXIII
Audran, Benoît der Ältere (K – 1661–1721) I, IIIXIX , XXII- XXXVI , XXXVIII-XLIX , LVI , LXVI , LXXVI
Baillie, Colin Campbell (E – England, erste Hälfte 19. Jh.) XLIX
Barbou, Jean-Joseph (D, Paris) I, II , Anhang A
Barry, Marie-Jeanne Bécu, comtesse du (E – 1743–1793) XXVIII
Baudelocque, Émile Louis Alexis (E – 1796–1863) XXIV
Bédoyère, Henri Huchet, Comte de La (E – 1782–1861) LXII
Belin, Théophile (E – 1851–1921) VI
Beraldi, Henri (E – 1849–1931) LXXX
Berès, Pierre (E – 1913–2008) LXII
Bignon, Armand-Jérôme (E – 1711–1772) VIII
Binet, Louis (K – 1744 – um 1800) LXIX , Anhang J
Bishop, Cortlandt Field (E – 1870–1935) XXXIV, XLV, XLVI
Blanchard, Jacques Auguste (K – 1766 – nach 1832) LVIII , LXIX , Anhang J
Bodoni, Giambattista (D, Parma) LVII
Boisrouvray, Guy de Jacquelot du (E – 1903–1980) LXI
Bonasse, Henri (E – 1899–1984) XLIX
Borde, Adélaïde Suzanne de la (E – 1753–1832) XLIX
Bordes, Antoine (E – Bordeaux, spätes 19./Anf. 20. Jh.) LXX
Bordes, Henri (E – 1841–1911) XIII
Bordes de Fortage, Philippe-Louis (E – 1846–1924) XXXVIII
Boucher, François (K – 1703–1770) LVIII
Boyer, Sieur de La Boissière, Jean-Baptiste-Simon (E – 1690–1763) II
Boyet, Luc-Antoine (B – um 1658–1733) I, VI
Bozérian, Jean-Claude (B – 1762–1840) LX , LXVII , LXXV
Bradel, Alexis-Pierre (B – tätig in Paris, spätes 18./ Anf. 19. Jh.) IV, X
Breslauer, Martin (E – 1871–1940) V, LXXII
Burrus, Maurice (E – 1882–1959) XXXIV
Cagnoni, Gaspare (K – 1774–1840) LVII
Caillard, Antoine-Bernard (E – 1737–1807) X
Calenberg, Heinrich Graf von (E – 1685–1772) XXXII
Capé, Charles-François (B – 1806–1867) LVIII , LXXX
Caylus, Anne-Claude de Pestels, Comte de (K –1692–1765) XXIII , XXV-XXXVI , LII , LIII , LIV, LV, LVIII , LX , LXIV, LXVI , LXXVII , Anhang C, G, H, I
Chaponnière, Jean-François (E – 1919–2005)
XXII , XXIII
Chartraire de Bourbonne, Jean-François-GabrielBénigne (E – 1713–1760) XL
Cochin, Charles-Nicolas d. J. (K – 1715–1790)
XXV-XXXI , XXXIII , XXXVIII-XLIX , Anhang C, D
Colloredo, Rudolph Joseph (E – 1705–1788) LI
Coustelier (D, Verlagshaus, Paris) XIX-XXXVI , Anhang C
Cousin, Charles (E – 1822–1894) XXVII , XXIX
Coypel, Antoine (K – 1661–1722) I, III-XIX , XXII -XXXVI , XXXVIII -XLIX , LII , LIII , LIV, LV, LVI , LVIII , LXV, LXVI , LXXVI , Anhang C, D, G, H, I
Coypel, Charles-Antoine (D, Paris) XV, XVI
Crapelet, Charles (D, Paris) LXXIX , LXXX
Cretté, Georges (B – 1893–1969) XVIII
Cromp, Pierrepont (E – 1732–1797) XXXIII
Crozet, Joseph (E – 1808–1841) XXIV
Cuzin, Francisque (B – 1836–1890) XI , LXXI
Dacier, Sévère (D, Versailles) Anhang H
Dacre, Thomas Barrett-Lennard (E – 1717–1786) XXXI
Dahmen, J. (B – tätig in Amsterdam, spätes 18. Jh.) XLVI
Danyau, Georges (E – 1832–1894) XIV
David, Bernard (B – 1824–1895) LXIX
David, François-Anne (K – 1741–1824) LVI
Debarle (D, Verleger, Paris) LXVI
Debure, Jean-Jacques (E – 1765–1853) XIV
Delaleu, Guillaume Claude (E – 1712–1774) XIX
Delbergue-Cormont, Victorien (E – 1816–1888)
XIII , XLIX
Dent, John (E – 1761–1826) XXIV
Derome, Jacques-Antoine (B – 1696–1760) IV, IX
Derome, Nicolas-Denis (1731–1790) IV, VIII , XIII , XIV, XXXII , XXXIX , LIII
Descamps-Scrive, René (E – 1853–1924) LXXVIII
Desenne, Alexandre Joseph (K – 1785–1827)
LVIII , LXXIII
Desenne, Victor (D, Paris) LXVII
Devaux, Jean-Baptiste (D, Paris) Anhang J Devéria, Achille (K – 1800–1857) LXXX
Didot (D, Verlagshaus, Paris) LVIII-LXII , LXIV, LXIX-LXXVIII
Douceur, Louis (B – um 1721–1769) XXVII , XXXVI , XXXVIa, XLI
Dubuisson, Pierre-Paul (B – tätig um1746 – 1762)
LII
Dupréel, Jean-Baptiste-Michel (K – 1757–1828)
LXVII , LXVIII
Du Villard, Emanuel (D, Amsterdam) Anhang B
Eaton, Stephen (E – gestorben 1834) XLV
Eisen, Charles (K – 1720–1778) XXXVIIIXLIX , Anhang D
Esmerian, Raphaël (E – 1903–1976) LXII
Fétil, René-François (B – um 1725 – um 1799) XXVII
Fokke, Simon (K – 1712–1784) XXXVIIIXLIX , Anhang D
Fontaine, Auguste-Carolin-Jean (E – 1834–1882) LXI
Forbes, James (E – 1749–1819) LIX
Franchetti, Baron Édouard (E – zweite Hälfte 19. Jh.) LXXVIII
Froissart, Ludovic (E – gestorben 1977) XXIII
Frontier, Jean-Charles (K – 1701–1763) Anhang K
Fürstenberg, Hans (E – 1890–1982) LXIII
Galitzin (auch Golitsyn), Michel Petrovich (E –1764 – ca. 1835) LX
Gancia, Giovanni (E – gestorben gegen 1882) LXI
Gérard, François-Pascal Simon, Baron (K – 1770–1837) LVIII , LXIII , LXIV, LXIV, LXX , LXXI , LXXII , LXXIII , LXXIV, LXXV, LXXVI , LXXVII , LXXVIII , LXXX
Godefroy, Jean (K – 1771–1839) LXIV, LXX ,
LXXI , LXXII , LXXIII , LXXIV, LXXV, LXXVI , LXXVII , LXXVIII
Golowkin, Alexis de (E – spätes 18./frühes 19. Jh.)
LX
Gougy, Lucien (E – 1863–1931) XXIV, XXXII
Gruel, Léon (B/E – 1841–1923) LXXIX
Guérin (D, Verlagshaus, Paris) I, II , XIX-XXIV, Anhang A
Guntzberger, Lévy Marx (E – 1788–1863) XXIV
Guy-Pellion, Pierre (E – 1845–1910) III
Hanrott, Philip Augustus (E – 1777–1856) XXIV
Hauck, Cornelius John (1893–1967) XXXIV
Hersent, Louis (K – 1777–1860) LVIII , LXIII , LXXIII
Hirsch, Robert von (E – 1883–1977) XIV
Hoe, Robert (E – 1839–1909) IX , XI , XXIV, XLVI
Huser, Georges (B – 1879–1961) LXII
Imprimerie Royale (D, Paris) III-XIV
Jamot, Paul (E – 1863–1939) XVIII
Janzé, Louis Frédéric Vicomte de (E – 1817–1900)
XLIX
Kieffer, René (B – 1876–1963) LXXIII
Krauss, Georg Friedrich (tätig in Wien, 1. Viertel 19. Jhdt). LXXII
La Bédoyère, Henri Huchet comte de (E – 1782–1861) VII
Ladner, Oscar L. (E – 1873–1963) LXXII
Laferté, Pierre-Antoine (B – gestorben 1769)
XIX , XXXI , XXXIII
Lamy, Pierre-Michel (D, Paris) LVIII-LXII , LXIV
Langlois, Maire André François (E – 1874–1975)
I, XVI , XLVIII
Larcher, Jean Pierre (K – geboren 1795) LVIII , LXXIII
Lassize, Hubert de (E – gestorben gegen 1862) XXIV
Launay Nicolas de (K – 1739–1792) LI
Le Barbier, Jean-Jacques François (K – 1738–1826) LVIII , LXII , LXXVII
Lebeuf de Montgermont, Louis (E – 1841–1918)
VII
Lefrançois, Francisque (E – spätes 19./Anf. 20. Jh.) IX
Lehoucq, Charles-François-Joseph (D, Lille) LXV
Lemonnier, Louis François (B – gestorben 1776)
XII
Leonhardt, Karl Ludwig (E – 1922–2007) V, XXVI
Leroy, Alphonse (K – 1820–1902) LXXX
Lignerolles, Raoul Leonor (E – 1816–1893) X
Locatelli, Giuseppe (K – 1751–1828) LVII
Lortic, Pierre-Marcellin (B – 1822–1892) LXI
Maradan, Claude-François (D, Paris) LXVII
Marais, Henri (K – geboren um 1768) LXIV, LXX , LXXI , LXXII , LXXIII , LXXIV, LXXV, LXXVI , LXXVII , LXXVIII
Marie-Joséphine Louise, Comtesse de Savoie (E –1753–1810) LII
Marillier, Clément-Pierre (K – 1740–1808) LI
Martin, Emmanuel (E – gestorben gegen 1877) LVIII , LXXVIII
Martini, Pierre-Antoine (Pietro Antonio; K –1739–1797) LVIII , LIX , LX , LXI , LXIV, LXXVII
Massard, Jean (K – 1740–1822) LXIV, LXX , LXXI , LXXII , LXXIII , LXXIV, LXXV, LXXVI , LXXVII , LXXVIII
Massé, Jean-Baptiste (K – 1687–1767) LVIII
Massicot, Édouard Désiré (E – 1845–1903) LVIII
May, Paul (E – 1869–1940) XXXI
Maylander, André (B – 1901–1980) LXXVII
Maylander, Émile (B – 1866–1959) LXXVII
Michel, Marius (Henri-François-Victor Michel; B – 1846–1925) IX
Mirabeau, Honoré Gabriel de Riqueti, Comte de (E – 1749–1791) XLV
Miribel, G. de (E – 20. Jh.) IX
Monsiau, Nicolas-André (K – 1754–1837) LXVII , LXVIII
Montalembert, Charles-Forbes-René, Comte de (E – 1810–1870) LIX
Montguyot, Adrien François de (E – 1695–1783) II
Morgand, Damascène (E – 1840–1898) LXII
Motte, Charles Ètienne Pierre (K – um 1784/85–1836) LVIII , LXXIII
Moutard, Nicolas-Léger (D, Paris) LVI
Néaulme, Jean (D, Amsterdam und Den Haag) XXXVII-L, Anhang D-F
Olry-Roederer, Léon (E – 1869–1932) LXII
Padeloup, Antoine-Michel (B – 1685–1758) II , XX , XXIX
Paillet, Eugène (E – 1829–1901) XI
Patris, Charles-Frobert (D, Paris) Anhang J
Pauquet, Jean Louis Charles (K – 1759 – ca. 1824) LXVII , LXVIII
Pavée de Vendeuvre, Guillaume Gabriel (E –1779–1870) XLVII
Philippe II . de Bourbon, Duc d’Orléans (K – 1674–1723) I, III-XIX , XXII-XXXVI , XXXVIII-XLIX , LII , LIII , LIV, LV, LVI , LVIII , LIX , LX , LXI , LXIV, LXV, LXVI , LXXVI , LXXVII , Anhang C, D, G, H, I
Pichon, Jérome-Frédéric (E – 1812–1896) XIX
Piet, Alfred (E – 1829–1901) LVIII
Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, Marquise de (E – 1721–1764) XXI
Porgès, Rose-Anne (E – 1854–1937) XIII
Portalis, Melchior-Roger (E – 1841–1912) XIV, XXIV
Prud’hon, Pierre Paul (K – 1758–1823 in Paris)
LVIII , LXIII , LXIV, LXIX , LXX , LXXI , LXXII , LXXIII , LXXIV, LXXV, LXXVI , LXXVII , LXXVIII , LXXIX , LXX
Rahir, Édouard (E – 1862–1924) LVIII
Renesse, Comtes de (E – 18. Jh.) XXVI
Renouard, Antoine-Augustin (D, E – 1765–1853)
LXI , LXXIX , LXXX
Ribadeau-Dumas, Louis (E – 1876–1951) L
Ribault, Jean-François (K – 1767–1820) LVIII , LXII , LXXVII
Ripault, Armand (E – 1872 – um 1924) XXXIV, XLV, LXVII
Robert d’Orléans, Duc de Chartres (E – 1840–1910) LXI
Robin, Jean Baptiste Claude (K – 1734–1818) LVI
Roger, Barthélemy Joseph Fulcran (K – 1770–1841) LXX , LXXI , LXXII , LXXIII , LXXIV, LXXV, LXXVI , LXXVII , LXXVIII , LXXIX , LXXX
Rosenberg, Alexis von, Baron de Redé (E – 1922–2004) XXXVI
Rothschild, Alain de (E – 1910–1982) XXIX
Rouzeau-Montaut, Jean (D, Orléans) Anhang H
Saint-Aubin, Augustin (K – 1736–1807) LXXIX , LXXX
Salomons, Sir David Lionel (E – 1851–1925) XI , LVIII
Schiff, Mortimer Loeb (E – 1877–1931) XXIX
Scheffer, Charles (E – 19. Jh.) LXII
Schuhmann, Robert (E – 1869–1951) XIV
Scotin, Jean-Baptiste (K – 1678–1740) I-XIV, XXI , XXII , XXXVII-XLIX , L, LI , LVI ,
Anhang A, B, D
Shuter, James (E – gestorben 1826) XLV
Sickles, Daniel (E – 1900–1988) XXIX , LXII
Simier, René (B – 1772–1843) LXXVIII
Société Typographique de Bouillon (D) Anhang G
Suret, Nicolas-Maxime (D, Paris) LXVII
Tolstoi, Michail Michailowitsch (E – Odessa, spätes 19./Anf. 20. Jh.) XXVII
Trautz, Georges (B – 1808–1879) VII
Valade, Jean-Jacques-Denis (D, Paris) LII-LV
Verrue, Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes, Comtesse de (E – 1670–1736) I
Vidal, Géraud (K – 1742–1801) XXIII , LXV, Anhang G
Walther, Henry (B – tätig in London, gestorben1824) LVII
Weiller, Paul-Louis (E – 1893–1993) XIV, XLV
Wendling, Georges (E – 20. Jh.) LXXVIII
Wilhelm, Herzog in Bayern (E – 1752–1837) XXXVII
Woodhull, Michael (E – 1740–1816) LVII
Zierer, Daniel (E – 20. Jh.) XVIII
Zuylen van Nyevelt van de Haar, Étienne van (E – 1860–1934) XXIX