WunderKammer I



Memoriae Matris Meae Sacrum
Gertraud Tenschert
1. August 1924 – 20. Oktober 2021





Memoriae Matris Meae Sacrum
Gertraud Tenschert
1. August 1924 – 20. Oktober 2021

Heribert Tenschert
Antiquariat Bibermühle AG
Bibermühle 1–2 · 8262 Ramsen · Schweiz
Telefon: +41 (52) 742 05 75 · Telefax: +41 (52) 742 05 79
E-Mail: tenschert@antiquariat-bibermuehle.ch www.heribert-tenschert.com
English summaries are given at the end of each description. Detailed translations in English or French are available upon request.
Verfasser: Dr. Carsten Scholz, Dr. h. c. Heribert Tenschert
Prof. Eberhard König (Nr. 2, 3, 4, 5, 7)
Gestaltung, Redaktion, Lektorat: Heribert Tenschert, Maria Danelius
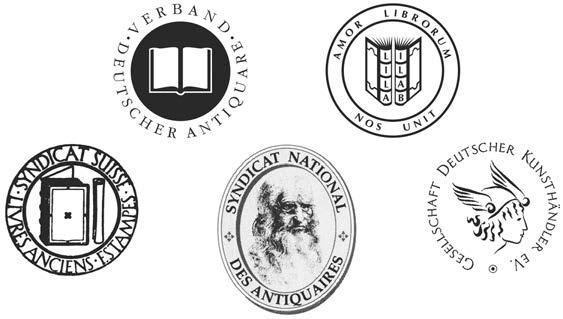
Photos, Einbandgestaltung: Viola Hediger, Heribert Tenschert
Verwendete Drucktype: 1689 GLC Garamond Pro
Satz und PrePress: LUDWIG:media GmbH in Zell am See
Druck und Bindung: Passavia GmbH und Co. KG, Passau
ISBN: 978-3-906069-38-8
Das 16. Jahrhundert ist gleichermaßen Mündung und Ziel wie Quelle und Aufbruch. Die rückenden Formationen von fast anderthalb Jahrtausenden christlicher Kunstübung stoßen an eine erste, ernste Grenze und laden ihre blitzenden Moränen ab, wundersam zutage liegende Brocken Genies aus der Hand Dürers, Raffaels, Tizians und all der anderen, schon in der Sekunde ihres Entstehens da für immer – der Katalog legt dafür Werkstücke von seltener Gewähr vor. Diese früher wie später nie mehr erreichte Prachtergießung teilt der Zeit um 1500 einen Segen aus, der das ganze folgende Säkulum mit seinem pfingstlichen Überschwang tauft, zu sehen noch an unserer letzten Nummer, dem Exemplar des Papstes zu Leben und Taten seiner Vorgänger, das alte Feuer beschwörend, als sei das abgelaufene Jahrhundert nicht ein einziger Proteststurm dagegen gewesen.
Aufbruch und Quelle war das Seizième für so vieles, dass wir uns hier auf die offenbarsten Bezüge und ihre Auswirkungen in der Bibliophilie beschränken müssen; in Stichworten: Luther, Religionskriege, Emanzipation von Literatur und Kunst, Einmischung des Islam, Länder- und Städtedarstellungen mit Realitätsanspruch, (Natur-)Wissenschaften, unverlierbare Fortschritte in Medizin, Technik etc.
Aus all diesen Ingredienzien ist das Gebräu gemischt, das unter dem Namen „Wunderkammer“ als unser neuer Katalog erscheint, entgegen den vielen vorausgegangenen keine eigene Sammlung, denn dafür wären sogar die 125 Nummern zu schmal, sondern einzeln erhältlich und hoffentlich als Gesamtheit trotzdem bestrickend.
„Herz der Bibliophilie“ ist der möglicherweise prätentiös erscheinende Untertitel, der uns angesichts der Frühlingsfeier des Angebots und des Tiefenwerts der meisten Exemplare aber nichts als gerechtfertigt erscheint. Mit zehn Handschriften wird begonnen - ohne Stundenbücher, die als Manuskripte wie als Drucke hereingenommen die Anzahl hoch ins Dreistellige gedrückt hätten – alle zehn von der Vielfalt des nunmehr Möglichen kündend: Literatur, Geschichte, Liturgie, Heraldik und Genealogie der Orden, zwei signierte Handschriften aus Frankreich und Italien von den Grenzen des Möglichen, der kleinste bekannte Koran, und von dem flagranten Mangel an Sittlichkeit in unserer Nr. 8 geht es geradewegs zum Olymp, zur schönsten von Hieronymus Oertl illuminierten Serie der kompletten Kupferstich-Passion von Dürer und schließlich über in ein sprachlos lassendes Mirakel vulkanischer Einbildungskraft desselben einsam großen Künstlers.
Die 21 Drucke auf Pergament verdienten jeweils eigene Bemühung; ich muss mich auf die Prunkreihe von vier in der tausendundeinen Farbe der Glaubensinbrunst illuminierten Missalien auf diesem Material beschränken, derengleichen es, soweit ich sehe, in keinem Katalog des letzten Jahrhunderts gegeben hat (dazu kommen fünf weitere mit dem Kanon auf Pergament, deren Holzschnitte von Burgkmair und Lucas Cranach das unbestritten Beste sind, was diese künstlerischen Grenzüberschreiter im Buch geleistet haben). Nicht zu vergessen den mit Ludwig XII . verbundenen Gaguin von 1500/1501 und den weiteren Text dieses Autors von 1518, in einem einzigen Exemplar für König François Premier gedruckt und illuminiert; noch sensationeller der Folio-Caesar von 1531, den Etienne Colaud mit eigenwertigen Miniaturen ausgestattet hat, aus den Sammlungen Jean de Laval – Anne de Montmorency – Diane de Poitiers - Anna von Bayern – Edward Harley – Lionel, Earl of Dysart – fast die nämliche, an bibliophiler Flughöhe nicht zu überbietende Provenienz zeigte sich schon beim Missale von Langres und dem Gaguin von 1518.
Und dennoch ist das Hauptstück – und eines der anbetungswürdigsten und herzbewegenden Bücher nicht nur des Katalogs, sondern aller Zeiten – die heute nur noch in insgesamt drei weiteren, zum Teil fragmentarischen Exemplaren vorliegende Luther-Bibel auf Pergament von 1558-1561, hier das ausdrückliche Geschenkexemplar des Kurfürsten an seinen Finanzreferenten Johann Pyrner: noch in den ersten machtvollen Einbänden gerüstet für die kommenden Jahrtausende und nach 460 Jahren komplett und mit 175 taufrischen Holzschnitten erhalten wie neu. Eine Trouvaille, wie sie ein Jahrhundert vielleicht einmal an den Tag bringt. Bietet die gerade behandelte Abteilung der Pergamentdrucke womöglich die außergewöhnlicheren Spezimina, so ist die folgende, Illumination und Illustration betitelt, wohl noch überraschender, ein Zeugnis von der Fruchtbarkeit des Gartens Eden. Ich hebe nur den Vergil von 1502 (Nr. 32) heraus, die erste illustrierte Ausgabe der Werke des römischen Nationaldichters überhaupt (und dann gleich mit über 200 pulsierenden großen Holzschnitten) nobilitiert durch einen Mosaikeinband des königlichen Buchbinders Gomar Estienne, der es mit den impeccabelsten Beispielen dieser Art in der BnF aufnehmen kann; unter Nr. 39 folgt zu allem Überfluss eine Lyoneser Ausgabe mit der gleichen Straßburger Holzschnitt-Suite, aber sämtlich in zeitgenössischer Illumination!
Der Leser wird unter Nr. 49 auf das ohne Zweifel schönste illuminierte Exemplar von Leonhard Fuchs’ Kräuterbuch treffen, das der Hofmaler der Königin Maria von Ungarn, Hubert Cailleau, zwischen 1542 und 1552 für einen bislang noch nicht identifizierten Besteller (eventuell die Königin selber?) in unvorstellbar leuchtender Süße und Differenziertheit gestaltete, unter Nr. 59 das in Visionen der Vollendung spielende Exemplar des kompletten Städtebuchs von Braun-Hogenberg (sechs Bände, über fast 50 Jahre hinweg erschienen) vollständig und bis in den letzten Quadratmillimeter in makelloser Original-Illumination erhalten, gebunden in zwei dunkelrote französische Maroquinbände, die aus dem Ganzen ein Geschöpf aus einer anderen bibliophilen Umlaufbahn machen.
Kurz erwähnt soll noch sein das einzige bekannte Exemplar der Erstausgabe von Daniel Specklins Festungslehre, deren Radierungen mit bedachtester transluzider Verve – vom Autor selbst? – illuminiert sind, auch der unikale Boissard in seinem glosenden Kolorit, bevor wir zu einem weiteren „Achttausender“ kommen: Georg Mack der Jüngere, der letzte Nürnberger Illuminator von evidenter Genialität, hat eine Flavius Josephus-Ausgabe mit 132 Gemälden in Gold und Dutzenden Farben bereichert, die aus dem Buch eine Art Traverse durch die schönsten Renaissance-Säle der Eremitage oder der Alten Pinakothek in nuce machen; nie ist mir diese Vollendung der Illumination in gleicher Fülle vor Augen gekommen.
Vieles wäre noch zu rühmen: Georg Hoefnagels komplette „Archetypa …“ von 1592, unauffindbare Ausgaben zur Geschichte der Normandie, zu Gérard de Nevers, vier verschiedene illustrierte Exemplare des Rosenromans, die sinnverwirrenden Wachsfarbenmosaikeinbände zu Cratander, Aristoteles, Terenz, die persönliche Bibel des Heiligen Karl Borromäus, die prachtvollsten Einbände von Jakob Krause außerhalb der Bibliotheken, der größte bekannte Fanfare-Einband auf Christoph Plantins illustrierter Kupferstich-Bibel von 1583, drei frühe Montaigne-Ausgaben: eine davon in einem buchstäblich unvorstellbaren Einband, die drei Unika des Volksbuchs vom Dr. Faust – und selbst diese nicht gerade geizige Aufzählung ist ein Affront gegen die nicht genannten Werke, die auf ihre Weise genau solche Herzkranzgefäße der Bibliophilie sind, wie die genannten. Alles in allem repräsentiert dieser Katalog die Sammeltätigkeit und meine nicht immer gleichmütig ertragene Ungeduld zur endlichen Abrundung über 25 Jahre hin: hat sie sich gelohnt?
Zu Beginn wurde behauptet, das 16. Jahrhundert sei Mündung und Quelle zugleich. Die überraschenden Horizonte, die unser Katalog zieht, scheinen dies zu bestätigen.
Aber spürt man auch, wie das Aufeinandertreffen der Strömungen und Leidenschaften einander nicht übertönt oder verzerrt, sondern zum Schweben bringt und ins Symphonische dreht? Man kann das als Ehren-Charta der Bibliophilie des Jahrhunderts deuten: indem sie ihre wunderwilden Jahrzehnte übersteht, schöpft sie, der Zeit enthoben, aus der Schönheit des Künftigen ihre fortdauernde Geltung.
Bib ermühle, den 28. Februar 2023
H. T.
66 D. Specklins „Architectura von Vestungen”: Das wichtigste Buch zum Festungsbau in deutscher Sprache, von 1589, mit altkolorierten Radierungen: so wohl unikal
67 Der sensationelle Auftritt des Illuminators Georg Mack 1590 in einem bibliophilen Gesamtkunstwerk mit 132 großen, signierten Gemälden über Holzschnitt
68a-d Die bedeutendste flämische Kupferstichfolge zur Bibel im 16. Jahrhundert mit 153 Kupfern, mit den Auslegungen des Jesuiten Hieronymus Natalis (1591-)1593-1596
69 „Natura sola magistra” –Georg Hoefnagels naturkundliches Meisterstück von 1592, komplett mit 52 Kupfertafeln von legendärer Seltenheit
70 Monumentales Magdeburger Missale von 1503: Eines von drei bekannten Exemplaren, im ersten Einband, aus der Sammlung der Herzöge von Bourbon-Parma
71 Unauffindbar:
78 Gott ist rot: Zwingli, Politiano, Duodo – von größter Seltenheit – das dritte bekannte Exemplar? Die Psalmen in H. Zwinglis Übersetzung von 1533, das
80 Eines von zwei bekannten Exemplaren dieses Ritterromans von 1543(?): das Exemplar Guyon de Sardière – Duc de La Vallière – A. A. Renouard – Firmin-Didot
81 Exempla docent? Kaiserviten von 1544 in der Hand eines Frevlers – ein genealogisch auf die Medici anspielender Mosaikeinband: Geschenk Cosimos für seinen Schwiegersohn Paolo Giordano Orsini?
82 Das unvergleichliche Exemplar von Jean-Baptiste Colbert in unberührter Erhaltung: Herwagens griechische Bibel von 1545
83 Die Komödien des Terenz 1545 in einem distinguierten Einband mit reicher Mosaik-Wachsfarbenmalerei, Exemplar der Earls of Sunderland
84 John Bales erste gedruckte britische Bibliographie von 1548 in einem Mosaikeinband für Sir Thomas Wotton aus den Sammlungen Earl of Chesterfield –Earl of Carnarvon – William Moss – Major Abbey - Breslauer
95a-e Fünf Einbände für Jacques-Auguste de Thou von 1582-1643, in verschiedenen Ausführungen und Farben, davon zwei in Folio
96 Plantins Kupferstich-Bibel von 1583 im größten bekannten Fanfare-Einband: das für Jacques-Marius d’Amboise gedruckte Exemplar
96a Plantins Kupferstich-Bibel von 1583: Das Exemplar aus den Sammlungen Louis-Jean Gaignat – M. Wodhull – E. Doheny
97 Montaignes „Essais”, die erste komplette Ausgabe von 1588, ungemein breitrandig, in einem Einband von Pierre-Alexis Bradel 900
98a-c Die Volksbücher von Faust und Wagner: drei unauffindbare frühe Drucke 1589-1596-1597, davon zwei unikal
99a Der sakrosankte Montaigne: das schönste denkbare Exemplar der Ausgabe letzter Hand von 1595, in einem einzigartigen vergoldeten Maroquinband von Lortic 911
99b Montaignes Essais, ein zweites Exemplar der Ausgabe letzter Hand von 1595, makellos erhaltenes Exemplar in einem Einband von Rivière
100 Leben und Taten der Päpste von Ciaconius: Das mit über 1.000 in Gold, Silber und Farben illuminierten Wappen ausgestattete Widmungsexemplar für Papst Clemens VIII. von 1598-1601, aus der Sammlung des Earl of Rosebery und von Roger Peyrefitte

Der einzige Zeuge: Ludwig Sterners Handschrift der Schwabenkriegschronik des Johann Lenz, entstanden 1500 – 1501, der Codex Unicus der bedeutenden Schweizer Dichtung
Sterner, Ludwig. Die Schwabenkriegschronik des Johann Lenz und die Burgunderchronik des Peter von Molsheim, mit Anhängen. [Deutsche Handschrift]. Freiburg im Üechtland, 1500 – 1501.
293 Bl. – Gebunden in 37 Lagen zu 4 Doppelblättern, Ausnahmen: Lage 21 ohne das textlose Anfangsblatt, das als Bl. 293 eingesetzt wurde; Lage 35 mit Verlust von 3 Doppelblättern, diese früh durch leere Bl. ersetzt; Lage 37 (Beilage) aus Einzelblättern zusammengesetzt. – Handschrift auf kräftigem Papier der Papiermühle Marly bei Freiburg im Üechtland, in oberrheinischer Bastarda, in Teil I (Bl. 1-159) einspaltig, in Teil II (Bl. 160-185) zweispaltig, in Braun mit roten Überschriften, teilweise rubriziert.
Mit zahlreichen größeren und kleineren Freistellen für nicht ausgeführte Illustrationen; mit einigen fünfzeiligen Initialen (die erste zweifarbig in Blau und Rot) sowie zahlreichen, meist dreizeiligen, alternierend blauen und roten Lombarden.
Folio (300 x 251 mm; Schriftspiegel: in Teil I ca. 225 x 145/155 mm; in Teil II ca. 230 x 165/170 mm).
Hellbrauner blindgeprägter Schweinslederband der Zeit über abgeschrägten Holzdeckeln auf drei Bünde; auf den Deckeln Rahmenwerk von drei- und vierfachen Steicheisenlinien sowie vier verschiedenen Einzelstempeln (Schriftband »maria«, Palmette, Schwanen- und Rosettenmedaillon), mit zwei Schließen, aus dem Franziskanerkloster Freiburg im Üechtland (begriffen, Rücken, Gelenke und obere Schließe restauriert, Schmutzspuren auf den ehemaligen Außenblättern beider Teile).
Die Eidgenossen als unüberwindliche Kriegsmacht um 1500 – eine unikale Quelle
Diese Handschrift, die »ohne Zweifel zu den wichtigsten kulturellen Zeugnissen der frühen Neuzeit« [Schanze 7] in der Schweiz gehört, befand sich ein halbes Jahrtausend in Schweizer Privatbesitz, ehe sie 1998 überraschend im Antiquariatshandel auftauchte und von Heribert Tenschert erworben werden konnte. In seinem Auftrag erarbeitete Frieder Schanze eine mustergültige Beschreibung nebst Teil-Edition des Manuskripts.
Die deutsche Handschrift verbindet eine Chronik des Schwaben- bzw. Schweizerkriegs von 1499 mit einer Chronik der Burgunderkriege von 1474 bis 1477 und ergänzt beide Werke jeweils durch eine Reihe politischer Dichtungen. »Die Bedeutung der Handschrift liegt zum einen in ihrer Funktion als Überlieferungsträger: Die umfangreiche und literarisch anspruchsvolle Reimchronik des Johann Lenz« über den Schwabenkrieg sowie »nicht weniger als sechs politische Lieder sind allein durch

sie auf uns gekommen, und für fünf weitere Lieder bietet sie immerhin die Erstüberlieferung oder die früheste handschriftliche Bezeugung, darunter das wirkungsmächtige Lied vom Ursprung der Eidgenossenschaft. Zum anderen aber kommt in ihr ein Bewußtsein von der Außerordentlichkeit der beschriebenen Ereignisse zum Ausdruck, und in dieser Hinsicht stellt sie ein hervorragendes, ja einzigartiges Dokument eidgenössischer Historiographie dar«. Allein schon durch die »Verbindung von Burgunderkriegs- und Schwabenkriegschronistik und ihre Verselbständigung gegenüber allen anderen historischen Zusammenhängen« hat der Kompilator »die beiden eindrucksvollsten kriegerischen Erfolge der Eidgenossenschaft im ausgehenden Mittelalter unmittelbar aufeinander bezogen und zu einem großen Ereigniskomplex vereint. Er hat damit ein chronikalisches Konzept verwirklicht, das das Selbstbewußtsein der Eidgenossenschaft als einer nahezu unüberwindlichen Kriegsmacht in der Zeit um 1500 in prägnanter Weise dokumentiert. Aus diesem Grund darf dem Sternerschen Codex historische Signifikanz zugesprochen werden«. Der spezielle Wert dieser Handschrift wurde »lange verkannt«, da sie »zumeist nur als spätere Abschrift eines verlorenen Originals galt«. Erst Schanzes Untersuchung ergab den »unerwarteten Befund […], daß wir es mit dem Original zu tun haben« [Schanze 7].
Ihr Verfasser Ludwig Sterner (um 1470 – 1541) hatte am Schwabenkrieg selbst als Feldschreiber des Freiburger Kontingents teilgenommen und sich 1501 in Freiburg im Üechtland als Notar niedergelassen. »Es ist sicher nicht falsch, wenn man Sterner als einen Gebildeten bezeichnet. Als Notar benötigte er zwar keine akademische Ausbildung, aber er mußte doch über allerhand juristische Kenntnisse verfügen und besaß, wie wohl die meisten seiner Kollegen, ein mehr als gewöhnliches Maß an allgemeiner Bildung« [Schanze 16]. Von 1506 bis 1510 amtierte er als geschworener Schreiber, ehe ihn ein Delikt Ämter und Bürgerrecht kostete, so daß er nach Biel auswich, wo er von 1510 bis zu seinem Tod 1541 Stadtschreiber war. »Wiederholt war er auch in auswärtigen Angelegenheiten tätig und vertrat die Stadt Biel oder den Bischof von Basel auf der eidgenössischen Tagsatzung« [ebd. 15].
Wohl schon »in der zweiten Hälfte des Jahres 1500 hatte Sterner Gelegenheit, die Lenzsche Chronik abzuschreiben«. Johann Lenz war von 1491 bis 1496 Schulmeister in Freiburg gewesen, dann in Saanen im Berner Oberland, wo er die Chronik noch im Kriegsjahr 1499 in Angriff genommen und wohl im Februar 1500 beendet hatte. Ein Exemplar wurde von der Stadt Freiburg angekauft und diente Sterner als Vorlage. Noch während des Kopierens »muß ihm die Idee gekommen sein, die Schwabenkriegschronik mit der Freiburger Burgunderkriegschronik zu einer sinnvollen Einheit zu verbinden« [ebd. 35]. Letztere war eine von dem Freiburger Johanniter Peter von Molsheim im Jahr 1479 angefertigte Bearbeitung der Kleinen Burgunderchronik des Berner Kanzleibeamten Diebold Schilling d. Ä. von 1477, ergänzt um sieben einleitende Kapitel »über die Gründung Freiburgs und Berns und über die weitere Herrschaftsgeschichte Freiburgs«, gestützt auf die Kleine Berner Chronik Conrad Justingers« von 1420, und um drei eigene Kapitel Molsheims über die aktuellsten Ereignisse, nämlich die »Befreiung Freiburg von der Herrschaft Savoyens im Jahr 1477« und die »Erhebung Freiburgs zur Reichsstadt« [ebd. 40]. Sterner kopierte sie »in den letzten Monaten des Jahres 1500, und am 24. Januar 1501 lag auch diese Chronik fertig vor« [ebd. 35; auf S. 34 gibt Schanze versehentlich den »28. Januar« als Datum an]. »Ein Anhang dazu war vermutlich schon eingeplant, er wurde am 16. Februar abgeschlossen und durch einen gereimten Kolophon gekrönt«.

Der Chronologie der Ereignisse entsprechend ist die später entstandene Burgunderkriegschronik der des Schwabenkriegs im Codex vorangestellt. »Ganz zuletzt vervollständigte Sterner den Schwabenkriegsteil durch die Erweiterung des Liedanhangs, so daß zwei ausgewogene Teile zustande kamen«.
Johann Lenz’ Chronik vom Schwabenkrieg steht in zweifacher Hinsicht einzig dar: Zum einen unterscheidet sie sich durch einen literarischen Erzählrahmen wie auch durch eine eminent parteiische »Beurteilung aus eidgenössischer Sicht […] eklatant von allen anderen eidgenössischen Schwabenkriegschroniken«, die sich »weitgehend aufs Erzählen« [ebd. 81] beschränken. Zum anderen ist sie – gerade wegen dieser ›Exzentrik‹? – einzig und allein in Ludwig Sterners Handschrift überliefert. Schon dieser muß gespürt haben, daß sie »etwas Besonderes« [ebd. 84] darstellte.
Frieder Schanze meinte, »wer das Lenzsche Werk mit den Erwartungen liest, die man für gewöhnlich an eine Chronik stellt, wird überrascht und befremdet sein«, und bezog sich dabei zunächst auf den »in gereimten Versen abgefaßten feierlichen Prolog, in dem der Verfasser die himmlischen Mächte um Inspiration und Hilfe bei seinem gedicht bittet«, was, so Schanze, »noch hingehen« mochte. Freilich signalisiert schon dieser verkappte ›Musenanruf‹ einen literarischen Anspruch, der sich in einer kurzen Rahmenhandlung konkretisiert: »Anstatt wenigstens nach dem Prolog gleich zur Sache zu kommen, erzählt der Verfasser erst einmal genüßlich von einem Waldspaziergang, den er im Jahr 1499 unternimmt. Da ihm der Wald unbekannt ist, verirrt er sich und kommt zu einem hübschen Platz, wo an einem von Bäumen bestandenen Bach vielerlei Vögel aufs Herrlichste musizieren« [ebd. 81]. Auch hier, so Schanze vage, fühle man sich »beim Lesen in eine Sphäre versetzt, die mehr mit Poesie als mit Geschichte zu tun hat« [ebd. 81f.]. Tatsächlich liegen die poetischen Vorbilder auf der Hand, verirrten sich doch schon die Protagonisten in Dantes Divina Comedia und Colonnas Hypnerotomachia eingangs ihrer Abenteuer im Wald.
Schließlich weist Schanze auf die Gestaltung des Kriegsberichts als Dialog hin – eine »Art der Inszenierung, die es in der gesamten Chronistik nicht noch einmal gibt«. Denn der Ich-Erzähler, der sich ausdrücklich als Johann Lenz bezeichnet, wandert erst noch an einem Bachlauf bergan und trifft bei einer Gebirgshöhle »auf einen alten, ehrwürdigen Einsiedler, der seit langem keinen Menschen mehr erblickt hat und nicht weiß, was in der Welt vorgegangen ist«, der aber »als wißbegieriger Fragesteller und kluger Kommentator fungiert« [ebd. 82]. Schanze interpretierte dieses kommunikative Setting vom Verfasser aus, der im Grunde »nichts anderes getan [habe], als seine persönliche Situation zu spiegeln: So wie er selbst in der Einsamkeit seines entlegenen Gebirgsortes auf Nachrichten aus der Ferne angewiesen war, die er reflektierend verarbeitete, so bringt im Werk nun er selbst, Johann Lenz, in Verkehrung der Rollen die empfangene Kunde als Erzähler von außen in das Abseits der Einsiedelei, wo entsprechend seinem Gesprächspartner die Aufgabe der Reflexion zufällt« [ebd. 83]. Auch diesen Rollentausch sieht er in der Person des Autors begründet, der »kein Freiburger, sondern, wie er ausdrücklich bekennt, ein Schwabe« [ebd. 71] war, gebürtig aus Heilbronn. Die »Selbstdarstellung als moralisch-religiöse Autorität und dazuhin als Repräsentant wahrer eidgenössischer Gesinnung« verbot seiner Meinung nach »nicht nur die Bescheidenheit, sondern auch die eigene Herkunft«, denn »in einem Werk, das den Krieg zwischen Eidgenossen und Schwaben behandelte, die Stimme des wahren Eidgenossen ausgerechnet aus dem Mund eines Schwaben er-
tönen zu lassen, das war nicht nur unglaubwürdig, sondern unmöglich, selbst wenn der Schwabe sich mit Entschiedenheit als Eidgenosse gebärdete«. Doch rechtfertigte allein das den ungewöhnlichen Konstruktions-Aufwand – zumal Schanze selbst als Gegenbeispiel den Schwaben Schradin anführt, der »als eidgenössischer Propagandist […] seine Herkunft einfach verschwiegen« [ebd. 83] hatte? Aber hat die »paradiesische, gleichsam geschichtslose Naturwelt der Einsiedelei« [ebd. 82f.], in die Rahmenhandlung und Dialogstruktur eingebettet sind, nicht vielleicht doch ein konkretes Vorbild?
Tatsächlich lag dieses sehr nahe – in der Gestalt des Obwaldner Einsiedlers Nikolaus von Flüe (1417 – 1487), der die »wilde Ranftschlucht zu seiner bleibenden Siedelstätte« erwählt hatte, um dort »über 19 Jahre in strengster Askese« zu leben. »Von Nah und Fern strömten Pilger zu dem ›lebenden Heiligen‹, um von ihm Trost und Rat zu empfangen«. In direktem Anschluß an die Burgunderkriege vollbrachte er durch die indirekte Mitwirkung am »Stanser Verkommnis« 1481 eine »pazifistische Grosstat«, wobei »sein Einfluß allein einen drohenden Bürgerkrieg« zwischen den acht alten Orten der Eidgenossenschaft verhinderte und zugleich »den Städten Freiburg und Solothurn den Eintritt als vollberechtigte Kantone in den Schweizerbund öffnete« [HBLS 3, 180]. Gerade für Freiburg bedeutete dies nach der Befreiung von Savoyen und der Erhebung zur Reichsstadt den entscheidenden letzten Schritt zur Sicherung seines politischen Status!
War »nach seinem Tode […] der Name des Bruders Klaus ein politisches Programm schlechthin« [Schanze 181], so wird man ihm in Freiburg in besonderer Weise ein ehrendes Gedenken bewahrt haben. Die Einführung des weisen Einsiedlers in seine Schwabenkriegschronik war insofern gerade kein Bescheidenheitsgestus von Johann Lenz, vielmehr versuchte er, an der Autorität des Schweizer Schutzpatrons zu partizipieren bzw. zu parasitieren: War Nikolaus von Flüe »konsequenter Pazifist«, der sich gegen »jedes Kriegen« [ebd. 180] und alle Reisläuferei ausgeprochen hatte, so trumpft Lenzens Einsiedler mit einem einseitigen Urteil auf. Für ihn »ist der Adel der Urheber aller Zwistigkeiten, und zwar mit seiner Absicht, den Schweizern wieder einen Herrn geben zu wollen. Das muß jedoch mißlingen, weil die Feinde sich gotteslästerlich verhalten und Gott sich dafür an ihnen rächt, indem er den Schweizern zum Sieg verhilft«. Gerade vor dem Hintergrund der Nachwirkung Nikolaus von Flües geben diese »Wertungen und Deutungen […], in denen sowohl die individuellen Auffassungen des Chronisten als auch charakteristische Denk- und Vorstellungsweisen der Zeitgenossen zum Ausdruck kommen« [ebd. 81], der unikalen Abschrift eine ganz besondere Note.
Darüber hinaus hat die Lenzsche Chronik einen »beträchtlichen historiographischen Wert. Sie bietet Fakten und Zusammenhänge in reicher Fülle mit vielen eigentümlichen Details und zeichnet ein eindrucksvolles Bild des gesamten Kriegsgeschehens und der Vorgeschichte seit der Gründung des Schwäbischen Bundes«, dies ungeachtet der »Mängel und Unausgewogenheit der Darstellung, die sich unvermeidlich ergeben, wenn ein Chronist in zeitlicher Nähe zu den Ereignissen schreibt und nur über beschränkte Informationsmöglichkeiten verfügt« [ebd. 80].
Neben Augenzeugenberichten wurden auch »die Lieder von den Chronisten als historische Quellen geschätzt« [ebd. 49] und überliefert. So enthält die Burgunderchronik zwei Stücke des ungemein produktiven Dichters und Sängers Veit Weber, nämlich das Pontarlier-Lied über einen Kriegszug 1475 in burgundisches Gebiet und das Murten-Lied , »das bekannteste und am weitesten verbreitete
Lied über die Schlacht« [ebd. 48] des Jahres 1476. Der Anhang beginnt mit einem Gedicht über die Burgunderkriege des Konrad Pfettisheim nach einem Straßburger Druck von 1477; darauf folgt ein Lied vom Ursprung der Eidgenossenschaft: »Es feiert den Sieg der Eidgenossen und ihrer Verbündeten und enthält darüber hinaus eine der frühesten Bezeugungen der Tellensage« – bei der von Sterner gebotenen Fassung handelt es sich »um die älteste aller erhaltenen Überlieferungen; sie bietet auch den besten Text« [ebd. 58]. Das anschließende Lied über den Züricher Bürgermeister Hans Waldmann und seine Hinrichtung im Jahre 1489 hatte den »Scherer von Illnau« als Verfasser, also einen wortgewandten »Barbierer in Illnau bei Pfäffikon«, und kolportiert die gängige Meinung, Waldmann habe die Stadt dem Kaiser übergeben wollen. »Nach dem Verlust der einzigen Parallelüberlieferung des Liedes muß Sterners Niederschrift als Unicum gelten« [ebd. 66]. Das abschließende Lied über die Macht des Pfennigs von Balthasar Wenck steht »deswegen am Ende des Burgunderkriegsteils, weil bei den dort geschilderten Ereignissen Geld und Gut eine große Rolle spielten und manches nur um ihretwillen geschehen sei. Auf diese Weise wird das moralisierende Lied […] zum zeitgeschichtlichen Kommentar« [ebd. 67]
Im Schwabenkriegsteil finden sich fünf Liedeinlagen: Das Lied gegen die Schweizer vom Wormser Reichstag über das Bündnis der Heiligen Liga 1495 gegen Frankreich und die Eidgenossen ist einmal mehr »nur als Bestandteil der Lenzschen Chronik überliefert« [ebd. 100]. Es folgen das Lied über die Schlacht am Schwaderloh, verfaßt 1499 von dem »Luzerner Pfeifer und Reisläufer« [ebd. 101] Hans Wick, und ein Lied über die Schlacht bei Glurns, bei dem ein Einblattdruck von 1499 »Lenz als Vorbild gedient haben [könnte]« [ebd. 103]. Auch von dem Lied über den Schwäbischen Bund und die Schweizer des Mathes Schantz gibt es einen Einblattdruck von 1499, doch ist es »wegen verschiedener Abweichungen […] relativ unwahrscheinlich«, daß dieser die Vorlage für den Schreiber war. »Das Lied polemisiert scharf gegen die Schweizer und macht zugleich Propaganda für den Schwäbischen Bund als den Hauptakteur im Kampf gegen die Schweizer« [ebd. 107]. Ein Lied über die Schlacht bei Dornach von Johann Lenz ist nur fragmentarisch erhalten.
Wie die Burgunderkriegs-Chronik hat auch die des Schwabenkriegs einen eigenen Liedanhang. Aus dem Jahr 1499 stammt das »kurze, aber brisante« Lied gegen die Bündner, »dessen Überlieferung allein Ludwig Sterner zu verdanken ist«. Aus habsburgischer Sicht polemisiert es »gegen die Stadt Chur, der Verrat an Österreich vorgeworfen wird, gegen den wankelmütigen Bischof von Chur und gegen Bündner Führungspersonen«, wobei das Hauptmotiv »der Bauernspott« [Schanze 110] ist. Es folgt ein weiteres Lied gegen die Schweizer. Das fragmentarisch erhaltene, »ebenfalls nur durch Sterner überlieferte Lied schließt ohne Überschrift unmittelbar an das vorhergehende an, so daß es als dessen Fortsetzung erscheint«. Es ergeht sich gleichfalls in »Polemik gegen die ungeheuerlich hochmütigen Schweizer puren, die sich angeblich auf eine Stufe mit dem Papst und dem Kaiser stellen« [ebd. 111]. Es folgen zwei Lieder über den gesamten Krieg, von dem nur für das erste mit Peter Müller ein Autor namhaft zu machen ist. Es ist »erst nach Ende des Krieges, frühestens nach dem Friedensschluß vom 22. September 1499, entstanden« [ebd. 113]; »Sterners Codex bietet die älteste Überlieferung, doch fehlt am Anfang knapp die Hälfte des Textes« [ebd. 111]. Es stellt »den König als den Urheber des Krieges hin, weil er die Eidgenossenschaft habe unterwerfen und ihr ›einen Herrn‹ geben wollen« [ebd. 113]. Für das zweite, das in der letzten Strophe eine Verwünschung über die Schwaben und
ihren Bund ausspricht, bietet Sterners Codex »die älteste und einzige vollständige Überlieferung« [ebd. 116]. Auch für das abschließende, breit bezeugte Lied über die Schlacht bei Dornach, »dessen anonymer Autor sich in der Schlußstrophe als eidgenössischer Schlachtteilnehmer ausgibt«, stellt Sterners Handschrift »die älteste Überlieferung« [ebd. 117] dar und erweist sich »gegenüber den anderen Zeugen als eigenständige Variante einer verlorenen Urfassung« [ebd. 120]. Insgesamt besitzt das in der Chronik enthaltene politische Liedgut – sechs Lieder unikal, fünf als Erstüberlieferung – einen eigenen bedeutsamen Quellenwert für diese entscheidende Phase der Schweizer Geschichte. Die letzten Blätter des Codex [Bl. 286r-292r] enthalten eine von fremder Hand geschriebene Beilage, die ihrer Entstehung nach nichts mit den übrigen Teilen zu tun hat und erst zwei Jahrzehnte später vor dem Binden des Codex hinzugefügt wurde. Es handelt sich um eine Abschrift des Freiburger Vennerbriefs von 1404 mit dem Nachtrag von 1407. Dies war nun allerdings »ein Rechtstext von grundlegender Bedeutung« für die Stadt. »Nachdem zu den drei älteren Stadtquartieren (Burgbanner, Aubanner, Spitalbanner) aufgrund des Wachstums der Stadt ein viertes, das Neustadtbanner, hinzugekommen war« [Schanze 124], regelte das Dokument »das Wahlverfahren der städtischen Beamten und der Mitglieder des Rates. Die Venner (›Fähnriche‹) oder Bannermeister waren die Vorsteher der Stadtquartiere und der zugehörigen Dörfer der Landschaft, sie hatten für Ruhe und Ordnung und für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen und waren auch für die militärische Führung ihres Quartiers zuständig« [ebd. 125]. Dieses, zu Sterners Zeiten bereits hundert Jahre gültige »Grundgesetz des Freiburger Staates« erinnerte am Ende des Codex an den Ausgangspunkt der politischen Entwicklung, die mit der Aufnahme der Stadt als gleichberechtigter Kanton in den Schweizerbund ihre Vollendung fand und im Schwabenkrieg ihre Feuertaufe bestand. Der Vennerbrief blieb »bis zur Einführung der Helvetischen Verfassung im Jahr 1798« [ebd. 124] in Kraft und war insofern auch für spätere Generationen von Buchbesitzern von Interesse – von sehr speziellem Interesse sogar: Denn er legte auch fest, »daß die Adligen von der Würde eines Venners oder Heimlichers [Vertrauensmanns] ausgeschlossen blieben«. Tatsächlich ist die betreffende Stelle »von späterer Hand unterstrichen und überdies durch die Marginalie NB . (›nota bene‹) hervorgehoben« [Schanze 125, vgl. Bl. 288r] – anscheinend von einem Mitglied der Adelsfamilie von Diesbach [vgl. HBLS 2, 711ff.], in deren Besitz sich der Codex im 19. und 20. Jahrhundert befand.
Was aber geschah mit der Handschrift nach ihrer Fertigstellung? – Völlig fertiggestellt wurde sie gar nicht, was sich in ihrer Überlieferungsgeschichte schon früh als Manko erwies. Denn »es hätten wohl vor dem Binden erst noch die geplanten Illustrationen ausgeführt werden sollen, deren Fehlen besonders bei der Schwabenkriegschronik schmerzlich ins Auge fällt. Um diesen Mangel zu beheben, brauchte man freilich einen geeigneten Künstler und überdies das nötige Geld. Entweder das eine oder das andere oder auch beides scheint nicht vorhanden gewesen zu sein, so daß Sterner einstweilen darauf verzichtete, die Handschrift zum Buchbinder zu geben«. So verwahrte er ihre beiden Teile zunächst »in ungebundenem Zustand« [Schanze 34]. Seltsam ist, daß sie schon bald »nicht mit der Sorgfalt behandelt wurde, die Sterner ihr bei der Herstellung hatte angedeihen lassen. Am Schluß gingen Blätter verloren, und Verschmutzungen zeigen, daß die losen Lagen irgendwo ungeschützt herumgelegen haben müssen. […] Die Vermutung liegt nahe, daß sie in andere Hände kam, als Sterner 1510 dazu verurteilt wurde, alles Schriftgut in seinem Besitz, das einen Bezug auf Freiburg hatte,
auszuliefern«. Später kam sie »wieder zu ihm nach Biel«, wo er drei Jahrzehnte als Stadtschreiber amtete; »vielleicht wurde er damit von der Stadt Freiburg für gute Dienste belohnt, die er ihr, wie es etwa 1521 der Fall war, geleistet hatte«. Gebunden wurde die Handschrift »vor 1524«; daß der Einband jedoch »nicht lange zuvor entstanden sein kann, beweist die Datierung des Papiers, das der Buchbinder verwendete, um die verlorengegangenen Blätter zu ersetzen. Damals wurde dem Codex auch der Freiburger Vennerbrief beigebunden« [ebd. 36]. Dank einer Arbeit von Abraham Horodisch lassen sich die verwendeten Einzelstempel der Werkstatt des Freiburger Franziskanerklosters zuweisen. Das »maria«-Schriftband (Nr. 8, die Palmette (Nr. 26), das Rosettenmedaillon (Nr. 20) und das Schwanenmedaillon (Nr. 38) sind bei ihm abgebildet [Horodisch, Tafel 62f.]. »Fest steht, daß die Handschrift 1524 fertig gebunden in Sterners Besitz war« [Schanze 27].
Wahrscheinlich wurde nach Johann Sterners Tod im Jahr 1541 in Biel seine »Bibliothek aufgelöst«, da ihre wenigen identifizierbaren Reste weit verstreut sind. »Einzelne Bände mögen jedoch bei den Erben verblieben sein, so vielleicht auch die Chronikhandschrift, für die sich einer der Söhne interessiert haben könnte. Sie muß aber spätestens nach deren Tod (Jakob verstarb 1582, Ludwig wahrscheinlich schon vorher) wieder nach Freiburg gekommen sein«. Denn »der erste namentlich bekannte Besitzer nach Sterner selbst war der Freiburger Weibel Michel Lombard […], ein untergeordneter Gerichtsbeamter, und zwar 1567 – 1568 Kleinweibel des Freiburger Neustadtquartiers und 1569 – 1594 Kleinweibel des Burgquartiers. Nach seinem Tod verkaufte seine Witwe 1599 die Chronikhandschrift an […] Wilhelm Techtermann (1551 – 1618) aus einer vornehmen Freiburger Patrizierfamilie, einen humanistisch gebildeten Juristen und einflußreichen Politiker, lange Jahre Staatsschreiber, dann Landvogt von Greyerz, Venner des Burgquartiers und zuletzt Mitglied des Kleinen Rats. Er besaß eine große Bibliothek und legte eine Urkundensammlung von über fünfzig Bänden an. Nachdem der Sterner-Codex in der Techtermannschen Bibliothek eine Bleibe gefunden hatte wird er dort wohl bis ins 18. Jahrhundert aufbewahrt worden sein«. Erst 1845 ist der Besitz des Codex durch die Freiburger Familie von Diesbach nachweisbar; »wie er dort hingeraten ist, kann nicht gesagt werden« [Schanze 36]. Ein Zweig der 1434 von Kaiser Sigismund nobilitierten Berner Familie war nach der Reformation nach Freiburg übergesiedelt [vgl. HBLS 2, 711f.], insofern sie durch den Adelsstatus stets in einer gewissen Außenseiterposition verblieb, handelte es sich bei dem Erwerb der Chronik auch um eine Art sekundärer ›Aneignung‹ von Geschichte. Diese Ambivalenz zeigt sich exemplarisch an der Person von Fréderic Henri de Diesbach (1818 – 1867), der von 1841 bis 1844 »Offizier im Dienste Oesterreichs« [ebd. 715] gewesen war, bevor er 1845 die patriotische Handschrift in Freiburg »in der 1840 gegründeten Historischen Gesellschaft« vorstellte. Noch befand sie sich »in der Diesbachschen Familienbibliothek« [Schanze 37] als gemeinsames Gut, doch war Fréderic Henri »der letzte Inhaber des Familienmajorats, das am 16.1.1849 abgeschafft und am 9.2.1850 zwischen den Gliedern der Torny-Linie verteilt wurde« [HBLS 2, 715]. Die geschah interessanterweise gleichzeitig mit der Publikation des Schwabenkriegsteils durch Fréderic Henri im Druck: Während man – im unmittelbaren Anschluß an den unseligen innerschweizerischen Sonderbundskrieg von 1847/48 – die öffentliche Bedeutung des Werkes erkannte, wurde die Handschrift selbst nun endgültig ›privatisiert‹. Fréderic Henri vererbte sie an seinen Sohn Max de Diesbach (1851 – 1916), der sie als Historiker und Direktor der Freiburger Kantonsbibliothek
zur Genüge zu würdigen wußte. Doch anscheinend seit Ende der 1950er Jahre »wurde die Diesbachsche Bibliothek immer wieder durch den Verkauf wertvoller Handschriften in ihrem Bestand geschmälert« und »denselben Weg ist dann wohl auch der Sterner-Codex gegangen« [Schanze 37]. Den ihm zukommenden würdigen Platz im kulturellen Gedächtnis der Schweiz muß er noch finden.
Provenienz: Auf dem hinteren Spiegel: »Ach du min Ludwig [/] Du klehempst mich [/] Sterner 1524«, unterfangen von Sterners Handzeichen; ähnlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel. – Im späten 16. Jahrhundert im Besitz von Michel Lombard, Weibel in Freiburg im Üechtland, von dessen Witwe an Wilhelm Techtermann, ebendort: Auf dem vorderen Spiegel dessen Exlibris mit den handschriftlichen Initialen »W. T.« und dem Erwerbungsjahr »1599«, wie auch auf Bl. 1r vermerkt (das Exlibris wurde erst 1608 gestochen). – Auf dem vorderen Spiegel lateinische Sentenzen wohl des 16. Jahrhunderts, auf dem hinteren Notizen und Federproben von zwei Händen des 17. Jahrhunderts, u. a. »Caspar« und »item ist mir schuldig der erßam Peter Ganzhagel«. – Wohl bis ins 18. Jahrhundert in der Techtermannschen Bibliothek, danach zwischenzeitlich in Bern. – Spätestens ab 1845 im Besitz der Freiburger Familie Diesbach; auf dem vorderen Spiegel oben links durchgestrichen »Villars«, d. i. Villars-les-Joncs bzw. Uebewil, ein Schloß der Familie; der Name Diesbach auch in Bleistift auf dem Vorsatzblatt. Fréderic Henri de Diesbach (1818 – 1867) veröffentlichte 1849 die Schwabenkriegschronik und mehrere Lieder. – Max de Diesbach (1851 – 1916) – Schweizer Privatsammlung.
Literatur: Schanze. – Zum Einband vgl. Horodisch, Tafel 62-63. The manuscript, written by the notary Ludwig Sterner in Fribourg/Switzerland in 1500 and 1501, contains Peter von Molsheim’s chronicle of the Burgundian Wars from 1474 to 1477 and – uniquely preserved here – Hans Lenz’ rhyming epic chronicle of the »Schwabenkrieg« of 1499, supplemented by a series of political songs that have also uniquely or for the first time been presented here. In addition to its documentary value, the manuscript, by combining both events, represents an unrepeatably exceptional testimony to Swiss/South German historiography, in which the self-confidence of the Confederation as an almost insurmountable war power in the period around 1500 is expressed in a concise manner. See the full facsimile published by us and its scholarly commentary volume.

Graduale festivum . [Vom Andreastag bis zum Commune Sanctorum, für franziskanischen Gebrauch. Lateinisches Manuskript]. Ferrara, Nachfolger von Cosmé Tura, etwa 1500 – 1505.
214 gezählte Bl., dazu 1 nicht zugehöriges Blatt aus einem anderen Chorbuch als Vorsatz vorn, hinten eingeklebt ein nur halb so großes Papierblatt mit 6 Zeilen eines franziskanischen Chorgesangs zu Ehren des Antonius von Padua. – Gebunden in 26 Lagen zu 8 Blatt, mit einem Ternio als Endlage (276). – Handschrift auf durchweg sehr kräftigem Pergament, das in der Farbigkeit der hellen Fleischseite deutlich von der dunkleren Haarseite abweicht, in Schwarz und Rot, in Gotico-Rotunda, zu 5 Zeilen aus Notation auf vier Notenlinien und Text; waagerechte Reklamanten regelmäßig.
3 große, in Gold und Farben illuminierte Bildinitialen von einem Nachfolger von Cosmé Tura, die Anfänge der einzelnen Abschnitte mit prächtigen Federwerk-Initialen, Versanfänge mit großen Lombarden auf Federwerk abwechselnd in Blau auf Rot und in Rot auf Violett.
Imperial-Folio (595 x 410 mm, Schriftspiegel 392 x 272 mm, mit darüber und darunter hinausragenden Formen).
Brauner Kalblederband der Zeit über Holzdeckeln auf fünf neuere (statt ursprünglich acht) Lederbünde; der wohl von Beginn an aus zwei Brettern gefügte Vorderdeckel zusammengehalten durch mit je 14 Nieten befestigte Eisenbänder, mit den zwei äußeren Eckbeschlägen, der Hinterdeckel mit den zwei äußeren Eckbeschlägen, dem Mittelbeschlag und den beiden nach außen gestellten kleineren Beschlägen (Bezug nur in Teilen erhalten, einige Beschläge fehlen, die an den Blatträndern aufgeklebten Verweisschildchen aus Makulatur eines Drucks aus dem späteren 16. Jh. abgeschnitten und auch sonst stark in Mitleidenschaft gezogen, auf Bl. 213 der untere Randstreifen abgeschnitten, mit Nachträgen und Gebrauchsspuren, Miniaturen farbstark und ungestört).
Mit drei großen, in Gold und Farben illuminierten Miniaturen
Viele sind berufen, und am Sterbebett Marias kommen der Legende nach alle zusammen – wie in der Miniatur auf Blatt 58 in diesem Graduale: Die in die Welt verstreuten Apostel haben sich eingefunden, um Marias Hinscheiden zu begleiten. Einer von ihnen, wohl Petrus, liest die Sterbeliturgie, der jugendliche Johannes steht ihr zu Füßen, die Menge der übrigen Apostel verliert sich im Hintergrund, während über ihren Köpfen, gemalt in Gold-Camaïeu auf tiefdunklem Blau, Jesus seine Mutter im Himmel empfängt, umgeben von in alle Richtungen ausgehenden Goldstrahlen, die an einen Kreuznimbus denken lassen.
Wenige sind auserwählt – diesen Eindruck vermittelt das mit wunderbarer Delikatesse gemalte Initial-Bild auf dem ersten Blatt der Handschrift: Rechts am Rand, am Ufer des Sees Genezareth steht
Jesus, und streckt seine Hand segnend in Richtung der beiden Fischer Andreas und Petrus in ihrem Kahn aus. Die Brüder sind in geradezu gegensätzlicher Individualität geschildert: Andreas, in rotem Gewand, steht hoch am Heck und hält das Ruder; der in dunkles Blau gekleidete Petrus kniet im Bauch des Bootes und beugt sich über die Reling, um das vom Fang schwer gewordene Netz einzuholen. Dennoch hebt er bereits den Kopf seitlich zu Christus, während Andreas noch starr nach unten schaut. Zwei ungleiche Brüder werden Menschenfischer. Die feine Sensibilität des Malers spiegelt sich auch in Wellen und Wolken, pflanzt sich fort über die detailliert erfaßte Uferbegrünung und greift schließlich aus in die großen plastischen Formen des Randschmucks.
Von der Berufung der ersten Jünger zieht der Buchmaler mit einer dritten Miniatur eine direkte Linie zu einem später Auserwählten: Viermal so groß wie das Bild zu Mariä Himmelfahrt ist die Initiale G auf Blatt 79: Sie zeigt zum Fest des heiligen Franziskus, in freier Landschaft und vor bewölktem Himmel, dessen Idealporträt. Streng ins Profil gewendet, blickt Franz von Assisi mit frischen jugendlichen Gesichtszügen ins Weite, eingerahmt von einer vegetabilen Bordüre in saftigen Buntfarben von besonderer Leuchtkraft und Intensität, mit Ausblühungen nach links, die seiner Blickrichtung folgen. Durch den Wechsel des Bildkonzepts von ganzfigurigen Szenen zum großen Profilporträt kommt der Betrachter dem Heiligen unversehens nahe, doch deutet dessen unbewegter Blick in die Ferne zugleich auf hieratische Distanz.
Dies war zweifellos die Intention des Malers, in dessen hochklassiger Franziskus-Miniatur wir auch seine eigene Visitenkarte erblicken. Sie erinnert an das berühmte Profilportrait der Eleonora von Aragon aus der Cornazzano-Handschrift M 731 der Morgan Library in New York, das einem Fortsetzer von Cosmé Tura (um 1430 – 1495) zugeschrieben wird, dem Hofmaler der Este in Ferrara und Begründer der sogenannten Ferrareser Schule [vgl. Visser Travagli 232f.]. Auch unsere monumentale Handschrift ist wohl im engsten Umfeld des wenige Jahre zuvor verstorbenen Cosmé Tura in Ferrara um 1500 – 1505 entstanden, mit einem hohen Sinn für Repräsentation in formaler wie stilistischer Hinsicht, für den liturgischen Gebrauch eines bedeutenden italienischen Franziskanerklosters – das sich von den Anfängen des Bettelordens denkbar weit entfernt hatte. Das komplett und gut erhaltene Graduale enthält auf 214 Blättern Notation und Text liturgischer Gesänge im Verlauf des Kirchenjahrs für die wichtigsten Heiligentage und, vom Umfang her noch gewichtiger, den gesamten Bestand für das Commune Sanctorum, entsprechend der Ordnung der Litanei von den Aposteln zu den Jungfrauen absteigend. Auf einem franziskanischen Kalender gründet die Auswahl der Heiligen; das hier enthaltene Fest der Verklärung Christi (6.8.) wurde erst 1457 von Papst Calixtus III . in den Kalender aufgenommen. Das als Vorsatz vorgeschaltete Blatt stammt aus einem ähnlichen Chorbuch, das nicht identifizierte Fragment nimmt Bezug auf Antonius von Padua und vielleicht auch auf einen weiteren franziskanischen Heiligen, Ludwig von Toulouse; das nachgebundene Papierblatt enthält Zeilen eines franziskanischen Chorgesangs zu Ehren des Antonius (»Alleluja. Alleluja, Antoni compar inclite«). Auf dem letzten Blatt wurden im 17. Jahrhundert Tabellen zur Auffindung einzelner Texte in dem Band nachgetragen.
So wie das Kirchenjahr von der hierarchischen Ordnung seiner Feste geprägt ist, so beachtet die sorgfältige Handschrift hierarchische Strukturen auch im Text: Die einfachen Initialen reihen sich

mit ihrem Farbwechsel und dem Federwerk, das sich fast ganz auf senkrechte Linienbündel im Zentrum der Buchstaben konzentriert, in die allgemeine oberitalienische Tradition ein. Sehr viel subtiler und auffälliger sind die großen Initialen zu den jeweiligen Heiligentagen und Festen: Sie liegen in einem teppichhaften Lineament, das entweder in Rot oder Blau gehalten und von Elementen in der Gegenfarbe durchwoben ist; diese Binnenform umgibt eine breite Borte in der Gegenfarbe, die ihrerseits wieder in kleinen Zierelementen mit der jeweiligen Gegenfarbe spielt. Die Borte schafft ein prachtvolles Quadrat, das oft Mühe hat, nicht mit den darüber oder darunter liegenden Linien der Notation in Konflikt zu geraten. Wie entschieden sich die Initialen von anderem mehr oder weniger zeitgenössischen Dekor abheben, belegt der Vergleich mit den beiden Federwerk-Initialen auf dem vorn eingefügten fremden Blatt: Dort herrscht ähnlich der Wechsel von Rot auf Blau und Blau auf Rot, doch werden die Initialen von einem dichten Kranz spitzig auslaufenden Federwerks ganz anderen Charakters umgeben. Die stärksten Akzente setzt das der ferraresischen Hofkunst entsprungene franziskanische Graduale festivum mit den drei auf höchstem Niveau illuminierten Bild-Initialen, und hier insbesondere mit dem hinreißend schönen, monumentalen Porträt des Ordensgründers Franz von Assisi. Die Dialektik von Einmaligkeit und Wiederholung, von Allgemeingültigkeit und Ausnahme, die das pulsierende Leben der Kirche auf der Höhe ihrer Macht spüren läßt, prägt die Ausstattung dieser glanzvollen Handschrift insgesamt.
Provenienz: Angefertigt in Ferrara für ein italienisches Franziskanerkloster.
Literatur: Visser Travagli 232f.
This monumental ceremonial gradual for Franciscans, illuminated on parchment, was made around 1500 - 1505 in Ferrara. The creator of the three high-class miniatures was a close and very gifted assistant of the founder of the School of Ferrara, Cosmé Tura. In particular, the large profile portrait of Francis of Assisi conveys an aura of courtly and hieratic distance, which stands in peculiar tension to the original ideals of the mendicant order. The splendid manuscript is complete and well preserved in its old binding (this one lacking the calfskin used for the covers).


Wappenbuch mit Erläuterungen zur Geschichte des Ordens vom Goldenen Vlies und dessen Souveränen bis zu Kaiser Karl V. [Französisches Manuskript]. Flandern, 1531 oder kurz danach.
16+1 28 316 4-510 66+1 = 58 Bl. – Gebunden in ungewöhnlicher Lagenordnung, letztes Blatt ursprünglich als festes Vorsatz. – Handschrift auf Pergament, in schwarzer Fraktur, Zeilenzahl schwankend, auf den Wappenseiten mit je zwei Zeilen, zweispaltig über jedem Wappenbild, mit grauer Reglierung.
Fünf ganzseitige Miniaturen mit Vollbild und fünf ganzseitigen Zierseiten für Motto, Wappen und Helmzier, ohne Bordüren (blaue Fonds der Miniaturen wohl später ergänzt); eine siebenzeilige Initiale in Gold auf grünem Grund und goldener Einfassung; 189 überreich illuminierte Wappen von Rittern des Goldenen Vlieses mit der Halskette und der jeweiligen Helmzier, jeweils gepaart zwischen in Pinselgold gemalten Säulen in Renaissance-Dekor; einzeilige Initialen als Goldbuchstaben auf roten und blauen Flächen; Zeilenfüller entsprechend.
Folio (295 x 205 mm; Textspiegel: 198 x 121 mm).
Brauner Ledereinband mit Silberprägung des mittleren 16. Jahrhunderts auf fünf sichtbare Bünde.
Ein perfekt erhaltenes, vollständiges und rätselhaftes Exemplar
Der Orden vom Goldenen Vlies war 1430 vom burgundischen Herzog Philipp dem Guten eingerichtet worden; er steht in der Tradition der mittelalterlichen Ritterorden, in denen sich ein Souverän seine Getreuen und Verbündeten besonders verpflichtete. Die meisten Gründungen dieser Art haben ihren Stifter nicht lange überlebt, weil sie zu offensichtlich an nur eine Person gebunden waren. Doch die Habsburger setzten die burgundische Tradition fort und behielten sie auch nach der Trennung des Hauses in eine spanische und eine österreichische Linie in beiden Häusern bei, so daß der Orden heute noch in zwei Zweigen besteht.
In der Auseinandersetzung mit dem französischen König Karl VII . wollte Philipp der Gute eine entschlossene Gefolgschaft um sich scharen; deshalb verlangten die Statuten, daß man keinem zweiten Orden angehören durfte und die Kette ständig zu zeigen hatte. Die wechselnden Koalitionen in den kriegerischen Auseinandersetzungen bis weit ins 16. Jahrhundert hinein führten jedoch auch dazu, daß Mitglieder wieder ausgeschlossen wurden. So legte man Bücher wie dieses an, die in einzelnen Kapiteln die Abfolge der Souveräne und die Aufnahme ebenso wie den Tod oder die Verstoßung Einzelner dokumentieren und durch die sichtbaren Wappen mit der Helmzier in vollen Farben jedem Mitglied helfen sollten, die anderen hohen Herren und ihre Gefolge sofort zu erkennen.
Ein Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies von 1531, in imperialer Pracht auf Pergament illuminiert, eventuell für Kaiser Karl V. selbst?
Katalognummer
Wann die Kodifizierung in der hier vorliegenden Form erfolgte, läßt sich nicht genau bestimmen. Sie folgt recht genau eingehaltenen Regeln: An eine kurze Einführung schließt sich die Reihe der burgundischen Herzöge und deren habsburgischer Erben an. Vielleicht aus der Tradition der Gebetbücher, die mit Doppelseiten zur Eröffnung der wichtigsten Textanfänge aufwarteten, stammt der Gedanke, die einzelnen Souveräne in einem Vollbild auf Verso einer als Incipit-Seite zu verstehenden Malerei gegenüberzustellen, auf der die Devise mit dem Wappen und der Helmzier den Namen des einzelnen Herrschers ersetzt; dann folgen kurze Erläuterungen zu dessen Führung des Ordens und jeweils nach Ordenskapiteln getrennt die Wappen der Ritter.
Fünf Bildnisse zeigen die beiden letzten Herzöge von Burgund, Philipp den Guten und Karl den Kühnen, und die drei Habsburger Maximilian I., Philipp den Schönen und Karl V. auf schmalen Bodenstreifen vor blauem Grund, was einen prächtigen Effekt gegenüber dem roten Grund der ganzseitigen heraldischen Malereien schafft. Die Herrscher tragen selbstverständlich das ihnen zukommende Ordensornat: Tunika und Mantel in purpurnem Samt, der Mantel weiß gefüttert; dazu eine Sendelbinde aus dem gleichen Stoff. Die Mäntel sind kunstvoll geschlungen und abweichend vom Ornat wie weite Glockenkaseln geschnitten. Tatsächlich hat man die Mäntel nur leicht über die Schultern ragend aus rechteckigen, zu den Seiten offenen Stoffbahnen gefügt. Der Maler kannte das Ornat also entweder nur vom Hörensagen oder er versetzte die dargestellten Herrscher absichtlich in Draperien, bei denen es mehr auf die Wucht des Eindrucks ankam.
Das Ordenskapitel, das 1531 in Tournai getagt hatte, ist Ansatzpunkt für dieses Werk; allerdings fehlen drei damals ernannte Ritter. Ein Fehler unterlief dem Schreiber, indem er auf Blatt 53 »Guillaume Conte de Nassou« auftreten ließ, ausgerechnet einen Protestanten, der 1533 die Reformation in Nassau-Dillenburg einführte. Gemeint ist vielmehr dessen Bruder Heinrich III . von Nassau (1483 – 1538), der seit 1505 Ordensmitglied war, an der Erziehung Karls V. beteiligt war und 1515 – 1521 für die Habsburger als Statthalter von Holland und Seeland amtiert hatte. So zeugt der Band entweder von einer nicht ganz übersichtlichen Situation in der Geschichte des Ordens oder von einer gewissen Distanz bzw. Internationalität von Schreiber und Maler.
Dies zeigt sich auch in dem anspruchsvollen künstlerischen Stil: Die Porträts befreien sich im Vergleich mit früheren Wappenbüchern des Ordens von der knappen Form; in der Draperie wie in den Gesichtern herrscht eine Großzügigkeit, die einen eigenständigen künstlerischen Duktus verrät, dem es überhaupt nicht darauf ankommt, einem streng auf die spätgotische Ästhetik festgelegten Vorbild gerecht zu werden. In der Tradition gotischer Maßwerkschleier werden die oberen Ecken, teilweise auch die unteren mit goldenem Blattwerk verziert, das allerdings ganz in Renaissance-Formen gehalten ist. Entsprechend sind die Leistenrahmen von niedrigen Dreiecksgiebeln, in die Muscheln einbeschrieben sind, bekrönt; auch die Konsolen unten und das krautige Laub, das oben zur Bekrönung dient, verrät den Willen, mit italienischer Dekoration mithalten zu wollen. Vergleichbares findet sich in der Schrift: Sie löst sich von den Beschränkungen der burgundischen Bastarda und entwickelt Formen, die fast schon zur Fraktur gehören. Die Initialen und Zeilenfüller stehen in der gotischen Tradition; die Balustersäulen als Rahmung der Wappenschilde zeigen hingegen, wie entschieden sich die Renaissance hier durchzusetzen versucht und wie die Form dann rasch in einen krautigen







Manierismus umschlägt. Das erschwert die Zuordnung des Werks. Man spürt den Einfluß neuerer manieristischer Tendenzen und verliert dabei zugleich das Zutrauen in eine allzu eng auf Flandern, vor allem auf Simon Bening konzentrierte Zuschreibung. Die Ritter kamen keineswegs alle aus dem flämischen Raum. Es ist nicht einmal unmöglich, dass eine solche Handschrift möglicherweise entweder im Rheinland oder gar in Oberitalien (Genua?) entstanden gedacht werden kann. Das wäre durchaus in größter Nähe zum Ordenssouverän der Zeit, Karl V., geschehen, und bezeugte die Internationalität des Ordens und der künstlerischen Ambitionen der 1530er Jahre.
Dieses auf Pergament illuminierte Wappenbuch ist ein durchaus rätselhaftes, vor allem aber in seiner Pracht überwältigendes Stück: vollständig und ausgezeichnet im ersten Einband erhalten, dürfte es das letzte vergleichbare Prachtmanuskript eines Armorials in Privathand sein.
Provenienz: Eventuell für Andrea Doria, Fürst von Melfi, einen jener Ritter, die von Karl V. 1531 in Tournai in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen wurden und dessen Wappen hier als letztes ausgeführt erscheint, oder aber, angesichts des außergewöhnlichen Luxus der Herstellung, möglicherweise eines der Exemplare, die für den Souverän Karl V. selbst gedacht waren.
Literatur: vgl. die Ausstellungskataloge Exposition de la Toison d’Or à Bruges, La Toison d’Or, Trésors de la Toison d’Or.
The Armorial of the Order of Knights of the Golden Fleece, illuminated in imperial splendour on parchment and preserved complete in a 16th century binding, was created on the occasion of the chapter held in Tournai in 1531, possibly for Andrea Doria, Prince of Melfi, who was admitted to the Order at that time, or for Emperor Charles V himself. It contains 189 coats of arms (five full-page) and five full-page portraits of the Order’s sovereigns, from Philip the Good to Charles V, all of them illuminated in the most overwhelming manner. The stylistic freedom and the artistic level of the manuscript, which oscillates between late Gothic and Renaissance, indicate that it was created in the immediate vicinity of Charles V, be it in Flanders (workshop of Simon Bening?) or even in Northern Italy, and at the same time testifies to the Order’s internationality.

Evangelistar. Secundum usum romanum. [Perikopenbuch für das Kirchenjahr, nach römischem Gebrauch. Lateinisches Manuskript]. Paris, 1545.
2 Bl. (Vorsätze), 50 gezählte Bl., 5 Bl. (Vorsätze) – Gebunden vorwiegend in Lagen zu 8 Blatt, davon abweichend die letzte Textlage 74 und die Vorsätze. – Handschrift auf Pergament, in Textura, zu 28 Zeilen in zwei Kolumnen, in Rot regliert; die Endzeilen oben und unten zum Rand ausgeführt.
54 Bilder, davon 2 große, über zwei Kolumnen ausgreifend und 18 Zeilen hoch; 23 spaltenbreite Miniaturen, 8-10 Zeilen hoch, jeweils mit Bordürenstreifen aus Blumen und Akanthus außen; 26 meist fünfzeilige Bildfelder in Initialen und 3 Camaïeu-Initialen mit antikischen Akten, alles vom Meister des Jean Hubert und seinem Atelier illuminiert; ferner 101 Prachtbuchstaben in unterschiedlichsten Formen aus Akanthus, Blumen und Flechtwerk vor farbigen Gründen; Versalien gelb laviert.
Royal-Folio (395 x 258 mm; Textspiegel: 256 x 171 mm).
Weinroter Maroquinband des 18. Jahrhunderts auf sechs erhabene Bünde, mit goldgeprägtem Rückentitel im zweiten und dritten Feld sowie reicher Vergoldung mit zentralen Blumenstempeln, umgeben von Goldpunkten, in Zackenbordürenrahmen in den übrigen Rückenfeldern; die Deckel mit dreifachem Goldfiletenrahmen und kleinen Eckfleurons, von Derôme.
Traditionsbewußte Malerei und Schreibkunst im Umkreis des französischen Königshofs
Dieses prachtvoll illuminierte Manuskript aus dem Coelestinerkloster Quinze-Vingt in Paris, im Kolophon auf das Jahr 1545 datiert, verrät in vielerlei Hinsicht eine Rückbesinnung auf mittelalterliche Traditionen des kirchlichen Buchwesens. Wie ein altehrwürdiges Evangelistar bietet die großformatige Handschrift die Perikopen für den Lauf des Kirchenjahres; freilich sind die Lesungen aufgeteilt in die beweglichen Feste im Temporale und die datumsgebundenen im Sanctorale.
Die Schrift, eine Textura, war mit ihren steilen gotischen Lettern um 1545 schon entschieden antiquiert, so daß ihre Wahl für eine solche Prachthandschrift als bewußter Rückgriff verstanden werden muß. Der Schreiber beherrscht die alte Schrift vorzüglich und verfügt über einen großen Formenschatz an Versalien, die in der Textura besondere Pracht entwickeln. Zwar wirken die Buchstaben recht geräumig; doch macht er keinerlei Kompromisse gegenüber der zeitgenössischen Ästhetik, die kleine rundliche Schriften gewohnt war. Seiner Leistung war er sich sehr bewußt: Johannes Holand,
Mit 45 Miniaturen prachtvoll vom Meister des Jean Hubert illuminiertes Evangelistar der Pariser Coelestiner, signiert und datiert 1545 von Johannes Holand, aus der Sammlung des Duc de la Vallière

der zugleich Prior des Klosters war, nennt sich stolz am Ende und in Zierbuchstaben auf Blatt 16v: »sanctus Petrus celestinus / frater iohannes prior 1545«. Selbstverständlich wirkte er auch als Rubrikator; welchen Beitrag er indes zu den gemalten Buchstaben leistete, läßt sich nicht bestimmen; immerhin legt seine »Signatur« nahe, daß er wenigstens teilweise für sie verantwortlich war.
In den Initialen wird die Summe aus den Erfahrungen der französischen Buchmaler mit der gesamten europäischen Buchkunst der Renaissance gezogen: Die Buchstaben entstehen aus Flechtwerk, aus Akanthus, wie er in Italien entwickelt, in Flandern aber noch weiter gebracht worden war, und aus Knotenstöcken, die eher im Norden beliebt waren. Köpfe, antikische Masken und Grotesken beleben die Initialen. Ihr Fond mag einfach mit quadriertem Muster versehen sein, kann spätgotische Spiralen, Akanthusblätter, flämisch wirkende Blumen ebenso wie ihre stärker stilisierten französischen Verwandten enthalten. Freie Zierbuchstaben sind hingegen in farbigem Camaïeu gehalten, also jener Technik, die gerade in Frankreich ihre schönste Blüte im 16. Jahrhundert erlebte, und zeigen antikische Akte, Soldaten und Pferde.
Recht erstaunlich wirken die Bordürenstreifen, die alle Bilder begleiten; sie verraten aufmerksames Studium älterer französischer Handschriften und dann doch eine kreative Auseinandersetzung mit dem dort vorzufindenden Material: Nach außen durch eine feste Kante abgegrenzt, schließen sie an den offenen Rändern mit spiralig geführten Blättern. Gefüllt sind sie mit Blütenzweigen und Akanthus auf kleinen Resten des Tintenwerks, das ursprünglich für Dornblattspiralen diente. Gäbe es nicht, beispielsweise neben dem Großbild auf Blatt 21v, Kompartimente mit plastisch durchgestaltetem Akanthus, der die extrem späte Zeitstellung verrät, könnte man die kräftig bunten Bordüren unserer Handschrift um die Mitte des 15. Jahrhunderts datieren.
Außerordentlich ist die Qualität der Buchmalerei, die auf französischen Vorstufen im Bereich der Hofkunst der sogenannten 1520er Werkstatt fußt, die eine Generation zurückliegt. Die allermeisten Miniaturen stammen aus der Hand des Meisters von Jean Hubert, so genannt nach einem Leben Marias aus der Sammlung Leber in der Stadtbibliothek von Rouen (Cat. Leber I, 1839, 146), der diese Handschrift für König François Premier entwarf und nach dessen Tod Heinrich II . widmete und 1548 datierte. Vergleiche Livres d’Heures Royaux, 1993, Nr. 3 mit Farbtafel.
Während alle Miniaturen einheitlich von diesem überlegenen Künstler gestaltet wurden, tritt in der zweiten Hälfte des Kodex eine schwächere Hand auf, der auch einige Bildinitialen überlassen sind. Da in den historisierten Initialen insgesamt auf das Intelligenteste mit der Position des Buchstabens umgegangen wird, ist zwischen den dekorativen und den erzählenden Partien nicht zu trennen – die logische Folge wäre, alles dem Prior der Coelestiner von Quinze-Vingt zuzuschreiben; dann wäre Johannes Holand nicht nur als Schreiber, sondern auch als Maler für den Kodex verantwortlich. Dagegen spricht vielleicht die hohe Position des Mannes in der kirchlichen Hierarchie; doch gehörte es gerade im 16. Jahrhundert auch zur Übung bedeutender Kirchenleute und Patrizier, zumindest im Schreiben professionelles Geschick zu beweisen. Eine Interpretation der Signatur in dem Sinne, daß Holand nicht mit eigener Hand arbeitete, sondern das Werk machen ließ (fecit fieri), wird hingegen durch die Tatsache nahegelegt, daß der wesentlich schlechtere zweite Maler in den Lagen 4 und 6 so versteckt wurde, daß man seine Hand nicht sah, wenn man den Kodex lagenweise ungebunden







übergab. So verhält sich eigentlich nur eine Werkstatt, die für einen Auftraggeber arbeitet, dem man gleichbleibende Qualität vorspielen möchte.
Unter den insgesamt 54 Bildern ragen zwei große heraus; sie zeigen die triumphal geschilderte Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Auch bei dieser greift der Maler eine mittelalterliche Darstellungstradition auf, um über sie hinauszuweisen: In einem einfachen verschlossenen Raum sitzen die Apostel um Maria auf niedrigen Bänken. Sie sind eng zusammengerückt, so daß viel Platz für die Weite des Innenraums bleibt, der zu Fenstern aufsteigt, durch die leuchtend blauer Himmel und ebenso strahlende Wolken zu erkennen sind. Vom mittelalterlichen Heiligenbild schreitet die Kunst hier in Richtung eines neuzeitlichen Interieurs voran, in dem die Heilsgeschichte eher beiläufig spielt.
Künstlerisch bietet der Band ein überzeugendes Beispiel dafür, daß auch die späte Buchmalerei herausragender Leistungen fähig war. Dabei verstand sie es, alle Register der großen alten Kunst zu ziehen und zugleich mit Neuem zu verbinden. Von der Textura als Textschrift her traditionell, zeigt sich der Kodex im gemalten Schmuck Tendenzen der Renaissance gegenüber aufgeschlossen. In den Miniaturen verbinden sich beste Erfahrungen mit italienischer und deutscher Kunst, vor allem aus der Dürerschule, spannungsvoll zu großartiger französischer Malerei.
Das Pariser Coelestinerkloster wurde 1778 aufgelöst [vgl. Franklin II , 99f.]; im Jahr zuvor verkaufte es einen Großteil seiner Bibliothek an den Marquis de Paulmy und den Duc de la Vallière. Dieser ließ unser Buch von Dêrome neu einbinden. Bis heute ist es vollständig und ausgezeichnet erhalten
Provenienz: Angefertigt 1545 für das Pariser Kloster Quinze-Vingts der Coelestiner, deren Zeichen, ein Kreuz über einem »S« (für das Hauptkloster Saint Esprit de Sulmone), in der linken Initiale auf Blatt 42; der alte Bibliothekseintrag des Klosters dürfte auf Blatt 1 gestanden haben, wo er bis auf die Jahreszahl 1545 getilgt wurde. – 1777 Verkauf an den Duc de la Vallière, dessen Katalog, Bd. I, 1784, 243: 96 livres, vgl. auch verschiedene Einträge auf den vorderen Vorsätzen. – Alfred Piat, aus dessen Auktionen von 1898/99 gelangte der Band an den amerikanischen Sammler Clarence S. Bement, dessen Wappenexlibris im Vorderdeckel. – Sir William Thomlinson, dessen Auktion Sotheby’s, London 22.2.1938, Nr. 504 (£ 155 an Sawyer). – Richard Holmden, dessen Auktion Sotheby’s, London 17.7.1950, Nr. 21 (£ 310 an Edwards).
As a late document of manuscript culture, the splendidly illuminated Gospel book of the Parisian Coelestines, dated and signed by the prior of the monastery Johannes Holand in 1545, once again demonstrates all the glory of medieval penmanship and illumination. The quality of the miniatures by the Master of Jean Hubert is outstanding, building on the French court art of the so-called 1520 workshop, which combined Flemish and Italian inspirations; in addition, there are even inspirations from the Dürer school. After the dissolution of the Coelestine monastery of Quinze-Vingt in 1778, the Duc de la Vallière acquired the book and had it rebound by Dêrome.

Missale für die Hochfeste und Canon Missae, hier als Ordinarium Missae bezeichnet. [Lateinisches Manuskript mit Noten]. Pavia, um 1550-60 oder um 1564.
60 Bl., das letzte modern (in Buchdruck um 1900: Benedictio Solemnis. In Missa Pontificalis, mit farbig gedrucktem Randschmuck), dazu 1 Doppelblatt als Vorsätze vorn und ein festes Vorsatz derselben Art hinten. – Gebunden in Lagen zu 8 Blatt bis auf die Lage 44 vor Zäsur, ohne Reklamanten. – Handschrift auf Pergament, in Antiqua, zu 24, in der Cyrus-Messe zu 23 Zeilen; mit Noten zu 8, in der Sirius-Messe zu 9 Zeilen aus je 4 Notenlinien und einer Textzeile; nur die senkrechten Grenzlinien grau zu Tage tretend, die waagerechten in farbloser Stiftreglierung, Notenzeilen mit dem Rot des Rubrikators.
Eine ganzseitige textlose Miniatur in prächtigem Beschlagwerk-Rahmen, eine siebenzeilige und vollfarbige Bild-Initiale in Vollbordüre auf farbigem Grund mit Wappen, eine weitere siebenzeilige und vollfarbige Bild-Initiale mit reichem Randschmuck auf Pergament-Grund, eine fünfzeilige Initiale mit der Darstellung einer Hostienmonstranz als Buchstabenteil; diese Zierbuchstaben wie auch alle anderen, in Gold und Farben ausgeführten, jeweils mit einem Streifen starkfarbiger Randmalerei aus Akanthus und Blumen; die Anfänge der Messen mit 4 fünfzeiligen und einer vierzeiligen Initiale, davon 3 mit inhaltlich zugehörigen Bildmotiven in goldener Camaïeu-Malerei; die übrigen farbigen Initialen mit Buchstaben in Gold-Camaïeu auf abwechselnd blauen und purpurnen Flächen, eine bis vier Zeilen hoch; Versalien nicht markiert.
Folio (350 x 245 mm).
Brauner Kalblederband der Zeit auf fünf sichtbare Bünde, mit Bild- und Goldprägung: auf Vorder- und Rückseite die getilgten Wappen Rossi aus steigendem Löwen mit Krone, vorn von einer Bischofsmitra, hinten von einem Kardinalshut bekrönt.
Wichtiger Ausgangspunkt für das Oeuvre eines manieristischen Illuminators von Rang
Buchmalerei des 16. Jahrhunderts in Pavia ist der Forschung kaum geläufig, wenngleich schon 1917 in einem Monumentalwerk über die Kunst im Umfeld des Hofes von Ludovico il Moro eine ganze Reihe von Namen genannt wurde – unter ihnen Guarniero Berretta, von dem berichtet wird, er sei »nella miniatura pittore singolare« [Malaguzzi Valeri 196] gewesen. Bislang war von ihm jedoch nur bekannt, daß er von 1575 bis 1577 an der Ausmalung von Chorbüchern für die berühmte Kartause von Pavia gearbeitet hatte, wobei ihm wohl Evangelista della Croce sowie Benedetto da Bergamo vorausgingen, in dem Cristina Romano seinen Lehrer vermutet. Dieser mag ihn mit der
Das Festmissale des Kardinals de’ Rossi, Bischofs von Pavia, reich illuminiert und mit einer signierten Miniatur von Guarnerio Berretta
neuen Formensprache des Manierismus vertraut gemacht haben. Als wesentlichste Eigenschaften seiner Miniaturen benennt Romano eine delikate Farbwahl mit zartem Grau und Rosa, Himmel, die sich dunstig vom Azur zu Rosa und Gelb entwickeln, dabei brillantes Lapislazuli, kurzum eine Verankerung in der Chromatik des Manierismus.
Dies gilt auch für das Vollbild der Kreuzigung Christi [Bl. 46v] in unserem Missale, das ganz am unteren Bildrand mit Goldbuchstaben signiert ist: »guarnerius b[err]eta faciebat«. Unter bewölktem Himmel ist das Kreuz aufgerichtet, das der Maler als ein Heilsgerät versteht und deshalb mit zarter Goldhöhung überzieht. Es steht auf der Schädelstätte; also liegt am Kreuzfuß ein Schädel über einem Felsabbruch, der sicher eine Assoziation zu Hölle und Unterwelt oder wenigstens zu Adams Grab bringen soll. Der Blick von der kahlen Wiese Golgathas reicht bei sehr niedrigem Horizont über wenig spezifische Bauten, die offenbar Jerusalem vertreten, in weite Ferne, die nicht nur in zartes Blau, sondern in der letzten Entfernung sogar in Rosa getaucht ist; denn alle Farben des Regenbogens spielen in dem Himmel, der zum starken Ausdrucksträger wird.
An Michelangelo scheint die Körperlichkeit des kräftigen, ja fast gedrungenen Erlösers orientiert zu sein. Jesu Haupt ist im Tode nach unten gesunken, zu Maria hin; der Lanzenstich hat bereits seine Seite geöffnet. Weder die Schmerzensmutter noch der Lieblingsjünger vermögen in ihrem bitteren Schmerz aufzublicken. Die Jungfrau birgt ihre Tränen in das Tuch ihrer Haube, während der jugendliche Johannes sich, ebenso gesenkten Hauptes, ergriffen ans Herz faßt. Ihre Farben spielen mit der Tradition von rotem Kleid und blauem Mantel bei Maria, Orangerot und hellem Blau bei dem Jünger, doch haben sie sich im Zuge der Wendung zum Manierismus so gewandelt, daß eine ganz neue Wirkung entsteht, zu der auch die grau-violetten Innenseiten der Mäntel beitragen. Die Bordüre ist ein prachtvolles Beispiel für eine gleichfalls noch junge Dekorationsart, die man wegen der harten metallischen Wirkung, die hier auch durch Vergoldung betont wird, als Beschlagwerk kennt.
Das Kreuzigungsbild erweist sich somit durch die in goldenen Majuskeln geschriebene Inschrift als ein weiterer Ausgangspunkt für das Oeuvre eines Illuminators von Rang: Guarnerio Berretta, der in seiner Zeit als einzigartiger Miniaturmaler gefeiert wurde, betritt mit der Kreuzigung als einer verbürgten, eigenhändigen großen Miniatur die Bühne der Kunstgeschichte. Damit präsentieren wir hier ein bemerkenswertes Werk aus einer späten, aber immer noch beeindruckenden Phase der italienischen Buchmalerei.
Das Festmissale steht in engster Verbindung mit der Familie Rossi aus San Secondo, die im 16. Jahrhundert zwei Bischöfe von Pavia stellte: Giovan Girolamo de’ Rossi trat sein Amt 1530 an und hatte es bis 1544, dann wieder von 1550 bis zu seinem Tod 1564 inne. Evtl. wurde die Malerei schon für ihn geschaffen, allerdings mag der erste Besitzer auch ein Unbekannter gewesen sein, weil die Messe des Ortspatrons Cyrus von Pavia nachträglich eingefügt wurde. Möglicherweise wurde das Manuskript aber auch um 1564 zur Wahl seines Nachfolgers und Neffen Ippolito de’ Rossi geschaffen oder erworben und neu gebunden: Denn der steigende Löwe auf den Deckeln, der auf dem Frontispiz und in einer Initiale auf Blatt 7 wiederholt wird, gehört zum Wappen der Familie. Im Jahr 1585 wurde Ippolito von Papst Sixtus V. in den Kardinalsstand erhoben; was der Anlaß

war, das Wappensupralibros auf dem Hinterdeckel mit dem Kardinalshut zu ergänzen. Der Band ist vollständig und ausgezeichnet erhalten.
Provenienz: Wohl Giovan Girolamo de’ Rossi, Bischof von Pavia 1530 – 1544 und 1550 – 1564, eventuell dessen Nachfolger und Neffe Ippolito de’ Rossi, der 1585 in den Kardinalsstand erhoben wurde; dieser hat möglicherweise 1564 den Einband anfertigen und 1585 das Wappensupralibros auf dem Hinterdeckel durch den Kardinalshut ergänzen lassen. – Von späteren Besitzern fehlt jede Spur. Literatur: Zu Berretta: Malaguzzi Valeri; Romano; siehe vor allem Bollati, M. Dizionario biografico dei miniatori italiani, Milano 2004, S. 98-101
Until now, the only known work of the illuminator Guarnerio Berretta was his work on choir books for the Charterhouse of Pavia around 1575/77. In this festive missal, he emerges much earlier as a mannerist illuminator of distinction with a brilliant full-page signed miniature (the only one known thus) of the Crucifixion of Christ. The manuscript was produced either around 1550/60 or around 1564 for a Cardinal de› Rossi, Bishop of Pavia, and is excellently preserved in the old binding, complete and with rich secondary illumination.






Koran . [Manuskript]. Persien, datiert 972 H. [= 1564].
407 Bl. – Handschrift auf Wachspapier in achteckigem Format, zu jeweils 14 Zeilen.
Mit einem doppelseitigen illuminierten Unwan (Schmuckblatt zur Eröffnung) sowie mit Rosettenmustern an den Rändern jeder Seite.
Extremes Kleinformat (55 x 53 mm).
Originaler roter Lederband mit reicher (später intensivierter) Vergoldung, in einer ziselierten silbernen Kapsel, diese wohl aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (Einband unscheinbar repariert, die letzten beiden Bl. restauriert, Kolophon mit Rasurspur, aber lesbar).
Orient und Ornament – ein einsames Meisterwerk
Das muslimische Bilderverbot trieb bestimmte Kunstfertigkeiten, namentlich die der Kalligraphie und Ornamentik, im Orient in einsame Höhen. Das ist bei diesem persischen Manuskript aus dem Jahr 1564 in besonderer Weise der Fall: Es gibt unseres Wissens überhaupt nur ein einziges vergleichbares Stück, es befindet sich in der Bibliothek des Aga Khan.
Der gesamte Koran hat in diesem achteckigen Codex von nur gut 5 Zentimetern Durchmesser Platz gefunden. Eröffnet von einem in Gold und Farben illuminierten doppelseitigen Unwan, bietet er eine einzige kalligraphische Tour de Force, die das Werk den qualitätsvollsten orientalischen Miniaturenhandschriften des 15. und 16. Jahrhunderts ebenbürtig an die Seite stellt. Das Kleinod hat sich in seiner im 18. Jahrhundert gefertigten Silberkapsel in wunderbarem Zustand erhalten.
This Persian Qur›an manuscript from 1564 is an outstanding masterpiece of Muslim calligraphy, on a par with the highest quality oriental miniature manuscripts of the 15th and 16th centuries. Opened by a double-page unwan illuminated in gold and colours, the entire Koran is accommodated in the octagonal codex of only a good 5 centimetres in diameter! The original leather binding has survived in wonderful condition in a silver case made in the 18th century. The only comparable piece is in the library of the Aga Khan.
Eine der kleinsten bekannten Koran-Handschriften in achteckigem Miniaturformat, datiert 1564

Promotionsurkunde . [Lateinisches Manuskript]. Perugia, 29. Oktober 1582.
26 Bl. – Gebunden in regelmäßigen Lagen aus 13 Doppelblättern. – Handschrift auf Pergament, in sorgfältiger Humanistenkursive; Initien in großformatiger goldener Capitalis Quadrata, wichtige Passagen im Text ebenfalls in Capitalis golden hervorgehoben. – An drei Stellen notarielle Beglaubigungen des Urkundentextes mit Notariatszeichen
8 ganzseitige Miniaturen, 4 dekorierte Initialen, davon 1 historisiert; alle Seiten mit breiten goldenen Rahmen versehen.
Quart (215 x 158 mm; Schriftspiegel: 123 x 83 mm).
Zeitgenössischer flexibler Einband im Langstichstil, bezogen mit etwas älterem Brokatpapier aus floralem Muster in Violett über teils gepunztem Goldgrund, mit rot-golden gebändertem und punziertem Schnitt.
Auf Augenhöhe mit den größten Leistungen der italienischen Illuminationskunst
Schon bei seiner Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften am 29. Oktober 1582 in Perugia muß Statilio Paolini eine gewisse Prominenz genossen haben. Dies spiegelt sich in dem außerordentlichen Aufwand, der mit seiner Promotionsurkunde getrieben wurde, ebenso wie in den Namen bedeutender geistlicher wie weltlicher Würdenträger, die im Text in goldener Capitalis aufscheinen. Der zweifellos bedeutendste unter ihnen ist der Erzbischof von Perugia, Vincenzo Ercolani (1517 – 1586), ein enger Vertrauter Papst Gregors XIII . Der Text gliedert sich in drei Abschnitte unterschiedlicher Länge, die jeweils durch einen Notar beglaubigt sind, zweimal durch Mariottus Antenorus, einmal durch Agabitus g. Antonij de Herutiis.
Statilios Vater Antonio Maria bekleidete eine hohe Position in der Verwaltung der etwas abgelegenen Bischofsstadt Osimo in den Marken. Mit dem Studium an der Universität Perugia rückte Statilio entschieden näher an die Elite des Kirchenstaats heran. Dies spiegelt sich in den qualitätvollen Miniaturen, die auch für eine Form von Patronage stehen mögen: Blatt 1 füllt eine Kartusche mit dem Wappen von Papst Gregor XIII . vor einer purpurfarbenen Draperie; auf der Rückseite trägt Herkules die Wappen von Domenico Ottolini, dem Bischof von Lucca und apostolischen Protonotar, und Vincenzo Ercolani, dem Erzbischof von Perugia. Die mit Sicherheit auf dessen Familiennamen anspielende, nur mit dem Löwenfell behängte Herkules-Figur, könnte andeuten, daß zu ihm nicht nur eine formale Beziehung, sondern auch eine geistig-literarische Nähe bestand. Auf der Seite gegenüber sitzt eine ebenfalls recht freizügig bekleidete Frau vor einem Baum. Sie präsentiert zwei Kartuschen
Promotionsurkunde der Universität von Perugia für Statilius Paolinus, mit acht künstlerisch eigenständigen Miniaturen


mit den Wappen von Perugia und Osimo, der Heimatstadt Paolinis. Die hügelige Landschaft mit dem Ort im Hintergrund soll vermutlich ebenfalls Osimo darstellen, mit seiner Burg aus der Zeit der Renaissance, von der heute nur noch wenige Reste stehen. Auf der Rückseite des zweiten Blattes umrahmen vier Putti eine Kartusche, deren ovales Innenfeld leer gelassen ist – möglicherweise hätte hier noch ein Porträt des Promovierten eingesetzt werden sollen. Die beiden oberen Putti halten zwischen sich ein kleines Wappen mit einem Löwen, wohl das Paolinis. Angesichts dieses Motivs dürfte das Löwenfell des Herkules gleichfalls auf seine persönliche Nähe zu Erzbischof Ercolani anspielen. Kein Herkules, doch ein anderer nackter Heros erklimmt in der ganzseitigen Miniatur auf Recto des letzten Blattes einen felsigen Berggipfel. Mit der Rechten greift er nach einem Felsbrocken, der die Spitze des Berges bildet. Auf einem Schriftband über seinem Kopf steht das Motto »Tandem« – offenbar ist es Sisyphus, der hier soeben seine schwere Arbeit beendet hat. Gemeint ist damit der Promovierte selbst, wie sich aus der heraldisch-emblematisch verdichteten Komposition auf der Rückseite ergibt. Dort stehen zwei männliche allegorische Figuren auf Postamenten, zwischen diesen lagern sich zwei Löwen um eine Kartusche, wieder mit dem Löwenwappen. Zwischen den beiden Männern erscheint eine quadratische Schrifttafel mit in winziger Kursive geschriebenen Versen in italienischer Sprache, die auf die mühselig absolvierten Studien und ihr glückliches Ende verweisen: »Ne le miserie vissi, e negli errori«, doch nun »tanto lo stato mio candido rende«. Darüber sieht man das rätselhafte Emblem von Statilius Paolinus: Es zeigt einen im Meer schwimmenden Fisch, über dem am Himmel der zunehmende Mond zu sehen ist. Es spielt an auf seinen Beinamen »Accademico lunatico«, also etwa »der Grillenhafte«, den er als Mitglied der Accademia degli Insensati in Perugia trug. Darüber schrieb Giovanni Ferro 1623 in seinem Teatro d’imprese: »fra gli Insensati di Perugia l’Academico Lunatico per nome Statilio Paulini scrisse sopra il medesimo corpo, e pesce una parola del salmo Dealbabor, dimostrando la medesima intenzione di schiettezza, e lealtà, e dipendenza« [Ferro II , 463]. Durch die Mitgliedschaft in dieser 1561 gegründeten literarischen Vereinigung von Autoren und Adligen, die über Gewißheiten jenseits der »sensi« – also jenseits der »Sinne« in Form von Zweck wie Sinnlichkeit – philosophierten, hatte der junge Paolini wichtige Beziehungen knüpfen können. Eine weitere Anspielung darauf ist das Medaillon mit den fliegenden Kranichen, die gleichsam die Himmelssphäre über dem Fisch im Meer erweitern. Dieses Motiv wählte der principe der Gesellschaft, Leandro Bovarini, als eigenes Emblem: Demnach tragen die Vögel Steine in den Krallen, deren Gewicht sie zur Erde zieht, während sie zugleich den himmlischen und göttlichen Dingen entgegenstreben – womit auch der Querbezug zu dem seinen Stein rollenden Sisyphus hergestellt ist. Statilio Paulini gelang ein beachtlicher Aufstieg: Er wurde Sekretär von Papst Clemens VIII ., dessen Pontifikat von 1592 bis 1605 zu den bedeutendsten in der Ära der katholischen Reformen gehörte. Seine Affinität zur Literatur spiegelt sich auch in der Freundschaft mit Torquato Tasso, wenngleich jugendliche »Grillenhaftigkeit« und Freizügigkeit dabei wohl auf der Strecke blieben. Der später erreichten Bedeutung Paolinis greift die erstaunliche künstlerische Ausstattung seiner Promotionsurkunde bereits vor: Obgleich der dafür verantwortliche Maler namentlich bislang nicht identifizierbar ist, gehören die Miniaturen zweifelsohne zu den qualitätvollsten Zeugnissen der italienischen Buchmalerei im späten Cinquecento. Die manieristische Prägung der Miniaturen mit ihrer Vorliebe für markante Farbkontraste und außergewöhnliche Posen der Figuren verbindet sich mit




einer gekonnten Wiedergabe des menschlichen Körpers. Bei den Aktfiguren und den Putti wird das Spiel der Muskeln durch raffinierte Hell-Dunkel-Modulation betont, den anderen Figuren verleihen die aufwendigen Draperien Monumentalität. Besonders sorgfältig ist auch die Ausarbeitung der unterschiedlichen Gesichter.
Auch in der Darstellung der Landschaft stellt der Illuminator sein Talent unter Beweis. So steht dem in duftigen Farben gehaltenen Hintergrund auf Blatt 2r die schroffe, in zahlreiche Schattierungen von Grau und Braun gestaltete Oberfläche des Felsens auf Blatt 26v gegenüber. Durch die Verwendung von Lichthöhungen in Form von feinen goldenen Schraffuren besitzen die Miniaturen insgesamt einen luxuriösen Charakter, der durch den außergewöhnlich guten Erhaltungszustand und die ungebrochene Leuchtkraft der Farben noch verstärkt wird. In den heraldischen, durch Putti und allegorische Figuren belebten Kompositionen dieses Illuminators zeigt sich eine deutliche Auseinandersetzung mit den Errungenschaften Michelangelos, in die sich aber noch ein weiteres Element mischt, das sich vielleicht durch die Aufenthalte von nördlich der Alpen ausgebildete Künstlerpersönlichkeiten in Italien erklären läßt.
Die außerordentliche Qualität der acht ganzseitig angelegten, hinreißenden Miniaturen übertrifft nicht nur das in einer Doktorurkunde Übliche und zu Erwartende himmelweit, sondern steht auf einer Höhe mit den größten Leistungen der italienischen Illuminationskunst in der Mitte des 16. Jahrhunderts, die hier nur mit dem Namen Giulio Clovio umrissen sei. Text und Miniaturen der vollständigen Handschrift sind hervorragend erhalten.
Provenienz: Geschrieben für Statilius Paolinus anläßlich der Erlangung des Doktorgrades der Rechtswissenschaften an der Universität Perugia am 29. Oktober 1582. – Schweizer Privatsammlung.
Literatur: Ferro; Mancini, Miniatura
Eight full-page, ravishing miniatures make this doctoral certificate of the University of Perugia from 1582 an unexpected art-historical event: they are on a par with the greatest achievements of Italian Mannerist illumination of the mid-16th century, namely that of Giulio Clovio. The recipient of the parchment document was the lawyer Statilius Paolinus, later secretary to Pope Clement VIII and friend of Torquato Tasso, who was protected by the Archbishop of Perugia Vincenzo Ercolani.
Mit unerhörten erotischen Miniaturen: das Stammbuch des Augsburger Patriziers Hans Jakob Widholz von 1583/84: durchgehend illuminierte Handschrift auf Pergament
Widholz, Hans Jakob . Album amicorum. [Manuskript]. Venedig, 1583 – 1584.
23 Bl. – Durchgehend in Gold und Farben illuminierte Handschrift auf Pergament.
Mit 43 ganzseitigen Miniaturen in Gold und Farben, meist unten mit kleinem Schriftfeld, davon 16 erotische bzw. anzügliche und 6 sonstige Darstellungen sowie 21 Wappen.
Oktav (148 x ca. 100 mm).
Moderner Pergamentband mit goldgeprägtem Titel und doppelten Querfileten auf dem glatten Rücken, doppeltem Goldfiletenrahmen auf den Deckeln, mit marmorierten Vorsätzen, zusätzlichen Papier- und doppelten Pergament-Vorsatzblättern und Ganzgoldschnitt, in marmoriertem Saffianschuber (Schrift gelegentlich etwas abgerieben).
Geld und Liebe – das Stammbuch des Augsburger Kaufmannssohns Hans Jakob Widholz
Der Vergleich dieses Stammbuchs mit dem etwa zur gleichen Zeit angelegten Album des Nürnberger Patriziers Hans Albrecht Haller von Hallerstein in unserer Sammlung liegt nahe; hier ist es mit Hans Jakob Widholz (um 1559 – 1618) ein Augsburger Kaufmannssohn, der 1583 – 1584 ein solches Vademecum in die weite Welt mitnahm. Groß sind allerdings die Unterschiede! Dem kaum dem Knabenalter entwachsenen Haller gaben die Eltern ein aus zwei emblematischen ›Vordrucken‹ bestehendes, schön gebundenes Buch, in das sie ihre Wappen einmalen ließen, mit auf den Weg ins Studium – das von Widholz war seinerzeit wohl nur einfach gebunden und enthält ganze 23 Blätter kleinen Formats. Daß dies ein Buch »zu guetter gedechtnis« und teurem Angedenken sein sollte, vermittelte zunächst nur das kostbare Beschreibmaterial: Pergamentseiten, die erst noch zu füllen waren.
Hans Jakob Widholz entstammte einem Handelshaus mit weitreichenden Beziehungen: Über Venedig bezog man Baumwolle aus Kreta sowie Güter aus der Levante, italienische Baumwolle wurde nach England verkauft, von dort wiederum Tuche importiert, auch unterhielt man Kontakte nach Hamburg, Sachsen, Böhmen und Polen. Sein Vater Hans hatte das Unternehmen zu höchster Blüte geführt, als Hans Jakob nach 1583 nach Venedig ging – diese Ortsangabe ist mehreren Einträgen im Album Amicorum beigegeben. Anders als der Nürnberger Patrizier Haller oblag er offenbar keinen juristischen Studien, sondern war an die Drehscheibe des internationalen Handels geschickt worden, um praktische Erfahrungen und Weltläufigkeit zu erlangen.
Privat scheint er sich hauptsächlich unter seinesgleichen bewegt zu haben: Da trug sich am 9. Januar 1583 »Hans Hertzl der Jung« ein, der im Jahr darauf Hans Jakobs Schwester Anna Maria heiratete –





und schon 1587 zweifelhafte Bekanntheit erwarb, weil er »falsche Münzen prägen ließ und in Umlauf brachte« [Häberlein 55]. Neben diesem Schwager ist auch ein Vetter aus der Familie seiner Mutter, einer geborenen Mader, anzutreffen, mit Abraham Jenisch (1560 – 1639) ein weiterer Augsburger Kaufmannssohn. Aus Illertissen stammte Hans Christoph II . Vöhlin (1561 – 1587), ein Mitglied der bedeutenden Handelsdynastie, die sich in den 1590er Jahren in Augsburg mit den Welser zusammentat; aus Radolfzell Martin Peller (1559 – 1629), der damals am Fondaco dei Tedeschi für einen Nürnberger Kaufmann tätig war; später erbaute er in Nürnberg das berühmte Pellerhaus. Thobias Allz kam »von Salzburg«, ein »M. Berzkowsky z Schbirorowa« aus Böhmen: Das Adelsgeschlecht Beřkovský ze Šebířova ist seit der Mitte des 15. Jahrhunderts schriftlich nachgewiesen; Radslav I. (1476–1537) brachte es bis zum Amt des Obersten Landschreibers von Böhmen.
Die Einträge der hoffnungsvollen Kaufmannssöhne sind zumeist recht prosaisch und stereotyp nach demselben Muster abgefaßt: Ich – der Eintragende – habe dieses Wappen dem ehrenfesten Hans Jakob Widholz zum guten Gedächtnis machen lassen. Dafür prunken die allesamt in Gold und Farben eingemalten Wappen, entweder in freier Landschaft oder in Innenräumen vor ausgebreiteten Ehrentüchern, mit ausladender Helmzier, als wollten sie es mit jedem Adelswappen aufnehmen.
Poesie und große Worte waren ihre Sache nicht, dafür neben stolzer Repräsentation die sinnlichen Vergnügungen, die sich den Junggesellen in der Lagunenstadt boten. Hans Ronners italienische Devise »Chi me non vuol non me merita« ließ offen, ob er dabei eher an geschäftliche oder geschlechtliche Beziehungen dachte. Anders als der junge Haller beim Abgang zur Universität waren Widholz und seine Freunde in Venedig als Mittzwanziger auch im heiratsfähigen Alter. Erstaunlich freizügig ausgelebt werden erotische Phantasien jedenfalls auf dem Pergament: Die 22 Bildchen sind eine seltene, erstrangige und sehr vergnügliche Quelle für die Mentalität dieser jeunesse dorée im späten 16. Jahrhundert – als rings umher katholische Gegenreformation wie auch protestantische Orthodoxie zunehmend rigoros gegen ketzerische Gedanken jedweder Art durchgriffen. Gleich in der Eingangsminiatur wird die Klerikerkaste darum drastisch auf die Hörner genommen. Eine Nonne schwimmt in einem See, in den zwei Mönche in hohem Bogen kopfüber hineinhüpfen, während einer an Land steigt: Sie alle entblößen dabei mit hochgezogener Soutane Gesäße und Genitalien. Vorn am Ufer bewerten zwei – korrekt gekleidete – Damen die Szene hausfraulich-sachlich: »So hab ich al mein Lebtag kein grössere Knödl geseh«. Sie tauchen später noch einmal mit zwei Galanen auf: Ein Paar umarmt sich, die Partner reichen jedoch jeweils einer anderen Person am Bildrand ein flammendes Herz – offenkundig eine Illustration der Entscheidung zwischen Geld oder Liebe, die auch den ledigen Kaufmannssöhnen nach ihrer Lehrzeit unweigerlich ins Haus stand.
Es scheint, als seien die Miniaturen von ein und demselben Maler in einem Zug hergestellt worden: Sie zeigen fast alle die gleiche komplementäre Tonalität von Blau und Grau – oftmals für voralpin wirkende Landschaftshintergründe – gegenüber Rosa und Violett, die eine weiche, fast abendlich anmutende Stimmung verströmen. Die Darstellungen sind in der Regel in Rot und Gold gerahmt, darunter Schriftfelder freigelassen, denen durch einen Auftrag von ›Rouge‹ an den Seiten eine gewisse Plastizität verliehen wird. Die meisten Bilder entstammen einem vom Courtoisen ins KonkretErotische hinüberspielenden Motivkreis, mit gelegentlichen Anflügen satirischen Ernstes. So springt
eine Darstellung ins Auge, die einen senkrecht geteilten Mann zeigt: Die eine Körperhälfte ist die eines Landsknechts mit Gewehr in der Hand, dessen Bein dynamisch ausschreiten will, vielleicht zum Feldlager mit den bunten Prunkzelten hinter ihm. Die andere Hälfte ist ein Mönch in grauer Kutte und mit Rosenkranz, auf den im Hintergrund die Kirche wartet. Hie gewaltsamer Erwerb, dort Frieden in der Askese – das immerhin war eine Wahl, die die lebensfrohen Kaufmannssöhne nicht zu treffen brauchten! Ihre Gedanken kreisten vorderhand um Lebens- und Liebesgenuß, was auf den Miniaturen in vielfältiger Weise variiert wird: Ein alter Mann schleppt auf seinem Rücken eine leicht bekleidete Blondine davon, ein anderer lupft ihr Hemd und entblößt ihr Gesäß. Eine junge Dame sitzt im Garten mit einem Obstkorb auf dem Schoß, ein auf der Mauer stolzierendes Äffchen hat eine rote Frucht entwendet. Ein kostbar gekleidetes Paar mittleren Alters: er ganz in Schwarz, sie in einem üppigen Goldbrokatkleid mit rosa Wangen und hochgestecktem Blondhaar. Ein Reitpferd scheut vor dem Feuer zurück. Ein elegantes Paar steht im Begriff sich zu küssen. Drei Frauen sitzen beim Spiel im Garten einer italienischen Villa. Ein Paar sitzt auf einer Steinbank, er greift der nicht ganz Widerstrebenden ins allzu weit geöffnete Kleid. Ein Mädchen hält ein großes Füllhorn, aus dem rote Rosen quellen, am Bildrand heult ein Hund mit rotem Halsband. Venus mit einem Pfeil in der Hand wird begleitet von einem Amorknaben mit Bogen: »Doch ir geschos niemandt schaden kann [/] wer Gott von Herrzen Rueffet An«. Eine frei in der Landschaft stehende junge Frau hebt ihr silbernes Hemd und zeigt sich mit entblößter Scham einem jungen Mann – dieser verbirgt sich hinter einem Baumstamm und blickt hilfesuchend zum Betrachter; zu ihren Füßen steht ein phallusförmiges Federvieh. Eine Schöne schaut in den Spiegel, hinter ihr scharrt ein geschmücktes Pferd gesenkten Kopfs mit den Hufen.
Moralische Botschaften treten fast völlig zurück; einmal tritt eine Justitia mit Waage und Schwert auf, doch die Legende klingt eher sarkastisch: »Justitia köm manchem wol. [/] Wen man thet das man thun sol«. Richtig ernst wird nur der Arzt am Lager eines maskierten Kranken, der in der Bildunterschrift mahnt: »Im Anfang bedenk das End«. Tatsächlich kam ein solches Ende allzu bald: Hans Jakob hatte gerade anderthalb Jahre in Venedig verbracht, als sein Vater am 1. Juni 1584 starb und er nach Augsburg zurückgerufen wurde. Er wird dann in das Familienunternehmen eingetreten sein, 1585 heiratete er die 19jährige Euphrosina Weiß und gründete seinen eigenen Hausstand; bald darauf kam die Tochter Susanna zur Welt.
Provenienz: Auf dem Spiegel Wappenexlibris des Wiener Industriellen Rudolf [von] Gutmann (1880 – 1966), dessen Besitz von den Nationalsozialisten beschlagnahmt, erst Jahrzehnte später restituiert und u. a. bei Sotheby’s und Christie’s versteigert wurde.
Literatur: www.süddeutsche-patrizier.de
This Album Amicorum provides eye-opening insights into the private world of Hans Jakob Widholz, the son of a merchant from Augsburg, who stayed in Venice in 1583/84: 21 friends proudly contributed their coats of arms in gold and colours on blank sheets of parchment; sensational and unique are 22 miniatures with mostly erotic or obscene motifs, which must surely be considered unique in this permissiveness – especially in the repressive atmosphere of the Counter-Reformation.





Die vollständige Kupferstich-Passion von Albrecht Dürer, unvergleichlich illuminiert von Hieronymus Oertl, in einem Gebetbuchmanuskript auf Pergament, datiert 1587
Oertl, Hieronymus . Passio Vnsers Herrnn Jesu Christi Auß den vier Euangelisten gezogen. Mit schönen Figuren getziert. Auch mit Christlichen vnnd Schönen andechtigen Gebetten einem Jeden Christen seer nutz zulösen. Beschriben durch mich Hieronymum Örtl Augustanum. [Manuskript]. [Nürnberg], 1587.
20 Bl. Pergament; 2 leere Bl. Pergament. – Mit Reglierung durch Streifen von Flüssiggold, eingefaßt von roten Linien.
Mit 17 ganzseitigen, montierten Kupferstichen von Albrecht Dürer, alle vollendet in Gold und Farben von Hieronymus Oertl illuminiert, mit Signatur »AD« und Jahreszahlen.
Oktav (160 x 105 mm).
Dunkelroter Maroquinband um 1700 auf vier flache Bünde, mit reicher floral-ornamentaler Rückenvergoldung; auf den Deckeln außen breiter goldgeprägter Dentellerahmen, zentral ein ovales Kreuzigungsmedaillon, von breiter Bordüre eingefaßt; mit Stehkantenvergoldung, Goldbrokatvorsätzen (Augsburger Papier) und vorn und hinten 5 weiteren Blättern aus starkem Papier; in mit Filz ausgelegter Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel.
Ein Kronzeuge der »Dürer-Renaissance«
Dieses Büchlein ist doppelt sensationell: Es enthält alle sechzehn von Albrecht Dürer eigenhändig gestochenen Blätter der berühmten Kupferstich-Passion von 1513, die einen Gipfelpunkt seines druckgraphischen Schaffens darstellen. Im Jahr 1587 stellte der Nürnberger Kalligraph und Illuminator Hieronymus Oertl sie für das von ihm geschriebene Gebetbuch neu zusammen und malte sie aufs delikateste aus, wodurch er ein neuartiges bibliophiles Gesamtkunstwerk schuf. Diese Kombination von Graphik und Illumination auf allerhöchstem Niveau ist von einzigartiger Wirkung und Evidenz.
Kostbare Gebetbücher für den individuellen Gebrauch hochgestellter Personen hatte es schon im Mittelalter gegeben. Doch die Erfindung des Buchdrucks hatte dieses Genre vor eine neue Herausforderung gestellt – angesichts der Möglichkeit der Vervielfältigung galt es, die unikale, persönliche Aura zu bewahren. Oertl trotzte der Nivellierung, indem er an den skripturalen Traditionen festhielt und zugleich Altes und Neues, Handschrift und Druck zu einem hybriden Buchtyp verband. Buchmalerei war ohnehin nicht durch technische Verfahren ersetzbar. So wurden in handgeschriebenen Text Druckgraphiken integriert, die ihrerseits wie Miniaturen übermalt wurden – dabei entstanden »unique examples of the art of book arts« [Baeyer 6].



Solche »neo-illuminated manuscripts« [ebd. 5], wie Emanuel von Baeyer sie jüngst in einem drei solchen Exemplaren gewidmeten Katalog nannte, kamen am Ende des 16. Jahrhunderts im Zusammenspiel mit dem Aufschwung der Kalligraphie wie auch der »Dürer-Renaissance« in Mode [vgl. ebd.]. Dies erscheint paradox: Denn gerade Dürer war es, der die Druckgraphik durch feinste Strichführung in den Stand setzte, »mit dem, was Pinsel und Ölfarbe zu leisten vermögen« [Sonnabend 23], zu rivalisieren. Lange postulierten Forscher, daß »eine nachträgliche Kolorierung […] sich damit nicht vereinbaren« [ebd. 22] lasse. Demgegenüber wies Hans Georg Gmelin bereits 1983 darauf hin, daß »besondere Besteller« zur damaligen Zeit diese »Auffassung nicht geteilt« hätten. So nähmen im 16. Jahrhundert »nicht nur ankolorierte, sondern mit Deckfarben fast oder vollständig ausgemalte druckgraphische Blätter immer mehr zu« [Gmelin 183]. Dies bedeutete keineswegs deren Entwertung, sondern war ein Sekundäreffekt ihrer grundsätzlichen Aufwertung, gerade durch Dürer: Von ihm leitete man die enorme »Entwicklung der Graphik ab, so daß frühere Druckgraphik nur unter dem möglichen Aspekt dieser Autorschaft gesehen wurde« [ebd. 193]. Durch ihre Bewertung als Kunstwerke wurden sie »für hochgestellte Auftraggeber ›illuminationswürdig‹« [ebd. 195] und erhielten mit der Ausmalung endgültig »den Charakter einmaliger Originale, biographischer Urkunden des jeweiligen Künstlers« [ebd. 193].
Für diese neue Form der Kunst- und insbesondere Dürerverehrung um 1600 ist das hier vorliegende Bändchen mit nicht weniger 17 originalen Kupferstichen von der Hand Albrecht Dürers ein Kronzeuge! Man vergleiche damit den Gesamtbestand, den Gmelin für das damals noch geteilte Berlin ermittelte: »Westberlin besitzt 27, Ostberlin 38 illuminierte Dürerstiche«, darunter viele verwaiste Einzelblätter ohne »Bezeichnungen der Miniaturisten« [ebd. 197]. Ein Pergamentblatt mit dem aufmontierten Stich Petrus und Johannes heilen den Lahmen aus Dürers Kupferstich-Passion mißinterpretierte Gmelin als »Auftrag, einen[!] Kupferstich zu illuminieren«, wobei er den rückseitigen Text mit einer Erinnerung des Leidens Christi »noch interessanter« fand – der allerdings gar nicht zu dem Bild paßte. Der autoptische Befund entspricht vielmehr genau der Abfolge in unserem Band: Das Blatt stammt aus einem ganz ähnlichen Gebetbuchmanuskript. Es trägt die Bezeichnung » GM 1588«, die Gmelin »mit dem Nürnberger Illuministen Georg Mack [d. Ä.]« [ebd. 186] identifizierte. Zu ihm gehören offenbar drei Blätter aus der Josefowitz Collection, die Susan Dackerman in ihrem Ausstellungskatalog Painted Prints präsentierte [Dackerman, Nr. 46], sowie vier weitere dokumentierte Einzelblätter [vgl. ebd., Anm. 3]. Eine dort ebenfalls vorgestellte vollständige Serie wurde 1585 von Hans Mack koloriert [ebd., Nr. 39]. Da auch sie ausgebunden wurde, können sich diese beiden Stücke der bekannten Briefmalerfamilie, »who dominated the profession in Nuremberg« [ebd., S. 5], schon als ganze nicht mit unserem Gebetbuch messen. Emmanuel von Baeyer bot in seinem Londoner Katalog von 2019 ein vollständiges Exemplar mit den gleichen Dürer-Stichen (und weiterem Bildmaterial) an: »The large number of engravings by Dürer certainly makes this volume the most valuable of all known illuminated manuscripts created by Hieronymus Oertel« [Baeyer 100]. Baeyers Manuskript des in Nürnberg ansässigen Schrift- und Buchkünstlers Oertl ist nun das unsrige an die Seite – und chronologisch noch voranzustellen: Das von Baeyer beschriebene Exemplar entstand 1595, unseres, auf dem Titel von Oertl voll signiertes bereits 1587, damit auch noch vor demjenigen Georg Macks d. Ä., von dem Gmelin das versprengte Blatt beschrieb.

Hieronymus Oertl (1543 – 1614) war Schreiber, Buchgestalter, Illuminator und Hersteller in einem. Als er sich 1580 in Nürnberg niederließ, hatte er bereits ein bewegtes Leben hinter sich. Als Sohn des protestantischen Syndicus der Stadt Augsburg humanistisch erzogen, kam er »in seinem fünfzehnten Jahre an den kaiserlichen Hof und bekleidete späterhin die Stelle eines kaiserlichen Hofprocurators und Notars« in Wien. Konnte er sich zunächst als »eifriger Verfechter der freien Ausübung der Augsburger Confession in österreichischen Landen« profilieren, so untersagte Kaiser Rudolf II . bald nach seinem Regierungsantritt genau dies. Als sein Statthalter befahl Erzherzog Ernst 1578 »den Städten und Märkten die Einstellung des evangelischen Gottesdienstes und die Rückkehr in den Schoß der katholischen Kirche unter Androhung harter Strafe«. Weil Oertl im Namen der protestantischen Wiener Bürgerschaft eine Bitte um »die fernere Zulassung der Augsburger Konfession« an den Erzherzog richtete, wurde er »zum Tode verurtheilt, dann aber zu ewiger Verbannung begnadigt« [ADB 24, 445]. In Nürnberg baute er sich ein neues Leben auf. Er arbeitete als »notary« [Baeyer 61], wurde »1607-14 Genannter« und war als »Kunstmaler« und Schreibmeister bekannt, der so klein schreiben konnte, daß er »das Vaterunser auf einem pfenniggroßen Raum unterbrachte«. Außerdem verfaßte er »theologische und geschichtliche Schriften, darunter eine mehrbändige Ungarische Chronologie der Kriege, Belagerungen und Schlachten, die 1604-13 erschien« [Grieb 1097f.]. Dank der Forschungen von Emanuel von Baeyer und Truusje Goedings wissen wir nun, daß er auch der Schöpfer »of at least seven different illuminated prayerbooks produced between 1583 and 1605« war, hergestellt »for his own pleasure in his spare time […], inspired by the Bible and the best engravings with biblical scenes he could find« [Baeyer 61]. Mit dem vorliegenden Band erhöht sich die Zahl der bekannten Manuskripte Oertls auf acht.
Nach mittelalterlichem Vorbild wurde Pergament als halt- und kostbare Grundlage des Gebetbuchs gewählt, in das die Texte kunstvoll von Hand eingetragen wurden, in stets gleichbleibend schöner Fraktur. Große Initialen, die den Lesefluß aufhalten, gibt es nicht mehr, dafür beginnt jede Seite mit einer in Flüssiggold geschriebenen ersten Zeile, auch die Versalien sind goldgehöht; filigrane Goldschnörkel dienen als Zeilenfüller. Die Titelseite und eine die vier letzten Seiten einnehmende Dancksagung für das Leiden Christi sind nicht in schwarzer, sondern in roter Tinte geschrieben. Die eklatante Differenz zu einer mittelalterlichen Miniaturenhandschrift besteht darin, daß das Bildprogramm aus 17 ganzseitigen Kupferstichen besteht, die der Schreiber einmontierte und illuminierte. Bei allen Gebetbüchern Oertls waren die Graphiken jeweils der »starting point for his work […]. Once he had an adequate selection, he looked for the best correspondent fragments in the Bible, and together they inspired his writing of prayers. So, first there was the image, and then came the word« [ebd. 54]. Für das vorliegende Gebetbuch war es Oertl gelungen, die komplette Folge von Albrecht Dürers erstmals 1513 gedruckter Kupferstich-Passion zu erwerben, die er mit dem Einzelblatt der Maria mit Kind am Baum kombinierte.
Schon im 15. Jahrhundert verbreitete sich »die fromme Übung, sich die Leiden zu vergegenwärtigen, die Gottes Sohn für das Seelenheil der Menschen auf sich genommen hatte«, getrieben von dem »starken Bedürfnis der Gläubigen nach emotionaler Anteilnahme, nach einem Mitleiden und damit nach gefühlsmäßiger Nähe zu Gott«. Schon damals halfen bei der Veranschaulichung »kleinformatige Holzschnitte, die erst in Bücher eingeklebt, später auch mitgedruckt wurden« [Sonnabend




116]; gegen Ende des Jahrhunderts erschien eine schon bald berühmte Passionsfolge im aufwendigen Kupferstich von Martin Schongauer. In Überbietung dieses Vorbilds schuf Albrecht Dürer mit der Großen und der Kleinen Passion in Holzschnitt sowie der Kupferstich-Passion gleich drei Variationen über das Thema. Insbesondere nach seiner zweiten Italienreise (1505 – 1507) arbeitete er daran; die beiden Holzschnittwerke erschienen 1511. Die Kupferstich-Passion veröffentlichte Dürer als seine letzte druckgraphische Folge zwei Jahre später. Sie war »ein Kraftakt des Künstlers«, weil er sich hier nicht auf das Zeichnen auf Holzstöcke beschränken konnte, sondern »die Mühsal des Kupferstechens selbst auf sich nehmen« mußte. Schon aufgrund der aufwendigen Technik wählte er das kleine, dafür aber »schlanke, ›aristokratische‹ Hochformat« [ebd. 182] und sprach zugleich noch stärker einen »an der Qualität des Bildes orientierten Geschmack« [ebd. 116/118] an. So laden die Stiche »zum beschaulichen Verweilen ein, sie enthüllen Feinheiten, zumal der psychologischen Durchdringung der Vorgänge« [Winkler 1957, 231], ebenso wie von »Gewändern, Waffen und Rüstungen, die im Licht ihre stofflichen Besonderheiten entfalten« [Sonnabend 182]. Friedrich Winkler nannte sie »unvergleichlich konzentrierte, ja wuchtige Schöpfungen« [Winkler 1957, 231]. Dürer veröffentlichte die Kupferstich-Passion ohne Begleittext und wahrscheinlich nicht in Buchform [vgl. Sonnabend 184; Winkler 1957, 230]. Stattdessen beanspruchten die Blätter, die er auch einzeln verschenkte, von Anfang an »wohl mehr den Status eines wertvollen Kunstwerks«. Allerdings existiert »ein frühes gebundenes Exemplar des sächsischen Kurfürsten Friedrichs des Weisen«, das die »eingebundenen Kupferstiche mit handgeschriebenen Gebeten« [Sonnabend 184] verbindet. Dieses einzigartige Stück, heute im University Museum von Princeton, ist ein direkter ›Vorfahr‹ unseres Exemplars.
Schon in den Holzschnittfolgen der Großen und Kleinen Passion ließ sich »ein aufschlussreicher Wandel der graphischen Sprache« Dürers beobachten, in der »feine parallele Schraffuren« dominieren, deren Helldunkel-Effekt ein besonderes »Körpervolumen und eine atmosphärische räumliche Wirkung« erzeugen. Mit der Kupferstich-Passion , von der zwölf Blätter im Jahr 1512 entstanden, zielte Dürer darauf, »die Möglichkeiten des Kupferstichs bis zu den äußersten Grenzen voranzutreiben« [Sonnabend 23], was in den drei Meisterstichen der Jahre 1513/14, Ritter, Tod und Teufel, Hieronymus im Gehäus und der Melancholie einen krönenden Abschluß fand. Die besondere graphische Qualität setzte, wie schon in den Holzschnitten, »nur – dem Medium entsprechend – intensiver und feiner, auf tonale Wirkung«: Dunkle Flächen »strahlen eine düster beklommene, manchmal klaustrophobische Stimmung aus, die die Bösartigkeit und Gewalttätigkeit des Passionsgeschehens untermalt« [ebd. 23]. Vor diesem Hintergrund beschränkt sich Dürer »auf wenige, wirkungsvolle Hauptfiguren, die durch die Lichtregie und Größenverschiebungen in Szene gesetzt werden«. Dabei fällt helles Licht weniger auf Christus, der durch »überproportionale Größe und zentrale Gegenwart« herausgehoben wird, stattdessen öfter auf Einzelfiguren und deren »menschliche Niedertracht« [ebd. 184].
Hieronymus Oertl modifizierte die Zusammenstellung und Abfolge der Graphiken geringfügig, doch so, daß darin ein eigenständiges Konzept sichtbar wird. Zunächst stellte er dem Passionszyklus ein nicht dazugehörendes, aber gleichfalls 1513 erschienenes Einzelblatt voran, das Maria mit Kind auf dem Schoß unter einem Baum in freier Landschaft zeigt. Zärtlich zieht sie den nackten kleinen Knaben


»im traulichen Beisammensein in einem Winkel« zu sich heran, doch auch »wie in banger Ahnung, daß er ihr einst entrissen werden wird« [Waetzoldt 144]. Nach Ansicht Friedrich Winklers begreift das Kind »die innige Liebkosung nicht ganz«, hat »die Hand abwehrend an die Brust der Mutter gedrückt […] und wendet in seiner Bedrängnis den Blick auf den Beschauer« [Winkler 1957, 235] – doch ist es wohl der Betrachter, der die Zweisamkeit stört: als sündiger Mensch, für den Christus die Passion auf sich zu nehmen hat. Sind die Augen Marias auf dem Stich geschlossen, so hat der Illuminator sie ihr geöffnet: Mitleidig schaut die junge Mutter ihr Söhnchen an. Mit diesem gemütvollen Vorspiel auf der Titelrückseite kontrastiert grell das folgende erste Motiv aus der Kupferstich-Passion: Es zeigt mit der Szene am Ölberg »den Augenblick, da Christus die Entscheidung, das Kreuz auf sich zu nehmen« [Waetzoldt 154], trifft: »Der knieende Jesus hat die Arme verzweifelt emporgeworfen, leidenschaftlich ruft die gequälte Kreatur die Hilfe der Gottheit an, das Gebet wird zum Klageschrei« [ebd. 159]. Für diese Gegenüberstellung überging Oertl das von Dürer als Titelblatt konzipierte Motiv Christus als Schmerzensmann an der Säule, das er stattdessen an die vorletzte Stelle rückte. Es folgt die Gefangennahme, mit der die eigentliche Leidensgeschichte Jesu beginnt. Danach erscheint Christus vor Kaiphas, der ihn anschließend Pilatus vorführt. Wirken diese beiden Darstellungen ikonographisch etwas redundant, steigert sich die Dramatik danach Schlag auf Schlag: An die Geißelung schließt sich unmittelbar die Dornenkrönung an, nach dem Ecce homo wäscht Pilatus seine Hände in Unschuld. Das Geschehen nimmt seinen Lauf mit Kreuztragung, Kreuzigung, Kreuzabnahme, Grablegung, Christus in der Vorhölle und der Auferstehung. Doch nach diesem Triumph setzt Oertl nochmals einen unerwarteten Kontrapunkt, indem er nun Dürers Titelblatt, Christus als bekümmerten Schmerzensmann, einsetzt – für den andächtigen Betrachter ein Wechselbad der Gefühle. Doch auch damit ist das Ende noch nicht erreicht. Das letzte Bild zeigt eine Szene, die schon zur Apostelgeschichte gehört: die Heilung eines Lahmen durch die Jünger Petrus und Johannes. Während Wilhelm Waetzoldt glaubte, Dürer habe dieses zuletzt entstandene 16. Blatt der Kupferstich-Passion beigefügt, »um die Seitenzahl eines Druckbogens vollzumachen« [Waetzoldt 154] und das Blatt tatsächlich »der Folge meistens nicht beigefügt« [Albrecht Dürer, Nr. 604] ist (auch nicht in dem Exemplar Kurfürst Friedrichs des Weisen), schließt Oertl mit ihm eine erzählerische Klammer um das eigentliche Passionsgeschehen, die durch das Eingangsbild eröffnet wurde: War dort der privaten Idylle von Mutter und Kind Raum gegeben, so zeigen die an humanistische Gelehrte erinnernden Apostel, daß die Kraft, Wunder zu wirken, auf sie übergegangen ist« [Sonnabend 184]. In beiden Motiven wird die Passionsgeschichte ein Stück weit distanziert, sie nähern sich stattdessen dem Erfahrungsbereich der Betrachter an.
Motivisch humorvoll gebrochen wurde der geistliche ›Helldunkel‹-Effekt von Tod und Triumph Christi bereits von Dürer, wozu ihm Christus in der Vorhölle Anlaß gab: Während sich der Erlöser hilfreich zu den Verdammten beugt, die unter ihm in einer Höllengrube zusammengepfercht sind, kokettiert »hinter ihm die reizende Eva mit dem alten Adam, den »ein Teufel in Gestalt einer riesigen Eidechse« vom Höllentor herab mit seiner Lanze nur sachte »piekt« [Winkler 1957, 234]
– Oertl kolorierte das Monstrum in geradezu närrischer Buntheit in Gelb, Blau, Rot und Orange. In den gleichen Farben, und wohl nicht zufällig, hatte er eingangs die schlafenden Jünger im Garten Gethsemane am Ölberg ausgestattet.


Überhaupt ging er bei der Kolorierung eigenwillige Wege, die sich von den Vorgaben tendenziell lösen: Bei Dürer ermangelte allein die als erste bereits 1507 gestochene Beweinung »noch des schwarzen Grundes, den alle Passionsdarstellungen haben« [ebd. 232]; schon die beiden 1508 datierten Stiche Christus am Ölberg und die Gefangennahme sind als Nachtszenen in einem »das Bild bestimmenden, grauen Ton«, der »in den späteren Stichen von 1512 noch intensiviert ist«, und die Passion insgesamt »in einer düsteren, verhaltenen, oft beklemmenden Stimmung« stattfinden läßt, »in finsterer Nacht und in schlecht beleuchteten, bedrückenden Räumen« [Sonnabend 182]. Oertl setzt andere Akzente: In Dunkelheit getaucht sind bei ihm vor allem die Szene vor Kaiphas und die Kreuztragung; die beiden Begegnungen mit dem römischen Statthalter Pontius Pilatus sind eher in ›klassisch‹-dezenter Farbigkeit gehalten, während sonst bewegte Buntheit dominiert, so auch bei dem in Blau, Rot und Orange prangendem, sein Schwert schwingenden Petrus in der Gefangennahme. Nah bei Dürer ist Oertl da, wo er dessen Lichteffekte durch die »Judenfarbe« Grellgelb verstärkt, etwa bei den Figuren des wütenden Kaiphas, der Jesus geißelnden Henkersknechte und dem Lakaien, der Pilatus Wasser einschenkt. Im Vergleich mit den Illuminationen der beiden Mack, die in der Ausstellung Painted Prints gezeigt wurden, arbeitet Oertl ungleich differenzierter: Wirken die Farben Hans Macks in ihrer »highly sophisticated manner« [Dackerman, Nr. 39] insgesamt schwächer, so benutzte Georg Mack »deep, rich opaque paints, which often conceal the engraving below« [ebd., Nr. 46]. Insgesamt entspricht diese Ästhetik der Annahme Gmelins, nach der für den damaligen Betrachter die Farben »die graphische Vorlage der Originale im Sinne eines größeren stofflichen Reizes für das Auge gesteigert haben: für uns eine ungewohnte Einstellung« [Gmelin 197]. Sieht man hier die ursprüngliche Strichelung noch durch, so ging die weitere Tendenz dahin, daß sich die bemalten Graphiken dem Auge immer mehr wie Miniaturen darbieten, womit sie zugleich »are upscaled into a different plane« – als »a new distinct work of art« [Baeyer 6].
Manchmal mochte dieses Verfahren aus einem »Kompromiß zwischen Auftraggeber und Künstler« resultieren, denn insbesondere an den Höfen war »die Arbeit der vielbeschäftigten Miniaturisten […] überaus gefragt, oft waren schwer welche zu bekommen« [Gmelin 188]. Gerade Dürers Name aber mußte jeden Epigonen überstrahlen; entsprechend kaschierte Oertl dessen Signet nicht, sondern zog es im Gegenteil auf jedem einzelnen Stich zusammen mit dem Entstehungsjahr deutlich sichtbar nach. Daß er sich so sichtlich an den Malerfürsten anlehnte, mag auch damit zu tun haben, daß er keinen realen Fürsten mehr als Auftraggeber hatte: Zwar war er vom Wiener Hof geprägt, an dem er viele Jahre gelebt hatte, doch war er als Verbannter in Nürnberg auf sich allein gestellt – ein Grund mehr, sich ostentativ auf den Nürnberger Dürer zu berufen, um einen Abnehmer erst zu gewinnen. Entsprechend findet sich in dem perfekt erhaltenen Buch keinerlei Hinweis auf einen Besteller oder auf frühe Provenienz. Sicher dürfte sein, »daß noch – oder schon wieder – am Ende des 16. Jahrhunderts« Dürers Kunst, »auch in der durch Illuminierung herausgehobenen Druckgraphik, […] nicht nur zu ästhetischer Betrachtung, sondern zu religiöser Meditation veranlaßt hat« [ebd. 186]. In ihrer Eindrücklichkeit wirkte sie auch lange darüber hinaus. Das schmucke rote Maroquinbändchen aus der Zeit um 1700 zeigt auf beiden Deckeln in Goldprägung eine Kreuzigungsszene.




Vor diesem Hintergrund – und auch im Vergleich mit den konkurrierenden Mack-Illuminationen – läßt sich nicht genug betonen, welch einzigartigen Schatz unsere kunstvoll von Hieronymus Oertl in Gold und Farben illuminierte vollständige Folge von 17 der gesuchtesten Stiche Albrecht Dürers im Rahmen von Oertls Manuskript auf Pergament darstellt. Ihre nahezu makellose Erhaltung und besondere Brillanz verdanken sie auch der Tatsache, daß sie über Jahrhunderte hinweg in dem Gebetbuch und seinem alten, ebenfalls tadellosen Einband pietätvoll bewahrt wurden.
Literatur: Vgl. Baeyer, Nr. 9, V-VI , sowie Abb. S. 44 (Maria) und 102-133; vgl. insbesondere Gmelin und Sonnabend. – Zu den Radierungen Dürers: Albrecht Dürer, Nr. 604; Meder, Nr. 3-18 und 34 (Maria); Schoch/Mende/Scherbaum I, Nr. 45-60 und 67 (mit Abb. aller Blätter); Sonnabend, Nr. 123-138, und S. 22f.; Winkler 1957, 230-234 und 235 (Maria) sowie Abb. 112116. – Zu Oertl: Vgl. Dackerman, Nr. 39 und 46; Grieb 1097f.; Will 3, 71f.
Albrecht Dürer’s engraved Passion of 1513, consisting of 16 leaves, is a pinnacle of his printmaking. Together with the single leaf of Mary and Child under a Tree from the same year, the complete series was integrated into this prayer book manuscript on parchment by the Nuremberg illuminator and calligrapher Hieronymus Oertl in 1587 and illuminated with masterly distinction. The combination of graphics and illumination, which today appears idiosyncratic, together with the calligraphy created a new type of bibliophile work of art at the highest level and at the same time a crown witness of the »Dürer Renaissance« around 1600. Of the three comparable manuscripts known by H. Oertl this one is doubtless the finest and most staggering.


[Oertl, Hieronymus]. Der christlich Glaube [/] Mit Gottseligen christlichen und hoch tröstlichen Gebeten wie ein jeder Christ Täglich vor den Augen des HERRN seines Gottes erscheinen mag. [Manuskript]. [Nürnberg, um 1600].
37 Bl. Pergament; 1 separates Bl. Pergament.
Mit 16 ganzseitigen, montierten, in Gold und Farben illuminierten Kupferstichen, davon 12 mit einzeiligen lateinischen Bildlegenden.
Quart (ca. 212 x ca. 156 mm).
Neuerer violetter, floral ornamentierter Seidenband über Holzdeckeln auf vier Bünde, mit Pergamentvorsätzen und Ganzgoldschnitt; in mit Filz ausgelegter schwarzer Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel, signiert »J. & S. Brockman«.
Ein Buch für die Ewigkeit
Neben Hieronymus Oertls Gebetbuch mit Dürers Kupferstich-Passion können wir hier mit einem weiteren »neo-illuminated manuscript« [Baeyer] aus seiner Produktion aufwarten. Es ist wohl kurze Zeit später entstanden, größer, umfangreicher und konzipiert mit anderem thematischen Schwerpunkt und Bildmaterial. Als eine von acht bekannten Handschriften Oertls reiht sie sich ein in die illustre Reihe dieser »unique examples of the art of book arts around 1600« [ebd. 6].
Auch hier wurde der kalligraphische Text auf Pergament geschrieben, in einheitlicher, schöner Fraktur. Initialen gibt es gleichfalls nicht mehr, nun aber einen Wechsel von größerer und kleinerer, schwarzer und roter, teils auch goldgehöhter Schrift, was den Text gut proportioniert. Die Überschriften sowie die ersten und letzten Zeilen der einzelnen Absätze und Seiten sind besonders reich mit filigranem Feder- und Schnörkelwerk geziert, was der Schrift eine zarte, fast vibrierende Anmutung gibt. Es gibt einen Bordürenschmuck, verglichen mit mittelalterlichen Handschriften allerdings in reduzierter Form: Eine schmale, aber reich vergoldete rote Papierbordüre, von schwarzen Linien begleitet, faßt Textund Bildseiten ein. Das Lateinische ist auch in diesem Gebetbuch der deutschen Sprache gewichen. Die Illumination der 16 ganzseitigen montierten Kupferstiche ist im Vergleich zu unserem früheren
Spezimen noch opulenter geworden, was nicht nur am größeren Format der Abbildungen liegt: Die Differenz zwischen zartem und kräftigem Farbauftrag tritt noch deutlicher hervor; lineare, gestrichelte und flächige Goldhöhungen setzen überall Glanzlichter. Auf Grund der gesamten Machart läßt sich unser Band unzweifelhaft der kleinen Zahl illustrer Oertl-Handschriften beigesellen und etwas später datieren.






Das Gebetbuch mit dem Titel Der christlich Glaube hat in Inhalt und Bildprogramm allerdings keine Parallele mit Oertls übrigen Arbeiten; lediglich das »Frontispiz« gegenüber dem Titel wurde auch in einem anderen Werk verwendet, dort aber ganz anders illuminiert [vgl. Baeyer, Abb. S. 56, ohne Identifizierung des Stichs]. Ikonographische Grundlage ist eine Kupferstichserie nach Zeichnungen von Marten de Vos, die bei Nagler als »Das Credo, oder die Glaubensartikel. Folge von 13 Blättern mit Titel. Ad. Collaert sc. et exc.« angeführt ist und von der sich ein späterer Druck mit dem Titel XII Fidei Apostolicæ Symbola, iconibus artificiosissimis (Amsterdam 1633) nachweisen läßt. Das Titelblatt zeigt ein Säulenportal, aus dem Oertl das zentrale Medaillon ausschnitt, um seine eigene Titelinschrift direkt auf das darunterliegende Pergament aufzutragen.
Marten de Vos (1532 – 1602), der sich auf seiner Gesellenwanderung in Italien »besonders an Tintoretto anschloß«, war seit seiner Rückkehr 1558 der »führende Maler Antwerpens« und »typische Vertreter des niederländ. Manierismus«. Er hat »in großem Umfange Stichvorlagen geschaffen, die er von zahlreichen Stechern der Zeit vervielfältigen ließ« [Thieme/Becker 34, 555]. Nagler nannte sie »interessante Compositionen«, die »der eigenthümlichen Zartheit des Meisters […] angemessen« [Nagler, Künstler-Lexicon 20, 556] seien. Die Serie zum Credo wurde von Adrian und Jan Collaert II . gestochen, dessen Signatur »Ioann Collaert sculp.« fünfmal im Bild erscheint; Bildunterschriften wie »M. de Vos inuent.« und »Adrian Collaert sculp.« bzw. »excud.« wurden hingegen abgeschnitten. Die 12 ganzseitigen, immer auf linken Seiten montierten Stiche illustrieren die einzelnen Artikel des Glaubensbekenntnisses. Sie zeigen die Schöpfung (in mehreren Szenen), die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor, die Verkündigung an Maria, Kreuzigung samt Grablegung, Höllenfahrt und Auferstehung Christi, Himmelfahrt, das Jüngste Gericht sowie Pfingsten. Die Artikel »[in] Sanctam ecclesiam catholicam [!], sanctorum communionem« und »remissionem peccatorum« werden durch vielfigurige Straßenszenen veranschaulicht, den Beschluß bilden die Auferstehung der Toten und das himmlische Jerusalem als Ort des ewigen Lebens.
Präludiert wird das Programm von drei (von uns nicht zuzuordnenden) Stichen, die auf Jesu Rettungstat gleichsam hinführen: Schlägt man das erste Blatt um, empfängt den Betrachter – vergleichbar unserem anderen Oertl-Manuskript – eine gemütvolle Genreszene: Elisabeth und ihr kleiner Sohn Johannes besuchen die Heilige Familie im Stall zu Bethlehem. Das Lamm des Täufers richtet sich zutraulich an Marias Schoß auf und läßt sich vom Jesusknäblein anfassen. Gegenüber erblickt man zwei leicht bekleidete, muskulöse Männer: Johannes tauft Jesus im Jordan. Es folgt das »Frontispiz«, das ebenso wie der Titelstich eine Art Säulenportal zeigt, dessen Wölbung hier allerdings durch ein von Engelchen gehaltenes Spruchband gebildet wird. Im Zentrum steht auf einer blauen Erdkugel, Tod und Schlange zertretend, der triumphierende Jesusknabe. Das muß nun nur noch im Credo »Täglich« bezeugt und geglaubt werden. – Ein unfertiges Pergamentblatt mit einem aufmontierten Kruzifix wird später beigelegt worden sein. Den Stich von Hieronymus Wierix nach Marten de Vos verwendete Oertl noch in zwei anderen Manuskripten [vgl. die Abbildungen Baeyer, S. 42f., sowie dessen Nr. 8. XIII , S. 86]; das zur Bemalung vorbereitete Blatt illustriert anschaulich seine Arbeitsweise.







Die Thematik des Gebetbuchs ebenso wie die Kombination der einzelnen Elemente deuten auf die dezidiert protestantische Gesinnung des Urhebers – auch wenn dieser sich einer Bilderfolge bediente, die den Glauben an die »ecclesiam catholicam« propagierte. Dafür sprechen die klare Konzentration auf Christus einerseits und den rettenden Glauben andererseits, verbunden mit der – Fegefeuer und Hölle übergehenden – Zuversicht, die schon auf dem Titel in einer Kartusche am Seitenfuß ausgedrückt wird: »All Todten werden auffersthen [/] Wann Gottes Posaun wirdt anghen«. Gleichwohl scheinen die Gebete von einer untergründigen »manieristischen« Unruhe durchwirkt, indem sie permanent um die Sorge um das ewige Leben kreisen, bis hin zum Schlußsatz – mit dem sich auch der Schreiber verabschiedet: »Wer wol von dieser Welt wegfehrt, [/] Ins Himlisch Vatterland einkert«. Auch in seinem geistlichen Gehalt bestätigt das Buch somit eine Dialektik, die es, zwischen Mittelalter und Barock, Tradition und Neubeginn, Handschrift und Druck, auf allen Ebenen prägt. Es vermittelt das Bild einer individuellen Religiösität, die in der diesseitigen Welt immer weniger Halt findet: Aura und Aufbruch stehen in spannungsvoller gegenseitiger Durchdringung. Dabei ist das Werk in Konzeption und Ausführung aus einem Guß. Hieronymus Oertl war nicht nur »a fine scribe, but was one of the best illuminators of his generation. He was responsible for the selection of the Biblical texts, for writing the prayers, for colouring and gilding the drawings and for illuminating the prints« [Baeyer 54].
Die Stiche prunken mit einer reich differenzierten Buntheit, »ranging from delicate and sensitive translucent washes to pastose soluring« [ebd. 64]. Sind einerseits die graphischen Strukturen durchaus noch sichtbar, so bewirkt die intensive, eindringliche Ausmalung, daß die Graphiken andererseits wie Miniaturen wirken. Hierin geht Oertl weiter als in der Kolorierung von Dürers Kupferstich-Passion 1587, was eine spätere Entstehungszeit nahelegt, denn »Blätter, in denen der graphische Charakter immer mehr von der Deckfarbenmalerei überlagert wird, scheinen in ihrer überwiegenden Mehrheit nach 1600 entstanden zu sein« [Gmelin 192]. Baeyer fühlte sich von ihm an »contemporary Mannerist paintings by Bartholomäus Spranger and the earlier Rosso Fiorentino« [Baeyer 5] erinnert, Truulsje Goedings an den Stil, »favoured by the court of Rudolf II in Prague around 1600, and, more specifically, of prints by the Augsburg master-colourist Dominicus Rottenhammer« [ebd. 47]; die Qualität von Oertls Arbeit sei »equal to or even slightly better than Rottenhammer’s and surpasses the rather mechanical approach of the Mack family« [ebd. 61]. Wurden solche »hybriden« Kunstwerke zu ihrer Entstehungszeit europaweit sehr geschätzt, so sind sie heutzutage eher »underexposed in current art and book history, and unjustly so« [ebd. 30]. Die ebenso innovative wie aufwendige Verbindung von Altem und Neuem macht auch unsere illuminierte Gebetshandschrift von Hieronymus Oertl zu »a precious possession« [ebd. 47].
Literatur: Baeyer, S. 146 (dieses Exemplar). – Zu den Radierungen nach de Vos: Nagler, KünstlerLexicon 20, 559. – Zu Oertl: Grieb 1097f.; Will 3, 71f.
Hieronymus Oertl’s calligraphic prayer book manuscript on vellum, dedicated to the articles of the Christian faith, is illustrated by 16 full-page copperplate engravings illuminated by him in gold and colours, mostly by the Collaert brothers after Marten de Vos. The illumination is the pinnacle of the great art of colouring of the 16th century, creating ravishing paintings in their own right – the work can be dated precisely to the time around 1600.

Gaguin, Robert . Compendium Roberti Gaguini super Francorum gestis: ab ipso recognitum & auctum. Paris, Thielman Kerver für Durand Gerlier und Jean Petit, 1500.
Aa 6 a-z 6 A-F6 = Titelbl., 5 Bl. (mit dreispaltigen Registern), 169 gezählte Bl., 5 Bl. – Chroniktext mit schmaler Marginalspalte gedruckt; mit blaßroter Reglierung. Gedruckt auf Pergament.
Mit ganzseitigem Titelholzschnitt, auf dem vorletzten Blatt wiederholt, und Druckermarke, jeweils in Gold und Farben illuminiert, und mit 10 sechs- bis siebenzeiligen Zierinitialen in Gold, davon 9 auf altrosa-blau geteiltem Grund, eine auf altrosa Grund.
Folio (ca. 275 x ca. 190 mm).
Brauner Kalblederband des 17. Jahrhunderts auf fünf goldornamentierte Bünde, mit goldgeprägtem Rückentitel, die Rückenfelder mit reicher floral-ornamentaler Vergoldung in doppelten Goldfiletenrahmen; mit zweifarbigem Sprengschnitt (beschabt, Titelbl. am oberen Rand mit kleiner Ausbesserung, erste und letzte Bl. mit einigen Wurmlöchlein).
Hochbedeutendes Exemplar einer ebenso bedeutenden Ausgabe
Robert Gaguin (1433 – 1501) war 1477 in heikler Mission von König Ludwig XI . nach Deutschland geschickt worden: Er sollte das Heiratsprojekt zwischen Erzherzog Maximilian von Österreich und Maria von Burgund verhindern, scheiterte jedoch und fiel bis zu Ludwigs Tod 1483 in Ungnade. Erst unter Karl VIII . wurde er wieder mit Gesandtschaften betraut. Seit 1483 arbeitete Gaguin an seiner Geschichte Frankreichs. Die Erstausgabe erschien 1495; die Schlußverse von Erasmus von Rotterdam waren dessen erste Veröffentlichung überhaupt. Weitere Begleittexte lieferten die Humanisten Benedictus Montenatus, Faustus Andrelinus, Cornelius Girardus Goudensis und Iodocus Badius Ascensius. In der vorliegenden vierten Auflage aus dem Jahr 1500 drückte sich die humanistische Tendenz erstmals auch im Erscheinungsbild aus: Sie wurde in Antiqua gesetzt. »Plus belle, plus ample et plus correcte« [Brunet] als ihre Vorgänger, war sie zugleich die Ausgabe letzter Hand – mit einigen kleineren, nichtsdestoweniger signifikanten Ergänzungen Gaguins.
Während die ersten neun, bis 1461 reichenden Bücher eine Kurzfassung der Grandes Chroniques de France von 1477 darstellen, liefert Gaguin in den beiden letzten Büchern als gut informierter und

zugleich distanzierter Zeitgenosse interessante Nachrichten über die Regierung Ludwigs XI . und Karls VIII . – auch bei letzterem hatte er vergeblich um einen offiziellen Auftrag zur Abfassung des Geschichtswerks geworben. Möglicherweise setzte er persönlich und politisch neue Hoffnungen in Ludwig XII ., der im Mai 1498 als Vertreter der rivalisierenden Nebenlinie des Hauses Valois unverhofft auf den Thron kam und sofort eine tatkräftig ausgreifende Politik begann: Seine Ehe mit der unfruchtbaren Jeanne de France ließ er annullieren, um im Januar 1499 Anne de Bretagne, die Witwe Karls VIII ., zu heiraten und so ihr Herzogtum weiter an Frankreich zu binden. Auch den erfolglos gebliebenen Italienkrieg seines Vorgängers nahm er wieder auf – mit Karls Niederlage bei Fornovo hatte die vorige Auflage von Gaguins Compendium geendet. Jetzt führte der Historiker sein Werk über die erfolgreiche Rückkehr Ludwigs XII . aus Italien hinaus fort und folgte ihm an den Niederrhein: Die neue Ausgabe schloß mit der Schlichtung eines Territorialstreits zwischen den Herzögen Karl von Geldern und Wilhelm von Jülich-Berg durch den französischen König im Dezember 1499.
In diesem historischen Moment, als Frankreich im Großen und Ganzen konsolidiert zu sein schien, stürzte am 25.10.1499 die Brücke Notre-Dame, die über den großen Arm der Seine zur Kathedrale führte, in sich zusammen. Über diese Brücke zogen die Könige in Paris ein, und schon wegen dieser symbolischen Bedeutung wurde ihr Neubau sofort in die Wege geleitet. Der Einsturz wird sowohl am Schluß des Textes, als auch im ›Nachwort‹ Josse Bades erwähnt. In der vorliegenden seltenen Druckvariante findet sich darüber hinaus auch ein neunzeiliger »additional paragraph on the punishment of those responsible for the collapse« [BMC]. Dieser endet: »pœna indicta est qnto idus ianuarii. Anno christiane religionis. M.cccc. nonagesimonono«. Die hier genannte Jahreszahl 1499 ergibt sich aus der Datierweise des Autors »more gallico« [ebd.], das tatsächliche Datum ist der 9. Januar 1500. Damit reichte der Bericht unmittelbar bis an den Druckbeginn heran, der im Kolophon mit dem 13. Januar 1500 angegeben wurde – datiert »in the modern style« [ebd.], weil der Drucker ausdrücklich des christlichen ›Jubeljahres‹ Erwähnung tat. Ganz offensichtlich veranstalteten Autor und Drucker diese Ausgabe also in einer nach ihrem Verständnis welthistorisch bedeutsamen Wendezeit: Das Alte war vergangen, eine neue Ära brach an. Robert Gaguin erlebte diese allerdings nicht mehr: Er starb bereits im Jahr darauf, während sein Werk noch eine ganze Reihe weiterer Auflagen erlebte – man sehe nur unser unikales Pergamentexemplar von 1518.
Auch das vorliegende Exemplar der Ausgabe letzter Hand ist auf Pergament gedruckt, die drei Holzschnitte sind zudem kostbar in Gold und Farben illuminiert. Van Praet kannte neben einem Pergamentexemplar in der Bibliothèque du Roi nur zwei weitere, eines, das aus dem Collège de Navarre stammte, sich im Besitz des Duc de La Vallière befand 1817 und wiederum 1822 auf der vente Mac-Carthy in Paris verkauft wurde (es fehlte der Titel mit Holzschnitt und das erste Blatt), und ein weiteres »avec les initiales peints en or et en couleurs«, das aus der Bibliothek von Louis Henri de Loménie, comte de Brienne 1724 an Robert Harley gelangte: ist dies das vorliegende, das somit in unserer Sammlung mit Harleys Pergamentexemplar der Ausgabe von 1518 wieder vereinigt wäre?
Brunet und Graesse kannten neben dem königlichen und dem Mac-Carthy-Exemplar nur das – selbe
der Auktionen in London 1848 (Delessert) und Paris 1853 (Alfred Chenest).

Die Bibliographen beobachteten »im typographischen Satz durchgehend Abweichungen« [Ohly/ Sack], die in unserem Exemplar allerdings bedeutsam sind: Es zeichnet sich neben dem seltenen neunzeiligen Zusatz am Schluß auch durch die variante Titelinschrift aus, die der von Pellechets Nr. 4972A entspricht, bei der »le premier cahier (Aa) est d’un autre tirage« als bei den meisten Exemplaren. Handelt es sich dabei um einen besonders frühen Ausdruck?
Die Bemalung der auf dem vorletzten Blatt wiederholten Titelillustration ist nicht nur wegen ihres herausragenden Niveaus, sondern auch wegen ihrer Art und Weise bemerkenswert. Der Holzschnitt zeigt die beiden französischen Nationalheiligen S. Denis und S. Remy, die zu beiden Seiten einer Säule mit den Aufschriften »Iusticia« und »Fides« stehen. Diese trägt einen gekrönten Schild mit dem französischen Lilienwappen. Vor der Säulenbasis halten zwei Flügelhirsche ein Schriftband, auf dem zu lesen ist: »Hec sunt francorú celebranda insignia regum«. Interessant ist in diesem Zusammenhang die das Mittelfeld umgebende, filigran in Gold ornamentierte blau-rote Zickzackbordüre – insbesondere das, was durch sie verdeckt wird: Hier waren ursprünglich »les armes de douze provinces de France« [Van Praet 92] zu sehen. Die Übermalung hebt also die Zentrierung des Titelbilds – und indirekt des Geschichtswerks – auf den König hervor, dessen Politik über das ›provinzielle‹ Frankreich in die Bretagne, nach Italien und ins Deutsche Reich ausgriff. Da sie strikt zeitgenössisch ist, scheint dies ein starkes Indiz dafür zu sein, daß das rare Pergamentexemplar mit dem seltenen Annex aus dem unmittelbaren Umfeld Ludwigs XII . stammt – für den Autor selbst ging der Wunsch nach solcher Königsnähe wohl kaum mehr in Erfüllung. Ein Exemplar der späteren Ausgabe von 1514, ebenfalls auf Pergament und koloriert, kostete auf der 12. Macclesfield Sale (4481) £ 109.250, obwohl die unteren Ecken sämtlich von Mäusen unschön teils mit Bildverlust abgenagt waren.
Provenienz: Verblaßter, rasierter zeitgenössischer Besitzvermerk am Rand des illustrierten vorletzten Blatts verso: »Moy Emile Jean sire de Ceyssane« (= Cezanne, gaskognischer Adel, siehe Rietstap); einige zeitgenössische Feder- bzw. Schriftproben auf der letzten leeren Seite. – Auf dem hinteren fliegenden Vorsatz verso Vermerk aus dem 19. Jahrhundert: »Cet ouvrage vient de la bibliothèque de pont-hu[ponthieu?]«. Französische Privatsammlung.
Literatur: Adams G 16; BM STC French 191; BMC VIII , 217; Brunet II , 1438; Claudin II , 283ff.; Goff G-15; Graesse III , 4; GW IX , 10454: kennt ein Exemplar auf Pergament. Hain *7413; Hubay, Nr. 395; IDL 1877; Ohly/Sack, Nr. 1178f.; Panzer II , S. 333, Nr. 590; Pellechet, Lyon, Nr. 284; Pellechet, Catalogue 4972A; Polain 1539; Renouard 1908, II , 448ff.; Van Praet, Bibliothèque du Roi V, S. 92f., Nr. 110.
This is the – enlarged – definitive edition of Robert Gaguin’s History of France, whose account extends into the year of printing, the »Jubilee« of 1500, so indicated in the colophon. The author and publisher associated the young King Louis XII with hopes for the dawn of a new era, which is reflected in a special way in this exceptional copy: It is one of only a few vellum copies (four or five), the three woodcuts are sumptuously illuminated in gold and colours, the way the title picture is overpainted additionally emphasises the importance of the king – indications that the book comes from the immediate circle of Louis XII .


Missale Pataviense . [Augsburg], Erhard Ratdolt, 1505.
Π 14 a-[q] 8 [r] 6 s-z 8 A-D8 E-F10 Π 6 A-E8 = 13 [statt: 14] Bl., 224 gezählte Bl., 15 [statt: 16] Bl., Bl. 225-263 = 291 [statt: 294] Bl. – Die drei leeren Blätter (am Ende der Vorstücke, F10 und das letzte) entfernt. – Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot.
Mit zwei ganzseitigen Illustrationen (Schutzheilige, Kreuzigung), einer sehr großen historisierten Initiale und einem kleinen Medaillon, sämtlich in Holzschnitt und zeitgenössisch koloriert; mit einem halbseitigen Holzschnitt zur Ermittlung der Sonntagszahl sowie großer, in Rot und Schwarz gedruckter Holzschnitt-Druckermarke am Schluß; außerdem mit einer zehnzeiligen und 12 achtzeiligen Zierinitialen in rotem und schwarzem Druck, einer acht- und einer sechszeiligen Zierinitiale auf schwarzem Grund, sehr zahlreichen Lombarden in Rotdruck, ferner mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System, begleitet von Text mit größeren Versalien in schwarzem und rotem Druck.
Folio (360 x 226 mm).
Brauner Kalblederband über starken Holzdeckeln auf vier breite, von Streicheisenlinien begleitete Bünde, mit einzelnen Medaillonstempeln in den Rückenfeldern, auf den Deckeln Rahmenwerk von Streicheisenlinien und drei verschiedenen Rollenstempeln, mit durchbrochenen und ziselierten Mittelund Eck-Buckelbeschlägen, sowie Schließbeschlägen mit intakten Schließbändern, mit verblaßtem Gelbschnitt und Resten von ledernen Blattweisern (Einband wurmstichig, Lederbezug an den Kanten mit kleinen Fehlstellen, Schließbänder mit Einrissen, am Unterrand kleinere Wurmspuren, Schnitt-Tränkung hier und da in den Blattrand eingedrungen, anfangs am Innensteg etwas feucht-, streckenweise etwas finger-, sonst kaum fleckig, ganz vereinzelte Randläsuren).
Ein Meisterwerk des Augsburger Frühdruckers Erhard Ratdolt
»Augsburg darf stolz auf ihn seyn«, schrieb schon der Buchhistoriker Georg Wilhelm Zapf über Erhard Ratdolt: Er sei die »Zierde unter den Buchdruckern seiner Vaterstadt« und habe »Werke mit solcher typographischen Schönheit gedruckt, daß solche allen andern den Rang streitig machen müssen« [Zapf I, XXXI f.]. Der wahrscheinlich 1447 in Augsburg geborene Ratdolt war früh nach Venedig gegangen und hatte dort 1476 eine Druckerei eröffnet. Der enorme Konkurrenzdruck veranlaßte ihn jedoch, 1486 zurückzukehren. Mit einem kunstvollen Brevier für das Bistum Augsburg empfahl er sich dem Bischof, der ihn einlud, weitere liturgische Werke für die Diözese herzustellen. Solche Aufträge waren technisch sehr anspruchsvoll, doch der Absatz war gesichert – und ein Ablaß von 40 Tagen, für Hersteller wie Käufer. Ratdolt brachte nicht nur sein venezianisches Typenmaterial mit, sondern auch »ein untrügliches Gefühl für Proportionen« [Bellot 27], das ihm gerade bei den


kompliziert zu druckenden Liturgica zustatten kam: Der stete Wechsel von Schwarz- und Rotdruck war ebenso zu bewältigen wie die Notenschrift, die »durch Ratdolt ihre üblich gebliebene Gestalt« [ebd.] erhielt: »An technisch-handwerklicher Exaktheit sind fast alle seine Werke unübertrefflich«, resümierte Josef Bellot. In den folgenden Jahrzehnten druckte Ratdolt Breviere und Meßbücher für fast alle Bistümer im süddeutschen und österreichischen Raum [vgl. Diehl 155]. Das erste Missale für Passau war 1491 noch dort gedruckt worden, Ratdolt wurde erstmals 1494 mit der zweiten Auflage betraut, die vorliegende von 1505 – in der Variante vom 5. Januar – ist bereits sein vierter Druck. Ein Missale benötigte zuallererst eine Abbildung der Schutzheiligen der betreffenden Diözese, sodann eine Kreuzigungsdarstellung zum Meßkanon, und Ratdolt verstand es, sich dafür »die Mitarbeit der besten Augsburger Künstler seiner Zeit zu sichern« [ebd.]. Hans Burgkmair schuf bereits für das Passauer Missale von 1494 das ganzseitige Heiligenbild, das für die vorliegende Ausgabe aktualisiert wurde, indem unten das Wappen des seit 1500 amtierenden Bischofs Wiguleus Fröschl eingesetzt wurde. Auch das »innig empfundene Kreuzigungsbild«, bei dem Mittel- und Hintergrund völlig frei blieben und das »zuerst im Missale für Freising vom Jahre 1502 auftaucht«, sowie »der schöne T-Buchstabe, mit dem die Canongebete anfangen« [Schottenloher 1922, XVII], stammen von Burgkmair. Eine bahnbrechende Entwicklung Ratdolts in Venedig war der Mehrfarbendruck gewesen, und auch das Passauer Schutzheiligenbild war 1494 auf diese Weise gedruckt worden [vgl. Davies]. In unserer Ausgabe zeugen noch die Initialen und die große Druckermarke in Rot und Schwarz von diesem technischen Ehrgeiz – die Holzschnitte Burgkmairs erscheinen stattdessen in schönem traditionellen Kolorit.
Mit der Herstellung kirchlicher Bücher blieb ein konservativer Zug verbunden; noch eine weitere Neuerung, die Ratdolt erst in den Buchdruck eingeführt hatte, fehlt hier: ein Titelblatt »mit Druckort, Drucker und Jahreszahl« [Diehl 161]. Stattdessen beginnt unser Missale altertümlich mit einer leeren Seite; dafür wird man im Umblättern von den drei Passauer Schutzheiligen Valentinus, Stephanus und Maximilianus in Farbe begrüßt; rechts hebt unvermittelt der aktuelle Bischof zu sprechen an: »Wigelinus dei [et] ap[osto]lic[a]e sedis gratia episcopus Patavien[sis]«. Dieser Eingang liefert keine Druckdaten, wohl aber evoziert er eine Aura persönlicher Präsenz. Wiguleus Fröschls Vorrede, die freilich fast im Wortlaut derjenigen seines Vorgängers Christoph Schachner von 1494 folgt, »empfiehlt […] das Buch und verleiht den herkömmlichen Ablaß« [Schottenloher 1922, XVII]. Auf den Blättern 3 bis 8 folgt der Kalender, dann ein Holzschnitt zur Ermittlung des Sonntagsbuchstabens und das Inhaltsverzeichnis. Erst dann kommt auf Blatt a1 der rotgedruckte Hinweis: »Incipit liber missalis s[ecundu]m chor[um] patauie[n]sem«. Tatsächlich war das Missale ja weniger zur stillen Lektüre als vielmehr zum (semi)oralen Gebrauch in rituellen Kontexten gedacht, wovon in unserem Exemplar die Blattweiser ebenso zeugen wie die sechs Blätter des Canon missae, des eucharistischen Hochgebets, die in großer Schrift und auf Pergament gedruckt sind, um der täglichen Benutzung besser standzuhalten. Van Praet kannte solche Exemplare nur von Passauer Missalien der Ausgaben 1491, 1494, Wien 1507 und Nürnberg 1514; das einzige für uns nachweisbare Exemplar der Ausgabe in geradezu identischer Illumination (Werkstatt-Kolorit?), aber sehr viel prekärer erhaltenem Einband, wurde auf Auktion 55 von Hartung & Karl, München, im November 1987 unter Nr. 244 für DM 62.000 plus Aufgeld verkauft.

Während die älteren Augsburger Inkunabeldrucker in erster Linie »volkstümlich-erbauliche und belehrende Bücher« [Bellot 13] produziert hatten, die jüngeren sich hingegen dem Humanismus zuwandten, nahm Ratdolt mit seinen feierlichen, in einer Rotunda-Schrift gedruckten Liturgica eine ganz eigenständige Position ein, die es ihm allerdings nicht ermöglichte, den »sich schnell ausbreitenden weiterentwickelten Renaissanceformen« [ebd. 26f.] zu folgen. Seit 1505, ab der Erscheinung unseres Missales also, ging seine Tätigkeit merklich zurück, auch sein seit 1515 beteiligter Sohn vermochte es nicht, sich den Entwicklungen anzupassen. Überdies konnte die hieratische Aura der Missalien angesichts der allgegenwärtigen kirchlichen und sozialen Mißstände nicht darüber hinwegtäuschen, daß »die Konzentration auf die Eucharistie und das häufige Messelesen […] keine Tugend, sondern Ausdruck einer Not« der Kirche war: »Die meisten Priester konnten nichts anderes« [Lexutt 42]; zumal bei den Meßkaplanen genügte angesichts der Lehre, daß die »Sakramente objektiv wirkten, […] weithin eine rein mechanische Verrichtung der beruflichen Pflichten« [Moeller 41]. Die lutherische Wittenberger Kirchenordnung von 1522 verwies die Priester hingegen »an ihre eigentliche Aufgabe […], die nicht im Messelesen besteht, sondern in der Fürsorge für Arme und Kranke« [Lexutt 76]; auch bei Ratdolt und Sohn in Augsburg »fiel das liturgische Programm […] der einsetzenden Reformation zum Opfer« [Bellot 27]. Die Offizin schloß im Jahr 1522 – was blieb, waren typographische Meisterwerke ersten Ranges. Schon Georg Wilhelm Zapf drang mit Nachdruck darauf, sie »als Denkmale den Nachkommen aufzubehalten« [Zapf I, XXXII].
Provenienz: Deutsche Privatsammlung.
Literatur: Adams L 1190; Bellot 26; BM STC German 951; vgl. Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 291 (Ausgabe 1494, mit Abb. des Heiligenbilds); Dodgson II , S. 60, Nr. 2; vgl. Geisberg, Nr. 821-823 (Burgkmair); vgl. Graesse IV, 547; vgl. Panzer I, S. 121, Nr. 124 (Ausgabe 1494), und IX , S. 210, Nr. 162b (Ausgabe 1508); Proctor 10644; Schottenloher 1922, S. XVII und Tafeln 51-56; Städtische Kunstsammlungen Augsburg, Nr. 4 und 9; vgl. Van Praet, Bibliothèques I, S. 142f., und ders., Roi I, S. 218f. (nicht diese Ausgabe); VD 16 M 5607; Weale/Bohatta, Nr. 771; nicht bei Zapf.
Erhart Ratdolt had run a printing workshop in Venice for ten years before settling in his home town of Augsburg. His liturgical prints are considered unsurpassed masterpieces, both technically and aesthetically – including this Passau Missal of 1505, with a canon section printed on vellum and three illuminated woodcuts by Hans Burgkmair, the best Augsburg artist of his time. Moreover, the edition is in a miraculously preserved contemporary binding, which seems inconceivable given its constant use.
Missale Constantiense . [Augsburg], Erhard Ratdolt, [1505]. [Daran: 9 Meßordnungen des 18. Jahrhunderts].
Π 8 Π 6 a-p 8 q-[r] 6 s 8 A-I8 A-E8 F4 = 7 Bl. [statt 8 Bl.], 5 Bl., 1 leeres Bl., 132 gezählte Bl., 8 Bl. (Kanon), Bl. 133-204, 40 gezählte Bl. 3 [statt: 4] Bl. – Erstes Blatt (Schutzheilige) und letztes, leeres Blatt entfernt. – Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot.
Mit einer ganzseitigen Illustration (Kreuzigung), einer sehr großen historisierten Initiale und einem kleinen Medaillon, sämtlich in Holzschnitt und zeitgenössisch koloriert; mit einem halbseitigen Holzschnitt zur Ermittlung der Sonntagszahl sowie großer, in Rot und Schwarz gedruckter Holzschnitt-Druckermarke am Schluß; außerdem mit einer zehnzeiligen Zierinitiale in Schwarzdruck, einer zehnzeiligen und 12 achtzeiligen Zierinitialen in rotem und schwarzem Druck, sehr zahlreichen Lombarden in Rotdruck, ferner mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System, begleitet von Text mit größeren Versalien in schwarzem und rotem Druck.
Folio (345 x 240 mm).
Brauner Kalblederband des 18. Jahrhunderts über starken Holzdeckeln auf fünf breite, jeweils von drei Streicheisenlinien eingefaßte Bünde, auf den Deckeln Rahmenwerk von Streicheisenlinien und ornamentalen Rollenstempeln, mit rautenförmigen floralen Einzelstempeln in den Freiflächen und kleinen Eckfleurons; mit zwei Lederschließen mit Messingverschluß, blauem Sprengschnitt und papierenen Blattweisern; in moderner brauner, mit Filz ausgelegter Halblederkassette mit goldgeprägtem Rückentitel (Außengelenke eingerissen, Ecken etwas bestoßen, beschabt, eine Schließe defekt, Deckel sowie erste und letzte Lagen mit wenigen Wurmlöchern, durchgehend leicht fingerfleckig).
Aus dem Besitz des Wiener Bischofs Johannes Fabri
Dieses Konstanzer Missale druckte Erhard Ratdolt im gleichen Jahr wie das Passauer; Aufbau, Layout und Typen sind analog, der Kalenderholzschnitt ist identisch, auch der Kanonteil – gleichfalls auf Pergament gedruckt – weist die gleichen drei Holzschnitte von Hans Burgkmair auf. Das Eingangsblatt mit den Schutzheiligen wurde hier entfernt, sodass das Buch direkt mit der Vorrede des Konstanzer Bischofs Hugo von Landenberg einsetzt. Ratdolt druckte unter dem Datum des 8. Oktobers 1505 drei Varianten, nachdem er schon 1504 ein Missale für Konstanz produziert hatte.
Bemerkenswert ist der zeitgenössische handschriftliche Eintrag auf dem ersten Blatt, der das Buch als Geschenk des Wiener Bischof Johannes Fabri (1478 – 1541) ausweist. Dieser amtierte um 1510 als Prediger in Lindau, 1514 als Pfarrer in seiner Heimatstadt und ab 1517 als Generalvikar in Konstanz:


Mit guten Gründen können wir davon ausgehen, daß er das Missale selbst als Priester gebrauchte. Ab 1523 war er Berater des jungen Erzherzogs und späteren Kaisers Ferdinand I. womit sich sein Wirkungskreis nach Österreich verlagerte: 1524 wurde er Koadjutor des Bistums Wiener Neustadt, 1530 Bischof von Wien. In dieser seiner letzten Lebensphase verschenkte er das Konstanzer Missale, das er selbst nicht mehr benötigte.
Dadurch gelangte es wohl wieder in den vorderösterreichischen Raum, irgendwann in das Gebiet der Diözese Augsburg. Denn noch im 18. Jahrhundert wurden ihm zwölf Akzidenzdrucke angebunden, eine achtseitige Broschüre mit sechs Missæ propriæ novissimæ per Diœcesi Augustana, gedruckt ohne Ort und Jahr, sowie elf einzelne Meßformulare zu verschiedenen Anlässen, jeweils auf einem Blatt in Schwarz und Rot gedruckt in Augsburg bei Joseph Simon Hueber zw. Joseph Anton Labhart zwischen 1751 und 1783.
Provenienz: Auf dem ersten Blatt von alter Hand: »Ex com[m]issione […] mi Domini Epi[scopi] Johannes Fabri & […] Viennens[is] etc.«
Literatur: Adams L 1182; Alès 47 (mit falscher Lesung des Datums); Bellot 26; nicht in BM STC German; Bohatta, Nr. 115; Graesse IV, 545; Panzer VI , S. 134, Nr. 27; vgl. Proctor 10642 (Ausgabe 1504); Schottenloher 1922, S. XVIII und Tafel 63-64 (Variante); Van Praet, Roi I, S. 198, Nr. 287; VD 16 M 5582; Weale/Bohatta, Nr. 311; Zapf II , S. 23, Nr. IX .
This Missal for Constance features the same canon woodcut by Hans Burgkmair in very beautiful colouring, but lacks the frontispiece illustration with the patron saints. The canon woodcut, the same in 12a and 12b, is generally considered Burgkmair’s finest achievement in this field.
Missale [Ambianense] . Ad vsum insignis ecclesie Ambianen[sis]. De nouo peroptime correctum / cum consilio et auxilio plurimorum etiam expertoru[m] fideliter emendatu[m]. Rouen, Martin Morin, 1506.
A8 A-M8 N-O6 [52 Bl.] VI 8 VII 6 VIII 4 P-R 8 S6 T-X8 Y-Z6 a-d 8 e-f 6 g8 = 229 [statt: 234] gedruckte Bl.; 52 eingefügte Bl. in Manuskript = zusammen 281 Bl., von alter Hand numeriert 1-209, 300-371. – Die Blätter N6, O1 und O4-6 entfernt; N5 und O2-3 in den Manuskriptteil integriert. – Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot; mit blaßroter Reglierung. – Letzte, unbedruckte Seite zweispaltig und mit Reglierung in Rot und Schwarz zeitgenössisch beschrieben. Mit großer illuminierter Holzschnitt-Initiale und Holzschnitt-Druckermarke in Schwarz und Rot in dreiseitigem Bordürenrahmen auf dem Titel, 4 halbseitigen illuminierten Holzschnitten (etwa 145 x 140 mm) in ganzseitigen Bordürenrahmen (solche auch jeweils auf den Rückseiten), 2 ganzseitigen, in Flüssiggold und Farben illuminierten Kanon-Holzschnitten in Bordürenrahmen, auf deren Versoseiten zwei ganzseitige Miniaturen in Halbgrisaille vom Meister vom Thuison; die Manuskriptseiten überwiegend mit schwarzen Noten auf rotem vierlinigen System, mit 4 sehr großen illuminierten Initialen auf Goldgrund (ca. 110 x 115 mm) mit dem Wappen von François de Halluin (begleitet von Kompartimentbordüren, davon 2 in Schriftspiegel-Länge, die Te igitur-Initiale in ganzseitigem Bordürenrahmen), 75 weiteren große illuminierten Initialen auf Goldgrund und 282 kleineren goldenen Initialen auf abwechselnd altrosafarbenem und blauem Grund; der gedruckte Text mit zahlreichen größeren und kleineren Holzschnittinitialen, meist in Rot, die größeren mit gemalten Höhungen in Blau, mit schwarzen Noten auf rotem vierlinigen System.
Folio (355 x 255 mm).
Brauner Kalblederband des 18. Jahrhunderts auf sechs von blindgeprägten Querfileten begleitete Bünde, mit goldgeprägtem Rückentitel, auf den Deckeln zwei doppelte und ein einfacher Blindfiletenrahmen, dazwischen in den Ecken goldgeprägte Monogramme, zentral ein goldgeprägtes gekröntes Wappensupralibros, mit blindgeprägten Bordüren auf Steh- und Innenkanten sowie mit papierenen Blattweisern; in weinroter, mit Filz ausgelegter Lederkassette mit Rückenvergoldung (Einband mit kleinen Schabstellen, Kapitale mit kleineren Läsuren, vordere Außengelenke mit Einrissen, erste Bl. und letzte Lagen mit wenigen Wurmlöchern).
von Amiens von 1506, das für Bischof François de Halluin individuell zusammengestellte Pergamentexemplar mit 52 prachtvoll illuminierten Manuskriptblättern und zwei ganzseitigen Grisaille-Miniaturen


Unikales Exemplar mit Illumination im nordfranzösisch-flandrischen Stil um 1500
Ursprünglich stand die flandrische Familie van Halewijn im Dienst der Herzöge von Burgund. Doch nach dem Tod Karls des Kühnen wechselte Louis d’Halluin auf die französische Seite, avancierte zum Kammerherrn König Ludwigs XI . und seiner Nachfolger und wurde 1512 zum Gouverneur der Picardie ernannt. Von seinen drei Söhnen war der jüngste, François de Halluin (1483 – 1538), besonders prunkliebend. Schon mit 19 Jahren wurde ihm das Bistum Amiens zugesprochen, die Abtei Le Gard erhielt er gegen den Willen des Konvents, der von den Brüdern gewählte Konkurrent wurde unter mysteriösen Umständen ermordet [vgl. Barbier]. Die ständigen Zwistigkeiten mit seinem Domkapitel erreichten einen Höhepunkt, als der baufreudige Bischof im Chorraum der Kathedrale von Amiens neben dem Hochaltar für sich selbst ein Grabmonument errichten ließ, das jene der Stadtheiligen Firmin und Honoré noch übertraf [vgl. ebd.]. Lebte er wie ein repräsentationsfreudiger Renaissancefürst, so ereilte ihn ein standesgemäßer Tod: Im Juni 1538 wurde er auf der Jagd in den Wäldern von Le Gard von einem Wildschwein angegriffen und erlag kurz darauf seiner Verletzung. Nicht in seinem Mausoleum im Dom von Amiens, sondern im Zisterzienserkloster Le Gard fand François de Halluin seine letzte Ruhe.
Nicht anders als prunkvoll kann man dieses Missale nennen, das er sich als junger Bischof wohl unmittelbar nach dem Druck im Jahre 1506 zusammenstellen ließ. Den Erstdruck eines Missales für Amiens hatte Jean du Pre 1497 in Paris herausgebracht, im Folgejahr auch einen auf Pergament. 1505 druckte Martin Morin in Rouen eine Quart-Ausgabe. Auch diese vorliegende vierte Ausgabe des Missale Ambianense auf kräftigem Pergament stammt aus seiner Offizin.
Zur Ausstattung gehören vier etwa halbseitige Holzschnitte, die von ganzseitigen Bordürenrahmen eingefaßt sind; in einer Art ›Nachhall‹ sind jeweils auch die Rückseiten von Bordüren eingerahmt. Gezeigt werden die Gregorsmesse zum ersten Advent [A1], die Auferstehung [L1], die Kreuzigung des heiligen Andreas [T1] und eine vierteilige Darstellung aller Heiliger. Die Holzschnitte sind sorgfältig koloriert, wobei der lebhafte Kontrast zwischen Rot und Blau abgemildert wird durch Baunrot sowie lichtere Braun-, Blau-, Grün-, Gelb- und Grautöne. Dies alles ist solide Werkstattarbeit.
Ganz anders das prachtvolle Schau-Spiel, das sich auf den ganzseitigen illuminierten Kanonbildern, der Kreuzigung und der Maiestas Domini, auf ihren jeweiligen mit ganzseitigen Miniaturen in Halb-Grisaille bedeckten Versoseiten sowie auf 52 eingefügten Manuskriptblättern den Augen darbietet. Die beiden Kanonholzschnitte wurden weit intensiver koloriert als die übrigen Buchillustrationen, auch die schwarzen Linien meist übermalt, so daß sich der Eindruck von Miniaturen ergibt. Die Farbpalette ist noch vielfältiger und die Plastizität durch Schattierungen wie auch durch Goldhöhungen stärker herausgearbeitet. ›Technisch‹ vermitteln sie also gewissermaßen vom Druck zum Manuskript, in das sie ebenso integriert sind wie das gedruckte Blatt N5; auch der Text der vier entfernten Blätter der Lage O wurde wohl in die Handschrift aufgenommen. Die rückwärtige Bemalung der beiden Blätter mit den Kanonbildern durch zwei ganzseitige Miniaturen läßt ebenfalls darauf schließen, daß diese ›Sonderanfertigung‹ bereits mit dem Druck des Pergamentexemplars von François de Halluin in Auftrag gegeben wurde, dessen Wappen fünfmal zu sehen ist. Der insgesamt 52 Blätter umfassende handschriftliche Einschub, überwiegend mit Noten, wurde nicht zuletzt deshalb so umfangreich,

weil die kalligraphische Schrift besonders groß ist: Auf einer Seite fanden nur 15 Textzeilen bzw. fünf Notensysteme mit fünf Textzeilen Platz. Vermutlich mußte der fast noch jugendliche Bischof besonders genau hinlesen, weil er beim Zelebrieren der Messe nicht textsicher war.
Die auffallend prachtvolle Ausstattung des Manuskriptteils ist charakteristisch für die Buchkunst des nördlichen Frankreich und Französisch-Flanderns um 1500, stilistisch ist sie jedoch nicht ganz homogen. Die großen Initialen am Beginn besonders wichtiger liturgischer Abschnitte sind mit ihrem Dekor von Efeublattranken auf Blattgoldgrund konservativer als diejenigen mit Blumen und Früchten auf Flüssiggoldgrund. ›Modern‹ wirken auch die mit Flüssiggold gehöhten, farblich sehr elaboriert differenzierten Kompartimentbordüren mit Früchten, Akanthusblättern und Blüten, man vergleiche hier insbesondere die Kompartimente in der Umrißform halbierter Fleurs de lys zur Te-igitur-Eröffnung [Bl. 146]. Anscheinend war hier derselbe Künstler am Werk wie bei den Kanonholzschnitten; bei der Kreuzigung versuchte er, den Bordürenstil durch die Beifügung von Flüssiggold, grünen Blättern und Früchten dem der übrigen Miniaturen anzupassen. Während dieser Dekor insgesamt als typisch französisch anzusprechen ist, setzen die beiden ganzseitigen Darstellungen der Heiligen Franziskus und Barbara in Halb-Grisaille einen anderen geographischen Akzent, der auf einen flämischen oder in Flandern ausgebildeten Meister hindeutet. Der Künstler der beiden Grisaille-Miniaturen dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit der picardische Maler mit dem Notnamen „Meister von Thuison“ (genauer Thuison-les-Abbéville) sein, der um 1500 das bekannte Retabel für die Kartause von Thuison schuf, das sich heute im Art Institute of Chicago befindet, siehe France 1500, 2010, Nr. 174 mit vier Farbtafeln S. 338-339: die Maria dort sowohl als auch eine Reihe von fast identischen Gesichtszügen zum Portrait von François Halluin und seinem Namensheiligen legen diesen Schluss nahe, vor allem die sehr auffallende und charakteristische Wiedergabe der Augenpartie und der markanten Nasen sprechen dafür, dass wir es hier mit einem neu entdeckten Werk dieses bedeutenden Künstlers zu tun haben! Siehe hierzu auch Peindre à Amiens et Beauvais au XVe et XVIe siècles, 2021, S. 121-125, wo ein weiteres Werk des Künstlers von 1505, ehemals bei Jussupow, erwähnt wird, als für einen „François“ (weil ebenfalls mit dem Heiligen Franziskus dargestellt) gefertigt – allerdings stimmt das dortige Wappen nicht mit dem unseren überein.
Grundsätzlich waren Kooperationen zwischen französischen ›Dekorateuren‹ und flandrischen Illuminatoren durchaus üblich [vgl. Brinkmann 245-260]. In unserem Missale ähnelt die Dekoration der Kompartimentbordüren und zweizeiligen Initialen denen zweier Stundenbücher in Paris und Hannover, von denen letzteres die gleiche Mischung aus ›altmodischen‹ und modernen Elementen aufweist [vgl. ebd., Abb. 218 und 221-223]. Generell deutet die Verbindung von flämisch wirkenden Miniaturen und französischem Dekor also auf die Grenzregion, die Susie Nash als »melting pot« der Stile im späten 15. Jahrhundert beschrieb. Doch angesichts der prominenten Präsenz, ja Selbstdarstellung des Bischofs François de Halluin – er selbst kniet vor seinem Namensheiligen Franz von Assisi, der gerade die Stigmatisierung empfängt – und angesichts seiner flandrischen Familienherkunft können wir unterstellen, daß der flämische Einschlag seinen persönlichen Vorlieben zu verdanken ist.
Genau dafür scheint auch der nächste greifbare Besitzer ein feines Gespür besessen zu haben. Der Einband des 18. Jahrhunderts verweist durch das Wappensupralibros und das Monogramm (V mit





Kreuz) auf Arnould-Hugues-Joseph Van der Cruisse, seigneur de Waziers et de Wervick (1712
1793), Sproß einer in Lille ansässigen adligen Beamtenfamilie, einen lokalhistorisch interessierten Bibliophilen: »il enrichit considérablement la bibliothèque qui lui venait de sa famille et sauva, lors de l’expulsion des Jésuites en 1762 leur bibliothèque, qui leur fut rendue quand ils revinrent« [Olivier 903]. Diese Provenienz führt nun in den unmittelbaren Grenzbereich zwischen Flandern und Frankreich: Der Doppelort Wervick/Wervicq, dessen Seigneurie Van der Cruisse innehatte, liegt beiderseits des heutigen Grenzflusses Leie – und zugleich in direkter Nachbarschaft zu der Stadt Halluin (Halewijn), nach der François de Halluin seinen Namen trug.
Alle frühen Ausgaben des Missale Ambianense sind extrem selten und jeweils nur in ein oder zwei Exemplaren bekannt. Von der vorliegenden Ausgabe besitzt die Bibliothèque municipale von Amiens zwei – inkomplette? – Pergamentexemplare, kein weiteres ist bekannt. Von der auf dem Titel erwähnten Teilauflage auf Papier ist überhaupt kein Exemplar überliefert.
Provenienz: Die Zusammenstellung des Exemplars erfolgte wohl unmittelbar nach dem Druck für den Amienser Bischof François de Halluin oder Halewijn (1483 – 1538); sein Wappen wurde im Manuskriptteil in alle großen Initialen eingemalt, auf einer der Miniaturen kniet er betend mit seinem Wappenschild vor seinem Namensheiligen Franziskus. Aus europäischem Antiquariatshandel.
Literatur: Nicht bei Adams; Aquilon/Girard, Nr. 18; nicht in BM STC French; Frère II , 315; nicht bei Van Praet; Weale/Bohatta, Nr. 15. – Zu Halluin: Barbier (erwähnt unser Missale). – Zum

Manuskript: Vgl. Brinkmann, S. 245-280 und Abb. 218-239; Morgan u. a., S. 140f.; Nash.
The illuminated Missal of Amiens printed in 1506 with half-page and full-page coloured woodcuts, one of only three known vellum copies, contains 52 additional illuminated manuscript leaves: Bishop François de Halluin had the copy made for his personal use in unheard-of splendour. His coat of arms was painted into the large initials in the manuscript part, and on a full-page miniature he kneels praying with a coat of arms before his namesake saint Francis. The strikingly splendid, unique decoration of the manuscript part is characteristic of the book art of northern France and French Flanders around 1500, as evidenced in particular by the painting technique of half-grisaille in the two full-page miniatures of Saints Francis and Barbara by the Master of Thuison-les-Abbéville from Picardy.

Missale Saltzeburgense . Wien, Johannes Winterburger, 1506.
Π 8 †4 a-r8 s 6 t8 v6 Π 2 + 6 x6 y-z 8 A-I10 K-L 6 = 12 Bl., 156 gezählte Bl., 1 Bl. (Kreuzigung), 6 Bl., Bl. 157-262 = 281 [statt: 282] Bl. – Das leere Bl. des Kanonteils wurde bis an den Falz abgetrennt, der verbliebene Steg auf das zweite Kanonblatt (nach der Kreuzigung) aufgeklebt. – Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot.
Mit einem ganzseitigen, aus zwei Teilen zusammengesetzten Holzschnitt (Schutzheilige), einem ganzseitigen, in Gold und Farben illuminierten Holzschnitt (Kreuzigung), einer sehr großen historisierten Initiale und einem kleinen Medaillon, gleichfalls in Holzschnitt und zeitgenössisch illuminiert; mit einem halbseitigen Holzschnitt zur Ermittlung des Sonntagsbuchstabens sowie rotgedruckter Holzschnitt-Druckermarke am Schluß; außerdem mit rund 40 neun- bis vierzeiligen Schmuckinitialen, meist auf schwarzem, vereinzelt auf rotem Grund, sehr zahlreichen vier- bis einzeiligen Lombarden in Rotdruck sowie mit Paragraphenzeichen, ferner mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System, begleitet von Text mit größeren Versalien in schwarzem und rotem Druck.
Folio (314 x 221 mm).
Brauner Kalblederband der Zeit über Holzdeckeln auf drei breite, von Streicheisenlinien begleitete Bünde, mit Semis von Blütenstempeln in den Rückenfeldern, auf den Deckeln Rahmenwerk von Streicheisenlinien und ornamentalem Rollen- bzw. seriell gesetztem Einzelstempel, das von einer Platte mit Rankenwerk gefüllte Mittelfeld dreiseitig (hinten: vierseitig) umgeben von gemalter(?) Blütenbordüre bzw. oben von kalligraphischem »Missale« in Flüssiggold; mit ziselierten Mittel- und Eck-Buckelbeschlägen, sowie Schließbeschlägen mit intakten Schließbändern, mit Resten von ledernen Blattweisern (Einband mit geringfügigen Schabstellen und kleinen Einrissen am Kopf, anfangs etwas fingerfleckig, meist unscheinbarer Feuchtfleck am unteren Innensteg, erster Holzschnitt mit kleinen Wurmlöchern außerhalb des Bildes).
Als König Maximilian I. im Jahr 1490 das unter Matthias Corvinus besetzte Wien zurückeroberte, setzte dort ein Aufschwung ein, der sich auch in der Buchgeschichte widerspiegelt. Der Drucker Johannes Winterburger trat erstmals 1492 an die Öffentlichkeit; nach 1500 wurde er »der liturgische Drucker im österreichischen Raum schlechthin« [Durstmüller 25]. Mit einem Missale für Passau trat Winterburger 1503 in unmittelbare Konkurrenz zu dem berühmten Erhard Ratdolt, der im selben


Jahr sein drittes Missale Pataviense druckte. Schon bald überflügelte ihn der Wiener: 1507, 1509, 1512 und 1513 erhielt er Aufträge zu weiteren Ausgaben. Kaum direkte Interessenüberschneidungen gab es hingegen mit Bezug auf das Bistum Salzburg. Ein Salzburger Missale war 1492 erstmals gedruckt worden, Winterburger erhielt den Auftrag zu der hier vorliegenden vierten Ausgabe des Jahres 1506. Die sorgfältig gesetzten und korrigierten, zweifarbig gedruckten, mit Holzschnitten, Initialen und Musiknoten versehenen liturgischen Bücher sind ohne Zweifel seine »schönsten und repräsentativsten Erzeugnisse« [ebd.].
Möglicherweise trieb ihn die Konkurrenzsituation mit Ratdolt an, denn Anton Durstmüller beobachtete, »daß sich der Wiener Drucker mit der Technik seines Kollegen auseinandergesetzt haben muß« [ebd. 24]. Zum Vergleich fühlt man sich herausgefordert, wenn man Winterburgers Salzburger Missale von 1506 neben Ratdolts Passauer von 1505 hält: Dessen Missale für den niederbayerischen Suffragan übertrifft das für den österreichischen Metropoliten schon von der schieren Größe her deutlich, ohne protzig zu wirken – ein breiterer Rand, ein größerer Satzspiegel und schlankere Lettern bewirken eine kontemplative Stimmung. Ähnliches gilt für die Auszeichnungsschriften: Wohl hatte Winterburger auf die stete Vermehrung seiner selbst geschnittenen Typen besonderen Ehrgeiz verwandt [vgl. Dolch 20], auch konnte er hier erstmals seine großen Zierinitialen mit Blattornamentik auf schwarzem Grund präsentieren [vgl. ebd. 24] – doch sind die Initialen und Lombarden Ratdolts eine Spur feiner. Etwas Großzügig-Monumentales haben auch die drei ganzseitig dargestellten Passauer Schutzheiligen. Das Salzburger Missale zeigt demgegenüber einen zweiteiligen Arma-ChristiHolzschnitt mit architektonischem Rahmen, in dessen Tympanon in diesem Fall die Heiligen Rupert und Virgil vor dem Salzburger Dom eingesetzt wurden. Die in Deutschland gebräuchliche »Manier der Stöckezusammensetzung« [Gollob 1936, 87] mochte drucktechnisch effektiv sein, ästhetisch befriedigend war sie umso weniger, als die rein dekorative italienische Vorlage »höchst unitalienisch in zwei Stockwerke gegliedert« und beide Teile jeweils »als Raumausschnitt mit natürlichen Körpern behandelt« wurden« [Gollob 1926, 56].
»Künstlerisch hervorragend« [Dolch 27] ist hingegen der dem jungen, bis 1505 in Wien tätigen Lucas Cranach d. Ä. zugeschriebene Holzschnitt zur Ermittlung des Sonntagsbuchstabens: Auf schwarzem Grund und in extrem plastischer Beleuchtung stürzt eine Eule dramatisch über eine Taube her. Auch Hedwig Gollob sprach hier von einer »prachtvollen Spitzenleistung« [Gollob 1936, 84], die in der harmlos strahlenden Sonne im Passauer Pendant bei diesem untergeordneten Bildmotiv freilich gar nicht angestrebt wird.
Ein Vergleich gerade der beiden Kreuzigungsbilder zum Canon missae ist umso mehr berechtigt, als das Salzburger erstmals für Winterburgers Missale Pataviense 1503 erschien – also in direkter Konkurrenz zu Ratdolts paralleler Ausgabe [vgl. Gollob 1925, S. 92]. Die gleichfalls Cranach zugeschriebene Salzburger Kreuzigung hält das hohe Qualitätsniveau vollauf. Hedwig Gollob arbeitete den Entwicklungsschritt gegenüber etwas früheren Wiener Darstellungen heraus. »Die Szene ist viel natürlicher, irdischer aufgefaßt. […] Hier ist gerade das menschliche Leid dargestellt in seinen Qualen, im Verzerren der Züge, im schmerzlichen Aufblicken Mariens, im krampfhaften Ringen der Hände bei Johannes. Es ist das Transzendentale verlorengegangen, aber als etwas Neues das Natür-

lich-menschliche hinzugekommen«: Maria und Johannes unter dem Kreuz »stehen schwer auf«, ihre Gewänder sind »breit und massig«, selbst das »Eigenleben jedes einzelnen Gegenstandes«, bis hin zu den sprießenden Grashalmen, ist »ziemlich stark betont« [Gollob 1926, 16f]. Dabei handele es sich um »jene Stilwandlung, die gerade damals ziemlich allgemein vom gotischen Transzendentalismus zur Auffassung des 16. Jahrhunderts hinüberleitet« [ebd. 17]. Die intensive Farbigkeit unterstützt diesen Eindruck. Burgkmair sparte sich hingegen jeglichen Detailrealismus, ließ Mittel- und Hintergrund völlig frei und lenkte die Aufmerksamkeit des Betrachters ganz auf die Innerlichkeit der Beteiligten. Eine Anomalie fällt bei dem großen Initial »T« zum »Te igitur« auf, mit dem der Canon beginnt: Eigentlich müßte es eine heilige Messe darstellen [vgl. Gollob 1925, 92] – und nicht David und Moses. Auch das Kußbild eines Medaillons mit dem Osterlamm findet sich nicht im Missale Saltzburgense von 1506. Der auf Pergament gedruckte Kanonteil muß also aus einem anderen Missale übernommen worden sein. Interessanterweise ergab sich der gleiche Befund bei einem weiteren Exemplar in der Auktion 64 von Zisska & Lacher. Dort hielt man den Kanonteil für eine Übernahme aus Winterburgers Missale Pataviense von 1503, obwohl er »mit keinem der drei bei Gollob verzeichneten Drucke übereinstimmend« war. Darum nehmen wir das auch zeitlich näherliegende Missale Olomucense von 1505 als Quelle an, bei dem der Bildbestand wohl identisch ist [vgl. Gollob 1925, Nr. 167, vgl. S. 81]. Offenbar stellte Winterburger beim Druck des Olmützer Missales einige überzählige Kanonteile auf Pergament her, die er auch beim Salzburger Missale ›einsetzte‹, um sich hier den Druck auf Pergament ganz zu sparen – ein weiterer feiner Qualitätsunterschied gegenüber Ratdolt, der für den ›Laien‹ praktisch nicht bemerkbar war.
Daß unser Exemplar nicht im Nachhinein von einem bibliophilen Sammler ›zusammengestückt‹ wurde, sondern den verlagsfrischen Originalzustand widerspiegelt, findet eine Bestätigung im Einband. Auch diesen möchten wir als originären ›Verlagseinband‹ ansprechen. Schon Walther Dolch bemerkte, daß Winterburger die kostbaren liturgischen Drucke »nicht schutzlos in die Welt hinaussandte; wenigstens einen Teil der Auflage ließ er bereits in Wien binden, denn eine ganze Reihe gleicher Missalbücher besitzt gleichen Einband oder ähnlichen Einband mit gleichartigen Stempeln« [Dolch 31f.]. Damit aber »wäre eine moderne Verfahrensweise um Jahrhunderte vorweggenommen« [Durstmüller 26f.]. Auch an den Wiener Einbänden läßt sich die Zäsur erkennen, die sich mit der Rückeroberung der Stadt durch Maximilian vollzog. Bis dahin waren die Buchdeckel meist durch eine »Rautenteilung innerhalb eines oder mehrerer Rahmen« [Holter 124] geprägt. Nun drangen auch in der Einbandkunst von mehreren Seiten Neuerungen ein, insbesondere »von Augsburg und Nürnberg«, bei einer »gewisse[n] Berücksichtigung italienischer Formvorstellungen, da diese in der östlichen Nachbarschaft unter Mathias Corvinus und König Wladislas schon stark Fuß gefaßt hatten«; in Gestalt von »Platten« und »Rollen, neben und mit den bisher allein maßgeblichen Einzelstempeln« [ebd.]. Eben dieser Entwicklungsstufe entspricht unser Einband, der demnach als strikt zeitgenössisch anzusehen ist. Betrachten wir den kreisförmigen »Blattwirbel«-Stempel und das »Rautenwerk, gefüllt mit Vierblatt« genauer, so sticht die große Ähnlichkeit mit zwei in der Einbanddatenbank aufgeführten Stempeln des etwas später nachweisbaren Wiener Slatkonia-Meisters [Werkstatt w003131] ins Auge. Die Vermutung liegt nahe, daß dieser auch für Winterburger gearbeitet hat.
An den Innovationen wie auch an den unterschwelligen Heterogenitäten unseres Missale Saltzburgense läßt sich die stürmische Entwicklung von Winterburgers Offizin um die Jahrhundertwende deutlich ablesen – gerade auch im Vergleich mit der abgeklärten Stilsicherheit des Augsburgers Ratdolt. Während dieser jahrzehntelang Erfahrungen in Venedig sammeln konnte, gibt es in Winterburgers Drucken immerhin »viele Dinge«, die »durch südliche Beziehungen zu erklären sind« – so »sein Signet mit den weißen Ranken auf dem schwarzen Grund, das eine »sehr deutliche Nachahmung italienischer Signete« [Gollob 1936, 83] darstellt. In seinen Initialen und Leisten bot »das oberitalienische Element« hingegen »nur eine gewisse formale Grundlage für den wienerischen Charakter des Ganzen« [ebd. 84], wobei durch die habsburgischen Beziehungen in die Niederlande auch »westliches Material« [ebd. 85] hereinspielte. So sehr die beiden Missalien Ratdolts und Winterburgers einander durch die strenge liturgische Form entsprechen: Spürt man dort die altehrwürdige Aura Augsburgs, so hier die unruhigen Aufbrüche im jungen Wien.
Provenienz: Auktion Hartung & Karl 49, München, 7.9.5.1985, Nr. 250 (mit 2 Abb., davon eine farbig auf dem Umschlag): Zuschlag DM 60.000 plus Aufgeld, an H. P. Kraus.
Literatur: Nicht bei Adams; Bohatta, Nr. 418; Denis, Nr. 18; Dodgson II , S. 280; Dolch, S.56ff., Nr. 42; Gollob 1925, Nr. 171; Panzer IX , S. 2, Nr. 8; nicht bei Van Praet; VD 16 M 5621; Weale/Bohatta, Nr. 1381; Zisska & Lacher 64, Nr. 226; zu Winterburger: ADB 43, 477f.; Durstmüller 23-27; Gollob 1936; Mayer 21ff.; zu den Holzschnitten: Gollob 1926, Frontispiz, S. 15f., 20f. und 55ff.
The Salzburg Missal, printed by Johannes Winterburger in Vienna in 1506, reflects the rapid upswing of Vienna under Emperor Maximilian I also in the art of printing. The two woodcuts by Lucas Cranach the Elder are outstanding, especially the illuminated full-page depiction of the Crucifixion in the canon section printed on vellum. The strictly contemporary, extraordinarily beautifully preserved Viennese binding, possibly by the Slatkonia Master, also features characteristic innovations of the stamp decoration. This unheard-of copy already cost over DM 70,000 37 years ago.

Vigerius, Marcus . Decachordum christianum Iulio. II . Pont. Max. dicatum. Fano [dann Pesaro], Hieronymus Soncinus, 1507.
aa 8 a 10 b-z 8 & 8 A 10 B-E8 F10 AA -BB 8 = 7 [statt: 8] Bl. (nachgebunden), 246 gezählte Bl., 16 Bl. – Es fehlt das leere Blatt aa8. – Die Blätter aa2-7 (Index der Kapitelüberschriften am Ende des Haupttextes) zwischen den Lagen F und AA eingebunden. Gedruckt auf Pergament.
Mit 10 großen, jeweils von vierteiligen Bordüren umrahmten, und 33 kleineren (davon 6 wiederholten) Holz- oder eher Metallschnitten, die kleineren bis auf zwei auf Cribléegrund.
Folio (310 x 203 mm).
Nachtblauer Maroquinband des frühen 19. Jahrhunderts auf fünf falsche Doppelbünde, mit goldgeprägtem Titel etc. im 2.-4. Rückenfeld und reicher ornamentaler Goldprägung in den übrigen drei Kompartimenten; die starken Deckel mit neunfachem Goldfiletenrahmen, in den Ecken stilisierte Blüten, mit dreifachen Goldfileten auf den Stehkanten, auf den Innenkanten breites Rahmenwerk aus Fileten und jeweils mittigen Ornamenten, mit Pergamentdoublüren, doppelten Pergamentvorsätzen und Ganzgold- über Rotschnitt, von Charles Lewis; in moderner, mit Velours ausgelegter nachtblauer Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel (erste Lage aus einem anderen Exemplar ergänzt, leeres Bl. aa8 fehlt, Bl. p6 mit kleinerer Reparatur am unteren Rand, einige Bl. auf der Haarseite angegilbt).
Der schönste aller Soncino-Drucke
Marco Vigerio della Rovere (1446 – 1516) war auf Wunsch seines Großonkels, des damaligen Franziskanergenerals und späteren Papstes Sixtus IV., in den Franziskanerorden eingetreten, um eine kirchliche Karriere zu machen: 1476 wurde er Bischof von Senigallia, 1502 auch von Ventimiglia, 1503 wurde er unter seinem Cousin, dem neugewählten Papst Julius II ., Gouverneur der Engelsburg, 1505 Prokurator seines Ordens und Kardinal, 1506 Erzbischof von Trani. Im selben Jahr zog er sich allerdings ins Studiolo zurück, um diese aszetische Schrift über die zehn wichtigsten Ereignisse im Leben des Heilands zu verfassen, die er Julius widmete. Erschlossen wird sie von zwei umfangreichen Registern.
Unsteter war der Lebensweg des jüdischen Druckers Gerson ben Moses alias Girolamo Soncino (1460 – 1534). Sein Großvater, ein Arzt, war aus Speyer ins lombardische Soncino ausgewandert; bei seinem Onkel, hatte er eine Druckerlehre gemacht [vgl. Servolini 110], um sich mit der Produktion vorwiegend hebräischer Schriften eine eigene Existenz aufzubauen. 1491 – 1494 war er

in Brescia, 1496/97 im nahegelegenen Barco, ehe er sich 1501 in Fano als dortiger Erstdrucker niederließ. Die Stadt an der Adria galt als »più tollerante verso gli ebrei« [Ascarelli/Menato 200] und erschien ihm möglicherweise als ein guter Ausgangspunkt für den Export hebräischer Drucke in die Levante. Außerdem hatte dort der Humanist Lorenzo Astemio seinen Wohnsitz genommen, den Soncino in der Folgezeit als »editore ed il correttore delle opere in latino ed in volgare« [ebd.] engagierte. Möglicherweise um kirchlichen Behelligungen zuvorzukommen [vgl. Servolini 110], druckte er auch das Decachordum des Kardinals Vigerius, wo im Kolophon die Franziskaner Guido de Sancto Leone und Francesco Armillino als Korrektoren genannt sind.
Soncino hatte »bravi compositori e impressori e l’eccellente intagliatore di punzoni e matrici Francesco Griffo di Bologna« [ebd.] mit nach Fano gebracht. Das in humanistischer Antiqua gedruckte und mit zehn ganzseitigen Illustrationen ausgestatte Decachordum gilt als »le plus beau livre qui soit jamais sorti des presses des Soncino« [Fumagalli 119] – es war zugleich das vorläufig letzte, das in Fano entstand: 1507 kam die Stadt unter die Herrschaft des Kirchenstaats, Soncino verzog nach Pesaro, wo auch der Druck zuendegebracht wurde. Bis 1519 pendelte er zwischen Fano, Ortona a Mare und Pesaro, später war er in Rimini und Cesena anzutreffen, aber »le difficoltà da lui incontrate per motivi religiosi, per invidie o gelosie, lo decisero infine ad allontanarsi dall’Italia« [Ascarelli/Menato 201]. 1529 ist ein hebräischer Druck von ihm in Saloniki nachgewiesen, danach zog er weiter nach Konstantinopel, wo Girolamo Soncino, »le plus célèbre des imprimeurs de cette famille« [Fumagalli 117] starb.
Das Buch wird optisch strukturiert durch die durchdachte Abfolge von zehn großen und 33 kleinen Holz- bzw. wohl eher Metallschnitten [vgl. Mortimer]: Großzügig folgen zunächst sieben ganzseitige Illustrationen, beginnend mit der Verkündigung an Maria und vier Szenen aus der Kindheit Jesu. Wo nicht gerade der Bretterstall zu Bethlehem gezeigt wird, blicken wir konsequent perspektivisch in prächtige Renaissance-Innenräume. Auch Jesu Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag und die Szene auf dem Ölberg muten eher idyllisch an, bevor die eigentliche Passionsgeschichte in 33 kleinen Darstellungen geschildert wird. Der Cribléegrund vermittelt eine Atmosphäre gesteigerter Unruhe, fast man möchte meinen, der Himmel höre gar nicht mehr auf zu weinen. Das letzte Abendmahl wird auf Blatt o5r und p2v in zwei Zuständen wiedergegeben, das zweite Mal mit einer veränderten Handhaltung Christi. Am Ende der Serie drängt sich dem Betrachter ein schier unentrinnbares Wiederholungsmuster auf: Auf die Kreuztragung folgen sieben Bilder, deren sechs – unterbrochen nur vom Würfeln der Soldaten um Jesu Gewand – den Gekreuzigten in immer neuen Variationen darstellen! Daß gerade die ersten beiden identisch sind und einander auf den Blättern A1v und A2r gegenüberstehen, ist in diesem Zusammenhang sicherlich kein Versehen, zumal dasselbe Bild die triste Reihe auf B8r auch beschließt. Dann aber kommt auf C1v als fulminantes Großbild die Auferstehung. Bei diesem Anblick verweilte auch ein früher Leser: Gegenüber füllte er – zum einzigen Mal – mit der Feder den für eine Initiale freigehaltenen Raum mit einem verschnörkelten »S«. Jesus schwebt förmlich über dem geöffneten Felsengrab, bevor er auf dem nächsten ganzseitigen Bild zum Himmel aufsteigt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, nun wieder in einem streng zentralperspektivisch gesehenen Renaissance-Innenraum, steht als Schlußbild.





Alle großen Bilder sind, ebenso wie der Titel mit Vigerios Wappen, von schwarzgrundigen vierteiligen Bordürenrahmen in zwei ähnlichen Varianten umgeben. Ein Schnitt trägt die Signatur » FV«, hinter der Nagler Florio Vavassore vermutete, was für diesen jedoch zu früh erscheint; Essling sah darin einfach das Kürzel für »Fano Vrbe«. Auch die Signatur »L« auf einem zweiten Schnitt, für die Tammaro de Marinis Lucantonio degli Uberti vorschlug, kann nicht sicher aufgelöst werden. Insgesamt jedoch entspricht der Stil »venezianischen Missale-Illustrationen aus dem Kreis um Giovanni Bellini« [Fünf Jahrhunderte].
Das Erbauungsbuch des Marcus Vigerius fand weite Verbreitung; 1517 erschienen zwei weitere Ausgaben. Von der ersten Ausgabe kannte Van Praet drei Exemplare auf Pergament – eines in der Pariser Bibliothèque Nationale, eines in der Florentiner Biblioteca Riccardiana und eines, das der Londoner Buchhändler Longman in seinem Katalog von 1818/19 anbot: das unsrige! Er verkaufte es an George Hibbert (1757 – 1837), auf dessen Auktion 1829 es als »elegantly bound in blue morocco by Lewis« beschrieben und von Bohn ersteigert wurde, der es wiederum an Beriah Botfield verkaufte – schon damals ohne die erste Lage, die später aus einem anderen Exemplar ergänzt wurde. Der kinderlos verstorbene Sammler vererbte seine Bibliothek an die Familie Thynne, Marquesses of Bath, auf Longleat House in Wiltshire. Zwei weitere Pergamentexemplare befinden sich in der British Library und in der Universitätsbibliothek München.
Provenienz: Longman Catalogue, London 1818/19, Nr. 10069, für £ 15-15-0 verkauft an George Hibbert (1757 – 1837). Auf dessen Auktion 1829 als Nr. 8434 an John Bohn für £ 15-10-0 und von diesem an Beriah Botfield (1807 – 1863) zum Preis von £ 31-0-0 (Bleistiftvermerk auf dem Innendeckel). – Auktion Highly Important Printed Books from Beriah Botfield’s Library, Christie’s, London, 30.3.1994, Nr. 36 an Breslauer.
Literatur: Adams V 746; Ascarelli/Menato 201; Brunet V, 1216 (erwähnt 2 Pergament-Exemplare, darunter dieses) und Supplement II , 887; De Marinis, Nr. 214; EDIT 16 CNCE 32811; Essling I, S. 145; Fünf Jahrhunderte 64; Fumagalli 119; Graesse VI /2, 313; Isaac 13970; Mortimer, Italian, Nr. 537; Nagler, Monogrammisten, II , Nr. 2536 (Vavassore); Panzer VII , S. 2, Nr. 11; Passavant I, S. 141f.; Rahir 672; Sander III , 7589, und VI , Abb. 738-740; Servolini 112f. und 115, Nr. 24; Van Praet, Bibliothèque du Roi I, Nr. 413; Wetzer/Welte 12, 950f.; zu Charles Lewis: Howe 58f.
The Life of Jesus by Marcus Vigerius, printed in 1507, with 43 woodcuts, ten of them full-page, from the Venetian circle of Giovanni Bellini, is the most beautiful print by the famous Jewish printer Girolamo Soncino. Only three vellum copies of the first edition are known; this one comes from the estate of George Hibbert and Beriah Botfield and was bound by Charles Lewis in the early 19th century.
Missale ad consuetudinem ecclesie Romane: vna cu[m] dicte ecclesie institutis / co[n]suetudinibusq[ue] elimatissime reuisum atq[ue] impressum: additis plurimis co[m]moditatibus que in ceteris prius impressis omisse fuerunt atq[ue] desiderantur […]. Paris, Guillaume Eustace, 1511.
† 8 a-l 8 m 10 n-z 8 τ 8 A-D 8 E4 10 = 8 Bl., 227 gezählte Bl., 13 Bl. = zusammen 248 Bl. –Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot. – Gedruckt auf Pergament.
Mit halbseitiger Druckermarke auf dem Titel, einer vierseitigen Bordüre und sieben Illustrationen von halber Spaltenbreite, alles in Metallschnitt; mit 1 ganzseitigen Kreuzigungs-Holzschnitt; ferner mit sehr zahlreichen sieben- bis neunzeiligen und vielen vier- bis fünfzeiligen MetallschnittInitialen auf Cribléegrund, mit zweizeiligen Lombarden in Rotdruck sowie mit Paragraphenzeichen, ferner mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System.
Oktav (171 x 107 mm).
Moderner violetter Samtband über Holzdeckeln auf fünf Bünde, mit Schließe mit ziselierten Silberbeschlägen, Pergamentvorsätzen und Ganzrotschnitt; in mit blauem Filz ausgelegter weinroter Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel, signiert »J. & S. Brockman« (Bünde und Kanten berieben, Bl. C3-4 mit originärer Randfehlstelle und minimalem Textverlust, vereinzelt etwas fleckig).
Ein Pariser Pergament-Missale – klein und fein
Unter allen Missalien in unserer Sammlung ist dieses mit Abstand das kleinste, zugleich besonders zierlich und fein: Dies betrifft sowohl die Typographie als auch die Illustrationen und Initialen in Metallschnitt, bei denen der Cribléegrund diesen Eindruck noch eigens betont. In der Ausstattung wird auf nichts verzichtet, selbst der Kreuzigungsholzschnitt bringt neben Maria und Johannes auch Maria Magdalena, vier römische Soldaten – einer davon zu Pferd – und schließlich die beiden mit Jesus gekreuzigten Schächer auf kleinem Raum (122 x 79 mm) unter.
Vor allem aber kommt der preziöse Charakter darin zum Ausdruck, daß das gesamte Missale auf Pergament gedruckt ist. Ebert, Brunet und Graesse erwähnten jeweils ein und dasselbe Exemplar im Besitz von Justin Comte de Mac-Carthy-Reagh; Van Praet kannte ein zweites »à Lyon, chez l’abbé Périchon, chanoine de Saint-Paul«. Die Provenienzkette unseres Exemplars setzt bereits 1629 mit dem etwas versteckten handschriftlichen Besitzvermerk eines Pfarrers ein, der zugleich der »misere par la guerre« gedenkt. Bis ins späte 19. Jahrhundert klafft eine Lücke, schließlich gelangte es in den Besitz der amerikanischen Sammlerin Carrie Estelle Doheny (1875 – 1958), von der noch zwei weitere römische Missalien in unserem Bestand stammen.
Provenienz: Auf Blatt p3v am unteren Rand: »Louis Roch curé de Grilly & vicaire [/] Darmance en Lanne 1629 le 3 de [/] Juin, anne de misere par la guerre«. – Beiliegend vormaliges Vorsatzblatt mit handschriftlichem Besitzvermerk »M. E. Dobson. Feb. 1891«. – Auf dem Spiegel das goldgeprägte Maroquin-Exlibris von Carrie Estelle Doheny, deren Auktion Christie’s, New York, 14.12.2001, Nr. 211.
Literatur: Nicht bei Adams und in BM STC French; Bohatta 325; Brunet III , 1759; Ebert 14151 (Pergament); Graesse IV, 549; Moreau, 1511, Nr. 166; Van Praet, Bibliothèques I, S. 60, Nr. 134; Weale/Bohatta, Nr. 1004.
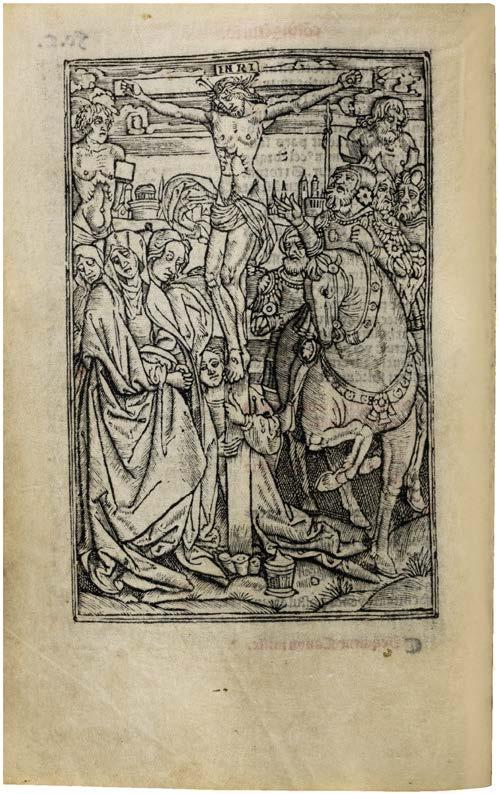
The small-format Missale Romanum of 1511 is distinguished by a particular delicacy of typography, illustrations and metal-cut initials. It is one of only two known copies on vellum and comes from the collection of the famous American female collector Carrie Estelle Doheny.

Missale ad usu[m] ac co[n]suetudine[m] Saru[m] . Paris, Wolfgang Hopyl für Franz Birckmann d. Ä., 1514.
† 8 a-k8 l 6 m-t8 v-y 6, A-H8 I10, A-H6 = 8 Bl., 170 [recte: 168] gezählte Bl., 74 Bl., 64 Bl. = zusammen 314 Bl. – Die (nicht gedruckten?) Blätter e3, e6, h3 und h6 wohl original in Handschrift eingefügt. – Die Foliierung springt nach Bl. 86 (= l6) auf 89 (= m1), aber so vollständig. – Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot. – Gedruckt auf Pergament.
Mit dreiviertelseitiger Verlegermarke in ganzseitigem dreiteiligen architekturähnlichen Rahmen, auf der letzten Seite ohne Rahmen wiederholt, der Rahmen um eine vierte Leiste ergänzt noch dreimal wiederholt, außerdem mit einem ganzseitigen, einem halbseitigen und 29 spaltenbreiten Holzschnitten, sämtlich in Metallschnitt und zeitgenössisch koloriert; ferner mit 28 fünf- bis siebenzeiligen, kolorierten, meist figural geschmückten Initialen, etwa 350 fünf- bis siebenzeiligen Initialen (meist auf Cribléegrund, wenige in Rotdruck), wenigen vier-, einigen dreizeiligen Zierinitialen, sehr zahlreichen zwei- und einzeiligen Lombarden in Rotdruck sowie gedruckten Paragraphenzeichen, ferner mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System.
Folio (304 x 213 mm).
Brauner Maroquinband um 1732 auf sechs goldverzierte Bünde, mit olivgrünem Lederrückenschild, die übrigen Kompartimente mit reicher Vergoldung in dreifachen Goldfiletenrahmen; auf beiden Deckeln goldgeprägtes Wappensupralibros des 19. Jahrhunderts, außen goldgeprägter Dentelle- in dreifachem Goldfiletenrahmen; mit Goldzier auf den Steh- und Innenkanten, mit Marmorpapierund den originalen Pergamentvorsätzen sowie Ganzgoldschnitt (berieben, Kanten leicht beschabt, im Text einige absichtliche Schabstellen u. ä.).
Mit dem Segen der heiligen Ursula: Ein Köln-Pariser Prachtwerk für England
Für die südenglische Diözese Sarum bzw. Salisbury wurden relativ viele Missalien gedruckt – dies ist jedoch »an extreme rare edition« [Quaritch III , 17392], von der man heute »un dizaine d’exemplaires« [Auxerre Auctions], vornehmlich im Besitz englischer und amerikanischer Bibliotheken, kennt. Unter diesen nimmt unser koloriertes Exemplar auf Pergament aus dem Altbesitz der englischen Adelsfamilie Tollemache eine Spitzenposition ein. Das Buch selbst ist das Ergebnis einer bemerkenswerten internationalen Kooperation am Anfang des 16. Jahrhunderts – das Missale für Salisbury wurde in Paris für einen Kölner Verleger gedruckt. Franz Birckmann wurde bereits 1504 »in London erstmals als Buchhändler und Herausgeber eines Missales für Sarum erwähnt«, 1510 erneut »als Lieferant einer



größeren Anzahl von liturgischen Büchern für Sarum, die für ihre Qualität und Sorgfalt bemerkenswert gewesen seien«, ab 1511 wurde er dann »als Buchhändler in Kölner Akten aufgeführt« [Henseler]. Schnell gelang es ihm in der Folgezeit, »den Austausch der literarischen Produktion Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande und vor allem Englands in seine Hand zu bekommen« [ NDB 2, 254]
Eigenartig wirkt der dreiviertelseitige Metallschnitt auf dem Titel, der auf der letzten Seite wiederholt wird: In einer aus drei Etagen bestehenden Loggia zeigt er oben die thronende Gottesmutter mit den drei Weisen, darunter die heilige Ursula, die ihren Mantel schützend über eine unübersehbare Schar kniender Jungfrauen gebreitet hat, ganz unten in einem engen gemauerten Raum ihr Martyrium mit sieben Gefährtinnen, seltsamerweise in einem Kessel, unter dem Flammen hervorschlagen. Was aussieht wie ein ungewöhnliches Titelbild mit dem dreifachen Lob weiblicher Frömmigkeit, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als die überdimensionierte Verlegermarke Birckmanns: Den Triumphbogen ganz oben flankieren links das Wappen Kölns, rechts eine Art Hauszeichen mit einer gespiegelten 4, das in einer seiner anderen Büchermarken prominenter hervortritt. Diese Ikonograpie wurde allerdings mit Bedacht gewählt: Die heilige Ursula ist die Schutzheilige von Köln. Die legendäre britische Königstochter sollte trotz ihres Gelübdes der Jungfräulichkeit den englischen Prinzen Aetherius heiraten, brach zuvor jedoch mit 11000 jungfräulichen Gefährtinnen zu einer Pilgerfahrt auf. Ihre Flotte wurde von einem Sturm in die »Waalmündung getrieben u[nd] gelangte n[ach] Köln. Einer Engelsvision U[rsula]s gehorchend, fuhren sie weiter rheinaufwärts nach Basel« [LCI 8, 521] und wanderten von dort nach Rom. Bei der Rückkehr erlitten sie den Märtyrertod durch die Köln belagernden Hunnen. Nicht zufällig zeichnet ihr Weg von England über Ärmelkanal, Waal und Rhein nach Basel mit Köln als Zentrum die Haupthandelsrouten Birckmanns nach – die gerade auch dem Missale für Salisbury zugrundelagen!
Die heilige Ursula, die »nach d[er] Mutter Gottes […] am häufigsten dargestellte Schutzmantelfig[ur]« [ebd. 522], wählte sich der wagemutige Verleger auch als persönliche Patronin: Über ihrem ausgebreiteten Mantelsaum flattert parallel ein Schriftband mit seiner Devise, dem Seneca-Wort »Ima permutat brevis hora summis«. Geradezu kurios werden die ikonographischen Anspielungen, wenn man ein weiteres seiner Bücherzeichen hinzuzieht: Es zeigt »in einem doppelten Kreis eine Henne mit insgesamt sechs Küken« [Henseler], von denen sie fünf unter ihren Fittichen hält. Was einerseits eine Reverenz an Birckmanns Adresse in der Kölner Straße »Unter Fettenhennen« war –später trug auch sein Haus den Namen »zur fetten Henne« [ebd.], spielt andererseits unübersehbar an Ursula als ganz andere schützende »Glucke« an! Schließlich wird auch des in Paris ansässigen Druckers gedacht: Das auf der Konsolleiste angebrachte Motto »Fortuna opes auferre non animum potest« war das Wolfang Hopyls. Selbstbewußt verweisen die auch in Humanistenkreisen verkehrenden Beteiligten auf dem Titel auf ihre europäische Zusammenarbeit.
Der halbseitige Holzschnitt der Meßfeier und die ganzseitige Kreuzigung ähneln ikonographisch den entsprechenden Darstellungen unserer Missalien von Langres und Évreux – dort wird dem Gekreuzigten zusätzlich effektvoll das Bild des thronenden Gottvaters gegenübergestellt. Diese Erweiterung der Ikonographie scheint hier in gewisser Weise vorbereitet durch die Gottesmutter, die die Weisen aus dem Morgenland nicht im Stall von Bethlehem, sondern gleichfalls auf einem Thron empfängt: Sekundär würde die Verlegermarke so doch auch mit der Funktion eines Titelbildes aufgeladen.










Auch wenn bei weitem nicht alle Illustrationen und Initialen übermalt wurden, schon gar nicht deckend in der Art von Miniaturen, trägt der Druck selbst insgesamt durchaus noch Charakterzüge einer Handschrift. Dies wird vor allem an der strikt durchgeführten Hierarchisierung der Abschnittsgliederung bis hinunter zu den roten Lombarden und den Paragraphenzeichen deutlich. Wie präsent die traditionelle Schreibkunst in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts noch war, zeigt sich in unserem Exemplar darin, daß die versehentlich nicht gedruckten Blätter e3 und e6 sowie h3 und h6 wohl original in Handschrift auf Pergament eingefügt wurden. Vom geistlichen Gebrauch des Missales zeugt die zeitgenössische Abschrift dreier Gebete auf der unbedruckten Rückseite von Blatt I10. Auch wenn die englischen Bischöfe schon 1531 beschlossen, die päpstliche Autorität nicht mehr anzuerkennen und die Suprematsakte von 1534 festlegte, der englische König sei »the supreme head in earth of the Church of England« [zit. nach Lexutt 111], war dies zunächst ein »rein politischer Akt ohne jede theologische Motivation«. Erst 1549 wurde mit dem Common Prayer Book »eine anglikanische Liturgie eingeführt«, wobei sich der Kult »beinahe durchweg als römisch-katholisch« [ebd.] erweist. Aus Salisbury floh der letzte römisch-katholische Bischof, Francis Mallet, erst im Jahr 1559 aus England. Unser Missale scheint entsprechend für eine Übergangszeit noch weiterbenutzt und dafür leicht ›modifiziert‹ worden zu sein: Im letzten Teil wurde auf Blatt C8 eine ganze und auf G7 eine Drittel-Spalte (in Rotdruck!) wohl absichtlich durch Verwischen unleserlich gemacht, an mehreren Stellen, so schon im Kalender, wurden Worte wie »papa« weggeschabt; auf c1v und c2 einige Absätze über Thomas Becket durchgestrichen und – absichtlich? – mit Tinte ›befleckt‹.
Irgendwann wurde das kostbare, idiosynkratisch illuminierte Missale (in unserer Sammlung gedruckter Stundenbücher finden sich einige Exemplare mit dieser Farbwahl) aber doch aus seinem ursprünglichen rituellen Kontext ausgeschieden. Auf der Rückseite des fliegenden Vorsatzes findet sich der Vermerk »Among the Old Books at Helmingham [/] new Bound 1732«. Diese Angaben bestätigt der Namenseintrag »Lionel Tolmach« auf der Rückseite des originalen Pergamentvorsatzes ebenso wie der alte Einband selbst. Die Familie Tollemache saß seit 1480 – und bis heute – auf Helmingham Hall bei Ipswich; Lionel, 4th Earl Tollemache, (1708 – 1770). Ungemein selten: Bohatta kennt nur zwei Exemplare auf Pergament, darunter das inkomplette der British Library.
Provenienz: Im Besitz der Adelsfamilie Tollemache bis zur Auktion Sotheby’s, 6.6.1961, Nr. 26: £ 420. an Traylen. – Auxerre Auctions, 15.9.2007: Sfr. 55.000. Französische Privatsammlung.
Literatur: Adams L 1203; BM STC 282; Graesse IV, 550; Lowndes III , 1576; Quaritch III , Nr. 17392; nicht bei Van Praet; Weale/Bohatta, Nr. 1419.
The Missal for the English diocese of Salisbury was printed in 1514 by Wolfgang Hopyl in Paris for the Cologne publisher Franz Birckmann the Elder – a remarkable example of international cooperation under the sign of humanism, which is also symbolically expressed in the peculiar large publisher’s mark with title-page character. The precious copy, printed on vellum and idiosyncraticly coloured at the time of publication, was apparently continued to be used after the founding of the Anglican Church, with offensive passages being made unrecognisable. Later, the book passed to Lionel, 4th Earl Tollemache.
Seyssels Explanatio moralis (1515): Eines von zwei Exemplaren auf Pergament
Seyssel, Claude de . Explanatio moralis in primu[m] caput eua[n]gelii diui Luc[a]e: quatuor tractatus contine[n]s: q[ui]bus omne[m] hominis pœnite[n]tis, proficie[n]tis & perfecti statu[m] verbis euangelistæ appositissime accomodat: Leoni decimo Pon. Maximo nuncupata. [Paris], Iodocus Badius Ascensius, 1515.
á 4 a-o 8 p 6 = 4 Bl., 118 gezählte Bl. – Mit Marginalspalte. Gedruckt auf Pergament. Mit Druckermarke auf dem Titel, 3 zehnzeiligen und 3 sechszeiligen Zierinitialen auf Cribléegrund. Klein-Quart (ca. 195 x ca. 136 mm).
Dunkelblauer englischer Maroquinband des 19. Jahrhunderts auf fünf von gestrichelten Goldlinien begleitete Bünde, mit goldgeprägtem Rückentitel in drei Rückenfeldern und reicher Goldprägung in dreifachem Filetenrahmen in den übrigen drei Kompartimenten; auf den Deckeln breite floral-ornamentale Dentellebordüre in gestricheltem und dreifachem Filetenrahmen, mit Goldzier auf Steh- und Innenkanten sowie gepunztem Ganzgoldschnitt, eventuell von Charles Lewis; in modernem blauen Leinenschuber mit goldgeprägtem Rückentitel (Bl. a4 etwas fleckig, vereinzelt kleine korrigierende Marginalien von alter Hand).
Das Mysterium der Inkarnation als Weckruf an die Mächtigen
Dieses Buch schrieb der Bischof von Marseille, Claude de Seyssel (1450 – 1520), in den Mußestunden seines politischen Ruhestands – die längste Zeit seines Lebens hatte der Kirchenmann als umtriebiger und versierter Diplomat agiert. Als unehelicher Sohn des gleichnamigen Marschalls von Savoyen hatte er sich nach juristischen und theologischen Studien und einer Professur in Turin zum Berater und Minister Karls VIII ., dann Ludwigs XII . emporgearbeitet. In den kriegerischen Auseinandersetzungen Frankreichs mit Kaiser Maximilian I. und dem Papst um die Vorherrschaft in Mailand und Oberitalien spielte er eine bedeutsame Rolle: 1512 gelang es ihm, die Schweizer zur Neutralität zu verpflichten, 1513 konnte er sie allerdings nicht von einem Bündnis überzeugen – Frankreichs Position in Oberitalien brach zusammen. Seyssel geriet zwischenzeitlich persönlich in die Zerwürfnisse zwischen Ludwig XII . und Papst Julius II ., doch durfte er 1513 den Höhepunkt seiner diplomatischen Karriere erleben, als ihn der neu inthronisierte Leo X. empfing – jener Papst, der Ablaßhandel, Nepotismus und Machtpolitik auf die Spitze trieb und dadurch die Reformation auslöste. Nach dem Tod Ludwigs XII . 1515 zog Seyssel sich mit immerhin 65 Jahren endgültig aus der aktiven Politik zurück.


Eine tiefere Besinnung hatte bei ihm offenkundig die Einsicht in die »human[a]e co[n]ditionis fragilitas« [á2v] bewirkt. Schon 1514 veröffentlichte er Teile seines Lukas-Kommentars, der hier erstmals vollständig erschien. Darin widmete Seyssel sich nur dem ersten Kapitel, das von der wundersamen Schwangerschaft der unfruchtbaren Elisabeth mit Johannes dem Täufer, von der Verkündigung an Maria und ihrem Besuch bei Elisabeth berichtet – also vom mystischen Beginn der Menschwerdung des Herrn. Genau auf diesen Kern – »incarnati verbi mysteriu[m] nostreq[ue] salutis« [á1v] – verweist auch der Herausgeber Guillaume Petit (1470 – 1537) in seinem Brief an den Autor, den er mit einem eindringlichen Verweis auf seine intensive Lektüre des Textes einleitet: »Legi perlegiq[ue] ac relegi« [ebd.]. Möglicherweise hatte er auch König Ludwig XII . daraus vorgelesen, als dessen Beichtvater er zu dieser Zeit besonders gefordert war: Er verfaßte sein Schreiben im Dezember 1514, Ludwig starb am 1. Januar 1515. Seyssel wiederum wandte sich in seiner Widmungsvorrede an niemand geringeren als Papst Leo X. Ob er auch ihn zu einer Umkehr bewegen wollte? Ihm übereignete er ein auf Pergament gedrucktes Exemplar, das, wie schon Van Praet bekannt war, »se conserve dans la Bibl. Magliabecchi, à Florence«. Leo X. war jedoch so sehr in innerkirchliche Händel und die europäische Politik verstrickt, daß er den Rufen nach einer Reform der Kirche keinerlei Gehör schenkte.
Wem aber war dann das hier vorliegende zweite bekannte Pergament-Exemplar zugeeignet? Der hohe Rang und die Vermittlerposition des Savoyers Claude de Seyssel als Bischof von Marseille zwischen Paris und Rom machen einen kühnen Schluß plausibel: Dieses Buch gehörte dem König! Dazu paßt der Befund, daß Van Praet insgesamt sechs Werke Seyssels als Pergamentexemplare in der Bibliothèque du roi vorfand – nur dieses fehlt anscheinend in der stolzen Reihe. Vielleicht war auch der junge Franz I. an Seyssels Explanatio moralis nicht sonderlich interessiert; er wünschte sich von ihm vielmehr ein Werk über La grant monarchie de France, ein Buch das 1519 erschien und das politische Denken in Frankreich während des gesamten 16. Jahrhunderts prägen sollte.
Provenienz: König François Premier? Philipp Augustus Hanrott, dessen Auktion Evans, 20.2.1834, Nr. 2694, an Payne: £ 2.2.0. – Erworben bei Payne & Foss von Beriah Botfield (1807 – 1863) für £ 16.16.0. – Auktion Printed Books and Manuscripts from Longleat, Christie’s, London, 13.6.2002, Nr. 62: £ 10.775 (= Sfr. 25.000).
Literatur: Nicht bei Adams und in BM STC French; Brunet V, 328f.; Ebert 21077; Graesse VI /1, 379; Moreau 1515, 1220; Renouard 1908, III , 258 (kennt zwei Exemplare); Van Praet, Bibliothèques I, S. 53, Nr. 111 (Exemplar von Leo X.).
Claude de Seyssel, Bishop of Marseille and advisor to the French King Louis XII, retired from active politics after the King’s death on 1 January 1515. The Explanatio moralis, printed in the same year and dedicated to Pope Leo X, marked his turn into a mystical admonisher. Only two vellum copies of the book are known; one was given by Seyssel to the Pope – so this one was presumably intended for the young King Francis I.! Later it was owned by Philip Augustus Hanrott and Beriah Botfield.
Missale von Langres von 1517: das einzige bekannte, von Etienne Colaud reich illuminierte Exemplar auf Pergament, mit herausragender Provenienz: Michel de Boudet? –Jean Bouhier – Edward Harley? –Fürst Demidoff – russische Zaren
Missale diocesis Lingonensis nu[n]c cu[m] varijs additame[n]tis: et in fine deuotis officijs / atq[ue] prosis / ante hac nusqu[uam] visis. Paris, Jean Petit, 1517.
† 8 a-q 8 r 6 s 4 t2 v6, A-H8 I6 A-C8 D-E6 = 8 Bl., 134 gezählte Bl., 12 Bl., 70 Bl., 35 gezählte Bl., 1 Bl. = zusammen 260 Bl. – Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot. Gedruckt auf Pergament.
Mit großer Holzschnitt-Druckermarke in gemaltem, ganzseitigem Bordürenrahmen auf dem Titel, mit 2 ganzseitigen, einem halbseitigen und 101 einspaltigen Metallschnitten in zwei Größen, sämtlich zeitgenössisch in Gold und Farben illuminiert von Etienne Colaud und seinem Atelier; mit einigen siebenzeiligen historisierten und illuminierten Metallschnitt-Initialen, zahlreichen vierbis sechszeiligen Initialen mit Floraldekor auf Goldgrund und zahlreichen ein- bis zweizeiligen Initialen in Gold, alternierend auf blauem und rotem Grund, und mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System, mit Gelbmarkierungen von Versalien.
Folio (311 x 224 mm).
Roter Maroquinband des 18. Jahrhunderts auf sechs goldverzierte Bünde, mit dunkelgrünem Maroquin-Rückenschild, floralen Einzelstempeln in den durch Fileten und gestrichelte Linien gerahmten Rückenfeldern; auf beiden Deckeln goldgeprägtes Wappensupralibros, außen goldgeprägter Rokokorahmen, mit Goldzier auf den Stehkanten, goldenen Brokatpapiervorsätzen und Ganzgoldschnitt; in roter, mit Filz ausgelegter Halbmaroquinkassette mit grünem, goldgeprägtem Maroquinrückenschild (berieben, Vorsätze am Rand oxydiert).
Unikales Exemplar – von einzigartiger Provenienz
Langres-sur-Marne, heute ein Landstädtchen, war in Mittelalter und früher Neuzeit von eminenter Bedeutung. Die 1284 an die Krone gefallene Stadt entwickelte sich zu einer wichtigen Grenzfestung gegen Lothringen und Burgund; das Bistum reichte noch weit über diese Grenze hinaus, im Süden bis nach Dijon. Es gehörte zu den reichsten des Landes. In einer Doppelrolle als Geistlichem und Politiker finden wir entsprechend auch den Bischof Michel Boudet (1469 – 1529), der im Jahr seiner Amtseinführung 1512 französischer Gesandter in Spanien war. 1515 assistierte er bei der Krönung Franz’ I.; 1516 wurde er Kaplan der Königin Claude de France. Das vorliegende Missale ließ er 1517 drucken – in diesem Jahr stattete er seiner Diözese eine Visitation ab.




Der lokale Bezug des Missales ist im Kalendarium deutlich herausgestellt. Der dritte Ortsbischof Desiderius von Langres wird an seinem Gedenktag, dem 23. Mai, in Rotdruck hervorgehoben; sowohl er als auch Bischof Urban von Langres sind in die Suffragien miteinbezogen. Missalien für die Diözese sind nicht sonderlich häufig; Weale/Bohatta nennen sechs Drucke. Diese Ausgabe, gedruckt in gotischer Schrift zu 42 Zeilen, ist besonders selten, von ihr waren Weale/Bohatta nur vier unvollständige Exemplare bekannt, die nicht mehr alle vorhanden sind.
Von diesem dürftigen Bestand hebt sich unser prachtvolles, vollständiges, auf Pergament gedrucktes und herausragend zeitgenössisch illuminiertes Exemplar umso glanzvoller ab. Es war gewiss der Pariser Meister Etienne Colaud, der den Metallschnitten und Initialen mit seiner delikaten wie nachdrücklichen Ausmalung in Gold und Farben das Aussehen eigenständiger Miniaturen verlieh. Tatsächlich eine solche ist der bewegte Titelrahmen zum Auftakt, mit Akanthusranken auf gepunktetem Grund, darin Frosch und Vogel, Blüten und Früchte. Nach Kalendarium und Tabula folgt als feierliches Eingangsbild die goldgleißende Darstellung der Meßfeier. Etwa in der Mitte des Buches, vor dem mit nur 21 Zeilen deutlich größer gedruckten Canon missae, finden sich die beiden ganzseitigen, in goldenen architekturalen Rahmen einander gegenüberstehenden Darstellungen der Kreuzigung Christi und des thronenden Gottvaters mit Tiara. In den kleineren Illustrationen und Initialen sind Szenen aus dem Leben und der Passion Christi sowie von Aposteln, Märtyrern und Heiligen zu sehen.
In einzigartiger Weise repräsentiert unser Missale die Glanzzeit von Langres in der Renaissance. Danach verloren Stadt und Bistum mit dem Ausgreifen Frankreichs nach Osten allmählich ihre historische Bedeutung. 1731 wurde Dijon mit seinem Umland abgetrennt und zu einem eigenständigen Bistum erhoben. In dieser Umbruchszeit wechselte auch unser Exemplar von Langres nach Dijon, von der geistlichen in die weltliche Sphäre über, um fortan als bibliophiles Erinnerungsstück an große Zeiten weitergegeben zu werden. Diesen hochinteressanten Übergang können wir glücklicherweise in Umrissen rekonstruieren. Unübersehbar trägt ein vorgeschaltetes Pergamentblatt, wohl das erhaltene originale Vorsatzblatt, ein großes illuminiertes Wappen samt Besitzvermerk – das des berühmten Dijoner Bibliophilen und Staatsmanns Jean Bouhier (1673 – 1746), mit dem Datum 1721. Jean Bouhier, war ein »savant et littérateur, président à mortier au Parlement de Bourgogne« [Guigard II , 75] und »un bibliophile d’une classe superieure« [Olivier], seine Bibliothek war »connue dans toute l’Europe« [Olivier]. Dabei leitete ihn eine doppelte Ausrichtung: Betraf seine Sammelleidenschaft »principalement l’histoire de la Bourgogne« [ebd.], so war sie zugleich von enzyklopädischem Ausmaß. Er selbst wurde 1727 in die Academie française gewählt, unter Befreiung von der Residenzpflicht in Paris. Indem er das Alte unter den Auspizien der Aufklärung bewahrte, moderierte er aktiv einen wahrhaft historisch zu nennenden Übergang. Sicherlich kein Zufall war es, daß Voltaire 1746 Bouhiers Platz in der Akademie einnahm.
Vor diesem Hintergrund wird es nicht leicht, der Argumentation der Kollegen von H. P. Kraus zu folgen, nach der Bouhier das Missale an Edward Harley verkauft habe, in dessen Katalog 1744 ein gleichartiges Spezimen auftauchte. Daß wir damit von der Existenz eines parallelen illuminierten Exemplars auf Pergament ausgehen müssen, kann unseren Besitzerstolz kaum ankränkeln, zumal



jenes, das noch Van Praet als »richement enluminé, avec les initiales peintes en or et en couleurs« bezeugte, seit 200 Jahren verschollen ist. Plausibel ist wohl eher, daß Jean Bouhier unser Exemplar mit seiner Bibliothek an seinen Schwiegersohn Jean-François-Gabriel-Bénigne Chartraire de Bourbonne (1713 – 1760) weitergab, dieser wiederum an den seinigen, einen Comte d’Avaux, der sie »vendit, en 1784, à l’abbé de Clairvaux« [Guigard II , 126f.], François Le Blois. Das unweit von Langres gelegene berühmte Kloster war in den Wirren der Französischen Revolution jedoch kein sicherer Hort: 1792 verbrachte man die Bücherkollektion nach Troyes, doch, so berichtete Guigard, »elle n’y arriva pas intacte. Le pillage commença à Barbe-sur-Aube, et, d’après nos renseignements, elle lassait dans chaque ville une partie de des trésors. De sorte que arivée au lieu de sa destination, elle se trouva considérablement diminuée« [ebd. 78f.]. Während sich Teile der Sammlung später in den Bibliotheken von Troyes, Montpellier und in der Nationalbibliothek in Paris anfanden [vgl. Olivier], tauchte unser Missale 1796 in der Sammlung Demidoff in Moskau auf [vgl. Van Praet]. Dort erhielt es den heute noch vorhandenen Einband mit dem goldenen Wappensupralibros; später gelangte es in die Bibliothek der russischen Zaren in Zarskoje Selo. In der Geschichte dieses Buches, die sich über ein volles Halbjahrtausend nachvollziehen läßt, spiegelt sich in einzigartiger Weise der Wandel von einem hieratischen, lokal gebundenen Gegenstand hin zum Objekt eines bibliophilen Universalismus auf allerhöchstem Niveau.
Provenienz: Eventuell der Bischof von Langres, Michael de Boudet – Jean Bouhier (1673 – 1746), mit dessen illuminiertem Wappen [vgl. Guigard II , 75ff. und Olivier 2423], Besitzvermerk und Signatur, datiert 1721, auf Pergamentvorblatt. – Eventuell Edward Harley oder zwei weitere Generationen in Familienbesitz, 1784 an die Abtei Clairvaux verkauft. – 1796: Fürst Demidoff, Moskau, mit Wappensupralibros. – Bibliothek der russischen Zarenfamilie, mit deren Stempeln verso Vorblatt. – Gilhofer & Ranschburg, Kostbare Bücher und Manuskripte aus den Bibliotheken russischen Zaren in Zarskoje-Selo, Versteigerungskatalog VIII , Luzern 15.6.1932, Nr. 228 und Tafel 21f.: Est. CHF 8.000. – H. P. Kraus, Katalog 188, New York 1991, Nr. 75: $ 240.000 (= CHE 360.000).
Literatur: Nicht bei Adams und in BM STC French; Brunet III , 1763; Graesse IV, 546 (erwähnt ein Exemplar auf Pergament, gewiss das unsere); Van Praet, Bibliothèques I, S. 100, Nr. 273 (erwähnt das Exemplar Demidoff); Weale/Bohatta, Nr. 536.
This Missal was printed in 1517 on commission of the influential Bishop of Langres, Michel Boudet, chaplain to Queen Claude de France. If the edition is very rare anyway, this is the only copy printed on vellum; the more than 100 woodcuts and numerous metal-cut initials were illuminated in gold and colours by the outstanding Parisian master Etienne Colaud and his workshop. The complete and immaculately preserved book from the heyday of the Burgundian bishopric came in the early 18th century to the Dijon statesman Jean Bouhier, later – possibly coming from Edward Harley – it was in the possession of the Russian noble family Demidoff in Moscow and ultimately in the library of the Russian Tsars in Tsarskoe Selo.




Missale s[ecundu]m choru[m] & ritu[m] Eysteten[sis] Ecclesie . Nürnberg, Hieronymus Höltzel für Gabriel von Eyb, 1517.
gezählte Bl., 1 leeres Bl., Bl. 155-158, 6 Bl., Bl. 159-264. – Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot. –10 Blätter, darunter der Canon Missae, auf Pergament. – Mit einem zusätzlichen Widmungsblatt auf Pergament.
Mit Holzschnitt-Titel in großen gotischen Typen, ganzseitigem illuminierten Wappen des Bischofs Gabriel von Eyb, ganzseitigem Porträt des hl. Willibald, ganzseitigem Kreuzigungsbild, illuminierter T-Initiale und von zwei Engeln gehaltenem Volto Santo als Kußbild; mit 1 neunzeiligen, 3 acht-, 4 sieben-, 4 sechs-, 4 fünf-, 1 vier- und 12 dreizeiligen, in Gold und Farben illuminierten historisierten Initialen, alles in Holzschnitt; mit zahlreichen Lombarden in Rotdruck sowie gedruckten Paragraphenzeichen; ferner mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System, begleitet von Text mit größeren Versalien in rotem Druck.
Imperial-Folio (395 x 275 mm).
Zeitgenössischer Schweinslederband der Klosterbuchbinderei Rebdorf über Holzdeckeln auf fünf breite, von Streicheisenlinien verzierte Bünde, auf den Deckeln Rahmenwerk von Streicheisenlinien, Rollen- und Einzelstempeln, auf dem Hinterdeckel dreimal der Stempel »rebdorff« [Kyriss 28, 1-3 und 7]; mit zwei erneuerten Lederschließen mit Messingbeschlägen sowie Resten von ledernen Blattweisern (leicht berieben, Gelenke erneuert, wenige Bl. mit fachmännisch reparierten Einrissen, einige mit ergänzten Randfehlstellen).
Ein bemerkenswertes Zeugnis katholischen Reformwillens
Dieses Buch ist aufs engste mit dem Eichstätter Bischof Gabriel von Eyb (1455 – 1535) verbunden, dem in der Frühzeit der Reformation eine Führungsrolle auf katholischer Seite zuwuchs. 1517 gab er dieses große Eichstätter Missale bei Hieronymus Höltzel in Nürnberg in Auftrag, wie im Kolophon vermerkt ist. Als Kanonbild findet sich manchmal eine Kreuzigung von Albrecht Dürer [Muther 843]. In unserem und einigen anderen Exemplaren [vgl. Van Praet] ließ der Bischof hingegen anstelle des Dürer-Holzschnitts dem auf Pergament gedruckten Canon missae zwei weitere gedruckte Pergamentblätter voranstellen, auf deren erster Seite er sich mit einem Hirtenbrief an alle Geistlichen seiner Diözese wendet. Darin beklagt er den Verfall des Gottesdienstes, um im gleichen Atemzug seinen Willen zu Reformen zu betonen. Mit diesem vierten Eichstätter Missaldruck seit 1486 will er die




Heilige Messe auf eine neue Grundlage stellen will. Eyb beläßt es nicht bei väterlichen Ermahnungen zum gewissenhaften Messelesen, vielmehr appelliert er bei seinen Klerikern an ein persönliches Treueverhältnis und wirft dabei das ganze Gewicht der kirchlichen Hierarchie in die Waagschale: Die Blattrückseite nimmt sein ganzseitiges, prachtvoll illuminiertes Bischofswappen ein [vgl. Siebmacher 8, Taf. 23] – als heraldisches Symbol einer sehr diesseitigen Autorität. Auf der gegenüberliegenden Seite erblickt man hingegen den Bistumsgründer, den heiligen Willibald, bei dem die weltlichen Attribute zurückgenommen sind: hinter ihm ein aufgespannter Gobelin, zu seinen Füßen sein Wappenschild (nicht dasjenige Eybs, wie Meder meinte), vor allem aber liest er in bzw. aus einem Buch – vermutlich die Heilige Messe. Auf der Rückseite schließlich ist als »höchste Instanz« der Heilsvermittlung der Gekreuzigte selbst dargestellt, wohl ein Werk Hans Burgkmairs. Unten auf der Seite ist ein kurzes Gebet für den Bischof und die Seinen um Frieden und Schutz »ab o[mn]i adversitate« plaziert – ein überdeutlicher Hinweis auf die krisenhaften Entwicklungen, die es abzuwenden gilt. Erst nach diesen Präliminarien beginnt der Canon missae zur Eucharistie; der Kreuzigungsholzschnitt, der zugleich auf diesen einstimmt, hat dabei eine Scharnierfunktion. Die anschließende illuminierte Initiale zum Te igitur mit dem Opfer Isaaks stammt wie die Willibald-Darstellung und die zahlreichen illuminierten, mit figürlichen Darstellungen aus den Fünfzehn Mysterien historisierten Initialen von Hans Springinklee [vgl. Alès bzw. Muther 1134] oder Erhard Schön [vgl. Geisberg].
Vermutlich ließ Gabriel von Eyb die beiden Pergamentblätter nicht von vornherein im Druckjahr 1517 einschalten, sondern erst nach den Anfängen der lutherischen Reformation, in die er unmittelbar involviert wurde. Daß er prinzipiell die Notwendigkeit zu einer kirchlichen Erneuerung sah, geht aus dem Missale selbst und dem beigegebenen Hirtenbrief zur Genüge hervor. Doch Luthers Thesen bargen noch ganz anderen Zündstoff, und Eyb bat den Ingolstädter Theologen Johannes Eck, seine Bedenken gegen die Wittenberger Thesen schriftlich abzufassen. Ausgerechnet Eybs lutherisch gesinnter Vetter Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden spielte diese Obelisci dem Reformator zu, der darauf mit seinen Asterisci antwortete. Spätestens bei der Leipziger Disputation von 1519 zwischen Eck und Luther, in der dieser einige Thesen von Jan Hus als »wahrhaft evangelisch« bezeichnete, wurden die Gegensätze unüberbrückbar; 1520 reiste Eck nach Rom, wo er am 15. Juni von Papst Leo X. die Bannandrohungsbulle Exsurge Domine gegen Luther erwirkte. Als erster deutscher Bischof veröffentlichte Gabriel von Eyb sie nur wenige Tage später.
Genau in dieser Zeit verstärkte er seine Bemühungen, die eigenen Gefolgsleute ›auf Kurs‹ zu halten. Davon zeugt die dritte Spur von ihm in unserem Exemplar: Auf der Rückseite eines vorgeschalteten Pergamentblattes findet sich ein sechszeiliger, 1520 datierter kalligraphischer Geschenkvermerk an die »fratribus in Rebdorff«, verbunden mit der unmißverständlichen Aufforderung, daß diese »ex eo missas legerint«. Seit 1503 amtierte in dem Augustiner-Chorherrenstift vor den Toren Eichstätts der mit Eyb befreundete Humanist Kilian Leib (1471 – 1553) als Prior. Auch er hatte die Mißstände in der katholischen Kirche kritisiert, auch er bekämpfte jedoch die lutherische Bewegung in Wort und Schrift. 1530 begleitete er Eyb nach Augsburg zu Beratungen über die Confutatio Augustana [vgl. NDB 14, 15]. Während Eyb 1533 die markgräflich-ansbachischen Gebiete seines Bistums für die alte Lehre verloren geben mußte, konnte Leib seine Klostergemeinschaft »im wesentlichen vor lutherischen Ideen bewahren« [ebd.].
Ihm verdankt sich auch der Ruhm der Klosterbücherei als einer der bedeutendsten in Deutschland. Von 1471 bis 1544 war eine hauseigene Buchbinderei in Betrieb, in der auch der vorliegende Schweinslederband entstand, wie an dem dreimal auf dem Hinterdeckel eingeprägten Stempel »rebdorff« [Einbanddatenbank, s004380, Kyriss 7] abzulesen ist. Als weitere Einzelstempel finden sich ein kleiner Blütenkopf [Kyriss 1], ein gepunkteter Kopfstempel [s004388, Kyriss 2], eine Ranke mit Eicheln und Eichenblättern [s004384, Kyriss 3], ein Doppeladler mit Krone [s004551] sowie zwei Rollenstempel in Gestalt von Wellenranken mit Blüten [r000125 und r000126]. Auf aufwendiges Beschlagwerk wurde verzichtet, ein Zeichen, daß das mit Blattweisern versehene Missale dezidiert für den frommen Gebrauch und weniger als Objekt der Repräsentation gedacht war.




Noch 1790 wird unser Missale im Katalog des letzten Rebdorfer Bibliothekars Andreas Strauß als »editio splendida« und »opus in ipsa Diocesi rarissimum« [Strauß] gewürdigt; doch 1806 wurden Kloster und Bibliothek im Zuge der Säkularisation aufgehoben, die Bücher in alle Welt verstreut. Nach einer zwei Jahrhunderte währenden Odyssee durch den Altbuchhandel können wir dem Buch nun seine eigene Geschichte wiedergeben: als einem bedeutsamen Zeugnis für die Bemühungen des Eichstätter Bischofs Gabriel von Eyb um eine katholische ›Gegen-Reform‹ schon in den ersten Jahren der lutherischen Bewegung.
Provenienz: Auf einem vorgeschalteten Pergamentblatt verso kalligraphischer Geschenkvermerk des Eichstätter Bischofs Gabriel von Eyb, datiert 1520, an das Augustiner-Chorherrenstift Rebdorf bei Eichstätt. – 1790 von Strauß im Rebdorfer Bibliothekskatalog erwähnt: S. 328f., Nr. IV; Kloster und Bibliothek wurden 1806 aufgelöst. – Bernard Quaritch, Catalogue 154, London 1895, Nr. 7; erneut in dessen Catalogue 207, Nr. 165. – Auktion Sotheby’s, London, 13.5.1919 (Stock of J. & J. Leighton). – John Meade Falkner, Durham, dessen Auktion Sotheby’s, 15.12.1932, Nr. 314: £ 56, an Goldschmidt. – Auktion Sotheby’s, 29.3.1933, Nr. 806: £ 20, an Thorp. – Sammlung Henry S. Borneman, Philadelphia, dessen Auktion Parke Bernet, New York, 1./2.11.1955. Christie’s 14.11.2007, 77: Est. £ 12-18.000.
Literatur: Nicht bei Adams; Alès 59; BM STC German 512; Bohatta, Nr. 82; Dodgson I, S. 264, S. 375f., Nr. 8, und S. 416, Nr. 89; Geisberg, Nr. 155-191 (Schön) und 313 (Springinklee: Willibald); nicht bei Graesse; vgl. Meder, Nr. 183, 2a (Dürer-Holzschnitt); Muther 843 (DürerHolzschnitt) und 1134; Panzer VII , S. 458, Nr. 130; Passavant III , S. 182f., Nr. 189, und S. 219, Nr. 310; Proctor 11016; Röttinger 1925, Nr. 10 (Schön); vgl. Tenner, Auktion 129 (= Sammlung Adam II), Heidelberg, 4.11.1980, Nr. 287; Van Praet, Roi, 172, Nr. 289bis; VD 16 M 5570; Weale/Bohatta, Nr. 391; zum Einband: Kyriss 1951ff., Nr. 28 und Tafel 63, Nr. 1-3 und 7.
In this Eichstätt Missal of 1517, not only was the Canon Missae printed on vellum, but also two additionally inserted leaves with a pastoral letter from the reform-minded Bishop Gabriel von Eyb, which are only found in a few copies. Another preceding vellum leaf contains a calligraphic gift note dated 1520 to the Augustinian canons in Rebdorff near Eichstätt, whose prior Kilian Leib was a friend of the bishop. The original pigskin binding comes from the monastery’s own bookbindery.

[Pfinzing, Melchior, und Maximilian I. Die geuerlicheiten und einsteils der geschichten des loblichen streytparen und hochberümbten helds und Ritters herr Tewrdannckhs]. Nürnberg, Johann Schönsperger, [1517].
a-c 8 d 6 e-h 8 i 6 k-n 8 o 6 p-q 8 r 6 s-t8 v6 x-y 8 z 6 A-B8 C6 D-E8 F6 G-H8 I6 K-L 8 M6 N8 O6 P8 A8 = 288 [statt: 290 Bl.]. – Blatt a1 in Pergament ersetzt, der Titel kalligraphisch in Schreibweise und Zeilenfall dem der zweiten Auflage von 1519 folgend ergänzt; das leere Blatt P5 am Ende von Kapitel 117 entfernt. Gedruckzt auf Pergament.
Mit 118 großen (textspiegelbreiten), im Druck numerierten Holzschnitten von Leonhard Beck, Hans Burgkmair und anderen.
Royal-Folio (ca. 340 x 222 mm).
Kalblederband des frühen 18. Jahrhunderts auf fünf Bünde, mit reicher ornamentaler Blindprägung und hellbraunem Rückenschild; auf den Deckeln goldgeprägtes gekröntes Wappensupralibros in Oval mit blindgeprägter Umschrift »I.A.E.V.D.H.F.Z.A.H.Z.A.V.O.1.7.1.8«; mit blindgeprägten Stehkanten, festen Marmorpapiervorsätzen, je zwei freien Pergamentvorsätzen und Ganzgold- über Rotschnitt; in moderner roter Maroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel (Deckel beschabt, Rücken restauriert, Gelenke, Kapitalbändchen und Vorsätze erneuert, Pergament meist nur mit den natürlichen Verfärbungen, Quetschfalten und Löchlein, davon 3 Holzschnitte (9, 40, 98) betroffen, sonst nur leicht fingerfleckig, am Oberrand einige Schnörkel etwas angeschnitten, Bl. a1 und P5 entfernt).
Maximilian-Memoria im Takt der Jahrhunderte
Über den Theuerdank, das von Kaiser Maximilian I. (1459 – 1519) in Auftrag gegebene, autobiographisch getönte »Heldenbuch« und zugleich das »erste bibliophile deutsche Buch« [Burger 17], gibt unser Katalog 85 Der Wille zum Ruhm von 2021 zur Genüge Auskunft – darum an dieser Stelle nichts über Maximilians grandiose Selbstinszenierung, die exklusive »Theuerdanktype« und die 118 herrlichen Holzschnitte von Hans Burgkmair, Hans Schäufelein und Leonhard Beck, die sich in diesem unkolorierten Exemplar wohlerhalten präsentieren. Auch auf die Seltenheit heben wir nicht weiter ab: Es handelt hier sich um eines der vermutlich rund 40 Luxusexemplare der Erstausgabe von 1517 auf kräftigem Pergament. Wie die meisten hat auch dieses aufgeklebte Korrekturstreifen an den üblichen Stellen, so auf den Blättern v5r, g6r, A4v und A6v; auf g6v, m1v, r3v, A5v und A6e beweisen Verfärbungen, daß die Zettelchen irgendwann verlorengingen; lediglich auf dem letzten Blatt A8r findet sich keine Überklebungsspur. Das leere Blatt P5 im 117. Kapitel wurde – wie
Die Erstausgabe des „Theuerdank” von 1517 in der Luxusvariante auf Pergament in einem datierten Einband von 1718




oft – entfernt: Vom Herausgeber Melchior Pfinzing waren hier drei Seiten freigelassen worden, um anzudeuten, daß der für Gottes Heilsplan unabdingbare Kreuzzug gegen die Türken noch nicht stattgefunden hatte – diese Lücke lief allerdings der Absicht des »Ruhmeswerks« tendenziell zuwider und wurde im Nachhinein gern ›rückgängig gemacht‹. Auch das Titelblatt fehlt, es wurde wohl im 19. Jahrhundert ersetzt durch ein kunstgerechtes kalligraphisches Faksimile auf Pergament, allerdings in der Schreibweise der zweiten Auflage von 1519 – ein Symptom historisch uninformierter Buchliebhaberei gleich in zweifacher Weise: Denn mit Bedacht waren wohl im Jahrhundert zuvor alle etwaigen Spuren frühen Buchbesitzes konsequent getilgt worden, als der Theuerdank neu gebunden wurde. Der Kalblederband des frühen 18. Jahrhunderts besitzt einen aufwendigen blindgeprägten Rückendekor, nahm sich also in einer Bücherwand sehr repräsentativ aus. Die Deckel blieben hingegen schlicht, bis auf die Wappensupralibros, die den ersten greifbaren Besitzer offenbaren: Joseph Anton Eusebius von der Halden, Freiherr zu Autenried, Herr zu Anhofen und Ochsenbrunn. Von der Halden, der aus vorarlbergischem Kleinadel stammte, ergriff im Leben offenbar jede Gelegenheit, um emporzukommen. So erheiratete er sich mit der Witwe des Philipp Friedrich von Lapière im Jahr 1684 die Gutsherrschaft Autenried mit Anhofen und Ochsenbrunn, gelegen in der habsburgischen Markgrafschaft Burgau im heutigen Bayerisch-Schwaben. Bereits zwei Jahre später wurde er in den erbländischen österreichischen Freiherrenstand erhoben. In den folgenden Jahrzehnten diente er verschiedenen kirchlichen Herren als Verwaltungsbeamter und Diplomat, so 1702 dem Hochmeister des Deutschen Ordens als Geheimrat und Abgesandter beim Regensburger Reichstag; 1704 – 1713 verwaltete er die krainische Herrschaft Bischoflack für den Bischof von Freising, danach war er Erzbischöflich-Salzburger Geheimrat und Kämmerer und wiederum Reichstagsgesandter. In solchen Diensten wohlhabend geworden, erbaute von der Halden 1708 – 1711 in Autenried das sogenannte »Schloß«, dessen Anlage in der Tat eher einer Residenz als einem Gutshaus glich. Dies paßte durchaus zu seiner Position in Bischoflack, wo er als Statthalter des Territorialherrn fungierte. An seinem Lebensabend hatte von der Halden als Fürstendiener alles erreicht, was in seinen Möglichkeiten stand. Nur symbolisch konnte er seinen Status noch weiter festigen.
Und genau das tat er mit dem Erwerb unseres Theuerdank auf Pergament! Einerseits ist zu bedauern, daß wir die Provenienz dieses Exemplars nicht weiter zurückverfolgen können. Andererseits setzte Joseph Anton Eusebius von der Halden mit dem Erwerb und der Neubindung des vorliegenden Exemplars einen selbstbewußten Neuanfang und markierte damit zugleich eine interessante Etappe der Rezeption von Maximilian I. und dessen Theuerdank, die wir so noch nicht beobachten konnten. Denn bei von der Haldens Besitzvermerk handelt es sich nicht nur um ein einfaches Wappensupralibros in Goldprägung, es ist vielmehr umgeben von der Umschrift seiner Initialen und dem Datum 1718. Wenn in diesem Jahr der Einband hergestellt wurde, dürfte von der Halden das Buch 1717 erworben haben, exakt 200 Jahre nach Erscheinen – ein deutliches Indiz für die fortwährend gepflegte gedechtnus, die Kaiser Maximilian I. gerade mit diesem »Ruhmeswerk« erstrebt hatte! Und schon 1719 stand mit dem 200. Todestag Maximilians das nächste Gedenkjubiläum an, Anlaß genug, den Theuerdank erneut würdig zu präsentieren. Hatte Joseph Anton Eusebius von der Halden zeitlebens katholischen Prälaten gedient, so setzte er sich mit diesem Buch in eine ›unmittelbare‹ Beziehung zu den Habsburgern, ja zu Maximilian persönlich.




Daß es sich beim Titelhelden um den Kaiser selbst handelte, davon hatte der Herausgeber Melchior Pfinzing noch in seiner erläuternden Clavis ein Geheimnis gemacht: »Tewrdanck bedeut den lobliche[n] Fürsten K.M.E.Z.O.V.B.« [A1v], doch ließ sich das Akronym leicht als »Kaiser Maximilian, Erzherzog zu Österreich und Burgund« auflösen. Lag der Verschleierung von Maximilians Identität die Absicht zugrunde, Biographisches in den mehrfachen Schriftsinn eines romanhaften »Heldenbuchs« zu integrieren, so nahm die Nachwelt die Erzählung zunehmend als historische Überlieferung, die das Ihre zum Nachruhm des kaiserlichen »letzten Ritters« beitrug. Von der Halden folgte ganz offensichtlich diesem Vorbild, wenn er als Umschrift seines Wappens »I.A.E.V.D.H.F.Z.A.H.Z. A.V.O.1.7.1.8« in die Deckel einprägen ließ. Zumindest an Zahl der Buchstaben und der dadurch aufgezählten Titel übertraf Joseph Anton Eusebius von der Halden, Freiherr zu Autenried, Herr zu Anhofen und Ochsenbrunn in barocker Fülle sein historisches Vorbild um Längen.
Interessant ist der Vorgang auch mit Blick auf die Druckgeschichte des Theuerdank. Nachdem er 1596 in siebter Auflage, allerdings nur noch in einer kleinformatigen Schrumpfform erschienen war, unterbrach der Dreißigjährige Krieg die Rezeptionsgeschichte. Erst 1679 und 1693 brachte Matthäus Schultes in Ulm eine achte und neunte Auflage heraus, allerdings in miserabler Qualität. Wohl war die Tradition noch wirksam, aber eine repräsentative Ausgabe von Maximilians Ruhmeswerk war schon lange nicht mehr zur Hand. Gewiß waren von der Halden diese Ausgaben bekannt, vielleicht hatten diese sogar seine Phantasie beflügelt – Autenried liegt, in kaum 25 Kilometern Entfernung, geradezu vor der Ulmer Haustür. Umso bemerkenswerter, daß er sich eben nicht mit einem der Spätdrucke zufrieden gab, sich vielmehr die Erstausgabe in der seltenen Luxusvariante auf Pergament beschaffte. Während die Druckgeschichte des Theuerdank mit den Ulmer Ausgaben endgültig abriß, belegt unser Exemplar, wie die Maximilian-Memoria »in dürftiger Zeit« mit den alten Ausgaben aktualisiert wurde und triumphale Urständ feierte.
Provenienz: Wappensupralibros von Joseph Anton Eusebius von der Halden mit Datum 1718. – Auf dem Spiegel Exlibris des britischen Politikers George John Warren Venables-Vernon, 5th Baron Vernon (1803 – 1866), der wohl die Vorsätze erneuern, den ursprünglichen Rotschnitt vergolden und das Titelblatt ergänzen ließ (Sale 1918, 390: £ 175). Auf dem fliegenden Vorsatz Besitzvermerk des schwedischen Sammlers Per Hierta (1864 – 1924) mit Datum »1918« – exakt 200 Jahre nach von der Halden – Quaritch, Cat. 386, 471: £ 1.000 – C. Hauck, Sale 2006, 230: $ 144.000 (= CHF 180.000). Bedeutende deutsche Privatsammlung, aus der wir es erwarben.
Literatur: Adams P 962; Bartsch VII , S. 136, Nr. 132 (Schäufelein); BM STC German 690; Brunet V, 767; Cicognara 1116; Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 329; De Bure, BellesLettres, I, 728ff., Nr. 3552; Dibdin, Decameron I, 200ff.; Dodgson I, 252ff., S. 419, Nr. 1, S. 504, Nr. 2 (Traut), II , 7f., Nr. 5 (Schäufelein), S. 58f., Nr. 7 (Burgkmair), S. 109, Nr. 2 (Breu), S. 123ff., Nr. 3 (Beck), S. 147, Nr. 23 (Weiditz, »doubtful«), und S. 198, Nr. 1 (Master N H); Ebert 22869; Fünf Jahrhunderte 70; Goedeke I, 336; Graesse VI /1, 106f.; Hollstein, German V, Nr. 416-430 (Burgkmair); Laschitzer 108ff.; Muther 845; Oldenbourg, Schäuffelein, L 119; Panzer, Annalen I, S. 408ff., Nr. 885; Proctor 11180; Röttinger 1925, Nr. 2; Van Praet IV, 347, S. 233ff., und V, S. 376; VD 16 M 1649.








The first edition of the Theuerdank from 1517, the first bibliophile work of art in German book history with 118 magnificent woodcuts by Hans Burgkmair, Hans Schäufelein and Leonhard Beck, is presented here in the deluxe version on vellum and in a dated binding from 1718. Two hundred years after the publication of the work and in time for the 200th anniversary of the death of Emperor Maximilian I, the nobleman Joseph Anton Eusebius von der Halden, Baron of Autenried, who resided in the margraviate of Burgau, thus documented his loyalty to the Habsburgs under the sign of the memoria of the great emperor and »last knight«. Later in the collections of Lord Vernon, Per Hierta and C. Hauck. See also our catalogue 85 »Der Wille zum Ruhm«.

Gaguins «Mer des Croniques» 1518 aus den Sammlungen
Diane de Poitiers – Anne de Bavière – Edward Harley –Earl of Dysart
Gaguin, Robert . La Mer des Croniques / et Mirouer historial de Fra[n]ce […]. Lequel traicte de tous les faitz aduenuz de puis la destruction de Troye la grant / tant es royaulme de France que Angleterre Irlande Espaigne Gascoigne Flandres / & lieux circonuoysins. Nouuelleme[n]t translate de latin en fra[n]coys addicio[n]ne de plusieurs adicions […] iusques en lan mil cinq cens et. X VIII . auecques les Genealogies de France. Nouuellement imprimez. Paris, Nicole de la Barre, 1518.
AA -BB 6 a-z 6 τ6 A-R 6 = Titelbl., 9 [statt: 11] Bl. (Table), 242 [statt: 246] gezählte Bl. – Table zweispaltig, Chroniktext mit schmaler Marginalspalte gedruckt; mit blaßroter Reglierung. – Es fehlen die Blätter BB 1, BB 6, f3, g2, k6 und O1.
Mit Titelminiatur (über Holzschnitt-Druckermarke) und 9 [statt: 13] in Gold und Farben illuminierten Holzschnitten (einer wiederholt), davon 3 ganzseitig, einer kombiniert mit einer zusätzlich einmontierten Falttafel; mit (schwacher) Holzschnitt-Druckermarke am Schluß; mit zahlreichen Zierinitialen, die vier- bis sechszeiligen in Gold auf diagonal geteiltem, altrosa-blauem Grund, die ein- bis dreizeiligen auf einfarbigem Grund, mit gedruckten Paragraphenzeichen und Gelbmarkierungen von Versalien.
Folio (ca. 313 x ca. 219 mm).
Brauner englischer Kalblederband (Harley-Einband) des späten 17. Jahrhunderts auf fünf goldornamentierte Bünde, mit rotem, goldgeprägtem Maroquinrückenschild, die Rückenfelder mit reicher ornamentaler Vergoldung in doppelten Goldfiletenrahmen; mit doppeltem Goldfiletenrahmen auf den Deckeln und goldgeprägten Stehkanten; in moderner brauner, mit Velours gefütterter Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel (Einband beschabt und etwas fleckig, Rücken restauriert, Vorsätze am Rand leimschattig, Vorsatz- und Vorbl. mit ersetztem Randabschnitt, 6 Bl. entfernt).
Provenienz: König Franz I. von Frankreich (regierte 1515 – 1546). – Diane de Poitiers – Anne de Bavière – Edward Harley, 2nd Earl of Oxford (1689 – 1741); verkauft 1744 (Osborne Cat. III , 3219) an Lionel, 4th Earl of Dysart (1707 – 1770) von Ham House. In dessen Familienbibliothek bis zur Ham House-Auktion I von Sotheby’s 1938, dort als Nr. 141 ersteigert von Maggs. – Später französische Privatsammlung.



Das Gleiche . Paris, Nicole de la Barre für Jean Petit, 1518.
AA -BB 6 a-z 6 τ6 A-R 6 = 12 Bl.; 246 gezählte Bl. – Table zweispaltig, Chroniktext mit schmaler Marginalspalte gedruckt.
Mit Holzschnitt-Druckermarke in vierteiligem Holzschnitt-Rahmen auf dem Titel, 13 Holzschnitten (drei wiederholt), davon 3 ganzseitig; mit zahlreichen Zierinitialen auf Cribléegrund und gedruckten Paragraphenzeichen.
Folio (270 x 189 mm).
Mittelbrauner Maroquinband auf fünf Bünde mit goldgeprägtem Rückentitel in zwei Feldern und floralen Einzelstempeln in doppelten Blindfiletenrahmen in den übrigen Rückenfeldern; Deckel mit doppeltem äußeren Filetenrahmen und floral-ornamentalem, von vierfachen Fileten eingeschlossenem Bordürenrahmen sowie einem Semé von Fleurs de lys im Mittelfeld, alles in Blindprägung; mit doppelten Goldfileten auf den Steh-, Goldbordüre auf den Innenkanten, mit marmorierten Vorsätzen und Ganzgoldschnitt, auf dem Spiegel signiert »Chambolle-Duru«; in mit Filz ausgeschlagenem Pappschuber mit braunen Maroquinkanten.
Provenienz: Auf dem Spiegel Wappenexlibris (gestochen von Heylbrouck fils) mit der Devise »Laet vaeren nydt« von Albert-Philippe Charles vicomte van Vaernewyck (1762 – 1841), bis 1794 Advokat am Großen Rat von Mecheln, dem höchsten Gericht der spanischen Niederlande.
Das dem König gewidmete unikale Pergamentexemplar, illuminiert von dessen Buchmaler; dazu ein vollständiges schwarz-weißes Exemplar auf Papier
Die erstmals 1495 gedruckte Weltgeschichte – mit besonderer Berücksichtigung Frankreichs – von Robert Gaguin (1433 – 1501) war zu Anfang des 16. Jahrhunderts weit verbreitet. Fast jedes Jahr erschien eine neue Ausgabe, erst recht, seitdem das Compendium super Francorum gestis ins Französische übersetzt und von Pierre Desrey (1450 – nach 1519) mit einem Prolog versehen und weitergeführt worden war – unsere Ausgabe bis ins Erscheinungsjahr 1518.
Eine Weltchronik, die vom antiken Troye la grant geradewegs auf das royaulme de France und auf die jüngsten Taten des französischen Königs Franz I. zulief, mußte aber auch diesem höchstpersönlich zusagen – schon weil das Heilige Römische Reich Deutscher Nation darin links liegen gelassen wurde, und damit der Rivale Kaiser Maximilian I., der selber »Hektor von Troja zum Urahn der Habsburger zu machen« [Silver 21] versuchte. Tatsächlich widmete der Drucker Nicole de la Barre dieses Exemplar dem König, das als einziges auf Pergament gedruckt wurde – die Bibliographen wissen, wenn überhaupt, nur dieses als Beispiel anzuführen. Sämtliche Blätter bestehen aus Kalbshaut und sind von einer seidigen Beschaffenheit, was bei diesem großen Buchformat und -umfang keineswegs selbstverständlich ist.
Der König nahm die Gabe in Gnaden an und demonstrierte seine besondere Wertschätzung dadurch, daß er die Illustrationen von Jean Coene IV, dem aus Brügge stammenden und seit 1500 in königlichen Diensten stehenden Buchmaler, in Gold und Farben ausmalen ließ – in einer so kostbaren

Weise, daß man den Eindruck einer genuinen Handschrift mit Miniaturen gewinnt. Der Name des Künstlers ist erst seit unserem Katalog Boccaccio und Petrarca in Paris bekannt, in dem wir die Trionfi Petrarcas mit Miniaturen dieses Malers anbieten konnten. Auch Vergleiche mit dem 1518 datierten Escudier-Galitzin-Perkins-Shaw-Manuskript in unserem Katalog Vom Heiligen Ludwig zum Sonnenkönig sowie mit den Abbildungen bei Anne-Marie Lecoq lassen keinen Zweifel zu, daß er diesen Pergamentdruck illuminiert hat. Auf dem Titel wurde de la Barres anscheinend mit Absicht schwach abgedruckte Marke (vgl. letzte Seite) mit einer echten Miniatur übermalt. Diese zeigt das französische Königswappen mit den drei Lilien, gehalten von zwei Engeln und eingefaßt von einem antikisierenden architektonischen Rahmen, auf diese Weise die doppelte, religiös und welthistorisch herzuleitende Dignität des Monarchen signalisierend.
Der Autor Robert Gaguin ist im Anschluß an das ausführliche, doppelspaltig gedruckte Inhaltsverzeichnis (von dem das Blatt BB 1 fehlt) auf einem halbseitigen Holzschnitt (BB 5v) dargestellt: In Gelehrtentracht mit Barett sitzt er an einer Truhe, auf der Schreibutensilien liegen, und weist mit erhobenem Zeigefinger auf eine Schriftrolle, die er gemeinsam mit einem Engel hochhält: »Spes mea de[us]« ist darauf zu lesen. Der Umgang des Autors mit dem Himmelsboten wirkt deutlich vertrauter als auf dem entsprechenden Holzschnitt in unserem Roman de la rose von 1521. Die motivische Parallele in der Titelminiatur, auf der zwei Engel das Königswappen halten, ist evident. Das Blatt BB 6, das die Autoren vor einem Kruzifix zeigt, wurde entfernt.
Prachtvoll mit sehr viel Gold illuminierte Jean Coene IV den ganzseitigen Holzschnitt auf Blatt a6r, der den Gründungsakt des christlichen Frankenreichs illustriert. Die senkrechte Teilung stellt wiederum den weltlichen und den religiösen Aspekt je einzeln heraus: Links sieht man König Chlodwig in goldener Rüstung und mit erhobenem Schwert über einen am Boden liegenden Standartenträger hinwegreiten –ein pikantes anachronistisches Detail ist, daß dessen Feldzeichen den erst seit 1433 verwendeten Doppeladler des deutschen Reiches zeigt! Rechts hingegen erblicken wir Chlodwig bei seiner Taufe in einem kirchlichen Innenraum. Die erstmals 1488 in La mer des Histoires verwendete Darstellung wurde auf Blatt O1 wiederholt [vgl. Davies], um die Geschichte Karls VIII . und Ludwigs XII . voneinander zu trennen; dort allenfalls ›typologisch‹ passend, wurde sie diesem Exemplar gleichfalls entnommen. Einige kleinere Holzschnitte, die interessanterweise aus dem 1484 in Paris erschienenen Roman Destruction de Troie stammen, zeigen Schlachtengetümmel in ›Nahaufnahme‹. Die Illustration auf Blatt e2r wird auf l6v wiederholt, was man auf den ersten Blick gar nicht bemerkt, weil sie von Jacques Coene IV völlig anders illuminiert wurde. Sie zeigt: den Tod Hektors von Troia [vgl. Claudin I, 189]! Die Blätter g2 und k6 wurden leider entfernt; ihr Verlust ist insofern halbwegs zu verschmerzen, als sie eine identische Abbildung zeigten. Wieder im prachtvollen Kolorit des königlichen Miniators präsentiert sich die dramatische Kampfszene auf Blatt g4v, ebenso die beiden ganzseitigen genealogischen Tabellen auf o1v und s4r, von denen die erste mit einer doppelblattgroßen Klapptafel kombiniert ist – diese zeigt die Nachkommen Ludwigs des Heiligen bis zu Franz I. Möglicherweise wurde sie eigens diesem königlichen Exemplar eingefügt, denn sie fehlt bei dem von Fairfax Murray ebenso wie bei unserem Papierexemplar.


Zwar bleibt es ein unverzeihliches Sakrileg, daß aus dem unikalen Buch zwischen der Versteigerung von 1724 und dem Ham House Sale 1938 insgesamt sechs Blätter herausgeschnitten wurden, doch nimmt dies dem Widmungsexemplar für König Franz I. von Frankreich nichts von seiner Einzigartigkeit. Das breitrandige Pergament ist fleckenfrei und makellos. Von der vente Anet mit den Beständen der Diane de Poitiers und der Anne de Bavière 1724 kam es in die berühmte Harleian Library von Edward Harley, 2nd Earl of Oxford (1689 – 1741), wo es den heutigen Einband erhielt. Während deren Manuskripte später den Grundstock der Bestände des British Museum bildeten [vgl. Catalogus Bibliothecæ Harleianæ II , 8685], wurde unser Druck 1744 an Lionel, 4th Earl of Dysart (1708 – 1770), verkauft. In Familienbesitz blieb es bis zu Sotheby’s Ham House-Auktion I von 1938.
Aufschlußreich ist der Vergleich mit dem beiliegenden – vollständigen – Papierexemplar. Es gehört zu der selteneren Variante mit der Marke Jean Petits auf dem Titel, die seitenidentisch, aber mit minimal vergrößertem Textspiegel und in leicht veränderter Orthographie gesetzt wurde. Hier sehen wir nicht nur die aus dem Pergamentexemplar entfernten Illustrationen – insbesondere die ganzseitige Kreuzigung, »ingeniously combined« [Davies] mit den Passionswerkzeugen und den beiden knienden Figuren des Verfassers und des Fortsetzers, die vom Meister der Apokalypsenrose stammt. Vielmehr haben wir die Holzschnitte, die (bis auf die Kreuzigung) wohl auch von Jean Coene entworfen wurden, im originalen, unkolorierten Zustand: Bemerkenswert ist die im anderen Exemplar zur Gänze übermalte Titeleinfassung, »composed of hunting and pastoral scenes, either formerly used in, or copied from, a Livre d’Heures« [ebd.], vor allem aber auch die Kampfszene auf g4v, die im Pergamentexemplar völlig frei quasi als eigenständige Miniatur neu konzipiert wurde.
Literatur: Bechtel G-7; nicht in BM STC; Brun 194; Brunet II , 1439 (zit. dieses PergamentExemplar); Davies, Fairfax Murray, French, Nr. 184 (ohne die Falttafel); Graesse 3, 4 (zit. dieses Pergament-Exemplar); vgl. Lecoq, Abb. 73 und 169-177; vgl. Tenschert XXXVIII , 291ff. und 320; Moreau 1518, Nr. 1823, Van Praet, Bibliothèques IV, S. 111, Nr. 17 (ohne Angabe eines Exemplars).
This is the unique vellum copy, dedicated by the printer to the French King Francis I, of the French translation of Robert Gaguin’s History of the World in the supplemented edition of 1518. The king had it sumptuously painted in gold and colours by his illuminator Jean Coene IV, who added his own creative touches, as comparison with the accompanying black and white paper copy shows. In the 17th century, the unique book came into the possession of Edward Harley, who had it rebound, and then to Lionel, 4th Earl of Dysart.



Processionarium . Incipit liber p[ro]cessionarius secundum consuetudine[m] ordinis sancti p[at]ris nostri Hieronymi: cum suis additamentis nouiter factis. [Saragossa, Jorge Coci], 1526.
A-P8 Π 1 = 119 gezählte Bl., 2 Bl. – Durchgehend in Schwarz und Rot gedruckt. – Gedruckt auf kräftiges Pergament. – Zusätzlich eingebunden 3 handschriftliche Notenblätter (eines halbseitig) aus Pergament.
Mit vierteiliger Titeleinfassung, 1 ganzseitigen, von einer vierteiligen Bordüre eingefaßten Abbildung in Holzschnitt, mit zahlreichen Zierinitialen in Schwarz und Lombarden in Rot, fast durchgehend mit schwarzgedruckten Noten auf rotem fünflinigen System.
Quart (ca. 190 x ca. 122 mm).
Schwarzbrauner, blindgeprägter Kalblederband der Zeit über Holzdeckeln auf drei breite, mit Streicheisenlinien verzierte und von doppelten Streicheisenlinien begleitete Bünde, auf den Deckeln ornamentaler Rollenstempel-Rahmen zwischen doppelten Streicheisenlinien, darin eine große Raute der nämlichen Art, zentral ein aus acht Pointillé-Kreuzen gebildetes großes Kreuz, mit zwei Schließbeschlägen auf dem Rücken, mit Inschrift auf dem Fußschnitt und zwei beidseitig beschriebenen, zusammengehörigen Blättern aus einer Pergamenthandschrift als fliegenden Vorsätzen (bestoßener Einband restauriert und an mehreren Stellen ergänzt, Schließen fehlen, Fußschnitt fleckig).
Aus dem Weltkulturerbe Portugals
Liturgische Prozessionen finden nicht nur unter freiem Himmel statt, wie zu Fronleichnam und Palmsonntag, sondern auch während der sonntäglichen Eucharistiefeier, indem Priester und Assistenten feierlich in die Kirche ein- und ausziehen. Seinem kommunikativen Zweck entsprechend ist dieses Prozessionale durchgehend zweifarbig in einer besonders großen Type großzügig und breitrandig gedruckt und gleichzeitig von handlichem Format. Dank des kräftigen Pergaments und des robusten Holzdeckelbandes hat es sich bis heute sehr gut erhalten.
Das Buch selbst hat einen weiten Weg zurückgelegt: Es handelt sich um einen Druck von 1526 aus Saragossa für den Hieronymitenorden. Dieser war im 14. Jahrhundert auf der iberischen Halbinsel in franziskanischem Geist entstanden und folgte ab 1373 der Augustinusregel und dem Geist des Kirchenvaters Hieronymus: Dessen Porträt als Eremit, umgeben von einer vierteiligen Bordüre, schmückt ganzseitig die Titelrückseite. Wie in Spanien genossen die Hieronymiten auch in Portugal wegen ihrer Sittenstrenge die besondere Protektion des Königshauses. Ihnen vertraute König Manuel I. das Mosteiro de Belém bei Lissabon an, zu dem er 1502 den Grundstein legte und das im enthusias-



tischen Geist der Epoche der Entdeckungen zu einem Höhepunkt der spätgotischen Architektur und einem Monument der nationalen Größe Portugals aufwuchs. Die dreischiffige Hallenkirche ist einer der ungewöhnlichsten Innenräume des Landes, der Kreuzgang gleichfalls ein Juwel portugiesischer Baukunst. Hier fand Vasco da Gama ebenso seine letzte Ruhe wie die Könige Manuel I. und der unglückliche ›Märchenkönig‹ Sebastian. Im Jahr 1833 jedoch wurde der Orden in Portugal verboten, das Kloster 1834 in ein Waisenhaus umgewandelt. Verwaist war damit auch unser Prozessionale, dessen Herkunft aus Belém ein spanischer Kaufvermerk von 1883 verbürgt.
In jüngster Vergangenheit erhielt das Mosteiro dos Jerónimos in dem inzwischen nach Lissabon eingemeindeten Belém seinen alten Glanz zurück: Im Jahr 1983 wurde das Kloster von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt, 2007 unterzeichneten hier die Regierungschefs der EU-Staaten feierlich den Vertrag von Lissabon zur Reform der Europäischen Union. Es wäre an der Zeit, auch unser Prozessionale, dessen Gesänge einst in den heiligen Hallen des berühmten Klosters erklangen, neu zu würdigen.
Provenienz: Ein handschriftlicher Kaufvermerk auf der Titelrückseite von 1883 verbürgt die Herkunft aus dem 1834 aufgelösten Hieronymitenkloster in Belèm bei Lissabon.
Literatur: Alès 311; Bohatta, Nr. 594 (unvollständiges Pergamentexemplar); vgl. Palau 238152 (Anm.).
The Processional for the Hieronymite Order, which was widespread on the Iberian Peninsula, was printed in Saragossa in 1526. The vellum copy preserved in the old binding is of the most venerable provenance: it comes from the Hieronymite monastery of Belém near Lisbon, for which the Portuguese King Manuel I himself laid the foundation stone and which today belongs to the UNESCO World Cultural Heritage.
Missale ad co[n]suetudine[m] i[n]signis ecclesie Ebroicensis una cum dicte ecclesie institutis co[n] suetudinibusq[ue]. Paris, Jean Kaerbriant und Didier Maheu für Jean Petit, 1527.
† 8 a-l 8 m-n 6 o-t8 v6, A-H8, AA -DD 8 EE 6 = 8 Bl., 154 gezählte Bl., 64 gezählte Bl., 37 gezählte Bl., 1 Bl. = zusammen 264 Bl. – Zweispaltiger Druck mit schmaler Marginalspalte in Schwarz und Rot; mit blaßroter Reglierung. Gedruckt auf Pergament.
Mit halbseitiger Holzschnitt-Verlegermarke in gemaltem, ganzseitigem Bordürenrahmen auf dem Titel, 2 ganzseitigen Holzschnitten, 1 halbseitigen Holzschnitt (Gregorsmesse) in gemaltem, ganzseitigem Bordürenrahmen, 21 viertelseitigen und 128 kleineren Holzschnitten, sämtlich in Gold und Farben illuminiert vom Meister der Anne de Graville; mit 2 kleinen unkolorierten Holzschnitten, außerdem mit zahlreichen fünf- und zweizeiligen Initialen in Gold oder Blau auf altrosa oder blauem Grund mit Ornamentik in Gold oder Weiß, gelegentlich auch figural und in Farben, mit Gelbmarkierungen von Versalien.
Folio (ca. 330 x ca. 220 mm).
Zeitgenössischer Halbschweinslederband über Eichenholzdeckeln auf sechs breite und zwei schmale Bünde, mit Streicheisenlinien auf dem Rücken, Dekor von zwei Rollenstempeln auf den Deckeln, originalen Pergamentvorsätzen und Ganzgoldschnitt, in schwarzer, mit Filz ausgelegter Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel (Deckel mit einigen Wurmspuren, untere Ecken mit kleinen Abbrüchen).
Das unikale illuminierte Pergamentexemplar
Von diesem Missale für den Gebrauch des Bistums Évreux in der Normandie sind zwei Exemplare bekannt: Das andere, ein Papierexemplar in der Pariser Bibliothèque Sainte Geneviève, ist inkomplett. Unser Exemplar, das einzige vollständige, ist hingegen auf Pergament gedruckt; darüber hinaus wurden seine 152 Holzschnitte ebenso minutiös wie splendide von einem der bedeutendsten Maler der Zeit, dem Meister der Anne de Graville in Gold und Farben ausgemalt (siehe unseren Kat. Horae 124.3 und M. Orth I, Nr. 36, Abb. 95), so daß es auch heute noch die reinste Augenlust ist, bei den liebevollen und lebhaften Darstellungen zu verweilen – herausragend natürlich die beiden einander gegenüberstehenden und wie ganzseitige Miniaturen wirkenden Bilder der Kreuzigung Christi und des thronenden Gottvaters. Stehen sie ikonographisch denen im Missale von Langres nahe, so unterscheiden sie sich deutlich in Details, Umrahmung und Farbgebung.










Während Adolphe André Porée in seiner Bibliographie über Les anciens livres liturgiques du diocèse d’Évreux festhielt, »ce missel fut publié par ordre de l´évêque Ambroise Le Veneur«, trägt das original erhaltene Vorsatzblatt am Schluß den zeitgenössischen Eintrag: »Raynaldus-viconte cantor eccl[es]ie ebr[oicensis] iussit hunc imprimi libru[m] et ornari insignis figuris«: Raynald Vicomte, der Kantor der Kirche von Evreux, gab den Auftrag, dieses Buch zu drucken und mit ganz besonderen Bildern zu schmücken. In jedem Fall deutet das mit diesem Eintrag verbundene Insider-Wissen auf die enge Verbindung unseres Exemplars mit der Kathedrale Notre-Dame zu Évreux selbst hin. Zur Illumination: Der erst kürzlich definierte Meister der Anne de Graville steht in der ersten Reihe der Buchmaler nach 1500 in Paris und muss auf einer Höhenlinie mit Jean Pichore und Etienne Colaud angesiedelt werden, wobei er letzteren an Eleganz und Farbenschönheit oft noch übertrifft: es ist nur recht und billig, diesen einzigartigen Druck auf Pergament mit seinen mehr als 150 eigenhändig illuminierten Holzschnitten als sein Hauptwerk überhaupt zu bezeichnen; siehe die oben gegebenen Hinweise auf unseren Stundenbuch-Katalog Horae B. M. V. und Myra Orth’s große Überschau der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Zur Zeit der Herstellung des Missales hatte die Reformation in der Normandie bereits seit sieben Jahren Fuß gefaßt. Als König Franz I. 1540 in Évreux ein Inquisitionsgericht einrichtete, widersetzten sich die Einwohner so entschieden, daß er es wieder auflöste. Seit 1559 gab es in Évreux eine reformierte Kirche die bis zur Aufhebung des Edikts von Nantes im Jahr 1685 bestand. Unser unikales, verschwenderisch ausgestattetes Prunkexemplar zeigt sich von solchen Unsicherheiten in keiner Weise angekränkelt. Wenn es dasjenige der Kathedralkirche war, dann ist mit dem Verlust in den Wirren der Französischen Revolution zu rechnen. Bald darauf befand es sich im Besitz eines Privatmannes, wenn auch eines hochgestellten Geistlichen: Jean-Paul-Gaston de Pins (1766 – 1850), Generalvikar von Bourges, ab 1817 Bischof von Béziers und ab Dezember 1823 apostolischer Administrator des Erzbistums Lyon. Als dieser es 1824 verkaufte, begann die ›zweite Existenz‹ des Missales als eines bibliophilen Objekts, dessen (kunst)historischer Rang noch nicht abschließend gewürdigt wurde.
Provenienz: Eintrag auf hinterem Vorsatz: »Raynaldus vicomte cantor eccl[es]ie ebr[oicensis] iussit hunc imprimi libru[m] et ornari insignis figuris«: Raynald Vicomte war »Cantor«, das heißt der nach dem Bischof einflussreichste und vermögendste Würdenträger der Kathedrale zu Evreux, er gehörte dem normannischen Adelsgeschlecht der Le Vicomte de Blangy an (siehe Rietstap II , S. 999), er hat sich auch auf dem ersten Blatt eingetragen: »Ce p(rese)nt livre est a mons(ieur) R. le chantre V(icomte)«. Laut Bleistiftvermerk auf dem Vorsatz gehörte es dem Marquis Jean-Paul-Gaston de Pins (1766 – 1850), vgl. auch die drei Pinienzapfen im ursprünglich freigelassenen Wappenschild auf Bl. I [vgl. Olivier 2226], und wurde 1824 von Brun in Narbonne erworben. – Arthur Brölemann, mit dessen Signaturen »B 164« und A 19« verso Vorblatt, dessen Katalog Lyon 1897, Nr. 146; Auktion (Henri Auguste Brölemann) seiner Nichte Mme Mallet, Sotheby’s, London, 4./5. Mai 1926, Nr. 165: £ 820. – Quaritch, Cat. 386, 849: £ 1.500 – J. G. Barber, Esq., seine Auktion Sotheby’s, London, 22.6.1953: £ 880, an Thorp. – Lionel Robinson (Sale 1986, 75: £ 57.200 (= CHF 150.000) an »Suter«: zweithöchster Preis der Auktion – H. P. Kraus, Katalog 188, New York 1991, Nr. 74: $ 325.000 (= CHF 502.000).



Literatur: Nicht bei Adams; Catalogue […] Brölemann, Lyon 1897, Nr. 146; Moreau 1527, 1278; Porée, S. 26f. (kennt unser Exemplar nicht); nicht bei Van Praet; Weale/Bohatta Nr. 367, S. 65 und 327.
Only two copies of the Missal printed in 1527 for the use of the bishopric of Évreux in Normandy are known: This one alone is complete and printed on vellum (the other incomplete and on paper); moreover, its 152 woodcuts were as meticulously as splendidly coloured in gold and colours by the Master of Anne de Graville. It is in a totally impeccable condition from one end to the other and still in its original binding. After the French Revolution, it passed into the hands of the Bishop of Béziers, Jean-Paul-Gaston de Pins, and later into the collections of A. Brölemann, Lionel Robinson and H. P. Kraus.


Psalteriu[m] horas canonicas ca[n]tare in ecclesiis volentib[us] secundu[m] laudabilem co[n]suetudine[m] Ecclesie traiectensis perutile. Delft, Cornelius Henricz. [Lettersnijder] für Bartholomeus Jacobsz in Leiden und Jan Seversz. die Croepel in Amsterdam, 1530.
Π 4 a-t6 v4 A-C6 D4 E-K 6 = 180 Bl. – Mit dem leeren Blatt v4. – Zweispaltiger Druck auf Pergament in Schwarz und Rot.
Mit ganzseitigem architekturalen Holzschnitt-Rahmen auf dem Titel, einer achtzeiligen historisierten Holzschnitt-Initiale, 18 vierzeiligen und 109 dreizeiligen Zierinitialen sowie zahlreichen ein- bis dreizeiligen Initialen in Schwarz oder Rot, mit rotgedrucktem vierlinigen Notensystem, manchmal mit handschriftlich eingetragener Notation.
Folio (ca. 280 x 200 mm).
Originaler dunkelbrauner holländischer Kalblederband über starken, abgefasten Eichenholzdeckeln auf vier breite, mit Blindfileten verzierte und von schraffierten Blindlinien begleitete Bünde, mit fetten Blindfiletenrahmen in den Rückenfeldern, mit ungewöhnlichen geflochtenen Kapitalbändern; auf den blindgeprägten Deckeln außen ein vierfacher Filetenrahmen, darin ein von dreifachen Fileten eingefaßter Rollenstempelrahmen (Tiere in Ranken), im Mittelfeld diagonal gekreuzte dreifache Fileten, darin rautenförmige florale Einzelstempel; mit acht Buckel-, acht Eck- sowie vier Schließbeschlägen aus Messing, mit ledernen Blattweisern; in schwarzer, mit Filz ausgelegter Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel (hinteres Außengelenk mit längerem Einriß, vorderes repariert, lederne Schließbänder großteils fehlend, vorderes Vorsatz fast lose, Titel am Innensteg mit Einriß, den Rand des Holzschnitts betreffend, leicht fingerfleckig).
Das einzige Pergamentexemplar des schönen Drucks, im originalen Einband
Holländische Pergamentdrucke des 15. und 16. Jahrhunderts sind »excessivement rares« [Le Bibliophile Belge]; sie wurden ausschließlich zu liturgischen Zwecken hergestellt, in erster Linie für das besonders wohlhabende Bistum Utrecht. Dieses einzige bekannte Pergamentexemplar des großartigen Psalters war sogar Van Praet unbekannt.
Der Psalter ist zugleich ein glänzendes Meisterwerk des Delfter Druckers Cornelis Henricz, von dem nur 11 Drucke aus den Jahren 1517 – 1534 bekannt sind. Seinen Übernamen »Lettersnijder«
konnte er als einen Ehrentitel tragen: Der Druck erfolgte in einer würdevollen großen liturgischen Type zu 28 Zeilen plus Kopfzeile, mit schönen figürlichen und ornamentalen Initialen in Schwarz-



und Rotdruck sowie vierlinigen Notensystemen, von denen einige von Hand mit sauberer NeumenNotation ausgefüllt wurden.
Überhaupt finden sich zahlreiche Notizen des 16. Jahrhunderts auf den vier fliegenden Vorsatz-Blättern, dem Titel, der letzten, leeren Seite und gelegentlich auch am Rand, die eindeutig bezeugen, daß das Buch zu gottesdienstlichen Zwecken genutzt wurde. Sie liefern liturgische Anweisungen und Ergänzungen und geben obendrein eine Aufstellung der besten Sänger des betreffenden Klosters. Skurril ist eine kleine Hinzufügung auf Blatt r6, wo, angelehnt an eine Versalie, ein hakennasiges, mißmutig dreinblickendes Männergesicht im Profil eingezeichnet wurde. Laut einer anonymen Notiz in Le Bibliophile Belge aus dem Jahr 1869 war der Erstbesitzer ein Kloster in Overijssel, das wir demnach wohl in einer der alten Hansestädte Deventer, Kampen, Oldenzaal oder Zwolle suchen können.
Auch der originale Einband ist ungewöhnlich gut mit allen Messingbeschlägen erhalten. Der Rollenstempel mit Tieren und Fabelwesen in Ranken ähnelt demjenigen auf einem Einband von Jan Boscaert um 1525 [vgl. Goldschmidt 1928, Tafel 45] und weiteren Beispielen bei Hulshof/Schretlen [Tafeln 28-29], die sämtlich aus Flandern stammen.
Provenienz: Erstbesitz eines Klosters in Overijssel. – Wappenexlibris von Thomas Brooke auf dem Innendeckel, dessen Katalog 1891, S. 545f. – Sotheby´s, Ingham Brooke sale, 7.3.1913, Nr. 25. –The American Art Association, Auktion New York, 30.1.1923, Nr. 500. – Exlibris von Clarence Dillon, Dunwalke Library, dessen Auktion, Sotheby’s, New York, 5.-9.4.1980, Nr. 39. – H. P. Kraus, Katalog 156, New York 1980, Nr. VII: $ 52.000, und Katalog 188, New York 1991, Nr. 71: $ 54.000 (CHF 81.000). – Exlibris der Bibliotheca Philosophica Hermetica von Joost Ritman in Amsterdam. – Dessen Auktion Sotheby’s, London, 6.12.2000, Nr. 70.
Literatur: Nicht bei Adams; Le Bibliophile Belge, 3. sér., IV, S. 123f. (dieses Exemplar); nicht in BM STC Dutch; Bohatta, Nr. 464 (mit abweichender Kollation); Graesse VII , 451; Nijhoff I, S. 6 und, Tafeln Delft, Henricz IV-VI; Nijhoff/Kronenberg I, Nr. 345; nicht bei Van Praet.
The beautifully printed Psalter from Utrecht of 1530 is a masterpiece of the Delft printer Cornelis Henricz, called »Lettersnijder« - this is the only known parchment copy. It is presented in a magnificent Dutch Renaissance binding with all 20 brass fittings preserved. From the collections of Sir Thomas Brooke and Joost Ritman.
Der einzige Druck auf Pergament: Caesars Werke von 1531, mit 12 eigenhändigen Miniaturen des Hofmalers Etienne Colaud und überreich illuminiert;
Exemplar von Jean de Laval, Seigneur de Châteaubriant –Anne de Montmorency – Diane de Poitiers –
Anne de Bavière – Edward Harley – Earl of Dysart
Caesar, Gaius Julius . Les commentaires de Iules Cesar. […] Translatez par noble homme Estienne Delaigue dict Beauuoys. Des batailles & conquestz faictz par Cesar au pays de Gaule. Translatez par feu de bonne memoire Robert Gaguin […]. Paris, Pierre Vidoue für Poncet le Preux und Galliot du Pré, 1531.
é 4 A-P6 Q 4 a-q 6 r4 = 12 Bl., 94 gezählte Bl., 99 gezählte Bl., 1 Bl. – Druck auf Pergament. – Mit Marginalspalte gedruckt; durchgehend regliert und mit Gelbmarkierungen von Versalien.
Mit ganzseitigem architektonischen Titelrahmen, dem französischen Lilienwappen auf der Titelrückseite, 7 ganzseitigen floralen Rahmen, zwei halbseitigen Karten und 18 Abbildungen (darunter 5 Wiederholungen), alles in Holzschnitt und in Gold und Farben illuminiert, dazu 12 eigenhändige Miniaturen von Etienne Colaud anstelle der nicht eingedruckten, teils wiederholten Holzschnitte; ferner mit 5 elf- bis zwölfzeiligen, einer neunzeiligen, rund 150 achtzeiligen, 24 sechs- bis siebenzeiligen und 10 kleineren historisierten Initialen; auf der letzten Seite die Holzschnitt-Verlegermarke du Prés mit gelbmarkierter Schrift.
Folio (325 x 210 mm).
Französischer roter Maroquinband (Harley-Einband) des frühen 18. Jahrhunderts auf sechs goldverzierte Bünde, mit goldgeprägtem Rückenschild und zierlicher floral-ornamentaler Vergoldung mit gekrönten Lilienmotiven sowie Sternchen und Goldbällen um ein zentrales Ornament aus Goldpunktlinien in den übrigen Rückenfeldern; mit dreifachem Goldfiletenrahmen auf den Deckeln, doppelten Goldfileten auf den Stehkanten, vergoldeten Innenkanten, marmorierten Vorsätzen, weiteren Papier- sowie doppelten Pergamentvorsätzen und Ganzgoldschnitt.
Unikales illuminiertes Pergamentexemplar mit unvergleichlicher, lückenloser Provenienz
Dieses Buch, ein Unicum, verweist in mehrfacher Beziehung auf den engsten Umkreis um König Franz I. von Frankreich (1494 – 1547). Zu diesem gehören der Übersetzer und Herausgeber, Étienne de Laigue, ebenso der Buchmaler Étienne Colaud, und schließlich auch die beiden ersten Besitzer, Jean de Laval und Anne de Montmorency.
Die chronologische Sammlung von commentarii über Cäsars Kriege umfaßt neben Cäsars De bello Gallico und De bello civile die Werke De bello Alexandrino sowie De bello Africo und De bello Hi-

spaniensi, die von seinen Gefolgsleuten Aulus Hirtius und Cornelius Balbus Maior herausgegeben worden waren. Das Corpus Caesarianum lag so bereits Sueton vor, wurde allein in dieser Form dem Mittelalter überliefert und war 1513 von Aldus Manutius gedruckt worden. Dessen Ausgabe war die Grundlage dieser ersten vollständigen französischen Übersetzung; lediglich das Werk über den gallischen Krieg war bereits 1485 in der Übertragung von Robert Gaguin erschienen; es wurde hier mit orthographischen Anpassungen übernommen. Étienne de Laigue, seigneur de Beauvais, hatte bereits »une carrière militaire sans doute brillante« [Boutroue 159] im Dienst Franz’ I. hinter sich, als dessen Gefangennahme in der Schlacht von Pavia 1525 ihn zu literarischen Formen der Bewältigung und Selbstvergewisserung trieben, bei denen Cäsar als militärisches und diplomatisches Vorbild dienen konnte: Der König belohnte seinen Getreuen mit der Privilegierung des Buches sowie der Aufnahme in den Michaelsorden. In der Folgezeit betraute er ihn mit diplomatischen Missionen in ganz Europa [vgl ebd. 168]. De Laigues und Gaguins Übersetzung des Corpus Caesarianum wurde bis 1577 noch elfmal nachgedruckt [vgl. ebd. 163], immer in kleinerem Format, was auf schulischen Gebrauch hindeutet. Die repräsentative erste Ausgabe, die einzige in Folioformat, ist hingegen extrem selten.
Von dieser liegt nun wiederum das einzig bekannte Exemplar auf Pergament vor – illuminiert von Étienne Colaud, der zwischen 1512 und 1541 ebenfalls für Franz I. und sein Umfeld als Buchmaler tätig war. Unter anderem fertigte er auf Bestellung des Königs eine Serie von Handschriften der Statuts de l’ordre de Saint-Michel, was ihn auch bei den Ordensmitgliedern bekannt gemacht haben dürfte. Zu ihnen gehört der Erstbesitzer unseres Buches, Jean de Laval, seigneur de Châteaubriant (1486 – 1543), dessen gekröntes, von der Ordenskette umgebenes Wappen in den Titelrahmen integriert wurde, indem die Marke des Verlegers Galliot du Pré vollständig übermalt wurde.
Das Corpus ist mit insgesamt 20 Abbildungen ausgestattet, wobei die beiden halbseitigen Karten Galliens und Spaniens sowie fünf Darstellungen von Orten in Gallien (Rheinbrücke, Avaricum, Alesia, Uxellodunum und Marseille) nach der Aldine von 1513 kopiert wurden [vgl. Boutroue 165]. Einen zeremoniösen Charakter erhält das Werk durch den architektonischen Titelrahmen und das königliche Wappen auf der Titelrückseite sowie durch sieben floral dekorierte Rahmen zu den Zwischentiteln.
Aura und Ansehen einer Luxushandschrift erhält das Buch durch die Art der Bemalung, vor allem den 12 eigenständigen Miniaturen Etienne Colauds. Denn nicht nur Lavals Wappen auf dem Titel wurde frei eingemalt, auch bei den Illustrationen wurden alle Holzschnitte im Text und am Kapitelende durch unabhängige Miniaturen von bemerkenswerter Qualität in Komposition und Ausführung ersetzt. Die sieben ganzseitigen Einrahmungen der Zwischentitel, ursprünglich mit stereotypem Holzschnittdekor, wurden mit kunstvoll variiertem, floralem Dekor auf Goldgrund bedeckt. Passend dazu wurden schließlich die fast 200 Initialen koloriert, weißgehöht und auf komplementärfarbige Gründe mit linearer Goldornamentik gesetzt, während die goldenen Binnengründe mit vielerlei Blüten geschmückt wurden. Alle Abbildungen einschließlich der beiden Karten wurden ebenso intensiv wie nuancenreich koloriert und goldgehöht und sind in perfekter Frische erhalten.
Jean de Laval, seigneur de Châteaubriant (1486 – 1543), war bereits 1516 an den Königshof gekommen, wo vor allem seine Gattin Françoise de Foix Karriere machte: Sie wurde die langjährige













Mätresse Franz’ I., bis dieser sich um 1528 der jüngeren Anne de Pisseleu zuwandte. Françoise zog sich nun wieder zu ihrem Mann in die bretonische Provinz zurück, der 1531 mit der Stelle des Gouverneurs der Bretagne ›abgefunden‹ wurde. Ob ihm in diesem Zusammenhang auch unser illuminiertes Pergamentexemplar des soeben erschienenen Cäsar überreicht wurde?
Für die in Kauf genommenen Entbehrungen scheint sich Jean de Laval indes etwas zu offen schadlos gehalten zu haben. Bei einer Inspektionsreise in die Bretagne soll der Connétable Anne de Montmorency (1493 – 1567) auf finanzielle Unregelmäßigkeiten gestoßen sein; auch ermittelte er zu den Umständen des frühen Todes von Françoise de Foix im Jahr 1537. Anne de Montmorency entlastete Laval, der ihn zum Erben von Châteaubriant – und unseres Buches machte [vgl. Bedos Rezak, S. 26f., 305 und 323]. Dieser wiederum schenkte es Diane de Poitiers (1499/1500 – 1566), der Mätresse und Vertrauten König Heinrichs II . Deren Erbe trat Anne de Bavière, princesse de Condé (1648 – 1723), an [vgl. Quentin-Bauchart]. Auf ihrer Auktion der Schloßbibliothek von Anet 1724 wurde das Buch als Nr. 64 für 70 livres an Edward Harley, 2nd Earl of Oxford and Earl Mortimer (1689 – 1741), verkauft [vgl. Van Praet und Brunet]. Dieser ließ es eventuell von Augustin Duseuil unmittelbar nach der Auktion noch in Frankreich in den jetzigen Einband fassen. Aus dessen Besitz kaufte Lionel, 4th Earl of Dysart (1707 – 1770) das Buch 1744, das bis zur Ham House-Auktion von Sotheby’s am 30. Mai 1938 in Familienbesitz blieb – eine lückenlose Provenienz, die sich nobler kaum denken läßt. Seit 1938 war das Exemplar über drei Generationen in Pariser Privatbesitz, aus dem wir es 2021 erwarben. Es scheint unmöglich, ein anderes ähnlich bedeutendes Werk zu finden, dessen mannigfaltige Provenienz seit dem Druck im frühen 16. Jahrhundert bis heute ununterbrochen dokumentiert ist.
Aus Lavals Erstbesitz stammen zwei weitere auf Pergament gedruckte, illuminierte Geschichtswerke von Thukydides bzw. Jean Froissart, die aus der Bibliothek des Prinzen Eugen von Savoyen in die Österreichische Nationalbibliothek gelangten und 1986 in der Ausstellung zur Bibliotheca Eugeniana im Prunksaal gezeigt wurden [Bibliotheca Eugeniana, Nr. 45 und 46]. Obwohl auf Tafel 6 Lavals eingemaltes Wappen und ein auf Schloß Anet verweisender Besitzvermerk abgebildet sind, blieb die herausragende Provenienz dort unbekannt. Vor allem aber ist zu erwähnen der berühmte "Perceforest", den der Duc d'Aumale 1852 auf der Versteigerung der Bibliotheken seines Vaters Louis-Philippe für 11.650 Goldfrancs erwarb (Nr. 1318), auch er aus der uns nun schon weidlich bekannten Auktion von Château d’Anet von 1724, wo ihn Graf Hoym für 601 Livres erwarb. Siehe L. Delisle, Chantilly - Le Cabinet des livres imprimés, 1905, S. xxxivf. und Nr. 1427.
Provenienz: Auf dem Titelrahmen eingemalt das Wappen von Jean de Laval, seigneur de Châteaubriant. – Anne de Montmorency. – Diane de Poitiers. – Anne de Bavière, princesse de Condé. – Auf deren »vente de la bibliothèque du château d’Anet, en 1724« [Brunet] als Nr. 64 ersteigert von Edward Harley, 2nd Earl of Oxford and Earl Mortimer, vgl. Catalogus Bibliothecæ Harleianæ I (1743), Nr. 4802, und III (1744), Nr. 3226. – Verkauft an Lionel, 4th Earl of Dysart von Ham House. In dessen Familienbibliothek bis zur Ham House-Auktion von Sotheby’s am 30. Mai 1938, dort als Nr. 59 ersteigert von Galanti: £ 180.0.0. – Pariser Privatsammlung, aus deren dritter Generation wir das Werk vor zwei Jahren erwarben.








Literatur: Nicht bei Adams und Bechtel; BM STC French 89; Brunet I, 1459 (zitiert dieses Exemplar); Ebert 3301 (zitiert dieses Exemplar); Graesse II , 10; Lonchamp, Français II , 90; Quentin-Bauchart I, 315, Nr. 64 (dieses Exemplar); Schweiger II /1, 53; Van Praet, Bibliothèques III , S. 38f., Nr. 59 (dieses Exemplar); Rahir 362.
The first complete French translation of all the writings of Julius Caesar by Étienne de Laigue and Robert Gaguin is presented here in the rare first and only folio edition of 1531 – and this is the only printed copy on vellum. The first owner was Jean de Laval, Seigneur de Chateaubriand, whose wife was the mistress of King Francis I for many years. He commissioned the court painter Étienne Colaud to illuminate the book, who created independent miniatures instead of the twelve illustrations in woodcut, which have been preserved in perfect freshness. If the translator, first owner and illuminator already belonged to the close circle of the royal court, so did the following prominent owners: the Connétable Anne de Montmorency, Diane de Poitiers and Anne de Bavière. The incomparable, unbroken provenance continues in the 18th century, with Edward Harley and Lionel, 4th Earl of Dysart, and extends into 2021.

Missale secundum ritum Augustensis ecclesie diligenter emendatum [et] locupletatum: ac in meliorem ordinem q[uam] antehac digestum. Mandato [et] impensis Reuerendissimi ac illustrissimi Principis ac D[omi]ni / Domini Othonis tituli sancte Sabine presbyteri Cardinalis: Episcopi Augustani: prepositi ac domini in Elvvangen: ad Dei honorem: Ecclesie sue / suorumq[ue] clericorum profectum nouis typis […] elegantissime excusum. Dillingen, Sebald Mayer für Otto Truchseß von Waldburg, 1555.
†6 ††6 ††† 8 †††† 8 a-z 8 aa-ff 8 gg6 hh-zz 8 aaa-lll 8 mmm-ooo 6 = 28 Bl., 471 gezählte Bl., 1 leeres Bl. – Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot. – 8 Blatt auf Pergament.
Mit ganzseitiger vierteiliger Titeleinfassung in Holzschnitt, ganzseitigem Holzschnitt (Maria mit Kind), weiterem Holzschnitt (Meßopfer) in ganzseitigem architekturalen Rahmen (dieser noch zehnmal wiederholt, mit wechselndem Motiv im Sockelbereich), mit drei illuminierten Holzschnitten im Canon missae (ganzseitige Kreuzigung, historisierte Te igitur-Initiale und Gotteslamm-Medaillon); mit rund 60 sehr großen Initialen (davon die Hälfte mit Randleisten als Ausläufern), über 200 fünf- bis achtzeiligen und rund 380 vierzeiligen Initialen in Holzschnitt; mit zahlreichen Lombarden in Rotdruck sowie gedruckten Paragraphenzeichen; ferner mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System, begleitet von Text mit größeren Versalien in rotem Druck.
Folio (360 x 248 mm).
Brauner zeitgenössischer Kalblederband wohl des Lauinger Buchbinders Balthasar Werner über abgeschrägten Holzdeckeln auf sieben von Streicheisenlinien verzierte Bünde, mit goldgeprägten Fleurons in den von mehreren Streicheisenlinien gerahmten Rückenfeldern; auf den Deckeln Rahmenwerk von Streicheisenlinienbündeln und einem Rollenstempel, im Mittelfeld vorn das vormals bemalte und vergoldete Wappen Ottos von Waldburg, hinten sein Emblem; mit punziertem Ganzgoldschnitt (Einband beschabt und mit kleinen oberflächlichen Abplatzungen, die beiden Schließen fehlen, durchgehende leichte Bräunung, vor allem im Textspiegel, sowie Nässespur im unteren weißen Rand, auf Bl. 375-430 von den Ecken her in den Textspiegel sich ausdehnend, 4 Bl. mit Randeinriß, ein leeres Vorbl. mit kleineren Fehlstellen).
Der Pelikan von Dillingen, oder: ein bischöfliches ›Meßopfer‹
Dieses Missale für das Bistum Augsburg von 1555 zelebriert eindrucksvoll die geistig-moralische Wende der katholischen Kirche im Zuge der Gegenreformation. In den Jahren 1489 – 1510 waren

allein sieben Ausgaben gedruckt worden, eine Serie, die unter dem Eindruck der religiösen Krise und der reformatorischen Bewegung in der schwäbischen Metropole abrupt endete. Erst 45 Jahre später, im Jahr des Augsburger Religionsfriedens, wurde diese neue Ausgabe gedruckt. Sie sollte für das 16. Jahrhundert die letzte sein. Initiator und Geldgeber war der Augsburger Bischof Kardinal Otto Truchseß von Waldburg-Trauchburg (1514 – 1573). Das bischöfliche Wappen findet sich auf dem Titel ganz oben in der breiten Holzschnittrahmung sowie auf der Titelrückseite am unteren Bildrand. Dazu gesellt sich auf dem Titel auch zweimal ein emblematisches Motiv: das des Pelikans, der sich die Brust aufreißt, um mit seinem Blut seine Jungen zu nähren – ein Sinnbild für Christus ebenso wie für Otto, dessen Motto »Sic his qui diligunt« [Dielitz 294] hinzugefügt ist: »So [tun] sie denen, die sie lieben« – Otto bringt sich sinnbildlich den Seinen zum Opfer.
Sein Vorgänger war 1537 von den Protestanten aus Augsburg vertrieben worden, und der seit 1543 amtierende Otto von Waldburg selbst scheute keine Kosten, das Werk der Gegenreformation entschieden voranzutreiben. Vielleicht nicht zufällig klingt in seiner Devise das Verbum »diligunt« an seinen Ausweichsitz Dillingen an, wo er alle Kräfte konzentrierte: 1549 gründete er hier das Collegium St. Hieronymi, das er 1551 von Papst Julius III . zur Universität erheben ließ und später unter dem Einfluß von Petrus Canisius dem Jesuitenorden übertrug – die erste Jesuitenuniversität in Deutschland. 1550 berief er auch Sebald Mayer nach Dillingen, dessen Druckerei ebenso wie die Universität ein »Verteidigungs- und Angriffsinstrument der katholischen Kirche gegen die neue Lehre« [Bucher 1] sein sollte. Gegen die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens von 1555 hatte Otto von Waldburg vergeblich protestiert. Von nun an wandte er sich vermehrt der Seelsorge unter den Seinen zu – das große Missale ist der programmatische Auftakt und sichtbarste Ausdruck dieses Bemühens. Für die praktische Umsetzung war Sebald Mayer der richtige Mann, dessen Drucke »alle sauber und klar ausgeführt« sind. Das Missale ist seine »hervorragendste drucktechnische Leistung« und »durch die Holzschnitte Matthias Gerungs auch in künstlerischer Hinsicht sehr bemerkenswert« [ebd. 14].
Auf die illustrierte Titeleinfassung mit Bischofswappen, Pelikan-Emblem und Heiligenfiguren folgt auf der Rückseite die übliche Darstellung der Bistumspatrone, hier also der Heiligen Ulrich und Afra. Auf dem ganzseitigen Holzschnitt sind sie allerdings an die Seite gerückt, um der Himmelskönigin mit ihrem Kind Platz zu machen. Die Szenerie ist in die Wolken verlegt, in denen nicht nur Engel umherfliegen, sondern auch die Taube des Heiligen Geistes. Von einer Wolke oben links schaut die Halbfigur Gottvaters herab, der mit seinen segnend erhobenen Händen die ganze Welt zu umarmen scheint. Als räumliches Pendant dazu ist oben rechts das Monogramm Gerungs mit der Jahreszahl 1555 eingraviert – ein versteckter Hinweis auf das Selbstverständnis des Renaissancekünstlers als eines anderen Schöpfers?
Ganz im Stil der Renaissance gehalten ist zum Beginn der Meßordnung die ganzseitige Bogenarchitektur mit zwei vorgelegten Säulen, auf denen Peter und Paul stehen. Sie schauen auf das Bogenfeld mit der Marienkrönung, die in den Zwickeln von schwebenden Engeln begleitet wird. Im Mittelfeld ist eine Darstellung des Meßopfers zu sehen, das Waldburgsche Wappen an einem Säulenfuß, das Monogramm des Zeichners zentral unten am Sockel. Insgesamt wird der Bogen noch zehnmal im Buch wiederholt, wobei die Darstellungen im Sockelbereich zwischen legendarischen Szenen




und solchen aus dem Leben Jesu wechseln [vgl. Nagler 571]. Das eucharistische Hochgebet wird ganz traditionell durch eine ganzseitige Kreuzigung, eine historisierte T-Initiale und ein Medaillon mit dem Lamm Gottes illustriert, die hier recht kräftig in Blau, Grün, Rot, Rotbraun und Braun, Altrosa und Hellgelb koloriert wurden. Ebenfalls von Matthias Gerung stammen die drei verschiedenen Schmuckalphabete, über die Albert Fidelis Butsch allerdings meinte, sie würden »hinlänglich beweisen, wie weit die Formen dieses Künstlers hinter denjenigen, zu seiner Zeit in Deutschland üblichen, zurückbleiben« [Butsch II , 41].
Bischof Otto Truchseß von Waldburg-Trauchburg gab nicht nur den Druck des Missales in Auftrag; ähnlich wie sein Eichstätter Amtsbruder Gabriel von Eyb in der Frühzeit der Reformation verschenkte er auch Exemplare an geistliche Institutionen in seinem Territorium. Bei dem unsrigen gab er zudem wohl den Einband in Auftrag, der von einer blindgeprägten Rolle mit Christus, Paulus, David und Johannes dem Täufer umrahmt wird. Das Motiv war sehr beliebt, der vorliegende Stempel ist jedoch fast identisch mit einem in der Einbanddatenbank gelisteten [r003788] des von ca. 1555 – 1575 tätigen Lauinger Buchbinders Balthasar Werner, es fehlen lediglich dessen Initialen »B. W.« bei der Paulus-Figur. Das Mittelfeld des Vorderdeckels nimmt wiederum das Bischofswappen ein [vgl. p003285], das Spuren früherer Vergoldung und Bemalung aufweist; auf dem des hinteren ist noch das – absichtlich? – stärker beschabte Pelikan-Emblem zu erkennen, am deutlichsten das letzte Wort der Devise, »diligunt«. Gleichwohl ist dieses Widmungsexemplar des Augsburger Bischofs mit dem schön illuminiertem Kanonteil auf Pergament im ersten Einband in gutem Zustand auf uns gekommen. Dabei ist das Werk, wie schon Nagler betonte, »äusserst selten, indem einzelne Exemplare der Holzschnitte wegen zerschnitten wurden« [Nagler 570].
Provenienz: Kardinal Otto Truchseß von Waldburg-Trauchburg (1514 – 1573), mit dessen Wappensupralibros auf dem Vorderdeckel. – Darüber in alter Handschrift: »Dmi …«[?] und die Bibliothekssignatur »Th 251[7]«, wiederholt auf dem Titel. – E. P. Goldschmidt, Catalogue XVI , London [1929], Nr. 64 (mit Abb.): unser Exemplar?
Literatur: Adams L 1178; BM STC German 512; Brunet III , 1766, und Suppl. I, 1040; Bucher, Nr. 39 und Tafel 2-3; Butsch II , S. 41 und Tafel 76; Dodgson II , S. 213, Nr. 2; Ebert 14145; Graesse IV, 543; Langer/Rainer, Nr. 9.2; Nagler, Monogrammisten, IV, Nr. 1824; Thieme/ Becker 13, 487f.; VD 16 M 5556; Weale/Bohatta, Nr. 109; zum Buchbinder: Haebler I, 474f. (kennt weder den Namen noch diese Rolle).
The late Augsburg Missal with the Canon Missae on vellum and illuminated woodcuts by Matthias Gerung was produced in 1555, the year of the Augsburg Religious Peace – not least as a sign of the steadfastness of Bishop Otto Truchsess of Waldburg-Trauchburg, who was willing to make sacrifices for the Counter-Reformation and had it printed at his own expense. He probably also commissioned the bookbinder Balthasar Werner from Lauingen to make the binding, which shows the bishop’s coat of arms on the front and the pelican emblem on the back, which means he probably dedicated the copy to a monastery in his diocese.
Nur für Ordensmitglieder auf Pergament gedruckt: Die Statuten des Ordens vom Goldenen Vlies – lateinische Erstausgabe (um 1559) und zwei französische Ausgaben
Constitutiones clarissimi atque excellentissimi Ordinis Velleris Aurei: e Gallico in Latinum conversae. [Antwerpen, Willem Silvius, um 1559].
A-L 4 M1 = 45 Bl. – Druck auf Pergament. – Zwei zusätzliche Manuskriptblätter nachgebunden, ein drittes mit wenigen Worten Text entfernt.
Mit 5 in Gold und Farben illuminierten Holzschnitt-Initialen.
Quart (256 x 168 mm).
Kalblederband der Zeit mit erneuertem Rücken auf fünf flache, goldornamentierte und von Goldfileten begleitete Bünde, mit goldgeprägtem Rückentitel und floralen Einzelstempeln in den Rückenfeldern; auf den Deckeln einfacher und doppelter Goldfiletenrahmen, letzterer mit floralen Einzelstempeln in den Ecken, zentral ein spitzovales Medaillon mit Arabesken auf Goldgrund, mit modernen Pergamentvorsätzen (Rücken stilgerecht erneuert, Deckel beschabt, Schließbändchen entfernt, Titel leicht knittrig und schwach fleckig).
Provenienz: Eventuell im Erbgang von Joachim von Neuhaus (1526 – 1565), Ordensritter seit 1561, an seine Nachfahrin Maria Josepha Gräfin Czernin von Chudenitz (1667 – 1708); deren 1701 datierter Schenkungsvermerk an die Bibliothek des Gymnasiums des Piaristenklosters Kosmanos (Kosmonosy) bei Jungbunzlau. Das Kloster wurde im Zuge der Josephinischen Reformen ab 1782 aufgehoben.
Literatur: Nicht bei Adams; BM STC Dutch 87; vgl. Brunet II , 239; vgl. Cockx-Indestege u. a., Nr. 690 (»Plantinus, 1560«); vgl. Graesse II , 254; vgl. Van Praet, Bibliothèque du Roi V, S. 143f., Nr. 159-162 (andere Ausgaben); Voet, The Plantin Press, Nr. 1017.
Les ordonnances de l’Ordre de la Thoyson d’Or. [Antwerpen, Christophe Plantin für Willem Silvius, nach 1559].
A-I4 = 4 Bl., 63 S. – Druck auf Pergament.
Mit 5 siebenzeiligen historisierten Holzschnitt-Initialen.
Quart (232 x 160 mm).
Pergamentband des 17. Jahrhunderts mit handschriftlichem Rückentitel (Schließbändchen entfernt).
Provenienz: Pergamentexemplar, darum aus dem Besitz eines Ordensmitglieds. – Auf dem Vorsatz früher Namensvermerk »Pastoy«.

Literatur: Vgl. Adams G 492 (andere Lagenzählung, »ca. 1558«); nicht in BM STC Dutch; Brunet IV, 211f.; Cockx-Indestege u. a., Nr. 2257 (»ca. 1559«) bzw. 6445 (»na 1559); Graesse V, 39; Voet, The Plantin Press, Nr. 1017.
Les ordonnances de l’Ordre de la Toison d’Or. [Antwerpen, Balthasar I Moretus, um 1626].
*4 **4 A-K 4 L 2 = 7 [statt: 8] Bl., 83 S. – Das erste, leere Blatt entfernt. – Druck auf Pergament. Mit ganzseitigem gestochenen burgundischen Wappen und ganzseitiger gestochener Darstellung der Ordenskollane von Cornelius Galle, außerdem mit 5 Schmuck-Initialen und 3 verschiedenen Schmuckvignetten in Holzschnitt.
Quart (255 x ca. 183 mm).
Zeitgenössischer Pergamentband mit doppeltem Goldfiletenrahmen auf den Deckeln, mit Kalblederrücken auf drei Bünde, mit Papierrückenschild (Rücken im 18. Jahrhundert erneuert, leeres erstes Bl. entfernt).
Provenienz: Johann Franz Desideratus Fürst zu Nassau-Siegen (1627 – 1699), Ordensritter seit 1661. – Dessen Witwe Isabelle Claire Eugénie, geb. Baronesse du Puget de la Serre (1651 – 1714).
– William Salloch. – Auktion Christie’s, New York, 1.6.1991, Nr. 12.
Literatur: Voet, The Plantin Press, Nr. 1017; Van Praet, Bibliothèque du Roi V, S. 142f., Nr. 158 (»vers 1560«).
Die tadellos erhaltenen Pergamentexemplare dreier Ordensritter
Der Orden vom Goldenen Vlies, einer der ältesten und bedeutendsten Ritterorden, wurde 1430 von Herzog Philipp dem Guten von Burgund gestiftet, um Verbündete noch fester an sich zu binden; die Statuten wurden 1431 erlassen. Nach dem Tod Karls des Kühnen und der Hochzeit seiner Erbtochter Maria mit dem österreichischen Erzherzog Maximilian I. wurde dieser 1478 Großmeister des Ordens, der von nun an eine Institution der Habsburger war. Nachdem Philipp II . 1555 zum Großmeister ernannt, 1558 zum Kaiser proklamiert worden war und er im April 1559 den günstigen Frieden von Cateau-Cambrésis mit Frankreich geschlossen hatte, hielt er im Juli ein Ordenskapitel in Gent ab, auf dem neun neue Mitglieder aufgenommen wurden.
Im Umfeld dieses Treffens wurden die Ordensstatuten erstmalig gedruckt, sowohl in französischer Sprache als auch in der lateinischen Übersetzung des niederländischen Dichters, Hofsekretärs und Ordenskanzlers Nicolaus Grudius (1504 – 1570). Die genauen Daten und Umstände sind ungeklärt; sie hängen mit der »somewhat jealous relationship« [Clair 273, Anm. 1] der beiden Antwerpener Drucker Willem Silvius und Christophe Plantin zusammen: »Silvius must have been appointed Printer to the King in 1560«, meinte Leon Voet – ein repräsentativer Druck der Constitutiones bzw. Ordonnances des Ordens vom Goldenen Vlies mochte dafür die beste Empfehlung sein. Also druckte er 1559/60 anscheinend mehrere Ausgaben in beiden Sprachen, und zwar »in the Plantin Press – with or without the knowledge of Plantin« [Voet, The Plantin Press]. Plantin behauptete jedenfalls einige Jahre später, daß Silvius dazu seine Abwesenheit in Paris genutzt habe.

Cockx-Indestege u. a. schrieben die lateinische Version »Plantinus, 1560« zu; Voet hingegen meinte, die ersten beiden der insgesamt vier lateinischen Ausgaben seien ca. 1559 – 1560 »not in the Plantin Press« gedruckt worden – »or otherwise Silvius must have brought to Plantin’s office his own cast type« [ebd.]. In unserer Ausgabe folgen auf die ursprünglichen 66 Kapitel 16 weitere, die von Hand in wunderbar gleichmäßiger Antiqua um die Kapitel 17 bis 21 ergänzt wurden, beginnend auf der letzten bedruckten Seite und zwei zusätzliche Blätter füllend – wenige letzte Worte standen offenbar auf einem weiteren, später entfernten Blatt. Wahrscheinlich markiert die handschriftliche Ergänzung den Unterschied zwischen den beiden Ausgaben, von denen hier demnach die erste vorliegt. Denn auch die von Van Praet in der Bibliothèque du Roi gesehene erste französische Ausgabe hat nur »XVI chapitres d’additions« [Nr. 157].
Demgegenüber sind in unserem zweiten Exemplar, den französischen Ordonnances de l’Ordre de la Thoyson d’Or, die 21 ergänzenden Kapitel zur Gänze in den Drucktext integriert, mit einem Hinweis auf die Genter Versammlung vom 29. Juli 1559. Hierbei handelt es sich um die zweite oder dritte Edition, die wohl nach 1559 gedruckt wurde. Die Ausgabe mit dem veränderten Titel Les ordonnances de l’Ordre de la Toison d’Or – unser drittes Exemplar – schrieb Van Praet »Plantin, vers 1560« [Nr. 158] zu, allerdings handelt es sich es nach Voet hier wohl um »a counterpart of the Latin edition of Balthasar I Moretus of [1626]«. Gegenüber der früheren Ausgabe wurde diese »superbe édition« [Van Praet] in größerem Format und in größerer Type gedruckt; außerdem wurden nach dem Titel zwei ganzseitige, von Cornelius Galle (1576 – 1650) signierte Kupfer eingefügt. Sie zeigen das spanische Wappen und unter einer Krone die Ordenskollane über der burgundischen Devise »Ante ferit qua[m] flamma micet«.
Alle drei Exemplare wurden auf Pergament gedruckt und waren den Ordensrittern selbst vorbehalten; der Provenienz kommt hier also eine besondere Bedeutung zu. Selten war die Verbindung zwischen einem Buch und seinem Besitzer so eng: Enthielt es einerseits Verhaltensvorschriften, nach denen der »Ritter« zu leben hatte, diente es andererseits als Ausweis seiner Zugehörigkeit zu einem der exklusivsten politisch-gesellschaftlichen Zirkel des Heiligen Römischen Reiches.
Die Erstausgabe der Constitutiones enthält auf dem Titel einen Geschenkvermerk der böhmischen Gräfin Maria Josepha Czernin (1667 – 1708) aus dem Jahr 1701 an die Bibliothek des Gymnasiums des Piaristenklosters Kosmanos (tschechisch Kosmonosy). Im Zuge der Josephinischen Reformen ab 1782 wurde das Kloster aufgehoben, sein Besitz dem Religionsfonds einverleibt, das Gymnasium nach Jungbunzlau verlegt, womit sich die Spuren des Exemplars verloren. Wie aber war das Buch überhaupt in ein böhmisches Dorf gekommen? In dem Vermerk gab die seit 1687 mit dem Prager Oberstburggrafen Hermann Jakob Czernin von und zu Chudenitz verehelichte Gräfin [vgl. Siebmacher 30, S. 170f.] eigens ihren Geburtsnamen – »nata Slavatiana« – an, der auf ein in jeder Hinsicht reiches Erbe verwies: Ihr war als Tochter des Grafen Johann Georg Joachim Slavata (1638 – 1689) auch die große südböhmische Herrschaft Neuhaus (Jindrichuv Hradec) zugefallen. Dessen Vater wiederum war Wilhelm Slavata von Chlum und Koschumberg (1572 – 1652), seit 1621 Reichsgraf, seit 1628 Oberstkanzler von Böhmen und seit 1643 Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies!

Wie aber wäre der 1643 zum Ordensritter ernannte Slavata an ein 1559 gedrucktes Exemplar gekommen, statt an einen Neudruck von 1626? Möglicherweise hatte bereits er es ererbt: Denn er hatte Lucie Otilie (1582–1633), die Tochter Adams II . von Neuhaus (1546 – 1596) zur Frau bekommen; mit ihr war nicht nur der Anfall des Neuhausschen Erbes verbunden, sondern auch eine besondere Nähe zum Herrscherhaus: Ihr Vater hatte die Ämter des böhmischen Oberstkanzlers und Prager Oberstburggrafen auf sich vereinigt; bereits dessen Vater Joachim von Neuhaus (1526 – 1565) hatte seit 1554 als Oberstkanzler amtiert. Dieser war zusammen mit den Erzherzögen Maximilian und Ferdinand erzogen worden und lebenslang mit den Habsburgern verbunden geblieben. Vor allem aber war schon er 1561 vom spanischen König Philipp II . in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen worden – er dürfte somit der Erstbesitzer des Exemplars gewesen sein. Diese Vermutung wird auch durch das Arabesken-Medaillon auf den Deckeln gestützt. Eine besondere, an die Tradition der Buchmalerei anknüpfende Noblesse geht zudem von den fein in Gold und Farben illuminierten Initialen aus. Anzunehmen ist, daß die Constitutiones jeweils zusammen mit der Herrschaft Neuhaus – zweimal in weiblicher Linie! – vererbt wurden, gleichsam als ideelles Pendant zum profanen materiellen Besitz.
Diese mutmaßliche Provenienz unterstreicht noch einmal eindrücklich die Bedeutung von Buch und Erstbesitzer. In den beiden Jahrzehnten von 1560 bis 1580 wurden nur fünf Männer in den Orden aufgenommen: die französischen Könige Franz II . und Karl IX ., der Kaisersohn Juan de Austria, Herzog Erich II . zu Braunschweig-Lüneburg und: der böhmische Kanzler Joachim von Neuhaus! Die Constitutiones bezeugen somit seine Ebenbürtigkeit mit den mächtigsten Männern der europäischen Politik in der Mitte des 16. Jahrhunderts, daneben freilich auch den Wandel der Funktionselite vom Ordens-»Ritter« zum Verwaltungsbeamten – der in der bürokratischen Form der gedruckten Statuten seine Entsprechung findet. Von dieser einmal erreichten Position Joachims von Neuhaus her wird klar, daß das persönliche Dokument zu einem familienhistorischen Denkmal werden mußte. Die potentielle Zugehörigkeit zum elitären Kreis der Ordensritter prägte sich dem Selbstbild der nachfolgenden Generationen tief ein: Gelang es nach Joachim auch dem Gatten seiner Enkelin, Wilhelm Slavata, in den Orden aufgenommen zu werden; so heiratete dessen Erbe Johann Georg Joachim mit Gräfin Maria Margaretha Elisabeth Trautson (1642 – 1698) wiederum die Tochter bzw. Enkelin zweier weiterer Ritter des Ordens zum Goldenen Vlies [vgl. Siebmacher 26/ II , S. 378]. Dieses ideelle Erbe sowohl aus der väterlichen wie aus der mütterlichen Linie kulminierte gewissermaßen in Maria Josepha. Damit nicht genug: Auch der Vater ihres Gatten, Humprecht Johann Graf Czernin von Chudenitz (1628 – 1682) hatte seit 1675 die Kollane des Ordens vom Goldenen Vlies getragen. Als vorläufig letztem Familienmitglied wurde diese Ehre 1996 Franz Graf Czernin von und zu Chudenitz (1927 – 2002) zuteil.
Ihrer originären Aura wie auch ihrem Beschreibstoff – kräftigem Pergament – entsprechend, befinden sich alle drei Exemplare in einem fast makellosen Erhaltungszustand; unser Exemplar der französischen Ausgabe von ca. 1560 präsentiert sich noch völlig authentisch in seinem ursprünglichen schlichten Pergamentband und wurde in späterer Zeit nur mit einem knappen Besitzvermerk (»Pastoy«) versehen.
Das jüngste Exemplar von 1626 erlaubt hingegen wieder einen interessanten Einblick in die frühe Besitzgeschichte: »Jean François Desire prince de Nassau [/] Chevalier de l’ordre de la toison d’or [/] gouverneur et Capitaine generale [/] des duchéz de gueldres et Limbourg [/] mourut l’an 1699 le 17 de decembre [/] a Ruremonde« – wohl aus Anlaß seines Ablebens wurde dessen Kurzbiographie auf dem Innendeckel niedergeschrieben. Johann Franz Desideratus zu Nassau-Siegen, geboren 1627, Graf und seit 1652 Fürst zu Nassau, war General-Feldmarschall in habsburgisch-spanischen Diensten und Gouverneur in Luxemburg, Limburg und Geldern gewesen und 1661 in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen worden. Eine andere Hand vermerkte, das Buch »appartient a M[adam]e le Princesse douairière de Nassau«, gehöre also seiner verwitweten dritten Ehefrau Isabelle Claire Eugénie, geborene Baronesse du Puget de la Serre (1651 – 1714) – deren Ebenbürtigkeit von ihrem Stiefsohn gerichtlich angefochten wurde. Interessant ist, daß die Zugehörigkeit zum Orden vom Goldenen Vlies über die Person des Johann Franz Desideratus hinaus auch hier an eine lange familiäre Tradition anknüpfte: Vor ihm waren zuletzt Johann-Ludwig Graf von Nassau-Hadamar (von 1643 bis 1653) und Johann VIII . Graf von Nassau-Siegen (1624 bis 1638) Mitglieder gewesen; als erster des Geschlechts war Engelbert II . von Nassau (1451 – 1504) bereits 1473, also noch in der burgundischen Frühzeit, in die illustre Ritterrunde aufgenommen worden. Von solchen Ehren zehrte das Selbstbewußtsein ganzer Adelsgeschlechter über Jahrhunderte. Das Haus NassauSiegen erlosch 1743.
The young Emperor Philip II had the statutes of the Habsburg Order of the Golden Fleece printed for the first time in 1559: Here we have the Latin first edition, a French edition printed a little later and a French edition printed around 1626. Each was intended only for knights of the Order and printed on precious vellum. In the Latin edition, the original 66 chapters are followed by 16 more, to which chapters 17 to 21 were added by a contemporary hand; these are already integrated into the printed text in the second copy. Two full-page engravings by Cornelius Galle were added to the third copy. In the case of two copies, the provenance allows us to reconstruct the membership of individual knights in the Order for their entire family over generations: The first comes from the Bohemian noble family of Czernin/Slavata/Neuhaus, the third from the count or princely house of Nassau-Siegen.

Eines von vier noch existierenden Exemplaren auf Pergament der monumentalen Lutherbibel 1561 in Einbänden von Brosius Faust, mit 170 großen Holzschnitten, Geschenk von Kurfürst August von Sachsen an Johann Pyrner: das einzige je im Handel aufgetauchte Exemplar
Biblia germanica . Biblia, Das ist: Die gantze heilige Schrifft: Deudsch. Doct. Mart. Luth. 2 Bde. Wittenberg, Hans Lufft, [1558-]1561 [im Kolophon jeweils: 1560].
)(6 A-Z6 a-z 6 Aa-Kk6 Ll8; A-Z6 a-Z6 Aa-Rr 6 Ss 4 = 6 Bl., 344 gezählte Bl. Und: 382 gezählte Bl. – Auf Pergament gedruckt. – Der erste Band mit einem zusätzlichen Widmungsblatt auf Pergament. Band I mit ganzseitiger historisierter Holzschnittrahmung von Lucas Cranach d. J. auf dem Titel (295 x 205 mm) und ganzseitigem Schöpfungsholzschnitt von Hans Brosamer, datiert 1550 (225 x 148 mm), Band II mit Holzschnittrahmung mit Wappen und Weinstöcken (200 x 145 mm), außerdem mit insgesamt 170 Holzschnitten von Georg Lemberger (115 x 135 mm) und Hans Brosamer (105 x 145 mm) sowie zahlreichen historisierten und floral dekorierten Initialen in Holzund Metallschnitt.
Groß-Folio (ca. 381 x ca. 250 mm).
Fürsten- oder Prunkeinbände (ca. 415 x 290 mm) von Brosius Faust, mit dessen Monogramm, datiert 1564, aus blindgeprägtem Schweinsleder über Eichenholz mit abgeschrägten Kanten auf sechs mit fetten Fileten verzierte Bünde, mit dreifachen Filetenrahmen in den Rückenfeldern; auf den Deckeln Rahmenwerk aus Blindfileten und vier verschiedenen Rollenstempeln sowie zwei waagerechte Streifen, darin in Goldprägung vorn die Initialen »D.D.H.M.F. [/] V.E.M.S« (= »Der durchlauchtigste Herzog […]«?), jeweils links und rechts flankiert vom sächsischen Wappen, hinten die Initialen »I. P.« und »1564«; mit mächtigen, durchbrochenen Mittel- und Eckbuckelbeschlägen (diese mit Adler-Motiven) auf blauem Pergamentgrund sowie ziselierten Schließen aus Messing; mit doppelten fliegenden Pergamentvorsätzen und punziertem Ganzgoldschnitt; in zwei weinroten, mit Filz ausgelegten Halbmaroquinkassetten mit goldgeprägten Rückentiteln (Bd. I: Rücken mit wenigen Wurmlöchlein und geringfügigen Läsuren an den Kapitalen, 2 Beschläge ohne Pergamentunterlage, Schließen erneuert).
Staat und Religion im konfessionellen Zeitalter – das Beispiel des Kurfürstentums Sachsen
Wenn je ein Buch seine Zeit auf würdigste Weise repräsentieren kann, dann ist es dieses eindrucksvolle, auf Pergament gedruckte Widmungsexemplar einer monumentalen Lutherbibel von staunenswerter Schönheit und Seltenheit aus dem Umkreis des Kurfürsten von Sachsen. Der mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 erreichte historische Stand und der Geist des konfessionellen Zeitalters, wie sie sich in dem bedeutendsten protestantischen Territorium des Deutschen Reiches ausprägten, werden





hier in einzigartiger Weise gebündelt und zum Ausdruck gebracht. Die Zeichen der epochalen religiösen, politischen und mentalitätsgeschichtlichen Umwälzungen vereinigen sich dabei mit einer wie für die Ewigkeit gemachten Pracht – und tatsächlich sind die beiden Bände fast makellos auf uns gekommen.
Hans Lufft in Wittenberg war Luthers wichtigster Drucker und blieb auch nach dessen Tod seinem Werk treu verbunden. Die Wirkung und Popularität der Lutherbibel versuchte er durch eine überreiche Zahl von Bildern zu steigern, die er bei renommierten Künstlern in Auftrag gab. Der ganzseitige Titelholzschnitt von Lucas Cranach d. J. erschien erstmals in Luffts Bibeldruck von 1541. Die durch einen links verdorrten, rechts grünenden Baum senkrecht geteilte Bildfläche stellt Szenen von Sündenfall und Verdammnis solchen der Erlösung gegenüber – ein starkes dogmatisches Programm, das »vermutlich auf Luther und die anderen Wittenberger Theologen zurückgeht« [Volz 1978, 155]. In eine weltliche Idylle transformiert erscheint das pflanzliche Motiv auf dem zweiten Titelblatt, wo zwei Weinreben reiche Trauben tragen, die ein Äffchen pflückt, während in den Zweigen Knaben spielen. Insgesamt 170 Holzschnitte enthält der laufende Text; überwiegend stammen sie von Georg Lemberger aus Luffts Bibel von 1540 [vgl. Schmidt, Illustration 217f.]; Hans Brosamer fertigte die ganzseitige Schöpfungsdarstellung am Anfang, die 20 Illustrationen zu den Propheten und die 37 zur Apokalypse. Die vorliegende, in gotischen Typen in sieben Größen gedruckte Ausgabe nahm Lufft schon ab 1558 in Angriff, denn es existieren Exemplare mit diesem Datum auf dem Titel, unsere Variante mit dem Jahr 1561 ist hingegen selten; das Kolophon hat jeweils die Jahreszahl 1560.
Damit stellt sich dieser Bibeldruck in die Zeit der politischen und religiösen Konsolidierung nach dem Religionsfrieden von 1555. Im Kurfürstentum Sachsen hatte Herzog August (1526 – 1586) einen der »modernsten Territorialstaaten in Deutschland« [Moeller 179] und ein blühendes, durch seine Bergschätze begünstigtes Land übernommen. Nirgendwo waren die öffentlichen Finanzen derart wohlgeordnet«, Kursachsen besaß »eine Vormachtstellung im Reich« [ebd. 180], hier hatte auch der Protestantismus seinen Mittelpunkt. August setzte den Landes- und Verwaltungsausbau konsequent fort, so in Form weiterer fiskalischer Reformen zur Stärkung der materiellen Basis seiner Macht, die sich in eigenartiger Weise mit der Stabilisierung des religiösen Überbaues verband – genau dieses Phänomen ist in unserem Bibelexemplar mit Händen zu greifen.
Dem ersten Band ist ein zusätzliches Pergamentblatt mit einem Rahmen aus Flüssiggold vorgeschaltet, auf dem zwei große, mit ineinander verschlungenen und goldgehöhten Schnörkeln und Ausläufern geschmückte D-Initialen den Blick zunächst auf den Schenker lenken: »Der Durchlauchtigste hochgeborene furst und herr / Herr Augustus Hertzogk Zu Sachsen« wird – ganz amtlich – mit seinen wichtigsten Titeln genannt. Dann erfährt man in der in einer stilisierten gotischen Textura geschriebenen Widmung, er habe »etliche Exemplar« auf Pergament drucken lassen, und mit dem vorliegenden am 6. August 1564 seinen Rentschreiber Johann Pyrner »begnadet«. Darüber hinaus habe seine Kurfürstliche Gnaden ihn »durch derselben Renthmeister Bartel Lauterbachen gnedigst erinnern vnnd vermahnen laßen / darinnen vleißigst Zuelesen Vnnd seinen dinst treulich Zuuerrichten«. Der Landesherr ließ also einem seiner hohen Finanzbeamten über dessen Vorgesetzten – unter Einhaltung des Dienstwegs – eine Bibel zukommen, deren fleißige Lektüre wiederum der treulichen »dinst«-Verrichtung zugutekommen sollte. Ist eine direktere Verknüpfung von Staat und Staats-Religion denkbar?

Kaiser Maximilian I. hatte als ›letzter Ritter‹ seine Anhänger noch mit Exemplaren seines Theuerdank belohnt. Die Reformation bewirkte auch in dieser Dedikationspraxis einen Wandel: Schon von Luffts Bibeldruck von 1541 ist bekannt, daß »evangelische Fürsten sich diese Medianausgabe erwählten, um sich besonders kostbare […] Pergamentexemplare herstellen zu lassen«, für die eigens »vom jüngeren Cranach Wappentitelblätter« [Volz 1978, 155] mit Herrscherwappen entworfen worden waren. Bei dieser Ausgabe war es ähnlich, nur mag man sich verblüfft-enttäuscht fragen: Wie konnte es sein, daß der Erzmarschall des Heiligen Römischen Reiches eine solche kostbare Pergamentbibel keinem adligen Getreuen, sondern einem subalternen Rentschreiber vermachte?
– Genau darin kommen die speziellen Charakteristika des modernen Verwaltungsstaats im konfessionellen Zeitalter zum Vorschein: Die Gabe hat nicht mehr nur repräsentativen und symbolischen Wert, sondern dient als Mittel der gegenseitigen Durchdringung von Staat und Religion, bei der den Staatsdienern eine Schlüsselfunktion zukommt. War schon der Rentschreiber Johann Pyrner ein nicht unwichtiges Rad im Getriebe der Finanzverwaltung, so war sein Vorgesetzter, der Hofrat und Landrentmeister Bartholomäus von Lauterbach (1515 – 1578), ein Protagonist der sächsischen Fiskalreformen. Von dessen Amtskollegen Hans Harrer stammt mit der ähnlich monumentalen Bibel von 1572 ein interessantes Parallelstück in unserer Sammlung. Ihm als Rentkammermeister war es zu verdanken, daß Kursachsen einen enormen Staatsschatz anhäufte.
Wie der Staat insgesamt auf die Religion baut, so wird persönliche Religiosität eng mit dem Dienst am fürstlichen Kirchenherrn assoziiert. Indem die eingeforderte Frömmigkeit des Johann Pyrner keine Privatangelegenheit mehr ist, entfernt sie sich allerdings von der ursprünglichen reformatorischen Lehre, nach der es allein der Glaube sein sollte, der »das Heil empfängt«, und mit dem das Christsein »im eigentlichen Sinn als ein individueller Sachverhalt definiert« wird« [Moeller 183]. Hier wird also auch »die Gefahr eines leblosen und lebensfremden Doktrinarismus« spürbar, in dem sich das »Zeitalter der Epigonen« [ebd. 182] ankündigt. Doch schien es angesichts der neuen Herausforderungen durch die erstarkende Gegenreformation und den Calvinismus unabdingbar, sich »nicht mehr gegenüber dem konfessionellen Gegner, sondern gegenüber den Vertretern der eigenen Konfession« [Lexutt 124] zu profilieren, um das Erreichte abzusichern.
Wie ernst die Religion dabei genommen wurde, zeigt die Einbeziehung eines weiteren prominenten sächsischen Amtsträgers: Auf dem zweiten Vorsatzblatt befindet sich eine wahrscheinlich autographe Predigt von dem in Leipzig lehrenden Theologen und Generalsuperintendenten Nicolaus Selneccer (1530 – 1592), datiert Dresden, den 5. August 1569. Der behandelte Psalm 119 beginnt, im Wortlaut unserer Bibel: »Wol denen die on wandel leben / Die im gesetze des HERN wandeln«. Das Thema von Gesetz und Gehorsam wird im Psalm unermüdlich variiert; die Parallelen zum frühneuzeitlichen Obrigkeitsstaat sind evident. Selneccer schreibt indes explizit über einen anderen Vers: »Stercke mich HERRE das ich genese, so wil ich stetige Lust haben zu deinen zeugnissen (zu deinem wort)«. Indem er die »Zeugnisse« nicht etwa mit »Weisungen«, sondern mit dem »Ewigen WORT, welches ist unser lieber herr und heiland Jesus Christus«, gleichsetzt, macht er den geistlichen Sinn wieder sichtbar: »das wir nemblich Lust sollen haben zum wort Gottes« – durchaus eine Ermunterung zu einer individuell-andächtigen Lektüre der Bibel, die eben nicht in der Funktion eines anderen ›Gesetzbuchs‹ aufgeht. Die Prachtbibel, die darin niedergeschriebene Predigt und ihr

Inhalt weisen zugleich auf ein Grundprinzip, das die protestantische Konfession mit dem modernen Verwaltungshandeln teilt: sola scriptura.
Zu dem Netzwerk der an unserem Exemplar beteiligten Hofbediensteten gehört schließlich der Dresdener Hof- und Meisterbuchbinder Brosius Faust. Er arbeitete u. a. für die Rentkammer [vgl. Schunke 1943, 64], und so überrascht nicht, daß er mit diesem Auftrag betraut wurde. Die imponierenden Schweinslederbände mit den mächtigen Messingbeschlägen sind 1564 datiert, stammen also aus dem Jahr der Widmung an Johann Pyrner. Auf den Deckeln verwendete er fünf verschiedene Rollenstempel: Von diesen ist in der Einbanddatenbank allein der Palmettenfries [w003995] bekannt, der den äußeren Rahmen bildet und den er des öfteren benutzte. Ihm bislang nicht zugeordnet sind eine breite Rolle mit Szenen aus dem Leben Jesu und eine schmalere mit religiösen Darstellungen; von zwei weiteren mit Renaissanceornamenten und Porträtmedaillons trägt die eine sein Monogramm »B. F.«, die andere wurde von Ilse Schunke abgebildet [Schunke 1943, S. 63]. Insgesamt ähnelt sein »Wittenberger Stil« mehreren Einbänden Jakob Krauses [vgl. ebd., Tafel 15, und Schmidt, Jakob Krause, Tafel 1-6], der 1566 als Hofbuchbinder nach Dresden kam und mit Faust einige Werkzeuge gemeinsam nutzte. Auch wenn der Kurfürst »etliche Exemplar« auf Pergament hatte drucken lassen – mit einem Kostenaufwand, den sich wohl kaum ein anderer Reichsfürst hätte leisten können – so kannte Van Praet doch nur fünf, alle mit dem Druckjahr 1558 und offenbar von Herzog August gestiftet, die sich ausnahmslos in deutschen Bibliotheken befanden. 1824 immerhin vier Exemplare (die aber nicht mehr sämtlich existieren – nach neuesten Angaben der SBB -PK gibt es nur noch drei Exemplare weltweit, darunter dasjenige der British Library); das unsrige ist überhaupt das einzige, das jemals im Handel war. Die Seltenheit unseres Widmungsexemplars trifft sich mit seiner Schönheit und Makellosigkeit: In seinen gewaltigen originalen Einbänden ist es vollständig und wie unberührt erhalten.
Provenienz: Johann Pyrner, kurfürstlich-sächsischer Rentschreiber, 1564. – "German Collector", sale Christie's London, 23.6.1993, Nr. 49: £ 243.500 (Sfr. 562.500) – H. P. Kraus, Katalog 200, New York 1994, Nr. 159: $ 625.000 (= ca. CHF 820.000).
Literatur: Adams B 1178 (Druckjahr 1558); BM STC German 90 (Druckjahr 1558); nicht bei Darlow/Moule; Delaveau/Hillard, Nr. 130 (Druckjahr 1558); Mejer 85; vgl. Panzer, Entwurf, S. 440ff., Nr. 17 und 18 (jedoch beide mit Abweichungen); Schmidt, Illustration, S. 223ff.; Strohm E 427 (mit Abweichungen); Van Praet, Bibliothèques I, S. 34f., Nr. 55, und IV, S. 6f.; VD 16 B 2744 (Druckjahr 1558); Volz 1954, S. 157, 24b. – Zu Faust: Haebler I, 110-113; Schunke, 1943, 60ff. The monumental two-volume Luther Bible, printed on vellum by Hans Lufft in Wittenberg (1558-)1561, illustrated with a woodcut title after Lucas Cranach the Younger and very numerous woodcuts after Georg Lemberger and Hans Brosamer, is, according to the handwritten dedication page, a gift given by Elector August of Saxony to his »Rentschreiber« Johann Pyrner in 1564. On the second flyleaf is an autograph sermon by the Leipzig General Superintendent Nikolaus Selneccer, and the two imposing and completely unimpaired bindings, dated 1564, were made by the Dresden court bookbinder Brosius Faust. Of the probably six known parchment copies, only three are known today besides this one, which is also the only one that has ever been on the market in the past 460 years.

Das Neue Testament (1571) aus Plantins großer Polyglotten-Bibel, aus den Sammlungen von König Philipp II. von Spanien, A. Chardin, Earl of Ashburnham und Fairfax Murray –das einzige bekannte Exemplar auf Pergament in Privathand
. Novum Iesu Christi D. N. Testamentum. Sacrorum bibliorum tomus quintus. 2 Teile in 2 Bdn. Antwerpen, Christophe Plantin, 1571.
Biblia polyglotta .
†7 A -Z6 Aa-Ss 6 Tt5 und a-z 6 aa-zz 6 aaa 8 = 7 Bl. (inkl. Frontispiz), 499 [recte: 501] S., 1 leeres Bl. Und: 566 S., 1 Bl. – Teil 1: letztes Bl. doppelt gezählt; evtl. wurde ein leeres Bl. [Tt6] entfernt.
Mit gestochenem Frontispiz, Holzschnitt-Druckermarke am Ende sowie zahlreichen figürlichen Initialen und einigen Zierleisten in Holzschnitt.
Groß-Folio (ca. 410/420 x 290 mm).
Nachtblaue englische Maroquinbände um 1825 über Holzdeckeln auf sechs Doppelbünde, mit goldgeprägtem Rückentitel, dreifachen Goldfileten auf den Stehkanten und breiter Innenkantenvergoldung aus Filetenbündeln mit Eckornamenten, mit Pergamentdoublüren und doppelten fliegenden Pergamentvorsätzen sowie Ganzgoldschnitt, von Charles Hering (Einbände minimal fleckig, Rücken und Gelenke berieben, Ecken mit minimalen Stauchspuren).
Das bedeutendste Druckwerk der Niederlande – das einzige Pergamentexemplar in Privathand
Die monumentale fünfsprachige Bibel, die Christophe Plantin (1520 – 1589) in Antwerpen unter der Schirmherrschaft des spanischen Königs Philipp II . druckte, ist das »wichtigste Werk, das je von einem Drucker in den Niederlanden herausgegeben wurde« [Voet, Museum 10]. Erstaunlich ist diese editorische Großtat erst recht vor dem Hintergrund der schwierigen Zeitumstände. Die Gärungen des konfessionellen Zeitalters hatte der aus Frankreich in die spanischen Niederlande ausgewanderte Plantin am eigenen Leib zu spüren bekommen. Im Jahr 1562 war er angeklagt worden, eine ketzerische Schrift gedruckt zu haben und floh für ein Jahr nach Paris, während Gläubiger – evtl. um eine Beschlagnahmung zu verhindern – seine Habe verkaufen ließen. 1563 nahm er seine Drucktätigkeit wieder auf, mußte sich jedoch erneut in Brüssel für ein von der Zensur beanstandetes Buch rechtfertigen [vgl. Clair 25f.]. Obwohl er selbst bei jeder Gelegenheit seine katholische Rechtgläubigkeit beteuerte, pflegte er »relations with the heterodox sects« [ebd. 31] und war »friend of many of the most prominent Calvinists« [ebd. 32]. Er beharrte auf dem Recht des Einzelnen, »to be free to form his own convictions and to proclaim them« [ebd. 35]. Als Unternehmer faßte er hingegen den Plan zu einem großen Befreiungsschlag: Die berühmte, 50 Jahre zuvor in Alcalá de Henares gedruckte

polyglotte Bibel, die bereits selten war, weil zahlreiche Exemplare bei einer Schiffshavarie zugrundegegangen waren, wollte er in erweiterter Form neu herausbringen.
Als in Antwerpen immer mehr flämische Übersetzungen der Luther-Bibel erschienen, reagierte die kirchliche Zensur zunehmend repressiv; zuletzt waren die Drucker sehr vorsichtig geworden [vgl. Clair 60]. Im Zuge der Gegenreformation wuchs in der katholischen Kirche allerdings auch die Einsicht, daß man das Feld der »Schrift« nicht länger den Protestanten überlassen konnte. Hier setzte Plantin an: »To print a Bible in its original languages, the text of which should be as correct as erudition could make it, explained and commented by the greatest theological minds, and printed with loving care upon the finest of paper – what more meritorious task could a printer undertake, and what task more likely […] to make his name remembered?« Plantin versprach sich von einem solchen Unternehmen neben Reichtum und Ruhm auch Ruhe: Mit dem König von Spanien wollte er den denkbar mächtigsten Patron für sich gewinnen, »who then could impugn his orthodoxy? Here ambition and self-protection joined hands« [ebd. 59].
Dank seiner Kontakte zu Kardinal Antoine Perrenot de Granvelle und zum königlichen Sekretär Gabriel de Çayas gelang es ihm, bei König Philipp II . für das monumentale Projekt einer polyglotten Biblia Real Gehör zu finden. Dieser stellte ihm seinen gelehrten Hofkaplan Benito Arias Montano (1527 – 1598) an die Seite. Ihm oblag, assistiert von Plantins Korrektoren und Theologen der Universität Löwen, die inhaltliche Gesamtverantwortung, und auf seinem Feld war er nicht weniger ehrgeizig als Plantin: »He decided which spellings should be retained; he personally translated a series of Aramaic texts into Latin and wrote most of the treatises that made the apparatus so valuable« [Voet Compasses I, 63]. Dieser Apparat umfaßte detaillierte Abhandlungen über Sitten und Gebräuche der Juden, Grammatiken, Wörterbücher und »revised versions of particular texts with emendations and interlinear glosses« [ebd. 60]. War schon die griechische Übersetzung wissenschaftlich bedeutsam, so stellten die altsyrische und aramäische (»chaldäische«) »an invaluable source of new data« [ebd. 61, vgl. Clair 72f.] dar. Die griechischen und syrischen Typen waren eigens von Robert Granjon in Lyon geschnitten worden [vgl. Clair 65]. Im August 1568 begann der Druck, im Mai 1572 lag das Riesenwerk vor: die Biblia polyglotta in fünf, der Apparatus in drei Bänden, alles in allem das umfangreichste und komplizierteste Druckunternehmen des 16. Jahrhunderts. Es erschien in fünf Ausgaben: 960 Exemplare wurden auf Royal-Papier aus Troyes gedruckt, 200 auf Royal-Papier aus Lyon, 30 auf Imperial-Papier aus Deutschland, 10 auf Imperial-Papier aus Italien, vermutlich Fabriano, und 13 Exemplare auf Pergament, die vom spanischen Hof bestellt worden waren [vgl. Clair 75]. Im Vatikan war man so schockiert über diese ohne eigenes Zutun erbrachte Leistung, daß Papst Pius V. zunächst die päpstliche Approbation verweigerte; erst sein Nachfolger Gregor XIII . erteilte sie gnädig im September 1572 [vgl. ebd. 77f.].
Großzügig hatte der spanische Hof die ursprüngliche Zahl von sechs bestellten Pergamentdrucken auf 13 erhöht, wofür der Drucker sage und schreibe 16.263 zusätzliche Kalbshäute beschaffen mußte. Die Kosten dafür hatte er wiederum zum großen Teil selbst zu tragen, da ihm der königliche Faktor in Antwerpen weniger als die Hälfte der dafür benötigten Summe zur Verfügung stellte [vgl. Clair 75]. Die Pergamentexemplare waren nie für den Handel vorgesehen und somit selbst unmittelbar



nach Erscheinen im Wortsinne unerreichbar. Herzog Albrecht V. von Bayern versuchte bei Plantin persönlich ein Exemplar zu bestellen, mußte sich aber ebenso mit einem der Vorzugsexemplare auf Papier begnügen wie Wilhelm von Oranien. Auch die drei Exemplare, die Plantins Patron Kardinal Granvelle in Paris für sich binden ließ, entstammten der Papierausgabe [vgl. Clair 86]. Ganz offensichtlich wurden auch nicht alle 13 vorgesehenen Pergamentexemplare hergestellt, denn wir haben nur Kenntnis von 11 Stücken; und auch diese wurden nicht vollständig gedruckt, denn zwei Exemplare der drei Kommentarbände scheinen nur auf Papier zu existieren [vgl. Van Praet, S. 5].
Nachdem das Pergamentexemplar der Universitätsbibliothek Löwen in den Revolutionswirren von 1797 unterging [vgl. Clair 85], sind heute nur noch vier in öffentlichen Sammlungen lokalisierbar: Das Widmungsexemplar für Papst Pius V. im Vatikan, ein Geschenkexemplar für Emmanuel von Savoyen in der Biblioteca Nazionale von Turin, eines für den niederländischen Gouverneur Philipp von Alba im Britischen Museum und eines im Escorial, als eines von sechs, die Plantin an Philipp II . sandte. Dort verblieben sie, bis 1789 eines an den »couvent de Saint Étienne de Salamanque« [Van Praet, S. 5] kam, zwei an den »Prince of the Asturias, one to the Infante Gabriel and one to the Infante Luis« [Clair 85]. Deren Verbleib ist unbekannt, doch eines von ihnen dürfte mit dem unsrigen identisch sein. Es war von jeher unvollständig; nach Van Praets Beschreibung »manquoit le premier volume, et dont les tomes 7 et 8 ètoient aussi en papier« [Van Praet, S. 5], bei Fairfax Murray waren die Bände 2 bis 6 vorhanden. Da das Alte Testament und der Apparat somit nur Torsi waren, erscheint die Separierung des in zwei Bände gebundenen Neuen Testaments als dem einzigen in sich kompletten Part plausibel. Die zeitgenössische handschriftliche Numerierung (der Druckerwerkstatt?) »n°. 5.80 v°.7« bzw. »8« auf beiden Titeln belegt, daß die Bände ursprünglich Teil des gesamten Sets waren. Unser Neues Testament, dem als Frontispiz die Taufe Jesu nach Wierix vorangestellt ist, ist somit das einzige bekannte in Privathand.
Thomas Frognall Dibdin beschrieb 1817 das damals im Besitz von Jean Godefroy Würtz befindliche Exemplar als »white, clean, ample: not to be surpassed«, um dann andächtig zu verstummen: »Language can scarcely do justice to its extraordinary beauty and perfection of condition«. Dieses unser breitrandiges Exemplar ist mit seiner Höhe von 420 mm ebenso hoch wie das bei van Praet zitierte in Turin. Vermutlich erhielt es »its presently binding about 1825-30, before Lord Ashburnham purchased it« [Davies]. Noch heute präsentiert sich dieses Denkmal der Kirchen- und Buchgeschichte in der bestmöglichen Erhaltung.
Provenienz: Sammlung A. Chardin, Auktion Paris 1811, Teil III , Nr. 2. – Johann Gottfried Würtz, der Teilhaber von Treuttel & Würtz, deren Auktion am 12.6.1817, Nr. 150: £ 225 [vgl. Van Praet, S. 5]. – Bertram 4th Earl of Ashburnham (1797 – 1878), dann dessen Sohn, dessen Auktion am 25.6.1897, Nr. 429: £ 79.0.0. – Charles Fairfax Murray, Auktion am 10.12.1917, Nr. 48: £ 140, an Harvey.
Literatur: Nicht bei Adams; Bibliotheca Sussexiana I/2, S. 28ff., Nr. 2; BM STC Dutch 22; Brunet I, 851; Clair 57-86; Cockx-Indestege u. a., Nr. 436; Darlow/Moule 1422; Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 61 (dieses Exemplar!); Dibdin, Decameron II , 154; Dibdin, Introduction I, 12ff.; Ebert 2103; Funck 277; Graesse I, 362; Lonchamp, Français II , 52; Rahir 320; Van Praet, Bibliothèque du Roi I, Nr. 1; Voet, Compasses I, 56f. und 60-65; Voet, The Plantin Press, Nr. 644, V.
The monumental polyglot (= five-language) Bible printed by Christophe Plantin in Antwerp under the patronage of the Spanish King Philip II is the most important printed work ever produced in the Netherlands. The Greek and Syriac types had been specially cut by Robert Granjon in Lyon. Instead of the 13 ordered by the Spanish court, probably only eleven copies, and even these not complete, were printed on vellum. Today, only four can be located in public collections, and our New Testament in two volumes, which was later in the collections of Ch. Chardin, Earl of Ashburnham and Fairfax Murray - the only one known to be in private hands, in bindings by Charles Hering and in the best possible condition - probably came from an incomplete copy formerly in the Escorial.


Graduale Ordinis Cartusiensis . Paris, Guillaume Chaudière, 1578.
á 8 A-Z6 AA - HH 6 II 8 = 8 Bl., 193 gezählte Bl., 1 leeres Bl. – Durchgehend in Schwarz und Rot gedruckt. – Gedruckt auf Pergament.
Mit halbseitiger Titelillustration in ganzseitigem Rahmen, zahlreichen grotesken Initialen in vier Größen in Holzschnitt, durchgehend mit schwarzgedruckten Noten auf rotem vierlinigen System.
Folio (ca. 272 x ca. 197 mm).
Blindgeprägter Schweinslederband der Zeit über abgeschrägten Holzdeckeln auf sechs breite, mit Streicheisenlinien verzierte Bünde, mit handschriftlichem Rückentitel am Kopf; die Deckel mit Rahmenwerk aus Streicheisenlinien und diversen Rollenstempeln; mit ziselierten Eckbuckelbeschlägen, zwei intakten Schließen aus Messing und Ganzrotschnitt (vorderes Außengelenk mit restauriertem Einriß, am Fuß Rest von Rückenschild des 17./18. Jahrhunderts).
Ein wunderbar erhaltenes Pergamentexemplar
Dieses im ersten Einband wunderbar erhaltene Graduale, eines von nur drei bekannten Exemplaren auf Pergament, stammt aus einem der wohlhabendsten und schönsten Kartäuserklöster Frankreichs, Notre-Dame de bonne ésperance in Aubevoye bei Gaillon in der südlichen Normandie. Der Erzbischof von Rouen, Kardinal Charles de Bourbon (1523 – 1590), hatte es 1571 unweit seiner Residenz in Gaillon, einem der prachtvollsten Residenzschlösser Frankreichs, gleichsam als dessen geistliches Gegenstück gegründet. Als Prinz von Geblüt war er von frühester Kindheit an für die kirchliche Laufbahn vorgesehen und hatte bereits 1540 seinen ersten von sechs Bischofstiteln erworben, doch blieb er als Berater Karls IX . und Heinrichs III . stets in engster Tuchfühlung mit der königlichen Macht. So stand die Gründung der Kartause einerseits im Zeichen der Gegenreformation, andererseits im Schatten der Hugenottenkriege, die 1572 in der Bartholomäusnacht gipfelten.
Das Graduale, das Charles de Bourbon zur liturgischen Erstausstattung seiner Gründung herausgab, zelebriert hingegen eine völlig unangefochtene Repräsentativität. Der rotgedruckte Titel wird umrahmt von einer Renaissancebordüre mit Rollwerk und grotesken Figuren, die sich in der unteren Blatthälfte in einem zweiten Holzstock fortsetzt. Die halbseitige Illustration veranschaulicht die Stiftung der Kartause: Charles de Bourbon hat hinter sich den knieenden Konvent versammelt und präsentiert das Kirchengebäude mit beiden Händen der Maria und dem Jesusknaben, die oben rechts aus einer Wolke zur Erde herabschauen. Auf einem im Freien
aufgestellten Altartisch in der rechten Bildhälfte, an dem sein Wappen angebracht ist, liegt ein aufgeschlagenes Buch – wohl genau unser Graduale, aus dem die Brüder gleich ihre Choräle singen werden. Tatsächlich ist diese Selbstreferenz mit guten Gründen auf unser Exemplar projizierbar, denn es scheint sich um ein ›Masterexemplar‹ für den liturgischen Gebrauch zu handeln. Es ist auf kräftigem, noch heute frischem Pergament gedruckt – und nur zwei weitere Pergamentexemplare sind überhaupt bekannt. Das eine lokalisierte Van Praet in der königlichen Bibliothek, wohin es 1826 gelangt war, das andere befand sich in der berühmten Sammlung Bourbon-Parma und liegt heute in Harvard.
Zu dieser ungeheuren Seltenheit gesellt sich ein unikales Merkmal, das uns gleich auf dem Titel entgegentritt: Eine zeitgenössische Hand, vermutlich der Drucker selbst, ergänzte kalligraphisch in Rot: »Correctu[m] i[n] Card ad cui[us] forma[m] cet[era] corriga[n]tur«. Entsprechend wurden die Rubrik Errata [Bl. à8] ergänzt um einen handschriftlichen Verweis auf Blatt 108 und eine Notenzeile in Rot und Schwarz. Darüber hinaus finden sich im Text einige weitere winzige Korrekturen und Anmerkungen [Bl. 22r, 23v, 151r und 185v]. Schließlich beeindruckt der originale Schweinslederband mit reicher Blindprägung auf den mächtigen Holzdeckeln und intakten Schließen – das Harvard-Exemplar hat einen Einband des 19. Jahrhunderts.
Im Zuge der französischen Revolution wurde die Kartause von Gaillon 1790 aufgehoben und an einen Privatmann verkauft – unser Graduale tauchte für lange Zeit unter, bis es die amerikanische Sammlerin Carrie Estelle Doheny (1875 – 1958) um die Mitte des 20. Jahrhunderts bei dem Londoner Antiquar Hellmut Albert Feisenberger erwarb, um es an das von ihr mit umfangreichen Beständen ausgestattete katholische Seminar St. Mary’s of the Barrens in Perryville, Missouri, weiterzugeben. Nach Einstellung des Studienbetriebs wurden die Bücherschätze 2001 versteigert.
Provenienz: Auf der letzten, leeren Seite ein Epigramm des 17./18. Jahrhunderts. – Auf dem Spiegel das goldgeprägte Maroquin-Exlibris von Carrie Estelle Doheny. – Auktion Christie’s, New York, 14.12.2001, Nr. 208: $ 14.100 (= Sfr. 24.000).
Literatur: Nicht bei Adams; Alès 305; BM STC French 270; Bohatta, Nr. 552 (Pergament); Brun 200; nicht bei Brunet; Mortimer, French, Nr. 253 (Pergament); Van Praet, Bibliothèque du Roi VI , S. 35, Nr. 334bis.
This beautifully preserved gradual from 1578 comes from one of the most prosperous and beautiful Carthusian monasteries in France, Notre-Dame de bonne ésperance in Aubevoye, which the Archbishop of Rouen, Cardinal Charles de Bourbon, had founded in 1571 as a spiritual counterpart to his residential castle in nearby Gaillon. The half-page title illustration illustrates the foundation of the Charterhouse by the archbishop, with the Gradual apparently already open on the altar: As one of only three known copies on vellum, this one probably belonged to the monastery’s first festive liturgical equipment, as indicated by a few corrections by a contemporary hand. Provenance: C. E. Doheny.


Vergilius Maro, Publius . Publij Virgilij maro[n]is opera. [Auf der Titelrückseite:] Publij Virgilij Maronis opera cum quinq[ue] vulgatis commentariis: expolitissimisq[ue] figuris atq[ue] imaginibus nuper per Sebastianum Brant superadditis: exactissimeq[ue] reuisis: atq[ue] elimatis. Straßburg, Johannes Grüninger, 1502.
Bl., 4[10] [recte: 409] gezählte Bl., 34 gezählte Bl. – Einige Fehler in der Blattzählung (insbesondere nach Bl. 189), doppelt gezählt werden etwa Bl. 52 und 305, übersprungen 246, 250 und 316. – Grundtext von zweispaltigem Kommentar in kleinerer Type umgeben, der Annex zweispaltig, gedruckt in Antiqua. – Titel in Schwarz und Rot gedruckt.
Mit insgesamt 214 großen, teils ganzseitigen Holzschnitt-Illustrationen (210 etwa textspiegelbreit), Druckermarke auf dem letzten Blatt sowie zahlreichen Schmuckinitialen.
Folio (ca. 298 x 206 mm).
Hellbrauner Kalblederband um 1550, vom königlichen Buchbinder Gomar Estienne, auf dem glatten Rücken ein Semis aus zu Dreibergen gruppierten Goldpunkten, darin eingelegt eine zentrale Kartusche aus olivem Maroquin mit floraler Ornamentik auf Goldpunktgrund, an Kopf und Fuß dieselbe, jeweils halbierte Kartusche; auf den Deckeln zwei doppelte Goldfiletenrahmen, dazwischen acht Fleurons, um ein Semis wie auf dem Rücken, mit großen geschwungenen, aus rotem Maroquin mosaizierten Eckstücken mit schwarzer Wachsfarbenmalerei bedeckten und von Goldlinien eingefaßten stilisierten Blatt- und Blüten-Ranken, um das zentrale ovale Wappenmedaillon mit rot eingelegtem Kreuz und vier goldgeprägten Lilien dunkelbraunes Bandwerk und eine große schwarze Kartusche, gleichfalls mit stilisierten Ranken; mit floral-ornamental punziertem Ganzgoldschnitt; in moderner schwarzer Lederkassette mit goldgeprägtem Rücken (Vorsätze leimschattig und fleckig, zwei Blätter der ersten Lage – aus einem anderen Exemplar? – neu einmontiert, Bl. 104 mit repariertem Einriß, Bl. 220 mit Fehlstelle im weißen Rand, wenige Bl. mit kleineren Randläsuren, einige alte Unterstreichungen und kurze Marginalien, gelegentlich etwas fleckig, wenige Bl. mit Feuchtrand). Insgesamt ist der Einband in herrlich unbeeinträchtigtem Zustand.
In einem grandiosen Mosaikeinband von Gomar Estienne, Buchbinder

Vergil (70 – 19 v. Chr.) galt im Mittelalter und in der Renaissance als der größte Dichter schlechthin. Sein Werk wurde von Kommentaren und allegorischen Auslegungen begleitet, die fester Teil der Überlieferung wurden: Seit der Vergilausgabe von 1491 des Humanisten Antonio Mancinelli wurden dessen Erläuterungen regelmäßig zusammen mit denen des Servius (geb. 370 n. Chr.) und dessen Zeitgenossen Tiberius Claudius Donatus sowie der Humanisten Cristoforo Landino und Domizio Calderini gedruckt. Dies ist auch in der vorliegenden Ausgabe von Sebastian Brant der Fall, wo der Vergiltext zweispaltig vom Kommentar umrahmt ist. Die Autorschaft wird jeweils »durch vorangestellte Namenskürzel gekennzeichnet«

[Taegert 26]. Brant fügte den drei Hauptwerken Vergils, Bucolica, Georgica und Aeneis, einige kleinere ihm zugeschriebene Dichtungen hinzu, außerdem ein einleitendes und ein Schlußgedicht an den Leser. Vor allem aber ist dieser Straßburger Druck Johannes Grüningers von 1502 die erste illustrierte Werkausgabe Vergils. Die 214 Holzschnitte aus Grüningers eigenem Atelier beeinflußten die VergilIllustration durch Neudrucke, Nachstiche und als ikonographisches Vorbild »bis ins 17. Jh. nachhaltig« [ebd. 17]. Dabei sind sie ganz ›unklassisch‹, spiegeln vielmehr in detailfreudigem Realismus die elsässische Lebenswelt um 1500 wider: »Die Römer sind bekleidet wie Straßburger Bürger und Elsässer Bauern; die Costüme, die Waffen, die Arbeitsgeräthe sind diejenigen vom Ende des 15. Jahrhunderts«; in der Aeneis sieht man Ritter und Landsknechte, in Schlachten wird bereits mit Kanonen geschossen [Bl. 243]; ein Karren ist mit dem Straßburger Wappen geschmückt [Bl. 219v]; einmal wird die Fahne mit dem Bundschuh hochgehalten [Bl. 231]. Eine Nymphe sitzt »in elsässischer Tracht, langem Schleppkleid, einer Haube auf dem Kopf« kranzflechtend in einer Landschaft; die »Göttinnen haben kein anderes Kleidungsstück als eine jener grotesken Coiffuren, die bei den eleganten Damen der Renaissance Mode waren« [Muther].
Staunt man darüber, »daß der ganze Virgil in der naivsten Weise in die Tracht und Sitte des Jahres 1500 übersetzt ist«, so sollte man nicht verkennen, »welche Masse von Kenntnissen und Gelehrsamkeit in den einzelnen Blättern niedergelegt ist« [ebd.]. Der Herausgeber Sebastian Brant persönlich leitete die Künstler des Grüningerschen Ateliers bei der Konzeption der Bilder an – ähnlich wie später bei seiner Ausgabe von Petrarcas Von der Artzney










bayder Glück . Wer allerdings »nie ein griechisches Kunstwerk gesehen hat, kann naturgemäß von der Majestät, Größe und Grazie ihrer Götterwelt keine Ahnung haben« [ebd.]. Auch stilistisch tragen die Zeichnungen noch mittelalterliche Züge. Die lieblichen Landschaften sind »von einem erhöhten Standpunkt aus gesehen und erstrecken sich oft bis an den oberen Bildrand, so daß die Bildflächen dicht gefüllt« [Fünf Jahrhunderte] werden können: Oft sind verschiedene Szenen nebeneinander ins Bild gesetzt, wohingegen jeder Versuch einer perspektivischen Darstellung unterbleibt. Die ältere Forschung sah darin etwas Rückständiges: »Ein Nichtgelehrter hätte sie einfach für ländliche Scenen aus Elsaß oder für Schlachten und Belagerungen seiner Zeit wahrgenommen; die Bedeutung der mythologischen und allegorischen Darstellungen aber hätte er trotz der beigeschriebenen Namen der Götter und Helden nicht erraten«, meinte Muther; für Kristeller bildeten sie einen »recht wunderlichen Kontrast zu dem Inhalte des Buches« [Kristeller, Kupferstich 45]. Doch stand die Bebilderung ja eben nicht für sich, sondern eröffnete neben dem lateinischen Text »eine zweite, ›optische‹ Dimension«, die »einem ungelehrten oder im Lesen ungeübten Publikum eine Verständnishilfe« [Taegert 26] und »visual aids to memory« [Goldschmidt 1950, 48] liefern wollte. Außerdem boten die Illustrationen »a lively imagination, and the Strasbourg edition is one of the most lavishly illustrated of classical texts« [Mortimer]. Technisch sind sie mit ihren feinen und dicht gestrichelten Schraffuren, die »den Formen Rundung verleihen, feine Abstufungen vom Licht zum Schatten erlauben und den Eindruck malerischer Differenziertheit erwecken«, wohl bereits »von der Technik des Kupferstichs angeregt« [Fünf Jahrhunderte].
Die große Wertschätzung des Buches spiegelt sich in dem überreich dekorierten Mosaikeinband, der aus der Zeit um 1550 stammt, wahrscheinlich ist er um 1547 in Auftrag gegeben worden, als Graf Jacques de Saint-Mesmin Präsident am Chambre de Comptes de Bretagne wurde. Er ist in klassischer Center-and-Cornerpiece-Manier auf gepunktetem Grund in verschiedenen Brauntönen, Schwarz und Rot und mit üppiger Goldprägung gestaltet und erinnert an Einbände der »Dotted Group« oder »Group IV« [Hobson, Maioli 40] in der Sammlung des Thomas Maiolus, mit denen er die »finely designed central cartouches« [ebd.] und den glatten Rücken teilt. Nicht nur vergleichbar, sondern zumindest in der Mosaizierung der Rücken-Kartuschen identisch ist der um 1556 für König Henri II . angefertigte Einband zu Joh. Schöner, Opera Mathematica, von 1551, der auch in der Deckelgestaltung und der Rundum-Punzierung des Goldschnitts starke Ähnlichkeit aufweist, siehe »Reliures Royales de la Renaissance«, B. N. 1999, Nr. 104, mit drei Farbabbildungen; dazu vgl. den Macchiavelli von 1546, Nr. 93 ebenda, für die Deckelgestaltung. Das Faktum eines so erlauchten Einbands mit allerhöchster Vergleichsprovenienz auf einem der schönsten illustrierten Bücher der Zeit, der ersten illustrierten Vergil-Ausgabe überhaupt, macht aus dem Exemplar eine Zimelie von unschätzbarem Wert. Auf dem Hinterdeckel findet sich der Namensstempel von Sir Andrew Fountaine (1676 – 1753), der ab 1701 auf seiner mehrjährigen Grand Tour durch Europa begann, Bücher, Kunst und Münzen zu sammeln, mit Datum 1692. Im Jahr 1820 wurde das Werk von dem Londoner Buchhändler Bohn verkauft; irgendwann gelangte es zurück nach Frankreich und 1939 in den Besitz des elsässischen Parlamentsabgeordneten und Philatelisten Maurice Burrus.
Provenienz: Das ovale Wappen-Supralibros gehört Jacques de Saint-Mesmin, Président de la Chambre de Comptes de Bretagne, der laut Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 3. Ed. 1892, III , S. 103, im Jahr 1547 ins Präsidentenamt gewählt wurde – Auf dem Hinterdeckel am Rand blindgeprägter Namensstempel von Sir Andrew Fountaine. – Auf dem Vorblatt gegenüber Titel von älterer Hand: »Bohn’s Catalogue 1820. £ 2. 12. 6.« – Auf dem vorderen Vorsatz gestochenes Exlibris von Maurice Burrus (1882 – 1959). – Französische Privatsammlung.
Literatur: Adams V 457; BM STC German 895 442; Brun 312; Brunet V, 1277f.; Chrisman, S. 64, A1.3.1.; Dibdin, Introduction II , 542; Ebert 23665; Fünf Jahrhunderte 61; Graesse VI /2, 334; Kristeller, Straßburger, S. 32ff., 41f. und Nr. 99; Lonchamp, Français II , 470; Mambelli 99; Muther 557; Panzer VI , S. 27f., Nr. 12; Proctor 9888; Ritter 2411; Schmidt 1879, II , Nr. 163; Schmidt 1893, Nr. 60; Schweiger II /2, 1154; Taegert, Nr. 10; VD 16 V 1332; Wilhelmi 594 (Brant). – Zum Einband: Hobson, Maioli 40f.
Johann Grüninger’s Strasbourg print from 1502 with over 210 large woodcuts is the first illustrated edition of Vergil’s works. The editor Sebastian Brant guided the artists of Grüninger’s studio in the conception of the pictures, which in detail-rich realism depict not so much ancient Roman as Alsatian life around 1500. The book’s high esteem is reflected in the captivatingly richly decorated mosaic binding, which the royal bookbinder Gomar Estienne probably created around 1547 for Jacques de Saint-Mesmin, the first president of the Chambre de Comptes de Bretagne, the date of his appointment. The immaculately preserved marquetry binding has direct counterparts in the collection of King Henry II of France. The combination of the finest illustrated edition of Virgil with a royal mosaic binding of the period makes this copy a unique work of art.


Gyron le Courtoys . Auecques la deuise des armes de tous les cheualiers de la table ronde. Paris, [Antoine Couteau(?) für] Antoine Vérard, [um 1501-1503].
à 8 a-m 8 n-o 6 A-R 8 S6 = 6 [statt: 8] Bl., 110 [recte: 108] gezählte Bl., Bl. 201-3[42]. – Bl. 71-72 in der Foliierung übersprungen, letztes Bl. falsch gezählt, aber so komplett, bis auf die in Faksimile ersetzten Bl. à1 (Titel) und à8. – Durchgehend zweispaltig gedruckt; mit Paragraphenzeichen.
Mit 4 [statt: 6, die fehlenden in Faksimile ersetzt] ganz- bzw. fast ganzseitigen Illustrationen und Verlegermarke auf der letzten Seite sowie mit zahlreichen grotesken Zierinitialen und Lombarden; alles in Holzschnitt.
Folio (311 x 206 mm).
Roter Maroquinband des 19. Jahrhunderts auf fünf mit Goldfileten versehene Bünde, mit goldgeprägtem Rückentitel in zwei und abstrahiertem Blütenstempel in den übrigen, von doppelten Fileten gerahmten Rückenkompartimenten; auf den Deckeln doppelter Goldfiletenrahmen, darin Entrelacs-Rahmenwerk aus zackigen Filetenstreifen, mit abstrahierten Eckfleurons; doppelte Goldfileten auf den Steh-, Dentellebordüre auf den Innenkanten, mit blauen Maroquindoublüren, doppelten marmorierten Vorsätzen und Ganzgoldschnitt, auf dem Spiegel signiert »Lortic« (fehlende Bl. à1 und à8 in Faksimile ersetzt).
Der erste Artusroman eines Italieners in erster Ausgabe
Der Schriftsteller Rustichello da Pisa, bekannt als Mitautor von Marco Polos Reiseberichten, führte selbst ein bewegtes Leben. Um 1270 bereiste er Frankreich und England und begleitete bis 1272 den späteren König Eduard I. auf dem achten Kreuzzug ins Heilige Land. Dieser machte ihn mit dem Artus-Stoff bekannt, und Rustichello verarbeitete »a larger work by Hélie de Borron, who lived in England at Henry III .’s court« [Davies], um 1275 zu dem frühesten von einem Italiener verfaßten Roman aus dem arthurischen Motivkreis. Ein Teil davon wurde als die Geschichte des Tafelritters Gyron le Courtoys von Antoine Vérard erstmals gedruckt. Es existieren zwei Varianten, die von der Forschung auf 1501 bzw. 1503 datiert werden, wovon hier die zweite vorliegt. Die mit sechs großen Holzschnitten ausgestattete Edition von Vérard, ein schöner zweispaltiger Druck in Bastarda, mit zahlreichen grotesk-figuralen Initialen und wie eingemalt wirkenden Lombarden ist »la plus belle et la plus recherchée, et les exemplaires bien complets en sont fort rares« [Brunet].
Auch der »Herbst des Mittelalters« war mit der Zeitenwende von 1500 schon vorüber, die Ideale des Rittertums in der Epoche der Landsknechtsheere und der Artillerie historisch geworden, als sie





in den frühen Romandrucken neu ›aufgewärmt‹ wurden. Vielleicht gerade darum fühlte man sich im historistischen 19. Jahrhundert mit dem frühen 16. Jahrhundert besonders verbunden. Als erster Besitzer ist der Pariser Verleger, Drucker und Buchhändler Ambroise Firmin-Didot (1810 – 1876) faßbar, der auch als Philologe und bedeutender Bibliophile hervortrat. In dessen erster Pariser Nachlaßauktion wurde das Buch am 15. Juni 1878 versteigert. Noch kurz vor seinem Tod hatte er dem raren Exemplar eine Pflege zuteil werden lassen, die es nach den Maßstäben der Zeit zum Exempel aufwertete. Der Buchbinder Marcellin Lortic (1822 – 1892), »un des plus célèbres relieurs de son temps« [Beraldi III , 72] – dessen Etikett die Jahreszahl 1876 aufweist – ersetzte das fehlende Titel- sowie das letzte Blatt der ersten Lage als perfekte Faksimiles, er reinigte den Buchblock so sorgfältig, daß er sich in geradezu makellosem Zustand darbot, und faßte ihn in einen prächtigen, historisierenden roten Maroquinband. Der Deckeldekor erinnert an Grolier-Einbände »mit strenggeometrischem, vorwiegend rectilinearem Bandwerk« [Arnim 37; vgl. ebd. 36] des Entrelac-Binders Jean Picard um 1540 – 1543, freilich in souveräner Adaption. Stets schuf Lortic »du nouveau avec l’ancien« [Devauchelle II , 61]. Die Ausgabe ist ungemein selten (Bechtel unbekannt, da er nur vier große Holzschnitte zitiert), das einzige in den letzten Jahrzehnten aufgetauchte Exemplar erschien im Katalog P. Rossignol 18, Nr. 3: komplett im Einband von Chambolle, zitiert unser Exemplar: € 45.000.
Provenienz: Ambroise Firmin-Didot (1810 – 1876), dessen Auktion I, Paris, 6.-15.6.1878, Nr. 573 (frs. or 1.300). L. Gougy, I, 1934, 128: frs. 5.100 plus frais
Literatur: Nicht bei Adams; Bechtel G-406 (»c. 1503«); BM STC French 215; Brunet II , 1840; Claudin II , 485; vgl. Davies, Fairfax Murray, French, Nr. 216 (nur 2. Ausgabe 1519); Ebert 9150; Goff 1964, G-736; Graesse III , 190f.; Hain 8340; Lonchamp, Français II , 195; Macfarlane, Vérard 139, kennt nur drei Exemplare ; Pellechet, Lyon, Nr. 314. – Zu Lortic: Beraldi III , 7194; Devauchelle II , 56-61; Fléty 115.
This very rare chivalric romance about the knights of King Arthur’s Round Table was printed for A. Verard around 1500, today 1503 is given as the most likely date. It has six marvellous large woodcuts (two appear here in later facsimile) and was in the 19th century in the famous collection of Ambroise Firmin-Didot. All bibliographies are unanimous in underlining the fact that nearly no complete copy is known.
[Lorris, Guillaume de und Jean de Meung] . CE st le romant de la rose [/] Moralise cler et net [/] Tra[n]slate de rime en prose [/] Par vostre hu[m]ble molinet. Lyon, Guillaume Balsarin, 1503.
Bl. – So komplett, ein hypothetisches leeres Blatt a4 wird in der Zählung nicht berücksichtigt. – In zweispaltigem Druck.
Mit großer Zierinitiale zum Prolog, einem größeren Eingangsholzschnitt, 138 Text-Holzschnitten und Druckermarke.
Klein-Folio, mit Témoins (285 x ca. 197 mm).
Dunkelbrauner moderner Kalblederband mit Blindprägung im Stil der Zeit auf fünf Bünde; auf den Deckeln Rahmenwerk aus Streicheisenlinien gefüllt mit verschiedenen Rollenstempeln (Titel und erste Prolog-Seite von älteren Händen in Sepia beschrieben, erste drei Blätter am Innenfalz angerändert und wohl nachträglich ergänzt, erste Bl. fleckig und mit Randläsuren, sonst kaum fleckig).
Die populärste französische Dichtung des Spätmittelalters in einer Adaption um 1500
Der Roman de la Rose liefert das vielleicht faszinierendste Beispiel für das kulturelle Kontinuum, das vom höfischen Hoch- über das krisenhafte Spätmittelalter bis hinein in die frühe Neuzeit reicht. Verfaßt wurde der rund 21700 Verse umfassende Roman von zwei verschiedenen Autoren, die im Abstand von 50 Jahren daran arbeiteten.
Als Guillaume de Lorris um 1230 das Werk begann, waren die höfischen Ideale von Minne und Ritterlichkeit noch vorbildlich; es gilt geradezu als »Musterbild höf[ischer] Lyrik« [Lex MA VII , 991]. Der Ich-Erzähler berichtet von einem Traum, in dem er den Minnegarten besucht: Während er an der Außenmauer des hortus conclusus Darstellungen der verschiedenen Laster erblickt, erhält er Einlaß in eine »vornehme Gesellschaft von höf. Tugenden«, die er beim Tanzen beobachtet. Doch »am Brunnen des Narziß entdeckt er ein Rosengebüsch: da treffen ihn die Pfeile Amors« [ebd 992.] – von nun an ist er ein Amant auf der Suche nach seiner Dame, die schön wie eine Rose ist. Hier schon zeichnen sich erste Brüche mit der höfischen Konvention ab: Die »profane Autorität des Liebesgottes« wird »der Wahrheit der Bibel und der religiösen Allegorie« [Mancini, Moralistik 384] entgegengesetzt; die Phantasiegebilde des Paradiesgartens verblassen, indem der Held »den Wahn des Begehrens« kennenlernt und beginnt, »seine eigene Geschichte zu ›leben‹«. Die Liebesgeschichte nimmt allerdings »eine tragische Wende, als die Rose von Jalousie in ein Schloß eingesperrt wird. Mit den Klagen des Amant, die inmitten eines Satzes vom Erzähler unterbrochen werden« [ebd. 383], endet der Text Guillaumes de Lorris. Indem anders als im trobadorischen Roman es »nicht mehr um die ritterliche Bewährung, deren Prüfstein aventiure und Minnegemeinschaft sind« [Glier
428] geht; indem das Liebeswerben »konkreter, subjektiver« wird, kann die Geschichte unversehens »tragisch enden« [Mancini, Moralistik 384]. Damit schafft der Autor bereits »etwas völlig Neues« [Glier 428] gegenüber den Ritterromanen seiner Zeit.
Beeindruckt der Text von Guillaume de Lorris »durch seine subtilen psychologischen Einsichten und seine raffinierte allegorisch-didaktische Präsentation des Liebeserlebnisses«, so steigern sich bei seinem Fortsetzer Jean de Meung um 1280 »satirische Schärfe« und »realistisch-kritische, skeptisch-pessimistische Weltbetrachtung« [Erzgräber, Europäische Literatur 35]. Die Handlung wird konsequent zuende geführt: Ein »Sturmangriff der Venus, mit ihren glühenden Pfeilen, überrennt schließlich die Festung«, die Rose wird befreit. Ein »burleskes Gleichnis« umschreibt das Pflücken der Blume, das »ohne Ausschweife als Entjungferung dargestellt« [Lex MA VII , 992] wird. Dazwischen liegen zahlreiche Irrungen und Wirrungen, in denen »neuartige Widersprüche« der spätmittelalterlichen Welt sichtbar werden: »die Wirren der Stadt und des Geldwesens, ein glänzender, aber unerreichbarer Hof, Probleme mit der eigenen Identität« [Mancini, Moralistik 385]. Die »Tücke und List der Frauen, Kampf um Geld und Macht bestimmen diese Welt, wo Fortuna die Fäden in ihren Händen hält« [Lex MA VII , 992]. Konkret konfrontieren verschiedene allegorische Figuren den Helden mit widersprüchlichen Lehren und Strategien, die letztlich auch die »ethischen und veredelnden Werte der idealistischen Liebe« [Mancini, Moralistik 387] relativieren oder gar zerstören. Längst ist das Rittertum »zum Spiel, zur Maskerade erstarrt«, hat die »Verschmelzung von höfischer und christlicher Liebes- und Leidensfähigkeit« [Erzgräber, Langland 244] ihre Aura und Überzeugungskraft verloren. Zwar bleibt die »Sehnsucht nach der plenitudo, nach dem existentiellen Glück, das der Mensch in einem nun unerreichbaren Paradies genossen hat«, doch zugleich wagt sich der Roman »mutig in die tabuisierten Bereiche der Psychologie der Leidenschaften und der gesellschaftlichen Repression« [Mancini, Moralistik 388].
Angesichts der ironischen Grundhaltung des Autors ist es »nicht immer leicht, den genauen Sinn oder auch nur die Richtung der Argumentation zu rekonstruieren: Liebesallegorie, Laienenzyklopädie, Sittensatire, misogyne Schimpfreden, mystische Predigt, obszöne Komödie, philosophisches Traktat wechseln einander ständig ab« [ebd.]. Die Suche nach Orientierung spiegelt sich auch in dieser Auflösung der Form wider, die der generellen Entfaltung »allegorischer, didaktischer und satirischer Literatur« [Glier 427] im Lauf des Spätmittelalters entspricht. Jean de Meung nötigt seine Leser »zu kritischer Auseinandersetzung mit der Komplexität« [ebd. 432] der Liebesproblematik. Insgesamt bildet der Roman de la Rose »mit seinen zahlreichen Bezügen auf die antike Mythologie […] und seinen 80 Exempla« ein einzigartiges »Kulturdenkmal, ein unersetzliches Zeugnis über die Kenntnisse eines Klerikers des 13. Jh.« [Lex MA VII , 992]. Doch er weist eben auch weit über seine Zeit hinaus. Die »iron[isch]-satir[ische] Umdeutung der höf. Minneallegorie« und die semantische Offenheit machten den Roman »zum ständig zitierten Klassiker bis in die Mitte des 16. Jh.« [ebd. 991].
Eine Umsetzung in Prosa schuf um 1482 Jean Molinet, Hofdichter und Chronist am burgundischen Hof Karls des Kühnen, dann des Erzherzogs Maximilian. Er widmete sie Philipp von Kleve-Ravenstein, einem im Irrgarten der Liebe und der Kriege umherstreifenden Kavalier, der einstmals vergeblich um die Hand Marias von Burgund geworben hatte und nun auf ihrer und Maximilians



Seite im Niederländischen Krieg gegen die Franzosen kämpfte. In seiner Vorrede wird er als kriegserfahrener als jeder andere Prinz seines Alters geschildert, »and not being contented with warring under the triumphant standard of Mars, as desirous of being Champion des Dames under the pleasant guidance of Venus« [Bourdillon 161f.]. Sollte Molinet das Vorwort zu Beginn seiner Arbeit verfaßt haben, wäre dies möglicherweise eine Anspielung auf Kleves Bewerbung um Maria von Burgund, denn eine Heirat stand 1482 nicht bevor, er verehelichte sich erst 1487. Das aber wäre eine interessante Bestätigung für das fortwährende Interesse am Rosenroman gerade als einem ›Lehrbuch‹ zur konkreten Lebensbewältigung am Ausgang des Mittelalters.
Molinet erachtete es als nötig, an jeden Abschnitt noch eine allegorische Interpretation der moralité anzuhängen, an der Bourdillon kein gutes Haar ließ. Davon unberührt blieb freilich der eigentliche Romantext als »a literal prose rendering of the poem […] simple and generally close« [ebd.]. Er lasse sogar Rückschlüsse auf die von Molinet verwendete Handschrift zu und auf seine Bemühungen, »to get to the meaning of his author« [ebd.]. Erstmals erschien dessen Prosafassung im Jahr 1500 in Paris bei Vérard; die Lyoner Ausgabe von Guillaume Balsarin von 1503 ist die zweite. Die Holzschnitte folgen einer in Lyon entstandenen Serie von ursprünglich 85 Bildern, die bereits in den meisten frühen Folio-Ausgaben des Rosenromans Verwendung gefunden hatten. War schon deren Zeichnung »naïve and simple; and the cutting rude and archaic« [Bourdillon 82] und ohne perspektivisches Wissen, so waren diese 140 Holzschnitte zumeist »poor recuttings« von jenen, die mehr durch ihre schiere Anzahl beeindruckten. Die vorliegende Ausgabe fand Ebert »gut gedruckt«, schon zu seiner Zeit war sie »in schönen Exx. selten«.
Provenienz: Unter den zeitgenössischen Notizen in Sepiatinte auf dem – zusammen mit dem Prolog wohl später vorgebundenen – Titelblatt ist u. a. die Jahreszahl »1507« lesbar. Französische Privatsammlung.
Literatur: Baudrier XII , 41 und 60ff.; Bechtel M-440; nicht in BM STC French, bei Brun und Graesse; Bourdillon Y; Brunet III , 1176 (mit Abb. der Druckermarke); Ebert 19322; Panzer VII , S. 279, Nr. 30; Tchemerzine VII , 250; Vingtrinier 99.
The Roman de la Rose, the most popular French poetry of the late Middle Ages, was translated into prose around 1482 by the Burgundian court poet Jean Molinet and supplemented with allegorical interpretations; the Lyon print by Guillaume Balsarin of 1503 is the second edition. The 140 woodcuts follow a series of images also produced in Lyon. Like all early editions of the Roman de la Rose, this one is extremely rare; moreover, our copy is almost uncut.
[Pinder, Ulrich] . Speculum passionis domini nostri Ihesu christi. Nürnberg, [Ulrich Pinder], 1507.
A-O6 P-Q 4 = 1 Bl., 90 [statt: 91] gezählte Bl. in zweispaltigem Druck. – Es fehlt das leere Blatt Q4.
Mit 76 Holzschnitten, sämtlich altkoloriert, davon 39 ganzseitig (5 wiederholt) und einer zweidrittelseitig von Hans Schäufelein und Hans Baldung Grien.
Folio (ca. 304 x 205 mm).
Deutscher (österreichischer?) Kalblederband des 18. Jahrhunderts mit zwei Rückenschildern und reicher Rückenvergoldung; auf den Deckeln goldener Dentellebordürenrahmen in doppeltem Filetenrahmen, mit Steh- und Innenkantenvergoldung, Kleisterpapiervorsätzen und punziertem Ganzgoldschnitt (Einband berieben und leicht fleckig, Ecken bestoßen, im oberen weißen Rand schwache Feuchtigkeitsspur und zusätzlich vom Innensteg ausgehender kleinerer Feuchtfleck, hier und da Verfärbungen vom Kolorit, minimaler Braunfleck im äußersten Seitenrand der letzten 4 Bl., Bl. A1 großteils hinterlegt, so daß recto nur der Titel freiblieb, Bl. A2 am Kopfsteg angerändert). Insgesamt ein prachtvolles Exemplar.
Ein altkoloriertes Exemplar, von größter Seltenheit
Dies ist ein spektakuläres Exemplar der Erstausgabe eines der schönsten Holzschnittbücher der Epoche, illustriert von zwei der bedeutendsten Künstler der Zeit: Hans Schäufelein und Hans Baldung Grien, die von 1503 bis 1507 bzw. 1506 in der Werkstatt Albrecht Dürers arbeiteten. Als Präzedenz für das mit 76 Holzschnitten ausgestattete Werk läßt sich nur die Apokalypse von Dürer selbst anführen, der vielleicht vom Erfolg des Pinderschen Unternehmens – 1517 erschien eine zweite Auflage – wiederum zur Herausgabe seiner drei großen Holzschnittserien in Buchform angeregt wurde.
Eindrücklich läßt sich die – mit Erläuterungen von Bernhard von Clairvaux und Bonaventura angereicherte – Passionsgeschichte Christi an der monumentalen Reihung der 39 ganzseitigen Illustrationen nachvollziehen: Eine ganzseitige Kreuzigung und ein großer Schmerzensmann auf den Rückseiten der beiden ersten Blätter bilden den Auftakt, auf den bis Blatt 15 zunächst nur kleinformatige Abbildungen folgen, ehe der Einzug Jesu nach Jerusalem [Bl. 16v] den Reigen der großen Bilder erst wirklich eröffnet. Von eher ruhigen, fast idyllisch anmutenden Szenen, wie dem Abschied von der Mutter, dem letzten Abendmahl, der Fußwaschung und dem Gebet am Ölberg, steigert und dramatisiert sich das Geschehen mit der Gefangennahme über Verhöre und Verspottung bis zu den Szenen kaum überbietbarer Grausamkeit: Geißelung, Kreuztragung, Annagelung und Kreuzaufrichtung; ehe
mit Beweinung und Grablegung eine beruhigte Bildsprache zurückkehrt. Fast heiter reicht Christus dann in der Vorhölle einem erfreuten Toten die Hand zum Gruß, bevor er triumphal aufersteht und nacheinander seiner Mutter, Maria Magdalena und den Jüngern erscheint. Es folgen Himmelfahrt und im Gegenzug die Herabkunft des Heiligen Geistes, der als Taube auch die Marienkrönung im Himmel ›überwacht‹, ehe wir Christus am Jüngsten Tag thronend auf der Weltkugel sehen dürfen. Die ganze Heilsgeschichte wird im wuchtigen Rhythmus dieser ganzseitigen Bilder mit großer optischer Plausibilität eingefangen. Sämtliche Illustrationen erscheinen dabei in wunderbarem Altkolorit in Gelb, Grün, Rosa, Rot, Braun, Blau und Grau – ein Befund, der von größter Seltenheit ist. Mehr als die Hälfte des Bildmaterials, nämlich 39 Holzschnitte, darunter 35 ganzseitige (davon 5 wiederholt) stammt von Hans Schäufelein. Bis auf den Titelholzschnitt mit Christus am Kreuz (wiederholt auf Bl. 56r) und vier kleine Holzschnitte [Bl. 12 und 13] wurden sie hier erstmals gedruckt. Hans Baldung Grien steuerte 22 Holzschnitte (zwei wiederholt) bei. Zwölf davon wurden hier zum ersten Mal abgedruckt, so der zweidrittelseitige Schmerzensmann [Bl. 1v] sowie die ganzseitige Kreuzannagelung [51v] und -aufrichtung [54r]. Die ganzseitige Kreuzigungsszene [65r] ist zweitverwendet. Ein weiterer Holzschnitt, der Gang nach Jerusalem, läßt sich Dürers Assistenten Hans von Kulmbach zuweisen.
Der vielseitige Mediziner und Herausgeber Ulrich Pinder war von 1489 bis 1493 Leibarzt des Kurfürsten Friedrich III . von Sachsen gewesen und seit 1493 Stadtarzt von Nürnberg wo er zum Freundeskreis von Conrad Celtis, der »Sodalitas Celtica«, gehörte. Er verfaßte nicht nur medizinische Schriften, die er mit hervorragenden Holzschnitten versah, sondern war selbst als Buchdrucker tätig – so druckte er auch dieses Werk in seinem eigenen Haus.
Provenienz: Katalog Tenschert XX (1987), Illumination und Illustration, Nr. 64 (Sfr. 68.000). – Exlibris der Bibliotheca Philosophica Hermetica von Joost Ritman in Amsterdam. Von uns direkt zurückerworben.
Literatur: Adams P 1243; Bartsch VII , S. 126f., Nr. 34 (Schäufelein); BM STC German 697; Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 333; Dodgson II , S. 5f., Nr. 1, und S. 17, Nr. 2-31; Ebert 16913; Fünf Jahrhunderte 63; Geisberg, Nr. 246-248, 367-368, 370-382, 385-396 (Schäufelein), 328-333, 383-384 (Baldung), 369 (Hans Süß von Kulmbach); Mende 286-297; Muther 897; Neufforge 325; Oldenbourg, Baldung Grien, L 7; Oldenbourg, Schäufelein, L 4; Panzer VII , S. 446, Nr. 48; Proctor 11031; VD 16 P 2807.
The Speculum Passionis, published by the Nuremberg city physician Ulrich Pinder, is one of the most beautiful woodcut books of the period, illustrated by two of the most important artists of the time: Hans Schäufelein and Hans Baldung Grien, who previously worked in Albrecht Dürer’s workshop. Accordingly, only Dürer’s Apocalypse can be cited as the model for this work, which is illustrated with 76 woodcuts, including 39 full-page woodcuts. In this spectacular copy of the first edition of 1507, all illustrations appear in wonderfully differentiated original colouring - a case of the utmost rarity. Provenance: Joost Ritman.









Geiler von Kaysersberg, Johann . Predigen Teütsch: und uil gütter leeren. Augsburg, Johann Otmar, 1508.
A-B8 C6 D-E8 F-G6 H8 I-S8-6 T-Y6 Z4 = 156 gezählte Bl. – Zweispaltig und mit Paragraphenzeichen gedruckt, Textpassagen am Beginn einiger Abschnitte in Rot.
Mit 4 Evangelisten-Medaillons auf schwarzem Grund auf dem Titel, 3 ganzseitigen, zeitgenössisch kolorierten Holzschnitten von Hans Burgkmair, ferner mit 4 elf- bis zwölfzeiligen Holzschnitt-Initialien, davon 3 auf rotem, eine auf schwarzem ornamentalen Grund und 3 koloriert, schließlich mit zahlreichen in Rot eingemalten Lombarden in unterschiedlicher Größe sowie rot unterstrichenem Titel.
Folio (281 x 196 mm).
Blindgeprägter Halbschweinslederband der Zeit über Holzdeckeln auf drei breite filetenverzierte Bünde, mit dreifachen Filetenrahmen in den Rückenfeldern; auf den Deckeln Rahmenwerk von Streicheisenlinien und zwei verschiedenen Rollenstempeln, mit zwei intakten Messingschließen (einst senkrecht gebrochene Deckel alt restauriert, Papier gering gebräunt und schwach stockfleckig, letzte Bl. leicht wasserfleckig).
Die »helltönende Posaune von Straßburg« – gedruckt in Augsburg
Johann Geiler von Kaysersberg (1445 – 1510) ist der bedeutendste deutsche Prediger des ausgehenden Mittelalters. Stand ihm als Theologen »fast das gesamte Wissen seiner Zeit zur Verfügung«, so war es sein Hauptanliegen, die »Mitmenschen zu christlichem Lebenswandel anzuhalten, sie sittlichmoralisch zu bessern und ihnen so den Weg zum wahren Heil zu öffnen« [ NDB 6, 150]. Dabei scheute er weder vor herber Kritik – auch an der Obrigkeit – noch vor derber Sprache zurück. »In der Wärme und Kraft seines Ausdrucks« wie »in der concreten Popularität seiner Bilder […] ist er geradezu unübertroffen« [Wetzer/Welte 5, 190]; er verwendete »Allegorien, Gleichnisse, Erzählungen, Sprichwörter und volkstümliche Redensarten in reicher Zahl« [ NDB 6, 150], spannte Ernst und Komik zusammen, berühmt sind seine Predigten über Brants Narrenschiff. Die Zeitgenossen nannten Geiler die »helltönende Posaune von Straßburg« [Wetzer/Welte 5, 192], dort bekleidete er seit 1478 das eigens für ihn geschaffene Amt des Dompredigers. Rasch wurde er so beliebt, daß er auch andernorts predigte – »besonders in dem Kloster der Reuerinnen (poenitentes), das er kirchlich reformirt hatte, und einmal längere Zeit in Augsburg (von Michaelis 1488 bis zu Anfang des Jahres
Die erste deutsche Buchausgabe Geilers von Kaysersberg, mit frühen Buchholzschnitten Burgkmairs, original koloriert und im ersten Einband, aus Sammlung Joost Ritman
1489) gelegentlich eines Besuches bei dem ihm befreundeten Bischofe Friedrich von Zollern« [ebd. 189]. Dieser hatte sogar versucht, Geiler ganz »für seine Diözese zu gewinnen« [ebd. 191].
Den weiten und anhaltenden Widerhall der »Posaune von Straßburg« bezeugt eindrucksvoll das vorliegende Buch. Als »Mann des lebendigen Worts« [ebd. 192] veröffentlichte Geiler selber fast nichts, doch wurden die hier vorliegenden Predigten, »gehalten theils in Augsburg, theils bei den Pönitenten in Straßburg, […] von gottseligen Personen nachgeschrieben« [ebd. 194], und, wie auf dem letzten Blatt eigens betont, »on sein wissen vn[d] zu thun« 1508 in Augsburg von Johann Otmar gedruckt, »durch des kostens darlegung Etlicher ersamen […] die da (weltlichen rum zuuermeiden) nicht hye wöllen genännt werden« [Bl. 156v] – das Werk sollte seinen Meister loben. Von den sieben Titelzeilen gelten fünf allein dem Autor; umrahmt wird der rot unterstrichene Rechtecksatz von vier Medaillons mit den Evangelistensymbolen auf schwarzem Grund, die Otmar in anderer Form schon 1502 auf einem Titelblatt verwendet hatte [vgl. Breyl 257]. Hier scheinen sie den »evangelischen« Charakter der Predigten Geilers gleichsam zu »besiegeln«. Die fromme Sorgfalt der Herausgeber bezeugt das ausführliche Register am Schluß des Bandes [Bl. 149v-156r].
Wie bei Luther, so lag auch bei Geiler »der Schwerpunkt seiner Lehre […] in der Rechtfertigung«, allerdings in altkirchlicher Form. Zwar predigte er seinen Zuhörern, »daß Gottes Liebe grenzenlos sei und daß Christi Leiden sie vom ewigen Tod erlöst hatte«, doch dürfe »diese Gnade nicht passiv hingenommen werden«, vielmehr sollten die Gläubigen so handeln, »als ob ihr Heil von ihrem eigenen Wirken abhänge«. Zuerst müsse »mit dem Laster aufgeräumt« werden, sodann sollten die Christen »alle von der Kirche gebotenen Mittel […], den Empfang der Sakramente, aber auch Andachten und private Gebete« als »Weg zum geistlichen Fortschritt« [TRE 12, 160] nutzen.
Programmatisch steht dafür der ganzseitige Holzschnitt auf der Titelrückseite, der den Berg des schowenden lebens ins Bild setzt und mit der Aufforderung »Primum querite regnum dei et iustitiam eius« das Thema der Rechtfertigung direkt anspricht. Aus dem Hintergrund strebt eine Pilgerschar den Berg hinan, im Vordergrund verweilen Rosenkranz-Beter an der Strecke, links oben haben Gläubige bereits die Kirche auf dem Gipfel erreicht; die körperliche Aufwärtsbewegung wird durch die Worte »Sursum corda« – »Empor die Herzen!« – ins Geistliche transponiert. Von diesem Aufstieg handelt der erste Teil des Buches. Auf dem zweiten großen Holzschnitt [Bl. 38v] werden die Pilger – die Kirche ist im Hintergrund angeschnitten sichtbar – näher vorgestellt: Zwei durch ihre Kleidung und Ausstattung sofort als Wallfahrer erkennbare Männer tauschen sich aus, links schaut eine Frau zu ihrem fragend aufblickenden Kind herab: »Hyenach volgend Achtzehen aigenschafften/ Die ain gutter Christenbilger/ an sich nemen soll« [Bl. 39r]. Gut sichtbar am Fuß eines steinernen Wegkreuzes brachte Hans Burgkmair seine Signatur an. Ist aus diesen »ersten eigentlichen Illustrationen des Meisters« dessen Eigenart vorerst nur »schwer herauszulesen« [Muther], so stellen sie doch eine überzeugende Illustration der bildhaften Sprache Geilers dar – auch der Künstler hatte die Predigen Teütsch nicht ohne Gewinn gelesen. Es folgen Ettlich Predigen , dann diejenige von den sieben Eselhalftern, oder Wie die seel des mensch[e]n / durch die verlurst der vrspringklichen gerechtikait / gleych worden ist ainem esel. [Bl. 87r-108v]. Zu ihnen liegen keine Holzschnitte vor. Erst der Zöllner Zachäus, der einen Feigenbaum erklettert, um Jesus zu sehen, erregte wieder das





Interesse des Illustrators: Zum einen konnte er dem neugierigen Betrachter hier eine – Palme – vor Augen stellen, zum anderen das Motiv des Aufstiegs in origineller Form wiederaufnehmen. Die Baumwurzel wird durch ein Schriftband mit dem Glauben assoziiert, der Stamm, an dem der Sünder gerade emporklimmt, als Hoffnung markiert, sieben Äste bedeuten Tugenden, hoch oben in der Krone winkt das Flatterband der »liebe« [Bl. 136v]. Auch hier sind die inhaltliche Beziehung der Illustration auf den Text und die durchdachte Komposition bemerkenswert. Wenngleich Burgkmairs frühe Holzschnitte »weder von der Erfindung noch von der technischen Durchführung her zu den gelungensten seines Werkes« [Städtischen Kunstsammlungen Augsburg] zählen und der traditionellen Umrißkomposition verpflichtet sind [vgl. Ott 1997, 233], so passen sie gerade in dieser schlichten Zugänglichkeit zu den volkstümlichen Predigten Johann Geilers. Sie brauchen keine raffinierten Schraffuren und Schattierungen, sondern finden ihr Genüge am angemessenen Kolorit: Die Erde ist braun oder gelb, Wiesen, Büsche und Bäume sind grün, für menschliche Kleidung wird Rot bevorzugt – damit ist die Palette des Malers im wesentlichen ausgeschöpft. Mit diesen Mitteln koloriert er sorgfältig, auch die großen Initialen.
Gepflegt ist auch der Erhaltungszustand unseres breitrandigen Exemplars zu nennen. Schon in der Frühzeit müssen die Deckel einmal gebrochen sein; beim hinteren stabilisieren drei symmetrisch eingelegte Holz-Rechtecke in geradezu ästhetischer Weise die glatte senkrechte Bruchlinie. Ein gelehrter Kleriker vertiefte sich damals in das volkstümliche Predigtbuch: Es weist durchgehend kurze saubere Marginalien in lateinischer Sprache auf.
Provenienz: Exlibris der Bibliotheca Philosophica Hermetica von Joost Ritman in Amsterdam. – Dessen Auktion Sotheby’s, London, 6.12.2000, Nr. 55.
Literatur: Nicht bei Adams (nur Ausgabe 1510); BM STC German 336; Dodgson II , S. 61, Nr. 6, siehe auch S. 57, Nr. 3; Ebert 8246; Geisberg, Nr. 827-829 (Burgkmair); Goedeke I, 399, Nr. 9; Graesse III , 41; Muther 857; Panzer, Annalen I, S. 287f., Nr. 603; Proctor 10671; Schmidt 1879, II , Nr. 180; Städtische Kunstsammlungen Augsburg, Nr. 30-32; VD 16 G 790; Wetzer/Welte 5, 194; Zapf II , S. 32ff., Nr. I.
This is the first German book edition of the most important German preacher of the late Middle Ages, Johann Geiler von Kaysersberg. The work was printed without his knowledge in 1508 by Johann Otmar in Augsburg. It contains three early full-page woodcuts by Hans Burgkmair. The originally coloured copy is in the first binding and comes from J. Ritman's celebrated collection.
Meder, Johannes . Parabola filij glutonis profusi atq[ue] p[ro]digi nedu[m] venuste veru[m]etia[m] vtiliter [et] deuote […]: pro totius anni precipue quadragesime sermonib[us] acco[m]modata. Basel, Michael Furter, 1510.
a-z 8 A-E8 = 231 Bl., 1 leeres Bl. – Titelblatt in Schwarz- und Rot gedruckt. – Zweispaltig gedruckt und mit rot eingemalten Paragraphenzeichen.
Mit 18 ganzseitigen Abbildungen (davon 2 wiederholt) und 3 verschiedenen Druckermarken, alles in Holzschnitt und altkoloriert; einige in vorgesehene Spatien rot eingemalte Lombarden (zumeist in der Tabula).
Oktav (151 x 205 mm).
Moderner dunkelbrauner Kalblederband nach historischen Vorbildern auf fünf von Blindfileten begleitete Doppelbünde, mit blindgeprägtem Rückentitel; auf den Deckeln zwei dreifache Blindfiletenrahmen, das Mittelfeld von dreifachen Blindfileten durchkreuzt, in den dadurch abgeteilten Feldern rautenförmige Stempel, auf dem Innendeckel signiert »G. Huser« (einige Blätter mit unwesentlichen Randläsuren).
Der verlorene Sohn in der Nachfolge Christi
Diese Sammlung von fünfzig Predigten für die Fastenzeit aus der Feder des Basler Franziskaners Johannes Meder war als Quadragesimale de filio prodigio bereits im 15. Jahrhundert dreimal von Michael Furter gedruckt worden. Herausgeber war Sebastian Brant, der das Vorwort und ein Gedicht in elf Distichen beisteuerte. Für die vorliegende vierte und letzte Ausgabe wurde der Text neu gesetzt und zusätzlich ein vierzeiliges Gedicht des Franziskaners Daniel Maier (alias Agricola) auf dem Titel abgedruckt. Auch wurden noch zwei weitere, jeweils unterschiedliche Druckermarken Michael Furters hinzugefügt.
Der kleinformatige Band spricht vor allem auch optisch an, enthält er doch 18 fast blattgroße Illustrationen; die Holzschnitte der ersten beiden Ausgaben von 1495 bzw. 1497 waren in einer »nur in der UB Münster vorhandenen Ausgabe zwischen 1497 und 1500 durch systematischer schraffierte Nachschnitte ersetzt worden« [Hieronymus], die in diesem Neudruck übernommen sind; neu sind die Druckermarken Furters. Inhaltlich ist die Bilderfolge »sehr bedeutend« [Muther], indem sie die Geschichte des verlorenen Sohnes auf interessante Weise mit der Passion Christi verknüpft. Von Anfang begleitet den verlorenen Sohn ein Engel, der immer wieder gebärdenreich auf die schließlich stattfindende ›Umkehr‹ hinweist.
Die Fastenpredigten des Johannes Meder, mit 18 altkolorierten Holzschnitten vom „Meister des Haintz Narr”












Die Entstehung des Holzschnittbuchs schließt unmittelbar an die von Sebastian Brants berühmtem Narrenschiff an, das 1494 erschien. Die Darstellungen werden dem sogenannten Meister des Haintz Narr zugeschrieben, dem »besten heimischen Reißer […], den Basel vor dem Auftreten Dürers 1492 besaß« [Winkler 1951, 41]. Er hatte bereits an der Illustration des Narrenschiffs »unter dem anregenden Eindruck der Wirksamkeit des Hauptmeisters (Dürer)« [ebd. 90] mitgearbeitet und sich vorsichtig »der neuen naturalistischen Kunstrichtung« geöffnet. Schon dort bewies er eine »Begabung, die Figuren geschickt ins Bild zu stellen« und »das Sprechende von Ausdruck und Gebärden« [ebd. 91] glaubwürdig wiederzugeben. Wenngleich die Baseler Illustratoren insgesamt nach Dürers Weggang 1493 einem »Stilgemengsel mit naturalistischem Einschlag« verhaftet blieben, so gewann der Haintz Narr-Meister in den Holzschnitten zu Meders Quadragesimale von 1495 »mehr Abstand zu der überragenden Persönlichkeit des Hauptmeisters (Dürer)«: Während »die knorrigen Baumstämme« ohne Dürers Vorbild »gar nicht denkbar« sind, erfahren seine Figuren eine noch »subtilere Modellierung« [ebd. 92].
Passend zu Inhalt und Intention des Buches stammt unser Exemplar wohl aus dem Dominikanerkloster in Freiburg im Breisgau. Doch wurde es anscheinend nicht nur als Predigtvorlage genutzt, sondern auch zur stillen Kontemplation der Bettelmönche. Denn die Bilder wurden mit einem sparsamen, aber wirkungsvollen Kolorit vorwiegend in den Farben des warmen Spektrums ausgestattet: Sie changieren von Gelb über Orange und Rot zu Braun, einige Flächen blieben weiß. Gelegentlich werden zur Hervorhebung einzelner Figuren auch Blau bzw. Blaugrau eingesetzt – eine einfache, ruhige Farbsprache, die zur klaren Erfassung der Bildinhalte beiträgt.
Den angemessen schlichten Einband nach historischem Vorbild fertigte der seit 1903 selbständige Pariser Buchbinder Georges Huser (1879 – 1961), »un maître aux goûts classiques, un exécutant parfait« [Devauchelle].
Provenienz: Alter Eintrag auf dem Titel: »Conv: friburg: Ord: Pr…«, wohl das Prediger- bzw. Dominikanerkloster in Freiburg im Breisgau, das nach vergeblichen Renovationsversuchen 1794 aufgelöst wurde. – Verso Titel und auf dem vorletzten Blatt Monogrammstempel »VF« in Lorbeerkranz, um 1800 [nicht bei Lugt]. – Etikett des Baseler Antiquars Henning Oppermann auf dem hinteren Spiegel.
Literatur: Nicht bei Adams; BM STC German 605; Brunet III , 1565f.; Graesse IV, 460; nicht bei Heckethorn; Hieronymus 1972, Nr. 61; Isaac 14121; vgl. Muther 469f.; Panzer IX , S. 392, Nr. 84b (unter »Melder«); nicht bei Stockmeyer/Reber (nur frühere Ausgaben); VD 16 M 1855; Wilhelmi 445. – Zum Buchbinder: Devauchelle III , 262f.; Fléty 93.
The Lenten sermons of Johannes Meder, edited by Sebastian Brant, are presented here in the edition of 1510. They are illustrated by 18 woodcuts almost the size of a sheet by the master of Haintz Narr, who was already involved in the illustration of Brant’s Ship of Fools. In an idiosyncratic way, the story of the prodigal son is linked to the Passion of Christ. The pictures present themselves in a sparse but effective colouring predominantly in warm hues.




Dürer, Albrecht . Passio domini nostri Jesu […] per fratrem Chelidonium collecta. Cum figuris Alberti Dureri Norici Pictoris. Nürnberg, Albrecht Dürer, 1511.
Folge von 12 großformatigen Holzschnitten von Albrecht Dürer. Groß-Folio (Blattgrößen leicht unterschiedlich, bis 394 x 281 mm, Titelblatt 386 x 254 mm).
Ungebunden (überwiegend auf die Einfassungslinie, Gefangennahme umlaufend ca. 2-3 mm, am rechten Rand ca. 5 mm beschnitten; einzelne Ausdünnungen oder winzige Fehlstellen, 1 Bl. mit kleinen Papierbrüchen auf der Wasserzeichenlinie, 3 Bl. mit unbedeutenden Braun- bzw. Rotflecken im Bildbereich, Auferstehung mit Spuren alter Rotstift-Quadrierung), gerahmt unter Glas.
Der »Höhepunkt in der Kunstgeschichte des Holzschnitts«
Schon im 15. Jahrhundert verbreitete sich »die fromme Übung, sich die Leiden zu vergegenwärtigen, die Gottes Sohn für das Seelenheil der Menschen auf sich genommen hatte«, getrieben von dem »starken Bedürfnis der Gläubigen nach emotionaler Anteilnahme, nach einem Mitleiden und damit nach gefühlsmäßiger Nähe zu Gott« [Sonnabend 116]. Gegen Ende des Jahrhunderts erschien eine schon bald berühmte Passionsfolge in Kupferstich von Martin Schongauer. Dieses Vorbild überbot Albrecht Dürer noch mit den beiden Holzschnittserien der Kleinen und vor allem der Großen Passion, denen sich die Kupferstich-Passion anschloß. »Die Intensität von Dürers Auseinandersetzung mit dem Leiden Christi zeigt, dass das Thema ihn neben dem geschäftlichen Interesse auch persönlich sehr berührte« [ebd. 118].
Hier liegt nun die komplette Folge von Dürers zwölf großartigen Holzschnitten der Großen Passion vor, bis auf drei Blätter aus der von Dürer selbst veranstalteten Ausgabe von 1511 stammend, mit Titelblatt, lateinischem Text auf den Rückseiten und dem Kolophon auf dem letzten Blatt.
Die ersten sieben Passionsszenen waren schon in den Jahren 1496 bis 1500 entstanden: Christus am Ölberg, Geißelung, Schaustellung, Kreuztragung, Christus am Kreuz , Beweinung und Grablegung. Unterbrochen durch Dürers Italienaufenthalt und andere Arbeiten ruhte das Werk bis 1510, als er die Darstellungen von Abendmahl, Gefangennahme Christi, Christus in der Vorhölle und Auferstehung [vgl. Sonnabend 118, Panofsky 181] und zuletzt 1511 das Titelblatt mit der Darstellung des Schmerzensmannes und einem Landsknecht hinzufügte, um die Serie im selben Jahr als Buch zu publizieren. Das kaiserliche Privileg zum Schutz gegen unerlaubte Nachdrucke auf dem letzten Blatt (zusammen mit dem Druckvermerk) sowie die sorgsame Plazierung des Monogramms drücken Dürers besondere Wertschätzung seiner Holzschnitte aus.





Da zwischen der Entstehung der ersten und der letzten Blätter der Folge über zehn Jahre liegen, verdeutlichen die Holzschnitte die künstlerische Entwicklung des Meisters von spätmittelalterlichen zu renaissancehaften Formelementen. So dominieren in den nach der italienischen Reise entstandenen Blättern »Passagen, in denen feine parallele Schraffuren gleichmäßig graue Flächen erzeugen«, einen »mittlere[n] Ton, von dem sich dunklere Partien als Schatten und unbedruckte, helle Stellen des Papiers als Licht abheben«. Diese Helldunkel-Methode schuf ein besonderes »Körpervolumen und eine atmosphärische räumliche Wirkung«. Damit markieren diese Blätter Albrecht Dürers einen absoluten »Höhepunkt in der Kunstgeschichte des Holzschnitts« [Sonnabend 21f.].
Auch inhaltlich sind die Illustrationen in besonderer Weise aufgeladen, Erwin Panofsky sprach von einer »merkwürdige[n] Wiederbelebung des ›Visionären‹ im Rahmen des neuen Holzschnittstils« [Panofsky 182]. So verschmilzt Dürer die Szene Auferstehung Christi »in Wirklichkeit […] mit der Himmelfahrt, ebenso wie die Himmelfahrt Mariens mit der Szene ihrer Krönung verschmolzen wird« [ebd. 183]. Auch andere Darstellungen enthalten mehrere in den Evangelien geschilderte Episoden in jeweils einer Komposition, z. B. sind die Fortführung nach Jerusalem, der Judaskuß und die Petrus-Malchus-Szene sowie der fliehende Jüngling in der Gefangennahme synchron dargestellt.
Die Holzschnitte der vorliegenden kompletten Folge entstammen bis auf die Szenen der Schaustellung, Kreuztragung und Christus in der Vorhölle der Textausgabe von 1511. Zwei dieser drei Blätter, die keinen rückseitigen Text haben, lassen sich bibliographisch zuordnen: die Kreuztragung der Augsburger Ausgabe von 1675 [Wasserzeichen Meder, Nr. 178, Augsburger Wappen mit M, Meder 119 III /c] und Christus in der Vorhölle dem frühesten Zustand nach der Textausgabe [Wasserzeichen Meder, Nr. 325, gotisches P mit Wappen, Meder 121 III /a]. Die Blätter der Textausgabe von 1511 haben zumeist das Wasserzeichen Blume mit Dreieck [Meder, Nr. 127]. Die Holzschnitte sind überwiegend auf die Einfassungslinie beschnitten und tragen verso verschiedene alte Montierungsspuren. Kleinere Mängel beeinträchtigen den Gesamteindruck nur wenig: Dies ist insgesamt ein sehr gutes Exemplar der komplett selten gewordenen Reihe. Der besonders feine gratige Abzug der „Schaustellung“ Christi hingegen gehört sogar dem ersten Druck von 1498 an, da die zwei hierfür angegebenen Charakteristika zutreffen: die Fehlstelle an der inneren Kante des Eckpfeilers oben und die Lücke links unten (fehlendes Stück Stoff am Wams des Knaben oder Kleinwüchsigen)! Die durchgehend hohe, ungemein gleichmäßige Qualität des Drucks lässt im Übrigen keinesfalls eine Attribution an die späteren Abzüge nach 1570 zu, die sämtlich als „flau“ gekennzeichnet werden. Außerdem findet sich keiner der für spätere Drucke vermerkten Schäden. Auch ist das Blatt in jeder Hinsicht den anderen neun aus der Textausgabe überlegen. Man darf, angesichts der Tatsache, dass vom ersten Druck bei Schoch/Mende/Scherbaum überhaupt nur zwei Exemplare verzeichnet sind (und ein ungewisses), sicherlich von einer Sensation sprechen, die unser drittes Exemplar darstellt, das durch die hier erstmals verzeichnete Entdeckung die gesamte Suite in eine neue, unerhörte Qualität erhebt.
Provenienz: Deutsche Privatsammlung.
Literatur: Albrecht Dürer, Nr. 597; Meder, Nr. 113-124; Schoch/Mende/Scherbaum II , Nr. 154-165 (mit Abb. aller Blätter); Sonnabend, Nr. 51-62, und S. 20ff.; Winkler 1957, 114ff. sowie Abb. 64.

Albrecht Dürer spent more than a decade on the woodcut series of the Great Passion, which he published in 1511. The 12 large-format woodcuts reflect Dürer’s artistic development from late medieval to Renaissance formal elements and mark an absolute high point in the art history of the woodcut. Here we have the complete set in wonderfully unaffected condition, all but three leaves from the edition of 1511 published by Dürer himself, with title page, Latin text on the versos and the colophon on the last leaf. One of the three leaves, the «Presentation of Christ », is in the untraceable first impression (only two other copies known) of 1498!

[Aurelius, Cornelis] . DI e cronycke van Hollandt Zeelandt en[de] Vrieslant beghinnende va[n] Adams tiden tot die geboerte ons heren Jh[es]u[m] Voertgaende tot de[n] iare M. CCCCC . Ende Xvij. Met de[n] rechten oerspronc, hoe Hollandt eerst begrepen en[de] bevvoent is gheweest va[n] de[n] Troyane[n]. En[de] is inhoudende va[n] die hertogen va[n] Beyere[n] Henegouvve[n] en[de] Bourgo[n]gen Die tijt dat si ant graefscap gevveest hebbe[n]. Met die cronike der biscoppen van uutrecht, seer suuerlic geexte[n]deert en[de] int lange v[er]haelt. Leiden, Jan Seversz, 1517.
te: 434] gezählte Bl. – Die Blattnummern 343 und 435 wurden übersprungen, aber so komplett.
Überwiegend zweispaltig, Titel in Schwarz und Rot gedruckt.
Mit etwa 240 (110 verschiedenen) Illustrationen und zahlreichen kleinen Wappen in Holzschnitten.
Folio (282 x 195 mm).
Hellbrauner Kalblederband des 18. Jahrhunderts auf sechs Bünde, mit goldgeprägtem Rückenschild und floraler Vergoldung in den dreifach gerahmten Rückenfeldern; die Deckel mit sehr feinem Zacken- in doppeltem Filetenrahmen in Blindprägung sowie mit Goldbordüre auf den Stehkanten; mit marmorierten Vorsätzen und Ganzrotschnitt (beschabt und etwas fleckig, Außengelenke mit Einrissen, nur ganz vereinzelt kleine Randläsuren oder Flecken, Bl. 269 mit ersetztem kleinen Eckabriß und ergänztem Buchstabenverlust in 6 Zeilen).
Mit insgesamt rund 240 Holzschnitten, in schöner Erhaltung
So wie der gelehrte niederländische Augustiner Cornelius Aurelius (um 1460 – 1531) in seinem Leben Mönchtum und Humanismus verband, so hielt er auch in seiner in die Weltgeschichte eingebetteten cronycke van Hollandt an der mittelalterlichen Grundidee der universitas christiana, der Harmonie zwischen kirchlicher und weltlicher Macht, Papst und Kaiser, Glaube und Moral fest. 1497/98 war der von der Devotio moderna geprägte Aurelius nach Paris gesandt worden, um das Kloster St. Victor im Sinn der Windesheimer Kongregation zu reformieren – bei dieser Gelegenheit hatte er sich mit dem Historiker Robert Gaguin befreundet und entscheidende Anregungen für seine eigene Geschichtsschreibung empfangen; 1508 hatte ihn Kaiser Maximilian I. mit dem Dichterlorbeer gekrönt. Sein »magnum opus« [Tilmans 55] erschien 1517 – gerade in dem Moment, als Luthers Auftreten die überkommene universitas erschütterte. In der Folgezeit wollte Aurelius mit seinem anonym erschienenen Werk offenbar nicht in Verbindung gebracht werden – er selbst hatte darin scharfe Kritik am grassierenden Ablaßhandel geübt. Sein Verleger Jan Seversz war zum
Luthertum übergelaufen und wurde 1524 aus Holland verbannt, so daß es Aurelius ratsam schien, »to disclaim any connection with both the heretic and the chronicle« [ebd. 80]. Später wurde sein Werk zur »basis for the teaching of dutch history in schools until the nineteenth century« [ebd. 3]. Indem Aurelius die holländische Geschichte in die universale Welt- und Heilsgeschichte einbettete, ließ er sie bei Adams tiden beginnen, und nahm geographisch tendenziell die gesamte damals bekannte Welt in den Blick [vgl. ebd. 129/131] – schließlich war die Grafschaft Holland ein essentieller Teil des römisch-habsburgischen Reiches, das nun über das Meer nach Amerika ausgriff. Eine fakultativ dem Werk beizufügende Weltkarte ist jedoch nur in zwei Buchexemplaren überliefert [vgl. ebd. 98/101]; überhaupt weitete Aurelius die Perspektive nur so weit aus, wie ihm für die holländische Historie dienlich schien. Dem Kleriker lag die Geschichte der Kirche und ihrer Heiligen besonders am Herzen, wobei er auch »the abuses of the Church – the corruption of clergy and heresy« beschrieb, in der Gewißheit, daß die Kirche »had always defeated this kind of crisis« [ebd. 63]. Auf säkularem Gebiet lieferte Aurelius neben einer »encyclopedic collection of information« [ebd. 128] auch »political lessons for the present day« und »in Christian morality« [ebd. 15]. Im Unterschied zu den mittelalterlichen Chronologien war seine Historie den humanistischen Prinzipien der historischen Wahrheit und rhetorischen Wirksamkeit, dem Quellenvergleich und der Faktenauswahl verpflichtet. Mit der Verwendung der Volkssprache verband sich die Absicht, »to act as intermediary between scholar and layman and to provide a ›national‹ basis for historical traditions« [ebd. 196].
Nach seiner Einteilung in 32 Divisies wird das Werk auch Divisiekroniek genannt; grundlegend ist jedoch die Dreiteilung in alte, mittlere und neuere Geschichte nach humanistischem Muster, angepaßt an die regionalen Verhältnisse: Der erste Teil umfaßt die römische Epoche unter Einschluß der karolingischen Zeit. Als erster niederländischer Geschichtsschreiber identifizierte Aurelius seine Landsleute mit dem Stamm der Bataver, der den Römern nicht unterworfen, sondern frei mit ihnen verbündet gewesen sei [vgl. ebd. 7]. Mit Dirk I. von Holland beginnt 863 die mittlere Epoche der Grafenzeit, in der jede Divisie einem Dynasten gewidmet ist [vgl. ebd. 144]. Sie endet 1433 mit der Eingliederung Hollands in das Burgunderreich, was den Beginn der jüngsten Periode markiert. Mit dem Übergang der Herrschaft an die Habsburger wird die Geschichte Hollands wieder integraler Teil der Reichsgeschichte [vgl. ebd. 150], womit der Kreis sich schließt und die Intention des Autors manifest wird: Er schreibt »a ›national‹ chronicle in the context of imperial history« [ebd. 152], die Gegenwart fest im Blick: Die Geschichtserzählung reicht bis zum Jahr 1516, als es dem habsburgischen Statthalter der Niederlande, Heinrich III . von Nassau, gelang, die marodierenden Truppen des Herzogs Karl von Egmond bei Nieuwpoort am Lek zurückzuschlagen und damit die habsburgische Autorität und die Sicherheit Hollands fürs erste wiederherzustellen [Bl. 434v; vgl. Tilmans 56].
Spricht aus dem Text trotz seiner Anonymität deutlich das humanistische Selbstbewußtsein des Autors, so hatte er mit der reichen Bebilderung des Buchs nur wenig zu tun [vgl. ebd. 97f.]. Denn DIe cronycke van Hollandt Zeelandt en[de] Vrieslant war auch für den Leidener Drucker Jan Seversz das wichtigste Werk, um damit Hartmann Schedels Weltchronik nachzueifern. Es enthält rund 240 unterschiedlich große Holzschnitte von 110 verschiedenen Stöcken (ohne die Wappen); »more than
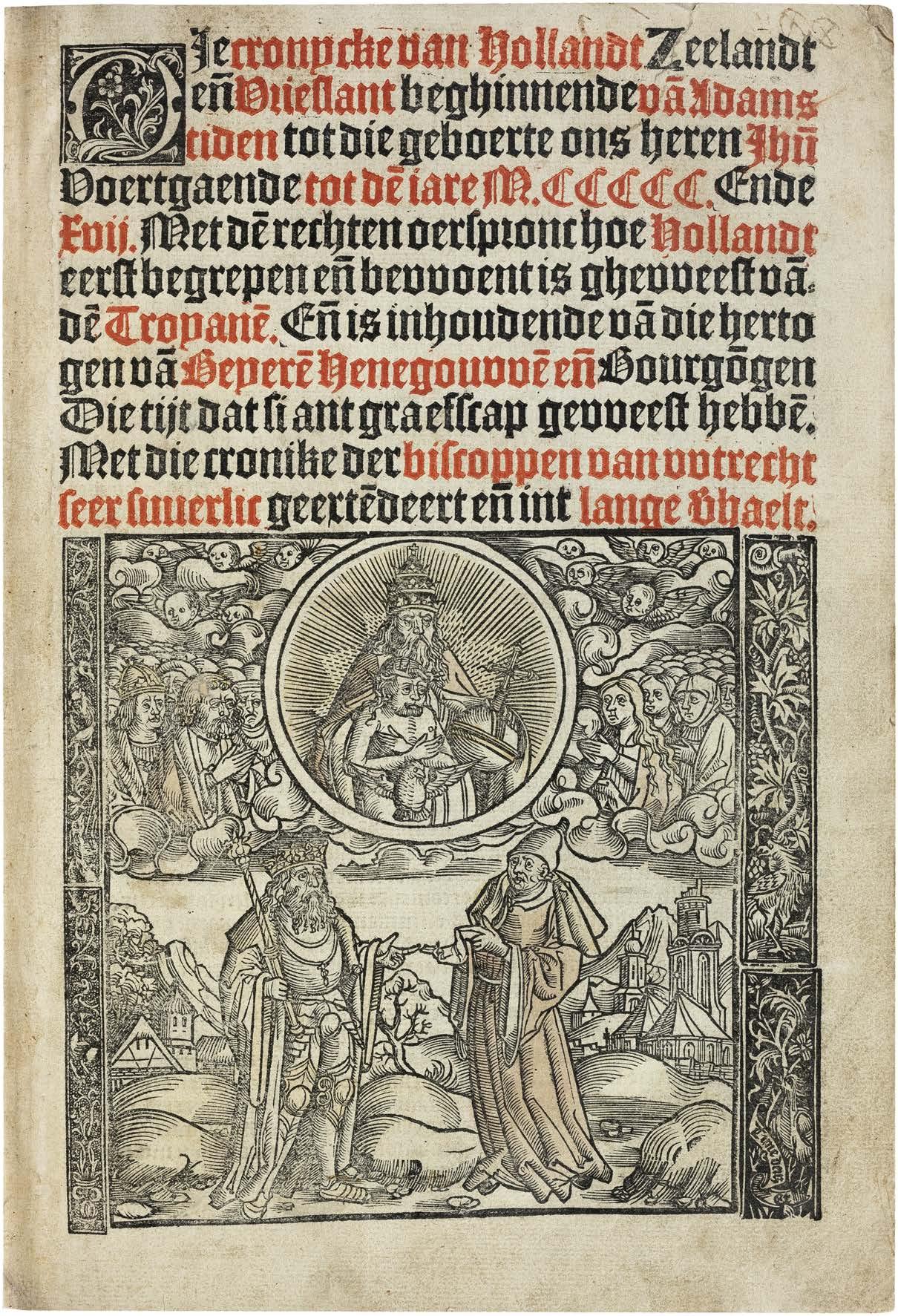
the half« [ebd. 151] von ihnen sind Kopien der Illustrationen Hans Burgkmairs d. Ä. für Schedels Chronik, andere stammen aus dem Chevalier déliberé von Olivier de la Marche von 1486. Geschnitten wurden sie zumeist von Jacob Cornelisz van Ostsanen (um 1470 – 1533), der sich darin »als kerniger Charakteristiker« [Thieme/Becker 7, 28] erweist. Sie zeigen sakrale und Schlachtszenen, Belagerungen, Turniere, Porträts von Rittern und Damen ebenso wie Ansichten von Dordrecht, Egmond, Gorcum, Haarlem, Rijnsburg und Utrecht.
Nur zehn – allerdings meist prominente – Holzschnitte wurden speziell für die Divisiekroniek entworfen; sieben davon (fünf verschiedene) schreibt man heute Lucas van Leyden (1494? – 1533) zu, dem neben Dürer »für die Entwicklung der Druckgraphik im frühen 16. Jahrhundert einflussreichsten Künstler im nördlichen Europa« [Matile 9]; drei seinem Lehrer Cornelis Engelbrechtsz (1468 – 1527) [vgl. Tilmans 94]. Die beiden Holzschnitte von Gottvater und der Madonna in der Mandorla vor dem ersten Kapitel [Bl. 3r] stammen ebenso von Lucas van Leyden wie das fast seitenlange ganzfigurige Porträt des Grafen Dirk I. von Holland [Bl. 96r, auf Bl. 149r ohne Banner wiederholt], außerdem die Porträts von Bonifatius [Bl. 59v] und Herzog Pippin von Brabant [Bl. 50v und 214r; Friedländer 33]. Hollstein hatte ihm auch das Brustbild Karls V. [Bl. 432v, Hollstein, Dutch X, 109] sowie vier weitere Illustrationen zugeordnet, die zuvor schon in Erbauungsbüchern gedruckt worden waren: Porträts der Heiligen Katharina und Maria Magdalena [Hollstein, Dutch X, 85-86], die Geburt [Bl. 26v, Hollstein, Dutch X, 13] und die ganzseitige Kreuzigung Christi [Bl. 28r, Hollstein, Dutch X, 32], ein »stattliches Kanonblatt« [Friedländer 32] nach Burgkmair. Von Cornelis Engelbrechtsz sind die Porträts von König Philipp dem Schönen [Bl. 413r] und Herzog Philipp dem Guten von Burgund [Bl. 281r], letzteres »based on the famous painting by Rogier van der Weyden« [Tilmans 148], mit dem der dritte Teil des Werks beginnt. Besondere Aufmerksamkeit verdient Das Wunder der Heiligen Barbara von Gorinchem [Bl. 279v; vgl. Matile Nr. 82], bei dem sich Engelbrechtsz’ Autorschaft nicht nur stilistisch erschließen läßt: Dieser Holzschnitt nimmt als einziger direkt Bezug auf die Erzählung: Demnach wurde 1448 der Metzger Henric Cock von Barbara aus seinem brennenden Haus in das seiner Tochter gebracht, wo er noch die Sterbesakramente empfangen konnte, ehe er seinen Brandverletzungen erlag. »Even the toes which Henric Cock lost on the way«, fanden Eingang in die Darstellung, was darauf schließen läßt, daß der im gleichen Leidener Vorort wie Aurelius ansässige Engelbrechtsz »carved this illustration to the author’s own specifications« [Tilmans 97]. Wohl gleichfalls auf dessen Betreiben wurden das Baumwunder [Bl. 433r] und die Inschrift auf einem 1502 in Leiden gefundenen römischen Ziegel [Bl. 92r] dargestellt. Als Humanist interessierte sich Aurelius für solche archäologischen Funde als »silent witnesses to a glorious past« [Tilmans 98].
Schon Nijhoff und Kronenberg beobachteten vier Varianten der Erstausgabe, von denen laut Tilmans die vierte immer zusammen mit der zweiten und dritten auftritt. In unserem Exemplar sind alle vertreten: Am Ende des ersten Teils [Bl. 92v] wurden die Wappen weggelassen und der Text in die Seitenmitte gerückt [Variante NK I; vgl. Tilmans 147, Fig. 7, und 296]; auf Blatt 2r wurde der Holzschnitt der Erschaffung Evas durch Christus Salvator Mundi ersetzt [ NK II]; auf Bl. 7r und 12r finden sich zwei kleine Schreibvarianten [ NK III]; und auf Blatt 1r stehen Gottvater und Maria anstelle eines Holzschnitts »representing the mankind’s path to heavenly salvation« [Tilmans 113, Fig.









15; NK IV]. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Nebenvarianten, weil einzelne Lagen noch während des Druckvorgangs korrigiert wurden. Wie meist fehlen die letzten vier Blätter mit dem Index.
Karin Tilmans ging davon aus, daß von der ersten Ausgabe nicht mehr als 150 Exemplare gedruckt wurden, von denen nur gut 100 verkauft worden seien, während die Restauflage später in Antwerpen mit einer Ergänzung versehen wurde. Das unsrige gehört demnach zu den sofort verkauften Exemplaren ohne die Fortsetzung, von denen Tilmans 49 ermittelte [vgl. ebd. 292f.]. Die Holzschnitte wurden mehrheitlich nur leicht in Rot und Gelb gehöht; es finden sich kaum Gebrauchsspuren in dem breitrandig und bemerkenswert schön erhaltenen Buch. Im 18. Jahrhundert ließ es Pierre-Jean Borluut (1725 – 1782), seigneur de Noortdonck, binden und mit seinem Wappenexlibris versehen. Dieser stammte aus einem bedeutenden flandrischen Adelsgeschlecht, war Schöffe in Gent und ein bedeutender Bibliophiler. Seine Sammlung historischer und genealogischer Bücher wurde 1782 in Gent versteigert.
Provenienz: Auf Vorblatt gegenüber Titel Besitzvermerk J. F. Van de Velde des 17. Jahrhunderts (laut Berès). – Wappenexlibris mit drei Hirschen und dem Schriftband »groeninghe velt« des Genter Adeligen Pierre-Jean Borluut (1725 – 1782). – Pierre Berès, Pays-Bas anciens (Catalogue 71), Paris 1981, Nr. 79: F 45.000.
Literatur: Adams A 2253 (mit stellenweise abweichenden Lagensignaturen); BM STC Dutch 97; Brunet I, 1888; Ebert 4167; Graesse II , 148; Hollstein, Dutch X; Nijhoff/Kronenberg I, Nr. 613; Rahir 370. – Zu Borluut: Vgl. Rietstap I, 253.
The famous Divisiekroniek of 1517 still embedded Dutch history in the universal history of the world and salvation, but was already committed to the humanist principle of historical truth and written in the vernacular. For the Leiden printer Jan Seversz, the book was his most important work, with which he emulated Schedel’s World Chronicle. In addition to numerous coats of arms, it contains around 240 woodcuts from 110 different blocks, including many copies after Hans Burgkmair the Elder. Ä.; seven (five different) were designed by Lucas van Leyden especially for the Divisiekroniek. The 18th century binding was commissioned by the Ghent nobleman Pierre-Jean Borluut.

[Vergilius Maro, Publius] . Opera Vergiliana docte [et] familiariter exposita: docte quide[m] Bucolica: & Georgica a Seruio. Donato. Mancinello: & Probo nuper addito: cum adnotationib[us] Beroaldinis. Aeneis vero ab ijsde[m] præter Mancinellum & Probu[m] & ab Augustino datho in eius principio: Opusculoru[m] præterea q[uae]da[m] ab Dominico Calderino. Familiariter vero o[mn]ia ta[m] opera q[uam] opuscula ab Iodoco Badio Ascensio. […] Omnia quidem tam Bucolica: Georgica Opusculoru[m]q[ue] no[n]nulla: & Aeneis: q[uam] tertiusdecim[us] a Mapheo Vegio liber: expolitissimis figuris & Imaginibus illustrata. [Titel von Band II:] Aeneis Vergiliana […]. 2 in 1 Bd. Lyon, Iacobus Sacon für Ciriacus Hochperg, 1517.
†10 a-z 8 aa-bb 8 cc 6; †† 8 A-Z8 AA - QQ 8 RR- SS 6 TT10 = 10 Bl., 205 gezählte Bl., 1 leeres Bl.; 8 Bl., 324 gezählte Bl., 10 Bl. – Tabulae dreispaltig, Text meist zweispaltig, Kommentare unter und neben den Haupttext in kleinerer Antiqua-Type gedruckt, mit schmaler Marginalspalte. – Die beiden Titel in Schwarz und Rot gedruckt.
Mit 2 vierteiligen (identischen) architekturalen Titelrahmen, insgesamt 208 textspiegelbreiten (mit einer Ausnahme) Illustrationen und zahlreichen größeren und kleineren Schmuckinitialen, alles in Holzschnitt und original koloriert.
Folio (ca. 325 x ca. 218 mm).
Brauner Kalblederband der Zeit über abgeschrägten Holzdeckeln auf vier Bünde, mit Rahmenwerk aus Blindfileten und Rollenstempeln auf den Deckeln, vorn in Goldprägung »Virgilius« und »151…«, mit vier Messing-Schließbeschlägen (Rücken fachmännisch schlicht erneuert, die beiden Schließbänder fehlend, Vorsätze leimschattig und mit unterlegten Fehlstellen, vorderes fliegendes Vorsatz neu angesetzt, Titel mit ergänzter Eckfehlstelle ohne Bildverlust, Papier leicht gebräunt, erste und letzte 10 Bl. seitlich, teils auch unten angerändert, sonst durchgehender schmaler Feuchtrand, gegen Ende gering wurmspurig, gelegentlich Randein- und -ausrisse, vereinzelt etwas fleckig, häufiger alte Unterstreichungen und knappe Marginalien in brauner und roter Tinte).
Die Werke des bedeutendsten lateinischen Dichters – mit interessanten Rezeptionsspuren
Mit der kommentierten Werkausgabe des Vergil haben wir ein weltliches ›Buch der Bücher‹ vor uns. Denn »dem ganzen Mittelalter galt er nicht allein als der größte römische Dichter, sondern als der Dichter schlechthin« [Taegert 12], und »auch in der Renaissance dauerte die überragende Wertschätzung Vergils fort« [ebd. 13]. Da man ihn als »Verkünder des Heilands« ansah, war ihm ein Platz »neben Patriarchen und Propheten« [ebd. 18] sicher; auch galt er als »Inbegriff der Weis-
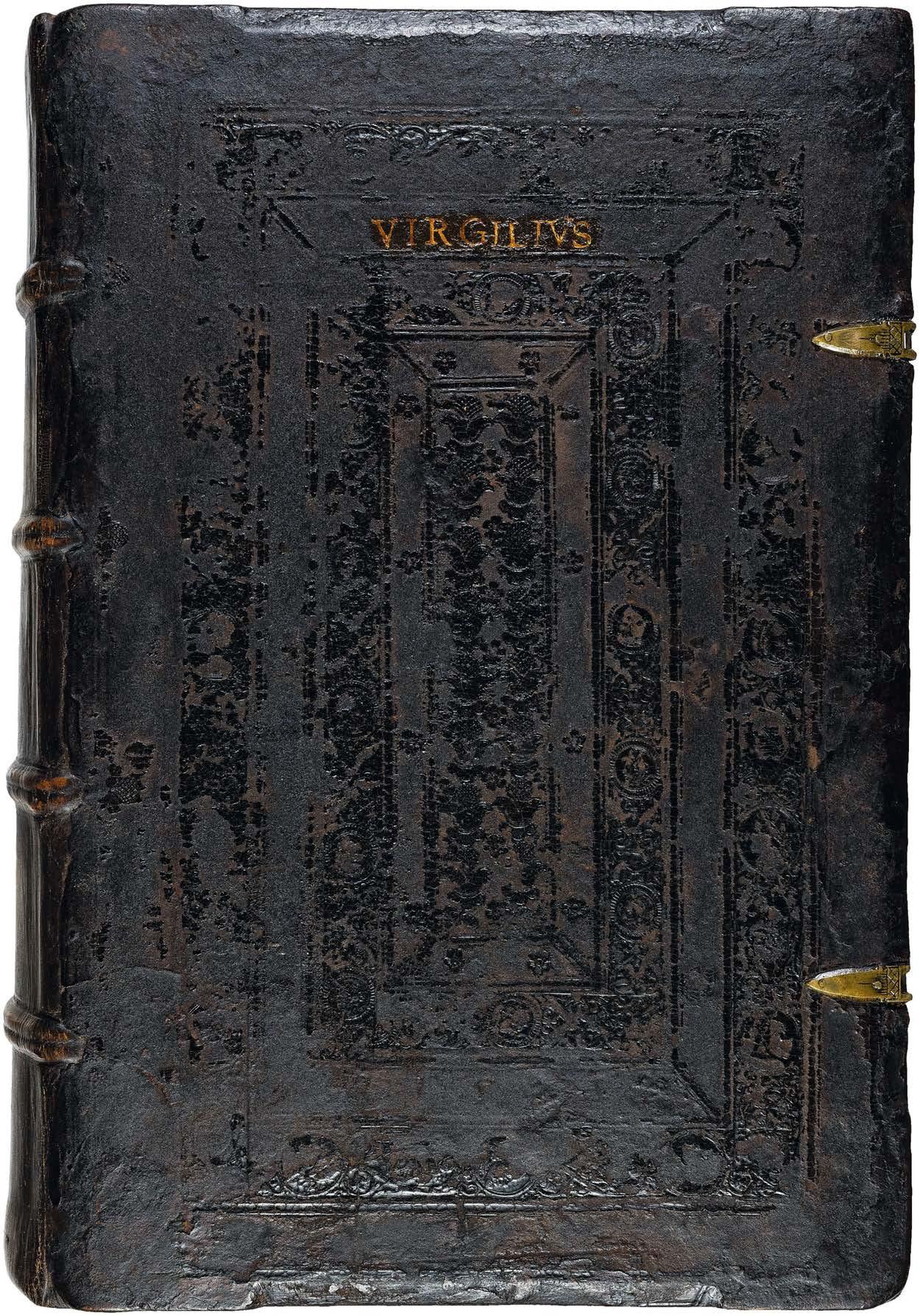



















heit«. Bei den Humanisten bahnte sich ein neues Verhältnis zu Vergil an, der nun »mit nüchternem Verständnis zunächst einmal als Dichter studiert wurde« [ebd. 13]. Die vorliegende Ausgabe wird begleitet von den spätantiken Kommentaren des Servius und des Donatus sowie der Humanisten Antonio Mancinello, Filippo Beroaldo, des Herausgebers Iodocus Badius Ascensius und anderer. Den Auftakt bilden die zehn Bucolica, die Hirtengedichte. Sie stellen ein goldenes Zeitalter vor Augen, schildern »eine Welt friedvoller ländlicher Geborgenheit«. Weiter holt Vergil in den vier Büchern der Georgica aus. Hier zeigt er pragmatisch die Wege zur Erreichung jener »idealen Existenzform« auf und gibt der »mühevollen kultivierenden Landarbeit in der Auseinandersetzung und im Zusammenwirken mit den Kräften der Natur eine Sinndeutung« [ebd. 11]. Der Kampf um eine Heimat wird in der Aeneis – im zweiten Band dieser Ausgabe – in eine (welt)historische Dimension gestellt. Nach dem Fall seiner Vaterstadt Troia gelangt Aeneas nach Latium, wo ein siegreicher Zweikampf gegen den König Turnus den Weg zur Gründung Roms eröffnet. Damit wurde Vergil zum »Künder der imperialen Sendung Roms, die […] in der Friedensherrschaft des Augustus ihre strahlende Vollendung« [ebd.] fand – und an der das »Heilige Römische Reich« des Mittelalters immer wieder Maß nahm. Auch an der ›Vervollkommnung‹ der Aeneis arbeitete sich die Nachwelt ab; die erfolgreichste Fortsetzung schuf 1428 Mapheus Vegius: In einem 13. Buch erzählt er von der Beerdigung des Turnus, der Hochzeit des Aeneas und von seiner durch Jupiter verheißenen Apotheose – analog zur Aufnahme des guten Christen in den Himmel. Das Supplement war »von 1471 an bis in die Mitte des 17. Jhs.« [ebd. 13] regelmäßiger Bestandteil der Ausgaben Vergils. Insgesamt standen dessen drei große Werke für die »drei Stufen der menschl. Kulturentwicklung« [Lex MA VIII , 1525].
Jacques Sacon hatte schon 1499 eine erste Vergil-Ausgabe herausgebracht; für die vorliegende nutzte er als Textbasis die Fassung von Iodocus Badius Ascensius, die erstmals 1500 – 1501 bei Thielman Kerver in Paris gedruckt worden war [vgl. Mortimer], und als Bildmaterial die Holzschnitte der Straßburger Ausgabe von 1502, die Johannes Grüninger ein letztes Mal 1515 in einer deutschen Übersetzung der Aeneis [vgl Mortimer] verwendet hatte (siehe unter Nr. 32 in diesem Katalog unser Ausnahmeexemplar der ersten Ausgabe von 1502). In der Lyoner Edition zeigen sie bereits »signs of wear, several have been split and pieced together« [Mortimer], was angesichts der wundervollen, vielfarbigen und im Auftrag differenzierten zeitgenössischen Kolorierung in keiner Weise ins Gewicht fällt.
Interessanterweise scheint man sich in Straßburg bewußt geblieben zu sein, daß das reizvolle Holzschnittwerk von hier stammte – wohl nicht zuletzt, weil es die heimische Lebenswelt in detailfreudigem Realismus abspiegelte: Jedenfalls weist die frühe Provenienz unseres Exemplars ins Elsaß. Ein Besitzvermerk auf dem Titel wurde zwar ausgestrichelt, doch lassen sich die Worte »Collegii Regis et Seminar« entziffern, die wir – im Abgleich mit dem Besitzvermerk in einem anderen Druck – dem Jesuitenkolleg in Molsheim zuordnen. Die 1580 gegründete Akademie erhielt 1618 das Promotionsrecht; als Zentrum der Gegenreformation im Elsaß war sie zeitweise bedeutender als die Konkurrenz im protestantischen Straßburg. Demnach gehörte die Vergilausgabe zur unentbehrlichen philologischen Grundausstattung der Schule; bemerkenswert ist zudem, daß in dem Exemplar die vierte Ekloge der Bucolica [Bl. 23v-24r] mit der quasi-religiösen Prophezeiung des goldenen
Zeitalters und der Geburt eines Knaben intensiv mit Unterstreichungen, Anmerkungen und einem Notabene-Händchen versehen wurde.
Der Gang durch »verschiedene Hände« spiegelt sich in vier untereinander geschriebenen Vergilzitaten auf der Rückseite des fliegenden Vorsatzes. Die zweite Hand schrieb auf den Titel die Worte, die Aeneas vor seinem Kampf mit Turnus an seinen Sohn Askanius richtete: »Disce puer Virtutem ex me verumq[ue] laborem [/] fortunam ex aliis. Adhort. Aeneae ad filium. pag: 311« [Aeneis 12, 435f.] – »Lerne den Mut, mein Sohn, von mir und wahres Bemühen, aber von andern das Glück«. Offensichtlich ist dies die Mahnung eines Vaters an seinen Sohn, dem er das Buch zum fleißigen Studium ans Herz legt. Tatsächlich unterstrich dieser – die dritte Hand! – die entsprechende Stelle auf Blatt 311v in dunkelroter Tinte. Zugleich markiert die Widmung den Übergang des Buches von der öffentlichen in eine private Sphäre. Wohl deswegen machte der neue Besitzer den älteren Eigentumsvermerk fast völlig unleserlich, und betonte auf der Seite gegenüber »Jure me possidet [/] Johannes Casparus Bitsch. [/] Anno 1686«. Diese Betonung des rechtmäßigen Besitzes war umso eher angebracht, als Johann Kaspar Bitsch (1668 – 1721), der das Buch mit sechzehn Jahren bekam, aus einer angesehenen Straßburger Juristenfamilie stammte, die eng mit der Straßburger Universität verbunden war. Sein Großvater war dort Professor, bei dem sein Vater promovierte. Johann Caspar selbst promovierte 1697 dort ebenfalls in Jura. Später war er Secretarius bei Herzog Christian II . von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld, dann hochgräflich-leiningenscher Kammerrat und Rentmeister, gestorben ist er in Straßburg. Auf dem vorderen Vorsatzblatt notierte er, auch in dunkelroter Tinte, als kurzes Resümee seiner Beschäftigung mit Vergil das vierzeilige »Alcinoi de Vergilio judicium«. Schon der griechische Philosoph Alkinoos, hatte Vergil mit Homer verglichen. Bald nach 1750 rückte man dann »den bislang eher maßvoll beachteten Homer in den Mittelpunkt bewundernden Interesses«, und Vergil mußte »in seinen Schatten treten« [Taegert 14]. Die deutlichen, allerdings absolut fachmännisch restaurierten Gebrauchsspuren verzeiht man dem im originalen Einband erhaltenen Exemplar gern. Unseren Nachforschungen gemäß ist dies das einzige in den letzten 100 Jahren aufgetauchte Exemplar im originalen Kolorit.
Provenienz: Jesuitenkolleg Molsheim im Elsaß – 1686 datierter Besitzeintrag des Straßburger Studenten Johann Kaspar Bitsch (1668 – 1721). Französische Privatsammlung.
Literatur: Adams V 468; Baudrier 12, 344ff.; BM STC French 442; Brun 312; Brunet V, 1282; vgl. Fünf Jahrhunderte 61 (Ausgabe Straßburg 1502); Graesse VI /2, 336; Mambelli 135; Mortimer, French, Nr. 537M; vgl. Muther 557 (Ausgabe Straßburg 1502); Panzer VII , S. 316f., Nr. 337; Renouard 1908, III , 364f.; Schmidt 1883, Nr. 60 (Ausgabe Straßburg 1502); Schweiger II /2 1157.
The Lyon Vergil edition of 1517 in the text version by Iodocus Badius Ascensius (Josse Bade) once again offers the more than 210 Strasbourg woodcuts of the 1502 edition (see no. 32). All of them appear here in equally ravishing and sophisticated contemporary colouring. In Alsace, the illustrations seem to have remained well-known; in any case, the early provenance of the copy preserved in the original binding points to the Jesuit College in Molsheim and the Strasbourg legal family Bitsch. We know of no other originally coloured copy.
Blarru, Pierre de . Insigne Nanceidos opus de bello Nanceiano. Hac primum exaratura elimatissime nuperrime in lucem emissum. Saint-Nicolas de Port, Petrus Jacobi, 1518.
a 8 b-v6 x8 = 130 Bl. – Mit Marginalspalte gedruckt.
Mit 36 Illustrationen (darunter 13 Wiederholungen), einer Bandwerk-Initiale und dem lothringischen Wappen verso Titel, mit Druckermarke und mit einer großen, grotesk-figürlichen Initiale nach dem Vorbild von M. Huss in Lyon [Brun] auf der letzten Seite, ferner mit einigen Schmuckinitialen auf schwarzem Grund, alles in Holzschnitt.
Folio (272 x 195 mm).
Kalblederband des 17. Jahrhunderts auf fünf Bünde, mit dunkelrotem, goldgeprägtem Rückenschild, die Rückenfelder mit doppelten Goldfiletenrahmen und floral-ornamentalen Einzelstempeln; die Deckel mit doppeltem Goldfiletenrahmen und ovalem Wappensupralibros, mit rotem Sprengschnitt (Außengelenke geschickt restauriert, etwas beschabt und fleckig, Vorsätze am Rand etwas leimschattig, Titel- und letzte S. etwas angestaubt, letzte Bl. minimal feuchtrandig, sonst kaum fleckig).
Einer der ersten und schönsten Drucke Lothringens
Selten wurde vom Krieg solenner berichtet als in diesem, schon von De Bure gepriesenen »ouvrage rare et recherché des Curieux«. Das lateinische Epos vom Burgunderkrieg zwischen Karl dem Kühnen und René II . von Lothringen 1475 – 1477 wurde »en belles lettres rondes« [Brunet] mit großzügigem Zeilenabstand und einer breiten Marginalspalte auf kräftiges Papier gedruckt. Die beigegebenen Holzschnitt-Illustrationen »sont d’une belle qualité« [Rahir] und »d’excellente facture« [Brun]. Den Eindruck feierlicher Gemessenheit steigert in unserem Exemplar noch der besonders breite Rand, der auch bei der Neubindung im 17. Jahrhundert belassen wurde.
Im Druckjahr 1518 lagen die kriegerischen Ereignisse bereits mehr als eine Generation zurück –Zeit genug, um sie in ein versöhnliches Licht zu tauchen. Gewidmet ist das Werk Herzog Anton II . von Lothringen (1489 – 1544), der stets die Neutralität seines Landes zwischen Frankreich und Deutschland zu bewahren suchte. Den Beinamen »der Gute« verdankte er seinen »erfolgreichen Bemühungen um den äußeren und inneren Frieden seines Landes« [ NDB 1, 316]. Herausgeber war der Humanist Jean Basin, der von dem Autor Pierre de Blarru (1437 – 1510) testamentarisch mit dieser Aufgabe betraut worden war. Blarru war Rat und Sekretär Herzog Renés, Augenzeuge des Krieges und auch des Begräbnisses des in der Schlacht von Nancy gefallenen Herzogs Karl ge-
Das Epos über die Burgunderkriege und das Ende Karls des Kühnen –aus den Sammlungen Fieubet de Naulac und William Bateman





wesen. Dieses sein Hauptwerk hatte er bereits mit einigem zeitlichen Abstand als Kanoniker in St. Dié um 1500 verfaßt.
Auch wenn das Epos in sechs Büchern und 5044 Versen den Sieg der Lothringer über die Burgunder feiert, zeugt die noble Gestaltung von Respekt auch gegenüber dem unterlegenen Gegner. Unverzichtbar war gewiß das triumphale Titelbild, das »Renatus. Lothoringiae Dux« zeigt, wie er in Prunkrüstung und mit hoch erhobenem Schwert auf einem Pferd einhersprengt – kein statuarisches Reiterstandbild, sondern Ausdruck energischer Kraft und Macht. Zum Beginn des Liber primus teilen sich jedoch zwei ›Mannschaftsaufstellungen‹ gleichberechtigt eine ganze Bildseite. An ihrem ›Trikot‹ sind die Truppen erkennbar: Im unteren Holzschnitt überall das weiße Burgunderkreuz, im oberen das schwarze Kreuz der Lothringer, die letztlich die Oberhand behielten. Die folgenden Illustrationen, die aus stilistischen Gründen dem Lothringer Künstler Gabriel Salmon zugeschrieben werden, zeigen den Verlauf des Krieges; die Hauptserie besteht aus 14 Stöcken in insgesamt 27 Abdrucken; drei weitere Stöcke wurden wohl für ein anderes Buch geschnitten [vgl. Mortimer]. Der letzte Holzschnitt des Liber sextus erweist allerdings dem Verlierer die Reverenz: Er zeigt das von Trauernden umstandene Grabmal, auf dem Karl der Kühne als vollplastische Figur mit gefalteten Händen und Schwert am Gürtel ruht; zwei treue Hündchen am Kopf- und Fußende der Grabplatte.
Tatsächlich blieb die Freude Renés II . von Lothringen (1451 – 1508) am Sieg über die konkurrierende ›Mittelmacht‹ Burgund nicht ungetrübt, geriet er im Zuge des Krieges doch zwischen die Fronten des größeren Konflikts mit dem französischen König Ludwig XI ., in dem er mehrmals die Seite wechselte. Die Entscheidungsschlacht von Nancy am 4./5. Januar 1477 hatte ihm sein zeitweise verlorenes Land wiedergegeben, »aber alle weitern sich daran knüpfenden Erfolge nahm ihm König Ludwig vorweg, der das burgundische Erbe mit Beschlag belegte«, und »überall kam Ludwig XI . den Anschlägen René’s zuvor«. So erreichte »sein unruhiger Ehrgeiz […] nirgends sein Ziel« [ADB 28, 210] – sein Sohn Anton II ., zwischen Frankreich und Deutschland weitgehend auf sich allein gestellt, reagierte darauf mit einer dezidierten Politik des Ausgleichs.
Das Buch erschien erstmals mit einem auf der Titelrückseite abgedruckten Privileg Antons vom 4. September 1518, in einem zweiten Tirage nochmals Anfang 1519. Dafür wurde einfach ein verändertes Privileg vom 21. Februar 1518 [= 1519] über das vorige montiert, wie Mortimer es für das Harvard-Exemplar beschrieb. Bei dem unsrigen wurde das neue Privileg sorgsam abgelöst und separat beigelegt. Auch der Drucker Petrus Jacobi, war sich seines Anteils an der patriotischen Gedenkkultur wohlbewußt – das Buch stellt einen der frühesten und zugleich einen der schönsten Lothringer Drucke dar. Jacobis von zwei Engeln gehaltenes Wappen findet sich am Ende des Textes. Wohl nicht zufällig hatte er sich nicht in der Hauptstadt Nancy, sondern einige Kilometer südöstlich in Saint-Nicolas de Port angesiedelt: Hier hatte René vor der Entscheidungsschlacht im Januar 1477 seine Armee versammelt und »durch seinen unerwarteten Angriff die burgundische Aufstellung völlig« zersprengt; hier hatte er ab 1481 zum Dank für den Sieg eine beeindruckende Basilika bauen lassen, deren 28 Meter hohe Kirchenschiffsäulen die höchsten in Frankreich sind. Und hier erschien nun das Opus de bello Nanceiano – als ein gedrucktes Monument des Krieges und Sieges, das zuallererst lokalpatriotische Wallfahrer erwerben konnten. Der Titel trägt den leider von uns
nicht lesbaren zeitgenössischen Namensvermerk eines Adeligen (»de«) der wenige kleine, anscheinend kundige Verbesserungen im Text anbrachte. In Adelsbesitz blieb das Buch: Das Wappensupralibros zeichnet den Band als Besitz von Gaspard III Fieubet de Naulac (1626 – 1694) aus, »conseiller au Parlement de Paris en 1649, maître des requêtes le 30 avril 1654, puis conseiller d’Etat ordinaire et chancelier de la reine Marie-Thérèse« [Olivier 252] und bedeutender Bibliophile. Wenig später brachte William 1st Viscount Bateman (1695 – 1744) sein Wappen auf dem Spiegel an. Das Buch blieb über 150 Jahre in Familienbesitz, ehe es 1893 in London zur Versteigerung aufgerufen wurde. Provenienz: Zeitgenössischer Namensvermerk "Johannes de Mandeville" (!) auf dem Titel und wenige kleine Korrekturen evtl. von derselben Hand. – Wappensupralibros von Gaspard III Fieubet de Naulac (1626 – 1694) [Olivier 252, Guigard II , 115]. – Auf dem Spiegel gestochenes Wappen von William 1st Viscount Bateman (Sale 25.5.1893). – Anderson Galleries, Auktion 3800, New York 1929, Nr. 192.
Literatur: Adams B 2103; BM STC French 70; Brun 135; Brunet I, 965; De Bure, Belles-Lettres, III , 431f., Nr. 2926; Ebert 2463; Graesse I, 438; Hain 3236 (»a. 1476 non impressionis, sed belli peracti videtur«); Lonchamp, Français II , 55; Mortimer, French, Nr. 102; Rahir 324.
The Latin epic poem about the Burgundian War 1475 - 1477 between Charles the Bold and René II of Lorraine is one of the first and most beautiful works in Lorraine. Written by René’s secretary Pierre de Blarru around 1500 and illustrated with beautiful woodcuts by Gabriel Salmon, the work was published in 1518 in Saint-Nicolas de Porte, the starting point of the decisive battle, where the duke of Lorraine had an impressive memorial church built - the solemn book is its printed counterpart. The 17th century binding bears the coat of arms supralibros of the French statesman Gaspard III Fieubet de Naulac.
[Isenberg, Walter] . Wie die mechtige Erbkünigreich vnnd Fürstentumb Hispania. Hunngern vnnd Gelldern/ zu den loblichen heüsern Osterreich vn[d] Burgundi kommen sein biß auf vnsern Allergnedigisten herrn/ herrn Karl Erwölten Römischen vn[d] Hispanischen sc. Künigen Ertzhertzogen zu Osterreich. Hertzogen zu Burgundi. Als den rechten natürlichen Erbherrn/ derselben Erbkünigreichen/ mit vil ergangen schönen geschichten/ so dan[n] von hochloblicher gedechtnuß von Kayser. Künig. Fürsten vnd herrn/ inkurz vergangen jarn beschehen ist. Augsburg, Johann Schönsperger, 1520.
A 4 B-E6 F4 = 32 Bl. – Die Lage A mit den Blättern 2-5, so komplett.
Mit großem Titelholzschnitt und 23 Textholzschnitten (von 19 Stöcken), ferner mit einigen gedruckten Schnörkeln, mit Lombarden und Paragraphenzeichen, teils mit Ausläufern.
Folio, mit Témoins (272 x ca. 191 mm).
Moderner Pergamentband mit handschriftlichem Titel am Kopf und zwei ledernen Schließbändern (Deckel etwas aufgebogen, leicht fingerfleckig, gelegentlich kaum wahrnehmbarer Feuchtrand).
Ein reich illustriertes Gedenkbuch an die Königswahl von 1519
Dieses schöne Augsburger Holzschnittbuch ist eines der letzten Werke Johann Schönspergers, des Druckers Kaiser Maximilians I., der 1517 und 1519 die ersten beiden Ausgaben des Theuerdank herausgebracht hatte. An das bibliophile Monumentalwerk lehnt sich auch die Gestaltung dieses schmalen Hefts an: durch gedruckte Schnörkel und federwerkartige Ausläufer bei Initialen und Paragraphenzeichen, vor allem aber durch die Bebilderung mit großen Holzschnitten. Auch inhaltlich versucht es, die durch Maximilians Hinscheiden im Jahr 1519 abgerissenen Fäden wieder aufzunehmen: Die Gedenkschrift zur Wahl seines Enkels Karls V. zum römisch-deutschen König ist diesem gewidmet und erzählt von der Geschichte der Vereinigung Burgunds und Habsburgs und dem Anfall der Erbkünigreich vnnd Fürstentumb Hispania. Hunngern vnnd Gelldern – also vom Aufstieg der Habsburger zu europäischer Geltung, deren Erbe Karl V. nun antrat. Autor war der »Burger zu Memmingen« Walter Isenberg, »kriegß secretari« Maximilians, der sich in der Umbruchssituation dem fernen Monarchen wohl selbst ins Gedächtnis bringen wollte. Dieser konnte das Werk allerdings nicht lesen: Der in Flandern aufgewachsene Karl beherrschte Niederländisch, Französisch und Latein, kaum jedoch Deutsch.
Doch ist das Buch reich bebildert: In jeder Hinsicht herausstechend ist der zweidrittelseitige Titelholzschnitt, der in der oberen Hälfte das halbfigurige Porträt Karls V. mit Szepter und der Kette des Ordens vom goldenen Vlies zeigt, darunter den Reichsadler. Bordürenartig eingerahmt wird
Ein sehr seltenes Augsburger Holzschnittbuch, gewidmet Karl V. aus Anlaß seiner Königswahl





die Darstellung von zahlreichen kaiserlichen Wappen. Der Augsburger Künstler, von dem weitere Blätter »bisher nicht nachgewiesen« [Geisberg] sind, arbeitete »nach Weiditz« [ebd., Nr. 799], die Zeichnung ist sichtlich feiner als die der übrigen Holzschnitte, gleichfalls »Augsburger Illustrationen unbekannter Meister« [Muther]. Zur Widmungsvorrede Isenbergs ist zu sehen, wie der Autor dem auf dem Thron sitzenden König sein Buch überreicht.
Die Darstellung der Historie beginnt mit einer Art erzählerischem Binnenrahmen: Wir sehen Herzog Karl den Kühnen von Burgund, wie er seiner Erbtochter Maria die eigene Lebensgeschichte mitteilt, die einen relativ breiten Raum einnimmt. Sie beginnt mit der Ankunft einer »Englisch Botschaft […] I[h]m zu uermehlen des Künigs von Engellants Thochter«, Margarethe von York. Die nächsten Holzschnitte zeigen, wie diese im Jahr 1468 in Flandern an Land geht und von Ordensrittern empfangen wird, wie sie nach Brügge zieht und wie sie dort von ihrem Bräutigam in Empfang genommen wird. Die Hochzeit illustrieren eine Festtafel, ein Lanzenstechen und eine »lustige« Jagd, die mit der Abreise der englischen Gäste zu Schiff kombiniert ist. Dann wird es ernst: Karl der Kühne zieht gegen Geldern, Kaiser Friedrich III . wiederum vor das von jenem belagerte Neuss; dann stirbt Karl in der Schlacht von Nancy 1477 – ein alter Ritter verkündet Maria dessen Tod. Zu diesem Zweck wird der Holzschnitt, der eingangs Vater und Tochter zeigte, in einem zweiten Zustand wiederholt: »Der Kopf des Königs ist durch einen jugendlichen Kopf mit einem Holzstöckchen von 15 : 13 mm ersetzt«. Wohl erst später bemerkte man, daß dieser Ersatz unpassend war, jedenfalls existiert noch ein »dritter Zustand: ein anderes Holzstöckchen ist eingefügt, das wieder einen bärtigen Kopf, aber mit geteiltem Barte zeigt« [Geisberg 801].
Nun greift Maximilian in die Geschichte ein: Der junge Erzherzog bittet seinen Vater um Erlaubnis zur Heirat und wird von seiner Braut Maria in den Niederlanden empfangen. Dann aber muß Friedrich III . – wie zuvor nach Neuss, der Holzschnitt ist der gleiche – ausziehen, um seinen Sohn 1488 aus der Hand flandrischer Aufständischer zu befreien. Dieser dankt es mit seinem Zug gegen die Ungarn. Die nächste Generation meldet sich an: Eine Gesandtschaft spricht wegen der Heirat von Maximilians Sohn Philipp mit der spanischen Infantin Johanna vor (der Holzschnitt ist mit dem der früheren Werbungsszene identisch); die Brautleute segeln nach Spanien (eine Wiederholung der Abreise der Engländer), doch Philipp stirbt bereits 1506. Nun treten die Enkel Maximilians auf den Plan: Ein Seestück steht für die Abreise Karls nach Spanien und Ferdinands in die Niederlande, so daß die Nachfolger bereitstehen, als Maximilian 1519 stirbt: Der Stock ist derselbe, der auch Philipps Tod darstellte. Mit dem letzten Holzschnitt schließt sich der Kreis zum Eingangsbild: Er zeigt Karl V. bei seiner Königswahl in Frankfurt 1519 auf dem Thron.
Es ist bemerkenswert, wie es gelingt, die dynastische Geschichte von vier Generationen in nur 24 Holzschnitten anschaulich werden zu lassen. Daß sich darunter vier Wiederholungen finden, scheint nicht so sehr der Ressourcenknappheit geschuldet als einer bewußten Erzähl-Ökonomie: In der Abfolge der Generationen unterstreicht es nur die Legitimität der translatio imperii, wenn sich die Bilder gleichen. Allein Karl V. ist davon nicht betroffen: Er steht singulär an Anfang und Ende des Huldigungswerks; auf ihn als König europäischen Formats läuft die Geschichte zu. Auch durch das dadurch vermittelte, strikt zeitgenössische Geschichtsbild ist das Buch aus der von Maximilian privilegierten Augsburger Druckerei von großem historischen Interesse.


Dies ist die einzige Ausgabe des laut Zapf schon im 18. Jahrhundert selten gewordenen, heute kaum auffindbaren Werks. Hinweise auf die Provenienz finden sich nicht, vielmehr wurde die eigene Aura des Werks stets respektiert: Es präsentiert sich wohl erhalten als kaum beschnittenes, sehr breitrandiges Exemplar in einem stilgerechten Pergamentband.
Literatur: Nicht bei Adams, in BM STC German, bei Brunet und Ebert; Geisberg, Nr. 799-816; Graesse III , 431; Hiler 468; Lipperheide Cg 13; Muther 957; nicht bei nicht bei Panzer und Proctor; Schottenloher, Bibliographie III , 31604; VD 16 I 346; Zapf II , S. 144, Nr. XLIII .
This beautiful Augsburg woodcut book from 1520 is one of the last prints by Johann Schönsperger, who had published the Theuerdank (see n°21) of Emperor Maximilian I shortly before. The typographical design and the 23 large woodcuts illustrating the history of the Habsburgs from Maximilian’s acquisition of Burgundy to Charles V’s election as king in 1519 highlight the rank of this booklet. The author, Walter Isenberg, a secretary of Maximilian, probably wanted to personally remind the new monarch of himself with this commemorative book, which is very rare today.



Lichtenberger, Johannes . Practica Meyster Johannen Liechtenbergers/ auff eyn news ersehen/ vnd weß im vorigen truck/ auß mangel deß alten exemplars versaumpt/ ist ietz zum aller verstendtlichsten widerumb erstattet/ Werende biß man schreiben wirt/ nach Christi geburt M. D. lxvij. Worms, [Peter Schöffer] 1528.
A-R 4 = 88 Bl.
Mit 45 großen Holzschnitten.
Klein-Quart (194 x 142 mm).
Schlichter neuer Pergamentband (im oberen Bereich durchgehende schwache Feuchtigkeitsspur).
Provenienz: Deutsche Privatsammlung.
[Lichtenberger, Johannes] . DI se Practica und Prenostication/ ist getruckt worden zu Mentz im M. CCCC . XCII . Jar. Vnd werdt biß man zelt/ M.D. LXVII . Jar. Darinn ain yeder mensch abnemen vnnd erkennen mag/ wie die vergangen zeytt / auch yetz die gegenwertig in diser Practica zutrifft/ Vnd darneben zubesorgen / wie hierinn künfftigs zukhommen mag / Doch Gott ist alle ding müglich. [Augsburg, Heinrich Steiner], 1534.
A-H6 = 48 Bl.
Mit 2 ganzseitigen und 44 halbseitigen Holzschnitten (davon der Titelholzschnitt wiederholt) von Jörg Breu d. Ä.
Folio (277 x 188 mm).
Roter Maroquinband des späten 19. Jahrhunderts auf fünf mit Goldfileten verzierte und von doppelten Goldfileten begleitete Bünde, mit goldgeprägtem Titel und Erscheinungsdaten in zwei sowie floralem Einzelstempel in den übrigen Rückenfeldern; auf den Deckeln dreifacher Goldfiletenrahmen mit nach innen gewandten Eckfleurons; mit doppelten Goldfileten auf den Steh-, Dentellebordüre auf den Innenkanten und Ganzgoldschnitt (Vorsätze am Rand leimschattig, kaum fleckig, anfangs ein, zum Ende hin mehrere Wurmlöcher, Bl. B1 und B6 mit etwas Bild- und Textverlust gut restauriert, einige unscheinbar hinterlegte Randläsuren).
Weitreichende Zukunftsaussichten
Zwei seltene Ausgaben der seit 1488 oftmals aufgelegten Prognostik des Hofastrologen Kaiser Friedrichs III ., Johannes Lichtenberger (um 1426 – 1503), liegen vor uns. Betrachten wir zunächst den jüngeren Druck von 1534. Was für ein rätselhaftes Titelbild – und wie ominös die Erläuterung, die



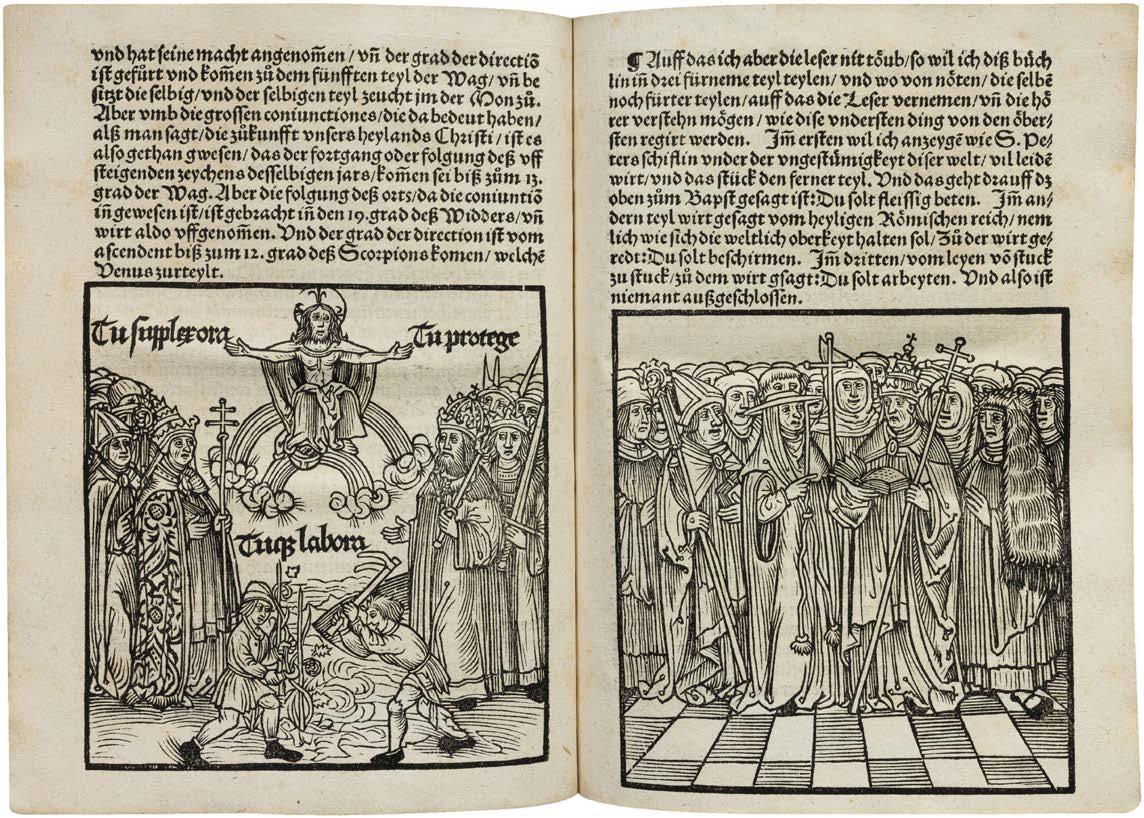







seiner Wiederholung beigegeben ist: »ein alter gebückter/bartechter/hinckender man[n] […] ligt auff einem man[n]e der hat einen ochsen bey den hörnern […] gleych als er ihn erwürgen wolt« [A5v].
Dargestellt ist das Zusammentreffen der Planeten Saturn und Jupiter im Zeichen des Skorpions im November 1484, das Lichtenberger in Verbindung mit einer bald folgenden Sonnenfinsternis als so gravierende Konstellation wahrnahm, daß er daraus Vorhersagen ableitete, die in ihrer thematischen und zeitlichen Reichweite nachhaltiges Aufsehen erregten. Auf dem Titel der Ausgabe von 1528 sieht man den Autor selbst, beide Hände zu einer expressiven Geste ausgestreckt.
Zunächst sichert Lichtenberger sich selbst ab: In der Vorrede beteuert er, daß seine Prophezeiungen nicht im Gegensatz zur göttlichen Vorsehung stünden, sondern daß er diese vielmehr zu erkunden versuche. Dabei beruft er sich auf Autoritäten aus allen Zeiten und Kulturkreisen: auf die Griechen Aristoteles und Ptolemäus, auf die römische Sibilla, auf die heilige Birgitta von Schweden und einen Bruder Reynhard Lolhard – sie alle sind in beiden Ausgaben auf dem zweiten, ganzseitigen Holzschnitt unter den Augen des himmlischen Vaters einträchtig ins Gespräch vertieft. Konkret hielt Lichtenberger sich an kurz zuvor erschienene Traktate von Eberhard Schleusinger und Paul von Middelburg, der ihn darum des Plagiats bezichtigte. Die Vorstücke enden jeweils mit einem »gebett des Maysters diß büchlins«, dem ein halbseitiger Holzschnitt gewidmet ist. Schließlich folgt auf die irritierende Darstellung des Zusammentreffens der Planeten wie zur Beruhigung der Gemüter ein Bild, das die Ordnung der Welt veranschaulicht: Gott sitzt auf einem Regen- oder Triumphbogen, der von Papst und Kaiser flankiert wird; im Vordergrund bearbeiten zwei Bauern im Schweiße ihres Angesichts den Erdboden.
Dieser gottgegebenen Ständeordnung folgt auch die Dreiteilung des Buches, wobei das Hauptaugenmerk Kaiser und Reich gilt: »A distinguishing feature of Lichtenberger’s prognostication is that it is evidently intended for German consumption. Its political predictions are largely for the Holy Roman Empire, its electors, and the adjoining states of central Europe« [Thorndike 477]. Die Thematisierung des Umgangs mit dem konkurrierenden Frankreich, mit böhmischen Ketzern und der türkischen Bedrohung, verbunden mit politischen Reformvorschlägen im Sinne des Kaisers, sicherten dem erstmals 1488 gedruckten Buch eine hohe Popularität und zahlreiche Auflagen in lateinischer wie deutscher Sprache. Das Auftreten Luthers und die Bauernaufstände luden den Text im 16. Jahrhundert mit neuer Bedeutung auf [vgl. ebd. 476], hatte Lichtenberger doch auch das Erscheinen eines »kleinen Propheten« geweissagt, der eine Reform der Kirche einleiten werde – im Streit der Meinungen gab sogar Luther selbst 1527 eine von ihm bevorwortete deutsche Ausgabe heraus. Da sich die Prophezeiungen bis auf das Jahr 1567 erstreckten, war auch das weitere Interesse gesichert, wie unsere beiden Ausgaben belegen. Überhaupt enthielt die Abhandlung »a little of almost everything, a fact which may account for its popularity. Lichtenberger dips into past as well as future […]. Present political and religious opinion is also freely expressed. […] He rails against the Jews for not accepting Christianity and seems to criticize the introduction of Roman law into Germany. […] Even alchemy is introduced into the discussion« [ebd. 479].
Auch die zahlreichen großen Holzschnitte sicherten den Erfolg des Buches. Dank dieser anschaulichen Rätselbilder zu den einzelnen Abschnitten machte »die Schrift auch auf jene, welche sie nicht lesen


konnten, den entsprechenden Eindruck« [Muther, S. 105]. Lichtenberger selbst hatte die Anweisungen zu den Inhalten vorgegeben, die in der Ausgabe von 1534 ausführlicher wiedergegeben werden. Ein Bild zeigt ein Kirchen-Schiff in dramatischer Seenot, ein anderes den kaiserlichen »Adler gantz traurig« und »mit wenig federn«, aber immerhin: »bey ihm stehet auch ein junger Adler« [B6]. Doch schon auf der nächsten Seite »scheucht ein Wolff mit auffgesperrtem rachen den Adler« [B6v]. Für die einzelnen Ausgaben wurden verschiedene Künstler herangezogen, die die Vorgaben jeweils auf eigene Weise umsetzten. Die Holzschnitte der Ausgabe von 1528 präsentieren sich in hervorragenden, kräftigen Abdrucken – doch weisen sie in ihrer schlichten Linearität ins 15. Jahrhundert zurück. Interessant ist der Vergleich mit der Folge in dem sechs Jahre später erschienenen Druck, die »wohl 1525 zum ersten Mal« publiziert worden war. Auch diese geht auf die »Illustrationen des am 20. Juli 1492 zu Mainz vollendeten Originals« zurück, doch ist sie ungleich ausdrucksvoller. Die Schnitte von Jörg Breu d. Ä. (um 1475/80 – 1537) gehören »zu den besten der mittleren Zeit des Künstlers« und dürfen »fast als Neuschöpfungen betrachtet werden« [Röttinger 1908, S. 51].
Die beiden sehr seltenen Ausgaben sind den meisten Bibliographen unbekannt geblieben, über ihre Provenienz geben unsere Exemplare nichts preis.
Literatur: Beide Ausgaben nicht bei Adams, in BM STC German und bei Brunet; Durling 2816 (Ausgabe 1534); nicht bei Ebert und Graesse; VD 16 L 1600 (Ausgabe 1528) bzw. VD 16 ZV 17889 (Ausgabe 1534); nicht bei Zinner; der Wormser Druck nicht bei Roth. – Zu Lichtenberger vgl. Thorndike IV, 473-480.
The court astrologer of Emperor Frederick III, Johannes Lichtenberger, had his far-reaching prophecies printed for the first time in 1488. They were given new meaning in the unsettling context of the Reformation, the Peasants’ War and the ongoing Turkish threat. This is evidenced by the two richly illustrated editions (with 45 and 46 large woodcuts respectively) of 1528 and 1534, which are so rare that they have remained unknown to most bibliographers.


Rüxner, Georg. Anfang : ursprung : unnd herkom[m]en des Thurnirs in Teutscher nation. Wieuil Thurnier biß vff den letsten zu[o] Worms / auch wie / vnd an welchen ortten die gehalten / vnd durch was Fürstenn / Grauen / Herrn / Ritter vnnd vom Adel / sie ieder zeit bsu[o]cht worden sindt. Zu[o] lobwirdiger gedechtnuß Römischer Keyserlicher Maiestat / vnnsers allergnedigsten Herrn / vnd alles Teutschen Adels / Hohen und Nidern stands voreltern / außgangen. Simmern, Hieronimus Rodler, 1530.
Π 8 a-g6 h7 i-z 6 aa-zz 6 A aa-X xx6 Π 6 = 8 Bl., 402 gezählte Bl., 6 Bl. (Register, das letzte leer). –Das mit h2 bezeichnete Blatt ist eine einmontierte Falttafel, die nicht in der Blattzählung enthalten ist.
Mit großer Titelinitiale »A« zu »Anfang«, ganzseitigem Reichswappen verso Titel und ganzseitigem Wappen am Ende der Vorstücke, einer Falttafel, 135 meist halb-, öfters auch zweidrittel- und ganzseitigen Illustrationen (oft mehrfach wiederholt, 16 große zusammengesetzt), 247 Wappen (36mal zu Fünfergruppen zusammengestellt) und abschließender Druckermarke, sämtlich in Holzschnitt. – Mit zahlreichen unausgefüllten Initialspatien mit Platzhaltern.
Folio (319 x ca. 208 mm).
Dekorativer Schweinslederband des 16. Jahrhunderts über Holzdeckeln auf sechs Bünde, mit Resten eines handschriftlichen Rückentitels; die Deckel mit reicher Blindprägung von Streicheisenlinien und Rollenstempeln; mit ziselierten Messing-Eckbuckelbeschlägen und -Schließen (Einband berieben und teils etwas nachgedunkelt, zwei Eckbeschläge mit minimalen Absplitterungen, Vorsätze neu, Falttafel in etwas kleinerem Format hinzugefügt, einige Bl. am Rand behutsam restauriert, hin und wieder Abklatsch von Druckerschwärze).
Eine letzte Selbstbespiegelung des Rittertums
Herzog Johann II . von Pfalz-Simmern (1492 – 1557) – auch »Herzog Hans vom Hunsrück« genannt – herrschte nur über ein kleines Territorium, stammte allerdings in direkter Linie von König Ruprecht von der Pfalz ab. Sein Schwiegervater war ein Cousin Kaiser Maximilians I. und mit diesem auch politisch eng verbunden. Wie dieser der Wissenschaft und Kunst zugeneigt, richtete Johann II . im Schloß zu Simmern eine Druckerei unter der Leitung seines Sekretärs Hieronymus Rodler ein, die zwischen 1530 und 1535 »einige prachtvoll ausgestattete Werke, meist aus der ritterlichen Sphäre« [ NDB 10, 510] produzierte – als erstes dieses Turnierbuch von Georg Rüxner. Gedruckt wurde es in der großen Neudörfferschen Dürer-Fraktur, einer der ersten Frakturtypen in der Nachfolge der Theuerdank-Type; Initialen sollten wie in einer Handschrift nachgetragen werden.
Die Erstausgabe von Rüxners Turnierbuch mit Hunderten von Holzschnitten






Gleich zu Beginn der Widmung an seinen Auftraggeber meldet sich der Autor selbstbewußt als »Georg Rüxner gnannt Hierusalem Eraldo und Khündiger der Wappenñ« [Bl. 1r], um am Schluß zu erklären, daß »Herolden nach lateinischer sprach Heroes /nach Hochteutscher sprach /Ernholden« [Bl. 6v] seien – so hieß schon der ständige Begleiter Maximilians im Theuerdank, und möglicherweise hatte Rüxner bereits für Maximilian als Herold geamtet. Nun diente er sich Johann II . von Simmern an, der als Herausgeber des Turnierbuchs selbst in die Fußstapfen des vermeintlich »letzten Ritters« trat: Schon Maximilian wollte das ritterliche Turnierwesen neu beleben, wovon sein Turnierbuch Freydal zeugte, das allerdings unvollendet blieb. Anders als Maximilian, der sich mit seinem alter ego Freydal selbst als den besten aller Ritter inszenieren wollte, kam es Rüxner und dem Herzog weniger auf die Turnierkämpfe selbst an als auf die Bestätigung ihrer gesellschaftlichen Grundlagen aus ihrem »Ursprung« und »Herkommen«: Es geht zum einen um die erschöpfende Dokumentation, zum anderen um die prinzipielle Frage, wer an Ritterturnieren teilnehmen und damit an den Privilegien einer aristokratischen Gesellschaft teilhaben durfte, die sich trotz aller Beharrungskräfte in stetem Wandel befand: Geschlechter starben aus, stiegen empor, landständischer Adel und Reichsritterschaft spalteten sich auf [vgl. Moeller 81], von unten drängte das selbstbewußte Stadtbürgertum nach.
Die »ordnu[n]g des hochlöblichen Ritterspils das gnant wirdt ein Thurnir«, entnahm Rüxner einem Tracträtlin des Bürgers Marx Wirsung, bei dem jedoch »etlicher mißbreuch der geschlecht« [Bl. 1r] getrieben würde, weshalb er »auß phlichten schuldig [sei] / dieselben zu corrigirn und endern / nach erkentnus des rechten Originals«. Dazu wiederum habe ihm der Vikar des Magdeburger Moritzstifts Johann Kirchberger eine niederdeutsche Schrift vorgelegt, die er »auß irem kurtze[n] Teutsch mit grosser mühe vnnd arbeit in diß hoch deutsch gebracht« [ebd.]. Anschließend warf Kirchberger das Heft jedoch »in meinem ansehenn jn ein feuer / darumb ich weyß solch Ritterspil von nymandt anderm dan mir / in diß hoch teutsch gezüng verwandelt vnd an tag bracht ist« [Bl. 1v]. Die Vernichtung des Originals im Anschluß an seine ›Rettung‹ hat eine interessante Parallele in einer ›Kulturtat‹ Maximilians, der im Ambraser Heldenbuch ebenfalls hochmittelalterliche Texte versammelte, deren unikale Quellen seitdem spurlos verschwunden sind.
Die Forschung geht davon aus, daß die ersten 14 Turniere frei erfunden, die Angaben ab dem 15. aber im wesentlichen vertrauenswürdig sind. Besitzt Rüxner gleichsam ein ›Wahrheits-Monopol‹ auf den Text, so ist Johann II . von Simmern in genealogischer Hinsicht rechtmäßiger ›Erbe‹ der angeblich 938 von König Heinrich I. mit dem ersten Turnier in Magdeburg gestifteten Tradition: über seinen gleichnamigen Großonkel Johann von Pfalz-Simmern, der ab 1464 Erzbischof von Magdeburg gewesen war. Und Rüxner beobachtet noch eine andere Kontinuität über alle 36 beschriebenen Turniere hinweg, daß er nämlich des Herzogs »voreltern von rechtem geblüt der swerdt seite[n] halb [recte: hab] souil vñ offt in disem ritterspil funden / von dem erste[n] biß vf den letstgehalte[n] thurnir zu Worms am Reine« [Bl. 2r]. An der Genealogie des Herzogs von Simmern läßt sich beispielhaft auch die geographisch-dynastische translatio imperii von den sächsischen Königen zu den Habsburgern nachvollziehen, von Magdeburg zu den Zentren im Westen und Süden des Reiches und schließlich zu den berühmten Vier-Lande-Turnieren der Rittergesellschaften vom Rhein, von Schwaben, Franken und Bayern in den Jahren von 1479 bis 1487 – eine Nord-Süd-Verlagerung, die der Autor sprachlich durch seine Übersetzung aus dem Niederdeutschen mitvollzieht. Als das




Turnierbuch 1530 erschien, lag das letzte dokumentierte Turnier in Worms schon 43 Jahre zurück, der Gegenstand rückte also allmählich selbst in historische Ferne. Als Herold, der über die Zulassung der Ritter entschied, war Georg Rüxner möglicherweise längst ›arbeitslos‹ geworden – ein triftiger Grund, ins Metier des Schriftstellers zu wechseln, um wenigstens auf dem Papier festzuhalten, wer ›dazugehörte‹: Auch der alte Turnieradel, nicht nur der neue ›Briefadel‹, mußte im Zuge der Verschriftlichung der Kultur seine Legitimation zunehmend auf Texte stützen! Diese soziale Distinktion sollte das Werk neu absichern.
Wohl gibt eine doppelblattgroße Falttafel den Blick frei auf das theatralische Getümmel eines Kolbenturniers auf einem Stadtplatz, bei dem zwei Mannschaften aufeinander einstürmen; auch zeigen 135 (nicht 125, wie seit Muther fälschlich kolportiert wird) meist halb-, aber auch ganzseitige Illustrationen Kampf- und Festszenen – Holzschnitte, die vom Herzog »Hans vom Hunsrück« selbst stammen [vgl. Muther] und »von großem kulturhistorischen und kostümgeschichtlichen Wert« [Neufforge] sind, wenn sie sich auch »an früheren Augsburger Turnierdarstellungen bei Marx Wirsung und Hans Burgkmair d. J.« [Fünf Jahrhunderte] orientieren. Doch schon ihre häufige Wiederholung offenbart eine Stereotypie, die eine Parallele in der Aufzählung der 36 Turniere samt Namenslisten der Teilnehmer und fast 250 Wappen der veranstaltenden Städte, der Schirmherrn und der jeweils vier Turniervögte hat. Auch die »Wappenschau« fand nun im Buche statt!
Das »ouvrage très-curieux« [Brunet] ist »höchst selten« [Neufforge]. Unser Exemplar wurde modern in einen zeitgenössischen Schweinslederband eingehängt, auf dessen Rücken noch die Buchstaben »… CHTONIS « lesbar sind: Offenbar handelte es sich ursprünglich um einen Einband für Werke Melanchthons, wofür auch der im Mittelfeld plazierte Rollenstempelrahmen mit den Allegorien von Fides, Charitas und Spes spricht.
Provenienz: Aus dem Besitz von Hans (eigentlich: Johannes) Dedi (1918 – 2016), dem Vorstandsvorsitzenden des Quelle-/Schickedanz-Konzerns, ohne Exlibris, jedoch mit dessen Notizen auf drei separaten Blättern, erworben in der Auktion 126 von Tenner am 6.5.1980 in Heidelberg, dort Nr. 829 (DM 10.000).
Literatur: Nicht bei Adams; BM STC German 760; Brunet IV, 1471; vgl. Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 373 (nur 2. Auflage!); Ebert 19557; Fünf Jahrhunderte 79; Graesse VI /1, 188; vgl. Lipperheide Tb 10 (nicht diese Ausgabe!); Muther 1783; Nagler, Monogrammisten, III , Nr. 1039; Neufforge 425; Rahir 625; VD 16 R 3541; Vinet 2037.
The famous Tournament Book by Georg Rüxner served the self-assurance of the knightly nobility »fit for tournaments« in view of the social upheavals in the early modern period. The splendid impression in Neudörffer’s Dürer typeface was published in 1530 by the art-loving Duke Johann II of PalatinateSimmern, to whom the 135 mostly half- but also full-page woodcuts with battle and festival scenes and 247 woodcuts with coats of arms are also attributed. The first edition presented here is extremely rare and almost immaculately preserved.





Rüxner, Georg. ANfang / urspru[n]g unnd herkomen des Thurniers inn Teutscher nation. Wieuil Thurnier biß vff den letstenn zu[o] Wormbs: Auch wie vnnd an welchen orten die gehalten/vñ durch was Fürsten/Grauen/ Herrn/ Ritter vñ vom Adel/sie iederzeit bsu[o]cht worden sindt. Zu[o] lobwirdiger gedechtnuß Römischer Keyserlicher Maiestat/vnsers aller gnedigsten Herrn/vnnd alles Teutschen Adels/ Hohen und Nidern stands/voreltern/ im truck außgangenn. Simmern, Hieronimus Rodler, 1532.
a-e 6 f 7 g-z 6 Aa-Mm 6 Nn 8 = 213 [recte: 214] gezählte Bl., 3 Bl. (zweispaltiges Register), 1 Bl. (Kolophon). – Blatt 193 wurde irrtümlich doppelt gezählt. – Das mit f4 bezeichnete Blatt ist eine einmontierte Falttafel, die nicht in der Blattzählung enthalten ist.
Mit großer Titelinitiale »A« zu »Anfang«, ganzseitigem Reichswappen verso Titel und ganzseitigem Wappen am Ende der Vorstücke, einer Falttafel, 40 überwiegend halbseitigen Illustrationen (oft mehrfach wiederholt, gelegentlich zusammengesetzt), 247 Wappen (36mal zu Fünfergruppen zusammengestellt) und abschließender Druckermarke, sämtlich in Holzschnitt und koloriert.
Folio (313 x ca. 212 mm).
Moderner Holzdeckelband mit Rücken aus Schweinsleder auf fünf falsche, durch Blindlinien betonte Bünde, mit blindgeprägtem Rückentitel und modernem Ganzgoldschnitt; in moderner brauner, mit Filz ausgeschlagener Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel (zahlreiche Holzschnitte durch das Tränken vor der Kolorierung mit bräunlicher Aura, Tafel im Falz unterlegt).
Die zweite, ›normale‹ Ausgabe – ein koloriertes Exemplar aus Altbesitz der Freiherrn von Fleckenstein
Nur zwei Jahre nach der ersten Ausgabe von Georg Rüxners Turnierbuch druckte Hieronymus Rodler im Simmerner Schloß diese zweite. Das Buch hatte den Nerv der Zeit getroffen: Es befriedigte das Bedürfnis des bedrängten niederen Adels nach genealogischer Selbstbestätigung und Abgrenzung gegen das aufsteigende Bürgertum und rief zugleich die untergehende ritterliche Turnierkultur nostalgisch in Erinnerung.
Nach den beiden frühen Drucken sollten 1566 und 1578 noch zwei weitere mit Holzschnitten von Jost Amman erscheinen, daneben entstanden zahlreiche Abschriften. Häufig wurde das Buch auch von Zeitgenossen erwähnt, so etwa in der berühmten Zimmerischen Chronik, die Rüxners Werk allerdings bereits etwas geringschätzig behandelte. In der Tat wurden seine Angaben, die besonders für die Frühzeit des Turnierwesens frei erfunden waren, bald auch angezweifelt, wenngleich Eberts ironischer Würdigung zu widersprechen ist, das Buch sei ausgerechnet »wegen seines histor. Un-
Die zweite Auflage von Rüxners Turnierbuch –original koloriert und mit adeliger Provenienz
werths« bekannt. Diplomatischer resümierte Neufforge, es habe »wegen seiner teilweise kuriosen genealogischen Angaben eine große Literatur hervorgerufen«.
Möglicherweise hatten der Autor Georg Rüxner und sein Verleger, der kunstsinnige Herzog Johann II . von Pfalz-Simmern, mit dem ›Publikumserfolg‹ anfangs nicht gerechnet, bzw. einen solchen gar nicht beabsichtigt. Denn der Erstdruck war als Prachtausgabe konzipiert und vielleicht nur in kleiner Auflage erschienen; er ist »höchst selten« [Neufforge]. Die auffälligsten Änderungen der zweiten Ausgabe betreffen die Wahl einer kleineren Frakturtype und die Verminderung der ›erzählenden‹ Holzschnitte von 135 auf 40, wodurch der Umfang des Buches halbiert wurde. Allerdings sind die Lettern immer noch recht groß, und auch bei den Illustrationen ergibt sich kaum ein Informationsverlust, im Grunde nur eine Reduktion der zahlreichen Wiederholungen. Bemerkenswert ist, daß die Illustration am Anfang unverändert bleibt: Dies gilt für die beiden ganzseitigen Wappen und die doppelblattgroße Turniertafel ebenso wie die ersten 17 Holzschnitte (bis Blatt 61). Die Wappen der Teilnehmer und Städte sind ohnehin vollständig wiedergegeben.
Die Initialspatien der ersten Ausgabe wurden in der zweiten zugunsten von fünfzeiligen Holzschnittinitialen aufgegeben: Die Herausgeber rechneten trotz aller Mittelalter-Nostalgie nicht mehr damit, daß die Erwerber der »Normalausgabe« den Druck noch im Stil einer Handschrift ausstatten wollten. Gerade bei dem Besitzer unseres Exemplars täuschten sie sich allerdings gründlich: Sämtliche Illustrationen wurden in Blau, Grau, Schwarz, Braun, Rot, Rosa, Grün und Gelb koloriert. Dies stellte schon insofern einen essentiellen Mehrwert dar, als sich die Wappen erst dadurch genau identifizieren ließen. Entsprechend findet sich auf Blatt 134 beim Wappen des Ritters »Reynhardt vonn Ratzumhauß« die handschriftliche Korrektur zweier verwechselter Farben, »soll rot sein« bzw. »soll grün sein«, steht am Rand.
Unser stilgerecht modern gebundenes Exemplar gibt keine explizite Auskunft über seine frühe Provenienz. Allerdings bezeugen einige Unterstreichungen die Beliebtheit des Werkes als genealogisches Handbuch noch bis ins 18. Jahrhundert hinein. Immer wieder sind die Familiennamen »Flecksteyn« und »Landßperg« markiert – überwiegend freilich bei den ersten 14 Turnieren, die wahrscheinlich niemals stattgefunden haben. Nimmt man das korrigierte Wappen »Ratzumhauß« hinzu, läßt sich mit diesen Daten der damalige Besitzer frappierend genau bestimmen. Bei den Fleckenstein, Landsberg und Rathsamhausen handelt es sich um Familien elsässischer Reichsritter, die demselben Heiratskreis angehörten. So ehelichte Heinrich-Jakob von Fleckenstein-Windeck (1636 – 1720) im Jahr 1659 eine Susanna Maria von Landsberg, ihr Sohn Friedrich-Jakob (1666 – 1710) 1688 hingegen Marie Catharine von Rathsamhausen (1665 – 1747), deren Mutter Anna Magdalena (1630 – 1687) wiederum eine geborene von Landsberg war. In Friedrich-Jakob können wir somit die Person vermuten, nach deren Vorfahren in unserem Turnierbuch geforscht wurde.
Die Höhenburg Fleckenstein im Unterelsaß war nicht irgendeine beliebige Ritterburg, vielmehr ein »wunderbarlich Hauß«, dem Daniel Speckle in seiner Architectura Von Vestungen eine Beschreibung und eine idealtypische Abbildung widmete – sie ist auch in unserer Sammlung zu besichtigen [Nr. 66, dort Bl. 88v und nachfolgende Tafeln]. Die Burg lag hart an der Grenze zur Pfalz, also in unmittelbarer Nachbarschaft zur Interessensphäre des Pfalzgrafen Johann II ., mehrere Fleckensteiner









standen in kurpfälzischen Diensten – das Turnierbuch muß ihnen wohlbekannt gewesen sein. Der Ersterwerber läßt sich nicht ermitteln; es muß nicht der 1552 verstorbene Jakob IV. von Fleckenstein, der Urururgroßvater Friedrich-Jakobs gewesen sein; das Buch kann auch aus einem anderen Familienzweig über fünf Generationen hinweg auf ihn gekommen sein. Er selbst starb mit 43 Jahren, ohne einen männlichen Stammhalter zu hinterlassen.
Sein ihn überlebender Vater Heinrich-Jakob war somit der letzte seines Geschlechts. Bei seinem Tod 1720 hinterließ dieser eine nicht unbedeutende Herrschaft über rund 40 Dörfer, die auf die weiblichen Nachkommen aufgeteilt wurde. Auf seinem Grabgedenkstein in der Kirche in Bühl (Buhl bei Soultz-sous-Forêts) ist sein Wappen zerbrochen dargestellt. Ein Hoch-Rühmlich geführter und Hoch-selig geschlossener Lebens-Lauff deß weyland Reichs Hoch-Wohlgebohrnen Herrn, Herrn Heinrich Jacobs, Freyhern von Fleckensein, des Letzten dieses Uhr-Alten und Hochabgestammten Hauses, gedruckt 1720 in Straßburg, zählt nicht nur alle seine Vorfahren bis zu den Ururgroßeltern auf, sondern spricht auch von einem Heinrich von Fleckenstein, der schon im Jahr 942, und weiterhin von »vielen anderen vortrefflichen Rittern aus diesem Hause«, die an »nachgefolgten Thurnier-Spielen« teilgenommen hätten. Auch der Autor des Nekrologs hat unser Turnierbuch gekannt.
Literatur: Nicht bei Adams; BM STC German 760; Brunet IV, 1471; vgl. Ebert 19557 (1. Ausgabe); Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 373; vgl. Fünf Jahrhunderte 79 (1. Ausgabe); Graesse VI /1, 188; vgl. Lipperheide Tb 10 (nicht diese Ausgabe); vgl. Muther 1783; Nagler, Monogrammisten, III , Nr. 1039; vgl. Neufforge 425 (1. Ausgabe); Rahir 625; VD 16 R 3542; Vinet 2037; zur Provenienz vgl. Hahn 65 sowie die Internetseite de.geneanet.org.
The second edition of Rüxner’s tournament book from 1532 was more sparsely equipped than the first - it was evidently aimed at wider circles of the nobility. It is all the more remarkable that this copy was coloured throughout in blue, grey, black, brown, red, pink, green and yellow at the time of publication, which made the approximately 250 coats of arms precisely identifiable in the first place. The book comes from the old collection of the Alsatian barons of Fleckenstein, for whom it remained of identifying importance until their extinction in the male line. In very fine condition.
Petrarcas philosophisches Hauptwerk: «Artzney bayder Glück» mit 261 lebensvollen Holzschnitten des Petrarca-Meisters, das Exemplar des Prinzen Essling
Petrarca, Francesco . Von der Artzney bayder Glück / des gu[o]ten vnd widerwertigen. Unnd weß sich ain yeder inn Gelück vnd vnglück halten sol. Auß dem Lateinischen in das Teütsch gezogen. Mit künstlichen fyguren durchauß / gantz lustig vnd schön gezyeret. 2 Teile in 1 Bd. Augsburg, Heinrich Steiner, 1532.
2Π 6 a 6 b4 A-Z6 a 6 Aa-Zz 6 Aaa-Fff 6 Ggg 4 = 22 Bl., 144 gezählte Bl., 178 gezählte Bl. – Titel in Schwarz- und Rotdruck.
Mit 261 großen Holzschnitten (126 im ersten, 135 im zweiten Band), 75 Bordüren in Mehrfachverwendung und figürlichen Initialen (H, S, V, W).
Folio (305 x 200 mm).
Grobgenarbter dunkelgrüner Maroquinband des 19. Jahrhunderts auf fünf mit Goldfileten verzierte Bünde, mit goldgeprägtem Rückentitel in zwei und Monogramm »VM « in den übrigen, von dreifachen Goldfileten umzogenen Rückenfeldern; die Deckel mit einfachem und dreifachem Filetenrahmen sowie zentralem Wappen, mit Steh- und breiter Innenkantenvergoldung, neuen marmorierten Vorsätzen und Ganzgoldschnitt, auf dem Spiegel signiert von M. Lortic; in neuem, mit Filz ausgeschlagenem Pappschuber mit Lederkanten (gewaschen, einige Blätter perfekt restauriert, Exlibris-Spur auf Spiegel, Bl. 68 irrtümlich jeweils im anderen Teil eingebunden).
Selbstbewußte Illustration auf dem höchsten Niveau der Dürer-Zeit
Von Francesco Petrarcas Traktat De remediis utriusque fortunae kursierten schon im 15. Jahrhundert zahlreiche Handschriften; seit dem Erstdruck 1474 gehörte es zum »festen Bestande der Lehrbücher der deutschen Humanisten« [Scheidig 8]. Die 261 Holzschnitte des »Petrarca-Meisters« stehen künstlerisch auf der Höhe der Zeit. Heinrich Röttinger versuchte, den Zeichner mit Hans Weiditz zu identifizieren, Muther glaubte, »Burgkmair’s höchste Leistung« [Muther, S. 143] vor sich zu sehen, Norbert Ott hat hingegen in jüngerer Zeit dezidiert auf die Differenzen hingewiesen: auf »ein geduldiges Interesse an den kleinen Realitäten« beim Petrarca-Meister gegenüber Burgkmairs »Neigung zum Heraldischen, zuweilen Glatten, Gefälligen, auch Erhaben-Repräsentativen« [Ott 1999, 239].
Die Hinfälligkeit alles Irdischen sollte die Beteiligten selbst bald einholen: Bereits 1520 starb der Übersetzer Peter Stahel über der Arbeit, so daß die Verleger kurzfristig Georg Spalatin, den Hofkaplan und Sekretär Friedrichs des Weisen, engagierten, der den Text 1521 abschloß. Sebastian Brant schrieb eine gereimte Vorrede und konnte noch den Zeichner bei der Konzeption der Bilder beraten,
ehe ihn 1521 der Tod ereilte. Der Künstler vollendete die Holzschnitte mit dem Schlußdatum 1520 und muß um 1523 verstorben sein, da kein späteres Werk von ihm überliefert ist – vermutlich geriet darum sein Name in Vergessenheit [vgl. Scheidig 11]. Nach dem baldigen Tod auch des Verlegers Wirsung, nach ruinösen Erbauseinandersetzungen und dem Bankrott des verbliebenen Teilhabers Sigmund Grimm im Jahr 1527 blieb das Werk ungedruckt liegen, bis Heinrich Steiner die Holzstöcke kaufte und den Druck 1532 herausbrachte.
Schon Francesco Petrarca (1304 – 1374) hatte die Unwägbarkeiten des Lebens zur Genüge erfahren. Sein Vater war zusammen mit Dante aus Florenz exiliert worden, in Frankreich erlebte er die ›Babylonische Gefangenschaft‹ der Päpste, in Rom die politischen Wechselfälle des mit ihm befreundeten Cola di Rienzo; um 1348 grassierte in Europa die große Pestepidemie. In seinem Haus in Fontaine de Vaucluse in der Provence verfaßte er »erste Skizzen und Entwürfe« zu De remediis; am Hof der Visconti, wo er seit 1353 lebte, arbeitete er »konzentriert daran« [KNLL 13, 173], bis ihn die Pest nach Venedig vertrieb, wo er das Werk 1366 vollendete.
Im ersten Teil disputiert die personifizierte Vernunft in 122 Dialogen mit den Allegorien der Freude und der Hoffnung über die trügerischen Eigenschaften des »guten« Glücks, im zweiten Teil argumentiert sie 132fach gegen die Klagen von Furcht und Schmerz, indem sie in den Widrigkeiten des Lebens eine Aufforderung zu Selbsterkenntnis und Gleichmut erkennt. In christlicher und stoischer Tradition nach dem Vorbild Senecas bietet Petrarca ein Heilmittel gegen Unglück und Glück, die beide den Launen der Fortuna entspringen. Jedoch gelingt es Petrarca »nicht oft, […] alle ›Freuden‹ abzutun; ebensowenig kann er alles das als nichtssagend erweisen, was den Menschen als Krankheit, Not, Bedrückung und Furcht quält« [Scheidig 14]. Die »sichere Selbstherrlichkeit der Vernunft […] ist Wunsch, ein Ideal, das weit gesteckte Ziel der ohnmächtigen Sehnsucht eines Menschen, der keineswegs unter den klaren Gesetzen des Verstandes, sondern in einer trüben Zerrissenheit des Gemütes lebt« [Eppelsheimer 69]. Die Weisheit gerate Petrarca so geradezu »zu einer dürren, fanatischen Vernünftigkeit, – zu einem bitterbösen Instrument, mit dem er […] alles, was Freude und Schmerz bereiten, was irgendein Gefühl auslösen könnte, erbarmungslos zerstört« [ebd.], was dem Werk »den Stempel des Fragwürdigen, ja oft genug des Unechten und Unwahren aufdrückt« [ebd. 74]. Immerhin verbindet sich bei dem Frühhumanisten Petrarca mit der Abwendung von der Scholastik und Dogmatik eine »Hinwendung zur Lebensphilosophie« [ebd.], die das »lebensfreudige Bewußtsein von einer in den Menschenwesen gegründeten natürlichen Entfaltung« [Wilhelm Dilthey, zit. nach Eppelsheimer 75] im 15. und 16. Jahrhundert heraufführt.
Auf diesem Weg ist der Zeichner, der Petrarca-Meister, bereits ein ganzes Stück weitergekommen. Denn keineswegs immer geht er auf Petrarcas Antithetik ein; schon in der ersten Szene, in der die Hoffnung spricht: »Ich hab ein plüend alter / mir ist zu[o] leben noch vil Jar« [Bl. 1], ignoriert er die Hinweise der Vernunft auf die Ungewißheit der Todesstunde und zeichnet nur das blühende Leben: Ein junger Adliger reitet mit seinen Windspielen zur Falkenjagd aus, während plaudernde junge Mädchen an einen plätschernden Renaissancebrunnen zusammengekommen sind. Wo er Gegenbeispiele zu den Behauptungen der Freude, etwa aus der antiken Mythologie ins Bild setzt, gehen diese oftmals auf Anweisungen des gelehrten Sebastian Brant zurück – lieber aber gibt sich





»der Petrarca-Meister ganz der freudigen Stimmung hin« [Scheidig 4], Bildern von Wohlstand und zufriedenem Leben. Noch seltener wird das Unglück relativiert. Auch der »Schmerz« beginnt seine Klage bei der körperlichen Beschaffenheit, die der Zeichner in ein Familienbild von kaum überbietbarer Häßlichkeit übersetzt. Zu diesen Menschen tritt ein kopfloses Wesen mit Augen an den Schultern, um sie zu belehren, daß »ihre Mißbildung noch nicht die schlimmste sei, es hätte noch schlimmer kommen können«. Ein solches Monstrum ist bei Petrarca nicht erwähnt, er bemüht als Trost stattdessen die historische Dialektik: Wenn Helena nicht so schön gewesen wäre, stünde Troia vielleicht noch immer. Auch aus den Darstellungen von Leid und Armut »spricht ein elementares Mitempfinden mit den traurigsten Erscheinungen der eigenen Zeit« [ebd. 205], und es wird »auf den Trost verzichtet, den Petrarca oft nur banal und gekünstelt, oft mit dem Hinweis auf jenseitiges Glück als Folge irdischen Unglücks zu geben vermag« [ebd. 191]. So ist der Petrarca-Meister »weniger Philosoph und mehr Mensch der Wirklichkeit« [ebd. 216], der in seinen detailreichen, auch physiognomisch differenzierten Bildern »unter den Künstlern seiner Zeit den schärfsten und umfassendsten Blick für das Leben in all seinen Verästelungen« [ebd. 28] besaß.
Auf Sterben und Tod Maximilians I. im Januar 1519 wird in den letzten Kapiteln angespielt. Ein erstaunlicher ›Anklang‹ an dessen im Weißkunig ausgedrückte Sorge, »mit dem glockendon vergessen« zu werden, wenn er sich »in seinem leben kain gedachtnus« mache, findet sich im Holzschnitt Von der lieb des geruchts im tod [Bl. 173r]: Ausgerechnet ein harfespielender Orientale steht am Bett des Sterbenden, um dessen Taten sinnbildlich ›an die große Glocke‹ zu hängen. Fatalerweise ist das Bildfeld im Hintergrund jedoch leer, was Scheidig wohl zu Unrecht als eine Verstümmelung der Darstellung ansah [vgl. ebd. 338]. Vielmehr entspricht diese Leerstelle der Textlücke im 117. Kapitel des Theuerdank, wo über den ausstehenden Türkenkrieg erst noch berichtet werden sollte – nach Maximilians Tod illustriert der Petrarca-Meister nur zu genau, was ›die Glocke geschlagen‹ hat! Um das ›therapeutische‹ Prinzip zu erkennen, muß man sich nur an Petrarcas Vorred halten, in der er warnt, daß sich »die gedächtnus / die verstentnus / die fürsichtigkkait« mitunter »zu unserem grossen schadenn verkeret, also gar verpflichten wir vns allweg […] auch zu schödlichen sorgen«. Gegen dieses Übel helfe »ein emsigs vnnd gar mundters lesen der edlen vnnd nutzen Bücher vnnd schrifften« der Philosophen, »Wöllicher leyb vorlange zeyt erfaulet ist / vnnd doch durch ihr götlich verständtnus / vnnd allerhaylsameste vnnderweysung noch bey uns leben / bey vnns wonenn / mit vns redenn […] allso das du von tag zu tag geren erfarner und gelerter wöllest werden / so du deiner vberträfflichenn gedächtnus offt für die bücher prauchest«. Maximilians Leitbegriff »gedächtnus« wird aus der Sphäre öffentlichen Andenkens in die des individuellen Denkens zurückgeholt. Dies demonstriert das ungewöhnliche Autorbild, das ein »klein heüßlein in einem lustigen thal« zeigt, in das hinein Petrarca sich »gesetzt / un[d] nichts anders gethon dan[n] studiert / gelernet / vnd bücher gemacht«. Wer schreibt, der bleibt: Selbstgewiß stellt der Editor die auch wörtlich zu nehmende oratio pro domo dem Text voran.
Tatsächlich blieb Petrarcas Artzney »eines der am meisten gelesenen Bücher« [Scheidig 7] bis zum Beginn des Dreißigjährigen Kriegs; 1620 erschien die neunte Auflage, gedruckt noch immer mit den inzwischen hundertjährigen Holzstöcken. Die erste Ausgabe freilich ist »von bekannt größter Seltenheit« [Neufforge]; unser Exemplar ist das des gelehrten Sammlers und Bibliographen Victor


Masséna prince d’Essling, duc de Rivoli (1836 – 1910), der sich von Marcellin Lortic (1852 –1928) einen Einband mit seinem goldgeprägten Wappenspralibros fertigen ließ.
Provenienz: Victor Masséna, Prince d’Essling, duc de Rivoli. Dessen Auktion Zürich, 15.-17.5.1939, Nr. 214 (CHF 500, erworben von Art Ancien).
Literatur: BM STC German 686; Dodgson II , S. 144, Nr. 15, und S. 192, Nr. 2; Fünf Jahrhunderte 81; Goedeke I, 392, Nr. 38 (Brant); Graesse V, 235; KNLL 13, 174; Musper S. 1316, L 124 und Nr. 59-319; Muther 886; Neufforge 242f.; Ott 1999; Passavant III , S. 275, Nr. 106 (Zuschreibung an Burgkmair); Rahir 580; Röttinger 1904, Nr. 24; Scheidig; Schmidt 1879, II , Nr. 171; VD 16 P 1725; Wilhelmi 464. – Zu Lortic vgl. Fléty 115.
Petrarch’s »Artzney bayder Glück«, in both Christian and Stoic tradition, sought to immunise people against all the vicissitudes of fate. The 261 lively woodcuts by the Petrarch master in this Augsburg first edition of 1532 speak a different language: by no means do they always follow the scholarly instructions of the editor Sebastian Brant; most of the time they give themselves directly to the expression of happiness or pain. The detailed, physiognomically differentiated depictions are at the highest level of the Dürer period. The copy comes from the estate of Victor Masséna, Prince d’Essling, who had it bound by Marcellin Lortic.



Fierrabras . Eyn schöne kurtzweilige Histori von eym mächtige[n] Riesen auß Hispanie[n] / Fierrabras gnant […] newlich auß Frantzösischer sprach in Teutsch gebracht […]. Simmern, Hieronimus Rodler, 1533.
A7 B-H6 I4 = 53 Bl.
Mit 20 meist halbseitigen Holzschnitten (Titelholzschnitt wiederholt) und halbseitiger Holzschnitt-Druckermarke, sämtlich altkoloriert.
Folio (313 x 211 mm).
Roter Maroquinband des späten 16. Jahrhunderts mit Du Seuil-Vergoldung, großem ornamentalen Mittelstück, umgeben von zwei Filetenrahmen, der innere mit Eckstücken aus Fleur de lis, und Ganzgoldschnitt (Rücken erneuert, Deckel mit kleinen Schabstellen, Ecken etwas bestoßen, Vorsätze leimschattig, Bl. A2 und A3 mit kaum merklich unterlegten Ausrissen im weißen Seitenrand, erste Lage mit schwacher Verfärbung in der unteren Ecke, sonst kaum fleckig, zum Ende hin wenige Wurmlöchlein).
Eines der schönsten illustrierten Volksbücher
Herzog Johann II . von Pfalz-Simmern (1492 – 1557) – auch »Herzog Hans vom Hunsrück« genannt – war eigentlich ein unbedeutender Duodezfürst. Dem Kriegshandwerk abgeneigt, widmete er sich vor allem der Staats- und Rechtslehre, in der er als führend galt, sowie Wissenschaften und Künsten. So stand er einerseits bei Kaiser Karl V. in höchstem Ansehen, der ihn zum Richter am Reichskammergericht in Speyer und zu seinem Statthalter beim Reichsregiment ernannte, andererseits sorgte er in seinem Ländchen mit der Hauptstadt Simmern für eine besondere kulturelle Blüte. Im Simmerner Schloß richtete er eine Druckerei ein, die »unter der Leitung seines Sekretärs, Hieronymus Rodler, 1530-35 einige prachtvoll ausgestattete Werke, meist aus der ritterlichen Sphäre, hervorbrachte« [ NDB 10, 510], so etwa Rüxners Turnierbuch und Volksbücher wie die Haymonskinder und diese deutsche Übersetzung des Fierabras.
Da der nah an der Grenze zum französischen Kulturraum beheimatete Johann »auch als Autor bzw. Übersetzer einiger der veröffentlichten Texte« [ebd.] in Frage kommt, dürfte diese Übertragung des altfranzösisches Heldenepos des 12. Jahrhunderts nach Deutschland und ins Deutsche ebenfalls ihm persönlich zu verdanken sein. Gab es dafür konkrete Motive? Fierrabras, ein heidnischer Riese, wird von dem christlichen Ritter Olivier besiegt und zum Christentum bekehrt. Zunächst belegt der Druck, daß die ritterlichen Ideale samt der Kreuzzugsidee keineswegs mit dem »letzten Ritter« Maximilian – man denke hier auch an die von ihm veranstaltete Textsammlung des Ambraser Heldenbuchs – ins Grab gesunken waren. Darüber hinaus war die Ausgabe Johanns möglicherweise eine









Hommage speziell an Maximilians Enkel und Nachfolger Karl V., stammte der Stoff doch aus dem Sagenkreis um Karl den Großen und spielte in Spanien. So fokussiert sich die doppelte Affinität des pfälzischen Herzogs zu Kultur und Kaiser gerade in diesem Buch.
Den besonderen Charme machen die 20 großen, teils aus drei Platten zusammengesetzten Holzschnitte aus. Sie zeigen Interieurs, Kampf- und Kriegsszenen und wurden zeitgenössisch ebenso kräftig wie differenziert koloriert, so daß sie wie kleine Gemälde wirken. Wenige Illustrationen wurden aus dem Turnierbuch übernommen, die meisten sind neu. Auch bei ihnen kann man davon ausgehen, daß der Urheber niemand anders als der Herzog »Hans vom Hunsrück« höchstselbst war [vgl. NDB]. Der schöne rote Maroquinband stammt vielleicht noch aus dem 16. Jahrhundert.
Provenienz: Katalog Tenschert XX , Illumination und Illustration, Nr. 76. – Exlibris der Bibliotheca Philosophica Hermetica von Joost Ritman in Amsterdam. – Dessen Auktion Sotheby’s, London, 6.12.2000, Nr. 54: £ 16.350 (= CHF 41.000). Deutsche Privatsammlung.
Literatur: BM STC German 303; Brunet II , 1251; Ebert 7539; Goedeke II , 21, Nr. 4; Graesse II , 577; Heitz/Ritter 149; Nagler, Monogrammisten, III , Nr. 1039; Neufforge 237; Muther 1785; NDB 10, 510; VD 16 F 1007.
In addition to Rüxner’s tournament book, the art-loving Duke Johann II of Palatinate-Simmern is also responsible for this German first edition of the Old Provençal heroic epic poem of Fierabras from 1533. The 20 large woodcuts, partly composed of three plates, with interiors, battle and war scenes, whose author was probably also the duke himself, make the work one of the most beautiful illustrated »Volksbücher«. It is offered here in superb original colouring, the like of which we have not found in other copies in recent decades. The beautiful red morocco binding dates from the late 16th century. From the Joost Ritman Collection.




[Richental, Ulrich] . Das Concilium. So zuo Constantz gehalten ist worden / Des jars do man zalt von der geburdt vnsers erlösers M. CCCC . XIII . Jar. Mit allen handlunge[n] iñ Geystlichen uñ weltlichen sachen / Auch was diß mals für Bäpst / Kayser / Künig / Fürsten vnd Herrn sc. Geystlichs vnd weltlichs stands / sampt den botschafften oder Legationen / der Künigreychen / Lande[n] vñ Stetten / die zuo Constantz erschinen seind / mit ire[n] wappen Contrafect / vñ mit andern schönen figuren vñ gemäl / durchauß gezieret. Augsburg, Heinrich Steiner, 1536. [Vorgebunden: I.] DE s aller durchleuchtigsten großmechtigste[n] vnüberwindtlichsten Keyser Karls des fünfften: vnnd des heyligen Römischen Reichs peinlich gerichts ordnung / auff den Reichsztägen zuo Augspurgk vnd Regenspurgk in jaren dreissig / vñ zwey vnd dreissig gehalten / auffgericht vnd beschlossen. Mainz, Ivo Schöffer, 1534. [Und: II .] Satzung / Statuten und Ordenungen / Beständiger / guotter Regierung / Einer billichen / Ordenlichen Policei / In ieden Rechten gegründtes Ebenbild. […] Weiland in des H. Reichs statt Worms fürgenommen / Jetz new mit höhstem fleiß Restituirt und añ tag geben. Frankfurt am Main, Christian Egenolff, 1534. [Und: III .] BA mbergische Halßgerichts vnd Rechtlich ordnung / iñ peinlichen sachen zuo volnfarn allen Stetten / Communen / Regimenten / Amptleuten / Vögten / Verwesern / Schultheyßen / Schöffen / vnd Richtern / dienstlich / fürderlich vnd behülfflich / darnach zuo handeln und rechtsprechen […]. Mainz, Johann Schöffer, 1531. [Und: IV.] Rotweilisch Hoffgericht . Ordenung / vnnd sundere Gesatz des Heiligen Römischen Reichs Hoffgericht zu Rotweil / Wie weilant Künig Conrat / ein Hertzog zu Schwaben solichs einer statt Rotweil vmb jren sonderen verdienst gnedliglich geben und zuogestelt hat. Frankfurt am Main, Christian Egenolff, 1535.
A-Z6 a-n 6 = 215 gezählte Bl., 1 leeres Bl.
Mit drittelseitiger Titelillustration, dem von kolorierten Löwen gehaltenen Konstanzer Wappen (ankoloriert wiederholt), 42 fast ganzseitigen Illustrationen (davon 40 koloriert, 11 zweiteilig), 3 halbseitigen kolorierten Illustrationen, über 1100 Wappendarstellungen (davon etwa 480 koloriert, einige ungefüllt), 2 illustrierten Schmuckleisten (jeweils mehrmals wiederholt und teils koloriert) und 2 größeren Schmuckinitialen, alles in Holzschnitt.
Vorgebundene Drucke:
I. Π 6 A-E6 F4 G6 = 6 Bl., 39 gezählte Bl., 1 leeres Bl. – Mit zweiteiliger Titelillustration, 1 halbseitigen Textillustration, 2 Wappen, 1 großen Zierinitiale auf Cribléegrund und Druckermarke, alles in Holzschnitt.
II . Π 6 A-K 6 L 4 M6 = 6 Bl., 69 gezählte Bl., 1 leeres Bl. – Mit zwei Wappen und halbseitiger Illustration auf dem Titel sowie ganzseitigem Stammbaum, alles in Holzschnitt.
III . Π 6 A-H6-4 I4 = 6 Bl., 43 gezählte Bl., 1 leeres Bl. – Mit 22 Illustrationen, die meisten halb-, einige fast ganzseitig, überwiegend aus 2 Stöcken zusammengesetzt (wenige Stöcke wiederholt, die Figur des Richters mehrmals), 2 Darstellungen von Schriftrollen und Druckermarke, alles in Holzschnitt.
IV. a-g 4 = 28 Bl. – Mit gelegentlichen Témoins. – Mit Titelillustration und -wappen, zwei illustrierten Leisten und 1 weiteren Textillustration in Holzschnitt.
Folio bzw. [IV:] Quart (ca. 290 x 200 mm).
Schweinslederband der Zeit über Holzdeckeln auf vier Bünde, in den Rückenfeldern Blindprägung von Knospenstauden in Rautengerank, die Deckel mit reichem, blindgeprägtem Rahmenwerk von Streicheisenlinien und Rollenstempeln, Mittelfeld vorn mit Knospenstauden in rautenförmigen Ranken, hinten mit Muster aus gekreuzten doppelten Streicheisenlinien; mit altem handschriftlichen Rückentitel und zwei Messingschließen (Einband leicht berieben, 1 Beschlag fehlend).
Richentals Chronik und vier Gerichtsordnungen, gedruckt 1531 – 1536, in einem zeitgenössischen Schweinslederband
Die berühmte Constitutio Criminalis Kaiser Karls V., drei weitere Gerichtsordnungen, gedruckt in den Jahren 1531 bis 1535, und die ungemein farbige (auch wirklich kolorierte) Chronik des Konstanzer Konzils von Ulrich Richental im Zweitdruck von 1536, zusammen in einem wuchtigen Schweinslederband: Wer mochte den durchaus antiklerikalen Konzilsbericht aus dem 15. Jahrhundert mit gewichtigsten juristischen ›Fachtexten‹ kombiniert haben – und zu welchem Zweck?
Der strikt zeitgenössische Einband verrät leider nur wenig über seine Herkunft: Die vier Einbandstempel entsprechen denen eines in der Einbanddatenbank verzeichneten, aber nicht (bzw. falsch) identifizierten Bandes in Wolfenbüttel aus einer unbekannten Werkstatt [w002232]: eine Knospenstaude [s014799], eine sie umgebende Rautenranke [s014800], eine Flechtwerk- [r000830] und eine Jagd-Rolle [r000831]. Die Knospenstaude scheint darüber hinaus mit zwei anders bezeichneten Stempeln [s030561 und s025208] auf zwei Einbänden in der Staatsbibliothek München identisch zu sein. Der eine enthält eine Straßburger Inkunabel aus dem Kloster Steingaden südlich von Augsburg [BSB -Ink M-237], der andere eine Sammelhandschrift [Clm 28511], die »nach Schrift, Initial- und Einbandstil […] in Süddeutschland entstanden« [Kudorfer 89] ist. Wir möchten daher annehmen, daß der Buchbinder nicht in Frankfurt oder Mainz zu suchen ist, wo die vier Gerichtsordnungen gedruckt wurden, sondern in Augsburg, wo die Konzilschronik als der jüngste und umfangreichste Text des Sammelbandes hergestellt und vor der Bindung noch in aller Eile koloriert wurde: Dafür spricht nicht nur eine gewisse Flüchtigkeit der Bemalung, sondern auch der Umstand, daß sie nach Blatt 135 von 215 Blättern endet. Sie umfaßt 40 der 42 großen Holzschnitte, aber nur die Minderzahl der über 1100 Wappen. Dies erlaubt einen weiteren Schluß: Der Auftraggeber war an der Chronik weniger als »Wappenbuch« interessiert, obschon es »in seiner Reichhaltigkeit ohne Vergleich dasteht« [Neufforge 216], denn zur exakten Identifizierung der Wappen wäre die Kolorierung unabdingbar gewesen. Es wird sich also kaum um einen traditionsgebundenen Vertreter des Feudaladels, auch nicht um einen Geistlichen, dafür um einen nicht unbedeutenden ›weltlichen‹ Bürger der Reichs-

stadt Augsburg gehandelt haben, dem die gerade im Druck erschienenen Gerichtsordnungen für seine Amtspraxis unentbehrlich waren. Diese sind sorgfältig kombiniert.
Im Zuge der Bemühungen um eine Reichs- und Rechtsreform waren 1495 auf dem Reichstag zu Worms der Ewige Landfriede und das Reichskammergericht errichtet worden, das zunächst in Frankfurt, dann kurzzeitig in Worms seinen Sitz nahm. Wohl unter dessen Einfluß verabschiedete der Rat der Reichsstadt 1498 eine »Anpassung des Stadtrechts an das römische Recht« [Hoke 102], das 1507 zum ersten Mal gedruckt wurde – hier liegen die Satzung / Statuten und Ordenungen / Beständiger / guotter Regierung, vom Rat in des H. Reichs statt Worms fürgenommen, in der vierten Auflage vor. Das Gesetzeswerk besaß »Lehrbuchcharakter«; bis 1564 wurde es neun Mal aufgelegt. In den Rahmen der großen Reichsreform fügte sich auch der Beschluß ein, den 1498 der Reichstag zu Freiburg faßte, »eine gemeinsame Reformation und Ordnung in dem Reich fürzunehmen, wie man in criminalibus procediren soll« [Radbruch 7]. Vorreiter war hier allerdings wiederum eine Partikularmacht: Die BA mbergische Halßgerichts vnd Rechtlich ordnung von 1508, erarbeitet unter Johann Freiherr von Schwarzenberg, und erlassen von dem Bamberger Bischof Georg III . Schenk von Limpurg, hier in der dritten Auflage, griff gleichfalls bereits auf Elemente des römischen Rechts und humanistisches Gedankengut aus Italien zurück [vgl. ebd. 10]. Sie repräsentierte nicht nur das Hochgericht in einem geistlichen Territorium, sondern bildete die Grundlage für die »bedeutendste, ja die einzig bedeutende gesetzgeberische Arbeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation« [ebd. 5], die unserem Sammelband voransteht: die berühmte Peinliche Gerichtsordnung Karls V. , das erste allgemeine deutsche Strafgesetzbuch, das die willkürliche und territorial zersplitterte mittelalterliche Rechtspraxis vereinheitlichen und – trotz aller »peinlichen« Grausamkeiten – mäßigen sollte. Sie wurde 1530 auf dem Reichstag in Augsburg beschlossen. Hier liegt sie in ihrer ersten Ausgabe von 1534 vor. Eher wie ein Relikt aus der mittelalterlichen Rechtspraxis mutet hingegen der vierte Druck der Sammlung an, der Erstdruck der Ordenung / vnnd sundere Gesatz des Heiligen Römischen Reichs Hoffgericht zu Rotweil: »In Süddeutschland hatte sich eine Reihe von Landgerichten erhalten, welche ihren Zusammenhang mit dem Reiche zu bewahren wußten, also keiner Gerichtsgewalt eines Landesfürsten unterstanden. Diese unmittelbaren Gerichte besaßen vor allem den Vorzug, die Reichsacht über Missetäter verhängen und […] das in ihrem Gerichtsbezirk gelegene Gut des Ächters einziehen zu können« [Fehr 39]. Der Hofrichter in Rottweil waltete »an des Kaisers Statt« in Schwaben und darüber hinaus, das dortige Hofgericht war »eines der hervorragendsten Tribunale« [ebd.] überhaupt, in Konkurrenz zu der sich entwickelnden territorialen Gerichtsbarkeit der Landesherren. Mit der Gründung des Reichskammergerichts als Appellationsinstanz wurde seine Autorität von den Reichsständen allmählich untergraben, auch wenn es bis zum Ende des Alten Reiches 1806 nie aufgehoben wurde – seine Stätte ist bis heute im Weichbild Rottweils erhalten.
Widmete sich die deutschsprachige Chronik des Konstanzer Konzils des Ulrich von Richental (um 1360 – 1437) auch der Kirchengeschichte des frühen 15. Jahrhunderts, so richtete sie sich allerdings nicht an Theologen [vgl. Wacker 303]. Sie war der »Bericht eines unbeteiligten und außerhalb der Dinge stehenden Privatmannes, eines Zuschauers am großen Weltspektakel, der laufend aufzeichnete, was ihn interessierte und was er in Erfahrung bringen konnte« [Feger 21]. Richental begann diese Sammlung von tagebuchartigen Aufzeichnungen und anderen »Quellen, Akten und Urkunden […] aus eigenem Antrieb, führte sie aber später in offiziellem Auftrag weiter« [Wacker 300]. Dazu ließ er – möglicherweise von




Konrad Witz – einen »umfangreichen Bilderkreis […] von eminent kritischem Charakter« [ebd.] herstellen. Gisela Wacker sah in dem »realistischen Stil, in der Abkehr von symbolischen Darstellungsformen und in der Erfassung von Staatsakten und Szenen des Alltagslebens« einerseits eine »weltanschauliche Nähe zur Devotio moderna« [ebd. 200], andererseits den »Ausdruck einer bürgerlich geprägten profanen Geisteshaltung mit ungewöhnlich weltoffenen, toleranten und demokratischen Zügen« [ebd. 301f.]
Die Hauptresultate des Konzils waren die Verdammung und Hinrichtung von Johannes Hus und seinem Gesinnungsgenossen Hieronymus von Prag sowie die Beendigung des kirchlichen Schismas durch die Wahl von Papst Martin V. Die eigentlichen Probleme des kirchlichen Lebens waren damit aber nicht gelöst, vielmehr beginnt mit dem Konzil in der eschatologischen Deutung von Chronist und Illustrator die »Herrschaft des Antichrist« [ebd. 301], während die »vom Konzil als Ketzer verurteilten böhmischen Reformer als Märtyrer in der Nachfolge Christi stilisiert« [ebd.] werden. Das sich seit dem Konzil von Konstanz artikulierende Krisenbewußtsein betraf jedoch nicht nur die kirchliche, sondern die Welt-Ordnung als ganze, waren doch durch »das Schisma und die Auseinandersetzungen um das Königtum […] die universalen Ordnungsmächte in Frage gestellt« [ebd.]. So dokumentiert die Chronik letztlich »das Bedürfnis des Einzelnen und sozialer Gruppen, sich ihres gesellschaftlichen und rechtlichen Status stets neu zu vergewissern«, etwa »durch die Vergegenwärtigung des mittelalterlichen ordo-Gedankens in Prozessionen, Rechtsakten und Wappengliederungen« [ebd.]. Entstanden in den 1430er Jahren zur Zeit des Basler Konzils, »wandte sich die populäre Konzilsgeschichte an die Bevölkerung, an die Herrschaften und Stände des Reiches und bezeugte die weite Verbreitung der antirömischen Stimmung« [ebd. 267]; zugleich sollte sie »der Mobilisierung bürgerlicher und fürstlicher Reformkräfte dienen« [ebd. 303]. Aus dieser Perspektive erschließt sich auch der Sinn der Zusammenstellung der Chronik mit den vier Gerichtsordnungen. Fraglich ist nur, inwiefern die Probleme der Konzilszeit nach hundert Jahren noch virulent waren.
Tatsächlich blieb die Grundvoraussetzung für das Interesse an der Richentalschen Chronik die andauernde Bedeutung des Konstanzer Konzils »für die Reformbestrebungen in Kirche und Reich«. Diese »lebten zur Zeit des Basler Konzils verstärkt wieder auf und zogen sich seither wie ein roter Faden durch die Geschichte des gesamten 15. Jahrhunderts; sie mündeten in der Reformation Luthers und schließlich in der katholischen Reform des Trienter Konzils« [ebd. 204f.]. Richentals Werk blieb dabei das Standardwerk, »bis 1541 die Konziliengeschichte des Schweizer Historikers Stumpf im Druck erschien«. Auch wenn die »weitverzweigte handschriftliche Rezeption« [ebd. 267] den realistischen wie auch den reformerischen Charakter insbesondere des ursprünglichen Bilderzyklus verwischte [vgl. ebd. 266 und 304], so haben doch »alle überlieferten Manuskripte und Druckausgaben […] die Kompositionsschemata, die Makroelemente, der ursprünglichen Illustration beibehalten« [ebd. 203]. Der Augsburger Erstdruck von 1483 schloß sich eng an die Handschriften der späten1460er Jahre an, und auch Heinrich Steiner hat bei der vorliegenden zweiten Ausgabe des Jahres 1536 »den Text zwar sprachlich modernisiert, aber nicht grundsätzlich verändert« [ebd. 269]. In seiner Vorrede stellte er einen »direkten Zusammenhang zwischen dem historischen Ereignis und den zu seiner Zeit geführten Diskussionen über ein Konzil« [ebd. 269f.] her. Dies geschah über einige signifikante Modifikationen der Bebilderung, wie Gisela Wacker dargelegt hat. So wurden die 40 Holzschnitte »auf der Grundlage der alten Kompositionsmodelle nach den Entwürfen von Jörg








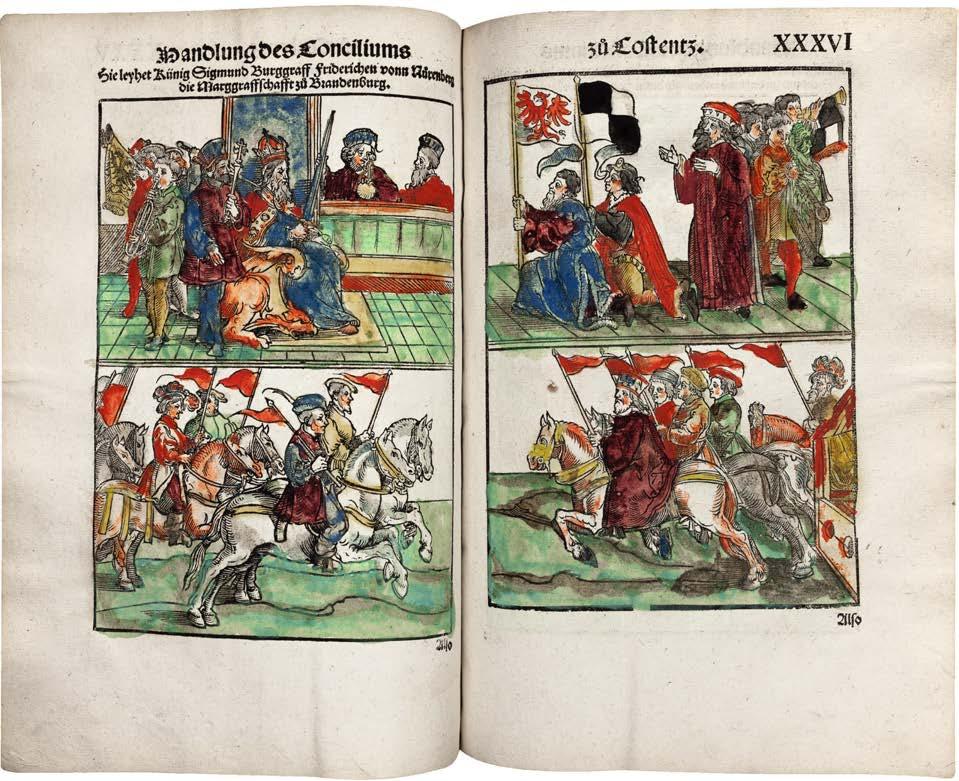

Breu dem Älteren vollständig neu geschnitten« [ebd. 268]; die beiden einige Male wiederholten Schmuckleisten gehen wohl auf Hans Burgkmair zurück.
Der Titelholzschnitt stammt aus Steiners Erstausgabe von Petrarcas Von der Artzney bayder Glück von 1532. Er zeigt rechts den auf einem Sphingenthron sitzenden Papst im Profil; ihm gegenüber ein Kollegium geistlicher Würdenträger und zentral einen Kardinal, der einen Bannblitz gegen ihn schleudert: Was in Petrarcas Trostspiegel die Vergänglichkeit irdischer Macht illustrierte, deutet hier auf die Absetzung eines fragwürdigen Papstes durch ein nicht minder fragwürdiges Konzil als den »Hauptinhalt des Buches« [Wacker 269]. Die einander auf Blatt 11v und 12r gegenüberstehenden Holzschnitte veranschaulichen eine Zusammenkunft zwischen Kaiser Sigismund und dem (Gegen-) Papst Johannes XXIII . 1413 in Lodi – doch sind sie »eindeutig als Kaiser Karl V. und […] Papst Paul III . Farnese« [ebd. 270] zu identifizieren, die um 1535 ein neues Konzil in Mantua planten. Jan Hus hingegen wurde in der Szene seiner Degradierung auf Blatt 25v »mit den Gesichtszügen Luthers ausgestattet« [ebd.], wobei dessen ausgestreckte Arme auf das »zugrundeliegende Bildmodell des Schmerzensmannes« [ebd. 271] verweisen. Daß die Parallelisierungen nicht fortgesetzt werden, deutet Wacker gleichfalls als intentionalen Akt des lutherisch gesinnten Jörg Breu: Eine weitere zwischen Kaiser und Papst vereinbarte – und wie auf dem Titelbild dargestellt: ungültige –Universalsynode würde es nicht geben; »den Gang zum Richtplatz und zur Verbrennung vollzieht allein Hus«, Luthers »Schicksal wird sich nicht wie das von Hus vollenden« [ebd. 286]. Der Schlußholzschnitt stammt wiederum aus einem anderen Augsburger Druck, Bämlers Historie von der Kreuzfahrt nach dem Heiligen Land von 1482. Laut Wacker sollte die altertümliche Darstellung des Aufrufs Papst Urbans II . zum ersten Kreuzzug von 1095 an die akute Türkengefahr erinnern – und davor warnen, die Kreuzfahrer wie weiland gegen die Hussiten nun gegen die Protestanten einzusetzen [vgl. ebd. 288f.].
Insgesamt repräsentiert der Neudruck von 1536 also nicht einfach nur das »schöne Holzschnittbuch« [Benzing 17], wie es Heinrich Steiner pflegte, auch ist es weit mehr als ein »wahrhaftes Volksbuch über das Konstanzer Konzil« [Feger 22]. Gisela Wacker erkannte »als hauptsächliche Wirkungsabsicht die Mobilisierung der öffentlichen Meinung« [Wacker 278] und die »Funktionalisierung des Konstanzer Konzils und der böhmischen Reformer für das Parteiinteresse der Reformkräfte im Reich« [ebd. 290]. Dazu paßt die kirchliche Situation in Augsburg, wo 1534 gegen den Widerstand der Fugger »durch Beschluß der Ratsmehrheit faktisch die Reformation eingeführt« [ebd. 272] worden war. Hier dürfen wir uns den Erstbesitzer und Zusammensteller unseres Bandes vorstellen, als einen weltlichen Amtsträger, dem es um das Reich und dessen Reform im protestantischen Sinne zu tun war. Eine solche Position wäre wenig später im Zuge der einsetzenden Konfessionalisierung kaum mehr haltbar gewesen – ähnlich wie »mit dem endgültigen Erlöschen der konziliaren Idee nach dem Konzil von Trient […] auch die Rezeptionsgeschichte der Richentalchronik« [ebd. 304] abbrach. Interessanterweise liefert unser Exemplar allerdings einen Anhaltspunkt für die fruchtbare Neuanknüpfung der Rezeption kurz vor dem Ende des Alten Reichs.
»Ex libris perillustr. Dni Equitis Fr. de Mayersfeld« ist auf dem Innendeckel zu lesen. Franz Ferdinand von Mayersfeld de Löwenkron muß vor der Mitte des 18. Jahrhunderts geboren sein, nach Aus-






kunft eines privaten Genealogieportals im Internet [mejenfeldt.nl] heiratete er 1769 in Wien, war Oberst und Kommandant in Kufstein und wurde 1780 in den österreichischen Adelsstand erhoben – nach diesem Datum muß der Sammelband also in seine Hände gelangt sein. Diverse österreichische Staatshandbücher führen ihn ab 1801 als »wirkliche[n] Hofsekretär in der Böhmisch-österreichischen Hofkanzlei« in Wien; laut dem Hof- und Staats-Schematismus des österreichischen Kaiserthums von 1812 war er »dermahl bey der geistl. Vermögens-Ausmittlungs-Hofcom[mission]« [S. 184] unter dem Vorsitz von Josef Karl Graf von Dietrichstein tätig.
Diese Information stellt ihn in einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Reformen Kaiser Josephs II . – in historischer Parallele zu der (kirchen)geschichtlichen Situation des 15./16. Jahrhunderts: Man denkt unwillkürlich an den Versuch der Schaffung einer von der päpstlichen Autorität unabhängigen österreichischen Staatskirche. Dabei betrachtete sich der Staat als Verwalter der weltlichen Güter der Kirche, deren Vermögen ab 1782 in einen zentralen Religionsfond überführt wurde – mit dessen »Ausmittlung« war auch der Hofsekretär Franz von Mayersfeld beschäftigt. Seine spätere Spur führt nach Mähren, wo er sich in Leipnik, dem heutigen Lipník nad Becvou, als Tabakshändler selbständig machte – wohl nicht zufällig: Die Herrschaft Helfenstein, in der das Städtchen lag, befand sich im Besitz der Familie seines Dienstherrn Dietrichstein. Dort starb er 1837. Damit besteht zugleich eine regionalgeschichtliche Verbindung zu der Konzilschronik, insbesondere zu den böhmischen Märtyrern Jan Hus und Hieronymus von Prag. Inwieweit Mayersfeld aus dem Sammelband konkrete Argumentationshilfen für seine politische Haltung bezog, oder ob ein ›antiquarisches‹ Interesse überwog, ist nicht zu ermitteln – er selbst stand an einer historischen Zeitenwende. 1804 verkaufte er seine »Gemälde- und Büchersammlung« [Handbuch 232] an das Prämonstratenserkloster Neureisch (Nová Rise) in Mähren, aber offenbar nicht den vorliegenden Sammelband. Eine etwas spätere Hand trug auf dem Titel ein: »Bibliothecae Illustris. Dni Equitis Franc Mayersfeld de Löwenkron«. Die Schreibweise des Vornamens verrät nur, daß der Schreiber tschechischer Zunge gewesen sein muß.
Literatur: Nicht bei Adams; BM STC German 729; nicht bei Brunet (nur Erstdruck); vgl. Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 353; Dodgson II , S. 110, Nr. 8; Ebert 5083; Feger; Graesse II , 246; Muther 1109; Neufforge 465; VD 16 R 2202; Wacker. – I.: Radbruch; Roth, S. 188, Nr. 17; VD 16 D 1071; II .: VD 16 W 4388; III .: BM STC German 64; vgl. Geisberg, Nr. 777-798 (Ausgabe 1507: Wolf Traut); Roth, S. 83, Nr. 150; VD 16 B 262; IV.: BM STC German 758; Schottenloher, Bibliographie III , 28151; VD 16 D 765.
This bulky, presumably Augsburg pigskin binding combines the second printing of Ulrich Richental’s famous Chronicle of the Council of Constance of 1536 with four editions of important court orders from the years 1531 - 1535, including the first edition of the Constitutio Criminalis of Emperor Charles V. The problems and reform ideas raised in the Council of Constance with regard to church and empire were also virulent in the Reformation period, which explains the unusual compilation of texts. The colouring of the Council chronicle, which ends after two thirds of the book but includes almost all of the 42 large woodcuts, yet only the minority of the more than 1100 coats of arms, indicates that the first owner was not a nobleman but rather a politically ambitious citizen of the imperial city of Augsburg, where the Reformation was effectively introduced in 1534 by majority vote of the council.


[Holbein , Hans d. J.]. Historiarum ueteris instrumenti icones ad uiuum expressæ. Vnà cum breui, sed quoadfieri potuit, dilucida earundem expositione. Lyon, Melchior und Caspar Trechsel [für Jean und François Frellon], 1538.
A-M 4 = 48 Bl.
Mit Holzschnitt-Druckermarke auf dem Titel, 92 Holzschnitten nach Hans Holbein und einer Holzschnitt-Kartusche mit Grotesken um das Kolophon auf dem letzten Bl.
Klein-Quart (187 x 130 mm).
Olivgrüner Maroquinband um 1880 auf fünf mit Goldfileten versehene Bünde, mit goldgeprägtem Titel in zwei und stilisiertem Dornblatt-Stempel in doppeltem Goldfiletenrahmen in den übrigen Rückenfeldern; auf den Deckeln breite, von Fileten gerahmte Dornblatt-Bordüre um ein freigelassenes Mittelfeld, mit doppelten Goldfileten auf den Steh- und breiten Goldbordüren aus Blattranken und Fileten auf den Innenkanten, mit marmorierten Vorsätzen und Gold- über marmoriertem Schnitt, auf dem Spiegel signiert von Chambolle-Duru (Bl. K1 unter Verwendung alten Papiers fachgerecht angerändert, alte Anmerkungen auf Bl. M2 und die alte Foliierung in der oberen Ecke der Blätter ausgewaschen).
Provenienz: Gestochenes Wappenexlibris von Sir David Salomons auf dem Spiegel; Ausschnitt aus Salomons Broomhill Library Catalogue, 1916, Nr. 2562, auf Vorblatt montiert. – Exlibris der Bibliotheca Philosophica Hermetica von Joost Ritman in Amsterdam.
[Holbein , Hans d. J.]. Icones historiarvm Veteris Testamenti, Ad viuum expressæ, extremáque diligentia emendatiores factæ, Gallicis in expositione homœoteleutis, ac versuum ordinibus (qui priùs turbati, ac impares) suo numero restitutis. Lyon, Jean Frellon, 1547.
Mit Holzschnitt-Druckermarke auf dem Titel, 94 Holzschnitten nach Hans Holbein und 4 Porträtmedaillons in Holzschnitt auf dem vorletzten Bl. Klein-Quart (181 x 120 mm).
Nachtblauer Maroquinband des späten 19. Jahrhunderts auf glatten Rücken, mit goldgeprägtem Titel, floralen Einzelstempeln und gepunkteten Querfileten auf dem Rücken; auf den Deckeln zwei blindgeprägte Rahmen, der innere mit goldenen Eckfleurons, mit marmorierten Vorsätzen und Ganzgoldschnitt.
Provenienz: Auf einem Vorblatt Wappenexlibris von John Savile, dem 4. oder 5. Earl of Mexborough, auf Methley Hall, Yorkshire.


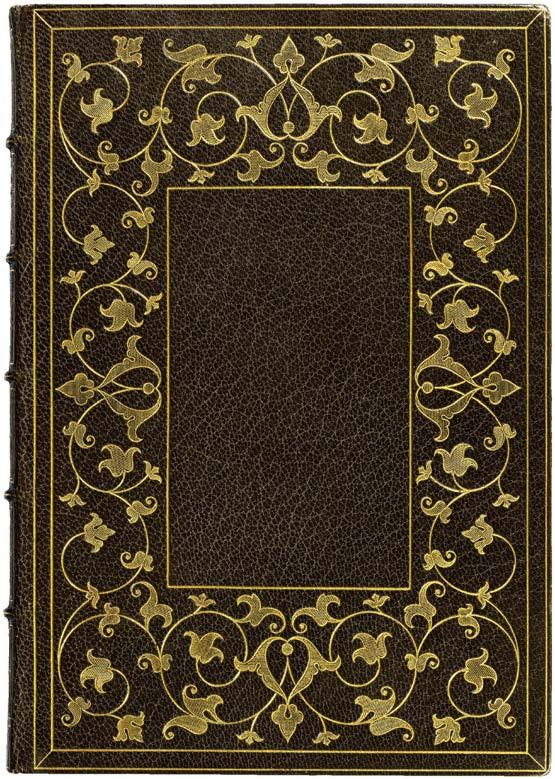


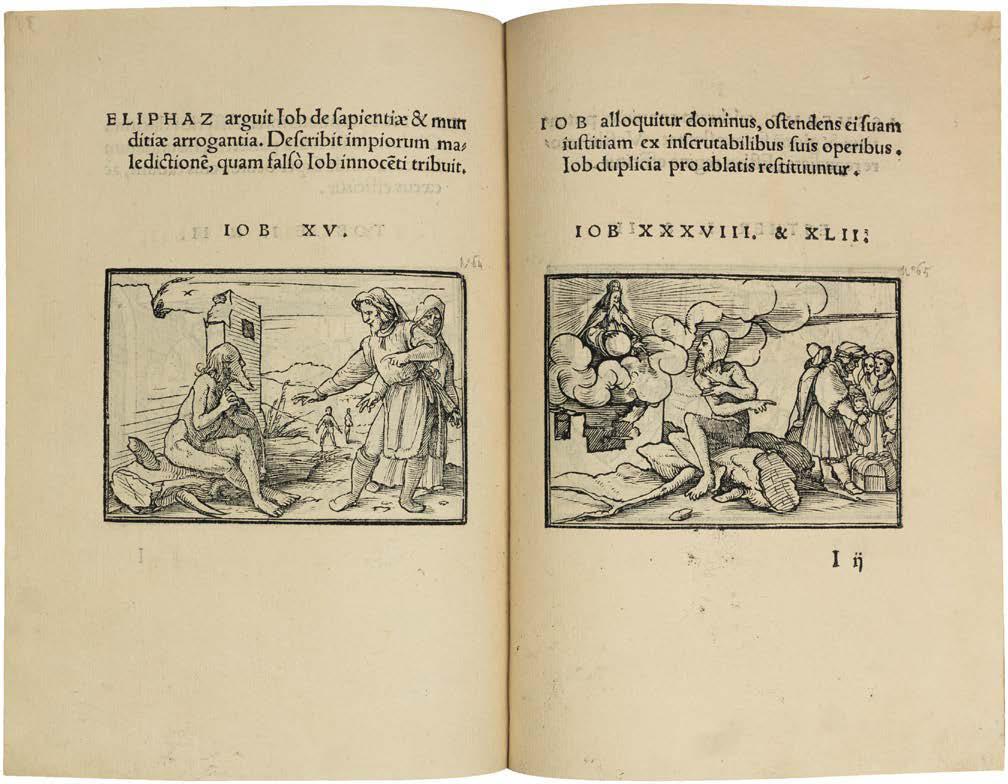


Die großartige Zeichnungen Hans Holbeins d. J. zum Alten Testament dienten bereits 1531 als Vorlage für die Illustration von Froschauers deutscher Bibel, doch wurden damals bei weitem nicht alle Szenen ausgeführt. Vollständig erschien der Holzschnittzyklus, geschnitten von Veit Specklin, 1538 zuerst in einer Folio-Bibel und noch im gleichen Jahr als separate Bilderfolge mit einem Geleitwort von François Frellon: Hier werden die einzelnen Szenen von kurzen lateinischen Beschreibungen und Angaben der entsprechenden Bibelstellen begleitet. Gegenüber der Bibel tritt bei diesem Bildbändchen »der stärker erbauliche Zweck« [Hieronymus 1984, 499] deutlich hervor. Dies zeigt sich schon an den ersten vier Bildern zur Geschichte von Adam und Eva, die den ebenfalls bei Trechsel gedruckten Les simulachres […] de la mort [vgl. Vial 29 und Hieronymus, 1984, Nr. 441] entnommen wurden.
Von der Erstausgabe der Separatfolge sind zwei Varianten bekannt, hier liegt der zweite Druck mit den größeren Lettern für die Lagensignaturen I-M vor. Außerdem sind zwei Holzschnittpaare der Lage I vertauscht. Exemplare sind »fort rares« [Brunet]. Die hochbedeutende Holzschnittfolge liegt hier in einem sehr schönen, breitrandigen Bibliophilen-Exemplar in einem Einband mit historisierendem Dekor von Chambolle-Duru aus der Bibliothek des großen Sammlers Sir David Salomons (1851 – 1925), Tunbridge Wells, vor.
Die Bilder, »remarquablement belles dans cette édition« [Baudrier] und »gravées avec beaucoup de délicatesse« [Brunet], hatten großen Erfolg, weitere Ausgaben erschienen in rascher Folge. Ab der zweiten Ausgabe von 1539 wurde der Bildbestand um zwei Holzschnitte vermehrt, ferner um ein Vorwort in lateinischen Versen von Nicolas Bourbon, das den Namen des Künstlers nennt: »Holbius est homini nome[n]« [Bl. A2]. sowie um ein französisches von Gilles I Corrozet, der laut Delaveau/ Hillard »sans doute« auch der Autor der französischen Vierzeiler unter den Bildern war.
Der hier vorhandenen Ausgabe von 1547, die in der ersten Druckvariante mit den bei Delaveau/ Hillard u. a. genannten Merkmalen vorliegt, wurden noch vier weitere Holzschnitte am Schluß des Büchleins hinzugefügt: ovale Medaillons mit den Porträts der Evangelisten von der Hand eines anderen Künstlers. Die Holzschnitte wurden nochmals von den originalen Stöcken abgezogen [vgl. Brun]. Auch später wurden die Bilder häufig kopiert; ihr Einfluß auf die Bibelillustration ist unübersehbar [vgl. van der Coelen 69ff.].
Literatur: Adams B 1963 (nicht Ausgabe 1538); Baudrier V, 175 und 209; BM STC French 68; Brun 130f.; Brunet III , 252f; vgl. Delaveau/Hillard, Nr. 1252 (die andere Druckvariante) bzw. Nr. 1258; Graesse III , 317; Hieronymus, 1984, Nr. 442a bzw. 442b und S. 497ff.; Leemann-van
Elck 1938, 49f.; Lonchamp, Français II , 226; Mortimer, French, Nr. 277 (vgl. ebd. die andere Druckvariante, Nr. 276) bzw. Nr. 281; Müller 1997, 105.1-4 und 108; Neufforge 307 (Ausgabe 1547); Passavant III , S. 360f., a und e; Rahir 461; J. Vial.
This separate edition - 48a - of 1538 contains the first impression of Hans Holbein’s series of pictures on the Old Testament, cut by Veit Specklin. It is of great rarity. The copy comes from the collections of Sir David Salomon and Joost Ritman. 48b contains four other previously unprinted woodcuts.


Fuchs, Leonhart . De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati, adiectis earundem vivis plusquam quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effictis & expressis […]. Basel, M[ichael] Isengrin, 1542.
Α 6 β 8 A-Z6 a-z 6 aa-zz 6 aaa-fff 6 = 14 Bl., 896 S., 2 Bl. – S. 34 bei der Zählung übersprungen, nach S. 60 korrigiert. – Mit schmaler Marginalspalte gedruckt, Explicatio (2 Bl.) zweispaltig, Register vierspaltig.
Mit Druckermarke auf Titel und letztem Blatt, ganzseitigem Verfasserporträt auf der Titelrückseite, 3 Porträts der Illustratoren auf dem vorletzten Blatt und 512 Pflanzendarstellungen (davon 508 ganzseitig), alles in Holzschnitt und koloriert; mit einer gezeichneten, aquarellierten, signierten und 1552 datierten Schmuckkartusche des Illuminators Hubert Cailleau auf dem vorletzten Blatt verso; ferner mit zahlreichen Holzschnitt-Initialen.
Groß-Folio (355 x 233 mm).
Mit grünem Samt bezogener moderner Holzdeckelband auf vier Bünde, mit durchbrochenen EckBuckelbeschlägen und zwei Schließen mit Beschlägen aus ziseliertem Messing, mit Ganzrotschnitt; in grüner, mit Filz ausgeschlagener Halbmaroquinkassette mit goldgeprägtem Rückentitel (Titel leicht angeschmutzt, mit Restaurierungen an den Rändern und ergänztem Eckausschnitt, dadurch teilweise Verlust eines alten Eintrags, erstes Widmungsblatt angerändert, Schlussblatt an Kopf und Bund angerändert sowie mit Restaurierungen, einige Bl. mit weiteren unauffälligen Randrestaurierungen, Abb. S. 329 minimal angeschnitten, gegen Ende kleines Wurmloch im Außensteg).
Die Erstausgabe des berühmtesten aller Kräuterbücher, koloriert vom Hofmaler der Maria von Ungarn
Leonhart Fuchs (1501 – 1566) aus Wemding galt als Wunderkind. Bereits mit zwölf Jahren begann er in Erfurt das Studium der Philosophie und Naturlehre; 1519 wurde er Schüler Johannes Reuchlins in Ingolstadt, 1524 erwarb er den medizinischen Doktortitel, 1526 wurde er Professor. Als überzeugter Lutheraner begab er sich 1528 als Leibarzt in die Dienste des Markgrafen Georg des Frommen von Brandenburg nach Ansbach; 1535 holte ihn Herzog Ulrich von Württemberg an die Universität Tübingen. Dort richtete er sich mit seiner großen Familie im früheren »Nonnenhaus« der Beginen ein, wo er auch einen Arzneipflanzengarten anlegte.
Das Kräuterbuch des Leonhart Fuchs, unvergleichlich illuminiert von Hubert Cailleau, dem Hofmaler der Königin Maria von Ungarn, vielleicht das schönste bekannte Exemplar dieser Grundlegung der Botanik







Dieser lieferte einen großen Teil der Vorlagen für die 1542 veröffentlichten Commentarii – das »most beautiful« [PMM], »most famous« [Garrison/Morton], »most celebrated« [Dibner, Horblit] und »großartigste Kräuterbuch« [Heilmann] aller Zeiten. In alphabetischer Ordnung ihrer griechischen Namen beschreibt Fuchs neben 400 einheimischen auch 100 ausländische Pflanzen – mehr als doppelt so viele wie sein Vorgänger Otto Brunfels. Allein 40 Arten beschrieb er zum ersten Mal [vgl. Hunt], darunter »many new plants from America« [Dibner]. Die lateinische Erstausgabe richtete sich vor allem an Ärzte und Apotheker; im Vorwort gibt Fuchs einen geschichtlichen Abriß der Verwendung von Pflanzen in der Medizin. Gegenüber den Vorläufern bedeutet der Text »insofern einen Fortschritt«, als Fuchs im Gefolge des Humanismus »den arabischen und arabistischen Autoren endgültig abgesagt« [Nissen, BBI 44] und sich den antiken Quellen selbst zugewandt hat. Astrologie, »Symbolik und Aberglauben« werden aus der Medizin zugunsten einer »Renaissance des alten Griechentums« [Heilmann 205] verbannt.
Blieb sein vorwiegend von pharmazeutischen Anwendungen handelnder Text »noch dem Buchwissen verhaftet«, so interessierte sich Fuchs als Botaniker für die Pflanzen als solche – hier trat »eigenes Naturstudium in den Vordergrund«. Fuchs vermittelt »Kenntnisse über Vorkommen, Formen und Lebensgeschichte und läßt die Pflanzen deswegen in einer idealen Form – mit Wurzeln und mit allen Stadien der Entfaltung von der Knospe über die Blüte bis zur reifen Frucht, ohne Rücksicht auf die natürlichen Größenverhältnisse abbilden« [Fünf Jahrhunderte]. Schon daß auf über 500 Folio-Seiten »nur unversehrte und ausgewachsene Exemplare« dargestellt werden, war für Claus Nissen Beleg genug, daß der Botaniker auch auf die Illustration »einen bestimmenden Einfluß« ausübte. Noch »unmittelbarer spürt man seine Hand […], wenn etwa der besseren Kenntlichkeit zuliebe bald hier ein Blatt, eine Blüte dort anders gestellt ist als an der lebenden Pflanze« [Nissen, BBI 44]. Aber Fuchs ließ den Stuttgarter Malern Albert Meyer und Heinrich Füllmauer »auch zu künstlerischen Effekten freie Hand«; schön zu sehen etwa bei »Efeu und Clematis, deren Blätter und Zweige […] ein sehr ausdrucksvolles Ornament bilden« [ebd. 45]. Blunt sah auch hier das puristische Ideal der Renaissance am Werk: »Fuchs’s artists tended to idealise their plants as the Greek sculptors idealised their heads« [Blunt 51].
Der Autor und die beteiligten Künstler waren sich ihrer Leistung vollkommen bewußt: Während sich Leonhart Fuchs auf der Titelrückseite gegenüber seinem Vorwort von Hans Burgkmair [vgl. Neufforge] als Ganzfigur auf ganzer Seite porträtieren ließ, erscheinen die Mitarbeiter als Halbfiguren am Ende des Werkes: Albrecht Meyer, wie er eine vor ihm in der Vase stehende Blume zeichnet, Heinrich Füllmauer, der eine Zeichnung auf den Holzstock überträgt, und der Straßburger Formschneider Veit Rudolph Speckle. »Erstmals werden somit in einem Buch auch die Illustratoren im Bilde gewürdigt« [Fünf Jahrhunderte].
Unsterblichen Ruhm gewann das Werk aufgrund der Abbildungen, die »neben ihrer künstlerischen Vollkommenheit auch eine botanische Genauigkeit und Brauchbarkeit aufweisen, die niemals wieder übertroffen worden ist« [Nissen, BBI 44], die zum »Maßstab für die spätere botanische Buchillustration« [Fünf Jahrhunderte] wurde, und die man bis an die Schwelle der Gegenwart auch in wissenschaftlichen Werken benutzte, »da es bis heute nichts Schöneres und künstlerisch Wertvolleres gibt« [Heilmann 205]. Unterstützt wird ihre Wirkung durch das großzügige Layout (Nissen
spricht gar von »Papierverschwendung« [Nissen, BBI 46]), die Sorgfalt »in typographischer und drucktechnischer Hinsicht« [ebd. 45] und den Druck auf »crisp, white paper« [Blunt 49]. Veit Rudolph Speckle übertrug die Illustrationen in feinen Umrißlinien und ohne Schraffierungen auf die Holzstöcke. Zwar begründete Fuchs dies im Vorwort damit, daß buchstäblich kein Schatten auf die Klarheit des Dargestellten fallen solle, doch deutet dies wohl auch auf die von vornherein beabsichtigte Kolorierung hin [vgl. ebd. 51]. Nissen bezweifelte dies, aus Sorge um die zierlichen Graphiken, »jedenfalls käme nur eine sorgfältige, miniaturähnliche Ausführung in Frage, wenn man sie nicht verschlimmbessern will, und in der Tat sind gut kolorierte Exemplare noch seltener als beim Brunfels’schen Werk« [Nissen, BBI 46].
Dem hier vorliegenden Ausnahmeexemplar hätte jedoch auch Nissen seine Bewunderung nicht versagt. Sämtliche Holzschnitte wurden illuminiert von einem französischen Miniaturmaler ersten Ranges, der sein Werk in einer reizenden Kartusche 1552 datierte und signierte: Hubert Cailleau (um 1526 – 1590) aus Valenciennes, Hofmaler der Maria von Ungarn, der Schwester Kaiser Karls V. und Statthalterin der spanischen Niederlande. Den Auftraggeber der Illumination unseres Werkes kennen wir nicht: Sein Name, den Cailleau selbst um dessen Æternae Memoriæ willen in die von einer geflügelten weiblichen Memoria-Figur bewachte Kartusche eintrug, wurde mit brauner Tinte penibel getilgt, nur noch die Initialen »H« und »P« sind zu erahnen. Doch möchten wir ihn gleichfalls im unmittelbaren Umfeld Marias vermuten, wo auch das Werk selbst einen besonderen Ruf genossen haben mochte: Der Protegé von Leonhart Fuchs, Georg von Brandenburg, war auch Vormund und Erzieher von Marias früh verstorbenem Gatten Ludwig Jagiello gewesen. Ihr kaiserlicher Bruder erhob Fuchs 1555 ohne dessen Zutun in den Adelsstand.
Noch heute werden in Douai acht liturgische Handschriften aufbewahrt, die Cailleau zwischen 1544 und 1570 für die unweit von Valenciennes gelegene Abtei Marchiennes illuminierte. Sie zeigen »einen geschmackvollen Miniaturisten, der besonders in den Bordüren, welche Alexander Bening zu Ehren gebracht hatte, Eleganz und reiche Erfindungsgabe besitzt. Der Stil der Miniaturen selbst ist kalt und ohne Erfindung, er zeigt den Einfluß der italienischen Renaissance, die mit ihrem Eindringen Eigenheit und Kunst der Niederlande vernichtete« [Thieme/Becker]. Gerade diese Erfahrungen Cailleaus in der – allmählich aus der Mode kommenden – vegetabilen Bordürenmalerei, verbunden mit einer gewissen Nüchternheit, empfahlen ihn für die Aufgabe, Pflanzen nicht mehr als Beiwerk religiöser Texte, sondern ›nach der Natur‹ zu illuminieren. Damit war er möglicherweise das Vorbild, auf jeden Fall ein historischer Vorläufer seines Antwerpener Landsmannes Georg Hoefnagel. In unserem Kräuterbuch lief Cailleau zu künstlerischer Bestform auf. Sein überaus feines und präzises Kolorit zeichnet sich zusätzlich durch eine außergewöhnlich differenzierte Farbgestaltung aus, die weit über das zu seiner Zeit übliche Muster hinausgeht und durch Mischungen, Schattierungen und Variationen im Farbauftrag eine faszinierende Naturnähe von Blatt- und Wurzelwerk, Blüten und Früchten erzielt. Zu den gedruckten lateinischen und deutschen Pflanzennamen fügte er auch die französischen in sorgfältiger Kalligraphie hinzu, oft in mehreren Namensvarianten. Die Abbildungen sind in unserem außerordentlich schönen und durchaus breitbrandigen Exemplar stets unangeschnitten, mit der einzigen Ausnahme der überblattgroßen Darstellung der Mistel [S. 329]. Das einzige in den letzten Jahrzehnten






aufgetauchte Exemplar von vergleichbarem Anspruch war dasjenige des großen Sammlers JacquesAuguste de Thou, angeboten 2012 im Katalog eines New Yorker Antiquariats (Nr. 4: $ 950.000). Aus den dort und anderweitig gegebenen Farbabbildungen geht unzweideutig die Superiorität unseres Exemplars im Kolorit hervor, das differenzierter, abwechslungsreicher, feuriger und wohlmöglich auch botanisch genauer ist als das von de Thou.
Weitaus sprechender und entlarvender noch ist der Vergleich mit Leonhard Fuchs' eigenem Exemplar der deutschen Version von 1543, „New Kreuterbuch“, wovon soeben (2021) ein originalgetreues Faksimile im Taschen-Verlag erschienen ist (heute aufbewahrt in der Stadtbibliothek Ulm): obwohl Fuchs hier das Kolorit selbst vorgab und überwachte, ist es mit der Schönheit, Farbintensität und Differenziertheit unseres Cailleau-Exemplars in keiner Weise vergleichbar: weder ist die Kolorierung annähernd so vollständig ausgeführt, noch ist der Farbauftrag auch nur von fern vergleichbar intensiv bzw. detailliert oder leuchtend und im raren Fall, wo Farben einigermaßen übereinstimmen, ist das Fuchs-Exemplar bei weitem gröber und pauschaler in der Färbung. Demnach dürfte unsere Behauptung, dieses sei das schönste Exemplar überhaupt, keinen Widerspruch mehr auslösen.
Leonhart Fuchs amtierte insgesamt sieben Mal als Rektor der Universität Tübingen; für die 1557 abgeschlossenen Ergänzungen zu seinem Kräuterbuch fand er jedoch bis zu seinem Tod 1566 keinen Drucker. Was bleibt, sind die Bilder der Pflanzen aus seinem Garten und aus aller Welt: »Volle zwei Jahrhunderte, ja vielleicht bis zur Gegenwart [hat] die botanische Illustration in ihrem Bann gestanden« [Nissen, BBI 47].
Provenienz: 1552 datierter Vermerk Æternae Memoriæ (ubi prius opera Huberti / Caillou Vallencenatis colorum lineamentis / ad vivum exornari iussisset…Anno domini 1552 des Illuminators Hubert Cailleau mit getilgtem Namen des Erstbesitzers »H… P…«? Wir sind zuversichtlich, die zweifelsohne bedeutende Provenienz zu ergründen. – Zuletzt Liechtensteinischer Privatbesitz.
Literatur: Adams F 1099; Arber 64ff. etc.; Blunt 48ff.; Brunet II , 1415; Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 175; Dibner 19; Durling 1675; Ebert 7983; Fünf Jahrhunderte 87; Garrison/ Morton 1808; Graesse II , 642; Heilmann 205ff.; Horblit 33b; Hunt 48; Lonchamp, Suisse 1117; Meyer IV, 312f.; NDB 5, 681f.; vgl. Neufforge 508f. (deutsche Erstausgabe); Nissen, BBI I, S. 44ff. und Nr. 658; PMM 69; Pritzel 3138; Sparrow 72; Stillwell III , 372 = IV, 640; Stübler, S. 234ff. und Nr. 37; VD 16 F 3242. – Zu Cailleau: Thieme/Becker 5, 360f.
The most famous of all herbal books is offered here in the first edition of 1542. The author Leonhart Fuchs describes 400 native and 100 foreign plants, 40 species for the first time ever. Not only he himself, but also the illustrators Albert Meyer and Heinrich Füllmauer as well as the mould cutter Veit Rudolph Speckle are honoured with portraits - a novelty in the history of books. The illustrations, unsurpassed in their accuracy and beauty, remained the standard for botanical book illustration for centuries. The present exceptional copy was illuminated by Hubert Cailleau, court painter of Queen Mary of Hungary, up to the year 1552 in an extremely staggering and yet botanically precise manner and provided with a large watercolour colophon, presumably for a recipient from the inner circle of his patroness, if not for the Queen herself.


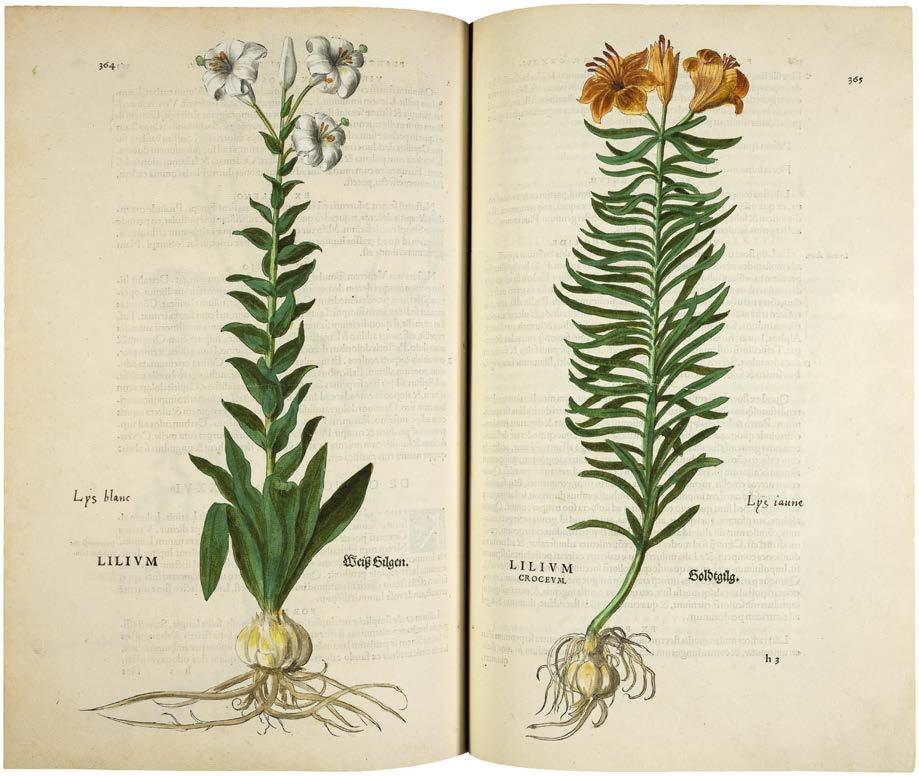
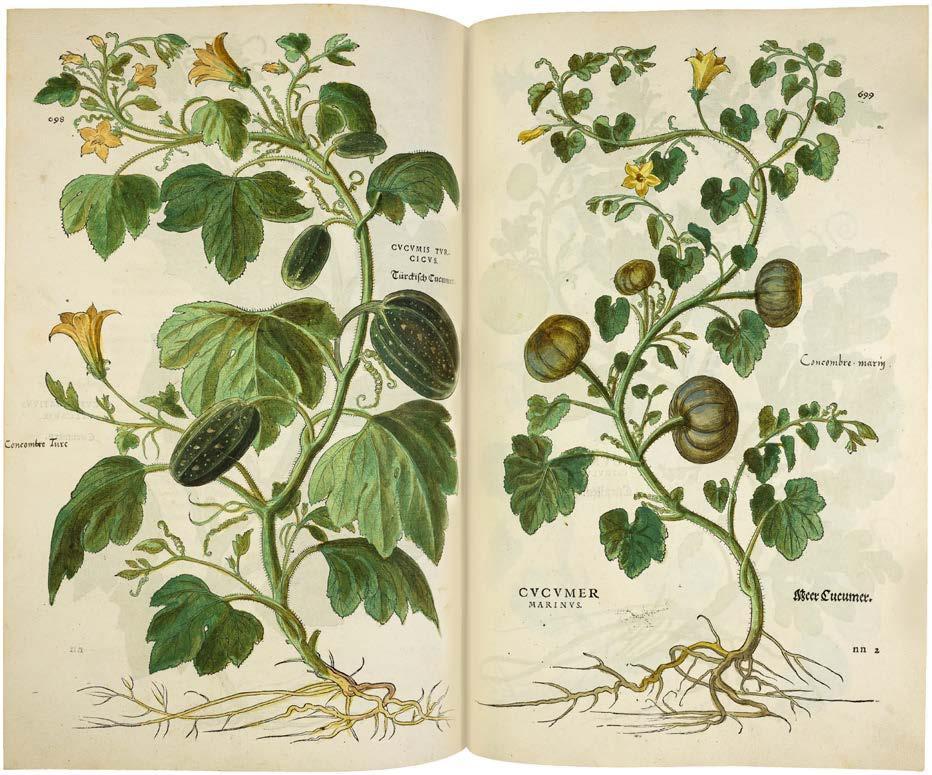






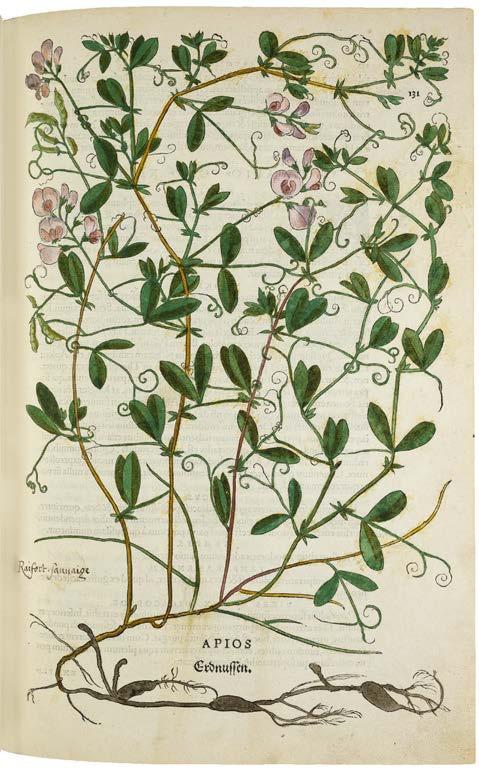


















Stumpf, Johannes . Gemeiner Loblicher Eydgnoschafft Stetten/ Landen vnd Völckeren Chronicwirdiger thaaten beschreybung. Hierin[n] wirt auch die gelegenheit der gantzen Europe/ Jtem ein kurtzuergriffne Chronica Germanie oder Teütschlands/ in sonders aber ein fleyssige histori vnd ordenliche beschreybung Gallie oder Franckrychs fürgestellt/ darauff den[n] obgedachte der Eydgnoschafft beschreybung volget. Welchs alles mit gar schönen Geographischen Landtaflen/ Contrafetischem abmalen der Stetten/ Fläcken vnd Schlachten/ auch mit vilen alten vnd herrlichen Waapen/ künigklicher/ fürstlicher vnd Edler geschlächten oder Geburtstaflen fürgebildet […]. 2 Bde. Zürich, Christoph Froschauer, 1548.
LLL 4 MMM 6 = 6 Bl., 332 gezählte Bl., 9 Bl. (Register), 1 leeres Bl. Und: 466 [statt: 467] gezählte Bl., 1 Bl. Errata, 9 Bl. (Register), 1 leeres Bl. – Im zweiten Band fehlt das leere Blatt II 4 = 188. – Mit schmaler Marginalspalte gedruckt, Register dreispaltig. – Titel in Rot und Schwarz gedruckt.
Mit Druckermarke auf dem Titel, 23 Karten, davon 8 ganzseitig und 5 als doppelblattgroße, auf Stegen montierte Tafeln, ca. 3900 Abbildungen (von ca. 2500 Stöcken, darunter über 1900 Wappen), mit einigen Stammtafeln und Zeit-Leisten sowie zahlreichen Schmuckinitialen, alles in Holzschnitt.
Folio (ca. 390/395 x ca. 241/248 mm).
Blindgeprägte Kalblederbände von Brosius Faust über abgeschrägten Holzdeckeln auf fünf mit Fileten versehene und von Doppelfileten begleitete Bünde; auf den Deckeln Rahmenwerk aus Blindfileten und vier verschiedenen Rollen- sowie Einzelstempeln, in waagerechten Streifen, vorn oben Titel- und Bandbezeichnung, unten die Initialen »T V D«, hinten die Jahreszahl »M D X I«; mit neuen ziselierten Messingschließen (behutsam restaurierte Einbände mit leichten Schabspuren, die ersten drei Bücher mit deutlichen Fingerspuren, sonst nur gelegentlich fleckig, Bd. II: durchgehend wenige, auf den letzten Bl. zunehmende Wurmlöcher, fast ausschließlich im weißen Rand, erste Lagen und letzte Bl. mit Nässerändern, wenige Randeinrisse, Bl. 287 mit langem, aber sauber geschlossenem Einriß).
»Die größte Leistung des schweizerischen Buchdrucks« des Jahrhunderts
Die 1547/48 erschienene Schweizer Chronik des Johannes Stumpf ist »die erste und jahrhundertelang einzige gedruckte eidgenössische Geschichte, die alle Teile des Landes gleich eingehend« beschreibt und so zur »Schweizer-Bibel« wurde. Die auch gesondert herausgegebenen 13 Landtafeln »stellten den ersten und lange Zeit einzigen Atlas eines Staates dar« und sind zugleich »eines der
Die erste illustrierte Schweizerchronik, in zwei datierten Einbänden von

frühesten Denkmäler des sich selbst bewusst gewordenen, von jeder Bindung befreiten, souveränen eidgenössischen Staates« [Weisz 14]. Stumpfs »Monumentalwerk« [ebd.] wurde eine »Grundlage der schweizerischen Geschichtsschreibung« [Staedtke 84]. Indem der Text zugleich den Übergang vom alemannischen Dialekt zur neuhochdeutschen Schriftsprache vermittelt, gehört er »zu den bedeutendsten Sprachdenkmälern der Schweiz im 16. Jahrhundert« [Feller/Bonjour 183; vgl. Staedtke 84]. Autor, Verleger und Hauptillustrator waren keine gebürtigen Schweizer, jedoch eingebunden in ein Beziehungsnetz, in dem sich das geschichtliche und geistige Aufblühen des soeben reformierten Zürich ebenso spiegelt wie die kulturelle und politische Emanzipation Gemeiner Loblicher Eydgnoschafft.
Der Theologe Johannes Stumpf (1500 – 1577/78) kam über Freiburg und Basel 1522 als Prior in das Ordenshaus Bubikon im Zürcher Oberland. Hier schloß er sich der Reformation Zwinglis an, mit dem er Freundschaft schloß. Als nach Zwinglis Tod Darstellungen erschienen, die den Reformator »in ein schiefes Licht stellten«, entschloß sich Stumpf, ihm zunächst im Rahmen der chronikalischen Arbeit seines Schwiegervaters Heinrich Brennwald ein »würdiges Denkmal zu setzen« [Weisz 8]. Sein erstes publiziertes Werk war eine 1541 gedruckte Beschreibung des Konstanzer Konzils [vgl. Wyss 194]. Doch unter dem Eindruck der humanistischen Geschichtsschreibung weiteten sich seine Interessen auf die allgemeine Landesbeschreibung und Sittenschilderung aus. So behandeln die ersten drei Bücher der Chronik Europa, Deutschland und Frankreich, das vierte die Geschichte der Schweiz von Cäsar bis zur Lösung der Urkantone von Österreich 1314, das fünfte bis zwölfte die Schweizer Landesteile und das dreizehnte die eidgenössische Geschichte von 1314 bis zur Gegenwart Stumpfs. Wenn er als »reiner Berichterstatter« [Wyss 195] schrieb, so gleichwohl aus einer bestimmten Perspektive, die sich gegenüber seinen früheren Arbeiten sogar »radikal verschoben« hatte. Die politischen Grundlagen dafür wurden mit den Siegen der Eidgenossen im Burgunder- und im Schwabenkrieg gelegt, die kulturellen durch den Humanismus, dem die »feste Umschreibung eines idealisierten Nationalcharakters« [Weisz 8] zur vornehmsten Aufgabe des Historikers wurde. Die Eidgenossen erscheinen nicht mehr in die Reichsgeschichte eingebunden, sondern »erstmals als eine alte, selbständige, von Deutschen und Franzosen streng zu unterscheidende Nation« [ebd. 10]. Insofern ist es nur konsequent, wenn Strumpf nicht mehr nur annalistisch berichtet, sondern sein Werk »auf topographisch-historischer Grundlage« [Feller/Bonjour 182] aufbaut. Im Jahr 1544 unternahm er sogar eine Fußreise durch die gesamte Schweiz, um in Klöstern unbekannte Quellen zu erschließen und römische Inschriften zu kopieren. Ist einerseits »die patriotische Tendenz gegen die Fürsten« [ebd. 185] unübersehbar, so will Stumpf andererseits »dem Ausland beweisen, daß die Schweiz nicht revolutionären Ursprungs sei« [ebd. 183]. Mit Blick auf die inneren Verhältnisse übt er »Mäßigung und Versöhnlichkeit in konfessionellen Fragen« [ebd. 185]. Seinen einheimischen Zeitgenossen will er demonstrieren, »wie einig, wie stark einst die Schweiz gewesen, während ihr jetzt wegen der ausgebrochenen Uneinigkeit die Gefahr der Schwäche drohe« [ebd. 183]. So kommt in Stumpfs Schweizerchronik eine speziell »helvetische Renaissance mit ausgeprägt nationaler Färbung« [Weisz 10] zum Ausdruck.
Unterstützung erhielt Johannes Stumpf insbesondere von Aegidius Tschudi, Heinrich Bullinger und Joachim Vadian, der sogar als »der wahre Autor großer Teile des Stumpff’schen Werkes« [Wyss


194] gelten kann. Dank Vadians Bibliothek standen ihm zudem »reiche literarische Quellen zu Gebote« [ebd. 195]; sein nicht vollständiges Schriftenverzeichnis nennt 152 Autoren [vgl. Weisz 10], eine Vielzahl, die den Quellenvergleich und damit einen methodischen Fortschritt ermöglichte [vgl. Feller/Bonjour 182]. Daneben verwendete Stumpf auch »die mündliche Überlieferung, ferner bildliche Darstellungen, Münzen, Siegel, Wappen« [ebd. 183], was sich in der überreichen Illustration des Werkes niederschlug.
Ohne den aus Bayern zugewanderten Druckherrn Christoph Froschauer wäre das Werk nicht realisierbar gewesen. Aus seinen Pressen gingen »die Werke hervor, die – historisch gesehen – die reformierte Kirche begründet haben«. Für Zürich leitete er damit eine »Blütezeit des Buchdrucks, der Buchillustration und des Verlagswesens« [Staedtke 13] ein, die mit dem Blick über den Schweizer Tellerrand verbunden war: Frankurt war mit seiner Buchmesse »bis in die fünfziger Jahre hinein der größte Absatzmarkt seiner Bücher« [ebd. 14]. Die Niederlage von Kappel und der Tod Zwinglis 1531 brachten Rückschläge, die Froschauer ausglich, »indem er das Schwergewicht seiner Buchproduktion in erweitertem Maße auch auf die Wissenschaft verlagerte« [ebd. 17]: In diesem Kontext steht die große Schweizerchronik des Johannes Stumpf.
Eigens für die Chronik richtete Froschauer in seiner Druckerei ein Zeichen- und Formschneideatelier ein – das erste überhaupt in Zürich – und engagierte dafür 1544 Heinrich Vogtherr den Älteren (1490 – 1556). Dieser hatte bei Hans Burgkmair in Augsburg gelernt und sich 1526 in Straßburg niedergelassen, wo er vor allem als Buchillustrator tätig war. Bis 1546 zeichnete er für die Chronik rund 400 Illustrationen, wohl direkt auf den Stock [vgl. Leemann-van Elck 1952, 46], unterstützt von dem »zeichnende[n] Formschneider VS « [ebd.]. Vogtherrs Monogramm » HVE « ist nur einmal, allerdings an prominenter Stelle zu sehen: gleich zu Beginn des Buches auf der herzförmigen Weltkarte [Bl. 2], die bereits anderwärts gedruckt worden war [vgl. Shirley 86]. Von ihm stammen auch die 13 großen Landtafeln, von denen fünf doppelblattgroß sind [vgl. Leemann-van Elck 1935, 20]; Stumpf hatte zu ihnen (mit Ausnahme der zum 13. Buch) die Entwürfe geliefert [vgl. ebd. 11; Feller/Bonjour 184]. Generell arbeitete Vogtherr »ziemlich selbständig; die Vorlage dient ihm nur als Anstoss, und meistens arbeitet er nach dem Texte aus der Phantasie« [Leemann-van Elck 1935, 32]. Paul Leemann-van Elck ließ Vogtherr, einem »der geschicktesten Illustratoren um die Mitte des 16. Jahrhunderts« [ebd.], eine ausführliche Würdigung zukommen: »Es sind die schönsten, künstlerisch bedeutendsten, plastischsten Abbildungen, die sich durch exakte, ins Einzelne gehende, überaus bewegte Darstellung kennzeichnen; das Figürliche ist, trotz der häufig vorkommenden Ueberfülle, gut durchkomponiert und geschickt angeordnet«, der »von einem leicht erhöhten Standpunkt aus« gesehene Raum »perspektivisch gut proportioniert. Der Künstler steht ganz auf dem Boden der Renaissance und befleissigt sich einer sachlichen Darstellung« [ebd. 24]. Dabei bewahre Vogtherr sich ein offenes Auge »für urwüchsiges Volksleben, das er ungeschminkt meisterhaft zu schildern versteht. Der ihm eigene Realismus und die damit verbundene Vorliebe zur Darstellung des Derben und Schaurigen kommt in den mit fast sadistischer Breite zur Schau getragenen Folter-, Hinrichtungs-, Greuel- und Mordszenen zur Geltung« [ebd. 28]. Insgesamt liefere Vogtherr »lebendige Beiträge zur Sittengeschichte« [ebd. 28].


Nach dem Weggang Vogtherrs und des Meisters VS im Jahr 1546 spielte der Zürcher Maler Hans Asper (1499 – 1571) bei der Illustration der zweiten Hälfte der Chronik die Hauptrolle. Auch seine Initialen finden sich an signifikanter Stelle, auf dem Porträt Zwinglis [Teil II , Bl. 163; vgl. Leemann-van Elck 1935, 38ff.]. Zuvor war er »im Auftrage Froschauers in der Eidgenossenschaft herumgereist«, um weitere »Örtlichkeiten für die Chronik zu skizzieren« [Leemann-van Elck 1952, 46]; ab dem Spätherbst 1546 übertrugen er und Rudolf Wyßenbach die Zeichnungen auf die Stöcke [vgl. ebd. 47], die von zwei Brüdern Wyßenbachs geschnitten wurden [vgl. Staedtke 19]. Den Stil dieser zweiten Hauptgruppe von Illustrationen charakterisierte Leemann-van Elck als »gediegen, korrekt, trocken, etwas pedantisch und dann und wann von der Gotik noch nicht völlig gelöst. Aus den Bildern spricht schlichte Sachlichkeit […]. Der reformatorisch-aszetische und somit zürcherische Geist beseelt sie« [Leemann-van Elck 1935, 44]. Zwar stünden sie künstlerisch denen Vogtherrs nach, doch sei es womöglich auch Aspers Absicht gewesen, durch »seine mehr schematische Darstellungsart« [ebd. 45] bewußt »volkstümlich zu wirken« [ebd. 44]. Nicht zuletzt dadurch sind diese Abbildungen »in kultureller und topographischer Hinsicht von Bedeutung und verleihen der Chronik bleibenden Wert« [ebd. 45].
Die Besitzgeschichte zeugt von dem anhaltenden Interesse, das dem Werk weit über die Schweiz hinaus entgegengebracht wurde. Die beiden reich dekorierten Einbände stammen laut der Jahreszahl auf den Hinterdeckeln aus dem Jahr 1561; von den Rollenstempeln läßt sich derjenige mit Christus, David, Paulus und Johannes dem Täufer aufgrund der Schreibweise der Legenden mit Hilfe der Einbanddatenbank exakt bestimmen: Es handelt sich um eine Rolle des Dresdener Buchbinders Brosius Faust [w003995], die Haebler bereits auf einem Einband von 1556 identifizierte [r002342 = Haebler II , 143]. Faust war laut Einbanddatenbank von 1554 bis 1578 tätig und 1564 Mitbegründer der Dresdener Buchbinderinnung. Bestätigt wird die Zuweisung an ihn indirekt durch die Initialen »T V D« auf den Vorderdeckeln; der dritte Buchstabe »D« läßt sich wohl mit »Dresden[sis]« auflösen. Zwar können wir den Auftraggeber des Einbands nicht identifizieren, doch weil Faust auch für Kurfürst August von Sachsen arbeitete, könnte der Besitzer der gewichtigen Schweizer Chronik ebenfalls aus Hofkreisen stammen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Verteilung der zarten Unterstreichungen in Rot: Sie finden sich lediglich in den ersten drei Büchern auf den Karten und im Text und dienen der allgemeinen geographischen und historischen Orientierung. Unterstrichen sind etwa Namen und Begriffe wie »Francken«, »Celtae«, »Tacitus«, »Attila«, »Adel« und »der erst Teütsch Keyser« Karl der Große. Die Information, daß »Papst Johannes in offnem Eebruch ergriffen/ und erstochen« wurde, dürfte vor allem für einen lutherischen Leser von Interesse gewesen sein. Generell finden sich die Unterstreichungen nur in den Büchern, die über »Europa«, »Germania« und »Gallia« handeln; der zweite Teil des dritten Buchs über »Franckrych« und in Sonderheit die Bücher über »Helvetia« und die Schweizer Landschaften waren von minderem Interesse. Sie wurden nur an einer einzigen Stelle kommentiert. Im Buch über die »Lepontier« (Tessiner) handeln einige Kapitel »Von allerley thieren im Alpgebirge« [Bl. 286v], eines allein vom possierlichen Murmeltier, das indes auch in den Kochtöpfen landete: »Man isset jr vil in den Alpischen lendern«. Stumpf selbst lief bei dieser Vorstellung schon das Wasser im Munde zusammen: »Als denn sind sy vast gut nit allein im pfäffer/ sond auch bei
rüben oder kappiskraut kochet. Sy sind gar feißt/ doch ist jr feißte nit wie andere feißte oder späck/ sonder lieblich zeessen«. Im gleichen Atemzug beteuerte er: »Es ist ein rein un[d] sauber thierlin wo man sy zeücht/ sy thund ir notturfft nit in ir näst/ sonder suchend etwan ein besondern heimlichen winkel darzu/ dareyn sy brüntzlend vnd ire bönle legend. […] Es schmöckt und wilteret starck/ so es läbt/ gleych wie die meüß« [Bl. 289v]. Dem Dresdener Hofmann behagte das aber überhaupt nicht, vor allem, wenn er »schmöckt […] wie die meüß« mit »schmecken« statt »riechen« übersetzt haben sollte. Wie auch immer: Er unterstrich die letzten vier Worte und setzte an den Rand: »Nec gustavi, nec gustabo«. Das köstliche Mißverständnis über die Schweizer als Murmeltier- oder Mäusefresser ist einerseits zum Piepen, andererseits offenbart es auf delikate Weise das kulturelle Gefälle in der damaligen Wahrnehmung zwischen Alpenbewohnern und den Flachländern im Norden.
Im 17. Jahrhundert befand sich unser Exemplar im Besitz des Juristen Johann Jakob Brottwolf, der 1631 als Stadtschreiber und bis 1647 als Syndikus der Stadt Weißenburg in Bayern amtierte. Er besaß es »Jure hereditario«, hatte es also wohl von seinem Vater geerbt; wie und wann dieser es aus Sachsen nach Franken überführt hatte, können wir nicht rekonstuieren. Brottwolf verlor sein Amt in dem Jahr, als die protestantische Freie Reichsstadt von Truppen Tillys eingenommen und schwer geplündert wurde – ein Jahr vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Erst im späteren
18. Jahrhundert meldete sich wieder ein Besitzer mit seinem Namenseintrag: der Historiker Johann Paul Reinhard (1722 – 1779), Professor und Universitätsbibliothekar in Erlangen. Hatte Stumpfs Chronik für ihn noch einen historischen Quellenwert, so für einen späteren eher einen ›historistischen‹: Mit einem den mittelalterlichen Lautstand imitierenden Vermerk trug sich – vielleicht erst im 19. Jahrhundert – in »diß buoch« ein Dietrich Kleber ein, »der Zeit Schön[n]b. Hoffmaister«, also wohl ein Erzieher der Grafen Schönborn in Wiesentheid in Unterfanken.
Provenienz: Auf den Deckeln des Dresdener Einbands vorn in Blindprägung die Initialen »T V D«, hinten die Jahreszahl 1561 (»M D L X I«). – Auf dem Titel: »Jure hereditario possidet Joh: Jac: Brottwolf.«, also wohl Hans Jakob Brottwolf, bis 1647 Syndikus der Stadt Weißenburg in Bayern. – Darunter: »Jo. Paullus Reinhardus«, d. i. der Erlanger Historiker und Universitätsbibliothekar Johann Paul Reinhard (1722 – 1779). – Auf den fliegenden Vorsätzen verso archaisierender Besitzvermerk des 19. Jahrhunderts(?) von Dietrich Kleber »Schön[n]b. Hoffmaister«, also wohl bei den Grafen Schönborn in Wiesentheid. – Auktion Christie’s, London, 4.6.2008, Nr. 199 (£ 6.875 = Sfr. 14.500). – Europäische Privatsammlung.
Literatur: Nicht bei Adams; Barth 10216; BM STC German 839; Brunet V, 572; Ebert 21872; Feller/Bonjour 180ff. (mit 2 Abbildungen); Graesse VI /1 516; Leemann-van Elck 1940, 106ff. (mit Abbildungen); Lonchamp, Suisse 2819; Schottenloher, Bibliographie III , 33570b; VD 16 S 9864; Vischer C 376; Weisz; Wyss 193ff. – Zu den Illustrationen: Leemann-van Elck 1935; Shirley 86 (Weltkarte). – Zu Faust: Haebler I, 110-113; Schunke, 1943, 60ff.
The Swiss Chronicle of Johannes Stumpf, published in 1547/48, was the first to describe all parts of the country in equal detail and thus became the basis of Switzerland’s national self-image as well as its historiography. The 13 »Landtafeln« represent the first ever atlas of a state. The inclusion of pictorial sources, coins, seals and coats of arms was reflected in the abundant illustration with thousands of
woodcuts, for which Heinrich Vogtherr the Elder and, after him, Hans Asper were responsible. The greatest achievement of Swiss book printing of the century was realised by the Zurich printer Christoph Froschauer. Our first copy was bound in two dated calfskin volumes by the Dresden bookbinder Brosius Faust in 1561. Later it was owned by the lawyer and syndic of the town of Weißenburg in Bavaria, Johann Jakob Brottwolf, and the Erlangen historian and university librarian Johann Paul Reinhard.



