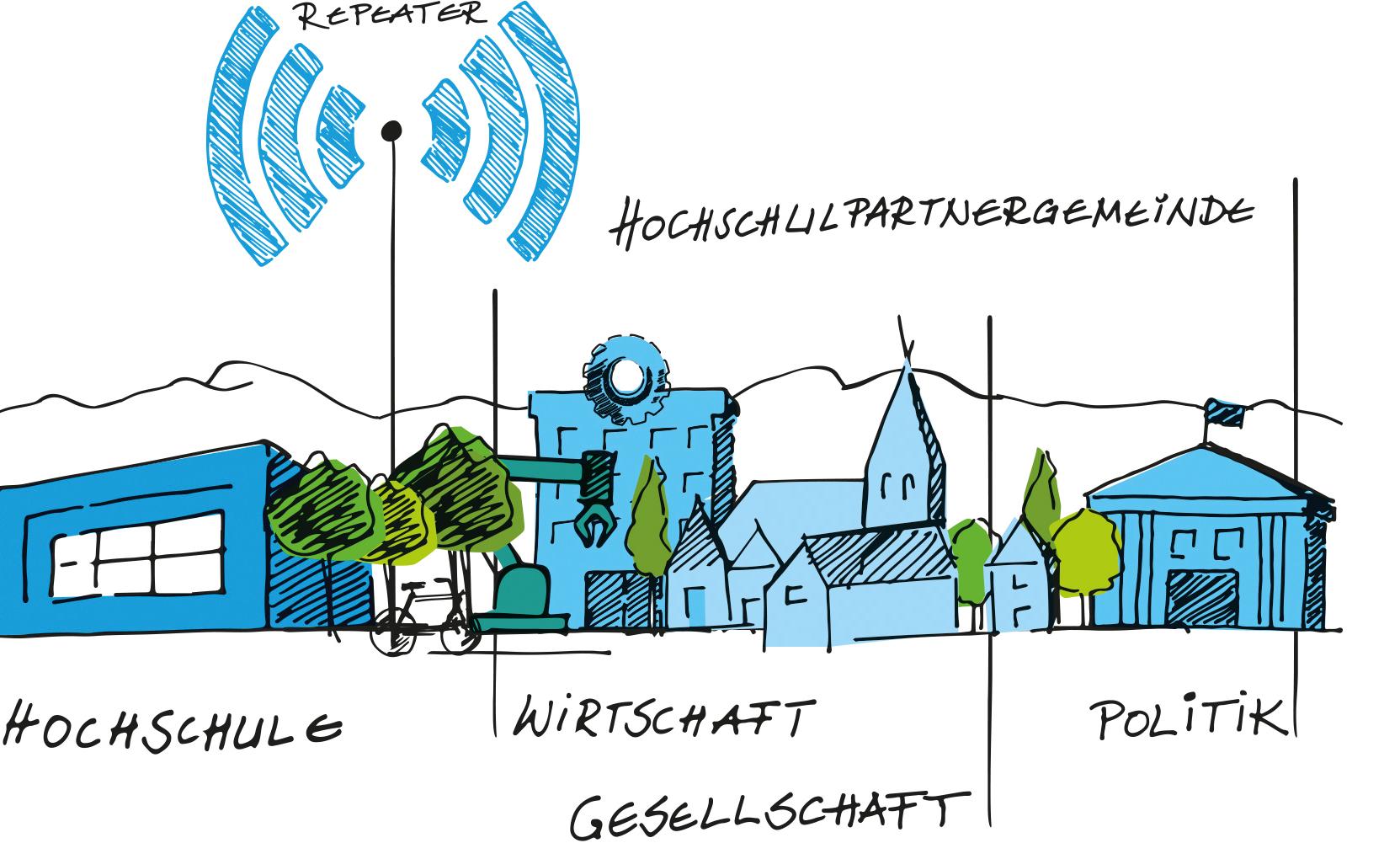15 minute read
Hochschulpräsident Hartmut Ihne
from "durchdringen -Klarheit schaffen, Barrieren überwinden, Gehör finden", Jahresbericht 2019 der H-BRS
Muss die Wissenschaft politischer werden?
Politik und Wissenschaft folgen ihren eigenen Agenden. Wie können sie künftig besser miteinander kommunizieren? Wie kann aus dem Nebeneinander ein Miteinander werden? Aus der Perspektive der Politik beziehungsweise der Wissenschaft argumentieren Norbert Röttgen, MdB und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, und Hochschulpräsident Hartmut Ihne.
Ɏ
Die Coronakrise hat das ganze Land in den Ausnahmezustand versetzt. Wie beurteilen Sie die Situation mit Blick auf die Hochschulen?
Prof. Dr. Hartmut Ihne: Die Krise bedeutet für Hochschulen eine immense Herausforderung. Zunächst versuchen Wissenschaftler Antworten zu finden – medizinisch, ökonomisch, gesellschaftspolitisch. Zudem definieren wir gerade die gesellschaftliche Rolle der Wissenschaft neu. „Unite behind the science“ heißt der Slogan von Fridays for Future. Noch dazu müssen wir die Hochschule unter großen Veränderungen am Laufen halten: Wir bewerkstelligen in der Krise eine rasante Umstellung auf E-Learning-Angebote. Das alles ist für eine komplexe, quasi-parlamentarische Organisation wie eine Hochschule eine große Aufgabe.
Norbert Röttgen: Aus der politischen Perspektive verdient ein Aspekt höchste Aufmerksamkeit: Bereits Mitte Januar wurde in Fachzeitschriften über die mögliche Dimension der Krise berichtet.
Schon Mitte Januar! Und als die wissenschaftliche Erkenntnis wenig später dem Laien zugänglich wurde, wurde sie dennoch politisch weitgehend ignoriert. Ich denke, beide Seiten sind gefragt: die Wissenschaft, warum sie nicht vernehmbar und wirksam Alarm schlägt, und die Politik, warum es ihr nicht gelingt, aufmerksam den Wissenschaftlern zuzuhören. Das müssen wir dringend aufarbeiten.
Ihne: Wissenschaft und Politik haben ihre je eigene Agenda. Bisher ist es uns nicht gelungen, diese produktiv zu synchronisieren. Wie kann der Graben überbrückt werden? Um die Kommunikation zu verbessern, müssen wir uns fragen, welche Aufgabe jeder hat und wie der andere tickt. Wissenschaft ist ein methodischer Prozess, der versucht, möglichst interessensneutral zu verlaufen. Wissenschaftler machen die Wahrheit ihrer Sätze und Satzsysteme davon abhängig, ob sie (a) logisch widerspruchsfrei durchdeklinierbar sind und – in den empirischen Wissenschaften – ob sie (b) im Experiment nachweisbar und wiederholbar sind. Die demokratische Politik macht dagegen die Wahrheit ihrer Sätze davon abhängig, ob sie eine Zustimmungsmehrheit finden. Das heißt, meine politische Idee ist ‚wirkungslos‘, solange ich keine parlamentarische Mehrheit bekomme. In beiden Welten existieren also unterschiedliche Wahrheitstheorien: in der demokratischen Politik das Mehrheitsprinzip, in der Wissenschaft das Prinzip der Logizität und der Überprüfbarkeit im Experiment. Das ist schon ein großer erkenntnistheoretischer, also fundamentaler, Unterschied. Röttgen: Das ist richtig, aber meinem Empfinden nach geht das Problem tiefer: Es herrscht auf beiden Seiten eine nicht mit der unterschiedlichen Natur der jeweiligen Welten zu erklärende Selbstgenügsamkeit. Wenn im aktuellen Fall der CoronaPandemie ein Wissenschaftler die Wahrheit empirisch erkennt, dann den Fall abschließt und nicht frühzeitig Alarm schlägt, dann ist das nur mit Selbstgenügsamkeit oder Selbstgefälligkeit zu erklären. Wenn dieses Nebeneinander von Politik und Wissenschaft schon in evidenten Katastrophenszenarien zu beobachten ist, dann frage ich mich, welche Kosten diese Kommunikationsstörung in anderen, weniger drängenden Fällen hat.
Ɏ
Aber aktuell sind Wissenschaftler in der Debatte sehr aktiv, und die Politik handelt auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Schlägt nicht gerade die Stunde der Wissenschaft?
Röttgen: Die Stunde der Wissenschaft schlägt in der vorausschauenden Beratung, Aufklärung und gegebenenfalls Warnung. Vor der Krise ist gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft gefragt. Ein banaler Vergleich dazu: Nicht erst, wenn das Auto liegen bleibt, schlägt die Stunde des Automechanikers, sondern vor Beginn der Reise. Insofern ist klar – jetzt, da die Katastrophe da ist, erleben wir die öffentliche Rolle der Wissenschaftler. Übrigens beobachte ich dabei einen Trend, dem wir entgegensteuern müssen: Politik darf nicht an die Wissenschaft übergeben. Wir müssen vermeiden, dass sich die demokratische Verantwortung hinter Virologen und Biologen versteckt. Das heißt, die wissenschaftliche

Erkenntnis ersetzt auch während einer Katastrophe nicht die demokratische Verantwortung und Entscheidungszuständigkeit. Das ist und bleibt Aufgabe der Politik.
Ihne: Was heißt es überhaupt, sich hinter ‚der Wissenschaft‘ zu vereinigen? Zu Beginn der Coronapandemie konnten wir beobachten, welche einseitige und damit unter Umständen problematische Richtung das nehmen kann: Denn da das Problem zunächst als Gesundheitsproblem wahrgenommen wurde, wurden die Virologen gehört. Zur Wissenschaft zählen aber genauso Ökonomen, Psychologen, Informatiker,
Im Gespräch während der Pandemie: mit Sicherheitsabstand und per Videoschaltung zur Interviewerin

Sozialwissenschaftler und viele andere. Jede Disziplin steuert ihre Perspektive zum Gesamtbild bei. Wie viele Kollateralschäden darf ich in einem Lockdown zulassen? Wo und wann muss ich das Land wieder allmählich öffnen, bevor gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen so kaputt sind, dass ein Takeoff nicht mehr möglich ist? Spätestens mit dem Lockdown wurde klar, dass zum Lebenserhalt nicht nur die medizinische Versorgung beiträgt, sondern das gesamte sozioökonomische System. Also auch funktionstüchtige Institutionen, Unternehmen, Organisationen, Arbeitsplätze. Die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, ist insgesamt ein lebenserhaltendes System und dient dem Schutz von uns Menschen. Ohne Institutionen, ohne Wirtschaft, ohne Arbeitsplätze könnten wir nicht überleben. Das Gesundheitssystem ist nur ein Teil dieses Gesamtsystems. Die Politik muss aber den gesamten Lebensschutz und seine fundamentalen Bedingungen im Auge haben, wenn sie uns wirklich schützen will. Es ist unethisch, nicht alles Relevante in politische Entscheidungen einzubeziehen.
Röttgen: Natürlich, Wissenschaft ist plural, divers, kontrovers – dies zu verkennen ist problematisch. Für die politische Abwägungsentscheidung ist es wichtig, Transparenz herzustellen und die widerstreitenden Aspekte sichtbar zu machen. Dies gelingt nur in einem Diskurs, an dem alle teilnehmen, die Wissenschaftler, die verantwortliche Politik und die Öffentlichkeit. Diesen Diskurs auch im Krisenverlauf aufrechtzuerhalten ist eine ganz wesentliche Stabilisierungsmaßnahme.
Ɏ
Welche Lehren sollten wir aus der gegenwärtigen Situation ziehen? Muss der Diskurs stärker institutionalisiert ablaufen als bisher?
Ihne: Ein kluger Kopf hat einmal gesagt: ‚Wenn du eine Botschaft hast, musst du den Ort der richtigen Akustik suchen‘. In der Wissenschaft treten wir aus dem Elfenbeinturm heraus, wir können Wirkungen erzeugen, aber müssen den Ort der richtigen Akustik wählen. Welches sind diese Orte, wo wir durchdringen wollen – sind es Fachkonferenzen oder Talkshows? Ist es das Parlament? Ich wünsche mir als Wissenschaftler sehr viel diskursivere Parlamente. In ein diskursives, aktives Parlament können sich Wissenschaftler einklinken. Dort sollten unsere Gegenwarts- und Zukunftsfragen aufgehoben sein. Heute sind die Debatten meist lahm, in Ausschüssen bereits verhandelt, erhalten geringe öffentliche Aufmerksamkeit. Zwar haben wir viele Expertenkommissionen, aber dringen sie wirklich durch? Es geht darum, eine gemeinsame Sprache zu finden; das ist extrem schwierig.
Röttgen: Ich stimme Ihnen zu, Herr Ihne, das Parlament muss seinen Beitrag zum Diskurs leisten, indem wir dort Debatten führen, deren Ergebnis
nicht schon am Anfang feststeht. Sondern der Verlauf der Debatte, wie argumentiert wird, entscheidet das Ergebnis mit. Wir Parlamentarier können das Parlament bei grundlegenden Weichenstellungen mit Selbstbewusstsein zu einem Ort von Entscheidungen machen. Das halte ich für eine ganz wesentliche Reform.
Aber wir schauen von unterschiedlichen Seiten auf das Thema. Ganz eindeutig muss auch die Wissenschaft politischer werden, indem sie ihre Verantwortung für die Wirkung ihrer Erkenntnisse klarer wahrnimmt. Deshalb muss sie sich mit den Besonderheiten der Politik und ihrer Langsamkeit auseinandersetzen und erkennen, dass es in der Politik auch um Mehrheit und Macht geht und Politik kein reiner Erkenntnisprozess ist.
Ɏ
Wie kann das gelingen?
Röttgen: Es muss ein aus der Wissenschaft heraus verändertes Bewusstsein geben. Das hängt an einzelnen Personen, nicht an Strukturen. Personen, die mehr öffentliche Wirkung für ihre Sache anstreben und sich nicht mit der Entdeckung der Wahrheit begnügen.
In der Regierung brauchen wir so eine Art Bundesrechnungshof für gefährliche globale Entwicklungen. Eine unabhängige Institution, die nicht darauf hinweist, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern die auf die Entwicklung aufmerksam macht, dass das Kind sehr bald in den Brunnen fallen könnte. Sie muss sich institutionell Gehör verschaffen können. Man könnte meinen, dafür seien die Ministerien zuständig. Aber alle Erfahrungen der letzten zehn Jahre zeigen, dass die Ministerien das nicht schaffen. Keine Regierung hat die Finanzmarktkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise oder jetzt die Pandemie kommen sehen.
Ɏ
Mehr öffentliche Einmischung – wie passt das zur selbstgestellten Aufgabe und Selbstbewertung der Wissenschaft, Herr Ihne?
Ihne: Die wissenschaftlichen Erfolgsparameter werden in Publikationen und Zitationen gemessen. Ein Gespräch mit dem Parlament oder ein Zeitungsinterview zählt nicht, selbst wenn man auf diese Weise viele Millionen Menschen erreicht. Wissenschaft will neutral und methodisch klar sein. Das reicht aber nicht. Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Denn Wissenschaft wird öffentlich finanziert und besitzt die Komplexitätsentschlüsselungstools, die es uns möglich machen, Zusammenhänge zu erkennen. Das schreit förmlich nach der Verpflichtung, diese gesellschaftliche Verantwortung der Wissenschaft – wie Sie eben gesagt haben, Herr Röttgen – neu zu definieren.
Wir müssen uns noch stärker öffnen. Genauso wie sich das Parlament seine Rolle zurückerobern und im 21. Jahrhundert neu konfigurieren muss, muss die Wissenschaft ihre Kommunikation neu gestalten, und zwar in einer Sprache, die die Menschen verstehen. Das können wir nicht nur Journalisten überlassen, sondern wir müssen selber klarmachen, wo die Relevanz einer Erkenntnis liegt. Röttgen: Wir können also festhalten: Zum Chancenpotenzial dieser Krise können wir die gesellschaftliche Anerkennung der Wissenschaft hinzufügen.
Das Gespräch wurde am 23. März 2020 geführt.
Norbert Röttgen

ist seit 2014 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, dem er seit 1994 angehört. Der heute viel geachtete Außenpolitiker war von 2009 bis 2012 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist Röttgen durch seinen Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II verbunden.
Gegen Armut und Einsamkeit
Mit dem Hennefer Start-up Obstkäppchen e. V. bekämpfen Alumnus Christopher Kossack und Carina Raddatz ein akutes Problem: Altersarmut. Für ihr Projekt finden sie Gehör, sogar bei der Bundeskanzlerin.
Alles beginnt in der Kölner Innenstadt, als Carina Raddatz eine Seniorin beim Sammeln von Pfandflaschen beobachtet. Bewegt und erschüttert von diesem Bild, beschäftigt sie sich genauer mit dem Thema Altersarmut und findet heraus, dass alleine in Köln über 14.000 ältere Menschen auf finanzielle Hilfe des Staates angewiesen sind. Ein sorgenfreies Leben ist den Betroffenen oftmals nicht gegeben, ebenso wenig wie eine gesunde Ernährung.
Sie will etwas bewegen, das Problem überwinden. Gemeinsam mit Schulfreund und Unternehmer Christopher Kossack, der Betriebswirtschaft an der H-BRS studierte, überlegt sie, was unternommen werden kann. „Ich bin immer ein Freund davon gewesen, etwas selber zu gründen und in die Hand zu nehmen“, erzählt Kossack. Im Sommer 2017 gründen die beiden in Hennef also das Social Start-up Obstkäppchen e. V. Die Idee: Ehrenamtliche versorgen von Altersarmut betroffene Menschen ein- bis zweimal im Monat mit Tüten voller Obst, Gemüse und anderen gesunden Lebensmitteln, um sie so bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährung zu unterstützen – kostenlos und anonym. Doch das Projekt wirkt auch der Einsamkeit entgegen: „Den Senioren sind nicht nur die Lebensmittel wichtig, sondern vor allem auch der zwischenmenschliche Kontakt“, sagt Kossack.
Auszeichnung durch Merkel
Bisher finanziert sich das junge Unternehmen ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Daneben hilft den Gründern die Auszeichnung der Initiative „Startsocial“, ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung sozialen und ehrenamtlichen Engagements, der unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel steht. „Von 300 Bewerbern wurden nur sieben als Bundespreisträger ausgezeichnet, darunter wir“, berichtet Kossack. Im Juni 2019 überreichte Merkel ihnen in Berlin persönlich einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro.

Danach zieht das Unternehmen Interesse von Menschen aus ganz Deutschland auf sich und befindet sich momentan in einer Umbruchphase. Schon bald soll eine gemeinnützige GmbH neben dem Verein gegründet werden, um zukünftig deutschlandweit Seniorinnen und Senioren zu unterstützen, die von Altersarmut betroffen sind.
Wir sind vorne dabei
E-Learning ist seit der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus wichtiger denn je. Viele Hochschulen müssen nun lernen, via Bildschirm zu den Studierenden durchzudringen. Die H-BRS geht voran.
Einsamer Campus, leere Hörsäle, Seminare per Videokonferenz – das Bild an deutschen Hochschulen im Jahr 2020 gleicht sich vielerorts. Dass E-Learning und virtuelle Lehre gerade in Zeiten von Corona zentrale Bestandteile des Studiums sind, ist mittlerweile jedem klar. Marco Winzker, Professor für Digitaltechnik und Mitglied im Direktorium des Zentrums für Innovation und Entwicklung in der Lehre (ZIEL), beschäftigt sich bereits seit sieben Jahren mit den Möglichkeiten und Vorteilen von E-Learning. „Das Thema entwickelte sich insgesamt langsam, aktuell erleben wir natürlich einen unglaublichen Schub.“
Für die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist Onlinelehre kein Neuland, durch die jahrelange Arbeit ist sie vielmehr Vorreiterin auf diesem Feld. „Wir haben eine sehr gute Grundinfrastruktur für E-Learning und können durch unsere Kenntnisse andere Hochschulen beraten. Wir sind ganz vorne dabei“, erzählt Winzker. Vor allem im Bereich der RemoteLabore (Onlinelabore) ist die H-BRS landesweit führend. Nicht alle deutschen Hochschulen sind schon so weit – viele Lehrende müssen die Barriere Digitalisierung erst noch überwinden und lernen, wie man mittels elektronischer Lehrangebote zu den Studierenden durchdringt. Doch die gegenseitige Unterstützung der Hochschulen ist groß: „Das Hochschulforum Digitalisierung bietet viel Informationen und Vernetzung, inklusive einer Anlaufstelle für diejenigen mit Nachholbedarf“, berichtet Winzker.
Es gibt einen Digitalisierungsschub
Wie sich die Hochschullehre verändern wird, nachdem irgendwann wieder Normalität eingekehrt ist, beschäftigt viele. Winzker prophezeit: „Es wird einen Digitalisierungsschub, einen Kenntnisschub und einen Erneuerungsschub geben, das Ganze gibt sehr viele Impulse. Doch ob es am Ende eine schnelle nachhaltige Trendwende sein wird oder E-Learning wieder stark zurückgefahren wird, bleibt abzuwarten.“
Eine Aufgabe für die Wissenschaftskommunikation
Viele Menschen begegnen künstlicher Intelligenz mit großer Skepsis. Was löst Vorbehalte und Ängste aus und wie kann die Wissenschaft zu den Menschen durchdringen? Oliver Ruf, Professor für Kommunikationswissenschaft und Medienpraxis, antwortet.
Warum sorgt das Thema künstliche Intelligenz für
Skepsis?
Das Verhältnis von Mensch und Maschine spielt eine große Rolle. Seitdem es Technologien gibt, die unter dem Verdacht stehen, bestimmte Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich dem Menschen zugeschrieben sind, existieren die Angst, etwas zu verlieren, und das Gefühl einer existenziellen Bedrohung. Das Bild, das wir heute von künstlicher Intelligenz in der Gesellschaft haben, ist dabei interkulturell differenziert. Dahinter steht jedoch meist ein gewisses Phantasma von Maschinen, wie es uns speziell die filmische Fiktion vormacht. Das heißt: Unser Bild von KI ist nach wie vor fiktional und medial geprägt. Und wir haben immer die Befürchtung, dass in jedem Moment eine Art Terminator durch die Tür kommen kann, der alle Menschen töten will und gar kein Interesse am Menschsein hat, sondern einem eigenen Existenzwillen folgt. Diese Vorstellung ist noch immer in vielen Köpfen vorhanden, obwohl dies unglaublich weit weg von der Möglichkeitsdimension künstlicher Intelligenz ist. Aber weil eine solche Darstellung gerade in der filmischen Narration funktioniert, haben wir den Eindruck, dass es vielleicht doch möglich sein könnte – es bleibt ein Gefühl des Unheimlichen zurück.
Ɏ
Wie kann die Wissenschaft dazu beitragen, dass
solche Barrieren überwunden werden?
Wir brauchen zwingend eine Wissenschaftskommunikation, die einerseits versteht, was technisch und technologisch gemacht wird, und die andererseits dazu in der Lage ist, diese Themen einer breiten Bevölkerung verständlich zu vermitteln, damit Vorbehalte, Ängste und Imaginationen abgebaut beziehungsweise abgeschwächt werden können. Diese Kommunikation muss dazu in der Lage sein, KI zu visualisieren, zu verbalisieren, realistisch darstellbar und nachvollziehbar zu machen, ohne deren kritische Reflexion zu vernachlässigen. Ich bin überzeugt davon, dass dies nicht die Aufgabe der Disziplinen sein kann, die diese Technologien entwickeln. Vielmehr brauchen wir ein eigenes Fach dazu – in jedem Fall die Medienkulturwissenschaft, im besten Fall die Philosophie.
Klarheit schaffen
Um den Klimawandel aufzuhalten, müssen innovative und nachhaltige Technologien die Märkte durchdringen. Welche Herausforderungen entstehen dabei?
Nachhaltige, innovative Technik wird im Hinblick auf den Klimawandel immer wichtiger, die Nachfrage wächst: nach Technologien zur umweltfreundlichen Stromerzeugung, nach Hybrid- und Elektroautos für eine klimafreundlichere Mobilität oder nach Smart-Home-Systemen für Energieeinsparungen in den eigenen vier Wänden. Die Herausforderung dabei ist, dass neue Technologien keine negativen Auswirkungen auf die Ökologie insgesamt und die Gesellschaft haben sollten.
„Forscher und Entwickler müssen die Auswirkungen in ihrer Gesamtheit auf dem Schirm haben“, sagt Stefanie Meilinger, Professorin für nachhaltige Technologien. Es ist nicht ausreichend, sich auf eine einzelne Umweltwirkung zu konzentrieren. „Beispiel Dieselgate: Da hat man sich sehr stark auf die CO 2 -Problematik fokussiert. Die Stickstoffemissionen wurden dabei aber zeitweise vollkommen vernachlässigt“, kritisiert sie. Eine Sensibilisierung für den Gesamtzusammenhang sei wichtig. Daher achten Meilinger und ihre Kollegen stets darauf, bereits bei den Studierenden das Bewusstsein für Wechselwirkungen zwischen technologischer, ökologischer und gesellschaftlicher Veränderung zu schärfen und nicht nur das technische Know-how zu vermitteln.
Den Blick weiten, Klarheit schaffen

Zu hohe Kosten bei der Entwicklung von nachhaltiger Technik werden oft als das erste und größte Hindernis genannt. „Für den Erfolg technischer Innovationen spielen jedoch viel mehr Dinge eine Rolle als nur die Kosten. Zum Beispiel politische Institutionen wie die EU“, meint Meilinger. „Sie geben die Rahmenbedingungen vor.“ Auch Akzeptanzfragen müssten vonseiten der Ingenieure und Hersteller beachtet werden: Wie ist die Haltung einer Gesellschaft und was beeinflusst sie? Was sind erfolgreiche Innovationspfade?
Das Wichtigste: „Den Blick weiten auf alle Faktoren, die dafür verantwortlich sind, ob sich ein Technologiepfad als Mainstream durchsetzt.“
45
Auf das Miteinander kommt es an
Das Leben an unserer Hochschule hat viele Facetten. Studierende kommen für einige Semester, erwerben neues Wissen, machen einen Abschluss – und verlassen die Hochschule wieder. Professorinnen und Professoren sowie (Gast-)Wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler lehren und forschen – manchmal nur für kurze Zeit, häufig auch über viele Jahre. Beschäftigte in Verwaltung, Bibliothek, zentralen Einrichtungen und Instituten tragen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben zu einer lebendigen Hochschule bei.
Nicht alles davon ist gleichermaßen sichtbar, und doch sind alle Akteure und Aktivitäten Teil eines gedeihlichen, abwechslungsreichen und harmonischen Lebens an der Hochschule.
Sichtbar wurden 2019 die zusätzlichen Seminarräume in Sankt Augustin und Rheinbach, der Auftakt zum Innovationscampus Bonn, das Projekt „Gesunde Hochschule“ mit seinen vielfältigen Aktivitäten, die Studieninformationstage, das Sommerfest sowie der Weihnachtscampus, die Aktivitäten der Studierendeninitiative „Green Campus“, Veranstaltungen der Kinderuni, der Unternehmenstag, die Absolventen- und die Stipendienfeier – um nur einige Highlights herauszugreifen. Eher im Hintergrund, aber nicht weniger wichtig, ist das Alltagsgeschäft. In zahlreichen Gesprächen geht es darum, Gehör zu finden, Barrieren zu überwinden und am Ende Klarheit darüber zu gewinnen, welche neuen Themen entwickelt, berechtigten Interessen berücksichtigt und Projekte angestoßen oder umgesetzt werden. Exemplarisch zu nennen sind die vielfältigen Maßnahmen zur Digitalisierung, zum Beispiel der verschiedenen Verwaltungsprozesse und der Lehre, die Besetzung zahlreicher Professuren und Honorarprofessuren, die Etablierung eines Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagementsystems, das Semestergespräch mit den Studierenden, die Beratungen und Beschlussfassungen der Gremien.
Nachhaltigkeit ist weiterhin ein prägendes Element in allen Bereichen: So haben wir 2019 bei der Energieversorgung auf 100 Prozent Ökostrom umgestellt und hierdurch ca. 26,3 Tonnen CO 2 eingespart. Außerdem wurde die Hochschule als Fairtrade-University ausgezeichnet.
Ohne Zweifel gibt es aber auch noch vieles, was sich optimieren ließe, um das Leben an der Hochschule noch besser zu gestalten. Auf das Miteinander kommt es dabei an!
Angela Fischer
Kanzlerin