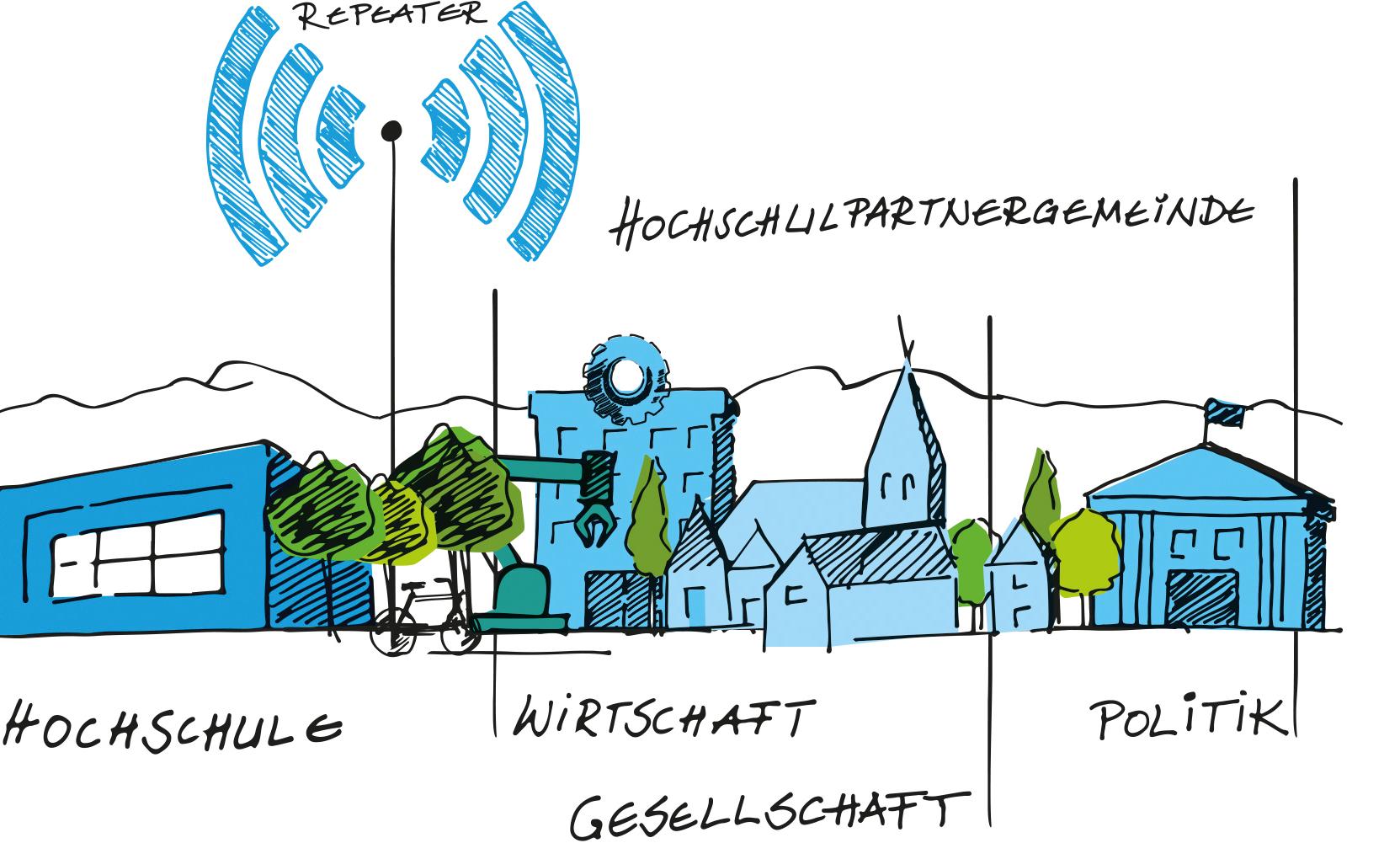1 minute read
Artenvielfalt bewahren – Biodiversitätsforschung
from "durchdringen -Klarheit schaffen, Barrieren überwinden, Gehör finden", Jahresbericht 2019 der H-BRS
Im Umkreis von Naturschutzgebieten (Karte oben) untersuchen Forscher im DINA-Projekt die Auswirkungen landwirtschaftlicher Nutzung auf Insekten
Artenvielfalt bewahren
Internationales Zentrum für Nachhaltige Entwicklung beteiligt sich an Projekt zu Biodiversitätsforschung
Die Vielfalt unseres Ökosystems ist bedroht. Besonders der Insektenschwund ist ein zentrales Thema. Was können wir dagegen tun? Auf diese und andere drängende Fragen will das Forschungsprojekt „Diversity of Insects in Nature Protected Areas“ (DINA) Antworten finden. Das Internationale Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zählt zu den acht Projektpartnern, darunter die AG Spezielle Botanik der Justus-LiebigUniversität Gießen und der Entomologische Verein Krefeld. Die Leitung liegt beim Naturschutzbund (NABU).
Wie soll die Natur vor weiterer Verarmung gerettet werden? Diese Frage treibt IZNE-Direktorin Wiltrud Terlau um. Deshalb engagiert sich die Professorin als Vorstandsmitglied des Bonner Biodiversitätsnetzwerks BION. Aus diesem Netzwerk stammen Partner für das seit Mai 2019 laufende DINA-Forschungsprojekt.
Pionierprojekt in der angewandten Biodiversitätsforschung
Als interdisziplinäres Forschungsvorhaben untersucht DINA die Auswirkungen landwirtschaftlicher Nutzung im Umkreis von Naturschutzgebieten auf die Biodiversität. Im Detail geht es um Insekten in bundesweit 21 ausgewählten Naturschutzgebieten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Vorhaben mit gut 4 Millionen Euro. In den Naturschutzgebieten aufgestellte sogenannte Malaise-Fallen fangen Insekten, die anschließend untersucht werden. Aufgestellt und überprüft werden die Fallen meist von Ehrenamtlichen. „Die Interdisziplinarität und Zur Zählung und Identifizierung nutzen Forscher im DINAProjekt sogenannte Malaise-Fallen (rechts)

eine gute Zusammenarbeit mit den nichtwissenschaftlichen Partnern sind wesentlich für das Gelingen des Projekts. Wir können viel von- und miteinander lernen“, betont Terlau.
Das IZNE identifiziert alle relevanten Interessengruppen – etwa Landwirte und Anwohner –, um gemeinsam nach Lösungen für den Erhalt der Biodiversität zu suchen. Gelingen soll dies durch qualitative und quantitative Studien, später sollen die Beteiligten in sogenannten Social Labs Gehör finden. Das Projekt dient der Faktenfindung. „Im Fokus der Artenschutzdebatte müssen Fakten und nicht Emotionen stehen, sonst kommen wir nicht weiter“, kommentiert die wissenschaftliche Projektmitarbeiterin Angela Turck die politische Tragweite. Aus den Forschungsergebnissen sollen sich konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. DINA läuft bis April 2022 – genug Zeit, um wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur in die Artenschutzdebatte einzubringen, sondern auch in Taten umzusetzen.