Klima
Klasse


Inhaltsverzeichnis Klasse 3
Vorwort

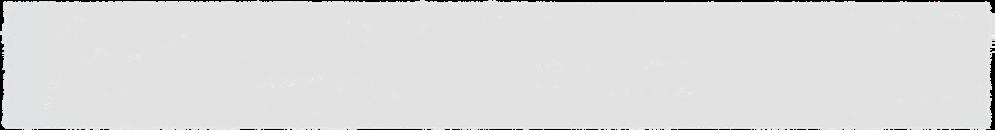
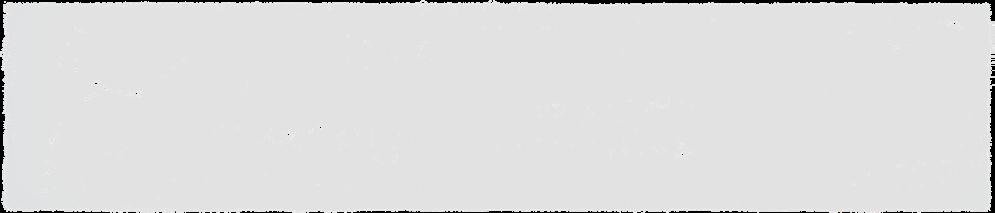





Vorwort

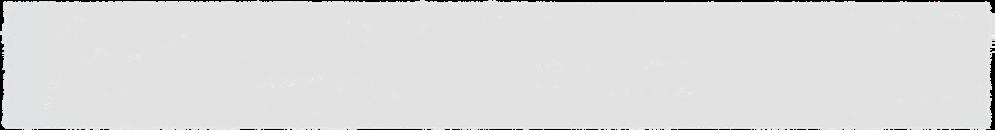
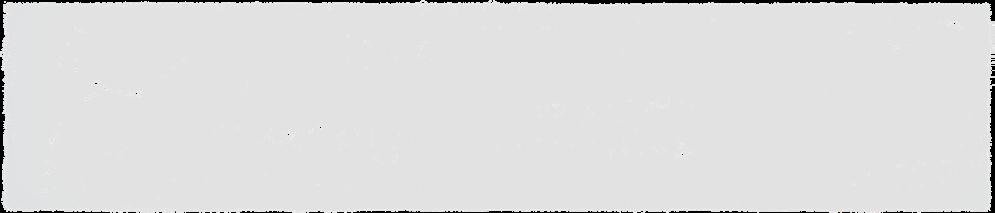






Liebe Kinder, wenn etwas kompliziert wird, sagen Erwachsene oft zu Kindern: „Lass das mal lieber uns machen.“ Manchmal versprechen sie Dinge, die sie nicht ein halten. Bestimmt fällt euch dafür auch ein Beispiel ein.
Bei einer sehr wichtigen Sache halten sie ihre Verspre chen seit vielen Jahren nicht ein. Es ist die Klimakrise. Wenn wir sie nicht aufhalten, könnte die Erde sich schon bald stärker aufheizen als von der letzten Eiszeit bis heute. Dabei wissen wir schon lange, was wir tun müssen. Wir dürfen bereits in wenigen Jahren kein Erdöl, kein Erdgas und keine Kohle mehr verbrennen. Denn dabei entsteht das Gas Kohlendioxid, das die Erde erhitzt. Das bedeutet: keine Benzin- und Dieselautos, keine normalen Flugzeuge, keine Öl- und Erdgasheizungen und keine Kohlekraftwerke mehr. Stattdessen müssen wir Solaranlagen, Windkraftanlagen und Elektroautos nutzen. Außerdem sollten wir viel weniger Fleisch und Milchprodukte essen. Von Kindern erwarten Erwachsene, dass sie dazulernen und sich anders verhalten, wenn es gefährlich wird. Bei der Klimakrise schaffen sie das selbst aber nicht. Das hat in den vergangenen Jahren vielen Kindern Angst gemacht. Sie haben unter dem Namen Fridays for Future gestreikt und demonstriert.

Dadurch konnten sie die Welt bereits ein bisschen besser machen, denn nun reden alle über die Klimakrise. Die Regierung verspricht, endlich wirksame Maßnahmen gegen die Erderwärmung einzuleiten. Es ist wichtig, dass ihr wisst, was wir gegen die Klimakrise tun können, die Regierungen und auch jede und jeder Einzelne von uns.
Dann könnt ihr sehen, ob die Erwachsenen ihre Versprechen einhalten. Denn dabei geht es um eure Zukunft!







Du kennst vielleicht die Kinder Ellist, Youlaf, Mo und Stewa schon aus den anderen Schuljahren. In den eBooks stellen sie viele Fragen, diskutieren miteinander und vermitteln euch einige Klimafakten. Sie sind wie du älter geworden.


Immer noch beschäftigen sie sich intensiv mit Fragen des Klimawandels. Manchmal gehen sie sogar gemeinsam zu Demonstrationen für den Klimaschutz. Sie haben zwischenzeitlich vieles gelernt und einige Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler kennengelernt.






Ellist kümmert sich immer noch gern um alle. Er fragt sich, wie es allen Menschen auf der Erde gut gehen kann. Vor allem die Fragen, wie seine Freunde und Freundinnen jetzt und zukünftig gut miteinander leben können, beschäftigen ihn. Wichtig ist ihm, wie man in Streitsituationen zu gemeinsamen Lösungen kommen kann, bei denen niemand benachteiligt wird. Er hat sich wie die Wirtschaftswissenschaftlerin Elinor Ostrom die Frage gestellt, wie man knapper werdende Ressourcen gerecht verteilt. Frau Ostrom hat 2009 den �� Nobelpreis für ihre Forschungen in Fischerdörfern bekommen. Erinnerst du dich an das Fischerspiel in Klasse 2? Da geht es um die Regeln, die Frau Ostrom empfiehlt!
Ellist mag Tiere und Natur immer noch sehr. Er isst hin und wieder Fleisch und trägt ganz selbstverständlich seine Sneaker. Seine Schuhsammlung wird immer größer. Darüber muss er nachdenken, weil er das eigentlich nicht o. k. findet. Braucht man mehr als ein Paar Schuhe? Ellist hat Ideen, wie er diese Zwickmühle den anderen erklären kann. Das gibt regelmäßig lange Diskussionen mit seinen Freundinnen und Freunden.


Rerum, sit, volum alit aut ratendam lab omniam deles qui ipsumquisqui occum adi dolorrovit eiunt, tessequi quia pro molum sandest qui nimpernam, od moluptat fugia consendunt plignim esti dolum quo qui volo rem vidi volupis et dolupta tionse laciteni di res ut as etus inihill itaspit hil et etur? Oluptat ioreprae laborep taspistotata cumquia eratur simus dolora doloreprovid enimolum corrorias volorepta parum quid et quianda aute


Mo, 8 Jahre Mo redet nach wie vor leidenschaftlich gern. Sie möchte ihre Gedanken und ihr Wissen sofort den anderen mitteilen. Sie hat allerdings gelernt, den anderen erst zuzuhören. Mo stellt immer noch viele Fragen. Naturwissenschaftliche Fragen und Probleme begeistern sie. Ihr großes Vorbild ist die Klimaforscherin Friederike Otto. Den Titel des Buches „Wütendes Wetter“ findet Mo grandios. Frau Otto kann außerdem schwierige Klimazusammenhänge sehr gut erklären. So verstehen viele Menschen die Ursachen des Klimawandels. Ob sie dann auch etwas da gegen tun?
Wenn sie Mo reden hören, denken ihre Freunde und Freun dinnen ebenso an den �� Kommunikationsdirektor Carel Mohn.

Herr Mohn leitet die Internetplattform �� Klimafakten.de.


Dort werden alle Informationen zum Klima so geschrieben, dass möglichst viele Menschen sie verstehen können. Herr Mohn redet gern mit denen, die Zweifel an dem Klimawandel haben. Er bleibt auch bei hitzigen Diskussionen entspannt.
Mo findet es sehr beeindruckend, wie er etwas für den Klimaschutz tut und viele Menschen erreicht. Das kann er, weil er das Denken der Menschen nachvollziehen kann. In diesem eBook wirst du ihn näher kennenlernen!






Youlaf ist nach wie vor ein aufmerksamer Beobachter und Zuhörer. Manchmal glauben die anderen Kinder, dass er ihnen schon wieder nicht zuhört, was aber nicht stimmt. Youlaf überlegt sich, wie Men schen, Mitwelt und alles andere auf der Welt gut miteinander in Frieden leben könnten. Wichtig ist ihm dabei die Frage der Gerechtigkeit.
Youlaf bewundert Malala Yousafzai. Sie hat als 11-jähriges Mädchen in Pakistan begonnen, sich für die Rechte von Mädchen einzusetzen.
Als sie 13 Jahre alt war, wurde sie von den �� Taliban durch Schüsse in Kopf und Hals schwer verletzt. Malala hat für ihren Mut und ihren Einsatz für Mädchenrechte in ihrem Land viele Preise bekommen. 2013 bekam sie sogar den Friedensnobelpreis in Oslo.
Youlafs Großeltern sind in Somalia geboren. Er selbst kam in Deutschland zur Welt. Youlaf hat immer noch den Wunsch, seine Großeltern in Somalia zu besuchen, und hofft, dass dies bald möglich sein wird. Er ist sich sicher, dass in allen Ländern sofort etwas für das Klima getan werden muss. Das meint auch der Meteorologe und Klima forscher Mojib Latif. Mojibs Eltern sind aus Pakistan, er ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Herr Latif forscht seit vielen Jahren zur Erderwärmung. Er kritisiert, dass die Energiewende in vielen Ländern der Welt im Schneckentempo vorangeht.
Youlaf möchte, dass auch all seine Freunde und Freundinnen etwas für den Klimaschutz tun. Er hat angeregt, dass alle ge meinsam mit seinen Eltern und seinen zwei Schwestern an Klimademonstrationen teilnehmen.


Stewa hat immer noch sehr viel mehr Fragen als Antworten. Niemand ist vor ihren Fragen sicher. Stewa gibt sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden.
Sie zweifelt an, ob immer alles so ist, wie andere behaupten. Das bedeutet lange, interessante Diskussionen. Stewas Lieblingsforscher ist Stephen Hawking, der welt berühmte Astrophysiker. Er hat sich zeitlebens mit der Erforschung von Himmelserscheinungen beschäftigt.


Rerum, sit, volum alit aut ratendam lab ipidit, omniam deles qui ipsumquisqui occum adi dolorrovit eiunt, tessequi quia pro molum sandest qui nimpernam, od molup tat fugia consendunt plignim esti dolum quo qui volorem vidi volupis et dolupta tionse laciteni di res ut as etus inihill itaspit hil et etur? Oluptat ioreprae laborep taspistotata cumquia eratur simus dolora doloreprovid enimolum corrorias volorepta parum quid et quianda aute


Zusammen mit seiner Tochter Lucy hat er zwei Kinderbücher über den Kosmos geschrieben. Wie Stewa musste Herr Hawking ab seinem 26. Lebensjahr einen Rollstuhl nutzen. Er verlor dann mehr und mehr seine Bewegungsfähigkeit – aber nicht seine hervorragende Denkfähigkeit!
Auch bei Stewa funktioniert das Tüfteln und Experimentieren im Rollstuhl.
Die anderen Kinder mussten lernen, mit einem Talker zu kommunizie ren, weil Stewa nur so sprechen kann. Das funktioniert aber richtig gut. Stewa interessiert sich brennend für den Weltraum. Sie hat gehört, dass sich die erste Frau im Weltall, Walentina Wladimirowna Tereschkowa, ein Leben auf einem anderen Planeten sehr gut vorstellen kann. Jetzt überlegt Stewa, ob das nicht die Lösung unserer Probleme auf der Welt sein könnte – das Leben auf einem anderen Planeten.
Sie fragt sich: Wie gehen wir dann dort mit den Ressourcen um? Und würde es uns helfen, das von den Menschen verursachte Klimaproblem auf der Erde zu lösen?


Warum ist es auf der Erde warm? Warum wird es zunehmend wärmer?

Station 1: Alarm! Auf der erde wird es wärmer
Station 2: Gurken in der Antarktis
Station 3: Unser Planet - ein Treibhaus?

Station 4: Rekord im November! 21,4 Grad in Sachsen
Station 5: Wo kommt das viele CO2 her?
Station 6: Wandernde Gletscher
Für neugierige Forscherinnen und Forscher: Landeis und Meereis
Der Polarforscher Benoît Sittler
Mystery – Das Verschwinden der Tiere in Grönland



Warum ist es auf der Erde warm? Warum wird es zunehmend wärmer? Mo liest manchmal Zeitung. In der letzten Zeit sind ihr Schlagzeilen aufgefallen, die sie nicht verstanden hat:

Diskutiere mit einem anderen Kind:


• Warum hat Mo Schwierigkeiten, die Überschriften zu verstehen?
• Was findest du besonders an den Überschriften?



• Worum könnte es in den einzelnen Artikeln gehen?
Mo möchte herausfinden, was hinter den Schlagzeilen steckt.
Aus diesem Grund hat sie viele Informationen gesammelt: Texte, Bilder, Zeichnungen, Modelle, Versuche und Videos.
An den folgenden sechs Forschungsstationen findest du Material und Anleitungen. Deine genauen Arbeitsaufgaben findest du im Forschungsbuch. Mo hat diese Anregungen zu allen Schlagzeilen gefunden.



•



Suche dir eine Partnerin / einen Partner. Gemeinsam erarbeitet ihr euch mindestens vier der sechs Stationen.
• Die erste Station beinhaltet einen bereits aufgebauten Versuch. Den werden alle Kinder der Lerngruppe während der Unterrichtsstunde beobachten.
• Beachtet, dass ihr die Reihenfolge einhaltet und keine Station überspringt.
Sieh dir den folgenden Versuchsaufbau genau an.
Vermute: Welches Ereignis könnte an dieser Station das Thema sein?
Diskutiere mit deiner Partnerin / deinem Partner:
• Welche Eiswürfel schmelzen schneller? Was vermutest du?

• Wie kann man dies am besten überprüfen?

•
Zeichne den Versuch in dein Forschungsbuch. Notiere dort auch deine Vermutung.






Beachte! Es dauert einige Zeit, bis die Eiswürfel geschmolzen sind. Beobachte den Zustand der Eiswürfel in beiden Schalen immer dann, wenn du eine weitere Station bearbeitet hast. (Die Stationen 4 und 5 solltest du erst bearbeiten, wenn du zu diesem Versuch eine Erklärung gefunden hast!)
• Trage die Ergebnisse deiner Beobachtung in die Tabelle im Forschungsbuch ein.

• Hast du eine Vermutung, was der Versuch mit der Schlagzeile zu tun habe könnte? Überlege und diskutiere mit deiner Partnerin / deinem Partner!
(Tipp: An den weiteren Stationen wirst du noch mehr herausfinden, das dir dabei hilft, diese Frage zu beantworten.)
Gurken erntet man bei uns in Deutschland in der Regel von Juli bis Oktober. Pflanzen wie die Gurke benötigen Wärme zum Wachsen. Damit sie auch auch da wachsen können, wo es zu kalt für sie ist, nutzen die Menschen Gewächshäuser. Ein anderes Wort für Gewächshaus ist Treibhaus. Wie funktioniert ein Treibhaus?

Treibhaus? Was für ein komisches Wort. Was passiert da? Wie funktioniert ein Treibhaus?


Schau dir die Zeichnung genau an: Verfolge die Vorgänge, die in dem Treibhaus stattfinden.
1. Erkläre einem anderen Kind in eigenen Worten, warum mit einem Treibhaus auch in kalten Gegenden wärmeliebende Pflanzen (z. B. Gurken, Tomaten) angebaut werden können.
2. Die Sonne scheint durch die Glasscheiben (oder Plastikscheiben) des Treibhauses.
3. Wind, Regen oder Schnee gelangen aufgrund der Glasscheibe (oder Plastikscheibe) nicht in das Treibhaus.
4. Durch die Sonnenstrahlen erwärmen sich im Treibhaus der Boden und die Luft.
5. Die warme Luft im Gewächshaus bleibt durch das Glas (oder Plastik) im Treibhaus eingeschlossen.

6. Durch die Wärme im Treibhaus können Pflanzen auch dann wachsen, wenn es draußen zu kalt ist.
Im Forschungsbuch ist das Treibhaus abgebildet.
Hier sind allerdings die Vorgänge durcheinandergeraten!





Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge!



•
•






Was haben alle Treibhäuser gemeinsam?
Was ist wichtig, damit ein Treibhaus funktioniert?










Erkläre deine Vermutungen!
Schreibe oder zeichne deine Erklärungen in das Forschungsbuch.

Station 3:

In einem Gewächshaus oder Treibhaus speichert das Glas die Wärme im Haus. Auch die Erde hat eine Schutzhülle. Diese Schutzhülle ist aber nicht wie beim Treibhaus aus Glas oder Kunststoff. Sie besteht aus Gasen wie zum Beispiel aus �� Stickstoff, �� Sauerstoff, �� Kohlenstoffdioxid (abgekürzt: CO2, sprich: Ze-ozwei), �� Methan und Wasserdampf. Man nennt diese Hülle �� Atmosphäre. Der �� Weltraum beginnt über der Atmosphäre. Licht von der Sonne gelangt durch die Atmosphäre zum Erdboden und erwärmt die Erde. Die Wärme, die von der Erde zurück in den Weltraum strahlt (�� Reflexion), wird durch die Schutzhülle (Atmosphäre) der Erde zu einem kleinen Teil festgehalten. Diese Wärme kann nicht zum Weltraum zurück. Durch diesen Effekt ist es auf der Erde so warm, dass wir gut leben können.


Auf der Erde passiert Ähnliches wie im Gartentreibhaus. Man sagt dazu „natürlicher 2, Methan und Wasserdampf in der Atmosphäre nennt man Treibhausgase. Ohne die Treibhausgase in der Atmosphäre läge die Temperatur auf der Erde durchschnittlich bei -18 °C. Die Oberfläche der Erde wäre deshalb vermutlich mit einer Eisschicht überzogen. Ein Leben, wie wir es kennen, wäre nicht möglich.











Lies den Text im Forschungsbuch. Markiere alle Wörter im Text, die du wichtig findest und helfen, den Treibhauseffekt zu erklären. Unterstreiche auch neue Worte und die, die du nicht verstehst (in einer anderen Farbe).



Sag mal Mo, was ist eigentlich mit „Modell“ gemeint? Kannst du mir das erklären?
Na ja, damit man sich schwierige Sachen vorstellen oder sie anderen erläutern kann, nutzt man in der Wissenschaft Modelle. So kann man Sachen und Vorgänge darstellen, die man nicht sehen kann. Aber man kann sie sich vorstellen, weil dazu geforscht wurde. Wie die Treibhausgase oder die Atmosphäre. Auch die Zeichnung vom Treibhaus mit den Vorgängen, die den Treibhauseffekt ausmachen, ist ein Modell. Ist das klar geworden? Oder hast du noch Fragen?




Im Forschungsbuch findest du ein Modell von dem Treibhauseffekt auf der Erde. Beschrifte das Modell des natürlichen Treibhauseffektes.
Diskutiere mit deiner Partnerin / deinem Partner:


• Warum heißt es in der Schlagzeile „Unser Planet: ein Treibhaus?“?
• Was haben die Erde und ein Treibhaus gemeinsam?
• Was unterscheidet die Erde von einem Treibhaus? Notiert eure Überlegungen im Forschungsbuch!
Ohne den natürlichen Treibhauseffekt können wir auf der Erde nicht leben.
Wir Menschen verursachen aber zu viele Treibhausgase, die in die Atmosphäre gelangen. Durch Abgase von Autos, Flugzeugen oder Fabriken werden die Gase
Kohlenstoffdioxid (alles über CO2 erfährst du in Station 5) oder Methan immer mehr. Dadurch kann immer weniger Wärme zurück in den Weltraum gelangen. Auf der Erde wird es dadurch immer wärmer. Man spricht von einem menschenge machten Treibhauseffekt.
Schau dir das �� Video zum menschengemachten Treibhauseffekt an. Schreibe deine Fragen und unverständliche Vorgänge auf ein Notizblatt.



Sieh dir das Video ein zweites Mal an:


• Achte auf die Dinge, die du beim ersten Mal nicht verstanden hast.
• Drücke den Pausenknopf an den Stellen, die du wichtig findest, oder an denen deine Fragen beantwortet werden.
• Notiere die Vorgänge und Antworten auf deine Fragen im Forschungsbuch!






Beantworte die folgenden Fragen:

• Wieso heißt es „menschengemachter Treibhauseffekt“?
• Was spielt beim menschengemachten Treibhauseffekt eine große Rolle?
• Was hat der menschengemachte Treibhauseffekt mit dem Klimawandel zu tun?


Was hat der menschengemachte Treibhauseffekt mit der Schlagzeile zu tun? Schreibe deine Ideen in das Forschungsbuch.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhalten häufig neue Forschungsergeb nisse, die in einem vorhandenen Modell nicht vorkommen. Mit diesem Modell können sie dann die neuen Ergebnisse nicht erklären. Manchmal überarbeiten sie das Modell. Sie verändern das Modell so, dass nun alle wichtigen alten und neuen Informationen und Vorgänge im Modell vorkommen. Allerdings müssen sie manch mal ein komplett neues Modell erstellen.
Zeichne ein Modell vom menschengemachten Treibhauseffekt in dein Forschungsbuch! (Tipp: Nutze deine Notizen und die Informationen aus dem Video! Das Modell vom natürlichen Treibhauseffekt aus Station 3 hilft auch.)
Vergleiche den natürlichen und menschengemachten Klimawandel miteinander. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten fallen dir auf? Schreibe deine Überle gungen in das Forschungsbuch!



Station 5:
Kohlenstoffdioxid oder CO ist ein wichtiges Treibhausgas. Es steht in Zusammenhang mit dem natürlichen und menschengemachten Treibhauseffekt und dem Klimawandel. Obwohl es nur sehr wenig vorkommt, könnten wir ohne CO2 in der Atmosphäre nicht leben. Dieses Gas bewirkt, dass ein Teil der Wärme auf der Erde bleibt.
Kohlenstoffdioxid ist ein natürliches Gas. Es entsteht bei der Atmung von Lebewesen. Auch der Mensch atmet CO2 aus.
Pflanzen verbrauchen CO2, um leben zu können. Bei Vulkan ausbrüchen gelangt Kohlenstoffdioxid in die Luft und bei Waldbränden entsteht es durch die Verbrennung von Holz und Blättern.

Die Menschen verursachen aber zu viel Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre. In den Kohlekraftwerken, bei Fahrzeugen mit Benzinmotor oder Dieselmotor, bei Flugzeugen und Schiffen wird etwas verbrannt. Dadurch entsteht CO2. Auch bei der Herstellung und dem Transport von Lebensmitteln, Kleidung und Technik wird CO2 produziert. Diese vielen Treibhausgase gelangen in die Atmosphäre. Deshalb werden Wärme strahlen daran gehindert, die Erde zu verlassen. Dadurch erwärmt sich die Erde. Man spricht vom Klimawandel.
Diesen Text findest du in deinem Forschungsbuch. Unterstreiche dort alle Stellen und Wörter im Text, die du besonders wichtig findest.





• Warum ist das Treibgas Kohlenstoffdioxid (CO2) für die Erde wichtig?

• Was hat Kohlenstoffdioxid mit dem Klimawandel zu tun? Schreibe deine Überlegungen in das Forschungsbuch!




Zeichne eine Mindmap zur Schlagzeile ins Forschungsbuch!
Wir Menschen produzieren eine Menge CO2. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben über Jahre hinweg viele Informationen darüber gesammelt.

Aus diesen Angaben haben sie ein Diagramm wie dieses hier erstellt:

• Was kannst du anhand des Diagramms erkennen?



•
Warum kommt es zu diesem Anstieg?
Diskutiere mit anderen und begründe deine Meinung!
Hast du Ideen, wie man weniger CO2 verursachen kann? Diskutiere deine

Ideen mit deinem Partner / deiner Partnerin. Schreibt die besten Ideen in das Forschungsbuch.





Was meinen die denn mit „Wandernde Gletscher“? Die können doch nicht laufen!

Nein, natürlich nicht. Aber da es auf der Erde immer wärmer wird, schmelzen die Gletscher und werden kleiner. Und dabei „rutschen“ sie auf einem Wasserfilm.



Weißt du denn, was Gletscher sind?

Gletscher sind große Eismassen, die sich aus Schnee gebildet haben. Heute gibt es sie in �� Mitteleuropa nur noch in den Alpen. Damit sich Gletscher bilden können, muss es kalt sein. Es muss viel Schnee fallen. Ab der �� Schneegrenze ist es so kalt, dass statt Regen immer Schnee fällt. Sogar im Sommer. Gletscher entstehen dann, wenn mehr Schnee fällt als schmilzt. Wenn auf der Erde die Temperaturen weiter steigen, schmilzt im Sommer mehr Eis weg, als durch die Kälte im Winter gebildet wird. Ein Gletscher besteht aus verschie denen Schichten: oben liegt der Schnee, darunter der �� Firn und ganz unten Eis.



Das Schmelzen der Gletscher kannst du beobachten, wenn du Bilder von früher und heute vergleichst. Du kannst die Folgen des Klimawandels dabei sofort sehen. Auch Videos können dir helfen, die Entstehung, die Bildung und das Schmelzen der Gletscher zu verstehen.
Schau dir das �� Video über die Entstehung von Gletschern genau an!
Du kannst nun diese Fragen beantworten:
• Wann sind die Gletscher entstanden?


•
Aus welchen Schichten besteht ein Gletscher?
• Was ist der Firn?





• Warum sind Gletscher für die Menschen auf der Erde wichtig? Notiere die Antworten im Forschungsbuch.
Diese beiden Fotos wurden in den Alpen gemacht. Beide Aufnahmen wurden vom gleichen Standort aus fotografiert. Zwischen den Fotos liegen aber 70 Jahre. Was fällt dir auf? Schreibe deine Beobachtung in dein Forschungsbuch!

Gletscher sind bis zu 1000 Meter dick und bewegen sich aufgrund ihres Eigengewichts in Richtung Tal. Dabei hinterlassen sie eine eigene Landschaft. Wie sieht die Land schaft nach Rückzug des Gletschers aus? Schreibe deine Überlegungen in das Forschungsbuch!



Überlege gemeinsam mit einem anderen Kind: • Was können die Menschen tun, um das Schmelzen der Gletscher zu verlangsamen?



Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Dort gibt es den Schneeferner Gletscher. Dieser Gletscher schrumpft immer mehr. Deshalb hat man versucht, das Schmelzen mit großen Kunststoffplanen zu verlangsamen. Durch die steilen Hänge konnte man nur einen kleinen Teil des Gletschers abdecken. Deshalb wurde das Projekt im Jahr 2013 eingestellt.

Eine Menge Schnee und Eis befindet sich auf dem Land. Gletscher wie auf der Zugspitze, schneebedeckte Berge, fast ganz Grönland und die Antarktis (der Südpol) sind mit Schnee und Eis bedeckt. Dieses Eis nennt man Landeis. Eis kann sich auch im Meer bilden. Eisberge gibt es in der Arktis (Nordpol) und eine große Fläche des Meeres ist mit �� Packeis bedeckt. Dies ist das Meereis.








• Was passiert, wenn das Meereis schmilzt?
• Was passiert, wenn das Landeis schmilzt?
Diesen Versuch kannst du zu Hause durchführen!
Du brauchst:


2 gleich große Gläser
2 - 4 gleich große Eiswürfel
• einen oder mehrere Steine
• Wasser


Lege den Stein oder die Steine in eines der Gläser und lege die (zwei) Eiswürfel darauf (Landeis). Gib genau so viele Eiswürfel in das andere Glas (Meereis).
Fülle Wasser in beide Gläser bis zur Höhe der Steine und markiere die Wasserlinie mit einem Filzschreiber oder Klebeband. In beiden Bechern ist die Wasserlinie auf der gleichen Höhe. Beobachte, wie sich der Wasserstand beim Schmelzen der Eis würfel verändert. Es kann etwa 2 Stunden dauern, bis das Eis geschmolzen ist. Halte das Ergebnis im Forschungsbuch fest.
Was passiert, wenn das Landeis schmilzt?
Was passiert, wenn das Meereis schmilzt?
Schau dir dieses Video erst an, nachdem du den Versuch durchgeführt hast! In diesem �� Video siehst du den Versuch im Zeitraffer und kannst genau beobachten, was passiert.



Nie wieder frieren, keine dicke Kleidung mehr tragen müssen, immer im Meer baden gehen können und viel öfter Eis essen. Das ist doch schön! Wo liegt das Problem, wenn die Erde wärmer wird?
Wir fragen jemanden, der sich mit der Erwärmung der Erde schon sehr lange beschäftigt. Eigentlich wollte dieser Mann nur Wühlmäuse beobachten …


Benoît Sittler hat eurer Lerngruppe einen Brief geschrieben. Lies seinen Brief sorgfältig. Du kannst ihn dir gern auch vorlesen lassen. Du findest den Brief auch im Forschungsbuch. Merke dir, was Benoît aus der polaren Zone be richtet. Versuche herauszufinden, welches Tier er in der Hand hält.


Liebe Kinder, mein Name ist Benoît, das ist ein französischer Name und man spricht es wie Beno-ah. Ich bin Biologe und beschäftige mich als Wissenschaftler mit dem Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen. Seit mehr als 30 Jahren fliege ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen jedes Jahr für viele Wochen nach Grönland. Jedes Jahr, wenn es in Deutschland warm wird, fliegen wir ins ewige Eis. Dort ist es dann so kalt wie bei uns im Winter, knapp über 0 °C.








Wisst ihr, wo Grönland liegt? Habt ihr vielleicht schon mal etwas über dieses Land gehört?
Grönland ist ein sehr großes Land, größer als Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien zusammen. Du kannst dir aber bestimmt vorstellen, dass dort, wo es meistens kalt ist, nur wenige Menschen wohnen. Im Norden von Grönland, wo wir hinfahren, gibt es keine Menschen und keine Häuser. Wir schlafen in Zelten auf dem gefrorenen Boden. Das ist sehr kalt, aber wir haben zum Glück dicke Schlafsäcke. Einkaufen können wir auch nicht, denn wo keine Menschen leben, braucht man auch keine Supermärkte. Wir müssen das Essen für die vielen Wochen vor Beginn der Reise einpacken und die ganze Zeit mitnehmen.
Grönland ist ein besonderer Lebensraum. Dort gibt es keine Krokodile und keine Palmen, weil es viel zu kalt ist. Wir beobachten Tiere, die sich im Schnee und Eis am wohlsten fühlen, wie zum Beispiel Schneeeulen, kleine Nagetiere, die Lemminge heißen, Eisbären, Robben, Raubmöwen und auch Pflanzen, die nur dort oben im kalten Norden wachsen.
In Grönland kann man den Klimawandel besonders gut beobachten, weil die Tem peratur an den Polen der Erde schneller ansteigt als in der Mitte. Da ich seit über 30 Jahren jeden Sommer in Grönland verbringe, konnte ich sehr gut beobachten, wie sich das ewige Eis verändert. Mit dem Verschwinden des Eises verändert sich die Tierwelt.
Wird das Eis weniger, gibt es weniger Lemminge. Und je weniger Lemminge es gibt, desto weniger Schneeeulen leben dort.
So ist es meistens, allerdings konnten wir im Sommer 2020 wieder ganz viele Lemminge zählen. Wir versuchen nun herauszufinden, warum das so ist.


Ich habe euch ein Rätsel mitgeschickt. So könnt ihr noch einige weitere interessante Sachen über Grönland erfahren.
Versucht, die passenden Kärtchen zu Grönland herauszusuchen. Einige verweisen auf Probleme mit der immer wärmer werdenden Erde, also dem Klimawandel. Wenn ihr euch entschieden habt, klebt die Kärtchen auf ein Blatt. Erzählt euch dann gegenseitig eure Geschichte über Grönland und den Klimawandel. Ein Tipp: Ihr müsst nicht alle Kärtchen verwenden, aber so viele, wie ihr für richtig haltet.

Viel Spaß wünscht und viele Grüße sendet euch




Überlege zuerst allein.
Trage deine Vermutung in das Forschungsbuch ein. Tausche dich anschließend mit deiner Lerngruppe aus. Stellt die Erwärmung der Erde ein Problem für die Tierwelt in Grönland dar?












Lest die Karten und beantwortet folgende Fragen mündlich:
1. Welche Karten mit Informationen zu Grönland stimmen?

2. Gibt es Karten mit überflüssigen Informationen?
3. Gibt es Karten mit falschen Informationen zu Grönland?
Begründet eure Lösungen!
• Schneidet die Karten aus dem Forschungsbuch aus und sortiert sie nach den obigen Fragen.



• Erstellt ein neues Poster zu Grönland. Macht darauf deutlich, was der Klimawandel bewirkt.





Was fällt euch zu Grönland ein? Was fällt euch zu Grönland ein?


Messstationen im Klassenzimmer!
Vom Wetter zum Klima

Eine Klimavorhersage erstellen

Klima(wandel) in Sachsen und auf der Erde
Die polare Zone
subpolare
















Schau dir die einzelnen Bilder genau an. Überlege, worum es sich bei dem Gezeigten handelt.
• Welche der Bilder passen nicht mehr in die heutige Zeit?

• Machen sie dennoch interessante Aussagen?
• Was kann man mit ihrer Hilfe erfahren? Teile deine Überlegungen der Lerngruppe mit!




Denke für dich über folgende Fragen nach. Schreib dir einige Notizen dazu ins Forschungsbuch.
• Warum misst man das Wetter?
• Wie misst man das Wetter?
• Wer misst das Wetter?
• Was ist ein Meteorologe? Gibt es Meteorologinnen?





• Wie sieht er oder sie aus?
• Wie ist das Wetter heute?
• Wie war das Wetter in den letzten Tagen?
• �� What‘s the weather like today?
• Bei welchen Fragen stimmt ihr überein?
• Worüber habt ihr unterschiedliche Ansichten?
• Schaut gemeinsam das Video. Könnt ihr schon mitsingen?


Youlaf weiß immer noch nicht genau, was Wetter ist. Erklärt
es ihm! Formuliert es in höchstens zwei Sätzen! Schreibt diese in das Forschungsbuch.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie die �� Wettervorhersage erstellt wird, kannst du dir dieses Video vom SWR Kindernetz PLUS anschauen.

O.K. Jetzt wissen wir viel über das Wetter.
Aber was ist denn nun Klima?



„Dieses Jahr hatten wir einen sehr feuchten Sommer.“?


Das heißt, dass wir selten schwimmen gehen konnten. Oder im letzten Jahr: „Es hat viel zu wenig geregnet. Es war ein zu trockenes Jahr.“ Man konnte oft zum Schwimmen gehen. Tiere und Pflanzen aber haben gelitten. Das wird was mit dem Klimawandel zu tun haben!
Klima bedeutet, dass es irgendwo normalerweise warm oder kalt ist, dass es trocken oder feucht ist. Von Klima spricht man aber erst, wenn man das Wetter über Jahre beobachtet und aufgezeichnet hat.
Zum Beispiel über einen Zeitraum von 30 Jahren. Die Daten stellt man grafisch in einem �� Diagramm dar.








Diagramme zeigen Informationen auf einen Blick. Sie sind meistens übersichtlicher als ein Text mit ein paar Zahlen. Meteorologen und Meteorologinnen arbeiten mit einem Niederschlagsdiagramm.
Es stellt die Niederschläge, also Regen, Schnee, Graupel und Hagel, über einen bestimmten Zeitraum dar.

Das abgebildete Niederschlagsdiagramm zeigt die Niederschläge in Sachsen. Es gibt sie aber auch für fast alle anderen Länder und Regionen auf der Welt.
Das Diagramm zeigt auf der nach oben gehenden (senkrechten) Geraden die Niederschlagsmenge. Auf der nach rechts zeigenden (waagerechten) Geraden werden die einzelnen Jahre eingezeichnet. Daraus lässt sich entnehmen, wie viel es durchschnittlich in den Jahren geregnet hat und ob es ein eher feuchtes Jahr mit viel Regen oder ein eher trockenes Jahr mit wenig Regen war.

Die Niederschlagsmenge wird normalerweise in Litern pro Quadratmetern oder der Höhe in Millimeter (mm) angegeben.
Die Skala eines Regenmessers wird in Millimetern angegeben. Hierbei entspricht ein Millimeter Niederschlagshöhe im Becher einem Liter Regen pro Quadratmeter. Bei 20 mm Niederschlagshöhe sind dann 20 l auf diese Fläche gelandet. Das sind zwei große Eimer voll. Anhand des Diagramms kannst du ablesen, wie viel Wasser in Sachsen in einem Jahr gefallen ist. Das be deutet nicht, dass es auch in deinem Ort genau diese Niederschlagsmenge war. Die Klimaforschenden haben einen Wert für ganz Sachsen für ein ganzes Jahr berechnet.








• Was könnten die Punkte bedeuten, was sagt dir die Linie?
• Was kannst du an dem Verlauf der roten Linie erkennen?
Wenn du ein Wettertagebuch geführt hast, kannst du selbst ein Diagramm erstellen. Im Forschungsbuch findest du eine Tabelle und eine Anleitung, wie du das Diagramm zeichnen kannst!


Jetzt bist du ein Meteorologe oder eine Meteorologin und arbeitest in einem Team. Ihr wisst, dass für eine Klimavorhersage mehrere Wettererscheinungen wichtig sind: der Niederschlag, aber auch die Temperatur. Ein Niederschlagsdiagramm gibt es bereits. Ihr erstellt jetzt zusammen ein Temperaturdiagramm für Sachsen, um die Entwicklung des Klimas der letzten 100 Jahre genauer zu beschreiben. Erinnert ihr euch noch an den DWD? Den Deutschen Wetterdienst?

Dort hat Mo nach den Wetterdaten der letzten 100 Jahre gefragt. Ein Forscher hat ihr geantwortet und sie hat diese Temperatur
Könnt ihr mir bitte helfen? Es sollen alleDaten in ein Diagramm übertragen wer-den. Dann können wir herausfinden, wiewarm oder kalt es im Durchschnitt inden letzten 100 Jahren in Sachsen war.
Nutzt die Vorlage im Forschungsbuch. Die Farben in der Tabelle helfen euch.



Sie kann für ein Land, ein Bundesland oder eine Stadt ermittelt werden. Sie wird aus dem
Durchschnitt der zwölf Monatsmitteltemperaturen errechnet. Zum Beispiel: In jedem Monat des Jahres 2019 war es in Deutschland ungefähr so kalt oder warm, wie du es unten in der Tabelle siehst. An manchen Tagen in einem Monat war es kälter, an manchen war es wärmer. Zusammen mit der Nachttemperatur wird die Durchschnittstemperatur berechnet.

den
man diese
Durchschnittstemperaturen und


die Summe wieder durch 12 Monate, erhält man die Jahresdurchschnittstemperatur.


Durch den Klimawandel ist es in Sachsen in den letzten 100 Jahren immer wärmer geworden. Aber ist das wirklich so schlimm? Es ist doch super, wenn wir länger baden gehen, Eis essen und im T-Shirt draußen spielen können!
• Stimmst du den Aussagen von Ellist zu? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
• Was meinst du: Gibt es Orte auf der Welt, wo es in den letzten 100 Jahren wärmer geworden ist?









Gebiete der Erde, in denen das Klima ähnlich oder sehr ähnlich ist, bilden sogenannte Klimazonen. Auf der Erde gibt es fünf große Klimazonen. Die Klimazonen legen sich wie Gürtel um die Erde.
So verlaufen die fünf Klimazonen rund um die Erde.
Schau dir die Karte genau an!
Finde heraus, wie die fünf Klimazonen verlaufen. Hilfen bieten die Farben, wie sie in der Legende angegeben sind.

• Was ist die größe Klimazone der Erde?

• In welcher Klimazone liegt Deutschland / Sachsen?
Wie sieht der Lebensraum für Pflanzen, Menschen und Tiere in den einzelnen Klimazonen aus? Gibt es unterschiedliche Tier- und Pflanzenwelten?
• Sucht eine Klimazone aus, die euch besonders interessiert.



• Beantwortet die Fragen in dem Forschungsbuch!
• Wenn ihr mehr über ein Land in eurer Klimazone erfahren wollt, könnt ihr die Website �� www.kinderweltreise.de aufrufen.
•
Bereitet euch anschließend auf eine Präsentation eurer Klimazone vor. Überlegt, was ihr der Lerngruppe berichten wollt!
• Gestaltet ein Plakat für euren Vortrag! Im Forschungsbuch findet ihr Bilder zum Ausschneiden. Ihr könnt gern auch selbst etwas malen!
• Überlegt euch kurze Texte und eine Überschrift für „eure“ Klimazone.




 Amerika
Südamerika
Afrika
Asien
Amerika
Südamerika
Afrika
Asien




Mein Name ist Nanuk und ich lebe auf Grönland. Mein Land gehört zur polaren Zone. Zwei Gebiete gehören zur polaren Zone: die Antarktis und die Arktis.

Die Temperaturen sind hier fast immer unter 0 °C. Der Boden ist meistens gefroren. Das nennt man Dauerfrostboden. Als Niederschlag gibt es hier meist Schnee und sehr viel Eis. Der Winter auf Grönland ist sehr lang, die Temperatur fällt manchmal unter - 40 °C.


Dann ist es meist dunkel und es gibt Schneestürme. Diese werden in den letzten Jahren immer stärker und kommen häufiger vor. Ende April tauen bei uns Eis und Schnee und es wird wärmer.
Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. Dieser ist leider sehr kurz. Er dauert nur ca. zwei Monate – es ist wenig Zeit, um draußen zu spielen.
Da der Boden fast das ganze Jahr über gefroren ist, findet man bei uns nicht viele Pflanzen. Einige halten es hier aber aus, ihnen macht die Kälte nichts aus. Es gibt Gräser, Moose und Flechten.
Für die meisten Tiere sind die langen kalten Zeiten und das Eis schwierig. Eisbären, Pinguine, einige Vogelarten und Fische haben sich den Lebensbedingungen angepasst.
In letzter Zeit bemerke ich, dass es hier ständig wärmer wird, die Eisberge und Eismassen schmelzen früher und schneller.
Grönland















Ich bin Olivia und ich komme aus dem Norden Kanadas. Mein Land gehört zur subpolaren Zone. Die subpolare Zone liegt zwischen der polaren und der gemäßigten Klimazone. Sie erstreckt sich rund um die Polarkreise. Island und der Norden von Russland gehören auch dazu.

In der subpolaren Zone gibt es keine Jahreszeiten, wie du sie in Deutschland kennst. Die Temperatur liegt hier meistens bei 0 °C. In kalten Monaten gibt es Frost.
In den wärmsten Monaten betragen die Temperaturen durchschnittlich +10 °C. Insgesamt haben wir hier sehr wenig Regen. Unsere Böden sind fast das ganze Jahr gefroren. Daher sagen wir dazu „Dauerfrostboden“. Wenn sich das Eis zurückzieht oder es Bereiche ohne Eis gibt, wachsen auf Grönland neben Moosen und Gräsern auch kleine Sträucher. Die Landschaft aus Moosen, Gräsern und Sträuchern nennt man bei uns Tundra. Bäume haben wir hier keine. Da es bei uns nicht so kalt ist wie in der polaren Zone, gibt es hier einige Pflanzen.

Sogar Tiere wie Polarfüchse und Polarwölfe, Schneehasen, Rentiere, Eisbären, Pinguine und verschiedene Vogelarten leben hier.
In letzter Zeit bemerke ich, dass es hier immer wärmer wird. Die Eisberge und Eismassen schmelzen früher und auch die Pflanzen wachsen früher. Die warmen Monate werden länger.
Kanada Russland Island













Ich bin Anna und ich komme aus Russland. Ich lebe in der gemäßigten Zone. Die gemäßigte Zone liegt zwischen der subpolaren und der subtropischen Zone. Auch dein Land Deutschland liegt wie meines in dieser Zone. Weitere Länder sind große Teile Europas, Russlands und Kanadas sowie der USA. Wie du siehst, gibt es hier viele unterschiedliche Länder und Regionen.

In Russland gibt es vier Jahreszeiten. Im Winter sind die Tage „kurz“, da die Sonne nur selten scheint. Im Sommer sind die Tage eher „lang“ und wir haben bis zu 16 Stunden Sonnenschein. Bei uns fällt über das ganze Jahr verteilt sehr viel Regen, im Winter in Form von Schnee. Durch den Regen und reichlich Sonnenstunden können Bäume prima wachsen. Es gibt neben Nadelwäldern auch Misch- und Laubwälder. Viele Tiere finden genügend Wasser und Futter zum Überleben. Rehe, Hasen und viele Insekten leben hier.
Für den Regen spielt die Nähe des Landes zu einem Ozean eine Rolle. Es regnet an der Küste mehr und häufiger als in der Mitte meines Landes. Dort ist es trockener und es gibt sogar Steppen.
In letzter Zeit bemerke ich, dass es hier immer wärmer wird. Die Pflanzen blühen früher, der Winter ist wärmer und beginnt später. An Weihnachten schneit es häufig nicht mehr.
 Russland
Russland
























 Mischwald
Mischwald



 Marokko z
Marokko z

Ich bin Faris aus Marokko und lebe nahe der Sahara - der größten Wüste der Welt. Mein Land gehört zur subtropischen Zone. Die subtropische Zone liegt zwischen der gemäßigten Zone, zu welcher dein Land Deutschland gehört, und der tropischen Zone. Viele Länder gehören ganz oder nur zum Teil zu dieser Zone. Einige möchte ich dir hier nennen: Teile von Europa, Asien, Afrika, Amerika und Australien.

Bei uns in Marokko schwankt die Temperatur über den Tag verteilt sehr: Tagsüber ist es sehr heiß, und in der Nacht, wenn wir schlafen, sehr kalt. Die durchschnittliche Temperatur im Jahr beträgt 20 °C. Wir haben einen milden Winter: Die Temperatur des kältesten Monats schwankt zwischen 2 °C und 13 °C.

Im Sommer ist es richtig heiß: Es ist fast immer über 20 °C. Da die Unterschiede zwischen Sommer und Winter nicht allzu groß sind und wir keinen Herbst und Frühling haben, sprechen wir bei uns auch nicht von Jahreszeiten.
In Marokko und in der subtropischen Zone regnet es selten. Wir gehen daher sehr sparsam mit Wasser um und sammeln das Regenwasser in Brunnen.








Wir haben hier viele Pflanzen und Tiere. In den sehr heißen Gegenden lebt eine seltene Raubkatze - der Karakal. Hier leben viele Kamele, Schakale, Hyänen, Wüstenfüchse und Gazellen. Es gibt neben Wüsten auch kleinere immergrüne Wälder und �� Savannen mit Bäumen und Sträuchern. In den letzten Jahren sind die Temperaturen hier stark gestiegen, im Sommer wird es immer heißer und es regnet seltener. Die Sandstürme entwickeln sich häufiger und heftiger.
 Wüstenlandschaft
Dornensavanne mit typischen Tieren
Wüstenlandschaft
Dornensavanne mit typischen Tieren



Ich heiße Kumar und lebe mit meiner Familie in Bangladesch. Mein Land gehört zur tropischen Zone – der heißesten Zone der Erde. Die tropische Zone wird von der subtropischen Zone umrahmt. Zur tropischen Zone gehören die Mitte Amerikas, Südamerika, die Mitte von Afrika und Südostasien – dort komme ich her. Hier ist es sehr heiß und schwül. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei etwa 25 °C. Es ist also ganzjährig warm bzw. heiß. Und es regnet sehr viel. Der kälteste Monat bei uns hat über 13 °C.

Die Temperatur schwankt nur leicht, große Temperaturunterschiede sowie Kälte und einen Winter gibt es nicht. Es gibt keine Jahreszeiten.



Ab Mitte Mai beginnt bei uns die Regenzeit, die bis September dauern kann. In kurzer Zeit kann es so viel regnen, dass Straßen unter Wasser stehen. Der Regen fängt plötzlich an und kann Minuten bis Stunden, manchmal sogar Tage dauern. In der Regenzeit sollte man immer einen Regenschirm dabeihaben. Nach der Regenzeit dauert es wieder Monate, bis der nächste Regen kommt.
In der tropischen Zone gibt es so viele Pflanzen- und Tierarten wie nirgendwo sonst auf der Erde. Pflanzen und Tiere finden optimale Bedingungen zum Wachsen vor.
Die meisten Tiere leben im Regenwald. Dieser bietet ihnen viel Schutz, Nahrung und Wasser. In letzter Zeit bemerke ich, dass es hier immer wärmer wird.
Bangladesh z


Philosophieren ist ein Nachdenken über bedeutende Fragen des Erkennens, des Handelns, des Hoffens und des Menschseins überhaupt.



Wichtig ist dabei das eigene Denken – und das Finden einer für sich selbst guten Antwort. Die kann sich jedoch immer wieder ändern; es gibt kein Richtig und Falsch beim Philosophieren. Alle sollen den anderen die eigenen vielleicht verrückten und unangepassten Gedanken mitteilen.
Denk über folgende Fragen nach und rede mit anderen Kindern oder Erwachsenen über deine Gedanken:
•
Ist es gerecht, dass die Bevölkerungen in anderen Weltregionen aufgrund des Klimawandels geschädigt werden?

•
Stell dir vor, dass das gesamte Eis auf der Welt schmilzt.
Du kannst etwas dagegen tun: Was würdest du machen?
•
Hat jeder Mensch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Klimaerwärmung gestoppt wird?
denke ...








Wie
können
bekommt der Kühlschrank
passiert, wenn Wasser
kommt die Energie
unseren Kühlschrank?
Energieträger werden in Deutschland

Energie

in der
sagt die Wissenschaft?
wandelt der Heizkessel in Wärmeenergie
mit
mit
mit
mit

der
Umwandlung in


Du hast dich vermutlich schon mit dem Thema „Energie“ beschäftigt. Daher weißt du, dass Energie in verschiedene Energieformen umgewandelt werden kann. Dein Körper wandelt die Nahrung in chemische Energie und Wärmeenergie um. Der Haarfön wandelt elektrische Energie in Wärme um.
Durchsuche dein Forschungsbuch aus Klasse 2. Du findest dort das Energiehaus.

• Erinnere dich an die verschiedenen Energieformen, die du im Alltag erleben kannst.
• Welche Formen von Energie erkennst du in deinem Energiehaus?
• Welche Energieformen treten häufiger auf als andere?



�� Du kannst dir ebenso dieses Video anschauen!
In deinem Forschungshaus und in deinem Alltag kannst du erkennen, dass elektrische Energie besonders häufig vorkommt. Viele Geräte benötigen elektrische Energie und wandeln sie in andere Energieformen um.
Entdecke einige elektrische Geräte in dem Energiehaus im Forschungsbuch und bei dir zu Hause.
Überlege, in welche anderen Formen von Energie die Geräte die elektrische Energie umwandeln.
Nutze die Übersicht in deinem Forschungsbuch.
Überlege, in welche Energieform das Gerät die elektrische Energie umwandelt.
Schreibe deine Ideen in die Tabelle im Forschungsbuch.








Elektrische Energie kann in viele andere Energieformen umgewan delt werden.

Diese unterschiedlichen Umwandlungen gelingen mit elektrischer Energie viel leichter als die Umwandlung anderer Energieformen. Aufgrund dieser einfachen Umwandlungen werden viele Geräte mit elektrischer Energie betrieben.


Das ist eine großartige Sache! Ich würde gern wissen: Wie entsteht die elektrische Energie und woher kommt sie?


tiere mit einem anderen Kind die Fragen von Mo. Notiert eure Überlegungen in eure Forschungsbücher.
Die Menschen können die elektrische Energie erst seit dem 18. Jahrhundert nutzen. Um das Jahr 1799 oder 1800 hat Alessandro Volta erstmals elektrische Energie so erzeugt, dass er sie als elektrische Beleuchtung nutzen konnte. Dafür nahm er verschiedene Metalle und in Säure getränkte Pappen und legte sie in Schichten übereinander. Bei dieser Konstruktion löste sich das Metall teilweise auf und gab Elektronen ab, deren Bewegung als elektrische Energie genutzt werden konnte.








Dies ist ein geschlossener Stromkreis mit Glühlampe und Batterie. So kann man die Lampe zum Leuchten bringen.


Wir hatten vor einigen Tagen einen Stromausfall in unserem Haus. Könnt ihr euch vorstellen, wie blöd es für mich ist, mich im Dunkeln im Haus zu bewegen? Ich dachte mir, zum Glück gibt es ja Taschenlampen. Aber dummerweise war die Batterie aufgebraucht und wir hatten keine neue! Damit das nicht noch einmal passiert, habe ich eine ganz besondere Taschenlampe geschenkt bekommen. Schaut mal!
Die braucht keine Batterien. und funktioniert immer!
Diese besondere Taschenlampe nennt man „Dynamolampe“. Manche sagen auch Handkurbellampe dazu. Diese Lampen wurden im 19. Jahrhundert erfunden. Sie wurden im Kohlebergbau eingesetzt, damit die Bergleute �� unter Tage besser sehen konnten.


Du untersuchst, was Dynamogeräte leisten können. Dazu benötigst du eine Dynamolampe und ein besonderes Radio. Wenn es in der Lern gruppe nur jeweils ein Exemplar gibt, können einige Kinder den Versuch für alle vorführen.





Du brauchst: Eine Dynamotaschenlampe und eine Stoppuhr
• Vermute, wie lange die Taschenlampe nach 15 Sekunden Kurbeln leuchtet. Notiere deine Vermutung im Forschungsbuch.

• Bewege an der Dynamotaschenlampe für 15 Sekunden den Dynamo. Du musst je nach Gerätetyp kurbeln oder einen Schalter im Takt drücken. Miss die Zeit mit der Stoppuhr.
• Wie lange kann die Taschenlampe mit der so umgewandelten Energie leuchten? Miss wieder die Zeit! Du musst die Stoppuhr vorher auf „Null“ stellen.

• Schreibe das Ergebnis in das Forschungsbuch.

Du benötigst: Ein Dynamoradio und eine Stoppuhr
• Nimm das Dynamoradio und drehe 15 Sekunden am Dynamo.
Man kann bestimmt auch in das Radio hineinschauen. Dafür braucht man einen Schraubendreher ...
• Wie lange kannst du mit der so umgewandelten Energie Radio hören?
• Miss die Zeit mit der Stoppuhr! Wenn das Radio längere Zeit sendet, als du gedreht hast, musst du es genauer untersuchen!
• Gibt es am Radio weitere Möglichkeiten zur Energieumwandlung?
• Hast du eine Idee, wie man diese unterbrechen kann?
• Überlege: Warum gibt es mehrere Möglichkeiten der Energiegewinnung für das Radio?
• Wenn du das Radio aufmachen konntest: Welche Bauteile kannst du erkennen?
Diskutiert in der Lerngruppe:

• Entsteht der elektrische Strom, den wir für den Betrieb von Geräten benötigen, von ganz allein?
• Was müssen wir mit einem Dynamo tun, wenn wir elektrischen Strom nutzen wollen?
Mit einem Dynamo kann man elektrische Energie produzieren. Auch Fahrräder haben solch einen Dynamo. Schau dir ein Fahrrad genau an: Finde heraus, wie man die Lampe zum Leuchten bringen kann.

•


Welche Teile sind notwendig, damit sie leuchtet?
• Was muss außerdem passieren?
• Warum benötigt man einen Dynamo?








Schreibe deine Ergebnisse in das Forschungsbuch.
Haben wir in unserer Wohnung überall solche Dynamos? Wird auch der Kühlschrank mit einem Dynamo betrieben? Bestimmt nicht!
Dann müsste immer jemand die Kurbel drehen! Woher kommt eigentlich der elektrische Strom?
Der sieht bei meinem Fahrrad aber anders aus!




Ellist hat natürlich recht: Der Kühlschrank in der Küche hat keine Batterie und auch keinen Dynamo. Er kühlt, weil er an einen Stromkreis angeschlossen ist. Und woher kommt der Strom? Einen Dynamo gibt es auch nicht in einem Haus. Wer sollte den auch immer in Bewegung halten?
Sc hon vor langer Zeit haben die Menschen die Wasserkraft genutzt, um etwas in Bewegung zu setzen.
Mit dem fließenden Wasser wurden z. B. Mühlenräder angetrieben. Das war eine wichtige Leistung der Menschen. Sie haben gelernt, die Muskelkraft durch natürliche Energien, nämlich Wasser und Wind, zu ersetzen.
Das Mühlenrad war eine Form der Wasserturbinen. Nun konnte man zum Beispiel ohne menschlichen Kraftaufwand das Korn zu Mehl mahlen. Ein französischer Ingenieur hat sich im 19. Jahrhundert den Namen „Turbine“ ausgedacht.
•

Beim Fahrrad hast du einen Dynamo. Wer setzt diesen in Bewegung?
• An der Wassermühle gibt es eine Wasserturbine. Wer setzt diese in Bewegung?



Kann man eine Wasserturbine auch nutzen, um elektrischen Strom zu erzeugen?






Aber es gibt doch nicht überall Flüsse, die so stark fließen, dass sie die Turbine antreiben können. Was kann man dann tun?


Youlaf hat recht. Nicht überall kann man eine Wasserturbine durch einen Fluss in Bewegung setzen.
Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke er hitzen Wasser. Dadurch entsteht Dampf. Der drückt sich aus dem Behälter her aus und treibt die Dampfturbine an. Diese hat sehr viele Schaufeln, da für sind sie recht klein. Der Wasser dampf dreht den Dynamo, so wie du das durch das Drehen des Vorderrades bei deinem Fahrrad machst. In einem Kraftwerk sagt man zum Dynamo „Generator“. Dieser Name bedeutet übersetzt „Erzeuger“. Im Generator wird durch die Bewegungsenergie elektrische Energie „hervorgebracht“. Das hast du auch beim Dynamo am Fahrrad erfahren.



Und wieso hat das heißeWasser so viel Kraft?



Arbeite zusammen mit einem anderen Kind!
Ihr benötigt folgendes Material:
Ein feuerfestes Glasgefäß (Reagenzglas oder Erlenmeyerkolben), Wasser, Luftballon, Versuchszange, Teelicht





•
Fülle das Gefäß mit etwas Wasser. Verschließe das Gefäß mit einem Luftballon. Halte das Gefäß mit einer Zange fest.
•

Führe nun das Gefäß über ein Teelicht und warte ab.
• Was kannst du beobachten?

• Überlegt gemeinsam, was hier passiert!
Ist doch klar! Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Wenn es über 100 Grad Celsius heiß wird, wird es zu Wasserdampf.
Dabei vergrößert sich der Platzbedarf um das 1 600- 1 700- fache. Ein Liter flüssiges Wasser braucht also in gasförmigem Zustand 1 600 bis 1 700 Liter Platz.





Stewa erklärt den Versuch ganz schön kompliziert!
• Diskutiere mit der Lerngruppe, was bei deinem Versuch passiert ist.




• Zeichne deine Beobachtung ins Forschungsbuch.
• Schreibe deine Erklärung der Vorgänge dazu.
• Diskutiere in der Gruppe, was dieser Versuch mit einem Kraftwerk, in dem elektrische Energie „generiert“ wird, zu tun haben könnte.
In einem Kraftwerk sind mehrere Stationen notwendig, damit elektrische Energie entsteht. Man braucht Hitze, Wasser (wird erhitzt zu Dampf), Turbinen (Wasserrad) und einen Generator (Dynamo).

Skizziere in deinem Forschungsbuch die Abfolge der Vorgänge in einem Kraftwerk!
Nutze Pfeile, um zu zeigen, in welcher Reihenfolge die Vorgänge stattfinden.
Ellist hat es schon als Problem erkannt: Ein Kühlschrank funktioniert nicht mit einer Batterie. Ein Dynamo kann zwar eine Lampe zum Leuchten bringen, aber Kühlschrank, Fernseher, Küchenmaschine, Licht – und das alles gleichzeitig? Das schafft man nicht mit einem Dynamo. Das heißt, wir benötigen bei uns zu Hause und in der Schule mehr elektrische Energie, damit alle Geräte funktionieren.
Ich denke, dass wir Kraftwerke benötigen.
Die Frage ist, wie wir genügend Wasserdampf bekommen. Und brauchen wir den in allen Kraftwerken?
Diskutiert die Fragen von Mo in einer Kleingruppe!


Ihr habt es sicher herausgefunden: Der elektrische Strom für unseren Kühlschrank kann aus verschiedenen �� Kraftwerken kommen. Sie lassen sich anhand der �� Rohstoffe, aus denen elektrischer Strom nutzbar gemacht wird, unterscheiden.
Beschäftige dich gemeinsam mit einem anderen Kind mit einem Kraftwerk eurer Wahl. Verfasse einen Steckbrief für das Kraftwerk. Du wirst mit deinem Partner / deiner Partnerin das Kraftwerk der ganzen Lerngruppe vorstellen.

Am Ende des Vortrages zieht ihr euer Fazit über das Kraftwerk:
Das Kraftwerk ist gut für unsere Mitwelt, weil ...
Das Kraftwerk ist nicht gut für unsere Mitwelt, weil ...

Diese Punkte sollen im Steckbrief vorkommen:
• Wie heißt das Kraftwerk?
Welcher Rohstoff wird genutzt?
Welche Vorteile bietet das Kraftwerk?
Welche Nachteile hat es?



Gibt es das Kraftwerk in Sachsen?
Wo in Sachsen steht es? (Suche den Ort auf der Karte!)
Euer Fazit: Das Kraftwerk ist nicht gut für unsere Mitwelt, weil …
Schreibe deine Ergebnisse ins Forschungsbuch!











Im Atomkraftwerk (man sagt auch Kernkraftwerk) werden die �� Kerne bestimmter Atome des Schwermetalls Uran gespalten. Dabei entwickelt sich eine sehr große Hitze, mit der Wasser verdampft wird. Mit dem entstandenen Wasserdampf werden Turbinen ange trieben. Die Bewegungsenergie der Turbinen wird in elektrische Energie umgewandelt. Es findet keine Verbrennung von Rohstoffen statt, deshalb wird kein �� Kohlenstoffdioxid (CO2) ausgestoßen.

Beim Spalten der Atomkerne entstehen neben der Wärme �� radioaktive Strahlung und radioaktiver Müll. Diese Strahlung kann Tiere und Menschen sehr krank machen. Bis dieser radioaktive Abfall aufhört zu strahlen, dauert es mehrere Millionen Jahre. In Deutschland weiß man nicht, wo dieser Müll gelagert werden soll. Bis zum Jahr 2022 sollen in Deutschland alle sechs verbliebenen Kernkraftwerke stillgelegt werden. In Sachsen steht keines dieser Atomkraftwerke; es gab hier auch nie ein Atomkraftwerk.



In Kohlekraftwerken wird Kohle verbrannt. Dabei entsteht Hitze, die Wasser zum Verdampfen bringt. Der Wasserdampf treibt �� Turbinen an, deren Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. Kohlekraftwerke liefern zuverlässig Energie, egal wie gut oder schlecht das Wetter ist.
Beim Verbrennen der Kohle entsteht eine große Menge Abgase und �� Kohlenstoff dioxid (CO2). Deshalb möchten Menschen, die die Umwelt schützen wollen, dass Kohlekraftwerke in Deutschland nicht mehr genutzt werden.




Die Kohle befindet sich in der Erde. Manchmal auch an Orten, wo Menschen wohnen. Um die Kohle mit riesigen Baggern ausgraben zu können, werden Städte und Dörfer abgerissen. Die Menschen, die dort leben, müssen ihre Häuser verlassen und an andere Orte umziehen. Auch viele Tiere verlieren so ihren Lebensraum. Kohle ist ein Rohstoff, der aus abgestorbenen Pflanzen unter der Erde entsteht.
Dafür braucht es viele Millionen Jahre. Es gibt nicht unendlich viel Kohle in der Erde. Man sagt zur Kohle wie auch zum Öl und Gas, dass es ein „fossiler“ Brennstoff ist.
Das Wort „fossil“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „ausgegraben“.
In Sac hsen gibt es Kohlekraftwerke in Boxberg und in Lippendorf.


In Wasserkraftwerken werden �� Turbinen durch fließendes Wasser angetrieben. Es gibt viele verschiedenartige Wasserkraftwerke.
•
Kleine Wasserkraftwerke liegen meistens an Flüssen und sammeln so wenig Stau wasser an, dass es nicht notwendig ist, große Dämme oder Speicher zu bauen.
•



In einem Wasserkraftwerk am Meer, dem Meeresströmungskraftwerk, wird die Energie der Wellen durch Turbinen in elektrische Energie umgewandelt. Besondere Kraftwerke nutzen den �� Tidenhub bei Ebbe und Flut.

• In einem Speicherkraftwerk wird Wasser zu einem Stausee aufgestaut. In be stimmten Zeiten brauchen die Menschen mehr elektrische Energie. Dann wird Wasser aus dem See in Rohren abgelassen und im Kraftwerk wird durch Turbinen und Generatoren elektrische Energie erzeugt.



In Wasserkraftwerken entstehen keine Abgase. Das Wasser kann immer wieder gestaut und genutzt werden.
Mit dem Bau von Staumauern wird jedoch in die Natur eingegriffen. Viele Tiere verlieren ihre Lebensräume und Pflanzen verschwinden. Auch Menschen verlieren ihre Heimat, wenn das Tal, in dem sie leben, zu einem Stausee wird.
In Sachsen gibt es ca. 300 Wasserkraftwerke. Die größten Wasserkraftwerke sind Kriebstein, Niederwartha und das Pumpspeicherwerk Markersbach in Mittweida.





Photovoltaikanlagen bestehen aus vielen einzelnen �� Solarzellen. In einer Solarzelle wird die Energie der Sonne in elektrische Energie verwandelt. Die Solarzellen bestehen aus dem Material �� Silizium. Im Silizium sind winzig kleine Teilchen – die �� Elektronen. Wenn sie von den Strahlen der Sonne getroffen werden, bewegen sie sich. Durch diese Bewegung entsteht Strom.


Da die Sonne riesige Mengen an Energie erzeugt und nie damit aufhört, steht uns diese Energie immer zur Verfügung. Es entstehen keine schädlichen Emissionen.
Um ausreichend elektrische Energie zu erhalten, sind große Flächen mit Photo voltaikanlagen notwendig. Die Sonnenstrahlung als Energiequelle ist nicht überall gleichmäßig verfügbar. Je nach Standort, Witterung und Jahreszeit schwanken die erzielbaren Energiemengen der Photovoltaikanlagen enorm. In der Nacht wird gar keine Energie erzeugt.
In Sachsen gibt es viele große Photovoltaikanlagen, die ganze Felder bedecken. Diese werden „Solarpark“ genannt. Auch auf sehr vielen Dächern von Wohnhäu sern sind Anlagen installiert.


















Die Windkraft ist eine weitere Art, wie man Energie nutzen kann. Die Energie des Windes wird in elektrische Energie um gewandelt. Das macht man mit einer Windkraftanlage. Der Wind weht gegen Flügel des Rotors, der dann einen Generator bewegt. Der Gene rator funktioniert ähnlich wie der Dynamo am Fahrrad.

Die Windkraft nennt man „erneuerbare Energie“, da der Wind auch in Zukunft weht und durch das Nutzen der Windkraft nicht weniger wird. Bei der Windkraft entstehen keine Abgase und kein sonstiger Müll. Windenergie kann nur umgewandelt werden, wenn es windig ist. Die sich drehenden Flügel können für Vögel und Fledermäuse gefährlich sein. Manche Leute finden, dass die Windkraftanlagen in der Landschaft nicht schön aussehen. Außerdem halten sie die �� Rotoren für zu laut. In Sachsen gibt es mehr als 25 große Windparks. So nennt man Ansammlungen, bei denen viele Windenergieanlagen zusammenstehen. Anlagen gibt es z. B. in Dittelsdorf, Zerre, Heynitz, Lützen und in der Nähe von Dresden. Einzelne Windräder, man nennt sie Kleinwindanlagen, stehen z. B. an privaten Häusern, kleinen Gewerbebetrieben, Landwirtschaftsbetrieben und Kläranlagen.











In einer Biogasanlage wird ver sucht, mithilfe von sehr kleinen Lebewesen Energie zu erzeugen. Das sind Bakterien, die ohne Sauerstoff leben können.



Dafür zersetzen sie Pflanzen wie Gras, Raps oder Mais oder auch Gülle oder Abfall aus der Biotonne. Dabei entsteht ein Biogas, das, nachdem es gereinigt und getrocknet wurde, als Energieträger genutzt werden kann. Es kann Motoren antreiben oder durch Verbrennung seine Energie in Wärme umwandeln. Biogas kann witterungsunabhängig erzeugt und gespeichert werden. Man kann nachwachsende Pflanzen oder auch biologische Abfälle verwenden.
Beim Verbrennen des Biogases entsteht kaum zusätzliches Kohlenstoffdioxid (CO2). Für die Erzeugung von Biogas werden häufig spezielle Energiepflanzen, z. B. Mais, angebaut. Dies braucht große landwirtschaftliche Flächen. Diese Flächen werden auch für den Anbau von Nahrungsmitteln benötigt. Manchmal werden Wälder ab geholzt, um Platz für den Anbau von Energiepflanzen zu schaffen.
In Sachsen gibt es mehr als 300 Biogasanlagen. Die meisten davon sind Teil eines landwirtschaftlichen Betriebes. Sie stehen oft dort, wo auch Landwirtschaft betrieben wird.








Es gibt unterschiedliche Formen der Energiegewinnung. Kohle, Uran, Öl und Gas sind Energieträger, die endlich sind. Wenn die Menschen diese aufgebraucht haben, sind sie weg. Man kann Energie auch bekommen, ohne dass sie aufgebraucht wird. Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft und Bioenergie stehen immer zur Verfügung. Deshalb nennt man sie „erneuerbare Energien“.

• Erzählt allen anderen Kindern von eurem Kraftwerk. Nutzt dabei euren Steckbrief!
• Entwerft ein Symbol für euer Kraftwerk. Daraus soll hervorgehen, ob die Energieträger aufgebraucht werden oder die genutzte Energie immer vorhanden ist.
• Diese Kraftwerkssymbole nutzt ihr, um die vorhandenen Kraftwerke gemeinsam in eine Karte von Sachsen einzutragen.
• Entscheidet in der gesamten Gruppe, an welchen Orten ihr welche neuen Kraftwerke bauen würdet!


Ich muss genau darüber nachdenken, welche der Kraftwerke schädlich für die Mitwelt und das Klima sind!
Schwierig … Was hat denn Vorrang? Natur, Tiere, Mensch heute oder in Zukunft?




Wie in Sachsen werden auch in Deutschland insgesamt verschiedene Rohstoffe für die Erzeugung von Strom verwendet. Bis 1990 waren dies vor allem die fossilen Brennstoffe.
Danach setzte ein Umdenken ein: Viele Bürger und Bürgerinnen, auch Wissen schaftler und Wissenschaftlerinnen, erkannten, dass diese Energieträger endlich sind und auch das Verbrennen schädlich für Menschen, Tiere, Natur und die gesamte Erde ist. Heute (2021) werden in Deutschland vielfältige Energieformen genutzt.
Ein Roh stoff ist etwas aus der Natur, das die Menschen verwenden können. Man kann Rohstoffe in verschiedene Gruppen einteilen. Eine wichtige Einteilung ist die Frage danach, ob es sie immer geben wird oder ob sie sich erschöpfen. Man spricht von Ressourcen (der Rohstoff kann zu Ende gehen) oder von erneuerbaren Energien (diese können immer wieder gewonnen werden, z. B. die Sonnenenergie).
Schau dir die Grafik oben genau an.



• Hast du eine Idee, welche Energieform zu viel genutzt wird?


• Welche Energieformen könnten in Deutschland mehr genutzt werden?
• Warum?







Schau dir dein Energiehaus im Forschungsbuch der Klasse 2 noch einmal an. Gibt es in deinem Haus Heizkörper?

Hoffentlich, denn bei uns in Deutschland kann es ganz schön kalt werden!
Heizkörper im Haus kennt man. Und die sind im Winter warm. Aber warum? Wie kommt die Wärme in den Heizkörper? In allen Zimmern werden sie warm, im Dachgeschoss wie in der ersten Etage!

Stell dir vor, in der Schule gäbe es keine Heizung und du müsstest den ganzen Tag stillsitzen und lernen. Wäre das möglich?

Sicherlich nicht! Alle würden krank werden oder sich nicht konzent rieren können. Zum Glück gibt es in jeder Schule Heizsysteme.
Gehe auf Entdeckungstour und finde heraus, wie die Heizung in deiner Schule funktioniert!
�� Sieh dir diesen Film über die Funktionsweise einer Heizung an.
Ob die Heizung in der Schule auch so funktioniert? Du kannst dir gemeinsam mit anderen Kindern Fragen zu eurer Schulheizung überlegen! Bilde eine Lerngruppe mit drei weiteren Kindern. Jede Lerngruppe überlegt sich Fragen zu einem Thema. Schaut euch gern den Film noch einmal an! Vereinbart mit dem Hausmeister oder der Hausmeisterin einen Termin, an dem er oder sie eure Fragen beantworten kann. Denkt daran, dass jede Lerngruppe einen Termin benötigt. Die Gruppen müssen sich absprechen!

Das können die Themen der Lerngruppen sein.
Alle Gruppen stellen die gefundenen Fragen und Antworten im �� Plenum vor. Trage die Ergebnisse in dein Forschungsbuch ein.
Dort gibt es diese Tabelle (S. 59 60): Gruppe Thema Fragen Antworten


Ort der Heizung
Wärmeentstehung

Leitungen der Heizung
Weg der Wärme zum Klassenzimmer
Wärmeregulierung im Klassenzimmer
Zeitlicher Betrieb der Heizung
Wärme in unterschiedlichen Räumen

Wenn ich im Klassenzimmer lange stillsitzen muss, wird mir kalt. Geht es dir auch so? Was machst du dann?
• Schau auf ein Thermometer im Klassenraum.
Wie warm ist es im Moment?
Wer fühlt sich wohl? Wem ist es zu kalt oder zu warm?
Welche Temperatur ist für dich die „Wohlfühltemperatur“?









Forschende aus verschiedenen Wissenschaften (Medizin, Pädagogik, Lernforschung) haben herausgefunden, dass eine Raumtemperatur von mindestens 20 °C und maximal 26 °C am besten für das Lernen und Arbeiten ist. Als angenehm empfinden die meisten Menschen eine Temperatur zwischen 20 °C und 22 °C. Aber: In einem Raum, in dem viele Menschen sind, muss man für frische Luft sorgen. Deshalb sollte man regelmäßig die Fenster und Türen öffnen und so für einen Luftaustausch sorgen.


Worauf musst du achten, damit beim Lüften nicht unnötig Wärmeenergie verloren geht?
Eine große Heizungsanlage hat eine zentrale Heizungsregelung. Damit wird die Anlage an- oder ausgeschaltet. Nachts, am Wochenende oder in den Ferien kann die Temperatur in eurem Klassenzimmer abgesenkt werden. Im Sommer wird die Heizung komplett ausgestellt.
Thermostatkopf z
Mit dem Thermostatkopf am Heizkörper im Raum lässt sich die Raumtemperatur regeln. Die Stufe 3 entspricht einer Temperatur von 20 °C. Wird es im Raum wärmer, wird das �� Ventil geschlossen, der Heizkörper wird kalt. Stellt man den Regler auf Stufe 5, werden die Heizkörper wärmer und die Raumtemperatur kann 28 °C erreichen. Dann gibt es auf dem Thermostatkopf auch noch das ❄ -Zeichen. Wenn die Temperatur im Raum weniger als 7 °C beträgt, wird das Ventil geöffnet und es fließt warmes Wasser durch den Heizkörper. Dies ist ein Frostschutz.




Im Film hast du erfahren, dass in einem Heizkessel Öl, Gas oder Holz verbrannt werden kann. Je höher die Raumtemperatur sein soll, desto mehr Wärmeenergie muss in der Heizungsanlage umgewandelt werden.
Das bedeutet, dass mehr Rohstoffe verbrannt werden müssen.
Fazit: Je höher die Wärmeenergie ist, desto höher ist der Bedarf an Rohstoffen, die in der Heizungsanlage in Wärmeenergie umgewandelt werden.
Menschen verbrauchen für die Heizung Rohstoffe, um sich in war men Zimmern aufhalten zu können. Gibt es auch Möglichkeiten, mit erneuerbaren Rohstoffen zu heizen?
• Untersucht in Kleingruppen die verschiedenen Rohstoffe und Heizmöglichkeiten.
• Schreibt eine Lernkartei mit den wichtigsten Informationen über den gewählten Rohstoff. Die Lernkartei wird an die Pinnwand geheftet. Einen Vorschlag findest du im Forschungsbuch.
• Arbeitet die Vor- und Nachteile des Rohstoffs als Heizmaterial heraus!









Erdgas ist ein Rohstoff, der tief in der Erde eingeschlossen ist. Es entstand wie Erdöl und Kohle aus den Resten von Pflanzen und Tieren, vor allem aus Algen. Diese sind vor vielen Millionen Jahren abgestorben und von Erde und Gestein eingeschlos sen worden. Das Erdgas wird mit Bohrtürmen und Pumpen aus der Erde herausgeholt. Die weltweiten Gasvorräte sind nicht unendlich.


Heute fördert man oft das Gas in für die Mitwelt heiklen Gebieten wie in der Nord see, der Arktis und in Sibirien. Bei der Gewinnung von Erdgas wird das Gas Methan freigesetzt. Das ist ein sehr schädliches Treibhausgas.
Durch die Verbrennung von Erdgas wird das Heizungswasser und Warmwasser erhitzt. In vielen Häusern ist eine solche Gastherme installiert. Hierbei entweichen weniger klimaschädliche Gase in die Umwelt als bei der Verbrennung von Kohle und Erdöl.





Erdöl entsteht wie Erdgas und Kohle aus Pflanzen und Tierresten. Die Lagerstätten liegen bis zu 3 000 m tief unter der Erdoberfläche. Erdöl wird mit Bohrtürmen und Pumpen aus der Erde, auch vom Meeresboden, heraus geholt. Das rohe Öl wird zu Heizöl für die Häuser, zu Diesel und Benzin für Schiffe und Autos sowie zu Kerosin für Flugzeuge weiterverarbeitet.



Viele Dinge wie Gummi, Kunst stoffe, Medikamente, Farben usw. werden mit Erdöl hergestellt.

Erdöl ist nur begrenzt auf der Welt vorhanden. Die Umwelt kann stark geschädigt werden, wenn man nach Öl bohrt oder wenn es beim Transport ausläuft. Beim Verbrennen in Motoren, Heizungen und Kraftwerken werden giftige Abgase und große Mengen CO2 freigesetzt.








Holzpellets werden als Brennstoff in kleinen Heizkraftwerken und vor allem für Heizungen in Wohnhäusern genutzt. Pellets sind ein nach wachsender Rohstoff. Werden Bäume gefällt, können neue gepflanzt werden.
In Deutschland werden für die Pellets keine Bäume gefällt, da sie aus Holzabfällen von Sägewerken entstehen. Aus Sägemehl und Sägespänen werden kleine Holzpellets gepresst. Beim Verbrennen von Holzpellets entsteht viel weniger Treibhausgas als beim Verbrennen von Kohle, Gas oder Öl. Für die Holzpellets wird ein Lagerraum benötigt, um eine große Lieferung trocken und in der Nähe des Heizkessels aufzubewahren. Wenn es für die Pellets lange Transportwege braucht, werden dadurch Treibhausgase produziert, die schädlich für Umwelt und Klima sind. Das könnte in Deutschland nötig werden, wenn es nicht mehr genügend Abfälle in den Sägewerken gibt.









Fernwärme bedeutet, dass es ein größeres Heizkraftwerk gibt, das durch Verbrennen von Kohle, Erdgas oder Heizöl Wärme erzeugt. Diese Wärmeenergie wird in Rohr leitungen zu Wohngebäuden transportiert. Die Wohnungen bekommen so neben Raumwärme auch Warmwasser.

Es wird häufig die Wärmeenergie großer Kraftwerke genutzt. Der Wasserdampf, der dort Turbinen antreibt, wird zu heißem Wasser. Dieses wird für die zentralen Heizungsanlagen der Wohngebäude verwendet. Man nennt dies „Kraft-WärmeKopplung“ (KWK). Dadurch braucht man weniger Brennstoff für die gleichzeitige Strom- und Wärmebereitstellung. Die entstehenden Schadstoffe werden reduziert. Durch die langen Transportwege zu den Wohnungen kühlt sich das Warmwasser allerdings ab und es geht ein Teil der produzierten Wärme verloren.
Dieser �� Film erläutert das Prinzip der KWK für Umwelt und Klima.
Die Sonne erwärmt unseren Körper, das Wasser im See, den Boden … Das erleben wir ständig.
Diese Wärme kann ebenso „gesammelt“ und in den Wohnhäusern genutzt werden.

Die Geräte dafür nennt man Solarkollektoren.
Solar ist lateinisch und heißt „Sonne“, Kollektor bedeutet „Sammler“. Die Kollektoren, man sagt auch Sonnensammler dazu, wandeln die Sonnenenergie in Wärme um.
Sie werden auf Gebäudedächern oder auf Freiflächen installiert. Ein Solarkollektor ist ein Kasten, in dem mehrere Röhren in Schlingen gelegt sind. Die Abdeckung des Kastens ist schwarz, weil schwarz am besten die Wärme festhält.


In den Röhren ist eine spezielle Flüssigkeit, die von der Sonne erwärmt wird. Diese wird zu einem Speicher im Haus geführt, wo die Wärme an das Wasser im Speicher abgegeben wird. Das Wasser im Speicher ist nun warm und kann zum Waschen, Duschen und Heizen genutzt werden.


Im Sommer reicht die Sonnenenergie aus, um das gesamte Wasser des Speichers zu erhitzen. Die Sonnenstrahlung ist kostenlos und die Sonne hört nicht auf zu scheinen. Bei einem Sonnenkollektor wird nichts verbrannt, sodass auch kein CO2 entsteht. Nur für die Herstellung der Solaranlage wird CO2 freigesetzt.





Luft, Erde und Grundwasser enthalten immer Wärmeenergie. Auch wenn es friert, ist in Luft, Erde und Wasser immer noch Wärme. Erst bei - 273 °C gibt es keine Wärme mehr. Diese Umweltwärme wird genutzt, um unsere Häu ser zu heizen und Wasser zu erwärmen. Dafür braucht man eine Wärmepumpe. Durch diese Maschine läuft ein Kältemittel, das auch bei Minustemperaturen die Umweltwärme aufnehmen kann. Das ist anders als bei Wasser, das gefriert. Das Kältemittel nimmt die Umweltwärme auf, wird dadurch wärmer und gasförmig. Dieses Gas wird anschließend zusammengedrückt, wodurch die Temperatur noch weiter steigt.



Die hohe Temperatur erhitzt Leitungen, durch die das Wasser fließt, das für die Heizung oder zum Duschen genutzt wird. Wärmepumpen benötigen elektrische Energie, um einerseits die Pumpe zu betreiben, die das Gas zusammendrückt, und andererseits das Wasser auf eine höhere Temperatur zu erhitzen, falls es durch die Umwelt nicht ausreichend heiß wurde. Sie sind leistungsstark und können in neuen Häusern gut eingebaut werden. Die Wärmepumpe verursacht im Vergleich zu einer Ölheizung wenig CO2.

Wärmepumpe z
Kältemittel wird unter hohem Druck heiß




Die Familie von Mo braucht eine Heizung für das neue Haus. Sie gehen alle gemeinsam auf eine Heizungsmesse, auf der ihnen die verschie denen Heizungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Natürlich will ihnen jeder Vertreter und jede Vertreterin der unterschiedlichen Heizungsarten seine Heizung verkaufen. Alle erzählen, wie ihre jeweiligen Heizungen funktionieren und welche Vorteile sie haben. Häufig vergessen sie zu sagen, dass es auch Nachteile gibt. Aber Mo fragt dann immer nach. Am Ende der Veranstaltung diskutieren alle gemeinsam, welche die beste Heizung für das Haus, aber auch für die Umwelt ist. Diese Heizung will sich die Familie dann anschaffen.


Ein Kind spielt Mo. Mo ist immer neugierig und wird viele Fragen stellen. Vor allem will sie wissen, welche Gefahren und Nachteile die Heizung und die Rohstoffe für die Umwelt und die Menschen haben.
Zwei Kinder spielen die Eltern. Sie unterstützen Mo in den Fragen zu den einzelnen Heizungen und den Rohstoffen. Vor allem wollen sie wissen, ob es sich bei den Brennstoffen um ��regenerative, also erneuerbare Rohstoffe handelt.
Alle anderen Kinder sind Vertreterinnen und Vertreter ihrer Heizung. Die Kinder, die eine Lernkartei zum Rohstoff Erdöl geschrieben haben, wollen einen Ölheizung verkaufen. Diejenigen, die sich mit Fernwärme beschäftigt haben, wollen, dass Mos Familie sich an das Fernwärmenetz anschließen lässt. Alle Kinder stellen der Lerngruppe ihre Heizungsanlage vor.







Nach der Schlussdiskussion kann jedes Kind zwei Punkte an Heizungsformen vergeben, die es sich wünscht! Die Heizungsform, die dann die meisten Punkte bekommt, sollte Mos Familie sich anschaffen.
Achtet bei der Wahl bitte auch darauf, ob es durch die Heizung Belastungen für die Umwelt gibt! Denkt daran, dass sich die Erde immer weiter erwärmt! Und dass es manche Rohstoffe bald nicht mehr geben wird!
Mo hat nun durch die Hilfe der Lerngruppe eine gute Beratung für die Anschaffung einer Heizung bekommen.
Wie umweltfreundlich beurteilst du die Heizung in deiner Schule?

Diskutiere mit einem anderen Kind:


• Ist die Heizung klima- und umweltfreundlich? Begründe deine Meinung!
•
Was sollte an der Heizung deiner Meinung nach geändert werden?
• Was kannst du im Klassenzimmer tun, um keine Wärmeenergie zu verschwenden?
• Wie kannst du für dich selbst handeln, um den Wärmebedarf durch Heizungen zu verringern?






Ich habe gerade gelesen, dass fast die Hälfte der gesamten Energie unseres Alltages für die Umwandlungen in Wärme und Kälte benötigt wird. Bei uns in Deutschland ist es überwiegend die Wärmeenergie.

Da muss man was tun!







Du hast erfahren, dass die Sonnenenergie in Kollektoren aufgefangen wird und zur Erwärmung von Wasser und Wohnungen genutzt wird. Erlebe selbst, wie das Sonnensammeln funktioniert!

Du findest im Forschungsbuch eine Anleitung zum Bau einer Fingerheizung.
Beobachte, wie dein Fingerkollektor funktioniert:

• In welche Richtung musst du den Finger halten, damit der Finger warm wird?




• Warum wird der Finger viel wärmer als ohne Fingerheizung?
Tausche dich mit einem anderen Kind über die Ideen aus. Dieser Solarkocher funktioniert wie eine Fingerhei zung. Durch die Spiegelwand werden die Sonnenstrahlen auf den mittleren Bereich konzentriert. Dort steht der schwarze Kochtopf. Er sammelt die Sonnenstrahlen, sodass sein Inhalt, z. B. Wasser, stark erhitzt wird. Kleine Solarkocher werden zur Zubereitung von Proviant bei Wanderungen und Expeditionen verwendet. In Indien gibt es einen Solarkocher, mit dem für 18 000 Menschen gekocht werden kann!

In diesem �� Film erfährst du, wie in der Solarküche in Indien nur mithilfe der Sonnenenergie gekocht wird.

Wenn du magst, kannst du über die folgenden Fragen nachdenken und mit anderen Menschen darüber sprechen.

Denk daran: Es wird bestimmt nicht die eine richtige Antwort auf diese Fragen geben!
Gemeinsam könnt ihr versuchen, so viele Antworten wie möglich zu finden.
•
•
Kann aus Nichts etwas entstehen?
Was wäre, wenn es auf der ganzen Welt keine Roh stoffe mehr gäbe?
•

•


Was bedeutet Energie für uns?

Kann Energie aus der Welt verschwinden?




Welche Verkehrsmittel gibt es und wie unterscheiden sie sich?
Mobilität und Energie
Wie funktioniert der Antrieb eines Fahrzeuges?

Wie verändern die Verkehrsmittel die Natur?
und Fliegen

Verkehrsmittel verändern die Natur
für Züge

- Wege für Autos
Welche Verkehrsmittel gab es früher?
Was ist ungünstig an den schnellen Fahrzeugen?
Welche Verkehrsmittel bringt die Zukunft?
Wie funktioniert ein Elektromotor?
Nachdenkfragen zur Mobilität



Alle Kinder müssen morgens zur Schule. Manche laufen, andere werden mit dem Auto gebracht. Manchmal, wenn Kinder eine Fahrradprüfung gemacht haben, dürfen sie auch mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule kommen. Mo läuft zur Schule. Das Laufen ist ihr wichtig, weil sie dabei viel Spaß hat. Sie entdeckt interessante Dinge auf dem Weg. Wenn sie Freundinnen trifft, kann sie mit diesen reden. An einer Straße auf die grüne Ampel oder Autos zu warten, findet sie sehr langweilig. Deshalb beob achtet sie jetzt immer die vorbeifahrenden Autos. Häufig sitzt nur eine Person im Auto: der Fahrer oder die Fahrerin. Manchmal sitzt ein Kind auf der Rückbank.

Personen mit dem Rad fahren auf einem Radweg, wenn einer da ist. Autos sind auf der Straße. Mo läuft auf dem Gehweg. Manchmal muss sie vor einer Ampel war ten und die Autos vorbeifahren lassen. Jedes Verkehrsmittel hat seinen Platz und seinen zugewiesenen �� Verkehrsweg.




Morgens sind sehr viele Menschen unterwegs. Manche fahren mit der Straßenbahn. Die meisten aber mit dem Auto. Warum laufen nicht mehr Menschen zu Fuß so wie ich?



Überlege und schreibe die Antworten in dein Forschungsbuch:





• Welche Verkehrsmittel hat Mo auf ihrem Schulweg gesehen?
• Welche Verkehrsmittel beobachtest du auf deinem Weg zur Schule?
• Welche anderen Verkehrsmittel kennst du?



• Welche Verkehrsmittel hast du schon einmal genutzt?
Wohin bist du mit diesen gefahren?
• Warum gehst du zu diesen Zielen nicht zu Fuß?
Mhm, stimmt schon. Wenn ich meine Großeltern in Dresden besuche, gehe ich nicht zu Fuß. Da wäre ich dann von Zettlitz aus mehr als 15 Stunden unterwegs. Das würde ich gar nicht schaffen ...
Welche Verkehrsmittel nutzt du? Welche Wege legst du damit zurück? Warum nutzt du diese Verkehrsmittel?
Sammle die Wege, die du mit den verschiedenen Verkehrsmitteln zurücklegst. Finde zu jeder Frage zwei Beispiele:
• Welche Wege gehst du zu Fuß?

• Für welche Wege nimmst du das Fahrrad?
•
Welche Strecken fahren deine Eltern mit dem Auto?
•

Für welche Strecken nutzt du, viel leicht mit der Familie, den Zug?
Trage deine Wege und Verkehrsmittel in die Tabelle im Forschungsbuch ein!



•




Wie unterscheiden sich die zurückgelegten Strecken?
• Kann man die Strecken auch mit anderen Verkehrsmitteln zurücklegen? Begründet eure Meinung!
• Wie weit sind die Strecken? Wie schnell und wie lange ist man mit den jeweiligen Fahrzeugen unterwegs?
• Was ist anders beim Reisen auf diesen Strecken mit den verschiedenen Verkehrsmitteln?
Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720-1797), genannt Baron von Münchhausen, erzählt von seinem Ritt auf der Kanonenkugel:
„Um die Festung und das Heer der Feinde auszukundschaften, schwang ich mich auf eine Kanonenkugel, die wir in Richtung der Feinde abgeschossen haben. Um wieder unbeschadet zurückzugelangen, wechselte ich im Flug auf eine gegnerische Kanonenkugel, die mich wieder zurück in unser Lager brachte.“
Diese Grafik aus dem Jahr 1873 zeigt, wie der �� Baron Münchhausen auf einer Kanonenkugel reitet.

Kann das sein? Beratet euch zu zweit und begründet eure Meinung!


Seht euch jetzt die folgenden Aussagen an. Welche Strecken wurden mit welchem Verkehrsmittel zurückgelegt?
Entscheidet, ob die Aussagen stimmen oder falsch sind. Notiert eure Ergebnisse in dem Forschungsbuch:
a) Wenn Oskar zweimal pro Jahr seine Großeltern in München besucht, fährt er von Leipzig mit dem Fahrrad nach München.
b) Oskars Eltern fahren mit dem Auto zum Einkaufen. Der Supermarkt ist 500 Meter entfernt.
c) Zum Fußballtraining geht Oskar zu Fuß.
d) Um neue Kleidung zu kaufen, fliegt Oskars Familie am liebsten mit dem Flugzeug in die Nachbarstadt.
e) Die Urlaubsfahrt nach Spanien legt Oskars Familie mit der Straßenbahn zurück.




•

Tausche dich mit deiner Sitznachbarin / deinem Sitznachbarn darüber aus.
• Formuliert zwei weitere richtige oder falsche Aussagen und lasst andere raten!
Alles, was sich bewegt, benötigt Energie. Menschen erhalten die Energie, die sie bei der Fortbewegung brauchen, aus der Nahrung, die sie essen. Verkehrsmittel, die einen Motor haben, brauchen Kraftstoff. Es gibt sehr unterschiedliche Kraftstoffe. Was weißt du bereits?
• Welche Kraftstoffe oder Energien benötigen Autos, um fahren zu können?
• Woher bekommen Straßenbahnen ihre Energie zur Fortbewegung?
• Was treibt ein Flugzeug an?

Notiere deine Gedanken im Forschungsbuch.


74



Der schnellste Vogel auf Kurzstrecken ist die Taube. Sie kann bis zu 120 km/h schnell fliegen. Das schnellste laufende Tier ist der Gepard. Er spurtet mit über 110 km/ h über die Wiese. Woher bekommen diese Tiere ihre Energie? Recherchiert auf der ��Website von geolino und auf der �� Website der Tierchenwelt.
In der Regel gilt ein Grundsatz bei der Fortbewegung:


• Je schneller wir uns fortbewegen, desto mehr Energie benötigen wir.
Das gleiche gilt für die Entfernung:
• Je weiter wir gehen / fahren / fliegen, desto mehr Energie brauchen wir.
Ordne den Energiebedarf für die folgenden Fortbewegungsarten und Entfernungen ein. Die Bewegungsarten sollen in eine Reihenfolge von „wenig Energiebedarf“zu „viel Energiebedarf“ gebracht werden.

wenig Energie viel Energie
a) 500 km mit dem Auto fahren (von Torgau bis München)
100 Meter rennen (Längsseite eines Fußballfeldes)
5 000 km mit dem Flugzeug fliegen (Somalia, wo Youlafs Familie wohnt)

50 km mit dem Auto fahren (von Zettlitz bis zum Markkleeberger See vor Leipzig)
100 Meter spazieren gehen (ungefähr 200 Schritte)
500 km mit dem Flugzeug fliegen (von Leipzig nach Zürich)
5 km spazieren gehen (von Zettlitz bis Rochlitz)
Diskutiere deine Ergebnisse mit einem anderen Kind.
Überlegt gemeinsam:


• Wie schnell bewegen sich die Verkehrsmittel?
• Macht es einen Unterschied, ob ein oder mehrere Menschen in einem Fahrzeug sind?
Früher sagte man zu den Fahrzeugen „Automobile“. Du hast schon gelernt, dass das Wort „mobil“ „beweglich“ bedeutet. Das Wort „Autos“ heißt „selbst“. Ein Auto ist also etwas, das sich scheinbar „von selbst bewegt“. Man kann auch sagen: Das Auto ist ein Selbstbeweger. Es wird zum Beispiel nicht von Pferden gezo gen.




Autos und Schiffe fahren mit Benzin oder Diesel, Flugzeuge fliegen mit Ke rosin. Dies sind Flüssigkeiten, die man aus Erdöl herstellt. Im Motor werden sie mit Luft zu einem Gas vermischt und dann verbrannt. Deshalb nennt man das einen Verbrennungsmotor. Beim Verbrennen entstehen heiße Abgase, die sich ausdehnen.


Dabei drücken sie auf einen Kolben, der sich in einem Zylinder auf und ab bewegt. Diese Bewegung wird über ein Getriebe auf die Räder des Autos oder die Schraube des Schiffes übertragen.
Dies ist ein Getriebe. Man kann die verschieden großen Zahnräder erkennen.






Hier ist er aufgeschnitten, damit du dir den Vorgang besser vorstellen kannst.
Der Kolben bewegt sich im Zylinder auf und ab. Der Brennraum ist der Raum ober halb des Kolbens.
Takt: Der Kolben geht nach unten und saugt Gas an.
Takt: Der Kolben geht nach oben und drückt das Gas zusammen.
Takt: Das Gas explodiert und drückt den Kolben nach unten.
Takt: Der Kolben geht nach oben und drückt die Abgase hinaus (rot gezeichnet)
Der Vorgang beginnt wieder von vorn.







Benzin wird in der �� Raffinerie aus Erdöl hergestellt. In einigen Ländern wird heute dem Benzin Öl aus Pflanzen beigemischt. So braucht es weniger Erdöl. Das Benzin wird dadurch umweltfreundlicher. Man braucht dafür aber viel Ackerland.
Diesel ist ein Kraftstoff, mit dem viele Autos und Lastwagen fahren. Auch Busse fahren manchmal mit Diesel. Diesel wird aus Erdöl gewonnen.
Sc hweröl wird fast nur für große Schiffe verwendet, manchmal auch für Lokomotiven. Schweröl gilt als umweltschädlich und hat einen hohen Schadstoff-Ausstoß. Auch Schweröl wird aus Erdöl gewonnen.
Kerosin wird vor allem als Treibstoff für Flugzeuge und Hubschrauber verwendet.
Wie bei Diesel und Schweröl ist auch bei Kerosin das Erdöl der Ausgangsstoff für die Herstellung.
Du weißt bereits:
• Je s chneller die Fortbewegung ist, desto mehr Energie wird gebraucht.
• Je weiter die zurückgelegte Strecke ist (durch Gehen / Fahren / Fliegen), desto mehr Energie wird benötigt.

Schätze den Energiebedarf für die folgenden Fortbewegungs arten und Entfernungen ein. Bringe sie in eine Reihenfolge von „wenig Energiebedarf“ zu „viel Energiebedarf“. Du findest die Skala im Forschungsbuch.


1 000 km mit dem Flugzeug bei einer Geschwindigkeit von 1 000 km in der Stunde (km/h). (Von Dresden aus wärst du mit dem Flieger in einer Stunde in Rom, Italien.)


10 km mit der Straßenbahn, bei einer Geschwindigkeit von 15 km in der Stunde (km/h). (Die Straßenbahn ist in 40 Minuten vom Bahnhof Dresden in Freital.)

100 km mit dem Auto, bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h. (Mit dem Auto würdest du in einer Stunde von Dresden aus in Stollberg / Erzgebirge sein können.)
10 km zu Fuß, bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h (Du würdest zwei Stunden laufen, z. B. von Zettlitz nach Hartha.)
100 km mit dem Reisebus bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h (Wenn du von Dresden losfährst, braucht der Bus eine Stunde und 35 Minuten, um in Leipzig anzukommen.)

Tausche dich mit einem anderen Kind aus.



• Vergleicht die Reihenfolge, in die ihr die Fortbewegungsmittel gebracht habt.
•
•


Diskutiert über die unterschiedlichen Einordnungen der Fortbewegungsmittel.
Überlegt: Ein Bus ist schwerer als ein Auto, also braucht er mehr Energie. Welches Fahrzeug sollte man nutzen, wenn man die Umwelt schützen will? Warum?





Oskar ist ein Freund von Youlaf. Im letzten Jahr ist er in den Ferien zum ersten Mal mit seiner Familie nach Spanien geflogen.


So ein Flugzeug ist ganz schön groß, dachte er, als er es am Flughafen sah. Wenn er an den Flug zurückdenkt, erinnert er sich vor allem an die Lautstärke der Motoren beim Start. Das Flugzeug wurde auf der Startbahn so schnell , dass es ihn kräftig in den Sitz gedrückt hat.

Aus dem Fenster hat er beobachtet, wie die Bäume immer schneller an ihm vorbeizogen. Dann hob das Flugzeug ab. Aus dem Fenster sah Oskar, wie das Flugzeug über Häuser, Straßen, Wälder und Flüsse hinwegflog.
Oskar konnte erkennen, wie groß die Autobahnen sind, auf denen die Autos und LKWs fahren. Ihm wurde bewusst, dass Autos nur dort fahren können, wo Straßen sind.







Das Flugzeug flog höher und höher und alles wurde immer kleiner. In der Ferne sah Oskar ein weiteres Flugzeug. Das schien direkt auf ihn zuzukommen. Oskar fragte sich: Gibt es in der Luft eigentlich auch so etwas wie eine Straßenverkehrsordnung für die Flugzeuge?
Das Fliegen hat die Menschen schon immer fasziniert. Aber auch nachdenklich ge macht. Vor fünfzig Jahren sind sehr wenige Menschen mit dem Flugzeug geflogen. Heute reisen die Menschen genauso häufig mit dem Flugzeug wie mit dem Auto in den Urlaub.

Lies dir folgende Äußerungen durch. Was sagen dir die Aussagen?

„Wer fliegen will, muss den Mut haben, den Boden zu verlassen.“
Walter Ludin, Schweizer Journalist
„Wenn wir Flügel hätten, hätten wir nie das Flugzeug erfunden.“


Pavel Kasarin, ein Schriftsteller aus Tschechien
„Das einzig Gefährliche am Fliegen ist die Erde.“ Wilbur Wright (1867 1912), der erste Flugzeugpilot


•

Bist du schon mit dem Flugzeug geflogen? Was war für dich das Aufregendste dabei?
Überlege dir eine Geste, Mimik oder Statue, die dies zeigt!
Zeige sie den anderen Kindern und berichte dann von deinen Gefühlen.
• Wie hat sich Oskar beim Start des Flugzeugs gefühlt? Was ist ihm am meisten in Erinnerung geblieben?

Präsentiere Oskars Erlebnisse und Gefühle ebenfalls mit ��pantomimischen Gesten.

• Was hat sich Oskar gedacht, als er so aus dem Fenster geschaut hat? Welche Beobachtungen hat er gemacht?



Schreibe diese Beobachtungen in das Forschungsbuch.
Diskutiere mit einem anderen Kind:


• Warum fährt Oskars Familie nicht mit einem anderen Verkehrsmittel nach Spanien? Mit dem Auto, dem Zug oder dem Fahrrad?
• Finde Gründe, warum sich die Familie für das Flugzeug entschieden hat.






Verkehrsmittel sind unterschiedlich schnell, deshalb eignen sie sich für unterschiedliche Entfernungen. Große Entfernungen sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad schwer zu überbrücken. Es braucht viel Zeit, die meistens nicht vorhanden ist. Allerdings können Menschen wandernd fast überall hin. Es müssen nicht zwingend Straßen ��asphaltiert oder Schienen verlegt werden, um Wege zu bekommen, auf denen man gehen kann. Auch darauf kann man laufen: auf Gras, auf Steinen, auf Erde. Für andere Verkehrsmittel müssen meistens Wege gebaut und angelegt werden. Autos benötigen Straßen und Straßenbau verändert die Natur!
Die Natur wird verändert, wenn Eisenbahnschienen verlegt werden. Häfen benötigen Molen und Piers, an denen Schiffe anlegen können. Das verän dert die Natur.
Flughäfen benötigen lange Start- und Landebahnen, die breiter sind als Autobahn spuren. Auch hier wird in die Natur eingegriffen.
Wo vorher nur Erde und Gras war, sind jetzt Straßen, Schienen, asphaltierte Flä chen und verdichtete Böden. Dort können Autos und Busse fahren sowie Flugzeuge starten und landen.

Wo Schienen sind, können Züge und Straßenbahnen fahren.
Wo Häfen sind, können Schiffe anlegen.
Die Menschen bauen und verändern die Natur, um schneller von einem Ort zum anderen zu gelangen.

Erforsche die benötigten Flächen und Bauarten der verschiedenen Verkehrswege.
Bildet Gruppen mit vier Kindern. Jede Gruppe übernimmt einen Verkehrsweg und recherchiert die jeweiligen Verkehrswege! Präsentiert eure Ergebnisse in einem kurzen Vortrag. Zeigt Mate rialien, Fotos oder sonstige Dinge, die ihr herausfinden konntet!
Fußwege gibt es überall und sie sind sehr verschieden ausgebaut.
Findet heraus:
• Auf welchen Wegen lässt es sich schwer gehen? Wer hat dort insbesondere Probleme?



• Wo ist ein solcher Weg in deinem/eurem Wohnort? Zeichnet einen besonders schwer begehbaren Boden oder macht ein Foto in eurem Wohnort! Bringt auch etwas Baumaterial der Wege mit.


Findet heraus:



• Wie sollte ein sicherer Fahrradweg sein?






• Wie sollte ein Fahrradweg gekennzeichnet sein?
Wie breit sollte ein Fahrradweg sein, damit man sicher darauf fahren kann?
Welchen Belag sollte ein guter Fahrradweg haben?
Ihr könnt die Fragen miteinander diskutieren und ebenso im Internet recherchieren. Sucht in eurem Wohnort gut gebaute Fahrradwege und schlechte Fahrradwege. Schreibt die Mängel und die Straßennamen auf. Vielleicht macht ihr Fotos von den Radwegen.
Tragt eure Ergebnisse in das Forschungsbuch ein.
Ein Bahnhof ist eine Anlage, an der Reisende Züge besteigen oder verlassen dürfen. Oder es werden Güterzüge be- oder entladen.


Manchmal gibt es große Gebäude, vor allem in Städten. Dann sagt man Hauptbahnhof dazu.
Findet heraus:


• Gibt es in eurem Ort einen Bahnhof? Wenn nicht, befragt einen Erwachsenen zu einem nahegelegenen Bahnhof.
• Wie viele Gleise hat der Bahnhof?
• Warum braucht man so viele Gleise?





• Wie groß ist der (nächstgelegene) Bahnhof im Vergleich zu eurem Schulgebäude?


Würde der Bahnhof auf euren Schulhof passen?
• Warum fahren Züge nicht auf Straßen?
Schreibt alle eure Erkenntnisse auf. Vielleicht macht ihr Fotos vom Bahnhofsgebäude und von den Gleisen. Tragt eure Ergebnisse in das Forschungsbuch ein.







Es gibt sehr unterschiedliche Straßen: Stadtstraßen, Hauptverkehrsstraßen, Landstraßen, Autobahnen, Kraftfahrstraßen ...


•
•
•
•
•

Warum haben Autobahnen mindestens vier Fahrstreifen und zwei Standstreifen?
Warum haben manche Stadtstraßen ebenso vier oder mehr Fahrstreifen?
Welche Straßenformen gibt es in eurem Ort?

Welchen Belag haben diese Straßen?
Welche Straße in eurem Ort ist in einem schlechten Zustand?

Schreibt alle eure Erkenntnisse auf. Vielleicht macht ihr Fotos von wichtigen Straßen und Straßenbelägen. Tragt eure Ergebnisse in das Forschungsbuch ein.
Oskar erzählt seiner Großmutter von seinen Erlebnissen im Flugzeug. Seine Omi hört fasziniert zu. Sie war viel älter als Oskar, als sie zum ersten Mal geflogen ist.
„Als ic h Kind war, so um 1960, wären meine Eltern nicht auf die Idee gekommen, mit mir nach Spanien in den Urlaub zu fliegen. Urlaub haben wir in der Nähe gemacht, auf dem Bauernhof oder in den Bergen. Ich war noch nie in Spanien. Man muss auch nicht nach Spanien fliegen. Einen spannenden und erholsamen Urlaub kann man auch in unserer Gegend machen.“
Sie zeigt Oskar und seiner Schwester ihr Fotoalbum. Oskar staunt, was seine Großmutter in ihrem Urlaub alles erlebt hat!









Denk über die folgenden Fragen nach! Tausche dann mit dem Nachbarskind deine Gedanken aus!
• Warum ist Oskars Großmutter nicht nach Spanien geflogen, als sie in seinem Alter war und mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat?
• Hast du eine Idee, wo seine Großmutter Urlaub gemacht haben könnte? Wie ist sie dorthin gekommen?
•


Interviewe deine Eltern und Großeltern nach ihren Urlaubsorten in der Kindheit.

Wo haben sie ihre Ferien verbracht? Wie sind sie dorthin gekommen?
Was haben sie dort erlebt?
Wie verreiste man vor 200 Jahren? Heute nutzen wir Verkehrsmittel, die vor 100 oder 200 Jahren noch gar nicht erfunden waren oder nur von wenigen genutzt werden konnten. Stell dir vor, Oskar wäre vor 100 Jahren in die Schule gegangen. Die wäre im Nachbardorf, 5 km entfernt.
In den Ferien hätte er Urlaub in der Umgebung gemacht. Welche Verkehrsmittel hät te er nutzen können? Welche hätte er auf seinem Schulweg beobachten können?

Flugzeuge gibt es noch nicht lange. Man hat sie erst erfinden müssen. Das war ein langer Prozess, der schon in der Antike also vor Christi Geburt begann. Aber das erste Motorflugzeug gab es erst sehr viel später. Auch Autos mussten erst erfunden werden. Dazu musste erst der Verbrennungsmotor entwickelt werden. Vor den Verkehrsmitteln, in denen Rohstoffe verbrannt werden, hat man sich anders fortbewegt.
Sortiere die folgenden Verkehrsmittel der Reihenfolge nach in den Zeitstrahl ein!




Stelle dir vor, du könntest in die Zukunft schauen.
• Welche Verkehrsmittel sollte man erfinden?
• Zeichne deine Ideen in dein Forschungsbuch.



• Ordne auch deine Fahrzeuge in den Zeitstrahl ein!
• Erläutere in der Lerngruppe deine Ideen! Was ist das Besondere an deinem Verkehrsmittel?
Heute kann man in immer kürzerer Zeit große Strecken zurücklegen. Mit dem Flug zeug kann man an einem Tag einmal um die Welt fliegen. Früher hat das viel länger gedau ert. Die erste Weltumrundung mit dem Schiff fand 1519 statt. Sie dauerte drei Jahre! Heute schafft man das mit einem guten Segelboot in 40–50 Tagen!
Ein bekanntes Buch, das von den Abenteuern einer Weltreise erzählt, ist von Jules Verne. Es heißt „In 80 Tagen um die Welt“.
Der reiche Engländer Phileas Fogg wettet am 2. Oktober 1872 in seinem Club in London, die Welt in achtzig Tagen umrunden zu können. Zusammen mit seinem neuen Diener bricht er sofort auf.


Was den beiden unterwegs widerfährt, ist viel aufregender, als mit den Eltern im Auto an die See zu fahren.
Es ist ein großes Abenteuer, das in die Dschungel Indiens führt und in Amerika sei nen Lauf nimmt. Erschwerend kommt hinzu, dass Phileas Fogg von dem Polizisten
Fix verfolgt wird, der glaubt, dass Fogg ein gesuchter Londoner Bankräuber ist ...




• Je schneller und je weiter man sich fortbewegt, desto mehr Energie wird benötigt. Bei jedem Verbrennungsmotor entstehen Abgase. Abgase und die Stoffe, die damit in die Luft abgegeben werden, bezeichnet man als Emissionen. Ein solcher Stoff ist CO2 Kohlendioxid. Dieses Kohlendioxid ist schlecht für das Klima und beschleunigt die Erderwärmung noch mehr.
Bilde eine Gruppe mit vier anderen Kindern.


Schaue dir die Tabelle mit den verschiedenen Verkehrsmitteln und ihren benötigten Energiemengen an. Jedes Kind aus der Gruppe übernimmt oder „ist“ ein Fahrzeug. Ein Kind stellt die „Fahrzeuge“ so nebeneinander, dass zuerst das Fahrzeug mit den wenigsten Emissionen bis hin zu dem mit den meisten Emissionen in einer Reihe stehen. Wenn ihr mögt, malt euch das Fahrzeug auf und nehmt es in die Hand.
Welches Verkehrsmittel verursacht am meisten CO2 Emissionen? Diskutiert in der Gruppe!

Mit dem Flugzeug von München nach Stuttgart (220 km)

Mit dem Auto von Dresden nach Leipzig (110 km)
Mit dem Zug von Leipzig nach Berlin (200 km)

Mit dem Bus von Chemnitz nach Nürnberg (240 km)






Es ist sinnvoll, verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu vergleichen. Man will herausfinden, welches am wenigsten umweltschädlich ist.
Das kann man tun, wenn man die Personen, die in dem Fahrzeug sind, berücksichtigt. Es macht einen Unterschied, ob nur eine Person in dem Auto von Leipzig nach Berlin sitzt oder alle Plätze besetzt sind also insgesamt 5 Personen mitfahren.
Man berechnet, wie viele Emissionen pro Person und pro gefahrene Kilometer entstehen. Man nennt das auch „Emissionen pro Passagierkilometer“. In einen ICE - Zug passen zum Beispiel ungefähr 750 Personen. Das heißt, die Menge an Emissionen muss man auf diese Personen verteilen. Flugzeuge sind unterschiedlich groß. Sie transportieren je nach Größe ungefähr 200 bis 800 Personen.
So kann man die Verkehrsmittel besser miteinander vergleichen und bei jeder Strecke erkennen, welches Verkehrsmittel am wenigsten umweltschädlich ist.
Denkt nun noch einmal gemeinsam über die Reihenfolge eurer Aufstellung nach.
Stellt euch nun so, wie es sein würde, wenn alle Fahrzeuge voll besetzt wären.
Es gibt Verkehrsmittel, die besonders umweltschädlich sind. Es gibt die Möglichkeit, Verkehrsmittel so auszuwählen, dass sie gut geeignet und wenig klimaschädlich sind.
Menschen waren nicht immer mit Autos unterwegs. Flugzeuge sind erst seit 1970 als Massenverkehrsmittel für die Menschen interessant geworden.
Verkehrsmittel sind vielfältig und sie verändern sich. Früher sahen Autos anders aus als heute. Autos werden mit unterschiedlichen Energien angetrieben. In der Regel sind es heute aber immer noch die fossilen Brennstoffe, die verwendet werden.




Forscher und Forscherinnen fragen sich, wie wir uns in Zukunft fortbewegen können. Man möchte neue Verkehrsmittel und bessere Verkehrsmittel bauen. In den vergangenen 30 Jahren hat sich einiges verändert. Heute denken die Autoindustrie, aber auch Politiker und Politikerinnen vor allem über klimaschonende Fahrzeuge nach. Bist du schon einem Auto begegnet, das an einem Kabel angeschlossen war? Diese Autos können ohne Benzin oder Diesel fahren. Sie fahren mit elektrischer Energie. Man nennt sie Elektroautos, sie sind Teil der Elektromobilität. Die Elektromobilität hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, vor 20 Jahren fuhren nur vereinzelt Autos mit elektrischer Energie.



• Warum sollen Autos heute eher mit elektrischer Energie angetrieben werden?
• Wo kommt die elektrische Energie für die Autos her?

• Was ist das Besondere an den Elektroautos? Was fällt auf, wenn ein Elektroauto durch die Straßen fährt?
• Warum fahren nicht alle Fahrzeuge, also auch Lastwagen, Reisebusse und Traktoren, mit elektrischer Energie?
Ein Elektromotor wandelt den elektrischen Strom in Bewegung um. Im Prinzip ist er wie ein Fahrraddynamo aufgebaut. Man benötigt Magneten, die sich in einer Drahtspule drehen. Wenn elektrischer Strom durch die Spule fließt, entsteht eine Kraft, die auf die Magneten wirkt und sie in Bewegung setzt. Diese Bewegung wird auf eine Welle übertragen. Durch verschiedene Getriebe können so die Autoräder angetrieben werden.



Einen kleinen Elektromotor kannst du leicht selbst bauen. Die Anleitung dazu findest du auf der �� Website von tuduu.org.

Die Frage nach dem „richtigen“ Verkehrsmittel ist nicht immer einfach zu beantworten.

In der Philosophie spricht man von einer Dilemmadiskussion: Man sammelt alle Argumente, um danach zu einer eigenen Entscheidung zu kommen. Diskutiere mit dir selbst, mit anderen Kindern oder Erwachsenen die folgenden Aussagen:
• Autos sollten prinzipiell für alle Menschen verboten werden. Das schont die Umwelt und das Klima.
• Die Menschen sollten sich nur so weit auf der Welt bewegen, wie sie es zu Fuß oder mit dem Fahrrad tun können.
• Man braucht nicht nach Mallorca oder Amerika fliegen. Durch das Internet oder Fernsehen kann man sich diese Länder auch zu Hause an schauen und kennenlernen.
Bilder sagen manchmal mehr als Worte:
• Welche Fragen fallen dir zu dem Bild rechts ein?




Was haben Nahrungsmittel mit einem guten Leben zu tun?
Warum kann man in Deutschland das ganze Jahr über Tomaten kaufen?
Eine Erkundung: Woher kommen die Tomaten im Supermarkt?
Wie klimafreundlich sind Tomaten?
Eine Geschmacksprobe
Wie werden Tomaten angebaut?
Welche Tomaten kommen in die Supermärkte?
Transport von Tomaten – vom Anbau bis zum Verzehr

Tomaten mögen es warm
Tomaten und Wasser
Tomaten und das Leben der Arbeiter
Preise von Tomaten
Tomaten und Gesundheit

Abfall, Müll – oder was?



Ein Leben fast ohne Plastik
Was sind Gütesiegel?









Ich lese gerade etwas über Paradiesäpfel! Spannend.
Es soll über 3 000 verschiedene Sorten geben! Du kennst sie nicht? Das sind Tomaten. Paradiesapfel heißen sie in Österreich.

Die Tomate stammt ursprünglich aus Mexiko.
Die dort lebenden �� Azteken hatten die Tomate Xitomatl genannt. Als Kolumbus Amerika entdeckte, kam auch die Tomatenpflanze nach Europa. Die Menschen wussten nicht, dass man die Früchte essen konnte. Sie hielten die Tomatenpflanze lange Zeit wie eine Zierblume. In Deutschland hat man die ersten Tomaten vor ungefähr 120 Jahren gegessen.
Erst wenn die gelbe Blüte durch ein Insekt befruchtet wird, kann daraus ein Samen wachsen. Um den Samen herum wächst dann die eigentliche Tomate. In der �� Biologie gelten Tomaten als Beeren. Auf unseren Märkten oder in unseren Läden werden sie jedoch meist beim Gemüse einsortiert.

Die Samen einer Tomate können ausgesät werden und so gibt es weitere Tomatenpflanzen.
 Samenz
Samenz




Die Klimakinder haben einige Aussagen zu Tomaten gesammelt. Lies die einzelnen Aussagen genau durch.

• Entscheide dich, ob du der Aussage zustimmst oder nicht. Überlege dir ein Argument für deine Meinung.
• Schreibe deine Argumente in das Forschungsbuch.











Die Menschen in Deutschland mögen Tomaten nicht gern essen. Möhren sind ihr Lieblingsgemüse …
Tomaten gibt es schon immer in Deutschland. Sie sind ein traditionelles Lebensmittel. Sie werden täglich gegessen.
In unserer Region kann man gut Tomaten anbauen. Die meisten in Deutschland gegessenen Tomaten kommen von hier.
Tomaten haben im Sommer Saison. Man kann sie nur im Sommer kaufen.
Tomaten bestehen fast nur aus Wasser.

Die gesamte Lerngruppe führt eine Tomatendebatte.
Alle Pro-Kinder (diejenigen, die die Aussagen bestätigen) sitzen auf einer Seite. Alle Contra-Kinder (diejenigen, die gegen die Aussagen stimmen) auf der anderen.

• Nun geht es immer abwechselnd: Einem Pro-Argument folgt ein Contra-Argument!
• Bevor ihr euer Argument sagt, müsst ihr die Aussagen der Klimakinder vorlesen.

Warum kann man in Deutschland das ganze Jahr über Tomaten kaufen?


• Zu welcher Jahreszeit kann man in Deutschland Tomaten ernten?
• Zu welcher Jahreszeit kann man im Supermarkt Tomaten kaufen?
Diskutiere mit einem anderen Kind:
• Warum kann ich Tomaten im Supermarkt fast jederzeit kaufen?
• Handelt es sich um ein saisonales Lebensmittel?

Saisonale Lebensmittel sind Lebensmittel, die in deiner Region wachsen und zu der Zeit geerntet werden, in der du sie auf dem Markt kaufen kannst. Sie kommen direkt vom Feld auf den Ladentisch.


Regionale Lebensmittel stammen aus der angegebenen Region und werden dort auch verarbeitet, verpackt und vertrieben. Sie haben kurze Transportwege.
Das bedeutet meist einen niedrigeren CO2-Ausstoß.



Im Supermarkt kannst du das ganze Jahr hindurch Tomaten kaufen. Manchmal sind sie lose in einer Kiste, häufig sind sie bereits abgepackt.






• Wo sind die Tomaten gewachsen? Du findest den Namen der Region oder des Landes am Regal selbst oder auf einem Schild auf der Verpackung!
•
•

•
Untersuche die Herkunft von vier verschiedenen Sorten!

Notiere die Orte / Regionen in deinem Forschungsbuch.
Schreibe die Kosten für 1 kg Tomaten in dein Forschungsbuch.


Im Forschungsbuch ist eine Karte von Europa abgedruckt.

Zeichne in jede Region, aus der die Tomaten herkommen, eine Tomate ein.
•


Vergleiche mit einem anderen Kind, welche Herkunftsorte es entdeckt hat.
• Welche Orte sind gleich?


• Vergleicht eure Ergebnisse mit denen der gesamten Lerngruppe.
• Was fällt euch auf?

Die Tomate ist noch vor Möhren, Speisezwiebeln und Gurken das meistverzehrte Gemüse in Deutschland. Es werden in einem Jahr circa zweieinhalb Millionen �� Tonnen Tomaten verbraucht. Das ist ungefähr so viel, wie 2 500 Elefanten wiegen! Um diese Menge Tomaten auf einmal zu transportieren, würde man 90 000 Lastkraftwagen (LKW) be nötigen. Wenn die dicht hintereinanderfahren, wäre das eine Strecke von 1 700 km. Die Autobahn von Hamburg nach Rom wäre komplett mit Autos zugeparkt!










Das sind unglaublich viele Tomaten! Es bedeutet, dass jeder Mensch in Deutschland in einem Jahr ungefähr 27 kg Tomaten isst. Das ist mehr als ich wiege!
Du musst bedenken, dass wir die nicht alle roh essen! Sie sind im Ketchup, auf Pizza, in Suppen … Weißt du, wo die Tomaten überall herkommen?
Ich weiß es. Die Kinder haben es zum Teil schon herausgefunden. Aus den Nieder landen, Spanien, Belgien, Marokko, Italien, Frankreich …






Das ist aber kein guter Umgang mit der Umwelt! Die weiten Transporte, die Plastikverpackungen … Die Luftqualität wird immer schlechter. Ich habe gelesen, dass es schon eine riesengroße Plastikmüllinsel im Ozean gibt!
Meine Großmutter hat selbst Tomatenpflanzen in ihrem Garten. Zwar gibt es bei ihr nur von Juli bis Oktober Tomaten, aber die schmecken! Die sind so süß, da braucht man außer Butter nichts anderes auf dem Pausenbrot!


• Organisiert eine „Tomatenverkostung“ in der Lerngruppe.



• Einige Kinder bringen Tomaten von zu Hause mit in die Schule.
• Versucht, auch Tomaten aus einem heimischen Garten (eigener Garten, Garten von Verwandten oder fragt Personen z. B. in Schrebergärten) zu bekommen.
• Merkt euch den Herkunftsort der Tomaten!
• Schneidet nun die Tomaten in kleine Stücke. Unter den Teller legt ihr den Zettel mit dem Herkunftsort. Neben dem Teller liegt eine Liste, in die die Kinder eine Note eintragen dürfen.
• Nun darf jedes Kind die Tomaten probieren und mit Noten bewerten.
Welche Tomate hat die besten Noten bekommen?







Die Tomate ist eine einjährige, Wärme liebende und frostempfindliche Pflanze. Sie kann als Busch wachsen, in den meisten Gewächshäusern wächst sie jedoch als �� Schnurtomate bis zu 15 Metern. Fast immer werden Tomaten in riesigen Gewächshäusern gehalten. Zum Bestäuben werden Hummelvölker im Gewächs haus freigelassen. Die Gewächshäuser werden in kühleren Gegenden wie in Deutschland beheizt, wenn das ganze Jahr geerntet werden soll. Die Tomaten brauchen gleichmäßig viel Wasser und ausreichend Düngung. Die Pflanzen werden in kleinen Töpfen vorgezogen. Wenn die Setzlinge genügend groß sind, werden sie gepflanzt. Sieben bis zwölf Wochen nach der Pflanzung wird zweimal wöchentlich geerntet.
Der Geschmack der Tomaten kann sehr unterschiedlich sein –je nach Sorte und Anbaugebiet.

Aber auch für die Umwelt und das Klima macht es einen Unterschied, welche Tomaten wir konsumieren.
Bildet eine Lerngruppe mit sechs Kindern.
• Lest die Texte und findet heraus, was für den Anbau von Tomaten in den Län dern Deutschland, Spanien und den Niederlanden notwendig ist. Immer zwei Kinder übernehmen ein Land.

• Tragt die Ergebnisse in die Tabelle im Forschungsbuch ein.

• Überlegt gemeinsam, was für die Tomatenpflanzen in einem eigenen Garten oder Schulgarten benötigt wird.










In Deutschland werden auf insgesamt 400 Hektar Land Tomaten angebaut. Ein Hektar Land ist noch größer als ein Fußballfeld.
In den Niederlanden sind es 1800 Hektar Land, das für Tomatenpflanzen genutzt wird. Das sind 4,5-mal mehr Fläche als in Deutschland.
In Spanien werden 56 000 Hektar Land mit Treibhäusern für Tomaten bebaut. Das ist 140-mal so viel Platz, wie man in Deutschland für den Tomatenanbau nutzt.



Gewächshausfelder für Tomaten in Spanien
Gewächshaus für Tomaten in den Nieder landen

Gewächshaus für Tomaten in Deutschland
Auf den riesigen Gewächshausflächen für Tomaten kann nichts anderes wachsen keine Bäume, Sträucher, Wiesen und Blumen. Somit leben nur wenige Insekten und andere Tiere an diesen Orten.
In diesem �� Video kannst du dir anschauen, wie in einem Betrieb in den Niederlanden die Tomaten sortiert, gewogen, verpackt und auf Lastwagen getragen werden.

In den einzelnen Ländern wird unterschiedlich viel Platz für den Tomatenanbau benötigt. Wenn du dir vorstellst, dass alle Tomaten aus Deutschland, den Niederlanden und Spanien zusammen in Sachsen angebaut werden, würden auf den Flächen Sachsens, die in der Karte farbig gezeichnet sind, nur Tomaten wachsen! Auf den Flächen von Chemnitz und Dresden zum Beispiel würden alle Tomatenpflanzen Spaniens wachsen – da wären dann natürlich keine Häuser und Straßen!



Fläche des Tomatenanbaus in Deutschland
Besucht den Schulgarten oder einen Garten in der Nachbarschaft! Versucht, die Fragen zu beantworten, und erzählt es den anderen in der Gruppe:


• Wie viel Platz nehmen Tomatenpflanzen in dem Schulgarten oder in einem Garten in deiner Nähe ein?
•
•
Wie viele Tomatenpflanzen wachsen dort?
Kannst du oder können die Gartenbesitzer und Gartenbesitzerinnen abschät zen, wie viele kg Tomaten in einem Jahr geerntet werden?
•

Für wie viele Menschen reichen die geernteten Tomaten?
Schreibe deine Erfahrungen in das Forschungsbuch!







Stewa hat sich schon gewundert, dass jeder Mensch in Deutschland so viele Tomaten isst. Die müssen gepflanzt, gepflegt und geerntet werden. Damit gibt es sie aber noch nicht zu kaufen! Sie müssen noch in den Supermarkt gelangen!
Die meisten Tomaten werden in Lastwagen transportiert.
Innerhalb von Deutschland werden 100 000 Tonnen Tomaten angebaut.
Du erinnerst dich: Ein Elefant wiegt ungefähr 6 Tonnen.
Das sind ungefähr so viele Tomaten, wie 16 666 Elefanten wiegen. Das kann man sich nicht vorstellen!
Und diese vielen Tomaten werden alle in Lastwagen geladen und fahren über die Straßen und Autobahnen zu den Großmärkten und Supermärkten. Würde man die Tomaten alle zur gleichen Zeit in die Laster laden und diese auf die Straße schicken, wäre die Autobahn von Dresden nach Chemnitz mit den Tomatenlastwagen zugestellt! Das wären dann 3 900 solcher Lastwagen!
In den Niederlanden werden jährlich 1 Million Tonnen Tomaten geerntet. Auch diese werden auf Lastwagen geladen und in Orte innerhalb Europas transportiert.


Stellt man diese Tomatenlastwagen hintereinander auf die Autobahn, gäbe es von Dresden bis München auf der Autobahn eine einzige Schlange mit Tomatenlast wagen.
Das sind 23 000 Lastwagen auf 460 km. Wenn man mit dem Auto diese Strecke ohne Pause fährt, braucht man dafür fast fünf Stunden!






In Spanien werden fast 5 Millionen Tonnen Tomaten jährlich angebaut. Würde man alle in Spanien geernteten Tomaten auf Laster laden und diese auf einer Autobahn aneinanderreihen, so wäre die gesamte Strecke von Dresden bis in die südlichste Spitze Spaniens, Gibraltar, mit Lastwagen vollgestellt. Wie gut, dass die Tomaten nicht alle zur selben Zeit transportiert werden!




In Deutschland lieben die Menschen die Tomaten aus Spanien. Diese Tomaten werden über 2 000 km mit dem LKW bis zu unseren Supermärkten transportiert. Das verbraucht viel Energie für die Fahrzeuge. Die Lastwagen brauchen etwa 30 Liter von dem Kraftstoff Diesel auf 100 km. Sie transportieren damit allerdings auch etwa 30 Tonnen Tomaten auf einmal. Dennoch gibt es �� Emissionen, welche die Luft verschmutzen. 2019 wurden 180 000 Tonnen Tomaten nach Deutschland transportiert. Das waren ungefähr 6 000 vollbeladene große Lastzüge. Diese Tomaten waren dann ungefähr vier Tage in einem Lastwagen auf der Autobahn unterwegs.
Tomaten aus den Niederlanden und aus Deutschland müssen nicht so weit reisen. Je näher der Anbau an unserem Supermarkt oder dem Ort, wo wir die Tomaten verzehren, statt findet, desto kürzer ist der Transportweg. Das spart Energie und schont die Umwelt. Deshalb sollten auch die Kunden darauf achten, wo sie ihre Tomaten einkaufen. Wenn sie mit dem Auto 20 km zum Supermarkt oder zu einem Bauernhof in der Nähe fahren würden, um ein Kilogramm Tomaten zu kaufen, wäre das viel schädlicher für die Umwelt als der Transport mit dem großen Sattelzug.





•

Woher bekommst du deine Tomaten?
• Wie weit ist der Supermarkt, Markt oder Garten entfernt?


• Mit welchen Verkehrsmitteln kommst du dorthin?
• Wie viel und welche Energie verbraucht das?

Tomaten mögen es warm Tomatenpflanzen können in den Garten gepflanzt werden, wenn es mindestens 15 °C warm ist. Frost vertragen Tomaten nicht. In einem Gewächshaus darf es höchstens 30 °C warm sein.
In Deutschland und auch in den Niederlanden ist es nicht kontinuierlich gleich warm und sonnig wie in Spanien. Haben die Tomaten gleich bleibende Wärme und Licht, hat man den besten Ertrag auf einem Hektar Anbaufläche. Deshalb werden die Tomaten in Deutsch land und in den Niederlanden in Gewächshäusern angebaut, die beheizt werden, damit es warm genug ist. Dafür wird viel Energie benötigt. Das Heizen der Gewächshäuser erfordert mehr Energie als der Transport von Tomaten in den LKWs.

In Spanien muss man die Gewächshäuser nicht beheizen. Dort gibt es das ganze Jahr über genug Sonnenenergie. Allerdings gibt es dort andere Herausforderungen.













• Kennst du Menschen, die in einem Gewächshaus Tomaten anbauen?
• Werden dafür außer der Sonne zusätzliche Energien eingesetzt?
• Pflanzt ihr Tomaten im Schulgarten an? Benötigt ihr dort zusätzliche Energie?

In Südspanien werden die meisten Tomaten für Europa angebaut. Das Klima ist trocken und heiß. In dieser Gegend regnet es selten und es gibt keine Flüsse.


Tomaten brauchen zum Wachsen viel Wasser; sie bestehen fast nur aus Wasser. In Spanien wird für ein Kilogramm Tomaten fast 50 Liter Wasser benötigt das sind fünf große Eimer voll. In Südspanien, in der Gegend von Almería, ist die Wasserknappheit ein großes Problem. Der Tomatenanbau verbraucht so viel Wasser, dass die Flüsse und Stauseen austrocknen, das Grundwasser absinkt und der Boden verdorrt. In Deutschland verbraucht man 9 Liter Wasser pro Kilogramm Tomaten.
In den Niederlanden sind es viel weniger, nämlich 2 Liter Wasser pro Kilogramm Tomaten. Hier wird ein besonderer Boden verwendet, der das Wasser speichert. Außerdem wird das Regenwasser auf gefangen und zum Wässern verwendet.
• Fragt nach, wie viel Wasser ein Hobbygärtner für seine Tomatenpflanze benötigt!
• Wie viel Wasser wird im Schulgarten verbraucht, bis die Tomaten geerntet werden können?


In vielen Regionen, wo das zu uns transportierte Gemüse angebaut wird, arbeiten Menschen zu einem Niedriglohn. Das bedeutet, dass die Arbeitenden viel weniger Geld für ihre Arbeit bekommen, als gesetzlich festgelegt wurde und sie verdienen sollten. Sie kommen aus ärmeren Ländern wie Osteuropa oder Afrika.
In Südspanien leben die Arbeitenden oft in Slums, haben keine festen Häuser und meistens kein fließendes Wasser und keinen elektrischen Strom. Die Leute arbeiten in den Gewächshäusern, weil sie in ihrem Heimatland keine Arbeitsstelle bekommen. Sie schicken ihren geringen Lohn an ihre Familien, damit diese ein wenig besser leben können.




In Deutschland und in den Niederlanden arbeiten auch viele Men schen für einen geringen Lohn. Die Arbeits - und Lebensbedingungen sollen besser sein als für die Menschen in Südspanien.


Wenn Privatmenschen Tomaten in ihrem Garten anbauen, dann tun sie das meistens, weil es Freude macht. Viele sagen, dass diese Tomaten viel köstlicher sind als gekaufte Tomaten. In der Regel müssen diese Hobbygärtner nicht von einem Verkauf der Ernte leben.
Preise von Tomaten Tomaten aus den südlichen europäischen Ländern sind im Supermarkt häufig am günstigsten. Das liegt daran, dass es in diesen Ländern sonnig und warm ist und man keine Energie benötigt, um die Gewächshäuser zu heizen. Außerdem erhalten die Arbeitenden in diesen Ländern meistens einen sehr niedrigen Lohn.
Tomaten aus den Niederlanden sind teurer, da dort Gewächshäuser benötigt werden, die beheizt werden müssen.
Tomaten aus unseren Regionen sind meist die teuersten. Hier hat man Gewächshäuser, die viel Wärmeenergie brauchen. Dazu gibt es in Deutschland höhere Lohnkosten. Das macht die Tomaten für die �� Verbraucher und Verbraucherinnen teuer.




•



Du hast bereits im Supermarkt herausgefunden, aus welchen Ländern die Tomaten kommen.
• Du hast auch die Preise für die unterschiedlichen Tomaten aufgeschrieben.
• Vergleiche die Preise der Tomaten. Aus welchem Land kommen die günstigsten Tomaten? Begründe!
Tomatenanbau kann ganz schön problematisch sein! Muss man denn unbedingt Tomaten essen? Es geht doch auch ohne ...

Klar sollte man Tomaten essen, denn sie sind sehr gesund! Sie enthalten viele wichtige Vitamine.
Das Vitamin A ist gut für gesunde Augen, die B-Vitamine unterstützen das Herz und den Kreis lauf. Dann gibt es in den Tomaten viele Mineralien und natürlich Wasser. Der Stoff, der die Tomate rot färbt, schützt die Haut vor Sonnenschäden. Deshalb sind Tomaten ein super Sommergemüse!





Mo hat erfahren, dass Tomaten empfohlen werden, weil sie ein gesundes Lebensmittel sind.
Ellist hat darauf aufmerksam gemacht, dass es auf der Welt viel Plastik, Luftverschmutzung und Wasserknappheit gibt. Und dass dies auch mit dem Tomatenanbau zu tun hat.
In der Tabelle zum „Tomatenanbau hier und anderswo“ hast du notiert, ob und wie in den einzelnen Regionen die Umwelt belastet wird. Du kannst an deiner Tabelle erkennen, welche weiteren problematischen Dinge in manchen Regionen stattfinden.





•
•



Sollte man keine Tomaten oder weniger Tomaten essen?
Sollte man im Supermarkt Tomaten aus Spanien, den Niederlanden oder aus einer Region in der Nähe kaufen?
• Sollte man zum Bauernhof fahren und dort Tomaten kaufen?
• Sollte man nur noch eigene Tomaten anbauen?
•
Ist es immer besser, die Tomaten aus der Region zu kaufen? Oder gibt es Gründe für den Kauf von spanischen oder niederländischen Tomaten?
• Was würdest du tun?
Schreibe einen Text in dein Forschungsbuch.
• Teile deine Gedanken mit und begründe deine Entscheidung.
•

Schreibe Fragen auf, die du zum Anbau und Konsum von Tomaten hast.

Ellist hat im Zusammenhang mit dem Tomatentransport die Plastikverpackungen und die Plastikmüllinsel im Ozean angesprochen.
Müll oder Abfall sind überwiegend Dinge, die wir nicht mehr brauchen und die wir loswerden möchten. Dazu gehören kaputte und benutzte Sachen wie zerbrochene Tassen, defektes Spielzeug, volle
Die Wellen spülen das Plastikzurück an den Strand
Windeln oder Dinge, die beim Auspacken von Dingen anfallen. Abfälle wie Verpackungen aus Plastik oder Karton sind feste Stoffe, aber auch Flüssigkeiten oder Gase aus der Industrie gehören zum Abfall.


In den meisten Haushalten wird der Müll sortiert. Dennoch wird zu sorglos und zu viel weggeworfen. Es gibt Menschen, die sagen: „Nicht alles ist einfach Müll.“
Vieles, was wir in den Abfall werfen, beinhaltet Wertstoffe, die wiederverwendet werden können. Bei diesen Materialien gilt: Verbrennen ist Verschwendung.
Finde heraus, was bei dir zu Hause weggeworfen wird.
• Du kannst einen Tag lang jedes weggeworfene Teil notieren oder fotografieren.
• Bitte alle Familienmitglieder, die Dinge, die sie in den Eimer werfen, vorher auf deine Liste zu schreiben.
• Du kannst die Liste unterteilen in: Restmüll, Plastik (Gelbe Tonne), Papier, Biomüll.



• Wenn es geht, fotografiere die einzelnen weggeworfenen Dinge.
• Merke dir Dinge, die du wegwerfen solltest, aber behalten wolltest.
Diskutiert in der Kleingruppe. Nutzt dazu die Notizen und Fotos.
• Was hebst du (oder deine Familie) auf, was andere wegwerfen?
• Was heben andere auf, was für dich in den Müll gehört?
• Welche Dinge im Müll könnten wiederverwendet werden? Wofür?




• Wie viel Müll ist Verpackung von Lebensmitteln? Ist die Verpackung notwendig?






In Deutschland werfen die Menschen in einem Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Das wäre das Gewicht von 2 Millionen Elefanten (so viele gibt es gar nicht mehr). Würde man diese Menge Müll auf Lastwagen laden, wären dafür 480 000 LKWs notwendig. Oft kaufen die Menschen zu viele Lebensmittel ein. Sie können gar nicht alles essen, bevor es verdirbt oder schlecht wird. Es wird weg geworfen. Dabei sind viel Energien, Wasser und andere Rohstoffe für die Lebensmittelherstellung eingesetzt worden! Ein weiteres Problem sind die Plastikverpackungen. Obst und Gemüse, Back- und Süßwaren, Fleisch- und Wurstprodukte, Käse und Milchprodukte beinahe alles ist in Plastik verpackt. Das soll die Lebensmittel länger frisch halten. Aber muss wirklich alles in Plastik verpackt sein? Überlege:
• Wann ist es sinnvoll, ein Lebensmittel in Plastik zu verpacken?

• Wann ist die Plastikverpackung überflüssig?


Oft entsteht viel zu viel Plastikmüll. Plastik liegt dann an Straßenrändern oder auf Feldern.
Das ist gefährlich: Kühe können beim Grasen Abfälle verschlucken. Plastik gerät in Flüsse, Seen und Meere und wird von Fischen, Schildkröten und Vögeln gefressen. Die Ber ge an Plastik verursachen große Probleme auf der ganzen Welt.

In diesem ��Film „Tschüss Plastik!“ erzählt Jana von ihren Erfor schungen zum Thema Plastik . (EU bedeutet „Europäische Union“. Das ist eine Vereinigung von 27 europäischen Ländern). Bevor du dir den Film anschaust, suche dir drei der folgenden Fragen aus, die du anschließend schriftlich beantworten willst. Schreibe die Antworten in das Forschungsbuch.
1. Worüber war Jana nach ihrem Einkauf im Supermarkt entsetzt?
2. Warum ist Plastik oftmals nützlich?
3. Warum ist der viele Plastikmüll ein Problem?






4. Was geht bei der Verbrennung von Plastik verloren?
5. Was ist in ganz Europa verboten?


6. Was sind die Vorteile eines Bienenwachstuchs?
Diskutiert anschließend in der Kleingruppe eure Ideen zu den folgenden Fragen. Zeichnet ein Beispiel in das Forschungsbuch und beschreibt es!
• Wie können Plastikverpackungen verringert werden?
• Was kann man statt Plastik für Verpackungen verwenden?







Viele Umweltorganisationen beschäftigen sich mit der Frage, wie man die Umwelt von den Plastikbergen befreien kann. Zumindest sollten die Berge nicht höher werden. Sie empfehlen drei wichtige Vorgehensweisen:



Zum Einkaufen geht man am besten nie ohne Taschen, Beutel und Dosen aus dem Haus. Dann kann man darauf achten, dass Lebensmittel nicht unnötig in Plastik verpackt sind. Apfel, Gurke, Kohlrabi und viele andere Obst- und Gemüsesorten haben eine eigene „Verpackung“ – ihre Schale. Sie brauchen nicht noch eine extra Schutzschicht aus Plastik. Es gibt Netzbeutel für Obst und Gemüse, die man jedes Mal zum Einkaufen mitnimmt. Alle �� Umverpackungen sollte man im Supermarkt zurücklassen. So zeigt die Kundschaft, dass sie diese nicht haben möchte.
Immer mehr Läden füllen frische Lebensmittel in mitgebrachte Gefäße und Behältnisse aus Glas oder Porzellan. Darin können sie zu Hause weiter aufbewahrt werden. Brotdosen aus Metall oder ein Bienenwachstuch halten das Schulbrot frisch.





Dinge aus Plastik lassen sich mehrfach verwenden. Eine Plastiktüte kann beim nächsten Einkauf wieder benutzt werden. Behältnisse aus Plastik können zur Aufbewahrung von anderen Dingen dienen. Sie werden zu Gefrierbehältern, Tuschbechern, Behältern für Schrauben und Nägel, Schatztruhen für Muscheln oder Steine.



Viele weggeworfene Verpackungen aus Plastik könnten recycelt werden. Plastikmüll aus der gelben Tonne wird zu Fabriken ge fahren. Dort wird er gereinigt, zerkleinert geschmolzen und zu neuem Plastik verarbeitet. Aus Plastikflaschen werden nicht wieder Plastikflaschen, sondern zum Beispiel Kunststoffbauteile für Fernseher, Haushaltsgeräte oder Schaltknöpfe für Autos. Damit Plastikverpackungen recycelt werden können, ist eine sorgfältige Mülltrennung wichtig. Müll, bei dem Papier, Essensreste und Plastik vermischt werden, kann nicht recycelt werden. Er wird deswegen verbrannt. Dabei entstehen viele Abgase. Die sind schädlich für die Menschen und die Umwelt.






Aber können Kinder denn überhaupt etwas tun, um Plastik zu vermeiden? Die Erwachsenen kaufen doch immer ein ...


Das stimmt so nicht. Überleg mal, was wir uns so wünschen und kaufen: Autos, Tierfiguren, Bausteine aus Plastik …



Das könnt ihr alles von mir haben, ich brauch das nicht mehr. Eh, das ist die Idee: Wir veranstalten einen Tauschmarkt!


Überlegt in der Gruppe, wie ihr Plastikverpackungen vermeiden oder wiederverwenden könnt.
• Sammelt 10 Ideen und schreibt / malt sie in das Forschungsbuch.
• Gestaltet gemeinsam ein Plakat oder fertigt eine Collage an.


• Der Titel kann lauten: Gesucht! Plastikschurken
• Bringt für diese Collage Plastikteile von zu Hause mit.

• Gestaltet eine Ausstellung und ladet eure Eltern und andere Schulklassen zu der Ausstellung ein.

• Erzählt den Besuchern und Besucherinnen, warum ihr diese Ausstellung gemacht habt!


Als ich im Supermarkt war, habe ich ein Regal mit Verpackungen entdeckt, auf denen Zeichen und Bilder aufgedruckt sind. Als ich danach fragte, hieß es: Das sind Gütesiegel! Mehr hat der Verkäufer nicht erzählt. Ich kann immer noch nichts damit anfangen. Könnt ihr mehr herausbekommen?
• Schau zu Hause nach, ob es ein Lebensmittelprodukt mit einem „Siegel“ gibt.
• Wenn ja, frage die Eltern, ob du es für einen Tag mit in die Schule nehmen darfst.
• Achte darauf, dass das Produkt nicht angebrochen ist!
Das Wor t „Siegel“ ist die Abkürzung von „Gütesiegel“.


Diese Symbole oder Zeichen haben unterschiedliche Bedeutungen. Einige zeigen, wie die Lebensmittel produziert wurden, andere weisen darauf hin, dass Arbeiter und Arbeiterinnen „fair“ bezahlt wurden.








• Untersuc ht in der Lerngruppe, welche Siegel auf den einzelnen Lebensmitteln abgedruckt sind.

• Besprecht in der Gruppe, was die von euch gefundenen Siegel bedeuten könnten.



• Überlegt, ob diese Siegel etwas mit dem Klimawandel zu tun haben könnten.

• Sucht im Internet nach den Siegeln, die einen Namen aufgedruckt haben. Ihr könnt auch zuerst den Begriff „Siegel“ eingeben.


Klickt diese Seiten an: �� klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon �� www.zdf.de/kinder/logo/fair-trade-100.html
• Malt zwei Siegel in das Forschungsbuch. Schreibt einige Worte dazu, die die Bedeutung des Siegels erläutern.
• Schaut euch �� dieses Video an. Hier erfahrt ihr, warum man das Siegel „Fairer Handel“ eingeführt hat.


Gestaltet die Mindmap im Forschungsbuch. Nennt alle Gründe, die den fairen Handel notwendig machen. Berücksichtigt, warum es uns Menschen nutzt, mehr Geld für diese Produkte auszugeben.
• Spielt eine Einkaufssituation. Es gibt zwei Schokoladensorten. Eine sehr günstige Schokolade und eine mit dem Siegel „Fair Trade“. Die ist doppelt so teuer.
Ein Kind spielt den Verkäufer bzw. die Verkäuferin. Er bzw. sie will unbedingt die preiswerte Schokolade verkaufen. Die zwei kaufenden Kinder haben den Film über den fairen Handel gesehen. Welche Schokolade werden sie kaufen? Wie argumentieren sie gegenüber dem Verkäufer oder der Verkäuferin?








Diese Siegel sind eine großartige Sache! Sie verhelfen vielen Menschen zu einem guten Leben. Siehst du das auch so? Ich verstehe nur dieses Siegel nicht. Darauf steht nichts ...
Ellist meint das Europäische Bio-Siegel. Im Jahr 2010 hat man es in Europa eingeführt. So kann man z. B. sehen, ob die Tomaten, die aus den Nie derlanden oder Spanien kommen, biologisch angebaut wurden. Bio ist eigentlich alles, was wächst. Mit dem Siegel verpflichten sich die Land wirte allerdings, dass

• die Tiere, die der Lebensmittelproduktion dienen, Auslauf haben und nicht zusammengepfercht werden. Hühner dürfen zum Beispiel draußen herumlaufen.
• Pflanzen natürlich und nicht mit chemischen Mitteln gedüngt oder gegen Schädlinge behandelt werden.
• die Tiere ökologisches Futter bekommen.
Die Betriebe werden einmal im Jahr kontrolliert, ob sie die Bedingungen erfüllen. Tun sie das nicht, bekommen sie eine Frist, in der sie den Fehler beheben können. Wenn die Tiere dann immer noch falsch gehalten oder giftige Düngemittel genutzt werden, muss der Landwirt das Siegel wieder abgeben. Weil die Biobetriebe dadurch viel höhere Kosten haben, nicht so viel anbauen können und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fair bezahlen, sind die Produkte mit diesem Siegel in den Läden teurer als dieselben Produkte ohne Siegel.

•


Ist es gut, dass Tiere mehr Platz zum Leben bekommen? Sie werden doch geschlachtet und gegessen!
• Ist es gerecht, dass man für Bioprodukte mehr Geld bezahlen muss?
• Kann man den Unterschied zwischen einem Bio-Apfel und einem anderen Apfel sehen und schmecken?
• Wer hat ein gutes Leben durch das Bio-Siegel?


Wenn ihr die Diskussion geführt und euch in der Lerngruppe ausgetauscht habt, schau dir den �� folgenden Film an. Louis und Peter erfahren in einem Laden für Bioprodukte genau, wo her die Waren kommen, wer in dem Laden arbeitet und vieles mehr.
Du weißt nun viel über Siegel, Bioprodukte und Fair Trade.
• Schreibe einen Brief für die Schulzeitung oder an deine Eltern, in dem du begründest, warum du es gut und richtig findest, dass es diese Produkte gibt.
• Du kannst erklären, welche Produkte du dir zu Hause oder für die Schulküche oder den Schulkiosk wünschst.
• Schreibe auch, dass es Nachteile gibt. Begründe, was man für ein gutes Leben tun sollte.
•

Entwerfe ein eigenes Siegel, das für deine Wünsche und für ein gutes Leben steht. Dafür hast du eine Seite im Forschungsbuch.
• Du kannst dieses Siegel dann etwas kleiner unter deinen Brief malen und erläutern, was es aussagen soll!

Wie entsteht ein T-Shir t?

Schritt: Die Baumwolle wird angebaut und geerntet
Schritt: Die Baumwolle wird zu Fäden gesponnen
Schritt: Der Stoff wird gewebt
Schritt: Das T-Shirt wird genäht
Schritt: Das T-Shirt wird verkauft
Wie wertvoll ist ein T-Shirt?



Wie kommt das T-Shirt zu seinem Preis?
Kinderarbeit in der Kleidungsindustrie
Woran erkennst du klimagerechte und faire Kleidung?
Wie kannst du dich noch klimagerecht kleiden? Was können sich alle leisten?
Zum Nachforschen, Weiterdenken und Philosophieren




So ähnlich haben Schulkinder gebrauchte Kleidung im Klassenzimmer aufgehängt. Sie haben versucht, die Geschichte eines Kleidungsstückes herauszufinden. Wenn du in dieser Lerngruppe warst, kannst du in deinem Forschungsbuch aus Klasse 2 nachlesen, was du entdeckt hast.
Jedes Kleidungsstück trägt ein Etikett. Das erzählt etwas über das Kleidungsstück.



Sieh nach, was auf dem Etikett deines heutigen T-Shirts steht!
Lass dir von einem anderen Kind helfen. Wo wurde das T-Shirt hergestellt? Du kannst deine Ergebnisse ins Forschungsbuch eintragen.


Reise mit dem T-Shirt zurück in die Länder, wo es bereits war! Die meisten T-Shirts sind um die ganze Welt gereist, bevor wir sie hier im Laden kau fen können. Die T-Shirts werden fast immer aus einem Baumwollstoff genäht. Die meisten T-Shirts waren in mindestens vier unterschiedlichen Ländern, bevor es sie in unseren Läden zu kaufen gibt.




O.K. Ich weiß, dass Baumwolle nicht wie die Wolle von einem Schaf stammt, sondern angebaut wird. Aber wo? Kann Baumwolle überall wachsen? Wie sieht die Pflanze aus? Ich habe sie bei uns auf den Feldern noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, wie daraus ein Stoff wird!
Schließe dich mit drei anderen Kindern zusammen. Ihr erarbeitet gemeinsam einen der folgenden Herstellungsschritte eines T-Shirts:























Jedes Kind wird Experte / Expertin für den jeweiligen Herstellungsschritt.
Wenn du mit deiner Erarbeitung fertig bist, bildest du eine neue Gruppe. Jedes Kind schließt sich mit jeweils einem Kind aus den anderen Gruppen zusammen. Diese Gruppe sieht jetzt so aus:








Jede Expertin / jeder Experte berichtet nun den anderen von dem jeweiligen Herstellungsschritt. Schreibe die Fragen auf, die du nicht beantworten kannst!
Schreibe dir Stichworte über dein neues Wissen in das Forschungs buch. Dann kannst du den anderen Kindern die Inhalte besser berichten!


Gemeinsam mit den Kindern in dieser neuen Gruppe liest du den Text „Das T-Shirt wird verkauft“.


1. Schritt: Die Baumwolle wird angebaut und geerntet Baumwolle wächst auf der Baumwollpflanze. Die Pflanze braucht viel Wärme und Wasser und wächst deshalb in den Tropen und Subtropen. Vor allem in den Ländern Kasachstan, China, Indien, Pakistan, Usbekistan und in den USA wird die Baumwollpflanze angebaut.


Da die Menschen viel Baumwolle brauchen, werden riesige Felder, die man Plantagen nennt, bepflanzt. Hier können somit keine Nahrungsmittel angebaut werden.


Der Baumwollstrauch ist ein durstiges Gewächs. Für 1 kg Baumwolle braucht man ungefähr 13 000 Liter Wasser – das sind 100 Badewannen voll Wasser. Für die Herstellung eines T-Shirts sind das ungefähr 3 250 Liter Wasser. Dadurch verschwinden Seen, trocknen Flüsse aus und fehlt den Menschen das Süßwasser als Trinkwasser. Für die Ernte der Baumwolle braucht man viele Arbeiter und Arbeiterinnen.
Oft müssen Kinder bei der Ernte helfen, damit die Familien genug zum Leben haben. Dann können sie nicht zur Schule gehen.











Früher hat man die weißen Samenhaare der Baumwolle mit der Hand an einem Spinnrad gesponnen. Dafür wird eine Baumwoll faser genommen, verdreht und gestreckt. So bekommt man den Faden. Erst 1764 wurde in England die Spinnmaschine erfunden. Sie konnte acht �� Garnspindeln auf einmal spinnen! Die Spinnmaschinen wurden immer größer. Sie wurden dann mit Dampfmaschinen angetrieben und konnten 1 000 Garnspindeln gleich zeitig spinnen. Heute werden zum Beispiel in China in großen Fabriken Garne gesponnen. Die Fasern werden dabei zu langen Fäden verdreht. Diese Fäden werden dann gefärbt. Zum Färben werden oft Mittel verwendet, die Menschen krank machen können. Die bunten Fäden werden zum Schluss auf große Spulen aufgerollt und zu einer Weberei geschickt.









Beim Weben von Stoffen müssen Fäden zweier Fadensysteme, man nennt sie „Kette“ und „Schuss“, rechtwinklig zueinander stehen. In einer bestimmten Reihenfolge werden sie auf einem Webstuhl verkreuzt. Der erste Webstuhl wurde im Jahr 1786 in England entwickelt. Heute gibt es zum Beispiel in Polen große Webereien. In so einem Gebäude stehen viele Maschinen nebeneinander. Sie weben aus Garn große Stoffbahnen. Das Prinzip des Webens ist immer gleich geblieben.


In Bangladesch nähen Frauen und manchmal auch Männer einzelne Stücke aus Baumwollstoff zu einem fertigen T-Shirt zusammen. Dabei hat jede Frau ihre eigene Aufgabe: Die eine Frau näht Vorder- und Rückseite zusammen und gibt es dann an die nächste Näherin weiter. Diese näht den Saum, eine dritte Frau den Ärmel usw. Die Frauen machen also den ganzen Tag die glei chen Nähte. Viele arbeiten mehr als 16 Stunden am Tag. Sie sitzen bei ihrer Arbeit meistens in großen Hallen eng beieinander. Viele haben einen sehr langen Heimweg und schlafen deshalb auf dem Boden in der Fabrikhalle. Kinder arbeiten auch in den Textilfabriken, obwohl das verboten ist. Wenn die Prüfer kommen, müssen sie sich verstecken. Frauen und Kinder werden für die Arbeit meistens schlecht bezahlt. Viele bekommen nicht mehr als 1 € am Tag.





Die T-Shirts waren schon in Indien, China, Polen und Bangladesch.



Von dort aus werden sie mit dem Flugzeug nach Deutschland gebracht. Um in die Geschäfte zu kommen, muss das T-Shirt somit noch mal 7 250 km (Luftlinie) reisen. Dann ist es aber erst am Flughafen.
Von dort wird das T-Shirt mit LKWs zu den Kaufhäusern und Läden gefahren. Insgesamt kann es sein, dass ein T-Shirt 26 000 km zurückgelegt hat – das ist ungefähr die Entfernung von Deutschland bis zum Südpol und wieder zurück! In den Läden können wir das T-Shirt dann kaufen. In den Geschäften hängen viele verschiedene T-Shirts. Sie haben unterschiedliche Größen, Farben und Motive. Für ein T-Shirt aus Bangladesch zahlt man ungefähr 10 €.
Dass T-Shirts auf so weiten Wegen transportiert werden, wusste ich nicht. Dann braucht das ziemlich viel Treibstoff, um LKW, Schiffe oder Flugzeuge anzutreiben. Ich weiß ja, dass Treibstoff Kohlendioxid produziert. Und das ist schädlich für unser Klima ...

• Mit welchem Transportmittel könnten die Treibstoffgase reduziert werden?
• Was können die Menschen tun, damit durch die T-Shirt-Herstellung das Klima nicht weiter belastet wird?

•
Was muss für die Menschen, die die Baumwolle ernten, Stoffe weben und T-Shirts nähen, getan werden?



T-Shirts aus Baumwolle mag man gern anziehen: In ihnen schwitzt man wenig. Sie haben eine hohe �� Atmungsaktivität. Man merkt Baumwolle kaum auf der Haut. Das sind große Vorteile gegenüber künstlich hergestellten Materialien. Wenn du mehr über die Eigenschaften von Baumwolle herausfinden möchtest:
Im Forschungsbuch sind Versuche beschrieben. Bei der Durchführung erfährst du, was an Baumwolle praktisch und was weniger gut an ihr ist! Verfasse einen Steck brief für Baumwolle, in dem alle Eigenschaften eingetragen sind.
Du hast erfahren, wie viele Menschen an der Herstellung eines T-Shirts beteiligt sind. Du hast auch erfahren, wie viel Mühe der Anbau von Baumwolle bereitet und wie groß die Menge an Wasser und Energie ist, bis das T-Shirt angezogen werden kann. Die meisten Menschen machen sich das nicht bewusst. Das haben auch zwei Künstler aus Amerika gedacht. Ihr Name ist „Guerra de la Paz“ (das heißt übersetzt etwa „Friedenskampf“). Die Männer sind in Kuba geboren. Sie haben Kunstwerke aus Kleidungsstücken geschaffen. In dem Film siehst du, wie das Kunstwerk „Tribute“ in einem Museum entsteht. Tribute bedeutet Anerkennung, Ehrung oder Abgabe.
Schau dir diesen �� Film der Künstlergruppe „Guerra de la Paz“ an. Sprecht in der Lerngruppe über den Film:
• Was machen die Künstler in dem Film?



• Was wollen sie deiner Meinung nach den Menschen damit sagen?
• Erinnert dich dieses Kunstwerk an etwas, was du erlebt hast?


•
Hast du Fragen an das Kunstwerk oder die Künstler? Schreibe deine Fragen in das Forschungsbuch.
• Wie soll dein Kunstwerk aus Kleidung aussehen? Male es in das Forschungs buch. Was willst du den Menschen damit sagen? Wenn du mehr Kunstwerke von den Künstlern ansehen möchtest, kannst du �� hier mit der Suchmaschine Google im Internet suchen.
111




Wir in Deutschland sind es gewohnt, dass alle Dinge in großen Mengen vorhanden sind. Es ist nicht leicht, sich dem Wunsch nach neuen Dingen zu entziehen.
Überlege:



• Welche Dinge hast du dir gekauft, weil du sie in der Werbung gesehen hast?
• Hast du dir schon einmal Dinge gewünscht, nur weil ein anderes Kind diese hatte?


• Welche Dinge, Spielzeuge oder Kleidungsstücke hast du bekommen, ohne dass du sie genutzt hast?
Wir vergessen viel zu oft, dass alles, was wir benutzen, nicht nur uns, sondern auch unsere Mitwelt betrifft. Unser Wunsch nach viel unterschiedlicher Kleidung verbraucht Rohstoffe und belastet so die Umwelt. Die meisten Menschen besitzen mehr Anziehsachen, als sie brauchen. Viele Kleidungsstücke liegen ungetragen im Kleiderschrank.
Durch das viele Kaufen reicht der Kleiderschrank nicht aus. Deshalb sortieren wir aus und werfen die Sachen weg, die uns nicht mehr gefallen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, sich klimagerechter zu kleiden.
Bedeutet das, dass es allen Menschen, die was mit Kleidung zu tun haben, gut geht?
Besprecht in der Gruppe:

• Wie viele Kleidungsstücke sind in deinem Kleiderschrank?
• Wie wichtig sind dir neue Kleidungsstücke?
• Was machst du bzw. deine Familie mit nicht getragenen Kleidungsstücken?
• Was verstehst du unter klimagerechter Kleidung?


Ellist und du, ihr habt sicherlich in Läden gesehen, dass T-Shirts sehr unterschied liche Preise haben. Doch wie kommen diese Preise zustande? Betrachte das unten stehende Bild sehr genau. Du findest auf den Bildern Informationen über die Zu sammensetzung des Preises für T-Shirts.
A bgebildet sind ein Fast Fashion T-Shirt und ein Slow Fashion T-Shirt Tausche dich mit einem Partner / einer Partnerin aus. Ihr dürft gern über die Unter schiede nachdenken und darüber diskutieren! Welches T-Shirt würdet ihr am Ende des Gesprächs kaufen?
Fast Fashion Vertreter: Bei meinem T-Shirt verdient eine Arbeiterin 13 Cent pro T-Shirt!


Slow Fashion Vertreter: Meine Näherin verdient an jedem T-Shirt 60 Cent!

Fast Fashion Vertreter: Für den Transport muss ich 6 Cent bezahlen!
Slow Fashion Vertreter: ...

Notiert die Antworten in dem Forschungsbuch!
Zu diesen Kosten gehören die Ladenmieten, der Lohn für das Personal, die Gewinne, die der Besitzer / die Besitzerin haben möchte, und eine Steuer, die an den Staat gezahlt wird. Marke: Wenn ein Designer oder Designerin ein Kleidungsstück entworfen hat, wird sein oder ihr Name auf die Kleidung gestickt. Meistens gehören die Designer und Designerinnen zu einer Firma. Für diesen „Markennamen“ muss bezahlt werden. Man spricht dann von einer Markenjeans oder einem Markenschuh. Heute gibt es auch Marken für nachhaltige Mode.








In der Industrie wird massenhaft und schnell aktuelle Mode zu immer günsti geren Preisen hergestellt. Diese ständig neuen Angebote zu Billigpreisen verführen die Menschen dazu, Kleidung ungeplant und spontan zu kaufen, ohne dass sie tatsächlich benötigt wird. Diese Kleidungsstücke sind von schlechter Qualität. Sie verbrauchen viel Energie bei der Herstellung und sind überwie gend aus Kunstfasern. Dadurch gelangen viele Plastikpartikel in die Umwelt (beim Tragen und durch das Waschen).
Da es so schnell eine neue Mode gibt, werden sechs von zehn gekauften T-Shirts nach einem Jahr weggeworfen. Vier von zehn T-Shirts werden weder verkauft noch genutzt.
Die Näher und Näherinnen arbeiten unter schlechten Arbeitsbedingungen und bekommen keine gerechte Bezahlung.
Slow Fashion bedeutet, dass die Kleidung wertgeschätzt wird. Es wird nicht massen haft, sondern in guter Qualität produziert. Die Kundschaft kauft weniger Kleidung, wählt diese gut aus und trägt die Kleidung, z. B. das T-Shirt, länger. Die Rohstoffe kommen überwiegend aus dem Bio-Anbau. Durch weniger Produktion entstehen weniger schädliche Umweltgifte.
Die Arbeiter und Arbeiterinnen werden fair bezahlt. Slow Fashion fängt bei der vorhandenen Kleidung an: Erst im Kleiderschrank schauen, was da ist, und dann entscheiden, ob man Neues braucht. Beschädigte Kleidungsstücke können repariert, nicht mehr passende getauscht werden. Soll es neu gekauft werden, dann ist es ein T-Shirt von guter Qualität und fairer Herstellung. Dafür geben immer mehr Menschen mehr Geld aus.



• Welche Ausgaben für ein T-Shirt findest du ungerecht?
• Welche Ausgaben sind für dich gerechtfertigt?
• Welches T-Shirt würdest du kaufen? Warum?

• Untersuche deine T-Shirts: Handelt es sich um Fast Fashion T-Shirts oder um Slow Fashion T-Shirts?



• Welche Gründe gibt es für das ein oder andere T-Shirt?
• Wie viele T-Shirts sind in deinem Schrank?
Wie sieht es in deinem Schrank aus? So? Oder so?

Ellist erinnert sich, dass er etwas über die Label in einem Klei dungsstück gelernt hat. Darauf steht, wo die Kleidung hergestellt wurde. Seine schicken Sneaker waren auch sehr preiswert.

Ob das auch etwas mit dem Herstellungsort zu tun hat? Er hat gelesen, dass die meisten Schuhe (87 %) in Asien produziert werden.
Untersuche deine Schuhe.

• Wo wurden diese hergestellt?



• Du findest das Etikett im Inneren des Schuhs.

Auf den Etiketten von Kleidungsstücken stehen oft Sätze wie „Made in Bangladesch“, „Made in China“ oder „Made in India“.

In diesen Ländern nähen Arbeiterinnen und Arbeiter
Kleidung meistens unter schlechten Bedingungen.
10 bis 12 Stunden täglich sitzen sie an den Nähmaschinen und bekommen dafür wenig Geld. Im Monat verdient eine Näherin in Bangladesch ungefähr 60 €. Sie verdient in der Stunde 20 Cent. So entstehen die günstigen Preise unserer Kleidung.






Kinderarbeit in der Kleidungsindustrie Hallo, ich heiße Kila und lebe mit meiner Familie in Dhaka. Das ist die Hauptstadt von Bangladesch. Dort lebe ich zusammen mit meinen drei kleineren Geschwistern und meinen Eltern in einer Armensiedlung - man sagt auch Slum (sprich: Slamm). Vor der Coronazeit konnte ich meistens in die Schule gehen – wenn ich nicht auf die kleinen Brüder aufpassen musste. Aber meine Eltern haben wegen der �� Coronapandemie ihre Arbeit in der Kleiderfabrik verloren. Die Schulen wurden geschlossen. Damit wir uns etwas zu essen kaufen können, arbeite ich jetzt in der Kleiderfabrik.. Warum ich arbeiten kann und nicht meine Eltern? Die Fabrikbesitzer bezahlen den Kindern weniger Lohn als den Erwachsenen. So können die T-Shirts billiger verkauft werden. Ich bekomme für meine Arbeit 40 € im Monat. Ich stehe jeden Morgen um 6.00 Uhr auf. Um 7.00 Uhr muss ich mit dem Nähen der T-Shirts anfangen. Meistens arbeite ich dann bis 18.00 Uhr – mittags mache ich eine halbe Stunde Pause. Ich würde schon gerne wieder in die Schule gehen oder mit den anderen Kindern spielen. Aber im Moment muss ich meinen Eltern mit Geldverdienen helfen. Sie bekommen keinen Arbeitsplatz. Eigentlich dürfen die Kinder hier in Bangladesch nicht arbeiten. Da gibt es ein Gesetz, das dies verbietet. Wenn es herauskommt, dass ich dort arbeite, muss der Fabrikbesitzer 50 Euro Strafe bezahlen. Ich glaube, davor hat er keine Angst.





Du weißt: Kinder brauchen und haben Rechte, damit sie ein si cheres und glückliches Leben führen können. Nicht alle Kinder in Indien oder Bangladesch müssen arbeiten gehen. Es gibt auch wohlhabende Familien dort. Aber jedes zehnte Kind in Bangladesch muss arbeiten. Wie sieht es mit ihren Rechten aus?
Sieh dir die Kinderrechte an. Du findest sie im eBook Klima.Leben der Klasse 2. Oder sieh dir diesen �� Film über Kinderrechte an.
Was denkst du? Werden Kilas Rechte berücksichtigt?
Welche Menschen nehmen die Rechte von Kila nicht ernst?
Such dir eine Partnerin oder einen Partner und formuliert einen Brief an eine der folgenden Personen. Beschreibe, was diese Per sonen ändern können, um die Rechte der Kinder zu wahren. Mache Vorschläge, wie das geändert werden kann.
A: Ein Brief an die Eltern von Kila
B: Ein Brief an Kila
C: Ein Brief an den Fabrikbesitzer
D: Ein Brief an die Inhaber der Kleidungsfirmen in Deutschland
E: Ein Brief an deine eigenen Eltern
F: Ein Brief an dich selbst







Überlegt, welchen Brief ihr wegschicken wollt. Denkt zusammen mit der Lehrkraft darüber nach, welche Adressen ihr braucht und wie ihr diese findet. Ihr könnt auch die örtliche Tageszeitung bitten, euren Brief abzudrucken. So werden viele Leute eure Meinung lesen können!










Viele Kleidungsstücke werden aus Stoffen wie Baumwolle hergestellt. Der Anbau von Baumwolle und anderen Naturfasern ist oft sehr umweltschädlich. Beim Anbau werden große Mengen �� Pestizide zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Sie gelangen in Seen und Flüsse und sind giftig für Tiere und Menschen. Zum Reinigen der Baumwolle wird viel Wasser benötigt. Das Einfärben und Bedrucken der Kleidung geschieht mit Chemikalien, von denen viele gefährlich sind. Heute wird auch Baumwolle nachhaltig produziert und weiterverarbeitet. Das bedeutet, dass weniger Wasser und Pestizide verwendet werden und die Men schen fair für ihre Arbeit bezahlt werden. Noch betrifft dies aber nur einen geringen Anteil der Kleidung aus Baumwolle. Von 200 T-Shirts ist gerade mal ein T-Shirt aus Bio-Baumwolle.

Das weißt du: An dem Etikett kannst du erkennen, wo dein Kleidungsstück herkommt. Auch die Materialien kannst du ablesen und auf dem Etikett wird dargestellt, wie das Kleidungsstück zu pflegen ist. Manchmal haben Kleidungsstücke ein weiteres Etikett oder Label (sprich: Läbel), auf dem eine Zusatzinformation vermerkt ist. Es gibt Label, die auf eine klimagerechte und faire Herstellung aufmerksam machen.


Im Forschungsbuch findest du Beschreibungen zu den Siegeln. Allerdings musst du noch herausfinden, welches Siegel zu welcher Beschreibung gehört. Male dann das Siegel neben den dazuge hörigen Text!


Es gibt immer mehr Modehersteller und Firmen, die klimafreundliche und faire Kleidung verkaufen. Häufig können wir diese Kleidung nur über das Internet bestellen, da es nicht überall Läden von diesen Firmen gibt. Aber auch große Textilläden beginnen, mehr faire und klimagerechte Kleidung anzufertigen und zu verkaufen.
Die Fair Wear Foundation (FWF, deutsch: Organisation für faire Kleidung) arbeitet mit Bekleidungsmarken und Textilbeschäftigten zusammen, um die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken zu verbessern.




Alle leitenden Personen in der Lieferkette eines Textils sind für die Bedingungen verantwortlich, unter denen das Produkt her gestellt wird. Auch die Menschen in Europa haben großen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in den weit entfernten Produktionsländern. Wenn eine Firma Mitglied beim FWF werden will, muss sie mit der Überprüfung der Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken einverstanden sein.
Auf der �� Webseite von Utopia.de kannst du sehen, welche Firmen für Kinder faire, klimagerechte und schadstoffarme Kleidung herstellen.








Youlaf hat ein Problem. Er würde gern fair hergestellte Kleidung kaufen und tragen. Er glaubt aber, dass seine Familie nicht genügend Geld hat, diese Kleidung für alle Familienmitglieder zu kaufen. Auch wenn es alle wollen. Er überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, sich schick zu kleiden und trotzdem klimagerecht zu leben. Er hat Informationen entdeckt, die ihm helfen könnten.
Schau dir die Konsumpyramide genau an:

• Erläutere, was die beste Art ist, klimabewusst mit Kleidung umzugehen.
• Begründe, warum du nicht immer nach den Schritten der Pyramide handelst.
• Erstelle deine eigene Konsumpyramide, nach der du zukünftig handeln willst.
• Vergleiche deine Pyramide mit der eines Mitschülers / einer Mitschülerin!
 Konsumpyramide
Konsumpyramide

Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, ob und wie man sich nachhaltig und fair kleiden kann, schau dir folgendes Video an:

Du kannst über die folgenden Fragen allein, mit einem Freund oder einer Freundin, in der Lerngruppe oder auch mit deiner Familie nachdenken und die Argumente austauschen!
•

Denkst du, dass man glücklicher ist, wenn man sich jedes Kleidungsstück, das man sieht und gut findet, kaufen kann?
• Was glaubst du: Fühlst du etwas anderes, wenn du weißt, dass dein T-Shirt fair produziert ist oder aus der Fast Fashion Produktion kommt?
• Ist ein Mensch, der teure Kleidung trägt, ein besserer Mensch?
• Hat ein „gutes Leben“ etwas mit Kleidung zu tun?


• Wie würdest du es finden, wenn jedes Land nur für die Menschen Kleidung herstellen dürfte, die in diesem Land leben?


Was ist für Menschen auf der Welt ein gutes Leben?

Leben anderswo


Juan, 9 Jahre alt, erzählt von Bolivien
Das Leben einer Urgroßmutter in Deutschland .
Wie viele Sachen braucht ein Mensch?
Bibliothek der Dinge

Ein gutes Leben für alle Menschen der Welt!
Was sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen?
Über die Klimakrise reden aber wie?
Kinder haben eine Meinung!
Du hast dich bestimmt schon einmal gefragt, was ein gutes Leben ausmacht. Vielleicht hast du in Klasse 2 sogar ein Plakat dazu angefertigt. Damals hattest du dann über diese Fragen nachgedacht:
Wenn du das Plakat noch hast:
Schau dir deine Gedanken an. Hast du heute noch andere Ideen und Gedanken zu den Fragen?

Wenn du noch nicht über diese Fragen nachgedacht hast, kannst du es jetzt tun.
•


Was findest du am Leben auf dem Planeten Erde wichtig?

• Können alle ein gutes Leben haben, wenn man nur an sich selbst denkt?
• Wie kann man gerecht sein?
• Was ist wichtig für alle Menschen?




Sprecht in der Lerngruppe über eure Einfälle und Vorstellungen von einem guten Leben!
Haben die Menschen überall auf der Welt die gleichen Vorstel lungen von einem guten Leben?
Mhm ... Wir hier in Deutschland sind uns ja auch nicht einig. Ich finde es spannend, die Meinung von Menschen aus anderen Ländern zu hören.

Du kannst nun Menschen aus anderen Ländern kennenlernen. Zuerst machst du eine weite Reise zum Kontinent Südamerika. Du erkennst das Land Bolivien auf diesem Kontinent – dort treffen wir dann auf Juan.
Schau dir die Karten von den Klimazonen auf Seite 35 - 45 noch einmal an.
• In welcher Klimazone liegt Bolivien?




• Was ist das Besondere an der Klimazone?



Juan erzählt euch sehr viel über sein Land Bolivien. Bildet eine Gruppe aus vier Kindern. Bereitet ein großes Poster auf dem Tisch vor. Jedes Kind aus der Gruppe erarbeitet sich einen Abschnitt aus den Erzählungen von Juan.
Schreibt und malt das Wichtigste in ein Feld des Posters. Dein Feld kennzeichnest du durch das Symbol (Berg, Tier …).







Kind erarbeitet: Wichtige Tiere
Kind erarbeitet: Gemeinschaft in Bolivien
Kind erarbeitet: Gutes Leben in Bolivien
Leben anderswo: Bolivien
Die Fragen können euch helfen. Sie müssen nicht alle von jedem Kind beantwortet werden.
•
•
•
Was ist für dich das Besondere an Juans Erzählung?
Was ist anders als bei uns in Deutschland?
Was ist dir besonders fremd?






• Welche Regelungen findest du gut?
•
•


Was gefällt dir an den Erzählungen nicht?
Was ist in Bolivien ein gutes Leben?

Wenn alle Kinder der Gruppe fertig sind, stellt ihr euch gegenseitig eure Ergebnisse vor. Bei Fragen schaut noch einmal gemeinsam in die Texte.

Anschließend tauscht ihr in der gesamten Lerngruppe eure Ergebnisse aus. Die Ergebnisse können im Forschungsbuch notiert werden.
Ich bin Juan. Ich lebe in der Region Qullaw (sprich: Kwijau).
Das heißt „Hochebene“ und liegt mitten in den Anden.
Die Anden sind das längste Hochgebirge der Welt. Es erstreckt sich durch mehrere Länder in Südamerika.
Das Klima ist kalt und trocken. Die Temperaturen liegen im Jahr zwischen 2 und 10 Grad Celsius. Wir leben in einer Höhe von über 2 000 Metern. Weil der Boden sehr fest ist, können wir nur wenig anbauen. Unser Grundnahrungsmittel ist die Kartoffel. Sie gedeiht gut in der rauen Umgebung. Über 100 verschiedene Kartoffelsorten haben die Bewohner bis heute gezüchtet.

Schafe und Alpakas sind wichtig für unser Leben in den Anden. Wir Kinder helfen bei der Arbeit mit den Tieren und auch beim �� Scheren der Alpakas. Die Fasern der Alpakawolle sind sehr fein. Damit stellen wir Schals, Handschuhe, Mützen und Pullover her.
Weben ist ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Die alten Web-Techniken und Muster lernen wir Kinder mit Hilfe von Zeichnungen.






Die geben wir dann auch an unsere Kinder weiter. Gemeinschaft in Bolivien
In Bolivien sprechen wir zwei Sprachen: Spanisch und die Sprachen der �� Indigenen. Meine Muttersprache ist Runa Simi, das bedeutet „Menschensprache“. Wir gehören zu der indigenen Bevölkerungsgruppe der Quechua (sprich: Ketschua). Unsere Vorstellungen vom guten Leben sind schon sehr alt. Für unsere Gemeinschaft hat unsere Göttin „Pachamama“ (Mutter Erde) eine große Bedeutung. Sie schenkt Leben, nährt und beschützt uns. Wenn sich eine Familie etwas wünscht, dann bringt sie der Mutter Erde ein Opfer dar. Wir wünschen uns eine gute Ernte und Glück. Für unsere Kultur ist eine starke Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe wichtig. Dafür gibt es das Prinzip „Ayni“. Ayni bedeutet “heute für dich, morgen für mich”. Alle Menschen aus dem Dorf helfen einer Familie bei privaten Vorhaben, z. B. dem Hausbau oder Feldarbeiten. Während der Arbeit werden die Helfenden mit Essen und Trinken versorgt.



Wir leben nach dem Prinzip des „Buen Vivir“ (sprich: ban wifär). Das bedeutet in deiner Sprache „das gute Leben“. Wir lehnen es ab, immer mehr haben zu wollen. Es sollen alle so gut versorgt werden, dass ihre Lebensbedürfnisse befriedigt werden und sie ein würdiges Leben führen können. „Buen Vivir“ gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für die Tiere und die Natur. In Bolivien ist das Recht auf ein gutes Leben in der Verfassung festgeschrieben. Es gibt also ein Gesetz dafür.



Das klingt richtig gut, oder? Aber es sieht in Wirklichkeit oft anders aus. In der Verfassung steht, dass die Natur Rechte hat. Das ist ein neues Gesetz aus dem Jahr 2013.
Gleichzeitig aber werden die Rohstoffe unseres Landes ausgebeutet, sogar in Gebieten, die für die indigene Bevölkerung besondere Bedeutung haben und geschützt sind.
Das ist ein großes Problem für uns. Ich finde es sehr schade. Ich würde gern, dass meine Kinder auch noch diese großartige Landschaft erleben.
Im Artikel 342 der bolivianischen Verfassung steht:
„Es ist Aufgabe des Staates und der Bevölkerung, die natürli chen Ressourcen und die Biodiversität zu erhalten, zu schützen und nachhaltig zu nutzen sowie das Gleichgewicht der Umwelt aufrechtzuerhalten.“
Biodiversität bedeutet eine biologische Vielfalt, also Artenvielfalt und vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen.
Im Internet auf der �� Kinderweltreise findest du viele interessante Informationen über Bolivien.




Wie mit einer Zeitmaschine reist du nun zurück in das Jahr 1930. Da wurde Rosa geboren. Rosa ist die Urgroßmutter von Johanna.

Johanna wollte von ihrer Urgroßmutter wissen, wie sie früher gelebt hat. Deshalb hat sie mit ihr ein Gespräch über ihr Leben geführt.
Lest gemeinsam in der Lerngruppe das Gespräch. Ein Kind liest Johannas Fragen, ein anderes Rosas Antworten. Macht zwischendurch Pausen und wiederholt, was ihr aus Rosas Leben erfahren habt.

Johanna: Mein Großvater, also der Papa meiner Mutter, ist ja dein Kind. Hattest du denn noch mehr Kinder?
Rosa: Oh ja, ich habe sechs Kinder. Vier Mädchen und zwei Jungen. Alle leben noch und haben selbst Kinder. Aber keiner lebt mehr auf dem Bauernhof.
Johanna: Du hattest einen Bauernhof? Erzähl mal. Gab es auch Tiere?
Rosa: Natürlich gab es Tiere. Deshalb musste ich morgens schon um vier Uhr aufstehen und die Kühe melken. Mit der Hand – Melkmaschinen gab es ja noch nicht. Und ich musste die Hühner aus dem Hühnerhaus lassen und ihnen Körner geben. Wenn das erledigt war, habe ich für alle das Frühstück zubereitet: für alle Knechte und Mägde, für deinen Urgroßvater und für die Kinder.

Johanna: Und dann hast du aber eine Pause gemacht, oder?


Rosa: Na ja, während des Essens habe ich schon gesessen. Aber nur kurz. Dann musste ich in den Garten, die Beete hacken oder das Gemüse pflanzen. Und ich habe dann das geerntet, was es zu Mittag geben sollte.






Johanna: Wie, du hast dann auch das Mittagessen gekocht? Für alle?

Rosa: Ja sicher. Wir lebten und arbeiteten doch alle gemeinsam auf dem Hof. Es waren so um die 15 20 Menschen. Die Eltern von deinem Urgroßvater lebten auch noch auf dem Hof. Die Mägde haben mir im Haus und beim Melken geholfen. Sie waren auch für die Gänse und Hühner zuständig. Die Knechte haben sich um die Pferde und Schweine gekümmert und auf dem Feld gearbeitet.

Johanna: So viele Tiere hattet ihr?
Rosa: Ja, wir hatten viele Tiere. Aber immer nur wenige von einer Art. Also 10 Kühe und nicht wie heute 100 oder sogar 500 Kühe. Und das Futter für die Tiere haben wir selbst angebaut. Deshalb mussten auch alle bei der Heuernte mithelfen. Ich natürlich auch. Fast jeden Tag habe ich 18 Stunden ununterbrochen gearbeitet. Da war ich abends todmüde und bin sofort eingeschlafen.
Johanna: Was habt ihr mit den Tieren gemacht? An Schlachthöfe verkauft?
Rosa: Ja, manchmal. Aber vor allem haben wir die Milch und Eier zum Essen gebraucht. Hin und wieder wurde ein Schwein oder ein Huhn geschlachtet. Dann gab es für alle Fleisch zum Mittagessen und Wurst für das Brot.
Johanna: Und wie hast du deinen Urlaub verlebt? Seid ihr da zusammen weggefahren?

Rosa: Urlaub gab es nicht. Wer sollte denn das Vieh versorgen? Selbst Weihnachten mussten wir wie immer in die Ställe. Die Mädge und Knechte durften dann ihre Familien besuchen.
Johanna: Du warst nie in deinem Leben im Urlaub? Du bist nie irgendwo anders hingefahren?
Rosa: Doch, warte mal! Bevor ich den Urgroßvater geheiratet habe, war ich mit meiner großen Schwester in Tirol. Mit dem Zug. Tirol ist in Österreich. Aber Berge – das ist nix für mich. Die schau ich mir auch heute noch lieber im Fernsehen an, als selbst hinzufahren.
Johanna: Fernseher und Telefon hattet ihr aber? Und einen Computer?

Rosa: Aber nein, Kind. Den ersten Fernseher bekamen wir 1967. Da war ich 37 Jahre alt. Und das Telefon kam noch viel später. Aber wir haben das auch nicht vermisst …

Johanna: Deine Möbel sehen auch ganz schön alt aus …




Rosa (lacht): Ja, die haben mir meine Eltern zur Hochzeit geschenkt. Das war meine „Aussteuer“.
Bei einer Heirat war es früher üblich, dass die Frauen für alles Nötige des Haushaltes sorgten. Bettwäsche, Handtücher, Möbel, manchmal auch Vieh oder Geld haben die Brauteltern gezahlt.
Aber wie du siehst, sind die Möbel immer noch schön. Und auch die Handtücher und die Bettwäsche nutze ich heute noch. Sie sind nicht kaputtgegangen!

Johanna: Und konntest du dir nie neue Kleider kaufen?
Rosa: Nein, brauchte ich doch nicht, solange die Kleider passen und nicht kaputt sind. Natürlich habe ich mein gutes Kleid wir haben dazu „Sonntagskleid“ gesagt - nicht im Stall getragen. Das schönste hatte ich, als ich 40 Jahre alt war – und das habe ich auch mit 70 Jahren noch getragen. Ich habe noch ein Bild. Schau mal!
Johanna: Und die Kinder, haben die auch nie was Neues bekommen?
Rosa: Na ja, die sind ja gewachsen und brauchten andere Kleidung. Aber da kam zwei Mal im Jahr eine Schneiderin auf den Hof. Sie hat dann Kleidung geändert oder neu genäht. Die alte wurde eigentlich nie weggeworfen …
Johanna: Dann hattest du aber ein ganz schön anstrengendes Leben. Nicht schön … Rosa (lacht): Oh, das finde ich aber nicht. Wenn ich deine Eltern anschaue, die haben es doch auch nicht so gut. Sie arbeiten auch, fahren euch Kinder ständig herum, müssen alle Lebensmittel und Kleidung einkaufen … Nein, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben.






Hat Johanna Recht? Oder hat Rosa ein gutes Leben gehabt, wie sie rückblickend feststellt?
Du findest im Forschungsbuch eine Tabelle. Dort ist in einer Spalte Rosas Leben zusammengefasst. Beschreibe in der zweiten Spalte, wie dein Leben heute aussieht.
Diskutiert anschließend die Äußerungen von Johanna und Rosa. Wer hat ein gutes Leben und warum?



Wenn ich mir

Rosas Leben anschaue, frage ich mich: Warum muss heute jede Familie eine eigene Waschmaschine, ein eigenes Auto oder eigenes Werkzeug haben?


Warum darf ich nicht den Garten unseres Hausbesitzers nutzen und dort etwas anbauen?


Den Gedanken von Ellist hatten auch andere Menschen.


Sie fragen sich, warum man mit vielen Dingen des Alltags nicht so umgeht wie mit Büchern: Seit fast 200 Jahren kann man sich für wenig Geld Bücher aus Bibliotheken ausleihen. Viele Menschen teilen sich also ein Buch. Und auch über ein Leben und Helfen in Gemeinschaft, wie es in Bolivien üblich ist und auch in Rosas Leben wichtig war, denken die Menschen nach.


Wie viele Sachen braucht ein Mensch?




Im Internet kannst du diese Einrichtungen finden und Informationen lesen. Suche dir eine Partnerin oder einen Partner. Gemeinsam erarbeitet ihr einen Steckbrief für eine der folgenden Einrichtungen:





a) �� Ein Gemeinschaftsgarten
�� Ein Leihladen
c) �� Ein besonderer Landwirtschaftsbetrieb
d) �� Ein Umsonstladen
Befestigt die Steckbriefe an einer Pinnwand. Erklärt den anderen Kindern, was an eurer Einrichtung das Besondere ist.
Gibt es in deinem Wohnort solche Einrichtungen? Plant gemeinsam einen Besuch dieser Orte.
• Sprecht mit den Leuten, die dort arbeiten.
• Ihr trefft sicher auch Menschen, die dort „einkaufen“. Überlegt euch vorher Fragen, die ihr den Personen stellen wollt.
Auf der Erde leben fast 8 Milliarden Menschen. Das sind hundertmal so viele Menschen, wie in Deutschland wohnen. In jeder Minute werden 150 Menschen geboren. Jeder Mensch ist einzig artig. Dennoch haben alle Menschen auf der Welt viel gemeinsam.
Alle machen sich über ein gutes Leben Gedanken. Sie haben Wünsche, Hoffnungen, Ziele und Träume.

Egal wo Menschen auf der Welt wohnen und wie sie leben: Sie alle wollen, dass es ihnen, ihren Kindern, Familien, Freunden und allen Menschen gut geht.





1. Was gehört für dich zu einem guten Leben unbedingt dazu? Du kannst auch die Ideen von anderen Menschen wie Juan, Rosa oder deinen Freunden und Freundinnen aufschreiben, wenn du sie richtig findest.

2. Überlege, ob es Menschen auf der Welt gibt, für die ganz andere Dinge wichtig sind, um ein gutes Leben zu haben. Was könnte das sein? Wer sind diese Menschen und wo leben sie?

Schreibe deine Gedanken in das Forschungsbuch!




Wenn man für alle Menschen ein gutes Leben möchte, ist es wichtig zu wissen, was ein gutes Leben ist. Wenn wir eine bessere Welt für alle wollen, müssen wir wissen, was eine bessere Welt wäre. Wir müssen also ein Ziel beschreiben, was wir erreichen wollen.


Welche Ziele hattest du dir schon einmal gesetzt?
Denk an Schule, Sport, Spiele, Reisen, dein Leben in der Zukunft!
Überlege einen Moment und tausche dich dann mit einem anderen Kind über eure Ziele aus!


Menschen vieler Länder haben darüber nachgedacht, wie die Welt gestaltet sein sollte, damit alle Menschen ein gutes Leben haben können. 193 Staaten der Welt haben sich zu den Vereinten Nationen zusammengeschlossen. Sie haben das Ziel, für alle Menschen den Frieden zu sichern, die Menschenrechte zu schützen und ganz allgemein dabei zu helfen, dass man in der Welt besser zusammenarbeitet. Die Orga nisation ist auch unter dem Namen UNO bekannt. United Nations Organization ist der englische Name.
Nach langen Verhandlungen hat sich die Organisation auf 17 Ziele geeinigt, die sie für die Welt als wichtig erachtet. Es sind globale Ziele für eine nachhaltige Ent wicklung.

Die Ziele werden abgekürzt „SDG“ genannt. Das bedeutet „Sustainable Develop ment Goals“ und heißt auf Deutsch „Ziele für nachhaltige Entwicklung“.
Schau dir dieses �� Video über Nachhaltigkeit an. Du erfährst, was der Begriff „Nachhaltigkeit“ bedeutet.
Die Vereinten Nationen haben diese Ziele mit Symbolen dargestellt. Schau dir die Symbole in Ruhe an. Du findest sie auch im Forschungsbuch.

•
Überlege zu jedem Symbol und Ziel, was diese aussagen könnten.


• Schreibe deine Ideen zu mindestens drei Zielen auf!
•
Vergleiche deine Ideen mit den Aussagen, die du in auf der �� Seite der Agenda 2030 lesen kannst.



















•
Ergänze deine Ideen im Forschungsbuch.

•
Setze dich mit einer Partnerin / einem Partner zusammen. Erklärt euch gegenseitig eure gewählten Ziele.
Diskutiert anschließend die folgenden Fragen:
Warum ist das Ziel wichtig?
• Trägt das Ziel zu einem guten Leben bei?
• Was hat das Ziel mit eurem Leben zu tun?
•
Was muss in der Welt passieren, damit die Ziele erreicht werden?
Bildet nun eine Gruppe mit einem anderen Paar. Nun kommen viel leicht neue Ziele dazu. Erklärt euch die noch nicht bekannten Ziele.

Vier Kinder diskutieren nun die Fragen:
• Welches ist das wichtigste Ziel?

• Welches Ziel ist am schwierigsten zu erreichen?
• Welches Ziel ist schon erreicht?

Die Vereinten Nationen haben mit dem Ziel Nr. 13 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Klima zu schützen ist.
Was hat dieses Ziel „Maßnahmen zum Klimaschutz“ mit einem guten Leben zu tun?
Erinnere dich:
• Was bedeutet Klimawandel?
• Was verursacht den Klimawandel?
•

Welche Folgen und Auswirkungen hat die Klimaerwärmung für die Lebewesen auf der Erde?


Für welche Ziele ist der Klimaschutz eine Bedingung und warum?

135



Du findest das Symbol 13 in dem Forschungsbuch auf Seite 135. Schneide die Symbole der Ziele aus, für die der Klimaschutz eine Voraussetzung ist. Lege sie auf die rechte Seite und verbinde beides mit einem Pfeil. An den Pfeil schreibst du die Begründungen.












Damit der Klimaschutz stattfinden kann, müssen einige der genannten Ziele eingehal ten werden. Sie helfen dabei, die Klimaerwärmung zu stoppen. Welche Ziele könnten das sein? Du kannst sie wieder ausschneiden und vor das Klimaschutzsymbol legen.
Wind- und Sonnenenergie verursachen keine Emissionen (CO2)
Tipp: Wenn dir ein Ziel fehlt, kannst du es selbst gestalten und ihm einen Namen geben. Füge es dann in deine Abbildungen ein!

Es gibt keine Dürren und Überschwemmungen. Man erntet genug für alle Menschen.




Über die Klimakrise reden – aber wie?
Viele Menschen bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern sprechen wenig miteinander über den Klimawandel. Warum ist das so?
Als ich meine Tante bat, nicht immer die 500 m mit dem Auto zum Supermarkt zu fahren, war sie richtig wütend. „Klimawandel, wenn ich das schon höre. Der Sommer war doch viel zu kalt!“ hat sie mit mir geschimpft.

Oh, ja. Ähnliches habe ich auch schon erlebt. Die Erwachsenen hören nicht zu, und viele behaupten, dass es keine Klimaerwärmung gibt.


Vielleicht finden wir nicht die richtigen Worte? Ich weiß, dass es Spezialisten gibt, die sich mit dem Thema „Sprechen über den Klimawandel“ beschäftigen. Sollen wir mal jemanden befragen?




Youlaf meint den �� Chefredakteur Carel Mohn. Tatsächlich hat er es geschafft, ein Interview mit Herrn Mohn zu führen. Herr Mohn arbeitet bei �� klimafakten.de. Das ist eine �� Onlinezeitung.
�� Interview mit Carel Mohn


Bevor du das Video anschaust, suche dir aus Youlafs Fragen drei für dich wichtige Fragen heraus.
Achte bei diesen Fragen gut darauf, was Herr Mohn antwortet. Notiere die Antworten im Forschungsbuch. Tipp: Du kannst gern das Video zwischendurch anhalten oder dir Teile noch einmal anschauen!



1. Was sind die Klimafakten.de? Was wird dort gemacht?
2. Was bedeutet Klimakommunikation?

3. Was ist wichtig, wenn man über das Klima spricht?
4. Wie kann ein Gespräch über den Klimawandel gelingen?
5. Bei welchem Problem ist die Klimakommunikation gelungen? Was war der Grund?

6. Was findet Herr Mohn an den globalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) wichtig? Warum findet er sie wichtig?
Besprecht in der gesamten Lerngruppe alle Antworten von Herrn Mohn. Ergänze deine Aufzeichnungen im Forschungsbuch.

Anschließend schreibst du Stewa oder Mo einen kurzen Brief, in dem du einen Tipp gibst, wie sie mit den Menschen kommunizieren können. Denke bei deiner Antwort auch an die globalen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung!




Kinder haben eine Meinung! Fridays for Future (sprich: Freideys for fiudscher) bedeutet auf Deutsch „Freitage für die Zukunft“. Schüler und Schülerinnen sowie Studierende auf der ganzen Welt gehen an bestimmten Freitagen nicht in die Schule, sondern streiken. Sie wollen Politiker und Politikerinnen dazu bringen, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen.


Dabei äußern viele Kinder ihre Meinung und spre chen über die Themen „Klima und Klimawandel“.
Kinder sind befragt worden, ob sie Fridays for Future kennen und welche Meinung sie zu der Bewegung haben.

Benenne eine Aussage, die du richtig und gut findest! Gib dieser Aussage eine Überschrift und begründe deine Auswahl im Forschungsbuch!
Benenne eine Aussage, der du nicht zustimmst! Begründe deine Wahl! Gib auch dieser Aussage eine Überschrift.
Stell dein Arbeitsergebnis anschließend der Lerngruppe vor. Diskutiert zum Abschluss gemeinsam folgende Fragen:

• Sind die Streiks der Schüler und Schülerinnen am Freitag sinnvoll?


• Sollten Kinder sich an diesen Streiks beteiligen? Begründet eure Meinungen!


„Also meine Eltern würden das wahrscheinlich gut finden, denn sie finden das mit dem Klimaschutz und dass die Kinder freitags auf die Straße gehen auch gut. Manche Erwachsene finden das glaube ich nicht so gut, weil sie meinen, dass die Schule wichtiger ist als der Klimaschutz.“ (Mädchen, 10 Jahre)
„Wir haben Meinungsfreiheit und dakönnen wir auch sagen, was bessergemacht werden sollte. Und das isteigentlich gut für die Politiker, weil daseben Tipps sind, die irgendwie anfeuernund anspornen.“ (Mädchen, 12 Jahre)

„Klimawandel könnte auch passie-ren, wenn jetzt in Südamerika derganze Urwald abgeholzt wird.Das hat dann Einfluss auf das Klimader ganzen Welt, weil das Gebietauch als grüne Lunge der Erdebezeichnet wird. Ein kleinerParkbaum kann ja mehr als fünfHausventilatoren neue Luft erzeu-gen. Deswegen haben wir, wenn dasabgeholzt wird, wirklichein Problem.“ (Junge, 8 Jahre)
„Die Demonstranten fordern, dass hier Gesetze dafür entstehen oder z. B. neue Autos gebaut werden. Also dass Fabriken mit Kohleverbrennung nicht mehr soviel Kohle verbrennen, damit Fabriken nicht mehr so viele Abgase produzieren.“ (Mädchen, 10 Jahre)
„Wenn eine Person damit anfängt, merken die anderen, dass sie das auch gut finden, und dann merken das immer mehr und dann gehen immer mehr auf die Straße.“ (Junge, 9 Jahre)






„Kinder demonstrieren für eine bessere Welt und dafür, dass sich auch mal was ändert. Aber mittlerweile sagen auch eh hier die Präsidenten, dass sie was ändern wollen, aber sie machen halt nix. Sie sagen‘s, aber müssen‘s halt auch umsetzen.“ (Junge, 9 Jahre)













IMPRESSUM
eBook KLIMA.LEBEN | Klasse 3

Herausgegeben vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL)
Wilhelm-Buck-Straße 2 01097 Dresden
Bürgertelefon: +49 351 564-20500
E-Mail: info@smekul.sachsen.de

Die Materialien sind im Rahmen der Initiative „Klimaschulen in Sachsen“ entstanden. Die Initiative ist eine gemeinsame Initiative der Sächsischen Staatsministerien für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft sowie Kultus.
Dr. Brunhild Landwehr (Universität Leipzig, Grundschuldidaktik (GSD) Sachunterricht)
E-Mail: Sachunterricht@uni-leipzig.de
Karl Wollmann (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht Naturwissenschaft und Technik (NawiT))
Dr. Brunhild Landwehr (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht)
Dorotheé Bauer (Universität Leipzig, GSD Werken)
Florian Böschl (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Melanie Haltenberger (Universität Augsburg, Didaktik der Geographie)
Dr. Susan Hanisch (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Pauline Kalder (Universität Leipzig, GSD Werken)
Alexandria Krug (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Jörg Mathiszik (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Dr. Victoria L. Miczajka (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Thomas Ottlinger (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht NawiT)
Heike Rauhut (Universität Leipzig, GSD Sachunterricht Sozialwissenschaft)
Elisabeth Wilhelm (Universität Leipzig, ZLS, GSD Sachunterricht und GSD Englisch)
Falk Böttcher (Deutscher Wetterdienst)
Cyndia Hartke, Lüneburg
Genese GmbH, Magdeburg
Kathrin Andreas, Bochum
© Annette Kitzinger, www.metacom-symbole.de
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes Quelle/ Autor Bearbeitung
13 2 369828341
https://stock.adobe.com/de/images/%E3% 83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%8 3%AB%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82 %B9-%E9%9B%AA%E6%99%AF%E8%89 %B2/369828341
13 1 470396695
https://www.istockphoto.com/de/foto/ private-der-greenhousewintergarten-gm470396695-34700420
13 2 268660198
https://stock.adobe.com/de/images/agarden-centergreenhousewith-a-colorful-display-of-potted-plantsandflowers/268660198
13 2 65164171 https://stock.adobe.com/de/images/ landwirtschafterbeeranbau/65164171
3 (pixabay) 3318639 https://pixabay.com/de/photos/erdbeerfelderdbeerkultur-%C3%BCberdacht-3318639/

2 352462425
https://stock.adobe.com/de/images/agreenhouse-forgrowingvegetables-is-in-the-garden/352462425
2376678 https://stock.adobe.com/de/images/edenproject/2376678
34393205
278764605
201737780
236490776

https://stock.adobe.com/de/images/biodome/34393205 sss78
https://stock.adobe.com/de/images/aerialpanoramagreenhousesin-the-almerimar-spain/278764605
https://www.istockphoto.com/de/foto/ luftverschmutzung-gm476562122-66666655
https://stock.adobe.com/de/images/ climate-changerhone-glacier-protected-withclothsswitzerland/236490776
https://stock.adobe.com/de/images/ klima/220282700
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
27 3 (pixabay) 1979445 https://pixabay.com/de/photos/islandpolarfuchs-fox-tier-1979445/ 12019

27 2 104294198
27 1 216060935
https://stock.adobe.com/de/images/snowyowl-buboscandiacus/04294198
https://www.istockphoto.com/ de/foto/s%C3%BCdpolarsskuagm1216060935-354449065
27 2 217568747
https://stock.adobe.com/de/images/ antarctica-naturebeautiful-landscape-birdflying-over- icebergs/217568747
27 2 15595436

27 2 123475903
27 1 485828690
https://stock.adobe.com/de/images/erdemitlandergrenzen/15595436
https://stock.adobe.com/de/images/polarbear-walkingon-sea-ice/123475903
https://www.istockphoto.com/de/foto/ arctic-fr%C3%BChling-im-s%C3%BCden-vonspitzbergengm485828690-73474215
2 371454383
https://stock.adobe.com/de/images/polarbear-on-icefloe-melting-iceberg-and-globalwarming/371454383
2 29428733
27 2 177439605
https://stock.adobe.com/de/images/ camping-inantarctica/29428733
https://stock.adobe.com/de/images/ beautiful-lonelybeach-in-caribbean-sanblas-island-kuna-yala-panamaturquoisetropical-sea-paradise-travel-destinationcentralamerica/177439605
27 1 1183367712
2 23048085
https://www.istockphoto.com/de/foto/eineeisscholle-indern%C3%A4he-des-tracy-armglacier-alaskagm1183367712-332696250
https://stock.adobe.com/de/images/ eiscreme-aufstanitzel/23048085
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
27 2 233781447
2 5660920
2 346299870
https://stock.adobe.com/de/ images/emperor-penguinchicks-inantarctica/233781447
https://stock.adobe.com/de/images/ wetterstationzugspitze/5660920
https://stock.adobe.com/de/images/ wetterstation-diesersteinkennt-das-wetter/346299870?prev_url=detail

29 2 199007552
https://stock.adobe.com/de/images/ meteorologistmonitoringstorms-on-his-computer-screens-closeupshot/199007552
1 600085282

https://www.istockphoto.com/de/foto/ meteorologistforcastinghurricane-gm600085282-103159197
2 172999034
2 312278439
(pixabay)
95242739
https://www.istockphoto.com/de/foto/wasist-das-wettergm172999034-6889970
20072854
345974025
170596059
https://stock.adobe.com/de/images/lichensinantarctica/312278439 Kim
https://pixabay.com/de/photos/erdeplanetenraum-welt-universum-11009/
https://stock.adobe.com/de/images/mousselichen-baseantarctique-primavera-terre-degrahamantarctique/95242739
https://stock.adobe.com/de/images/coloniede-manchotsempereurs-antarctique-mer-deross/20072854
https://stock.adobe.com/de/images/treetrunk-in-small-and-large-moss/345974025
https://stock.adobe.com/de/images/ panorama-at-twilightover-rothbury-heatheron-the-terraces-which-walk-offersviewsover-the-coquet-valley-to-the-simonsideandcheviot-hills-heather-covers-the-hillsideinsummer/170596059
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
2 164131786
182971997
2 238054378
2 220518159

2 16500552
2 156095781
2 270886013
https://stock.adobe.com/de/images/deer-inthe-tundraon-a-sunny-frosty-day/164131786
https://stock.adobe.com/de/images/ landschaft-indeutschland/182971997
https://stock.adobe.com/de/images/groupof-wolves-inhunt/238054378

https://stock.adobe.com/de/search? k=dornsavanne&asset_id=220518159
https://stock.adobe.com/de/images/ deserttrees/16500552
https://stock.adobe.com/de/images/lushrainforest-withmorning-fog/156095781
https://stock.adobe.com/de/images/smallstripped-babyof-the-endangered-tapir-tapirusindicus/270886013
518507608
https://www.istockphoto.com/de/vektor/ voltaik-haufen-erste-elektrische-batterie-vonalessandro-volta-ver%C3%B6ffentlichte-1880gm518507608-90077923
2 182533542
https://stock.adobe.com/de/ images/simpleelectricity-circuitvectorillustration/182533542
2 165438671
https://stock.adobe.com/de/images/ simpleelectric-motor-experiment-with-cellandmagnet-front-view/165438671
1151836480
https://www.istockphoto.com/de/foto/ taschenlampe-mit-dynamo-generatorgm1151836480-312282962
1044615052
https://www.istockphoto.com/ de/foto/wasserm%C3%BChlegm1044615052-279580582
121028616
https://www.istockphoto.com/de/foto/ power-generator-dampfbad-turbinemaschinen-w%C3%A4hrend-der-reparaturgm121028616-16822685
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
Quelle/ Autor Bearbeitung
3 (pixabay) 4126288 https://pixabay.com/de/photos/ landschaftschweiz-aargau-natur-4126288/
3 (pixabay) 2411932 https://pixabay.com/de/photos/ kraftwerkindustrie-schornstein-2411932/
3 (pixabay) 111366 https://pixabay.com/de/photos/ braunkohletagebau-tagebaukohleabbau111366/
3 (pixabay) 3780254 https://pixabay.com/de/photos/ hooverstaudamm-colorado-river-3780254/
3 (Wikimedia)

o. A. https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:20160601-00476-Kraftwerk-Ottmarsheim. jpg
3 Wikimedia o. A. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/4/4f/Getijdeninstallatie_ Oosterscheldekering_2.jpg
2 82260045 https://stock.adobe.com/de/images/solarpanelon-a-red-roof/82260045
(pixabay) 286025 https://pixabay.com/de/photos/ photovoltaiksolarzellen-boden-286025/

(pixabay) 159397 https://www.pexels.com/de-de/ foto/schwarze-und-silbernesonnenkollektoren-159397/
(pixabay) 4694666 https://pixabay.com/de/photos/ windm%C3%BChle-windkraftanlagewindkraft-4694666/
nedu503
https:// creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0
https:// creativecommons.org/ licenses/by-sa/4.0
https://stock.adobe.com/de/images/ modernebiogasanlage/65408919 fineartcollection
https://stock.adobe.com/de/images/ heizungmit-der-hand-aufdrehen/319272177
https://stock.adobe.com/de/images/ heizungstechniker-in-heizraum/36589244
Seite
Bild-
230778273
263675745
221729086
Link zur Quelle des Bildes Quelle/ Autor Bearbeitung
https://stock.adobe.com/de/images/oilrefinerypower-stationplant/230778273
https://stock.adobe.com/de/images/ erdolforderanlagerumanien/263675745
https://stock.adobe.com/de/images/ close-upon-a-pile-of-compressed-woodpellets 221729086
VanderWolf Images
1163143978
https://www.istockphoto.com/de/ foto/haufen-von-s%C3%A4gemehl-undhackschnitzeln-in-der-s%C3%A4gewerksholzverarbeitenden-industriegm1163143978-319288669
141252042

1073995332
https://stock.adobe.com/de/images/ fernwarme/141252042
https://www.istockphoto.com/de/ foto/solaranlage-auf-dem-dachgm1073995332-287547380
196340877
577629124
https://stock.adobe.com/de/images/ vierelemente/196340877
https://www.istockphoto.com/de/vektor/ energy-saving-heating-pump-systemgm577629124-99250707
photo 5000
65482539
https://stock.adobe.com/de/images/traveltheworld-monument concept/65482539
142803868 https://stock.adobe.com/de/images/ gefahrenzone-kind-wartet-mitscooter-amfahrbahnrand/14280386
https://stock.adobe.com/de/images/ differentmeans-of-transport-aroundaglobe/269709142?prev_url=detail

https://www.istockphoto.com/de/ vektor/baronm%C3%BCnchhausenreitet-diekanonenkugel-1873gm843199002-137832107
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes Quelle/ Autor Bearbeitung
3 (pixabay) 580026 https://pixabay.com/de/photos/getriebeantrieb-zahnrad-metall-580026/
2 331140735
https://stock.adobe.com/de/images/avisualdemonstration-of-the-operationof-a-fourspeed-internal-combustionengine/331140735
3 (pixabay) 286240 https://pixabay.com/de/photos/junge-lesenstudieren-b%c3%bccher-286240/ White77
2 65482539
2 437531088
https://stock.adobe.com/de/images/traveltheworld-monument concept/65482539
https://stock.adobe.com/de/images/luftbildmit-rapsfeldern/437531088
3 (pixabay) 2181180 https://pixabay.com/de/photos/flugzeughimmel-wolken-bew%c3%b6lkt-2181180/

2 95437010

https://stock.adobe.com/de/images/newroadconstruction/95437010
3 (pixabay) 116971 https://pixabay.com/de/photos/ fr%c3%bchling-sonnenschein-mai-berge-/
3 (pixabay) 4945392 https://pixabay.com/de/photos/ weg-betonpflaster-gepflastertenweg%2c-4945392/
3 (pixabay) 2254975 https://pixabay.com/de/photos/morgengoldene-sonne-gelb-sonne-2254975/
3 (pixabay) 918900 https://pixabay.com/de/photos/gehweggras-felder-wiesen-berge-918900/
3 (pixabay) 2520007 https://pixabay.com/de/photos/radfahrenfreizeit-erholung-wald-2520007/
(pixabay) 885609 https://pixabay.com/de/photos/radfahrermenschen-rucksack-885609/
(pixabay) 1728374
https://pixabay.com/de/photos/radwegfahrradweg-fahrradfahrer-1728374/
dimitrisvetsikas-1969
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
97 3 (pixabay) 1464459
98 3 (pixabay) 3462931
98 3 (pixabay) 3487588
98 3 (pixabay) 619082
98 3 (pixabay) 4439570
99 3 (pixabay) 220058

https://pixabay.com/de/photos/radwegstra%c3%9fe-fahrradstra%c3%9fechina-1464459/
https://pixabay.com/de/photos/bahnhofgleise-singen-3462931/ nir_design
https://pixabay.com/de/photos/zug-bahnhofeisenbahn-reisen-3487588/ ulleo
https://pixabay.com/de/photos/zug-spurenbahnhof-eisenbahn-619082/
https://pixabay.com/de/photos/leipzigsachsen-stadt-augustusplatz-4439570/
https://pixabay.com/de/photos/ stra%c3%9fe-gehweg-landschaftfahrbahn-220058/
99 3 (pixabay) 1837176
https://pixabay.com/de/photos/architekturgeb%c3%a4ude-autos-stadt-1837176/
Pexels 99 3 (pixabay) 3612474
https://pixabay.com/de/photos/der-verkehrstra%c3%9fe-autos-fahrzeuge-3612474/
pixel2013 99 3 (pixabay) 2602324 https://pixabay.com/de/photos/architekturgeb%c3%a4ude-alt-stadt-dorf-2602324/
2 50721009 https://stock.adobe.com/de/images/ horsecoach-icon/111644442
111644442 https://pixabay.com/de/photos/gehweggras-felder-wiesen-berge-918900/
Postage stamp Monaco 1955 A Floating City, by Jules Verne – Stock-Foto | Adobe Stock laufer
https://stock.adobe.com/de/images/ elektroautoan-der-ladesaule/267275166
https://www.istockphoto.com/ de/vektor/zukunft-des-verkehrsgm1328707070-412680716

Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes Quelle/ Autor Bearbeitung
105 2 165438671

https://stock.adobe.com/de/images/ simpleelectric-motor-experiment-with-cellandmagnet-front-view/165438671
107 1 1255467528
https://www.istockphoto.com/ de/foto/erbst%C3%BCckscheibegm1255467528-367301804
110 1 693171708
https://www.istockphoto.com/de/foto/ frisches-gem%C3%BCse-im-regal-imsupermarkt-gm693171708-127984289
110 1 487491713- https://www.istockphoto.com/de/foto/ verpackte-tomate-mit-frau-hand-im-supermarktgm487491713-38846912
111 2 177293206
https://stock.adobe.com/de/ images/europakarte-in-grenzenmitbeschriftung/177293206
MichellePatrickPhotography
114 1 1162529528
https://www.istockphoto.com/de/foto/ tomaten-topfen-tomato-setzlinge-green-leavesgm1162529528-318906601
114 3 (pexels) 2818573 https://www.pexels.com/de-de/foto/ rote-und-grune-tomatenpflanzen-auf-derzugschiene-2818573/
115 3 (pixabay) 1310961 https://pixabay.com/de/photos/tomategew%C3%A4chshaus-1310961/

115 1 1221062594
https://www.istockphoto.com/de/foto/ perspektivische-ansicht-eines-modernenindustriegew%C3%A4chshauses-f%C3%BCrtomaten-in-den-gm1221062594-357792736
115 1 899480390
https://www.istockphoto.com/de/foto/ tomaten-ripening-im-gew%C3%A4chshausgm899480390-248192707
117 2 369863801
https://stock.adobe.com/de/images/ trucklowering-a-trailer-loaded-to-thetop-with-freshpicked-red-tomatoes-in-afield/369863801
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
119 2 167981298
https://stock.adobe.com/de/images/ close-upview-of-woman-s-basket-fullofgroceries/167981298?prev_url=detai
119 2 213420579
https://stock.adobe.com/de/images/ peoplebuying-fruits-and-vegetablesingredientsummer-outdoors-farm-marketshoppingbackground-casual-purchasingselling-realnatural-healthy-lifestyle-candidcloseupimage/213420579
gorosi
119 2 85317286
https://stock.adobe.com/search/ images?k=Kofferraum%20Tomaten&search_ type=default-asset-click&asset_id=85317286

120 2 89692321- https://stock.adobe.com/de/images/ cute-littlegirl-watering-tomato-and-flowers-inthebackyard/89692321
122 2 299431646
https://stock.adobe.com/de/images/eurocoinsisolated-on-white-background-closeupmoneyconcept-top-view-flat-lay/299431646
Alexander
2 319107518
https://stock.adobe.com/de/images/ happy-littleasian-girl-child-standing-showingfront-teethwith-big-smile-showing-armsmuscles-smilingproud-looking-camera-showingbiceps-freshhealthy-green-bio-backgroundfitnessconcept/319107518
1 1208182476
https://www.istockphoto.com/de/foto/ wellen-schieben-plastikm%C3%BCll-an-denstrand-gm1208182476-349127343
nareekarn
2 293912945
https://stock.adobe.com/de/images/ plasticfood-containers-that-can-berecycled-if-theyare-collected-in-the-trashproperly/293912945
1 187676687
https://www.istockphoto.com/de/foto/ frische-speisen-in-m%C3%BClltonne-zuillustrieren-abfall-gm187676687-29653054
Mario De Moya F Joaquin Corbalan2 296368240
https://stock.adobe.com/de/images/singleuse-plastic-waste-issue-fruits-and-vegetables-inplastic-bags/296368240

Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes
125 1 483632191
https://www.istockphoto.com/de/foto/ schmutzig-fluss-kuh-f%C3%BCtternam-m%C3%BCll-kathmandu-nepalgm483632191-20662283
127 2 260566638
128 2 244960177

https://stock.adobe.com/de/images/ecofriendly-reusable-net-bags/260566638
https://stock.adobe.com/images/wideangle-view-at-recycling-plant-conveyorbelt-transports-garbage-inside-drumfilter-or-rotating-cylindrical-sieve-withtrommel/244960177

130 3 (pexels) 6141908
135 2 317959003
https://www.pexels.com/de-de/foto/lichtkreativ-entwurf-freude-6141908/
https://stock.adobe.com/de/images/100cottonlabel/317959003
3 (pexels) 6589319 https://www.pexels.com/de-de/foto/ menschen-fahrzeug-seil-kleider-6589319/
1 458589251 https://www.istockphoto.com/de/foto/h-mlabel-gm458589251-18400815
2 339313210
https://stock.adobe.com/images/travel-theworld-concept-watercolor/339313210
1 522556574 https://www.istockphoto.com/de/foto/ baumwolle-pflanzengm522556574-91698459
1 641632282 https://www.istockphoto.com/de/foto/ sanliurfat%C3%BCrkei-27-oktober2014-baumwollpfl%C3%BCcker-insanliurfa-t%C3%BCrkei-sielegen-diegm641632282-116392525
138 1 11710094 https://stock.adobe.com/de/images/ whitecotton/11710094
2 197342344 https://stock.adobe.com/de/images/ coarsecotton-factory-in-spinning-productionline-anda-rotating-machinery-andequipmentproduction-company/197342344
Pronoia
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes Quelle/ Autor Bearbeitung
138 2 63090152
138 1 172310688
138 2 138849872
https://stock.adobe.com/de/images/ multicolorsewing-threads-texture/63090152

https://www.istockphoto.com/de/foto/ textilfabriken-gm172310688-4142924
https://stock.adobe.com/de/images/ machines-for-dyeing-industry-textile-industrydyeing-machine-chemical-tanks/138849872
138 2 197342344
Coarse cotton factory in spinning production line and a rotating machinery and equipment production company
138 2 1323884969409403741
https://www.istockphoto.com/de/ vektor/gro%C3%9Fmutter-am-herdstrickt-und-k%C3%BCmmert-sich-um-dasbaby-in-der-wiege-das-m%C3%A4dchengm1323884969-409403741
139 2 238432448
https://stock.adobe.com/de/images/fullframe-shot-of-wovenropes/351000245
139 2 154250784
https://stock.adobe.com/de/editorial/ womanlooks-up-from-her-work-at-goldtexlimitedgarment-factory-inside-thedhaka-exportprocessing-zone-depz-insavar/154250784
2 180533990

60830793
https://stock.adobe.com/de/images/%E7% B9%94%E7%89%A9%E5%B7%A5%E5%A0 %B4%E3%81%AE%E7%B9%94%E6%A9% 9F/180533990
https://stock.adobe.com/de/stock-photo/ bunte-tshirts-im-modeladen/60830793
https://stock.adobe.com/de/images/ innenetikett-eineskleidungsstuck/68944166
https://stock.adobe.com/de/images/ sudamerika-bolivien/90989567
https://stock.adobe.com/de/images/ lamastanding-in-a-beautiful-southamericanaltiplano-landscape/278388347
sureeporn boonlerd/ EyeEm
Seite eBook Bilddatenbank*
Bildnummer Link zur Quelle des Bildes Quelle/ Autor Bearbeitung
157 1 472078967
https://www.istockphoto.com/de/foto/ peruanische-kleine-junge-tr%C3%A4gtkleidung-mit-lama-indern%C3%A4heliegendecuzco-gm472078967-31553660
157 1 1219090316
https://www.istockphoto.com/de/foto/ indigene-textilweberei-sucre-boliviengm1219090316-356467305
159 2 292995898
https://stock.adobe.com/de/search/ images?load_type=search&native_visual_ search=&similar_content_id=&is_recent_ search=&search_type=usertyped&k=Alte+Fra u&asset_id=292995898

160 1 1164163360

160 1 295828160
https://www.istockphoto.com/de/foto/ heuerntegm1164163360-319909919
https://www.istockphoto.com/de/ foto/alter-ofen-auf-einem-bauernhofgm1295828160-389434605
160 2 194393912
161 1 1307005355
https://stock.adobe.com/de/images/ futterung-im-kuhstallhistorisch/194393912
https://www.istockphoto.com/de/foto/altevintage-schrank-mit-buntglas-alter-holzschrankauf-wei%C3%9Fem-hintergrund-isoliertgm1307005355-397407525
172 3
4891278 https://pixabay.com/de/photos/ demonstrationfridays-for-future-4891278/
www.metacom-symbole.de
Alle

