FAZITGESPRÄCH

Merkur-Chef
Andreas Gaugg im Interview

FAZITGESPRÄCH

Merkur-Chef
Andreas Gaugg im Interview
August 2025
FAZITESSAY
Christian Wabl über das furchtbare Verbrechen an einer Grazer Schule
Wirtschaft und mehr. Aus dem Süden.
FAZITTHEMA
Von Christian Klepej

In der Bundesrepublik gilt es aktuell drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu bestellen. Dessen 16 Richter werden zur Hälfte vom Bundestag auf Vorschlag des zuständigen Parlamentsausschuss gewählt, die andere Hälfte vom Bundesrat. Die Union hatte den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht, Günter Spinner, in Stellung gebracht, die SPD die beiden Juristinnen und Rechtsprofessorinnen Ann-Katrin Kaufhold (LMU München) sowie Frauke Brosius-Gersdorf (Uni Potsdam). Und vor allem um letztere Nominierung ist ein heftiger Streit entstanden, der vorerst damit endete, dass die eigentlich schon für letzte Woche geplante Wahl auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Nicht ganz drei Wochen gingen dieser Entscheidung voraus und vor allem ein Brosius-Zitat aus einer Festschrift wurde dabei immer intensiver diskutiert: »Die Annahme, dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss.« Es geht also um das komplexe Thema Abtreibung. Brosius hat des öfteren vertreten,
Unsere Demokratie kann nicht nur das sein, was Linke für demokratisch halten
* Ich etwa bin von der tiefen Überzeugung geprägt, dass ein jedes empfangene Kind auch geboren werden sollte. Und jede Schwangere Beratung und Unterstützung erfahren sollte. Dazu habe ich im Dezember 2018 einen mir sehr wichtigen Text geschrieben. Hier zum Nachlesen: bit.ly/F149Ed
Abtreibungen (zumindest) bis zum Ende des dritten Schwangerschaftsmonats völlig freizustellen bzw. unter bestimmten (nicht näher definierten) Umständen auch bis zum Ende einer Schwangerschaft zu ermöglichen. Worauf der »biologistisch-naturalistische Fehlschluss« hinweist; sie selbst hat das mittlerweile relativiert und spricht nur mehr von den ersten drei Monaten. In den Tagen nach dieser Wahlverschiebung entstand nun vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien und bei linken Kommentatoren der »Narrativ« einer reaktionären und rechtsaffinen »Kampagne« gegen Brosius. Auf Wikipedia diskutiert und proklamiert man ganz selbstverständlich, dass da »die asozialen Medien, die AfD und katholische Fundamentalisten« dahinter stehen würden. Gleichzeitig hört man auch oft aus dem linken Lager, dass man »keinen Kulturkampf« führen wolle. Ich sage Ihnen, wir sind mitten drin in diesem Kulturkampf. Und bin mir sicher – ich habe diese Bestellungssache von Anfang an mitverfolgt –, es gab keine »Kampagne« und schon gar keine von »rechten« (ist gleich »rechtsextremen«) Netzwerken. Was stattfand war beispielsweise eine Mailaktion des Vereins »1000plus«, einer christlich geprägten Schwangeren- und Familienberatung, an alle Unionsabgeordneten, die darauf abzielte, dass diese nicht für Brosius stimmen sollten. Eine an sich mehr als basisdemokratische, vollkommen selbstverständliche Sache, die unter umgekehrten Vorzeichen wahrscheinlich mit zahlreichen Preisen bundesdeutscher Demokratieförderungsinstitutionen ausgestattet worden wäre. Aber 1000plus ist halt keine Lobby für etwa sich als Katzen identifizierende Personen oder auch kein Verein, der sich der Enteignung aller Besitzhabenden verschrieben hat, nein, es ist ein Verein, der dafür eintritt, dass es möglichst wenig Abtreibungen* gibt. Und damit wird er etwa in diversen Nachrichtenformaten ständig durch die Attribuierung »rechtspopulistisch«, »AfD-nahe« (was er nicht ist) oder Ähnliches negativ punziert und fortfolgernd als nicht mit »unserer Demokratie« (wie sie sie meinen) vereinbar geoutet. Zudem wird ins Blaue hinein einfach postuliert, alle Kri-
tiker der präsumtiven Höchstrichterin würden dieser ihre juristische Qualitfikation absprechen. Selbstverständlich meistens in Verbindung mit dem Hinweis auf einen patriarchalen Grundungeist, weil Brosius eine Frau ist und eine Frau in solch einem Amt in den Köpfen der alten verzopften Rechten ja nicht vorstellbar sei. Das ist natürlich veritabler Unsinn. Und Kulturkampf. Aus guten Gründen werden die Verfassungsrichter vom Bundestag (für eine zwölfjährige Amtszeit) gewählt. Und aus guten Gründen sollten dabei alle Kandidaten jedenfalls den äußeren Anschein möglichst großer Unbefangenheit und parteipolitischer Neutralität an den Tag legen. Die juristische Befähigung, soweit ist der Konsens aller Demokraten, wird dabei lange vor dem Kandidatenstatus geklärt und steht demnach außer Streit. Aber wenn dann eben ein Kandidat »Flanken« aufmacht, also von ihm »politische Positionen« zu sehr und zu poiniert bekannt werden, dann kann er eben als umstritten gelten. Selbstverständlich haben dann demokratische Strömungen, die solche Positionen ablehnen, das Recht, sich an die gewählten Volksvertreter zu wenden und dagegen aufzutreten. Das ist nicht rechtspopulistisch, das ist nicht fundamentalistisch. Das ist gutes Recht jedes Einzelnen. In unserer Demokratie. n
Sie erreichen den Autor unter christian.klepej@wmedia.at

Wie Klima und Wohlstand retten?
Europa zahlt für den Wandel und China macht das Geschäft. Die Debatte verlagert sich von Klimazielen zu Folgekosten.

Sicher auf Jahre
Die Merkur-Versicherung bewegt sich bei den Prämien auf die Milliarde zu. Wir sprachen mit CFO Andreas Gaugg.

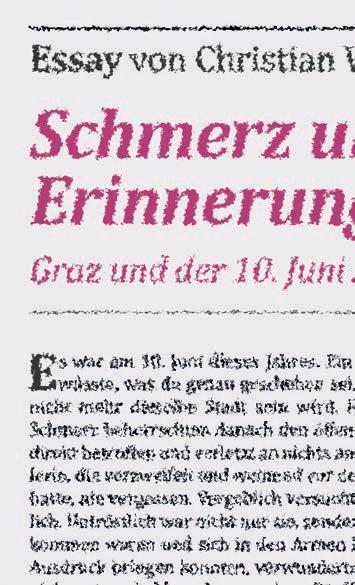
Schmerz und Erinnerung
Christian Wabl packt seinen Versuch, das Grazer Schulverbrechen einzuordnen, in einen Text um Schmerz und Sprachlosigkeit.
Die Steirerin Natascha Gangl hat mit ihrem Text »da Sta« den Bachmannpreis bei den 49. Tagen der deutschsprachigen Literatur gewonnen. Michael Petrowitsch erläutert.
Seite 78

Rubriken
Editorial 3
Politicks 12Investor 32
Außenansicht 38
Oberdengler 46
Immobilien 68
Alles Kultur 78
Schluss 82

Die Seelentaucherin
Sandra Pioro verarbeitet in »Nie mehr still« ihre jüdische Familiengeschichte.
Volker Schögler hat sich mit ihr getroffen.

Das Salz im Kernöl
Thomas Hartlieb stellt in seiner Ölmühle in Heimschuh in vierter Generation zwei Dutzend verschiedene Speiseöle her.
Liebe Leser!
Europa kämpft für das Klima und riskiert dafür sogar seine Deindustrialisierung. Die Produkte, mit denen die EU das Klima zu retten versucht, kommen jedoch – vom E-Auto bis zu den Windradgeneratoren – immer öfter aus China. Damit rütteln wir am Fundament unseres Wohlstandes.
Im Fazitgespräch erklärt Merkur-CFO Andreas Gaugg, wie stabile Prämien und langfristige Planung das traditionsreiche Unternehmen tragen – mit der Krankenversicherung als Kernprodukt und solider Entwicklung bei Unfall- und Lebensversicherungen.
Christian Wabl widmet sich dem Grazer Schulverbrechen und versucht, das Unfassbare in Worte zu fassen. Außerdem trafen wir Sandra Pioro. In ihrem Buch »Nie mehr still« verarbeitet sie die Traumata ihrer jüdischen Familiengeschichte und schuf damit ein aufrüttelndes Buch über Identität und Erinnerung.
In einer sommerlichen Außenansicht gibt Peter Sichrovsky einen Einblick in das Tennis-Mekka Wimbledon. Und schließlich besuchten wir Thomas Hartlieb im südsteirischen Heimschuh, wo aus einer alten Mühle ein Ölparadies mit Geschmack wurde.
Gutes Lesen! -red-
IMPRESSUM
Herausgeber
Horst Futterer, Christian Klepej und Mag. Johannes Tandl
Medieninhaber & Verleger
Klepej & Tandl OG
Chefredaktion
Christian Klepej Mag. Johannes Tandl
Redaktion
Peter K. Wagner (BA), Mag. Josef Schiffer, Mag. Maryam Laura Moazedi, Dr. Volker Schögler, Mag. Johannes Pratl, Helmut Wagner, Mag. Katharina Zimmermann, Mag. Michael Petrowitsch, Kim Vas (Satz und Produktion), Vanessa Fuchs (Organisation)
Lektorat AdLiteram
Druck
Walstead-Leykam
Vertrieb & Anzeigenleitung
Horst Futterer
Kundenberatung
Irene Weber-Mzell
Redaktionsanschrift
Titelfoto von Marija Kanizaj
Schmiedgasse 38/II, A-8010 Graz T. 0316/671929*0. F.*33 office@wmedia.at fazitmagazin.at facebook.com/fazitmagazin

Fazitthema
Von Johannes Roth
Langsam, aber spürbar wandelt sich das Klima – auch jenes in der öffentlichen Wahrnehmung. Extreme Wetterereignisse werden nicht mehr ausschließlich zum Anlass genommen, strengere CO₂-Reduktionsziele zu fordern. Zunehmend rückt mit den wachsenden Kosten der klimabedingten Unwetterschäden ein anderer Aspekt ins Zentrum der Diskussion. Die Finanzierung dieser Klimafolgen wird immer häufiger als drängendes, konkretes Problem erkannt; noch dazu als eines, das im Gegensatz zum global unkoordinierten CO₂-Abbau nicht den Europas Wohlstand gefährdet.
Wer die Klimadebatte heute seriös führen will, sollte die mediale Dynamik dahinter verstehen. Dazu muss man nicht bis ins Jahr 1820 zurückgehen, als Joseph Fourier erstmals den Treibhauseffekt beschrieb – ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre reicht aus. In diesem kurzen Zeitraum hat sich eine globale Debatte entwickelt, die in ihrer Emotionalität und Mobilisierungskraft mitunter sektenartige Züge trägt. Ausgangspunkt war das Schicksal eines jungen Mädchens aus Skandinavien, das unter psychischen Belastungen wie Depressionen und Essstörungen litt. Ihre Eltern, die sich keinen Rat wussten, schleppten sie zum Arzt. Und der diagnostizierte Asperger-Autismus. Das ist ein Krankheitsbild, das sich unter anderem in Problemen mit der Sprachentwicklung – mechanisch wirkende wiederholende »Standardphrasen«, Echolalie (Wiederholen von gehörten Wörtern oder Phrasen) – und Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation äußert. An Asperger Erkrankte haben oft Schwierigkeiten, einen Dialog zu führen, Einschränkungen im Gesichtsausdruck bzw. des Blickkontakts während der Kommunikation und der Gestik. Manche Erkrankte weisen auch eine starke Beschäftigung mit sich immer wiederholenden Tätigkeiten auf, einige zeigen starke soziale Auffälligkeiten, wie Probleme, sich in andere einzufühlen.
Wie Greta Thunbergs Aktivismus entstand Bei Greta Thunberg entschieden sich die Eltern, neben den anderen Therapieformen auch eine Selbsttherapie ihrer Tochter zuzulassen. Bei Greta bestand diese darin, dass sie ihren Autismus auf ein Thema (in späteren Interviews nannte sie es »Spezialinteresse«) fokussierte: den Klimawandel. Sie begann, in ihrem schwedischen Elternhaus das Licht abzuschalten, um Energie zu sparen. Ihre Eltern und ihre ältere Schwester nahmen es hin – wenn es nur gegen die Probleme der kleinen Greta helfen würde, wäre das schon in Ordnung, mögen sie sich gedacht haben. Auch als das Kind begann, sich vegan zu ernähren, zog die Familie mit. Und so kam, was kommen musste: Die aus Rücksichtnahme unwidersprochene innere Überzeugung der kindlichen Asperger-Autistin, dass nämlich der Klimawandel ein alles bedrohender Menschheitsfeind sei, manifestierte sich im Kopf des Mädchens zu einer unerschütterlichen, absoluten Wahrheit. Unbeschadet der Tatsache, dass die 12-Jährige – mitten in der Pubertät – weder charakterlich ausreichend gefestigt noch intellektuell in der Lage war, den komplexen Sachverhalt des Klimawandels und seiner politischen Folgen zu beurteilen, geschweige denn zu verstehen, ließ man sie gewähren. Dass sie für einen Schüleraufsatz zum Thema Umweltpolitik, den sie bei einem Schreibwettbewerb einer schwedischen Tageszeitung einreichte, einen Preis gewann, beförderte auch nicht gerade den sokratischen Ansatz zum notwendigen Skeptizismus. Im Gegenteil. Greta Thunberg radikalisierte sich still und leise und ihr Umfeld gleich mit.
Verführerisches Narrativ Eines der Mittel, die sie nutzte, war ihr »Schulstreik«. Das Bild, wie ein zartes, zerbrechliches Mädchen in der grauen Kühle eines Regentages mit angewinkelten Knien und einem Pappschild (»Skolstrejk för Klimatet«) vor dem schwedischen Reichstag sitzt, erregte Aufmerksamkeit. Es war viel zu stark, um von der überwiegend linken schwedischen Presse übersehen zu werden, zumal die Dürre und Hitzewelle des Jahres 2018 ausnahmsweise auch den Schweden hochsommerliche Temperaturen verschaffte. Ein gefundenes Fressen also für die Journaille, denn Reichstagswahlen standen an und Greta Thunberg bediente Klischees ohne Ende. Zu-
nächst saß sie also alleine vor dem Reichstag, während des Wahlkampfes täglich, nach den Wahlen dann nur mehr freitags. Eltern und Lehrer missbilligten den Streik zwar, ließen die 15-Jährige aber weiter gewähren. Gretas Narrativ: Die Politik sei schuld an der Klimaveränderung, zunächst die schwedische, dann die Politik weltweit, denn man würde nicht genug gegen die sich anbahnende Klimakatastrophe tun. Als es Winter wurde und Greta immer noch in ihren kindlichen Outfits vor dem Reichstag in der Kälte mit ihrem Pappschild hockte, gewann dieses Narrativ des kleinen, mutigen Mädchens, das sich im Dienst der Menschheit ganz alleine gegen die große Politik stellt, eine Eigendynamik auch außerhalb Schwedens.
Manipulation auf breiter
Plötzlich sprach die ganze Welt von Greta und der Klimakatastrophe. Der Streik fand schnell Nachahmer. Schüler auf der ganzen Welt mussten nicht lange überredet werden, sich freitags freizunehmen und für die gute Sache den Unterricht Unterricht sein zu lassen. Greta wurde zu Erwachsenenveranstaltungen eingeladen und ließ dort mit nicht unbeträchtlicher schauspielerischer Leistung ihrem heiligen Zorn freien Lauf: »How dare you?« Wie könnt ihr es wagen, schmetterte sie auf der UNO-Klimakonferenz den Politikern vor laufenden Kameras entgegen, und ihre vor Wut zitternde Stimme fand ihr Publikum ebenso wie ihr verzerrtes Gesicht und ihre gefletschten Zähne.
Das Klima sollte fortan jahrelang die Schlagzeilen beherrschen. Der Rest ist Geschichte. Schnell griffen die Mechanismen der linksgrünen Hegemonie. Wer das Kind kritisierte oder ihre Thesen hinterfragte, war bestenfalls »Klimaleugner«, »Schwurbler«, schlimmstenfalls Faschist. Wer sich als Retter des Klimas gerierte, durfte alles. Die, die für zurückhaltende Vernunft, wissenschaftliche Skepsis oder alternative Lösungsansätze waren, durften viel, nur eines nicht: sich äußern. Klimakleber und Vandalen wurden toleriert, absurde CO₂-Reduktionen versprochen und geplant, gesellschaftliche Fundamente wie Wärme im Winter oder Individualmobilität zur Disposition gestellt.
Direkter Einfluss auf die Politik
Die Grünen, die kurz zuvor in Österreich aus dem Parlament geflogen waren, feierten einen Wahlsieg nach dem anderen, bis sie durch die Koalitionsmathematik in Deutschland und Österreich die Gelegenheit erhielten, maßgeblich an der Gestaltung der Politik von der Regierungsbank aus mitzuwirken. Ohne mit der Wimper zu zucken, förderten sie inmitten der schwersten Krisen, die Europa in diesem Jahrhundert erlebt hatte, die Deindustrialisierung, etwa indem man Verbrennungsmotoren verbieten wollte – das Herzstück der europäischen Autoindustrie, mit der es weite Teile Mitteleuropas in den letzten 50 Jahren zu Wohlstand, Sicherheit und Frieden gebracht hatten. Damit nicht genug, nahm man sich die Haushalte vor. Dabei spielte ihnen ausgerechnet Wladimir Putin in die Hände. Plötzlich war ein weiterer moralischer Grund gefunden, einen »Bellum Justum« gegen fossile Brennstoffe zu führen. Schließlich unterstütze der Kauf von billigem Gas aus Russland das imperialistisch-diktatorische Putin-Regime. Ungeachtet der Tatsache, dass Deutschland, Österreich und andere Länder nicht nur ihre Wirtschaftskraft, sondern auch sehr, sehr viele Haushalte ihr Warmwasser, ihre Heizung und ihre Kochenergie diesem Gas verdankten, war ausreichend Grund gefunden, diese Energiequelle von heute auf morgen als moralisch minderwertig zu brandmarken und Alternativen durchzusetzen: Weithin sichtbare Windräder verunstalteten plötzlich mit der Rechtfertigung der CO₂-Einsparung ganze Gebirgszüge,
riesige Photovoltaikfelder werden mitten in die Landschaften gepflanzt, während jedoch der Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze nur schleppend vorangeht.
Der Einfluss Greta Thunbergs war enorm – und wirkt bis heute nach. Besonders sichtbar wurde er in der Verschärfung der europäischen Klimapolitik. 2019 präsentierte die EU mit dem »European Green Deal« einen umfassenden Maßnahmenplan, der unter anderem das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verankert. Auch wenn dieser Kurs nicht allein auf Thunbergs Wirken zurückzuführen ist, wird ihr doch das Verdienst zugesprochen, das Thema Klimakrise mit neuer Dringlichkeit in die öffentliche und politische Debatte getragen zu haben.
Ihre globale Präsenz – von Schulstreiks bis zur UNO-Rede – verlieh der Forderung nach ambitionierteren Klimazielen zusätzlichen Nachdruck. So wurde etwa das EU-Reduktionsziel für Treibhausgasemissionen bis 2030 von ursprünglich minus 40 auf minus 55 Prozent angehoben (bezogen auf das Jahr 1990). Vor allem Deutschland, als größte Volkswirtschaft der Union, trug maßgeblich zur Durchsetzung dieser verschärften Vorgaben bei – und vermittelte der Öffentlichkeit zunehmend das Narrativ, dass es zu diesen tiefgreifenden Einschnitten keine Alternative gebe. Dass Thunberg darüber hinaus höchst wirkungsvoll die Diskrepanz zwischen politischem Versprechen und realem Handeln anprangerte, führte dazu, dass einige Länder tatsächlich ihre Klimagesetze überarbeiteten. Das deutsche Klimaschutzgesetz von 2021 mit verschärften Zielen ist geradezu ein Schulbuchbeispiel dafür, wie öffentlicher Druck zu legislativen Änderungen führte. Ungeachtet der Tatsache, dass Thunbergs Einfluss eine zerrissene Bevölkerung weltweit noch weiter polarisiert und ihre Forderungen teilweise unrealistisch sind, wurde Klimaschutz von einem wissenschaftlichen Nischenproblem, dem nur technisch beizukommen ist, zur politischen Topagenda, der alle anderen politischen Ziele bis hin zur Wirtschafts- und Sozialpolitik untergeordnet werden müssen.
Religiöser Eifer flaut ab
Doch inzwischen flaut der religiöse Eifer, mit dem die Industriestaaten an ihrer CO₂-Reduktion arbeiten, langsam, aber sicher ab. Denn je entschlossener die Gesetzgeber die wohlstandsgefährdenden Schrauben anziehen, desto lauter wird der Zweifel, ob all das überhaupt einen messbaren Unterschied mache. Denn während sich Europa Fesseln anlegt – durch Verbote, Emissionshandel, Klimazölle und Förderprogramme, die mehr Bürokratie als spürbare Wirkung entfalten –, wächst der globale CO₂-Ausstoß unbeirrt weiter. China eröffnet jedes Jahr Dutzende neue Kohlekraftwerke, Indien holt in Sachen Industrialisierung auf, und selbst die USA setzen – trotz ihres grünen Vokabulars der letzten Jahrzehnte – unter Trump auf eine deutlich wirtschaftsfreundliche Energiepolitik. Europa hingegen spielt immer noch den klimatischen Musterschüler – koste es, was es wolle. Der Anteil der EU am weltweiten CO₂-Ausstoß liegt mittlerweile bei unter acht Prozent – mit weiter sinkender Tendenz. Selbst wenn Europa in naher Zukunft klimaneutral wäre, würde das laut einhelliger wissenschaftlicher Einschätzung den globalen Temperaturverlauf nur marginal beeinflussen. Die klimatischen Bedingungen blieben weitgehend unverändert. Auch das Auftreten von Extremwetterereignissen – oft als symbolischer Beweis für den Klimawandel angeführt – ließe sich durch europäische Emissionsreduktionen nicht unmittelbar verändern. Reduktion bedeutet, künftige Erwärmung zu bremsen, nicht aber, frühere kli-
matische Verhältnisse zurückzubringen – jene Zeiten, in denen die Winter schneereich, die Sommer gemäßigt und Unwetter selten waren.
Diese Realität wird in der politischen Debatte jedoch häufig ausgeblendet. Die Folge: Strategien zur Anpassung an die bereits spürbaren Klimaveränderungen werden vernachlässigt. Dabei wären gesetzliche und infrastrukturelle Maßnahmen dringend erforderlich – quer durch alle Bereiche: Versicherungen, Bauwirtschaft, Gesundheitswesen, Tourismus, Landwirtschaft, Freizeitund Verkehrsinfrastruktur. Es fehlt jedoch an einer entschlossenen Politik, die die notwendigen Voraussetzungen schafft, um Anpassungen rasch und effektiv umzusetzen.
Industrie reagiert mit Carbon-Leakage
Während sich europäische Staaten in Zieldebatten und Symbolpolitik verlieren, verlagern Konzerne ihre Produktion dorthin, wo Energie billig und Auflagen gering sind. Die Emissionen verschwinden nicht – sie ändern nur den Ort. Der Planet hat davon nichts gewonnen. Im Gegenteil: Europa verliert seine industrielle Substanz, ohne dass das Klima davon profitiert. Das ist die bittere Ironie eines gut gemeinten, aber global nicht abgestimmten Klimakurses. Wer CO₂ wirklich reduzieren will, braucht Technologieexporte, nicht Exportverbote – und Allianzen, keine Alleingänge. Doch Europa liebt seine moralische Vorreiterrolle mehr als die unbequeme Frage, ob der »Green Deal« dem Weltklima irgendetwas bringe? Im Euroraum sank – um ein Beispiel zu nennen –im Dezember 2024 die Industrieproduktion gegenüber 2023 um zwei Prozent, in Deutschland um vier Prozent und in Österreich um acht Prozent. In der Verbrennerindustrie ist der Rückgang besonders spürbar, Deutschland und damit das Zulieferland Österreich verlieren signifikant Marktanteile an China. Die Symptome einer auch durch die harten Klimavorgaben politisch vorangetriebenen Deindustrialisierung aufzuzählen würde den vorliegenden Rahmen allerdings sprengen.
Klima-Aktivistinnen verlieren Bedeutung
Zehn Jahre nach Greta Thunbergs Asperger-Diagnose sind nun endlich erste zarte Anzeichen da, dass sich der Wind dreht. Mit der Verlagerung ihres aktivistischen »Spezialinteresses« in Richtung Palästina-Befreiung nimmt der öffentliche Wille, wieder ernsthaft darüber zu diskutieren, wann welche Maßnahmen mit welchem Ziel gesetzt werden, zu. Bestes Beispiel dafür war eine vor wenigen Wochen auf Servus TV ausgestrahlte Diskussion, zu der neben dem Grünen Werner Kogler auch die als »Klima-Shakira« bekannte deutsche »Klimakleberin« Anja Windl eingeladen war. Das Thema wurde – professionell moderiert – so vernünftig diskutiert, dass Windl schnell am Ende ihrer Argumente angelangt war. Ihre Entrüstung darüber, dass sich die rationalen Argumente ihrer Mitdiskutanten nicht durch das Dreschen von infantilen PanikmacherPhrasen entkräften ließen, mündete darin, dass sie wutentbrannt mitten in der Diskussion das Studio verließ.
Anja Windl steht exemplarisch für eine neue Generation von Klimaschutzaktivistinnen, die weniger durch inhaltliche Tiefe als durch medienwirksame Inszenierung auffallen. Ihr Fokus liegt auf der möglichst effektvollen Verbreitung einer radikalen Botschaft – oft mit Karriereeffekten – und weniger auf der Förderung eines ernsthaften gesellschaftlichen Diskurses. In dieser Rolle fungieren sie als Vorbilder für nachkommende Generationen von Aktivisten. Es handelt sich dabei oft um ein wiederkehrendes Muster: Die Bereitschaft zum intellektuellen Diskurs tritt zugunsten rhetori-
scher Routine, geschliffener Sprache und strategischer Selbstvermarktung in den Hintergrund. Telegenität, nicht selten verstärkt durch den gezielten Einsatz äußerer Wirkungsmittel, wird zum Türöffner in Talkshows und Onlinekanäle.
Beispiele dafür sind neben Anja Windl auch Luisa Neubauer, Lena Schilling, Anuna de Wever, Adenike Olados oder Marinel Ubaldo – Aktivistinnen, deren mediale Reichweite häufig mehr ihrer PRKompetenz als der Unwiderlegbarkeit ihrer Argumente zu verdanken ist.
Während Europa sich unter dem Eindruck solcher medial verstärkter Appelle zu immer ehrgeizigeren Klimazielen verpflichtet, profitiert ein Akteur ganz besonders, und zwar China. Als weltweit führender Produzent von Schlüsseltechnologien wie Photovoltaikanlagen, Windkraftkomponenten oder Elektrofahrzeugen hat sich China eine nahezu monopolartige Stellung in jenen Industriezweigen gesichert, die für die europäische Klimawende essenziell sind. Der geopolitische Gewinner eines zunehmend ideologisierten Klimadiskurses ist damit bereits ausgemacht – und es ist nicht Europa.
Die Energiezukunft wird in China entschieden
Trotz eines Rekordausbaus von Windkraftkapazitäten in Europa –allein 2023 wurden laut dem Branchenverband WindEurope rund 17 GW neue Windkraftleistung installiert, so viel wie nie zuvor – stehen europäische Windturbinenhersteller unter massivem wirtschaftlichem Druck, wie u.a. das Industriemagazin berichtet.
Zwar sind die Auftragsbücher für 2024 gut gefüllt, doch strukturelle Probleme wie Lieferkettenengpässe, hohe Rohstoffpreise und technologische Rückschläge belasten die Bilanzzahlen. Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel von Siemens Gamesa, der Windkrafttochter von Siemens Energy, die 2023 mit technischen Problemen bei ihrer neuen Turbinengeneration kämpfte und Verluste in Milliardenhöhe schrieb. Der Mutterkonzern musste schließlich durch staatliche Bürgschaften in Höhe von 15 Milliarden Euro gestützt werden, um die Liquidität zu sichern, wie aus einem Bericht der FAZ (2023) hervorgeht.
Das Reich der Mitte weiß diese Schwäche smart zu nutzen. Während westliche Hersteller wie Vestas, Nordex oder Siemens Gamesa stagnieren oder rote Zahlen schreiben, expandieren chinesische Wettbewerber mit rasanter Geschwindigkeit. Goldwind, Envision und MingYang Smart Energy erhielten laut dem Branchendienst Bloomberg im Jahr 2022 neue Aufträge von über 55,3 Gigawatt, das entspricht etwa dem Doppelten der kombinierten Bestellungen der drei größten westlichen Hersteller. Chinesische Firmen profitieren nicht nur von niedrigeren Produktionskosten und staatlicher Unterstützung, sondern auch von einem stark wachsenden Heimatmarkt und zunehmender Exportorientierung – zuletzt auch nach Europa, etwa durch Joint Ventures oder Direktinvestitionen.
Die aktuelle Entwicklung erinnert stark an das Schicksal der euro-

päischen Solarindustrie, die binnen weniger Jahre von asiatischen Wettbewerbern – allen voran China – verdrängt wurde. Zwischen 2010 und 2018 sank Europas Anteil an der globalen Produktion von Solarzellen von über 20 auf unter fünf Prozent. Gleichzeitig stieg China zur dominierenden Industrienation in diesem Bereich auf. Nun droht der europäischen Windkraftbranche ein ähnliches Schicksal: Der Verlust technologischer Souveränität und industrieller Wertschöpfung an außereuropäische Anbieter wird zunehmend real.
Doch das ist nur ein Aspekt der wachsenden chinesischen Präsenz im Kontext des »European Green Deal«. Während in China nach wie vor in großem Stil neue Kohlekraftwerke errichtet werden, beteiligen sich chinesische Staatsunternehmen an strategisch relevanten europäischen Infrastrukturen. Besonders brisant ist in diesem Zusammenhang die Rolle der State Grid Corporation of China (SGCC) – eines der größten Energieunternehmen der Welt, das vollständig dem chinesischen Staat gehört und eng mit der Kommunistischen Partei verflochten ist.
In Deutschland wird derzeit kontrovers diskutiert, ob ein solcher Staatskonzern Anteile am größten Gasnetzbetreiber des Landes erwerben darf. In Österreich ist dieser Schritt bereits vollzogen: Über Beteiligungen an italienischen Energieunternehmen wie »CDP Reti« und »Snam« hat sich die SGCC seit 2014 indirekten Zugriff auf zentrale Teile der österreichischen Gasinfrastruktur gesichert – ein strategischer Fuß in der Tür Europas, eingebettet in die geopolitische Dimension der Klimapolitik.
Sichern. Schützen. Erhalten.
Unabhängigkeit versus Klimamoral
Dies wirft Fragen zur Energiesicherheit und zur Unabhängigkeit der EU im Rahmen der Energiewende auf. Aktuelle EU-Richtlinien von 2025 sehen strengere Prüfungen ausländischer Investitionen in kritische Infrastrukturen vor, um die Energiezukunft zu schützen – ein Schritt, der durch Bedenken über den wachsenden Einfluss Chinas auf Sektoren verstärkt wurde, die für die Dekarbonisierung entscheidend sind. Parallel dazu wird das von der SGCC 2015 vorgeschlagene Projekt einer globalen Energievernetzung diskutiert, das ein weltweites Smart-Grid mit Fokus auf erneuerbare Energien schaffen soll. Obwohl dies das Klimaziel der erneuerbaren Energien fördern könnte, birgt aber auch ein solches Modell geopolitische Risiken.
Fazit – der Klima-Idealismus als ökonomisches Harakiri
Für die Konzentration auf die CO₂-Werte, die einzig einer moralischen Vorreiterrolle dient, zahlen wir einen hohen Preis: Wettbewerbsnachteile für die Industrie, steigende Energiepreise für Haushalte, massive Subventionen für Technologien, deren globale Relevanz fraglich bleibt. Der Klima-Idealismus Europas droht zum ökonomischen Harakiri zu werden – nicht wegen der Idee, sondern wegen der Isolation. Klimapolitik wird mehr als moralisches Projekt gesehen, losgelöst von realer geopolitischer Wirkung, denn als tatsächliche Hilfsmaßnahme. Zehn Jahre nach Thunberg muss wieder die Vernunft in die Debatten Einzug halten.

Wir sichern unser Trinkwasser.
Wir schützen vor Hochwasser.
Wir erhalten saubere Gewässer.
Nachhaltig. Für alle. www.wasserwirtschaft.steiermark.at
Sichern. Schützen. Erhalten.
Wir sichern unser Trinkwasser.
Wir schützen vor Hochwasser.
Wir erhalten saubere Gewässer.
Nachhaltig. Für alle. www.wasserwirtschaft.steiermark.at



Persönliche Freiheit ist nur da möglich, wo es kollektive Unabhängigkeit gibt.
Wir müssen der Realität von heute ins Auge sehen.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Entgegennahme des Karlspreises im Mai 2025

MANUELA KHOM – TOPERGEBNIS UND KLARES EU-BEKENNTNIS Mit 98,6 Prozent wurde Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom beim Landesparteitag der Steirischen ÖVP zur neuen Landesparteiobfrau gewählt. Damit tritt sie ihr Amt mit einem politischen Vertrauensvorschuss an, der seinesgleichen sucht. Über 1.000 Delegierte und Gäste in der Schwarzl-Halle feierten dabei nicht nur eine Personalentscheidung, sondern auch das Bekenntnis zur Kontinuität eines Kurses, der gleichermaßen auf Geschlossenheit und Gestaltungswillen setzt.
Doch was heißt das für die Steiermark? Khom positionierte sich als Fürsprecherin für den unternehmerischen Mittelstand, für den Produktionsstandort und gegen die überbordende Bürokratie. In einer
Mit 98,6 % übernimmt Manuela Khom die Führung der Steirischen Volkspartei mit einem deutlichen Bekenntnis zur Steiermark, zu Wirtschaft und Europa.
Zeit, in der regulatorische Hürden immer öfter wirtschaftliches Wachstum hemmen, klingt die Ankündigung, »die Zettelwirtschaft« zu beseitigen, wie ein notwendiger erster Schritt. Dass sie das mit dem konkreten Beispiel – der Forderung nach Abschaffung der 2,70-MeterRaumhöhe-Regelung für Kindergärten – untermauerte, zeigt ihr pragmatisches Politikverständnis. Bei Khom steht das Machbare im Mittelpunkt.
Gegen Steiermark der zwei Geschwindigkeiten Zugleich warnte sie vor einem Auseinanderdriften der Regionen – ein Thema, das in Zeiten von Urbanisierung, des demografischen Wandels und der Standortkonkurrenz höchste Aktualität besitzt. Wirtschaftspolitisch bedeutet das,
dass Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung auch im ländlichen Raum Priorität behalten müssen, damit die Wertschöpfung nicht ausschließlich in den Ballungszentren stattfindet. Dass Khom hier ein »gleiches Wachstumstempo« für alle Regionen einfordert, ist ambitioniert, aber schlicht nicht machbar. Daher wird es in der Realität die viel wichtigere Aufgabe der Politik sein, die Pendelzeiten zwischen Ballungsräumen und Peripherie weiter zu verkürzen und – entgegen dem klimapolitischen Mainstream – die Pendler von den ständig steigenden Mobilitätskosten zu entlasten.
Klares EU-Bekenntnis
Die klare Positionierung von Khom zur EU ist ebenfalls bedeutsam. Sie stellt damit das aktuell wichtigste Differenzierungsmerkmal zur immer europafeindlicher agierenden FPÖ in den Vordergrund und das kann bei den kommenden Wahlgängen durchaus noch bedeutsam werden. In Zeiten zunehmender Abschottungstendenzen bekennt sich Khom zu einem offenen Europa, das nicht nur Fördermittel, sondern vor allem Marktchancen bietet. Sie betonte ganz klar, dass 50 Prozent des steirischen Wohlstands durch Exporte entstehen. Ihre Ansage, dass, wer die Grenzen schließen wolle, die Arbeitsplätze und den Wohlstand gefährde, war daher eine klare Abgrenzung zum Koalitionspartner FPÖ.
Khom betonte den wirtschaftlichen Erfolg als Voraussetzung für die soziale Absicherung. »Ohne Wirtschaft keine Sozialpolitik« sei kein neoliberales Dogma, sondern eine wirtschaftliche Realität, die von der Steuerlast bis zur Leistbarkeit öffentlicher Dienstleistungen reiche, so die stellvertretende Landeshauptfrau. In diesem Zusammenhang mag ihre Differenzierung zwischen jenen, »die können und wollen«, und jenen, »die nichts leisten wollen«, überspitzt klingen. Doch damit greift sie das legitime Unbehagen der Steuerzahler im Umgang mit Ansprüchen derjenigen, die noch nichts in

das Sozialsystem eingezahlt haben – also der Armutsmigranten – auf.
Appell zur Geschlossenheit
Dass sich Khom hinter die Koalition mit der FPÖ stellt, ist nur konsequent. Ihr Appell, nicht vom Spielfeldrand zu kritisieren, sondern mitzuarbeiten, ist ein deutlicher Aufruf zur Disziplinierung an etwaige innerparteiliche Kritiker. In diesem Zusammenhang betont sie die Rolle der ÖVP als stabiler Faktor in der Koalition, der mit der FPÖ zusammenarbeitet und nicht mit ihr streitet.
Die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Steiermark steht – Fachkräftemangel, Investitionsstau, Transformation von Industrie und Energie –, sind ihr bewusst. Die politische Richtung, die Khom einschlägt, lässt darauf hoffen, dass sie nicht auf Symbolpolitik, wie bei der von der FPÖ geforderten Abschaffung des IG-L-Hunderters, setzt, sondern auf echte Standortpolitik samt den erforderlichen Reformen. »Hinunter geht’s schnell – hinauf ist zach«, so Khom. Ihr ist klar, dass diese Realität auch für den Wirtschaftsstandort Steiermark gilt.
DIE AMPEL UND DIE PENSIONSLÜGE
In Bezug auf dringend notwendige Änderungen gönnt sich die Regierung einmal mehr den Luxus, die Realität zu ignorieren und den Kopf in den Sand zu stecken. Aus Angst vor den Alten begeht die Regierung Verrat an den Jungen. Während in ganz Europa – außer vielleicht in Frankreich – die Zeichen längst auf Reform stehen, halten ÖVP und SPÖ – und mit etwas Zähneknirschen leider auch die NEOS –unbeirrt an einem Pensionssystem fest, das wirtschaftlich völlig aus dem Ruder läuft. 2025 werden mehr als 33 Milliarden Euro aus dem Bundesbudget für die Pensionen aufgewendet – bis 2027 steigt dieser Betrag auf über 38 Milliarden. Ohne Strukturreform sprechen wir bis 2050 bereits von einer Billion Euro an kumulierten Pensionsausgaben. Das ist kein Pessimismus, das ist Mathematik.
MIT JOHANNES TANDL
Ohne Pensionsreform droht der Kollaps
Laut Statistik Austria steigt der Anteil der über 65-Jährigen innerhalb der nächsten 15 Jahre von knapp 20 auf etwa 27 Prozent, während die Zahl der Erwerbstätigen sinkt. Der Generationenvertrag, auf dem bekanntlich unser Umlagesystem basiert, wird so zu einer echten Zeitbombe. Denn wer heute 30 ist, wird morgen kaum mehr mit einer tragfähigen staatlichen Pension rechnen dürfen – es sei denn, Österreich findet endlich den Mut zu einer echten Reform. Natürlich weiß auch ÖAAB-Chef August Wöginger, dass das derzeitige System nicht zukunftsfähig ist. Die Politik lügt sich aus Angst vor der Wählergunst in die eigene Tasche. Statt das gesetzliche Pensionsantrittsalter schrittweise und transparent zu erhöhen, wird an kosmetischen Korrekturen gebastelt: ein bisschen Korridorpension, ein bisschen Teilpension und ein Nachhaltigkeitsmechanismus, der bei genauerer Betrachtung nichts als Budget-Monitoring ist. Der wird zwar öffentlich als zukunftsweisendes Instrument zur Stabilisierung des Pensionssystems verkauft, in Wirklichkeit ist er aber nicht mehr als ein Frühwarnsystem ohne konkrete Folgen. So lobt sogar Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger die Mini-Reform der Teilpension als »richtigen Schritt«. Tatsächlich ersetzt sie die unfaire Altersteilzeit. Aber sie löst natürlich das Grundproblem nicht. Die Reaktionen von Gewerkschaft und FPÖ auf jede noch so vorsichtige Korrektur zeigen, warum niemand die Wahrheit über die Tragfähigkeit des Pensionssystems ausspricht. So spricht FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch in Zusammenhang mit den leicht angehobenen Sozialabgaben der Pensionisten von einem »perfiden Griff in die Taschen der Pensionisten«, der Altersarmut und Ungerechtigkeit zur Folge haben werde. Doch was tatsächlich passiert, wenn wir den Status quo aufrechterhalten, ist das Gegenteil von Gerechtig-
keit. Künftige Pensionisten werden mit sinkender Kaufkraft und schrumpfenden Spielräumen konfrontiert, weil das System ohne tiefgreifende Änderungen kollabieren muss. Wer glaubt, man könne ein Pensionssystem aufrechterhalten, das auf einem Arbeitsmodell der 1970er-Jahre basiert, ignoriert nicht nur die Fakten, sondern gefährdet gezielt die Zukunft des Landes.
Das System der Biennalsprünge hat sich völlig überlebt
Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Drei Viertel der Menschen in Österreich gehen direkt aus der Erwerbstätigkeit in die Pension; und zwar, weil sie dürfen, nicht weil sie müssen. Nur eine Minderheit scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben aus. Außerdem braucht der Arbeitsmarkt in Zeiten des Fachkräftemangels dringender auch ältere Arbeitnehmer. Dass sich viele Betriebe die Beschäftigung von Menschen über 60 trotzdem nicht leisten können, hängt nicht mit der Arbeitsleistung der Älteren, sondern mit den Biennalsprüngen zusammen, die den Kollektivverträgen zugrunde liegen und ältere Arbeitnehmer alle zwei Jahre um etwa 3 bis 7 Prozent teurer machen als jüngere. Ein erster Schritt wäre daher die Abflachung der Biennalsprünge mit der Beschäftigungsdauer.
Andere Länder gehen längst voran. Deutschland hat die Rente mit 67, Dänemark steuert auf 70 zu. Österreich hält hingegen am Mythos der Frühpensionierung als Errungenschaft fest und scheut die Wahrheit, die lautet: Wer 30 Jahre arbeitet und 25 Jahre Pension bezieht, gefährdet das System für alle, die nach ihm kommen. Die Lösung kann nur in einer schrittweisen Erhöhung des Pensionsantrittsalters, kombiniert mit wirksamen Übergangsregelungen und Anreizen für längeres Arbeiten, liegen. Langfristig sollte die Pensionsfinanzierung aus einem ausgewogenen Mix aus Umlage- und Kapitaldeckung umgestellt werden.

Laute Stimmen, kritische Fragen, kontroverse Debatten – was in Europa als selbstverständlich gilt, ist im Kern Ausdruck eines Grundrechts: der Meinungs- und Informationsfreiheit. Verankert in Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta (GRC), schützt sie nicht nur das Recht, eine Meinung zu äußern, sondern auch, Informationen frei zu empfangen und weiterzugeben. Ebenso verpflichtet sie zur Achtung des Medienpluralismus – ein Garant für demokratische Willensbildung und wirtschaftliche Transparenz. Doch die rechtliche Reichweite reicht tiefer: Die Meinungsfreiheit wurzelt in der Menschenwürde. Sie ist – laut Artikel 1 GRC – „unantastbar“ und verlangt, dass jeder Mensch als selbstbestimmtes, urteilsfähiges Subjekt ernst genommen wird. Wer eine eigene Meinung bilden und äußern kann, lebt in Würde. Und wo Menschen systematisch zum bloßen Objekt gelenkter Information gemacht werden, beginnt die Aushöhlung ihrer Freiheit.
Gerade in Zeiten digitaler Informationsströme ist dieser Schutz nicht selbstverständlich. Algorithmen auf sozialen Plattformen steuern, was Nutzer sehen – oft mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu binden, nicht Debatten zu fördern. Gleichzeitig verbreiten sich
Desinformation und gezielte Manipulation in Echtzeit. Die Folge: eine fragmentierte Öffentlichkeit, die nicht mehr auf gemeinsamen Fakten, sondern auf personalisierten Wirklichkeitsausschnitten basiert.
Die EU hat reagiert – etwa mit dem Digital Services Act (DSA), der großen Plattformen Transparenz und Verantwortung auferlegt, dabei aber die Grenzen der Regulierung achtet. Denn auch die Bekämpfung von „Fake News“ darf nicht zur Zensur werden. Hier wirkt Artikel 11 GRC wie ein Kompass: Eingriffe in die Informationsfreiheit sind nur dann zulässig, wenn sie verhältnismäßig sind – und nie auf Kosten der Würde. Artikel 11 GRC ist mehr als ein Freiheitsrecht. Er ist Teil einer Wertearchitektur, die auf Würde, Freiheit und Pluralismus gründet. In einer digitalen Öffentlichkeit, in der Information zur wirtschaftlichen Ressource und politischen Waffe geworden ist, entscheidet sich an ihm, wie viel Raum der Mensch als denkendes Subjekt behalten darf. Freiheit braucht Würde – und umgekehrt.

Franz Tieber zeigt: Wenn man anpackt, bewegt sich etwas –und Frohnleiten profitiert auf ganzer Linie.
Ein Unternehmer als Motor für Erneuerung: Dank der Initiative von Franz Tieber wird Frohnleiten zum Vorbild dafür, wie ein Hauptplatz wieder zum lebendigen Zentrum einer Stadt werden kann.
Franz Tieber, Unternehmer und Frohnleitner Wirtschaftsstadtrat, steht seit vielen Jahren für gelebte gesellschaftliche Verantwortung. Mit strategischem Weitblick und persönlichem Einsatz investiert er nicht nur in seine Unternehmensgruppe, sondern auch gezielt in die nachhaltige und wirtschaftliche Entwicklung seiner Heimatstadt.
Dr. Andreas Kaufmann ist Rechtsanwalt und Universitätslektor in Graz. Er ist spezialisiert auf Bau-, Immobilien-, Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsrecht. ak-anwaltskanzlei.at
Ein aktuelles Beispiel ist seine Übernahme des ehemaligen SparMarktplatzls am Hauptplatz von Frohnleiten. Als sich kein neuer Betreiber gefunden hatte, entschied sich Tieber, mit seinem Unternehmen Franz Tieber GmbH selbst einzuspringen. Mit einer maßgeblichen Investition wird der Standort nach dem derzeitigen Umbau am 1. September unter der Marke Adeg neu eröffnet. Das Ziel ist die langfristige Sicherung der Nahversorgung im Zentrum sowie die Belebung des Ortskerns. Tieber betont: „Ich wollte nicht länger tatenlos zusehen, wie der Hauptplatz stirbt. Es geht um die Menschen, die hier leben, einkaufen und sich begegnen.“ Das neue Geschäft setzt auf ein hochwertiges Frischesortiment mit regionalem Bezug und persönlicher Beratung. Neben seinen unternehmerischen Tätigkeiten initiiert Tieber auch regelmäßig Projekte zur Belebung des Hauptplatzes. Die sogenannte „Froh“-Serie geht auf sein Engagement zurück: Froh Kids als großes Schulschlussfest, Froh Herbst, Froh Lei als große Faschingsparty, Froh Ice als Eislaufspektakel und vieles mehr für ein starkes Gemeinschaftserlebnis im Herzen der Stadt.



Betriebsbesuch der AMS-Vertreter beim Unternehmen
Accupower in Graz
Insgesamt die stolze Anzahl von 1.946 Betrieben besuchte das AMS Steiermark bei der heurigen Business Tour – im Fokus standen vor allem arbeitsplatznahe Ausbildungen.
Erfolgreiche Bilanz der heurigen AMS Business Tour: Im Frühjahr besuchten die Beraterinnen und Berater des Service für Unternehmen im AMS Steiermark 1946 Betriebe – das waren nach Wien die meisten Betriebe im Vergleich aller Bundesländer. Zudem wurden fast 300 telefonische Beratungen durchgeführt. Bundesweit gab es mehr als 12.700 kontaktierte Unternehmen, damit entfiel fast jeder fünfte Betriebsbesuch auf die Steiermark. „Der persönliche Austausch wirkt – und stärkt den regionalen Arbeitsmarkt nachhaltig“, betont AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.
Viele Gespräche drehten sich um die Frage, wie Unternehmen auch in herausfordernden Zeiten zusätzliche qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen und halten können. Eine maßgeschneiderte Lösung hierfür sind arbeitsplatznahe Ausbildungen: Über dieses Erfolgsmodell können künftige Fachkräfte zielgerichtet nach den konkreten Anforderungen direkt im Betrieb geschult werden, gefördert von AMS und Land Steiermark. Mit der Qualifizierungsförderung für Beschäftigte werden Unternehmen dabei unterstützt, bestehende Potenziale zu heben. Bei der Impulsberatung geben externe Experten und Expertinnen wertvolle Anregungen, um die eigene Attraktivität als Arbeitgeber zw. Arbeitgeberin zu erhöhen. „Selbstverständlich sind wir das ganze Jahr für die heimischen Unternehmen da. Betriebe mit Interesse an einer Zusammenarbeit können sich dafür gerne ans Service für Unternehmen ihrer regionalen AMS-Geschäftsstelle wenden“, sagt Snobe abschließend.
Informationen: gemeinsamausbilden.ams.at
WKO-Regionalstellen-Obmann Bernhard Bauer übt Kritik an übertriebener Bürokratie, die Unternehmen oft behindert.
»Tatort
Unter dem Titel „Stadt oder Stillstand“ hat die WKO Graz eine Kampagne gestartet, um Graz unternehmerfreundlicher zu gestalten. Dafür gibt es ein umfassendes Programm mit konkreten Maßnahmen und Forderungen, die von der WKO Graz aktiv vorangetrieben werden.
Die relativ hohe Beteiligung bei der WKO-Wahl in der Innenstadt, wo wir unsere Kampagne präsentiert haben, bestärkt uns darin, deren Inhalte konsequent voranzutreiben und den Austausch mit unseren Mitgliedern noch intensiver zu gestalten“, erklärt RST-Leiter Viktor Larissegger.
Einer der fünf zentralen Schwerpunkte bei den Kontakten zu Grazer Unternehmen ist die Stadtentwicklung. Die WKO Graz fordert eine Stärkung von Citymanagement und Stadtmarketing. Zudem setzt man sich für flexiblere Öffnungszeiten in der Gastronomie sowie für neue Angebote in der Innenstadt ein, um Graz langfristig als attraktiven Anziehungspunkt für Kunden und Besucher zu etablieren.
Ein weiteres Kernthema ist der Bürokratieabbau. „Überspitzt gesagt, sollte alles erlaubt sein, was nicht ausdrücklich verboten ist – und nicht umgekehrt“, betont RST-Obmann Bernhard Bauer. Er stellt eine neue Internetplattform vor, die veranschaulicht, mit welchen absurden Regelungen sich Unternehmer konfrontiert sehen. „Damit wollen wir eine Debatte über Erleichterungen anstoßen und konkrete Lösungen aufzeigen“, ergänzt Bauer.



Was tun bei Urlaubsmängeln?


AK-Expertin Birgit Auner antwortet:
Zu den häufigsten Problemen bei Pauschalreisen zählen Mängel in der Unterbringung am Urlaubsort. Informieren Sie den Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort bzw. per E-Mail und lassen Sie sich eine Bestätigung geben. Der Reiseveranstalter muss die Möglichkeit zur Verbesserung haben. Dokumentieren Sie alle Mängel möglichst genau mit Fotos, Videos, Name und Adresse von Mitreisenden (zur Beweisführung). Nach der Rückkehr können Sie mittels Einschreiben an den Reiseveranstalter eine Reisepreisminderung verlangen. Die „Wiener Liste und Frankfurter Tabelle“ (Entscheidungssammlungen) helfen, um die Höhe der Forderung einzugrenzen.
Einen Musterbrief finden Sie auf www.akstmk.at/urlaub


Ab 21. November verbindet British Airways mit ihrer Tochter BA Euroflyer dreimal wöchentlich den Flughafen Graz direkt mit London Gatwick. Die neue Linienverbindung wird mit einem Airbus A320 bedient und bietet den Reisenden direkten Zugang zur britischen Hauptstadt. BA Euroflyer ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der British Airways. „London war für uns der mit Abstand größte Markt ohne Direktflüge. Die Linienflüge mit BA Euroflyer nach London Gatwick sind für Wirtschaft, Industrie und Tourismus in unserer Region von enorm großer Bedeutung“, freut sich Wolfgang Grimus, GF des Graz Airport, „zusätzlich erhalten unsere Fluggäste Zugang zu Anschlussflügen zu ausgewählten Langstreckenzielen.“


Spar versorgte Kinderstadt „Bibongo“
Vom 7. bis 11. Juli verwandelte sich das Volkskundemuseum Graz in die Kinderstadt „Bibongo“. Rund 250 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren schlüpften in verschiedene Rollen – dabei hatten die Kids die Möglichkeit, verschiedene Jobs und Berufe auszuprobieren: vom Forscher über Bürgermeisterin bis hin zur Kauffrau. Spar war erneut Partner der Aktion und übernahm die Nahversorgung mit Lebensmitteln. Am Spar-Stand zahlten Kinder mit „Sternis“, führten Verkaufsgespräche und probierten sich in Handelsberufen aus. „Kinder erleben so spielerisch Verantwortung und Teamarbeit“, so Spar-GF Christoph Holzer. Das Projekt, organisiert von den Kinderfreunden Steiermark, fördert Demokratiebewusstsein und Selbstständigkeit.
Kampus ist SP-Graz-Spitzenkandidatin
Mit großer Mehrheit wählte der Vorstand der SPÖ Graz am 15. Juli Doris Kampus zur Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl 2026. Die Bezirksvorsteherin von Andritz und ehemalige Soziallandesrätin setzt auf bodenständige Politik mit klaren Maßnahmen. Sie will sich für Pflege, Gesundheitsversorgung und sozialen Zusammenhalt einsetzen. „Die Gesundheitsversorgung steht unter Druck, es fehlen Kassenstellen und die Pflege ist am Limit“, erklärt Kampus. Besonders wichtig und ein Herzensprojekt ist ihr die Anstellung pflegender Angehöriger, die sie als Pilotprojekt in Graz initiiert hat. „Graz braucht mehr als Symbolpolitik. Die Herausforderungen verlangen nicht nur Haltung, sondern konkrete Maßnahmen“, so Kampus. Am Stadtparteitag am 7. November stellt sie ihr Team vor – für eine Politik, die zuhört und handelt.


Am 16. Juni 2025 starteten in Graz die „Wochen der Inklusion“, die heuer aufgrund des großen Interesses auf einen Zeitraum von drei Wochen ausgedehnt wurden. Der offizielle Abschluss fand am 6. Juli statt. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, Teilhabe sichtbar zu machen und Barrieren weiter abzubauen. Inklusionsstadtrat Kurt Hohensinner betont: „Inklusion ist ein fortlaufender Prozess – Graz soll Vorreiterstadt werden.“ Die 2023 beschlossene Inklusionsstrategie der Stadt bildet die Basis dafür. Ein Highlight war der Eventtag am 27. Juni am Grazer Hauptplatz mit über 34 Organisationen, Mitmachstationen und inklusivem Bühnenprogramm. Von Rollstuhlparcours bis Kabarett, Sport und Musik wurde Vielfalt aktiv gelebt und gefeiert.

Wiederwahl von Bauer zum WKO-Obmann
Der Unternehmer Bernhard Bauer wurde am 15. Juli 2025 einstimmig als Obmann der WKO-Regionalstelle Graz wiedergewählt. Er steht seit Anfang 2023 an der Spitze der Grazer Wirtschaftskammer und wird auch künftig die Interessen der lokalen Betriebe vertreten. „Ich danke für das Vertrauen und setze mich weiterhin mit voller Kraft für eine starke Wirtschaft in Graz ein. Unser Programm ‚Stadt oder Stillstand‘ bleibt Leitlinie für die kommenden Jahre“, so Bauer. WKO-Steiermark-Präs. Josef Herk betonte die zentrale Rolle der Regionalstellen als erste Anlaufstelle für Betriebe und forderte eine „Koalition der Willigen“ zur gemeinsamen Umsetzung dringend notwendiger Reformen im Sinne der Standortentwicklung.

Die Knapp AG wurde bei der Exporters’ Nite der Wirtschaftskammer Österreich mit dem Global Player Award 2025 ausgezeichnet. Der Preis würdigt herausragende Exporterfolge und die internationale Marktführerschaft des steirischen Technologieunternehmens. COO Franz Mathi nahm die Auszeichnung am 2. Juni in Wien entgegen. Knapp ist mit über 8.300 Mitarbeitenden an 50 Standorten weltweit tätig und exportiert 96 % seiner Leistungen. Die Jury lobte die nachhaltige Wachstumsstrategie und Innovationskraft. „Die Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich“, so Mathi. Mit umfangreichen und innovativen Lösungen für Logistik, Robotik und Software gilt Knapp als internationaler Vorzeigebetrieb in der Intralogistik.

Sind die Klagen des Handels, insbesondere was die Grazer Innenstadt betrifft, berechtigt?
Ja, absolut! Erreichbarkeit ist für die Innenstadtwirtschaft lebensnotwendig. Die Verkehrs- und Parkplatzsituation, auch die Baustellenkoordination sind alles andere als wirtschaftsfreundlich. Die Konkurrenz im Onlinehandel, vor allem aus NichtEU-Ländern, nimmt stark zu. Ungleiche Rahmenbedingungen sorgen für einen Wettbewerbsnachteil. Hier muss die Politik rasch mit den richtigen Maßnahmen reagieren.
Gibt es eine Überkonzentration des Angebotes?
In der Innenstadt kann kaum mehr ernsthaft davon gesprochen werden, vielmehr muss versucht werden, die Innenstadt durch einen attraktiven Branchenmix interessant und konkurrenzfähig zu machen. Der Kampf um die attraktivsten Standorte ist sehr hart.
Inwiefern hat der heimische Handel seine Kompetenzen und Potenziale im OnlineBusiness erweitert?
Viele stationäre Händler richten zusätzlich Online-Shops ein bzw. verkaufen über Online-Plattformen. Diese Ergänzung ist wichtig, um für möglichst viele Konsumenten sichtbar zu sein. Der Lehrberuf ECommerce-Kaufmann zeigt, wie wichtig digitales Know-how ist, damit wird auch die Zielgruppe an Jugendlichen angesprochen. Mit dem go-online Servicecenter der Sparte Handel stehen wir seit über zehn Jahren den Betrieben zur Seite, wenn es um Fragen der Digitalisierung und des OnlineHandels geht.

Mit einem bunten Sommerprogramm lädt das Novapark Flugzeughotel in Graz zur entspannten Auszeit über den Wolken. Das Summer Special bietet von 7. Juli bis 6. September attraktive Preise bei den Hotelzimmern inklusive Frühstück und Zugang zur 3.000 m² großen Nova-Spa Wellnessoase. Kulinarisch lockt das 80s-Restaurant Iljuschin ab 15. Juli mit sommerfrischen Gerichten. Genießen Sie regionale Highlights und Salate auf unserer neuen Nova-Air-Sommerkarte. Auch kulturell wird viel geboten: Travestie-Star Dona Loca gastiert am 16. August, die beliebten „Boogie & Swing“-Abende steigen am 17. Juli und 21. August. Ab September starten auch die beliebten Klassiker wie Saunanächte, Live-Piano und Oldies-DJ-Nights wieder durch.

Oper Graz: Bühne frei für junge Stimmen
Der Förderkreis der Oper Graz fördert seit Jahrzehnten junge Gesangstalente und ermöglicht Stipendien im Opernstudio. Jährlich bewerben sich rund 300 bis 400 Nachwuchssänger für einen der begehrten Plätze – vier bis fünf werden aufgenommen. Das Opernstudio bietet intensive künstlerische Ausbildung, Sprachcoaching, Meisterklassen und erste Bühnenerfahrung. Aktuelle und ehemalige Talente wie Neira Muhić, Ekaterina Solunya und Corina Koller zeigen eindrucksvoll, wie aus Förderungen Karrieren werden. Intendant Ulrich Lenz bedankt sich für die Unterstützung: „Dank des Förderkreises können wir vier Sänger und Sängerinnen im Studio beschäftigen – das ist enorm wertvoll.“ Mitglieder profitieren von exklusiven Einblicken und Angeboten.
Grazer Pilotprojekt für Pfandflaschen

SPAR rettet Lebensmittel – und hilft Menschen
Am 6. Juni rief Spar Steiermark und Südburgenland gemeinsam mit dem Roten Kreuz zum Aktionstag „Lebensmittel retten, Menschen helfen“ auf. In 18 Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten der Region konnten Kunden und Kundinnen haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel kaufen und direkt spenden. Die Waren kommen armutsbetroffenen Haushalten in der Region zugute. Spar engagiert sich seit Jahren gegen Lebensmittelverschwendung – mit Spenden an Sozialorganisationen, „Rette-mich“-Boxen, Too Good To Go und KI-gestützter Warenwirtschaft. „Wir unterstützen Aktionstage wie diese sehr gerne. Als Lebensmittelhändler wissen wir: Lebensmittel sind kostbar – ökonomisch, ökologisch und menschlich“, so Spar-GF Christoph Holzer.
Pfand gehört nicht in den Müll – aus diesem Grund startet die Stadt Graz gemeinsam mit der Holding Graz ein Pilotprojekt mit sogenannten Pfandringen. Vize-Bgm. Judith Schwentner betont: „Jede Pfandflasche und Dose hat einen Wert. Die Pfandringe sollen helfen, Ressourcen zu schonen, und zugleich einen sozialen Mehrwert schaffen.“ Seit dieser Woche sind am Grazer Hauptbahnhof – dem meistfrequentierten Standort – vier Papierkörbe mit insgesamt 19 Pfandabgabemöglichkeiten ausgestattet. Dort können Leergebinde abgegeben werden, um von anderen Personen gesammelt und eingelöst zu werden. Das erklärte Ziel ist es, Abfall zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und soziale Aspekte zu fördern. Die Holding Graz evaluiert zunächst, wie das neue System angenommen wird.

(v.l.n.r.) Feierliche Verleihung des Landeswappens mit ehem. GF Ernst Konrad, Spartenobmann LIM Johann Reisenhofer, WKO-Präsident Josef Herk, e.denzel-GF Alexander Fürnschuß, LH Mario Kunasek, e.denzel-GF Manuel Pichler und HGF e.denzel & Intratec Herbert Planetz.
Das steirische Unternehmen e.denzel Elektro- und Gebäudetechnik erhielt mit der Überreichung der Landesauszeichnung eine Würdigung für Innovation, Nachhaltigkeit und gelebte Unternehmenskultur.
D
ie e.denzel GmbH in Graz wurde am 3. Juli mit dem Steirischen Landeswappen ausgezeichnet – eine der höchsten Ehrungen des Landes für herausragende wirtschaftliche Leistungen. Im Rahmen des offiziellen Festakts überreichte LH Mario Kunasek in Anwesenheit des langjährigen, früheren Geschäftsführers Ernst Konrad die Urkunde an das Führungsteam von e.denzel: Herbert Planetz, LIM Ing. Alexander Fürnschuß und Manuel Pichler.
Mit der Verleihung des Landeswappens wird ein Unternehmen gewürdigt, das sich seit Jahrzehnten durch Innovationskraft, wirtschaftliche Stabilität, nachhaltige Entwicklung und tiefe regionale Verwurzelung auszeichnet. Die verantwortlichen Geschäftsführer dankten in ihren Reden ganz besonders den rund 130 Mitarbeitenden – denn ohne ihr Engagement wäre der stetige Wachstumskurs von e.denzel nicht möglich gewesen.
„Die Firma e.denzel ist ein Paradebeispiel für modernes Unternehmertum mit Werten“, betonte Kommerzialrat Johann Reisenhofer, Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk, in seiner Ansprache. Auch WKO-Präsident Josef Herk brachte in seiner Rede seine Glückwünsche zum Ausdruck und unterstrich die bedeutende Rolle des Betriebs für die steirische Wirtschaft. Unter dem treffenden Motto „Ausgezeichnet!“ wurde nicht nur die Ehrung mit dem Landeswappen gefeiert, sondern auch das, was das Unternehmen im Innersten ausmacht: ein starkes, vielfältiges Team, das gemeinsam die Zukunft mitgestaltet.
Sommerfest mit Musik, Spaß und regionalem Genuss
Im Anschluss an den offiziellen Festakt verwandelte sich das Firmengelände in der Grazer Laubgasse in ein lebendiges Festgelände. Das e.denzel-Sommerfest war ein Dankeschön an die Be-
legschaft – mit Kulinarik aus der Region, Musik und zahlreichen Aktivitäten wie Bungee Run oder Axtwerfen. Eine Tombola mit attraktiven Preisen rundete das abwechslungsreiche Programm ab. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Wertschätzung und gelebter Firmenkultur. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Beat Club Graz, der unter anderem mit der Intonation der steirischen Landeshymne für einen emotionalen Höhepunkt der Veranstaltung sorgte.
Verantwortung aus Kompetenz und Tradition
Die e.denzel GmbH zählt heute zu den führenden Komplettanbietern für Energiesysteme und Gebäudetechnik in der Steiermark. Seit der Gründung 1918 hat sich das Unternehmen von einem klassischen Elektroinstallationsbetrieb zu einem modernen Technikdienstleister mit fünf zentralen Kompetenzfeldern entwickelt: Photovoltaik- & Speicherlösungen, HKLS-Systeme, Sicherheitstechnik, Elektroanlagen sowie Automatisierung & IT. Bemerkenswert ist die internationale, generationenübergreifende Belegschaft, die das Unternehmen prägt – Mitarbeiter aus mehr als einem Dutzend Nationen tragen tagtäglich zur Qualität und Innovationskraft bei. Das Unternehmen e.denzel versteht sich nicht nur als Arbeitgeber, sondern als starke Gemeinschaft mit sozialem und regionalem Verantwortungsbewusstsein. Als mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb – unter anderem mit dem „Star of Styria“ – investiert e.denzel nachhaltig in Fachkräfteausbildung und bietet jungen Talenten zukunftsorientierte Perspektiven. Zu den realisierten Projekten zählen Infrastrukturvorhaben ebenso wie industrielle Großanlagen und kommunale Einrichtungen – stets mit dem Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und technologischem Fortschritt.

Wassernetzwerk Steiermark 2050
Mit dem Programm „Wassernetzwerk Steiermark 2050“ sichert das Land Steiermark langfristig eine flächendeckende Trinkwasserversorgung. Bis 2050 werden rund 150 Mio. Euro in leistungsfähige Leitungen, Speicher und Infrastruktur investiert. Ursachen für den steigenden Bedarf sind Klimawandel und Bevölkerungswachstum – besonders im Großraum Graz sowie im Süden und Südosten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem innersteirischen Wasserausgleich zwischen wasserreichen und trockenen Regionen. Aktuelle Großprojekte umfassen etwa neue Leitungen zwischen Dobl und Seiersberg sowie in Graz-Thondorf. LRin Simone Schmiedtbauer und LH-Stv. Manuela Khom betonen: „Jeder Euro in die Wasserversorgung stärkt die Sicherheit und Lebensqualität in unseren Regionen.“

Aus Abfall wird Ressource: Amesbauer besucht Saubermacher
Im Rahmen seiner Öko-Tour besuchte Umwelt-LR Hannes Amesbauer den größten Standort des steirischen Entsorgungsunternehmens Saubermacher in Premstätten. Vor Ort informierten Gründer Hans Roth und Vorstand Andreas Opelt über innovative Umweltlösungen rund um flüssige Abfälle, Batterien, Lösungsmittel und Ersatzbrennstoffe. „Flüssige Abfälle zählen zu den anspruchsvollsten Abfallarten“, so Roth. Besonders im Fokus: die ressourcenschonende Aufbereitung anspruchsvoller Abfälle. Amesbauer zeigte sich beeindruckt: „Saubermacher steht für Innovation, Umweltverantwortung und soziale Kompetenz – ein Vorzeigebetrieb der Steiermark.“ Auch über Forschungsprojekte und Kreislaufwirtschaft wurde im Headquarter in Feldkirchen umfassend informiert.


Steirischer Sauvignon im Weltklasseformat
Erstmals fand die IWSC Global Judging Austria in der Steiermark statt – und die Gastgeber überzeugten auf ganzer Linie: 10 der 18 österreichischen Goldmedaillen gingen an steirische Weine, vor allem an Sauvignon Blancs, die die Jury mit Stilvielfalt, Ausgewogenheit und Charakter begeisterten. Insgesamt wurden 68 von 74 steirischen Einreichungen prämiert – ein beeindruckender Qualitätsbeweis. Die Steiermark setzt damit neue Maßstäbe bei der renommierten International Wine & Spirit Competition. WeinSteiermark-GF Martin Palz: „Auf den internationalen Märkten positionieren wir Styrian Sauvignon Blanc konsequent als unsere Leitsorte – mit dem klaren Ziel, die Steiermark dauerhaft als Weltspitze für die Rebsorte zu verankern.“
Sophie Guggi ist beste Nachwuchs-Spediteurin
Beim Lehrlingswettbewerb der Speditionskaufleute und -logistiker überzeugte die 22-jährige Sophie Guggi mit einer souveränen Leistung und wurde zur besten Nachwuchs-Spediteurin gekürt. Der Lehrling (Dachser Austria) setzte sich gegen acht Mitbewerber durch. Geprüft wurden Selbstpräsentation, Firmenvorstellung, Fachwissen zu Zoll, Versicherung und Reklamation sowie spontane Kommunikation auf Englisch. Auch schriftliche Aufgaben zu Transportabwicklung und Kalkulation waren Teil des Wettbewerbs. Platz zwei ging an Judith Rienessel (Kühne+Nagel), Platz drei an Lóránt Móric Tóth (Johann Huber). Die Siegerin erhielt einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro. Die Fachjury zeigte sich vom großen Können des Nachwuchses beeindruckt.

Christoph Holzer überreichte den Spendenscheck der Steirerlaib-Aktion an Catharina Brand von den Rote Nasen Clowndoctors.
Einkaufen und dabei Gutes tun – das geht ganz einfach mit dem Steirerlaib von SPAR. Heuer kamen bei dieser Spendenaktion insgesamt 7.830 Euro für den Verein „Rote Nasen Clowndoctors“ zusammen.
Seit 2017 wird der Steirerlaib – ein kräftiges Roggenmischbrot – von 17 lokalen Bäckereien exklusiv für SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in der Steiermark gebacken. Pro verkauftem Brot spendet das Einzelhandelsunternehmen SPAR 50 Cent für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Hinter dem Brot stehen traditionelle Handwerksbetriebe wie die Bäckereien Schneider aus Wettmannstätten, Kranich aus St. Peter am Ottersbach oder Gruber aus St. Lorenzen bei Knittelfeld. Sie beliefern täglich frisch die SPAR-Standorte in ihrer Region und setzen auf regionale Zutaten und steirische Qualität.
Unterstützung für Kinder in Spitälern Der Verein „Rote Nasen“ bringt seit über 30 Jahren Lachen und Hoffnung zu Menschen in belastenden Situationen. Ob in Spitälern, Pflegeeinrichtungen oder Reha-Zentren – mit Musik, Humor und
viel Feingefühl schenken Clowns kleinen und großen Patienten Lebensfreude und emotionale Stärke. „Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht: Wir freuen uns, unseren Kunden und Kundinnen eine unkomplizierte Möglichkeit zu geben, Gutes zu tun“, so Holzer. „Die Roten Nasen leisten wertvolle Arbeit, und wir sind stolz, sie mit dieser Summe zu unterstützen.“
„Wir sind überwältigt und bedanken uns von ganzem Herzen bei SPAR, allen Mitarbeitern und Kunden. Mit dieser Unterstützung können wir vielen Menschen ein Lächeln schenken – genau dann, wenn sie es am meisten brauchen“, erklärt Fundraiserin Catharina Brand von den Roten Nasen. Die Steirerlaib-Aktion zeigt eindrucksvoll, wie regionale Qualität und soziales Engagement Hand in Hand gehen: Ein Brot, das nicht nur schmeckt, sondern auch Herzen berührt.

Andreas Steinegger, Präsident der LK Steiermark
Welche Akzente wollen Sie in Ihrer neuen Funktion als LWK-Präsident setzen?
Dort, wo unseren Landwirte der Schuh drückt, werde ich genau hinhören, die Anliegen aufgreifen, sie klar ansprechen und entschlossen an Lösungen arbeiten. Weniger Zettelwirtschaft für die Familienbetriebe, die Klimawandelanpassung und eine verlässliche EU-Agrarpolitik sind jetzt vorrangige Aufgaben. Verstärken werde ich auch den Dialog mit der Bevölkerung, damit die Land- und Forstwirtschaft für jene „begreifbar“ wird, die wenig über sie wissen.
Wo sehen Sie Potenziale für mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft?
Ich bin ein glühender Verfechter einer nachhaltig produzierenden und wettbewerbsfähigen Land- und Forstwirtschaft. Die Biodiversitätsleistungen unserer steirischen Bäuerinnen und Bauern sind eindrucksvoll. Was sie oft unbemerkt für die Umwelt und Artenvielfalt leisten, ist von unschätzbarem Wert – für das ganze Land und für jeden einzelnen von uns. Vielfach unbekannt ist vor allem, dass durch die Bewirtschaftung die Artenvielfalt gesichert wird.
Welche Chancen sehen Sie für eine breitere Vermarktung regionaler Produkte? Regionalität ist ein Megatrend und auch saisonale Lebensmittel rücken immer mehr in den Fokus. Klimaschutz, kurze Wege und Qualität sprechen klar dafür. Das bäuerliche Versorgungsnetzwerk liefert frische Lebensmittel direkt vom Hof an die Gastronomie und Großküchen. Dieses hochwertige Angebot bäuerlicher Lebensmittel und der erstklassige Service des BVN sollten Gastrobetriebe noch gezielter nutzen.
Fazitgespräch
Von Peter K. Wagner und Johannes Tandl mit Fotos von Marija Kanizaj

Die Merkur Versicherung AG nähert sich mit einem Prämienvolumen von 922,6 Millionen Euro der Milliardengrenze.
Finanzvorstand Andreas Gaugg erklärt, warum der zweitgrößte private Krankenversicherer Österreichs auch in Zukunft auf sein Kernprodukt setzt. Und warum es im Grunde immer gilt, auf 100 Jahre zu kalkulieren.



Es ist zehn Uhr am Vormittag, als wir Andreas Gaugg beim Eingang des Restaurants »Arravané« treffen. Das moderne Restaurant im Erdgeschoss des Merkur-Campus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84 in Graz hat vor fünf Jahren seine Pforten geöffnet.
In der offenen Küche löst eine Köchin den Inhalt von einer Salsiccia nach der anderen aus der Haut, dahinter beginnt einer ihrer Kollegen gerade, langsam Fleisch anzubraten. Nur der Regen, der gegen die großen Glasfronten des Gebäudes prasselt, stört die Akustik, die auf das nahende Mittagsgeschäft schließen lässt.
»Auf geht’s«, steht auf Gauggs Laptopaufkleber – bald wird er uns mehr als eine Stunde Einblick in die Merkur Versicherung geben. Der 40-jährige CFO hat Platz genommen und überreicht uns den 240 Seiten umfassenden, in Buchform gebundenen Geschäftsbericht 2024. »Wir versichern das Wunder Mensch« prangt auf dem Cover. Der Slogan, der das Selbstverständnis des traditionsreichen Grazer Versicherers zusammenfasst.

Kein anderes Versicherungsunternehmen in Österreich ist so stark auf die Krankenversicherung spezialisiert wie wir.
Andreas Gaugg
Herr Gaugg, mit 922,6 Millionen Euro Prämienvolumen rückt Merkur in die Nähe der Milliardengrenze. Was waren die wesentlichen Treiber dieses Wachstums?
Der Markt der Krankenversicherung ist im vergangenen Jahr um zehn Prozent gewachsen, wir um zwölf. Anders als in den Jahren davor, konnten wir zudem in der Schaden- und Unfallversicherung leicht zulegen. Und besonders erfreulich ist, dass unsere Tochter in Salzburg, die Merkur Lebensversicherung, ein starkes vertriebliches Jahr hatte. Das sind rund 120 Millionen Prämienvolumen, und das ist im Konzern mit den 12,5 Millionen Gesamtergebnis abgebildet. Als Personenversicherer war es uns wichtig, eine starke Lebensversicherung im Portfolio zu haben.
Wie beurteilen Sie das Ergebnis vor Steuern im Jahr 2024 – sowohl für die AG mit 9,7 Millionen als auch im Konzernvergleich mit 12,5 Millionen?
Wir hatten im Jahr 2023 einen Einmaleffekt im Zusammenhang mit einem Immobilienprojekt bei der Merkur Versicherung AG, der 2024 natürlich nicht schlagend gewesen ist. 2024 zeigte sich aber, dass die Strategie, die wir konsequent verfolgt haben, zu greifen beginnt. Das heißt, wir sind operativ nicht nur vertrieblich, sondern auch bei der Veranlagung und im Kostenmanagement besser geworden.
Die SCR-Bedeckungsquote – also das Verhältnis zwischen den vorhandenen Eigenmitteln und dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapital zur Abdeckung möglicher Risiken – liegt bei bemerkenswerten 270,8 Prozent. Wie erklären Sie diese robuste Eigenmittelausstattung?
Wir haben uns bei der Merkur, seit dieses Regulativ gilt, entsprechend ausgerichtet. Und wir wissen natürlich, welche Schritte zu setzen sind, damit man auch diesbezüglich Stabilität an den Tag legen kann. Genau da sind wir 2024 mit besonderem Fokus herangegangen, insbesondere bei der Veranlagung. Wir haben also für unsere Kunden deutlich konservativer aber sicherer investiert. Und das schlägt sich in solchen Quoten nieder. Als Merkur unterscheiden wir uns übrigens deutlich von der übrigen Branche. Kein anderes Versicherungsunternehmen in Österreich ist so stark auf die Krankenversicherung spezialisiert wie wir. Dabei denken wir langfristig – unsere Kalkulationen sind auf einen Horizont von bis zu 100 Jahren ausgerichtet.
Die Krankenversicherung bleibt also Ihr Wachstumsmotor. Was macht Ihr Unternehmen in diesem Segment erfolgreicher als die Konkurrenz?
Die Merkur hat früh damit begonnen, den Vorsorgegedanken in den Mittelpunkt zu stellen und war eines der ersten Unternehmen
mit einer umfassenden Krankenversicherung. Das war und ist ein sehr innovatives Produkt. Das Vorsorgethema können wir als private Versicherung ganz anders bespielen, als etwa die öffentliche Hand. Denken Sie an unsere Vorsorgeprogramme oder unsere Kooperationen mit Gesundheitseinrichtungen. Ich glaube, dass uns der Gedanke an die Eigenvorsorge auch beim Absatz der Versicherungsprodukte hilft und einfach präsent ist bei unseren Kunden oder jenen, die es werden wollen.
Die Grawe hat vergangenes Jahr mit einem eigenen Krankenversicherungsprodukt gestartet. Dadurch erwächst Ihnen neue Konkurrenz direkt vor der Haustür. Wie gefährlich kann das werden?
Natürlich ist es schade, wenn man einen jahrzehntelangen Kooperationspartner verliert, aber ich bin der Meinung, man muss diese unternehmerische Entscheidung, die die Grawe getroffen hat, respektieren. Wir sind auch nach wie vor in einem guten Austausch und haben eine gute Beziehung. Aber es gibt ja nicht nur die Grawe und die Merkur auf dem Markt. Was uns auszeichnet, ist das jahrzehntelange stabile vertrauensvolle Verhältnis zu unseren Kunden. Unser Kernversicherungsprodukt läuft ja nicht über zwei oder fünf Jahre, sondern in der Regel wesentlich länger.
Wird die Krankenversicherung deshalb immer wichtiger, weil sich die Leute durch die Zweiklassenmedizin zum Abschluss veranlasst sehen? Oder ist die freie Arztwahl das schlagende Argument? Es sind viele Faktoren, einerseits wollen die Kunden abgesichert sein. Andererseits sieht man in den letzten 25 Jahren am Gesundheitsmarkt, dass sich das Angebot aus dem privaten Sektor vervielfacht hat. Fakt ist, der ambulante Bereich hat so stark zugenommen, dass es dermaßen viele Angebote gibt, die von der Sozialversicherung nicht abgedeckt sind, und sich so die Patienten für eine zusätzliche private Krankenversicherung entscheiden.
Welche Rolle spielen Gruppenversicherungen, bei denen sich Menschen über Betriebsräte versichern lassen können?
Das sind günstigere Angebote, und es kommt dadurch zu vielen Vertragsabschlüssen. Selbst wenn sie weniger zum Ergebnis beitragen, ist das Gruppengeschäft für die Merkur Versicherung wichtig. Ich habe selbst mit 24 Jahren und mit dem Einstieg ins Berufsleben eine Krankenversicherung abgeschlossen, die über den Betriebsrat kam.
Ihr Unfallversicherungsgeschäft hat ebenfalls über dem Marktschnitt zugelegt. Wie interpretieren Sie dieses Wachstum?
Positiv natürlich. Wir haben seit Jahren versucht, wieder in der Unfallversicherung Fuß zu fassen. Und es ist erfreulich, dass wir in den letzten beiden Jahren damit Erfolg hatten. Das Produkt war
immer gut, aber die Merkur war immer bekannt als Krankenversicherer, weniger als Anbieter von Unfallversicherungen.
Wie ist die Entwicklung in der Sachversicherung zu bewerten? Wie haben sich die Starkwetterereignisse des vergangenen Jahres auf diese Sparte ausgewirkt?
Natürlich spüren wir die Unwetterkatastrophen, aber wir sind bei einem kleinen Prämienvolumen nicht so stark exponiert wie andere Schadenversicherer. Unser Schadenversicherungsbereich setzt sich nicht nur aus Haushalt, Sturm oder Feuer zusammen, sondern auch aus Rechtsschutz und dergleichen. Das Risiko ist also vertretbar und natürlich ist man auch rückversichert.
Treiben Sie die Diskussion um eine allgemeine Versicherungspflicht für Katastrophenereignisse an?
Nicht aktiv, aber wir beobachten das Thema. Wie gesagt, wir sind in dem Segment nicht wirklich exponiert. Die strategische Ausrichtung ist bei uns eine andere. Wir bieten historisch auch Schadenversicherungen an und sehen sie als Ergänzung für unser Produktportfolio. Unser Fokus liegt klar auf der Krankenversicherung, auf der Lebensversicherung und auf der Unfallversicherung. Wir sind ein Personenversicherer.
In der Lebensversicherung ist die Entwicklung in der gesamten Branche seit Jahren durchwachsen. Mit der Nürnberger Versicherung haben Sie einen klassischen Lebensversicherer erworben. Welche Überlegung stand hinter dem Kauf?
Nicht nur für den Außendienst, sondern für jeden Vertriebspartner, der mit uns kooperiert, ist es wichtig, die Palette vollständig abzubilden. Und wenn wir uns als Versicherung positionieren, dann braucht man natürlich auch eine starke Lebensversicherung. Ich würde aber sagen, dass sich Lebensversicherungen jetzt wieder leichter verkaufen lassen.
Es gibt eine Diskussion um die Anhebung des Pensionsantrittsalters. Unterstützt die Unsicherheit der Bürgerinnen und Bürger den Absatz von Versicherungsprodukten?
Natürlich, das ist dieselbe Diskussion wie im Gesundheitssystem. Es ist auf der einen Seite schade, dass man so lange Reformen vor sich herschiebt, aber andererseits können wir von privater Seite unterstützen. Es muss für Menschen die Möglichkeit geben, privat vorzusorgen – das war auch schon immer so. Das Thema wird zunehmend volatiler und brisanter, und egal, ob im Bereich der Kranken- oder Lebensversicherung, wird es sich bemerkbar machen.
Die Strategie »2030+« der Merkur legt den Fokus auf »Versicherung, Absicherung, Vorsorge«. Geht es da um das Produktportfolio oder auch um die interne Aufstellung?
Unser größtes Kapital ist unsere Eigenständigkeit – und dieser Anspruch ist ganzheitlich zu verstehen. Es gibt eine Reihe von Erfolgsfaktoren, die unser Unternehmen stark gemacht haben. Diese müssen wir auch künftig erreichen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Dabei geht es um vertriebliche, produktseitige und strategische Dimensionen. Unsere Strategie berücksichtigt die Rahmenbedingungen und Herausforderungen, die wir klar identifiziert
volksbank-stmk.at
Wenn Beständigkeit auf Innovation trifft – modernisieren Sie Ihre Immobilien für den Erfolg von morgen.

: Medieninhaber und Hersteller: Volksbank Steiermark AG, Schmiedgasse 31, 8010 Graz, Tel.: +43 (0) 5 0901 1199, ksc@volksbank-stmk.at, Verlags& Herstellungsort: Graz, Stand: März 2025, WERBUNG
haben: Entwicklungen im Gesundheitssystem, technologischer Wandel, zunehmende Regulierung. Dazu zählen auch Herausforderungen wie Dora – der »Digital Operational Resilience Act« der EU –, der zusätzliche Aufwand bedeutet, aber zugleich unsere Widerstandsfähigkeit im digitalen Raum stärkt. Mit all diesen Themen müssen wir uns proaktiv und vorausschauend auseinandersetzen.
Apropos Dora, welche Rolle spielt Digitalisierung und KI in Ihrem Unternehmen?
KI ist ein Thema. Ich selbst bezeichne KI immer als Technologie, weil ich nicht glaube, dass KI irgendein Heilmittel sein kann, das selbständig unternehmerische Probleme lösen wird. Wir können als Versicherungsunternehmen natürlich immer nur Technologien einsetzen, die nachhaltig sind und die einen gewissen Sicherheitscharakter mit sich bringen. Wir haben bereits sehr viel IT-Knowhow, insbesondere in der Krankenversicherung, wo wir Technologien einsetzen, die es uns ermöglichen, das Service für den Kunden zu verbessern.
Im Vertrieb oder im Back Office … Bis vor zehn Jahren haben wir von den Kunden große Abrechnungspakete bekommen, weil sie oft nur einmal im Jahr ihre Unterlagen zur Abrechnung gebracht haben. Das ist heute ganz anders. Ich komme vom Wahlarzt, habe eine Rechnung, lade sie in die App hoch und alles ist erledigt. Das ist für den Kunden einfacher, aber die Abwicklung wird zu einem gewissen Grad effizienter. Da stehen natürlich Technologien dahinter, die man einsetzen muss, um dieses Servicelevel für den Kunden zu erreichen. Was mit dem
Einsatz moderner Technologien leider ebenfalls zugenommen hat, sind Versuche, die Systeme auszutricksen. Und auch davor müssen wir uns und unsere Kunden schützen.
Wie verändert sich die Rolle des Außendienstes im Zuge der digitalen Transformation?
Den großen Schub hat das Thema mit Corona bekommen, wo wir sehr schnell sehr viel »remote« im Außendienst umstellen konnten. Der Mitarbeiter erledigt seine Aufgaben vom Kundentermin, über Beratungen, Vorbereitungen aber Dokumentationen – digital und dezentral, mit seinem Onlinezugriff auf unsere internen Systeme. Auf der anderen Seite nehmen die Regulatorik und Dokumentationspflichten zu. Das heißt, wir brauchen diese digitale Unterstützung. Was früher mit zwei Formularen erledigt war, das spielt sich ja mittlerweile auf zig Seiten ab mit Unterschriften und unterstützenden Informationspflichten. Natürlich spielt da die Digitalisierung eine riesige Rolle.
Der internationale Geschäftsbereich der Merkur ist konstant erfolgreich. Gibt es einen besonderen Fokus auf neue Märkte? Wir sind in Slowenien, Kroatien und Serbien und mit der österreichischen AG im freien Dienstleistungsverkehr auch in Südtirol vertreten. Da gibt es immer wieder neue länderspezifische Produktauflagen, aber die sind meistens nicht bahnbrechend anders. Wir bieten daher auf die landespezifische Regulatorik adaptierte Produkte an. Wir scannen natürlich den Markt auf Chancen, aber das ist nicht prioritär. Wir versuchen zuerst einmal die bestehenden Hausaufgaben zu erledigen, bevor wir uns um Neues kümmern.



Der neue CLA.
Bis zu 792 km Reichweite (WLTP) mit einer einzigen Ladung*. Mehr auf www.mercedes-benz.at










Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie: Energieverbrauch kombiniert: 12,2–14,1 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km *Ermittelt nach WLTP; weitere Infos auf www.mercedes-benz.at/wltp. Tippfehler vorbeh. Abbildung ist Symbolfoto. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.

Mag. Andreas Gaugg, Jahrgang 1984, ist seit Oktober 2023 Finanzvorstand der Merkur Versicherung AG. Der gebürtige Kärntner studierte in Klagenfurt Betriebswirtschaft und startete seine Karriere bei der Hypo Alpe Adria, bevor er zu Ernst & Young wechselte. 2016 kam er zur Merkur, wo er seit 2017 als Bereichsleiter im Konzerncontrolling tätig war. Er ist verheiratet und Vater dreier Kinder.

Ich komme vom Wahlarzt, habe eine Rechnung, lade sie in die App hoch und alles ist erledigt.
Andreas Gaugg
»Wir versichern das Wunder Mensch« ist der Slogan der Merkur. Wie stark ist das Merkur-Versicherungsmodell von Prävention und gesundem Lebensstil geprägt? Hier am Merkur-Campus gibt es ja etwa auch ein Fitnesscenter.
Diesen Vorsorgegedanken gibt es in der Merkur Versicherung schon sehr lange. Die Entwicklung unserer Vorsorgeprogramme, wir nennen sie »ego4you«, hat ja immer schon medizinische Aspekte umfasst, aber eben auch Wohlfühlaspekte inkludiert. Das war schon immer ein USP der Merkur-Versicherung. Wir haben übrigens nicht nur ein Fitnesscenter bei uns im Campus, wir haben Kooperationen mit mehreren Fitnesscentern. Viele Kunden haben ein Produkt, das auch die »ego4you« Vorsorgeprogramme inkludiert, bei dem etwa der Fitnesscenterbesuch zu einem bestimmten Teil abgedeckt wird.
Wirft das Merkur-Gym hier am Campus auch Gewinne ab?
Das Fitnesscenter bilanziert positiv und ist tatsächlich profitabel. Es ist so, dass ziemlich genau die Hälfte der Benutzer externe Kunden sind, die das Topangebot in Anspruch nehmen wollen, und die andere Hälfte decken wir über unsere eigenen Programme ab.
Sie investieren auch in versicherungsfremde Branchen. Welche Hoffnungen verknüpfen Sie mit Investments im Bereich der Immobilien oder bei der Therme Loipersdorf? Unsere Immobilien sind Teil der Veranlagung. Wir interessieren uns im Zuge der Veranlagung natürlich auch für neue Projekte. Da begleitet unsere Immobiliengesellschaft eigentlich alles von der Akquisition über die Planung für neue Projektentwicklungen bis zur Vermietung. Der Fokus liegt auf Wohnbau, wir haben allerdings Grenzen, die wir nicht über- oder unterschreiten wollen. Wir sitzen in Graz, haben auch Immobilien in Wien, und natürlich wird es mit der Koralmbahn interessant, nach Klagenfurt zu schauen. Die Therme Loipersdorf haben wir als Teil eines Konsortiums gekauft und wir sind nicht am Betrieb beteiligt, weil das ein versicherungsfremdes Geschäft wäre. Wir haben das Hotel Sonnreich gekauft, und einen Standort für unsere »ego4you«-Vorsorgeprogramme etabliert – aber dort sind wir Eigentümer und nicht Betreiber.
Wie kann man die Therme Loipersdorf trotz des hohen Investitionsbedarfs so aufstellen, dass sie wirtschaftlich rentabel ist. Hat die Merkur Ideen dafür?
Es gab eine neue Quellenbohrung – das eine, was schon gesichert ist, ist das Wasser. Das andere ist, dass der Thermenbetrieb an sich wirtschaftlich positiv ist. Aber es ist auch so, dass man wahrscheinlich in die Technik investieren muss. Wenn man sich die Gesellschaften vor der Übernahme anschaut und danach, dann wird man sehen, dass sich sehr viel verbessert hat, auch in der Kapitalisierung. Vor der Übernahme war die Gesellschaft relativ stark verschuldet, jetzt ist sie kaum verschuldet. Wir haben die finanzielle Stabilität wiederhergestellt.
Warum hat die Merkur eine Kooperation mit dem Landgut am Pößnitzberg?
Wir hatten schon immer in der Vergangenheit Kooperationspartner aus dem Tourismus, die unsere Vorsorgeprogramme abdecken können. Wir sind Marktführer in der Steiermark, wir haben hier über 50 Prozent Marktanteil. Unsere Kunden wollen diese Programme in Anspruch nehmen – oft nur für ein Wochenende oder für ein paar Tage.
Wird das Namenssponsoring beim Grazer Fußballstadion verlängert?
Wir sind dabei, die Kooperation, die im Frühjahr 2026 endet, zu evaluieren. Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir unsere Entscheidung kommunizieren.
Wird es bald wieder einen Merkur-Generaldirektor geben?
Wir sind als Team angetreten und werden das auch zukünftig so weiterführen – Christian Kladiva ist für Risiko zuständig, Markus Spellmeyer für den Vertrieb und ich für Finanzen. Es hat jeder seine Kompetenzen und es ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Herr Gaugg, vielen Dank für das Gespräch!

Sommerzeit ist Ferialjobzeit. Wenn Kinder mit Sommerjobs ihr eigenes Geld verdienen wollen, laufen Eltern Gefahr, die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag zu verlieren. Sorgenfreier Zuverdienst besteht für alle Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres – diese dürfen ganzjährig beliebig viel verdienen, ohne Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag zu gefährden. Danach wird es etwas komplizierter: Kinder über 19 Jahre müssen darauf achten, dass das zu versteuernde Einkommen ohne 13. und 14. Gehalt nach Abzug von SVBeiträgen, Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen € 17.212 nicht überschreitet, damit Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag nicht verloren gehen. Dies unabhängig davon, ob das Einkommen in- oder außerhalb der Ferien erzielt wird. Sollte das zu versteuernde Einkommen höher sein, wird die Familienbeihilfe um den übersteigenden Betrag vermindert und muss zurückgezahlt werden. Die gleiche Einkommensgrenze gilt auch beim Bezug von Studienbeihilfe.
Achtung Negativsteuer: Für Niedrigverdiener bringt eine Arbeitnehmerveranlagung auf jeden Fall die Erstattung von bis zu 55 % der Sozialversicherungsbeiträge. In den meisten Fällen erfolgt diese über die antragslose Veranlagung durch das Finanzamt im Folgejahr.
Die Bauwirtschaft kämpft mit Innovationsstau, Fachkräftemangel und Regulierungsflut. Der gesamten Branche gelingt es seit Jahrzehnten nicht, ihre Arbeitsproduktivität in einem ähnlichen Ausmaß wie die übrige Wirtschaft zu steigern – also mehr Output mit gleichbleibendem oder geringerem Einsatz von Arbeit und Kapital zu erzielen. Daher wird das Bauen immer teurer und teurer.
Die Bauwirtschaft steht unter massivem Druck. Die Kosten für Wohn- und Infrastrukturprojekte steigen seit Jahren, während die Produktivität stagniert. In einer Zeit, in der andere Branchen längst auf Automatisierung und digitale Prozesse setzen, bleibt der Bau traditionell – mit weitreichenden Folgen für Preise, Effizienz und den Wohnungsmarkt.
Veraltete Prozesse, kaum Automatisierung
Im Vergleich zur Industrie hinkt die Bauwirtschaft bei der Automatisierung weit hinterher. Tätigkeiten wie Mauern, Messen und Montieren erfolgen weitgehend manuell – häufig unter wechselnden Wetterbedingungen und auf unvorhersehbarem Gelände. Technologische Konzepte wie „Building Information Modeling“ (BIM) sind zwar in der Planung etabliert, erreichen die Umsetzung auf der Baustelle aber nur selten.
Auch die Digitalisierung kommt kaum voran. Nur ein Bruchteil der Unternehmen setzt auf IT-vernetzte Maschinen. In Deutschland ist der Maschinenpark im
Schnitt elf Jahre alt – etwa doppelt so alt wie in anderen Industriezweigen. Gleichzeitig investieren deutsche Baufirmen nur rund 0,5 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung – weit unter dem EU-Schnitt von 2,1 Prozent. Die Folge: Ineffizienz, Stillstände und eine langsame Reaktion auf steigende Rohstoff- oder Lohnkosten.
Komplexe Projekte, veraltete Logistik, Fachkräftemangel und Überregulierung Hinzu kommt die enorme Komplexität auf Großbaustellen. Oft sind 30 bis 40 Gewerke beteiligt, deren Abstimmung Zeit und Ressourcen kostet. Laut Studien gehen bis zu 30 Prozent der Arbeitszeit für Koordination und Kommunikation verloren. Gleichzeitig ist die Materiallogistik ein Schwachpunkt: 73 Prozent der Betriebe nennen sie als zentralen Produktivitätskiller. Fehlende Standardisierung, verzögerte Lieferungen und mangelnde Transparenz führen zu Verzögerungen und Kostenexplosionen.
Erschwerend wirkt der akute Fachkräftemangel. In Österreich fehlen im Bau und

Mangelnde Innovationen, Überregulierung und Fachkräftemangel haben die Bauwirtschaft in die Produktivitätsfalle geführt.
Baunebengewerbe mindestens 10.000 Fachkräfte. Dazu kommt der demografische Rückgang bei Jugendlichen. Er betrifft bekanntlich die handwerklichen Berufe besonders hart. Und das verschärft die Fachkräftesituation zusätzlich. Die Bauwirtschaft setzt zwar verstärkt auf Ausbildungsinitiativen, eine besse-
re Berufsorientierung und attraktivere Rahmenbedingungen für ihre Lehrlinge. Trotzdem sinkt die Zahl der Ausbildungsanfänger. Die Folge für die Unternehmen: steigende Lohnkosten und wachsender Druck auf die bestehenden Belegschaften. Nicht zuletzt bremsen die überbordenden Regulierungen den Fortschritt aus. Neben

den gesetzlichen Vorschriften regeln etwa 3.500 DIN-Normen das Bauwesen – in Österreich dauert es im Schnitt 18 Monate, bis ein Bauprojekt genehmigt wird. Jede kleine Innovation im Bauprozess bedeutet neue Genehmigungsverfahren und rechtliche Prüfungen. Statt schneller, effizienter und günstiger zu bauen, wächst der Aufwand durch Formalismen und Vorschriften.
Kosten steigen schneller als die Inflation
Die Folge all dieser Faktoren ist eine historisch hohe Baukostenentwicklung. Laut Deutscher Bundesbank sind die Baukosten in den letzten 20 Jahren doppelt so stark gestiegen wie die Inflation. Besonders in urbanen Regionen wird Wohnen dadurch zunehmend unleistbar. Das Versprechen vom leistbaren Wohnraum droht zu scheitern – nicht am Willen, sondern an den strukturellen Defiziten der Branche. Die Bauwirtschaft befindet sich in einer Produktivitätsfalle. Ohne grundlegende Reformen – von der Digitalisierung über die Fachkräfteausbildung bis zur Deregulierung – wird der Preisanstieg weitergehen. Die Branche, die für Wachstum und Wohnraum steht, steht sich derzeit oft selbst im Weg. Wer die Wohnkosten in den Griff bekommen will, muss beim Bauen anfangen – mit Mut zur Innovation.
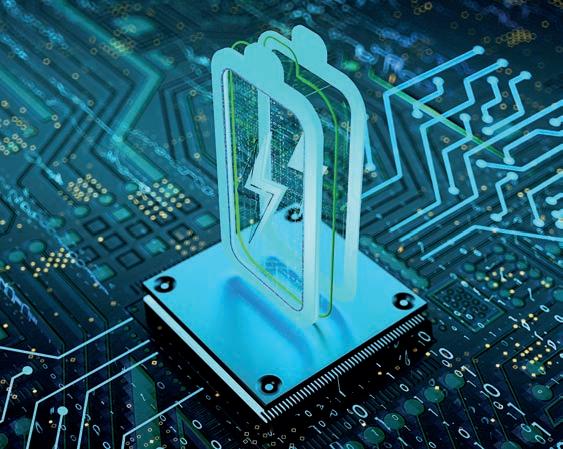
3 Millionen Euro Forschungsförderung!
Kooperationsprojekte steirischer Forschungseinrichtungen und Unternehmen
Batterie-Management, Recycling, Second Life und Produktion bis zu 600.000 Förderung pro Projekt




Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender Schadenslasten setzt die Wiener Städtische in der Steiermark ihren Wachstumskurs fort. Besonders Lebens- und Unfallversicherung verzeichnen starke Zuwächse – und auch die Gesundheitsvorsorge wird für junge Kunden zunehmend wichtig.
Im ersten Quartal 2025 konnte die Wiener Städtische in der Steiermark ein solides Prämienwachstum verzeichnen. Die gesamten Prämieneinnahmen stiegen auf 159,5 Millionen Euro. Besonders dynamisch entwickelten sich die Schaden-/Unfallversicherung mit einem Plus von 8,2 Prozent (90,9 Millionen) sowie die Lebensversicherung mit einem Zuwachs von 6,2 Prozent (46,5 Millionen). Die Krankenversicherung wuchs um 4,8 Prozent auf 22,1 Millionen.
Sicherheitsbedürfnis der Kunden steigt
Landesdirektor Michael Witsch sieht den Grund für das stabile Wachstum im gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung: „In wirtschaftlich krisenhaften Zeiten suchen Menschen nach Halt – wir bieten ihnen diesen durch stabile Leistungen in allen Lebenslagen.“
Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass die staatliche Pension im Alter nicht reichen wird, gewinne auch die Lebensversicherung wieder an Bedeutung.
Auch in der privaten Gesundheitsvorsorge zeichnet sich ein bemerkenswerter Trend ab: Die Neukunden werden immer jünger. Das Durchschnittsalter liegt mittlerweile bei nur 28 Jahren, jeder
v.l. Landesdirektor
Michael Witsch und Generaldirektor
Ralph Müller
Dritte ist sogar unter 20. Viele Eltern schließen bereits direkt nach der Geburt eine Zusatzversicherung für ihre Kinder ab. Witsch: „Frühe Absicherung bedeutet bessere Konditionen und einen lebenslangen Schutz.“
Mehr Schäden – mehr Auszahlungen
Das Wachstum auf der Prämienseite wird von steigenden Leistungsfällen begleitet. Im ersten Quartal 2025 zahlte die Wiener Städtische Steiermark täglich rund 480.000 Euro an Schadensleistungen aus – ein Plus von 5,5 Prozent. Besonders in der Kfz-Versicherung stiegen die Kosten, getrieben durch teurere Reparaturen. Auch im Gesundheitsbereich wurden mehr Leistungen beansprucht – und das bei steigenden Krankenhauskosten.
Ein besonderes Sorgenkind bleiben Unwetterschäden. Das Jahr 2024 brachte österreichweit mit 227 Millionen Euro den höchsten Schadensstand der Unternehmensgeschichte – auch die Steiermark war stark betroffen. Die Schadenssumme in der Steiermark stieg 2024 auf 21,7 Millionen Euro – ein Plus von über zehn Prozent. Laut Witsch sei eine Entspannung angesichts des fortschreitenden Klimawandels nicht in Sicht.

WKO Präs. Josef Herk (re.) und Dir. Karl-Heinz Dernoscheg zum Wirtschaftsbarometer: „Es zeigt sich wieder ein zaghafter Trend nach oben, wobei das Wirtschaftsklima insgesamt nach wie vor rau ist.“
Nach Monaten wirtschaftlicher Zurückhaltung zeigt das steirische Wirtschaftsbarometer erste Anzeichen einer konjunkturellen Erholung. Die jüngste Erhebung der WKO Steiermark unterstreicht eine leichte Stimmungsverbesserung bei den befragten Unternehmen.
WKO Präsident Josef Herk und WKO Direktor Karl-Heinz
Dernoscheg sprechen von einer „vorsichtigen Aufwärtsbewegung in einem weiterhin angespannten wirtschaftlichen Umfeld“. Der Saldo beim Wirtschaftsklima liegt nun bei -58,7 Prozentpunkten (zuvor: -73,6). Bei den Erwartungen fällt die Verbesserung noch deutlicher aus: Der Saldo steigt von -51,9 auf -26,6 Prozentpunkte.
Weitere Stabilisierung erwartet
Von den 757 befragten Unternehmen berichten 38,1 % von einem steigenden Umsatz, während 32,9 % rückläufige Zahlen melden. Daraus ergibt sich ein Saldo von +5,1 – ein erfreulicher Wert, der erstmals seit zwei Jahren im positiven Bereich liegt. Die Auftragslage bleibt mit -8,6 weiterhin im Minus, ebenso die Investitionen mit einem Saldo von -13,9. Besonders deutlich ist der Anstieg beim Preisniveau mit einem Saldo von +25,5. Die Beschäftigungslage liegt aktuell bei -3,4 Prozentpunkten. Für die kommenden Monate erwarten viele Betriebe eine Stabilisierung. Die Herausforderungen bleiben konstant: 74,9 % der Befragten nennen hohe Arbeitskosten. Dahinter folgen Bürokratie (56,3 %), hohe Energiepreise (49,7 %) sowie Steuer- und Abgabenlast (46,8 %).
Große Unterschiede je nach Region Regional betrachtet zeigen sich erste positive Impulse: Besonders in der Süd- und Weststeiermark verbessert sich das Wirtschaftsklima deutlich – von einem bisherigen Saldo von -79,3 auf -14,1. Auch in der Oststeiermark, im Bezirk Murau-Murtal und in Liezen hellt sich die Lage leicht auf. Im Großraum Graz (-42,6) und der Hochsteiermark (-34,9) bleibt das Stimmungsbild dagegen gedrückt. Die hohe Dichte an Industriebetrieben
und die Abhängigkeit von Energie- und Rohstoffmärkten dürften hier eine Rolle spielen. Unterschiede ergeben sich auch hinsichtlich Betriebsgröße. Ein-Personen-Unternehmen (EPU) verzeichnen mit +14,3 Prozentpunkten beim Umsatz und +23,2 bei den Erwartungen eine besonders starke Erholung. Das zeigt, dass kleinere, flexible Strukturen aktuell besser durch die Krise navigieren können. Klein- und Mittelbetriebe melden leichte Zugewinne, bleiben beim Ausblick aber verhalten. Großunternehmen melden beim bisherigen Umsatz einen hohen Positivsaldo von +29,4, zeigen sich aber in der Einschätzung der nächsten Monate mit einem Erwartungssaldo von -2,0 noch vorsichtig.
Handeln durch Politik ist gefordert
In Anbetracht der Ergebnisse fordert die WKO gezielte politische Maßnahmen. „Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts muss oberste Priorität haben. Wir brauchen niedrigere Lohnnebenkosten, wettbewerbsfähige Energiepreise und schnellere Genehmigungsverfahren“, so Herk und Dernoscheg. Eine von der WKO gemeinsam mit der Industriellenvereinigung und der Universität Graz entwickelte Handlungsanleitung zur Beschleunigung von Genehmigungsprozessen liegt bereits vor. Ziel ist es, Investitionen rascher umzusetzen und Planungssicherheit für Unternehmen zu schaffen.
Zu den zentralen wirtschaftspolitischen Forderungen gehören Deregulierung, Senkung der Energiepreise und Leistungsanreize. Zusätzlich betont die WKO die Wichtigkeit von Ausbildungsinitiativen und Fachkräfteförderung, um langfristig die Personalengpässe zu entschärfen. Auch die Unterstützung bei Digitalisierung und ökologischer Transformation müsse intensiviert werden, um die Standortqualität der Steiermark nachhaltig zu sichern.

Mit der Auszeichnung „Top 30 unter 30“ ehrten die WKO Steiermark und die „Steirische Wirtschaft“ heuer erneut die vielversprechendsten Jungunternehmer des Landes. Eine Expertenjury wählte die Sieger unter über 100 Nominierten. Die Verleihung fand im Erzherzog-Johann-Zimmer der WKO Steiermark statt. Präs. Josef Herk und Chefredakteur Mario Lugger überreichten die Auszeichnungen an die jungen Leistungsträger, die aus unterschiedlichsten Branchen stammen – vom Hightech-Start-up bis zum traditionellen Handwerk. „Mit so viel Innovationskraft und Einsatz ist uns um die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Steiermark nicht bange“, so Herk. Die geehrten Jungunternehmer stehen exemplarisch für Engagement, Kreativität und Unternehmergeist.

Römerweinstraße prämiert Top-Winzer
Am 14. Juni 2025 wurden im Rahmen des „Wine Weekends“ im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf die besten Weine der Oststeirischen Römerweinstraße prämiert. Eine hochkarätige Jury – u. a. mit Weinbaudirektor Martin Palz, Master of Wine Maximilian Glatz und Weinkönigin Magdalena Niederl – bewertete 59 Finalweine in zwölf Kategorien. Besonders hervorgehoben wurde der „Urbanus“, der Signature-Wein der Region. Veranstaltet wurde der Event vom Weinbauverein Bad Waltersdorf und der Römerweinstraße, begleitet von regionaler Kulinarik und Musik. „Unsere Winzer und Winzerinnen stehen für Qualität und Leidenschaft sowie die beeindruckende Vielfalt, die sie Jahr für Jahr hervorbringen – das schmeckt man in jedem Glas“, so Obmann Andreas Posch.

Seit Juni 2025 verbindet die türkische Pegasus Airlines dreimal wöchentlich Graz mit Istanbul-Sabiha Gökçen, dem zweitgrößten Flughafen der Türkei. Geflogen wird jeweils dienstags, freitags und sonntags. Die Flugzeit beträgt rund 2 Stunden 15 Minuten. Von Istanbul aus bietet Pegasus weitere Anschlüsse zu über 150 Destinationen in 54 Ländern, darunter Bodrum, Dubai oder Amman. „Die Direktverbindung zwischen Graz und Istanbul bringt mehr Auswahl für Reisende und macht unsere Stadt international noch sichtbarer“, betont Stadtrat Manfred Eber. Auch Wolfgang Grimus, GF des Graz Airport, sieht großes Potenzial: „Eine attraktive Ergänzung zu den bestehenden Linienflügen und ein starker Impuls für neue Märkte.“

Cordula Schlamadinger (Kinderdrehscheibe), AK-Präs. Josef Pesserl und AKFrauenreferatsleiterin Bernadette Pöcheim (v. l.) präsentierten den 12. AKKinderbetreuungsatlas.
Die Arbeiterkammer Steiermark hat ihren 12. Kinderbetreuungsatlas veröffentlicht und zeigt damit Stärken und Schwächen der Kinderbetreuung im Bundesland auf. Zwar gibt es punktuelle Verbesserungen, jedoch auch klare Rückschritte.
I
nsgesamt erfüllen 154 der 285 steirischen Gemeinden die Anforderungen der „Kategorie A“ – das sind drei mehr als im Vorjahr. Diese Kategorie setzt voraus, dass eine Kinderkrippe für unter Dreijährige, ein Ganztageskindergarten und eine Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder vorhanden sind. Dennoch ist die Zahl der Gemeinden, die dem Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf (VIF) entsprechen, leicht zurückgegangen: Nur 72 Gemeinden bieten Betreuungszeiten, die beiden Elternteilen eine Vollzeitbeschäftigung ermöglichen –eine weniger als im Vorjahr.
Mehr Mittel für Ausbau und Betrieb Positiv hervorzuheben ist, dass alle Gemeinden in der Steiermark über eine Betreuungseinrichtung für Kinder zwischen drei und sechs Jahren verfügen. Zudem stieg die Zahl der Gemeinden mit Kinderkrippen von 177 auf 182. Einen negati-
ven Trend gibt es hingegen bei den Tageseltern: Ihre Zahl sank steiermarkweit von 437 auf 433.
Ein bedeutender Fortschritt ist die Reduktion der Gruppengröße in Kindergärten auf 22 Kinder ab dem Betreuungsjahr 2025/26. Dennoch bleibt der Personalmangel eine große Herausforderung. Die AK fordert daher mehr finanzielle Mittel für den Ausbau und Betrieb von Betreuungseinrichtungen sowie mehr Ausbildungsplätze für pädagogisches Fachpersonal. AK-Präsident Josef Pesserl drängt auf einen verbindlichen Masterplan für die Kinderbetreuung mit konkreten Zielen: von einer umfassenden Bedarfserhebung über einen Rechtsanspruch auf kostenfreie Betreuung bis hin zu besseren Arbeitsbedingungen für das Betreuungspersonal. Alle Gemeindeergebnisse sind unter kinderbetreuungsatlas.akstmk.at abrufbar.

Johann Reisenhofer, WKO-Spartenobmann Gewerbe & Handwerk
Die Lehrstellen in Handwerk und Gewerbe bleiben schwierig zu besetzen. Was muss sich ändern, damit die Betriebe bessere Karten im Kampf um die hellsten jungen Köpfe in die Hand bekommen?
Fangen wir damit an, was sich nicht ändern darf: Die Lehrlingsförderung muss aufrechtbleiben! Sie ist für die Unternehmen essenziell, damit sie weiterhin erstklassige Ausbildungsplätze anbieten können. Natürlich brauchen wir auch flexiblere Arbeitszeitmodelle – Stichwort Viertagewoche –, um die Attraktivität der Lehre zu steigern.
Wie sehr bremst aus Ihrer Sicht die zunehmende Bürokratie den unternehmerischen Alltag in Gewerbe und Handwerk?
Die Behördenverfahren dauern generell viel zu lang! Das dämpft die Investitionsfreudigkeit, und das wirkt sich negativ aus. Wir brauchen aber auch mehr Entscheidungsfreudigkeit in den Behörden. Auch die Dienst-nach-Vorschrift-Mentalität schwächt den Standort.
Welche strukturellen und konjunkturellen Herausforderungen belasten das Bau- und Baunebengewerbe derzeit am stärksten? Wir haben nach wie vor ein Finanzierungsproblem: Geld ist nun einmal der Treibstoff der Wirtschaft, ohne den der Konjunkturmotor nicht anspringen kann. Wir brauchen dringend eine Lockerung der Regeln – sowohl bei den privaten als auch bei den Gewerbefinanzierungen. Was hilft der Wegfall der KIM-Verordnung, wenn die Banken so weitermachen müssen wie bisher?
Von Peter Sichrovsky

Jedem Menschen steht eine Meinung zu. Ihm diese abzusprechen, bedeutet, ihm einen Teil seiner Freiheit zu nehmen, ihn in Unfreiheit zurückzulassen. Jedem Menschen steht es auch zu, sich über Tatsachen zu informieren, die seine Meinung beeinflussen könnten. Es ist auch der umgekehrte Weg möglich. Die Suche nach Tatsachen, bevor man sich eine Meinung bildet. Ich hatte das Glück, dieses Jahr eine Pressekarte für Wimbledon zu bekommen. Als begeisterter Tennisspieler ist Wimbledon für mich natürlich das Mekka des Tennissports und ein unvergessenes Erlebnis. Ich möchte hier nicht über sportliche Ergebnisse schreiben. Bei Erscheinen des Heftes ist Sieg und Niederlage bereits Geschichte. Es geht um ein anderes Erlebnis, eine Pressekonferenz und ein Interview, als ein Spieler und eine Spielerin plötzlich aus der nüchternen Rationalität der sich wiederholenden Fragen und Antworten ausbrachen und persönlich über sich selbst sprachen. Einer der Spieler, der sich nach einem Sieg der Presse stellte, gab erstaunliche Einblicke in das Verhalten der Spieler. Bei den
Über die Einsamkeit im Tennissport
Fragen und Antworten nach einem Sieg im sogenannten Media-Center erklärte er zuerst, warum er diesmal besser war als sein Gegner, sprach über seine Vorhand, seine Rückhand und seinen Aufschlag. Die Fragen konzentrierten sich auf seine Spieltechnik, und er beantwortete sie ruhig, eher gleichgültig, als würden die Fragen ihn langweilen.
Als ein Reporter fragte, ob er sich jedes Mal auf die gleiche Art und Weise auf ein Spiel vorbereite, sagte er plötzlich lachend: »Sie haben keine Ahnung, wie abergläubisch Tennisspieler sind, wenn das Geringste von der Routine abweicht, wird man schon nervös, ob das ein schlechtes Omen sein könnte.« Er überraschte uns. Wir hatten eine technische Antwort erwartet, über Aufwärmen, Griffhaltung, Beinstellung, vielleicht die unterschiedliche Bespannung der Schläger und andere spezifische Einzelheiten der Vorbereitung.
»Die meisten von uns, und auch ich, glauben an die notwendige Wiederholung von Einzelheiten des Alltags«, sagte er, »wir sind in keiner Mannschaft, wir sind alleine und mit all den Trainern sind wir dennoch auf uns selbst angewiesen, jede Handlung, jedes Verhalten im Alltag sollte von der Routine nicht abweichen. Ich esse und trinke dann jeden Tag das Gleiche, immer zur gleichen Zeit, gehe zur gleichen Zeit schlafen, trage die gleiche Kleidung, bis zu Socken und Unterhosen. Würde mir mein Trainer für die Ausrüstung kurz vor dem nächsten Spiel das falsche Stirnband vorbereiten – wobei es genau das gleiche wäre, jedoch eben nicht dasselbe, gewaschen und gebügelt –, ich würde es nicht tragen. Es muss sich alles wiederholen. Wir haben fast Angst vor einem Abweichen, als ob ein anderer Salat unsere Siegeschancen verhindern würde, wir sind Einzelgänger und müssen diese Wiederholungen auch selbst kontrollieren.« Er lachte beim Reden, als ob er selbst nicht glauben würde. Beim Training über er vor allem Schläge, mit denen er beim letzten Spiel dem Gegner überlegen war. Es gehe um die Perfektionierung des Funktionierenden. Diese Wiederholungen während der Tage und Stunden vor dem Spiel würden ihm
die Sicherheit und Ruhe für das Spiel geben. Ich erinnerte mich an Nadal, der vor jedem Aufschlag an seinen Haaren zupfte, zuerst links, dann rechts, immer wieder die gleichen Bewegungen. Auch andere Spieler und Spielerinnen pflegen Rituale, die sie ständig wiederholen.Eine Kollegin des Spielers, ebenfalls sehr erfolgreich, sprach über ein anderes, sehr persönliches, doch ähnliches Thema. Es ging um die Einsamkeit der Tennisspieler und -spielerinnen. Sie hätten zwar ihr Team, man spreche auch über Persönliches, oft gehe es um Spaß und Herumblödeln, doch es seien eben bezahlte Mitarbeiter, Angestellte, die jederzeit ausgewechselt werden könnten und keine Freunde oder Freundinnen, die einem unabhängig zur Seite stehen. Das ganze Jahr sei man unterwegs, mit nur wenigen Pausen, von einem Hotel zum nächsten. Es gäbe zahlreiche Kollegen und Kolleginnen im Tenniszirkus, die unter qualvollen Depressionen leiden würden. Da könne auch all das Geld der Topspielerinnen und -Spieler nicht helfen. Tennis ist kein Mannschaftssport, es sind einsame Heldinnen und Helden, oft verehrt und bewundert, doch ist das Spiel vorbei, egal ob man gewonnen oder verloren hat, kommt der Zeitpunkt, an dem man alleine im Hotelzimmer sitzt – oft tage- und wochenlang. Deshalb würden viele Spieler mit ihren Familien reisen, Eltern, Geschwister und Ehepartner. Tennis ist wahrscheinlich der einsamste Sport aller Sportarten. n
Sie erreichen den Autor unter peter.sichrovsky@wmedia.at
Es war am 10. Juni dieses Jahres. Ein Anruf aus dem Ausland mit der Frage, ob ich wüsste, was da genau geschehen sei, hat angekündigt, dass Graz ab diesem Datum nicht mehr dieselbe Stadt sein wird. Fassungslosigkeit. Sprachlosigkeit, Trauer und Schmerz beherrschten danach den öffentlichen Raum. Fast jeder kannte jemanden, der direkt betroffen und verletzt an nichts anderes mehr denken konnte. Ich werde die Schülerin, die verzweifelt und weinend vor der Kerze, die sie für ihre Mitschülerin entzündet hatte, nie vergessen. Vergeblich versuchten ihre Freundinnen sie aufzurichten. Untröstlich. Untröstlich war nicht nur sie, sondern alle, die am Grazer Hauptplatz zusammengekommen waren und sich in den Armen lagen. Wie diese Jugendlichen ihre Trauer zum Ausdruck bringen konnten, verwunderte mich. Ich hatte in meinem Leben noch nie so viele weinende Menschen gesehen. Die Hilfe, die sie einander boten, war berührend und zeigte mir, wie sie sich im Schmerz vor dem Zusammenbruch schützten.
Am Ende
Wenn jemand seinem Leben ein Ende macht, was geht ihm durch den Kopf? Welche Gedanken und Gefühle? Wann erkalten Gefühle und schlagen sie in Hass um? Was hat sich dann in einem Menschen jahrelang so mächtig aufgestaut an Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung, dass sie in tödlicher Gewalt ausbrechen? Alle jene, die so einen Menschen kannten und verloren haben, hinterlässt er zutiefst bedrückt und verzweifelt. Fragen ohne Antwort rauben den Schlaf. Wenn so eine grausame Tat auch noch davor geliebte Menschen mit in den Tod reißt, dann steigert sich dieses Gefühl der Ohnmacht und Fassungslosigkeit ins Unermessliche und Unerträgliche. Dass die Ereignisse so viele Grazerinnen und Grazer zutiefst ergriffen hat, in vielen Gesprächen nach Worten und Erklärungen gesucht wurde, bei denen immer wieder unterdrückte Tränen die Augen füllten, überschattete die Stadt. Am liebsten würde auch ich vergessen. Doch jedes Mal, wenn ich über den Hauptplatz gehe, taucht das Bild wieder auf, von diesem Mädchen, von denen, die helfen wollten, und all den anderen, die gegen ihre Tränen ankämpften. Manchmal sind es die schmerzvollsten Momente, die unvermittelt in ein Leben einbrechen. Würde es helfen, wenn man erkennt, was zu dieser Wahnsinnstat geführt hat? Wie können wir mit diesen Bildern und ihrer Dramatik leben und uns damit auseinander setzen? Müssen wir uns damit überhaupt auseinandersetzen? Wenn nach dem Verlust eines geliebten Menschen oder einer Trennung ein Mensch glaubt, alles zu verlieren, in Panik gerät, »den Kopf verliert« und »rot sieht«, nur noch alles zerstören will – zeigt diese Tat dann nicht den Verlust all dessen, was der Unglückselige verloren hat oder nicht erhalten und erreichen konnte, weswegen er nicht mehr leben will?
Literatur und Lieder
Filme, Literatur und Lieder sind voller Berichte vom Schmerz der Liebe, vom Schrecken des Verlassen werdens, von den Auswirkungen von Krieg und Gewalt, der Kälte und Leere der Einsamkeit. Wenn man genauer wissen möchte, was einen Menschen schließlich Amok laufen lässt, könnte man auch im Buch »Amok« des amerikanischen Schriftstellers Stephan King nachlesen. Wie es Kindern, Jugendlichen in der Schule oder in Heimen gehen kann, erfährt der Leser in Friedrich Torbergs Roman »Schüler Gerber«. Wie es Thomas Bernhard in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte in der Schule ergangen ist, auch das ist in seinem Buch »Ein Kind« ausführlich beschrieben und zu lesen. Peter Handkes Beschreibungen seiner Erlebnisse im Internat und mit den Schulgegenständen geben Einblick in das, was einem einsamen Schüler durch den Kopf geht und wie fremd ihm der Stoff bleibt.
Unser Essayist Christian Wabl mit dem Versuch, das furchtbare Verbrechen an einer Grazer Schule, das uns alle erschüttert hat, aufzuarbeiten.

Christian Wabl, geboren 1948 in Graz, Studium der Kunst und Lehramt Deutsch an der Universität von Amsterdam sowie Studien in den Sprachwissenschaften, Hebräisch und Philosophie. Er ist Mitbegründer mehrerer Alternativschulen und arbeitete lange bildungspolitisch in der Grünen Akademie Steiermark.
Viele wollen die Zeitung gar nicht mehr lesen, weil ihnen täglich die Schilderung schlimmer Schicksal in ihrer Nähe entgegen schlägt.
Doch nicht nur Jugendliche drehen durch und sehen rot. Auch aus Beziehungen brechen Menschen aus und trennen sich plötzlich. Die Verlassenen rächen sich scheinbar eiskalt an denen, die sie für ihr Unglück verantwortlich machen, etwa wenn ihnen ein Besuchsverbot auferlegt wird. Manchmal zerstören sie dabei sogar ihre eigene Familie und sich selbst. Ganze Völker wollten in der Geschichte lieber sterben als sich unterwerfen und opferten ihr Leben. Die Herkunft des Wortes »Amok«, das dann zum Kriegsgeschrei wurde, verweist auf diese Tatsache. Was hilft, mit dramatischen Situationen fertig zu werden, nicht zu verzweifeln und unterzugehen?
In den vielen Gesprächen, in denen der 10. Juni und die Tage danach immer wieder Thema waren, erinnerten sich die Menschen oft an ihre eigene Kindheit, Jugend, Zeit in den Schulen, aber auch an den Alltag als Erwachsener danach. Welche Angst sie gehabt haben, wenn sie zur Prüfung antreten mussten und wie sie sich vor der Mathematikschularbeit fürchteten, alle Formeln zu vergessen, oder sich im entscheidenden Augenblick an die einfachsten Dinge nicht mehr erinnern zu können. Wie schlimm sie es überhaupt und immer wieder fanden, wenn sie einfach nicht und nicht verstehen, und sie dem Unterricht nicht folgen konnten, und sich selbst für sträflich dumm hielten. Waren es Mütter oder Väter, berichteten sie oft vom Gefühl der Ohnmacht und dem Verlust der Nerven, wenn sie ihren Kindern die Hausaufgaben nicht mehr erklären konnten oder den Nachhilfeunterricht nicht mehr bezahlen konnten. Diese Geschichten wurden häufig als Anekdoten erzählt und manchmal humorvoll als kleine Heldengeschichten verpackt. Doch immer wieder gingen sie über in Erzählungen von Verzweiflung und Überforderung, wenn die Arbeit nicht mehr zu bewältigen war, und der Wunsch, mehr für die Kinder da zu sein, nicht mehr mit den eigenen Möglichkeiten vereinbar war. Oft endete und gipfelte das Ganze in Geschichten von unheilbaren Krankheiten und Tod, über die man am liebsten überhaupt nicht mehr reden wollte und verstummte. Unvermeidlich folgte die Zuweisung von Verantwortung und Schuld, meist an »die anderen«, an Politiker und »das System«. Der Glaube an eine bessere Gesellschaft ist bei vielen verloren gegangen. Stattdessen hat sich eine resignierte Stimmung und eine fatalistische Haltung breitgemacht. Selbst bei denen, die einst an eine grundlegende Veränderung glaubten und dafür als naive Träumer abgestempelt wurden.
Wenn dann ein Ereignis wie das vom 10. Juni in den Alltag einbricht, dann wird ersichtlich, wie groß die allgemeinen Ängste und Befürchtungen sind, dass überhaupt alles nicht mehr so weiter geht, weiter gehen kann und überhaupt alles zusammenbricht. Viele wollen die Zeitung gar nicht mehr lesen, weil ihnen täglich die Schilderung schlimmer Schicksal in ihrer Nähe entgegen schlägt. Der Ausbruch von Gewalt, von einzelnen oder ganzen Heerscharen ausgeübt, schwebt über den Ländern in unterschiedlicher Form und Ausmaß, die alle als Bedrohung empfinden. Immer wieder bemerkt jemand, dass wir doch alle zusammen halten, dass wir aufmerksamer für den und die Nächste sein müssten, dass die ganze Gesellschaft ganz anders organisiert sein müsste, grundsätzlich andere Regeln gelten müssten, um das Leben gerechter, weniger gestresst und weniger einsam gestalten zu können. In meiner Schulzeit stellte ich mir diese Fragen. Es war eine Zeit, in der die Welt in einem hoffnungsvollen Aufbruch war, und Studenten sowie Schüler von einer gerechten Welt träumten und daran glaubten, dass eine solche möglich sei. Wir wussten nichts von den wirtschaftlichen und finanzpolitischen Mächten, wussten auch nichts davon unter welchem Druck unsere Eltern standen, wie mühsam sie sich anstrengten, den Alltag zu bewältigen und machten ihnen die größten Vorwürfe, was nur dazu führte, dass sie ihre Lebensweise verteidigten. Warum hatten sie keine Zeit, uns Fragen zu beantworten und uns nicht einmal die eine zu stellen: Wie geht es dir? Und ruhig und geduldig hätten sie sich unsere Antworten anhören können. Oder fragen können: Was macht dir Angst? Bist du unglücklich? Wovon träumst du, und was können wir tun, um deine Träume zu verwirklichen? Wir wussten damals nicht, dass ihre Parole »Durchhalten. Nicht aufgeben!« war, eine Parole, die sie aus dem schrecklichsten Krieg der Menschheit mitgebracht hatten. Viele Lehrer hatten vergessen, wie ängstlich Kinder sein können und dass sie sich meistens nicht wehren können. Wenn auch heute ein Schulkind die Erwartungen nicht erfüllen kann, sitzen bleibt, nicht mitkommt, ergeht es ihm möglicherweise ähnlich.
Gibt es eine Lösung, eine Erlösung?
Während ich an diesem Essay schreibe, erinnere ich mich an ein Aufsatzthema in der Religionsstunde, das lautete: »Worauf können wir hoffen? Gibt es eine Lösung, eine Erlösung?« Ich erinnere mich nicht mehr genau, was ich damals geschrieben habe, aber ich weiß noch, dass mir die Rede des Religionslehrers, die große Lehre von der Liebe und der Notwendigkeit des Verzeihens als ein möglicher Ausweg aus den großen und kleinen Kriegen erschienen ist. Und auch heute sehe ich darin noch die Rettung, um den alltäglichen und den großen Krieg zu beenden. Schon damals habe ich mich gefragt, warum so wenige ihr Leben danach ausrichten. Und kam schließlich zu dem Schluss, dass viele, allzu viele, zu sehr verletzt sind, als dass sie die Schritte setzen und die Worte sagen können, derer es bedarf, um mit den anderen friedlich weiter leben zu können. Wir sind ein christlich geprägtes Land und die Grundsätze mussten wir in der Schule auswendig lernen, aber wie sind sie mit den alltäglichen Erfahrungen zu verbinden und anzuwenden? In diesen teilweise sehr erregten und emotionalen Gesprächen kam das immer wieder vor, dass Abneigung und Hass den Ton angaben, da erhob einmal ein Teilnehmer erregt seine Stimme und sagte: »Liebet Eure Feinde und tut Gutes jenen, die Euch hassen!«. Darauf herrschte eine seltsame Stille und niemand wusste, wie darauf zu reagieren. Keiner wollte diesen Vorschlag durch eine abfällige Bemerkung in Grund und Boden stampfen. »Wir leben ja eigentlich in einem christlichen Land« sagte eine Frau etwas kleinlaut. Dann erzählte einer, dass er einen einen Flüchtling kenne, der von Abschiebung bedroht, nicht mehr leben will, wie ohnmächtig er sich fühle, weil er nicht helfen kann. Nach den ersten Tagen danach, begann die Zeit der Suche nach Erklärungen und des Diskutierens von Maßnahmen, damit so etwas nie mehr geschehen könne.
Abschließend eine Nachricht
Wochen später schrieb mir ein Teilnehmer dieser Gespräche aus einem fernen Urlaubsland und ich möchte diese Zeilen an den Schluss dieses Textes stellen: Ich glaube, als Kind sollte man die Möglichkeit haben, all seine Gefühle »rauszulassen«, die vermeintlich guten wie auch die vermeintlich schlechten. Welche davon von den Eltern und allgemein akzeptiert werden, prägt das ganze Leben. Ich habe gelernt, dass man fürs »richtige Verhalten« belohnt wird. Fürs Schlimmsein wird man bestraft. Doch was ist, wenn »Schlimmsein« einfach eine schlechte Note ist? Was bedeutet »brav« oder »schlimm« überhaupt? Es hängt immer von der Gesellschaft, vom Zeitgeist ab. Als Kind ist man ausgeliefert, der Bewertung von Eltern, Lehrern, Mitschülern und der Norm. Ein Kind, das seine Gefühle unter Androhung verneinen muss, hat es später schwer. Auch als Jugendlicher und auch als Erwachsener. Manche explodieren: in Wut, in Gewalt, im Amok. Andere implodieren: still, leise, im Rückzug und Selbstaufgabe. Doch in den meisten Fällen geschieht etwas anderes: Die Gefühle bleiben verborgen und unterdrückt, verschwinden aber nicht. Statt Lebendigkeit zeigt sich mehr und mehr Kälte. Eine Kälte, die heute »normal« scheint. »So ist das eben«, sagt man.
Ich erkenne diesen stummen Schrei nach Liebe, nach einem »Hilf mir!« Ich kenne ihn aus meiner Kindheit. Und die Hoffnung, die sich verflüchtigt, bis man glaubt, Nähe gäbe es nicht mal in der Familie. Dann, im tragischsten Fall, bleibt nur noch Raserei und Kälte. Bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist Schluss! Mit euch, mit mir. Die Macht, traurig zu sein, hasserfüllt – und trotzdem geliebt. Und jetzt? Jetzt ist es zu spät! Ich will nicht mehr geliebt werden – nur noch gefürchtet!
Eine Erinnerung aus der Vergangenheit: Erste Klasse Volksschule; Schulschluss - ich komme nach Hause. Es ist niemand hier: der zuhört! Mich versteht! Einen menschlichen Tipp gibt. Nur ein paar wärmende Worte findet. Ich bin ein Kind. Schenke mir nur eine Minute deiner Zeit und nimm mich in deinen Arm. Das … könnte mein Leben retten! Ich hatte Glück. Ich war oft im Wald. Ich habe Schönheit erlebt:den warmen Sommerwind auf meiner Haut gespürt. Den bezaubernden Schmetterling beobachtet. Auch Fische gejagt, Wespen verflucht und mir zig mal die Hände am scharfen Felsen aufgeschürft. Die Natur hat mir gezeigt, dass es nie nur eine Seite gibt. Das hat mir immer wieder Hoffnung gemacht und Lebensfreude geschenkt - wie auch all die Menschen, die sich mit mir verbunden fühlten. n
Wir sind ein christlich geprägtes Land und die Grundsätze mussten wir in der Schule auswendig lernen, aber wie sind sie mit den alltäglichen Erfahrungen zu verbinden und anzuwenden?

Sandra Pioro wurde am 15. April 1968 in Stuttgart in eine jüdische Familie als jüngstes von drei Geschwistern hineingeboren. Mutter Ingeborg musste die Kinder bald allein großziehen, nachdem Vater Samuel, dessen Beruf ein Geheimnis war, früh die Familie verließ. Nach der Matura im Musikgymnasium Nagold im Schwarzwald absolvierte sie das vormalige Konservatorium der Stadt Wien, jetzt »Muk«, und wurde Schauspielerin, zuletzt in Graz und betrieb hier auch ein Modelabel. Heute ist sie in leitender Stellung bei den »Roten Nasen« tätig. Soeben ist im Keiper-Verlag ihr Romandebüt »Nie mehr still. Die Reise zu mir selbst. Eine jüdische Geschichte.« erschienen.
Fazitbegegnung
Volker Schögler trifft auf Sandra Pioro
Sandra Pioro hat sich auf eine Reise zu sich selbst begeben. Aus dieser Reise wurde nach 22 Monaten der Schreibarbeit und Selbstreflexion ein Buch. Auf Tauchgängen in die Tiefen ihrer Seele und ihrer Träume, aber auch physisch auf den Spuren ihrer Vorfahren im In- und Ausland sowie in internationalen Suchdiensten und Archiven gegen das Vergessen entstand: »Nie mehr still« mit dem Untertitel: »Die Reise zu mir selbst. Eine jüdische Geschichte.« Es ist eine Aufarbeitung der Traumata der sogenannten Kriegsenkel, jener Generation, die den Krieg, den Nationalsozialismus, den Holocaust, die Angst und das Grauen nicht selbst erlebt hat. Die aber unter diffusen Symptomen, vor allem Ängsten leidet, deren Ausgang die neurowissenschaftliche Forschung in der Epigenetik, der generationsübergreifenden Vererbung von Traumata, verortet – was sowohl für die Täter- wie auch die Opferseite gilt. Auch das bleierne Schweigen über jene Zeit betrifft beide Seiten, wenn auch oft in unterschiedlicher Ausformung und weil Verfolgung zumindest im Sinne von Ausgrenzung in Gestalt von Antisemitismus noch immer stattfindet. Wie auch die Angst davor. Diese Erfahrung musste die Autorin bei einigen Buchhandlungen machen, die das Buch zwar loben, sich aber nicht getrauen, weitergehende Promotion zu machen. Erschütternd ist auch ihre Schilderung im Buch, wie die Auslagenscheiben ihres Ateliers in einem durchwegs vornehmen Grazer Stadtviertel mit Hakenkreuzen beschmiert wurden und ein zufällig vorbeikommendes Ehepaar spontan die Reinigungsarbeit übernommen hat.
In ihrem schonungslos autobiographischen Roman erkennt Sandra Pioro, dass sie ihre Vergangenheit beleuchten und jene Fragen stellen muss, die in ihrer Familie bislang vermieden wurden. So begibt sie sich auf Spurensuche, um die vielen offenen Fragen nach ihrem Vater zu klären, der als Jugendlicher mehrere Konzentrationslager überlebt hat und 1991 spurlos verschwunden ist. Die Begegnung mit ihrer
jüdischen Geschichte und den Traumata ihrer Eltern und Großeltern lässt sie ihre Identität finden: als Tochter eines Auschwitz-Überlebenden, als Künstlerin und als jüdische Frau. Der Abgrund des familiären Schweigens über die Vergangenheit seit ihrer Kindheit in Stuttgart formte auch sie selbst zu einer schweigenden Person, zumal wenn sie sich mit Antisemitismus konfrontiert sah.
Sich niemandem anzuvertrauen verstärkte ihr Gefühl, weniger wert und nicht erwünscht zu sein. In ihrem Buch trifft Sandra Pioro einen zugleich stimmungsvollen wie spannenden Ton, der auf erschreckend schlüssige Weise vergangene und gegenwärtige Sachverhalte und Tatbestände widerspiegelt. Fantasiegebäude, unglaubliche Träume und merkwürdige Zufälle scheinen nur solange zweifelhaft, bis sie selbst schreibt: »Würde ich eine fiktive Geschichte schreiben, hätte ich es anders gestrickt, denn das käme mir zu glatt vor, um es glaubwürdig wirken zu lassen. Das Leben hat offensichtlich seine eigenen Gesetze und schreibt sich seinen eigenen Roman.«
Sandra Pioro ist Absolventin des ehemaligen Konservatoriums der Stadt Wien (musikalisches Unterhaltungstheater, Gesang, Musical), debütierte im Wiener »Ronacher«, war zuletzt bis zum Jahr 2000 Ensemblemitglied bei den Vereinigten Bühnen Graz und betrieb anschließend ein eigenes Modelabel.
Heute ist sie bei den »Roten Nasen« Leiterin des Coaching-Teams und der Abteilung Kostüm und Ausstattung. Mit der Veröffentlichung der eigenen Geschichte hat sie das Schweigen durch das Wort ersetzt, »um letztendlich diejenige zu sein, die ich eigentlich geworden wäre.« Was nach dem Buch für sie anders sei? »Ich war früher die Suchende und habe jetzt diese Lücke in meiner Geschichte geschlossen, nun habe ich so eine Ruhe gekriegt, eine Art innere Stärke und Selbstbewußtsein.« Das darf auch für die Autorin Sandra Pioro gelten, die wunderbar mit der geschriebenen Sprache umzugehen versteht, was eine Fortsetzung geradezu einfordert. n
Carola Payer im Gespräch mit Werkmeister und Messerschleifer Ferdinand Gotthardt

Dr. Carola Payer betreibt in Graz die »Payer und Partner Coaching Company«. Sie ist Businesscoach, Unternehmensberaterin und Autorin. payerundpartner.at
enn Ferdinand Gotthardt über die Kunst des Schleifens spricht, dann klingt das nicht nach einem Hobby, es klingt nach Philosophie, Präzision, Leidenschaft und ein wenig nach Rebellion gegen die gängige Vorstellung vom Altern. Denn während sich andere mit Sudoku und Seniorentanz den Lebensabend versüßen, dreht Gotthardt in Laßnitzhöhe Schleifscheiben, formt Stahl und gründet sein Unternehmen »Ferdl & Jan’s Messerschleiferei«. Mit 75 Jahren wohlgemerkt. Heute ist er 78 Jahre alt und vermutlich der älteste Jungunternehmer der Steiermark. Sein Weg dorthin? Alles andere als geplant!
Vom Werkmeister zum Schleifjunkie
Ferdinand Gotthardt war Werkmeister im Maschinenbau, spezialisiert auf Zerspanungstechnik. Ein Beruf, der ein gutes Auge, technisches Verständnis und eine ruhige Hand verlangt. Drei Eigenschaften, die auch seine zweite Karriere prägen sollten. »Ich habe vor drei Jahren zufällig Diamantschleifscheiben entdeckt. Das hat mich sofort fasziniert«, erzählt Gotthardt. Aus Neugier wurde Interesse, aus Interesse Leidenschaft und aus Leidenschaft wurde plötzlich ein Gewerbe. Erst ein Messer, dann ein weiteres, schließlich kamen die Kunden, per Mundpropaganda, über den Bürgermeister und seine Tochter.
Unternehmensgründung mit 75. Warum nicht?
Die Frage, warum jemand mit 75 noch ein Gewerbe gründet, hörte er oft. Seine Antwort: »Weil ich’s kann. Und – weil ich will.« Ein Satz, so einfach wie entwaffnend. Gotthardt lebt das, was vielen in der Businesswelt heute fehlt: den Mut, Neues zu probieren, unabhängig von Konventionen, Alter oder Karrierepfad. »Wenn man mit dem eigenen Hobby Geld verdienen kann und die Liebe zur Metallurgie hat, dann braucht man keinen Motivationskick«, sagt er. Weil die Bürokratie erstaunlich reibungslos mitspielte, war der Weg zum Gewerbeschein ebenso glatt wie seine Messer. Der 78-jährige Steirer Ferdinand Gotthard zeigt vor, wie man von der Werkbank ins Wohnzimmer, vom Ruhestand in die Selbstständigkeit kommt und wie Lebensfreude schärfer sein kann als jedes seiner Messer.
Familie als Rückgrat. Und Businesspartner Dabei ist Gotthardt keineswegs ein einsamer Tüftler in der Werkstatt. Seine Enkel sind fixer Bestandteil des Unternehmens: Der eine kümmert sich ums Büro, der andere übernimmt die »steuerlichen Dinge«. So wurde aus einem privaten Schleif-
»Ich mach das Technische, die Jungen das Kaufmännische. Am Ende freut sich der Kunde über ein scharfes Messer.«
FERDINAND GOTTHARDT
projekt ein Dreigenerationenunternehmen, mit Herz, Hirn und Hand. »Ich mach das Technische, die Jungen das Kaufmännische«, sagt er und lacht. »Am Ende freut sich der Kunde über ein scharfes Messer.«
Business mit Grat. Iim wahrsten Sinne
Der Teufel steckt beim Schleifen im Detail. Genauer gesagt im Grat. Wer ein Messer nur schärft, aber den Grat nicht richtig entfernt, hat zwar ein glänzendes Ergebnis, aber kein dauerhaft gutes. »Die Kunst liegt im richtigen Entgraten«, sagt Gotthardt. Dafür hat er sich sogar Techniken aus Australien angeeignet, wo ein Wissenschaftler das perfekte Entgraten erforscht hat. Er schleift maschinell, auf Nassschleifmaschinen mit kubischem Bornitrid und Diamantscheiben. Vom Küchenmesser über Friseurscheren bis zu Aufschnittscheiben, kein Stahl ist vor ihm sicher. Und wenn er ein Messer erzeugt, dann blitzt nicht nur die Klinge, sondern auch seine Augen.
Statt Ruhestand lieber Unruhestand
»Der Ruhestand«, so sagt Gotthardt, »ist nicht gleich Stillstand.« Für ihn bedeutet das Alter nicht Rückzug, sondern neue Freiheit. Eine Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich begeistert. Dabei bringt seine Tätigkeit auch gesundheitliche Vorteile: »Durch das Schleifen habe ich meine Feinmotorik wie-

der trainiert«, erklärt er. »Ein echter Antiagingeffekt!« Abends grübelt er oft noch über neue technische Herausforderungen und wenn ihm um vier Uhr früh die Lösung kommt, steht er eben auf und geht in die Werkstatt. Andere nennen das Arbeit, Gotthardt nennt es Erfüllung.
Generationen und Gesellschaft
Natürlich hat er sich anfangs Fragen gefallen lassen müssen: »Warum tust du dir das noch an?« Doch statt Zweifel erntete er bald Bewunderung. Auch wenn nicht jeder bereit ist, 16 Euro für einen Schliff auszugeben. »Die Jugend wirft lieber weg, als zu reparieren«, bemerkt er mit Wehmut. Er hat eine treue Kundschaft, Menschen, die Qualität zu schätzen wissen. Sein Unternehmen ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte in Stahl, sondern ein stiller Protest gegen eine Wegwerfgesellschaft, gegen das Altern als Mangel und für den Wert des Handwerks mit Handschlagqualität. Ferdinand Gotthardt ist kein Einzelfall, er ist Teil eines wachsenden Trends. Laut Daten der Wirtschaftskammer Österreich wagten im Jahr 2023 rund sieben Prozent aller Gründer den Schritt in die Selbstständigkeit im Alter von über 60 Jahren. Das sind knapp 3.000 Menschen, Tendenz steigend. Dabei sind die Gründe vielfältig: Finanzielle Absicherung, der Wunsch nach Sinn, der Drang zur Selbstverwirklichung oder schlicht Langeweile. Doch was sie alle vereint, ist Mut. Der Mut, dem Leben ein weiteres Kapitel hinzuzufügen.
Alter ist eine Option, kein Hindernis
Wer Ferdinand Gotthardt trifft, merkt schnell: Die Lebenslust ist messerscharf. Seine Geschichte zeigt, dass Unternehmertum kein Ablaufdatum kennt. Dass Erfahrung, Leidenschaft und Handwerk auch jenseits der 70 ihre Blütezeit erleben können und dass ein gutes Messer, wie ein erfülltes Leben, mit dem richtigen Schliff lange scharf bleibt. Er beweist, was viele nur vermuten: Man ist nie zu alt zum Gründen. Man ist nur zu jung zum Aufgeben. Wenn Sie das nächste Mal ein stumpfes Küchenmesser in der Hand halten, denken Sie daran: Vielleicht braucht es keinen Neukauf. Sondern einfach nur einen Ferdinand. n
Ferdl und Jan’s Messerschleiferei
Inhaber: Ferdinand Gotthardt
8301 Laßnitzhöhe, Tomscheweg 38 Telefon +43 664 73570357 ferdinand.gotthardt@aon.at
A Rumpler is no long ka politisches Konzept. Es braucht Einfühlungsvermögen, Verständnis und viel Respekt.



Fotos: Andreas Pankarter
Liebe Steirer und Innen! Liebe Freunde, diesmal follt mir die Fazit-Rundschau schwer. Keiner konn nachvollziehen, was a Verlust eines Menschen für an anderen bedeutet, scho gar net, wenn es um Kinder geht. A Freund hot mir amal beim Begräbnis seines verunglückten Buam unter Tränen gsagt: Jetzt waß i, wos da liebe Gott mit Schmerz g’meint hot … ich frog mi nur, wieso er des braucht? Es müsst noch so aner Katastrophe wie in Graz an Klescher machn und die Wölt müsst stillstehn … aber dos Lebn geht unbarmherzig weiter.
Wäre des jetzt net der Moment, wo Politiker, Wirtschaftler, andere Wichtige und vor allem wir nicht nur reden, sondern zum Wohle oller übergreifend, wirklich z‘sammenstehn wie olle Einsatzkräfte am und noch dem 10 Juni in Graz? I was, wie naiv dos is, denn das parteipolitische Hickhack is schon wieder ausbrochn. Was braucht es denn noch an Katastrophen, damit mir unsere meist scho ranzigen Ideologien vagessn und dem Nächsten wirklich amol zuahörn? Das Klimaproblem krieg ma net in Griff, die Wirtschaft lauft folsch, politische Unfähigkeiten weltweit, Terrorismus, Amokläufe. Das schafft gewaltige Ängste und Aggressionen überall und mia hörn uns gegenseitig net zu, es sei denn, ma schreit hülflos auf, aber donn is ma gleich ah Feindbild.
Es werden einige Förderungen dieser Sozialeinrichtungen gstrichen, die sie um ein gesellschoftliches Miteinand, um Integration, um Verhinderung von Vereinsamung und Verwahrlosung grod bei jungen Menschen bemühen. Die gleichen Politiker, die uns vorher die Kulturstrategie 2030 als Errungenschaft gepriesen hobn, streichen jetzt Kulturförderungen kleiner und umso wichtigerer kommunikativer Kultureinrichtungen. Und die großen werden in Ruh
lossen. Die gleichen Politiker, die uns vorher das Leitspital eingeredet hoben, erklärn uns jetzt, dos dos Gegenteil bessa wär, warum?
Aus Angst, Mocht zu verliern, owa aus Angst gstorbn, is a gstorbn?
Die FPÖ-gführte Londesregierung ist demokratisch gewählt und i bin Demokrat. Ich akzeptiere sie, das heißt owa net, dass ich sie nicht kritisiere. Und verstehen kann ich die Sparerei eh, denn net sie sind schuld am Budget-Minus. Aber handeln wir doch aus der Vernunft heraus und nicht ideologisch. Egal wölche Partei, wir sitzen im sölben Boot. Schaun wir doch die Wirklichkeit on und hören wir auf mit diesen kindischen Parteibefindlichkeiten und gegenseitigen Beschuldigungen.
Jeda mocht Fehler, wichtig is, wos wir draus lernen. Vielleicht wär des der große Reichtum, aus dem mir das Beste für unser Land schöpfen können? Das wär doch wos? Denn a Rumpler, wie der Herr Landeshauptmann gsagt hat, a Rumpler is no long ka politisches Konzept; genauso wenig, wia Feindbilder schoffen. Es braucht gegenseitiges Einfühlungsvermögen, Verständnis und vor allem viel Respekt. Herzensbildung eben – des mocht uns und unsere Heimat aus, in der jeder Plotz haben muass, so wia er is, wenn er si an die gemeinsamen Regln holt. Und wos und wia Heimat zu sein hot, konn und darf net parteipolitisch bestimmt wern. Dafür san noch imma einzig und allein unsere Herzen zuständig. Und rechtes Heimatsumpern is Sentimentalität und hot mit ehrlichn Gfühlen nix z’tun.
In diesem Sinne wünsch i uns Mut und kühle Köpf in ana haßen Zeit. Bis zur nächsten FazitRundschau und Aufpassen aufeinand’, weil der Teifl schloft net! Euer Sepp Oberdengler.
Sie möchten Sepp Oberdengler im Radio hören? Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es nach den Kirchenglocken um 12.15 auf Radio Steiermark eine neue Folge. Auch als Podcast. Die aktuelle Programminformation finden Sie auf steiermark.orf.at
Ein geliebter Mensch stirbt. Plötzlich braucht man eine Bestattung. Aber an wen wenden? Die einen versprechen das Blaue vom Himmel, andere werben mit Frieden, Pietät oder Natur. Nur ein Anbieter begleitet die Menschen in Graz seit 130 Jahren respektvoll, professionell und absolut verlässlich:
… bietet Rundum-Service ohne Zusatzkosten
Unsere günstigen Dienstleistungspakete sind fair kalkuliert, wir verrechnen nur, was wirklich vereinbart wurde. Auch den wunderschönen, denkmalgeschützten Jugendstil-Zeremoniensaal und die Aufbahrungshalle in Mariatrost stellen wir unseren Kund:innen ohne Mietkosten zur Verfügung.
… führt die Verstorbenen nicht unnötig herum
Nur die Grazer Bestattung verfügt als einziger Anbieter in Graz über ein eigenes Krematorium. So können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Liebsten nach der Verabschiedung nicht unnötig herum geführt werden, sondern direkt in der Grazer Feuerhalle kremiert werden.
… bringt den Wald auf den Friedhof
Und nicht die Urne in den Wald. Warum? Weil Beisetzungen im Waldbereich am Urnenfriedhof die Natur spürbar machen: Barrierefrei zugänglich, öffentlich und mit eigenem Auto erreichbar. Auch Kerzen können Sie hier selbstverständlich abstellen.
… ist die Nr. 1 für Erd- und Feuerbestattungen in der Steiermark Als langjähriger Partner aller 14 Grazer Friedhöfe arbeiten wir eng und vertrauensvoll mit allen Pfarren und Religionsgemeinschaften zusammen.
Sie denken an Ihre Liebsten. Wir an alles andere.


Raiffeisen legt ersten Sozialbericht vor
Raiffeisen Österreich hat am 18. Juni erstmals einen umfassenden Sozialbericht veröffentlicht. Dieser dokumentiert das gesellschaftliche Engagement der Genossenschaften: Über 5.500 Sportvereine und 4.900 Kulturprojekte werden jährlich unterstützt. Insgesamt investiert Raiffeisen 56 Mio. Euro pro Jahr in Sponsoring, Spenden und regionale Projekte. Laut einer Studie des Economica Instituts sichert dieses Engagement 820 Arbeitsplätze, schafft eine Bruttowertschöpfung von 51,4 Mio. Euro und bringt 21 Mio. Euro an Steuerleistung. „Die Zahlen belegen, das Raiffeisen Steiermark als Leitbetrieb nicht nur Partner der steirischen Wirtschaft ist, sondern auch selbst messbaren wirtschaftlichen Mehrwert leistet“, sagt RLB-Gen-Dir. Martin Schaller.


„One night Exhibition“ im Schloss Kalsdorf Am 14. Juni fand im Schloss Kalsdorf bei Ilz eine besondere „Onenight Exhibition“ zu Ehren des Künstlers Martin Roth statt. Fünf Jahre nach seinem frühen Tod zeigte die Ausstellung „Second Nature“ ein ebenso poetisches wie radikales Werk, das Natur nicht nur thematisiert, sondern zum Medium macht. Roth ließ etwa Gras auf persischen Teppichen wachsen – ein Sinnbild für Vergänglichkeit, Pflege und Koexistenz allen Lebens. Günther Holler-Schuster führte in das Werk ein, das die Galerie Reinisch Contemporary präsentierte. Die Installation „Untitled (Persian Rugs)“ von 2012 wurde als Hommage an einen Künstler gezeigt, der Natur und Kunst als untrennbar verbunden verstand – und ein Vermächtnis der Achtsamkeit hinterließ.
Von 9. bis 13. September 2025 kämpfen zehn Fachkräfte aus der Steiermark bei den EuroSkills im dänischen Herning um Medaillen – und sorgen für ein historisches Novum: Erstmals vertreten mehr Frauen als Männer die Steiermark bei einem internationalen Berufswettbewerb. Sechs junge Steirerinnen sind Teil des 49-köpfigen Nationalteams, das bei den BerufsEuropameisterschaften vor über 100.000 Fans antritt. „Dass erstmals mehr Frauen als Männer unser Bundesland bei den EuroSkills vertreten, ist kein Zufall − es ist ein kraftvolles Signal, dass Talent kein Geschlecht kennt. Unsere steirischen Fachkräfte brennen für ihren Beruf und tragen dieses Feuer nach Europa hinaus“, betont Josef Herk, Präsident von SkillsAustria und der WKO Steiermark.

(v.l.) Freizeit Graz-GF Michael Krainer, Verkehrsplaner Martin Smoliner, LRin
Claudia Holzer, Obmann-Stv. Daniel Berchthaller (WKO Seilbahnen) und Verkehrsverbund-GF Peter Gspaltl.
Die Kooperation zwischen dem Verkehrsverbund Steiermark und den Seilbahnbetreibern bringt die Themen Freizeit, Mobilität und Nachhaltigkeit auf einen gemeinsamen Nenner. Unter dem Motto „Auf der Freizeitschiene durchs Steirerland“ werden S-Bahn, RegioBus und RegioBahn mit 19 Sommerseilbahnen vernetzt – eine starke Initiative für sanften Tourismus und regionale Wertschöpfung.
Die Öffis erschließen viele steirische Ausflugsziele – von Burgen und Thermen bis hin zu Berggipfeln und Seenlandschaften. Besonders in den Sommermonaten punkten die steirischen Seilbahnen mit attraktiven Freizeitangeboten, die ohne Auto erreichbar sind. Ob Familienwanderung, MountainbikeAbenteuer oder Panorama-Ausblick – das Erlebnis beginnt schon bei der Anreise mit Bus und Bahn.
Wachstumsmarkt Sommertourismus
„Der Freizeitverkehr ist neben Schülerund Pendlerverkehr das dritte Standbein des ÖV. Gerade Freizeitnutzer sind offen für neue Wege – hier liegt großes Potenzial“, erklärt Verkehrslandesrätin
Claudia Holzer. Dank gezielter Fahrplanabstimmungen sind viele Talstationen per Öffis erreichbar, inklusive flexib -
ler Ticketlösungen wie dem FreizeitTicket Steiermark oder dem KlimaTicket Steiermark.
Auch die Seilbahnbetreiber zeigen sich zufrieden: „Der Sommertourismus macht mittlerweile bis zu 15 % des Jahresumsatzes aus“, so Daniel Berchthaller, Obmann-Stv. der WKO Seilbahnen Steiermark. Die Kombination mit den Öffis senkt den Parkplatzdruck, verlängert Aufenthaltsdauer und spricht neue Zielgruppen an. Zudem bieten Partnerbahnen wie Planai, Riesneralm oder Bürgeralpe Rabatte für KlimaTicket-Besitzer.
Das Ergebnis: Ein zukunftsweisendes Modell, das nachhaltige Mobilität fördert, touristische Regionen stärkt und den Zugang zur alpinen Natur erleichtert – ohne Stau, Parkplatzsuche oder Umweltbelastung. Infos zu Routen, Tickets und Seilbahnen unter www.verbundlinie.at/seilbahnen.

Ein wirksamer Herkunftsschutz wird nicht nur aus Sicht der Bauern immer wichtiger. Wie kann die Politik nach diversen Tierschutzskandalen das Vertrauen in das AMAGütesiegel wiederherstellen?
Vertrauen entsteht durch Transparenz und Konsequenz. Wer auf das AMA-Gütesiegel achtet, bekommt 100 Prozent Qualität aus Österreich – und damit Fleisch, das unter höchsten Standards produziert wurde. Natürlich müssen auch die Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt auf Qualität aus Österreich achten.
Wie treibt die Steiermark die Klimaanpassung voran und wie will das Land den Hochwasserschutz finanzieren?
Klimaanpassung passiert jetzt. Wir setzen dabei auf Vorsorge und Investitionen. Dazu zählen Projekte wie das Wassernetzwerk Steiermark, eine nachhaltige Flächenbewirtschaftung in der Landwirtschaft und moderne Schutzbauten. Jeder Euro, den wir heute investieren, verhindert morgen Millionenschäden. Die Finanzierung ist eine gemeinsame Aufgabe von Land, Bund und Gemeinden.
Die Finanzierbarkeit von Wohnbau- und Energieförderungen stößt an budgetäre Grenzen. Wie wird das Land reagieren? Die hohe Nachfrage zeigt, dass die Menschen in klimafitte Häuser und leistbares Wohnen investieren wollen. Deshalb müssen die Fördermittel dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Wir setzen klare Prioritäten: Wohnraum für junge Familien, Energieeffizienz im Gebäudebestand und regionale Wertschöpfung. So erzielen wir mit dem vorhandenen Budget maximale Wirkung.

Schon in der Zwischenkriegszeit war Kiendler Stromversorger für die nähere Umgebung.
Die Wurzeln des Unternehmens Kiendler in Ragnitz reichen bis in das Jahr 1696 zurück. Was einst als eine der vielen Getreidemühlen in der Gegend begann, hat sich über 13 Generationen hinweg zu einem innovativen und zuverlässigen Energieversorger in der ganzen Region entwickelt. Das im August 2024 eröffnete modernisierte Wasserkraftwerk stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg in Zukunft dar.
Die lange Geschichte des Unternehmens ist untrennbar mit dem Weissenegger Mühlgang verbunden – einem 19 Kilometer langen Wasserlauf, der im 19. Jahrhundert durch den Zusammenschluss mehrerer Murarme entstand und bis heute zentrale Grundlage für die Nutzung der Wasserkraft im Raum Ragnitz bildet. Im späten 19. Jahrhundert nahm mit der raschen technischen Entwicklung die Elektrifizierung hier ihren Anfang. Im Jahr 1895 folgte der Einbau einer Francis-Turbine mit Gleichstromgenerator, mit der erstmals die elektrische Energieversorgung der Mühle möglich wurde. Im beginnenden 20. Jahrhundert stand der Ausbau der Strominfrastruktur der Region im Fokus: 1912 wurde eine erste Stromleitung zum Schloss Laubegg gebaut, gefolgt von einer zweiten Leitung nach St. Georgen und einer dritten Leitung Richtung Osten. Bereits 1924 schloss sich das Versorgungsnetz Kiendler dem steirischen Verbundnetz an – ein Meilenstein für die regionale Energieversorgung. In der Zwischenkriegszeit wurde durch weitere Zusammenschlüsse die lokale Stromversorgung immer weiter erheblich verbessert. Parallel dazu trieb das Unternehmen den Bau von Kraftwerken konsequent voran. Zwischen 1937 und 1954 entstanden die Kraftwerke Ragnitz II und Ragnitz III, sowie der Anschluss mehrerer Ortsteile in der Umgebung.

Ein Familienunternehmen mit Tradition und Verantwortung: Paul Kiendler sen. mit Ehefrau Johanna und den Söhnen Ulrich (li.), Paul jun. und Markus (re.).
Erweiterung der regionalen Energieversorgung
Der strategische Ausbau wurde auch in den Folgejahren fortgesetzt: 1994 übernahm Kiendler die Kraftwerke Köppelmühle und Leyrerbach II. Mit dem Bau eines Nahwärmenetzes in Ragnitz im Jahr 2006 und der Inbetriebnahme des 110/20 kV Umspannwerks in St. Stefan positionierte sich das Unternehmen zunehmend als universeller Energieversorger. Ein besonders zukunftsweisender Schritt war die Installation einer Photovoltaikanlage mit 40 kWp am Mühlendach im Jahr 2011. Zeitgleich intensivierte das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit anderen regionalen Energieversorgern im Rahmen der Energy Services Handels- und Dienstleistungs-GmbH.
Schon 2013 begann Kiendler mit der Einführung intelligenter Stromzähler („Smart Meter“) – ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung. 2017 setzte Kiendler ein ökologisches Zeichen mit dem Bau einer Fischaufstiegshilfe beim Kraftwerk Ödt, wodurch die ökologische Durchgängigkeit geschaffen wurde. Im Folgejahr wurden die übrigen Kraftwerke modernisiert und in der Leistung gesteigert. Ein strategischer Schritt für die Zukunft war 2023 die Verdopplung des Stromnetzes durch den Kauf des EVU Lugitsch in Feldbach. Mit dem Abriss der Kraftwerke Ragnitz II und III und dem Neubau eines neuen Wasserkraftwerks in Ragnitz wurde 2024 ein weiteres Großprojekt eingeleitet.

Am langen Tag der Energie bestaunten Besucher moderne Kraftwerkstechnik.
Energiewende erleben: Der „Lange Tag der Energie“
Der Lange Tag der Energie fand heuer am 28. Juni 2025 statt. Bei Kiendler strömten zahlreiche Besucherinnen und Besuchern herbei, um das neue Kleinwasserkraftwerk in Ragnitz zu besichtigen. Auch Landesrätin Simone Schmiedtbauer war beeindruckt vom „spannenden Blick hinter die Kulissen eines innovativen Vorzeigebetriebs“. Das Unternehmen betreibt fünf Kleinwasserkraftwerke, die jährlich über 12,5 Mio. kwh Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen. Am Energieschauplatz des Kraftwerks Ragnitz konnten sich die Besucher ein Bild machen, wie der Strom in der Turbine erzeugt wird, über das Stromnetz in den Haushalt kommt, wo er schlussendlich zum Kühlen, Heizen oder Beleuchten verwendet wird. „Dass bei unseren Projekten für die Energiewende auch die Ökologie nicht zu kurz kommt, beweist sich bei der Besichtigung der Fischaufstiegshilfe“, erklärt Paul Kiendler. „Ein anschauliches und eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Energiewende konkret aussehen kann“, lobte Schmiedtbauer. Das Unternehmen Kiendler positioniert sich damit als Botschafter der regionalen Energiewende und als sichtbarer Teil der Lösung in einer Zeit steigender Anforderungen an die Stromversorgung. Mit einem klaren Fokus auf umweltfreundliche Energiequellen wie Wasserkraft, Nahwärme und Photovoltaik ist Kiendler heute mehr denn je ein starker Partner für eine zukunftsfähige Energieversorgung in der Steiermark.
Das neue Kraftwerk – modern und umweltfreundlich Im Zentrum der aktuellen Investitionen steht das neue Wasserkraftwerk Ragnitz. Es ersetzt die beiden historischen Altanlagen im Mühlgang und liefert Strom für den Bedarf von etwa 700 Haushalten. Das im vorigen Jahr errichtete Kraftwerk nutzt eine Turbine des Herstellers Watec in Kombination mit einem Generator von TES. Mit einem Durchfluss von 12.600 l/s und einer Ausbaufallhöhe von 3,5 m erreicht es eine Nennleistung von 320 kW. Die jährliche Stromerzeugung liegt bei rund 2.500.000 kWh – ein bedeutender Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Region. Die moderne Kaplanturbine mit Synchrongenerator, ein innovatives Steuerungssystem, und eine aufwendig geplante Fischaufstiegshilfe machen die Anlage nicht nur effizient, sondern auch ökologisch vorbildlich. „Wir produzieren sauberen Strom dort, wo schon unsere Vorfahren die Wasserkraft genutzt haben“, erklärt Ulrich Kiendler. „Nachhaltigkeit ist für uns kein Modewort –sie ist Teil unserer DNA.“ Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit zeitgemäßen ökologischen Standards umgesetzt. Der Fischaufstieg, der rund 300.000 Euro an Inventionen erforderte, gilt als technisches Highlight – ein Zeichen dafür, dass Energiewirtschaft und Naturschutz kein Widerspruch sein müssen. Doch Kiendler ist weit mehr als Strom aus Wasserkraft. Das Unternehmen betreibt ein eigenes Stromverteilernetz von rund 1.250 Kilometern Leitung mit über 23.000 Kunden in der Südoststeiermark. Außerdem bietet es Elektroinstallationen, versorgt die umliegenden Häuser mit Nahwärme, produziert Strom in Photovoltaikanlagen, betreibt eine Getreidemühle und erzeugt mehrfach ausgezeichnetes Kürbiskernöl. In Summe beschäftigt Kiendler rund 170 Mitarbeiter, darunter 20 Lehrlinge – im Laufe der Zeit wurden über 300 Lehrlinge im eigenen Haus ausgebildet. Der regionale Wertschöpfungseffekt für die ganze Region ist enorm: „Wir denken langfristig – bei Projekten wie bei Menschen“, betont Markus Kiendler.

Gemeinsamer Einsatz für die Energiewende: (v.l.) Irene Hofer (Energieagentur), GF Paul Kiendler, LRin Simone Schmiedtbauer und Bgm. Manfred Sunko.

Neuer Glanz für kulinarisches Kleinod
Der große Frühjahrsputz 2025
Beim 17. „Großen steirischen Frühjahrsputz“ setzten zwischen 22. März und 10. Mai über 70.000 Menschen ein starkes Zeichen gegen Umweltverschmutzung. Gemeinsam sammelten sie rund 210.000 Kilogramm Müll in Wäldern, Wiesen, Gewässern und auf öffentlichen Flächen – und führten diesen der fachgerechten Entsorgung zu. Die Aktion, organisiert vom Lebensressort des Landes Steiermark, der WKO-Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement, den Abfallwirtschaftsverbänden und dem ORF Steiermark, will das Bewusstsein für saubere Umwelt stärken. LRin Simone Schmiedtbauer freut sich über das Engagement der Menschen: „Die große Beteiligung zeigt einmal mehr, wie stark das Bewusstsein für unsere Umwelt in der Bevölkerung verankert ist.“

Nach behutsamer Revitalisierung öffnete Anfang Juni das Winzerhaus Kogelberg in der Südsteiermark wieder seine Türen. Das Traditionshaus wurde in Rekordzeit von nur vier Monaten modernisiert – unter Erhalt des historischen Charmes. „Wir freuen uns sehr, dass das traditionsreiche Winzerhaus seine Pforten nach der Eröffnung im neuen Glanz erstrahlt und damit den Grundstein legt, um seine kulinarische Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Mit Bernd und Stefan Nauschnegg haben wir zwei erfahrene Gastronomen aus der Region als neue Pächter gewonnen und sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft das Winzerhaus weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft führen wird”, so Vorstandsmitglied sagt Oliver Kröpfl.

Steirische Wirtschaft kürt Nachwuchsforscher
Bei der feierlichen Vergabe der WKO-Forschungsstipendien wurde Laurissa Skorianz von der Med-Uni Graz für die beste wissenschaftliche Nachwuchsarbeit 2025 ausgezeichnet. Ihre Arbeit zur „Abrasionsbeständigkeit von Amalgamalternativen“ überzeugte die Fachjury besonders – sie erhielt dafür zusätzlich zum regulären Stipendium einen mit 1.000 Euro dotierten Sonderpreis. Insgesamt wurden im Europasaal 22 wirtschaftsnahe Diplom- und Masterarbeiten prämiert. Die WKO Steiermark schüttete dafür rund 67.000 Euro an Fördermitteln aus. WKO-Präs. Josef Herk betonte die Bedeutung des Programms für den Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft. Seit Beginn der Initiative wurden rund 700.000 Euro an heimische Nachwuchstalente vergeben.


Am Verkehrsknotenpunkt St. Michael entsteht bis Jahresende 2025 der erste große E-Ladehub der Energie Steiermark. Mit zehn Hyper-Chargern (bis zu 300 kW), Lounge, Imbiss-Automaten, Kinderspielpfad und überdachter Ladezone bietet der Standort Komfort und Innovation. Das Investitionsvolumen beträgt 4,3 Millionen Euro. Der Betrieb erfolgt energieautark dank PV-Anlage und Speicher. Eine Erweiterung auf 20 Ladepunkte, auch für E-LKWs, ist geplant. Bürgermeisterin Nicole Sunitsch: „Ein starker Impuls für nachhaltige Mobilität und regionale Lebensqualität.“ Landesweit sollen bis 2027 rund 2.000 Ladepunkte verfügbar sein. Bereits 2024 wurden 4,4 Mio. kWh Grünstrom über die E-Ladeinfrastruktur der Energie Steiermark abgegeben – Tendenz steigend.
Das Biotech-Unternehmen Novogenia und der steirische Logistikexperte KNAPP bauen gemeinsam ein hochautomatisiertes Logistikzentrum in Hallwang bei Salzburg. Ziel ist die effiziente Produktion und weltweite Distribution personalisierter Gesundheitsprodukte wie genetisch abgestimmter Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. Das smarte Lager verknüpft erstmals Labor, Produktion und Versand in einem System: Innerhalb von 20 Minuten werden alle Einzelteile eines Kundenauftrags automatisiert zusammengeführt. Bis zu 8.000 Pakete sollen ab 2026 täglich versendet werden – bei nur fünf Tagen Lieferzeit. Technologisch setzt das Zentrum auf Open Shuttles, Evo Shuttle und Knapps KiSoft-Software – für Flexibilität, Präzision und Zukunftssicherheit. Fotos: ORF / Schöttl, Margit Kundigraber, Foto Fischer, Knapp / Niederwieser, Energie Steiermark

Sicher zahlen im Urlaub: Raiffeisen gibt Tipps Mit Beginn der Urlaubssaison informiert Raiffeisen Steiermark über sicheres Bezahlen auf Reisen. „Viele wünschen sich Sicherheit und Verfügbarkeit – wir bieten beides mit einfachen Maßnahmen“, so RLB-Vorstandsdir. Ariane Pfleger. Empfohlen wird eine Kombination aus Karte und Bargeld. In der Mein-Elba-App können Kartenlimits angepasst oder Karten gesperrt werden. Für Auslandsreisen bietet Geo Control zusätzlichen Schutz. Im RaiffeisenValuten-Webshop lassen sich Fremdwährungen bequem online bestellen. Innerhalb der Eurozone fallen keine Zusatzspesen bei Kartenzahlung an. Beim Buchen gilt: Nur sichere Websites nutzen und Belege aufbewahren. „Mit unseren digitalen Services und persönlicher Beratung sorgen wir für einen sorgenfreien Urlaub“, so Pfleger.

Haindl Mühle eröffnet Erlebnistour
Mit der feierlichen Eröffnung ihrer ersten Erlebnistour wurde die Haindl Mühle in Kalsdorf als 50. Unternehmen in das Programm „Erlebniswelt Wirtschaft“ aufgenommen. Im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums präsentierte der Familienbetrieb CO₂-neutrale Produktion und traditionelles Müllerhandwerk hautnah. Die liebevoll gestaltete Tour, entwickelt mit der Agentur Atelier Haas, gewährt spannende Einblicke in regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit. Daniela Haindl nahm das Gütesiegel von LR Willibald Ehrenhöfer und CIS-GF Eberhard Schrempf entgegen – ein Meilenstein auf dem Weg zum neuen Wahrzeichen. Haindl Mühle Kunstmühle & Ölpresse, Dorfstraße 75, 8401 Kalsdorf, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 8:00–12:00 Uhr sowie 13:00–17:00 Uhr.

Auch im vergangenen Jahr ging der EPU-Erfolgstag mit zahlreichen Besuchern und bei schönstem Wetter über die Bühne.
Der EPU-Erfolgstag in der „Summer Edition“ geht dieses Jahr als humorvolle Ausgabe in die nächste Runde. Die entspannte Summer Edition findet am Donnerstag, 4. September ab 14:00 Uhr mit zahlreichen Speakern, Networking und vor allem mit einem Zusammensein in entspannter Atmosphäre statt − bei Schönwetter natürlich als Open Air bei der WKO Steiermark in Graz!
Highlights des Programms
Als Highlight wird Roman Szeliga in seinem Input „Humor im Business − Sie werden lachen, es ist ernst!“ dem Ernst des Lebens mit humorvollen Pointen entgegenwirken. Denn: Nachgelacht bringt manchmal mehr als nachgedacht!
Christiane Stöckler, Moderatorin bei Antenne Steiermark, verrät in ihrem Input etwas über unsere Stimme, denn diese ist laut der Expertin die akustische Visitenkarte und somit das Aushängeschild, nicht nur bei Gesprächen, sondern auch bei Telefonaten, Calls und Sprachnachrichten − beruflich wie privat. Martin Stettinger demonstriert anhand von Beispielen, wie man Künstliche Intelligenz konkret im Ein-Personen-Unternehmen bestmöglich einsetzen kann.
Dienstleistungsmarktplatz
Beim diesjährigen Erfolgstag bieten wir Ihnen am Dienstleistungsmarktplatz eine Bühne, auf der Sie sich vor allen Gästen gegen Verlosung eines Wertgutscheins präsentieren können.
Rahmenprogramm
Das bewährte Rahmenprogramm mit Live-Musik, Streetfood und entspannter Stimmung bleibt bestehen und lädt auch heuer wieder zum Verweilen ein!
Termin:
EPU-Erfolgstag am Donnerstag, 4. September ab 14:00 Uhr bei der Wirtschaftskammer Steiermark Körblergasse 111-113, 8010 Graz Infos und Anmeldung: www.erfolgstag.at
Fazit traf den Klubobmann der steirischen ÖVP zum Interview. Trotz der Rolle als Juniorpartner in der Landesregierung ist er davon überzeugt, wichtige VP-Projekte auf Augenhöhe mit der FPÖ umsetzen zu können. Das Gespräch führte Johannes Tandl.

ist seit der aus VP-Sicht ziemlich verunglückten Landtagswahl Klubobmann der VPLandtagsfraktion und bildet gemeinsam mit der frisch gewählten Parteiobfrau LHStv. Manuela Khom die inhaltliche Speerspitze der steirischen Volkspartei.
Wie wichtig ist die Zugehörigkeit zur Landesregierung für die ÖVP –wäre der Gang in die Opposition keine Alternative gewesen? Für uns war klar: Wir wollen weiter Verantwortung übernehmen –nicht zuschauen, sondern gestalten. Die Verfassung sieht vor, dass die stimmenstärkste Partei den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt – in diesem Fall eben die FPÖ. Wir haben uns bewusst entschieden, den Weg in die Regierungsbildung zu gehen. Denn in der Regierung kann man mehr für die Steiermark tun als in der Opposition. Und Verantwortung zu übernehmen ist sicher nie ein Fehler.
Die ÖVP-Bundespartei verortet die Kickl-FPÖ als „rechtsextrem“. Ist die FPÖ für Sie eine Partei wie jede andere?
Die FPÖ ist Teil unseres politischen Systems und sitzt seit langer Zeit im Nationalrat und im Landtag. Natürlich gibt es Persönlichkeiten, mit denen Zusammenarbeit schwierig ist. In Wien ist mit Kickl jemand tätig, der sich der Verantwortung entzogen hat, indem er Kanzler werden, aber seine Wahlversprechen nicht einlösen wollte. Die Sprache von Kickl ist bewusst grenzüberschreitend. Aber die Partei an sich ist definitiv – wie alle anderen – Teil unseres politischen Systems.
Bis jetzt sind der Landesregierung das Ende des IG-L-Hunderters und einige Maßnahmen gegen Asylmissbrauch gelungen. Wann darf man mit echten Reformen rechnen?
Im Regierungsprogramm sind natürlich Punkte enthalten, die dem einen Partner wichtiger sind als dem anderen. Aber auch in der ÖVP freuen sich viele über das Ende des IG-L-Hunderters. Aber: Die Standortpartnerschaft wird für Wirtschaft und Industrie noch sehr wichtig und ist ein klares Bekenntnis zu einer starken Steiermark in einem starken Europa. Wir haben der Bürokratie den Kampf angesagt, das war uns als Wirtschaftspartei wichtig. Wir wollen mehr Freiraum schaffen, mehr Vertrauen geben und weniger Regeln aufstellen. Das alles trägt die klare Handschrift der ÖVP.
Die Leitspitalsdiskussion entwickelt sich zur Farce. Die FPÖ hat mit unhaltbaren Versprechen bei der Ennstaler Bevölkerung gepunktet und kann diese nun nicht einhalten. Wie geht es der ÖVP dabei? Was wir jetzt sehen, ist schlicht die Folge der letzten Wahl. Für das Leitspital in der ursprünglichen Form hat es keine Mehrheit mehr gegeben – weder im Bezirk noch im Landtag. Jetzt liegt ein Vorschlag der Fachleute vor, der machbar ist. Ob es dabei bleibt, wird man sehen.
Viele ÖVP-Wähler vermissen die Pflöcke, mit denen sich die ÖVP um eine inhaltliche Abgrenzung zur FPÖ bemüht. Ich glaube, es gibt genug Unterschiede: Unser klares Bekenntnis zu Europa ist ein zentraler Unterschied. Ohne Europa kein wirtschaftlicher Erfolg, keine funktionierende Migrationspolitik. Und auch inhaltlich setzen wir klare Schwerpunkte – ob bei der Stärkung der Industrie, bei der Entlastung der Betriebe oder bei der Integration. Wer die Heimat liebt, muss sie in Europa stark machen.
Die Kunasek-FPÖ präsentiert sich als wirtschaftsliberal und darüber hinaus als heimatverbunden. Erodiert dadurch nicht das Profil der ÖVP?
Ohne ein Bekenntnis zu Europa ist Wirtschaftsliberalität eine leere Hülle. Wer die Heimat wirklich liebt, muss schauen, dass sie in Europa stark vertreten ist. Und nur wenn die ÖVP weiterhin dafür kämpft, bleibt die Steiermark ein starker Standort.
Sie selbst haben kürzlich Missstände im Sozialbereich aufgezeigt.
Gibt es ernsthafte Ansätze, sicherzustellen, dass sich Arbeit eher lohnt, als vom Sozialsystem zu leben?
Das System muss fairer und gerechter werden. Die Menschen sollen durch Leistung ihren Alltag bestreiten können – nicht durch Sozialleistungen. Deshalb werden wir das Sozialleistungsgesetz in der Steiermark verschärfen und anpassen. Auch in Sachen Asyl –neben der Bezahlkarte habe ich schon längst eine Arbeitspflicht in Unterkünften des Landes gefordert.
Die Kronen Zeitung hat kürzlich eine Umfrage veröffentlicht, bei der die FPÖ deutlich gewinnt. Wie geht es Ihnen angesichts dieser Zahlen?
Bei dieser Umfrage liegen alle Veränderungen zur Landtagswahl im Bereich der Schwankungsbreite. Weder das Minus bei uns noch das Plus beim Koalitionspartner ist dramatisch. Es ist aber ein Auftrag, den neuen Weg entschlossen weiterzugehen. Das gelingt aber nicht von heute auf morgen.
Könnte Ihr Freund Sebastian Kurz in Zukunft wieder einen wertvollen Beitrag zur Politik in Österreich leisten?
Die Inhalte von Kurz waren immer richtig – das zeigt sich heute mehr denn je. Strenge Migrationspolitik, strenge Integrationspolitik, Fokus auf Industrie und Wirtschaftsstandort, Realpolitik statt Wunschdenken. Insofern könnte er jederzeit wieder einen Beitrag leisten.
Sehen Sie eine Möglichkeit, das Budget in den nächsten vier Jahren in Ordnung zu bringen?
Die derzeitige Situation hat viele Ursachen – die liegen nicht nur in der Steiermark. Der Zugang unseres Landesrates Willibald Ehrenhöfer, jede einzelne Ausgabe zu überprüfen, ist daher richtig. Ziel ist es, Spielräume für die Zukunft zu schaffen – für Investitionen in Bildung, Innovation und Infrastruktur. Wer heute spart, sichert morgen Chancen.
Wie schaut derzeit eigentlich die Basis der ÖVP zur SPÖ aus?
Ja, auch wenn die Koalition nun eine andere ist. Beim Kopftuchverbot in Kindergärten haben wir gemeinsam mit der SPÖ ein starkes Zeichen gesetzt. Ich glaube, es wird auch künftig Projekte geben, bei denen wir parteiübergreifend zusammenarbeiten können.
Entbürokratisierung bzw. Deregulierung ist eines der Kernziele dieser Regierung. Wie weit ist man hier?
Wir haben im ersten Schritt des aktuellen Entwurfs zum Deregulierungsgesetz bei den Städten und Gemeinden begonnen. Weniger Meldepflichten, kürzere Verfahren und das Abschaffen von 30 nicht mehr zeitgemäßen Gesetzen. Niemand versteht, warum man heute noch Dokumente doppelt und dreifach an Behörden schicken muss. Kürzere Fristen, weniger Gutachten, weniger Zettelwirtschaft. So schaffen wir echte Entlastung. Und ein zweites, noch größeres Paket folgt 2026.
Manuela Khom wurde Anfang des Monats zur Parteiobfrau der steirischen Volkspartei gewählt. Wie schätzen Sie die innerparteiliche Lage nun ein?
Manuela Khom hat in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen. Sie ist nah an den Menschen dran und beschäftigt sich mit Themen, die die Menschen beschäftigen. Ihr Herz schlägt für das Land und für die Leute. Durch das hervorragende Wahlergebnis gehen wir mit einer starken Mannschaft, einer klaren Richtung und einer starken Kapitänin in die Zukunft!

Die Premiere des neuen Networking-Formats „JW Connector –Next Level Networking“ der Jungen Wirtschaft und der Jungen Industrie Steiermark war ein voller Erfolg: 120 junge Unternehmer nutzten die Chance auf echten Austausch im Grazer Dom im Berg. Im Fokus stand nicht der Frontalvortrag, sondern persönliche Begegnung, ehrliches Feedback und konkrete Unterstützung. Vier Jungunternehmer präsentierten ihre Herausforderungen – flankiert von erfahrenen „Superconnectern“ aus der Wirtschaft, die Know-how und Kontakte teilten. „Es sind oft nicht nur die Ideen entscheidend, sondern die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit“, so JW-Landes-Vors. Christian Wipfler. Der Abend wurde so zum Sprungbrett für neue Chancen und mutige Ideen.

Kulturherbst 2025 in Leoben
Mit einem bunten Mix aus Kabarett, Musik, Theater und Stadtgeschichte startet Leoben in die Kultursaison Herbst/Winter 2025. Das Programm wurde am 25. Juni im Stadttheater präsentiert.
Zu den Highlights zählen Auftritte von Gernot Kulis, Wolfgang Böck, den Paldauern, Okemah und den Old School Basterds. Die Steiermark Schau von 20. August bis 31. Oktober sowie fünf Operettenabende mit „Wiener Blut“ runden das Angebot ab. Lokale Künstler und Künstlerinnen, Brauchtumspflege, Themenführungen und die „LEctors“ sorgen für besondere Impulse. Bürgermeister Kurt Wallner und Kulturreferent Johannes Gsaxner betonen: „Leoben steht für lebendige Kultur – getragen von Vielfalt, Tradition und regionalem Engagement.“


LWK-Initiative gegen Laborfleisch
Mit 68.787 Unterschriften haben die Landwirtschaftskammern Steiermark und Kärnten ein starkes Zeichen gegen Laborfleisch gesetzt. Nun befasste sich der Petitionsausschuss des EU-Parlaments mit der gemeinsamen Initiative. Die EU-Kommission wurde zur Stellungnahme aufgefordert, auch der Umweltausschuss berät darüber. LK-Steiermark-Präsident Andreas Steinegger warnt vor den Risiken: „Fleischimitate aus dem Reaktor gefährden unsere sichere Lebensmittelversorgung und begünstigen Konzerne statt bäuerlicher Betriebe.“ Auch LK-Kärnten-Präsident Siegfried Huber betont: „Es gibt keine Langzeitstudien zu den gesundheitlichen Folgen.“ In Brüssel wurden zudem neue Allianzen gegen die eventuelle EU-Zulassung geschmiedet.

Die Kfz-Neuzulassungen steigen auch 2025 weiter – besonders bei E-Autos und Hybridmodellen. In der Steiermark legten sie um 9,7 % zu, während Verbrenner deutlich verlieren: Benziner -14,5 %, Diesel sogar -32,8 %. Hingegen stiegen Hybridfahrzeuge um 15,1 %, reine E-Autos machen bereits 17 % aus. „Der Markt folgt keiner Ideologie – moderne, effiziente Antriebe setzen sich durch“, so WKO-Landesgremialobmann Peter Jagersberger. Auch im Gebrauchtsegment wächst das Angebot. Ein Grund: der Entfall der NoVA für leichte Nutzfahrzeuge ab Juli 2025 – das beflügelt ETransporter (+47,3 %). Parallel steigt die Ladeinfrastruktur stark an: 31.651 öffentliche Ladepunkte gibt es in Österreich, 3.859 davon in der Steiermark – ein Plus von 34 %.
















































Engagement gegen Lebensmittelverschwendung: SPARLehrlinge packen „Too Good To Go“-Sackerl.
Vom 5. bis 20. Juni haben SPAR-Lehrlinge in ausgewählten Filialen insgesamt 1.820 „Too Good To Go“-Sackerl gepackt – und damit gezeigt, dass Engagement gegen Lebensmittelverschwendung schon in der Ausbildung beginnt.
Die Kooperation mit „Too Good To Go“ besteht seit 2021 – und wird seither aktiv von allen SPAR-Mitarbeitern mitgestaltet. „Alle unsere Systeme sind darauf ausgerichtet, genau das im Markt vorrätig zu haben, was tatsächlich verkauft wird. Aber auch bei genauester Planung und Abverkauf bleiben manche Produkte übrig. Die Kooperation verbindet Sparen, Nachhaltigkeit und Genuss für unsere Kunden und wurde jetzt Teil der Lehrlingsausbildung“, so SPAR-GF Christoph Holzer.
Keine Chance der Verschwendung
Die steirischen SPAR-Lehrlinge im zweiten Lehrjahr stellten von 5. bis 20. Juni 1.820 abwechslungsreiche „Too Good To Go“-Überraschungssackerl zusammen und sorgten so für ein attraktives Angebot. Ziel war es, das Bewusstsein für Lebensmittelwertschätzung sowohl bei den Lehrlingen als auch bei den Kunden und Kundinnen zu stärken. „Unsere Lehrlinge haben mit viel Engagement und Kreativität gezeigt, wie einfach und effektiv Lebensmittelrettung sein kann. Mit dieser Initiative möchten wir für einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln sensibilisieren“, ergänzt Holzer.
Lebensmittel sind kostbar
Im Aktionszeitraum wurden in ganz Österreich insgesamt 11.247 „Too Good To Go“-Sackerl verkauft und so zahlreiche Lebensmittel vor dem Verderb bewahrt. „Gemeinsam mit SPAR und unserer Community reduzieren wir jeden Tag Lebensmittelverschwendung und leisten damit einen positiven Beitrag für unsere Umwelt. Wir freuen uns daher besonders, dass sich auch die SPAR-Lehrlinge mit voller Motivation für mehr Nachhaltigkeit einsetzen, und sagen danke für ihren Beitrag“, sagt Georg Strasser-Müller, Country Director von Too Good To Go Österreich und der Schweiz.


Nachhaltigkeit zum Angreifen: Mitglieder der Jungen Wirtschaft Graz-Umgebung besuchten im Rahmen einer Eco-Tour den steirischen Umweltpionier Saubermacher. Gründer Hans Roth empfing die Jungunternehmer an den Standorten Premstätten und Feldkirchen und gab Einblicke in Kreislaufwirtschaft, Batterie-Recycling und nachhaltige Logistik. Auch ÖFB-Teamkapitänin Sarah Puntigam, Klimabotschafterin des Unternehmens, betonte die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Sport. Highlight war die Präsentation eines innovativen ELkws mit Werkstoffscanner und integriertem Defibrillator. „Gerade junge Unternehmer können viel zum Klimaschutz beitragen“, so Roth. Die Teilnehmer zeigten sich begeistert vom Pioniergeist des Unternehmens.



Beim Demo Day des dritten Hummelnest-Accelerators der RLB Steiermark wurde dem argentinischen Mental-Health-Start-up „Cux Emo“ ein mögliches 100.000-Euro-Investment in Aussicht gestellt. Cux ist eine Plattform für psychische Gesundheit, die KI und Telemedizin benutzt, um 24/7 personalisierte Unterstützung und einen vertraulichen Raum für die Nutzer anzubieten. „Cux fördert mentale Gesundheit im Arbeitsalltag – ein wachsendes Thema mit Zukunftspotenzial“, betont Ariane Pfleger, RLBVorstandsdirektorin für Transformation. Das Hummelnest-Programm, gemeinsam mit Transformation Lighthouse, bringt internationale Start-ups in die Steiermark, stärkt das regionale Ökosystem und setzt neue Impulse für Innovation und Kreislaufwirtschaft.
Das Regio-Bus-Angebot im steirischen Vulkanland wird weiter ausgebaut und verbessert. Nach einer Neuausschreibung bleibt das bewährte System bestehen – mit insgesamt 36 Regio-Bussen, die jährlich über 1,3 Mio. Kilometer zurücklegen. Neu ist die grenzüberschreitende Linie 561: Erstmals verbindet ein Regio-Bus Bad Radkersburg mit Gornja Radgona in Slowenien – ein historischer Schritt im steirischen Verkehrsverbund. „Wir freuen uns sehr, dass das Verkehrsangebot im Vulkanland in die Verlängerung geht und es zudem zu zusätzlichen Verbesserungen kommt. Die neue grenzüberschreitende Regio-Bus-Linie nach Slowenien wird uns unseren Nachbarn noch näherbringen“, erklärt Verkehrsverbund Steiermark-GF Peter Gspaltl.
Saubermacher
Saubermacher engagiert sich international für soziale Projekte und ist seit über drei Jahren in Kroatien aktiv und unterstützt das Kinderheim „Centar za djecu Zagreb“ mit einer großzügigen Spende zur Verbesserung von Bildungs- und Betreuungsangeboten. Rund 250 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 21 Jahren werden dort betreut, viele ohne elterliche Fürsorge. 175 Mitarbeitende, davon 130 Fachkräfte, bieten psychologische Betreuung, Schulunterricht und soziale Integration. Auch schwangere Frauen und Mütter in Not finden dort ein Zuhause. Saubermacher-Gründer Hans Roth: „Kinder sind unsere Zukunft. Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, junge Menschen zu unterstützen, die ohne familiären Rückhalt aufwachsen müssen.“
Steirischer Arbeitsmarkt weiter unter Druck
Mit Ende Juni 2025 waren in der Steiermark insgesamt 42.305 Personen ohne Beschäftigung, davon 34.281 arbeitslos gemeldet und 8.024 in Schulung. Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet das einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 12 Prozent, die geschätzte Arbeitslosenquote liegt bei 5,9 Prozent. Gleichzeitig ist die unselbstständige Beschäftigung auf rund 547.000 Personen gesunken. Der Rückgang offener Stellen verschärft die Situation: Nur 10.924 Jobs sind beim AMS gemeldet – ein Minus von 18 Prozent im Vergleich zu 2024. Besonders betroffen sind Personen über 50 Jahre. AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe sieht vorerst keine Trendwende: „Wir werden noch auf eine Stabilisierung warten müssen. Die Arbeitslosigkeit wird in diesem Jahr wohl vorübergehend die Marke von 39.000 Personen erreichen.“

Die Landwirtschaftskammer unterstützt Bäuerinnen und Bauern bei naturnaher Bewirtschaftung (v.l.n.r.)
Kammerdirektor Werner Brugner, Präsident Andreas Steinegger, Vizepräsidentin Maria Pein

Peppo Reiter-Haas schafft mit Streuobstwiesen und Hecken wertvolle Lebensräume für Wildtiere und bestäubende Insekten.

Alexandra Frewein erhält mit Weidewirtschaft artenreiche Almwiesen und erzeugt hochwertige Heumilch.

Alois Kiegerl verbindet mit seinen Murbodner-Rindern Artenschutz, Tierwohl und regionale Fleischproduktion.
Die heimischen Bäuerinnen und Bauern sind nicht nur Garanten für unsere Lebensmittelversorgung – sie sind auch Partner beim Schutz der Artenvielfalt. Im Rahmen der „Woche der Landund Forstwirtschaft“ vom 20. bis 27. Juli zeigen sie auf, wie aktiver Naturschutz in der Praxis aussieht.
Biodiversität ist kein Zufallsprodukt – sie entsteht durch verantwortungsvolle Bewirtschaftung“, betont LK-Präsident Andreas Steinegger. Täglich leisten Land- und Forstwirte wertvolle Beiträge für sauberes Wasser, fruchtbare Böden, Tierwohl und Artenvielfalt – oft unbemerkt. „Es braucht mehr Bewusstsein, dass Landwirtschaft und Naturschutz nicht im Widerspruch stehen, sondern einander ergänzen“, so Steinegger. Die Landwirtschaftskammer unterstützt Biodiversität nicht nur praktisch, sondern auch durch Beratung: 3.000 Beratungsstunden wurden 2024 an Betriebe geleistet. Mit der Initiative „NaturVerbunden Steiermark“ werden konkrete Lösungen für die Vereinbarkeit von Produktion und Naturschutz erarbeitet.
Grüne Inseln für Tiere und Pflanzen
Die Zahlen sprechen für sich: In der Steiermark werden 2025 über 28.000 Hektar Biodiversitäts- und Naturschutzflächen bewirtschaftet. Allein 1.800 Hektar Ackerland sind mit insektenfreundlichen Blühmischungen bestellt. Diese Flächen sind Rückzugsräume für Wildbienen, Vögel, Kleintiere – und Nahrungsquelle für Bestäuber. Mehr als 350.000 registrierte Bäume, Sträucher und Hecken sowie Landschaftselemente bieten Tieren Nahrung, Schutz und Verstecke. Über 7.700 Höfe mit 140.000 Rindern praktizieren die Maßnahme „Tierwohl Weide“. Damit erhalten sie nicht nur das Tierwohl, sondern auch die artenreiche Kulturlandschaft.
Naturschutz und artenreiche Wiesen
Seit 2023 haben sich die Naturschutzflächen auf 15.000 Hektar verdoppelt. Ohne mineralischen Dünger, mit späten Mähterminen und gezielter Pflege sorgen diese Flächen für die Wiedervermehrung seltener Kräuter, Wildgräser und heimischer Tierarten. 7.000 Betriebe setzen auf biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung. Auf über 93.000 Hektar arbeiten sie nach den Prinzipien umweltgerechter Bewirtschaftung, wodurch die genetische Vielfalt erhalten und die Bodenqualität verbessert wird. Rund 3.700 Biobetriebe bewirtschaften 60.000 Hektar nach strengen ökologischen Richtlinien – von Grünland bis zu Weinkulturen. Sie verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und fördern dadurch gezielt das Bodenleben und die Artenvielfalt. Entgegen weit verbreiteter Ansicht sind bewirtschaftete Wälder Hotspots der Artenvielfalt. Die waldökologische Basisinventarisierung im Forstgut Pichl ergab 3.000 Arten, darunter viele Rote-Liste-Arten. 2.500 Betriebe begrünen 24.000 Hektar Ackerflächen, stärken das Bodenleben, fördern Humusaufbau und speichern CO₂. Weitere 1.900 Betriebe stellen 2.400 Hektar Ackerland freiwillig still, wodurch Lebensräume für Insekten, Vögel und Wildtiere entstehen.


LRH: Aufholbedarf bei Kinderbetreuung
Trotz Bemühungen von Land und Gemeinden zeigt ein Bericht des Landesrechnungshofs deutliche Schwächen beim Angebot vorschulischer Kinderbetreuung. Vor allem bei unter 3-Jährigen hinkt die Steiermark stark hinterher. Kritisiert wird ein ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle beim ganztägigen Betreuungsangebot. Die schrittweise gesetzliche Reduktion der Gruppengrößen führt seit 2023/24 zu einem Rückgang der Kindergartenplätze, ohne dass dieser durch zusätzliches Personal kompensiert wurde. Da Bundesmittel fehlen, müsse das Land finanziell einspringen. Positiv hervorgehoben werden das neue „Steirische Kinderportal“ zur zentralen Vormerkung sowie die Betreuung durch Tageseltern in Gemeinden als flexible Übergangslösung.
Das Unternehmen B&R Industrial Automation, Teil der ABB-Gruppe, hat gemeinsam mit Knapp eine hochautomatisierte Intralogistiklösung am Standort Eggelsberg realisiert. Die neue Smart Factory umfasst ein automatisches Kleinteilelager mit über 91.000 Stellplätzen, ergonomische Pick-it-Easy-Arbeitsplätze sowie autonome mobile Roboter. Die maßgeschneiderte Lösung steigert Ergonomie, Flexibilität und Effizienz: Der Lagerdurchsatz konnte um 35 %, der Kommissionierdurchsatz um 50 % erhöht werden. Gesteuert wird das System mit der Software KiSoft One, voll integriert ins SAP-System. Die Partnerschaft zwischen B&R und Knapp, bereits durch Steuerungsund Sicherheitstechnik in den Open Shuttles gestärkt, soll künftig weiter ausgebaut werden.

Beim Sommertreffen der Landwirtschaftskammern warnen Präs. Josef Moosbrugger und LK Steiermark-Präs. Andreas Steinegger vor falschen Weichenstellungen auf EU-Ebene. Moosbrugger kritisiert den geplanten „Finanz-Eintopf“ der EU bei GAP und MFR – er fordert zweckgebundene Mittel für die Landwirtschaft sowie faire Importstandards. Steinegger lehnt die Ausweitung der EUIndustrie-Emissionsrichtlinie auf bäuerliche Betriebe ab. Außerdem fordert er eine „Null-Risiko“-Einstufung Österreichs bei der EU-Entwaldungsverordnung, um Bürokratie zu vermeiden. Die Forschung zeigt, dass bewirtschaftete Wälder hohe Artenvielfalt bieten. Weitere Forderungen betreffen Unterstützung beim Klimaschutz, Risikomanagement und bei erneuerbaren Energien.

Schmiedtbauer kritisiert EU-Budgetpläne
Nach Berichten über interne Probleme am LKH West verlangt die Grazer SPÖ-Vorsitzende Doris Kampus umgehend Klarheit zur Lage. „Ich will wissen, ob für die Grazer Bevölkerung ein Risiko besteht. Patientensicherheit muss an oberster Stelle stehen“, so Kampus. Sollte es zu schwerwiegenden Fehlern gekommen sein, seien diese lückenlos aufzuklären und abzustellen. Besonders kritisch sieht Kampus die internen Machtkämpfe in der KAGes, die ihrer Ansicht nach im öffentlichen Gesundheitswesen keinen Platz haben: „Unsere Gesundheitsversorgung wird von Beiträgen der Steirerinnen und Steirer finanziert. Da darf es keine Spielräume für persönliche Interessen oder Machtfragen geben.“ Die SPÖ-Politikerin fordert auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl zur transparenten Aufklärung auf.
Mit deutlichen Worten reagierte Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer auf die am 16. Juli vorgestellten Budgetpläne der EU-Kommission zur Gemeinsamen Agrarpolitik: „Der Entwurf geht in eine völlig falsche Richtung. Trotz massiv gestiegener Produktionskosten sollen die Mittel dafür gekürzt werden – das ist für unsere kleinstrukturierte, familiengeführte Land- und Forstwirtschaft nicht akzeptabel.“ Sie lehnt insbesondere die geplante Auflösung des bewährten Zwei-Säulen-Systems ab und fordert den Erhalt der Ländlichen Entwicklung und des Agrarumweltprogramms. „Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen faire Entlohnung für Umweltleistungen und verlässliche Planungssicherheit“, betont die Vorsitzende der Agrarreferenten.
Die Gewinner der steirischen Landesweinprämierung 2025

Die Steiermark hat ihre besten Weine gekürt – und das mit hoher Beteiligung und Qualität. Bei der Landesweinbewertung 2025, dem wichtigsten Weinwettbewerb des Bundeslandes, wurden aus knapp 1.700 eingereichten Weinen von rund 350 Winzern insgesamt 18 Landessieger ermittelt. Zwei Betriebe stachen dabei besonders hervor: Der Weinhof Ulrich aus St. Anna am Aigen holte gleich drei Landessiege und wurde obendrein zum Weingut des Jahres 2025 gekürt. Das Weingut Felberjörgl sicherte sich zwei Landessiege. „An der Bewertung können alle steirischen Qualitätsweine teilnehmen“, erklärt Weinbauchef Martin Palz. Dabei gelten strenge Bedingungen: In den klassischen Sortengruppen – wie etwa Welschriesling, Muskateller oder Sauvignon Blanc – müssen die Weine trocken ausgebaut sein und dürfen nicht mehr als 13% vol. Alkohol aufweisen, um den für die Steiermark typischen fruchtig-frischen Weinstil hervorzuheben.
Große Sortenvielfalt
Besonders bemerkenswert ist die Qualität und Vielfalt der eingereichten Weine. In den größten Sortengruppen spiegeln sich die regionalen Schwerpunkte deutlich wider: 180 Weißburgunder, 178 Welschrieslinge, 177 Muskateller und 143 Sauvignon Blancs wurden zur Bewertung eingereicht. Auch die kleineren Gruppen wie Schilcher (43) und Morillon (42) fanden Beachtung.
Die Vorauswahl ist streng: Nur etwa 17 Prozent der Weine – also 286 – schafften es ins Semifinale. Aus diesen wiederum wurden die besten sechs pro Kategorie für das Finale ausgewählt. Insgesamt erreichten lediglich 6,5 Prozent aller eingereichten Weine das Finale – das entspricht 108 Finalisten. „Das zeigt, wie schwierig es ist, das Semifinale, das Finale oder gar den Landessieg zu erreichen“, betont Palz.
Die Finalverkostungen erfolgten nach der bewährten Rangziffernmethode: Alle Finalweine werden in einer Reihe und blind verkostet. So werden die besten Weine nicht nur nach Qualität, sondern auch im direkten Vergleich innerhalb ihrer Sortengruppe ermittelt. Die Landesweinbewertung 2025 unterstreicht einmal mehr, wie hoch das Niveau im steirischen Weinbau ist. Die Siegerweine stehen exemplarisch für das, was die Region ausmacht: Charakterstarke, elegante und authentische Weine mit Herkunft und Handschrift.
Weingut des Jahres 2025: Unter den Finalisten wurde der Weinhof Ulrich aus St. Anna am Aigen zum „Weingut des Jahres 2025“ gekürt. Der Betrieb erhielt die begehrte Auszeichnung schon 2013 und 2019 und war heuer in drei Kategorien siegreich (Riedenweine Burgunder, Sauvignon Blanc sowie Sauvignon Blanc Ortstypisch). Als Doppelsieger etablierte sich das Weingut Felberjörgl mit Riesling und Prädikatswein.
Landessieger:
• Sekt: Burgunder Sekt Brut, Sekt Anna (St. Anna/Aigen)
• Schilcher: Schilcher Klassik DAC 2024, Der Peiserhof (Haiden)
• Welschriesling 2024, Weingut Burger (Gschmaier)
• Weißburgunder DAC 2024, Weingut Koller (Greith)
• Morillon DAC 2024, Weingut Grabin (Labuttendorf)
• Riesling Ried Höchleitn DAC 2022, Weingut Felberjörgl (Kitzeck/S.)
• Sauvignon Blanc DAC 2024, Weingut Bockmoar (Wildon)
• Muskateller DAC 2024, Weingut Adam-Lieleg (Leutschach)
• Scheurebe: Sämling 88 2024, Weingut Perner (Ehrenhausen)
• Traminer: Gelber Traminer Klöch DAC 2024, Weinhof Tomaschitz (Klöch)
• Prädikatswein: Beerenauslese 2022, Weingut Felberjörgl (Kitzeck/S.)
• Blauer Zweigelt Barrique 2021, Weinbau Labanz (Oberhaag)
• Rotwein-Vielfalt: Cuvée Deep Purple 2022, Weinhof Deutsch (Untergreith)
Orts- und Riedenwein:
• Sauvignon Blanc ortstypisch: Sauvignon Blanc St. Anna DAC 2023
• Burgunder ortstypisch: Morillon Ehrenhausen DAC 2024, Weingut Marko Ottenberg
• Riedenwein Burgunder: Chardonnay Ried Tamberg DAC 2021, Weinhof Ulrich Riedenwein
• Sauvignon Blanc: Sauvignon Blanc Ried Hochstraden DAC 2021, Weinhof Ulrich
• Schilcher Ried Pirkhofberg DAC 2024, Schilcherweingut Friedrich (Langegg)

Die steirische Landesregierung setzt mit der Bündelung der Zuständigkeiten für konfliktträchtige Tierarten – wie Wolf, Luchs, Fischotter oder Bär – in der Abteilung Land- und Forstwirtschaft einen wichtigen Reformschritt. Ziel ist ein praxistaugliches Prädatoren-Management im Jagdrecht. LR Hannes Amesbauer und LR Simone Schmiedtbauer wollen damit klare Zuständigkeiten und effizientere Abläufe schaffen – von Monitoring über Beratung bis hin zu Entnahmen. Besonders problematisch sind zunehmende Wolfsrisse und Fischotterschäden. Der Startschuss für gesetzliche Anpassungen ist erfolgt, die Umsetzung soll bis Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. „Wir verbinden Natur- mit Menschenschutz –mit Hausverstand“, so Amesbauer.

Fotoausstellung vom Landleben

Am 8. und 9. Juli fand die zehnte Auflage der Österreichischen Designgespräche auf Schloss Hollenegg statt. Dabei wurden neun erfolgreiche Projekte präsentiert, die zeigen, wie die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Design zu innovativen Produkten und wirtschaftlichem Mehrwert führen kann. Im Zentrum standen Gespräche am runden Tisch, bei denen Designer und Unternehmer über ihre Erfahrungen sprachen. Die Best-Practice-Beispiele reichten von Produktentwicklung bis Service Design und unterstrichen die Bedeutung kreativer Kooperation für unternehmerischen Erfolg. Veranstaltet wurde das Format von der Creative Industries Styria in Kooperation mit designaustria, dem Holzcluster Steiermark und Schloss Hollenegg for Design.
Beim Businesslunch Kärnten am 8. Juli im Schloss Seefels präsentierte die Lenzing AG innovative Ansätze für mehr Nachhaltigkeit in der Textilbranche. Mit ihrer Holzfasertechnologie und digitalen Lösungen wie Blockchain setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Kreislaufwirtschaft und Lieferkettentransparenz. „Lenzing zeigt, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind“, so Daniela Knieling von „respACT“. Auch BKS-Bank-Vorstand Nikolaus Juhász hob die Bedeutung des Austauschs für nachhaltige Entwicklung hervor. Lenzing strebt eine konsequente Dekarbonisierung der textilen Wertschöpfungskette an und entwickelt sich Schritt für Schritt vom linearen zum zirkulären Geschäftsmodell.
Die Ausstellung „Von oben im Tal“, die in der Hofgalerie des Museums für Geschichte in Graz gezeigt wird, eröffnet einen einzigartigen Blick auf das fotografische Werk von Franz Göttfried, der das ländliche Leben in St. Lambrecht in den 1920er- bis 1940erJahren dokumentiert hat. Rund 500 erhaltene Glasnegative bilden das Herzstück einer vielschichtigen Auseinandersetzung mit Erinnerungen und kollektiver Identität: Unter Einbeziehung der Menschen vor Ort begibt sich der Künstler Simon Baptist in das Gefüge der Bilder und deren Zwischenräume, sucht Orte und Menschen auf und nimmt dies als Ausgangspunkt für seine filmische Arbeit. Ausstellung „Von oben im Tal“. Simon Baptist – Archiv Franz Göttfried, von 13.6.2025 – 6.1.2026.


Milica Tomic im Kunsthaus Graz
Die Einzelausstellung „On Love Afterwards“ von Milica Tomić im Kunsthaus Graz lädt zur Reflexion über Verantwortung, Sichtbarkeit und Ungerechtigkeit ein. Im Fokus steht nicht das Objekt, sondern der Raum, der es umgibt – ein Schlüsselmotiv ihrer forschungsbasierten Praxis. Gezeigt werden Werke wie Ungelöst XY, I am Milica Tomić oder Last Letter, verknüpft mit einem Archiv, das Kontext und tiefere Einsicht bietet. Als Vorstand des Instituts für zeitgenössische Kunst beleuchtet Tomić Themen wie Erinnerung und politische Gewalt – mit Mitteln wie Performance, Installation und diskursiver Kunst. Kuratorin Andreja Hribernik: Wir eröffnen die Ausstellung in einer Zeit, in der die Stadt ein großes Trauma erlebt hat und dieses verarbeiten muss.“

Das Thermen- & Vulkanland ist einfach zu schön, um nicht da zu sein.
In den Sommermonaten dreht sich im Thermen- & Vulkanland alles um aktive Bewegungseinheiten in der Natur, belebendes Thermalwasser, regionale Genussbotschafter und kulturelle Erlebnisse und Veranstaltungen.
Abenteuer in der Natur
Die Sehnsucht nach endlosem Naturerlebnis kann bei einer Wanderung durch die sanften Weinberge oder einer spannenden Radtour durch den UNESCO Biosphärenpark gestillt werden. Am Wegesrand laden immer wieder gemütliche Einkehrstopps zur Pause. Erfrischung garantieren die kühlen Seen und Freibäder im Thermen- & Vulkanland. Die vier Golfplätze der Region versprechen ein abwechslungsreiches Golfspiel und bei einer Heißluftballonfahrt lässt sich das Thermen- & Vulkanland von oben entdecken.
Entspannt abtauchen
Im belebenden Thermalwasser der sechs Thermen – Parktherme Bad Radkersburg, Therme der Ruhe Bad Gleichenberg, Thermenresort Loipersdorf, Rogner Bad Blumau, Heilthermen Resort Bad Waltersdorf und H2O-Hotel-Therme-Resort, schöpfen die Gäste neue Kraft und regenerieren die müden Muskeln. Aufregende Ferienprogramme und Wasserattraktionen warten darauf, von den kleinen Gästen entdeckt zu werden.
Kulinarik der Erfinder
Essbarer Tiergarten, Schokoladen-Theater und Kakaokino: kein Tag, an dem hier nichts Neues erfunden wird. Und auch die Küchenchefs und -chefinnen der Region überraschen mit Gerichten, die Geschichten erzählen und den Gaumen fordern. Ob Haubenlokal, Buschenschank oder gut bürgerliches Gasthaus –hier ist für jeden das Richtige dabei. Auf der Straße der Lebenslust – der Vulkanland Route 66 – ist man dem Genuss auf der Spur. In den Genussmanufakturen haben Gäste die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Für Kulturinteressierte warten die Burgen, Schlösser und kleine historische Städte darauf, entdeckt zu werden. Und an lauen Sommernächten locken die Konzerte und langen Einkaufsnächte in die Städte.
Tourismusverband Thermen- & Vulkanland
GF Christian Contola
A-8280 Fürstenfeld, Hauptstraße 2a info@thermen-vulkanland.at www.thermen-vulkanland.at
Tel: +43 3382 / 55100

Saubermacher-Gründer Hans Roth unterstützt den Ankauf eines Mähwerkes für den Verein „Lebende Erde im Vulkanland“ mit Obmann Karl Lenz und GF Bernard Wieser (re).
Der Blaurackenverein „Lebende Erde im Vulkanland“ pflegt seit 1998 Wiesenflächen im Natura2000-Gebiet „Südoststeirisches Hügelland“ zwischen Bad Gleichenberg, Gnas, Straden, Klöch und Halbenrain, um den Rückgang der Grünlandbewirtschaftung zu kompensieren. Mit Unterstützung der Firma Saubermacher wurde ein neues Mähwerk angeschafft.
Die Pflege umfasst 300 Wiesen mit unterschiedlichen Anforderungen, die einer Vielzahl von Pflanzen- und Insektenarten als Lebensraum dienen. Durch Mahd und Weideprojekte wird die Artenvielfalt gefördert, während gleichzeitig Erosion und Hochwasserrisiken verringert werden. Die Wiesen spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie Humus aufbauen und die Landschaft stabilisieren.
Die einzelnen Wiesentypen beheimaten mehrere hundert verschiedenen Pflanzenarten, von denen jede das Vorkommen von sieben bis zehn Insektenarten fördert. Gepaart mit Strukturelementen wie Waldrändern, Wiesengräben, Hecken, Streuobst oder einfachen Ansitzwarten sowie von anderen bewirtschafteten Futterflächen, ergeben diese mosaikartig einen funktionierenden Biotopverbund.
Verbesserung der Brutplätze
Zusätzlich werden Vorfluter und Wegränder vom Verein kostenlos für die Gemeinde Straden gepflegt, um dort bodenbrütenden Brutvögeln die Vermehrung zu ermöglichen. Im jüngst begonnenen Weideprojekt verbessern Weidekühe die Talgründe im Blauracken-Brutgebiet. Mit dem neuen Scheibenmähwerk, das mit Unterstützung der Firma Saubermacher angeschafft wurde, wird eine optimale Gewinnung von vollwertigem Futter erzielt. „Saubermacher sieht es als seine große Verantwortung, eine lebenswerte Umwelt mitzugestalten und Naturschutz zu leben. Aus diesem Grund unterstützen wir den Verein ‚Lebende Erde im Vulkanland‘ gerne auf partnerschaftliche Weise in seiner Arbeit für die Artenvielfalt in der Region Vulkanland“, so SaubermacherGründer Hans Roth.



Im Center of Science Activities (CoSA) Graz wird Wissenschaft zum Erlebnis – und nun auch zum Kreativlabor für junge Designer. Im Rahmen der Ausstellung „CoSA meets Ortweinschule Graz“ zeigen 33 Schüler und Schülerinnen, wie sich Wissenschaft jugendnah visualisieren lässt. Die Kooperationsklasse für Grafik- und Kommunikationsdesign entwickelte neue Bildsprachen und Plakate für das CoSA. Schlussendlich kamen dabei rund 30 Konzepte heraus, die eine unglaubliche Bandbreite zeigen. Das Siegerprojekt von Paul Bürki und Lilia Berghofer überzeugte die Jury ganz besonders und wird umgesetzt. Seit 2019 begeistert das CoSA junge Menschen mit interaktiven Angeboten – nun bekommt es ein frisches Erscheinungsbild, gestaltet von der nächsten Kreativgeneration.
Im Arkadenhof des Schlosses Porcia feierte die BKS Bank am 16. Juli die Vorpremiere von „Der Bockerer“. Die Inszenierung des Erfolgsstücks von Ulrich Becher und Peter Preses nahm das Publikum mit in das Wien der 1930er und 1940er Jahre. Mit Wiener Humor und Humanismus erinnerte das Stück eindrucksvoll an die Kraft des Einzelnen in schwierigen Zeiten. Vorstandsmitglied Nikolaus Juhász betonte die Bedeutung von Haltung und Zivilcourage, Intendant Florian Eisner eröffnete den Abend mit herzlichen Worten. Die bewegende Inszenierung im historischen Ambiente überzeugte das Publikum und regte zum Nachdenken an. Beim anschließenden Buffet klang der Kulturabend genussvoll aus – ein gelungener Beitrag zur Förderung von Kunst und Gesellschaft.
Wie weit konnte römische Keramik reisen? Das neue Schaufenster in die Römerzeit in Flavia Solva rückt die weite Welt der antiken Warenströme in den Fokus. Im Rahmen des Projekts „Fundbearbeitung Flavia Solva“ wurden vom UMJ und dem Österreichischen Archäologischen Institut umfangreiche Keramikfunde ausgewertet – sie erzählen von regionalen und globalen Handelsverbindungen im Römischen Reich. Darüber hinaus ermöglichen Einblicke in unterschiedliche Aspekte des Alltagslebens – nicht nur in der Römerzeit, sondern auch von der späten Jungsteinzeit bis in die jüngste Vergangenheit. Ausstellung „Imperium auf Achse. Weitgereiste römische Keramik aus Flavia Solva“, Ort: Marburgerstraße 111, 8435 Wagna, Laufzeit: 27.6.2025 – 26.6.2026.

Das Kunsthaus Graz ruft zur Einreichung kreativer Konzepte für seine BIX-Medienfassade auf. Unter dem Motto „Radikale Hoffnung“ werden bis 31. August 2025 digitale Kunstprojekte gesucht, die auch Foyer und Vorplatz einbeziehen können. Die Ausschreibung richtet sich weltweit an Künstler und Künstlerinnen – das Preisgeld beträgt 8.000 Euro. Als visuelles Dialoginstrument im urbanen Raum lädt die BIX-Fassade mit 911 Pixeln zur künstlerischen Reflexion über Licht, Rhythmus und gesellschaftliche Themen ein. Die Jury besteht aus Andreja Hribernik, Gerfried Stocker und Sabine Himmelsbach. Der Projektpartner ist die Energie Graz. Einreichungen mit Vermerk Radikale Hoffnung werden bis 31.08.2025 unter office@kunsthausgraz.at entgegengenommen.

Das Unternehmen Brau Union Österreich präsentiert sich mit einem umfassenden Redesign. Die neue Dachmarke soll die regionale Stärke der zwölf Brauereien und ihrer 15 Biermarken sichtbarer machen und Werte wie Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit betonen. „Mit dem neuen Auftritt reagieren wir auf veränderte Konsumgewohnheiten und rücken unsere Vielfalt stärker in den Fokus“, so Daniela Winnicki, Director Corporate Affairs. Der grüne Farbton des Hopfens, neue Schriftbilder und ein modernes Logo stehen für Gemeinschaft und Qualität. Das Design soll sowohl intern verbinden als auch extern Orientierung geben. GF Daniel Frixeder: „Das neue Branding zeigt Haltung, feiert Vielfalt und unterstreicht den Qualitätsanspruch.“


Am 27. Juni fand an der Montanuniversität Leoben die zweite Akademische Feier des Jahres statt. Im feierlichen Rahmen wurden 64 Diplomingenieure graduiert und 26 Doktorate verliehen. Markus Mitteregger, CEO der RAG Austria AG, erhielt für seine Verdienste um nachhaltige Energie die Ehrensenatorwürde. Rektor Peter Moser stellte in seiner Rede die Weltraumforschung der Universität in den Fokus. „Die Montanuniversität ist nicht nur ein Ort der exzellenten Forschung, sondern auch ein Ort, an dem praktische Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft entwickelt werden“, so Moser. Der Hellmut-LonginPreis ging an Nathalie Gruber, die auch als neue Privatdozentin für Gesteinshüttenkunde vorgestellt wurde.




Das Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark und Günther Pedrotti präsentierten am 18. Juli das Programm der 9. Wasser Biennale 2025/2026 in Fürstenfeld. Seit 2008 steht das Element Wasser im Zentrum der Biennale, die Interventionen im öffentlichen Raum zeigt. Mit dabei sind das Künstlerinnenduo „raumarbeiterinnen“ sowie zahlreiche lokale Partner. Pedrotti erklärt: „Wasser spannt eine weite Oberfläche von Bedeutungen, wo Ursprünglichkeit und Kultur als Knotenpunkte für eine Reflexion unserer Wahrnehmungssensibilitäten sorgt.“ Die Leiterin Gabriele Mackert zeigt sich begeistert über den langjährigen Erfolg: „Die Wasser Biennale ist auch im 17. Jahr dank der Unterstützung der Gemeinde und vieler Interessierter eine Erfolgsgeschichte.


Anlässlich des Podcasts «Special Monkeys» besuchte der Geschäftsführer von Licht ins Dunkel Mario Thaler die Special People Inclusion Association in der Humboldtstraße in Graz. Im Zentrum des Podcasts stand das Thema Inklusion. Mario Thaler erzählt dabei viele persönliche Erlebnisse und wie er die Spendensituation in Österreich sieht. Auch zur immer wiederkehrenden ORF-Kritik nimmt der gebürtige Tiroler Stellung. Den 30-minütigen Podcast findet man auf Apple Podcast, Spotify und Sound Cloud unter «Special Monkeys» oder einfach auf der Website www.spia.org.

Almputztag schützt Weiden vor Verwaldung
Rund 300 Freiwillige halfen beim steirischen Almputztag auf 13 Almen, um sie von Stauden, Farnen und Gehölzen zu befreien. Damit sichern sie wertvolle Weideflächen für 50.000 Tiere. Auch LK-Präs. Andreas Steinegger und Vize-Präs. Maria Pein griffen zur Astschere – Steinegger auf der Lassachalm im Sölktal, Pein auf der Hochalm-Bärntal. In Begleitung von Steinegger erschien der Obmann des Steirischen Almwirtschaftsvereins Anton Hafellner, der einen Überblick über die Almwirtschaft gab. Pein erklärte: „In der Gemeinschaft macht die Arbeit Freude – und sie ist wichtig, um die Beweidung zu sichern.“ Almpflege schützt nicht nur Futterflächen, sondern erhält auch die Artenvielfalt und die typische Kulturlandschaft.

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl besuchte am 18. Juli den neuen Finanzerlebnispark FLiP im CoSA in Graz. Die interaktive Ausstellung ist ein Geschenk der Steiermärkischen Sparkasse anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens und vermittelt Jugendlichen und Erwachsenen auf spielerische Weise Finanzwissen. Vorstandsvorsitzender Georg Bucher betonte die gesellschaftliche Bedeutung finanzieller Bildung, besonders für junge Menschen. „Wer seine Finanzen versteht, trifft bessere Entscheidungen und sorgt nachhaltig vor. Im Rahmen der nationalen Finanzbildungsstrategie werden wir künftig noch stärker auf die Themen Alters- und Zukunftsvorsorge, Kapitalmarktkompetenz und Betrugsprävention im digitalen Raum setzen”, sagt EibingerMiedl.

Fordern Maßnahmen für leistbares Wohnen: (v.l.)
StRin. Doris Kampus, SP-Chef Max Lercher und Staatssekretärin Julia Schmidt.
Die steirische SPÖ präsentierte am 5. Juni bei einer Pressekonferenz ihre Forderungen für leistbares Wohnen. Für SP-Landesparteichef Max Lercher ist klar: „Die explodierenden Wohnkosten sind eine reale Belastung für viele Steirer und Steirerinnen und treiben die Inflation. Wer arbeitet, muss sich auch wieder mehr leisten können – das geht nur, wenn Wohnen leistbar bleibt.“
Lercher verweist auf Verbesserungen aus der vergangenen Regierungsperiode: Durch SPÖ-Initiativen wurde ein steirisches Wohnpaket umgesetzt, das den genossenschaftlichen Wohnbau stärkte, Mieterhöhungen im geförderten Bereich abfederte und Eigenheimprojekte förderte. Scharfe Kritik richtet Lercher an die jetzige Landesregierung: „Der abrupte Stopp von Jungfamilienbonus, Eigenheim- und Heizungsförderung hat viele Familien finanziell im Stich gelassen. Blau-Schwarz hat keine Alternativen vorgelegt.“ Die SPÖ fordert eine Fortführung der Maßnahmen sowie Investitionen in kommunalen und genossenschaftlichen Wohnbau.
Handlungsbedarf für leistbares Wohnen Auf Bundesebene begrüßt Staatssekretärin Julia Schmidt den Mietpreisstopp: „Allein 2025 bringt das 138 Mio. Euro Entlastung für insgesamt über eine Million Haushalte.“ Künftig sollen Mieterhöhungen gesetzlich begrenzt werden: im ersten Jahr maximal 1 %, im zweiten 2 %. Zudem wird die Mindestdauer von befristeten Mietverträgen auf fünf Jahre verlängert, um Planungssicherheit zu schaffen. In Graz ortet SPÖ-Stadträtin Doris Kampus dringenden Handlungsbedarf. Hohe Mieten, ein zu geringer Anteil an Gemeindewohnungen und wachsender Leerstand seien alarmierend. Die SPÖ fordert eine rasche Umsetzung des Leerstandsregisters und die Beibehaltung der Leerstandsabgabe. Zudem müsse Kurzzeitvermietung im urbanen Raum, etwa über Airbnb, stärker reguliert werden, um gewinnorientierte Spekulation zu verhindern und leistbaren Wohnraum zu sichern.
2025 zeichnet sich erstmals wieder ein positiver Trend am Immobilienmarkt ab. Im ersten Halbjahr wurden rund 10 % mehr Verbücherungen ins Grundbuch verzeichnet als im Vergleichszeitraum 2024 – ein klares Signal dafür, dass der Abwärtstrend gestoppt ist. Auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anspruchsvoll bleiben, zeigen die Marktdaten einen Aufwärtsschwung.
„Das Jahr 2024 war ohne Zweifel fordernd – aber wir haben es als Netzwerk beeindruckend gemeistert. Trotz rückläufigen Marktes verzeichnete RE/MAX mehr Immobilienverkäufe als je zuvor. Wir sind inzwischen an rund 30 Transaktionen pro Tag beteiligt und konnten unsere Marktstellung weiter festigen“, so Elke Raich, Immobilienmaklerin bei RE/MAX for all in Graz.
Ihr Kollege Daniel Harg ergänzt: „Der starke Jahresauftakt setzte sich weiterhin fort. Der kumulierte Umsatz von Jänner bis Juni liegt bei +29,87 % – damit übertreffen wir sogar das bisherige Rekordjahr 2022.“

Das Fundament dieses Erfolgs? Ein starkes Netzwerk, konsequente Investitionen in Technologie, Werbung und Weiterbildung, gelebte Kooperation zum Wohle der Kunden –und das positive Mindset im gesamten RE/ MAX-Team.
Entscheidend ist, mit erfahrenen Profis zu arbeiten.
Elke Raich und Daniel Harg begleiten Sie mit umfassendem Marktverständnis, strategischer Beratung und langjähriger Erfahrung im Raum Graz und Graz-Umgebung. Ob realistische Immobilienbewertung, maßgeschneiderte Verkaufs- und Preisstrategie oder ein individuelles Marketingkonzept – unser Rundum-sorglos-Paket reicht von der kostenlosen Ersteinschätzung bis weit über den Kaufabschluss hinaus. Wir sind Teil von RE/MAX for all – seit Jahren eines der drei erfolgreichsten Büros Österreichs – und stolz darauf, als RE/MAX die Nummer 1 am heimischen Immobilienmarkt zu sein. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!
Mag. (FH) Elke Raich
0664 42 41 767
e.raich@remax-for-all.at
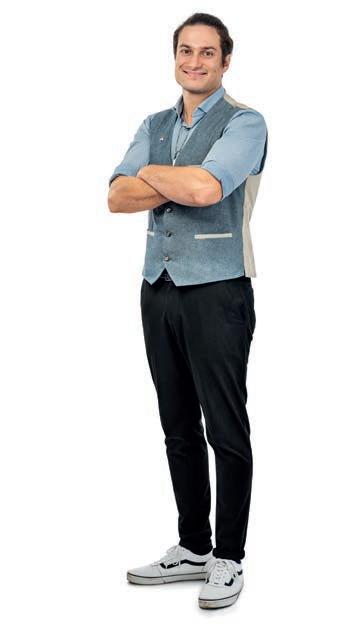
Daniel Harg
0664 18 73 385
d.harg@remax-for-all.at

Präsentierten die aktuelle Wohnstudie: (v.l.)
Steiermärkische Sparkasse Vertriebsdirektor
Peter Strohmaier, Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl und s-Real-GF Roland Jagersbacher
Der Wunsch nach Wohneigentum gewinnt in der Steiermark wieder an stärkerer Bedeutung. Laut der aktuellen Wohnstudie 2025, durchgeführt von Integral im Auftrag von Erste Bank, Sparkassen und s-Real, bevorzugen derzeit 52 % der Steirer und Steirerinnen Eigentum gegenüber Miete – trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten
Besonders stark ist das Interesse am eigenen Haus: 36 % der Befragten wünschen sich ein Einfamilienhaus, lediglich 16 % eine Eigentumswohnung. Insgesamt 39 % der Befragten träumen vom Eigenheim, doch 21 % halten diesen Traum angesichts hoher Preise und strenger Kreditvergaben für kaum realisierbar. Hoffnung gibt ein aktuell rückläufiges Zinsniveau: Mehr als die Hälfte sieht dadurch verbesserte Chancen auf Eigentum. Trotz hoher Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation (81 %) plant rund ein Drittel der Befragten innerhalb
der nächsten zehn Jahre einen Wohnortswechsel – vorzugsweise in ländliche Regionen. 31 % wünschen sich mehr Wohnfläche. Auch Nachhaltigkeit spielt eine zunehmende Rolle: Energieeffiziente Heizsysteme wie Fernwärme (34 %) und Wärmepumpen (23 %) stehen weiter hoch im Kurs.
Eigentum bedeutet Sicherheit
„Eigentum bietet nicht nur Wohnsicherheit, sondern auch langfristige Absicherung – vor allem im Alter“, betont Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steier-
märkischen Sparkasse. Die Nachfrage nach Wohnfinanzierung sei 2024 deutlich gestiegen. Über 20.000 Wohnberatungsgespräche belegen das hohe Interesse – ein Trend, den auch s-Real Steiermark bestätigt. „Ein weitgehend stabiler Immobilienmarkt ist der Schlüssel für mehr Investitionsbereitschaft in Wohneigentum“, erklärt sReal GF Roland Jagersbacher. Professionelle Bewertung und fundierte Beratung sollen Eigentumsentscheidungen erleichtern. Die Sparkasse sieht ihre Rolle dabei klar als verlässlicher Partner in allen Wohnphasen.


8020 Graz-Eggenberg: Nähe FH Joanneum u. Schloss Eggenberg / Gepflegte 2-Zimmer-Wohnung in Grünruhelage 59,24 m² Nutzfläche, ideales Anlegerobjekt, sehr gutes Raumkonzept, Zimmer getrennt begehbar, Kellerabteil, Parkplätze vorhanden (grüne Zone). HWB: 47,2 kWh/m2a, fGEE 0,92. KP: 159.000,- Euro, Renate Müller, M +43 664 8184132, renate.mueller@sreal.at, www.sreal.at


8010 Graz-Waltendorf: Elitäre Lage Ruckerlberg/Kleines aber feines Grundstück mit Stadtblick und Objektbestand aus Jahrhundertwende 211 m² Nutzfläche, 421 m² Grundstücksfläche, Baugrund ist voll erschlossen, Widmung WR 0,2 bis 0,6, Keller, Gas-Zentralheizung; HWB: 95 kWh/m2a, KP: 749.000,- Euro, Renate Müller, M +43 664 8184132, renate.mueller@sreal.at, www.sreal.at


8073 Feldkirchen bei Graz: Familienfreundliche 3-Zimmerwohnung in Grünruhelage
73,83 m² Nutzfläche, BJ 2007, im 2. und letzten Stock, gutes Raumkonzept, Süd-Ausrichtung, ca. 9 m² großer SüdBalkon, Carport zum KP von 15.000,- Euro, HWB: 61,4 kWh/m2a, KP: 174.000,- Euro, Renate Müller, M +43 664 8184132, renate.mueller@sreal.at, www.sreal.at

Persönliche Beratung im An- und Verkauf sowie umfassendes Service bei Ihren Immobilienentscheidungen haben bei uns erste Priorität.
Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung: von der sorgfältigen Bewertung über die Erarbeitung und Umsetzung eines Verkaufskonzeptes bis zur problemlosen Abwicklung des Kaufvertrages.
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Sandra Kielhauser
E-Mail:sandra.kielhauser@rlbstmk.at Tel.: 0316/8036-22704oder Mobil 0664/627 51 03
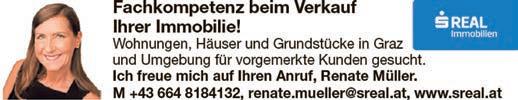


8401 KALSDORF bei Graz: Moderne 3-Zimmerwohnung mit großem Balkon 67,05 m² Nutzfläche, Erdgeschoss, sehr gutes Raumkonzept, große südseitige Terrasse mit ca. 22,10 m², hochwertige Einbauküche inkl. aller E-Geräte, Fernwärme, Fußbodenheizung, Tiefgaragen-Stellplatz zum Kaufpreis von 17.000,- Euro, Kellerabteil, HWB: 22 kWh/m2a., fGEE 0,71, KP: 181.000,- Euro, Renate Müller, M +43 664 8184132, renate.mueller@sreal.at, www.sreal.at

GRAZ-ANDRITZ:
Vielfalt pur: Ein Haus für jede Lebensphase - grenzenlose Möglichkeiten auf über 300 m²
Gstgr. ca. 1.390 m², Wfl. ca. 298 m², 6,5 Zi., 2 Balkone, 1 Terrasse, Garage,HWB: 130,8 kWH/ m2a, Klasse D, Kaufpreis: 899.500,- Euro, Objektnummer: 1606/16394
Mag. (FH) Elke Raich, +43 664/42 41 767, e.raich@remax-for-all.at

Sie suchen einen professionellen Partner für die Verwertung Ihrer Liegenschaft. Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung: von der sorgfältigen Bewertung über die Erarbeitung und Umsetzung eines Verkaufskonzeptes bis zur problemlosen Abwicklung des Kaufvertrages. Ich berate Sie gerne und freue mich auf Ihren Anruf.
Michael Pontasch-Hörzer, 0316/8036-2599 oder 0664/5345495. www.raiffeisen-immobilien.at
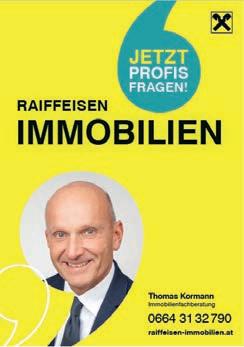

KOMPETENZ UNTER EINEM DACH
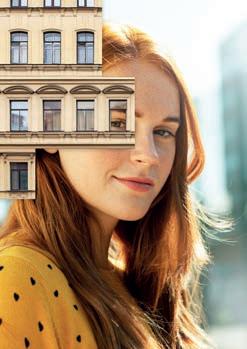
VALERI hat ein Auge für den Wert Ihrer Immobilie.
VERKAUF und VERMIETUNG

BERATUNG und EXPERTISE
BEWERTUNG und MARKTEINSCHÄTZUNG
FINANZIERUNG und FÖRDERUNG
VERANLAGUNG und ABSICHERUNG
RAIFFEISEN IMMOBILIEN STEIERMARK
VALERI, der schnelle Online Bewertungs-Check vom größten Immobilienbewerter.
Wohntraum-Center Graz | Radetzkystraße 15, 8010 Graz | Tel: 0316 8036 2596 raiffeisen-immobilien.at
Best of Fazitportrait
Von Volker Schögler mit Fotos von Heimo Binder


Thomas Hartlieb stellt in seiner Ölmühle im südsteirischen Heimschuh in vierter Generation Kürbiskernöl und weitere zwei Dutzend verschiedene Speiseöle her. Wie aus einer Getreidemühle aus dem 19. Jahrhundert und einem Sägewerk ein gut besuchtes Ölparadies und Ausflugsziel wurde, warum Kernöl niemals salzig sein sollte und ob der steirische Ölkürbis ein echter Steirer ist, hat Fazit versucht herauszufinden.
Wenn der gemeine Steirer »Kernöl« sagt, meint er immer Kürbiskernöl. Obwohl er weiß, dass das Unsinn ist. So wie der Schwede weiß, dass sich aus jedem Gräschen ein Schnaps brennen lässt, weiß der Steirer, dass sich aus jedem Kern ein Öl pressen lässt. Zumindest der Südsteirer. Zumindest einer wie Thomas Hartlieb. Er ist Ölmüller und seine Ölmühle steht im südsteirischen Heimschuh. Das ist später noch von Bedeutung. Hartlieb presst zur Zeit Öle aus 24 verschiedenen Kernsorten und eröffnet uns Unwissenden damit seltene wie ungeahnte neue Geschmackswelten. Wer weiß schon, wie Marillenkernöl schmeckt? Ja, Auskenner vermögen das zu erraten – es schmeckt nach Mandeln und riecht nach Marzipan. Aber haben Sie es schon einmal in einer Gemüsecremesuppe verkostet? Eben. Thomas Hartlieb, der den Betrieb in vierter Generation führt, weiß aber noch viel mehr und konnte mir eine alte Geschichte meines Vaters bestätigen, die noch dazu zu beweisen scheint, dass der steirische Ölkürbis, Cucurbita pepo var. styriaca, tatsächlich ein geborener Steirer ist, entsprungen der heimischen Scholle – Peter Rosegger hätte seine Freude gehabt, aber er hat ihn in dieser Form wahrscheinlich nicht gekannt, als er 1918 verstarb. Denn es ist erst ziemlich genau 100 Jahre her, als in der Süsteiermark bei den Ölkürbissen mit hartschaligem Kern eine Mutation entdeckt und weitergezüchtet wurde. Sie hat keine Schale um den Kern, genauer nur ein dünnes Häutchen. Damit entfiel die mühevolle, meist im Winter ausgeführte Arbeit für die Bauern, nach dem Trocknen der Kerne jeden einzelnen schälen zu müssen. Den Erzählungen meines Vaters nach tauchte die Mutation in der Oststeiermark Ende der Neunzehnzwanziger-, Anfang der Dreissigerjahre auf. Hartlieb: »Das Kürbiskernöl galt noch lange Zeit als Arme-Leute-Öl«. Das hat sich bekanntlich gewaltig geändert.
Suchtgefahr
Der Kürbis, von dem es mehr als 600 Sorten gibt, stammt ursprünglich aus Südamerika und ist in der Südsteiermark seit mehr als 300 Jahren bekannt. Wie das Öl seinerzeit hergestellt wurde, wird im frei zugänglichen Museum im Mühlenboden anhand der alten Originaleinrichtung anschaulich dargestellt und es ist klar erkennbar,


Erst in den letzten fünf bis sieben Minuten entstehen die Röstaromen.
Thomas Hartlieb
dass es sich hier auch um eine Getreidemühle gehandelt hat. Außerdem stand hier noch ein Sägewerk. Im Erdgeschoß neben dem Verkaufsladen trifft die Geschichte auf das Heute. Hier kann man jederzeit bei der zeitgemäßen Herstellungsmethode des Öls zusehen. In Hotels werden bekanntlich Duftstoffe eingesetzt, damit sich die Gäste wohlfühlen, hier sorgt der betörende Duft frischen Kernöls dafür, dass kaum ein Besucher dem Warensortiment widerstehen kann. Dass die meisten Leckerlis auch noch frank, frei und problemlos zu verkosten sind, gehört eigentlich verboten. So groß sind Sucht- und Abhängigkeitsgefahr angesichts von mit Schokolade, Wasabi, Karamell und Co überzogenen Kürbiskernen, diversen Mehlen und Mehlzusätzen, (Brot-)Backmischungen, Nudeln, Pestos, Marmeladen (von Isabellatrauben bis Kriecherl vulgo Mirabellen) und Fruchtaufstrichen, steirischem Reis, Gewürzen, Senfen bis zu Kochbüchern – teils aus eigener Produktion, teils Handelsware. Und im Onlineshop gibt es noch viel mehr. Während die unzähligen Essig- und Essigbalsamsorten von Apfel über Brombeer bis zu Zitrone und Schalotten wegen des hohen Säuregehalts eher nur für hartgesottene Degustationsprofis sind, scheint bei der Verkostung der erwähnten 24 von Hartlieb selbst hergestellten, teils seltenen Öle die Ausschaltung des freien Willens Programm. Nur zur Appetitanregung ohne Kommentar: Distelöl, Mohnöl, Pistazienöl, Leinöl, Leindotteröl, Sonnenblumenöl, Pinienöl, Macadamianussöl, Mandelöl, Schwarzkümmelöl, Hanföl, Traubenkernöl. Das war gerade einmal die Hälfte der Produktion. Der Schlüssel zur Qualität ist wohl das Zusammenspiel von Güte der Kerne und traditionellem Ölmüllerhandwerk bei Hartlieb. Das Pressverfahren gestaltet sich je nach Kernsorte unterschiedlich: »Bis wir die Parameter für eine neue Ölsorte optimiert haben, vergeht bis zu einem halben Jahr.« Dabei kommt ihm die Erfahrung von mehr als einem Jahrhundert und vier Generationen bei der Produktion von steirischem Kürbiskern- und Walnussöl zugute. »Das Endprodukt muss sich durch bestmöglichen Geschmack auszeichnen«, so der Ölmüller. Auch, wenn dabei die Geschwindigkeit der Herstellung geringer sei im Vergleich zu quasi automatisierten Ölproduktionen.
Kernölmuseum
Als Thomas‘ Urgroßvater Karl Hartlieb 1907 die Getreidemühle mit Sägewerk aus dem Jahr 1898 erwarb und nur wenige Jahre später eine kleine Ölmühle einrichtete, war diese für die ruhigen Wintermonate in der Müllerei gedacht. Die nahe Sulm lieferte die
Energie für den Betrieb, doch ständige Hochwasser bereiteten große Probleme. Großvater Albin modernisierte die Ölmühle 1957 und stattete sie mit einer gusseisernen Röstpfanne mit Rührwerk und mit einer modernen Hydraulikpresse aus, deren Zylinder aus einem alten Kanonenrohr gefertigt war. »Diese Presse ist nach der Generalüberholung im Jahr 2005 nach wie vor in Betrieb«, so Thomas Hartlieb. Als in den 1960-er Jahren im Zuge der Sulmregulierung die Wasserkraft wegfiel, stellte sein Großvater die Getreidemüllerei zur Gänze ein. Mit dem aus dem Verkauf des Wasserrechts erworbenen Kapital schaffte er eine neue Bandsäge an und konzentrierte sich neben dem sogenannten Landesproduktenhandel vor allem auf den Betriebszweig Sägewerk und die Herstellung von Mischfutter. Thomas‘ Vater Gerhard schließlich erbaute im Jahr 1985 ein neues modernes Bandsägewerk, das in den folgenden 20 Jahren den wirtschaftlichen Bestand des Unternehmens sicherte. In dieser Zeitspanne wurde die Ölmühle aber zu einem immer wichtigeren Geschäftszweig. Insbesondere die Nutzung des Betriebsstandortes mitten im südsteirischen Weinland als touristisches Ausflugsziel war Gerhard Hartlieb schon früh ein Anliegen. Im Zuge der Landesausstellung »Weinkultur« in Gamlitz 1990 richtete er einen kleinen Schauraum mit alten Geräten und Werkzeugen zur Kernölherstellung ein und öffnete die Türen der Ölpresse für jedermann, was damals noch eher ungewöhnlich war. Die ständig steigenden Besucherzahlen brachten der Sammlung bald den Titel »Kernölmuseum in Heimschuh« ein. Thomas Hartlieb, der jetzige Chef, übernahm das Unternehmen im Jänner 2000: »Wir haben 2004 mit dem Neubau der Ölmühle begonnen und ein Jahr später in Betrieb genommen. Jetzt erfüllt die Mühle auch die strengen Auflagen bezüglich der Betriebshygiene im Lebensmittelbereich.« Die größte Herausforderung für ihn war, das über Generationen erworbene Wissen um die Herstellung hochwertiger Öle anzunehmen und den heutigen Gegebenheiten anzupassen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.
200 Tonnen Kürbiskerne
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Sägerbranche machte Ende 2006 die Stillegung des Sägewerks notwendig. Die Maschinen wurden verkauft, die Halle zu einer ohnehin bereits dringend benötigten Lagerhalle für Rohstoffe zur Speiseölerzeugung umgebaut. Der adaptierte 120 Quadratmeter große Ausstellungsraum im Obergeschoß, der Mühlenboden der ehemaligen Getreidemühle, zieht mit der Ausstellung »Kernöl einst und jetzt«
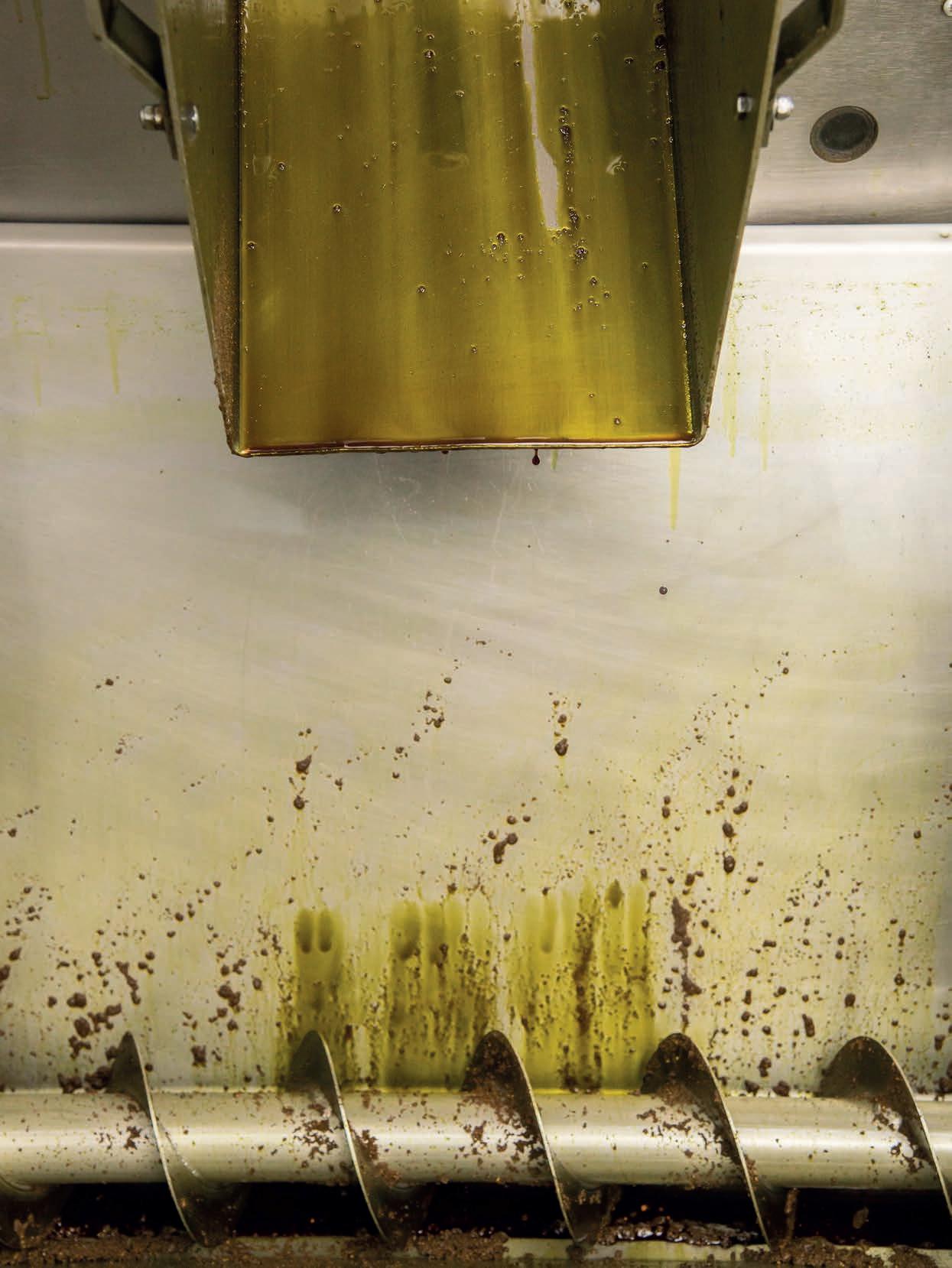


Wenn Kernöl salzig schmeckt, dann muss das Salz nachträglich zugefügt worden sein.
Thomas Hartlieb
pro Jahr mehr als 10.000 Besucher an und hat sich zu einem wettersicheren Ausflugsziel entwickelt . »Wenn man die tägliche Laufkundschaft mitzählt, werden es schon 20.000 sein«, so Hartlieb. Schließlich ist sein Betrieb von Montag bis Samstag geöffnet und produziert an den Wochentagen in zwei Schichten, um der Nachfrage gerecht zu werden. 200 Tonnen Kürbiskerne werden pro Jahr verarbeitet und ergeben eine Ausbeute von 80.000 Liter Kernöl. Zwei Drittel davon als Lohnpressung für die Bauern. Hartlieb selbst betreibt keine Landwirtschaft, sondern kauft die Kerne im Umkreis von 20 Kilometern zu und dieses sein Drittel unter eigenem Namen. Die Abfüllung erfolgt erst nach rund eineinhalb bis zwei Wochen, weil sich das Öl setzen muss, im Verkauf ist es bei Thomas Hartlieb nie älter als zwei Wochen. 15 Mitarbeiter erwirtschaften so einen Umsatz von zwei Millionen Euro im Jahr. Rund 60 Prozent der verkauften Öle sind Kürbiskernöl. Ein Liter kostet zur Zeit 24,80 Euro, ab Hof 21,50 Euro. Für einen Liter Kernöl werden zweieinhalb Kilogramm Kerne benötigt – »das sind 35 bis 40 Kürbisse«, so der Ölmüller. Seit 1998 gibt es für das steirische Kürbiskernöl den strengen Marken- und Herkunftsschutz innerhalb der EU, eine Plakette mit dem Zusatz »ggA«, was für »geschützte geografische Angabe« steht. Denn die größte Anbaufläche des steirischen Ölkürbis ist heute bereits Niederösterreich. Aber neben den Kriterien »Herkunft der Kerne« und »Kernsorte« muss auch der »Standort der Mühle« – nämlich in der Steiermark – erfüllt sein. Daher auch eingangs die Erwähnung, dass sich die Ölmühle von Hartlieb in Heimschuh befindet. Insgesamt gibt es in der Steiermark etwa 35 Ölmühlen. »Und mit der Prüfnummer kann der Flascheninhalt bis zum Acker rückverfolgt werden«, sagt Thomas Hartlieb.
Ölmühle Hartlieb
8451 Heimschuh, Mühlweg 1 Telefon +43 3452 825510 hartlieb.at
Dieses Fazitportrait erschien erstmals im November 2021.
Die Salzsache
Viertes Kriterium ist die Produktionsmethode, die sich aus vier Arbeitsschritten zusammensetzt: mahlen, kneten, rösten, pressen. Was so einfach klingt, ist in Wahrheit die Kunst. 60 Kilo Kerne – so viel fasst die große Presse – müssen vor dem Mahlen getrocknet sein. Die kleinere 30-Kilo-Presse ist im Übrigen für die anderen Öle da. Der entstandene Kernbrei wird in der Folge mit 10 bis 15 Liter heißem Wasser und rund 500 Gramm Salz versetzt, weil sich sonst Öl und Eiweiß nicht trennen. Das nicht fettlösliche Salz dient bei diesem als Denaturierung bezeichneten Vorgang nur als Hilfsstoff und bindet beim anschließenden Röstvorgang das durch die Temperatur verfestigte Eiweiß (Konditionierung) und so wie das Wasser sich durch Verdampfung verflüchtigt, erhält auch das Salz keinen Zugang zum Öl. Hartlieb: »Wenn Kernöl salzig schmeckt, dann muss das Salz nachträglich zugefügt worden sein.« Das wollte ich schon immer wissen. Erfahrung und Geschick sind für die Qualität ausschlaggebend. Der Röstprozess bei rund 100 Grad dauert etwa 45 bis 60 Minuten: »Aber erst in den letzten fünf bis sieben Minuten entstehen die Röstaromen.« Es wird mild-feinnussig bis kräftig würzig mit feinen Karamell- bis Kaffeetönen. Dieser Vorgang wird durch den Ölpresser gesteuert und ist daher eine handwerkliche Fertigung. Er benötigt neben Erfahrung auch sehr gute Produktkenntnisse. Dieses Wissen wird im Detail von Generation zu Generation weitergegeben. Das anschließende Pressen ist weniger geheimnisvoll, eher eine Frage von Kraft. Wer es wissen will: Pressdruck 300 Kilo pro Quadratzentimeter. Der Presskuchen wird vermahlen und als Tierfutter genutzt. Nach den erwähnten zwei Wochen im Lagertank aus Edelstahl haben sich die Schwebstoffe abgesetzt, das Öl wird in Flaschen gefüllt, fertig. n

Literatur

Ich trage zwar, seit ich fünfzig bin, keine Bluejeans mehr, aber meine Träume sind immer noch Kinderträume.
Claus Peymann, 1937–2025, deutscher Intendant und Theaterregisseur
Mit Natascha Gangl hat eine von uns (sic!) das Wettlesen in Klagenfurt gewonnen. Womit bewiesen ist: Auch steirische Autoren sind wettbewerbsfähig. Endlich sind wir wieder wer.
Von Michael Petrowitsch
Es war ja irgendwie auch und doch ordentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Welcher Steirer macht das Rennen? So zumindest wurde es von gewisser Seite propagiert. War lustig. In den »sozialen Medien« wurde ein Ringen um den begehrtesten Platz zwischen Max Höfler und Natascha Gangl inszeniert. Wir haben uns gedanklich beteiligt, die Sache beobachtet und insgeheim Däumchen gedrückt. Nun also doch eine Frau. Naja, wieso eigentlich nicht.
Sapporo lässt grüßen
Die Rückkehr nach Graz wurde im Literaturhaus zelebriert wie weiland die Rückkehr von Schranz aus Sapporo, der hat damals halt nichts gewonnen. Unsere schon, noch dazu eine, die sich mit Identitärem auseinandersetzt. Die dies sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat und nun in einer Vielschichtigkeit unterwegs ist, die ihresgleichen sucht. Hut ab. Die Abkunft macht das Werk. Autor und Werk trennen? Niemals! Die Radkersburgerin ist keine Mureckerin und schon gar keine Spielfelderin oder Ratscherin. Sie ist ähnlicher der Oberradkersburgerin, ein Ort, der genuin anders heißt, aber gleich funktioniert. Sie ist allerdings auch keine aus Radkersburg-Umgebung. Der halbe Kilometer macht den Unterschied.
Südsteiermark. Oder doch nicht Und da sind wir beim Thema: Die Bezeichnung »Südsteiermark« ist in die-
sem Fall so falsch wie nur was. Denn der Radkersburger Winkel ist eigen, so seine Menschen. Das ist bekanntlich historisch bedingt und wird transgenerational weitergegeben. Dass Natascha Gangl von dort stammt und sich damit, natürlich abstrahiert, auseinandersetzt, ist ihr hoch anzurechnen. Einerseits ist die Dialektfrage eine Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff, auf der anderen Seite sollte man sich genau diesen nicht wegnehmen lassen. Von niemandem. Natur-
gemäß soll und muss das Schreiben kritisch sein, so will es der Literaturkanon. Die Frage in diesem Fall ist immer, wie lege ich es an? Die Thematiken sind eigentlich ausgelatscht bis dorthinaus. Eigentlich eh schon alles gesagt. Und dann kommt doch eine daher und definiert alles neu. Man will ja nicht den Allerweltsteufel an die Wand malen und etwas von der »jüngeren Generation« daherfaseln. Aber in diesem Falle stimmt es doch.
Narrative halt
Auf der anderen Seite: Aber dort leben? Nein danke! Man kann über diese dort erlebten, recherchierten bzw. erzählt bekommenen Dinge nur mit Abstand schreiben und sprechen. Bleibt man im Grenzgebiet und fängt an sich zu äußern, fällt man unweigerlich in das falsche Narrativ. Was ist denn eigentlich das »falsche Narrativ«? Schwer zu sagen, das richtige ist auf alle Fälle das andere. Man kann Frau Gangl auf alle Fälle nur das Beste wünschen. Machen Sie bitte was aus dem Hype, aber trauen Sie ihm nicht! n
Natascha Gangl, geboren 1986 in Bad Radkersburg, hat mit ihrem Text »da Sta« das heurige Preislesen in Klagenfurt gewonnen.


Simone Kopmajer
Von Andreas Pankarter
Am Sonntag, den 24. August verwandelt sich der idyllische Klostergarten in Frohnleiten in eine Bühne voller Gefühl. Die österreichische Jazzsingerin Simone Kopmajer ist erneut zu Gast und lädt zu einem musikalischen Sommerabend der besonderen Art ein. Begleitet von ihrer Band, präsentiert sie unter dem Motto »Hope« gefühlvolle Songs voller Wärme, Tiefe und Charme. Also perfekt für alle, die sich gerne von Musik berühren lassen. Konzertbeginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf um 29 Euro bei Öticket oder telefonisch unter 06767667000 und an der Abendkasse um 35 Euro. Freie Platzwahl sorgt für entspannte Atmosphäre. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Konzert in die Pfarrkirche Frohnleiten verlegt. Die Magie des Abends bleibt also in jedem Fall erhalten. n
Blasmusiksommer
Die Blasmusikkonzerte in Frohnleiten sind beliebter Treffpunkt im Sommerkalender der Region. Bis zum 5. September gibt es jeden Freitag ab 17 Uhr stimmungsvollen Konzerte bei freiem Eintritt.

Halbzeit beim Frohnleitner Blasmusiksommer – und es steht bereits fest, die Konzerte sind mit je rund 250 Besuchern erfolgreich. Tendenz steigend. Ihr Debüt am Hauptplatz von Frohnleiten feiert am Freitag, dem 1. August, die Formation »Die fidelen Sechziger«, ein Ensemble mit 18 Musikerinnen und Musikern aus der Region Graz-Umgebung Nord und dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Ihr Programm umfasst traditionelle böhmisch-mährische Musik ebenso wie moderne Arrangements, Polkas und Märsche. Eine Woche später, am 8. August, folgt ein Auftritt der »Gratweiner Böhmischen«. Die etwa 15-köpfige Gruppe ist ein Nebenprojekt des Musikvereins Gratwein. Auch außerhalb des regulären Vereinsjahres
Die Mitglieder des Musikvereins Gratwein widmen sich mit Hingabe der böhmischen Blasmusik.
widmen sich die Musiker ihrer Vorliebe für böhmische Blasmusik. Das Repertoire reicht von klassischen Kompositionen Ernst Moschs bis zu zeitgenössischen Stücken der Szene. Am 15. August ist mit den »Blechvögl« erstmals eine Gruppe aus dem Schilcherland in Frohnleiten zu Gast. Gegründet im Jahr 2022, verbindet die Formation Brass-Musik mit Evergreens und Pop-Elementen. Den Abschluss bildet am 22. August die Postmusik Graz, die mittlerweile zum festen Bestandteil der Veranstaltungsreihe zählt.
»Der Blasmusiksommer ist eine gute Gelegenheit, den Feierabend gemeinsam mit anderen zu verbringen und dabei die musikalische Vielfalt heimischer Ensembles zu entdecken«, sagt Wolfgang Kasic, der die Konzertreihe seit mittlerweile 22 Jahren organisiert. n
Rezension
Sie ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel und eine der größten Burganlagen Österreichs, sondern geradezu das Wahrzeichen für die Oststeiermark. Die imposant auf dem markanten Basaltfelsen thronende Riegersburg. Jetzt liegt über diese »Festung im Wandel der Zeit« ein neues Buch vor.
Von Josef Schiffer
Der Grazer Wirtschaftshistoriker Walter M. Iber hat in einem handlichen Führer all das an Informationen untergebracht, was man zu Baugeschichte, Besitzern und Kunstschätzen wissen muss. Das umfangreiche Bildmaterial erlaubt einen guten Einblick in Vergangenheit und Gegenwart der Burg. Sozusagen im Schatten der Riegersburg aufgewachsen, kennt Iber von Jugend an alle Winkel und kleinen Geheimnisse der Wehranlage. Darüber hinaus will der Autor dem Leser aber mehr bieten als einen klassischen Burgführer: In zwei einleitenden Kapiteln bettet er das Bauwerk in die regionale und örtliche Umgebung ein. Er skizziert die bewegte Geschichte der Oststeiermark von der Babenbergerzeit über Türkengefahr und Hexenprozesse bis hin zu den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges, als die Burg schwere Schäden erlitt.
Zahlreiche Burgherren wie -herrinnen Nicht weniger bewegt ist Geschichte der Besitzer: Sie nimmt ihren Anfang mit dem halb legendenhaften Gründer Rudiger, der die Burg um 1125 erbaute und nur in Urkunden fassbar ist. Später wechselten die Besitzerfamilien häufig: Auf Walseer, Kuenringer, Reichenburger und Stadl folgte im 17. Jahrhundert Katharina Galler, die berüchtigte »Gallerin«. Nach dem Erlöschen der Grafen Burgstall erwarb 1822 Johann von Liechtenstein die Burg. Unter den Liechtensteinern wurde der Ort schon um 1900 zu einem Touristenmagneten. Einen neuen Aufschwung erlebte das vom Verfall bedrohte Objekt, als Prinz Friedrich und Prinzessin Annemarie in den späten Neunzehnsechzigerjahren in den Ort Riegersburg zogen und das Ruder in der Burgverwaltung übernahmen.
Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wurde die Riegersburg 1987 zum Schauplatz der erfolgreichsten steirischen Landesausstellung »Hexen und Zauberer«. Heute ist die Burg mit ihren zahlreichen Attraktionen aus dem touristischen Angebot der Steiermark nicht mehr wegzudenken.
Wissenschaftlicher Anspruch
Eine ausführliche Beschreibung der Burganlage und ihrer Räumlichkeiten, eine Zeittafel sowie ein Literaturverzeichnis runden den Band ab. Trotz des kompakten Umfangs ist Iber den wissenschaftlichen Ansprüchen treu geblieben und hat in zahlreichen Fußnoten die Quellen belegt und interessante Zusatzinformationen verpackt. n
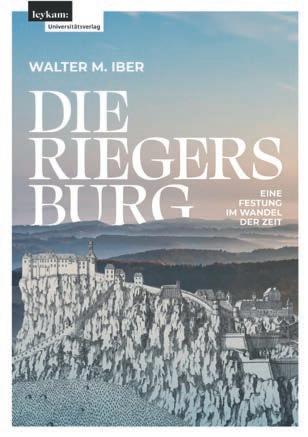
Die Riegersburg Eine Festung im Wandel der Zeit. Buch über die Geschichte der Burg von Walter M. Iber, Leykam 2025, 174 Seiten, ca. 25 Euro leykamverlag.at
Die Saison 2025/26 verspricht einen wahren Wunderreigen in Schauspielhaus und Oper von Graz. Ein kleiner Überblick über Großes und Erbauliches. Über Gewagtes und Kritisches.
Von Michael Petrowitsch
Die Spielzeit 2025/26 bietet Oper, Operette und Musical, das Versprechen von Ulrich Lenz, dem Intendanten, soll man beim Wort nehmen. Denn durfte er in der vergangenen Saison mit »Tannhäuser«, den »Trojanern« und dem Tanzabend »Sacre!« den 125. Geburtstag des ehrwürdigen Hauses begehen, steht in der aktuellen Saison erneut ein Jubiläum an: 75 Jahre Grazer Philharmoniker. Ohne den Klangkörper der Grazer Philharmoniker wäre das Programm der Oper Graz schlicht unmöglich.
Vielfältiges Angebot
Das Haus bietet wieder ein vielfältiges Angebot aus 289 Jahren Musik- und Tanztheatergeschichte. So zeigt uns Mozarts gerade in der Orchesterbehandlung einzigartige Oper »Idomeneo« – in gedanklicher Fortsetzung der »Trojaner« – einen Kriegsheimkehrer, der den Krieg weiter in sich trägt. Alban Bergs nur 50 km von Graz in Trahütten komponierter »Wozzeck« erzählt die Geschichte eines Femizids als verzweifelten Ausbruchsversuch des tragischen Titelhelden. Ein taffes »Schneewittchen« hingegen nimmt in Elena Kats-Chernins und Susanne Felicitas Wolf Version des bekannten Märchens ihr Leben in die eigene Hand. Die Marschallin in Richard Strauss’ »Rosenkavalier« will der nachfolgenden Generation ihr eigenes Schicksal ersparen. Auf der Studiobühne wiederum entdeckt ein inklusives Ensemble aus Spielern der »Theaterakademie LebensGroß« und Sängern der Grazer Oper eine gemeinsame Produktion. Schon am 27. September wird mit »Idomeneo« gestartet. Wolfgang Amadeus Mozart in seiner reinsten Form. »On the Town«, ein Musical von Leonard Bernstein folgt bereits am 25. Oktober. Ganz besonders freuen wir uns auf den »Wozzeck« von Alban Berg im Februar 2026.
Dritte Spielzeit
Die Intendantin des Schauspielhauses, die große Andrea Vilter, wiederum geht nun in die dritte Spielzeit in Graz. In ihrem Vorwort zum Programm 25/26 konstatiert

Chefdramaturgin
Anna-Sophia Güther und Intendantin Andrea Vilter bei der Präsentation der nächsten Spielzeit
sie zu Recht: »Die Welt sieht inzwischen anders aus und als Theaterschaffende haben wir – immer noch – das Privileg und die Verantwortung, uns mit unserer Kunst dazu zu verhalten. Reflexion, Auseinandersetzung und Kritik gehören genauso unabdingbar zum Theater wie Unterhaltung und das Erleben von Gemeinschaft. Haltung zu zeigen ist uns ebenso wichtig wie Fragen zu stellen.« Ein wahres Wort. Demensprechend gestaltet sie auch die kommenden Monate. Ganz spannend finden wir ein Projekt gleich zu Anfang im September, als Reaktion auf die Entwicklungen in der steirischen Kulturpolitik. Hier hat sich Vilter für ihre Institution kurzfristig dazu entschieden, eine zusätzliche Spielplanposition mit Akteuren der lokalen freien Szene
zu arrangieren. In einem Open Call wurde dazu eingeladen, Projekte vorzustellen, die durch die Kürzungen im Kulturbudget gefährdet sind.
Vorrang für das Junge Unter zahlreichen spannenden Einreichungen hat man der jungen Generation den Vorrang gegeben und eine Gruppe von Grazer Künstlern eingeladen: Das Team um Azlea Wriessnig, Alexander Benke und Marie Treuer beschäftigt sich in seinem aktuellen Projekt »Belly of the Best« mit dem Neuknüpfen und Pflegen von Beziehungen in einer aus den Fugen geratenen Welt. Das wird eine spannende raumgreifende Uraufführung. Und den ganzen Rest entnehme man bitte dem Netz. n

Wir suchen zum sofortigen Eintritt: mobile Betreuung von Menschen mit Behinderung sowie Buchhaltung und Organisation für unsere Projekte +43 316 677 248 job@spia.org

Allmonatliche Finalbetrachtungen von Johannes Tandl

Österreich ist kein armes Land. Aber ein erstaunlich ineffizientes. Die wirtschaftliche Basis ist stabil, der soziale Friede intakt und auch die Innovationskraft ist durchaus vorhanden. Dennoch scheinen wir Jahr für Jahr mehr Kraft aufzuwenden, um immer langsamer voranzukommen. Was wie ein Paradoxon klingt, ist das Ergebnis politischer Trägheit, ideologischer Selbstblockade und der Weigerung, notwendige Reformen anzupacken. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen, das ist die Steuer- und Abgabenlast. Österreich zählt zu den internationalen Spitzenreitern, wenn es darum geht, Arbeit hoch zu besteuern. Wer sich anstrengt, wird kräftig zur Kasse gebeten. Liberale Ökonomen sprechen von einer »Entmutigung der Leistungsbereitschaft« – und treffen damit ins Schwarze. Wer das Gefühl hat, dass sich Mehrarbeit nicht lohnt, zieht sich zurück. Das schadet dem Einzelnen und dem Standort. In einer offenen Volkswirtschaft ist Wettbewerbsfähigkeit kein Luxus, sondern eine Überlebensbedingung. Dazu passt das
Reformstau.
Österreich steht sich selbst im Weg
zweite Problemfeld, die Ausgabenpolitik. Selbst in wirtschaftlich guten Zeiten steigt bei uns die Staatsverschuldung, als wäre Geld kein knappes Gut, sondern eine natürliche Ressource. Corona mag Ausnahmen gerechtfertigt haben, doch was folgte, war kein Rückbau, sondern die Fortsetzung der Gießkannenpolitik mit neuen Etiketten. Antiteuerungsmaßnahmen, Energiegutscheine, Klimaboni – auch für jene, die keine Hilfe brauchen. Es fehlt nicht am Geld, sondern an Priorisierung und Mut zu klaren Kriterien. Und auch der Sozialstaat ist Teil des Problems. Aber er ist auch Teil der Lösung. Österreich leistet sich ein überkomplexes Transfersystem mit zahlreichen Fehlanreizen. Besonders augenfällig wird das bei der Mindestsicherung für kinderreiche Familien ohne Erwerbstätigkeit – ein Thema, das vor allem aber nicht nur Wien betrifft. Statt Menschen aus der Abhängigkeit zu holen, zementiert dieses System die Perspektivenlosigkeit. »Leistung muss sich lohnen« ist keine neoliberale Phrase, sondern Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit, die mehr sein will als ein reiner finanzieller Lastenausgleich. Gleiches gilt für das Pensionssystem. Die demografische Entwicklung ist kein Geheimnis, ebenso wenig der Umstand, dass das faktische Pensionsantrittsalter deutlich unter dem gesetzlichen liegt. Jährlich fließen Milliarden aus dem Budget in die Pensionstöpfe – Geld, das anderswo fehlt. Eine automatische Anpassung des Antrittsalters an die Lebenserwartung wäre sinnvoll. Doch die Politik will lieber beliebt sein als ehrlich. Ähnlich ist es im Bildungsbereich. Die Ausgaben sind hoch, die Ergebnisse aber nur mittelmäßig. Österreichs Schüler schneiden bei Pisa und anderen Vergleichen nicht schlecht, aber eben auch nicht gut ab. Das Problem liegt nicht allein am Geld, sondern an Strukturen, die zu wenig Autonomie, zu wenig Leistungsorientierung und zu wenig Transparenz bedingen. Wer das Lernen erleichtern will, muss auch bereit sein, Unterschiede sichtbar zu machen und gezielt zu fördern. Am Arbeitsmarkt verschärft der Fachkräftemangel den Strukturstau. Österreich braucht qualifizierte Zuwanderung; nicht irgendwann, sondern jetzt. Doch
während Asylmigration dominiert, fehlt ein attraktives System für jene, die mithelfen wollen, dieses Land wirtschaftlich und gesellschaftlich zu tragen. Warum erhält nicht jeder Zuwanderungswillige der einen Arbeitsplatz nachweisen kann, automatisch eine Arbeitserlaubnis? Ganz ohne Bürokratie! Zuerst als Saisonier, danach befristet auf drei Jahre und später eben unbefristet? Und dann sind da noch die Bürokratie, die Klimapolitik oder der Föderalismus. Egal ob Kohlendioxidbepreisung oder Heizungsförderung: Es dominiert Chaos statt Konzept. Die eine Hand weiß nicht, was die andere verbietet. Anstatt auf marktwirtschaftliche Anreize zu setzen, überbieten sich Ministerien mit Regulativen, die lähmen statt lenken. Dabei wären die Aufgaben klar: Bürokratie abbauen, Kompetenzen entflechten, Zuständigkeiten klären. Doch auch hier bleibt es beim Klein-Klein. Österreich hat also keinen Ressourcenmangel, sondern ein Reformdefizit. Es fehlt nicht an Ideen, sondern am Willen, an strategischer Klarheit und am Mut zur Reduktion. Wer alles fördern will, fördert am Ende niemanden. Wer alles absichern will, destabilisiert das Ganze. Wer den Wandel verweigert, verliert irgendwann alles. Es wird Zeit, dass sich etwas ändert. Nicht irgendwann. Jetzt. n
Sie erreichen den Autor unter johannes.tandl@wmedia.at









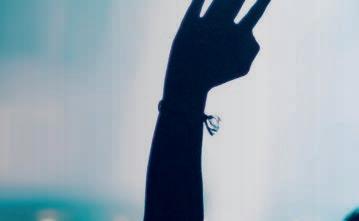
















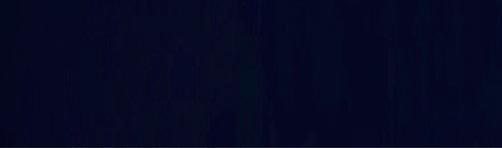
Vielen Dank an Anna Paier, Geschäftsführerin, Autohaus Paier & Paier GmbH für die gute Partnerschaft.

Die ganze Story auf wirmachtsmöglich.at