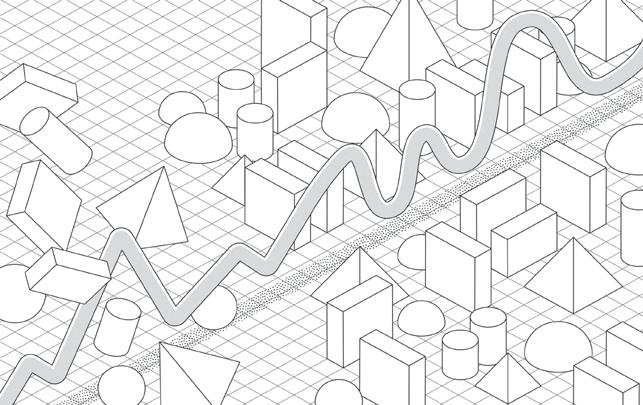5 minute read
Das Verhandeln der eigenen Gegenwart
from An die frische Luft!
by espazium.ch
studentischer Wettbewerb zur Utopie des Lernens in der Zukunft bringt überraschend vielfältige Lösungsansätze hervor.
Text: Hella Schindel
Vom Begriff der Utopie geht ein Zauber aus. Er ist eine Einladung zum losgelösten Denken, zum Entwickeln eines zukunftsorientierten Ideals. Im Studierendenwettbewerb «Utopia», bezogen auf das Lernen der Zukunft, öffnet er analoge und digitale Räume, imaginierte Bildwelten und existierende Architekturen, die sich auf ihre Nutzbarkeit als Lernumgebung überprüfen lassen müssen.
Besonders spannend ist die Suche nach einer Identität, die die
Lernenden auf eine neue Weise an die inzwischen ortlosen Institutionen binden könnte. So interpretierten auch viele der Teilnehmenden am studentischen Wettbewerb «Utopia» die Aufgabe und brachten dank dieser Freiheit im Denken inspirierte und inspirierende Lösungen hervor.
Blick in die Zukunft
Vor 100 Jahren legten Otto Rudolf Salvisberg und sein Protegé Otto Brechbühl einen radikalen Entwurf für das Unigelände Muesmatt in Bern vor, der den Beginn einer neuen Lernform ermöglichte und abbildete. Das Bauvorhaben war das erste, das die Architekten unter dem Namen Itten + Brechbühl ausführten. Um dieses Jubiläum im Sinne der Gründerväter zu feiern, wandte sich das Büro, das heute 350 Mitarbeitende zählt, mit einem Ideenwettbewerb an Studierende. Statt eines Rückblicks veranstaltete das Büro einen Wettbewerb, dessen Inhalt zugleich als
Hommage an seine eigenen Ursprünge zu verstehen ist. Vierzehn anonym eingereichte Antworten auf die Frage nach dem «Organismus für die Zukunft des Lernens» trafen ein. Die Offenheit der Aufgabe spiegelt sich in völlig unterschiedlichen Ansätzen. Das erstrangierte Team der ETH Zürich setzt auf die Auflösung der Universität in mehrere unabhängige Hubs, die als Lernorte mit unterschiedlichen Qualitäten digital vernetzt sind. Architektonisch stellen sich die Verfasserinnen die Hubs als spiralförmige Bauten vor, die in einem gut verbundenen Raster über die Stadt verteilt sind. Der klassische Campus bleibt als Ort der Identifikation und des Austauschs in veränderter Weise von Bedeutung und Teil des Systems.
Die Universität ist überall
Ein rein digitales Projekt, ebenfalls von Studierenden der ETH Zürich verfasst, landete auf dem zweiten Rang. Kern der Idee ist die Entwicklung einer App, die als Börse für zukünftige Lernorte funktioniert. Am Beispiel der Stadt Bern haben die Beteiligten eine Liste bestehender öffentlicher Orte zusammengetragen, die sich zum Lernen eignen – sie finden sie in ungenutzten Tiefgaragen oder auch im Münster. Weil die gewählten Räume allgemein zugänglich sind, stellen sie auch einen Beitrag zur Diskussion um Bildung für alle dar. Einzige Kritik an dem Wettbewerbsbeitrag ist seine Realitätsnähe – im Grunde kann die Idee sofort umgesetzt werden.

LERNWERK
Geschätzte Universität
Ganz im Gegensatz dazu basiert ein Beitrag aus der TU Braunschweig auf einer intellektuellen Grundidee: Der Schaffung eines fiktiven Raums für geistige Entfaltung, der durch das Nutzen aller Sinne entsteht. Der Verfasser geht von der These aus, dass sich jeder Mensch besonders stark auf einen seiner Sinne verlässt. Jedem davon ordnet er eine geometrische Figur zu. Indem er Räume imaginiert, die alle Geometrien in sich vereinen, bietet er Lernumgebungen an, die alle Sinne gleichmässig ansprechen und damit das Lernen bestmöglich unterstützen. Die Umsetzung der abstrakten Idee zum tatsächlichen Raum hält allerdings dem selbst gesetzten Niveau nicht stand.

Nachdenken
über das Lernen
Fusilli: Architektur einer Lernspirale (oben); in einem an die Universität adressierten Brief erklären die Verfasserinnen ihre Zuneigung (rechts).
WährendDuinderVergangenheitalstraditionellerCampus dasHerzstückderuniversitärenAusbildunggebildetund RäumefürjeglicheAnforderungenunddieergänzendeund notwendigeInfrastrukturgebotenhast,habensichdieZeitenmitderfortschreitendenDigitalisierungundletztendlich auchmitderPandemieverändert.VorlesungenundKurse könnenundwerdenzunehmendonlinestattfinden.Diesermöglichtdaszeit-undortsunabhängigeStudierenundauch, überdasmobileEndgerätamuniversitärenLebenteilzunehmen. Der traditionelle Campus wird dadurch hinfällig. DieserEntwicklungzumTrotzgibtesauchheutenochQualitäten,diewirandirnichtmissenmöchten.InZukunftsollst DunochstärkereinOrtdesZusammentreffensunddesAustauschsseinundalsAnlaufstelledienen.DennschlussendlichbistDuauchderOrt,mitdemwirunsidentifizieren,und der Ort, der uns alle verbindet.
Deine Studierenden
Ganz ohne architektonische Vision und auch ohne die eigentlich geforderten Planzeichnungen kommt der viertplatzierte Beitrag von Studierenden der Fachhochschule Muttenz aus. In einem textbasierten Blatt stellen sie die Verlagerung des Lernorts von räumlichen Umgebungen auf ein soziales Netzwerk heraus. Die Gegenwart anderer Menschen ist die Quelle von Wissen, auf die sie setzen. Eine logische Schlussfolgerung daraus ist die Einordnung von Lernen als lebenslangen permanen ten Zustand, der uns begleitet und an keinen Ort gebunden ist. Obwohl diese Betrachtungsweise zu keiner architektonischen Utopie und auch zu keiner der geforderten Planzeichnungen führt, schätzte die Jury die vertieften Gedankengänge.
Die ausgezeichneten Beiträge werden anlässlich der nächsten Architekturbiennale im European Cultural Center in Venedig ausgestellt sein (20. 5. bis 26. 11. 2023).
Für 2024 kündigen Itten + Brechbühl einen weiteren Ideenwettbewerb für Studierende an, der wieder Raum für neue Szenarien und eine Plattform für die Arbeiten der jungen Generation bieten will. Solche Gelegenheiten, die Grenzen der Realität gedanklich zu überschreiten und dafür sogar einen Preis in Aussicht gestellt zu bekommen, sollten die Studierenden nicht ungenutzt verstreichen lassen! •
«Utopia. Lernen der Zukunft», offener Wettbewerb für Studierende, ausgelobt von Itten + Brechbühl (2022)

FACHJURY
Dr. Sabine v. Fischer, Agentur für Architexte; Dr. Etna R. Krakenberger, Stabsleitung Lehre, Universität Bern; Pascal Posset, Landschaftsarchitekt BSLA, Hager Partner; Shadi Rahbaran, Architektin BSA, Rahbaran Hürzeler Architekten; Andreas Ruby, Direktor SAM (entschuldigt)
INTERNES PREISGERICHT

ITTEN + BRECHBÜHL (nicht stimmberechtigt)
Christoph Arpagaus, Vorsitzender der Geschäftsleitung; Daniel Blum, Leiter Entwurf Basel; Lidor Gilad, Partner, Leiter Entwurf Schweiz
Weitere Pläne und Bilder auf espazium.ch; Kurzlink: bit.ly/wb-utopia
Archimillenials im Fokus
Das späte 20. Jahrhundert ist selten im Fokus denkmalpflegerischer Debatten. Mit der Kampagne «Baukultur von 1975–2000» setzt der Heimatschutz den Anspruch auf den Erhalt dieser «Archimillennials».
Kanton Zürich
Baudirektion
Hochbauamt
Rathaus Zürich
Gesamtinstandsetzung und Erneuerung
Projektwettbewerb im selektiven Verfahren
24. Februar 2023
Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet einen selektiven Projektwettbewerb zur Vergabe von Generalplanerleistungen für die Planung, Ausschreibung und Realisierung der Gesamtinstandsetzung und Erneuerung des Rathaus Zürichs.
Bauaufgabe
Verwaltungsgebäude Titanic II, Bern
(Architektur: Rudolf Rast, Christian Furter 1993–1995).
Die Architektur der Jahre 1975 bis 2000 war bislang eher etwas für Connaisseurs denn für die breite Allgemeinheit. Bauten dieser Generation haben es in der öffentlichen Wahrnehmung oft schwer. Umso mehr überrascht die Zusammenstellung der Gebäude, die der Heimatschutz präsentiert: Vom Stadttheater in Winterthur (1976–1979) über die Chiesa di San Giovanni Battista in Mogno (1986) zum Verwaltungsgebäude Titanic II in Bern (1993–1995, vgl. Abb.) und vielen mehr. Die wissenschaftliche und baukulturelle Erforschung dieser Generation steht noch aus, gleichzeitig befinden sich unsere Städte in einem Transformationsprozess, der auch Bauten dieser Zeit unter Druck setzt. Mit der aktuellen Kampagne will der Heimatschutz den fachlichen Diskurs anstossen sowie die Wertschätzung dieser Periode verbessern. Zur Debatte gestellt werden aber nicht nur die Architekturen dieser Zeit, sondern auch die verbauten Materialien und Ressourcen. Die Lebenserwartung der architektonischen Kinder der BoomerGeneration ist noch lange nicht erreicht, sie alle sind noch keine 50 Jahre alt. Das wachsende Archiv auf der Website (vgl. Link unten) und auf Social Media zeigt wunderbare Bauten und verdeutlicht, dass im baulichen Erbe unserer jüngeren Vergangenheit einige Perlen zu finden sind. Diese jüngere Schweizer Architekturgeschichte gehört angemessen gewürdigt. Denn das Wissen um diese Bauten ist prägend für den zukünftigen Umgang und wird wegweisend dafür sein, wie wir unsere Städte weiterentwickeln. •
Salome Bessenich, Redaktorin Umwelt / Raumplanung
Weitere Informationen bit.ly/archimillenials
Gesucht wird ein Generalplanerteam unter der Führung eines Architekturbüros, welches die spezifischen Anforderungen an die Architektur, den Umgang mit dem Bestand und dessen Transformation an aktuelle und zukünftige Bedürfnisse sowie den Ratsbetrieb in hoher Qualität, Professionalität und Sensibilität umsetzen kann. Es sollen eine architektonisch, denkmalpflegerisch und betrieblich überzeugende Lösung sowie ein funktional, wirtschaftlich und nachhaltig optimiertes Projekt, welches interdisziplinär erarbeitet wurde, gefunden werden. Der Gestaltungsspielraum ist beim Rathaus als Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung limitiert, innovative Vorschläge werden erwartet.
Verfahren
Der Wettbewerb wird gemäss der Submissionsverordnung des Kantons Zürich öffentlich ausgeschrieben. Subsidiär gilt die Ordnung SIA 142/2009. Zur Prämierung von maximal 6 Entwürfen (Preise und Ankäufe) sowie der möglichen Ausrichtung einer fixen Entschädigung stehen dem Preisgericht insgesamt Fr. 240’000 (exkl. MWST) zur Verfügung.
Teilnahmeberechtigung
Um die Teilnahme am Wettbewerb bewerben können sich Anbietende von Generalplanerleistungen mit Wohn oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/ WTOÜbereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Preisgerichts, einem Experten oder einem bei der Vorprüfung Mitwirkenden in einem beruflichen Abhängigkeits bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen oder mit einem solchen nahe verwandt sind.
Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter
– Daniel Baumann, Abteilungsleiter Baubereich A, Hochbauamt (Vorsitz)
− Astrid Staufer, dipl. Architektin ETH BSA SIA, Frauenfeld
− Barbara Strub, dipl. Architektin ETH SIA BSA, Zürich
− Roger Diener, Prof. em. ETH Architekt BSA SIA BDA, Basel
− Alain Roserens, dipl. Architekt ETH SIA BSA, Zürich (Ersatz)

Termine
Eingabe der Präqualifikation bis Donnerstag, 13. April 2023, 16.00 Uhr
Auswahl der Teilnehmenden Mai 2023
Starttermin Projektwettbewerb Juni 2023
Abgabe Projektvorschlag September/Oktober 2023
Wettbewerbsunterlagen
Die Wettbewerbsunterlagen stehen unter www.zh.ch/wettbewerbe > aktuelle Ausschreibungen als Download zur Verfügung.
Neubau