CHÖRE












Das irre Potenzial der Vielstimmigkeit
MAGDALENA KOŽENÁ
Die Verwandlungskünstlerin
OPER KONZERTANT Imaginierte Inszenierungen








KURDISTAN-FESTIVAL Lieder der Verstummten

4<BUBALT=aagfaa>:V;Y 3 | 2023 E uro 6,50

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 23,9–19,6 (WLTP, gewichtet); CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (WLTP, gewichtet); elektrische Reichweite nach WLTP in km: 371–503 (EAER) · 440–566 (EAER City); Stand 06/2023 Ist für Elektrofahrzeuge
Elbphilharmonie
Hamburg. DER VOLLELEKTRISCHE TAYCAN.
wie die
für
HERZLICH WILLKOMMEN!
Liebe Leserin, lieber Leser, wie sein Gesicht gehört auch die Stimme eines Menschen untrennbar zu ihm. Sie gibt jeder Person ihren eigenen Klang. Kein Wunder also, dass die Sprache lauter vielbenutzte Wörter kennt, die von dem Wort Stimme abgeleitet sind. Was Stimmen sagen, muss nicht stimmen. Aber wenn etwas stimmt, dann ist es bestimmt richtig, auch wenn es uns verstimmt. Zugleich ist die Stimme das Herz der Musik und des Musikmachens, ob als Gesangsstimme oder als Chiffre für die Verläufe der einzelnen Instrumente in einer Komposition. Und jedes Konzert beginnt mit dem Stimmen der Instrumente.
In diesem Heft stimmt Sie ein kluger, auf Geschichte, Soziologie und Musikhistorie gleichermaßen Bezug nehmender Essay auf das jahrtausendealte Phänomen des Chorgesangs ein, bei dem die Stimmen der Einzelnen zum Klang des Kollektivs verschmelzen. Sublimste Kunst und Massenwahn gehörten als schärfste Antipoden von Anfang an zu dieser Übung (Seite 4).
Der Gesang der Mezzosopranistin Magdalena Kožená, des brasilianischen Jahrhundertmusikers Caetano Veloso und der britischen PostpunkIkone Elvis Costello liegt bei aller radikalen Verschiedenheit ihrer Stimmen nicht nur mir besonders am Herzen. Die drei sind in den kommenden Wochen live in der Elbphilharmonie zu erleben und werden hier in schönen, lesenswerten Porträts gewürdigt (Seiten 10, 64, 22). Auch der Klang von Wayne
Shorters Saxofon begleitet mich schon beinahe mein ganzes Leben lang. Zu gern hätte ich ihn einmal noch live in der Elbphilharmonie erlebt. Im November bereitet ihm ein hochkarätiges US Jazzquintett gemeinsam mit den Symphonikern Hamburg ein klingendes Epitaph im Großen Saal (Seite 60).
Kaum zu glauben, dass Felix Mendelssohn Bartholdy mancherorts immer noch als musikalisches Leichtgewicht gilt. Viele seiner Werke, die in den nächsten Monaten bei uns im Konzert zu erleben sind, gehören zum Besten der klassischen Musik. Ein scharfsinniger Text lädt dazu ein, ihn neu zu entdecken (Seite 16).
Ganz nah bei den Stimmen ist auch deren totale Verneinung: das Verstummen. Mit dem Kurdistan Festival feiern wir im November die historisch bedeutende und regional kaum zu fassende Kultur kurdischer Musik, die, wie viele Äußerungen der Kurdinnen und Kurden, in ihren Herkunftsländern von den jeweils gerade herrschenden Ideologien am liebsten zum Schweigen, wenn nicht zum Verschwinden gebracht würde. Vielleicht gibt Ihnen die Lektüre der sehr instruktiven Geschichte »Lieder der Verstummten« (Seite 52) noch einen Grund mehr, eines der Konzerte dieses Festivals mitzuerleben.
Ich freue mich auf eine weitere stimmungsvolle Saison mit Ihnen.
Ihr Christoph LiebenSeutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle

MAGDALENA KOŽENÁ
DIE VERWANDLUNGSKÜNSTLERIN
Die Mezzosopranistin singt sich durch die Jahrhunderte und Stile.
VON JULIKA VON WERDER
26
OPER KONZERTANT IMAGINIERTE INSZENIERUNGEN
Musiktheater ohne Szene kann viel mehr als nur reizvoll sein.
VON CHRISTOPH BECHER
32
MUSIKLEXIKON
STICHWORT: »STIMMEN«
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
VON CLEMENS MATUSCHEK
60
WAYNE SHORTER
WAYNES WELT
Der Saxofonist und seine wunderbar eigentümliche Musik
VON TOM R. SCHULZ
64
CAETANO VELOSO
EIN MANN, EIN KOSMOS
Eine Annäherung an die Stimme
Brasiliens in sieben Songs
VON STEFAN FRANZEN
GLOSSE
16
MUSIKGESCHICHTE
MUSIK OHNE SCHATTEN?
In Mendelssohns Musik sprechen viele Stimmen. Das ist eine ihrer Stärken.
VON ALBRECHT SELGE
48
REPORTAGE NACHTSCHLUPPE, HANDGESPROCHEN
22
ELVIS COSTELLO

AN DER RAMPE
Der Singer/Songwriter kommt in die Elbphilharmonie.


VON JAN PAERSCH
VÍKINGUR ÓLAFSSON »NICHT JEDER WIRD MEINE INTERPRETATION MÖGEN«
Der Pianist im Gespräch über Bachs »GoldbergVariationen«
VON BJØRN WOLL
58
UMGEHÖRT ÜBER-ZEUGUNGEN
Eine Frage, sieben Antworten
VON IVANA RAJIC
VON STEPHAN BARTELS
FÖRDERER
SPONSOREN 82 IMPRESSUM 88
UND
40 FOTOSTRECKE GOOD VIBRATIONS
VON NIKLAS GRAPATIN 14
70
Elbphilharmonie
WER SCHWEIGT, BLEIBT Über Stimmen und Sprachnachrichten VON TILL RAETHER 68 ENGAGEMENT ICH BIN EIN FAN VON CLAUDIA SCHILLER
MITARBEITER KLINGENDES AFTERWORK Der Betriebschor der
74
VON FRÄNZ KREMER
10
4
ESSAY
DAS IRRE POTENZIAL DER VIELSTIMMIGKEIT
Seit fast drei Jahrtausenden erlebt der Chor einen schlingernden Kurs durch die Geschichte.

VON TILL BRIEGLEB 34
REBECCA SAUNDERS
WAS WIRD SIE ALS NÄCHSTES FINDEN?
Mit unverwechselbarer Handschrift ist die Komponistin auf permanenter Expedition ins Ungewisse.
VON VOLKER HAGEDORN
KURDISTAN
LIEDER DER VERSTUMMTEN

Ein Festival feiert die Vielfalt und Lebendigkeit der kurdischen Musik.
VON MARTIN GREVE

52




4 Essay
Der Soweto Gospel Choir singt in Edinburgh zu Ehren Nelson Mandelas (2022)
Soldaten der Koreanischen Volksarmee singen in Pjöngjang zum Geburtstag Kim Jong-ils (2007)
DAS IRRE POTENZIAL DER VIELSTIMMIGKEIT
Tanz der Kritik und sozialer Kitt, Herrscherhuldigung und Gänsehautgefühl: Seit fast drei Jahrtausenden erlebt der Chor einen schlingernden Kurs durch die Geschichte.
VON TILL BRIEGLEB
Der einzige echte Feind des Chores ist die Skeptikerin. Über Jahrtausende mehr oder weniger ferngehalten von der öffentlichen Gemeinschaft, misstraut sie den Gesetzen der Masse. Selbst ihr männliches Pendant, der grübelnde Zweifler oder spöttische Bohemien, ging immer dann wieder gerne im Chor auf, wenn er darin zum Sprecher wurde oder sich anonym in der Masse bewegen konnte. Als charismatischer Führer oder flanierender Beobachter braucht der Mann den Chor. Die Individualität kritischer Weiblichkeit, die von der Gesellschaft bereits ausgeschlossen war, als der Chor auf dem antiken griechischen Theater erfunden wurde, scheut dagegen die Kirche des gemeinsamen Textes von dem Moment an, wo sie sich ihrer rechtlosen Rolle darin bewusst wird.
Es lässt sich die Geschichte des Chores nicht gerecht erzählen ohne diese Vorbemerkung, dass die vielstimmige Synchronität fast immer männlich war. Von brüllenden Heerscharen beim Angriff bis hin zu gregorianischen Mönchen beim Altar, von den ersten Männergesangsvereinen mit der Zelterschen Liedertafel in der Hand bis hin zum Stadionchor mit dem Bierbecher, vom Chordienst in derantiken Tragödie, für den man Bürgerrecht besitzen, also Mann sein musste, bis hin zu den berühmten Gefangenen, Jäger und Matrosenchören der Oper des 19. Jahrhunderts: Meist gebärdete sich die Singgruppe patriarchal und antiweiblich. Der erste gemischte Chor in Deutsch
land, die SingAkademie zu Berlin, wurde erst 1791, zwei Jahre nach dem Beginn der Französischen Revolution gegründet. Wo Frauen ansonsten mitsingen durften, etwa beim Gottesdienst, verlangte der Text ihre devote Unterordnung unter herrliche Autorität.
Diese traditionelle Einseitigkeit hat in Chören deswegen mehr Symbolik als im psychologischen Wettkampf des Dramas, weil es in diesen disziplinierten Ordnungen wesentlich um Bindung geht. Und das unterschied die Geschlechter über die Jahrhunderte fundamental. Während die Frau mit der Heirat abgeschnitten von gesellschaftlichen Netzwerken im Haus isoliert wurde, bestimmte sich der Erfolg des Mannes über die Anzahl lohnender Verbindungen, die er mit der Gesellschaft eingehen konnte. So sind Chöre das musikalische Abbild bestimmender Kollektive. Und die waren seit der Erfindung von Landraub und Krieg primär männlich.
HIER SPRICHT DAS VOLK
In der Weltgeschichte hatten Chöre allerdings nicht immer die gleiche Präsenz, schon gar nicht auf den Bühnen. Erst Claudio Monteverdi befreite sie zu Beginn des 17. Jahrhunderts wieder aus den Kehlen der Mönche für das Theater, wo sie in der Oper, aber nicht mehr im Schauspiel das Volk sprechen ließen. Doch wo die Chöre gegenüber dem individuellen Handeln an Bedeutung verloren – etwa in der Entwicklung des antiken Dramas wie in
Essay 5
›
seiner Wiedergeburt als Weimarer Klassik im deutschen Kleinfürstenstaat –, da hatte das meist etwas zu tun mit der Angst neuer Eliten vor den Massen, die das Gemeinsame artikulieren. Der Ehrgeizige liebt den Chor nur als Verstärker, nicht als Korrektiv.
Beispielhaft für diese Entmachtung ist bereits das Geburtsjahrhundert des Chores als kulturelles Phänomen um 500 vor unserer Zeitrechnung. Bei den griechischen Festspielen ermahnte die kollektive Stimme die Regenten zunächst noch penetrant ihrer demokratischen und vertraglichen Pflichten. Wobei demokratisch eben hieß, ohne Frauen, Sklaven und Fremde. Doch parallel zum wachsenden Autokratismus in den griechischen Stadtstaaten wurde diese klare Verständlichkeit gemeinschaftlicher Prinzipien immer weniger gut gelitten. Am Ende verkamen die Gewissenspredigten des Chores zu unterhaltenden musikalischen Pausenfüllern, den so genannten Embolima.
Als Tanz der Kritik – das griechische »chorós« bedeutet ursprünglich »Tanzreigen« und wurde auch so gestaltet – ebenso wie als Demonstration von Huldigung und Unterwerfung, die der Diktator so schätzt, verdankt sich die manipulative Gefahr des Chorlieds aber derselben Energie. Die Vielstimmigkeit besitzt ein irres Potenzial zur Überwältigung der Gefühle. Kaum ein Opern oder Oratoriumskomponist verzichtet deshalb darauf, sein Finale mit schmetternden Chören zur Klimax zu führen. Selbst Wagner, der im »Ring des Nibelungen« drei Teile lang auf jeden Choreinsatz verzichtet hatte, kehrte bei der »Götterdämmerung« zur dramatischen Steigerung mit dem »Mannenchor« zurück.
MASSE UND MACHT

Auch die wenigen Sinfonien nach Beethovens Neunter, die große Chöre vorsahen, sei es Gustav Mahlers »Sinfonie der Tausend« oder Felix Mendelssohn Bartholdys »Lobgesang« (s. S. 16), gierten nach diesem Gänsehautgefühl größter Erhabenheit, das im vielstimmigen Singen zur absoluten Intensität gesteigert ist. Doch so begeisternd und erschöpfend dieses Hörglück auch ist, die Empfindung
solcher Formen der Überwältigung steht eben bei skeptischen Menschen auch im Verdacht, das rationale Denken auszulöschen.
Die »Sieg Heil!«brüllenden HakenkreuzChöre, damals durchaus ein gemischtes Ensemble, sind für viele Menschen bis heute ein lehrreiches Trauma, der dröhnenden Klarheit vielkehliger Botschaften gründlich zu misstrauen. Diese von »Affekten« geleiteten Gemeinschaften, wie Elias Canetti sie in »Masse und Macht« analysierte, streben danach, alle »Verschiedenheiten loszuwerden und sich als Gleiche zu fühlen«. Diese Affekte streben demnach nicht nur nach Entladung in Gesang und Geschrei, sondern sie erzeugen auch den größtmöglichen Anpassungsdruck, wo jede Abweichung als Verrat gewertet wird. Das gilt schon für das Nichtmitsingen, etwa von Nationalhymnen, mit dem die Schweigenden sich außerhalb der Gemeinschaft stellen, was in vielen politischen Systemen eine durchaus gefährliche Verortung sein kann.
Im Zeitalter maximaler Individualität könnte die Annahme trotzdem sein, dass umso mehr Personen zum differenzierten Denken befähigt werden, je unangenehmer ihnen Darbietungen sinnstiftender Art ab 80 Dezibel sind, besonders wenn sie im Chor vorgetragen werden. Aber die Beliebtheit von Chorgesängen wird von solchen Vermutungen in keiner Weise geschmälert. Seien es die Nationalhymnen, beliebte Protestsongs auf Demonstrationen, Vereinslieder, Depeche ModeKonzerte oder schräge HappyBirthdayGesänge – Bindung durch gemeinsames Singen ist gesellschaftlicher Kitt, auch wenn es bekennende Kollektivverweigerer peinlich berühren mag.
Deswegen haben manche Theatermacher entgegen dem Profilierungs und Starsystem der Bühnenkünste immer mal versucht, Chöre wieder als handelnde Akteure zu etablieren. Bertolt Brecht und Erwin Piscator wollten in der Weimarer Republik die Spannungen zwischen Individuum und Volk durch chorische Elemente plastisch darstellen, was durch die Massenaufmärsche der Nazis und gleichklingende Veranstaltungen im so genannten Sozialismus gleich für Jahrzehnte als Bühnenmittel mitdiskrediert wurde. Aber seit der Wende gab es in der Vermischung zweier unterschiedlicher Theatertraditionen dann doch wieder viele neue Versuche, dem Chor seine Bedeutung als Träger kollektiver Wahrheiten zu geben.
Der Regisseur Einar Schleef sprach in diesem Zusammenhang von dem »gesunden Chor« im Gegensatz zum »kranken« der ideologischen Gleichschaltung. Er suchte nach einem »idealen Sprechen«, indem er schwarz gekleidete Ensembles unterschiedliche Stücke chorisch deklamieren ließ. Das führte natürlich sofort zum Skandal. Die berühmte Inszenierung von Rolf Hochhuths betulichem NachwendeDrama »Wessis in Weimar« am Berliner Ensemble 1993, die der DDR gequälte Theaterberserker Schleef als stundenlanges, rhythmisches Textschreien martialisch in Szene gesetzt hatte, brachte ihm postwendend den (falschen) Vorwurf ein, eine »faschistoide« Ästhetik zu bedienen.
6 Essay
›
Der Welt größter Wasserchor in Bad Füssing (1998)

Essay 7
Der Cor World Choir in Cardiff (1993)


8 Essay
Ein umweltbewegter Frauenchor in London (2009)
Fans von Bayer Leverkusen beim AS Rom (2023)
FREUDE SCHÖNER GÖTTERFUNKEN
Trotz der gebrochenen Geschichte zwischen Ergreifen und Einverleiben, wie es bei Canetti heißt, ist Singen im Chor für die Beteiligten in der Regel Freude schöner Götterfunken. Sonst würde es in Deutschland nicht immer noch drei Millionen Singende in rund 60.000 Chören geben. Gerade in Zeiten, wo die inszenierten Botschaften der Massenkommunikation fast ausschließlich eine Geschichte von Egoismus und Eitelkeit erzählen, ist das Aufgehen in der Einheit des Vielstimmigen etwas bedeutend Gemeinschaftsstiftendes. Auch wenn hier gelegentlich doch noch Störgeräusche der patriarchalen Tradition zu hören sind, etwa bei den Knabenchören, zu denen Mädchen keinen Zutritt haben, selbst wenn sie dagegen klagen. Die Neunjährige, die sich 2019 in Berlin vom Richter erklären lassen musste, dass ihre Stimme den »Knabenchorklang« störe, und der sei von der Kunstfreiheit gedeckt, kann davon ein Lied singen. Dabei sind Knabenchöre latent vom Aussterben bedroht, seit Kinder sich lieber mit dem Smartphone isolieren.
Und dennoch ist das Verbindende des Chores, gerade wenn er niemanden wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, seines Glaubens oder seiner Lustempfindungen ausschließt, eine geradezu utopische Insel in einer Gesellschaft, die im Schlaf zwar gerne von Solidarität redet, im Wachen aber das individuelle Interesse bis zur totalen Rücksichtslosigkeit liebt.
Der gemischte, und zwar der nicht nur nach Geschlechtern gemischte Chor ist da geradezu das Sinnbild einer Alternative, weil hier freiwilliger Verzicht auf eine Sonderrolle einhergeht mit dem Hören aufeinander. Wer in den Chor eintritt, sucht nicht das Solo im Leben –obwohl so manche Stimme in Opernchören heimlich der Meinung ist, die Arie besser singen zu können als die Diva. Aber genau das ist ja auch die Stärke eines Chores, der nicht unter Zwangsbekehrung leidet. Es gibt in dieser großen Gruppe mit einer Partitur für alle nach wie vor unterschiedliche Stimmen, Haltungen und Weltanschauungen, aber sie werden freiwillig untergeordnet, wenn es um die Vollkommenheit des Ganzen geht.
Das gilt im Besonderen für die vielen Konzert und Laienchöre, deren Selbstverständnis das Gemeinschaftliche ohne jeden Zwang hervorhebt. Das Motto des Konzertchors Köln etwa, »Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an« (E. T. A. Hoffmann), drückt diese große Sehnsuchgt nach Überbrückung von Differenzen im Singen aus. So gesehen ist der Chor das Instrument, das mehr als jedes andere dafür steht, was die Menschheit verbindet, und nicht was sie trennt.
GEWERKSCHAFTLICHE GRENZEN
Allerdings hat dieser Verzicht auf Egoismus seine Grenzen, sobald die Musik endet. Opernchöre haben nicht nur in Deutschland einen Grad gewerkschaftlicher Prinzipienstarre erreicht, der sich mit dem künstlerischen Betrieb, in dem sie arbeiten, nur äußerst schwer verträgt. Wer jemals an einer Produktion mit Chor gearbeitet hat, wird Situati
onen kennen, wo die Mitglieder des Singensembles neben der Bühne laut die Sekunden bis zu ihrer tariflich vereinbarten Pause (von denen es sehr viele gibt) herunterzählen. Die gelegentlich nach Außen dringenden Gerüchte von brüllenden Regisseuren während der Probe erscheinen sofort in einem anderen Sound, wenn man das Arbeiten im ständigen Unruheherd eines undisziplinierten Opernchors live erlebt hat.
Aber wenn die Gruppe schließlich inszenierungsdienlich auf der Bühne steht, dann sorgen zeitgenössische Regisseurinnen und Regisseure meist auch dafür, dass die Individualität in moderater Form wieder gewährleistet wird. Anders als die oft uniformierten und stehenden Chöre von historischen Aufführungen, bei denen die Masse nur den verstärkenden Hintergrund zur Macht der Gesangsstars zu bilden hatte, sind die Einbettung des Chores in das Bühnengeschehen und die Vielfalt der Kostüme heute eher Usus.
Obwohl Chorsängerinnen und sänger gelegentlich mehr eingebildete als echte schauspielerische Talente sind, liefert die szenische Arbeit mit großen Gruppen einen wesentlichen Beitrag zur Spektakelqualität von Oper. Und sie unterstützt die Wiedergabe einer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft auf der Bühne, in der die Gruppe zwar weiterhin Repräsentant einer Behauptung ist, aber in einer differenzierten Form. Auch die Dominanz des Männlichen in den berühmtesten Partituren des Kanons lässt sich in der szenischen Einbindung mildern oder egalisieren, wenn es gewünscht ist. Als gestischer Chor können heute auch Sängerinnen einen Kommentar dazu liefern, wenn der Mannenchor bei Wagner singt: »Heil! Heil! Heil dir Gunther!«
So hat das akustische Wesen Chor seit seinem Auftreten in der Kultur einen extrem schlingernden Kurs durch die Geschichte erlebt. Es symbolisierte sowohl den Triumph des bösen Willens wie den Ausdruck schöner Bescheidenheit. Aber je mehr der Chor sich vom Geschrei entfernte und dem Gesang näherte, umso mehr animierte er Komponistinnen und Komponisten zum Erfinden ergreifender Musik, deren Genuss die Skepsis kurzzeitig stumm stellen darf.
Essay 9
Im Chor geht freiwilliger Verzicht auf eine Sonderrolle einher mit dem Hören aufeinander.
DIE VERWANDLUNGSKÜNSTLERIN
Mit ihrer vielseitigen Stimme singt sich Magdalena Kožená durch die Jahrhunderte und Stile. Auch im Gespräch mit ihr wird es nie langweilig.
 VON JULIKA VON WERDER
VON JULIKA VON WERDER
Das Unangenehmste an Hosenrollen ist, dass Männer auf der Bühne immer so furchtbar viel anhaben: Unterhemd, Hemd, Weste, Sakko –das ist einfach viel zu warm!«, sagt Magdalena Kožená im Telefoninterview und lacht. Da kann man nur staunend mitlachen: Wenn das ihr größtes Problem ist, dann muss es diese Sängerin einfach draufhaben. Und das hat sie: Trotz warmer Weste und Sakko wird die 1973 im tschechischen Brünn geborene Mezzosopranistin seit vielen Jahren nicht zuletzt auch für anspruchsvolle Paraderollen dieses Stimmfachs gefeiert, etwa den Oktavian in Richard Strauss’ »Rosenkavalier«.
Kožená ist sehr konzentriert in diesem Telefonat. Sie antwortet ausführlich, aber nicht ausschweifend. Ihre Formulierungen wirken nicht so, als hätte sie sie schon oft gebraucht. Sie ist ganz bei der Sache.
Ob sie sich zwischendurch alle Hosenrollen wegwünscht, doch lieber Sopranistin geworden wäre? »Wenn, dann nur, um einmal Janáceks Kát’a Kabanová singen zu können«, antwortet sie prompt, »aber ansonsten überhaupt nicht. Ich liebe die vielseitigen MezzoPartien.
Da gibt es mehr, als man in 40 Jahren aktiver Sängerkarriere überhaupt schaffen kann.« Tatsächlich umfasst das Repertoire für die mittlere Frauenstimme zwischen Sopran und Alt ein beispiellos breites Spektrum von pubertierenden Jünglingen bis zu reifen Frauen. Viele Sängerinnen spezialisieren sich, machen sich entweder in leichtfüßigen Hosenrollen einen Namen oder als Grande Dame, bleiben im Barock oder schlagen den Weg in Richtung der dramatischen MahlerPartien ein.
Nicht so Magdalena Kožená: »Mir würde das wahr scheinlich einfach zu langweilig werden«, gibt sie zu. Und sieht das nicht nur als eine künstlerische Entscheidung, sondern als Charaktersache. Sie sei eben ein Mensch, der gerne viel ausprobiert und stets neue Herausforderungen sucht, erklärt sie bescheiden und sachlich, keinesfalls übermütig oder prahlerisch.
Und so wandelt sie durch die Jahrhunderte und Stile: An der Met sang sie Mozarts liebestollen Cherubino ebenso wie Debussys scheue Mélisande; in Salzburg brillierte sie als verführerische Carmen, in AixenProvence in Kaija Saariahos neuer Oper »Innocence«; auf der Konzertbühne begeisterte sie in Mahlers »Lied von der Erde« mit warmer Stimme und mit barockem Feingefühl in Bachs Passionen sowie – zuletzt in der Elbphilharmonie – in Händels »Alcina«. Wer sich ein bisschen mit Stimmbildung befasst, könnte meinen, diese Frau müsste sich alle paar Wochen umtrainieren und ihre Stimme immer wieder an andere technische Anforderungen anpassen. Eine Verwandlungskünstlerin ist sie allemal.
Und es geht noch weiter: Zwischen ihren unzähligen klassischen Alben taucht plötzlich Cole Porter in der Reihe von Koženás Aufnahmen auf. »Ich habe mich schon als Studentin in die Songs von Cole Porter verliebt«, sagt sie. Kein Wunder also, dass sie JazzLegenden wie Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Peggy Lee zu ihren größten Vorbildern zählt. Im Rahmen ihrer Residenz brachte sie die Evergreens aus dem American Songbook 2016 auch in Hamburg auf die Bühne. Das »Hamburger Abendblatt« fand das höchstens »sonderbar«; das Publikum feierte den überraschenden Exkurs.
Magdalena Kožená ist seit vielen Jahren regelmäßig an der Elbe zu Besuch, schon mehrfach auch zusammen mit ihrem Ehemann, Sir Simon Rattle. Der setzt sich für sie sogar manchmal ans Klavier – sehr seltene und besondere Chancen, den Dirigenten an den Tasten zu erleben. Ob es einen Unterschied macht, wenn er sie vom Klavierhocker statt vom Pult aus begleitet? »Ja, klar«, lacht Kožená, »denn als Klavierbegleiter muss er mir wirklich einfach mal folgen.«
Im November kommen die beiden mit MarcAntoine Charpentiers »Médée« zurück in die Elbphilharmonie. In der Titelpartie verkörpert Kožená eine verzweifelt eifersüchtige Ehefrau, die aus Rachsucht nicht nur ihre Nebenbuhlerin, sondern auch die eigenen Kinder tötet. »Auch wenn die Geschichte unglaublich grausam ist, mag ich diese Rolle sehr. Mir fällt kaum eine andere Partie ein, in der man so viele verschiedene und intensive Emotionen abbilden kann«, meint die Sängerin. Ihren ersten großen Erfolg als Médée feierte sie 2015 am Theater in Basel: »In jedem Wort, in jeder Geste ist starke Emotionalität«, jubelte damals eine Schweizer Kritik, »Kožená entfaltet die ganze Palette an Klangfarben des Zorns.« Ihre eigene Erinnerungen an diese Darbietung: »Es war eine sehr naturalistische Inszenierung von Nicolas Brieger, und es war viel Theaterblut im Spiel. In der Szene mit dem Kindsmord habe ich immer die Eltern am Rande der Probe gesehen und dachte mir: ›Ooooh sorry, das ist jetzt sicher kein schöner Anblick‹«. Sie lacht noch heute, wenn sie daran denkt. So furchteinflößend ihr Zorn auf der Bühne, so bestechend ist ihr Humor daneben. Auch sie war einst ein Kind auf der Opernbühne, sang im Kinderchor in Brünn, wo sie zum ersten Mal die einzigartige Luft der Theaterwelt schnuppern durfte. Auch sie hatte große Träume, die damals jedoch nicht über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinausreichten – vor allem, weil sie hinter dem Eisernen Vorhang großgeworden ist: »Für mich war eine Karriere an der Oper in Brünn lange Zeit alles, wovon ich geträumt habe. ›
Magdal E na KoŽ E nÁ 11
An die Metropolitan Opera, an Wien oder Paris hätte ich niemals auch nur gedacht.«
Magdalena Kožená stammt nicht aus einer Musikerfamilie, sondern wuchs als Kind eines Mathematikers und einer Biologin auf. In Berührung mit Musik ist sie im Kindergarten gekommen: Ihre Erzieherin spielte Klavier und zog das kleine Mädchen damit vollständig in den Bann. »Ich weiß noch genau, wie ich sie beobachtet habe und einfach sofort wusste, dass ich genau das auch mal machen will.« Ihre Eltern nahmen diesen Wunsch ernst, ermöglichten ihr Klavierunterricht – »und gesungen habe ich sowieso schon immer«, erzählt sie. Ihr TeenagerTraum, Pianistin zu werden, erlitt auf dem Weg zur Aufnahmeprüfung allerdings zunächst einen Dämpfer, weil sie sich die Hand brach. Also entschied sie sich kurzerhand, stattdessen erst einmal für ein Gesangsstudium vorzusingen. Zu ihrer eigenen Überraschung wurde sie angenommen.
Diese vielzitierte Geschichte wird in der Klassikwelt gerne als wegweisender Schicksalsschlag interpretiert, doch Kožená winkt schmunzelnd ab: »Ich habe mir halt die Hand gebrochen, wie sich viele Kinder mal die Hand brechen. Die KlavierAufnahmeprüfung habe ich ein Jahr später nachgeholt und dann einfach beides studiert«, sagt sie. Erst später musste sie sich dann wirklich entscheiden und blieb beim Gesang. Die scheinbar unüberwindbare Grenze zwischen Ost und West zerfiel, in den europäischen Nachbarländern wurde man bald auf die junge Sängerin aufmerksam. Sie gewann ein paar Preise, gab aufsehenerregende Debüts, bekam einen Plattenvertrag bei der Deutschen Grammophon und landete schneller an der Weltspitze, als sie es selbst realisieren konnte. Heute nennt sie das »eine Art von Wunder«, für das sie ehrlich dankbar ist.
Mit Simon Rattle hat Magdalena Kožená inzwischen drei Kinder, 18, 14 und 8 Jahre alt; gemeinsam leben sie in Berlin. »Kinder zu kriegen, hat für mich alles in neue Relationen gesetzt. Es gibt einem ein ganz anderes Gefühl dafür, was im Leben zählt«, sagt sie. Wie sich Karriere und Familie verbinden lassen? »Das ist natürlich nicht leicht. Wir haben die Kinder oft einfach mitgenommen.« Von ihnen getrennt zu sein, mag Kožená überhaupt nicht; es ist ihr wichtig, als Mutter wirklich da zu sein.

Wer sich nun vorstellt, im Hause KoženáRattle gäbe es ein aktives FamilienEnsemble, das die ganze Zeit Kammermusik spielt, liegt allerdings falsch. Alle drei Kinder lernen zwar Instrumente, aber eher als Hobby; und gemeinsam zu musizieren oder gar Unterricht bei den Eltern zu bekommen, »das gäbe nur Streit«, sagt die Sängerin belustigt. Dass die drei keine Musikerkarriere anstreben, erleichtert sie fast: »Ich glaube, es wird immer härter in dieser Branche, und außerdem ist es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, immer als Sohn von Sir Simon Rattle unterwegs zu sein.« Wirkliche Klassikfans sind ihre Kinder bisher sowieso nicht – »aber ich zwinge sie schon immer mal wieder, ins Konzert zu kommen«, erzählt Kožená. Und was hält der Nachwuchs davon, was die berühmten Eltern so treiben? »Wir machen Fortschritte. Neulich meinte der Älteste sogar, es war ganz okay.« In ihrer Stimme hört man ein großes Schmunzeln.
MÉDÉE Di, 21.11.2023 | 19 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal Freiburger Barockorchester, sir simon Rattle Magdalena Kožená, Reinoud Van Mechelen u. a. Marc-antoine Charpentier: Médée
12 Magdal E na KoŽ E nÁ
»Als Klavierbegleiter muss mir Simon wirklich einfach mal folgen.«

Aufregende Ringe zum Kombinieren PLAYLIST Hamburg: Jungfernstieg 8, T 040.33 44 88 24 · Mönckebergstraße 19, T 040.33 44 88 22 und An den besten Adressen Deutschlands und in New York, Paris, London, wien, Madrid – WEMPE.COM
WER SCHWEIGT, BLEIBT
Unser Kolumnist hört gern die Stimmen seiner Liebsten, aber er hasst Sprachnachrichten. Warum?
VON TILL RAETHER
ILLUSTRATION NADINE REDLICH

14 gloss E
Vor vielen Jahren hat meine Tochter unsere Anrufbeantworteransage eingesprochen. Den Festnetzanschluss und den integrierten Anrufbeantworter haben wir beibehalten, um ältere Familienmitglieder nicht zu verwirren. Sie haben sich diese Nummer vor Jahrzehnten gemerkt, das soll nicht vergebens gewesen sein. Ich hoffe, sie wissen es zu schätzen, Kleinvieh macht auch Mist. Die AnsageStimme meiner Tochter klingt so klein und lieb, ein Kinderstimmchen, selbstbewusst und gegen Ende leicht theatralisch erschöpft. Noch lieber höre ich nur die Gegenwartsstimme meiner Tochter.
Bei der Stimme meines Sohnes geht es mir genauso. Er ist voriges Jahr ausgezogen und lebt im Ausland, und wenn er tatsächlich mal anruft, prüfe ich den Klang seiner Begrüßung sofort wie ein Orakel. Geht es ihm gut? Braucht er Hilfe? Ist er einfach zu faul, etwas Nerviges selbst zu erledigen, und ruft deshalb mich an?
Früher hat mein eigener Vater gesagt: »Wie schön, deine Stimme zu hören!« Ich fand das archaisch und ein bisschen melodramatisch, so, als wäre mein betont technikfeindlicher Vater immer noch über die Erfindung des Fernsprechers erstaunt. Aber inzwischen geht es mir genauso: Wie schön, die Stimmen der Kinder zu hören. Wie schön, die Stimmen der Freunde zu hören, die sich nach längerer Zeit mal wieder melden, die Stimmen der Kolleginnen, mit denen ich sonst Mails von einem Ende Deutschlands ans andere schicke.
Wie schön, eure Stimmen zu hören. Außer, ihr schickt mir Sprachnachrichten. Es ist zwar die gleiche Stimme. Aber wenn sie mich per WhatsApp erreicht, verliert sie allen Zauber.
Schätzungsweise mag die Hälfte der Menschheit keine Sprachnachrichten: nämlich immer die, die gerade Sprachnachrichten bekommt. Für gut befunden werden Sprachnachrichten von der anderen Hälfte der Menschheit, nämlich jener, die gerade Sprachnachrichten aufnimmt. Eine verbreitete These lautet: Wer spricht, statt
zu schreiben, macht es sich einfach (muss nicht tippen, nicht sorgfältig formulieren, sich nicht kurz fassen).
Während umgekehrt, wer hört, statt zu lesen, mehr Arbeit hat (dauert länger, muss eine ruhige Umgebung oder Ohrhörer finden, muss die relevanten Informationen aus dem Gefasel extrahieren). Es entsteht eine Unwucht, viele empfinden es fast als Machtdemonstration derer, die labern dürfen, über die, die hören müssen.
Aber ist das wirklich der Grund für die Unbeliebtheit der so genannten Sprachis? Ich glaube, es liegt daran, dass die Stimme bei der Sprachnachricht aus ihrem Kontext gelöst und dadurch unheimlich und irritierend wird. Die Stimme, die einem persönlich ein Gefühl und eine Information übermittelt, ist so kostbar, weil sie einen einlädt, sofort auf ihre Schwingungen zu reagieren, auf ihre Körperlichkeit. So ist das im Dialog, egal, ob er an einem Tisch oder an zwei Telefonen stattfindet.
Die Sprachnachricht aber ist wie eine traurige, läppische Zeitkapsel. Weil sie, anders als die alte Ansage meiner Tochter, nicht einen Zustand der ferneren Vergangenheit konserviert, sondern den von vor dreißig Sekunden, fünf Minuten oder einer halben Stunde. Man möchte ihr ins Wort fallen, etwas ergänzen, widersprechen, zustimmen, aber es geht nicht. Sie gaukelt eine Nähe vor, die entweder, wenn ich mit der anderen Person nicht reden will, aufdringlich und unerwünscht ist, mitten in meinem Ohr. Oder, wenn ich sehr gern mit der anderen Person sprechen möchte, umso mehr auf ihre schmerzliche Abwesenheit hinweist.
Ich habe mir deshalb angewöhnt, die Sprachnachrichten auf anderthalb bis zweifacher Geschwindigkeit abzuspielen, die Entdeckung des entsprechenden Features ist eine große Erleichterung für mich. Erstens komme ich dadurch schneller an die Information, die ich brauche, zweitens klingen die Sprechenden wie Mickymäuse mit künstlicher Intelligenz, so dass ich ihnen wirklich nicht mehr böse sein kann.
gloss E 15
MUSIK OHNE SCHATTEN?
In Felix Mendelssohn Bartholdys Musik sprechen viele Stimmen. Das ist eine ihrer Stärken.

16 Musi K g E s C hi C ht E
VON ALBRECHT SELGE
Dunkeldüstre Schatten können sich unter scheinbar harmlosen Sätzen verbergen, die man in hellen Konzertfoyers vernimmt: Die Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy sei schön anzuhören, aber ihr fehle immer ein wenig das Tiefe, das Echte. Dieser Komponist habe im Grunde keine eigene Stimme gehabt, sondern irgendwie eine nachgemachte. So ungefähr habe ich es nicht nur in einer Konzertpause von einer Unbekannten aufgeschnappt, sondern auch öfter in meinem Bekanntenkreis gehört.

Unheimlich, welche Stimmen manchmal in uns nachtönen. Schon vor über 170 Jahren war zu lesen, dass »bei Mendelssohn selbst alles formelle Productionsvermögen« fehle und er »ganz offen nach jeder formellen Einzelnheit, welche diesem oder jenem zum Stylmuster gewählten Vorgänger als individuell charakteristisches Merkmal besonders zu eigen war, greifen mußte«. Aus Mangel an Originalität habe er Bach »nachgesprochen«. Und vor gut achtzig Jahren wurde ernstlich geschrieben, aus Mendelssohn »sprechen lauter vorderasiatische Rassenzüge: Gabe der Einfühlung in fremdes Seelenleben, der gefälligen Ausnutzung bestehender Formen, ein gewisser Mangel an jenem Schwergewicht, das für nordisches Empfinden zu einem ›großen‹ Menschen gehört.«
Die ersten Sätze schrieb Richard Wagner in seinem berüchtigten Aufsatz »Das Judenthum in der Musik« von 1850. Das zweite Zitat stammt aus einem 1937 erschienenen Werk mit dem vielsagenden Titel »Musik und Rasse«.
Neben dieser fatalen Wirkungsgeschichte beschreibt der US amerikanische Musikwissenschaftler R. Larry Todd in seiner umfangreichen MendelssohnBiografie (2003) eine weitere Schmählinie, die das Image des Komponisten bis heute lädiert habe: die im frühen 20. Jahrhundert einsetzende polemische Kritik am angeblich zutiefst verlogenen und prüden Viktorianismus, zu dessen Lieblingskomponisten Mendelssohn gehört hatte. Immerhin war Mendelssohn 1842 auf einer der zahlreichen Englandreisen, die zu den Höhepunkten seines Lebens zählten, sogar in den BuckinghamPalast eingeladen worden, wo er auf dem Klavier improvisierte, während die noch junge Queen sang. Und als Victorias Tochter, die ebenfalls Victoria hieß (vulgo »Vicky«), anno 1858 mit einem Preußenprinzen den Bund der Ehe einging, wurde auf der Orgel der Kapelle des St James’s Palace Mendelssohns berühmter Hochzeitsmarsch gespielt. Nicht etwa der aus »Lohengrin«! Zumindest in puncto Pracht und Popularität der Klangsache Eheschließung ist Wagner bis heute dem von ihm geschmähten Mendelssohn unterlegen geblieben.
Während der 1809 geborene Mendelssohn als 13jähriges Berliner Wunderkind noch einem Engel von himmelsnaturgemäß unklarer Geschlechtsidentität glich, wirkt er auf einer Zeichnung Aubrey Beardsleys, des Karikaturisten der Décadence, weich und weiblich. Nur entstand dieses Bild von Mendelssohn als dandy
haftem Riesenbaby anno 1896, fast ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod, und verrät mehr über die Nachwelt als über ihn. Aber es illustriert, wie Mendelssohns Image bald darauf auch in England, wo er schon zu Lebzeiten (noch) höheren Ruhm als in Deutschland genoss, ramponiert werden konnte.
VON FEEN UND DÄMONEN
Hörenswert ist übrigens Mendelssohns komplette Bühnenmusik zu Shakespeares »Sommernachtstraum«, aus welcher der Hochzeitsmarsch stammt – höchst bezaubernd als Ganzes in ihrer feenfröhlichflirrenden Festlichkeit. Sie lässt uns ahnen, dass hinter der nächsten Straßenecke möglicherweise nicht, wie wir sonst fürchten, der unendliche Abgrund lauert, sondern jene Welt der Elfen und Luftgeister, die unser kindliches Herz noch kannte. Wer aus der »Sommernachtstraum«Musik nicht mit lachendem Gemüt herauskommt, bei dem hilft höchstens noch Wein. Dennoch ist es leicht, Mendelssohns Grenzen zu sehen: etwa seine Verkennung des Phänomens Berlioz, dessen Maßlosigkeit und Entgrenzung er mit Ignoranz begegnete, vielleicht zum Schutz der eigenen Ästhetik des rechten Maßes. Elfen und Dämonen vertragen sich nicht gut. Das Bedrohliche, das Shakespeares »Sommernachtstraum« ja auch hat, ist Mendelssohns Bühnenmusik fremd. Und auch Chopin war ihm buchstäblich zu taktlos. Ebenso leicht aber ist es, das Infame an den ewigen Vorhaltungen gegen Mendelssohn zu benennen: etwa, dass ihm selbst die innige BachVerehrung vorgeworfen wurde, ausgerechnet ihm, der als treibende Kraft der Wiederaufführung der »Matthäuspassion« 1829 wesentlich zur Entstehung des identitätsstiftenden deutschen BachMythos beitrug. Dagegen verblasst beinah Mendelssohns Verdienst, dass auch seine eigenen Oratorien »Paulus« und »Elias« an Kraft und Poesie dem allermeisten weit überlegen sind, was in diesem ausgelutschten ›
Musi K g E s C hi C ht E 17
Androgynes Wunderkind von 13 Jahren (Zeichnung von Wilhelm Hensel, 1822)
NachHändelGenre im 19. Jahrhundert sonst in Deutschland entstand. Auch als Dirigent setzte er Maßstäbe, leitete als einer der ersten mit Stab, probte ausgiebig, führte nach seiner Berufung zum Leipziger Gewandhauskapellmeister 1835 die Gepflogenheit ein, auch Instrumentalwerke vom Pult aus zu leiten. Last but not least begründete er ebendort, nach Londoner Vorbild, die Gattung der »Historischen Konzerte«.
Und dann ist da noch jenes – zweifellos ambivalente –Kulturwunder der Assimilation. Den Beinamen Bartholdy nahm Felix’ wohlhabender Vater Abraham (ein Sohn des großen Philosophen der Aufklärung, Moses Mendelssohn) bei seiner Konversion zum protestantischen Christentum 1822 an. Bereits 1816 hatte er seine vier Kinder, darunter den siebenjährigen Felix, taufen lassen. Der Versuch des Musikwissenschaftlers Eric Werner in den 1960erJahren, eine Kontinuität von Mendelssohns bewusster jüdischer Identität nachzuweisen, war umstritten. Es scheint zwar verlockend, die Wahl des alttestamentlichen EliasStoffs sowie des KonversionsSujets schlechthin, der Figur des Paulus, so zu interpretieren, dass Verschmelzung und vielleicht auch Grenzgang für Mendelssohn zentrale Themen gewesen seien. Dabei muss man aber bedenken, dass bereits der Großmeister des Oratoriums, Georg Friedrich Händel, mit Vorliebe zu »alttestamentarischen« Themen griff, von Deborah, Esther, Susanna über Jephta, Joseph, Joshua bis zu Samson, Saul und Salomon. (Händels »Israel in Egypt« ließ übrigens Mendelssohn, der die Partitur in London aufgestöbert hatte, mehrfach in Düsseldorf, Leipzig und Berlin aufführen.) Wagners garstige Tiraden gegen den »Juden« Mendelssohn richteten sich gegen einen getauften Protestanten, der sogar eine ReformationsSinfonie samt finaler LutherSause schrieb: »Ein feste Burg ist unser Gott«.
HELLES LICHT UND ROMANTISCHER SCHIMMER
In diametralem Gegensatz zu den eingangs zitierten dunklen Tönen steht Mendelssohns eigene angebliche Helligkeit, die lichte Stimme seiner Musik. »Den hellsten Musiker« nannte ihn 1840 Robert Schumann. Wie steht es also ums Dunkeldüstre, ums Schattenhafte im Werk von Mendelssohn? Gibt es darin vielleicht Abgründe, Brüche?

Diese Fragen führen in die Irre, weil sie falsche Polaritäten konstruieren. Gewiss ist das Heraustreten des Menschen aus dem Dunkel für Mendelssohn zentral. In seinem »Lobgesang« in BDur von 1840, halb Sinfonie und halb Kantate, ist die mehrfach wiederholte flehentliche Tenorfrage der Angelpunkt des ganzen Werks: »Hüter, ist die Nacht bald hin?« Dennoch verweist Schumanns Etikett des hellsten Musikers auch und vielleicht vorwiegend auf jene Dunkelheiten, die Schumann in sich selbst wahrnahm. Was ihn und Mendelssohn hingegen verband, war die unbehagliche Herausforderung: Wie komponieren nach Beethoven – vor allem Sinfonien?
Schon die Zählung der Sinfonien mit ihren meist mehreren Fassungen geht bei beiden Komponisten verwirrend durcheinander: Schumanns Zweite und Dritte entstanden nach der Vierten, Mendelssohns Fünfte entstand vor der Zweiten, Dritten und Vierten. Auch mit den Beinamen ist es so eine Sache. In den Mittelsätzen der »Italienischen« Sinfonie ADur (vor allem im Trio) hornschallt ebenso ordentlich deutsche Waldromantik. Und der FinalSaltarello hat wieder mal etwas Feenhaftes, mehr jedenfalls als Ekstase oder dionysischen Exzess. Auf seiner großen Italientour 1830/31 reiste Mendelssohn auch nicht weiter südlich als bis Neapel; wie er wohl das archaische Kalabrien oder Sizilien gefunden hätte? Uraufgeführt wurde die »Italienische« jedenfalls 1833 mendelssohntypisch in – London!
18 Musi K g E s C hi C ht E
Das Wohnzimmer in der Leipziger Wohnung (Aquarell von Felix Mendelssohn Bartholdy, 1840)
Wirklich traumatisch wirkt übrigens der »Riese im Nacken«, wie Brahms später stöhnte, bei Mendelssohn nicht. Der Schwung seiner ganzen ADurSinfonie lässt sich in einem beredten Dialog mit der Sinfonie des großen Vorgängers in derselben Tonart hören, Beethovens Siebter. Achtet man darauf, so springt einen die Verwandtschaft zwischen diesen beiden Werken förmlich an. Nur dass es einen bei Beethoven eher zum Mittanzen reißt, bei Mendelssohn zum Mitsingen.
Das kann bei Mendelssohn öfter passieren: In der übervollen Schatztruhe seiner Kammermusik etwa im langsamen Satz des Klaviertrios dMoll. Dieses Andante con moto tranquillo wird gern als eine Art »Lied ohne Worte« bezeichnet, nach jenem lebenslangen Erfolgsgenre fürs Klavier (acht Hefte zwischen 1829 und 1845!), über das Mendelssohn selbst einmal gemurrt haben soll, es sei »nur für Damen«. Dabei geht der Spott über diese Hits fehl, und es passt nicht recht, den kurzen Stücken Texte unterzulegen, wie es im 19. Jahrhundert öfter geschah. Mendelssohn selbst schrieb 1842 in einem Brief über die Grenzen der Sprache: »Die Leute beklagen sich gewöhnlich, die Musik sei so vieldeutig; es sei so zweifelhaft, was sie sich dabei zu denken hätten, und die Worte verstände doch jeder. Mir geht es aber gerade umgekehrt. Und nicht bloß mit ganzen Reden, auch mit einzelnen Worten; auch die scheinen mir so vieldeutig, so unbestimmt, so missverständlich im Vergleich zu einer rechten Musik, die einem die Seele erfüllt mit tausend besseren Dingen als Worten. Das, was mir eine Musik ausspricht, die ich liebe, sind mir nicht zu unbestimmte Gedanken, um sie in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte.«
Es ist also viel mehr als eine Äußerlichkeit, wenn man bemerkt, dass etwa Mendelssohns eMollOpus 64 nicht nur eins der berühmtesten Violinkonzerte der
Musikgeschichte ist, sondern vielleicht das singendste von allen. Beredt und auch beschreibend ist Mendelssohns Musik dennoch. Im dritten Satz des erwähnten dMollTrios könnte einem auch einer jener Feenspuke begegnen, die Mendelssohn so lagen: freundliche Anderswelten statt Abgründe.
Formtraditioneller als Schumann folgt Mendelssohn den sinfonischen Vorstellungen eines idealen Klassizismus. Was ihn aber zugleich, wenn man so will, romantisch macht, ist der Umstand, dass »die Erfindung mehrfach durch außermusikalische Vorstellungen bestimmt« ist (Hans Christoph Worbs). Die Skizzen, auf die Mendelssohn bei der Komposition seiner aMollSinfonie »Schottische« 1841 zurückgriff, entstanden 1829 vor Ort auf der Reise im hohen Norden, und man hört das. Alfred Einstein fand in seinem Buch »Die Romantik in der Musik« (1950) für Mendelssohns Eigenheit den schönen Begriff des »romantischen Schimmers«, der über all seinen ebenmäßigen Äußerungen als etwas Subjektives glänze.
Immer auch ist hinter Mendelssohns Melancholien, statt des lauernden Absturzes, ein Schimmer von Licht. Umgekehrt ebenso hinter den Helligkeiten ein Schimmer von Melancholie. Nicht nur, wenn im »Sommernachtstraum« auf den berühmten Hochzeitsmarsch ein kurzer köstlich bizarrer Trauermarsch folgt.
Vielleicht sollte man Mendelssohns Musik einfach für sich schimmern lassen, ohne sie für andere Zwecke einzuspannen. Man muss Mendelssohn daher auch vor einigen seiner Verteidiger verteidigen. Wenn ihn Eduard Hanslick 1858 gegen Wagners Anwürfe in Schutz nahm, bestätigte er ja indirekt den Antagonismus, den dieser konstruiert hatte: »Ohne seine Formschönheiten, sein reines, klares Gestalten wäre (…) die Verwilderung, die wir gegenwärtig in der ›Zukunftsmusik‹ erleben, viel früher und ungleich verderblicher eingebrochen.« Doch wer Mendelssohn auf den Bremsklotz am Bein der wilden Verwagnerung reduziert, der erledigt ihn auch. Ohne dass sie gegen irgendetwas nützlich sein müsste, hat Mendelssohns Musik mit ihrer Helligkeit und ihrem romantischen Schimmer ihren Wert ganz in sich selbst.

FANNY, ODER: MANIE UND ZIERDE
Und doch gibt es Düsteres. Wie ein dunkles Kapitel der glanzvollen MendelssohnSaga wirkt, was Felix’ ältere Schwester Fanny erdulden musste, die mindestens so talentiert war wie ihr Bruder (man höre nur einmal ihr Streichquartett). Man mag zugestehen, dass allgemein die preußischdeutschen Verhältnisse für Frauen besonders eng und autoritär waren; in Frankreich gab es ganz
Musi K g E s C hi C ht E 19 ›
Hinter seinen Melancholien ist immer auch ein Schimmer von Licht, und hinter den Helligkeiten ein Schimmer von Melancholie.
Ansicht von Florenz (Aquarell von Felix Mendelssohn Bartholdy, 1830)
andere Freiheiten, zum Beispiel für die ungefähr gleichaltrige Louise Farrenc, die zur großen Sinfonikerin wurde. Dennoch ist es bedrückend zu lesen, wie Fanny Mendelssohn von ihrem Vater in einem Brief beschieden bekam, dass die Musik »für dich stets nur Zierde, immer Bildungsmittel und Grundbaß Deines Seins und Tuns« darstellen dürfe – und niemals Beruf, wie für Felix.

Auch wenn (wie Todd schreibt) »Fannys Anonymität typisch für ihre Zeit« gewesen sei, ist es aus heutiger Sicht doch befremdlich, dass Felix mehrere Lieder der Schwester unter seinem Namen veröffentlichte. Und dass er seine Schwester nicht darin bestärkte, selbstbewusst in die Öffentlichkeit zu treten, statt nur im privaten Rahmen zu wirken. Wer, wenn nicht er, hätte begreifen müssen, dass die Entfaltung ins Offene für einen künstlerischen Menschen kein Beiwerk ist, sondern eine Lebensnotwendigkeit?
Und doch, trotz dieses Abgrunds ist das innige Verhältnis der Geschwister Felix und Fanny ja bezeugt. »Mein Hamletchen« nannte sie ihn einmal, er sie: »liebste Fenchel«. Und schließlich ist da jenes welterschütternde Zittern, mit dem Felix’ 6. Streichquartett fMoll beginnt. Das entstand 1847, kurz nach dem Tod der Schwester, der den Bruder zutiefst erschütterte – und wenige Monate vor dem eigenen Ende. Kein Lobgesang folgt hier mehr auf die quälenden Fragen, die Nacht wird nicht mehr hin sein. Fanny wurde nur 41 Jahre alt, Felix lediglich 38. Das fMollQuartett zeigt auch die kompositorische Entwicklung im kurzen Leben dieses innerlich so fest scheinenden Künstlers. Der Kontrast zum wunderbaren DDurQuartett mit gepflegtem Feuer und gepflegter Melancholie, zehn Jahre zuvor entstanden, könnte krasser nicht sein. Hört man diese Werke hintereinander, fühlt sich das spätere erst recht wie ein plötzlicher Sturz aus heiterem Himmel in schwärzeste Gewitterwolken an. Wie der zweite Satz des letzten Streichquartetts »sich in einzelnen Floskeln manisch festbeißt« (Worbs), ist wahr
haft bemerkenswert für einen derart beredten Komponisten – und angesichts der Helligkeit dieses Komponisten, die eben doch besonders innig strahlt vor dem Hintergrund all der Gefährdungen des Menschen, die er und wir stets ahnen. Umso wertvoller ist Mendelssohns Musik aus den viel zu wenigen Jahren vor der Todesverdüsterung: Kunst, die weder den Hörer knechten noch seine Laune niederkartätschen und seine Augen ins Elend des Menschen drücken möchte, sondern die eben diesen Menschen zu erheben sucht und seine Seele (was das auch sein mag) leuchten lässt.
VIOLINKONZERT
Mi, 20.9.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Junge deutsche philharmonie
Matthias pintscher
noa Wildschut (Violine)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert e-Moll op. 64 sowie Werke von pintscher und zemlinsky
SOMMERNACHTSTRAUM
Do, 12.10.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
le Concert des nations
Jordi savall
Felix Mendelssohn Bartholdy: sinfonie nr. 4 a-dur »italienische«
Ein sommernachtstraum op. 61
DIE HEBRIDEN
So, 10.12.2023 | 11 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Martin schmeding (orgel)
Felix Mendelssohn Bartholdy: die hebriden oder die Fingalshöhle / Konzertouvertüre h-Moll op. 26 (Bearbeitung für orgel) sowie Werke von Bach, ligeti, dupré, Reger u.a.
ELIAS
Do, 21.12.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal pygmalion, Raphaël pichon stéphane degout
siobhan stagg u.a.
Felix Mendelssohn Bartholdy: Elias / Ein oratorium nach Worten des alten testaments op. 70
STREICHQUARTETT
Sa, 20.1.2024 | 16 Uhr
Laeiszhalle Kleiner Saal isidore string Quartet
Felix Mendelssohn Bartholdy: streichquartett Es-dur op. 44/3 sowie Werke von J. s. Bach und dinuk Wijeratne
LOBGESANG
So, 18.2.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal Balthasar-neumann-Chor und -orchester thomas hengelbrock
Eleanor lyons anna terterjan u. a.
Felix Mendelssohn Bartholdy: sinfonie nr. 2 B-dur op. 52 »lobgesang«
STREICHQUARTETT & LIEDER
Fr, 5.4.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Christiane Karg (sopran) aris Quartett
Felix Mendelssohn Bartholdy: streichquartett Es-dur op.12 ausgewählte lieder sowie lieder von schumann und Brahms in Bearbeitungen von aribert Reimann
LIEDER OHNE WORTE
Di, 9.4.2024 | 20 Uhr
Laeiszhalle Kleiner Saal amandine Beyer (Violine)
Marco Ceccato (Cello)
Kristian Bezuidenhout (hammerklavier)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Klaviertrio d-Moll op. 49 lieder ohne Worte (auswahl) Klaviertrio c-Moll op. 66
STREICHQUARTETT
Fr, 12.4.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal novus string Quartet
Felix Mendelssohn Bartholdy: streichquartett Es-dur op. 12 sowie Werke von schostakowitsch und Mozart
20 MusiKgEsChiChtE
Geliebte Schwester Fanny (Zeichnung von Wilhelm Hensel, um 1829)




































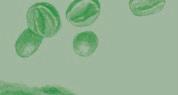









Hier den QR Code scannen und mehr erfahren. www.melitta-group.com
da, wo Innovationen schmecken. en hmecken.
AN DER RAMPE


22 El V is Cost E llo
VON JAN PAERSCH
Es hatte etwas von einem VarietéAbend. Mehr als zehn Jahre ist das letzte BandKonzert von Elvis Costello in Hamburg her. Der Gitarrist und Sänger, damals beinahe 60, entpuppte sich als veritable Rampensau, sauste durch die Reihen des CCH , befragte sein Publikum – und schickte es gar auf die Bühne. Dort durfte, wer wollte, in einem Käfig tanzen oder an einem drei Meter hohen Glücksrad drehen. Das »Spectacular Spinning Songbook« gab Costellos Tour den Namen. Die Nadel blieb bei einem von 40 Songtiteln stehen – den die Band kurzerhand anstimmte.
Costello hat in seiner bald 50jährigen Karriere tausende von Konzerte gespielt. Dem Los die Songauswahl zu überlassen, muss ihm wie eine prickelnde Abwechslung vom ewig gleichen TourAlltag vorgekommen sein. Der Zufall offenbarte aber auch Schmerzhaftes. So an dem Tag, an dem Costellos ExFrau zu Gast war. »Das Rad konnte gnadenlos sein«, erinnert er sich in seinen Memoiren. »Zum Beispiel an dem Abend, an dem Mary zum ersten Mal nach 25 Jahren zu einem meiner Konzerte kam. Die Apparatur wählte hintereinander acht Songs, in denen es um unsere zerrüttete Liebe ging – Songs, die ich geschrieben hatte, als ich sie betrog, und die uns beiden das Herz brachen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie beschämt ich war.«
Costello hat zwei Grammys gewonnen, wurde in die Rock’n’RollHall of Fame aufgenommen, das Magazin »Rolling Stone« listet ihn auf Rang 24 der 100 besten Songwriter aller Zeiten. Doch der Brite gehörte nie zu den wirklich ganz berühmten PopKomponisten, erreichte nie den Bekanntheitsgrad eines Bob Dylan, Elton John oder Paul McCartney. Was er aber mit diesen Größen gemeinsam hat: Es sind die privaten Dramen, die oft den Stoff für die besten Songs liefern.
Zum Beispiel »Almost Blue«. Das 1982 veröffentlichte Stück lässt sich als Abgesang auf seine erste Ehe lesen. Anfang der Siebziger trat Costello in Londoner Pubs auf und traf seine Jugendliebe Mary wieder. In seiner 2015 veröffentlichten Autobiografie heißt es: »Die nächsten zwei Jahre waren wir verlobt. Sie ging aufs College. Wir trennten uns. Wir versöhnten uns. Wir trennten uns. Wie es junge Liebende tun.« Costello, der damals noch
unter seinem Taufnamen Declan Patrick MacManus auftrat, heiratete Mary, als er gerade 20 Jahre alt war. Ihr erster Sohn wurde bald geboren, doch langfristiges Glück stellte sich nicht ein. »I have seen such an unhappy couple«, singt er in »Almost Blue«, fast eine JazzBallade, inspiriert von Chet Bakers Version von »The Thrill is Gone«.
»Veronica« ist ein weiteres Beispiel für eine Tragödie, die ein großes CostelloLied befeuerte. Der Song aus dem Jahr 1989 ist bis heute seine bestverkaufte Single in den USA . Treibendes Schlagzeug, euphorische EGitarren, eine kinderliedhaft beschwingte Melodie – doch der Künstler spricht von einem Ort im Dunklen: »Is it all in that pretty little head of yours? What goes on in that place in the dark?« Der Song behandelt subtil das Thema Alzheimer. Costello wusste, wovon er sang; die Krankheit hatte seine Großmutter Veronica befallen.
Der Song entstand gemeinsam mit seinem Vorbild Paul McCartney. Jahre später trat Costello zu Ehren des ExBeatles auf, in Anwesenheit der Queen. Costello im Rückblick: »Ich hatte nicht vorgehabt, jemals ein Konzert für die britische Königsfamilie zu spielen, aber Paul McCartney sollte in das Royal College of Music aufgenommen werden. Ich hätte es für keinen anderen getan. Denn dass Gott die Königin schützen möge, hatte man, wo ich herkam, nicht immer für die beste Option gehalten.«
Wo Declan Patrick MacManus herkam? Die Chroniken verzeichnen London, 1954. Das erste Domizil der Eltern war eine Kellerwohnung im damals wenig glamourösen Stadtteil Kensington, mit Plumpsklo auf dem Hof. Der Vater Ross war Sänger und JazzTrompeter. Er brachte unablässig PopSingles mit nach Hause, um die Songs für die Konzerte seiner Tanzkapelle einzustudieren. Der kleine Declan war in der beneidenswerten
Große Brille, raue Stimme, smarte Songs – das sind seit 1976
Elvis Costellos Konstanten.
El V is Cost E llo 23
Elvis Costello mag seine Wurzeln im Punk und New Wave haben. Doch längst tobt er sich in fast allen Genres aus.
›
Lage, Anfang der Sechziger stets den fabrikneuen Hits der Beatles, der Hollies und der Kinks ausgesetzt zu sein.
Man darf dem Künstler Glauben schenken, wenn er rückblickend schreibt, dass er sich aus LagerfeuerMelodien nie viel gemacht hat. Dem jugendlichen BeatlesFan waren die frühen Lennon/McCartneyKompositionen bald nicht mehr komplex genug. Costello widmete sich dem legendären SoulLabel Tamla/Motown und fragte sich, wie zum Teufel Marvin Gaye nur diesen himmlischen Gesang hinbekam.
In seiner Autobiographie »Unfaithful Music & Disappearing Ink«, die auf fast 800 Seiten höchst unterhaltsam den Nachweis seiner Fähigkeit zur Selbstironie erbringt, schreibt Costello über seinen ersten SoloAuftritt in Liverpool: »Ich erhielt dürftigen Applaus von ein paar Rentnern, die alkoholarmes Bier schlürften, und von ein paar versprengten Teenagern in ArmyMänteln, die Apfelmost tranken.«
Ob der Künstlername seine Idee gewesen sei?
»God no!«, grinst er als älterer Mann in einem Interview und führt aus, dass der »Costello« von einer Urgroßmutter stamme, die Anspielung auf Elvis Presley dagegen von seinem Manager. Der spendierte ihm gleichzeitig, 1976
war’s, eine übergroße Brille, die zu seinem Markenzeichen werden sollte, ähnlich wie die auffällige Zahnlücke.
»Leute wie Jane Birkin macht so eine Lücke sexy«, sagt Costello, »bei mir hat das ganz offensichtlich nicht geklappt.«
Schon bevor 1977 sein erstes Album erschien, war Costello mehr als nur ein talentierter Gitarrist und Autor zynischer, smarter Songs. Er verfügte über diese leicht angeraute Stimme, mit der er bald auch sein Talent als SoulCrooner unter Beweis stellen konnte. Doch meist waren seine Songs zu Beginn seiner Karriere so ungestüm wie sein Charakter. »I wanna bite the hand that feeds me«, sang er 1978 in »Radio Radio« – und setzte die angekündigte Rebellion prompt in die Tat um, als er den Song mit dem medienkritischen Inhalt bei »Saturday Night Live« spielte. Unangekündigt. Ein kleiner Eklat, der dazu führte, dass Costello jahrelang nicht mehr in der beliebten US Fernsehshow auftreten durfte.
Costello mag seine Wurzeln im Punk und New Wave haben – auf den mittlerweile 32 Studioalben hat er sich in fast allen Genres ausgetobt: Jazz, Soul, Country, sogar Ballett und klassische Musik hat er interpretiert, er hat so viele Songs geschrieben, »dass ich eine Woche lang spielen


24 El V is Cost E llo
Costello und Steve Nieve – hier 2020 in Liverpool – spielen seit 1977 zusammen.
Costello ist ein Bühnentier. Sein Spontan-Repertoire soll bei 150 Songs liegen.
könnte, ohne mich zu wiederholen«. Es gab ein Album mit den Rappern von The Roots und eines mit der NewOrleansLegende Allen Toussaint. Erst Anfang 2023 erschien »The Songs of Bacharach & Costello«, das alles enthält, was der Brite gemeinsam mit dem unlängst verstorbenen Komponisten Burt Bacharach komponierte. Bacharachs Hits waren bekannt für komplexe Harmonien und Akkordwechsel mit unerwarteten Modulationen –ähnliches ließe sich auch über viele CostelloSongs sagen.
Bereits seit 1977 wird Elvis Costello vom Keyboarder Steve Nason begleitet, dem frühzeitig der Beiname »Nieve« (ausgesprochen »naiv«) verpasst wurde. Dessen typischer OrgelSound prägte von Anfang an den klanglichen Charakter von Costellos Begleitband Attractions, die später in The Imposters umgetauft wurde. Längst ist Nieve Costellos liebster DuoPartner.
Wenn die beiden nun im Großen Saal der Elbphilharmonie auftreten, ist eine Rückkehr des »Spectacular Spinning Songbook«Glücksrads zwar unwahrscheinlich. Doch wird sich Costello gewiss erneut als begnadete
Rampensau erweisen und als Zeremonienmeister mit PorkpieHut den Kontakt zum Publikum suchen. Und vielleicht sogar Songwünsche erfüllen.
Elvis Costello hat seinen Memoiren nicht ohne Grund den Titel »Unfaithful Music & Disappearing Ink« gegeben. Die Texte des Singer/Songwriters bleiben nicht vertrauenswürdig, im besten Sinne. Kunst muss Widersprüche enthalten, darf so flüchtig wie Zaubertinte sein und ihre Herkunft nie komplett preisgeben – sonst wird sie banal. Man solle nicht versuchen, ihn zu durchschauen, singt Costello, der ewige Punk, in »All the Rage«: »Don’t try to read my mind / Because it’s full of disappearing ink.«
ÜBERNACHTEN IN DER SPEICHERSTADT

UNSER ANGEBOT FÜR SIE: 2 Übernachtungen inkl. AMERON Frühstücksbuffet | 1 Glas Champagner pro Person in der cantinetta bar | 2-Gang Menü in der cantinetta ristorante inkl. 1 Flasche Wasser | Nutzung unseres Fitness- & Spa-Bereichs VITALITY auf der 7. Etage mit Ausblick auf die historische Speicherstadt

El V is Cost E llo 25
ELVIS COSTELLO
Di, 19.9.2023 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal Elvis Costello (gitarre, gesang) steve nieve (Klavier)
AMERONCOLLECTION.COM
AMERON HAMBURG HOTEL SPEICHERSTADT, AM SANDTORKAI 4, 20457 HAMBURG RESERVIERUNG T. +49 40 638589 825 ODER VIA QR CODE
IMAGINIERTE INSZENIERUNGEN

Wenn der Konzertsaal
VON CHRISTOPH BECHER
Eine Frau und ein Mann stehen einander gegenüber. Sie sind frisch verheiratet, und der Mann lädt sie erstmals in sein Heim, eine dunkle Burg. Die Frau, sie heißt Judit, möchte Licht in die Finsternis einlassen und Luft und Wärme auch und bittet ihren Gatten, die sieben Türen öffnen zu dürfen. Dieser stimmt zu, wenngleich widerstrebend. Denn hinter der siebten Türe lauert ein schreckliches Geheimnis.
Judits Gatte heißt Blaubart, und auch ohne diesen Hinweis wissen Opernfans längst, dass hier von dem Einakter »Herzog Blaubarts Burg« die Rede ist, der einzigen Oper, die Béla Bartók geschrieben hat. Eine Oper für Sopran und Bariton, ohne Chor, mit einer betörenden, ebenso dramatischen wie zärtlichen Musik, die die komplette Handlung trägt, einschließlich aller unausgesprochenen Gedanken. Wenn man also bereit ist, sich Burg, Türen, Schatz, Waffen und Folterkammer in der eigenen Fantasie auszumalen, gleichsam aus der Musik herauszuhören, dann ist »Herzog Blaubarts Burg« die ideale Oper für den Konzertsaal.
Zugegeben, kaum eine Oper ist für den Konzertsaal geschrieben. Die meisten Komponisten denken bei ihren Bühnenwerken an ein Opernhaus, an Requisiten, Kostüme, Lichtwechsel, Maske und Regie. Und doch haben Opern im Konzertsaal viele Anhänger, weshalb Elbphilharmonie und Laeiszhalle in der Saison 2023/24 gleich zehn solcher Produktionen präsentieren – darunter auch Bartóks Einakter.
Allzu voreilig wird die Oper im Konzertsaal als »Konzertante Oper« etikettiert. Damit suggeriert man eine Aufführung, die bar jeder Szene, bar jedes optischen Hinweises auf die Handlung stattfindet: Sängerinnen in Abendkleidern, Sänger im Frack stehen mit dem Klavierauszug auf dem Notenpult rechts und links des Dirigenten und singen ihre Partien.
In Wirklichkeit verfließen die Grenzen zwischen den einzelnen Aufführungsformen und Gattungen. Längst werden Oratorien in Opernhäusern inszeniert, Sinfonien als Ballettmusiken gegeben und klassische Musicals auf Konzertbühnen dargeboten. Nachdem Nikolaus Harnon
court in den frühen 1990erJahren eine bis dahin unbeachtete Partitur von Johann Strauss’ Operette »Der Zigeunerbaron« ausfindig gemacht hatte, erklang das Werk bald darauf im Wiener Konzerthaus. Der britische Komponist George Benjamin, der dieses Jahr mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet wurde, dirigiert seine Opern wie »Written on Skin« und »Lessons in Love and Violence« nicht nur an führenden Opernhäusern, sondern auch in den Konzerthäusern von Brüssel, Paris, Hamburg, Köln, Dortmund und Essen.

Für solche Fälle haben sich Adjektive wie »semikonzertant« oder »halbszenisch« etabliert. Es gibt also ein breites Spektrum zwischen einer statischen Aufführung und einer mit Licht und Bewegung im ganzen Konzertsaal, mit Interaktion zwischen den Solisten, vielleicht auch mit ein paar Requisiten und zu den Charakteren passender Garderobe. Für den Erfolg der Aufführung können solche Elemente ausschlaggebend sein.
BEKANNTSCHAFT MIT RARITÄTEN
Den Generalintendanten der Elbphilharmonie, Christoph LiebenSeutter, begleitet das Genre von Anfang seiner beruflichen Laufbahn an. Schon Alexander Pereira, der in den 1980erJahren das Wiener Konzerthaus leitete und LiebenSeutter an seine Seite holte, programmierte konzertante Opern rund um Stars wie Agnes Baltsa, Montserrat Caballé, Plácido Domingo und José Carreras. Nikolaus Harnoncourt dirigierte frühe MozartOpern, die ebenso auf CD erschienen sind wie ein Zyklus von BelcantoRaritäten mit der legendären Edita Gruberová.
o p ER Konz ER tant 27 ›
zur Opernbühne wird, kann das viel mehr als nur reizvoll sein.
Polina Pasztircsák in Carl Maria von Webers »Der Freischütz« (Mai 2022)
Antonín Dvorˇáks »Rusalka« mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester (Mai 2022)
LiebenSeutter: »Hier konnte man Werke erleben, die in einem normalen Opernhaus kaum aufgeführt wurden, weil sie zu schwierig zu inszenieren oder weil die Musik zwar toll, aber die Libretti zu schwach sind. Auf diese Weise wurde für mich der Konzertsaal zur absolut gleichwertigen Möglichkeit, mir Opern zu Gemüte zu führen.«
Daran hat sich bis heute nichts geändert: Die Oper im Konzerthaus ermöglicht oft die Bekanntschaft mit Raritäten, um die die Bühnenhäuser einen Bogen machen. Auch alternative Fassungen können Anlass für konzertante Aufführungen sein, ebenso wie der Wunsch gefragter Interpreten, ein Werk musikalisch aufzuführen, ohne gleich mehrere Wochen in die szenische Erarbeitung zu investieren.

Im Wiener Konzerthaus baute Pereiras Nachfolger Karsten Witt das Opernangebot ab 1990 zu einem Abonnement aus. Für Witt wurde der Konzertsaal damit zum Opernhaus: »Wir haben das Licht im Saal angelassen, so konnte das Publikum nicht nur das Libretto im Programmheft mitlesen, sondern auch die Regieanweisungen. Und dann formiert sich eine ganz persönliche Inszenierung im Kopf. Während man als OpernhausBesucher einem Regiekonzept folgen muss, kann man sich im Konzertsaal seine eigene Inszenierung imaginieren.«
Ist also die Oper im Konzertsaal ein Ausweichort für Opernfans, die sich nicht mehr mit dem Regietheater herumschlagen möchten? LiebenSeutter antwortet diplomatisch: »In diese Klagen möchte ich nicht einstimmen. Es gibt tolle Inszenierungen, aber es kann im Opernhaus eben auch viel schief gehen. Mal schleppt der Chor, ein
andermal verbeißt sich die Inszenierung in einen einzigen Aspekt, oder man erwischt eine ungeprobte RepertoireVorstellung. In einem Konzerthaus hingegen läuft eine konzentrierte Probenarbeit auf einen Abend zu, und der stimmt dann eben.«
VOLLSTÄNDIGES VERSTÄNDNIS
Das bestätigt auch die Sopranistin Camilla Nylund, die an allen großen Opernhäusern der Welt gastiert und viele Opern auch in Konzerthäusern gesungen hat: »Eine solche Aufführung hat den Vorteil, dass es weniger szenischen Probenaufwand gibt. Wenn man dabei auswendig singt, kann man gut mit den Kolleginnen und Kollegen interagieren. Aus dem Publikum habe ich oft die Rückmeldung erhalten, man habe das Stück vollständig verstanden, eine Bühne sei gar nicht notwendig gewesen.«
Trotzdem sehnt sich Nylund nach der Opernbühne –und dem, was ihrem Auftritt vorangeht: »Ich liebe den Moment, in dem ich in der Maske sitze, sich jemand um mich kümmert, und ich mich noch einmal ganz auf den bevorstehenden Abend konzentrieren kann. Bei einer Oper im Konzertsaal hingegen gibt es diesen Moment nicht. Ich muss mich selbst schminken.«
Im Idealfall handelt es sich bei der Oper im Konzertsaal um eine Produktion, die zuvor auf der Bühne zu sehen war und deren Sänger ihre Partien auswendig können. So wie etwa bei Bernd Alois Zimmermanns »Die Soldaten«, wie sie im Januar 2024 in der Elbphilharmonie zu erleben sein wird. Das komplexe, unterschiedliche Zeitebenen und Tempi schichtende Werk war 1960 noch
Ein Chor-Solist in George Gershwins »Porgy and Bess« (Mai 2023)
als »unspielbar« abgelehnt worden; seit der Uraufführung durch Michael Gielen 1965 aber erklingt es regelmäßig auf europäischen Bühnen und gilt heute als Meisterwerk des Musiktheaters nach 1945. Die Kölner Produktion mit dem Gürzenich Orchester und FrançoisXavier Roth vom April 2018, inszeniert von der katalanischen Theatergruppe La Fura dels Baus, wurde inzwischen von dem spanischen Regisseur Calixto Bieito für Aufführungen im Konzertsaal optimiert.
Ähnlich ist es mit der deutschen Erstaufführung der BeckettOper »Fin de Partie« von György Kurtág im Oktober 2023 in der Elbphilharmonie. Alexander Pereira hatte das Werk bei dem ungarischen Komponisten ursprünglich für das Opernhaus Zürich in Auftrag gegeben, dann für die Salzburger Festspiele 2013 angekündigt und schließlich 2018 an der Mailänder Scala zur Uraufführung bringen lassen. »Nach dem Besuch der Uraufführung«, erinnert sich Christoph LiebenSeutter, »habe ich mehrere Versuche unternommen, das Stück nach Hamburg zu holen – und nun klappt es endlich.«
BEKANNTES IN BESONDERER GESTALT
Wie erwähnt, präsentieren die Konzerthäuser oft Werke, die es auf den Opernbühnen schwer haben – sei es, weil manche unzeitgemäßen Handlungen kaum noch inszenierbar scheinen, die Opernmusik aber durchaus fantastisch ist (darunter einiges von Franz Schreker, um nur ein Beispiel zu nennen); sei es, weil viele Opernhäuser auf regen Publikumszuspruch angewiesen sind und daher
Raritäten mit spitzen Fingern anfassen. Gerade die vorklassische Oper ist in den Häusern unterrepräsentiert und findet daher bei den Aufführungen in Elbphilharmonie und Laeiszhalle besondere Berücksichtigung: Opern von Christoph Willibald Gluck (»Iphigénie en Tauride«), Henry Purcell (»Dido and Aeneas«) und MarcAntoine Charpentier (»Médée«) stehen auf dem Programm, dargeboten von Ensembles und Dirigenten mit reicher Erfahrung in historischer Aufführungspraxis.
Dann gibt es Fälle, in denen bekannte Werke in besonderer Gestalt erscheinen. Hier freut sich LiebenSeutter vor allem auf die Wiederbegegnung mit dem Dirigenten René Jacobs: »Von ihm haben wir bereits Beethovens ›Leonore‹ gehört, also die Urfassung des ›Fidelio‹, sowie eine spezielle Fassung von Webers ›Freischütz‹, und nun machen wir Bizets ›Carmen‹. Die ist natürlich alles andere als eine Rarität – aber wir spielen sie in den kompakteren Dimensionen, mit denen sie 1875 in der Pariser OpéraComique uraufgeführt worden ist, und nicht mit dem Breitwandklang, den man von den ArenaAufführungen in Verona her kennt.« Apropos, wie ist es eigentlich um die akustischen Bedingungen bestellt? Opern sind schließlich für ein Bühnenhaus geschrieben, wo das Orchester im Graben sitzt und den Sängern gegenüber dynamisch zurücktritt. Im Extremfall, etwa im Bayreuther Festspielhaus, hört man auf der Bühne vom Orchester nichts, und allein der Dirigent übernimmt die Verantwortung für die Klangbalance zwischen Orchester und Gesang. Camilla Nylund

o p ER Konz ER tant 29
›
Konzertant, halbszenisch oder szenisch, mit dezenter Lichtregie, unter Ausnutzung des ganzen Saals oder voll kostümiert mitten im Orchester: Längst verfließen die Grenzen zwischen den Aufführungsformen.
Bo Skovhus und Adrian Angelico in Johann Strauß’ »Die Fledermaus« (Dezember 2018)
betont, wie wichtig es ist, dass sie das Orchester gut hört und so musikalisch etwas zurückbekommt. Die Nähe zum Dirigenten aber steht auf ihrer Wunschliste nicht oben: »Im Opernhaus besteht der Vorteil darin, dass der Dirigent etwas weiter weg ist und seine Gestik nicht direkt in mein Gesicht ragt.«

LiebenSeutter sieht gerade die Elbphilharmonie wie geschaffen für halbszenische Aufführungen: »Wenn die Sänger ihre Partien auswendig können, fangen sie automatisch an zu spielen, wenden sich einander zu, bewegen sich im Raum, stehen auch mal seitlich oder hinter dem Orchester oder an einem ganz anderen Ort im Saal. Wenn man diese Flexibilität nutzt, ist das Publikum hinter den Sängern oder seitlich davon kaum noch im Nachteil.« Stimmen aus dem Hamburger Publikum bestätigen das. Der Klassikfan und Investmentbanker Mark Miller etwa freut sich über die vielen zusätzlichen Spielorte in den Rängen und im gesamten Publikumsbereich. »Dadurch wird die Aufführung gewissermaßen dreidimensional. Und es ist gut, wenn ein Sänger mal in der Nähe der preiswerten Sitze steht.«
DAS GELD UND WAS WIRKLICH ZÄHLT
Bleibt noch eine rechtliche Besonderheit, nämlich die Verlagsabrechnung nach »Großem Recht«. Kurz erklärt: Jeder Konzertveranstalter muss für die gespielten Werke –sei es eine Sinfonie oder eine Klaviersonate – Gebühren an die Verwertungsgesellschaft Gema zahlen; das ist das sogenannte »Kleine Recht«. Das »Große Recht« gilt für Bühnenaufführungen und ist meist teurer. LiebenSeutter zeigt Verständnis für die Verlage: »Ob wir nach Kleinem oder Großem Recht abrechnen, ergibt sich aus der Auf
führung. Wenn die szenischen Elemente an Bedeutung gewinnen, kommt man um das Große Recht nicht herum. Bei den Opernaufführungen in der Elbphilharmonie nutzen wir zum Beispiel gerne die Möglichkeiten des Lichts, mit dem man Stimmungen zeichnen und die Spielorte der Sänger herausheben kann. Das kann bis hin zu einer komplexen Lichtregie gehen, und dann rechnen die Verlage natürlich Großes Recht ab, als ginge es um eine szenische Aufführung in einem Opernhaus.«
Bernhard Pfau vom SchottVerlag in Mainz bestätigt: »Aus einer konzertanten Aufführung wird eine szenische, wenn Schminke, Kostüme und Spiel der Sänger dazu kommen. Und wenn die Aufführung von vornherein als szenische Aufführung angekündigt wird, dann muss klar von einer Abrechnung nach Großem Recht ausgegangen werden.«
Das Geld ist also auch bei der Oper im Konzerthaus ein Thema. Natürlich ist eine Aufführung mit großem Orchester, ausgesuchten Solisten und Chor durch die Eintrittskarten nicht zu finanzieren. LiebenSeutter sieht das gelassen. »Es entspricht nun mal unserem Auftrag als Subventionsempfänger und Partner von Sponsoren, Veranstaltungen zu machen, die sich nicht rechnen. Darin unterscheidet sich eine Opernaufführung nicht von vielen Orchesterkonzerten.«
Entscheidend ist also, dass sich die Unternehmung Oper im Konzerthaus künstlerisch lohnt. Und dafür sind mit der stolzen Reihe international führender Sängerinnen und Sänger, Dirigenten und Orchester in Elbphilharmonie und Laeiszhalle die besten Voraussetzungen geschaffen. Die Opernbilder malen sich dann in der eigenen Fantasie wie von selbst.
Omar Ebrahim in Olga Neuwirths »The Outcast (März 2019)
PELLÉAS ET MÉLISANDE
Sa, 16.9.2023 | 19 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Budapest Festival orchestra
iván Fischer
Bernard Richter
patricia petibon u. a.
Claude debussy: pelléas et Mélisande
halbszenische aufführung in französischer sprache
FIN DE PARTIE
Sa, 14.10.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
danubia orchestra
Markus stenz
leonardo Cortellazzi
hilary summers u. a.
györgy Kurtág: Fin de partie
halbszenische aufführung in französischer sprache
MÉDÉE
Di, 21.11.2023 | 19 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Freiburger Barockorchester
sir simon Rattle
Magdalena Kožená
Reinoud Van Mechelen u. a.
Marc-antoine Charpentier:
Médée
Konzertante aufführung in französischer sprache
ORPHÉE AUX ENFERS
Sa, 30. & So, 31.12.2023 | 19 Uhr
Mo, 1.1.2024 | 18 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
ndR Elbphilharmonie
orchester, ndR Vokalensemble
Marc Minkowski
Marc Mauillon
tamara Bounazou u. a.
Jacques offenbach: orphée aux enfers
halbszenische aufführung in französischer sprache
DIE SOLDATEN
So, 21.1.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
gürzenich-orchester Köln
François-xavier Roth
Calixto Bieito (inszenierung)
tómas tómasson
Emily hindrichs u. a.
Bernd alois zimmermann:
die soldaten
inszeniertes Konzert
HERZOG BLAUBARTS BURG
Fr, 9. & Sa, 10.2.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
ndR Elbphilharmonie orchester


alan gilbert
Michelle deyoung, gerald Finley
Béla Bartók:
herzog Blaubarts Burg
Konzertante aufführung in ungarischer sprache
DIDO AND AENEAS
Mi, 14.2.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
il pomo d’oro
Maxim Emelyanychev
Joyce didonato
andrew staples u. a. henry purcell: dido and aeneas Konzertante aufführung in englischer sprache
CARMEN
Mo, 25.3.2024 | 19 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal

B’Rock orchestra, Chœur de Chambre de namur
René Jacobs
gaëlle arquez
sabine devieilhe u. a. georges Bizet: Carmen Konzertante aufführung in französischer sprache
IPHIGÉNIE EN TAURIDE
Fr, 24.5.2024 | 20 Uhr
Laeiszhalle Großer Saal Balthasar-neumann-Chor und -orchester thomas hengelbrock
Carolina lópez Moreno paolo Fanale u. a.
Christoph Willibald gluck: iphigénie en tauride Konzertante aufführung in französischer sprache
ST. FRANÇOIS D’ASSISE
So, 2., Do, 6. & So, 9.6.2024 | 17 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal philharmonisches staatsorchester hamburg
Kent nagano

thomas Jürgens, Julia Mottl, georges delnon (inszenierung) anna prohaska, Johannes Martin Kränzle u. a. olivier Messiaen:
saint François d’assise szenische aufführung in französischer sprache
Hans Werner Henzes »Das Floß der Medusa« mit Camilla Nylund (vorne rechts; November 2017)
Diesmal…
STICHWORT: »STIMMEN«

VON CLEMENS MATUSCHEK ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

JOSEPH HAYDN: SINFONIE NR. 60 »IL DISTRATTO«

Der allererste Ton ist in jedem Konzert stets derselbe: der Kammerton a, nach dem die Musiker ihre Instrumente stimmen. Vergessen sie’s mal, sind die Folgen verheerend. Genau diesen Fall simuliert Joseph Haydn – nie um einen musikalischen Scherz verlegen – in seiner Sinfonie Nr. 60 mit dem Beinamen »Der Zerstreute« (1774). Im Finale beginnen die Violinen gut gelaunt, setzen aber schon nach wenigen Takten abrupt die Instrumente ab, kontrollieren ihre Saiten und korrigieren die (zuvor absichtlich verstimmte) tiefe GSaite, um dann mit neuem Elan fortzufahren. Einmal mehr zeigt sich hier, wie Haydn selbst seine Entwicklung als fürstlicher Hofkomponist auf entlegenen Landschlössern beschrieb: »Ich war von der Welt abgesondert, und so musste ich originell werden.«
ALESSANDRO MORESCHI
THOMAS TALLIS: SPEM IN ALIUM
Eine der ganz großen Errungenschaften der europäischen Kunstmusik ist die Mehrstimmigkeit, das Nebeneinander unabhängiger, gleichberechtigter Stimmen, etwa im Chor. Bis ins Mittelalter hinein hatte die Kirche – ausgerichtet auf einen einzigen Gott – gegen diese musikalische Demokratie opponiert. Schließlich gab sie ihren Widerstand auf, als sie merkte, wie wunderbar sich Gläubige (und solche, die es noch werden sollten) durch vielstimmige Musik überwältigen ließen. Eine nochmalige Steigerung bot der Markusdom von Venedig mit seinen einander gegenüberliegenden Emporen, auf denen sich Sänger effektvoll im Raum platzieren ließen – die Erfindung des Stereoklangs. Doch das ist noch gar nichts gegen den Briten Thomas Tallis: Seine Motette »Spem im alium« aus dem Jahr 1570 nutzt 40 (!) Stimmen, organisiert in acht fünfstimmigen Chören. Durch ihre polyphone Eigenständigkeit entsteht ein räumlich wie akustisch kaum zu überblickendes Geflecht individueller Phrasen, die sich zu einem großen Ganzen vereinen.
Kastraten waren die spektakulärsten und zugleich moralisch fragwürdigsten Stimmen der Musikgeschichte. Durch den Eingriff vor Einsetzen der Pubertät blieb ihre hohe, klare Knabenstimme erhalten und verband sich mit der Kraft und dem Gestaltungsvermögen eines erwachsenen Sängers – eine atemberaubende Mischung. Doch der TestosteronMangel begünstigte auch übermäßiges Wachstum, Fettleibigkeit, Osteoporose und unterband (allen Legenden um Stars wie Farinelli zum Trotz) die Erektions und Fortpflanzungsfähigkeit. Eine ambivalente Haltung nahm einmal mehr die katholische Kirche ein: Weil Frauen im liturgischen Rahmen weder sprechen noch singen durften, beschäftigte der VatikanChor ab etwa 1550 Kastraten – selbst dann noch, als der Papst die Praxis der »Verschneidung« bei Strafe der Exkommunikation verbot. Der letzte päpstliche Kastrat, Alessandro Moreschi, starb erst 1922. Spät genug, um mit einigen Tonaufnahmen das Zeugnis einer versunkenen Welt zu hinterlassen.

32 MusiKlExiKon
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
OLIVIER MESSIAEN: CATALOGUE D’OISEAUX
Für den französischen Komponisten Olivier Messiaen war Musik nicht in Konzerthäusern zu Hause, sondern »im Wald, in den Feldern, im Gebirge, am Meeresstrand«. Denn im Gesang der Vögel hörte er mehr als in allen Stilen, »ob klassisch oder exotisch, alt oder modern«. Für den tief gläubigen Katholiken, der 60 Jahre lang als Organist der Pariser Kirche La Trinité amtierte, symbolisierte das Zwitschern und Tirilieren die Gegenwart Gottes. Also sammelte der begeisterte Ornithologe systematisch Vogelrufe, übertrug sie in Notenschrift und integrierte sie in seine klangprächtigen Werke. Eine Sonderstellung nimmt der zweieinhalbstündige Klavierzyklus »Katalog der Vögel« von 1958 ein. Insgesamt 77 Vogelstimmen sind darin zusammengetragen, von der Amsel bis zum Zaunkönig, vom Teichrohrsänger über den Steinschmätzer bis zum Mäusebussard. Ein faszinierendes Kompendium, das Kunst und Natur sinnlich vereint.
TOM WAITS: THE PIANO HAS BEEN DRINKING (NOT ME)

»Der Teppich müsste mal zum Friseur, die Barhocker brennen, die Jukebox muss pissen, die Kellnerin findest du nicht mal mit ’nem Geigerzähler und das Klavier ist besoffen – nicht ich.« So singt Tom Waits in einem seiner schönsten Songs. Ach, was heißt schon »singt«! Krächzt, knarzt, grummelt, grunzt, raspelt, röhrt. Neben dem späten Bob Dylan dürfte es kaum einen SingerSongwriter geben, der eine solche NichtStimme kultiviert hat. Wobei man sich bei Waits nie sicher sein kann, ob er wirklich einen im Tee hat, oder ob der angetrunkene, rauchende, depressive Künstlertyp nichts weiter ist als eine genüsslich zelebrierte Bühnenpose. Vermutlich weiß er es selbst nicht so genau. Von seiner Vielseitigkeit zeugen jedenfalls auch seine Filmauftritte – etwa in Jim Jarmuschs »Down by Law« – und seine beiden Opern »The Black Rider« und »Alice«, die er Anfang der Neunziger am Thalia Theater herausbrachte.
YMA SUMAC: VOICE OF THE XTABAY

»Nachtigall der Anden«, »Stimme der Inkas«, »Queen of Exotica« – die peruanische Sängerin Yma Sumac erhielt viele wohlklingende Ehrennamen. Als erste Frau aus Lateinamerika trat sie ab den 1950ern am Broadway und in der Carnegie Hall auf und erhielt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Verdient hatte sie sich ihn mit ihrer schier unglaublichen Stimme, die in jungen Jahren bis zu sechs Oktaven umfasst haben soll, das Doppelte normaler ausgebildeter Sänger. Von gutturalem Gesang bis zu vogelstimmenartigem Trällern reichte ihr Tonfall, von AndenFolk über Jazz und Mambo bis zu klassischer Oper ihr Stil. Ihre erste Platte »Voice of the Xtabay« klingt wie der hochgepitchte Soundtrack zu einem KarlMayFilm. Bis Mitte der Siebziger absolvierte sie 3.000 Konzerte, und noch immer ist sie mit 40 Millionen verkaufter Tonträger die erfolgreichste peruanische Künstlerin aller Zeiten.
KARLHEINZ STOCKHAUSEN: WELT-PARLAMENT
Das Abstimmen zählt zu den wesentlichen Aufgaben eines Parlaments, es bildet quasi den Kondensationspunkt seiner Arbeit. Hier werden Visionen Realität – oder abgeschmettert. Der größte Visionär in der Musikwelt nach dem Zweiten Weltkrieg war zweifellos Karlheinz Stockhausen. Als Pionier der elektronischen Musik erkundete er neue Wege der Klangerzeugung und eine daraus resultierende Ästhetik. Dabei machte er nicht bei Tönen halt, sondern avancierte zu einer Art Guru der von ihm selbst entwickelten WeltKulturPhilosophie. »Ich bin auf Sirius ausgebildet worden«, behauptete er einmal, »und will dort auch wieder hin, obwohl ich derzeit noch in Kürten bei Köln wohne.« Sein Opus magnum ist die 29stündige (!) Oper »Licht«, an der er gut 25 Jahre arbeitete. In einer Szene tagt das WeltParlament und diskutiert Themen wie Solidarität und Liebe, bis der Präsident von einer Sopranistin abgelöst wird, weil sein Auto abgeschleppt zu werden droht. Konsequenterweise zählte Stockhausen zu den Erstunterzeichnern eines Aufrufs für ein WeltParlament der UN

M DIE PLAYLIST ZUM LEXIKON FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/PLAYLIST

Musi K l E xi K on 33
WAS WIRD SIE ALS NÄCHSTES FINDEN?
Im Großen Saal der Elbphilharmonie bei den Vorbereitungen zu »Yes – eine räumliche Performance«

VON VOLKER HAGEDORN
Gar nicht so einfach, hier ein ruhiges Eckchen zu inden, im Kölner Café Funkhaus, wo es an einem kühlen Maienmittag rappelvoll ist. Pop schallt aus den Boxen, Kaffeemaschinen zischen, Geschirr klappert. Von unserem letzten Treffen erinnere ich mich, dass die Komponistin aus dem lärmigen Londoner Stadtteil Brixton stammt und Geräusche und Baustellen liebt. Rebecca Saunders findet schnell ein Tischchen, das ich übersehen habe, ganz am Rand, und da reden wir, noch ehe Ingwertee und Cappuccino kommen, schon über ihre Musik. Eine Musik, die in der Stille ihrer Berliner Wohnung entstand und am Abend zuvor erstmals zu hören war. »Skull« heißt das Stück für vierzehn Musiker, »Schädel«, eine unglaublich lebendige Musik und alles andere als knochig. Saunders ist in der bestens besuchten Kölner Philharmonie mitsamt dem Ensemble Modern geradezu gefeiert worden, auch für »Scar« und »Skin«, für das ganze nun vollendete, in sieben Jahren entstandene Triptychon.
Sie ist darüber merklich froh. Keine, die so etwas für selbstverständlich hält, seit sie 2019 mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet wurde, als erste Komponistin überhaupt – wobei es sie nervte, dass manche eben das wichtiger zu finden schienen als ihr Werk. Sie ist nicht der Rampentyp mit Botschaft und Bugwelle. Selbstbewusst, das schon, aber vor allem nachdenklich, offen, neugierig. Da wir beide im Bann des taufrischen Werkes stehen, ergibt sich die Gelegenheit, ihre Arbeitsweise vom aktuellen Stand aus kennenzulernen, sogar am Beginn einer neuen Entwicklung. Da ist es allerdings hilfreich zu wissen, was bisher geschah. Wie und warum Rebecca Saunders, 1967 in London geboren, sich vor knapp drei Jahrzehnten aus britischen Traditionen befreite und in Deutschland heimisch wurde, begleitet von der »absoluten Abneigung, auch nur ein melodisches Fragment zu schreiben«.
Nicht, dass man sie vorher zur Melodie gezwungen hätte. Die junge Rebecca hörte gern den Sängern zu, die von ihren Eltern begleitet wurden, beide Pianisten, »und
Brahms war meine große Liebe«, sagt sie lachend. »Ich war ja Geigerin und habe mit meinem Vater die Sonaten gespielt und aufgeführt.« Lieder schrieb sie schon als Kind, »es war so selbstverständlich und natürlich, eine Melodie zu schreiben«. Das Melodienschreiben hätte auch in Edinburgh so weitergehen können, wo sie Komposition studierte, hätte ihr dort nicht ein Professor Kassetten mit jüngster Avantgarde in die Hand gedrückt. »Das war ein kompletter Schock«, hatte sie mir bei einem früheren Treffen in Berlin erzählt. »Ich war wie wachgerufen. Was, das gibt’s? Ein Klang, der nur für sich da steht, der sich auf nichts bezieht als auf seine eigene Körperlichkeit!« Es war eine der »Chiffren« des Komponisten Wolfgang Rihm, die sie umgehauen hatte. »Da muss ich hin«, habe sie gedacht, bei dem wollte sie lernen. Mit einem Stipendium kam die 23Jährige nach Karlsruhe. »Ich konnte kein Wort Deutsch, und Rihm konnte nur wenig Englisch. Er hat einfache Fragen gestellt, über die ich tagelang nachdenken musste: ›Welches Gesicht hat dein Stück?‹ ›Hat es Augen?‹ Ich dachte, wow, es könnte keine Augen haben. ›Hat es einen Mund?‹ Nein. ›Welche Farbe?‹ Rot. ›Wo ist es denn?‹ Das war für mich ein Geschenk. Nicht über die Musik zu sprechen, sondern sich schon in der Musik zu befinden.«
So fing das an. Seitdem hat Saunders das Komponieren für sich neu erfunden, nach und nach alles neu erschlossen, die Instrumente, dann auch die Stimme, wenn auch noch lange keine »Melodie«; nebenher hat sie sich ein exzellentes Deutsch angeeignet und zwei Kinder großgezogen.
ERST EINMAL ZUHÖREN
In »Skull« stieg sie, wie schon oft, ein, indem sie zuhörte. »Ich habe mit dem Trompeter gearbeitet, Sava Stoianov, der aus Bulgarien kommt und einen komplett eigenen Klang hat. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie machst du dein Instrument warm, wie spielst du dich ein? Da kamen so halb offene Töne mit ganz tiefem Luftklang«, sie deutet das singend an, »und Improvisationen, melodische Fragmente, das fand ich unglaublich sinnlich und lyrisch.« Daraus wurde in ihrem Kopf ein Glissando um einen Halbton nach unten, zur Trompete kam die Bratsche, dann das Saxofon, »und dann kommen alle zusammen, das war die Keimzelle«. Eine melodische Keimzelle, die ein ganzes Stück prägt – das ist neu bei Rebecca Saunders, wie so manches in »Skull«.
Ohnehin wiederholt sie sich nie, jede ihrer Stationen brachte Spannendes hervor. Das erste Werk, das die Komponistin von sich gelten lässt, ist »Behind the Velvet Curtain« (1991), ein Rausch leuchtender Farben für Trompete, Harfe, Klavier und Cello. Seitdem entstanden mehr als 85 Kompositionen von großer Vielfalt, in denen immer ihre persönliche Handschrift zu erkennen ist.
Die Collage »Hauch – Musik für Tanz« von 2021 für Solisten und Tänzer, die für die Elbphilharmonie neu choreografiert wird, ist ein geradezu idealer Einstieg in Saunders’ Welt, denn sie bietet ein Prisma dieser Vielfalt ›
R EBECC a s aund ER s 35
Mit unverwechselbarer Handschrift ist die Komponistin Rebecca Saunders auf permanenter Expedition ins Ungewisse. Jüngst hat sie wieder Neuland betreten.
in szenischem Rahmen, zum Hören und zum Sehen. In »Hauch« werden sechs Solowerke und ein Duo aus sechzehn Jahren collagiert. »Es wird nicht einfach ein Stück nach dem anderen gespielt«, sagt sie, »es gibt auch Überlappungen. Stücke, die aufgeteilt werden, die kommen und gehen, so, dass sie sich mit den Tänzern bewegen. Zusätzlich habe ich aus jedem Werk Klänge genommen, die als Schatten agieren, wenn einer sein Solo hat. Und es gibt Improvisationen für alle Instrumente, die nach bestimmten Impulsen eine begrenzte Palette von Klängen spielen.«
Das früheste der Solowerke, die in »Hauch« sozusagen Teil einer Metakomposition werden, ist »Blaauw« für Trompete von 2004 (in neuer Version für die Collage), das späteste »To an Utterance – Study« für Klavier, 2020 geschrieben; dazu kommen Viola, Perkussion, Cello, Trompete und ein Duo für Violine und Oboe. War es schwierig, die verschiedenen Sprachen dieser Stücke zusammenzubringen? »Es war interessant und notwendig! Bei einer Collage ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Stücke und Module Eigenschaften haben, die sie von den andern unterscheiden und sofort erkennbar sind. So kann mit den Tänzern und Musikern – die bewegen sich auch – eine räumliche Polyfonie entstehen.«
Was sie bei der Konzeption fasziniert hat, ist die Veränderung der Zeit durch den Tanz. »Die Zeit fließt anders, als wenn eine Sängerin auf der Bühne steht. Man kann einen liegenden Ton haben, der sich leicht bewegt, fünf Minuten lang, wo der Tanz absolut in den Vordergrund kommt.« Wer wann was macht in diesen rund 80 Minuten, das hat Rebecca Saunders in der ihr eigenen Präzision auf
Millimeterpapier festgehalten, und zum Instrumentarium gehört auch eine stumme Stoppuhr. »Aber die läuft nicht immer«, sagt sie lachend.


KÖRPER, FARBE, RÄUMLICHKEIT
Tatsächlich klingt Saunders’ Musik, so extrem durchdacht sie ist, nie nach Papier, sie hat immer einen Körper. Eine Farbigkeit und eine Plastizität, die sich aus großer Nähe zu den Akteuren und aus feinsten Strukturen speisen, in der Wirkung so unmittelbar wie die Energien, die das von Akzenten durchzuckte Filigran im Streichquartett »Fletch« (2012) fast zum Naturereignis machen. Immer entstehen Räume und Welten, in die man beim Hören geradezu hineinsehen kann. Die Bewegungen darin können sich ausbreiten wie eine Meeresoberfläche (in »Scar« von 2019) oder Druck aufbauen wie in »Skin« (2016), dem ersten Stück, in dem Saunders eine Stimme zum Einsatz brachte, eine Sopranistin, die erst mal gar nicht singt, sondern flüstert, stammelt – als sei so viel zu sagen, dass es nicht zu sagen ist.
Die jüngste Arbeit »Skull« ist die mit dem eindeutigsten Material, das Saunders bis jetzt verwendet hat: kleine Sekunde abwärts, verarbeitet mit der ältesten polyfonen Technik, die es gibt – der Imitation, dem Wiederholen eines Motivs in einer anderen Stimme, in diesem Fall immer leicht verändert. »Ich kann nicht glauben, dass ich’s gemacht habe«, sagt sie und lacht, »es ist befreiend, ein Verbot aufzuheben.«
Hatte sie sich zuvor denn Imitationen im Ernst verboten? »Nein, aber man muss manchmal einfach Sachen ausschließen. Beim Komponieren kann man nicht alles in jedem Stück machen. Man muss Klänge, Ausdrucks möglichkeiten, Techniken ausschließen, um wirklich an den Kernklang für jedes einzelne Stück heranzukommen. Melodien – so etwas wollte ich lange nicht machen, weil es so viele andere Sachen gab, die ich erforschen wollte. Als ich 2011 anfing, Triller zu komponieren, war das auch eine Befreiung. Triller können ja etwas Oberflächliches sein. Ich hatte mir gesagt, so etwas schreibe ich erst, wenn ich verstehe, wie ein Triller an sich Sinn hat, wie das in meiner Musik verankert werden kann.« Im Violinkonzert »Still« für Carolin Widmann, von Samuel Beckett inspiriert, fand sie dann den Platz.

36 R EBECC a s aund ER s
»Es ist sehr gefährlich, wenn eine Kunst, die keine direkte gesellschaftliche Relevanz aufweist, als problematisch gesehen wird.«
Millimeter- und sekundengenau: die Timeline zu »Hauch – Musik für Tanz«
So gesehen, ist Saunders’ Œuvre eine permanente Expedition ins Ungewisse – jenes Ungewisse, in das sich Traditionen, Instrumente, über Jahrhunderte entwickelte Formen und Techniken verwandeln, wenn man sie nicht einfach übernimmt, daran anknüpft und sie fortschreibt, sondern sie angeht wie einen unerforschten Kontinent, und das mit der Akribie einer Wissenschaftlerin. Man möchte bei ihr immer wissen, was findet sie als nächstes für sich, was wird sie damit machen?



NATÜRLICH KEINE ARIE
Besonders beim Umgang mit der Stimme zeichnet sich ein spannender Weg ab: Auf »Skin« folgte mit »Yes« 2017 ein weiteres Stück mit Sopran – »das erste Mal, dass ich eine Akteurin zur Welt gebracht habe«, wie Saunders damals sagte. Sie hatte Molly Bloom zum Singen gebracht, den Schlussmonolog der Protagonistin im »Ulysses« von James Joyce, den Klangreichtum der uferlosen Sätze erforscht, in denen Molly schamfrei vom Leben und Lieben spricht bis hin zum finalen »yes I said yes I will Yes«.
Natürlich wurde das keine Arie. Saunders verteilt die Worte, besser gesagt die Hälfte der Wörter, auf eine Sopranistin und 19 Instrumentalisten. Es werden Silben in die Bassflöte geflüstert und geschrien, der Akkordeonist spricht, während sein Instrument einatmet, die Sängerin sogar dann, wenn sie keinen Atem mehr hat. Singen darf sie natürlich auch! In Saunders’ nächstem Stück für eine Sängerin, »Us Dead Talk Love« von 2021 für Altstimme und kleines Ensemble, gewinnt die Solistin schon mehr Raum für sich, sie wird unberechenbarer, persönlicher. »Beim Alt haben Sprech und Singstimme dieselbe Farbe, Sprechen und Singen können ineinander verwoben werden, anders als beim Sopran … aber guck mal, da ist die Diva – hello!« Rebecca Saunders winkt einer Frau zu, die gerade ins Café gekommen ist – ihre Sopranistin vom Vorabend, Juliet Fraser, ein Wunder an Präzision und Intensität; sie wird in der Elbphilharmonie auch die Vokalpartie in »Yes« übernehmen. »Juliet ist keine Diva, das ist das Schöne. Ich nenne sie Diva, und sie nennt mich Boss.« Saunders lacht sehr fröhlich, so unpassend sind die beiden Etiketten.
Und so sehr freut sie sich auf das, was »Us Dead Talk Love« bei ihr ausgelöst hat. »In Bern kam ich von der
Probe an diesem Stück nach Hause und wusste, dass ich jetzt eine Oper schreiben kann. Muss! Am nächsten Tag rief die Deutsche Oper Berlin an – wegen einer Oper! Und ich habe zugesagt. Zwei Tage davor hätte ich einen Opernauftrag abgelehnt.« Ed Atkins, ein britischer Künstler, schreibt nun das Libretto. »Es geht um Fragen und Antworten. Liebe, Tod, alles, was Oper ausmacht, aber keine Geschichte. Wir arbeiten mit wiederholten Mechanismen, vielleicht ein bisschen wie in Becketts Fernsehspielen. Eine enorme Herausforderung. Ich möchte, dass die Körperlichkeit der Musik einen komplett ausfüllt. Na, mal gucken. Mit Orchester … ich hätte niemals gedacht, dass ich so etwas mache, muss ich sagen. Aber das Leben ist zu kurz, da sollte man nicht zu lange warten.«
Sie erlaubt sich also Melodisches, lässt sich auf Stimmen ein, sogar auf eine Oper – kann es sein, dass auch die ältere Musik wieder interessant für sie wird? »Ich komme gerade zurück zu Barock und Vorbarock und spiele Couperin auf dem Klavier. Den habe ich gerade neu entdeckt, großartig!« Das Klavier war neben der Geige schon früh ihr Instrument, einfach weil ihr Elternhaus voller Klaviere war. Mit »To an Utterance« –im vergangenen Februar beim ElbphilharmonieFestival Visions zu hören – hat sie sich dem Instrument im Rahmen eines Klavierkonzerts neu angenähert. Komponiert ›

R EBECC a s aund ER s 37
hat sie es 2020, »im ersten Lockdown – vier Monate nur zu komponieren war so schön! Es war gewissermaßen ein Luxus, dass die Welt aufgehört hatte. Aber der zweite Lockdown war fürchterlich.«
DIE LIEBE ZUR POLYFONIE
Vieles von dem, was sie macht, speist sich aus Eindrücken vor ihrer Selbstfindung auf dem Kontinent. »Ich weiß noch, als ich ganz jung war, diesen Moment in einer MahlerSinfonie, wo ganz hohe Klänge einfach hängen, während unten alles wegbricht. Das habe ich immer mit mir getragen, bestimmte Momente, eine bestimmte Art von Klang. Und die Polyfonie, die in ›Skull‹ ganz im Vordergrund steht – wo die Instrumentalsolisten wirklich miteinander singen –, sie geht zurück auf mein Studium in Edinburgh, wo Polyfonie mein Lieblingsfach war. Alle meine Stücke sind auf eine Art mehrstimmig, ich denke polyfon. Aber so deutlich wie jetzt, das ist schon ganz neu.« Wie wird ihre Musik in ihrer Heimat rezipiert? »Ich werde weniger wahrgenommen als hier in Deutschland«, meint Saunders, »aber fast alle meine Werke werden in Huddersfield aufgeführt, das Huddersfield Contemporary Music Festival ist einfach großartig. Aber sie kämpfen gegen enorme finanzielle Schwierigkeiten und populistischen Gegenwind. Viele Veranstalter sind verängstigt, alles muss gerechtfertigt werden. Jedes Stück muss einen Bezug zu etwas haben, relevant sein, bestimmte Themen müssen angesprochen werden. Es gibt einen Mangel an Verständnis dafür, dass Kunst autonom sein muss.« Dass sich so etwas durch die ganze Musikgeschichte zieht, sei kein Grund zur Beruhigung, findet Saunders. »Sobald
von oben herab gesagt wird, was erlaubt ist und was nicht, befindet man sich in einer extrem schwierigen gesellschaftlichen Situation, und in Großbritannien ist das sehr weit fortgeschritten. Es gibt diese Tendenz neuerdings auch in Deutschland. Es ist sehr gefährlich, wenn eine Kunst, die keine direkte gesellschaftliche Relevanz aufweist, als problematisch gesehen wird. Wir dürfen diesen Diskurs nicht leicht nehmen, man muss aufpassen.«
Ein gutes Zeichen ist es allerdings, dass eine Komponistin wie Rebecca Saunders an großen Häusern wie der Elbphilharmonie und bei einem Festival wie Acht Brücken in Köln in den Fokus gestellt wird – und dann auch noch die Säle füllt. »Ich wurde angesprochen von Leuten, die meinten, das ist sonst nicht mein Ding, aber ich will mehr hören. Da kommen ganz normale Menschen, hören neue Musik und haben keine Ahnung, was da abgeht, und sind interessiert!«
Ja, was geht da ab in neuer Musik? Auf gewisse Weise immer auch das, wovor wir oft Angst haben: Man weiß nicht, was als nächstes passiert. Nur braucht man in einem nie zuvor gehörten Stück Musik vor dem Unbekannten keine Angst zu haben. »Das ist das Großartige an der neuen Musik«, sagt Rebecca Saunders. »Wenn man ein Stück zum ersten Mal hört, ist das ein Angebot, sich zu öffnen und tatsächlich etwas zuzulassen. Man begegnet etwas Unbekanntem, das ist aufregend und wunderschön. Und das erlebt man nicht für sich allein mit dem Kopfhörer. Wir machen das gemeinsam.«
M MEHR ÜBER REBECCA SAUNDERS FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
REBECCA SAUNDERS
YES
Fr, 24.11.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Ensemble Musikfabrik, Enno poppe
Juliet Fraser (sopran)
paul Jeukendrup (Klangregie)
Rebecca saunders: yes / Eine räumliche performance
DUST
Di, 5.12.2023 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
trio accanto
Rebecca saunders: dust; that time
sowie Werke von Beat Furrer und Misato Mochizuki
HAUCH
Mi, 28.2.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Ensemble Modern Rafaële giovanola (Choreografie)
Cocoondance Company
Rebecca saunders: hauch#2 –Musik für tanz
FLETCH
Sa, 11.5.2024 | 17 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
arditti Quartet
Rebecca saunders: Fletch sowie Werke von Carter, xenakis, neuwirth, Ferneyhough, nemtsov, lachenmann, harvey

UNBREATHED
Di, 28.5.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Ensemble Resonanz
Rebecca saunders: ire; all that dust; unbreathed
38 R EBECC a s aund ER s
DAS ELBPHILHARMONIE MAGAZIN
Für wen ist das Abonnement?
Für mich selbst Ein geschenk
Das Abo soll starten mit der aktuellen ausgabe der nächsten ausgabe
Rechnungsanschrift:
name Vorname
zusatz
straße / nr.
plz ort
land
E-Mail (erforderlich, wenn Rechnung per E-Mail)
Mit der zusendung meiner Rechnung per E-Mail bin ich einverstanden.
hamburgMusik ggmbh darf mich per E-Mail über aktuelle Veranstaltungen informieren.
Ggf. abweichende
Lieferadresse (z. B. bei Geschenk-Abo):
name Vorname

zusatz
straße / nr.
plz ort


Nutzen Sie die Vorteile eines Abonnements und lassen Sie sich die nächsten Ausgaben direkt nach Hause liefern.
Oder verschenken Sie das Magazin-Abo.
3 Ausgaben zum preis von € 15 (ausland € 22,50) preis inklusive Mwst. und Versand
Unter-28-Jahre-Abo: 3 ausgaben zum preis von € 10 (bitte altersnachweis beifügen)
Jetzt Fan der Elbphilharmonie Facebook-Community werden: www.fb.com / elbphilharmonie.hamburg
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular zu:
ELBPHILHARMONIE Magazin

leserservice, pressup gmbh
postfach 70 13 11, 22013 hamburg
Oder nutzen Sie eine der folgenden Alternativen: tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299 E-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de internet: www.elbphilharmonie.de
land
Jederzeit kündigen nach Mindestfrist: Ein geschenk-abonnement endet automatisch nach 3 ausgaben, ansonsten verlängert sich das abonnement um weitere 3 ausgaben, kann aber nach dem Bezug der ersten 3 ausgaben jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Ende der verlängerten laufzeit gekündigt werden. Widerrufsrecht: die Bestellung kann innerhalb von 14 tagen ohne angabe von gründen in textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) oder telefonisch widerrufen werden. die Frist beginnt ab Erhalt des ersten hefts. zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige absendung des Widerrufs (datum des poststempels) an: Elbphilharmonie Magazin leserservice, pressup gmbh, postfach 70 13 11, 22013 hamburg tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299, E-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de Elbphilharmonie Magazin ist eine Publikation der HamburgMusik gGmbH
Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg, Deutschland
Geschäftsführer: Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Zahlungsweise: Bequem per Bankeinzug gegen Rechnung
Kontoinhaber
iBan
BiC (bitte unbedingt bei zahlungen aus dem ausland angeben) geldinstitut
SEPA-Lastschriftmandat: ich ermächtige die hamburgMusik ggmbh bzw. deren beauftragte abo-Verwaltung, die pressup gmbh, gläubiger-identifikationsnummer dE32zzz00000516888, zahlungen von meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der hamburgMusik ggmbh bzw. deren beauftragter abo-Verwaltung, die pressup gmbh, auf mein Konto gezogenen lastschriften einzulösen. die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.
hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. die Einzugsermächtigung erlischt automatisch mit ablauf des abonnements.
datum unterschrift
IM ABO

GOOD VIBRATIONS


Solisten, Ensembles, Orchester, all die Musiker bei den Proben und später im Konzert, die Menschen im Publikum, die Besucher auf der Plaza, die vielen Mitarbeiter hinter den Kulissen: Tausende unterschiedlichste Stimmen versetzen die Elbphilharmonie Tag für Tag in eine Schwingung, die ganz wesentlich zur guten Stimmung im Hause beiträgt. Unser Fotograf hat sich vorgestellt, wie diese Schwingung aussehen könnte.
 FOTOS NIKLAS GRAPATIN
FOTOS NIKLAS GRAPATIN


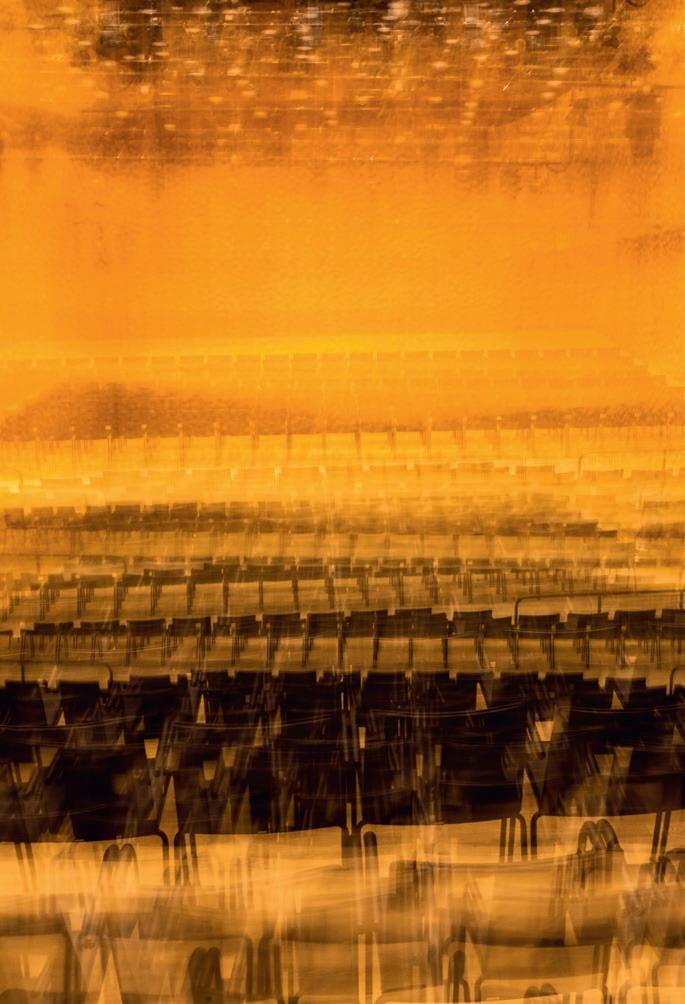























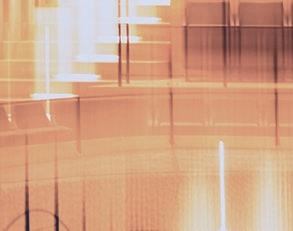





»NICHT JEDER WIRD MEINE INTERPRETATION MÖGEN«


















48 VíKinguR ÓlaFsson
Kaum zu glauben, aber Víkingur Ólafsson ist mittlerweile fast 40 Jahre alt. Dabei sieht der 1984 in Reykjavík geborene Pianist mit den charakteristischen runden Brillengläsern immer noch ein bisschen wie eine Mischung aus Harry Potter und MatheAss aus. In diesem eigenwilliglässigen HipsterLook hat er es mit seinen KlassikAlben auch schon in die PopCharts geschafft. Der Mann kommt an, auch und gerade bei einer jüngeren, nicht zwingend klassikaffinen Zielgruppe. Die leicht nerdige Aura des MatheGenies passt außerdem ganz gut zu seinem pianistischen Hausgott Johann Sebastian Bach, dessen Kompositionen gerne mal mathematische Strenge attestiert wird.
In seiner Heimat Island studierte Ólafsson bei Erla Stefánsdóttir und Peter Máté, bevor er 2008 an der Juilliard School of Music in New York bei Jerome Lowenthal und Robert McDonald seinen Masterabschluss machte. Ein Jahr später gründete er sein eigenes Plattenlabel, gewann einen Preis nach dem anderen und wurde von der Presse für sein »weiches Staccato« und seine »nuancierte Anschlagstechnik« gerühmt. »Ólafsson analysiert und filetiert, lässt sich aber auch hinreißen und horcht den Tönen nach, als improvisiere er frei vor sich hin«, war im »Tagesspiegel« zu einem Konzert mit Werken von Mozart und dessen Zeitgenossen zu lesen. Die »New York Times« wiederum bezeichnete ihn für seine BachInterpretationen schlicht als »Iceland’s Glenn Gould« –nicht der schlechteste Vergleich.
Ohnehin spielt Bach in der rasanten Karriere des Pianisten eine besondere Rolle, auch wenn er nach eigener Aussage »einen großen musikalischen Appetit« habe. Rameau, Mozart, Debussy, Chopin hat er im Programm, dazu die Werke seines Freundes Philip Glass. Überhaupt setzt er sich für Neue Musik ein, hat bereits mehrere Klavierkonzerte isländischer Komponisten uraufgeführt. Aber es war ein kleiner Auftritt mit Bachs »GoldbergVariationen« in Berlin, bei dem einige Scouts des Traditionslabels Deutsche Grammophon auf ihn aufmerksam wurden und ihm einen Exklusivvertrag anboten. Allerdings hat er die »GoldbergVariationen« zunächst einige
Jahre auf Eis gelegt, sich in der Zwischenzeit mit anderen Werken Bachs beschäftigt, um nun zu diesem bedeutenden Klavierzyklus zurückzukehren – mit frischen Ohren. Wenige Tage vor diesem Interview hat er die Aufnahmesitzungen dazu abgeschlossen, wie ohnehin die ganze kommende Spielzeit unter dem Motto »Goldberg« steht: Víkingur Ólafsson geht mit dem VariationenZyklus, den Bach angeblich zur nächtlichen Erbauung eines an Schlafstörung leidenden Adeligen komponierte, auf musikalische Weltreise – und macht dabei gleich zwei Mal Halt in Hamburg.
Sie haben einmal gesagt, dass Sie Bach jeden Tag stundenlang spielen könnten. Keine Angst, dass er Sie irgendwann langweilt?
Víkingur Ólafsson: Für mich ist Bach das Alpha und Omega. In seinen Werken fasst er sozusagen zusammen, was in der Musikgeschichte vor ihm war, und transformiert es in seine eigene Kunst. In gewisser Weise enthält seine Musik aber auch beinahe alles, was nach ihm kommt. Bei Bach gibt es eine erstaunliche Einigkeit darüber, dass er der größte Komponist aller Zeiten ist. Bei allen anderen gehen die Meinungen doch deutlich auseinander, selbst bei Mozart oder Beethoven. Mit Bach ist es ein bisschen wie mit Shakespeare unter den Schriftstellern: Ihm ist es gelungen, etwas zu schaffen, was größer ist als er selbst. Außerdem hat er so viele verschiedene Aspekte meiner musikalischen Entwicklung genährt.
Welche denn?
Er hat mich gelehrt, über die Struktur von Musik nachzudenken, was mir wiederum dabei hilft, wenn ich Mozart oder Chopin spiele. Außerdem war er mein Lehrmeister in technischer Hinsicht, ja er ist für mich der anspruchsvollste Klavierkomponist, weil man sich hinter der Polyfonie, wie er sie schreibt, nicht verstecken kann. Bei fast allen anderen Komponisten ist es einfacher, sich da aus der Affäre zu ziehen. Nehmen wir zum Beispiel Rachmaninows 3. Klavierkonzert, das in seiner Virtuosität sicher schwierig ist. Aber hinter all der Virtuosität kann man sich auch ein bisschen verstecken. Das geht bei Bach nicht, weil er den Interpreten exponiert und jede Schwäche in der Interpretation gnadenlos aufdeckt, technisch wie geistig. Und schließlich verbindet Bachs Musik den Pianisten mit dem Komponisten in mir. Bei ihm muss man zu einer Art CoSchöpfer werden. Er hat uns zwar die Noten hinterlassen, aber sonst gibt es keine Angaben zu Tempo, Dynamik, Phrasierung oder Artikulation. Es geht also darum, aus dieser Freiheit seine eigene Interpretation zu komponieren.
Sie kommen gerade aus einer Art Bach-Klausur. Wie war’s denn?
Ich habe die »GoldbergVariationen« aufgenommen. Zwei Wochen lang habe ich keine andere Musik gespielt, sondern sechs Stunden jeden Tag nur dieses eine Stück,
Ví K ingu R Óla F sson 49
Gleich in fünf Varianten sind die »Goldberg-Variationen« diese Saison zu hören – zwei davon mit dem Pianisten Víkingur Ólafsson, der hier über nichts anderes spricht als über Bachs einzigartiges Meisterwerk.
›
VON BJØRN WOLL
weil ich so tief eintauchen wollte wie möglich. Bei jedem anderen Komponisten wäre ich bei einer derartigen Konzentration vermutlich verrückt geworden, mit Bach aber funktioniert das für mich wunderbar.
Wann fing diese innige Beziehung zu ihm denn an, gab es ein Schlüsselerlebnis?
Das Witzige daran ist, dass ich Bach als Kind überhaupt nicht mochte. Vermutlich lag das daran, dass seine Musik eher trocken und technisch vermittelt wurde. Mit etwa 13 habe ich dann eine Aufnahme des »Wohltemperierten Klaviers« von Edwin Fischer aus den 1930erJahren gehört, eine der frühesten Aufnahmen, die wir von dem Stück haben. Da ist irgendetwas in mir passiert, denn zum ersten Mal verstand ich die Poesie in Bachs Musik. Dafür hat Edwin Fischer auf ewig einen Platz in meinem Herzen, auch wenn seine Interpretation für unsere heutigen Ohren ungewohnt romantisch klingt. Aber sein Zugang zu dieser Musik hat etwas in mir ausgelöst.
tation mögen wird. Denn mir ging es mit einigen Aufnahmen genauso. So ist das mit Bach: Der Spielraum ist groß, und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Pianisten sind daher oft immens. Das macht es ja so spannend, sich mit den verschiedenen Zugängen auseinanderzusetzen.
Nikolaus Harnoncourt hat einmal gesagt, Bachs Geheimnis läge darin, dass bei ihm keine Note zu viel ist. Stimmen Sie zu?
Wenn Sie heute Aufnahmen mit Bach hören, welche sind das?
Ich höre mir gerne seine Orchesterwerke, Kantaten und großen Chorwerke an, die Passionen zum Beispiel. Bevor ich mit den »GoldbergVariationen« ins Studio ging, wollte ich mein Gedächtnis aber auch da ein bisschen auffrischen. An einem Tag habe ich mir daher zwölf verschiedene Interpretationen angehört – nicht zwangsläufig den ganzen Zyklus, aber zumindest einige Variationen, um eine Vorstellung von den verschiedenen Herangehensweisen zu bekommen. Nachdem ich einige der berühmtesten Einspielungen gehört hatte, kam ich zu dem Schluss, dass die Aufnahme von Glenn Gould von 1955 für mich immer noch die beste ist, besser als seine spätere Version von 1981.
Viele Ihrer Kollegen vermeiden es, andere Aufnahmen zu hören, bevor sie selbst ins Studio gehen. Warum Sie nicht?
Sehen Sie, ich habe wirklich faszinierende Aufnahmen gehört. Doch kam es zu der paradoxen Situation, dass ich, so spannend ich die Interpretationen auch fand, nicht mit ihnen übereinstimmte und mir total klar war, dass ich es anders machen möchte. Mir war es aber wichtig, ein Gefühl für die Aufnahmegeschichte zu bekommen. Diese Auseinandersetzung mit der Interpretationsgeschichte hat mich schlussendlich in meinen interpretatorischen Entscheidungen bestärkt. Außerdem hat es mein Verständnis dafür gestärkt, dass nicht jeder meine Interpre
Wie könnte ich Harnoncourt widersprechen, ich würde es jedoch etwas einschränken. Ich stimme zu, was die Passionen und die großen Orchesterwerke angeht, auch die wichtigen Stücke für Tasteninstrumente. Aber unter den Klavierwerken gibt es auch weniger bedeutsame Stücke mit einer teilweise fast schon exzessiven Ornamentik. Das liegt natürlich auch an dem anderen Instrument, für das Bach schrieb: Auf dem Cembalo verklingen die Töne viel schneller als auf dem Klavier. Es gibt Momente in der Musik, die sich nicht eins zu eins auf das Klavier übertragen lassen, und in diesen Fällen haben wir Interpreten dann zwei Möglichkeiten: Entweder wir spielen diese Stücke nicht auf dem Klavier, oder wir suchen nach einer Möglichkeit, wie wir die Essenz der Musik auf das Klavier übertragen können, indem wir zum Beispiel weniger oder andere Triller spielen. Die Aufführungspraxis zu Bachs Zeit erlaubt uns da mehr Freiheit, als wir es heute gewohnt sind. Mein Instrument ist das Klavier, darauf fühle ich mich wohl, zum Beispiel weil es mir andere dynamische Abstufungen erlaubt. Wenn Bachs Cembalowerke auf dem Klavier nicht klingen, liegt das nicht am Instrument, sondern an mangelnder musikalischer Vorstellungskraft.
Wer sind Ihre persönlichen Favoriten unter den Bach-Interpreten, außer Edwin Fischer und Glenn Gould?
Vor allem Murray Perahia, sein BachVermächtnis ist schlicht fantastisch. Sein Spiel ist so persönlich, geprägt von einer großen Aufrichtigkeit und voller Licht. Man spürt darin förmlich die Warmherzigkeit des Interpreten. Außerdem bin ich ihm sehr dankbar, dass er die Tradition gestärkt hat, Bachs Klavierkonzerte auf dem Flügel zu spielen und sie nicht ausschließlich den Cembalisten zu überlassen.
Die »New York Times« hat Sie einmal als den »isländischen Glenn Gould« bezeichnet – ein Segen oder eher ein Fluch?
Mit den Medien ist es immer ein Spiel. Dieser Vergleich kam recht früh in meiner Karriere und hat eine Menge Menschen auf mich aufmerksam werden lassen, es war also durchaus ein Segen. Aber natürlich bin ich nicht wie Glenn Gould, niemand ist das, solche Vergleiche können also auch gefährlich werden. Allerdings bin froh, dass es Gould war, denn er ist eine der spannendsten Figuren. Vor allem für die Aufnahmegeschichte war er von immenser
50 Ví K ingu R Óla F sson
»Für mich ist Glenn Goulds Aufnahme von 1955 immer noch die beste, besser als seine spätere Version von 1981.«
Bedeutung, weil er geholfen hat, die Studioeinspielung als eigenständiges Kunstwerk neben der Konzertaufführung zu etablieren. Die »Goldberg«Aufnahme von 1955 ist ein Meilenstein und hat die Produktion klassischer Musik auf ein völlig neues Niveau gehoben. Ich habe einmal gelesen, dass er die »Aria« mehr als zwanzig Mal aufgenommen hat, weil es ihm darum ging, mit den Möglichkeiten der Studiotechnik so tief wie möglich in die Musik einzudringen und so etwas wie die ultimative Version des Stücks zu diesem Zeitpunkt zu konservieren.
Worum ging es Ihnen bei Ihrer eigenen Einspielung?
Es gibt zwei Möglichkeiten mit den »GoldbergVariationen«: Entweder betont man die Geschlossenheit des Zyklus und ordnet die einzelnen Variationen dieser Idee unter, indem man sie miteinander verbindet, etwa in den TempoRelationen. Oder man macht genau das Gegenteil und demonstriert Bachs Meisterschaft darin, aus der gleichen DNA dreißig derart unterschiedliche kleine Welten zu schaffen. Das macht die Schönheit des Stücks ja aus, wie man aus einer so einfachen »Aria« diese Fülle von unterschiedlichen Universen, diesen unglaublichen Reichtum erschaffen kann. Für die Studioproduktion habe ich endlos über die Struktur des Zyklus nachgedacht. Einige Variationen habe ich außerdem in unterschiedlichem Tempo aufgenommen. Das gibt uns in der Postproduktion die Möglichkeit, auszuprobieren, welche Varianten besser ins Gesamtkonzept passen. Dabei denke ich natürlich darüber nach, wie ich die dreißig Variationen zu einem Gesamtwerk vereinen kann, ohne dass sie am Ende alle gleich klingen.
Die kommende Saison haben Sie bewusst unter das Motto »Goldberg-Variationen« gestellt: Ein Jahr lang spielen Sie den Zyklus in zahllosen Konzerten um die ganze Welt …
… und Hamburg ist die einzige Stadt, in der ich ihn sogar zwei Mal spiele! Am Anfang der Spielzeit bin ich damit in der Laeiszhalle zu Gast, am Ende kehre ich nach Hamburg zurück, dann in die Elbphilharmonie. Es ist ein bisschen wie mit den »GoldbergVariationen« selbst: Am Anfang
steht die »Aria«, danach folgen die Variationen, bevor am Ende wieder die »Aria« kommt. Und so werden auch die Konzerte sein, die sich alle voneinander unterscheiden werden, weil sich meine Sicht auf das Stück und meine Art, es zu spielen, über dieses Jahr hinweg zwangsläufig verändern werden. Auch das war ein Grund für diese Entscheidung, dass ich wissen wollte, wie tief ich in eine Komposition eintauchen und wie viele verschiedene Facetten ich darin für mich entdecken kann.
Worin liegen die Herausforderungen für Sie als Interpret bei den »Goldberg-Variationen« – technisch und interpretatorisch?

Technisch gehören sie mit zum Anspruchsvollsten, was je für Klavier komponiert wurde. Bach experimentiert in jeder Variation damit, was auf dem Instrument zu seiner Zeit möglich ist. Der Zyklus ist so vielgestaltig und steckt voller Extreme. Zum Beispiel müssen sich die Hände häufig kreuzen, so dass wir in den verrücktesten Positionen spielen müssen. Allerdings sehe ich die »GoldbergVariationen« nicht als technisches Stück – für mich ist die größte Herausforderung, dem Zyklus in den eigenen musikalischen Überlegungen gerecht zu werden, sich mit Bachs kompositorischem Prozess auseinanderzusetzen und diesen in das eigene Spiel einfließen zu lassen. Es geht nicht darum, technische Hürden zu meistern, sondern darum, eine Idee auszudrücken.

Haben Sie eigentlich immer noch die Bach-Büste zu Hause? Was sagt sie Ihnen, wenn Sie Bachs Musik spielen?
Ich habe sogar mehrere Büsten von ihm. Vor allem erinnern sie mich stets daran, dass Bach keine Statue ist. Er ist nicht aus Marmor – und das gilt auch für seine Musik. Insofern ist die Büste fast eine Warnung, weil wir gerade in der klassischen Musik eine Tendenz haben, Komponisten und ihre Werke auf einen Sockel zu stellen, der unantastbar ist. Dabei muss es doch genau um das Gegenteil gehen: die Komponisten und ihre Musik heute zum Leben zu erwecken.
GOLDBERG-VARIATIONEN
Di, 10.10.2023 | 19:30 Uhr
Laeiszhalle Großer Saal VaRiation i
Víkingur Ólafsson (Klavier )
Mo, 4.12.2023 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal VaRiation ii
Jean Rondeau (Cembalo)
Do, 21.12.2023 | 19:30 Uhr








Elbphilharmonie Kleiner Saal VaRiation iii
yamen saadi (Violine)
sara Ferrández (Viola)
pablo Ferrández (Cello)
So, 14.4.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal VaRiation iV
asya Fateyeva (saxofon)
andreas Borregaard (akkordeon)
Eckart Runge (Cello)


Di, 25.6.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal VaRiation V
Víkingur Ólafsson (Klavier)
VíKinguR ÓlaFsson 51
LIEDER DER VERSTUMMTEN













52 KuRdistan
Frauen mit der Rahmentrommel Daff bei einem kurdischen Festival in Paris Ein jesidischer Tanbur-Spieler in Baadre bei Mossul, Irak
Ein Festival feiert die Vielfalt und Lebendigkeit der kurdischen Musik.
VON MARTIN GREVE
WIENER WALZEN
Anfang des 20. Jahrhunderts hatten einige Reisende so genannte Phonographen im Gepäck, mit denen sie unterwegs Stimmen und Gesänge auf Wachswalzen aufnehmen konnten. Der österreichische Archäologe und Anthropologe Felix von Luschan etwa nahm 1902 ein solches Gerät zu seinen Ausgrabungen in der Nähe des türkischen Gaziantep mit und hielt dort türkische und kurdische Lieder fest. Ähnlich der böhmische Theologiestudent Gustav Klameth, der sich am Silvestertag des Jahres 1912 in Jerusalem von einem assyrischen Priester aus Mardin (heute SüdTürkei) drei kurdische Lieder für den Phonographen vorsingen ließ.
Soweit wir wissen, sind diese beiden Tondokumente die ältesten Aufnahmen kurdischer Lieder überhaupt – Zufallsfunde, die nur durch viel Glück in den Phonogrammarchiven von Wien und Berlin erhalten blieben. Ein Jahrhundert später stießen die Musiker der Wiener Gruppe Danûk darauf und machten sich daran, neue Arrangements anzufertigen für diese alten Lieder aus der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei, aus der die Mitglieder der Gruppe während des Syrienkriegs selbst hatten fliehen müssen.
Überall suchen heute kurdische Musiker nach alten Aufnahmen, um verstummte Traditionen neu zu beleben. Die wichtigste Quelle dabei sind natürlich nicht PhonographenWalzen, sondern alte Musikkassetten. Denn seit in den 1960erJahren preisgünstige und transportable
Kassettenrekorder auf den Markt kamen, begannen überall regionale Sammler damit, mündlich überlieferte Geschichten und Lieder aufzuzeichnen, um sie so vor dem drohenden Verschwinden zu retten. Schon 1991 begann das Istanbuler Label Kalan Müzik mit seiner Archivserie, und auch das Teheraner MahoorInstitut veröffentlichte zahlreiche historische Aufnahmen iranischkurdischer Musik.
Die Brüder Metin und Kemal Kahraman, in der Türkei zunächst bekannt für ihre politischen Lieder, sammelten und interpretierten über Jahrzehnte hinweg Lieder alter Leute aus ihrer Heimatregion Dersim, einem politisch stark aufgeladenen kurdischen Gebiet im Osten Anatoliens. Sie lösten damit ein wahres DersimRevival aus, in dessen Folge immer weitere Sängerinnen und Musiker aufstiegen: Mavis¸ Günes¸er etwa, die zwar selbst nicht aus dieser Region stammt, aber jahrelang im Ensemble der Kahramans sang und nun historische Klagelieder über die Massaker und Kämpfe von Dersim 1937/1938 rekonstruiert hat; oder Aynur, die große kurdische Sängerin aus dem Süden von Dersim; und schließlich Ahmet Aslan, in der Türkei längst ein Superstar. Insbesondere seine Stimmtechnik ist einzigartig: Er beendet die meisten musikalischen Phrasen mit einer Art tiefem Seufzer, der allerdings weniger eine traditionelle Gesangstechnik von Dersim war als vielmehr eine Folge des hohen Alters der von privaten Sammlern aufgenommenen Sänger. In Ahmet Aslans Liedern wird es zum künstlerischen Stilmerkmal.
WAS IST KURDISTAN?
Der Name Kurdistan ist ein Traum, eine Hoffnung, eine Illusion, für andere auch ein Albtraum, eine Rechtfertigung für Krieg und Terror, die Sehnsucht nach einem weiteren Nationalstaat in einer Region, in der schon so viele andere mit ethnischen Säuberungen und Diskriminierung Unheil brachten.
Ku R distan 53 IRAK IRAN TÜRKEI Mittelmeer SYRIEN Kaspisches Meer Schwarzes Meer ASERBAIDSCHAN ARMENIEN Persischer Golf Gaziantep Erzurum Dersim Istanbul Mardin
Sirnak Kiğı Bagdad Halabdscha
Mossul Erbil Teheran Bodschnurd Uraman
›
Als Landschaftsname ist Kurdistan (das »Land der Kurden«) seit Jahrhunderten geläufig, einen kurdischen Nationalstaat aber hat es nie gegeben. Nur gleichnamige Provinzen bestanden sowohl im Osmanischen Reich wie im Iran, 1946 sogar – unter dem Schutz der UdSSR –eine kurzlebige Republik Kurdistan (auch Republik Mahabad) im Nordwesten Persiens. Einige einzelne kurdische Regionen konnten sich Eigenständigkeit erkämpfen, etwa die Autonome Region Kurdistan seit 1992, als die Vereinten Nationen im Nordirak eine Flugverbotszone ausriefen, oder Rojava im Norden Syriens, das 2013 im Zuge des syrischen Bürgerkriegs de facto autonom wurde, seit dem Ende des so genannten Islamischen Staates jedoch bedrängt wird von der syrischen Zentralregierung im Süden und der Türkei im Norden.
Besonders homogen aber wäre ein kurdischer Staat ohnehin nicht, politisch schon gar nicht, doch ebenso wenig sprachlich, religiös, kulturell oder musikalisch. Starke Unterschiede bestanden stets zwischen osmanischstädtischer und ländlicher Bevölkerung, zwischen tribalen und nichttribalen Kurden. Überdies leben nicht nur Kurden in der Region, sondern auch zahlreiche Türken bzw. Turkmenen, Araber und Assyrer bzw. Chaldäer. Bis zum Völkermord an den Armeniern von 1915 – an dem sich auch zahlreiche Kurden beteiligten – waren diese die größte Minderheit.
Kurdische Sprachen gehören zur indoeuropäischen Sprachfamilie und darin zur iranischen Sprachgruppe. Kurdisch ist also weder mit Arabisch verwandt noch mit Türkisch, wohl aber mit Persisch. Die wichtigsten kurdischen Dialekte sind im Norden Kurmandschi und im Süden Sorani. Wie komplex das Verhältnis zwischen sprachlichen und ethnischen Kategorien aber sein kann, zeigt der Fall des Zaza (oder Kirmandsch): Rein linguistisch gehört Zaza anscheinend nicht zu den kurdischen Sprachen, sondern ist eher verwandt mit dem nordwestiranischen Gûranî. Viele der rund zwei Millionen ZazaSprecher im östlichen Anatolien aber empfinden sich eben doch als Kurden – andere wiederum nicht.
DIE KURDISCHE DIASPORA
All die Aufstände, Massaker und Kriege, dazu die wirtschaftliche Armut vertrieben immer mehr Menschen aus den Bergen und Dörfern in die Städte der Region, dann in entfernte Großstädte wie Istanbul oder Mossul. Viele kurdische Dörfer sind heute vor allem im Winter verlassen, und nur noch im Sommer kommen die früheren Bewohner und ihre Nachkommen zu Besuch. Als europäische Länder wie Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Belgien, Schweden und die Niederlande ab 1961 Arbeitskräfte aus Anatolien anwarben, aber auch verstärkt politische Flüchtlinge aufnahmen, sahen viele Kurden die Chance für ein neues Leben gekommen. In Europa entstand ein dichtes Netzwerk kurdischer Organisationen, Vereine, Kulturzentren, Frauengruppen, Kindertagesstätten und Elternvereine. Regelmäßig finden große Konzerte und Festivals mit kurdischen Sängern und Sängerinnen statt, die auch Menschen anderer Herkunft anziehen. Tragisch bekannt wurde das Centre culturel kurde Ahmet-Kaya in Paris, benannt nach dem prominenten türkischkurdischen Sänger Ahmet Kaya, der 2000 in seinem Pariser Exil gestorben war: In diesem Kulturzentrum der kurdischen Gemeinde erschoss im vergangenen Dezember ein rechtsradikaler Attentäter drei Menschen, darunter den kurdischen Sänger Mîr Perwer.
MUSIKALISCHE VERWANDT SCHAFTEN
Eine große Mehrheit von Kurden sind sunnitische Muslime, und alle bekannten religiösen Gesangsformen des Islam wie Gebetsruf, Koranlesung und verschiedene Hymnen sind auch unter Kurden verbreitet, ebenso die Traditionen einiger SufiOrden, insbesondere der Qadirıya und Naqschbandıya.
Im Kult der Ahle Haqq im südlichen Iran wird eine kleine Langhalslaute namens tanbur zur Begleitung sakraler Lieder (kalam) gespielt. In den religiösen Versammlungen singen die Gläubigen so genannte nazm, metrisch frei in Ruf und Antwort zwischen Sänger und Gemeinde oder auch im Chor, teilweise begleitet durch Händeklatschen. Sowohl die Spieltechnik der tanbur als auch die Gesangstechnik ähneln persischer Kunstmusik. Bei Jesiden im Nordirak, der Türkei und in Armenien ist die Kaste der qawal für die Rezitation bzw. den Gesang religiöser Hymnen (qawl) zuständig. Vor allem das Instrumentenpaar šabbaba (Längsflöte) und daff (Rahmentrommel mit Zimbeln) gilt als heilig und darf lediglich von einem qawal gespielt werden.
Eine Minderheit von Kurmandschi und ZazaSprechern in der Türkei gehört dem Alevitentum an. In ihren religiösen Versammlungen spielte historisch die Langhalslaute tomir eine große Rolle, heute praktisch nur noch die moderne türkisch e bag˘lama. Eine spezielle Rolle nimmt hier die Region Dersim weit im Nordwesten des klassischen Kurdistan ein, mit ihrer Mehrheit von Zazasprachigen Aleviten. Dieses Dersimer Alevitentum ist heute mit dem anatolischen Alevitentum weitgehend verschmolzen, trug jedoch bis ins späte 20. Jahrhundert
Insgesamt geht man heute von rund 35 Millionen Kurden aus, etwa die Hälfte davon in der Türkei, jeweils gut sechs Millionen im Irak und im Iran und über zwei Millionen in Syrien und im Libanon. Aber stimmen diese Zahlen überhaupt noch? Leben nicht längst viel mehr Kurden außerhalb von »Kurdistan«? Die kurdische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist gezeichnet von Gewalt, angefangen von verschiedenen blutig niedergeschlagenen Aufständen in der Türkei über den 40jährigen bewaffneten Konflikt zwischen der türkischen Armee und der PKK mit seinen 40.000 Toten bis hin zu dem Giftgasangriff der irakischen Regierung auf die kurdischirakische Stadt Halabdscha 1988 mit alleine 3.000 bis 5.000 Toten. Zuletzt massakrierte der so genannte Islamische Staat in den Jahren 2014 bis 2017 vor allem kurdische Jesiden, vergewaltigte und verschleppte ihre Frauen. ›
54 Ku R distan
Besonders homogen wäre ein kurdischer Staat nicht, politisch schon gar nicht, doch ebenso wenig sprachlich, religiös, kulturell, musikalisch.








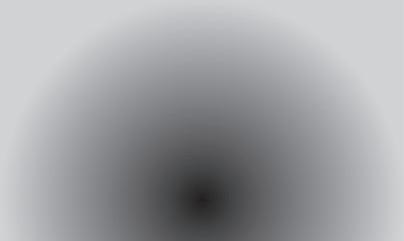

 Eine Zeremonie beim kurdischen Pir-Shalyar-Fest in Uraman, Iran Eine kurdische Hochzeit in Bodschnurd, Iran
Eine Zeremonie beim kurdischen Pir-Shalyar-Fest in Uraman, Iran Eine kurdische Hochzeit in Bodschnurd, Iran
hinein starke eigene Züge. Geistliche Führer (dedes) sangen in ihren Zeremonien ein reiches Repertoire, das die Dersimer Gläubigen regelmäßig zu Tränen rührte und in Trance versetzte.
Die wichtigste literarische und musikalische Tradition in Dersim jedoch sind Totenklagen, die alleine oder begleitet von einzelnen Instrumenten wie der kleinen Laute tomir oder der europäischen Geige gesungen werden. Die meisten erhaltenen Lieder erzählen von den Massakern der türkischen Armee an den Dersimern in den Jahren 1937 und 1938. Mittlerweile wechselten die meisten Musiker jedoch von der kleinen tomir zur größeren bag˘lama, als deren bester Vertreter heute Erdal Erzincan gilt.

RADIO ERIWAN

Ausgerechnet das sowjetischarmenische Radio Eriwan sendete ab den 1930erJahren erstmals regelmäßig auf Kurdisch, und die Programme wurden weit über Armenien hinaus via Kurzwelle gehört – in der Türkei und in Syrien, im Irak, Iran und in mehreren Sowjetrepubliken. Jahrzehntelang lernten Kurden so über Ländergrenzen hinweg erstmals DichterSänger (dengbêj) aus verschiedenen kurdischen Regionen kennen, darunter große Namen wie S¸akiro, Reso und Karapetê Xaco. Später, während der 1950er und 1960erJahre, sendete man auch in Teheran und Bagdad auf Kurdisch, und neue kurdische Sänger und Sängerinnen stiegen auf, etwa Mihemed Arif Cizrawî und sein Bruder Hesen Cizrawî, Mêryem Xan, Aram Tigran und Ays¸e Xan.
In der Türkei hingegen blieb Kurdisch lange Zeit umstritten; erst 2004 ging auch dort mit TRT Kurdî ein staatliches kurdisches Fernsehprogramm auf Sendung. Für Musiker in der Türkei blieb es riskant, sich selbst als »kurdische Musiker« zu bezeichnen. Zwar wurden schon
Erst der sowjetische Rundfunk

machte ab den 1930ern

kurdische Musiker länderübergreifend bekannt.
früh auch in der Türkei einige kurdische Sänger wie Diyarbakırlı Celâl Gülses oder später Ibrahim Tatlıses landesweit beliebt, allerdings nur mit türkischsprachigen Liedern.

Erst Ende der 1970erJahre begann auch der Aufstieg erster kurdischer Sänger aus der Türkei, darunter S¸ivan Perwer und später Nizamettin Arıç. Nach 1991, als das Verbot der kurdischen Sprache in der Türkei aufgehoben wurde, entwickelte sich Istanbul schließlich zu einem Zentrum kurdischer Musikproduktion. Kurdische Musik verlor allmählich ihre politischen Implikationen, und kurdisch singende Musiker wie Aynur oder die Gruppe Kardes¸ Türküler wurden in der ganzen Türkei und darüber hinaus populär. Immer neue Instrumente erschienen in solchen Gruppen, darunter die elektrische bag˘lama, internationale Perkussionsinstrumente, Keyboards, Schlagzeug, Bass oder Gitarre.
NEUE VERBINDUNGEN
Bis auf einige Ausnahmen leben die meisten der Musiker des KurdistanFestivals in der Elbphilharmonie nicht unmittelbar in der Region. Einige sind in Wien daheim (Kurdophone, Danûk), Aynur hat sich in Amsterdam niedergelassen, Astare Arter in Köln und Ahmet Aslan in Istanbul, während Kayhan Kalhor nach Jahren in den USA mittlerweile in den Iran zurückgekehrt ist.
In Europa versuchen eine Reihe dieser kurdischen Musiker, Jazz, Flamenco, Rock, westliche Klassik oder zeitgenössische Neue Musik in ihre Musik zu integrieren. In der Gruppe Kurdophone etwa sind iranischkurdische und österreichische Musiker versammelt. Taner Akyol aus Dersim schrieb ein Stück für Kammerorchester (»Tertele«), das 2018 in der Elbphilharmonie uraufgeführt wurde. Ahmet Aslan, ebenfalls aus Dersim, lernte im
Ein kurdischer Tabak- und Flötenverkäufer in Erbil, Irak
Zuge seines Studiums an der Rotterdamer Weltmusikakademie Codarts unter anderem FlamencoGitarre. Die Arrangements für Aynurs Album »Hevra / Together« aus dem Jahr 2014 stammten von dem spanischen Musiker Javier Linón; inzwischen arbeitet die Sängerin auch mit westlichklassischen Musikern oder zuletzt in Hamburg mit der NDR Bigband zusammen.
Andere aber bemühen sich um alte Musikaufnahmen und die Wiederbelebung verstummter Lieder. Ali Dog˘an Gönültas¸ beispielsweise, der aus der entlegenen Kleinststadt Kig˘ı stammt, einst ein armenischer Bischofssitz, später vergessen und schließlich im Zentrum der Kämpfe zwischen PKK und türkischer Armee zur NoGoArea geworden. Gönültas¸ war wohl der Erste, der selbst dort nach vergessenen Liedern suchte und sie dann neu interpretierte.
Aber auch neue Kombination alter Traditionen werden in Europa versucht, etwa in der musikalischen Begegnung von Gönültas¸ mit dem DichterSänger Saîdê Goyî aus der 450 Kilometer weit entfernten Provinz Sirnak im irakischtürkischen Grenzgebiet. Oder, beim Festival, in dem musikalischen Treffen des armenischen DudukSpielers Vardan Hovanissian mit dem Dersimer Sänger und SazVirtuosen Emre Gültekin. Und schließlich in den großen Gipfeltreffen dieses Festivals: Wenn der bag˘lamaVirtuose Erdal Erzinan aus dem ostanatolischen Erzurum auf den kurdischiranischen KamantscheSpieler
Kayhan Kalhor trifft – der sich anderntags mit der Sängerin Aynur und dem Hamburger Ensemble Resonanz zusammentut: Seine Komposition »Silent City« ist der Stadt Halabdscha gewidmet, die der irakische Diktator Saddam Hussein 1988 fast vernichten ließ.
M MEHR ZUM KURDISTAN-FESTIVAL FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
KURDISTAN
Elbphilharmonie Großer und Kleiner Saal
Fr, 17.11.2023
KURDOPHONE
iranisch-kurdische MughamMusik trifft auf Jazz-grooves
Fr, 17.11.2023
AYNUR & KAYHAN KALHOR
Ensemble Resonanz Verborgene Melodien aus den kurdischen Bergen
Sa, 18.11.2023
DANÛK
»Morîk« – eine hommage an vergessene kurdische lieder
Sa, 18.11.2023
KAYHAN KALHOR & ERDAL ERZINCAN die Kunst der improvisation
So, 19.11.2023
MYTHOS DERSIM ahmet aslan
Metin & Kemal Kahraman ali dog˘an gönültas¸ trio Mavis¸ günes¸er trio
Emre gültekin & Vardan hovanissian u.a. zwischen Freudenfesten, Klageliedern und Widerstand –ein gipfeltreffen der Kulturen anatoliens
D i e n e u e n T h a l i a Ca rd s
Ihre ThaliaCard – die BahnCard 50 fürs Theater Mit unseren ThaliaCards kann jede und jeder unser volles Programm ein Jahr lang genießen und da bei 50% sparen. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Jetzt neu in vier Varianten:
ThaliaCard Single 1 Person (€ 60)
ThaliaCard Double 2 Personen (€ 111)
ThaliaCard U30 1 Person bis 30 Jahre (€ 30)
ThaliaFerienCard 2 Personen (€ 30)
Jetzt einsteigen!
thalia-theater.de/thaliacard
Volles Programm zum halben Preis!
Ku R distan 57
JULIA BULLOCK
JazzGrößen wie Billie Holiday und Nina Simone gehören ebenso zu Julia Bullocks Vorbildern wie die Opernsängerinnen Régine Crespin und Edita Gruberová. Ungewöhnlich vielfältig ist auch das Repertoire der Sopranistin: Sie singt Händel und Mozart, Jazz und Blues, dazu viel Zeitgenössisches, und sie sucht immer wieder das Zusammenspiel der Künste – zuletzt in einer szenischen Produktion von Olivier Messiaens Liedzyklus

»Ich wünschte, jeder würde Gitarre spielen. Dann gäbe es wohl weniger Probleme auf der Welt«, vermutet Bill Frisell. Der 1951 in Baltimore geborene Gitarrist steht seit über 40 Jahren für ein sehr modernes, offenes JazzVerständnis mit Einflüssen aus Folk, Rock, Fusion und Klassik. Der inspirierende Austausch mit stilistisch unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern zeigte ihm, worum es in der Musik wirklich geht: Menschen zusammenzubringen. »Die Musik ist ein perfektes Modell für unseren Umgang miteinander. Wenn ich mit meiner Gruppe spiele, hören wir uns gegenseitig zu, interagieren miteinander und schenken uns viel Vertrauen. Das ermöglicht uns, Risiken einzugehen und voneinander zu lernen. Wo es Harmonie gibt, gibt es natürlich auch Dissonanz. So kommt es manchmal zu Konflikten, aber wir lösen sie – in der Musik.« Seine wahren Überzeugungen kann Frisell vor allem durch Musik vermitteln. »Und so wird die Musik zu meiner Stimme.«

»Harawi« der American Modern Opera Company, deren Gründungsmitglied sie ist. »Das ist doch das Schöne am Gesang, dass die menschliche Stimme in der Lage ist, sich auf so viele verschiedene Arten auszudrücken«, erklärt die 36jährige US Amerikanerin. Dabei sieht sie sich auch gesellschaftlich in der Verantwortung. »Ob ich nun singe oder programmiere, jedes Projekt, dem ich meine Stimme leihe, hat etwas damit zu tun, uns daran zu erinnern, uns gegenseitig als vollständige, komplexe menschliche Wesen zu respektieren – menschliche Wesen, die wir nicht abtun oder missachten können und sollten.«

ÜBER –ZEUGUNGEN
LUCILE RICHARDOT
Bis zu ihrem 27. Lebensjahr arbeitete die französische Mezzosopranistin Lucile Richardot als Journalistin. Erst danach widmete sie sich ganz der Musik. Schon in ihrer ersten Karriere hielt sie sich mit allzu rigiden Meinungen zu den großen, komplexen Themen unserer Zeit zurück. Sie zieht es vielmehr vor, sich »auf die kleineren ›Kämpfe‹ zu konzentrieren, für die zu plädieren ich mich berechtigt fühle: nämlich die Schubladen aufzubrechen, die Sänger eingrenzen und trennen –zwischen Choristen und Solisten, zwischen BelcantoSängern und den vielen anderen, die sich dem herausragenden Repertoire zehn weiterer Jahrhunderte widmen, zwischen ›Medienbestien‹ und diskreten Künstlern, die sich an ein untypisches Publikum richten.« Und auch im persönlichen Leben versucht Richardot ihre Stimme zu nutzen: »Im physischen Sinne, als eine Art Trost, Balsam und Vermittler von Glück … so wie ich mich bemühe, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu laut anzuschreien.«
58 uM g E hö R t
Eine Frage, sieben Antworten: »Wofür setzen Sie Ihre Stimme ein?«
VON IVANA RAJIC
BILL FRISELL
KAITLYN AURELIA SMITH


Ihre ersten Schritte ins Rampenlicht wagte die US amerikanische Komponistin, Sängerin und Produzentin als IndieFolkMusikerin mit klassischer Gitarre und Klavier. Erst als ein Nachbar ihr seinen ProfiSynthesizer auslieh (einen Buchla Easel), fand sie zu ihrer ganz eigenen, elektronisch traumwandelnden Klangsprache. Deshalb möchte sie auch andere dazu ermutigen, »verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten zu erforschen und sich zu verteidigen, wenn man verurteilt oder verspottet wird«. Doch nicht nur um solches Empowerment geht es Smith, sondern auch um Inklusion: »Ich wollte schon immer mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das tragbare Tonsender herstellt, die Klang in Vibration übersetzen – für Hörgeschädigte.«
SARAH WILLIS
2001 schaffte sie es als erste Frau in die Blechbläsergruppe der Berliner Philharmoniker. Sarah Willis ist eine Pionierin, die gern mal etwas wagt. Mit dem Havana Lyceum Orchestra etwa erkundete sie, wie Mozart in der Karibik klingen könnte: Ihr gemeinsames Erfolgsprojekt »Mozart y Mambo« kombiniert Werke des Komponisten mit traditioneller kubanischer Musik – eine prägende Erfahrung für die amerikanischbritische Hornistin. »Auf Kuba geht man nicht tanzen, man ist selbst die Musik«, hat sie gelernt. Die Spielfreude und Improvisationskunst der Musiker haben sie tief beeindruckt. Ihre Zusammenarbeit setzen sie mit »einer Art Buena Vista Social ClubProjekt« fort, für das sie das erste kubanische Hornkonzert komponieren ließen: »Jedes Stück basiert auf traditionellen Tänzen, die aus sechs verschiedenen Regionen Kubas kommen«, erklärt Willis. »Wir bringen die Stücke in die Welt, und der Erlös fließt zurück in dringend benötigte Instrumente für die kubanische Musikszene.«
YAMEN SAADI

»Als ich in Nazareth aufwuchs, war klassische Musik nicht oft zu hören«, erinnert sich Yamen Saadi. Doch mit 10 Jahren konnte der 1997 geborene Geiger ein Konzert von Daniel Barenboim in Jerusalem besuchen. Danach fragte er den legendären Pianisten und Dirigenten, ob er in dessen WestEastern Divan Orchestra mitspielen dürfe – ein Orchester, das junge Musiker aus Israel, Palästina und anderen arabischen Ländern zusammenbringt und ein Forum des Dialogs sein möchte. Ein Jahr später ging sein Traum in Erfüllung. Heute ist Yamen Saadi Konzertmeister im Orchester der Wiener Staatsoper. »Ein Risiko eingehen und einer Leidenschaft nachgehen, an die man glaubt, auch wenn es beängstigend ist« – dazu will der zielstrebige Geiger seine Mitmenschen immer wieder ermutigen. Und er möchte insbesondere die jüngere Generation aus arabischen Städten inspirieren, »europäische klassische Musik zu hören, die in unserer Kultur nicht vorkommt«.
JULIE CAMPICHE
Die Harfe gilt heute manchen als ein aus der Zeit gefallenes Saiteninstrument. Weniger in die Vergangenheit und viel mehr in die Zukunft ist jedoch der Blick der experimentellen JazzHarfenistin Julie Campiche gerichtet: Sie erfindet den Klang ihres Instruments fortlaufend neu. Mit elektronischen Effekten hat sie ihre Klangpalette komplettiert und so eine sehr persönliche Stimme entwickelt – mit der sie auch ihre Ansichten über politische und gesellschaftliche Ereignisse kommuniziert: »Ich kann nur Themen in meiner Musik verarbeiten, die mich emotional berühren. Und vieles davon hängt mit der Gesellschaft zusammen«, bekennt die 39jährige Schweizerin. »Alles, was mit der Gemeinschaft und der Art und Weise, wie wir unser Leben leben, zu tun hat, prägt meine Vision von der Welt. Für mich als Musikerin ist es deshalb wichtig, dass sich meine Kunst in die Textur unseres gemeinsamen Lebens auf dieser Erde einwebt.«

uM g E hö R t 59
WELT WAYNES

Der Saxofonist Wayne Shorter hat mit seiner wunderbar eigentümlichen Musik die Erde um einen ganzen Planeten reicher gemacht.





60 WaynE shoRtER
VON TOM R. SCHULZ
Ein gutes Gespräch lebt von der Abschweifung, so wie die gute Reise von kleinen, spontanen Umwegen. Was aber, wenn die Abschweifung selbst zum Formprinzip wird, der Umweg zum einzig gangbaren? Wer als Journalist je das inspirierende Irritationsvergnügen hatte, ein Interview mit dem Anfang dieses Jahres im Alter von 89 Jahren verstorbenen Saxofonisten Wayne Shorter zu führen, der wird dessen faszinierendes Umgehen jedes linearen Gesprächsverlaufs womöglich besser in Erinnerung behalten haben als das, was Shorter im Einzelnen tatsächlich gesagt hat. Dem direkten FrageAntwortSpiel des Künstlerinterviews, für die Vielgefragten dieser Welt ja oft genug tatsächlich öde Routine, verweigerte er sich ebenso liebenswürdig wie eigensinnig. Inzwischen kann man in Videos im Netz verfolgen, wie ehrfürchtige Fragesteller ihre Spickzettel sinken lassen und sich wortlos mitnehmen lassen in Waynes Welt, in der die kürzeste Verbindung zwischen zwei Gedankenpunkten verlässlich über ein Knäuel von Assoziationen und Nebengedanken läuft, denen nachzugehen seinem Dasein im Hier und Jetzt immer viel mehr zu entsprechen schien, als dem Interviewer eine einfache, klare, womöglich schon oft zuvor formulierte Antwort zu geben.
Waynes Welt – dass diese eine ganz eigene war, hatte schon Miles Davis zu schätzen gewusst, in dessen Quintett Wayne Shorter als Nachfolger John Coltranes am Tenor saxofon in den Sechzigerjahren zu Weltruhm gelangte. Die rätselhafte Schönheit von Shorters Gedankenflügen beim Reden, dies bedächtig Sprunghafte, war nichts anderes als das sprachliche Äquivalent der wunderbar eigentümlichen Verlaufskurven seiner Melodien, die er mit ebenso reichhaltigen wie geheimnisvollen Akkordfortschreitungen und allerlei rhythmischen Finessen unterlegte. Nach eher konventionellen HardbopAnfängen fand der 1933 in Newark, New Jersey, geborene Musiker schon bald zu einer Klangrede, die, wenn überhaupt einem Prinzip, dann dem lyrischer Unvorhersehbarkeit folgt.
SECONDHAND ZAUBERSTAB
Dabei begann Shorter, aus bescheidenen Verhältnissen stammend und aufgewachsen während der Großen Depression, sich erst mit 15 Jahren ernsthaft für Musik zu interessieren. Um dem augenscheinlich begabten Jungen eine Klarinette zu kaufen, legten die Großmutter und die Mutter ihr Erspartes zusammen. Für 90 Dollar erwarben sie ein gebrauchtes Instrument, das der Musikalienhändler aus den Einzelteilen mehrerer alter Klarinetten zusammengesetzt hatte. Für Wayne besaß diese Klarinette dennoch die Eigenschaften eines Zauberstabs, mit dessen Hilfe er die Welt da draußen verwandeln konnte – in Waynes Welt.
Mit 15 hatte er vom dritten Rang des örtlichen Theaters aus den Tenorsaxofonisten Lester Young erstmals im Konzert gehört – ein Erweckungserlebnis, das sich ihm derart ins Gedächtnis eingeprägte, dass er noch Jahrzehnte später sagen konnte, was Lester Young bei dem Auftritt angehabt hatte. Drei Jahre darauf spielte Shorter nicht nur selbst Tenor, sondern schrieb erstmals für eine Orchesterbesetzung. Bald wagte er sich auch an eine Oper, zu der er das Libretto selbst verfasst hatte. Über die Ouvertüre und den ersten Akt kam er indes nicht hinaus. Als er Jahre später entdecken musste, dass das gewählte Sujet dem der »West Side Story«, die 1957 herauskam, frappant ähnelte, gab er seinen Plan auf. Insofern schloss sich für Shorter ein sehr weit gezogener Kreis, als er in den letzten Lebensjahren seine schöpferische Energie erneut auf ein Opernprojekt lenkte. »… (Iphigenia)« lautet der Titel des Werks, für das die stupend versierte Bassistin und Sängerin Esperanza Spalding das Libretto schrieb. Sie war auch eine der Performerinnen bei den ersten Aufführungen der ehrgeizigen Produktion in den USA Ende 2021. Von der »Washington Post« als »nicht nur typografisch abenteuerliche neue Oper« beschrieben, feierte »… (Iphigenia)« im Dekor des Architekten Frank Gehry immerhin einen Achtungserfolg. Shorter selbst trat als Instrumentalist nicht in Erscheinung, wohl aber die drei übrigen Mitglieder seines seit zwanzig Jahren bestehenden, weltweit gefeierten Quartetts: der Pianist Danilo Perez, der Bassist John Patitucci und der Schlagzeuger Brian Blade. Und natürlich ein amtliches Opernorchester.
ALS WÜSSTEST DU NICHT WIE …

Unter all den Musikern, die im Orbit von Miles Davis in den Sechzigern und Siebzigern ihre Persönlichkeit fanden und selbst zu Stars wurden, war Wayne Shorter bis ins hohe Alter der wandelbarste und produktivste. Dabei blieben die Erfahrungen mit Miles für ihn Referenzpunkt bis zuletzt. Manche Anweisung, die der magische Trompeter ihm mit seiner rauheiseren Stimme auf der Bühne so zugeraunt hatte, besitzt ja auch durchaus die Qualität eines ZenKoans: »Spiel keine Musik, die wie Musik klingt.« Oder: »Spiel dein Horn so, als wüsstest du nicht, wie das geht.«

Zum singulären Rang der gut vier Jahre lang bestehenden Besetzung des Miles Davis Quintets mit Wayne Shorter, Herbie Hancock (Klavier), Ron Carter (Bass) und Tony Williams (Schlagzeug) hatte Shorter wesentlich beigetragen. Als Komponist lieferte er so bemerkenswerte Stücke wie »E.S.P.«, »Nefertiti«, »Iris« oder »Prince of Darkness«, die sich formal und vom musikalischen Gehalt her deutlich vom Hardbop abhoben, der zuvor das Repertoire ›

WaynE shoRtER 61
der Band bestimmt hatte. Auch als Solist neben Miles gewann er deutlich an Statur. LiveAufnahmen vom Dezember 1965 aus dem Jazzclub Plugged Nickel in Chicago legen Zeugnis davon ab, in welchem Maß Wayne Shorter mit seinem Improvisationsfluss, der kontinuierlich frisches Wasser führt, zur Inspirationsquelle der ganzen Band werden konnte. Er habe sich mit seinem Instrument oft wie ein Cello gefühlt, wie eine Viola, sagte Shorter einmal. Zur selben Zeit erschienen auf dem Label Blue Note zudem in rascher Folge SoloAlben, denen die Notenliteratur einige der schönsten und anspruchsvollsten Blätter im großen Buch der JazzStandards verdankt: »Speak No Evil«, »Infant Eyes«, »Footprints«, »Adam’s Apple« oder »Juju«. Die Schöpfung, Tod und Teufel sowie die ewige Frage nach dem Woher und dem Wohin prägen das weniger beachtete Album »The All Seeing Eye« (1966), ein Werk voller visionärer Kraft und Fantasie. Es klingt heute genauso aktuell und relevant wie vor bald sechzig Jahren.
IMMER HÖHERE HÖHEN


Als Miles Davis 1968 mit erweiterten Besetzungen und elektrischen Instrumenten zu experimentieren begann, ermunterte er Wayne Shorter, zusätzlich zum Tenor auch Sopransaxofon zu spielen. Von da an wurde das höher klingende Horn mit dem geraden Rohr in seinem Instrumentarium ebenso wichtig wie das Tenor; welches von beiden er im Konzert benutzte, folgte dabei mancher unergründlichen Laune. Da legte er nach einem Solo das Tenor in den Ständer, griff sich das Sopran, blies fünf Töne darauf, schüttelte den Kopf und nahm wieder das Tenor, um darauf weiterzuspielen – oder auch umgekehrt. Zufriedenheit, Selbstgewissheit, gar Eitelkeit auf der Bühne blieben diesem Großmeister der Improvisation zeitlebens fremd. In Waynes stark vom Buddhismus geprägter Welt war für ekstatische Selbstbegeisterung kein Platz; bis zu seinen letzten Auftritten wirkte er auf der Bühne introvertiert, scheu, manchmal beinah unbeholfen. Musikalisch aber zählte für ihn ebenfalls bis zuletzt nichts mehr als das Wagnis des Augenblicks. Im verschworenen Kollektiv mit seinem Quartett folgte er einem innerlich empfundenen Auftrag: »Bevor wir auf die Bühne gehen, fragen wir uns manchmal gegenseitig: Sind wir bereit, unsere Mission fortzusetzen?« Kernpunkte der Mission: Freiheit, Zuhören, den anderen Raum lassen, in neue Welten vordringen. Und dann setzten die vier zu mächtigen musikalischen Expeditionen ins Unbekannte an, bei denen Shorter auf dem Sopran in immer höhere Höhen vorzustoßen schien. In solchen Momenten verwandelte der passionierte Liebhaber von Fantasy, von Geschichte, von Comics, von Zeichentrick und anderen Filmen den Zauberstab von einst, die Klarinette seiner Jugendzeit, nochmal in ein neues, mythenschweres und scheinbar unbesiegbar machendes Werkzeug: in Excalibur, das Schwert von König Artus. Derlei gewaltfreie Allmachtsfantasien teilte Shorter im Laufe manches als Gespräch getarnten öffentlichen Monologs bereitwillig mit seinen andächtig lauschenden Zuhörern.
IN DIE HEXENKÜCHE UND RETOUR
Die größten kommerziellen Erfolge genoss Wayne Shorter natürlich mit Weather Report, der von ihm und dem Pianisten Joe Zawinul überaus glänzend geführten Hexenküche des Fusion Jazz der Siebziger. Zwei weitere MilesDavisAlumni lagen damals ebenfalls weit vorn in der Publikumsgunst: Chick Corea mit Return To Forever und John McLaughlin mit dem Mahavishnu Orchestra. Weather Report aber hatte zwei gleichermaßen kreative wie antagonistische Köpfe, einen genialen Boxer und einen nicht minder genialen Mönch. Nachzuhören, wie sich diese so ungleichen Glimmer Twins Zawinul und Shorter und ihre oft kongenialen Partner an Bass (Jaco Pastorius!), Schlagzeug und Percussion mit dem Spirit schrankenloser Improvisation über komplizierteste Harmonien, Rhythmen und Melodien hermachten, ist auch heute noch ein Fest.
Shorter aber, der sich kurz vor seinem Tod von einem Besucher in Los Angeles in einem Raum filmen ließ, in dem auf einem Sideboard neben allerlei FantasyFiguren dicht an dicht die begehrten kleinen GrammyGrammophone und sonstige Skulptur gewordene NobelAwards stehen, fand im späten Lebensrückblick Weather Report und auch die eigene vorübergehende Hinwendung zu elektronischem Instrumentarium eher nur noch »gut und schön«. Mit seinem so beständigen letzten Quartett fand Shorter sich viele Lebensumdrehungen später und auf entsprechend höherer Ebene auf jenem Weg wieder, den er nach dem Ende des Miles Davis Quintets 1968 verlassen hatte: elektrisierende Kammermusik ohne Strom, Kunst des Augenblicks, frei von jedem technischen Bombast, nackt, riskant, explosiv.

Wayne Shorter hat ein musikalisches Lebenswerk hinterlassen, in dem man nach Ausschuss wirklich lange suchen muss. Seine Klangreden und auch sein oft verrätselt scheinendes gesprochenes Wort haben die Erde um einen ganzen Planeten reicher gemacht. Waynes Welt gibt dem Dasein einen guten und sehr schönen Grund. Auch deshalb, weil für ihn die Musik nie wichtiger war als das, was alle gewöhnlichen Sterblichen tun: Ganz normal leben.



TRIBUTE WAYNE SHORTER

Di, 14.11.2023 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Ravi Coltrane, Esperanza spalding, danilo pérez, John patitucci, terri lyne Carrington symphoniker hamburg, Clark Rundell »the symphonic Music of Wayne shorter«
62 WaynE shoRtER





















Eitelkeit auf der Bühne blieb diesem Großmeister der Improvisation zeitlebens fremd.
Mit dem Miles Davis Quintet in London (1967)
Auf England-Tournee mit Weather Report (1976)
Mit Sopran- und Tenorsaxofon beim Jazz Port in Hamburg (1991)
EIN MANN, EIN KOSMOS
VON STEFAN FRANZEN
Dieser Musiker ist ein Universum! Das wird einem jedes Mal wieder klar, wenn man ins Werk des brasilianischen Ausnahmekünstlers Caetano Veloso eintaucht. Seit fünfeinhalb Jahrzehnten aktiv, schwebt der 1942 geborene Sänger, Komponist und Liedermacher als sehr aktiver Doyen nicht über der modernen Musik Brasiliens, sondern wirkt nach wie vor befruchtend mitten in ihr. Er hat den Tropicalismo mitbegründet und die moderne Música Popular Brasileira, er hat Folkloreschattierungen aller Gegenden des Riesenlandes, aber auch italienische und spanische Töne, WaveAnklänge, die Trommeln seiner Heimatregion Bahia, im neuen Jahrtausend mit seinem Sohn Moreno sogar Noise Rock in sein Schaffen integriert. Auf über 50 Schallplatten ist sein Werk dokumentiert, und jede von ihnen erzählt eine eigene Geschichte, wie ein Film mit Kulissen

der jeweiligen Zeit. Und all das mit einer Stimme, die schwere und geschlechtslos, traumtänzerisch sicher, so zärtlich wie politischresolut war und ist. Diese Stimme singt von Liebe in allen Schattierungen ebenso wie vom Wechselbad gesellschaftlich dunkler Jahre.
Die Songwriterin Maria Gadú, fast zwei Generationen nach Caetano geboren, sagte einmal: »Caetano Veloso ist das Umfassendste, das in Brasilien existiert! Er ist komplexer als alle sozialen Fragestellungen im Land. Es gibt so viele Schattierungen und Phasen in seinem Werk, man kann endlos darin abtauchen. Caetano ist ein Autor von geradezu absurder Eigenheit, und die erfüllt alle seine Songs.« Wo also anfangen? Hier eine Annäherung an diesen Giganten und seine einzigartige Stimme in sieben Songs.
In Caetano Velosos Musik spiegelt sich die Geschichte Brasiliens. Und in seiner Stimme Menschlichkeit, ja Menschsein überhaupt.
›

›
»TROPICÁLIA« (1968)
Er ist so etwas wie ein frühes Manifest seines Schaffens, dieser Song, der in Brasilien zusammen mit anderen Liedern der Zeit ein Erdbeben auslöste. Caetano Veloso, der Mitte der 1960er aus dem afrobrasilianisch geprägten Bahia nach Rio de Janeiro gekommen ist, begeistert sich zunächst für die Bossa Nova von João Gilberto. Doch die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm: Ein Militärregime hat Brasilien von rechts übernommen, verfolgt und foltert, beschneidet und zensiert. Veloso begründet mit seinen bahianischen Freunden Gilberto Gil, Gal Costa und Tom Zé sowie seiner Schwester Maria Bethânia eine Gegenbewegung: Sie nennt sich »Tropicalismo« und feiert so unerschrocken wie anarchisch die Vielfalt Brasiliens durch eine Collage aller Musikstile des Landes mit dem internationalen Pop der – vom Regime so bezeichneten – »Imperialisten«, sowie mit bilderreichen kritischen Texten. Der spannungsgeladene Eröffnungssong vom SoloDebüt des 25Jährigen muss damals wie ein Schock gewirkt haben: Er verquickt züngelnde Streicher, bedrohliche Blechfanfaren, Rhythmen des Nordostens und des Samba, erzählenden Sprechgesang und einen ansteckenden OhrwurmRefrain. Brasilien beschreibt Veloso als organisches und widersprüchliches Patchwork aus Bossa, Karneval, Urwald, Modernismus, Reichtum, Armut und Machtmissbrauch. »Ein verrücktes SongMonument, das ich für unsere Sorgen, unsere Vergnügungen und unsere Absurdität errichtet habe«, nennt er »Tropicalia« rückblickend in seiner Autobiografie »Verdade Tropical«.

»TERRA« (1978)
Das Regime empfindet die gewagte Musik und die ihr unnachvollziehbaren Texte des langhaarigen Veloso als Bedrohung. Ende 1968 wird er in der Morgendämmerung verhaftet und geht zusammen mit Gilberto Gil im Gefängnis durch Monate des Psychoterrors. Seine Frau Dedé bringt ihm ein Magazin, in dem die ersten Bilder der Erde aus dem All zu sehen sind. »Als ich mich in dieser Zelle eingesperrt fand, habe ich diese berühmten Fotos gesehen, wo wir sie erstmals ganz erblicken«, das sind die Anfangszeilen seines zehn Jahre später komponierten Liedes »Terra«. Hier kann man den Balladensänger Caetano Veloso kennenlernen: Mit geradezu zärtlicher, liebkosender Stimme besingt er den Planeten in einem schwebenden Folksong. Der Funke seiner Inspiration entzündete sich am weit entfernten Blick auf die blaue Murmel, und genauso fühlte er sich in der Isolation der Haft: Wie ein Mensch, der von ganz weit weg auf sein Dasein, seine Existenz blickt. Fern der Heimat muss er auch die nächsten Jahre zubringen: Der Haft folgt die Ausweisung nach London, wo er mit Gil ein mehrjähriges Exil übersteht.
»A TUA PRESENÇA MORENA« (1975)
Nach Velosos Rückkehr 1972 schwächt sich die Brutalität der Diktatur etwas ab, und der Sänger entwirft einige seiner besten Alben, die zu Klassikern der neuen Múscia Popular Brasileira werden. Thematisch bezieht er zunehmend die afroamerikanischen Wurzeln seiner bahianischen Herkunft ein. Die – auch erotische – Faszination an der schwarzen Frau hat er in dieser Miniatur eingefangen. Wie ein abwärts taumelnder, spiralförmiger Sog wirkt »A Tua Presença Morena«: Gitarren, Streicher und Trommeln scheinen eigenen Zeitebenen zu gehorchen, während seine faszinierte Stimme davon berichtet, wie die »schwarze Präsenz« nach und nach Besitz von ihm ergreift. »Sie tritt ein durch die sieben Löcher meines Kopfes, lähmt den Moment, löst mich auf, wickelt sich um meinen Oberkörper, meine Arme, meine Beine. Sie ist das Schönste in der ganzen Natur.«
»ESTRANGEIRO« (1989)
Ende der 1980er läutet Caetano Veloso eine neue Karrierephase ein: Er arbeitet mit Musikern aus New York, darunter die Gitarristen Marc Ribot und Bill Frisell (s. S. 58), und beginnt eine Partnerschaft mit dem Produzenten Arto Lindsay. Seine Musik findet zum PatchworkCharakter früher Jahre zurück: Funkig aufgeladener Pop, Bossa, Balladeskes, bahianische Perkussion: All das gibt es auf dem international gefeierten Album »Estrangeiro«. Und das gewaltige Titelstück ist ein Bewusstseinsstrom, der die Postkartenschönheit Rio de Janeiros dekonstruiert, im Text Bezüge herstellt zu Paul Gauguin bis hin zu Stevie Wonder.

66 Ca E tano V E loso
Mit João Bosco und João Gilberto (1989)
»OS PASSISTAS« (1997)
Auf dem Album »Livro« wendet sich Veloso in vielen Stücken Bahia zu. In seinem Heimatstaat im Nordosten Brasiliens wurde der Samba geboren. Doch während »Livro« rhythmisch zur Feier von Samba und SambaReggae wird, enthält es auch einige der schönsten poetischen Höhenflüge seines Werks. Im Eröffnungsstück »Os Passistas« ist Veloso ein grandioses Portrait zweier Sambatänzer gelungen. »Komm, ich werde meine Hand um deine Hüfte legen, dir deine Füße tausendfach vermehren. Schau zum Himmel, dreh dich: Der Schmerz definiert unser ganzes Leben, aber diese Schritte zeigen der Welt, wohin sie gehen soll«, heißt es da. Und wie sich die massive SambaPerkussion mit dieser unvergleichlich zarten, wendigen Stimme vereint: Das ist zum Niederknien.
»CUCURRUCUCÚ PALOMA« (2003)
Caetano Veloso ist nicht nur berühmt für seine Eigenkompositionen. Immer wieder hat er seine stimmlichen Qualitäten auch in Coverversionen unter Beweis gestellt. Als herausragend muss seine Lesart des mexikanischen Klassikers »Cucurrucucú Paloma« gelten. Für einen Auftritt in Pedro Almodóvars Film »Hable con ella« wandelt er die pathetische Ranchera über den unglücklich Verliebten, der nach seinem Tod als Taube zurückkehrt, in einen Abgesang voll schmerzlicher Innigkeit – und bringt damit Millionen zum Weinen. Seine Stimme erreicht in diesem Lied eine nahezu überirdische Leichtigkeit. Seitdem gilt: Es gibt ein »Cucurrucucú« vor und eines nach Caetano. Seine Version wird zur Schablone für alle darauffolgenden.
»NÃO VOU DEIXAR« (2022)
Als im Januar 2019 ein Rassist, Sexist und Verharmloser der Militärdiktatur ins Präsidentenamt Brasiliens gewählt wird, ist das für die ehemaligen Tropikalisten ein schwerer Schlag. Mehr als 50 Jahre nach seiner Verhaftung bedroht man Caetano Veloso erneut, ein ranghoher Militärbischof bezeichnet ihn in einer Predigt als Dummkopf, fragt, wie es wäre, ihm Rattengift zu verabreichen. Als Veloso während der Pandemie neue Songs für sein aktuelles Album »Meu Coco« schreibt, entwirft er auch »Não Vou Deixar«: »Ich werde dich nicht an der Geschichte unseres Landes herumschnitzen lassen, dich nicht entkommen lassen, auch wenn du sagst, es ist vorbei, und der Traum habe keine Farbe mehr.« Eine direkte Konfrontation mit dem Machthaber, die zeigt, dass Caetano auch mit 80 Jahren ungebrochen ist wie eh und je. Mittlerweile ist Bolsonaro Geschichte und Caetano immer noch da. Und wenn eine Stimme die Wunden, die ins Brasilien des 21. Jahrhunderts geschlagen wurden, heilen kann, dann ist es seine.
In der Elbphilharmonie (August 2021)
CAETANO VELOSO


Mi, 4.10.2023 | 21 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
»Meu Coco«
Ca E tano V E loso 67
Mittlerweile ist auch Bolsonaro Geschichte – und Veloso immer noch da, ungebrochen wie eh und je.
In New York zum Unabhängigkeitstag Brasiliens (1992)

68 E ngag EME nt
ICH BIN EIN FAN
Meine aufregende Reise mit der Elbphilharmonie begann 2019 mit dem MitmachProjekt
»Stadtlied«: Hamburgerinnen und Hamburger aller Altersgruppen, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, konnten da gemeinsam ein Lied über ihre Stadt schreiben. Das Ergebnis sollte im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg im Großen Saal der Elbphilharmonie präsentiert werden – was für eine verlockende Herausforderung! Ich wollte unbedingt mitmachen, und einer der Gründe, warum ich dann tatsächlich ausgewählt wurde, war sicherlich, dass ich die Çifteli, die albanische Langhalslaute, spiele. Ihr Klang ähnelt dem einer Mandoline, und obwohl sie nur zwei Saiten hat, kann sie auch recht voluminös klingen. Ich habe ein Lied komponiert und allein auf der großen Bühne vorgetragen, wobei ich mich auf der Çifteli begleitet habe. In meinem Lied thematisierte ich, wie meine Eltern vor vielen Jahren aus Albanien nach Deutschland gekommen sind. Mein Vater ist 1967 zum Arbeiten hierhergekommen, später hat er die ganze Familie nachgeholt. Ich lebe seit 1993 in Deutschland und bin hier groß geworden.
Schon als kleines Kind habe ich es geliebt zu singen. Mit sechs Jahren fing ich an, mir selbst das ÇifteliSpielen beizubringen. Bis dahin war das traditionelle albanische Instrument eine Männerdomäne, ich sah nur Männer und Jungen sie spielen. Ich dachte mir: »Das will und kann ich auch!« Ich lasse mich nicht so schnell einschüchtern oder abschrecken. Der Erfolg gab mir recht, schon als junges Mädchen wurde ich als Sängerin und Instrumentalistin häufiger zu Feierlichkeiten eingeladen.
In Deutschland habe ich das Musizieren dann stetig weiterverfolgt. Dass mich mein Weg schließlich sogar in die Elbphilharmonie geführt hat, ist für mich der absolute künstlerische Höhepunkt, das ist nicht zu toppen! Ich kann mich noch gut an die Eröffnung des Konzerthauses erinnern: Ich habe mir das beeindruckende Riesengebäude angeschaut und gedacht, wie toll es wäre, wenn eines Tages jemand mein Lieblingsinstrument im Großen Saal präsentieren und hier bekannt machen würde. Ich habe dabei im Traum nicht an mich gedacht.
Ich kann gar nicht mehr genau nachvollziehen, wie ich zur Elbphilharmonie gekommen bin. Ich habe früher oft an Projekten der »Musik von den Elbinseln« teilgenommen. Auch beim »New Hamburg Festival«, das vom
Deutschen Schauspielhaus Hamburg mitorganisiert wurde, war ich musikalisch unterwegs. Ja, und irgendwann erzählte mir dann eben jemand vom StadtliedProjekt der Elbphilharmonie…
Ich engagiere mich auch intensiv in anderen MitmachEnsembles der Elbphilharmonie. So konnte ich zum Beispiel im Kreativorchester meine Musikalität und mein Improvisationstalent weiterentwickeln und mich auch auf neuen Instrumenten ausprobieren. Zuletzt habe ich am CommunityProjekt »Love est. 2023« teilgenommen: Unter Anleitung von Künstlerinnen und Pädagogen entwickelten wir in monatelanger Probenarbeit ein genreübergreifendes Kunstprojekt mit Tanz, Gesang und Schauspiel, mit dem wir die vielen Facetten von Liebe in unserer Zeit einfangen wollten. Das Ergebnis präsentierten wir im Großen Saal, musikalisch begleitet vom Ensemble Resonanz. Mir gefällt diese Vielfalt, wenn alles möglich scheint und ich mich immer wieder neu erfinden kann. Ich lerne Dinge, von denen ich nicht wusste, dass ich sie kann.
Regelmäßig singe ich auch im Chor zur Welt. Für unser aktuelles Projekt »Together. Zusammen. Ensemble« begeben wir uns zum ersten Mal in die Welt der Oper und werden auch szenisch aktiv. Es macht großen Spaß, hochemotionale Opernmeisterwerke singen zu können. Ich lerne in allen Projekten so viele interessante, liebenswerte Menschen kennen. Aus den Proben komme ich immer hellwach und randvoll mit Adrenalin nach Hause. Auch wenn ich hauptberuflich Diplombetriebswirtin und Deutschlehrerin bin, ist die Elbphilharmonie mittlerweile fast mein zweites Zuhause geworden. Dank ihrer Unterstützung haben sich mir so viele Wege eröffnet. Im August trete ich zum Beispiel im Konzerthaus Berlin auf, wo ich einen kleinen Soloauftritt haben werde. Ich bin der Elbphilharmonie sehr dankbar, dass sie mir diese Möglichkeiten zur künstlerischen Entfaltung gibt und in ihren Programmen großen Wert auf kulturelle Vielfalt legt. Die Musik bringt uns zusammen, sie nährt unsere Seele und macht uns zu erfüllten Menschen.
E ngag EME nt 69
Hava Bekteshi weiß genau, warum sie sich bei den Mitmach-Ensembles der Elbphilharmonie engagiert.
AUFGEZEICHNET VON CLAUDIA SCHILLER FOTO GESCHE JÄGER
KLINGENDES
AFTERWORK
Öffentliche Auftritte gibt es nicht, dafür umso mehr gute

Laune im Proberaum: Im Elbphilharmonie Betriebschor singen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Abteilungen zusammen.

70 M ita RBE it ER
VON FRÄNZ KREMER FOTOS GESCHE JÄGER
Silke Sobieraj
Constantin Zill
Ein Summen ist zu hören im Kaistudio 7, hier unten im Backsteinsockel der Elbphilharmonie. Dann gehen alle in die Knie, springen mit Schwung wieder hoch und lassen die Arme fliegen: Zum Singen – das weiß jeder, der schon mal im Chor mitgemacht hat – braucht man mehr als nur seine Stimmbänder. Auch Beine und Bauch, Hüfte und Schultern, Stirn und Wangen sind gefragt, ja der ganze Körper. Außer vielleicht das Gehirn, das darf jetzt mal Pause machen. Die zehn Leute, die hier im Halbkreis stehen, haben bis vor wenigen Minuten noch telefoniert, organisiert, getippt. Im Proberaum ist jetzt genau das Gegenteil gefragt: nicht denken, nur fühlen, den Atem spüren.
Seit vier Jahren schon finden sich in den Kulissen der Elbphilharmonie Woche für Woche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen, um nach ihrer Arbeit noch ein wenig gemeinsam zu singen. Der Betriebschor ist aus dem Team heraus entstanden – und bewusst unkompliziert organisiert: Jeder kann mitmachen, jederzeit ein und aussteigen, das Repertoire eignet sich auch für jene, die das mit dem Singen einfach nur mal ausprobieren wollen. Sicher, es gibt im Team der Elbphilharmonie viele exzellente Musikerinnen und Sänger – doch im Betriebschor ist das nicht wichtig, hier geht es in erster Linie um das Zusammensein unter Kollegen. Auch Auftritte gibt es eigentlich nicht, zumindest keine offiziellen. Als ÜberraschungsAct hingegen taucht der Chor gerne mal auf, auf der Weihnachtsfeier, dem Sommerfest – und nun auch bei der nächsten Betriebsversammlung, die er mit ein paar Liedern eröffnen wird. Heute gehen die Mitglieder das Programm noch ein letztes Mal durch.
SILKE SOBIERAJ: »DIREKT EINE ANDERE ENERGIE«
Eine der Sängerinnen ist Silke Sobieraj. Sie hat in ihrem Leben schon vieles gemacht, bevor sie im Sommer 2022 als Guide in der Elbphilharmonie anfing: Sie ist promovierte Geschichtswissenschaftlerin, hat in Norwegen und Tschechien gelebt, als Lektorin gearbeitet, als Stadtführerin in Köln und Karlsruhe, neben dem Job an der Elbphilharmonie unterrichtet sie auch Norwegisch an einer Hamburger Volkshochschule. »In meiner Studienzeit in Norwegen habe ich entdeckt, wie schön das Singen in der Gruppe ist. Ich habe dort auch einen Sprachkurs gemacht, und die Lehrerin hat regelmäßig mit uns erwachsenen Schülern gesungen. Es war ganz selbstverständlich für alle. Von zu Hause in Deutschland kannte ich das damals so nicht. Da hatte man eher Hemmungen, einfach drauflos zu singen.«
Für ihren eigenen Norwegischkurs hat sie diese Praxis übernommen. »Da lass ich dann alle aufstehen, und wir singen so etwas wie ›Mein Hut, der hat drei Ecken‹. Das bringt direkt eine andere Energie in den Kurs.« Da sie selbst nicht Notenlesen gelernt hat, habe sie außerhalb des Kurses nie einen passenden Chor gefunden, »obwohl ich immer schon Lust aufs Singen hatte«, sagt sie. Der Betriebschor kam also genau richtig. Für sie, die die Elbphilharmonie nach außen vorstellt, sei es auch eine Möglichkeit gewesen, das Team im Inneren besser kennenzulernen.
»Wir Guides haben sonst wenig Berührungspunkte mit den anderen Mitarbeitern«, sagt sie, »ich kannte kaum jemanden. Seit ich im Chor singe, hat sich das radikal geändert.« Und es habe ihr auch durchaus Vorteile in ihrem Job gebracht. »Wir haben zum Beispiel Hausführungen mit dem Fokus Musik, da versuchen wir immer, dass die Gruppe in eine Orchesterprobe im Großen Saal reinhören kann. Von außen konnte ich bisher nie sicher sein, wann der Dirigent Pause macht. Aber seit ich mit einem der Orchesterwarte im Chor singe …«, lacht Sobieraj, »… seitdem weiß ich Bescheid.«
CONSTANTIN ZILL: »DA HAT MAN EINEN GRUND«
Auch Constantin Zill ist noch relativ neu im Team und freute sich, über den Chor gleich ganz unterschiedliche Leute kennenzulernen. Das Singen an sich ist für ihn aber nichts Neues. Als Teenager trat er als SingerSongwriter auf, später studierte er JazzPosaune in Linz, arbeitete zehn Jahre als Ensembleleiter, Lehrer und freiberuflicher Musiker, war mit seinem eigenen SwingTrio unterwegs, sang ColePorterNummern. Nach einem weiteren Studium der Musikvermittlung landete er schließlich im EducationTeam der Elbphilharmonie. Dort konzipiert und organisiert er heute Konzerte passgenau für besondere Zielgruppen.
»Im Moment kümmere ich mich etwa um unsere Konzertformate für Babys, für Schüler, aber auch für ältere oder demenzkranke Menschen«, sagt Zill. Bei seiner Arbeit macht er selbst keine Musik mehr, umso mehr freut er sich, einmal die Woche mit den Kollegen zu singen. »Man kann meist sehr schnell von allem anderen abschalten. Das könnte man mit Yoga oder Joggen auch. Aber beim Joggen stört es niemanden, wenn es mal nicht geht, daher lässt man es gern mal bleiben. Beim gemeinsamen Singen ist das anders. Da hat man einen Grund, warum man das zusammen macht. Und ein Ergebnis.« ›
M ita RBE it ER 71
Ein besonderer Reiz, in den Kaistudios der Elbphilharmonie zu proben, ist für Zill auch, dass hier die Instrumentenwelt zu Hause ist – und damit ein riesiges Lager mit über 500 Instrumenten. »Wenn man dann in einer Probe denkt: ›Da würde jetzt eine Glocke oder ein bisschen Percussion dazu passen‹, dann steht einfach jemand auf und holt es dazu«, erklärt Zill. »Das ist natürlich einmalig, dass wir auf all das hier zurückgreifen können.«
JESSICA SUHR: »MIT DICKEM GRINSEN IM GESICHT«

Gewöhnlich wird der Chor aber nur vom Klavier aus begleitet. An ihm steht auch heute Stephan Lutermann, Professor für Chorleitung an der Hamburger Musikhochschule, der es sich zwischen seinen vielen Projekten nicht nehmen lässt, als Externer einmal die Woche in die Elbphilharmonie zu kommen, um mit dem Betriebschor zu proben. »Er hat tolle Stücke ausgesucht, bei denen er jeden mitnimmt«, sagt Jessica Suhr, die im Alt singt. »Und ich mag es, dass er so einen Fokus auf die Aufwärmübungen legt.«

Suhr hat schon in mehreren Chören gesungen und dabei gemerkt, wie entscheidend das Aufwärmen ist. »Es gibt zum Beispiel eine Übung, bei der man sich zu zweit gegenseitig die Arme abstreift und massiert, bis in den kleinen Finger. Als ich das die ersten Male gemacht habe, konnte ich gar nicht fassen, wie viel das ausmacht. Man merkt, wie verspannt man eigentlich oft ist nach einem normalen Tag im Büro.« Suhr hat in ihrem Arbeitsalltag sonst wenig mit Tönen, sondern vor allem mit Tabellen und Preisen zu tun. Sie ist für den Einkauf und das Bestandsmanagement des Elbphilharmonie Shops auf der Plaza verantwortlich. »Ich bin ein Zahlenmensch, liebe es zu organisieren«, sagt sie.
Seit 2017 ist Suhr schon im Unternehmen, arbeitete zunächst über einen Dienstleister als Verkäuferin im Elbphilharmonie Shop, ehe sie 2020 eine feste Stelle im Team des Hauses annahm. »Ich fühle mich hier total wohl«, sagt sie. »Ich finde, die Elbphilharmonie ist ein modern denkendes Unternehmen, das auch gesellschaftliche Themen anspricht, das gefällt mir gut.« Der Chor
Alexander Itzke
Jessica Suhr
habe das positive Gefühl nochmal verstärkt. »Mittwochs gehe ich immer mit einem dicken Grinsen im Gesicht nach Hause und singe noch stundenlang weiter.«
ALEXANDER ITZKE: »WAS ICH MACHEN WOLLTE«
Von der positiven Energie, die beim gemeinsamen Musizieren entsteht, kann auch Alexander Itzke ein Lied singen. Er hat soziale Arbeit studiert und in seinen ersten Jobs immer versucht, Musik einzubringen: »Nach meinem Studium habe ich mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und ein Bandprojekt mit ihnen initiiert. Es war unglaublich, wie das manche Leute beflügelt hat –nicht nur bei den Proben und den Auftritten, auch darüber hinaus in ihrem Leben. Von diesen Erlebnissen hatte ich mehrere in den folgenden Jahren.«
Irgendwann wurde ihm klar, dass er solche Projekte noch intensiver verfolgen will. »Und dann sah ich eine Jobanzeige der Elbphilharmonie. Was da drinstand, war eins zu eins das, was ich machen wollte.« Seit Ende 2022 leitet er nun in der Elbphilharmonie Workshops und entwickelt mit zwei Kollegen das neue Format »Elbphilharmonie Soundtracker« für Jugendliche ab 16 Jahren,
mit dem sie demnächst in Schulen und Kulturzentren in ganz Hamburg Station machen. »Wir haben Musikinstrumente und andere Materialien dabei und wollen in mehreren Sessions mit den Teilnehmern kreativ werden, sie ermutigen, selbst etwas zu erschaffen«, erklärt Itzke. »Das Ziel ist, dass ein Werk entsteht, mit Musik, Geräuschen, vielleicht auch in Kombination mit Bildern, Schauspiel, einer Choreografie. Wir wollen so viel Input geben, dass niemand überfordert wird, und ansonsten möglichst offen sein. Sehr spannend – auch für uns.«
Itzke selbst hat als Kind angefangen, Trompete zu lernen, spielte im Blasorchester, hatte aber mit 15 Jahren immer weniger Lust, nur die Stücke anderer nachzuspielen. Also brachte er sich selbst Klavier bei, begann zu singen, in Bands zu spielen, eigene Songs zu schreiben. »Mit anderen Musik zu machen, hat mich immer auch selbst vorangebracht«, sagt Itzke. Und so war es auch mit dem Betriebschor: »Ein Tag vor der Weihnachtsfeier hat mich jemand gefragt, ob ich nicht mit auftreten will. Bis dahin hatte ich noch nie in einem Chor gesungen. Aber seitdem bin ich regelmäßig dabei – und habe schon wieder viel Neues gelernt.«
Jetzt Tickets sichern
Royal Concertgebouw Orchestra
Iván Fischer
Berlioz: Les Troyens
Monteverdi Choir
Orchestre Révolutionnaire et Romantique
John Eliot Gardiner
Israel Philharmonic Orchestra
Lahav Shani
Münchner Philharmoniker
Philharmonischer Chor München
Mirga Gražinytė-Tyla
und viele weitere Gastorchester, Ensembles und Solist*innen
M ita RBE it ER 73
26.8. 18.9.2023
In Zusammenarbeit mit
berlinerfestspiele.de
NACHTSCHLUPPE, HANDGESPROCHEN
Bei manchen Wörtern muss auch Celine Sawkins länger nachdenken. Zum Beispiel Nachtschluppe. Das kommt vor in »Frühlings Erwachen« von Frank Wedekind, 1891 geschrieben, 1906 uraufgeführt, und damals wusste mutmaßlich jeder, dass damit ein Nachthemd gemeint war. Aber wie übersetzt man das heute in die Gebärdensprache, ohne die flapsige Umgangssprache zu eliminieren? »Da muss ich mir noch was ausdenken«, sagt Sawkins und nippt an ihrem Kaffee. Sommer in Hamburg, eine Woche bis zu ihrem eigenen Auftritt bei »Frühlings Erwachen« am ErnstDeutschTheater an der Mundsburg. Obwohl, da muss man vorsichtig sein mit den Begrifflichkeiten. Denn ja, sie wird auf der Bühne stehen, und sie wird, sagen wir mal: performen. Aber nein, sie wird nicht Teil des Stückes sein. Sawkins und ihre Kollegin Sabrina Eifler sind für diesen Abend für eine Dienstleistung engagiert worden: Sie übersetzen das Stück simultan in die Gebärdensprache für Gehörlose. Und nicht mal das ist richtig formuliert: Sie übersetzen für die Schauspieler, den Regisseur, das ganze Ensemble des Stückes, damit die tauben Empfänger dem Geschehen folgen können.
Sawkins ist gerade in der Vorbereitungsphase. Neulich hat sie einen Probelauf des Stückes gesehen, sie
hat sich die Stolpersteine im Textbuch angestrichen. Da etwa, wo die Sprache von heutiger Jungendsprache in die von vor 120 Jahren wechselt. Wo in den Dialogen die Rollen wechseln oder durcheinandergehen, sie ist in stetigem Austausch mit Sabrina Eifler, der anderen Dolmetscherin auf der Bühne. »Das Stück ist ein echtes Brett«, sagt sie, zwei volle und ziemlich intensive Arbeitswochen wird sie am Ende investiert haben. Dazu kommt: »Frühlings Erwachen« ist ein SechsPersonenStück, Sawkins und Eifler sind nur zu zweit, »finde den Fehler«, sagt sie und lacht. Sie ist eine mehrfach gespaltene Persönlichkeit an diesem Abend, drei Rollen sind ihre. Wer spricht, das kündigt sie mit einer Namensgebärde an, und das wird dem tauben Teil des Publikums vorher in einer Einführung mitgeteilt, »denn den Namen immer zu buchstabieren, das würde den Prozess des Dolmetschens zeitlich zurückwerfen«.
Celine Sawkins ist also Gebärdensprachdolmetscherin. Theater ist nur ein Teil ihres Berufslebens, ein sehr schöner, findet sie. Aber das Beste an ihrem Job: Er ist so abwechslungsreich. Gestern stand sie auf einer Betriebsversammlung und übersetzte, heute war sie mit einem Gehörlosen beim Arzt. »Und nächste Woche der Wedekind«, sagt sie, ein Stück, das ihren Horizont
74 R E po R tag E ›
Gebärdensprache ist die Stimme der Gehörlosen. Da geht es um viel mehr als nur um den Austausch von Information.
VON STEPHAN BARTELS FOTOS MAXIMILIAN PROBST

R tag E 75
Stefan Goldschmidt


76 R E po R tag E
Celine Sawkins
erweitert – auch in Sachen Berufsverständnis, denn das Performative ist darin eigentlich nicht vorgesehen: »Ich erkläre nichts, ich lasse nichts weg, ich füge nichts hinzu«, sagt sie, »was ich tue, ist komplett dem Translationsprozess geschuldet.« Das ist nicht ihre eigene Entscheidung: Es gibt eine Berufs und Ehrenordnung, in der gilt Neutralität als Qualitätsmerkmal. Dass diese Neutralität aber nicht immer gleich aussieht, liegt in der Natur der Kundschaft. »Ich dolmetsche für einen Akademiker anders als für ein unbegleitetes Flüchtlingskind aus Afghanistan«, sagt Sawkins, »aber die Kriterien bleiben dieselben«. Also ist die Gebärdensprache eine technische, pragmatische? Oder kann sie auch eine Stimme sein, mit Zwischentönen, mit individuellen Eigenheiten, mit Modulationen und Phrasierungen in den Gesten? Sawkins überlegt einen Moment. Und sagt dann: Man müsse unterscheiden zwischen einem Übersetzungsprozess und einer privaten Unterhaltung. Und klar, man könne einen Zustand einfach mit einer Gebärde mitteilen, zum Beispiel: Es geht mir nicht gut. »Man kann das aber auch mimisch unterstreichen«, sagt sie, »und dann wird es definitiv individuell.«
SPRACHE VERÄNDERT SICH
Dass Celine Sawkins überhaupt mit dem Studium für Gebärdensprachdolmetschen anfing, hatte keinen persönlichen Hintergrund. Der Studiengang war damals frisch, sie hatte davon gehört und dachte naiv: irgendwie interessant. Sie ist dabeigeblieben, vor 19 Jahren hat sie ihr Studium beendet. »Gelernt habe ich seitdem trotzdem, und zwar jeden Tag«, sagt sie. »Sprache verändert sich, die der Hörenden doch auch. Das Wort ›whatsappen‹ zum Beispiel gibt es ja auch noch nicht so lange.«
Als Sawkins 2004 ihren Abschluss machte, war Simone Scholl schon da. »Da« ist das Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser an der Uni Hamburg, kurz IDGS , heute untergebracht am GorchFockWall. Hier wird nicht nur Gebärdensprache vermittelt, sondern auch erforscht. Und Scholl ist mittendrin als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrkraft für besondere Aufgaben. Seit 1987 gibt es das Institut, und das, sagt Simone Scholl, »liegt beinahe ausschließlich an der Neugierde eines einzelnen Linguisten«.
Dieser eine Linguist war Siegmund Prillwitz, der sowohl einen Professor als auch einen Doktor vor dem Namen trägt. Er guckte in den späten Siebzigern rüber
in die USA , wo die American Sign Language, die amerikanische Gebärdensprache, längst etabliert war, während in Deutschland noch immer auditivverbal erzogen wurde. Gründete 1981 am Germanistischen Seminar der Uni Hamburg die »Forschungsstelle Deutsche Gebärdensprache«. Er war es auch, der 1985 auf einem Kongress ganz offiziell nachwies: Ja, die Gebärdensprache ist eine eigenständige Sprache, und sie hat nichts mit der Grammatik des gesprochenen Deutsch gemeinsam. 1987 hat Prillwitz dann eben dieses Institut aufgemacht. Da war sie endgültig im Universitätsbetrieb angekommen, diese neue Sprache.
Das klingt jetzt irgendwie ziemlich akademisch, aber das war es nicht. Das Anerkennen der eigenen Sprache war ein Quantensprung für die Identität gehörloser Menschen. Und dann erst später das Internet! Die vielen Videos, in denen Kultur und Leben in Gebärdensprache vermittelt wurden! Wahrscheinlich hat sich in den vergangenen 20 Jahren keine Sprache weltweit so stark entwickelt wie die der Gehörlosen.
Simone Scholl kennt noch die Zeit davor. Sie ist Jahrgang 1964 und kommt aus Beckum im Münsterland, da gab es einen gehörlosen Schuster und eine gehörlose Schneiderin. »Wir haben unsere Sachen zu denen gebracht«, sagt sie, »und die haben mit uns gesprochen, denn das Orale hatten sie ja gelernt: sich zu artikulieren, mit ihrer Stimme verständlich zu machen.« Aber die beiden haben Simone ab und zu in ihren Gehörlosenverein mitgenommen. Da ist sie zum ersten Mal in Berührung gekommen mit der Gebärdensprache, für die es kaum Dolmetscher für Hörende gab. »Dafür hat sich damals kein Hörender interessiert«, sagt Scholl, »für die war das halt gestikulieren. Und wer es böse meinte, für den war es Affensprache.«
Scholl fand das Gebärden klasse. »Und ich dachte bei mir: Ich werde Gehörlosenlehrerin.« Aber als sie Mitte der Achtziger mit ihrem Studium begann, war die Gebärdensprache für Gehörlose im Unterricht verboten. »Die sollten sprechen lernen, wie die Generationen von tauben Menschen zuvor, und sich nicht mit diesem Rumgehampel ausdrücken – das war das Denken damals.« Scholl hat sich die Gebärdensprache dann im Gehörlosenverein draufgeschafft, durch Zugucken. Hat übersetzt, als Gehörlose sie darum gebeten haben. »Da hat mich das Dolmetschen gepackt«, sagt sie, »hätte auch eine andere Sprache werden können.« ›
R E po R tag E 77
»Man kann einen Zustand einfach mit einer Gebärde mitteilen, zum Beispiel: Es geht mir nicht gut. Man kann das aber auch mimisch unterstreichen, und dann wird es definitiv individuell.«
AUTOBAHN UND LANDSTRA ẞ E
Bummelig 80.000 Gehörlose gibt es in Deutschland, und einer von ihnen kommt jetzt in Scholls Büro. Auch Stefan Goldschmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut. Seine Geschichte ist eine andere: Er wurde 1967 taub geboren. Aber bis das jemand gemerkt hat, war er schon zweieinhalb Jahre alt. »Nicht mal mein Vater hat das mitbekommen, und der war Kinderarzt«, gebärdet Goldschmidt, zwei Dolmetscherinnen im Raum übersetzen ihn abwechselnd. Im Kindergarten ist er dann Kindern mit tauben Eltern begegnet, die sich mit Gebärdensprache verständigten, »ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm«. Später hat er fünf Jahre lang in Washington studiert, Soziologie und Deaf Studies, im damals gelobten Land der Gebärdensprache. »Das war mein Durchbruch«, sagt er, »da gab es keine Verbote und eine Kultur des einander Zusehens.« 1994 kam er zurück nach Deutschland, studierte am IDGS weiter, wurde anschließend dort angestellt. Nach 30 Jahren zieht er demnächst weiter nach München, an die Uni dort. Für die Luftveränderung.
Als das IDGS gegründet wurde, gab es vielleicht zehn, 20 Gebärdensprachdolmetscher – in ganz Deutschland. Aber immer mehr bekamen Interesse an der neuen Sprache, und wo Dolmetscher anfangs vor allem die Belange der Gehörlosen gemanagt hatten, führte die immer feinere Gebärdensprache zu mehr Teilhabe. Und zu einer Kultur, in der man sagen konnte: Erzähl du deine Geschichte, ich bin nur dein Übersetzer. Und trotzdem: Da ist immer noch eine Barriere zwischen hörenden und tauben Menschen. Simone Scholl stört das. »Es gibt viele Hörende, die die Gebärdensprache gaaanz toll finden«, sagt sie und rollt mit den Augen. »Aber Interesse an Gehörlosen haben die nicht.« Denn wer geht schon in die Vereine, wer sucht Kontakt zu Gehörlosen? Kaum jemand, sagt Scholl, »und deshalb ist da immer noch diese Sprachlosigkeit«. Sie wünscht sich, dass es anders wäre.
Stefan Goldschmidt nickt und sagt, Kommunikation zwischen Menschen sei wie eine achtspurige Autobahn. »Aber ein Hörender und ich wären erst mal auf einer Landstraße unterwegs. Und was ist, wenn dann noch Wildwechsel passiert?« Sprachliche Hindernisse prägen den Umgang miteinander, nicht anders als bei anderen verschiedensprachigen Menschen. Trotzdem ist die Gebärdensprache ein unfassbarer Gewinn für alle Beteiligten.
»Würde ich das alles hier in Lautsprache von mir geben«, lässt Goldschmidt übersetzen, »dann würden wir das Gespräch sehr schnell beenden. Das brächte uns einander nicht näher.« Und überhaupt: Die Gehörlosen würden sich auch gar nicht als Menschen mit Behinderung empfinden, »wir sind erst einmal eine sprachliche Minderheit. Natürlich behindert uns die hörende Gesellschaft im Alltag. Aber unsere Sprache ist doch etwas, das jeder lernen kann.« Und dann – jetzt wieder Simone Scholl –»hätten die allermeisten auch einen Zugang zur Gehörlosenkultur«.
Sie erinnert sich, apropos Kultur, an ein Theaterstück, »Verkehrte Welt«. In dessen Zentrum stand ein hörendes Kind in einer tauben Welt – und diese Welt war geschockt über die »Behinderung« des Kindes. »Und es gibt gehörlose Poesie, die kann, die sollte man nicht übersetzen«, sagt sie, »die steht für sich.« Da war etwa dieser aufsehenerregende Auftritt des gehörlosen Schauspielers und Gebärdensprachdolmetschers Rafael Grombelka, der beim »Supertalent« auf RTL Songs performte, zum Beispiel »Weinst Du« von Echt!. Das war in der Tat besonders und nie zuvor gesehen. Er rührte mit seiner Gebärdensprachpoesie die Jury und das Publikum nicht zu knapp zu Tränen. Und das beantwortet dann vielleicht auch noch einmal die Frage nach der Stimme. Denn wer eine eigene Sprache, Kultur und Poesie hat –natürlich hat der eine eigene Stimme.
Damit sind wir aber auch bei der Frage nach kultureller Aneignung. Da war etwa dieser Fall einer hörenden Dolmetscherin, die sich mit übersetzten Musikvideos einen Namen machte. Sich bei Konzerten und Festivals auf die Bühne stellte und Musik übersetze, den Text, den Rhythmus. »Die hat ihre eigene Performance hingelegt, und für ihre Selbstdarstellung wurde sie von der Presse gehypt«, sagt Stefan Goldschmidt. Was sie allerdings vergessen hatte: Taube Menschen mit ins Boot zu holen, deren Sprache sie sich bemächtigte. Das hat viele in der tauben Community verletzt. »Was wir uns vorstellen: dass man im Team arbeitet, dass immer auch ein tauber Dolmetscher dabei ist und die Musik performt«, sagt Goldschmidt. Das Problem, sagt Simone Scholl, liege auch in der Verklärung. »Ich lese heute immer noch oft: Gebärdendolmetscher geben tauben Menschen eine Stimme. Nein. Die haben eine eigene, die reden immer noch selbst.«
78 R E po R tag E
›
»Man liest heute immer noch oft: Gebärdendolmetscher geben tauben Menschen eine Stimme. Nein. Die haben eine eigene, die reden immer noch selbst.«


 Simone Scholl
Stefan Goldschmidt
Simone Scholl
Stefan Goldschmidt
ES WIRD SEHR KÖRPERLICH
Eine Woche später. Im ErnstDeutschTheater ist es noch eine Stunde bis zum Vorstellungsbeginn, im Foyer beginnt die obligatorische Einführung in das Stück. Der Dramaturgieassistent Julian Süssmann sitzt zusammen mit Celine Sawkins und Sabrina Eifler vor 30, 40 Menschen. Nicht alle sind taub, die meisten schon. Da ist eine Wohngruppe mit mehrfach Behinderten, eine Gruppe junger Gehörloser, einige wenige Ältere. Und denen verdolmetschen die beiden jetzt, was Süssmann über das Stück erzählt, welche Gebärde welche Rolle einleitet. Und irgendwann geht es dann los. Da stehen die beiden, vom Zuschauerraum aus gesehen, rechts vorn am Bühnenrand, Jeans, dunkle Blusen, gut sichtbar für alle im Saal und trotzdem dezent. Einmal, in den Kammerspielen war das, hat ein hörender Zuschauer sich in den ersten Minuten des Stücks aus dem Publikum heraus über sie und ihre Kollegen beschwert. Ein Schauspieler unterbrach sofort und machte dem Mann klar: Das Stück ist barrierefrei, die Dolmetscher bleiben, er könne sich frei entscheiden, ob er das auch tun wolle. Dann

fing das Ensemble nochmal von vorn an. »Das war das einzige Mal in meinem Berufsleben, dass sich jemand von mir gestört gefühlt hat«, sagt Celine Sawkins.
Auch heute: keine Beschwerden. Sawkins wirkt exaltierter als ihre Kollegin, das ist der Tatsache geschuldet, dass die drei männlichen Rollen ihre sind: Masturbationsgesten, Vaginen, Sex, es geht sehr körperlich zu bei Wedekind. Und dass die beiden so mitgehen, dass sie Atmosphäre, Stimmung, Emotion mit übersetzen, das gehört zum Hamburger Ansatz. »Es gibt auch den Frankfurter Ansatz, da wird ganz neutral der Text übersetzt«, sagt sie, »aber wir hier oben haben uns anders entschieden.« Ihre Dialoge gebärden die beiden immer hin zu den Zuschauern, nie einander zugewandt. Denn so ist es an so einem Theaterabend: Zuwendung bekommen nur die unten im Publikum. Und heute sogar mit einer eigenen Gebärde für ein großmütterliches Nachthemd samt der passenden ironischen Mimik: Nachtschluppe eben.
80 R E po R tag E
Mitarbeit: Ellen Weidlich
»Frühlings Erwachen« im Ernst-Deutsch-Theater
SPAZIERGANG IN DER RIESIGEN MUSIKWELT
Antje
MUSIK AN HOCHSCHULEN
DIE ZEHN BESTEN
Kein anderes Stimmfach ist in den letzten 50 Jahren derart explodiert wie das der C OUNTERTENÖRE.
VON DER OPERNBÜHNE ZUM LIEDGESANG
Trotz ihrer Liebe zu Oper und Konzert legt die Sopranistin Katharina Konradi nun ein Schubert-Album vor.

GESCHICHTE DER TENORSTIMME
Mit seinem Album „Contra-Tenor“ öffnet Michael Spyres unser Verständnis von einem Stimmfach.
MELODISCHE BLÜTEN
Wie uns der Schwede Bobo Stenson die jazzige Welt des Klaviertrios eröffnet .
AUF WALLFAHRT DURCH DIE MUSIKEPOCHEN
Eine Würdigung zum 80. Geburtstag des Dirigenten und Pioniers der Alten Musik John Eliot Gardiner

AUF DEN SPUREN DER HELDEN
Annette Reisinger vom Minguet Quartett über den Klaviermagier Glenn Gould und dessen Streichquartett
AUSSERGEWÖHNLICHE SPIELORTE
Das Hemsing Festival bietet Raum für Klassik und Volksmusik – in heimeliger Atmosphäre. www.fonoforum.de

R E po R tag E 81
Zusatzangebote & Dienstleistungen für Abonnenten gelten nur für Kunden der Reiner H. Nitschke Verlags-GmbH * Der Spezial-Abo-Preis im Inland für drei Hefte beträgt inklusive Porto 21,60 Euro (Ausland auf Anfrage). FONO FORUM erscheint jeden Monat für 10,80 Euro in der Reiner H. Nitschke Verlags-GmbH. Nähere Infos, Abos und Heftnachbestellungen finden Sie auf unserer Internetseite www.nitschke-verlag.de oder telefonisch unter 02251 650 46 0. service.nitschke@funkemedien.de SPEZIALABO-ANGEBOT * 3 Ausgaben lesen, 2 bezahlen + Gratis-CD fonoforum.de/spezialabo2022eph
romantischer Kammermusik für sein Instrument vor.
Flöten-Star Emmanuel Pahud stellt zahlreiche Bearbeitungen
Weithaas, eine der kreativsten Geigerinnen der Violinszene und Professorin zugleich über Entwicklungen im Musikbetrieb
DIE FÖRDERER UND SPONSOREN DER ELBPHILHARMONIE
Große Visionen brauchen ein starkes Fundament. Deswegen unterstützen namhafte Partner aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik die Elbphilharmonie. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk, das die Elbphilharmonie als Konzerthaus von Weltrang begleitet. So ermöglichen sie ein Konzertprogramm mit einem unverwechselbaren musikalischen Profil, Musikvermittlungsideen für alle Generationen sowie innovative Festivalkonzepte, die Maßstäbe im internationalen Konzertbetrieb setzen.

DIE FÖRDERER
d ER sti F tung E l B philha RM oni E
MÄZENE
ZUWENDUNGEN AB 1.000.000 EURO
prof. dr. dr. h. c. helmut und prof. dr. h. c. hannelore greve
prof. dr. Michael otto und Christl otto
hermann Reemtsma stiftung
Christine und Klaus-Michael Kühne
Körber-stiftung
peter Möhrle stiftung
Familie dr. Karin Fischer
Reederei Claus-peter offen (gmbh & Co.) K g
stiftung Maritim hermann & Milena Ebel
hans-otto und Engelke schümann stiftung
Christiane und Klaus E. oldendorff
prof. dr. Ernst und nataly langner
PLATIN
ZUWENDUNGEN AB 100.000 EURO
ian und Barbara Karan-stiftung
gebr. heinemann s E & Co. K g
Bernhard schulte gmbh & Co. K g
deutsche Bank ag
M. M. Warburg & Co
hamburg Commercial Bank ag
lilli driese
J. J. ganzer stiftung

Claus und annegret Budelmann
Berenberg – privatbankiers seit 1590
Mara und holger Cassens stiftung
Christa und albert Büll
Christine und heinz lehmann
Frank und sigrid Blochmann
Else schnabel
Edel Music + Books
dr. Markus Warncke
Berit und Rainer Baumgarten
Christoph lohfert stiftung
Eggert Voscherau
hellmut und Kim-Eva Wempe
günter und lieselotte powalla
Martha pulvermacher stiftung
heide + günther Voigt
gabriele und peter schwartzkopff
dr. anneliese und dr. hendrik von zitzewitz
prof. dr. hans Jörn Braun †
susanne und Karl gernandt
philipp J. Müller
ann-Mari und georg von Rantzau
dr. gaby schönhärl-Voss und Claus-Jürgen Voss
lennertz & Co.
GOLD ZUWENDUNGEN AB 50.000 EURO
Rainer abicht Elbreederei
Christa und peter potenberg-Christoffersen
h ER isto ag
Christian Böhm und sigrid neutzer
amy und stefan zuschke
SILBER
ZUWENDUNGEN AB 10.000 EURO
Ärzte am Markt: dr. Jörg arnswald, dr. hans-Carsten Braun
Baden-Württembergische Bank
Marlis u. Franz-hartwig Betz stiftung
hans Brökel stiftung für Wissenschaft und Kultur
Jürgen und amrey Burmester
Rolf dammers ohg
deutsche giganetz gmbh
EdEK aBanK ag
FR osta ag
Katja holert und thomas nowak
isabella hund-Kastner und ulrich Kastner
Knott & partner V di
hannelore Krome
dr. Claus und hannelore löwe
stiftung Meier-Bruck
Riedel Communications gmbh & Co. K g
BRONZE
ZUWENDUNGEN AB 5.000 EURO
dr. ute Bavendamm / prof. dr. henning harte-Bavendamm
ilse und dr. gerd Eichhorn
hennig Engels
dr. t hecke und C. Müller
Marga und Erich helfrich
Familie Klasen
Mercedes-Benz hamburg
georg-plate-stiftung
hella und günter porth
Carmen Radszuweit
Colleen B. Rosenblat
DER KURATORENKREIS
Jürgen abraham | Rolf abraham | andreas ackermann | anja ahlers | Margret alwart | Karl-Johann andreae | Rainer und Berit Baumgarten | gert hinnerk Behlmer | Michael Behrendt | Robert von Bennigsen | Joachim von Berenberg-Consbruch | tobias graf von Bernstorff | peter Bettinghaus | Marlis und Franz-hartwig Betz | ole von Beust | Wolfgang Biedermann | alexander Birken | dr. Frank Billand | dr. gottfried von Bismarck | dr. Monika Blankenburg | ulrich Böcker | Birgit Bode | andreas Borcherding | tim Bosenick | Vicente Vento Bosch | Verena Brandt | Beatrix Breede | heiner Brinkhege |
nikolaus Broschek | Marie Brömmel | tobias Brinkhorst |
gerhard Bruns-Raddatz | Claus-g Budelmann |
Engelbert Büning | amrey und Jürgen Burmester |
dr. Christian Cassebaum | dr. Markus Conrad | dr. Katja
Conradi | dierk und dagmar Cordes | Familie dammann |
Carsten deecke | Jan F. demuth | ulrike und Karl denkner |
dr. peter dickstein | heribert diehl | detlef dinsel |
Kurt dohle | Benjamin drehkopf | thomas drehkopf |
oliver drews | Klaus driessen | Christian dyckerhoff |
hermann Ebel | stephanie Egerland | hennig Engels |
Claus Epe | norbert Essing | heike und John Feldmann |
alexandra und dr. Christian Flach | dr. peter Figge |
Jörg Finck | gabriele von Foerster | dr. Christoph
Frankenheim | dr. Christian Friesecke | sigrid Fuchs |
Manhard gerber | dr. peter glasmacher | prof. phillipp
W. goltermann | inge groh | annegret und dr. Joachim
guntau | amelie guth | Michael haentjes | petra
hammelmann | Jochen heins | dr. Christine hellmann |
dr. Michael heller | dr. dieter helmke | Jan-hinnerk helms |
Kirsten henniges | Rainer herold | gabriele und henrik
hertz | günter hess | prof. dr. dr. stefan hillejan | Bärbel
hinck | Joachim hipp | dr. Klaus-stefan hohenstatt |
Christian hoppenhöft | prof. dr. dr. Klaus J. hopt | dr. stefanie howaldt | Rolf hunck | Maria illies | dr. ulrich t Jäppelt | dr. Johann Christian Jacobs | heike Jahr | Martin Freiherr von Jenisch | Roland Jung |

Matthias Kallis | ian Kiru Karan | tom Kemcke | Klaus Kesting | prof. dr. stefan Kirmße | Kai-Jacob Klasen | Renate Kleenworth | gerd F. Klein | Jochen Knees |
annemarie Köhlmoss | Matthias Kolbusa | prof. dr. irmtraud
Koop | petrus Koeleman | Bert E. König | sebastian Krüper | arndt Kwiatkowski | Christiane lafeld | Marcie ann gräfin lambsdorff | dr. Klaus landry | günther lang | dirk lattemann | per h lauke | hannelore lay |
dr. Claus liesner | lions Club hamburg Elbphilharmonie | dr. Claus löwe | prof. dr. helgo Magnussen | dr. dieter Markert | sybille doris Markert | Franz-Josef Marxen | thomas J. C. und angelika Matzen stiftung | helmut Meier | gunter Mengers | axel Meyersiek | Erhard Mohnen | dr. thomas Möller | Christian Möller | Karin Moojer-deistler | ursula Morawski |
Katrin Morawski-zoepffel | Jan Murmann | dr. sven Murmann | dr. ulrike Murmann | Julika und david M. neumann | Michael R. neumann | Franz nienborg | dr. Ekkehard nümann | thilo oelert | dr. andreas M. odefey | dr. Michael ollmann | dr. Eva-Maria und dr. norbert papst | dirk petersen | dr. sabine pfeifer | sabine gräfin von pfeil | aenne und hartmut pleitz | Bärbel pokrandt | hans-detlef pries | Karl-heinz Ramke | horst Rahe | ursula Rittstieg | Familie von Rauchhaupt | prof. dr. hermann Rauhe | prof. Michael Rutz | Bernd sager | siegfried von saucken | Jens schafaff | Birgit schäfer | dieter scheck | Mattias schmelzer | Vera schommartz | Katja schmid von linstow | dr. hans ulrich und gabriele schmidt | nikolaus h schües | nikolaus W. schües | Kathrin schulte | gabriele schumpelickv| ulrich schütte | dr. susanne staar | henrik stein | prof. dr. Volker steinkraus | Wolf o storck | greta und Walter W. stork | dr. patrick tegeder | Jörg tesch | Ewald tewes | ute tietz | dr. Jörg thierfelder | dr. tjark thies | dr. Jan thomas | dr. Jens thomsen | tourismusverband hamburg e. V. | prof. dr. Eckardt trowitzsch | John g turner und Jerry g Fischer | Resi tröber-nowc | hans ufer | dr. sven-holger undritz | Markus Waitschies | dr. Markus Warncke | thomas Weinmann | peter Wesselhoeft | dr. gerhard Wetzel | Erika Wiebecke- dihlmann | dr. andreas Wiele | dr. Martin Willich | ulrich Winkel | dr. andreas Witzig | dr. thomas Wülfing | Christa Wünsche | stefan zuschke
sowie weitere Kuratoren, die nicht genannt werden möchten.
VORSTAND: alexander Birken (Vorsitzender), Roger hönig (schatzmeister), henrik hertz, Bert E. König, Magnus graf lambsdorff, Katja schmid von linstow und dr. ulrike Murmann
EHRENMITGLIEDER: Christian dyckerhoff, dr. Karin Fischer †, Manhard gerber, prof. dr. dr. h. c. helmut greve †, prof. dr. h. c. hannelore greve, nikolaus h schües, nikolaus W. schües, dr. Jochen stachow †, prof. dr. Michael otto und Jutta a palmer †
E
B
E
E E. V.
d E s FRE und E s KRE is E s
l
philha RM oni
+ la E iszhall
ELBPHILHARMONIE CIRCLE
d ER unt ER n E h MERKRE is d ER E l B philha RM oni E
a B a C us a sset Management g mb h
a ddleshaw g oddard llp
ahn & si MR o CK Bühnen- und Musikverlag g mb h
allC u R a Versicherungs- a ktiengesellschaft
a llen o very llp
a-tour a rchitekturführungen
Bankhaus donn ER & RE us C h E l
Barkassen-Meyer
BB s Werbeagentur
B d V Behrens g mb h
BE ton gold
Bornhold d ie Einrichter Braun h amburg
British a merican tobacco g ermany
C. a . & W. von der Meden
Carl Robert Eckelmann
Clayston
Company Companions
d ienstleistungsgesellschaft der n orddeutschen Wirtschaft
d rawing Room
E n ER pa RC ag
Engel & Völkers ag
Engel & Völkers h amburg p rojektvermarktung
Esche s chümann Commichau
Eventteam g mb h
Flughafen h amburg
Fortune h otels
FR an K - g ruppe
Freshfields Bruckhaus d eringer
g arbe
g erresheim serviert g mb h
g ermerott i nnenausbau g mb h & Co. Kg
g roth & Co. g mb h & Co. K g
g rundstücksgesellschaft Bergstrasse
h amburg team
h anse l ounge, t he p rivate Business Club
h BB h anseatische Betreuungs- und Beteiligungs -

gesellschaft mb h
h einrich Wegener & s ohn Bunkergesellschaft
h ermann h ollmann g mb h & Co.
hhla
h otel Wedina h amburg
i K i nvestment partners
inp - h olding
i ris von a rnim
J a R a holding g mb h
FÖRDERKREIS
int ER national E s M usi KFE st ha MB u R g
Jürgen a braham
Corinna a renhold- l efebvre und n adja d uken
i ngeborg p rinzessin zu s chleswig- h olstein und n ikolaus Broschek
a nnegret und Claus- g Budelmann
Christa und a lbert Büll
g udrun und g eorg Joachim Claussen
Birgit g erlach
u lrieke Jürs
Ernst peter Komrowski
d r. u do Kopka und Jeremy z hijun z eng
h elga und Michael Krämer
s abine und d r. Klaus l andry
Marion Meyenburg
Joop!
Kesseböhmer h olding K g
K l B h andels g mb h
Konzertdirektion d r. Rudolf g oette g mb h
l auenstein & l au i mmobilien g mb h
l arimar portugal
l ehmann i mmobilien
l ennertz & Co. g mb h
loved
l upp + partner
Madison h otel
Malereibetrieb otto g erber g mb h
Miniatur Wunderland
nordwest Factoring und s ervice g mb h
n otariat am g änsemarkt
n otariat an den a lsterakaden
o ppenhoff
otto d örner g mb h & Co. K g
plath Corporation g mb h
print-o-tec g mb h
Rosenthal Chausseestraße g bR
R oxall g roup
s chlüter & Maack g mb h
s ervice-Bund g mb h & Co. Kg
s eydlitz g mb h
shp p rimaflex g mb h
s teinway & s ons
s tenzel’s Werbebüro
s tolle s anitätshaus g mb h
s trahlenzentrum h amburg MV z
s trebeg Verwaltungsgesellschaft mb h
taylor Wessing t he Fontenay h otel
trainingsmanufaktur d reiklang
u B s Europe s E h amburg
u nger h amburg
Vladi p rivate i slands
Weischer.Media
W i Rts C ha F ts R at Recht Bremer Woitag
Rechtsanwaltsgesellschaft mb h
Worlée Chemie
Wünsche g roup
s owie weitere u nternehmen, die nicht genannt werden möchten.
K. & s Müller
Christiane und d r. l utz peters
Änne und h artmut p leitz
Bettina und otto s chacht
Engelke s chümann
Martha p ulvermacher s tiftung
Margaret und Jochen s pethmann
Birgit s teenholdt- s chütt und h ertigk d iefenbach
Farhad Vladi a nja und d r. Fred Wendt
s owie weitere Förderer, die nicht genannt werden möchten.
SPONSOREN UND FÖRDERSTIFTUNGEN

PRINCIPAL SPONSORS

PRODUCT SPONSORS

diE paRtnER dER ElBphilhaRMoniE
CLASSIC SPONSORS


FÖRDERSTIFTUNGEN




















Herausgeber hamburgMusik ggmbh
geschäftsführer: Christoph lieben-seutter (generalintendant), Jochen Margedant platz der deutschen Einheit 4, 20457 hamburg magazin@elbphilharmonie.de www.elbphilharmonie.de
Chefredakteur Carsten Fastner
Redaktion Katharina allmüller, Melanie Kämpermann, Clemens Matuschek, tom R. schulz; gilda Fernández-Wiencken (Bild)
Formgebung g Roothuis gesellschaft der ideen und passionen mbh für Kommunikation und Medien, Marketing und gestaltung; groothuis.de gestaltung lina Jeppener (leitung), Janina lentföhr, lars hammer, susan schulz; Bildredaktion angela Wahl; herstellung sophie gabel, steffen Meier; projektleitung alexander von oheimb; Cvd Rainer groothuis
Beiträge in dieser Ausgabe von stephan Bartels, Christoph Becher, till Briegleb, stefan Franzen, niklas grapatin, Martin greve, Volker hagedorn, lars hammer, gesche Jäger, Fränz Kremer, Clemens Matuschek, Jan paersch, Maximilian probst, till Raether, ivana Rajic, nadine Redlich, Claudia schiller, tom R. schulz, albrecht selge, Julika von Werder, Bjørn Woll

Lithografie alexander langenhagen, edelweiß publish, hamburg
Korrektorat Ferdinand leopold
Druck hartung druck + Medien gmbh, hamburg
dieses Magazin wurde klimaneutral auf papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.
Anzeigenleitung
antje sievert, anzeigen Marketingberatung sponsoring tel: 040 450 698 03, office@kultur-anzeigen.com
Vertrieb pressup gmbh hamburg
Leserservice / Abonnement
Elbphilharmonie Magazin leserservice pressup gmbh
postfach 70 13 11, 22013 hamburg leserservice@elbphilharmonie.de tel: 040 386 666 343, Fax: 040 386 666 299
das Elbphilharmonie Magazin erscheint dreimal jährlich.

Bild- und Rechtenachweise
Cover: niklas grapatin; s 1 Michael zapf; s 2 oben: Julia Wesely, unten: Mark seliger, mitte: ari Magg, rechts: Maximilian probst; s 3 oben: afripics.com / alamy stock Foto, mitte: astrid ackermann, unten: picture alliance / design pics / axiom photographic | toby adamson; s 4 oben: picture-alliance/ dpa | Maxppp Kyodo news, unten: sst / alamy stock Foto, s 6 picture-alliance / dpa | stefan Kiefer, s 7 trinity
Mirror / Mirrorpix / alamy stock Foto, s 8 oben: Barry lewis / alamy stock Foto, unten: picture alliance/dpa | oliver Weiken; s 10 - 12 Julia Wesely; s 14 nadine Redlich; s 16 picture-alliance / leemage, s 17 - 20 akg-images; s 22 lins: picture alliance / dallE apRF, rechts: trinity Mirror / Mirrorpix / alamy stock Foto, s 24 links: picture alliance/united archives | kpa, rechts: picture alliance / photoshot; s 26 - 29 daniel
dittus, s 30 - 31 Claudia höhne; s 32 - 33 lars hammer; s 34 david lössl, s 36 - 37 unten: privat, oben rechts: astrid ackermann, s 38 astrid ackermann; s 40 - 47 niklas grapatin; s 48 links: Wiskerke / alamy stock Foto, rechts: Markus Jans, s 51 ari-Magg; s 52 oben: picture alliance / abaca | Villette pierrick/aBaCa, unten: picture alliance/ Epa-EFE | gailan haji, s 53 Janina lentföhr, s 55 oben: Rahman hassani / alamy stock Foto, unten: François-olivier dommergues / alamy stock Foto, s 56 guido dingemans / alamy stock Foto; s 58 unten links: Monica Jane Frisell, oben rechts: allison Michael orenstein, unten rechts: Franck Ferville, s 59 oben rechts: aubrey trinniman, oben links: Mambo Cover photo 2020 -M.Rittershaus, mitte: Clara Evens, unten: anoush abrar; s 60 Robert ascroft, s 63 oben: picture alliance / heritage-images | national Jazz archive/ heritage images, mitte: heritage image partnership ltd / alamy stock Foto, unten: Christoph Keller / alamy stock Foto; s 64 - 65 Fernando young, s 66 oben: Cover layout: Rogério duarte / photo: david drew zingg / artwork: liana and paulo tavares, unten: picture alliance / dallE apRF, s 67 oben: picture alliance / assoCiatEd pREss | luiz Ribeiro, unten: daniel dittus; s 68 gesche Jäger; s 70 - 73 gesche Jäger; s 74 - 80 Maximilian probst; s 82 - 83 robertsrob/istockphoto, s 84 - 85 nuture/istockphoto, s 86 - 87 dan hayward/istockphoto; s 88 Kai-uwe gundlach
Redaktionsschluss 13. Juli 2023
Änderungen vorbehalten. nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. printed in germany. alle Rechte vorbehalten.
träger der hamburgMusik ggmbh:
iM p RE ssu M
Die nächste Ausgabe des Elbphilharmonie Magazins erscheint im Dezember 2023.

































juliusbaer.com JULIUS BÄR IST PRINCIPAL SPONSOR DER
SAGT, DASS
EIN BERUF NACH ARBEIT ANFÜHLEN MUSS? Wie wir heute investieren, so leben wir morgen.
WER
SICH











































 VON JULIKA VON WERDER
VON JULIKA VON WERDER




































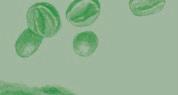












































 FOTOS NIKLAS GRAPATIN
FOTOS NIKLAS GRAPATIN


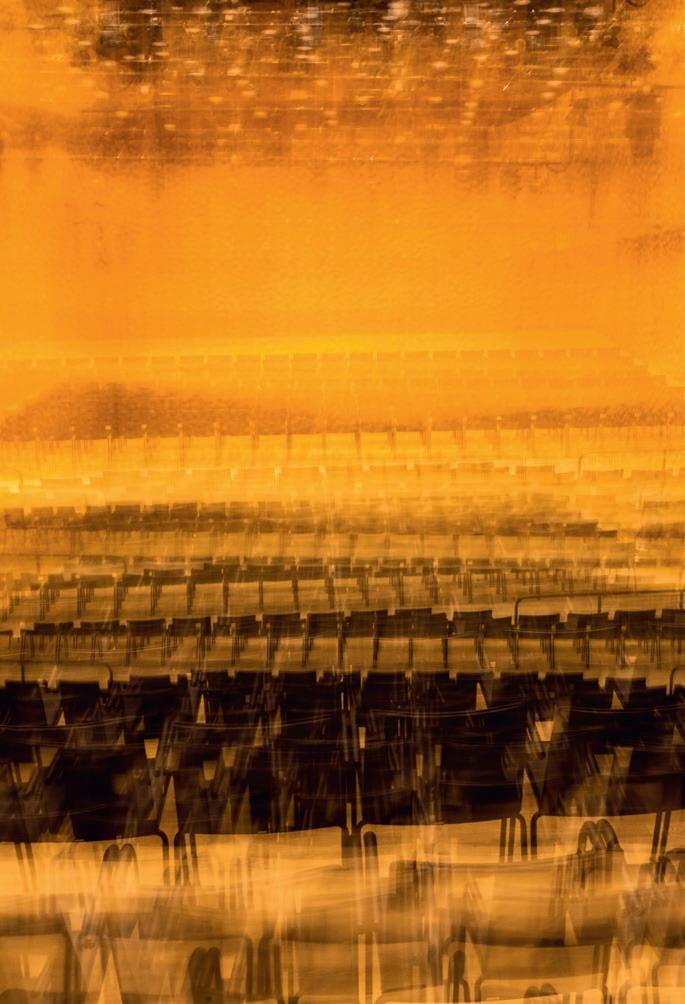























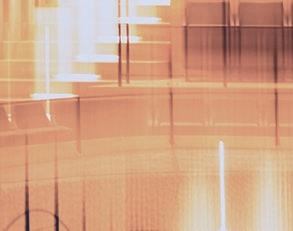
























































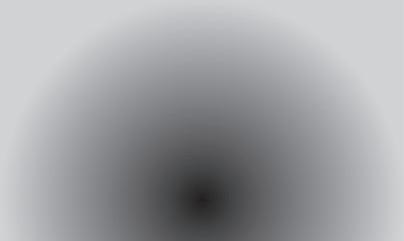

 Eine Zeremonie beim kurdischen Pir-Shalyar-Fest in Uraman, Iran Eine kurdische Hochzeit in Bodschnurd, Iran
Eine Zeremonie beim kurdischen Pir-Shalyar-Fest in Uraman, Iran Eine kurdische Hochzeit in Bodschnurd, Iran

































































 Simone Scholl
Stefan Goldschmidt
Simone Scholl
Stefan Goldschmidt


















































