

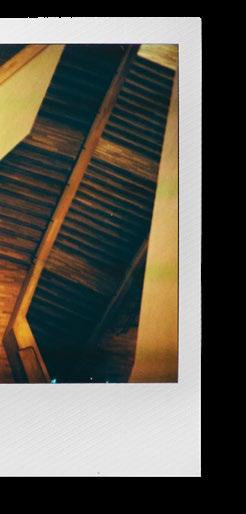
FOKUS CATALUNYA
Musik aus der eigensinnigsten
Ecke Spaniens

90 JAHRE ARVO PÄRT
Der weiße Magier


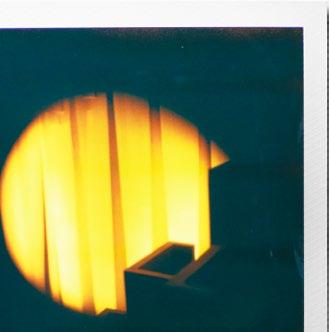





JUGENDORCHESTER
Frisch, motiviert, neugierig




PRINCIPAL SPONSOR DER

juliusbaer.com




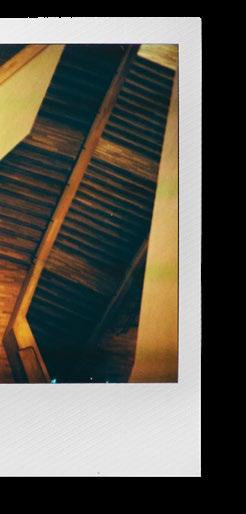
FOKUS CATALUNYA
Musik aus der eigensinnigsten
Ecke Spaniens

90 JAHRE ARVO PÄRT
Der weiße Magier


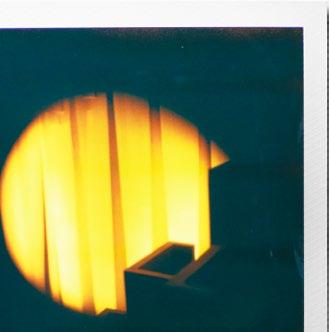





JUGENDORCHESTER
Frisch, motiviert, neugierig




PRINCIPAL SPONSOR DER

juliusbaer.com

Liebe Leserin, lieber Leser,
»Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft.« Dieses schöne und etwas rätselhafte Zitat wird Jean-Paul Sar tre zugeschrieben. Kann man Heimweh nach etwas haben, das noch vor einem liegt? Weil die Zukunft fraglos der Jugend gehört, diese aber noch nicht in ihrem Besitz ist? Oder spielte Sar tre auf die »Kugelgestalt der Zeit« an, wie der Komponist Bernd Alois Zimmermann die metaphysische Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nannte?
Das vorliegende Heft jedenfalls ist der Jugend gewidmet. Die Texte beleuchten facettenreich musikalische Aspekte des Jungseins: von einer historischen Tour d’horizon zu Künstlerinnen und Künstlern, deren frühe Berufung selbst widrige familiäre Umstände überwand (S. 4), über eine Würdigung der europaweiten Nachwuchsreihe Rising Stars (S. 16), bis hin zu dem Versuch, die verblüffend hohe Dichte an exzellenten – und oft sehr jungen –Dirigenten aus Finnland zu erklären (S. 26).
Zu den schönsten Begleiterscheinungen der Musik gehört, dass der ideelle Generationenvertrag in ihr ganz selbstverständlich gelebt wird. Alte und Junge gehen in einem symbiotischen Austausch miteinander um und lernen voneinander. Ihr biologisches Alter spielt eine allenfalls untergeordnete Rolle. Man begegnet schon früh
sehr reifen Musikerinnen und Musikern ebenso zuverlässig wie ihrem Pass nach greisen Komponisten, deren Wachheit, Lebendigkeit und Offenheit gegenüber dem stets Neuen sie ewig jung erscheinen lässt. Deshalb freut es mich besonders, dass gerade in diesem Heft zwei stilistisch sehr unterschiedlichen Grandseigneurs der Neuen Musik tiefgründige Porträts gewidmet sind – Arvo Pärt (S. 32) und Helmut Lachenmann (S. 66).
Natürlich widmet sich diese Ausgabe auch übergeordneten elbphilharmonischen Themen, die in den kommenden Wochen aktuell werden. Zwei Konzerte mit Musik von der Balkanhalbinsel etwa geben Anlass, über die große Kraft musikalischer Herkunft nachzudenken (S. 62), und das Festival »Catalunya« bringt im gewöhnlich grauen Hamburger November mit sieben aufregenden Konzerten Farbe und ein anders geartetes Temperament in die Stadt (S. 54). Der Titel dieser Geschichte bringt die Paradoxie der bereits erwähnten Kugelgestalt der Zeit auf den Begriff: »Ultramoderne Tradition«.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich auf viele Begegnungen mit Jung und Alt!
Ihr
Christoph Lieben-Seutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle
4
MUSIKGESCHICHTE
THAT’S WHAT I WILL DO!
Wie haben große Musiker als Jugendliche ihre Berufung entdeckt?
VON VOLKER HAGEDORN
14
MUSIKLEXIKON
STICHWORT »JUGEND«
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
VON CLEMENS MATUSCHEK
16

RISING STARS
AD ASTRA
Aufstrebende Stars auf den wichtigsten Bühnen Europas
VON DOMINIK BACH
20

JAZZ
DADDYS LIEBLINGSSAXOFONIST
Donny McCaslin leitet die Elbphilharmonie Jazz Academy 2025.
VON TOM R. SCHULZ
26
TARMO PELTOKOSKI
SCHON WIEDER EIN FINNE
Der nächste Jungdirigent aus dem hohen Norden
VON HELMUT MAURÓ
30
UMGEHÖRT
WEGE NACH OBEN
Eine Frage, sieben Antworten
VON IVANA RAJIC ˇ
32
ARVO PÄRT
DER WEIßE MAGIER
Ungemein klangschön, ungeheuer einfach – und doch mehr als einfach nur Schönklang
VON ALBRECHT SELGE
38
FOTOSTRECKE
SCHNELL, SPONTAN, SOFORT VON LOUIS ROTH
52
GLOSSE
SCHÖNE VERSCHWENDUNG
Alle Welt feiert die Jugend, ist aber von Jugendlichen genervt.
VON TILL RAETHER
62
WELTMUSIK
ELEGIE AM BALKAN
Sevdalinka und Rembetiko als melancholische Nationalgenres
VON STEFAN FRANZEN
66

HELMUT LACHENMANN
DER WIDERSPENSTIGE
Reflexion statt Reflex, das ist es, was der Komponist mit seiner Musik auslösen möchte.
VON MICHAEL REBHAHN
70
MITARBEITER
SPRUNGBRETT AM HAFEN
Die Auszubildenden in der Elbphilharmonie übernehmen direkt Verantwortung.
VON FRÄNZ KREMER
74
ENGAGEMENT
WIR SIND FANS
VON CLAUDIA SCHILLER
76
REPORTAGE AM ANFANG
Drei junge Menschen, die ihre ersten Schritte im Musikgeschäft hinter sich haben – und partout nicht davon lassen wollen.
VON STEPHAN BARTELS
88
82 IMPRESSUM
FÖRDERER UND SPONSOREN

46
INTERVIEW
»ICH GLAUBE AN DIE GROßE MELODIE«
Der Singer-Songwriter und Komponist Rufus Wainwright über sein »Dream Requiem« und die Unterschiede zwischen Pop und Oper
VON BJØRN WOLL

10
JUGENDORCHESTER
FRISCH, MOTIVIERT, NEUGIERIG
Hier trainieren die Profis von morgen – zur Freude des Publikums. VON HELMUT MAURÓ

54
FOKUS CATALUNYA ULTRAMODERNE TRADITION
Katalonien ist die eigensinnigste Ecke der iberischen Halbinsel, und das gilt auch für seine Musik –im besten Sinne.
VON STEFAN FRANZEN
Manchen großen Musikern wurde ihr Beruf nicht in die Wiege gelegt. Wie haben sie als Jugendliche trotzdem ihre Berufung entdeckt?
VON VOLKER HAGEDORN
Bach und Mozart und etliche andere Größen der Tonkunst hatten es gewissermaßen leicht: Ihnen blieb kaum etwas anderes übrig, als Musiker zu werden, sie wurden ins Metier hineingeboren. Das heißt nicht, dass alle Kinder von Komponisten, Sängern, Instrumentalisten in dieser Spur bleiben, aber die meisten Karrieren der Klassik beginnen bis heute doch in musikalischen, mindestens klassikaffinen Familien, in denen man sich kaum vorstellen kann, wie es ist, wenn der einzige Fetzen Oper, den ein Kind hört, vom Fernsehhasen Bugs Bunny dirigiert wird, ohne dass das Kind oder seine Eltern wüssten, dass es sich dabei um eine Arie von Rossini handelt und was genau eigentlich eine Oper ist.
So war es bei Charles Castronovo, einem der heute führenden lyrischen Tenöre seiner Generation (er wurde 1975 geboren), und er befindet sich damit in bester Gesellschaft. Ob Gustav Mahler oder Sofia Gubaidulina oder Sängerinnen von Birgit Nilsson bis Lise Davidsen – ihnen allen wurde ihr Beruf nicht gerade in die Wiege gelegt. Wie entdecken solche »Quereinsteiger« als Kinder und Jugendliche ihr Talent, ihre Berufung? Unter welchen gesellschaftlichen Umständen beginnen sie ihren Weg zur Musik?
Charles Castronovo wuchs, wie er erzählt, »nicht in der besten Gegend«, am Rand von Los Angeles auf. Seine Eltern hatten sich blutjung in New York kennengelernt, die Mutter kam aus Ecuador und war bei seiner Geburt 19 Jahre alt; der Vater, ein Sohn sizilianischer Einwanderer, arbeitete als Gabelstaplerfahrer. Als Siebenjähriger
erlebte Charles, wie auf einen 14-jährigen Nachbarsjungen geschossen wurde, drei Meter von ihm entfernt, drei Schüsse, der Junge brach zusammen. Er hat das alles gestochen scharf vor sich, wie gefilmt, er wird es nie vergessen. Ebenso wenig aber die Entdeckung, die ihn zum Opernsänger machte.
Charles sang gut und gern, er wollte Rockstar werden. Eine Gitarre und eine Band hatte er bald, »aber ich hatte nicht diesen Sound für Rock, die Stimme war zu sauber«. Eben das war aber im Schulchor willkommen, dort durfte er auch Soli singen. Darum gab ihm der Vater eines Freundes, ein aus Bologna eingewanderter Opernfan, ein paar CDs. Charles hörte den Anfang von »Otello«: »Ich konnte es nicht glauben, das war so … booaa, you know!« Und dann Plácido Domingo: »Ich hab’s gehört, ich hab’s gefühlt, und ich hab gesagt: That’s what I will do!« Für den 16-Jährigen war Oper wie Rock’n’Roll. Lag das Singen in der DNA der Familie? »Nein. Wenn Sie hören würden, wie der sizilianische Teil meiner Familie spricht …« Charles gibt raue, röchelnde Laute von sich. »Es klingt wie ein Mafiafilm. Da kann keiner singen.«
Der Schulchor spielt keine geringe Rolle bei diesem Werdegang, wie auch in anderen Sängerkarrieren. Camilla Nylund, Tochter einer Hebamme und eines Technikers im finnischen Vaasa, verdankt einem umtriebigen Musiklehrer am Gymnasium ihren ersten Soloauftritt im Musical »Jesus Christ Superstar«. Lise Davidsen aus dem norwegischen Städtchen Stokke, in deren Familie man vorzugs-





Lise Davidsen, Camilla Nylund, Birgit Nilsson und Maria Agresta
weise Handball spielte, entdeckte im Schulchor Bach und wurde erst mal Barocksängerin, ehe sie zu Wagner durchstartete. Die Verdi-Expertin Maria Agresta sang als Zwölfjährige im Kirchenchor eines süditalienischen Städtchens, als ein Lehrer ihr sagte: »Du könntest Opernsängerin werden.«
Das wurde freilich schon vielen prophezeit, und nicht immer waren die Eltern begeistert. Die Jahrhundertsängerin Birgit Nilsson, 1918 als Bauerntochter in einem südschwedischen Dorf geboren, durfte zwar schon als Kind mit ihrer schönen Stimme die Gäste erfreuen und mit 15 Jahren Gesangsunterricht nehmen, aber für ihren Vater stand fest, dass sie in der Landwirtschaft arbeiten sollte. Nur mit großer Entschlossenheit schaffte sie es, an die Königliche Musik-Akademie Stockholm zu kommen. Als
ihr Vater sie später erstmals als Tosca auf der Bühne erlebte, sagte er zu seinen Nachbarn im Parkett: »Für die brauchen Sie nicht zu klatschen, das ist doch nur meine Tochter.«
Weitaus schwieriger war es für hochbegabte Mädchen im Jahrhundert davor. Klavierunterricht war in ihren wohlhabenden Familien selbstverständlich, doch danach war Schluss. Seiner 14-jährigen Tochter Fanny schreibt Abraham Mendelssohn 1820: »Die Musik wird für ihn (den Bruder Felix, Anm.) vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde (…) werden kann und soll.« Ähnlich sah es in den 1870ern der britische Generalmajor John Henry Smyth. Als seine 17-jährige Tochter äußerte, sie wolle Komposition studieren, brüllte er: »Lieber sehe ich dich unterm Gras!« Ethel Smyth erzwang sich mit einem Hungerstreik den Weg ans Leipziger Konservatorium, aber um Anerkennung musste sie ihr Leben lang kämpfen.
EIN OFFENER FLÜGEL
Besonders spannend sind die ersten Schritte bei Sofia Gubaidulina, der ersten Komponistin, die zu Lebzeiten wirklich Weltruhm errang (sie starb am 13. März dieses Jahres in Appen bei Hamburg, wo sie seit 1992 gelebt hatte). In ärmlichen Verhältnissen wurde sie 1931 in der Tatarischen Autonomen Sowjetrepublik geboren. Sofias Vater war Landvermesser, ihre Mutter Lehrerin, man lebte im Wohnblock in der Hauptstadt Kasan, »doch wir hatten einen Flügel, und diese Tatsache, dass es ein Flügel war und kein

einfaches Klavier, entschied mein ganzes Leben«, erzählte Gubaidulina 2011. »Den Flügel konnten wir nämlich öffnen und dabei die Saiten berühren. Meine Schwester trat die Pedale, ich strich über die Saiten und spürte, dass etwas unglaublich Artistisches passierte. Diese intensive Erfahrung hat mich bereits geprägt, bevor ich Kontakt mit ›wirklicher‹ Musik hatte.«
Diese Musik ließ aber auf sich warten, obwohl Sofia schon mit fünf Jahren Klavierunterricht an der Musikschule bekam. Ihre Lehrerin hatte nur Kinderstücke unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Die fand Sofia langweilig. »Ich war damals ziemlich naiv und wusste noch nicht, dass neben all diesen Kinderliedern auch eine ganz andere klangliche, große Musikwelt existiert. (…) Ich verspürte die dringende innere Notwendigkeit, selbst etwas zu schreiben, um weitere Noten zum Musizieren zur Verfügung zu haben. Mit sieben Jahren habe ich dann Mozart und Haydn kennengelernt und gemerkt, dass bereits schöne Musik existiert. Aber da war ich mit dem Komponieren schon infiziert.« Die ganz besondere Autarkie, die sie dabei erwarb, hat es der Komponistin in der Sowjetunion dann nicht leicht gemacht, sie aber umso weiter gebracht.
EIN STUMMES KLAVIER
Sofia Gubaidulina strich über die Saiten eines offenen Flügels und spürte »etwas unglaublich Artistisches«.
Für ihre südkoreanische Kollegin Younghi Pagh-Paan, 1945 in Cheongju geboren, gab es lange kein Klavier. Als zweitjüngstes von zehn Kindern sang sie schon als Fünfjährige für ihren Vater, einen Ingenieur, der untröstlich war über den Verlust eines 17-jährigen Sohnes im Koreakrieg. »Er hat getrauert und jeden Tag getrunken, und dann war die Leber kaputt.« Er starb, als sie elf war; die Mutter brachte als Näherin die Familie durch. Für den verlorenen Vater sang Younghi nun »innerlich, ohne Ton«, das sieht sie als Beginn ihres Komponierens. Und sie lernte Klavierspielen bei einem Schullehrer. Üben konnte sie nur morgens, inoffiziell in der Schule. »Der Hausmeister hat ein Fenster hochgeschoben, damit ich reinklettern konnte.«
Sie lernte Noten lesen und schreiben, auf Notenpapier, das ihre ältere Schwester für sie anfertigte, und notierte sich Melodien aus dem Radio. Eine Papierklaviatur bastelte sie sich, zum stummen Üben und Ersinnen eigener Musik. »Mir die Klänge vorzustellen, das war eine wunderschöne Erfahrung. Da war ich total mit meinem Vater zusammen.« Aber von da bis zum Kompositionsstudium zuerst in Seoul, dann mithilfe eines Stipendiums 8.500 Kilometer weiter westlich in Freiburg – das allein war ein gewaltiger Weg. Er führte 1979 zum ersten Auftrag für ein Orchesterwerk, den je eine Komponistin für die Donaueschinger Musiktage erhielt; 1999 wurde Younghi PaghPaan – ebenfalls ein Novum in Deutschland – Kompositionsprofessorin in Bremen. Was auf diesem Weg nicht wenig half: »Meine Mutter und mein Vater haben mich nie unterdrückt.«
Auch ihr jüngerer Freiburger Kommilitone Wolfgang Rihm kam aus einer »klavierlosen« Familie. Die Mutter war gelernte Modezeichnerin und Hausfrau, der Vater Angestellter beim Roten Kreuz in Karlsruhe. Keine Bildungsbürger, aber sonntags wurde die Kunsthalle besucht. »Der Vierjährige zeichnete, malte und wünschte sich einen Ölfarbkasten, den er prompt bekam. Verlangte nach Musik und erhielt zum fünften Geburtstag die Blockflöte, mit acht Jahren dann ein Klavier, das budgetsprengend hundert Mark kostete und von der Großmutter finanziert wurde. Kaum hatte er gelernt, einen Ton an den anderen zu reihen, dachte er sich eigene Musikstücke aus.« So liest man es in Eleonore Bünings Buch »Über die Linie«. Rihm erinnert sich dort: »Meine Eltern haben mich immer sehr gefördert in dem, was ich wollte.«
Younghi Pagh-Paan bastelte sich eine Papierklaviatur. »Mir die Klänge vorzustellen, das war eine wunderschöne Erfahrung.«

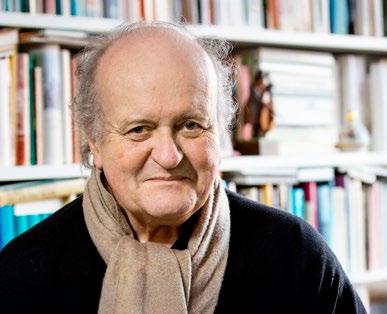
Frühes Singen im Chor spielte übrigens auch für Rihm eine große Rolle. Er war zwölf Jahre alt, als er in Karlsruhe im »Requiem« von Hector Berlioz mitsingen durfte. Damit begann bei ihm, wie er sagt, »eine tiefe Liebe zur französischen Musik« und zu Berlioz, einem der drei besonders innovativen Autodidakten, die im 19. Jahrhundert zur Welt kamen – nach ihm dann Richard Wagner und Arnold Schönberg. Berlioz stammte aus keinem musikfernen Milieu; sein Vater, ein Arzt in der Provinz, brachte dem kleinen Hector sogar die Flötentöne bei, im wörtlichen Sinne, und das Notenlesen. Doch den 18-Jährigen, der längst komponierte, nötigte er zum Medizinstudium in Paris. Als Hector es abbrach, wurden die Mittel gekürzt; sein Vater verzieh ihm nie, dass er Komponist wurde und nicht Arzt.


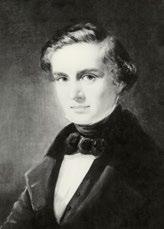

Richard Wagner, als Stiefsohn eines Schauspielers in Dresden aufgewachsen, fand auf Umwegen zur Musik; seine ersten Kompositionsversuche mit 17, 18 Jahren waren die eines unbeholfenen Spätentwicklers. Ein Start, der umgekehrt proportional zum ungeheuren Einfluss steht, den Wagners Musikdramen später hatten. Arnold Schönberg, Sohn eines Schuhwarenhändlers in Wien, begann mit acht Jahren zu komponieren. Als 16-Jähriger musste er aus familiären Gründen die Schule abbrechen und wurde Volontär bei einer Bank, wo er die Papiere mit Noten vollkritzelte … Eine Folge der Startsituationen von Berlioz, Wagner, Schönberg: Keiner von ihnen konnte jemals richtig Klavier spielen.
So hätte es auch bei Gustav Mahler sein können. Es gab Anfang der 1860er kein Klavier im Haus des Schnapsbrenners Bernhard Mahler im mährischen Iglau. Was Gustav an Musik hörte, kam von fahrenden Musikanten, Tanzkapellen und der Militärkapelle der Garnisonsstadt. Schon der Vierjährige lief ihr hinterher, die kleine Ziehharmonika um den Hals, die man ihm geschenkt hatte. Er war in der Lage, die Märsche nachzuspielen. So schaute man sich doch nach einem Klavier um und wurde bei den Großeltern in Ledetsch fündig. Gustav gelang es gleich, »den Tasten Zusammenhängendes zu entlocken«, wie der MahlerBiograf Jens Malte Fischer schreibt, und das Instrument wurde auf dem Ochsenkarren nach Iglau geschafft. Gustav bekam Klavierunterricht, und er schrieb 1866, mit sechs Jahren, sein erstes Stück: eine Polka mit einem Trauermarsch davor. Bezeichnend, wenn man bedenkt, welche Rolle die »Trivialmusik« später in Mahlers Sinfonien spielt. Die Fünfte etwa beginnt mit einem Trauermarsch und einer Trompetenfanfare, die an den »Generalmarsch« der k.u.k.-Armee erinnert, den Mahler seit Kindertagen kannte.
AUFMERKSAME LEHRER
Mahlers Weg an die Spitze der musikalischen Welt verdankt sich auch den Institutionen der Ausbildung. Er studierte bereits Musik in Wien, ehe er in Iglau sein Abitur machte. Als Berlioz noch Schädel in der Anatomie zersägen musste, kopierte er schon Partituren im Pariser Konservatorium. Charles Castronovo und vielen anderen gelang der Sprung in die internationale Szene durch das »Young Artist Development Program« der Metropolitan Opera in New York. Besonders die Rolle aufmerksamer Schullehrer ist aber bis heute kaum zu über schätzen – sofern die Musik noch auf dem Lehrplan steht. 23.000 Musiklehrerstellen an deutschen Grundschulen sind derzeit unbesetzt.
Es ist heute unvorstellbar, wie viel Musikunterricht Kinder im Thüringen des späten 17. Jahrhunderts hatten, und damit wären wir doch bei Johann Sebastian Bach. Es bestand Schulpflicht für Mädchen und Jungen, die vier Hauptfächer merkte man sich so: »Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen / muss man aus der Schule bringen.« Natürlich lernte der kleine J. S. in seiner Familie, die nur aus Musikern bestand, noch weitaus mehr, aber der gesellschaftliche Stellenwert der Tonkunst rangierte ohnehin weit über »Nebenfach«. Am Lyzeum in Ohrdruf, das Bach bis 1700 besuchte, galten von 30 Unterrichtsstunden nicht weniger als fünf der Musik. Dazu kam noch der Schülerchor, die Kurrende, mit mindestens einem (bezahlten!) Auftritt pro Woche. Bach ist und bleibt ein Wunder. Aber in jedem Wunder spiegelt sich immer auch die Gesellschaft, in der es möglich wird.
Was der junge Gustav Mahler an Musik hörte, kam von fahrenden Musikanten, Tanzkapellen und der Militärkapelle.


Concertgebouworkest Young
In zahlreichen Jugendorchestern trainieren die Profis von morgen –zur Freude des Publikums.
VON HELMUT MAURÓ
Zumindest für die Musik gab es sie, die guten alten Zeiten, als in jedem besseren Haushalt ein Klavier stand, das auch gespielt wurde. Als viele Kinder früh ein Instrument lernten und es bis zur Pubertät so weit brachten, dass sie auch Lust hatten, weiterzumachen, oft ein Leben lang, selbst wenn sie dann ganz andere Berufe ergriffen als den des Musikers.
Heute ist das etwas anders. In den wenigsten Haushalten steht ein Klavier, die wenigsten Jugendlichen beherrschen ein Instrument, und wenn man sich die Studentenzahlen der Hochschulen ansieht, so sind die landeseigenen Bewerber rar geworden. Das haben schon vor etwa zwanzig Jahren
auch die großen Orchester festgestellt, die auf guten Nachwuchs angewiesen sind, wenn sie ihre Stellung in der internationalen Konkurrenz behaupten wollen. Es war auch klar, dass Hochschulabsolventen nicht von heute auf morgen für einen Bühnenauftritt infrage kommen. Sie müssen am spezifischen Klang des Orchesters geschult und künstlerisch integriert werden, sich auch sozial verträglich einfinden. Auf Tourneen geht es sehr familiär zu, und auch im laufenden Betrieb zu Hause ist es wichtig, dass sich alle unbedingt aufeinander verlassen können.
Es lag also nahe, dass die großen Orchester ihren eigenen Nachwuchs ausbilden; mittlerweile betreiben die meisten von ihnen entsprechende Orchesterakademien mit strengen Aufnahmeprüfungen (s. S. 72, Mitarbeiter). Andere arbeiten eng mit Jugendorchestern zusammen, etwa die Sächsische Staatskapelle Dresden mit dem 1986 von Claudio Abbado in Wien gegründeten Gustav Mahler Jugendorchester oder die Berliner Philharmoniker mit dem deutschen Bundesjugendorchester (BJO). Letzteres wurde 1969 als Projekt des Deutschen Musikrats ins Leben gerufen, um rund hundert Nachwuchsmusikerinnen und -musiker sowie Preisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert in ihrem Bestreben nach einer professionellen Laufbahn zu unterstützen. Schon früh haben sich pro minente Dirigenten für das Orchester engagiert und mit ihm gearbeitet, darunter Herbert von Karajan, Kurt Masur, Gerd Albrecht, Steven Sloane, Kirill Petrenko und Simon Rattle.

Heute spielt das Bundesjugendorchester 25 Konzerte im Jahr, eines davon stets auch in der Elbphilharmonie, zuletzt im vergangenen Januar. Auch im Ausland ist man dank der Förderung durch den Bund unterwegs, in London, Birmingham, Edinburgh, Wien, Amsterdam, in den Jahren vor Corona sogar in Südafrika, Indien, China, Tunesien, der Ukraine. Dieses Jahr gibt es ein Campus-Projekt gemeinsam mit nigerianischen Musikern in Lagos und Bonn, dem Sitz des BJO. Die Tourneen werden in drei großen Arbeitsphasen vorbereitet, die immerhin zwischen 20 und 35 Tage dauern. Zehn davon sind für Proben mit erfahrenen Orchester musikern vorgesehen, die mit den einzelnen Stimmgruppen arbeiten, bevor der Dirigent auf den Plan tritt und es schließlich mit diesem und den Solisten in zwei großen Reisebussen losgeht. Zwei 40-Tonner transportieren die Instrumente und sonstige Ausrüstung, auch eigene Orchesterwarte fahren mit.

Karajan, Masur, Petrenko, Rattle –sie alle haben das BJO dirigiert.
Man kann sich also vorstellen, wie begehrt die Plätze im Bundesjugendorchester sind. Jedes Jahr kommen nach einem strengen Probespiel rund 25 neue Musikerinnen und Musiker im Alter ab 14 Jahren dazu – es soll keinen Generationsbruch geben –, entsprechend viele gehen mit 19 Jahren ab und beginnen ihr Studium. Mehr als achtzig Prozent der Orchestermitglieder machen die Musik später tatsächlich zu ihrem Beruf, viele in hochrenommierten Orchestern wie den Berliner Philharmonikern und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Andere Ehemalige gründen eigene Ensembles wie das längst etablierte Freiburger Barockorchester und das experimentierfreudige Ensemble Resonanz.
Auch die Junge Deutsche Philhar monie ist ein solcher Ableger des BJO (aus der später wiederum die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen her vorging). »Im Falle der Jungen Deutschen Philharmonie waren das Leute aus dem Bundesjugendorchester, die 1974, als sie das Höchstalter erreicht hatten, nicht auseinandergehen wollten«, sagt Sönke Lentz, der Direktor des BJO und Bereichsleiter für den musikalischen Profinachwuchs beim Deutschen Musikrat. »Die sagten sich:
Dann gründen wir eben das Bundesstudentenorchester.« So hieß es anfangs auch. Aber wie im BJO gilt auch hier: Irgendwann ist Schluss, mit dem Ende des Studiums ist für die Nachwuchsmusiker auch das Engagement in der Jungen Deutschen Philharmonie beendet.
»Das BJO ist aber nur die Spitze einer großen Pyramide«, sagt Sönke Lentz. »Ebenso wichtig ist die Arbeit der Landesjugendorchester und der vielfältigen Ensembles wie den Schulund Musikschulorchestern, den städtischen Jugendensembles, den musikalischen Kreis- und Landesorganisationen.« Allein im Raum Hamburg sind mehrere hundert Kinder und Jugendliche in Orchestern aktiv, in der Jungen Norddeutschen Philharmonie, im Jugend-Sinfonieorchester




Ahrensburg, im NDR Jugendsinfonieorchester, dem Felix Mendelssohn Jugendorchester oder in Schulorchestern wie dem des Albert Schweitzer Gymnasiums. »Hier wird großartige Arbeit geleistet«, sagt Lentz, »die aber wegen Schulzeitverkürzung, fehlender Musiklehrer und auch eines bedauerlichen Musikschulsterbens immer stärker unter Druck gerät.«
Es mangelt also nicht unbedingt an Geld – und schon gar nicht an Engagement bekannter Größen der Musikwelt, die sich für den Nachwuchs begeistern. Bestes Beispiel: Simon Rattle, der als Dirigent nicht nur mit seinen BR-Symphonikern und hochrangigen Ensembles wie dem Chamber Orchestra of Europe unterwegs ist, sondern sich auch regelmäßig der Jugend widmet, demnächst etwa dem National Youth Orchestra of Venezuela. Venezuela ist ein Sonderfall, was professionelle musikalische Jugendarbeit betrifft. Es gibt zahlreiche Kinder- und Jugendorchester in inzwischen mehr als 400 Musikzentren mit rund 700.000 jungen Musikern, zusammengefasst in dem Netzwerk El Sistema, das 1975 von dem Pädagogen, Komponisten und Sozialaktivisten José Antonio Abreu in Caracas gegründet wurde. Dieses System ist weltweit einzigartig und hat ähnliche Initiativen in mehr als sechzig Ländern angestoßen, etwa das brasilianische Neojiba Orquestra da Bahia, das im vergangenen Mai in der Elbphilharmonie gastierte.
International berühmt geworden ist das Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, das lange Zeit von Gustavo Dudamel geleitet wurde, der hier seine internationale Dirigentenkarriere begann. El Sistema ist vollständig staatlich finanziert, und weil es nicht dem Kulturministerium, sondern dem Sozialministerium zugeordnet ist, muss es auch nicht mit Etatkürzungen rechnen. Das vorrangig soziale Engagement der Organisation ist vom politischen kaum zu trennen, gleichwohl stehen die Kinder und Jugend lichen im Mittelpunkt, denen eine Chance zu sozialem Aufstieg gegeben wird.
Anders als etwa im Bundesjugendorchester müssen die jungen Musiker auch nicht mit 19 Jahren weiterziehen; vielmehr altert das gesamte Orchester gemeinsam, und es wird ein neues Nachwuchsorchester gegründet, zuletzt eben das National Youth Orchestra of Venezuela, mit dem nun Simon Rattle auf Tournee geht. Das ist natürlich sinnvoll, wenn nach dem altersbedingten Ausstieg aus einem Jugendorchester die Arbeitslosigkeit drohen würde; tatsächlich ist gerade die soziale Komponente für viele Jugendorchester weltweit ein wichtiger Faktor.
Allein im Raum
Hamburg sind
Hunderte Kinder in Orchestern aktiv.
Das war einst auch in Europa nicht anders, wo der Gedanke, Musik mit sozialem Engagement zu verbinden, schon früh aufkam, konkret im Venedig des späten 17. Jahrhunderts. In den vier ospedali, den bereits im Mittelalter gegründeten venezianischen Waisenhäusern für Mädchen (verwaiste Knaben wurden früh zur Arbeit herangezogen), entstanden im Laufe der Zeit Ensembles, Orchester und Chöre der Insassinnen, die in den sonntäglichen Messen, aber auch in eigenen Konzerten auftraten und so zum Unterhalt ihrer Organisationen beitrugen.
Andernorts hießen vergleichbare Einrichtungen conservatorio – der Name blieb in seiner musikbezogenen Bedeutung bis heute erhalten. Das dahinterstehende Prinzip würde man heute vielleicht als Ausbeutung Abhängiger einschätzen, aber man kann es auch so sehen: Wenn Notleidende sich zu großen Teilen selbst helfen können, retten sie sich in ihrem Elend einen Rest von Stolz und Menschenwürde.
Der berühmteste Musiklehrer der venezianischen ospedali ist sicherlich Antonio Vivaldi. Mit ihm als Geigen-, Cello- und Gambenlehrer, Ensembleleiter und Komponist erlangte das Orchester des Ospedale della Pietà ab 1703 einen legendären Ruf und lockte zahlreiche Italien-
reisende an. Allein dreißig seiner Violinkonzerte sind für eine seiner Schülerinnen dort entstanden. Aber auch andere Komponisten lieferten für die ospedali Musik. Der Hamburger Johann Adolph Hasse etwa komponierte um 1740 für das Ospedale degli Incurabili sein Oratorium »Serpentes ignei in deserto«, das unlängst in einer bemerkenswerten Neuaufnahme erschienen ist. Man hört schnell, welch hohes Niveau die jungen Musikerinnen der ospedali erreicht hatten.
In diesem Punkt müssen sich freilich auch die modernen Jugendorchester nicht verstecken, im Gegenteil. Oft klingen sie frischer, motivierter, neugieriger als die alten Hasen der großen Sinfonieorchester. Und wenn es einem Dirigenten gelingt, den jugendlichen Elan sanft zu ordnen, dann kann das Publikum mit diesen jungen Orchestern wirklich mitreißende, erfüllende, inspirierende Abende erleben.

CONCERTGEBOUWORKEST YOUNG
Do, 21.8.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Julia hagen (cello), elim chan (dirigentin) elizabeth ogonek: Moondog; edward elgar: cellokonzert; dmitri schostakowitsch: sinfonie nr. 5
GUSTAV MAHLER JUGENDORCHESTER
Mi, 27.8.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal renaud capuçon (Violine) Manfred honeck (dirigent) erich Wolfgang korngold: Violinkonzert; Piotr tschaikowsky: sinfonie nr. 5
TURKISH NATIONAL YOUTH PHILHARMONIC ORCHESTRA
Di, 2.9.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
ilyun Bürkev (klavier)
cem Mansur (dirigent)
Benjamin Britten: Four sea interludes aus »Peter grimes«; edvard grieg: klavierkonzert; cem esen: sarcasm; Ludwig van Beethoven: sinfonie nr. 5
JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE
Mi, 1.10.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Vivi Vassileva (schlagwerk) stanislav kochanovsky (dirigent) Avner dorman: Frozen in time / konzert für schlagzeug und orchester; dmitri schostakowitsch: sinfonie nr. 11
NATIONAL YOUTH ORCHESTRA OF VENEZUELA
Mi, 3.12.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal simon rattle (dirigent) george gershwin: cuban overture; samuel Barber: Adagio for strings; Leonard Bernstein: symphonic dances aus »West side story«; gustav Mahler: sinfonie nr. 1
JUGEND-SINFONIE ORCHESTER
AHRENSBURG
Sa, 20.12.2025 | 19:30 Uhr
Laeiszhalle Großer Saal
Polizeichor hamburg, kinderchor cantemus Weihnachtskonzert
NDR JUGENDSINFONIE ORCHESTER
Mi, 11.3.2026 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
stefan geiger (dirigent) edward elgar: enigma-Variationen; Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte. Diesmal …
VON CLEMENS MATUSCHEK ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

BENJAMIN BRITTEN: THE YOUNG PERSON’S GUIDE TO THE ORCHESTRA
Heutzutage ist musikalische Bildung unter dem Stichwort »Education« in aller Munde. Doch das war nicht immer so. Maßgeschneiderte Stücke für den Instrumentalunterricht gab es natürlich, aber erst im 20. Jahrhundert kam die Idee auf, auch bis dato kunstferne Kinder und Jugendliche durch entsprechende Werke mit dem klassischen Sinfonieorchester vertraut zu machen. War Camille Saint-Saëns sein »Karneval der Tiere« (1886) noch furchtbar peinlich, gingen Sergej Prokofjew (»Peter und der Wolf«, 1936) und Benjamin Britten (»The Young Person’s Guide«, 1946) in ihrer pädagogischen Mission geradezu auf. Britten, der sich auch durch sein »War Requiem« und Auftritte in befreiten Konzentrationslagern als großer Humanist zeigte, verzichtete dabei auf eine kindgerechte Story und setzte ganz auf die Kraft der Musik, indem er ein Thema seines barocken Landsmanns Henry Purcell nacheinander von allen Instrumenten spielen lässt und raffiniert variiert.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: EIN SOMMERNACHTSTRAUM
Auf den ersten Blick wirkt William Shakespeares »Ein Sommernachtstraum« wie ein entgleister Ausflug ins Schullandheim. Nachts sind alle Katzen grau, jeder knutscht mit jedem herum, bewusstseinserweiternde Drogen sind auch im Spiel. Gleich vier Paare finden zueinander, überschäumende Hormone erwecken eifernde Leidenschaft und leidenschaftliche Eifersucht, Elfen und Kobolde hopsen durchs Bild, sogar ein Esel ist mit von der Partie. Und zum Abschluss muss auch noch ein Amateur-Theaterstück aufgeführt werden. Kein Wunder, dass diese traumspielhafte erotische Komödie – gerade frisch ins Deutsche übersetzt –die Fantasie des 17-jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy anregte. Zum Abschluss seiner Lehrzeit warf er 1826 mit der Konzertouvertüre einen der größten Hits der Orchesterliteratur aufs Papier. Robert Schumann war begeistert: »Das ist ein Necken und Scherzen in den Instrumenten, als spielten die Elfen selbst.«
CARL PHILIPP EMANUEL BACH: PREU ẞ ISCHE SONATEN
Irgendwann kommt bei jeder und jedem der Punkt, an dem man gegen die Eltern rebelliert und den eigenen Stil findet. In der Jugend, manchmal auch erst später. Beispielhaft zu besichtigen in der Musikerfamilie Bach: Filius Carl Philipp Emanuel brauchte ein bisschen, um sich von Vater Johann Sebastians Legendenstatus und seinen mathematisch konstruierten Fugen allein zur Ehre Gottes zu emanzipieren. Erst als er als Cembalo-Begleiter des flötenden Königs Friedrichs des Großen finanziell auf sicheren eigenen Beinen stand, wagte er 1742 den Bruch in Form seiner »Preußischen Sonaten« mit spätpubertär wechselhaften emotionalen Extremen. Was heute recht gesittet anmutet, war damals purer Punk: Die Sturm-und-DrangJugend übernahm, das ondulierte Zeitalter des Barock hatte ausgedient.


SERGEJ RACHMANINOW: SINFONISCHE TÄNZE
Obwohl er einer der meistgefeierten Komponisten und Pianisten des 20. Jahrhunderts war, sehnte sich Sergej Rachmaninow praktisch sein ganzes Leben lang in das Russland seiner Jugend zurück. Doch das war aus mehreren Gründen unmöglich: Ein elterliches Gut ging früh pleite, ein anderes wurde nach der Oktoberrevolution von der Kommunistischen Partei konfisziert; zwei Weltkriege trieben ihn in wechselnde Exile nach New York, in die Schweiz und nach Los Angeles; in die Sowjetunion mochte er keinen Fuß mehr setzen. Zum Ausgleich umgab er sich fast nur mit Russen; Englisch lernte er nie so recht. In seinem letzten Werk, den »Sinfonischen Tänzen« von 1940, blickt er durchaus sentimental zurück auf sein bewegtes Leben. Musikalisch spiegelt sich das in etlichen Selbstzitaten, eingebunden in sein unwiderstehliches Idiom mit Taschentuch-Schnäuz-Garantie. Merke: Die Erinnerung an die Jugend ist die Heimat im Herzen.
LUDWIG VAN BEETHOVEN: MONDSCHEINSONATE

Gut 750 junge Musikerinnen und Musiker nehmen jedes Jahr in Hamburg am Regionalwettbewerb »Jugend musiziert« teil, bundesweit sind es mehr als 15.000. Jeweils etwa die Hälfte wird zur nächsten Stufe auf Landesebene weitergeleitet, von ihnen die Hälfte zum prestigeträchtigen Bundeswettbewerb. Praktisch alle heutigen Profis sind hier mit Preisen ausgezeichnet worden. Das mit Abstand meistgespielte Wettbewerbsstück, geschuldet den traditionell hohen Teilnehmerzahlen im Fach Klavier: der erste Satz aus Beethovens »Mondscheinsonate«. Vermutlich können sich Jugendliche mit den hyperromantischen Klängen besonders gut identifizieren. Bei Franz Liszt wären sie damit nicht durchgekommen; er hielt die Sonate für zu anspruchsvoll, um sie von Schülern verhunzen zu lassen. Beethoven selbst war ohnehin genervt von ihrer Popularität: »Immer spricht man von der cis-Moll Sonate! Ich habe doch wahrhaftig Besseres geschrieben.«
ROBERT JOHNSON: ME AND THE DEVIL BLUES Als mittelmäßiger Blues-Musiker verließ der gerade volljährige Robert Johnson 1931 sein Heimatdorf am Mississippi, nur um kurz darauf als Gitarrenvirtuose und gewiefter Songwriter zurückzukehren. Es gab nur eine Erklärung: Im Tausch musste er seine Seele dem Teufel verkauft haben, »at the crossroads«, an jener metaphorischen Kreuzung, an der sich junge Menschen für ihren künftigen Lebensweg entscheiden. Er selbst befeuerte diese Legende genüsslich, unter anderem in Songs wie dem »Me and the Devil Blues«. Dass er mit nur 27 Jahren unter ungeklärten Umständen verstarb, passte auch ins Bild. Dennoch dauerte es Jahrzehnte, bis seine Weiterentwicklung des Delta Blues ein breites Publikum fand –und begeisterte Fans wie Keith Richards, Eric Clapton und Bob Dylan. Heute gilt jeder einzelne seiner insgesamt nur 29 Songs als tausendfach gecoverter Klassiker und seine einzigen beiden Fotos als stilprägend für alle Blueser, ob mit oder ohne Teufelspakt.
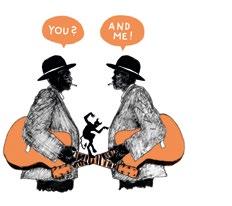
TOCOTRONIC: ICH MÖCHTE TEIL EINER JUGENDBEWEGUNG SEIN
»Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möcht mich auf euch verlassen können, lärmend mit euch durch die Straßen rennen. Und jede unserer Handbewegungen hat einen besonderen Sinn, weil wir eine Bewegung sind.« Wohl jeder, der mal jung gewesen ist, kann sich an die Sehnsucht erinnern, die aus diesen Zeilen spricht, an die Utopie, Teil eines Größeren zu sein, einen Sinn zu haben, Codes, Gleichgesinnte. Tja. 1995, als die Hamburger Band Tocotronic den Song herausbrachte, war der ahnungsvoll beschworene Geist der 68er längst verflogen und allgegenwärtigem Kommerz gewichen – da konnte sich der Diskurspop der »Hamburger Schule« mit seinen betont rohen Sounds und Feuilleton-kompatiblen Texten noch so auflehnen. Die notwendige Brechung des vermeintlichen Pathos lieferten die großen Jungs um Frontmann Dirk von Lowtzow im B-Teil des Songs gleich mit: »Jetzt müssen wir wieder in den Übungsraum. Oh Mann, ich hab überhaupt keinen Bock.«


Seit 30 Jahren bringt das »Rising Stars«-Programm aufstrebende Musikerinnen und Musiker auf die wichtigsten Bühnen Europas.
Es ist so ähnlich wie im Sport, wo die großen Clubs permanent nach jungen Talenten Ausschau halten und diese frühzeitig fördern, um sie optimal auf eine mögliche Profikarriere vorzubereiten. Auch aus dem Musikbetrieb sind Strukturen zur Nachwuchsförderung nicht mehr wegzudenken – der Klassikbereich macht da keine Ausnahme. Schon während der Ausbildung an den Musikschulen und -hochschulen spornen unzählige Wettbewerbe zu Höchstleistungen an, später winken den Besten bei internationalen Wettbewerben attraktive Preise. Renommierte Klangkörper betreiben eigene Orchesterakademien, um hochtalentierten Instrumentalisten nach dem Studium den Weg ins Profi-Orchester zu ebnen. Und natürlich strecken auch CD-Labels und Konzertveranstalter stets ihre Fühler nach potenziellen Stars von morgen aus.
1991 haben sich auf europäischer Ebene große Konzerthäuser zur European Concert Hall Organisation (ECHO) zusammengeschlossen. Den Anstoß dazu gaben der Wiener Musikverein, das Konzerthaus Wien und das Concertgebouw Amsterdam. Inzwischen vereint die ECHO 23 Spielstätten in 14 Ländern, darunter die Elbphilharmonie Hamburg, das Konzerthaus Dortmund, die Kölner Philharmonie, das Festspielhaus Baden-Baden,

die Philharmonie de Paris, das Londoner Barbican Centre, das Megaron in Athen, das NOSPR in Katowice und das Müpa Budapest.
Eines der wichtigsten Projekte der ECHO ist das »Rising Stars«-Programm. Seit der Saison 1995/96 hebt es jedes Jahr junge Musikerinnen und Musiker mit vielversprechenden nationalen Karrieren auf die europäische Bühne. Die einzelnen Konzerthäuser spüren die Nachwuchshoffnungen auf; alle Häuser gemeinsam einigen sich unter den Vorschlägen dann auf sechs Solisten oder Ensembles, denen schließlich eine Tournee durch die verschiedenen Spielstätten ermöglicht wird. Schon 2009, noch vor ihrer Eröffnung, hat die Elbphilharmonie mit dem Morgenstern Trio ihren ersten »Rising Star« nominiert; bis heute konnte sie 15 weiteren aufstrebenden Talenten zu diesem Titel verhelfen.
Bei den Konzerten stellen sich die »Rising Stars« nicht nur dem dortigen Publikum vor, sondern vernetzen sich auch mit den jeweiligen Häusern, sammeln Erfahrung, gewinnen Routine und erproben unterschiedliche Konzertformate. So veranstaltet die Elbphilharmonie ein eigenes Festival, in dem die »Rising Stars« an sechs aufeinanderfolgenden Abenden im Kleinen Saal zu erleben sind; in der Philharmonie de Luxembourg hingegen sind
In der Elbphilharmonie gibt es jedes Jahr für die sechs »Rising Stars« ein eigenes Festival.



Das Ganze ist keinesfalls auf die reine Klassik beschränkt. Auch in der kommenden Saison gibt es wieder einige Überraschungen.
die Konzerte über die ganze Saison verteilt; und das Bozar in Brüssel lädt die jungen Künstler zu lockeren Sonntags Matineen ein – mit kürzeren Programmen und ohne Pause, dafür inklusive Croissant und Kaffee fürs Publikum.
Wie nachhaltig das »Rising Stars«-Programm ist, zeigt schon ein kurzer Blick auf die folgende – höchst unvollständige – Liste einstiger Nominierter: Internationale Solisten wie Kirill Gerstein, Khatia Buniatishvili und Igor Levit (Klavier), Janine Jansen, Patricia Kopatchinskaja und Renaud Capuçon (Geige), Alisa Weilerstein und Daniel Müller-Schott (Cello), Antoine Tamestit (Bratsche), Jörg Widmann (Klarinette), Martin Grubinger (Schlagwerk) und Benjamin Appl (Bariton), dazu KammermusikEnsembles wie das Belcea Quartet, das Quatuor Modigliani, das Cuarteto Casals und das Signum Saxophon Quartet, aber auch prominente Orchestermusiker wie Emmanuel Pahud (Solo-Flötist der Berliner Philharmoniker) und Ramón Ortega Quero (Solo-Oboist beim Symphonieorchester des BR) – sie alle standen zu Beginn ihrer Karrieren als »Rising Stars« auf der Bühne.
Neben der instrumentalen und vokalen Spitzenförderung hat das Programm zudem noch einen besonderen Dreh: Es werden nämlich auch junge Komponistinnen und Komponisten unterstützt, denn alle ausgewählten Instrumentalisten geben für ihre Tourneen neue Stücke in Auftrag, die dann auch häufig gemeinsam erarbeitet werden – ein künstlerischer Austausch, der für beide Seiten enorm bereichernd ist. In der vergangenen Spielzeit
hat sogar ein ehemaliger »Rising Star« für die nächste Generation komponiert: Das Auftragswerk des Pianisten Lukas Sternath kam von Patricia Kopatchinskaja, die sich inzwischen neben ihrer Solo-Karriere als Geigerin auch als Komponistin etabliert hat.
Übrigens ist das Ganze keinesfalls auf die reine Klassik beschränkt. Schon vor zehn Jahren hat die Elbphilharmonie das auf zeitgenössische Musik spezialisierte Trio Catch nominiert; nochmal zwei Jahre zuvor das Pablo Held Trio, das inzwischen zu den exquisitesten Jazz-Trios Europas zählt (und demnächst im Rahmen der Reihe »Jazz Piano« nach Hamburg zurückkehrt).
Und mit Sean Shibe hat zuletzt die E-Gitarre Einzug ins Instrumentarium der »Rising Stars« gehalten.
Auch in der kommenden Saison gibt es wieder einige Überraschungen und ungewöhnliche Konstellationen. So spielt die von der Elbphilharmonie nominierte Cellistin Valerie Fritz nicht nur Solowerke von Johann Sebastian Bach und Peter Eötvös, sondern bringt für einige Duos auch einen Akkordeonisten mit – eine so seltene wie klanglich reizvolle Kombination. Auch ein Saxofonquartett zählt nicht gerade zu den alltäglichen Besetzungen. Das in Amsterdam gegründete Maat Saxophone Quar tet präsentiert neben Originalwerken auch schwungvolle Bearbeitungen bekannter Klassiker etwa aus Kurt Weills »Dreigroschenoper« und George Gershwins »Rhapsody in Blue«.
Im Vergleich dazu könnte der Klavierabend mit dem georgischen Pianisten Giorgi Gigashvili geradezu konventionel erscheinen – wäre da nicht die zweite Konzerthälfte, für die er sich seine langjährige Bandkollegin aus Tiflis, die Sängerin Nini Nutsubidze eingeladen hat. Zusammen stellen die beiden eine Auftragskomposition der ebenfalls aus Georgien stammenden Musikproduzentin und Komponistin Natalie Beridze vor, deren Titel »Georgian On My Mind« mehr sein dürfte als eine Reminiszenz an den bekannten Jazz-Standard. Beim vierten Konzert ist Áron Horváth mit seinem Cimbalom zu Gast. Auf diesem vor allem in Ost-MittelEuropa verbreiteten Hackbrett spielt er nicht nur eine Bearbeitung ebenjener Bachschen Cello-Suite, die drei Tage zuvor schon Valerie Fritz zum Besten gegeben haben wird, sondern auch fulminante Volksmusik aus Ungarn, wo das Instrument zum festen Instrumentarium gehört. Die isländische Sopranistin Álfheiður Erla Guðmundsdóttir erzählt mit einem bunten Programm die »Geschichte eines Vogels«, und das Klaviertrio Trio Concept stellt mit Nocturnes von Ernest Bloch und Giulia Lorusso sowie Sergej Rachmaninows »Trio élégiaque« die Mysterien der Nacht in den Mittelpunkt. Wie jedes Jahr gibt es vor den Konzerten die Möglichkeit, die jungen Musikerinnen und Musiker in kleinen Gesprächsrunden näher kennenzulernen. Denn auch dies – sich selbst dem Publikum vorzustellen, über das eigene Tun und über Musik zu reden – will gelernt sein und erfordert Erfahrung. Welches Format wäre dafür besser geeignet als die »Rising Stars«?
M WEITERE BEITRÄGE ZUM THEMA FINDEN SIE UNTER WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

RISING STARS
Elbphilharmonie Kleiner Saal
So, 18.1.2026 | 19:30 Uhr
Valerie Fritz (Violoncello)
goran stevanovich (Akkordeon)
Werke von J. s. Bach, Peter eötvös, sofia gubaidulina, Mikolaj Majkusiak, Jennifer Walshe, olivier Messiaen und robert schumann
Mo, 19.1.2026 | 19:30 Uhr
Maat saxophone Quartet
Werke von Jean rivier, Lili Boulanger, henriëtte Bosmans, dmitri schostakowitsch, Aleksandra Vrebalov, kurt Weill und george gershwin
Di, 20.1.2026 | 19:30 Uhr
giorgi gigashvili (klavier) nini nutsubidze (gesang)
Werke von domenico scarlatti, robert schumann, galina ustwolskaja und natalie Beridze
Mi, 21.1.2026 | 19:30 Uhr
Áron horváth (cimbalom)
Bence Babcsán (klarinette, saxofon, Flöten), Zsombor herédi (Akkordeon), dávid Lakatos (kontrabass)
Werke von J. s. Bach, Lászlo sáry, charlotte Bray, emma nagy, györgy kurtág, Béla Bartók sowie eigenkompositionen
Do, 22.1.2026 | 19:30 Uhr Álfheiður erla guðmundsdóttir (sopran)
kunal Lahiry (klavier)
»Migrations – story of a Bird«: Lieder von samuel Barber, nico Muhly, Jean sibelius, errollyn Wallen, Judith Weir, sergej rachmaninow, Lyra Pramuk, deborah Pritchard, Maria huld Markan sigfúsdóttir, Joseph haydn, déodat de séverac, Maurice ravel und Margaret Bonds
Fr, 23.1.2026 | 19:30 Uhr trio concept klaviertrios von ernest Bloch, clemens k thomas, sergej rachmaninow, giulia Lorusso und Mieczysław Weinberg

Die Elbphilharmonie Jazz Academy 2025 leitet mit Donny McCaslin ein fulminanter Musiker, der sich in seinen Schützlingen auch selbst wiedererkennt.
VON TOM R. SCHULZ

Die Elbphilharmonie Jazz Academy ist eine Biennale des Lernens, wie es sie wohl kein zweites Mal gibt. Wo sonst lädt ein Konzerthaus regelmäßig 15 der besten jungen Jazzmusikerinnen und -musiker aus aller Welt ein mit dem Angebot, dort eine Woche lang nach Herzenslust an ihrer Musik, ihrem Spiel, ihrem Ausdrucksvermögen zu feilen und am Ende bei einem Konzert vor über 4.000 Ohren vorzuführen, was sie in dieser Zeit geschaffen haben? Zur Seite stehen der improvisationshungrigen Jugend Mal für Mal sechs künstlerische Mentoren, die ihr Metier nicht nur kompetent zu vermitteln wissen, sondern selbst gestandene Performer sind. In der Vergangenheit waren das etwa Yaron Herman, Anat Cohen, Theo Croker, Sullivan Fortner, Melissa Aldana, Ziv Ravitz, Julia Hülsmann und Clarice Assad.
Die dritte Ausgabe dieser High-End-Ausbildungswoche im Spätsommer 2025 bietet insofern ein Novum, als erstmals einer der Mentoren zurückkehrt: Donny McCaslin bereicherte die Jazz Academy schon vor zwei Jahren, als die Klarinettistin Anat Cohen die Woche leitete. Diesmal darf der Saxofonist aus New York City das selbst tun. Die Kollegen und Kolleginnen, mit deren Hilfe er dem internationalen Nachwuchs Impulse geben wird, hat er selbst ausgesucht. Liest man die Namen, ersteht vor dem geistigen Auge sogleich eine Dream Band, die man am liebsten im Konzert erleben würde: Gerald Clayton und Django Bates (Klavier/Keyboards), Jorge Roeder und Allison Miller (Bass und Schlagzeug), Jen

Shyu (Gesang) und eben Donny McCaslin (Tenorsaxofon). Jeder dieser Big names wäre eine eigene Geschichte wert (Allison Miller hatte eine im »Elbphilharmonie Magazin« 1|2025). Doch die Dream Band bleibt ein Traum, zumindest für jetzt. Die sechs stellen ihr Können, ihre Erfahrung und ihr pädagogisches Geschick in dieser Augustwoche in Hamburg ganz in den Dienst besagter 15 jungen Musikerinnen und Musiker, die eine Fachjury unter McCaslins Vorsitz ausgewählt hat.
NULL HOCHMUT, NULL HERABLASSUNG
»Donny ist toll«, schwärmt eine Elbphilharmonie-Mitarbeiterin, die ihn bei der Jazz Academy 2023 Tag für Tag miterlebt hat. »Er hat sich total eingesetzt für die Akademisten und mit ihnen unwahrscheinlich viel Zeit verbracht.« McCaslin scheint tatsächlich zu jenen Künstlern zu gehören, bei denen das Gefälle zu aufstrebenden Talenten umso flacher wird, je ausgeprägter sich die eigene Meisterschaft entwickelt. Null Hochmut, null Herablassung. Dabei spielt der Mann sein Tenor technisch und konzeptionell derart souverän, dass man nicht zögert, ihn in eine Reihe mit den Größten seiner Zunft zu stellen –Michael Brecker, Joe Henderson, Sonny Rollins, John Coltrane.
In Uptempo-Nummern bringt er eine selbstgewisse, dabei immer leidenschaftliche Flamboyanz zum Funkeln, die langsamen Balladen lädt er auf mit dem Gewicht der Welt. Sein Sound ist durch und durch geformt. In seinen Stücken gibt es immer wieder Momente, in denen sich
Linke Seite: Donny McCaslin mit seinem Vater Don (um 1975)
Diese Seite: Bei Proben und im Abschlusskonzert der Elbphilharmonie Jazz Academy 2023
Der Mann spielt sein Tenor derart souverän, dass man nicht zögert, ihn in
eine Reihe mit den Größten seiner Zunft zu stellen.


einzelne Töne als vieldimensionale, machtvolle Gebilde in den Raum hineinschieben und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Doch auch sie fügen sich letzten Endes ein in ein stetes Kontinuum kühner Linien, irrer Blitze und Klangkaskaden. Wer Donny McCaslin Saxofon spielen hört, wird Zeuge eines mitreißenden, von einer quecksilbrigen musikalischen Intelligenz gesteuerten Bewusstseinsstroms.
Die phänomenale Kontrolle, die er in jedem Tempo über seine Musik behält, gelingt auch einem Donny McCaslin nur dank unentwegten Trainings. Die ElbphilharmonieMitarbeiterin berichtet beinahe ehrfürchtig, wie er sich vor zwei Jahren, kaum mal für einen Augenblick der Gruppe der Studierenden entronnen, immer wieder unverzüglich in einen Nebenraum verzog. Zum Üben.
Seit weit über zehn Jahren blüht und gedeiht Donny McCaslins eigene Musik im stabilen Milieu einer Quartettbesetzung, mit der er 2015 auch David Bowies schwarzen Schwanengesang »Blackstar« aufgenommen hat. Mit Jason Lindner (Keyboards), Tim Lefebvre (Bass) und Mark Guiliana (Schlagzeug) hat McCaslin gleichgesinnte Hypervirtuosen zu einer Supergroup des Jazz versammelt. Die vier schöpfen aus einem endlos scheinenden Vorrat spielerischer Möglichkeiten, Ideen und manchmal herrlich abseitiger Sounds und widmen
McCaslins überragende musikalische Autorität geht mit großer Freundlichkeit einher.
sich im Kollektiv der Musik wie austrainierte Athleten ihrer sportlichen Disziplin. Tightness und Lässigkeit gehen bei ihnen Hand in Hand. Die Impulsdichte der Musik fordert allerdings auch die Spiegelneuronen der Hörer zu Höchstleistungen. Denn McCaslins Kompositionen sind raffinierte Ideengehäuse, die er mit Rasanz und Inbrunst durcheilt und bei denen man nie weiß, was einen an der nächsten Ecke erwartet.
McCaslins überragende musikalische Autorität geht mit großer Freundlichkeit einher. Sie zeigt sich auch in scheinbar kleinen Dingen, etwa in seinem Vermögen, Gesichter und Namen von Menschen reproduktionsbereit abzuspeichern. Da begrüßt er einen dann nach Jahren mit dem Vornamen, als habe man sich gestern zuletzt gesehen. Mit seinem scheinbar unbekümmerten Jungsgesicht, dem strahlenden Lächeln und der umgekehrt aufgesetzten Cap auf dem Kopf sieht er aus wie der geborene Sieger. Seine oft jubelnden, ekstatischen Soli sprechen dafür. Doch aus seiner Musik jagen auch immer wieder Dämonen, gerade in jüngerer Zeit, mit Hall und
Echoeffekten verstärkt. »Stadium Jazz« heißt programmatisch einer seiner Songs. Wie bei den großen, Stadien füllenden amerikanischen Rockbands brechen auch bei ihm immer wieder Wut, Trauer, Verzweiflung mit roher Energie durch die intellektuelle Architektur der Stücke. Ungefragt erwähnt er im Gespräch Traumata aus der Kindheit, und man denkt: Die nie ganz verheilten sind es vielleicht, die aus manchem Chorus so herausschreien.
WARME HUMANITÄT
Donny McCaslin ist auf der Bühne groß geworden. Als er noch nicht gehen konnte, setzte ihn der Vater Don McCaslin – er spielte Vibrafon und Klavier – neben sich auf einen Stuhl, während er selbst mit seiner Band namens Warmth auf der Veranda des Cooper House in Santa Cruz allsonntäglich Stunde um Stunde Musik für die Community spielte. Es muss eine ziemliche HippieTruppe gewesen sein, sehr California style. »Manchmal konnte ich im Horn des Saxofons in einer Pfütze aus Speichel eine Zigarettenkippe schwimmen sehen«, erinnert sich McCaslin. Der Anblick hielt ihn nicht davon ab, im Alter von zwölf Jahren selbst mit dem Saxofon anzufangen. Von klein auf durfte er in Vaters Band mitspielen. »Wenn ich den Kopf hängen ließ, weil ich mal wieder irgendwas nicht richtig konnte, sagte er mir immer, dass ich sein Lieblingssaxofonist sei.«
Die warme Humanität des Vaters, der in Santa Cruz bisweilen 13 Gigs pro Woche spielte, lebt in seinem Sohn weiter. Dabei ist Donny McCaslin als Jazzpädagoge kein Mann für den künstlerischen Breitensport. Unter den 118 Bewerbern aus 19 verschiedenen Ländern für

die diesjährige Elbphilharmonie Jazz Academy kam er immer wieder auf jene Talente zurück, die nicht nur sehr gut spielen können, sondern deren eigene Musik ihn aufhorchen ließ. Da folgt er seinem Mentor, dem Vibrafonisten Gary Burton, in dessen Band McCaslin mit Anfang 20 eintrat, in seinem letzten Studienjahr am Berklee College of Music. Burtons Credo lautete: »Erst wenn du anfängst, deine eigene Musik zu spielen, wirst du auch deine eigene musikalische Stimme finden.« Schreib! Deine! Musik! Wer als junger Spieler diesem Imperativ folgt, habe wenigstens den Hauch einer Chance, in dem enorm dichten Feld exzellenter Instrumentalisten und Sänger zu reüssieren – eines Tages, ganz vielleicht, sagt McCaslin.
Sein Herz gehört fraglos den jungen, aufstrebenden Spielern, in denen er, Idol so vieler der Bewerber, immer auch sich selbst wiedererkennt. Schließlich ging Donny McCaslin schon mit 14 Jahren erstmals auf Europatournee. Sie verlief anders als erhofft, denn kaum war der junge Mann mit seiner Bigband von der Aptos High School auf dem alten Kontinent angekommen, musste er sich wegen einer Blinddarmentzündung für den Großteil der Reise in ein niederländisches Krankenhaus verabschieden. Vier Jahre später und musikalisch um etliche Umdrehungen weiter, tourte die Schulband ein zweites Mal durch Europa. Da war Donny McCaslin schon auf dem Sprung nach Berklee.
Am Konzept der Jazz Academy reizt ihn besonders, dass am Ende ein abendfüllendes Konzertprogramm für den Großen Saal stehen muss. Davor werden sich 15 hochbegabte und hochmotivierte Leute zwischen 18 und 30 Jahren, die einander zuvor nie begegnet sind, innerhalb weniger Tage mithilfe von sechs inspirierenden Jazz-Cracks zu mehreren Combos zusammengerauft haben, die nur eigene Stücke der Teilnehmer spielen. Der Druck ist beträchtlich, doch der Nutzen rechtfertigt ihn. »Eine solche Gelegenheit hätte ich früher gern selbst gehabt«, sagt McCaslin. Im Idealfall wird das Ganze, mit einem Plattentitel von Miles Davis gesprochen, auch und vor allem Big Fun.
Donny McCaslin jedenfalls ist wild, nein, von ganzem Herzen entschlossen, dass diese Akademiewoche für alle Beteiligten ein unvergesslich tolles Erlebnis wird.
M WEITERE BEITRÄGE ZUM THEMA FINDEN SIE UNTER WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
So, 24.8.2025 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal donny Mccaslin (tenorsaxofon), gerald clayton (klavier), django Bates (klavier), Jorge roeder (Bass), Allison Miller (schlagzeug), Jen shyu (gesang) sowie die 15 teilnehmerinnen und teilnehmer der elbphilharmonie Jazz Academy 2025 Abschlusskonzert









Mit
Tarmo Peltokoski
startet gerade der nächste Jungdirigent aus dem hohen Norden durch. Wie machen die das?
VON HELMUT MAURÓ
Hier in Hamburg fühlt er sich wohl, das kann man bei den Proben in der Elbphilharmonie mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unmittelbar spüren. Der finnische Dirigent Tarmo Peltokoski, gerade mal 25 Jahre alt, ist seit 2022 Erster Gastdirigent dieses Ensembles – ein Titel, der eigens für ihn eingeführt wurde. Im Künstlerzimmer gleich neben der Kantine wirkt er ruhig, konzentriert, spricht nachdenklich. Zur Probe hinüber in den Großen Saal geht es dann freudigen Schritts, nichts scheint er lieber zu tun als mit dem Orchester das Programm des Abends durchzugehen …
Tarmo Peltokoski ist aktuell der Jüngste in der beachtlichen Reihe von Dirigenten, die von Finnland aus Weltkarriere gemacht haben. Nach der Generation von Esa-Pekka Salonen und Jukka-Pekka Saraste, beide seit Jahrzehnten international renommiert und Chefs großer Orchester, rückt gerade die nächste nach. Zunächst überraschte Klaus Mäkelä die Fachwelt: Er wurde 2020 mit gerade einmal 22 Jahren Chef der Osloer Philharmoniker, ist inzwischen Musikdirektor des Orchestre de Paris und wird demnächst zusätzlich Chefdirigent des Concertgebouworkest in Amsterdam und des Chicago Symphony Orchestra.
Und mit Peltokoski ist schon der nächste Finne am Start. Vier Jahre jünger als Mäkelä, ist er nicht nur Erster Gastdirigent der Bremer Kammerphilharmonie,
sondern auch Principal Guest Conductor der Rotterdamer Philharmoniker sowie Chef der Lettischen Nationalphilharmonie und seit September vergangenen Jahres zudem Musikdirektor des Nationalorchesters in Toulouse. Im vergangenen Frühjahr zeigte ein Konzert im Münchner Nationaltheater exemplarisch, was dieser junge Dirigent in Sachen Kompetenz und praktischer Routine bereits draufhat: Peltokoski schlägt freudiger Auftrittsapplaus entgegen – auch im Süden hat sich herumgesprochen, dass sich hier ein neues Talent vorstellt. Noch in den Applaus hinein lässt er die Musiker mit Richard Strauss’ Tondichtung »Don Juan« losstürmen, treibt das Bayerische Staatsorchester mit energetischer Agogik zu Höchstleistungen – aber nicht ins dramatische Extrem. Strauss’ exzentrische Seite hält Peltokoski klein, da spürt man seine Herkunft aus dem kühlen Norden, so scheint es zunächst. Am Ende, nach der aufwühlenden Siebten Sinfonie von Jean Sibelius, wird man anders denken. Im Verlauf dieses Konzertabends öffnet sich Peltokoski immer weiter, wird komplexer und gleichzeitig nahbarer. Das Violinkonzert von Erich Wolfgang Korngold (mit dem herausragenden Junggeiger Daniel Lozakovich) klingt schon ganz anders als Strauss: freier, einfühlsamer, persönlicher, differenzierter, melodieverliebter. Und im »Misterioso« seiner finnischen Landsmännin Kaija Saariaho spürt Peltokoski noch den feinsten Verästelungen nach, bis der Orchesterklang Fahrt aufnimmt und immer größer wird. Man hat es kaum wahrgenommen: Der Dirigent hat dieses zeitgenössische Stück übergangslos in Sibelius’ Siebte überblendet. Ideell und klangästhetisch bindet er ohnehin alle Musik dieses Abends in einen konzentrierten Wahrnehmungszusammenhang: Es sind unterschiedliche Geschichten, aber es ist immer derselbe Erzähler, dem man zuhört. Vielleicht ist es eine Charakterfrage: das Gemeinsame zum Maßstab machen, das Trennende als bunte Vielfalt erhalten. Manche Werke klingen dann anders als gewohnt. Der »Don Juan« ist hier kein wilder Verführer mehr, sondern ein mitunter melancholischer, gleichwohl getriebener Mensch, und in Sibelius’ Siebter öffnen sich nordische Landschaften von unglaublicher Schönheit. Das Gemeinsame? Die Raffinesse der Instrumentation, für die Strauss unter anderem berühmt ist, findet sich auch bei Sibelius. Wenn die Blechbläserbatterie sanft zu den
Tarmo Peltokoski am Pult der Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen in der Elbphilharmonie
(oben: im März 2023 mit Asmik Grigorian und Matthias Goerne; unten: im Oktober 2024)


Peltokoski kam schon mit 14 Jahren zu seinem wichtigsten Lehrer. »In dem Alter hätten andere vielleicht gar nichts in mir gesehen.«
Streichern tritt, nicht überfallartig wie so oft, sondern fast zärtlich sich heranschmeichelnd, dann merkt man, wie gut das alles kalkuliert ist. Oder ist es die Leistung des Dirigenten, das alles klanglich so zu arrangieren? Jedenfalls ist es erstaunlich, wie perfekt dieser junge Künstler all diese Aspekte schon im Griff hat.
Was also läuft in Finnland in Sachen Ausbildung besser als im Rest der Welt? Warum können die Grundschüler dort besser rechnen, die Musiker besser musizieren? Das fragten sich auch Bildungswissenschaftler aus Sachsen-Anhalt und schickten Lehramtsanwärter in das Land, wo der Nachwuchs blüht. Im finnischen Oulu sollten sie nachschauen, wie man dort die Lernfähigkeit der Schüler durch kulturelle Bildung steigert. Und sie staunten nicht schlecht: Die Stundenzahl für musische Fächer ist in Finnland schon mal grundsätzlich höher als in Deutschland, und die Schüler können sie bei Interesse sogar noch erweitern. Die wichtigsten Ergebnisse dieses umfangreichen musischen Angebots fassten die Fachbesucher aus Deutschland in wenigen Stichworten zusammen: Es sorge für mehr Freiheit, Vertrauen, Ruhe, Geduld. Das benennt eigentlich pädagogisches Einmaleins, und vielleicht geht es gar nicht um neue Erkenntnisse, sondern um die Umsetzung, um die Unterstützung von Schülerinteressen statt autoritärer Erfüllung vorgegebener Lehrpläne. Es klingt plausibel, wenn die Bildungswissenschaftler sagen: Wir brauchen keine Lehrer, die gute Musiker sind, sondern solche, die den Kindern helfen, gute Musiker zu werden. Aber stimmt das so? Eifert man als Kind nicht lieber einem guten Musiker nach?
Darauf gibt es wohl keine generelle Antwort. Doch sicher ist: Der menschliche Faktor spielt bei der Ausbildung eine Schlüsselrolle, wie auch Tarmo Peltokoski im persönlichen Gespräch backstage in der Elbphilharmonie bestätigt. Er hat vier Jahre lang bei dem Mann studiert, der hinter dem finnischen Dirigentenwunder steht, beim legendären Dirigierprofessor Jorma Panula, der inzwischen

94 Jahre alt ist und nach wie vor unterrichtet, wenn auch nur noch privat. Schon Jukka-Pekka Saraste und Esa-Pekka Salonen waren seine Studenten an der Sibelius-Akademie in Helsinki, ebenso wie Sakari Oramo (der ihm dort als Professor nachfolgte), Osmo Vänskä, Hannu Lintu, Mikko Franck, Markus Poschner und Klaus Mäkelä.
Peltokoski kam 2014 im Rahmen eines Meisterkurses zu Jorma Panula. Der Vater hatte angefragt und erst einmal ein entschiedenes Nein erhalten. Dann zeigte er dem Meister ein paar Kompositionen seines Sohnes – und Panula stimmte zu. »Er hat ein scharfes Auge für das Potenzial, das in einem steckt«, erinnert sich der junge Dirigent. »Ich war ja gerade 14, als ich zu ihm kam, in dem Alter hätten andere vielleicht gar nichts in mir gesehen.«
Und was zeichnet nun Panula und seinen Unterricht aus? »Wesentlich sind sicherlich seine Menschenkenntnis und seine Wertschätzung, aber eigentlich unterrichtet er gar nicht so viel«, berichtet Peltokoski. »Er zwingt seine Studenten, für sich selber zu lernen. Wenn sie das nicht können, werden sie ohnehin keine Dirigenten.« Ganz wichtig sei aber auch, dass Panula seinen Studenten schon früh die Chance bietet, mit einem echten Orchester zu arbeiten – da sei er eisern, trotz aller hohen Kosten: Um zu lernen, wie man ein Orchester dirigiert, müsse man ein Orchester dirigieren. »In den allermeisten Dirigierklassen weltweit dirigieren die Studenten zwei Klaviere«, sagt Peltokoski. »Und so lernen sie, zwei Klaviere zu dirigieren – aber kein Orchester.«
Eine eigene finnische Dirigierschule will Tarmo Peltokoski allerdings nicht erkennen. »Wenn es so etwas wie eine finnische Schule gäbe, dann wäre es die Tatsache, dass es eben keine Schule ist, mit eigener Technik oder eigenem Klang wie etwa bei der russischen Klavierschule. Wir Finnen haben so etwas nicht. Wir sind Individualisten.«
TARMO PELTOKOSKI
Fr, 29.8.2025 | 19 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal die deutsche kammerphilharmonie Bremen, tarmo Peltokoski solisten: Mauro Peter, kathryn Lewek, elsa dreisig, Äneas humm u. v. a. romain gilbert (regie) Wolfgang Amadeus Mozart: die Zauberflöte halbszenische Aufführung mit Übertiteln
Mo, 9.3.2026 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal die deutsche kammerphilharmonie Bremen, tarmo Peltokoski daniel Lozakovich (Violine) Zoltán kodály: tänze aus galanta robert schumann: Violinkonzert Felix Mendelssohn Bartholdy: sinfonie nr. 3 »schottische«
Antworten: »Was war Ihr bisher größter Karriereschritt?«
VON IVANA RAJIC

STERLING
ELLIOTT
»Das Cello hat schon bei meiner Geburt auf mich gewartet«, erzählt Sterling Elliott schmunzelnd und doch ernst über den wohl wichtigsten Moment seines Musikerdaseins: »Mit meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Schwester gab es bereits drei Geigen, und so war klar, dass ich Cellist werden würde, um das Elliott Family String Quartet zu vervollständigen.« Schon gegen Ende seines Studiums an der New Yorker Juilliard School, konzertierte der Cellist mit großen Orchestern wie dem New York Philharmonic oder dem Boston Symphony Orchestra. 2023 ernannte ihn der in London ansässige Young Classical Artists Trust zum »Robey Artist« – ein zweijähriges Programm, in dessen Rahmen der YCAT sein Management in Großbritannien übernimmt und Sterling Workshops für Schulkinder leitet. Ähnlich letztes Jahr in Hamburg, wo er nicht nur in der Nachwuchs-Reihe »Teatime Classics« auftrat, sondern auch bei einem Instrumenten-Workshop in der Elbphilharmonie ein Dutzend Kinderherzen eroberte.
NOVO QUARTET

»Als Ensemble im Rahmen des ECMAster-Programms in Wien, Paris und Oslo zu studieren«, war unsere bisher wichtigste Entscheidung«, sagen die Mitglieder des NOVO Quartets aus Dänemark. »Es hätte auch schiefgehen können, so eng zusammenzuleben und zu arbeiten, noch dazu in uns unbekannten Ländern.« Doch das Risiko hat sich ausgezahlt: Das Quartett wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Ersten Preis und vier Sonderpreisen beim 77. Concours de Genève. Dieses Jahr folgte die Ernennung zum BBC New Generation Artist – ein Förderprogramm, das schon zahlreiche internationale Kar rieren beflügelt hat. »Das ist für uns ein unglaublicher Ver trauensbeweis und ein großer Meilenstein«, sagt das NOVO Quartet, das kürzlich sein Debütalbum mit Werken der dänischen Komponistin Mette Nielsen veröffentlichte. Dass die vier gern weniger bekanntes Repertoire ins Programm nehmen, zeigten sie im April auch in der Laeiszhalle: Neben einem der Beethovenschen »Rasumowsky«-Quartette spielten sie Musik der polnischen Komponistin Graz˙yna Bacewicz.
Der wichtigste Moment in der Karriere der in New York City aufgewachsenen Pianistin Julia Hamos war der Entschluss, nach Europa zu ziehen – in die deutsche Kulturmetropole Berlin, wo sie ihr Studium an der Barenboim-Said Akademie bei András Schiff absolvierte. »Von da an boten sich mir mehr und mehr großartige Möglichkeiten«, erzählt sie. So trat sie im Berliner Pierre Boulez Saal auf, und auch in der Laeiszhalle war sie 2024 gemeinsam mit der Cellistin LiLa (s. u.) zu Gast. Doch es waren vor allem ihre Kollegen und Dozenten an der Akademie, die sie inspirierten, zu wachsen und in der Kulturszene Fuß zu fassen: »Wir helfen uns gegenseitig, Auftrittsmöglichkeiten zu finden und ein Netzwerk aufzubauen.« Für die Zukunft nimmt sich die amerikanisch-ungarische Pianistin vor, ihr Repertoire weiterzuentwickeln – und ihre Programmgestaltung noch stärker an den eigenen Vorlieben auszurichten: »Ich möchte das spielen, was ich liebe, an den Orten, die ich liebe – und auf die Art und Weise, die mir entspricht.«


EMANUEL BLUMIN-SINT
»Für mich war es ein besonderes Erlebnis, den Fanny Mendelssohn Förderpreis zu erhalten«, erzählt der 20-jährige Fagottist Emanuel Blumin-Sint. Denn diese Auszeichnung ermöglichte ihm die Aufnahme seines ersten Solo-Albums, »Leading Bassoon«, das alle Facetten seines Instruments präsentiert. Viel zu selten stehe das Fagott als Solo-Instrument im Rampenlicht, findet er – und möchte genau das ändern. Einige Komponisten schrieben für ihn neue Stücke, etwa Valentin Silvestrov, der bekannteste zeitgenössische Komponist der Ukraine. »Darüber hinaus war ein ganz besonderer Moment mein Solodebüt in der Carnegie Hall im November 2024, sowie mein Solokonzert mit Orchester in der Berliner Philharmonie.« Im März 2026 folgt ein weiteres Debüt: ein Auftritt in der Laeiszhalle im Rahmen der Reihe »Teatime Classics«. Gemeinsam mit dem Akkordeonisten Pavel Efremov präsentiert Blumin-Sint, wie reizvoll diese ungewöhnliche Besetzung klingt, mit Barockmusik ebenso wie mit Werken des 20. Jahrhunderts.
»Mein wichtigster Karriereschritt war weder ein großer Auftritt noch eine Zusammenarbeit mit den Großen der Szene, sondern meine Zeit an der Kronberg Academy, die ich mit 16 begann«, erzählt die 2002 in China geborene Cellistin LiLa. »Dort traf ich auf Menschen, die Musik nicht nur spielten, sondern lebten. In dieser Umgebung keimte meine künstlerische Identität: Musik ist für mich keine Tätigkeit, sondern eine Art, die Welt zu begreifen.« Kein Wunder also, dass sie sich für ihren Auftritt in der Laeiszhalle im vergangenen Jahr mit Julia Hamos zusammentat, die ebenfalls durch die Musikakademie Wahlverwandte fand (s.o.). »Ich bin dankbar, von talentierten Freunden umgeben zu sein, die mich herausfordern, neu zu denken, was Musik ausdrücken kann«, erklärt LiLa. »Ich möchte einfach weiter lernen, dranbleiben, wachsen – und bereit sein, wenn der Moment es verlangt.«


MIKHAIL KAMBAROV
Mikhail Kambarov ist schon längst auf der Überholspur: Seit seinem Debüt mit gerade einmal acht Jahren kamen bedeutende Preise hinzu, ein begehrtes Stipendium der Deutschen Stiftung Musikleben und ein Studium bei Michail Lifits an der Musikhochschule in Weimar, wo einst der Klaviervirtuose Franz Liszt lebte und wirkte. Aber sein wichtigster Karrieremoment war, »als ich aufgehört habe, Erwartungen zu erfüllen, und angefangen habe, meiner eigenen musikalischen Stimme zu vertrauen«, offenbart er. »Es geht mir nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, echt zu sein.« Sein nächstes Ziel: »Grenzen überschreiten, neue Wege suchen, das Bekannte hinterfragen und Konzerte zu Erlebnissen machen, die im Herzen bleiben!« Ein Anspruch, den er auch an seinen bevor stehenden Auftritt in der Laeiszhalle stellt, wo er im Dezember Werke der romantischen Klaviervirtuosen Beethoven, Schumann und Chopin spielen wird.

»Der wichtigste Schritt in unserer Karriere als junges Ensemble war sicher der Gewinn des 2. Preises beim ARD-Musikwettbewerb 2023«, davon ist das Amelio Trio überzeugt. »Das hat uns wichtige Türen in die Klassikwelt geöffnet und uns bestätigt, dass wir als Gruppe am Ball bleiben sollten.« Noch zu Schulzeiten gründeten Johanna Schubert, Merle Geißler und Philipp Kirchner ihr Klaviertrio und musizieren nun, mit Mitte zwanzig, schon seit über einem Jahrzehnt zusammen. Anfang dieses Jahres sind sie zum ersten Mal in der Laeiszhalle aufgetreten; in der Spielzeit 2026/27 kommen sie auch in die Elbphilharmonie, im Rahmen ihrer Tournee als »Rising Stars« (s. S. 16): »Die führt uns in die größten und bedeutendsten Konzertsäle Europas!« Dieses Karriere-Sprungbrett ermöglicht ihnen vor allem eines: »regelmäßig Konzerte zu spielen, unsere eigenen Ideen zu verwirklichen und das tolle und vielseitige Repertoire für Klaviertrio mit unserem Publikum zu teilen.«
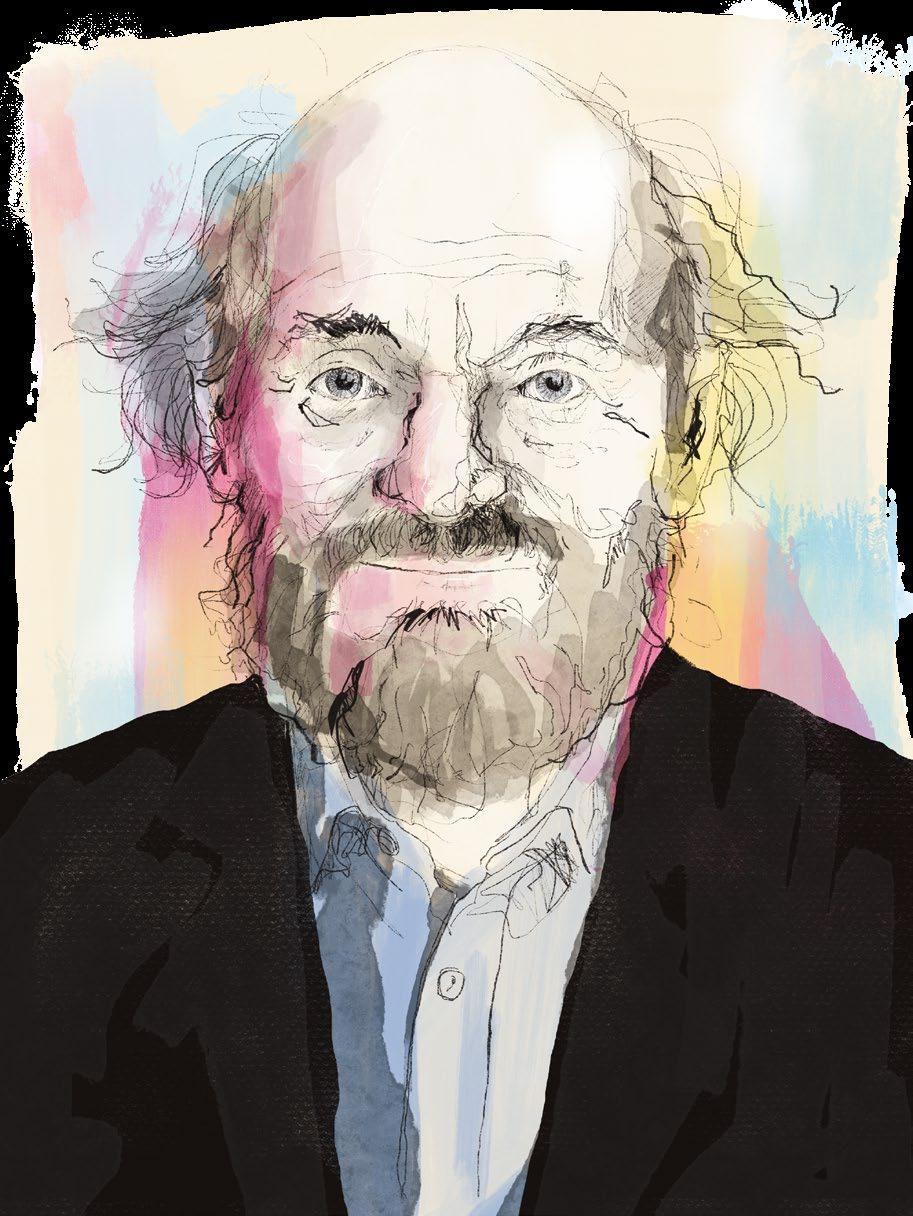
In der ungemein klangschönen, ungeheuer einfachen Musik Arvo Pärts geht es um mehr als einfach nur um Schönklang.
VON ALBRECHT SELGE
ILLUSTRATIONEN ANSELM M. HIRSCHHÄUSER
Es gibt Musikexperten, für die der Begriff »breites Publikum« nach bekifften Hörern klingt. Die höchst wohltönende Musik, der diese Hörer den Lorbeer ihrer Gunst gewähren, bringt jene Experten öfter mal auf die gebildete Palme. Denn ihre aufgescheuchte Fachkenntnis wittert Arges, Verderbenbringendes: Nebel, Seichtheit, Irrationalität. Ein Fall, auf den das besonders zutrifft, ist die tatsächlich ungemein klangschöne, ungeheuer einfache (oder einfach scheinende), zweifellos vom christlichen Glauben durchdrungene Kunst des estnischen Komponisten Arvo Pärt. Wie es in einer weithin bekannten Online-Enzyklopädie mit dem untergründigen Humor absoluter Sachlichkeit heißt: »Pärt erfreut sich einer für einen zeitgenössischen Komponisten ungewöhnlich großen Beliebtheit.« Dass die musikalische Menschheit in ihrer Breite sehr gern Pärt hört, belegt auch eine Statistik des britischen Klassikportals »Bachtrack« über die meistgespielten lebenden Komponisten im Jahr 2023. Da liegt vor dem mönchsbärtigen Esten allein noch der US-Amerikaner John Williams. Dessen Musik stammt allerdings von vor langer Zeit und aus einer weit, weit entfernten Galaxis, läuft also quasi außer irdischem Wettbewerb.
Andererseits ist auch Pärts Musik nicht von dieser Welt. Zumindest nicht nur. Doch gerade diese religiöse Dimension trägt vermutlich dazu bei, die verbliebenen sittenstrengen Hüter des musikalischen Fortschritts zur Weißglut zu treiben. »Religiöse und mittelalterliche Betrügereien« bescheinigt der straff progressive Jean-Noël von der Weid in seinem 500-seitigen, ziemlich apodiktischen Handbuch »Die Musik des 20. Jahrhunderts« dem Komponisten Pärt, oder auch »entleerten Mystizismus«. Pärts aus reduzierten Elementen entstehende Musik betäube den Menschen, befinden solche Richter, sie sei eine Art schnöde Gehörverdummung.
wirrung witterten. »Ein modernistisches Werk« nannte Pärts wohlmeinend warnender Kollege und Freund Jaan Rääts diesen »Nekrolog«. Und ein anderer Weggefährte, Eri Klaas, sagte besorgt: »Meines Wissens hat in Estland oder der ganzen Sowjetunion bisher noch niemand Zwölftonmusik geschrieben! Vielleicht erklären sie dich jetzt zum Dissidenten, zum Volksfeind?«
Zugegeben: Diese Zitate stammen nicht aus einer offiziellen Pärt-Biografie, sondern aus einem Comic. Und zwar aus der Graphic Novel »Zwischen zwei Tönen« von Joonas Sildre, einem sehr fundierten Buch über Pärts Leben, das eine ebenso kunstvolle wie unterhaltsame Einführung auch ins Werk des Komponisten bietet. Es ist ganz in schwarzweiß gehalten – und eben in den zahllosen Zwischentönen, die sich aus dieser binären Klarheit erst ergeben, quasi den Schwingungen des Nichtfarblichen. Ein wenig also wie die radikal reduzierte Zweistatt-Zwölftonmusik, die Pärt seit den späten Siebzigerjahren schreiben sollte, beginnend mit »Für Alina« von 1976 und »Fratres« von 1977.
Aber ist es nicht interessant, dass der frühe Modernist Pärt in der offiziellen Kulturpolitik der Sowjetunion ebenso aneckte wie der spätere Musikmönch Pärt in der oft erschreckend verbissenen progressiven Musikszene des Westens? (Wobei diese, was dann doch ein wesentlicher Unterschied ist, keine Staatsgewalt auf »Abweichler« hetzt.)
Auch der ebenfalls aus dem Ostblock in die Freiheit herübergemachte ungarische Komponist György Ligeti erkannte da – ohne Gleichsetzung – gewisse Parallelen.
Ziemlich genau das Gegenteil davon wurde allerdings einst dem jungen Arvo Pärt vorgeworfen, vor einer halben Ewigkeit, ums Jahr 1960 in der Sowjetunion. Das Werk »Nekrolog« des damals 26-Jährigen erregte Anstoß bei den Aufpassern des sozialistischen Fortschritts, die in westlicher Avantgarde bürgerliche Ohren- und Gesinnungsver- ›
Für das Echo auf Pärts kompositorische Anfänge aber galt zweifellos Ligetis Satz: »Totalitäre Systeme mögen keine Dissonanzen.« Und als solche musste in den frühen Sechzigern nicht nur Pärts »Nekrolog« empfunden werden, sondern auch das nachfolgende ambitionierte Orchesterwerk »Perpetuum mobile«, das Pärt mit Begriffen wie »Objektivität« und »mathematische Gleichung« beschrieb. Ein damals modischer Jargon, der doch dem unmittelbar erfahrbaren sinnlichen Reiz dieser spiralförmigen Musik nicht gerecht wird. Auf jeden Fall ist es ungemein spannend, dieses unsowjetisch »modernistische« Klangwunder »Perpetuum mobile« im Zusammenhang mit der puristischen Dreiklangs-Reflexion »Fratres« oder einem der absoluten Meisterwerke des späteren Pärt, »Tabula rasa«, zu hören.
EINFACH NÄHER AM GÖTTLICHEN
Zweifellos war das der entscheidende Wendepunkt: der post-perpetuum-mobilsche Entschluss des etwa 40-Jährigen, seine Musik radikal zu vereinfachen. Dazu entschied Pärt sich nicht, um systemtreue Botschaften in die Arbeiterschaft zu pauken, sondern um dem Göttlichen näherzukommen. Man schreibt so etwas im Jahr 2025 meist halb sehnsüchtig gerührt, halb peinlich berührt hin, aber bei Pärt ist es nun einmal essenziell. Eine Entdeckung fand damals statt, tief in den Siebzigern, als auch im Westen die Protestbewegungen sich in gegensätzliche Strömungen aufteilten, von der wiedergefundenen Empfindsamkeit des »Neuen Mannes« bis hin zum mörderischen roten Terrorismus. Und genau diesen Begriff »Entdeckung« benutzte nicht nur Pärt selbst im Rückblick, sondern verwendet auch der bereits oben zitierte Pärt-Schmäher von der Weid in seiner vielleicht lustigsten Attacke: Pärt sei »der erste Este, der die Theurgie des Diatonischen wiederentdeckt hat«.
Das ist doch mal ein Titel: der erste Este, der die Theurgie des Diatonischen wiederentdeckt hat! Im Griechischen bedeutet diátonos so viel wie »durch Ganztöne gehend«, was etwas in die Irre führt, weil eher das gemeint ist, was sozusagen glatt ins Ohr geht. Nämlich eine siebenstufige Tonleiter mit zwei Halbton- und fünf Ganztonstufen; also etwa eine C-Dur-Tonleiter, das heißt, die sieben weißen Tasten einer Klavieroktave statt der zwölf schwarzen und weißen, welche viel stärkere Reibung, Chromatik, Dissonanzen erzeugen.
Theourgía wiederum heißt »Gotteswerk« und bezeichnet laut Historischem Wörterbuch der Philosophie »eine Technik (ars) oder ein Ritual, das es entweder mit Zeichen und Symbolen oder durch ein Medium hindurch ermöglicht, in eine Beziehung mit den höheren Mächten zu treten«. Die Theurgie ist ein Gegenmodell zur Theologie, in der der lógos zu Gott führt; hier hingegen ist es eine Tat, ein Schaffen, ein Werk. Es geht darum, sich selbst für göttlichen Einfluss zu öffnen – eine Idee der Spätantike, als magische Vorstellungen allgegenwärtig waren. In gewisser Weise übernahm sie der orthodoxe Christ Pärt als Musiker. Also (um bei den Klaviertasten zu bleiben) keine schwarze, sondern so etwas wie weiße Magie. Zwischen zwei weißen Tönen sollen sich ohne ohrenaufschürfende Reibung göttliche Funken entzünden. Es geht um Größeres als um »bloß schön klingen«. (Wobei es selbstredend uneingeschränkt erlaubt ist, sich allein am »schönen Klang« zu erfreuen.)
Als Arvo Pärt am 11. September 1935 geboren wurde, war er kein Bürger der Sowjetunion, sondern der unabhängigen Republik Estland. Die bestand erst seit 1918 und hatte noch fünf relativ freie Jahre vor sich, bis zur Besetzung erst durch Stalins Rote Armee, dann durch Hitlers Wehrmacht. Die Klänge, die das kleine Kind umgeben, sind von anderer Art als ideologische Parolen und Kriegslärm: eine Mutter, die Volkslieder singt oder Schubertlieder,
Zur radikalen Vereinfachung seiner Musik entschied Pärt sich nicht aus Systemtreue, sondern um dem Göttlichen näherzukommen.
die ins Volksliedgut einsanken wie »Am Brunnen vor dem Tore« (das ja eigentlich aus der »Winterreise« stammt); der Klang der Schritte im Schnee; das Schlagen einer Pendeluhr; die Töne eines alten Klaviers, auf dem ein paar Tasten kaputt sind, so dass man diese fehlenden Töne singen muss.
Neben dem Klavierunterricht ist natürlich, wie damals bei den meisten Musikliebenden, das Radio von großer Bedeutung (als junger Mann sollte Pärt dann auch beim Rundfunk arbeiten und sich dort quer durch die klassischen Plattenarchive hören). Doch es ist überliefert, dass der ungefähr 14-Jährige ganz anders Radio hörte als seine Zeitgenossen: Wenn es zu Hause nicht ging, genoss er auf dem Marktplatz des Städtchens Rakvere Sinfonien, die aus einem dort aufgestellten hohen Lautsprecher gespielt wurden. Um dem Spott seiner weniger von der Muse geküssten Gleichaltrigen zu entgehen, umrundete er mit dem Fahrrad mit etwas Abstand diesen Lautsprecher, damit er nicht als weichlich-sonderlicher Musikhörer erkannt wurde. Kann man sich ausmalen, wie so etwas Klangvorstellungen fürs ganze Leben ins Schwingen bringen kann: als junger Mensch im empfänglichsten, geradezu magiefähigen Alter eine Sinfonie immerfort zu umkreisen?
DER GANG IN DIE STILLE
Bereits vor dem ordentlichen Musikstudium, das er 1954 begann, komponierte Pärt, etwa im Stil von Béla Bartók. Ab 1960 erregte er Anstoß wegen seiner Aufnahme westlicher Avantgarde-Ideen, aber eben auch wegen der unwiderstehlich in sein Werk einfließenden religiösen Züge, noch angedeutet in der zunächst ganz rational wirkenden »Collage über B-A-C-H« von 1964, aber etwas später provozierend unverstellt: in »Credo« von 1968, wo Bachs C-Dur-Präludium (sowohl in weithin bekannter Klavierfassung als auch bombastisch und nicht unbedingt geschmackssicher vergrößert durch Chor und Orchester) auf seriell-aleatorischen Widerbums prallt. Da siegt selbstverständlich Bach, gar mit Beckenschlägen, aber am Ende steht die Tendenz zur Andacht und zum Gang in die Stille. Pärt jedoch haderte bald mit seiner einige Jahre lang praktizierten Collagetechnik: »Es ergibt keinen Sinn mehr, Musik zu schreiben, wenn man fast nur noch zitiert.«
Eine Behauptung, die durch das Werk von Pärts Generationsgenossen Alfred Schnittke (der übrigens die letzten acht Jahre seines Lebens in Hamburg zu Hause war) phänomenal widerlegt wird. Aber wenn ein Künstler von Sinn spricht, dann geht es ja meist um Sinn »für
mich«; und Pärt befand sich in den Siebzigern in einer ausgesprochenen Schaffenskrise. Acht Jahre lang komponierte er so gut wie nicht – und trat 1972 der russischorthodoxen Kirche bei. Im selben Jahr heiratete er seine Frau (Eleo)Nora, eine jüdische Musikwissenschaftlerin, die zur Begleiterin seines Lebens wurde.
Aber neben der materiellen Existenzbedrohung (sowohl gesundheitlicher als auch beruflicher Art, etwa durch das Verbot des Werks »Credo«, von dem zu distanzieren sich Pärt jedoch weigerte) stand eine geistige und geistliche Perspektive durch Pärts Entdeckung gregorianischer Musik – aus dem Radio übrigens. Die religiöse Entdeckung dieser Zeit stieß zugleich eine jahrelange musikalische Expedition an. Aus ihr entstand jener unverkennbare Stil von komplexer Simplizität, der unter dem Schlagwort Tintinnabuli weltweit berühmt
Das Radio war für den jungen Pärt von großer Bedeutung. Doch er musste sich tarnen, um dem Spott seiner Kameraden zu entgehen.
und erfolgreich wurde. Die Schikanen durch die Kulturnomenklatura der Sowjetunion aber nahmen derart zu, dass Pärt mit seiner Frau Nora und den beiden kleinen Kindern im Januar 1980 von Tallinn über BrestLitowsk nach Wien ausreiste. Nach einigen Monaten dort lebten die Pärts bis 2008 in Berlins ruhigem Viertel Lankwitz, um im Alter nach Estland zurückzukehren –in einen freien Staat und ein Land des Gesangs, wo Traditionen der Vokalmusik gepflegt werden wie kaum irgendwo sonst. Die Bedeutung der musikalischen Übergestalt Pärt ist dort eminent, nicht erst seit 2018 das einflussreiche Arvo Pärt Centre eröffnet wurde; derart eminent, darf man anmerken, dass man jüngere estnische Musikschaffende auch schon mal über diese Dominanz stöhnen hört.
Das ominöse Schlagwort Tintinnabuli, mit dem man zahlreiche Werke Pärts (auch das sehr populäre »Spiegel im Spiegel« von 1978) bezeichnen kann, hat nichts mit Hergés Comic-Klassiker Tintin zu tun, sondern kommt vom lateinischen tintinnabulum, was Klinge oder Schelle bedeutet und bei Pärt wohl am ehesten klingende Schelle. Geprägt ist dieser Stil durch die Zweistimmigkeit

»Ich könnte meine Musik mit weißem Licht vergleichen, in dem alle Farben enthalten sind.«
ARVO PÄRT
einer diatonischen Melodiestimme und darunter der so genannten Tintinnabuli-Stimme, die in arpeggierten Dreiklängen einen glockenhaften Grundton schlägt. Komplexe oder archaische Wirkungen entstehen unter anderem dadurch, dass Pärt oft Kirchentonleitern (modale Skalen) verwendet – und dass die streng gehaltenen Tonarten seiner zwei Stimmen durchaus unterschiedliche sein können. Aber vielleicht ist der Geist von Pärts Musik am besten in seinen eigenen umschreibenden Worten aus dem Jahr 1999 zu fassen: »Ich könnte meine Musik mit weißem Licht vergleichen, in dem alle Farben enthalten sind. Nur ein Prisma kann diese Farben voneinander trennen und sichtbar machen; dieses Prisma könnte der Geist des Zuhörers sein.«
Wie Pärts Erfolg beim »breiten Publikum« gerade in der religiös abmagernden westlichen Welt beweist, verfehlt der an Ligeti anknüpfende, naheliegende Scherz sein Ziel, freiheitliche Systeme würden keine Assonanzen mögen. Darüber sind wir mittlerweile – gottlob! –doch wohl hinweg; wer heute einem zeitgenössischen Komponisten Terzen vorwürfe, der würde eher sich selbst zur komischen Figur machen. Die Wirkung von Pärts Musik kann aber über einen spirituellen Quickie durchaus hinausgehen. In seinem Buch »The Rest Is Noise« (das ich als Lektüre-Einstieg zur Musik des 20. Jahrhunderts weit wärmer empfehlen würde als von der Weids oben genanntes »Handbuch«) nennt der New Yorker Kritiker Alex Ross nicht nur eine Einspielung von Arvo Pärts »Tabula rasa« als eine von zehn ausgewählten Aufnahmen zur beglückenden Erstbegegnung mit zeitgenössischer Musik (neben beispielsweise Lutosławskis 3. Sinfonie, John Adams’ »Harmonielehre« und Georg Friedrich Haas’ »in vain«).
Er erzählt zudem über die Achtzigerjahre, als der PärtBoom in voller Blüte stand: »Für einige Menschen erfüllte Pärts seltsame spirituelle Reinheit auch verzweifeltere Bedürfnisse; eine Stationsschwester in einem New Yorker Krankenhaus spielte jungen Männern, die an Aids starben, regelmäßig ›Tabula rasa‹ vor. An ihren letzten Lebenstagen verlangten sie es immer und immer wieder zu hören.«
In einem umfassenderen Sinn aber sind wir ja alle von Geburt an Sterbende. Pärts unerhört schöne Musik vermag uns auch mit dieser – doch eigentlich unerträglichen – Tatsache zu versöhnen. Wenn wir in einem Akt weißer Magie zu jenem Prisma werden, das die Farben dieser Musik voneinander trennt und sichtbar macht. So bekifft dürfen wir schon sein.
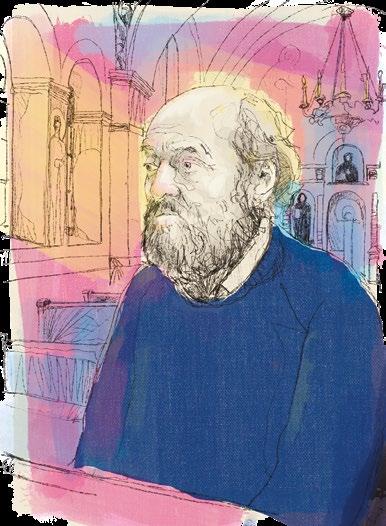
ARVO PÄRT 90 Elbphilharmonie Großer Saal
Do, 2.10.2025 | 20 Uhr iveta Apkalna (orgel)
Arvo Pärt: Annum per annum; Pari intervallo (Fassung für orgel); spiegel im spiegel; trivium; Mein Weg hat gipfel und Wellentäler sowie Werke von J. s. Bach und Pēteris Vasks
Sa, 11.10.2025 | 20 Uhr ensemble resonanz estnischer Philharmonischer kammerchor tõnu kaljuste (dirigent)
Arvo Pärt: stabat mater; Festina lente; L’Abbé Agathon; Adam’s Lament sowie ein Werk von raminta Šerkšnyte˙
Mo, 20.10.2025 | 20 Uhr estonian Festival orchestra, Paavo Järvi hans christian Aavik (Violine) Midori (Violine)
Arvo Pärt: collage über B-A-c-h; swansong; tabula rasa; Perpetuum mobile; summa; Fratres; Passacaglia; La sindone; cantus in memoriam Benjamin Britten
Do, 23.10.2025 | 20 Uhr tenebrae, nigel short george herbert (orgel)
Arvo Pärt: gloria (aus Missa syllabica); o Weisheit (aus sieben Magnificat-Antiphonen); the Beatitudes; cantate domino canticum novum; the Woman with the Alabaster Box sowie chorwerke von John tavener, orlando gibbons, William Byrd, roderick Williams, eric Whitacre, unsuk chin und thomas tallis
BEGLEITPROGRAMM
Fr, 3.10.2025 | 12 Uhr
Elbphilharmonie Kaistudio 1 Fr, 3.10.2025 | 19 Uhr Sasel-Haus nicolas namoradze (klavier, Moderation)
deep Listening: Musik und Meditation mit Werken von Arvo Pärt, J. s. Bach, Alexander skrjabin und Maurice ravel

Kaffee-Erfolg braucht Leidenschaft.
Viele träumen von der perfekten Maschine. Wir bauen sie. Überzeugen Sie sich selbst bei Ihrem Besuch in der Elbphilharmonie und genießen Sie unsere Kaffeespezialitäten!




Die Jugend mag unwiederbringlich sein, ihre Moden aber kehren so sicher in Wellen wieder, wie ihre Attribute unveränderlich sind. Schnell, direkt, faszinierend spontan und immer ein bisschen unvorhersehbar, dabei unvollkommen, ungeduldig, unscharf: So ist die Polaroid-Fotografie. Kein Wunder, dass sich junge Künstler wie unser Fotograf immer wieder neu für sie begeistern.
FOTOS LOUIS ROTH










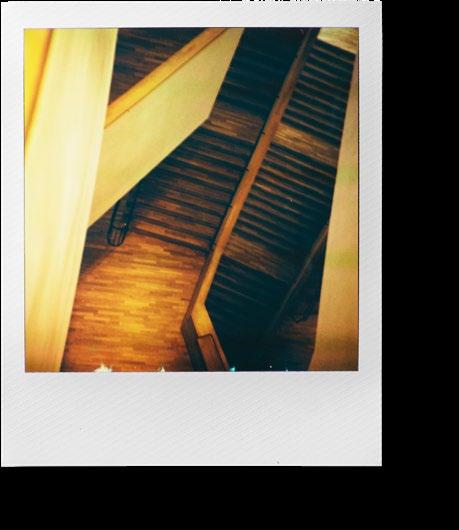
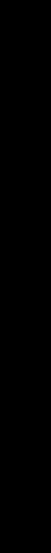




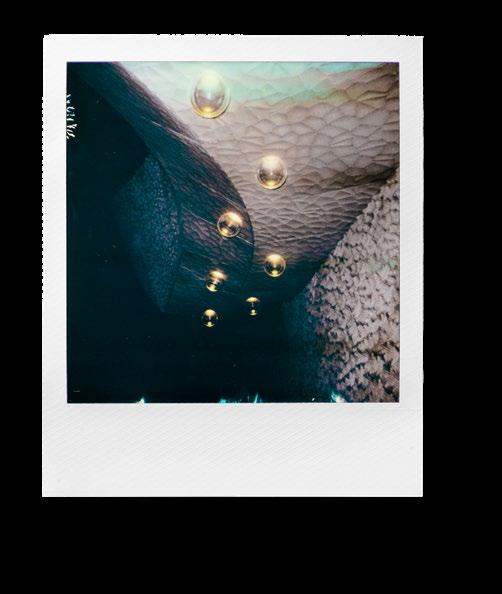



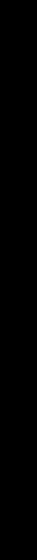
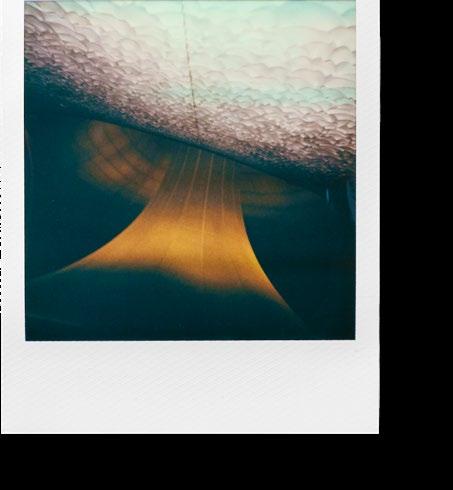

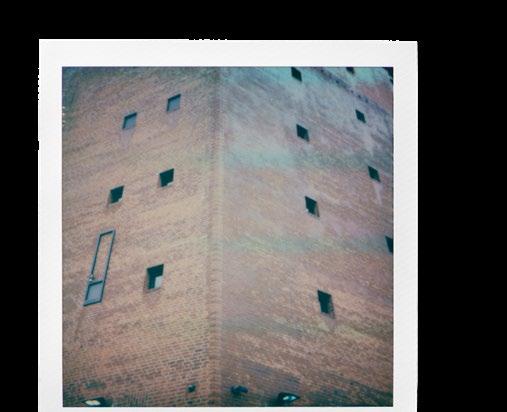


Der Singer-Songwriter und Komponist Rufus Wainwright im Gespräch über sein »Dream Requiem« und die Unterschiede zwischen Pop und Oper.
VON
BJØRN WOLL
Dieser Mann passt in keine Schublade: 1973 wurde Rufus Wainwright im Bundesstaat New York geboren, wuchs aber in Montreal auf und besitzt deshalb sowohl die US-amerikanische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft. 2023 erschien sein Album »Folkocracy«, eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, als er mit seinen berühmten Eltern, den Folk-Sängern Loudon Wainwright III und Kate McGarrigle, die Sommer auf Festivals verbrachte. Er selbst hat als Singer-Songwriter vor allem Popmusik gemacht. Beherrscht die große, glamouröse Geste dabei genauso gut wie den intimen Moment, getragen von seiner charakteristischen, sanft-rauen Stimme. Auch zu zahlreichen Soundtracks lieferte er Musik, darunter »Brokeback Mountain«, »Moulin Rouge« oder »Shrek«. Raffiniert und sophisticated sind seine Kompositionen. Er ist exzentrisch, eine queere Ikone und politisch aktiv; in den USA hat er sich für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe eingesetzt. Seit 2012 ist er mit dem deutschen Theaterproduzenten und Kurator
Jörn Weisbrodt verheiratet, seit 2011 hat er eine Tochter mit Lorca Cohen, der Tochter von Leonard Cohen. Schon als Teenager war Wainwright von Verdi fasziniert – der Beginn einer lebenslangen Opernpassion. Mittlerweile hat er sich selbst als klassischer Komponist etabliert, hat zwei Opern geschrieben – »Prima Donna« (2009, Manchester) und »Hadrian« (2018, Toronto) –sowie eine Reihe von Shakespeare-Sonetten für den Regisseur Robert Wilson vertont (2009, Berlin). Mit dem »Dream Requiem« hat er im vergangenen Jahr seinen klassischen Werkkatalog um ein kapitales Stück erweitert. Darin trifft der Text der lateinischen Totenmesse auf Lord Byrons apokalyptisches Gedicht »Darkness« (1816) mit seiner düsteren Endzeitstimmung. Nach der Premiere in Paris erlebt das kolossale Werk für Orchester, Chor, Sopran und Sprecherin nun in der Elbphilharmonie seine deutsche Erstaufführung. Die Byron-Verse werden von Isabelle Huppert rezitiert, der Grande Dame des französischen Films.
Herr Wainwright, woher kommt Ihre starke Verbindung zur klassischen Musik?
Rufus Wainwright: Ich bin nicht mit klassischer Musik aufgewachsen, meine Eltern waren Folk-Sänger. Meine Mutter hörte auch Künstler wie Glenn Gould, Martha Argerich und Luciano Pavarotti, sie war aber nicht wirklich eine Klassik-Enthusiastin. Mit 13 habe ich dann eine Aufnahme des Verdi-Requiems mit Leontyne Price und Jussi Björling gehört – und auf einmal war da dieser Hunger nach Klassik und besonders der Oper.
Klassischer Musiker wollten Sie aber nicht werden? Ich war damals mehr daran interessiert, Songs zu schreiben, und wollte meine Jugend, sagen wir mal, auf eine dekadentere Art erleben. Allerdings wurde die Oper zu einer geheimen Zutat für meine Songs: Einige davon erinnern ›


in ihrer dramatischen Struktur eher an eine Arie. Das war ungewöhnlich und half mir, als Künstler wahrgenommen zu werden.
Mit »Prima Donna« haben Sie aber doch noch die Seiten gewechselt …
… weil ich das Gefühl hatte, dass ich der Oper etwas zurückgeben möchte. Es ist ein eher einfaches Stück und hat eine gewisse Naivität, trotzdem mag ich es sehr. Ich wollte das Rad damit auch gar nicht neu erfinden, ich musste erst mal lernen, für Orchester zu schreiben. Die Shakespeare-Sonette waren da schon ein anderes Kaliber: Wenn man es mit Shakespeare zu tun hat, muss man zwangsläufig einen Gang höher schalten. Vor allem mit der Orchestrierung war ich zunächst unzufrieden und habe mir dafür extra die Unterstützung eines Orchestrators geholt. Die Erfahrung mit den Sonetten war ein wichtiger Schritt zu meiner nächsten Oper »Hadrian«, denn dafür musste ich einen Sound für das gesamte römische Imperium schaffen.
Wie lief die Arbeit am »Dream Requiem«, das ja noch größer besetzt ist?
Ich habe mich endlich als Komponist sicher gefühlt, weil ich genügend Erfahrung bei der Arbeit mit Orchester hatte, um mich wirkungsvoll ausdrücken zu können. Das galt aber nicht für den Chor: Das Schreiben von Chor sätzen habe ich voll und ganz erst mit dem Requiem gelernt.
War das eine bewusste Entscheidung, klassischer Komponist zu werden, oder ist das einfach so passiert?
Wie gesagt, der Einfluss der Klassik war in meiner Musik eigentlich schon immer da. Aber ich betrachte mich nicht
Innerste Gefühle im Songformat: Rufus Wainwright mit Mark Hummel in der Elbphilharmonie (2017)
als klassischen Komponisten per se. Oder bin ich doch einer? Ich weiß es gar nicht … Ich meine, ich könnte schon sagen, dass ich einer bin – obwohl mich das immer noch ein bisschen nervös macht, ich bin in gewisser Hinsicht durchaus bescheiden, ob Sie es glauben oder nicht. Aber ich bekomme regelmäßig Anfragen für mehr Opern, Orchesterstücke, Ballette. Es gibt also eine Nachfrage. Ich schätze, ich bin ein klassischer Komponist. Oh Gott!
In Deutschland gibt es oft eine große Skepsis, wenn Künstler die Grenzen zwischen U und EMusik überschreiten. Wie erleben Sie das?
Das ist mir bewusst. Aber ich tue gar nicht so, als sei ich der neue Bach oder Beethoven. Mein Name beginnt ja noch nicht mal mit einem B (lacht). Eine wirklich prägende Erkenntnis habe ich von Brigitte Fassbaender, deren Interpretation der »Winterreise« ich rauf und runter gehört habe, ich war wie besessen davon. Sie hat einmal gesagt, dass es bei Schubert kurze Momente gibt, die mehr bewegen als eine Fünf-Stunden-Oper. Wenn mir das in meinen Werken gelingt, die Menschen für ein, zwei Momente wirklich zu berühren, anstatt sie mit meinen intellektuellen Fähigkeiten und technischen Fertigkeiten zu überwältigen, dann habe ich meinen Job erledigt.
Macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie Pop oder Klassik komponieren?
Einen Song zu schreiben, ist sehr intim. Man versucht dabei, seine innersten Gefühle einzufangen. Wenn man ein klassisches Stück komponiert, eine Oper zum Beispiel, muss man stärker überlegen, was das Beste für das Werk ist. Man muss sich selbst ein bisschen aus der Gleichung herausnehmen. Allerdings gibt es im Requiem zwei Momente, die stark von meiner Popmusik beeinflusst sind:
Das »Agnus Dei« habe ich vor Jahren einmal für ein PopAlbum geschrieben. Und auch das »Sanctus« war ursprünglich ein Popsong, bei dem ich lange Zeit nicht wusste, was ich damit anfangen sollte. Vielleicht gibt es also eine stärkere Verbindung, als ich glauben möchte.
Ein entscheidender Unterschied zwischen einem Popsong und einer Oper ist die Länge. Beängstigt Sie das nicht?
Ich habe keine Angst davor, weil ich instinktiv komponiere, egal in welchem Genre. Ich befinde mich in einer Art Trance, so finde ich am besten heraus, wie ich das Schiff über Wasser halten kann. Das hat nichts mit Intellekt zu tun. Klar, ich habe eine Menge gelernt, und das ist alles in meinem Kopf. Aber wenn ich konkret schreibe, ist das ein sehr animalischer Prozess. Die lange Form macht mir also gar nicht so viele Sorgen. Mir fällt es eher schwer, mich in meinen Popsongs kurz genug zu fassen.
Brauchen Sie eine bestimmte Umgebung, um in diese Trance zu kommen?
Für mich spielt vor allem der Ort eine besondere Rolle. Für »Hadrian« bin ich extra nach Rom gereist, um Teile der Oper dort zu komponieren. Das Requiem ist in Los Angeles entstanden. Ich habe eine Freundin, die eine abgefahrene Villa in den Hollywood Hills besitzt, ein bisschen wie aus »Sunset Boulevard«. Dort saß ich dann mit Blick auf das Hollywood-Zeichen, während um mich herum Sandstürme und Feuer wüteten. Ursprünglich war es das Anwesen eines Stummfilmstars, später wurde aber eine katholische Mädchenschule daraus. Es gab also eine Menge katholischer Ikonografie, Bilder der

»Ich bin total von Strauss beeinflusst. Außerdem liebe ich Janáček und Messiaen. Auch ziemlich viel Berlioz steckt drin.«
Jungfrau Maria oder von Märtyrern, die gefoltert wurden. Die Naturkatastrophe draußen und die Heiligenbilder innen haben mich bei meiner Arbeit stark beeinflusst.
Worum geht es im »Dream Requiem«?
In die Zeit meiner Arbeit daran fiel die erste Amtszeit von Donald Trump, aber auch der Beginn der CovidPandemie. Außerdem gab es diese verheerenden Brände in Los Angeles. All das hat seine Spuren hinterlassen, das Stück wurde intensiver und düsterer. Kurz nach der Premiere in Paris wurde Trump erneut Präsident. Das »Dream Requiem« wurde so etwas wie der Tod des amerikanischen Traums. Es ist wie ein Hilferuf inmitten dieses ökologischen und politischen Strudels, in dem wir uns gerade befinden.
Trotzdem gibt es Momente von Schönheit in der Musik. Es ist aber eine vergängliche Schönheit, ein bisschen wie der Klang von Gustav Mahler vor dem Ersten Weltkrieg, eine Art Vorahnung des Endes.
In Ihrem Requiem unterbrechen Sie den traditionellen Text der lateinischen Totenmesse mit Passagen aus dem Gedicht »Darkness« von Lord Byron. Etwas Ähnliches hat Benjamin Britten in seinem »War Requiem« gemacht. Was war Ihre Absicht dabei?
Britten hat mich in der Tat beeinflusst. An dem Tag, an dem Putin die Ukraine überfiel, habe ich mir gerade Ausschnitte daraus angehört. Von diesem seltsamen Zufall war ich irgendwie betroffen. Es gibt aber noch einen anderen Grund: Ich bin kein religiöser Mensch. Es sollte also kein rein religiöses Werk werden, daher wollte ich ein säkulares Element, das auch mehr über die Umweltkatastrophe spricht, in der wir uns alle befinden.
Anders als bei Britten wird das Gedicht bei Ihnen nicht gesungen – warum?
Es ist viel einfacher, Latein zu vertonen, als es zu sprechen. Man muss nur genau hinhören, dann geht es fast von selbst. Im Englischen klappt das mit dem Singen nicht so einfach. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, Byrons Verse rezitieren zu lassen. Das bringt noch einmal eine andere Dimension in die Komposition. Außerdem ist es letztendlich auch ein gutes Werkzeug, das Stück zu promoten, wenn man, wie bei der Uraufführung, Meryl Streep hat oder Isabelle Huppert in Hamburg. Allerdings hatte ich das nicht so geplant. Alle Elemente haben sich ganz natürlich ergeben, was ein wichtiger Aspekt der Kreativität ist: Man musste die Dinge geschehen lassen.
Gewidmet ist das Werk unter anderem Ihrem großen Vorbild Giuseppe Verdi. Wo hören wir das besonders deutlich?
Der Anfang war mir wichtig, denn ich liebe den Anfang von Verdis Requiem. Er bringt uns sofort in diese Atmosphäre, man ist direkt gefangen. Das zu erreichen, habe ich auch versucht – die Leute wirklich gleich zu fesseln. Auch an sein beeindruckendes »Dies irae« wollte ich zumindest heranreichen. Was mir nicht unbedingt gelungen ist. Aber es ist ein guter Versuch, würde ich sagen.
Gab es andere Komponisten, die Sie beeinflusst haben?
Ich bin total von Strauss beeinflusst. Außerdem liebe ich Janácˇek und Messiaen. Man kann im Requiem tatsächlich hier und da ein bisschen Messiaen hören. Auch ziemlich viel Berlioz steckt drin. Eine Menge von großen Komponisten haben bei mir ihre Spuren hinterlassen, auch Schubert.
Hat sich Ihr eigener Stil als Komponist über die Jahre eigentlich verändert, von der ersten Oper bis zum »Dream Requiem«?
Ich glaube nicht, dass sich mein Stil geändert hat. Ich bin immer noch derselbe, glaube zu hundert Prozent an die große Melodie. Das ist das eine Element in der modernen klassischen Musik, das meiner Meinung nach fehlt. Damit meine ich nicht irgendeine Melodie, sondern so etwas wie die »Méditation« aus Massenets »Thaïs«,

22. und 23.8.2025 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal symphoniker hamburg, Lucie Leguay carl-Philipp-emanuel-Bach-chor hamburg, knabenchor hannover Mandy Fredrich (sopran) isabelle huppert (sprecherin) rufus Wainwright: dream requiem
eine Melodie, die alles um sie herum verblassen lässt. Für Komponisten war das früher die Norm, heute ist es selten geworden.
Als SingerSongwriter sind Sie Ihr eigener Interpret. Wie ist das für Sie bei einem Werk wie dem »Dream Requiem«, das Sie irgendwann aus der Hand geben müssen, und dann sind andere dafür verantwortlich? Ich erinnere mich an die erste Orchesterprobe vor der Premiere in Paris mit Mikko Franck. Das war das erste Mal, dass ich das Requiem live von einem Orchester gehört habe. Dann kam auch noch Meryl Streep spontan dazu und hat die ganze Zeit meine Hand gehalten. Ich habe mir nur gedacht: Ich höre mein Stück zum ersten Mal, und neben mir sitzt Meryl Streep – das ist verrückt! In diesem Moment war ich total erleichtert, das war nicht immer so. Als meine erste Oper uraufgeführt wurde, hatte ich mich als Verdi verkleidet – und kam mir am Ende ziemlich lächerlich vor. Ich war einfach nur nervös und verunsichert, es war ein Albtraum. Beim Requiem war das ganz anders, da war ich von einigen Momenten ehrlich überwältigt und bewegt.
Ihre Karriere als SingerSongwriter wollen Sie jetzt aber nicht an den Nagel hängen und nur noch als klassischer Komponist arbeiten? Noch nicht. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr singen kann, habe ich einen Plan B.


Nutzen Sie die Vorteile eines Abonnements und lassen Sie sich die nächsten Ausgaben direkt nach Hause liefern. Oder verschenken Sie das Magazin-Abo.
3 Ausgaben zum Preis von € 15 (Ausland € 22,50) Preis inklusive Mwst. und Versand
Unter-28-Jahre-Abo: 3 Ausgaben zum Preis von € 10 (bitte Altersnachweis beifügen)
Jetzt Fan der elbphilharmonie Facebook-community werden: www.fb.com / elbphilharmonie.hamburg
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular zu:
ELBPHILHARMONIE MA g AZ in Leserservice, Pressup gmbh Postfach 70 13 11, 22013 hamburg
Oder nutzen Sie eine der folgenden Alternativen: tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299 e-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de internet: www.elbphilharmonie.de
Für wen ist das Abonnement?
Für mich selbst ein geschenk
Das Abo soll starten mit der aktuellen Ausgabe der nächsten Ausgabe
Rechnungsanschrift:
name Vorname
Zusatz
straße / nr.
Land
Mit der Zusendung meiner rechnung per e-Mail bin ich einverstanden.
hamburgMusik ggmbh darf mich per e-Mail über aktuelle Veranstaltungen informieren.
Ggf. abweichende Lieferadresse (z. B. bei Geschenk-Abo):
e-Mail (erforderlich, wenn rechnung per e-Mail) name Vorname
Zusatz
straße / nr. PLZ ort
Jederzeit kündigen nach Mindestfrist: ein geschenk-Abonnement endet automatisch nach 3 Ausgaben, ansonsten verlängert sich das Abonnement um weitere 3 Ausgaben, kann aber nach dem Bezug der ersten 3 Ausgaben jederzeit ohne einhaltung einer kündigungsfrist zum ende der verlängerten Laufzeit gekündigt werden.
Widerrufsrecht: die Bestellung kann innerhalb von 14 tagen ohne Angabe von gründen in textform (z. B. Brief, Fax oder e-Mail) oder telefonisch widerrufen werden. die Frist beginnt ab erhalt des ersten hefts. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (datum des Poststempels) an: elbphilharmonie Magazin Leserservice, Pressup gmbh, Postfach 70 13 11, 22013 hamburg tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299, e-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de
Elbphilharmonie Magazin ist eine Publikation der HamburgMusik gGmbH Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg, Deutschland
Geschäftsführer: Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Zahlungsweise:
Bequem per Bankeinzug gegen rechnung
kontoinhaber
Bic (bitte unbedingt bei Zahlungen aus dem Ausland angeben) geldinstitut
SEPA-Lastschriftmandat: ich ermächtige die hamburgMusik ggmbh bzw. deren beauftragte Abo-Verwaltung, die Pressup gmbh gläubiger-identifikationsnummer de32ZZZ00000516888, Zahlungen von meinem konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die von der hamburgMusik ggmbh bzw. deren beauftragter Abo-Verwaltung, die Pressup gmbh, auf mein konto gezogenen Lastschriften einzulösen. die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.
hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. die einzugsermächtigung erlischt automatisch mit Ablauf des Abonnements.
Land datum unterschrift
Alle Welt feiert die Jugend, ist aber von Jugendlichen genervt.
VON TILL RAETHER ILLUSTRATION NADINE REDLICH

Sobald meine Tochter die ersten Buchstaben und Wörter lernte, wurde ihre Klasse vom Lehrer angehalten, jede Woche Tagebuch zu führen. Er verteilte 27 chinesische Kladden aus dem EuroLaden, und ab da schrieben die Kinder, die keine Ahnung von Rechtschreibung hatten, jedes Wochenende, was sie erlebt hatten, um es montags in der Schule vorzutragen. Das war sehr schwer zu entziffern, vor allem in den ersten beiden Jahren, aber ein Eintrag ist mir stark in Erinnerung geblieben und hat sogar meinen Sprachgebrauch geprägt. Meine Tochter schrieb, sie wäre mit Lisbeth und Nina auf dem Hof gewesen, dann hätten sie ein Eis gegessen und dann seien sie an den Zaun zur benachbarten Oberschule gegangen und hätten »die Jogentlichen gergert«.
Seitdem nennen wir Jugendliche in der Familie Jogentliche. Es ist eigentlich kein Wunder, dass die siebenjährigen Mädchen sich getraut haben, die Jogentlichen zu ärgern. Erstens war, wie gesagt, ein Zaun dazwischen, zweitens ist es die Grundeinstellung der Gesellschaft: Jogentliche ärgern. Jogentliche müssen morgens um acht Trigonometrie lernen, obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass ihre Gehirne vor allem Schlaf und keine dummen Fragen brauchen. Ihre Treffpunkte werden plattgemacht, aber wenn sie einfach nur so in der Gegend rumstehen, vor allem mit Bluetooth-Lautsprecher, kriegen sie erst recht Ärger. Wenn die Eltern der Jogentlichen irgendwas mit Medien machen, schreiben sie Bücher über die Jugend ihrer Kinder und machen sich darin über »Pubertiere« oder »Pubertisten« lustig. Ihnen wird von internationalen SocialMedia-Konzernen suggeriert, sie seien hässlich, um Kosmetikprodukte und Fitnesskurse an sie zu verkaufen, zugleich wird ihnen ihre Idealform als unerreichbares Schönheitsideal vorgehalten. Die Klos ihrer Schulen sind wegen Sparzwang unbenutzbar, aber auf der Straße vapen dürfen sie auch nicht.
Ja, Babys haben es schwer, sie kriegen keine Kitaplätze und können kaum irgendwas alleine machen. Ja, die ältere Generation wird oft dafür kritisiert, dass sie viel Beige trägt und den Planeten zerstört hat. Aber in Wahrheit
wird keine Altersgruppe so herabgesetzt und ausgegrenzt wie die formlose, aber irgendwie zu laute, zu stille, zu nervige, zu verdruckste, zu freche, zu angepasste Masse der Jogentlichen. Ich finde, die zufällige Wortschöpfung meiner Tochter ist so schön, weil sie der geschmähten Gruppe etwas heitere Würde zurückgibt: Es klingt, als würde eine Loriot-Figur versuchen, das Wort Jugendliche vornehm auszusprechen.
Seit der Erfindung der Schriftsprache gibt es Dokumente, in denen Menschen mittleren Alters sich über die Jugend aufregen, und mit Jugend sind nicht Longboard-Fahrer um die dreißig gemeint, sondern Menschen, die nicht mehr jung genug sind, um wie Kinder die Lizenz zum Scheißebauen und dabei Niedlichsein zu haben, zugleich aber nicht alt genug, um ernstgenommen zu werden. Perfekt in Form gegossen hat die gesellschaftliche Haltung zu Jogentlichen dann George Bernhard Shaw mit seinem Aphorismus »Youth is wasted on the young«, die Jugend ist an Jogentliche verschwendet. Denn wir wollen alle, was sie haben: die scheinbare Unbeschwertheit, das feste Bindegewebe, die vielen offenen Optionen, die Energie, die Leidenschaft, den günstigen Bahn-Tarif. Wir gönnen ihnen gar nichts, nicht mal das Graffiti-Häuschen im Park, das jetzt abgerissen wird, weil alle, die nicht Jogentliche sind, der Spraydosen-Geruch stört.
Erich Kästner hat kritisiert, dass Menschen ihre Kindheit ablegen »wie einen alten Hut«: »Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt.« Das trifft noch viel mehr auf die eigene Jogentlichkeit zu. Ich versuche mich deshalb daran zu erinnern, was mir damals wirklich gutgetan hätte, was ich eigentlich gebraucht hätte. Es wäre gewesen: wohlwollend in Ruhe gelassen zu werden. Nicht ständig kritisiert, zum Schweigen gebracht und zum Reden aufgefordert zu werden, nicht begutachtet und ignoriert, nicht zu Bundesjugendspielen und zum Stillsitzen gezwungen zu werden. Kurz: nicht geärgert zu werden. Denn, da sind sich, glaube ich, alle aktuellen und früheren Jogentlichen einig, das dürfen wirklich nur Siebenjährige.
TILL RAETHER lebt und arbeitet als freier Journalist und Autor in Hamburg.


Die Vorpyrenäen

Katalonien ist die eigensinnigste Ecke der iberischen Halbinsel, und das gilt auch für seine Musik –im besten Sinne.
VON STEFAN FRANZEN
Frankreich
Pyrenäen
Vorpyrenäen
Montserrat Valencia
Katalonien – man denkt an Barcelona und seine fantastischen Modernismus-Bauten, an Antoni Gaudís Sagrada Familia, Joan Mirós Gemälde und den Cellisten Pau Casals, an die wilde Costa Brava und die hügelig-herbe Landschaft der Vorpyrenäen, an die internationalen Siegeszüge des FC Barcelona, an skurrile Bräuche wie die Castells, Pyramiden aus menschlichen Körpern in der Gegend um Tarragona. Und man denkt natürlich auch an die jüngeren politischen Ereignisse, an die erneuten Bestrebungen zur Abspaltung dieser Region von Spanien.
Valencia
erbitterten Bürgerkrieg, der hunderttausende Katalanen ins Exil zwang. Die eigenständige Sprache, in Varianten von der französischen Grenze über die Balearen bis nach Valencia verbreitet, wurde verboten. Erst nach dem Ende der faschistischen Herrschaft erlangte Katalonien 1979 teilweise Autonomie zurück.
Der Nordosten tickte schon immer ein wenig anders als der Rest der Iberischen Halbinsel. Für verschiedene Völker war er Durchzugsgebiet zwischen Britischen Inseln und Vorderem Orient. Auch ein maurischer Einfluss machte sich bemerkbar, wenngleich das Kalifat von Córdoba sich nicht auf die ganze Region ausdehnte. Ende des 10. Jahrhunderts lösten sich die nach Abzug der Araber entstandenen Grafschaften aus der westfränkischen Lehnsherrschaft, und das Prinzipat Katalonien stieg nach dem Zusammenschluss mit Aragonien zu einer wichtigen wirtschaftlichen Macht im Mittelmeerraum auf. Seit dem 15. Jahrhundert war Katalonien Spielball zwischen den Einflusssphären, wurde zunächst von Spanien mitregiert, musste seinen nördlich der Pyrenäen gelegenen Teil an Frankreich abtreten, schlug sich auf die Seite der Habsburger gegen die Bourbonen, wurde unter Napoleon Teil des französischen Kaiserreichs.
Seiner kurz währenden provisorischen Autonomie in der Zweiten Republik ab 1931 wurde es schon acht Jahre später durch die Franco-Diktatur beraubt, nach einem
Seitdem gibt es immer wieder das Verlangen nach noch mehr Befugnissen innerhalb Spaniens. Heftig hochgekocht ist das Thema zuletzt 2017, als die Region fast täglich in den Schlagzeilen war. Neunzig Prozent der Bevölkerung unterstützten ein Referendum zur Abspaltung von Spanien. Und als Ministerpräsident Sanchez die »sündigen« Separatisten 2023 begnadigte, um eine Regierung bilden zu können, brodelte erneut ein Für und Wider in der spanischen Gesellschaft auf, denn man will das wirtschaftlich höchst erfolgreiche und wohlhabende Katalonien nun mal nicht ziehen lassen.
Das Streben nach Unabhängigkeit hat auch in der Musik seine Spuren hinterlassen. Etwa in der heimlichen Hymne Kataloniens, »L’Estaca«, geschrieben 1968 vom Liedermacher Lluís Llach: »Siehst du nicht den Pfahl, an den wir alle gefesselt sind? Wenn wir alle ziehen, bringen wir ihn zu Fall, und wir können uns befreien.« Dieser Song ging in vielen Sprachen um die Welt, wurde zum musikalischen Sinnbild der Freiheitsbewegungen von Polen bis Lateinamerika. Auch ein Liedermacher wie Chicho Sánchez Ferlosio ließ 1964 in seinem Lied »Gallo Rojo, Gallo Negro« noch einmal den Kampf der Republikaner
gegen die Putschisten während der Dreißigerjahre in einer dramatischen Ballade Revue passieren.
Heute allerdings geht es in der unverwechselbaren Musikkultur des widerspenstigen Kataloniens zwar weiterhin um Eigensinn, weniger aber um Separatismus. Vielmehr um Verbindendes, um einen speziellen Kitt, der die Vernetzung in den Süden, nach Valencia, hinaus auf die Balearen und auch über die Pyrenäen bis nach Frankreich ermöglicht; der die ganze Region zu einer Kulturnation zusammenschweißt, ihr ein starkes internationales Gewicht mit eigenem Profil gegenüber den anderen spanischen Regionen ermöglicht; und der dafür sorgt, dass die katalanische Musik sich wie zu einem glitzernden trencadís fügt, zu einem bunten Mosaik aus Porzellanscherben, wie man es in den Arbeiten des Architekten Antoni Gaudí oft sehen kann.
Bereits ein sehr frühes, faszinierendes Kapitel der europäischen Musikgeschichte hatte seinen Schauplatz in Katalonien. Zwischen der Metropole Barcelona und dem Städt—chen Manresa liegt auf einem Felsen das Benediktinerkloster Montserrat, Zentrum der Marienverehrung seit dem Mittelalter. Damals war es gang und gäbe, dass die Pilger in der Kirche übernachteten; ihre mitgebrachten Lieder auf Lateinisch, Katalanisch und Okzitanisch integrierte man in die Liturgie. Und auch damals schon katalanischer Eigensinn: Diese religiösen Lieder wurden teils sogar getanzt. Erstmals gesammelt wurde das Repertoire in einem Manuskript, das von ungefähr 1400 datiert. Jahrhunderte später bekam das Buch einen roten Einband, daher sein heutiger Name »Llibre Vermell«.
Das Benediktinerkloster Montserrat

Viele Interpreten unserer Zeit beschäftigten sich mit diesem herausragenden frühen Zeugnis europäischer Musik. Als führender Musikforscher Kataloniens hat dies auch Jordi Savall mit seinen Chorund Instrumentalensembles La Capella Reial de Catalunya und Hespèrion XXI getan. Seit den Siebzigerjahren verschreibt sich der Gambist insbesondere der Alten Musik und ihren Verbindungen zu den Klängen anderer Kontinente. Seine Version des »Llibre Vermell« setzte bereits vor 45 Jahren Maßstäbe.
TANZ IM KREIS
Ebenfalls Wurzeln bis hinab ins Mittelalter besitzt der typische Klang Kataloniens, der Klang der Cobla-Kapellen mit ihren schneidend und kraftvoll tönenden Schalmeien. Deren Vorläuferinstrumente waren zunächst bei den Spielleuten der Städte und im kirchlichen Kontext beheimatet. Dann kamen sie bei der einfachen Landbevölkerung in Gebrauch, denn sie waren laut und einfach zu spielen, also ideal für den Einsatz bei Dorffesten. Aus diesen frühen Schalmeien entwickelten sich schließlich bis Mitte des 19. Jahrhunderts die heute typischen Instrumente: die Tenora und ihre höher klingende Verwandte, die Tibla. Schließlich kehrten sie ins städtische Umfeld zurück, beschrieben historisch also eine Art Zickzack-Bewegung, vereinigten sich mit moderneren Blechbläsern. Das war der Zeitpunkt, zu dem Komponisten anfingen, für diese Ensembles zu schreiben, die man nun in ihrer institutionalisierten Form Cobla nannte.
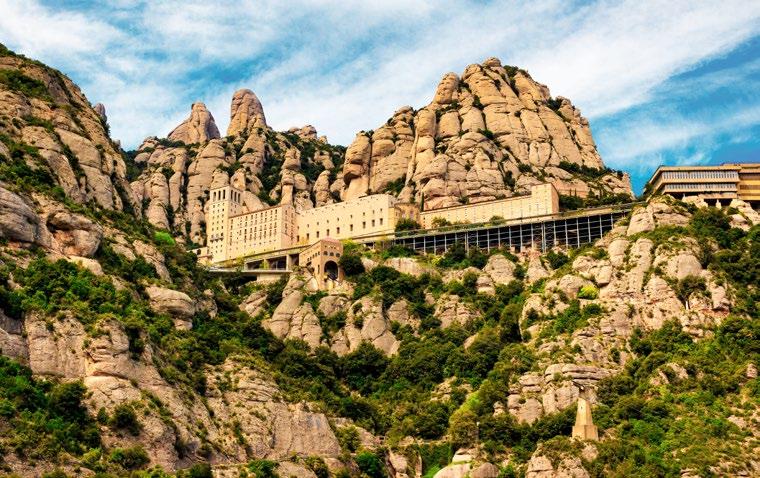

Zum schneidenden Klang der Schalmeien wird im Kreis getanzt. Unter Franco war diese Tradition verboten.
Die Stücke dieser reichen, komponierten Literatur nennen sich Sardanas. Es gibt sie auch in getanzter Form, als kreisrunden Reigen, meist im Freien ausgeführt – als regionales Kultursymbol waren sie unter Franco verboten. Die kunstvolle Konzertvariante zeigt sich einzigartig instrumentiert und mal witzig, mal romantisch oder gar melancholisch. Zu den Schalmeien treten in den Coblas der heutigen, meist elfköpfigen Besetzung hinzu: die Einhandflöte Flabiol (mit der anderen Hand schlägt der Spieler eine kleine Trommel), Trompeten, Ventilposaunen und das Fiscorn, eine Art Mini-Tuba, sowie zur basalen Stütze ein Kontrabass. Die Sardanas haben es bereits in den Siebzigern in die Rockmusik Kataloniens geschafft, als die Companyia Elèctrica Dharma für ihren Hit »Bal Llunatic« mit einer Cobla-Kapelle auf die Bühne ging.
KLASSISCH KATALANISCH
Überhaupt ist die Cobla-Literatur keineswegs eine verstaubte Musik. Es gibt wenige europäische Regionen, in der gerade der musikalische Nachwuchs ein so großes Interesse an den Wurzeln zeigt. Sardanas und überhaupt alle möglichen Arten der Tradition zu studieren, gilt in Katalonien mittlerweile als ultramodern. Mit dem Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) gibt es in Barcelona eine eigene Lehr-Institution für traditionelle Musik. Und das Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, dessen 20- bis 30-jährige Mitglieder aus allen Català sprechenden Gegenden stammen, kombiniert die Musik der Coblas mit Jazz, moderner Klassik und zeitgenössischer Poesie.

Zu den herausragenden Sardana-Ensembles zählt seit vierzig Jahren die Cobla Sant Jordi aus Barcelona, die sich im Laufe ihrer Geschichte ebenfalls dem Jazz, der Klassik und dem Flamenco geöffnet hat. Ihr Programm stellt Sardanas mit einer verblüffenden Spannbreite und aus mehr als hundert Jahren vor, darunter auch eine, die der Cellist Pau Casals im französischen Exil schrieb. Natürlich sind die Sardanas nur ein kleiner Teil dessen, was in Kataloniens Konzertsälen erklingt. Die Klassikszene der Region verfügt mit dem Orquestra Simfònica de Barcelona (OSB) über einen sinfonischen Klangkörper von Weltruf, der auch immer wieder lokale Eigenheiten, Traditionslinien und Größen vorstellt, etwa die Werke von Miquel


Wer einmal im Palau de la Música in Barcelona saß, wird dieses verblüffende Gesamtkunstwerk nicht mehr vergessen.
Oliu (geboren 1973), der in seine moderne Tonsprache Einflüsse von Robert Schumann bis Sofia Gubaidulina integriert. Oder von Federico Mompou (1893–1987), einer der großen Namen der katalanischen Musikhistorie und zugleich wohl der größte Eigenbrötler unter den Komponisten des iberischen Nordostens.
Mompous Ausgangspunkt in seiner Jugend war die damals brandaktuelle Musik von Claude Debussy und Erik Satie. Bekannt wurde er vor allem durch seine Klavierzyklen, die er über einen Zeitraum von fünfzig Jahren hinweg schrieb, gipfelnd in der »Música callada«, der Musik des Schweigens: Klänge von geradezu asketischer Kargheit mit metallischen, glockenartigen Akkorden, inspiriert durch die Schriften des Mystikers Juan de la Cruz aus dem 16. Jahrhundert. Mompou schuf aber auch Lieder, die später in eine Orchesterfassung gebracht wurden. Auch in seinen Kompositionen für Gesang dominiert ein melancholischer Ton, der sich durch eine einfache, volksnahe Melodiehaftigkeit auszeichnet, durchkreuzt jedoch immer wieder von einer raffinierten Chromatik.

Wer einmal im Palau de la Música Catalana saß, jenem modernistischen Wunderwerk im Herzen Barcelonas, wird dieses Erlebnis nicht mehr vergessen. Erbaut zwischen 1905 und 1908 von Lluís Domènech i Montaner, ist dieser Saal unter allen Konzertsälen der Welt das vielleicht verblüffendste Gesamtkunstwerk mit seinen opulent verzierten, leuchtenden Fenstern und Kuppeln, den Mosaiksäulen und Skulpturen. Der Palau gehört dem Volkschor Orfeó Català. Dessen Profi-Ensemble ist der Cor de Cambra, und in der Arbeit dieses Kammerchors schillert die vokale Pracht der spanischen Nordostregion über die Jahrhunderte und Stile hinweg. Seit 35 Jahren ist es seine Mission, das reiche katalanische Musikerbe wiederzuentdecken, zu bewahren und zugleich neue Werke anzuregen. So erstreckt sich sein Repertoire von geistlichen Gesängen der Renaissance bis hin zum Umgang einer neuen Komponistengeneration mit traditionellen Formen wie der Sardana, der Jota und dem Fandango. Die Jugendlichkeit der katalanischen Tradition setzt sich in etlichen, international tätigen Vokalensembles fort, die Volksmusik mit Electronica

kombinieren und dabei auf einen reichen Fundus von Genres zurückgreifen können. Da wäre die Glosa, eine Art espritvolles Stegreifgedicht, die heute gern auch genutzt wird, um aktuelle politische und gesellschaftliche Ereignisse zu kommentieren. Andere beliebte Formen sind die balearischen Tonadas und die Cants de Batre, die traditionell bei der Arbeit gesungen wurden. Das Frauenduo Tarta Relena setzt bei der Modernisierung alter Formen auf den charaktervollen Klang der katalanischen Sprache. Es greift neben den katalanischen und balearischen Quellen aber ebenso auf Traditionen aus Korsika, Kreta und Georgien zurück, huldigt Hildegard von Bingen und Songwriterinnen des 21. Jahrhunderts wie Björk –und schafft dadurch einen zeitgemäßen, jugendlichen Electronic-Folk, stets mit den ausdrucksstarken Stimmen im Brennpunkt.
IBERISCHES TIMBRE
Die derzeit vielleicht größte Stimme der katalanischen Musik gehört der Sängerin und Liederschreiberin Sílvia Pérez Cruz. Sie stammt aus dem Küstenort Palafrugell an der Costa Brava, deren regionale Eigenheiten sie mit vielen Klangfacetten Spaniens und der ganzen lateinamerikanischen Welt zu einer globalen Vokalmagie verbindet. Pérez Cruz wuchs mit der Habanera auf, die als Rückimport von Kuba in Palafrugell eine Hochburg hat; ihr früh verstorbener Vater war der führende Forscher dieses
Genres. Das Vehikel für all ihre musikalischen Visionen ist immer die Liedform, der Song, der Cancíon, das Chanson. »Wenn ich ein Lied höre, dann bin ich gleich in der Lage, die Schönheit darin zu erfassen«, sagt sie. »Mir kommt es auf Gefühle an, ich denke nicht in Genres wie klassischer Musik oder Rock.«
Und so enthüllt die 42-Jährige denn auch ohne stilistische oder geografische Grenzen stets die zeitlose Essenz eines Liedes. Ganz gleich, ob das nun aus ihrer eigenen Tradition oder aus dem Flamenco kommt, aus Brasilien, dem portugiesischen Fado oder der kubanischen Habanera. Ob sie Édith Piafs »Hymne à l’amour« aufgreift, Leonard Cohens »Take This Waltz« oder die mexikanische Ranchera »Cucurrucucú paloma«. Selbst Kunstlieder von Robert Schumann hat sie bereits adaptiert, eine Motette von Anton Bruckner mit dem Jazzstandard »My Funny Valentine« verknüpft.
»In einer Stimme liegt so vieles, was über Stile oder Territoriales, über den Körper hinausreicht«, sagt Pérez Cruz. »Aber: Ich kann mein Timbre als klar iberisch definieren. Da gibt es etwas, das alle Großmütter der Halbinsel hatten, das sich in allen Regionen und nicht nur im Fado oder Flamenco wiederfindet. Und das trage auch ich in meiner Stimme.« Eine Stimme, die trotz ihrer hohen Tonlage kraftvoll-erdig, dann wieder fast wispernd sein kann, die opulente Verzierungen und ein feinsinniges Vibrieren zu ihren Tugenden zählt. Es ist diese



beeindruckende Beherrschung vokaler Facetten, die dafür sorgt, dass Konzerte von Pérez Cruz zu tief berührenden, lang nachhallenden Erlebnissen werden.
Für ihr neuestes Duo-Projekt hat sie sich mit dem Portugiesen Salvador Sobral zusammengetan. Der ESCSieger von 2017 studierte in Barcelona Jazz und hat schon deshalb einen engen Bezug zu Katalonien. Die beiden ließen sich Lieder von Pérez Cruz’ Bandgeiger Carlos Montfort, von südamerikanischen Größen wie dem Uruguayer Jorge Drexler oder der Brasilianerin Dora Morelenbaum auf den Leib schneidern, auch der Pianist Marco Mezquida hat ein Stück beigesteuert. In der Begleitband findet sich am Cello mit Marta Roma eine jener vielen jungen Koryphäen dieses Instruments, die in Katalonien die von Pau Casals vor über hundert Jahren begonnene Traditionslinie mit dem Geist des 21. Jahrhunderts weitertragen. Und mit Darío Barroso kann das Duo auf einen exzellenten Gitarristen zählen, der spielend zwischen folkigen Begleitmustern und Flamencotechniken wechselt.
EIGENE SPIELART
Alma« trifft er auf den menorquinischen Pianisten Marco Mezquida, der nach eigenem Bekunden die Gesänge der Inselfischer genauso wie die der Pyrenäen in seiner DNA trägt. »Ich liebe das Klavier als solches und in seiner ganzen Vielseitigkeit«, sagt Mezquida. »Manche meiner Experimente klingen viel eher nach zeitgenössischer Klassik als nach Jazz, ich bin von Gamelan-Musik genauso inspiriert wie von der Kirchenorgel.«
Gemeinsam greifen Chicuelo und Mezquida hochvirtuos Flamenco-Rhythmen wie Zapateado, Bulería oder Tanguillo auf, formen ihren eigenen geistreichen Dialog in elegant tänzelndem Fluss und melodischem Überschwang, würzen mit Blues und Música Latina. Und zeigen musikalisch damit einmal mehr, was Katalonien auszeichnet: die überaus gelungene Verbindung von Kosmopolitismus und Eigensinnigkeit.
FOKUS CATALUNYA
Mi, 12.11.2025 | 20 Uhr
Laeiszhalle Großer Saal hespèrion xxi, La capella reial de catalunya, Jordi savall
Vokal- und instrumentalmusik aus dem »Llibre Vermell de Montserrat«
Do, 13.11.2025 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Juan gómez »chicuelo« (gitarre), Marco Mezquida (klavier), Paco de Mode (Perkussion) »del alma«
Fr, 14.11.2025 | 19 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal orquestra simfònica de Barcelona, Ludovic Morlot nuria rial (sopran)
Werke von claude debussy, Miquel oliu, isaac Albéniz, Maurice ravel und Federico Mompou
Fr, 14.11.2025 | 22 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal tarta relena: helena ros redon und Marta torrella i Martínez (stimmen) »És pregunta«
Sa, 15.11.2025 | 18 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal cobla sant Jordi – ciutat de Barcelona, Miquel Massana Ausgewählte katalanische sardanas
Sa, 15.11.2025 | 20 Uhr

Apropos Flamenco: Bei diesem Stichwort denken die meisten wohl an die Region Andalusien. Doch auch Katalonien verfügt über eine weltweit bekannt gewordene Spielart der Gitano-Musik, die Rumba Catalana, die mit den Gipsy Kings in den Achtziger- und Neunzigerjahren Welthits produzierte. Später, im Zug des von Manu Chao ausgelösten Hypes um die sogenannte Mestizo-Musik, trat sie in einer ruppigeren, vom Hip-Hop beeinflussten Variante mit Bands wie Ojos de Brujo ihren Siegeszug in der Weltmusik an. Heute lebt der Flamenco Kataloniens in aufregenden Jazzprojekten weiter, etwa beim Gitarristen Chicuelo, der noch bei der 2022 verstorbenen Legende Manolo Sanlúcar in die Lehre ging. Im Projekt »Del
Elbphilharmonie Kleiner Saal cor de cambra del Palau de la Música catalana, xavier Puig Marta cardona (Violine), Maria camahort (gitarre), Pere olivé (schlagwerk) katalanische Vokalmusik durch die Jahrhunderte und stile
So, 16.11.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal sílvia Pérez cruz (gesang, gitarre), salvador sobral (gesang, klavier), darío Barroso (gitarre), sebastià rosselló (gitarre), Marta roma (cello) »sílvia & salvador«
Großer Burstah 29 31
Hamburg
hamburg@embassies.com
040/60 773 881 0

Wohnen, Arbeiten und Gemeinschaft neu erleben.
Jetzt bewerben!
Im Herzen der Innenstadt, unweit von Rathaus und Binnenalster, entsteht in diesem Jahr mit «THE EMBASSIES» ein visionäres Wohn- und Lebenskonzept, das die Art und Weise, wie wir wohnen, arbeiten und uns begegnen, neu definiert.
Mit hochwertig ausgestatteten Apartments, einem exklusiven Clubbereich und vielfältigen Wellness- und Kulturangeboten richtet sich THE EMBASSIES an Menschen, die ein modernes und gemeinschaftliches Lebensumfeld suchen – ein Zuhause, das mehr ist als nur vier Wände.
Bewerbungen
Weitere Informationen zur Bewerbung finden Sie auf unserer Website. Gerne können Sie ab sofort einen Besichtigungstermin vereinbaren. embassies.com/hamburg
THE EMBASSIES HAMBURG CITY präsentiert sich als ein generationenübergreifendes, zeitgemäßes Wohnmodell. Ein Ort, an dem Begegnungen entstehen, Ideen wachsen und Lebensqualität großgeschrieben wird.

Für seine traurigen Lieder ist Bosnien seit Jahrhunderten bekannt: Illustration eines Tanzes (1870)
Sevdalinka
VON STEFAN FRANZEN
Zustände von Wehmut, Melancholie, Nostalgie werden in vielen Kulturen besungen. Es ist in Mode gekommen, solche Musik dann als den »Blues« der jeweiligen Länder zu bezeichnen. Aber ergibt das Sinn? Die Befindlichkeiten eines Volkes und die historischen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Musikstils sind doch sehr verschieden. Schon deshalb ist der notorische Rückgriff auf den Vergleich zum afro-amerikanischen Blues zu einfach. Ein wenig erinnert es an die beliebte Praxis, einen Musiker »den Jimi Hendrix seines Instruments« zu nennen, nur weil er besonders virtuos spielt oder gewagte Techniken beherrscht.
In der Musik Bosnien-Herzegowinas heißt das melancholische Nationalgenre Sevdalinka, und es wurde 2024 sogar von der UNESCO in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Das Wort ist abgeleitet vom allgemeinen Begriff für die Folklore, sevda, etliche ex-jugoslawische Völker haben es als Lehnwort aus dem Türkischen stibitzt. Dort bedeutet es Leidenschaft, sehnsüchtige Liebe, und auch bei den Bosniern steht das Wort heute für das Schmachten. Dass sevda (auch sevdah) wiederum so sehr dem Klang der portugiesischen saudade, der Bezeichnung für den dortigen Wehmutszustand ähnelt, ist kein Zufall. Das Wort hat seinen Vorläufer im arabischen Kulturraum, wurde dort und im Osmanischen Reich unter Medizinern verwendet: Sauda¯ entspricht dem griechischen melas cholé, der schwarzen Galle, und die war ja nach alter Vorstellung für die Traurigkeit, für den »Blues« zuständig.
Nach so viel Etymologie jetzt aber ein Blick auf die Musik. Zeugnisse über die Sevdalinka reichen über 500 Jahre zurück; das Genre hat sich sowohl aus osmanischen Einflüssen als auch den Mitbringseln der aus Spanien geflüchteten Sepharden entwickelt. Ein italienischer Reisender gibt bereits im späten 16. Jahrhundert Zeugnis ab vom Hören »trauriger Lieder«. Frühe Formen beschäftigten sich mit verbotener Liebe und verblichenen Geliebten. Diese Themen blieben, wobei die Liebe auch aus der Perspektive weiblicher Sexualität besungen und hin und wieder von ihren komischen Seiten her beleuchtet wird. Im Allgemeinen sind die Lieder langsam, besitzen eine komplexe Melodie mit Ausschmückungen. Die Reibungen darin, das Ziehen der Tonhöhe kann als verwandt mit den
blue notes der Afroamerikaner empfunden werden, auch wenn die Skalen selbst nicht pentatonisch wie im Blues aufgebaut sind.
Mit dem Aufkommen des Radios und der Schallplatte nahm die Sevdalinka einen großen Aufschwung, und die heute übliche Band-Besetzung kristallisierte sich heraus: Am wichtigsten ist das Akkordeon, dann Geige, Akustikgitarre, Bass und Schlagzeug, ab und zu auch Flöte und Klarinette. Die bedeutendste Sevdalinka-Band der Neuzeit ist zweifelsohne die Mostar Sevdah Reunion, deren Entstehen wesentlich mit den Nachwehen des Jugoslawienkriegs von 1991 bis 2001 zu tun hat.
Nachdem die Stadt Mostar mit ihrem weltberühmten Wahrzeichen, der alten Bogenbrücke Stari most über den Fluss Neretva, 1993 im Krieg zerstört worden war, hat sich eine große Lethargie auf die Einwohner gelegt. Der Musikproduzent Dragi Šestic´ nimmt Lieder auf einer Kassette auf, um seinen Schmerz zu zähmen, und schwört sich, nach Kriegsende die Sevdalinka international bekannt zu machen. Schließlich lässt er aus den baulichen und seelischen Trümmern 1999 ein Bandprojekt erstehen, das in Mostar und darüber hinaus hilft, die Wunden mit Musik zu heilen. Dafür holt er sich ganz unterschiedliche Sängerinnen und Sänger an Bord, etwa den König der RomaMusik, Šaban Bajramovic´, oder Sevdalinka-Diven wie Ljiljana Buttler und Amira Medunjanin. Im Laufe ihrer mittlerweile 25-jährigen Geschichte hat die Mostar Sevdah Reunion die Sevdalinka rundum mit einem frischen Anstrich versehen. Die melancholischen Lieder paart sie in ihrem aktuellen Programm »Bosa Mara« mit schnelleren

Tänzen, mit Jazz und mit Ausflügen ins Kosovo, nach Albanien und Kroatien. Aktuelle Sängerin ist Antonija Batinic´, die auch rockige Anleihen in ihre ornamentalen Gesangslinien einbaut.
Seine Gefühlslage hat der in die Niederlande ausgewanderte Band-Initiator und -Produzent Šestic´ 2013 bei der Veröffentlichung des Albums »Tales From A Forgotten City« erläutert, das er den Poetinnen und Poeten Mostars widmete: »Jedes Mal, wenn ich ein paar Tage in Mostar verbracht habe, überfällt mich Melancholie. Ich werde mir klar darüber, dass es heute nicht mehr die gleiche Stadt ist, die ich in meinen Gedanken gespeichert habe, von der ich träume, wenn ich mich Momenten der Nostalgie hingebe.« Und so hat die Sevdalinka nach dem Krieg eine weitere Facette der Wehmut hinzugewonnen: die der Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, des Exils. In diesem Punkt hat sie eine Schnittmenge mit dem Blues der deportierten Afroamerikaner. Und übrigens auch mit der Saudade, die ja nicht nur verlorener Liebe nachtrauert, sondern in der immer auch die unwiederbringliche Größe Portugals als Weltmacht mitschwingt.
Dieses Trauern um verlorene Größe und Heimat ist auch die Wurzel des griechischen Rembetiko. Er ist das musikalische Ergebnis der Vertreibung von mehr als einer Million Griechen aus Kleinasien 1922: Das Osmanische Reich hat den Ersten Weltkrieg verloren, wehrt sich gegen den Beschluss der Siegermächte, die türkischen Gebiete einzuschrumpfen. Um die Gebiete an der Ägäis zu halten, sollen die dort in großer Zahl siedelnden Griechen und Armenier vertrieben werden. Beim großen Brand von Smyrna (heute Izmir) im September 1922 werden deren Viertel vollständig zerstört. Die überlebenden Griechen fliehen auf die westliche Seite der Ägäis. So gelangt ihre sehr orientalisch geprägte Musikkultur, die auch Einflüsse aus den
Das Piräus-Quartett (Mitte der 1930er-Jahre)

George Dalaras
jüdischen Gemeinden der Stadt aufgesogen hat, aufs griechische Festland.
Während in Smyrna und im osmanisch-jüdisch geprägten Thessaloniki die Lieder in den »Café Amans« mit Begleitung von Violine, Oud und der Kastenzither Santur dargeboten worden sind, entwickelt sich unter den verelendeten Flüchtlingen vor allem im Hafen von Piräus eine schwermütigere Musik: In Haschhöhlen und Gefängnissen, im Reich der Gauner, Seeleute, Hafenarbeiter und Prostituierten macht sich Perspektivlosigkeit breit. Die Musiker dieses Milieus, die Rebetes, tragen ihre Verse mit brüchiger Stimme lediglich zur Begleitung von Bouzouki und ihrer kleineren Variante, der Baglamas vor. Dieser

Im Hafen, in den Haschhöhlen und Gefängnissen von Piräus, im Reich der Gauner, Seeleute und Prostituierten entwickelt sich eine schwermütige Musik: der Rembetiko.
ursprünglich orientalisch geprägte Gesang vermischt sich nun mit westlichen Tonarten zu einem faszinierenden, ambivalenten Klanggeflecht, dem Rembetiko. Ein Ausdrucksmedium der Benachteiligten, Vertriebenen: Das ist die Gemeinsamkeit zum Blues in den USA, dazu auch die Kargheit der Instrumentierung und die schmerzensreiche Stimmgebung. Das urbane Umfeld allerdings unterscheidet ihn vom frühen Blues. Bis heute hat diese untergründige Musik, die während der Diktatur ab 1936 verboten war, immer wieder stilistische Wandlungen erfahren und sich im Laufe der Jahrzehnte nicht zuletzt der elektrifizierten Popmusik angenähert. Das wiederum ist eine Entwicklung, die auch der Blues von den ländlichen Gebieten hinein nach Chicago und andere Metropolen genommen hat. Für diesen modernen Rembetiko steht George Dalaras, der selbst aus Piräus stammt. Schon in den 1960ern stand er auf der Bühne. Arbeitete nach dem Ende der Militärjunta mit Mikis Theodorakis, später auch mit internationalen Popgrößen von Paco de Lucía bis Bruce Springsteen, nahm weit über 50 Platten auf. Der Rembetiko spielt in den Facetten seiner Vita immer wieder eine große Rolle, und bei ihm ist er zu großer Liedermacherkunst mit ausgetüfteltem Kolorit avanciert. Einem der Pioniere des Genres, Markos Vamvakaris, hat er 2004 ein ganzes Album gewidmet.
Auch im Alter besitzt Dalaras’ Stimme noch die Kraft eines sanften, wendigen Tenors mit großzügigem Vibrato, der sich auch mal in kräftige Kehligkeit aufschwingt. Meist singt er mit geschlossenen Augen, inbrünstig und mit Pathos, aber selten affektiert oder prätentiös. Bei George Dalaras ist der Rembetiko von der Musik des Untergrunds, vom einfach instrumentierten Aufschrei der Unterschicht, zur Musik des ganzen griechischen Volkes, seiner Emigranten und der nicht-griechischen Fans auf dem ganzen Globus geworden. Und auch diese Universalität teilt er, bei allen Unterschieden, mit dem Blues von heute, der längst eine Weltsprache geworden ist.
MOSTAR SEVDAH REUNION
Sa, 30.8.2025 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal Mostar sevdah reunion »Bosa Mara – 25 Jahre Balkan Blues«
GEORGE DALARAS
Sa, 4.10.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal george dalaras (gesang) rembetiko-ensemble »rembetiko – der Blues der griechen«
Royal Concertgebouw Orchestra
Klaus Mäkelä
Orchestre de Paris –Philharmonie
Esa-Pekka Salonen
Orchestre Philharmonique de Radio France
Mirga Gražinytė-Tyla
Orchestre des Champs-Élysées / Collegium Vocale Gent
Philippe Herreweghe
Orchestra dell‘Accademia
Nazionale di Santa Cecilia / London Voices
Daniel Harding
Berliner Philharmoniker
François-Xavier Roth
Kirill Petrenko
und viele andere
Reflexion statt Reflex, das ist es, was Helmut Lachenmann mit seiner Musik auslösen möchte.
VON MICHAEL REBHAHN


Was ich will«, sagt Helmut Lachenmann in einem Interview aus dem Jahr 1971, »ist eine Musik zugleich als Ausdruck und ästhetisches Objekt einer Neugier, die bereit ist, alles zu reflektieren, aber auch in der Lage, jeden progressiven Schein zu entlarven.« – Alles reflektieren, alles infrage stellen, nichts als gegeben akzeptieren: Auf dem Fundament dieses methodischen Zweifels hat Lachenmann wie kaum ein zweiter Komponist die Bedeutungen dessen, was mit dem Begriff »Musik« gesichert scheint, grundlegend revidiert. Ihren Anfang nahm diese Entwicklung in Venedig. Ende der Fünfzigerjahre studierte Lachenmann dort privat bei
Nicht nur der Ton, sondern auch der Akt seiner Entstehung ist ihm wichtig: Der Komponist im Dokumentarfilm »Helmut Lachenmann – My Way« (2020)
Luigi Nono und ging durch die strikte Schule eines marxistisch grundierten kritischen Komponierens. Von Nono, resümiert er, habe er in erster Linie gelernt, »wie aus einer ästhetisch radikal umgepolten Umgebung Vertrautes so unvertraut stark und neu hervortritt«.
Die Befragung und Neubestimmung jenes »Vertrauten« wurde zu Helmut Lachenmanns großem Thema; ausgehend von Nonos Ideal einer antibürgerlichen Musik wollte er weiter gehen, »bis hinein in die energetischen Wurzeln der Klangmittel selbst dort, wo dies die gewohnte Musizierpraxis sprengt.« In diesem Sinne geht es seiner Musik immer um die kritische Analyse angestammter Hörhaltungen, um die Herauslösung des Unerwarteten aus der Sphäre eingeübter Wirkungen. Komponieren bedeutet für ihn gerade nicht, auf exotische Spielwiesen auszuweichen, sondern dort anzusetzen, wo sich die Konventionen verfestigt haben. Seine Aufgabe sei der Gang »in die Höhle des Löwen«, mitten hinein in den »philharmonisch vorgeprägten Raum«.
Vor diesem Hintergrund begreift Lachenmann nichts Geringeres als die »Befreiung des Hörens« als das Ziel seiner kompositorischen Arbeit. Das Hören, zumal in einer Zeit des ständigen Überangebots von Musik sowohl über- als auch unterfordert, müsse sich befreien durch das Eindringen in die Struktur des zu Hörenden als »bewusst ins Werk gesetzte, freigelegte, provozierte Wahrnehmung«. Seinen ästhetischen Entwurf, der zu dieser Befreiung leiten soll, beschreibt Lachenmann als Dialektik von »Angebot und Ver-
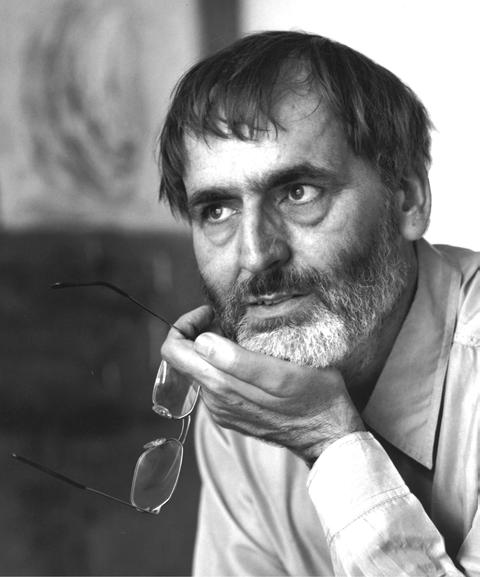
weigerung«. Und es ist gerade diese Aussage, die immer wieder verkürzt oder missverstanden wurde. Keineswegs geht es hier nämlich um die Verweigerung von Musik schlechthin, sondern vielmehr um eine Vermeidung klanglicher Usancen, die Hörer lediglich registrieren, anstatt auf das tatsächliche Klingende zu reagieren. Die »Verweigerung« gilt demnach einer Musik, die bloß Reflexe auslöst, statt Reflexionen zu erzeugen.
»Indem die gewohnte Klangpraxis ausgesperrt wird, wird bisher Unterdrücktes offengelegt.«
Lachenmann selbst bringt es so auf den Punkt: »Indem die gewohnte Klangpraxis ausgesperrt wird, wird bisher Unterdrücktes offengelegt, und die Klanglandschaft zeigt quasi die Rückseite der gesellschaftsüblichen philharmonischen Muster.«
EIN ECHO ZU BEGINN
Zurück zu den Anfängen. Seinen öffentlichen Einstand gibt Helmut Lachenmann 1962 bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt. »Echo Andante« ist der Titel des dort vom Komponisten selbst uraufgeführten Stücks für Klavier solo – also für ein Instrument, das er später einmal als »bürgerliches Möbelstück« bezeichnen sollte. Sein Opus 1 sei ein »Versuch am widerspenstigen Objekt«: eine Überlistung des Klaviers, dessen Klang aufgrund des Ausschwingvorgangs permanent zerrinnt. Lachenmann will stattdessen einen kontinuierlichen, fließenden Klavierklang erzeugen, und in dieser Form
der Widerständigkeit wird sein bereits erwähntes ästhetisches Credo denkbar sinnfällig: alles infrage stellen, nichts als gegeben akzeptieren.
Ende der Sechzigerjahre führt er diesen Ansatz zu einer weiteren Konsequenz. Er wendet sich explizit gegen jede Domestizierung des Klangs und entwickelt eine Musik, in der die akustischen Ereignisse so gewählt und organisiert sind, dass man den Akt ihrer Entstehung ebenso wichtig nimmt wie den resultierenden »Ton« selbst. Konkret heißt das, dass die Geräusche der Tonerzeugung, die gewöhnlich als unwillkommen vermieden werden, zur Hauptsache geraten. »Pression« ist der Titel eines Cellostücks aus dem Jahr 1970, in dem er dieses Prinzip erstmals ausformuliert. Musique concrète instrumentale nennt er das kompositorische Verfahren, mit dem er sein Ideal der »Umpolung« verwirklicht – eben die gewohnte Klangpraxis auszusperren und bisher Unterdrücktes offenzulegen. Das Resultat ist eine Musik, in der sich die Grenzen zwischen Ton und Geräusch auflösen. Der reine, schöne Ton des Cellos ist in »Pression« nur ein Sonderfall unter verschiedenen Möglichkeiten und steht gleichberechtigt etwa neben dem scharfen Knarren, das ein mit Überdruck geführter Bogen auf der Saite erzeugt.
Ein zentraler Terminus, den Helmut Lachenmann in dieser Zeit immer wieder gebraucht, ist der – explizit politisch konnotierte – Begriff der Freiheit. 1978 hält er bei den Darmstädter Ferienkursen eine neunteilige Vortragsreihe mit dem Titel »Über die Freiheit des kompositorischen Denkens«, die er mit folgendem Zitat eröffnet: »Weil eure Freiheit nur in einem Teil der Gesellschaft wurzelt, ist sie unvollständig. Alles Bewusstsein wird von der Gesellschaft mitgeprägt. Aber weil ihr davon nicht wisst, bildet ihr euch ein, ihr wäret frei.« Diese Worte stammen von dem marxistischen Autor Christopher Caudwell, der 1937 im spanischen Bürgerkrieg auf der Seite derer starb, die das Franco-Regime aufzuhalten versuchten. (1977 hatte
»Musik hat Sinn doch nur, insofern sie über die eigene Struktur hinausweist: auf Wirklichkeiten und Möglichkeiten um uns und in uns selbst.«
Lachenmann ihm sein Gitarrenduo »Salut für Caudwell« gewidmet.)
Caudwells Forderung im ästhetischen Bereich gilt einer Kunst, die auf eine Freiheit zielt, die den Menschen ermutigt. Statt sich in private Idyllen zu flüchten, solle der Künstler sich mit der Wirklichkeit und ihren Bedingungen und Widersprüchen realistisch auseinandersetzen.
Für Lachenmanns Komponieren gilt dasselbe: Komponist zu sein, ist für ihn untrennbar mit der Anstrengung verbunden, die Voraussetzungen und Bedingungen des gesellschaftlichen Umgangs mit Musik immer wieder neu zu hinterfragen. »Musik als existenzielle Erfahrung« ist der Titel seiner gesammelten Schriften und kann darüber hinaus als ein künstlerischer Leitsatz gelten: »Musik hat Sinn doch nur«, sagt Lachenmann, »insofern sie über die eigene Struktur hinausweist auf Strukturen, Zusammenhänge, das heißt: auf Wirklichkeiten und Möglichkeiten um uns und in uns selbst.«
Im Musiktheater »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern«, 1997 in der Regie von Achim Freyer an der Hamburgischen Staatsoper uraufgeführt, laufen die Fäden schließlich zusammen. Lachenmann macht aus Hans Christian Andersens tragischem Märchen eine gesellschaftskritische Parabel auf die soziale Kälte der Wohlstandsgesellschaft und die zum Terror pervertierte Utopie der Roten Armee Fraktion. Musikalisch zeichnet sich das Stück durch eine immense Bildhaftigkeit aus: Das heftige Frieren
des Mädchens wird ebenso vernehmlich wie die flüchtige Wärme der kleinen Flammen, markiert durch ein dreimaliges »Ritsch«, mit dem das Orchester zur gigantischen Metapher eines Streichholzes gerät.
SPIELERISCHE ERWEITERUNG
Mit Anfang des 21. Jahrhunderts beginnt dann eine bis heute andauernde neue »Phase« im Komponieren Helmut Lachenmanns. Zur elementaren Strenge der Musique concrète instrumentale tritt unmissverständlich eine spielerische Erweiterung jener Mittel, die imstande sind, »alles Klingende und klingend Bewegte […] ständig neu anzuleuchten«. Nach der Unterminierung des philharmonischen Tons bezieht sich diese »Anleuchtung« auf weitere musikalische Parameter: Rhythmen, Gesten, Melodien, Harmonien. 2018 wird dann in München eine Komposition uraufgeführt, deren Titel im Vorfeld für Irritationen gesorgt hatte: »My Melodies« für acht Hörner und Orchester. Lachenmann und Melodie? Das schien nicht vereinbar.
Und natürlich liefert er hier kein buntes Potpourri seiner Lieblingsmelodien. »›My Melodies‹«, stellt Lachenmann klar, »sind eben nicht ›meine Melodien‹ – die gibt es nicht –, sondern Frank Sinatra lässt grüßen: Sie vermitteln ›my way of melodies‹ beim kreativen Umgang mit den klingenden Mitteln.« Auch hier wieder: alles infrage stellen! In »My Melodies« wird nicht in Melodien geschwelgt –
stattdessen entfaltet sich eine Form von »Meta-Musikantik«. Schon im Moment ihres Auftauchens verformen sich die Melodien, so dass ihre Präsenz zu keiner Zeit sinnfällig wird.
NICHTS IST ERSCHLOSSEN
Dass Helmut Lachenmann das Denken in, mit und über Musik wie nur wenige andere Komponisten verändert hat und längst zu den maßgeblichsten Protagonisten der Neuen Musik zählt, ist nicht zuletzt das Resultat einer unausgesetzten Selbstkritik. Eine Musik, die das Infragestellen zu ihrer Maxime erhebt, verträgt weder Selbstzufriedenheit noch Entdeckerstolz. »Nichts ist erschlossen«, sagt Lachenmann, »denn Wege in der
Kunst führen nirgendwo hin – und schon gar nicht zum Ziel.«
Am 27. November wird Lachenmann 90 Jahre alt. Er hat die Historie der Neuen Musik von der jungen Nachkriegsavantgarde bis in die Jetztzeit in vivo mitvollzogen. Gleichwohl denkt er nicht daran, sich in die Komfortzone des arrivierten »Altmeisters« zu begeben, sondern ist nach wie vor davon überzeugt, dass ein Komponist die Verpflichtung hat, sich als zeitlebens Lernender zu akzeptieren. Nur im unausgesetzten Lernprozess könne es ihm gelingen, »ein Jungbleibender zu sein und andere neugierig zu machen auf den immer anders artikulierbaren Musikbegriff«.

SCHWERPUNKT HELMUT LACHENMANN
So, 21.9.2025 | 19 Uhr
Laeiszhalle Großer Saal symphoniker hamburg, sylvain cambreling helmut Lachenmann: schreiben / Musik für orchester gustav Mahler: sinfonie nr. 1
Fr, 28.11.2025 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Quatuor diotima
ensemble resonanz
helmut Lachenmann: die drei streichquartette
»gran torso«; streichquartett nr. 2 »reigen seliger geister«; streichquartett nr. 3 »grido«
Sa, 29.11.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal ensemble Modern, sylvain cambreling
helmut Lachenmann: concertini unsuk chin: graffiti
Di, 2.12.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal sWr symphonieorchester, François-xavier roth
Jean-François heisser (klavier) helmut Lachenmann: Ausklang / Musik für klavier mit orchester
Beethoven: sinfonie nr. 7
DOKUMENTARFILM:
HELMUT LACHENMANN – MY WAY
So, 23.11.2025 | 11 Uhr und So, 30.11.2025 | 11 Uhr
Zeise Kinos
»helmut Lachenmann – My Way« (regie: Wiebke Pöpel, d/it/ch 2020) Vorführung in deutscher sprache

Die Auszubildenden in der Elbphilharmonie schauen nicht nur anderen über die Schulter. Bei ihrem Start ins Berufsleben übernehmen sie auch direkt Verantwortung.
VON FRÄNZ KREMER FOTOS GESCHE JÄGER
An einem der wichtigsten Tage im ElbphilharmonieJahr steht Selina Demtröder gut gelaunt vor den Drehkreuzen am Haupteingang. Blaues Elbphilharmonie-Band um den Hals, in der Hand ein Klemmbrett mit einer langen Namensliste. Es ist der Tag der Saison-Pressekonferenz, in wenigen Minuten wird der Öffentlichkeit oben im Foyer im 13. Stock das Programm der nächsten Spielzeit vorgestellt. Demtröder hat die Veranstaltung mit vorbereitet und nimmt nun die Journalisten und Fernsehteams in Empfang. Dem Mann vor ihr, der in der einen Hand ein schweres Kamerastativ trägt und in der anderen eine Tonangel mit puscheligem Mikrofonkopf, steckt sie ein Plaza-Ticket zu und erklärt ihm den schnellsten Weg nach oben.
Seit fast anderthalb Jahren arbeitet Demtröder als Volontärin in der Abteilung Media Relations der Elbphilharmonie. Hier ist sie mit verantwortlich für die verschiedenen Aufgaben, die zur Medienarbeit rund um die Elbphilharmonie und ihre Konzerte gehören: Sie koordiniert Interviews, beauftragt Fotografen, gibt Pressekarten frei, führt Journalisten durch das Haus, hat Fotoshootings und Pressespiegel im Blick.
Das Volontariat, das sie im Januar 2024 begann, ist für Demtröder ein Weg, Erfahrungen in einem Berufsfeld zu sammeln, für das sie auch privat brennt. Seit Kindheitstagen spielt sie Cello, absolvierte einen Master in Musikwissenschaft und schrieb nebenbei für die Uni-Zeitung. In der Elbphilharmonie schätzt sie nun auch die neuen Wege, die ihre Abteilung geht: »Wir heißen Media Relations, weil wir nicht nur klassische Pressearbeit machen, sondern auch neue Medien im Blick haben, etwa indem wir jede Saison einen ›Creator in Residence‹ einladen.«
Die Gelegenheit, alles aus nächster Nähe kennenzulernen, mit dem australischen Social-Media-ContentCreator Derrick Gee durch die Orgel zu klettern, mal kurz mit dem Pianisten Alexandre Kantorow auf dem Flur zu plauschen, das schätzt Demtröder ganz besonders. »Richtig schön war es für mich auch, als ich ein Einführungsgespräch mit der Trompeterin Matilda Lloyd führen konnte. Ich war ziemlich aufgeregt, vor so großem Publikum auf die Bühne zu gehen. Aber es lief gut, und ich war danach einfach nur wahnsinnig glücklich!«
Wer wie Demtröder eine Ausbildung an der Elbphilharmonie absolviert, der stellt schnell fest: In diesem Haus, das immer in Bewegung ist, in dem kein Tag wie der andere verläuft, da kommt man auch als Neuankömmling schnell rein, darf praktische Erfahrungen sammeln – und kann Ver-

antwortung übernehmen. Neben Demtröder als Volontärin gibt es derzeit sieben Auszubildende und drei Werkstudenten, die in der Elbphilharmonie für verschiedene Bereiche in der Veranstaltungsbranche ausgebildet werden.
Und auch Musiker werden hier auf ihr Berufsleben vorbereitet. Auf der Bühne des Großen Saals – nur zwei Türen weg von der Pressekonferenz im Foyer, wo Demtröder sich inzwischen eingefunden hat – probt gerade das NDR Elbphilharmonie Orchester. Und wo das Orchester spielt, spielen auch seine Akademisten. Der Bassist Jonas Hensell ist einer davon. »Eine Orchesterakademie ist für viele ein erster Schritt nach dem Studium, bevor man sich auf feste Orchesterstellen bewirbt«, sagt er. Als Musiker muss man sich bei den Probespielen immer gegen große Konkurrenz durchsetzen – auch, um in die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters aufgenommen zu werden. 14 Akademisten werden hier pro Saison ausgewählt, ein bis zwei Akademisten pro Instrument, die dann ein Jahr lang mit dem Orchester proben und auftreten.
›
In diesem Haus, das immer in Bewegung ist, in dem kein Tag wie der andere verläuft, da kommt man auch als Neuankömmling schnell rein.


einem der weltbesten Orchester zu spielen. Ich weiß jetzt genau, was ich leisten muss, um auf diesem Niveau mitzuhalten.«
Als gebürtiger Hamburger ist Hensell dankbar, dass es die Elbphilharmonie gibt. Als er ein Jahr lang in New York studierte, sei Hamburg dort für viele ein Begriff gewesen. »Die Leute kannten immer zwei Dinge: St. Pauli und die Elbphilharmonie.« Nach seiner Akademie-Zeit ist der gute Name, den das NDR Elbphilharmonie Orchester in der Musikwelt genießt, nun ein Sprungbrett, um zu den Probespielen bei anderen großen Orchestern eingeladen zu werden.
»Als Akademist ist man nicht Vollzeit bei allen Konzerten dabei, sondern spielt nur die Hälfte der Projekte mit«, berichtet Hensell, »aber wenn man mitspielt, hat man natürlich die gleiche Verantwortung für den Klang wie alle anderen auf der Bühne.« Die Erfahrungen, die er in seiner Saison beim Orchester gesammelt hat, sind für ihn Gold wert: »Ich konnte hier mit wunderbaren Musikerinnen und Musikern, Dirigentinnen und Dirigenten zusammenarbeiten. Und ich habe erlebt, was es bedeutet, in
Begeistert von der Elbphilharmonie war Hensell aber auch schon, als er noch nicht selbst dort auftrat. »Als das Haus 2017 eröffnet wurde, hatte ich gerade mein Musikstudium begonnen und arbeitete nebenbei als Minijobber hier an der Foyer-Bar und an den Saaltüren«, erzählt er. »Durch großen Zufall war ich an einem Abend des Eröffnungsfestivals für eine der beiden Positionen eingeteilt, bei denen man während des Konzerts nicht draußen wartet, sondern im Saal sitzt. Und so erlebte ich – ganz unerwartet – das Chicago Symphony Orchestra unter Riccardo Muti. Ab da war es mein Traum, hier einmal selbst als Musiker zu arbeiten.«
Als Jonas Hensell im September 2024 die ersten Proben mit dem Orchester hatte, fing zwei Stockwerke tiefer auch für Taale Cremers ihre Zeit in der Elbphilharmonie an. Da begann sie ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Bei diesem Ausbildungsberuf ist Cremers anderthalb Tage pro Woche in der Berufsschule, den Rest vor Ort in der Elbphilharmonie. Im Produktionsbüro im 10. Stock lernt sie sämtliche Bereiche kennen, die für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen relevant sind. »Es ist in erster Linie ein kaufmännischer Beruf«, sagt Cremers, »man darf nicht denken, dass man nur auf Konzerten herumtanzt. Es ist viel Büroarbeit, bis dann der tatsächliche Veranstaltungstag kommt.«
Neben ihrem Schreibtisch hängen an der Wand mehrere aneinander geklebte A4-Blätter mit einer Jahresübersicht. Dort ist aufgeführt, welche Abteilungen der Elbphilharmonie Cremers in den nächsten Wochen durchläuft. Denn neben dem Produktionsbüro, sozusagen ihrer Basisstation, zu der sie immer wieder zurückkehrt, wird sie noch viele weitere Bereiche des Hauses kennenlernen: Technik, Künstlerisches Betriebsbüro, Vermietung, Konzertkassen, Personal, Rechnungswesen, Marketing. »Das ist ein Riesenvorteil, dass ich so viel sehe. Die Azubis in anderen Betrieben, die ich in der Berufsschule treffe, haben diese Abwechslung meistens nicht«, sagt Cremers.

»Und so ein richtiger Jahresplan wie hier ist noch seltener. Da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Überhaupt ist das, glaube ich, der allerbeste Ausbildungsplatz, den man sich wünschen kann.«
Für die Stelle ist sie im vergangenen Herbst von Köln nach Hamburg gezogen – und hat hier seitdem viel erlebt. Ein Höhepunkt sei für sie das viertägige ReflektorFestival von und mit Sophie Hunger gewesen. »Erstens weil ich die Konzerte extrem gut fand«, sagt sie. »Und weil ich da zum ersten Mal alleine als Ansprechpartnerin für Künstler des Festivals zuständig war.« Es seien »extrem lange Tage« gewesen, »aber die Stimmung war auch hinter der Bühne wahnsinnig schön. Ich hatte das Gefühl, dass das genau das ist, was ich machen will.«
Während Cremers noch einige Ausbildungsmonate vor sich hat, ist Hannah Bischofs in den allerletzten Zügen. Bischofs ist Azubi in der Veranstaltungstechnik –und gerade voll im Prüfungsstress. In zwei Wochen steht die schriftliche Abschlussprüfung an, die sie bei der Handelskammer schreiben muss. Besteht sie diese – und auch die praktische Prüfung – ist sie eine offizielle Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
Für Bischofs würde sich damit ein Kreis schließen: Als passionierte Schlagzeugerin liebt sie die Welt auf und hinter der Bühne. In der Elbphilharmonie hat sie nun in zweieinhalb Jahren von Licht- und Tontechnik bis hin zu Video- und Elektrotechnik alles kennengelernt. »Ein Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf der Sicherheit«, sagt Bischofs. »Es gibt ja generell auch viel ›Do it yourself‹ in der Branche, daher will man das Thema Sicherheit umso mehr betonen.«
Der Bereich, der Bischofs besonders interessiert, ist die Tontechnik, am liebsten sitzt sie »am FOH«, also dem als »Front of House« bezeichneten Platz im Saal, wo die Mischpulte stehen. »Wir haben hier in der Elbphilharmonie natürlich tolles Material, an dem wir lernen können. Seit Kurzem gibt es im Kleinen Saal zum Beispiel ein neues 3D-Audio-System, über das man den Klang nicht mehr nur klassisch stereo wiedergeben, sondern überall im Raum platzieren kann. Das bietet viele neue Möglichkeiten.«
Der Blick geht in der Ausbildung aber auch über die Elbphilharmonie hinaus: »Es gab einen Azubi-Austausch, wir waren zum Beispiel ein paar Tage bei Festivals wie dem MS Dockville oder dem Elbjazz und haben da wieder ganz andere Dinge gelernt.« In die Elbphilharmonie kam sie danach aber immer gerne zurück. Und so viel darf man schon verraten: Sollte mit den Prüfungen alles glattgehen, stehen die Chancen gut, dass man sie hier auch noch nach ihrer Ausbildung weiter sehen wird. Zum Beispiel an ihrem Lieblingsplatz, hinter dem Mischpult.

Die Jungunternehmer Chiara und Scott Wempe wissen genau, was sie an der Elbphilharmonie haben.
Chiara Wempe: Ich erinnere mich noch gut an die Bauphase der Elbphilharmonie. Mit unserem Vater habe ich damals gerne Late-Night-Drives durch die Stadt unternommen, und unsere Route führte stets auch in den Hafen und an der ElbphilharmonieBaustelle vorbei. Es war faszinierend zu sehen, was hier entstand. Später haben Scott und ich dann immer mal wieder die Konzertkarten unserer Eltern übernommen, wenn sie selbst keine Zeit hatten. Ich ahnte da noch nicht, wie stark sich unsere Mutter und unser Großvater für die Elbphilharmonie engagieren, bis ich eines Abends auf der großen Spenderwand im Foyer zufällig ihre Namen entdeckte – und mich gleich von meiner Begleitung daneben fotografieren ließ. Seit der vergangenen Saison engagieren auch wir beide uns: Wir fördern die Konzertreihe Fast Lane, in der sich junge Spitzenmusiker vorstellen, die auf dem Sprung zur Weltkarriere sind. Scott Wempe: Mein erster besonderer Elbphilharmonie-Moment war 2018 der Auftritt von David August im Rahmen des Reeperbahn Festivals. Ich arbeite heute noch manchmal als DJ und mache Hip-Hop; David August habe ich zu der Zeit selbst aufgelegt. Irgendwann fingen wir alle im Großen Saal an zu tanzen, das war unique! Ich finde, eine Stadt wie Hamburg hat ein derart tolles Konzerthaus verdient und sollte es sich leisten können, in dieser Kultur-Liga mitzuspielen. Es ist alles so durchdacht und auf einem hohen Niveau. Der Impuls für die Fast-LaneKooperation kam für uns im richtigen Moment: Wir hatten in der Firma gerade eine neue Aufgabe im Bereich Business Development übernommen und ein großes Markenstrategie-Projekt gemacht, wo wir uns um die neue Generation kümmern. Es passte also perfekt!
Chiara Wempe: Vier der sechs Fast-Lane-Konzerte haben wir selbst betreut. Wir haben Kunden eingeladen und im Anschluss den Abend gemeinsam in der Sky Lounge mit überwältigendem Blick auf die Elbe und die Stadt ausklingen lassen. Der Pianist Yoav Levanon ist nach seinem Konzert zu uns gekommen, und es war toll, sich mit dem Künstler des Abends austauschen zu können. Wir wissen bei den Konzerten vorher oft nicht, was uns erwartet. Manches ist uns musikalisch näher, manches müssen wir uns erst erhören, spannend ist es immer. Yoav Levanon war auf jeden Fall ein Highlight, sein phänomenales Klavierspiel, aber auch seine Beatboxing-Zugabe, die total unerwartet kam. Auch das Leonkoro Quartett war unglaublich gut.
Scott Wempe: Ich erinnere mich noch an ein anderes herausragendes Fast-Lane-Konzert: »The Mad Lover« mit Théotime Langlois de Swarte an der Barockvioline und Thomas Dunford an der Laute. Sie haben barocke Werke gespielt, und als Zugabe gaben sie »Let It Be« von den Beatles. Auf einmal hat der ganze Saal gesungen – ein echter Gänsehaut-Moment! Die künstlerische Spannbreite ist groß, und ich finde es cool, dass man immer wieder überrascht und herausgefordert wird. Das macht ein gutes Programm aus. Ich sehe hier eine Parallele zu unserem beruflichen Schaffen: Auch wir wollen Innovationen vorantreiben. Wir schätzen die Tradition und schauen gleichzeitig, wo Veränderungen anstehen und wo wir modernisieren können. Das machen die jungen Künstler mit ihren Programmen auch, wenn sie Neues, bislang Ungehörtes, Unerhörtes wagen. Das darf ruhig auch mal schräg und ungewohnt sein. Kunst muss nicht immer schön sein, es geht um den Ausdruck des eigenen Selbst und um den Dialog. Ich habe da keine Berührungsängste. Ich finde, die Elbphilharmonie macht vieles sehr gut und hat ein sehr diver ses Programm. Auch dass sie sich Hip-Hop anvertraut und Samy Deluxe schon ein paarmal hier aufgetreten ist, gefällt mir.
Chiara Wempe: Ich höre privat viel Musik, von Klassik bis hin zu Country und Heavy Metal, wenn ich Sport mache. Unser Vater hat sehr lange in einer Band Schlagzeug gespielt und gesungen, mein Bruder und ich haben dann auch Schlagzeug und Klavier gelernt. Insbesondere das Schlagzeug habe ich geliebt, auch weil ich das Gefühl hatte, ich kann da immer einfach drauflos spielen.
Scott Wempe: Am 70. Geburtstag unseres Vaters saßen wir alle zusammen und haben Musik gemacht. Das Gemeinschaftserlebnis beim Musikmachen reizt mich, sei es beim Hip-Hop oder beim Schlagzeugspielen oder als DJ. Das trifft auch auf das Musikhören zu: Bei einem Konzert in der Elbphilharmonie teile ich mit vielen anderen Menschen ein Erlebnis, das verbindet und steigert die Intensität. Wenn ich mir die Aufnahme des »Köln Concert« von Keith Jarrett alleine anhöre, ist das natürlich toll. Doch um wie viel aufregender muss die Live-Atmosphäre 1975 in der ausverkauften Kölner Oper gewesen sein!
AUFGEZEICHNET VON CLAUDIA SCHILLER FOTO CHARLOTTE SCHREIBER

Für die Musik brennen? Tun viele. Von der Musik leben? Schon sehr viel weniger. Wir haben drei junge Menschen getroffen, die ihre ersten Schritte im Musikgeschäft schon hinter sich haben – und partout nicht davon lassen wollen.
VON STEPHAN BARTELS
FOTOS ANNE MOLDENHAUER

Mal ehrlich, ideal ist das hier nicht für ein Konzert. Kein Wunder, das Café im »Marta« in Herford ist dafür auch nicht gemacht, sondern dafür, die kulinarische Versorgung der Museumsbesucher sicherzustellen. Der Raum ist wie der ganze stolze Frank-Gehry-Bau: rund, voller Nischen und Buchten und dank großer Fensterfronten schön hell. »Clubatmosphäre bekommen wir hier nicht rein«, sagt Phil Siemers stirnrunzelnd. Und grinst diesen Umstand weg, er ist schon mit ganz anderen Sachen klargekommen. Er wird nachher hier Musik machen, seine Musik, seine Art von souligem Pop mit deutschen Texten. In eine der GehryBuchten hat man eine Bühne gebastelt. Auf der baut Phil jetzt seine Sachen auf. Trägt mit seinem Techniker Finn die Instrumente und allen nötigen Elektrokram aus dem Audi A3, »der ist so voll, wir dürfen vor der Rückfahrt kein Gramm zunehmen«. Ganz wichtig heute: die Loopstation. Denn die macht es möglich, dass Phil allein auf der Bühne sitzt und es trotzdem wie eine ganze Band klingt. Wenn du jung bist und für etwas brennst, dann hast du diesen Traum mit Glück ein Leben lang. Der Traum des Phil Siemers aus Hamburg-Billstedt war: Fußballprofi. Er war ziemlich gut, spielte in Hamburg in den höchsten Jugendligen, ging auf eine Sportschule, die an den Olympiastützpunkt angeschlossen war. Als er dort eingeschult wurde, saß ein Lehrer vor den zukünftigen Olympioniken. Der hatte eine Bluesgitarre auf dem Schoß und brachte den Neuen ein Ständchen. Und sagte danach: Wenn jemand Bock hätte, das neben allem anderen auch zu lernen – er könne den Schülern in den Pausen gern ein paar Griffe zeigen. »Wenn ich so zurückdenke, wie es mit mir und der Musik angefangen hat«, sagt Phil Siemers, »dann war genau das der Moment.«
Er war sofort angefixt. So sehr, dass er nach den ersten paar Riffs, die er bei jenem Helmut Wedeking gelernt hat, einen Gitarrenlehrer an die Seite gestellt bekam und anfing zu singen, »vermutlich erstmal ›Wonderwall‹ oder so«. Er schaffte sich ein paar Songs drauf, sein Gitarrenlehrer Markus Baltensperger – der zweite wichtige Musikmensch in seinem Leben – nahm ihn mit zu eigenen Auftritten, als Ein-Teenie-Vorband. »Da bin ich dann mit 13, 14 Jahren auf die Bühne, hab meine drei Stücke gespielt, hab mich bedankt und bin wieder gegangen«, sagt Phil, als wäre das komplett selbstverständlich. War’s ja irgendwie auch. Denn seine Prioritäten hatten sich verschoben. Weg vom Fußball, hin zur Musik, er merkte: Da ist etwas in ihm, das genau das will. Er nahm Gesangstunden, investierte sein Konfirmationsgeld in einen ordentlichen Verstärker. Ließ sich von seinem Vater zu Auftritten fahren, Geburtstage, Dorffeste, so was. Und verdiente 50 Euro hier und 70 da. Er war 16. In Herford ist er nach dem Soundcheck mit den Veranstaltern was essen gegangen. Das Musik Kontor Herford e. V. holt Künstler nach Ostwestfalen, der Sache und nicht des Geldes wegen. Das Restaurant und das

Hotel gehen auf den Verein. Und Phils Gage, die okay ist, wie er sagt, unterer vierstelliger Bereich. Er lebt ja von den Auftritten. Ende Mai ist sein drittes Album erschienen, aber damit verdient man nicht mehr viel in Zeiten von Spotify & Co. Dafür hat jeder der 120 Leute hier im Publikum – mehr Platz war nicht in Herford – 30 Euro Eintritt bezahlt. Phil hat mit seinen 32 Jahren mehr als ein halbes Leben Bühnenerfahrung und eine gesunde Fanbase, die gern noch wachsen darf, findet er. Auch deswegen bekommt Herford nun den ganzen Phil Siemers.
Und eben: nur ihn. Er liebt das Spielen mit seiner Band, aber die ist nun mal ein Kostenfaktor. Phil spielt eine kleine Basssequenz ein, die Loopstation wird sie für den Rest des Songs wiederholen. Das gilt auch für den Schlagzeugrhythmus, das Gitarrenriff, dann wendet er sich dem E-Piano zu, spielt und singt von »Mila & Juri«, und es klingt schon irgendwie nach vier Leuten, irre. Viele im Publikum haben das noch nicht gesehen und schauen sich verblüfft an. Wie gut das klingt!
Eigentlich ist Phil mehr so oldschool. Das gilt für seinen Sound, für seine Stimme, sein Soul ist so zeitlos wie sein Gesang. Es gilt aber auch für die Art des Musikmachens: Gemeinsam mit anderen, das ist sein Ding. Er hatte früher eine Band, richtig viele Leute, die Frau, die später seine wurde, spielte Keyboard bei ihm. Es war ein gemeinsames Wachsen, die Band hat ihn als Songwriter besser gemacht. Mit 15 hat er damit angefangen, erst auf Englisch. ›

»Ich wurde von anderen gefordert, das hat mir geholfen«, sagt er. Phil Siemers hat einen eigenen Sound entwickelt. Und der wurde gehört. Allerdings von zu wenigen. Er hat dann angefangen zu studieren, Stadtplanung, erst an der TU in Harburg, später an der Hafencity Universität. Eine Alternative halt zur unsicheren Zukunft in der Kunst. Hat er sogar durchgezogen, bis zum Ende. Aber schon im ersten Semester hat er seinen Produzenten Sven Bünger kennengelernt, der dritte wichtige Musikmensch in seinem Leben. Der hat ihn endgültig in die professionelle Richtung geschubst. Ein paar Jahre später sind 850 Leute nur für ihn in den Mojo Club gekommen. Und in Berlin hat er mal vor viereinhalbtausend Leuten für Zaz im Vorprogramm gespielt.
Und trotzdem ist das Ganze beruflich immer noch eine wackelige Angelegenheit. Je größer man wird, desto höher sind auch die Kosten. Die Sache mit der Loopstation ist da wirtschaftlich ein Segen. Aber auch nur deshalb, weil sie funktioniert. Eine Stunde und vierzig Minuten spielt er heute in Herford, plaudert charmant und irgendwie lässig norddeutsch zwischen den Stücken, lässt auch mal die Maschine beiseite und spielt was Akustisches auf der Gitarre, »Lieblingsplatte« ist so ein Stück und sofort ein Publikumsfavorit. »Ich wusste gar nicht, dass der so super ist«, zischt eine Zuschauerin ihrem Mann zu. In Hamburg ist Phil Siemers schon eine kleine Größe. Im Rest der Republik hat er noch Entdeckungspotenzial. Er weiß noch, wie es sich angefühlt hat, als sich sein Traum von etwas Großem verschoben hat. Weg vom Fußball, wo es die wenigstens schaffen und er selbst irgendwann spürte: Ich gehöre nicht dazu. Hin zur Musik, zum Song-
schreiben, zum Singen, zum Auftreten, wo die Erfolgsaussichten, ganz oben anzukommen, kein bisschen größer sind. Aber es gibt dieses Titelstück seiner neuen Platte, er hat es auch in Herford gespielt. Es heißt »Was wenn doch«.
Genau: Was, wenn doch?
MAGISCHE HÄNDE
Einer gähnt jetzt, so ein langer Typ im Hoodie, aber ganz ehrlich: Da kann Heide Müller nun wirklich nichts für. Ist ja nicht so, dass es langweilig gewesen wäre an den vergangenen Tagen. Am Freitag hat sie ihre neuen Schäfchen kennengelernt, den Landesjugendchor Schleswig-Holstein, knapp über vierzig Jungs und Mädchen zwischen 15 und 25 waren es vorgestern, jetzt ist es Sonntagnachmittag, eine letzte Probe hat die Dirigentin angesetzt. Ein paar sind schon von ihren Eltern abgeholt worden. In diesem Sommer leitet Heide Müller den Chor, an fünf Wochenenden wird geprobt, zwei Auftritte sind geplant, und das hier in Rendsburg ist der Anfang. Im Nordkolleg, einem Hotspot Holsteiner Kultur, vom Nord-Ostsee-Kanal nur durch ein Wäldchen getrennt. »War ganz schön intensiv«, sagt sie, »kein Wunder, das jetzt einige ziemlich müde sind.«
Sie kennt sich aus mit solchen Chorwochenenden, das macht sie schon ihr Leben lang. Heide kommt aus Lenthe, einem Dorf bei Hannover, da hat sie schon im Kinderchor gesungen, bevor sie in die Schule kam. Hat mit sechs, sieben Jahren beim Mädchenchor Hannover angedockt. Es war ihr Ding. »Ich habe es geliebt, im Chor zu singen«, sagt sie, »und der Mädchenchor in Hannover ist ziemlich ambitioniert.« Die Organisation war professionell, und das heißt, tatsächlich im Wortsinn: Der Grundstein für einen Beruf in der Musik wurde in Heide Müller genau dort gelegt, als sie noch keine zehn Jahre alt war. »Darauf«, sagt sie, »hat alles aufgebaut«.
Im Fußball gibt es diese besonderen, diese seltenen Spieler, die früh schon wie Trainer denken, Jürgen Klopp ist so ein Beispiel. Den liebt Heide Müller, und vielleicht ist das kein Zufall, »das ist ein super Coach!« Und es gibt Parallelen. Kloppo hat immer die Idee hinter dem Spiel gesehen, schon als er noch auf dem Feld stand und nicht daneben. Sie hatte schon als sehr junge Chorsängerin ein Gefühl, nein, besser: eine Vision davon, wie eine Sequenz, wie ein Stück klingen sollte. »Ich glaube, meine Chorleiterin in Hannover hat genau das bei mir gespürt. Als ich 16 war, hat sie mich gefragt, ob ich nicht auch mal dirigieren will.« Sie wollte. Und spürte sofort etwas Zauberhaftes. Dieses Gefühl, als sie die Hände zum ersten
Heide Müller hatte schon als junge Chorsängerin eine Vision davon, wie ein Stück klingen sollte. Klar, dass sie Dirigentin werden wollte.
Mal hob und ein Klang daraus wuchs, eine Verbindung mit dem Klangkörper vor ihr, »und wenn du die Hände bewegst, dann verändert sich der Klang, das war … magisch«. Es war, sagt Heide Müller, Liebe auf den ersten Blick. »Ich habe sofort gewusst: Damit will ich nie wieder aufhören.«
Hat sie auch nicht. Hat erst in Hannover Schulmusik studiert und dann in Detmold Dirigieren, bis zum Bachelor. War ein Jahr in Schweden und hat ihren Master in Norwegen gemacht, »bei Grete Pedersen, die ist eine Legende und inspirierend, da wollte ich unbedingt hin«. Dafür ist sie nach Oslo gezogen und nach dem Abschluss vor einem Jahr einfach dort geblieben, es gibt schlechtere Lebensorte als Basis. Ihr Job ist ohnehin ein internationaler, und sie gilt mit ihren 29 Jahren in der Szene als Ausnahmetalent, arbeitet gerade in Belgien, den Niederlanden und Deutschland mit verschiedenen Chören. Außerdem ist ihr Beruf ziemlich exklusiv. In Detmold hatte sie vier Kommilitonen, in Oslo war da gerade mal ein Mensch, der mit ihr zusammen den Master machte. Dort hatte sie letztes Jahr auch noch eine Teilzeitstelle in der Domkirche. In der laufenden Konzertsaison arbeitet sie mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, mit der Cappella Amsterdam und dem Flämischen Rundfunkchor Brüssel, und kurz vor Weihnachten hebt sie vor dem Vokalensemble des NDR ihre Hände im Großen Saal der Elbphilharmonie. Die Jobs kommen zu ihr. Heide Müller ist begehrt. Auch hier in Schleswig-Holstein, der Landesmusikrat hat sie gewollt und für eine Saison gebucht. Im achteckigen Pavillon in Rendsburg laufen die knapp dreißig Jugendlichen jetzt durcheinander und produzieren Töne, stellen sich in einem weiten Halbkreis auf, singen ein schwedisches Volkslied und »Dat du meen Leevsten büst«, und

dann ist plötzlich Johannes Brahms im Raum, »Da unten im Tale läuft’s Wasser so trüb« singen sie auf Geheiß von Heides Händen. War aber wohl nicht so doll, einen minimalen waagerechten Strich malt sie in den lichten Sonntagnachmittag, und alle verstummen. »Ein bisschen mehr forte«, sagt Heide aufmunternd, schiebt die Ärmel des dunklen Rollkragenpullis hoch, dann geht es wieder los, und tatsächlich: Was sich gerade hübsch, aber ein wenig träge anhörte, bekommt plötzlich Wucht und Glanz. Zwischen dem, wie es am Freitag angefangen hat mit dem Landesjugendchor und ihr, und dem, wie sie die Gruppe am Sonntag entlässt, »ist ein Unterschied wie Tag und Nacht«, sagt sie. Heißt: Sie hat einen gelehrigen Haufen vorgefunden, der ihre Vision aufgesogen hat wie ein Schwamm. Die Musik ist die eine Sache bei ihrem Job. Aber das, sagt Heide, sei nicht alles. »Ich bin so vielen Dirigenten und Dirigentinnen begegnet, die mich auch als Mensch geformt haben«, sagt sie. Und meint damit, dass sie als Kind, als Jugendliche auf Leute getroffen ist, die ihr bei der Selbstfindung geholfen haben, bei der Ausbildung ihres Weltbildes. Sie spürt: Genau so eine ist sie jetzt auch. Und das liebt Heide Müller. »Klassische Musik ist so was Cooles«, sagt sie, »ich finde es super, dass sich so viele junge Leute dafür begeistern.« Sie hat ihren Traumjob gefunden. Dabei fühle der sich nicht mal wie ein Beruf an, sagt sie. »Aber es ist einer, den ich für den Rest meines Lebens machen möchte.«
LAUTER BAUSTEINE
Wenn es nur nach ihr gegangen wäre: In Hamburg hätte sie für immer bleiben können. Zwei Jahre hat Selena, in Düsseldorf geboren und erwachsen geworden, auf St. Pauli gelebt, am Hans-Albers-Platz über einem Club, »meine Gläser haben die ganze Nacht zum Reggae von unten im Schrank getanzt«. Das war ihr dann irgendwann zu viel, »und dann habe ich auch noch Ansprüche: Altbau mit Holzboden ist Pflicht«, sagt Selena. So was in bezahlbar hat sie dann erst in Berlin gefunden, in Kreuzberg lebt sie jetzt seit einem Jahr. »Aber Hamburg ist schon meine große Liebe«, sagt sie, »ich werde ganz sicher irgendwann zurückkommen.«
Selena, die darum bittet, ihren Nachnamen lieber nicht zu nennen, wäre für die Musikszene in Hamburg eine Bereicherung. War sie ja schon, unter dem Namen Modular ist es für sie in dieser Stadt so richtig losgegangen. Aber eigentlich ist das mit der Musik so eine Elternhaussache. Ihr Vater Sven ist Jazzgitarrist, »der ist ein hochbegabter Überflieger, den habe ich am Anfang zu imitieren versucht«, sagt sie. Eva, ihre Mutter, spielt Schlagzeug und Saxofon. »Deshalb habe ich ganz früh diese musikalische Klatsche mitbekommen. Bei uns liefen immer die Foo Fighters und die Red Hot Chili Peppers – musikalisch sozialisiert bin ich eigentlich wie ein 50-jähriger Mann«, sagt Selena, 27 Jahre alt. Mit 15 wollte sie unbedingt eine Band haben, sie sagt es genauso: »Ich wollte eine eigene Band.« Düsseldorf hat sie an Grenzen gebracht, sie fand nichts Passendes. Da hat sie das Naheliegende gemacht und sich ihre Eltern gegriffen. ›
»Wir waren dann Sanescere, eine kleine Indie-Band«, sagt sie. Zwei, drei Alben haben die drei produziert, sind aufgetreten, »nichts Bewegendes, aber für die ersten Steps war es super für mich«.
Aber ein Beruf, wie für ihre Eltern, wurde die Musik nicht sofort. Sie lernte Fotografie, eine richtig solide handwerkliche Ausbildung. Ließ sich danach in Teilzeit in einem Fotostudio anstellen. »Und dann kam Corona und hat uns alle weggeklatscht«, sagt Selena. Sie aber nutzte die Zeit. Entwickelte am Küchentisch Modular, ihr Soloprojekt, produzierte Songs mit ihrem Vater, veröffentlichte ein paar Sachen im Internet. Und stand, als die Pandemie abebbte, mit Mitte zwanzig vor einer Entscheidung: Bleibe ich jetzt gemütlich in meinem Fotobüro mit Festanstellung und ordentlichem Gehalt in der Düsseldorfer Altstadt hocken –oder gehe ich mit meinem Zeug raus in die Welt? Es wurde Option B. »Ich dachte, fuck it«, sagt Selena. »Wenn nicht jetzt, wann dann?«
Sie ist glücklich mit dieser Entscheidung, auch mit der, aus Düsseldorf weggegangen zu sein. Unabhängigkeit ist ihr wichtig, auch die finanzielle, »seit meinem Auszug von zu Hause habe ich alles selbst gestemmt«, sagt sie. Aber sie ist dieser Ganz-oder-gar-nicht-Typ, eher hundertzwanzig als hundert Prozent, und die Entscheidung für die Musik war eine exklusive. Was aber auch hieß: Da kam jetzt nicht am Monatsende verlässlich Geld aufs Konto. »Das habe ich anfangs schlecht ausgehalten, eigentlich halte ich es immer noch schlecht aus«, sagt sie. »Aber auf der anderen Seite habe ich von Haus aus ein Urvertrauen. Und ich habe gelernt, wenn du etwas machst, dann kommt auch was zurück. Das hat sich bislang immer bewahrheitet.«
Am Anfang kam bei ihren Auftritten viel Zuspielung vom Band, das funktionierte bei ihren Neue-Neue-DeutscheWelle-Songs ganz gut, die Gagen haben sie über Wasser gehalten in einer Branche, die, »da brauchen wir uns nichts vorzumachen, finanziell ziemlich beschissen ist«, sagt Selena. Aber sie ist da rausgewachsen, ihr Debütalbum »Lonely Hearts Club« ist neulich erschienen. Es kommt gut an. Aber für sie heißt das auch: Live geht jetzt nur noch mit Band, das ist ihr Anspruch »und da habe ich dann plötzlich ein Kostenproblem«.
Aber es geht ja nicht nur ums Geld. Modular gibt es auch deshalb, weil Selena an ihrem Küchentisch während des Lockdowns festgestellt hat, dass es in dieser rauen Welt des Neue-Deutsche-Welle-Pop keine Frauen gebe. »Wir leben in einem heteronormativen Weltbild im Pop«, findet sie, »da hatten Frauen nie wirklich eine Bühne, sondern sind dafür da, Männer anzuhimmeln. Männer sind für Labels berechenbarer, und es ist nicht besser geworden mit den Jahren.« Sie will das ändern, weil es sie nervt. Selena ist ein höchst politischer Mensch, Modular ist auch ein Versuch, im Business für mehr Sichtbarkeit von Frauen zu sorgen. Dem Backlash für alles Progressive in der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Dafür hat sie, nur so zum Beispiel, das FLINTA-Kollektiv Bande gegründet, »eine Konzertreihe für marginalisierte Gruppen«. Macht Awareness-Arbeit für den Konzertveran-

stalter FSK Scorpio, hat über Telegram eine Jobbörse für Frauen initiiert, »und die funktioniert echt super. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut aufgeht.«
Das gilt auch für Modular. Das Projekt wächst, gedeiht, verändert sich. Das Wort steht ja für Bausteine, und sie findet: Das passt heute noch besser als am Anfang. »Das Ganze ist ein Puzzle für mich. Du fügst immer neue Sachen hinzu und nimmst dir, was du brauchst, ob SoundBausteine oder Menschen, die darin eine Rolle spielen. Das finde ich toll.«
Seit drei Jahren gibt es Modular, und jedes Jahr an Silvester macht Selena eine Art inneren Kassensturz: Was war, was ist, was soll es werden? Sie stellt fest, dass sich die Schwerpunkte verschieben. Größer werden wäre schön, Geld verdienen auch, aber wichtiger ist für sie geworden, Menschen zu erreichen. Mehr Leute zu finden, die sich für die Welt begeistern können, die sie als Künstlerin aufmacht. »Wenn ich sehe, wie sich das entwickelt«, sagt Selena, »dann bin ich echt happy.« Vielleicht reicht es ja sogar irgendwann wieder für einen Altbau mit Holzboden in Hamburg.
HEIDE MÜLLER
Fr, 19.12.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal ndr Vokalensemble
christian schmitt (orgel) heide Müller (dirigentin) Weihnachtskonzert mit Werken von J. s. Bach, Poulenc, Praetorius, nordqvist u. a.
MODULAR
Sa, 17.1.2026 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Modular
»Lonely hearts club«
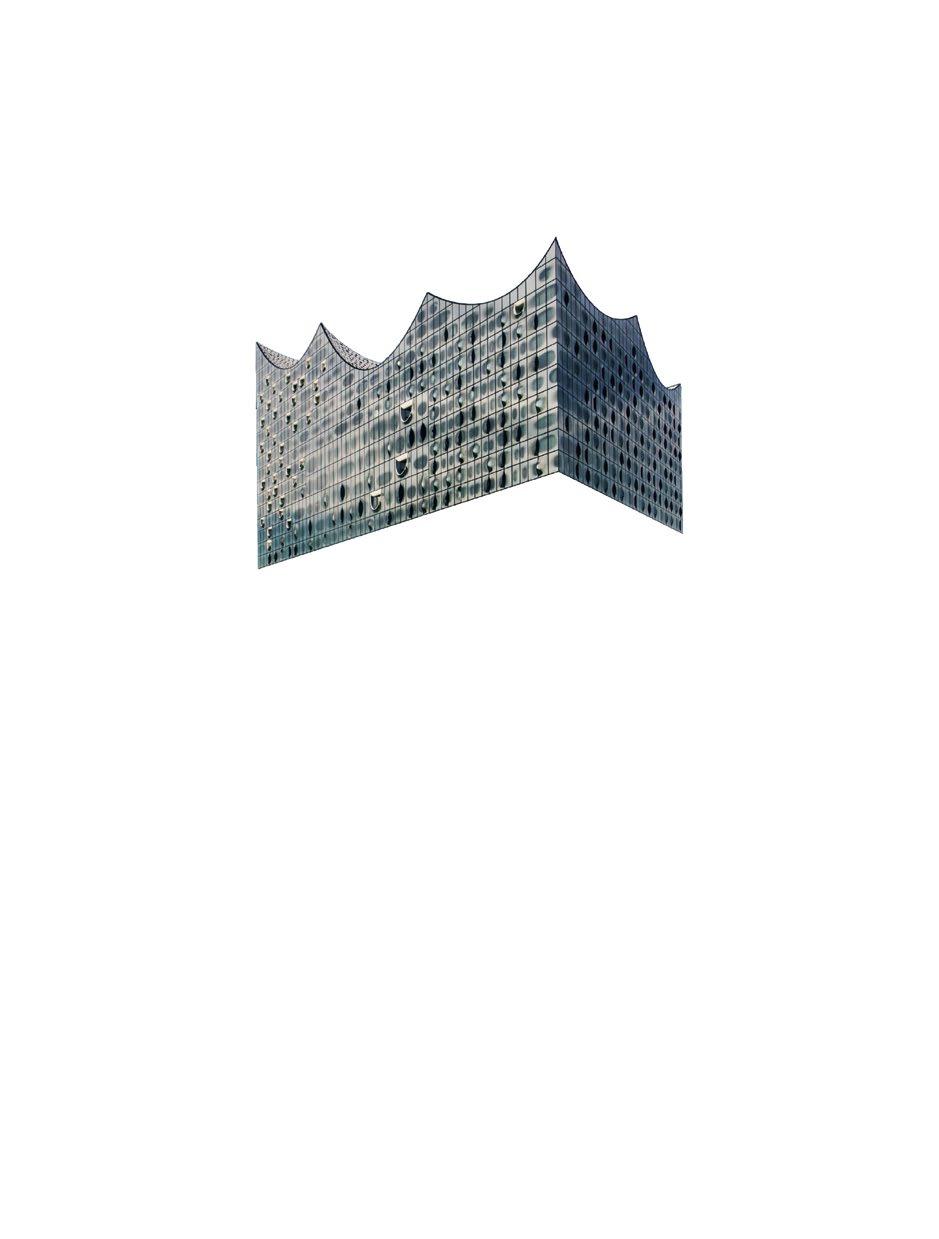

Große Visionen brauchen ein starkes Fundament. Deswegen unterstützen namhafte Partner aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik die Elbphilharmonie. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk, das die Elbphilharmonie als Konzerthaus von Weltrang begleitet. So ermöglichen sie ein Konzertprogramm mit einem unverwechselbaren musikalischen Profil, Musikvermittlungsideen für alle Generationen sowie innovative Festivalkonzepte, die Maßstäbe im internationalen Konzertbetrieb setzen.
der sti F tung e LBP hi L h A r M onie

MÄZENE
ZUWENDUNGEN AB 1.000.000 EURO
Prof. dr. dr. h. c. helmut und Prof. dr. h. c. hannelore greve
Prof. dr. Michael otto und christl otto hermann reemtsma stiftung
christine und klaus-Michael kühne körber-stiftung
Peter Möhrle stiftung
Familie dr. karin Fischer reederei claus-Peter offen (gmbh & co.) kg stiftung Maritim hermann & Milena ebel hans-otto und engelke schümann stiftung christiane und klaus e oldendorff
Prof. dr. ernst und nataly Langner k s. Fischer-stiftung
PLATIN
ZUWENDUNGEN AB 100.000 EURO
ian und Barbara karan-stiftung
gebr. heinemann se & co. kg
Bernhard schulte gmbh & co. kg
deutsche Bank Ag
M. M. Warburg & co hamburg commercial Bank A g
Lilli driese
J. J. ganzer stiftung claus und Annegret Budelmann
Berenberg – Privatbankiers seit 1590
Mara und holger cassens stiftung
christa und Albert Büll christine und heinz Lehmann
Frank und sigrid Blochmann else schnabel
edel Music + Books
dr. Markus Warncke
Berit und rainer Baumgarten christoph Lohfert stiftung eggert Voscherau
hellmut und kim-eva Wempe günter und Lieselotte Powalla
Martha Pulvermacher stiftung
heide + günther Voigt gabriele und Peter schwartzkopff
dr. Anneliese und dr. hendrik von Zitzewitz
Prof. dr. hans Jörn Braun † susanne und karl gernandt
Philipp J. Müller
Ann-Mari und georg von rantzau
dr. gaby schönhärl-Voss und claus-Jürgen Voss
Lennertz & co.
Familie schacht
Amy und stefan Zuschke
GOLD
ZUWENDUNGEN AB 50.000 EURO
rainer Abicht elbreederei
christa und Peter Potenberg-christoffersen heristo A g christian Böhm und sigrid neutzer
SILBER
ZUWENDUNGEN AB 10.000 EURO
Ärzte am Markt: dr. Jörg Arnswald, dr. hans-carsten Braun hans Brökel stiftung für Wissenschaft und kultur
Jürgen und Amrey Burmester rolf dammers ohg edek ABAnk Ag F r ostA A g katja holert und thomas nowak knott & Partner V di Jürgen k önnecke stiftung Meier-Bruck cornelia und sebastian siemers steinway & sons
BRONZE
ZUWENDUNGEN AB 5.000 EURO
André Boeder ilse und dr. gerd eichhorn hennig engels Marga und erich helfrich Familie klasen hannelore krome dr. claus und hannelore Löwe Medconsult dr. r J. Panny carmen radszuweit
sowie weitere spender:innen und stifter:innen, die nicht genannt werden möchten.
reundeskreises
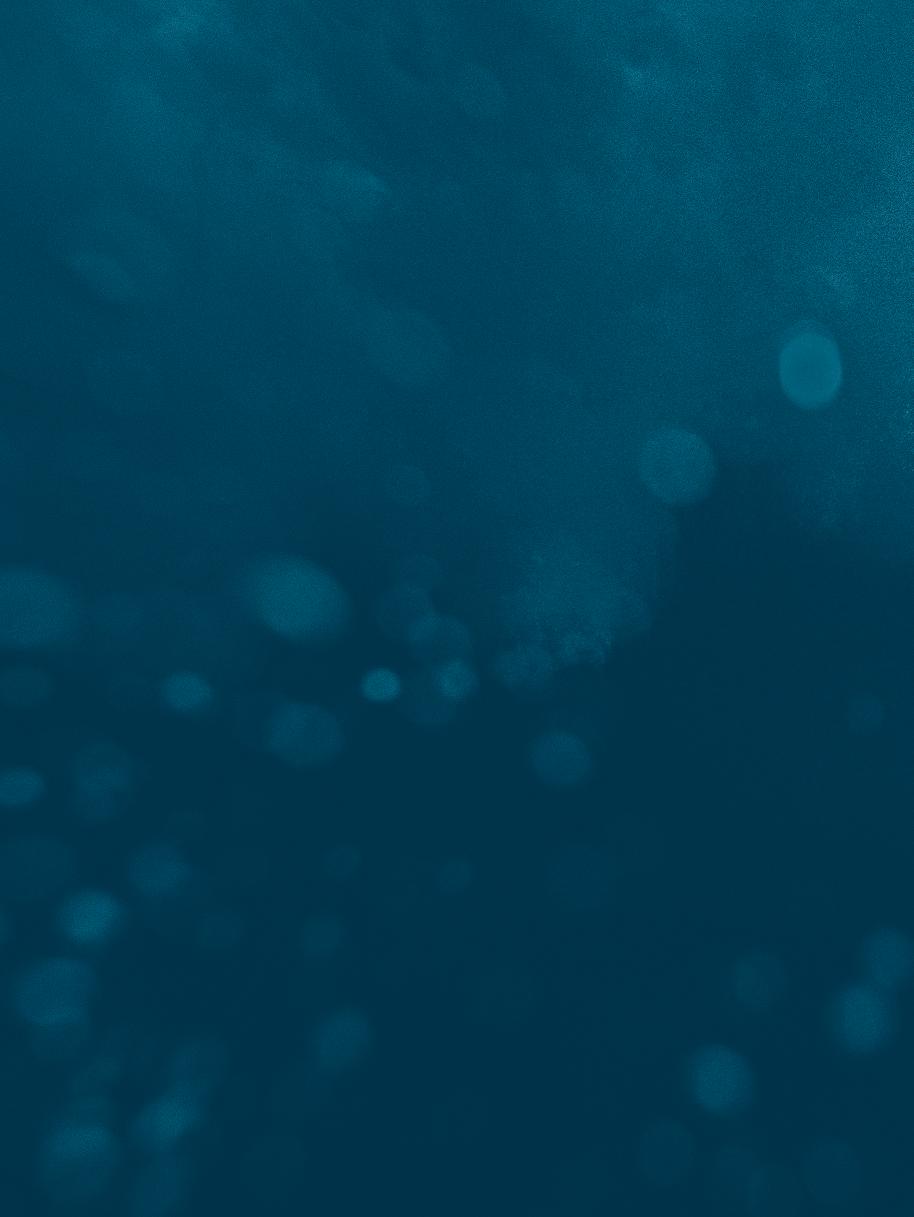
Jürgen Abraham | dr. Marcus Ackermann | Anja Ahlers | Margret Alwart | karl-Johann Andreae | cornelius Back | undine Baum | rainer und Berit Baumgarten | Florian Baumgartner | gert hinnerk Behlmer | Michael Behrendt | robert von Bennigsen | Joachim von Berenberg-consbruch |
Prof. dr. Wolfgang Berlit | Peter Bettinghaus | Marlis und Franz-hartwig Betz | Wolfgang Biedermann | Alexander Birken | dr. Frank Billand | dr. gottfried von Bismarck | dr. Monika Blankenburg | ulrich Böcker | Birgit Bode | Andreas Borcherding | tara Bosenick | Vicente Vento Bosch | Verena Brandt | Beatrix Breede | heiner Brinkhege | nikolaus
Broschek | Marie Brömmel | tobias Brinkhorst | claus-g Budelmann | engelbert Büning | Amrey und Jürgen Burmester | dr. christian cassebaum | dr. Markus conrad | dr. katja conradi | dierk und dagmar cordes | Familie dammann | carsten deecke | Jan F. demuth | dr. Peter dickstein | heribert diehl | kurt dohle | Benjamin drehkopf | thomas drehkopf | oliver drews | christian dyckerhoff | hermann ebel | Benjamin edenharder | stephanie egerland | Martin eggert | claus epe | norbert essing | heike und John Feldmann | dr. heike Fielmann | Alexandra und dr. christian Flach | dr. Peter Figge | Jörg Finck | gabriele von Foerster | dr. christoph Frankenheim | dr. christian Friesecke | sigrid Fuchs | Manhard gerber | dr. Peter glasmacher | Prof. Phillip W. goltermann | inge groh | Annegret und dr. Joachim guntau | Amelie guth | Michael haentjes | dr. Michael halévy | Petra hammelmann | Andreas hanitsch | Jochen heins | dr. christine hellmann | dr. dieter helmke | Jan-hinnerk helms | kirsten henniges | rainer herold | gabriele und henrik hertz | diana hess | Prof. dr. dr. stefan
hillejan | Bärbel hinck | Joachim hipp | dr. klaus-stefan hohenstatt | christian hoppenhöft | Prof. dr. dr. klaus J. hopt | dr. stefanie howaldt und uwe heine | Maria illies | dr. ulrich t Jäppelt | dr. Johann christian Jacobs | heike Jahr | Martin Freiherr von Jenisch | roland Jung | Matthias kallis | ian kiru karan | tom kemcke | klaus kesting | Prof. dr. stefan kirmße | renate kleenworth | dr. saskia kleier | Jochen knees | Annemarie köhlmoss | Prof. dr. irmtraud koop |
Petrus koeleman | Bert e könig | Arndt kwiatkowski | christiane Lafeld | dr. klaus Landry | günther Lang | dirk Lattemann | Per h Lauke | hannelore Lay | dr. claus Liesner | Lions club hamburg elbphilharmonie | dr. claus Löwe | Prof. dr. helgo Magnussen | sibylle doris Markert | Franz-Josef Marxen | thomas J. c und Angelika Matzen stiftung | helmut Meier | gunter Mengers | Malte Mengers | Axel Meyersiek | dr. thomas Möller | christian Möller | karin Moojer-deistler | ursula Morawski | katrin Morawski-Zoepffel | Jan Murmann | dr. sven Murmann | dr. ulrike Murmann | Julika und david M. neumann | Michael r neumann | Franz nienborg | dr. ekkehard nümann | thilo oelert | dr. Andreas M. odefey | dr. Michael ollmann | dr. eva-Maria und dr. norbert Papst | dirk Petersen | dr. caroline Petersson | dr. sabine Pfeifer | sabine gräfin von Pfeil | Aenne und hartmut Pleitz | hans-detlef Pries | karl-heinz ramke | horst rahe | sibylle von rauchhaupt | Prof. dr. hermann rauhe | sylvia reyers | ursula rittstieg | stephan rönn | ursula ross | eberhard runge | Prof. Michael rutz | Jens schafaff | Birgit schäfer | Mattias schmelzer | Vera schommartz | katja schmid von Linstow | dr. hans ulrich und gabriele schmidt | nikolaus h schües | nikolaus W. schües | gabriele schumpelick | ulrich schütte | dr. susanne staar | henrik stein | Prof. dr. Volker steinkraus | Wolf o storck | dr. Patrick tegeder | Jörg tesch | ewald tewes | dr. Jörg thierfelder | dr. tjark thies | dr. Jens thomsen | tourismusverband hamburg e. V. | John g turner und Jerry g Fischer | resi tröber-nowc | hans ufer | dr. sven-holger undritz | Andreas Völker | dr. Markus Warncke | thomas Weinmann | Peter Wesselhoeft | dr. gerhard Wetzel | erika Wiebecke- dihlmann | ulrich Winkel | dr. Andreas Witzig | dr. thomas Wülfing | christa Wünsche | stefan Zuschke
sowie weitere kuratorinnen und kuratoren, die nicht genannt werden möchten.
darüber hinaus leisten mehr als 2.000 Freundinnen und Freunde einen wertvollen Beitrag zur unterstützung der beiden konzerthäuser.
VORSTAND: Alexander Birken (Vorsitzender), roger hönig (schatzmeister), christian hoppenhöft, Bert e könig, Magnus graf Lambsdorff, katja schmid von Linstow und dr. ulrike Murmann
EHRENMITGLIEDER: christian dyckerhoff, dr. karin Fischer †, Manhard gerber, Prof. dr. h. c. hannelore greve †, Prof. dr. dr. h. c. helmut greve †, gabriele und henrik hertz, Prof. dr. Michael otto, Jutta A. Palmer †, nikolaus h schües, nikolaus W. schües und dr. Jochen stachow †
der unterneh M erkreis der e LBP hi L h A r M onie
ABA cus Asset Management
Addleshaw g oddard LLP
A hn & si M rock Bühnen- und Musikverlag g mb h
ALLcur A Versicherungs-Aktiengesellschaft
Allen o very s hearman s terling LLP
apoprojekt g mb h
a-tour Architekturführungen
Bankhaus donner & reusche L
Barkassen-Meyer
BB s Werbeagentur
B d V Behrens g mb h
Bornhold d ie e inrichter
Braun h amburg
British American tobacco g ermany
c A. & W. von der Meden
c LAY ston
c ompany c ompanions
d ienstleistungsgesellschaft der n orddeutschen Wirtschaft
d rawing room
d ungeon d eutschland g mb h
ener PA rc
e ngel & Völkers h olding g mb h
e sche s chümann c ommichau
e ventteam g mb h
Fortune h otels
F r A nk
Freshfields Partnerschaftsgesellschaft mbB
F ri BA i nvestment
g ermerott i nnenausbau g mb h & c o. kg
gerreshei M serviert g mb h & c o. kg
g ese & c ie Personalberatung g mb h
g rundstücksgesellschaft Bergstrasse
h amburg team
h anse Lounge, t he Private Business c lub
h einrich Wegener & s ohn Bunkergesellschaft
hh LA h otel Wedina h amburg
in P h olding Ag
JA r A ho L ding g mb h
Joop!
k ahl h olding

kesseböhmer h olding kg
k LB h andels g mb h
k linische Forschung Beteiligungsgesellschaft mb h
konzertdirektion d r. rudolf g oette g mb h
Larimar i nternational
Lauenstein & Lau i mmobilien
Lehmann i mmobilien
Lennertz & c o. g mb h
loved g mb h
Lupp + Partner
Madison h otel
Malereibetrieb otto g erber g mb h
Miniatur Wunderland
M rh trowe Ag h olding
nordwest Factoring und s ervice g mb h
n otare am g änsemarkt
otto d örner g mb h & c o. kg
pesch | Minotti
PLAth c orporation g mb h
print-o-tec g mb h
rosenthal c hausseestraße g b r
rox ALL g roup
s chlüter & Maack g mb h
s ervice-Bund g mb h & c o. kg
s teinway & s ons
s tolle s anitätshaus g mb h
str A h L en Z entru M h AMB urg MVZ
taylor Wessing the e MBA ssies
t he Fontenay h otel
t iffany & c o. treudelberg resort h amburg
u B s e urope se h amburg u nger h amburg
Weischer.Media
Worlée c hemie g mb h
Wünsche h andelsgesellschaft
s owie weitere u nternehmen, die nicht genannt werden möchten.
intern Ation AL es M usik F est h AMB urg
Jürgen Abraham
c orinna Arenhold-Lefebvre und n adja d uken i ngeborg Prinzessin zu s chleswig- h olstein und n ikolaus Broschek
Annegret und c laus- g Budelmann c hrista und Albert Büll g udrun und g eorg Joachim c laussen
e rnst Peter komrowski
d r. u do kopka und Jeremy Zhijun Zeng h elga und Michael k rämer c hristine und h einz Lehmann
Martha Pulvermacher s tiftung
Marion Meyenburg
k & s Müller c hristiane und d r. Lutz Peters
Änne und h artmut Pleitz
Bettina und otto s chacht e ngelke s chümann
Margaret und Jochen s pethmann
Birgit s teenholdt- s chütt und h ertingk d iefenbach
Anja und d r. Fred Wendt s usanne Wogart
s owie weitere Förderinnen und Förderer, die nicht genannt werden möchten.
die PA rtner der e LBP hi L h A r M onie

PRINCIPAL SPONSORS
FÖRDERSTIFTUNGEN


K. S. Fischer Stiftun g Hambur g



PRODUCT SPONSORS




Herausgeber hamburgMusik ggmbh geschäftsführer: christoph Lieben-seutter (generalintendant), Jochen Margedant
Platz der deutschen einheit 4, 20457 hamburg magazin@elbphilharmonie.de www.elbphilharmonie.de
Chefredakteur carsten Fastner
Redaktion katharina Allmüller, Melanie kämpermann, clemens Matuschek, tom r schulz; gilda Fernández-Wiencken (Bild)
Formgebung groothuis gesellschaft der ideen und Passionen mbh für kommunikation und Medien, Marketing und gestaltung; groothuis.de gestaltung Lina Jeppener (Leitung), Janina Lentföhr; Bildredaktion Angela Wahl; herstellung susan schulz, charlotte gall; cvd rainer groothuis
Beiträge in dieser Ausgabe von dominik Bach, stephan Bartels, stefan Franzen, Volker hagedorn, Lars hammer, Anselm M. hirschhäuser, gesche Jäger, Fränz kremer, clemens Matuschek, helmut Mauró, Anne Moldenhauer, till raether, ivana rajicˇ, Michael rebhahn, nadine redlich, Louis roth, claudia schiller, charlotte schreiber, tom r schulz, Albrecht selge, Bjørn Woll
Korrektorat Ferdinand Leopold
Lithografie Alexander Langenhagen, edelweiß publish, hamburg
Druck hartung druck + Medien gmbh, hamburg dieses Magazin wurde klimaneutral auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.
Anzeigenleitung
Antje sievert, Anzeigen Marketingberatung sponsoring tel: 040 450 698 03, office@kultur-anzeigen.com
Vertrieb Pressup gmbh, hamburg
Leserservice / Abonnement elbphilharmonie Magazin Leserservice Pressup gmbh Postfach 70 13 11, 22013 hamburg leserservice@elbphilharmonie.de tel: 040 386 666 343, Fax: 040 386 666 299
das elbphilharmonie Magazin erscheint dreimal jährlich.
Bild- und Rechtenachweise
cover: Louis roth; s 1 Michael Zapf; s 2 links Mitte: dino Bossnini, links unten: dave stapleton, rechts: guy Vivien / ecM records, s 3 oben: Miranda Penn turin, Mitte: hunderteins, unten: picture alliance / imageBroker / Moritz Wolf; s 5 kacheln von links nach rechts: James hole, suzy stöckl, Birgit nilsson Museum, elisa rinaldi, unten: sylvie roche, s 6 Melina Mörsdorf/laif, s 7 oben: Archiv universal edition, unten: si chan Park, s 8 kacheln von links nach rechts: picture alliance / sZ Photo / scherl, akgimages, Arnold schönberg center / Wien, akg-images; s. 10 Milagro elstak, s 11 oben: hunderteins, unten: sebastian Madej, s 12 rechts: daniel dittus, links von oben nach unten: Bastian eggers, Marcus krüger (2), s 13 nohely oliveros; s 14-15 Lars hammer; s. 16 sophie Wolter, s 17 links: dino Bossnini, rechts: Marco Borggreve, s 18 links: Jo Bogaerts, rechts: Müpa Posztós János, s 19 links: Yael cohen, rechts: Luigi de Palma; s 20 privat, s 21-22 claudia höhne, s 23 dave stapleton; s 26 Peter rigaud, s 28 daniel dittus, s 29 kees van de Veen; s 30 oben: rita kuhlmann, Mitte: Will hawkins Photography, unten: emma Wernig, s 31 oben: ina grajetzki, Mitte links: ettore causa, Mitte rechts: klara Justine heil, unten: irene Zandel; s 3236 Anselm M. hirschhäuser; s 38-45 Louis roth; s 47 Miranda Penn turin, s 48 claudia höhne, s 49 daniel dittus, s 50 links: picture alliance / cover images / kik A Press / cover images, rechts: tony hauser; s 52 nadine redlich; s 54 oben: Frederic reglain / Alamy stock Foto, Mitte: sergi Boixader / Alamy stock Foto, unten: Jan Wlodarczyk / Alamy stock Foto, s 55 Janina Lentföhr, s 56 oben: david ignaszewski, unten: Jordi carrio / Alamy stock Foto, s 57 oben: picture alliance / heritage-images / docutres-index / heritage-images, Mitte: 1Apix / Alamy stock Foto, unten: harold Abellán, s 58 oben: picture alliance / imageBroker /Mara Brandl, unten: ricardo rios, s 59 oben: duna Valles, Mitte: Lorena dini, unten: picture alliance / imageBroker / Mara Brandl, s 60 oben: Authors image / Alamy stock Foto, unten: Mireia Miralles; s 62 old Books images / Alamy stock Foto, s 63 Marin Margeta, s 64 oben: Jorgo tsolakidis / greece on tour, unten: scan from »Fünf griechen in der hölle«, trikont Lc 4270 (1982); s 66 deBunt Film / Wiebke Pöpel, s 67 guy Vivien / ecM records, s 69 hans kumpf; s 70-73 gesche Jäger; s 74 charlotte schreiber; s 76-80 Anne Moldenhauer; s 82-87 Justin Bartels / istockphoto; s 88 kai-uwe gundlach
Redaktionsschluss 24. Juni 2025
Änderungen vorbehalten.
nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Printed in germany. Alle rechte vorbehalten.
träger der hamburgMusik ggmbh:

ENTDECKEN SIE DEN CAYENNE.

S E-Hybrid Coupé (WLTP): Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert: 4,6 – 4,0 l/100 km; Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert: 10,6 – 9,9 l/100 km; Stromverbrauch gewichtet kombiniert: 19,9 – 19,1 kWh/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 103 – 90 g/km; CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: C – B; CO₂-Klasse bei entladener Batterie: G; Stand 06/2025

Mit unserem Gesundheitsschutz für Hunde und Katzen ist Ihr geliebter Vierbeiner jederzeit bestens abgesichert. Denn die Kosten für Behandlung, OP und alternative Heilmethoden sind abgedeckt – und das weltweit und bei jeder Rasse. Das zeigt: Hand in Hand ist HanseMerkur.