
31 minute read
NEUE ZEITRECHNUNG?
ARBEITNEHMERMARKT MIT NEUER ZEITRECHNUNG
Mit Beginn der Industriellen Revolution wurde die Arbeitszeit zuerst immer länger und seitdem wieder kürzer. Die Debatte um die Viertagewoche und Arbeitszeitverkürzung steht in einer historischen Kontinuität. Vor dem Hintergrund, dass der Arbeitsmarkt sich vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt entwickelt, muss sie erneut geführt werden.
Advertisement
TEXT: MARIAN KRÖLL
Es ist kein Naturgesetz, dass die wöchentliche Normalarbeitszeit, gemessen von Montag 0:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr, in Österreich 40 Stunden beträgt. Noch im 19. Jahrhundert war die 70-Stunden-Woche keine Seltenheit. Die 40-Stunden-Woche bzw. je nach Branche teils auch 38,5-Stunden-Woche gibt es hierzulande seit 1975. Die Forderung nach einer weiteren Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden wurde bereits 1987 erstmalig erhoben.
Bis 1859 – damals wurden die Sonntagsruhe und der 11-Stunden-Tag eingeführt – waren Arbeitnehmer im Hinblick auf ihre Arbeitszeit völlig vom Arbeitgeber abhängig, der diese nach Gutdünken festlegen konnte. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Ganz im
Gegenteil. Es sieht so aus, als dürfte sich der Arbeitsmarkt zumindest vorübergehend, mit
Blick auf die demografische Entwicklung, aus der eine Überalterung der Bevölkerung resultiert, womöglich sogar dauerhaft, zu einem Arbeitnehmermarkt wandeln, in dem die Arbeitskräftenachfrage das Angebot übersteigt. AMS-Tirol-Landesgeschäftsführer Alfred Lercher kennt die Gründe Die Ab- oder je nach dafür: „Der Fachkräftemangel einerseits ist nicht neu, wurde durch Sichtweise Erlösung die Pandemie aber verschärft. Hinzu kommt nun ein Arbeitskräf- des Menschen durch temangel und wir haben Probleme, Lehrstellen zu besetzen. Denn hier spüren wir die geburtenschwachen Jahrgänge. Gleichzeitig geht die Babyboomer-Generation in Pension und die erwerbstätige Bedie Maschine ist auch heute noch völkerung wird im Durchschnitt älter. Wir sind immer stärker auf Quell von Ängsten die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland und auf ei- und Hoffnungen ne höhere Erwerbsbeteiligung angewiesen. Wir beobachten, dass die Beschäftigung mit Ausnahme der Coronajahre sowohl bei den gleichermaßen.
Teilzeit- als auch bei den Vollzeitbeschäftigten stetig ansteigt.” Steigende Beschäftigung sorgt aber nicht für Entspannung am Arbeitsmarkt, weil zugleich noch ein anderes Phänomen auftritt, wie Lercher erklärt: „Gleichzeitig sehen wir in der Statistik in allen Altersgruppen einen eindeutigen Trend zu einer Verringerung der Arbeitszeit.
Es arbeiten also immer mehr Menschen, diese jedoch in einem geringeren Zeitausmaß.”
Darum entscheide heute, so Lercher, „die Attraktivität des Unternehmens darüber, wer zum Zug kommt“. Insofern ist es für den AMS-Landesgeschäftsführer auch keine Anomalie, dass vermehrt über die Viertagewoche geredet wird, sondern eine natürliche und logische gesellschaftliche Entwicklung. „Die Viertagewoche ist ein Arbeitszeitmodell, bei dem die

JULIA BRANDL, PROFESSORIN FÜR PERSONALPOLITIK
Beschäftigten ihre üblicherweise auf fünf Tage verteilte Arbeitszeit in vier Arbeitstagen erbringen, bei gleichem Gehalt. Man arbeitet also an vier Tagen etwas länger – beispielsweise zehn statt acht Stunden – und hat dafür drei statt zwei Tage ‚frei‘“, erklärt Julia Brandl, die eine Professur für Personalpolitik an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Innsbruck innehat. Die Wirtschaftswissenschaftlerin bestätigt Lerchers Aussage, dass ein wesentlicher Grund dafür, dass die Arbeitszeitdebatte jetzt aufkomme, der viel diskutierte Fachkräftemangel ist: „Die Gewerkschaften legen nun ihre Vorstellungen zur Arbeitszeitgestaltung vor und die Arbeitgeber wissen, dass sie diese Vorstellungen nicht ignorieren können, um Personal gewinnen und halten zu können.“ Wenn die Arbeit vor Ort stattfindet, ist ein weiteres gutes Argument für die Viertagewoche die Reduzierung von Fahrtzeiten und damit verbundener Verkehrsbelastung, führt Julia Brandl aus. Der Gesetzgeber in Österreich hat jedenfalls seine Unterstützung in Richtung 4 Viertagewoche signalisiert, indem viele Jobs nicht mehr adäquat oder überhaupt nicht mehr besetzt werden können? „Das sind Überlegungen, die derzeit viele beschäftigen. Es gibt Stimmen, die sagen, mit dem aktuellen Fachkräfte- bzw. generellen Arbeitskräftemangel wäre das nicht umsetzbar. Andere wieder meinen, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit zu einer Steigerung der Produktivität führt“, weiß Lercher, der zugleich betont, dass es unterschiedliche Ansätze brauche. Was für ein Unternehmen passt, kann für einen anderen Betrieb kontraproduktiv sein. „Das gewählte Arbeitszeitmodell muss auch mit dem Ökosystem und Erfordernissen des jeweiligen Unternehmens kompatibel sein“, sagt Lercher, der mit dem AMS auf individuelle Lösungen setzt. In dieselbe Kerbe schlägt auch Wirtschaftswissenschaftlerin Julia Brandl: „Die Arbeitsproduktivität hängt davon, ab, wie gut ein Arbeitszeitmodell in das Gesamtkonzept des Arbeitgebers für den Umgang mit Beschäftigten passt, und wie dieses Arbeitszeitmodell im Betrieb gelebt wird.“ Pauschalisierungen sind schwierig, die Datenlage ist nach wie vor dünn. Sicher weiß man derzeit nur, dass „ein neues Arbeitszeitmodell auch immer mit Umrüstungsaufwand verbunden ist, sowohl in den betrieblichen Abläufen als auch in den Köpfen der Beteiligten“, sagt Brandl. Ein aktuelles Pilotprojekt in Großbritannien mit mehr als 3.000 Teilnehmern aus unterschiedlichsten Branchen soll helfen, die Datenlage zu verbessern. „Erst wenn wir die Reaktionen der Beschäftigten auf einen zusätzlichen freien Tag verstehen, können wir die Auswirkungen der Viertagewoche auf Produktivität und Engagement besser abschätzen“, weiß Julia Brandl.
Außerdem sieht die Realität auch in Zeiten des Coronavirus noch anders aus. Die Pandemie mit ihren gesellschaftlichen und ökonomischen Einschränkungen dürfte zwar für manche Arbeitnehmer eine Atempause gebracht haben, während andere – besonders jene, die als systemrelevant gelten – besonders gefordert waren und sind. „Laut Statistik Austria lag die durchschnittliche Normalarbeitszeit von Vollzeiterwerbstätigen in Österreich im Jahr 2021 bei rund 42 Stunden pro Woche. Tendenz sinkend“, weiß Alfred Lercher. Das ist in der EU der zweithöchste Wert, im Schnitt wird dort 40,7 Stunden gearbeitet.
beispielsweise der Zwölfstunden-Arbeitstag etabliert wurde.
Was die Auswirkungen der breiten Einführung einer Viertagewoche betrifft, müsse man differenzieren, meint Alfred Lercher: „Sprechen wir von einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Gehalt oder sprechen wir von einer Verdichtung der Arbeitszeit auf weniger Tage?“ Lercher glaubt, dass es jedenfalls Änderungen geben wird, „ganz einfach, um die große Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften befriedigen zu können.“ Der AMS-Landesgeschäftsführer gibt zu bedenken, dass „die Einführung einer Viertagewoche zur Folge haben könnte, dass es besonders im Dienstleistungssektor zu einer Verminderung des Angebots kommt“. Das zeichnet sich bereits auch ohne Viertagewoche vor allem in der Gastronomie ab. Dort lässt sich eine Zunahme der Ruhetage beobachten, die auf chronischen Personalmangel zurückzuführen ist.
Wie ließe sich eine Viertagewoche – mit oder ohne Verkürzung der Arbeitszeit – überhaupt bewerkstelligen, wenn schon heute DIE REGENERATION DER ARBEITSKRAFT „Die Geschichte der Arbeitszeit ist eng mit der Industrialisierung verknüpft. Die Fest-
legung fixer Arbeitszeiten war nicht der Großzügigkeit der arbeitgebenden Unternehmen geschuldet, sondern der Erkenntnis, dass Arbeitskraft regeneriert werden muss. Die Freizeit dient der Regeneration der Arbeitskraft. Das wurde sukzessive juristisch reglementiert. Die Arbeitskämpfe des 19. Jahrhunderts waren wesentlich auch Kämpfe um Freizeit und um eine geregelte Arbeitszeit“, sagt Andreas Oberprantacher, der als Philosoph seine Gedankenwerkstatt als Professor für Praktische Philosophie an der Universität Innsbruck hat. Dass dieser Kampf um verträgliche Arbeitszeiten global nicht überall gleich weit fortgeschritten ist, lässt sich etwa anhand chinesischer Verhältnisse in der Tech-Industrie illustrieren. Dort gibt es, inoffiziell zwar, eine verbreitete Praxis der sogenannten 996-Arbeitswoche, die mitunter als „moderne Sklaverei“ bezeichnet wird. Zu Recht, denn 996 bedeutet, von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends an sechs Tagen die Woche zu arbeiten. Das ergibt eine knackige und nicht besonders nachhaltige 72-Stunden-Woche, die in unseren Breiten seit Jahrhunderten passé ist.
ARBEIT IST NICHT GLEICH ARBEIT Unter Arbeit wird nach wie vor hauptsächlich Erwerbsarbeit verstanden, die in Vollzeit vor allem von Männern geleistet wurde und wird. Andreas Oberprantacher weist auf die nach wie vor bestehende Heteronormativität der Verhältnisse hin: „Die unentgeltlich geleistete Arbeit der unzähligen Frauen, die für die Hausarbeit zuständig waren, ist überhaupt nicht anerkannt worden.“ Ein Umstand, der sich bis heute nicht wesentlich geändert hat. Notwendige Dinge wie Hausarbeit und zunehmend auch Angehörigenpflege bleiben überwiegend Frauensache und werden nicht ausreichend honoriert. Hausarbeit und Care sind gegenüber der Erwerbsarbeit, für die Arbeitszeitregelungen exklusiv gelten, offenbar Tätigkeiten zweiter Klasse, notwendig und doch selbstverständlich. Der Philosoph ortet allgemein eine gewisse Orientierungslosigkeit, die mit dem Arbeitsbegriff an sich zusammenhängt: „Es fällt uns gegenwärtig begrifflich schwer zu verstehen, was Arbeit überhaupt ist und woran sie festgemacht werden soll.“
Der Arbeitsbegriff bedarf, könnte man daraus folgern, einer Überarbeitung, einer inklusiveren Version 2.0. „Wir operieren mit einem Arbeitsbegriff, der nicht mehr wirklich brauchbar ist, um das zu erfassen, was heute alles an Arbeit geleistet wird“, legt es der Philosoph einmal grundsätzlich an. Er weist auch auf die besonders in der Pandemie augenfällige Lücke zwischen dem gesellschaftlichen Wert und der monetären Bewertung der Sorgearbeit hin. Vielfach wird die Arbeit vom Menschen

proudly presented by

Who else?

47°14‘37.446“ N 11°17‘24.698“ E – Luxuriöse Dachterrassen-MaisonetteWohnung in AXAMS/OMES, Wohnnutzfläche ca. 95,32 m², 3 Zimmer, Balkon / Gäste-WC / 2 Carports / Keller, Dachterrasse ca. 118 m², Baujahr 2018, KP 780.000 Euro

47°16‘30.439“ N 11°30‘36.857“ E – Perfekte Anleger-Starterwohnung in AMPASS, Wohnnutzfläche ca. 45 m², 2 Zimmer, 2018 komplett saniert, HWB 111,95 kWh/m2a, KP 255.000 Euro
© ARCHIVISU
47°13‘27.566“ N 11°16‘33.521“ E – Exklusive Terrassen-Wohnungen in AXAMS, Gesamtfläche ca. 924 m², 3 Wohnungen ca. 171 m² / ca. 85,86 m² / ca. 112,70 m², Garten / Terrasse / Keller, HWB 50 kWh/m2a
IMMOBILIENMANAGEMENT JENEWEIN GmbH
Eduard-Bodem-Gasse 8, 6020 Innsbruck Tel.: 0512-26 82 82 E-Mail: office@immobilien-jenewein.at www.immobilien-jenewein.at
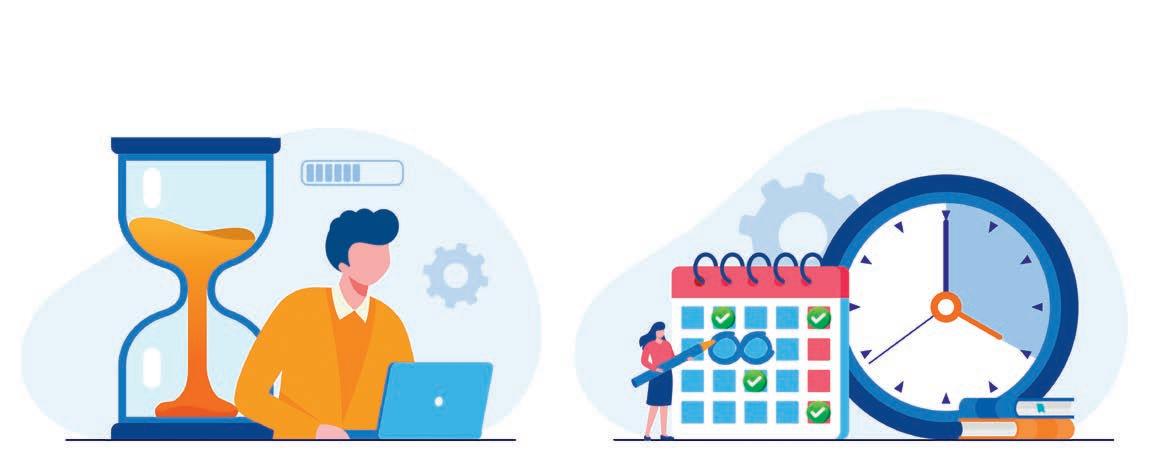
am Menschen als Selbstverständlichkeit erlebt, als zwischenmenschliches „no na ned“, als gesellschaftliche Vorbedingung, deren Fehlen sich erst bemerkbar macht, wenn sie nicht mehr im ausreichenden Umfang geleistet wird. Was das wirklich heißt, ist anhand des sich verschärfenden Pflegemangels mittlerweile in Echtzeit zu besichtigen. Es gebe in der Gesellschaft eben Arbeiten, die gehyped würden, und solche, die zwar als notwendig, aber weder finanziell noch symbolisch als wertvoll erscheinen. Erschwerend kommt dazu, dass besonders von Prekarisierung und mangelnder Wertschätzung betroffene Bereiche der Arbeitswelt keine besonders gute Lobby haben. Der Matthäus-Effekt – Wer hat, dem wird gegeben – schlägt auch in der Arbeitswelt gnadenlos zu. Für Andreas Oberprantacher ist diese ein Gebiet, auf dem arbeitend ebenso Selbstverwirklichung wie Selbstzersetzung stattfinden kann. „Selbstverwirklichung, über seinen Beruf zu dem zu werden, der man immer schon sein wollte, ist ein Mantra, das ich für relativ unglaubwürdig halte”, sagt der Philosoph. „Es gibt sehr viele Tätigkeiten, die nicht unbedingt zur Selbstverwirklichung beitragen, aber dennoch notwendig sind.“ Wer seine Selbstfindung und Identität zu sehr von seiner beruflichen Tätigkeit abhängig macht, könnte enttäuscht werden. „Die beiden Ziele, sich im Job zu verwirklichen und Auszeiten in Anspruch nehmen zu können, in denen man sich anderen Themen widmet, schließen sich meiner Meinung nach nicht aus. Selbstverwirklichung im Job ist für die Beschäftigten keine Frage, wie viel Zeit sie im Job verbringen und wann, sondern dass ihre Arbeit für sie sinnvolle Inhalte hat“, hält Julia Brandl fest. EINE FRAGE DER PRODUKTIVITÄT Das Missverhältnis zwischen Wert, Wertschätzung und Entlohnung, unter dem manche Berufsgruppen leiden, dürfte wiederum der, wie es Hannah Arendt einst formuliert hat, „Tendenz, alles Vorfindliche und Gegebene als Mittel zu behandeln; das große Vertrauen in Werkzeuge und die Hochschätzung der Produktivität im Sinne des Hervorbringens künstlicher Gegenstände“, geschuldet sein. Die Produktivität wurde in der Ökonomie zum Fetisch, Handeln mit Herstellen identifiziert und, wie Arendt einwendet, alles Denken, das nicht auf die „Fabrizierung von künstlichen Gegenständen, vor allem von Werkzeugen, mit denen man Werkzeuge produzieren kann“, abzielt, sei der Verachtung anheimgefallen. Dabei hat sich der Konnex zwischen Produktivitätsfortschritt und Entgelt für die produktive Tätigkeit längst in Luft aufgelöst, weil die Löhne und Gehälter nicht einmal annähernd im selben Ausmaß gewachsen sind wie die Produktivität.
Hannah Arendt führte Ende der 1950er-Jahre den Begriff des „animal laborans“, des Menschen als arbeitenden Tiers, ein, dessen Ziel die kontinuierliche
Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Umwandlung aller Dinge in Konsumgüter sei. Das klingt unverändert nach dem Stand der Dinge. Heute werden zusätzlich auch die meisten nichtmateriellen Dinge auf dem Dienstleistungsweg in Konsumgüter transformiert. Das Thema Produktivität führt auch AMS-Tirol-Chef Alfred Lercher ins Feld, wenn er zu bedenken gibt, dass seit den 1980er-Jahren in Österreich die kollektivvertragliche Normalarbeitszeit nahezu unverändert geblieben sei. „Und das, obwohl die Produktivität über die letzten Jahre rasant angestiegen ist. Einige Schätzungen gehen sogar davon aus, dass wir seit den 1980er-Jahren um mehr als 50 Prozent „Selbstverwirklichung, über seinen produktiver arbeiten“, sagt Lercher. Die Geschichte der Arbeitszeitverkürzung strotzt auf den ersten Blick nur so
Beruf zu dem zu vor Erfolgen, welche die Arbeitnehmer im werden, der man Lauf der Zeit errungen haben. Das Bild wanimmer schon sein wollte, ist ein Mantra, delt sich allerdings beträchtlich, wenn man diesen Fortschritt nicht nur an den Frühstadien der kapitalistischen Entwicklung das ich für relativ misst. „Wenn wir unseren Betrachtungen unglaubwürdig darüber, wie herrlich weit wir es gebracht halte.“ haben, etwas längere Zeiträume zugrunde legen, so kommen wir zu der überraschen-
ANDREAS OBERPRANTACHER den Feststellung, dass wir es bisher, was die jährliche Gesamtsumme der auf jeden entfallenden Freizeit anlangt, noch nicht sehr viel weiter gebracht haben, als uns wieder einem halbwegs normalen und erträglichen Maß zu nähern“, hält Arendt nüchtern fest und weist darauf hin, dass schätzungsweise „während des Mittelalters nicht mehr als die Hälfte der Tage im Jahr gearbeitet wurde“. Die – Zitat Arendt – „monströse“ Ausdehnung des Arbeitstages sei für die Anfangsstadien der Industriellen Revolution insofern charakteristisch gewesen, als man die Arbeiter „gleichsam mit den neu eingeführten Maschinen konkurrieren ließ“.

ANDREAS OBERPRANTACHER, PROFESSOR FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE
Die Ab- oder je nach Sichtweise Erlösung des Menschen durch die Maschine ist auch heute noch Quell von Ängsten und Hoffnungen gleichermaßen. Heute ist es nicht der Webstuhl, der uns überflüssig zu machen verspricht, sondern der Computer mit seinen Algorithmen und seiner künstlichen Intelligenz, der kurz vor dem Quantensprung steht. Geschichte wiederholt sich. Ob das noch eine Tragödie oder schon eine Farce ist, sei dahingestellt. Jedenfalls dürften die Menschen vor der Industrialisierung weniger gearbeitet haben. Heute sind wir beim Achtstundentag angelangt. Wobei es in manchen Berufsgruppen zunehmend schwieriger wird, Arbeit klar von Freizeit zu unterscheiden.
KOLONISIERTE FREIZEIT Die Grenze zwischen Freizeit und Arbeitszeit sei seit langem immer diffuser geworden, meint Philosoph Andreas Oberprantacher: „Vor allem die Freizeit wurde durch Arbeitszeit kolonisiert.“ Die technischen Geräte – allen voran das Smartphone –, die den Menschen im Alltag ein gewisses Vergnügen bereiten, sind zugleich die Geräte, die auch unaufhörlich Arbeit machen. Die Erwerbstätigen switchen außerhalb der regulären Arbeitszeit zwischen Candy Crush und E-Mail, zwischen TikTok und Firmenchat. Das ist wohl Dual Use im besten und schlechtesten Sinne. „Durch die ständige Erreichbarkeit vieler Arbeitnehmer bleibt die Regeneration auf der Strecke“, sagt Oberprantacher. Daraus ergibt sich fast schon eine Notwendigkeit, im Urlaub einmal im wörtlichen wie übertragenen Sinn abschalten zu können und der Stressfalle namens „ständige Erreichbarkeit“ zu entfliehen. Das affirmative „My home is my castle!“, die das Heim zur ultimativen Trutzburg der Privatheit erklärt, ist nicht zuletzt durch die Pandemie einem ambivalenteren „My home is my office“ gewichen, in dem Frei- und Arbeitszeit ineinanderrinnen. Oberprantacher sieht eine neue Vagheit über die Arbeitswelt hereingebrochen und mit ihr „die Tendenz, dass sich immer mehr Dinge beginnen als Arbeit anzufühlen“. Der Philosoph nennt beispielhaft die Versorgung der digitalen Existenz über die sozialen Medien. Unsere Internetidentität will schließlich gehegt und gepflegt werden, fast wie das Tamagotchi der 1990er. Für bedenklich hält der Philosoph auch die Entwicklung hin zu einem „Arbeiten-on-Demand“, vielfach prekär, in Teilzeit und ohne fixe Arbeitszeiten. Arbeit auf Ab- und Zuruf, die immer dann geleistet werden soll, wenn sie akut gebraucht wird. So soll wohl sichergestellt sein, dass „es nicht zu viel Leerzeiten gibt, die nicht effizient genutzt werden können“, erklärt Oberprantacher. Dieses zweifelhafte Modell findet sich schon in der sogenannten Gig Economy – einem informellen Arbeitsmarkt, bei dem zeitlich befristete Aufträge flexibel und kurzfristig an Arbeitsuchende, Freelancer oder geringfügig Beschäftigte vergeben werden – weitgehend verwirklicht.
GREAT RESIGNATION Anders als befürchtet geht dem modernen Menschen seine Arbeit durch den technologischen Fortschritt nicht aus. „Sie ist auch im 21. Jahrhundert nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil“, sagt Oberprantacher, der immer mehr Bedürfnisse geweckt sieht, die durch Arbeitstätigkeit befriedigt werden müssen. Zurücklehnen und die Früchte der kontinuierlichen Produktivitätsfortschritte in Form umgekehrt proportional abnehmender Wochenarbeitszeit zu ernten, ist weiterhin über weiteste gesellschaftliche Strecken eine Denkunmöglichkeit, ein geradezu häretischer Gedanke, der der herrschenden ökonomischen Logik zuwiderläuft. Dieser systemimmanenten Logik zufolge präsentieren sich manche Dinge als Sachzwänge, die aus einer Betrachtung von außerhalb des Systems vielleicht keineswegs so wirken würden. „Arbeitsverhältnisse müssen so gestaltet sein, dass das Leben für alle lebenswerter wird. Das gebietet schon die Menschenwürde. Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen muss heute auf mehreren gesellschaftlichen Ebenen geführt werden, weil er alle betrifft“, argumentiert Andreas Oberprantacher.
An die Stelle des Klassenkampfes ist heute ein verbreitetes Unbehagen mit dem Modell „Hamsterrad” getreten, das alle gesellschaftlichen Schichten durchdringt. Anders ist es kaum zu erklären, dass mit Anti-Work eine Haltung global salonfähig geworden ist, die geregelte Erwerbsarbeit aufgrund der vorherrschenden Arbeitsumstände ablehnt und für eine grundlegend neue Arbeitsethik eintritt. Eine damit in Verbindung stehende Kündigungswelle, wie sie die USA erfasst hat, gibt es in Österreich nicht, auch wenn die Wechselbereitschaft am heimischen Arbeitsmarkt historisch hoch sein dürfte, glaubt man dem Arbeitsklima-Index von

„Wir sehen in der Statistik in allen Altersgruppen einen eindeutigen Trend zu einer Verringerung der Arbeitszeit. Es arbeiten also immer mehr Menschen, diese jedoch in einem geringeren Zeitausmaß.“
ALFRED LERCHER, LANDESGESCHÄFTSFÜHRER AMS TIROL
SORA und IFES. „Waren vor Corona die individuellen Arbeitsmarktchancen noch die Grundvoraussetzung, tatsächlich den Schritt zur Veränderung zu wagen, so überlegen jetzt immer mehr Menschen einen Jobwechsel auch ungeachtet ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt, etwa wegen schlechter Arbeitsbedingungen, die sie sich nicht mehr gefallen lassen wollen“, heißt es im Arbeitsklima-Index, demzufolge über ein Viertel der Beschäftigten in Österreich offen für einen Job- oder gar Branchenwechsel sind. Das ist noch nicht die Great Resignation wie in den Vereinigten Staaten, aber jedenfalls ein starkes Signal, das bei der Diskussion um eine Viertagewoche bei gleicher oder kürzerer Arbeitszeit mitbedacht werden sollte. „In den Medien hören wir derzeit immer wieder, dass besonders junge Menschen kein Interesse mehr hätten, Vollzeit zu arbeiten, da diese in eine Erbengeneration fallen würden und das nicht nötig oder aber resigniert hätten, weil ihnen bewusst geworden sei, dass mit Arbeit ein Eigenheim finanziell nicht erreichbar ist. Es wird sicherlich Menschen geben, bei denen das zutrifft, aber eine pauschale Aussage darüber kann man nicht treffen. Wichtiger ist es, dass man von der Arbeit die Kosten des täglichen Lebens bestreiten kann und das besonders in Tirol, wo die Lebenshaltungskosten hoch sind“, vertritt Lercher einen pragmatischen Standpunkt. „Es geht so gesehen vor allem darum, die Realisierung verschiedener Lebensmodelle zu ermöglichen. Arbeitszeitverkürzung ist für viele ein großes Thema und das Gehalt ist ein wichtiger Baustein bei der Realisierung, aber nicht der einzige.“
Sobald von einer Arbeitszeitverkürzung die Rede ist, ist meist auch die Forderung nach einem wie auch immer gearteten „bedingungslosen Grundeinkommen“ nicht weit. Andreas Oberprantacher bringt dazu eine andere Idee als Alternative ins Spiel: „Ich halte es für plausibler, die gemeinnützige Infrastruktur, die es zum täglichen Leben braucht, zu entkommerzialisieren. Dadurch stünden diese Infrastrukturen – beispielsweise der öffentliche Verkehr – der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung und wären zugleich einer weiteren Finanzialisierung entzogen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde vermutlich schnell irgendwo abgeschöpft werden, weil alles bepreist werden würde.”
Fakt sei, betont Alfred Lercher, „dass eine Arbeitszeitverkürzung positive Effekte auf die Lebensqualität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat“. Befürworter der Viertagewoche würden häufig argumentieren, dass man so der Arbeitslosigkeit entgegenwirken könne, weil sich die Arbeit auf mehr Köpfe verteile. „Grundsätzlich klingt das plausibel, einige Studien belegen jedoch das Gegenteil. Auch Wifo und IHS sehen solche Argumente kritisch“, sagt Lercher. Während Diskussionen um die Arbeitszeit üblich sind und in einer historischen Kontinuität stehen, sorgt „Zeit“ als ausschlaggebende Maßzahl für die Entlohnung der Erwerbsarbeit kaum für Debatten. „Die Stunden als Bemessungsgrundlage für die Vergütung von Arbeit sind in unserem Beschäftigungssystem umfassend verankert“, sagt Julia Brandl. Sie sind elementarer Bestandteil von Arbeitsverträgen und Grundlage für die Planung der Produktionsabläufe oder Öffnungszeiten. Der AMS-Landesgeschäftsführer weiß sowohl aus persönlicher Erfahrung als auch aus der Forschung, dass „die 10. Stunde am Tag oder die 40. Stunde in der Woche nicht mehr gleichwertig sein kann wie die Stunden, die man erholt und mit frischer Energie investiert.“ In der Pandemie habe sich zudem gezeigt, wie wichtig „vermeintlich unproduktive Arbeitszeiten wie die Kaffeepause mit den Kolleginnen und Kollegen für das zwischenmenschliche Gefüge und die Arbeitsmotivation sein können. Eine klare Abgrenzung von produktiver und nicht produktiver Arbeitszeit ist daher kaum möglich.“ Alfred Lercher argumentiert weiter: „Ich glaube, dass 40 Stunden die Woche nicht mehr zeitgemäß sind und dieselbe Wertschöpfung auch mit weniger Stunden möglich ist. Durch kürzere Zeiten mit einem besseren Fokus könnte man das erreichen. So gesehen wäre eine Arbeitszeitreduktion vor allem eine Investition in die Leistungsfähigkeit und die Regeneration der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Eine breite Debatte um die Viertagewoche und in Folge auch um eine Verkürzung der Arbeitszeit wird, sofern der Arbeitsmarkt ein Arbeitnehmermarkt bleibt, jedenfalls stattfinden. Sie sollte ohne Zorn und Eifer geführt werden. Es wäre interessant, die These, wonach Produktivität ernten wird, wer Lebensqualität sät, schon bald einem großflächigen Praxistest zu unterziehen.
ARBEIT TROTZ(T) KRISE
Der Tiroler Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Monaten als äußerst robust erwiesen. Es gibt Rekordzahlen in der Beschäftigung, die Arbeitslosenquote liegt unter dem Vorkrisenniveau, die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt kontinuierlich. Dennoch ist der Mangel an Arbeitskräften stark spürbar – in allen Branchen. Die Arbeitsmarktdaten für Mai 2022.
2.153
Langzeitbeschäftigungslose
Das entspricht einem Minus von 2.901 Personen oder 57,4 % im Vergleich zum Vorjahr.
11.592
beim AMS gemeldete offene Stellen
1.396
beim AMS gemeldete offene Lehrstellen Lehrstellensuchende: 323
6.484
Menschen sind im April 2022 arbeitslos geworden – hauptsächlich in der Beherbergung und Gastronomie. 9.241 Menschen haben die Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum beendet.
4,4 %
Arbeitslosenquote in Tirol Österreich: 5,7 %
Damit verzeichnet Tirol die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 30 Jahren!
3,5 %
Arbeitslosenquote unter 25 Jahre Österreich: 4,8 %
15.579
vorgemerkte Arbeitslose Frauen: 8.325 / Männer: 7.254 Unter 25 Jahre: 1.501 / Über 50 Jahre: 5.291
Das entspricht einem Minus von 7.235 Personen oder 31,7 % im Vergleich zum Vorjahr.
340.000
unselbständig Beschäftigte in Tirol Frauen: 160.000 / Männer: 180.000
Das entspricht einem Plus von 9.000 Personen oder 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr
2.554
Personen sind in Schulungen des AMS.
WIR SORGEN FÜR IHRE GESUNDHEIT
Die Medizinische Universität Innsbruck ist mit rund 2.200 Mitarbeiter*innen in wissenschaftlichen, ärztlichen und administrativen Bereichen sowie etwa 3.400 Studierenden die bedeutendste medizinische Forschungs- und Bildungseinrichtung in Westösterreich. Gemeinsam mit den Tirol Kliniken am Landeskrankenhaus Innsbruck ist sie für die hochqualitative regionale und überregionale Patient*innenversorgung verantwortlich.
FORSCHEN
Die wissenschaftliche Forschung an der Medizinischen Universität Innsbruck ist sowohl national als auch international ausgesprochen erfolgreich. Den medizinischen Errungenschaften liegt eine lange Tradition zugrunde, deren Wurzeln bis ins Jahr 1562 zurückreichen. Heute ist der universitäre Medizin-Campus mit moderner Labor- und Klinikinfrastruktur Garant für eine erfolgreiche Gegenwart und vielversprechende Zukunft der medizinischen Forschung am Standort Tirol. Das breite Forschungsspektrum an der Medizinischen Universität Innsbruck umfasst in besonderer Weise die Bereiche Infektion, Immunität und Transplantation, Neurowissenschaften, Onkologie sowie Genetik – Epigenetik – Genomik.
LEHREN
Vom ersten Tag ihres Studiums an werden die künftigen Mediziner*innen und Wissenschafter*innen an der Medizinischen Universität Innsbruck auf die verantwortungsvollen Aufgaben des ärztlichen und wissenschaftlichen Alltags vorbereitet. Die Studierenden der Human- und Zahnmedizin erhalten eine wissenschaftlich fundierte und anwendungsorientierte Ausbildung auf höchstem Niveau, durch die sich der ständige Kontakt zu den Patient*innen wie ein roter Faden zieht. Vertiefend steht den Absolvent*innen postgradual ein PhD- oder Clinical-PhD-Studium offen. Das Wissen über molekulare Grundlagen von Gesundheit und Krankheit ist für die moderne Medizin unerlässlich. Dieses Know-how wird im Studium der Molekularen Medizin gelehrt.

HEILEN
Diagnostik und Behandlung gehören zu den Kernaufgaben an der Medizinischen Universität Innsbruck. Die Mitarbeiter*innen in den Universitätskliniken sind für eine hochqualitative, regionale und überregionale Krankenversorgung verantwortlich. Die Medizinische Universität Innsbruck arbeitet dabei sehr eng mit den Tirol Kliniken zusammen. Innsbrucker Mediziner*innen erlangen mit neuen Therapiemethoden und Forschungserkenntnissen internationale Beachtung. Patient*innen aus aller Welt kommen nach Innsbruck, um sich hier behandeln zu lassen. PR

Eine moderne Laborinfrastruktur bietet beste Voraussetzungen für erfolgreiche Forschung.
Im Skills-Lab finden Studierende ideale Bedingungen vor, ihre medizinischen Kenntnisse praxisnah zu testen.

Vom Labor zum Krankenbett: Neueste Behandlungsmethoden kommen täglich zum Einsatz.

INNOVATIVER MASCHINENBAU NEU GEDACHT
Angetrieben von unermüdlichem Innovationsgeist entwickelt und produziert die Felder Group im Herzen Tirols intelligente Lösungen und Produkte für all jene Anwender*innen, die mehr als einfach nur eine Maschine wollen. Richtungsweisende Maschinenkonzepte und qualitativ hochwertige Produkte haben das Familienunternehmen seit 1956 zu einem der Technologieführer der Branche gemacht.

Die Felder Group zählt zu den weltweit führenden Maschinenbau- und Technologieunternehmen im Bereich der Holz- und Verbundstoffbearbeitung. Über 800 Mitarbeiter*innen arbeiten täglich im Werk Hall in Tirol daran, intelligente Lösungen für die Holzbearbeiter*innen auf der ganzen Welt zu finden. Die Modellpalette der Felder Group umfasst weit über 180 Maschinen – von kombinierten Standard-Holzbearbeitungsmaschinen bis hin zum High-End-5-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum – sowie smarte Software und vollautomatisierte Robotiklösungen.
Heute zählen dieselben Werte, die das Unternehmen seit Jahrzehnten begleiten: „Wir sind ein Unternehmen, das sich dem Ziel verschrieben hat, auf Augenhöhe zu agieren, verlässlich zu sein und den Mut zu haben, Neues zu wagen. Wir glauben daran, dass dies dem Zeitgeist entspricht, und haben auch keine Angst, dies immer wieder neu zu überdenken und uns zu hinterfragen, um bestmöglich auf die Marktgegebenheiten zu reagieren“, kennen die beiden Geschäftsführer Hansjörg und Martin Felder die Gründe für den Erfolg ihres Unternehmens.
TIROLER UNTERNEHMEN, INTERNATIONALER ERFOLG Mit Pioniergeist zum Spitzentechnologie-Unternehmen: Über 40 Mitarbeiter*innen in der Forschungsabteilung entwickeln ständig neue Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender*innen auf der ganzen Welt. 39 internationale Patente, 100 Maschinen-Neuentwicklungen und Markteinführungen in den letzten Jahren zeigen den Stellenwert der Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Felder Group und haben das Unternehmen zu einem der Vorreiter der gesamten Branche gemacht. In den über 270 Verkaufs- und Servicestellen weltweit können die Maschinen auf Herz und Nieren geprüft und zahlreiche innovative Neuentwicklungen live erlebt werden.
VORREITER BEI FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Bereits 2012 setzte das Tiroler Familienunternehmen mit der patentierten, revolutionären Silent-Power Spiralmesser-Hobelwelle neue Maßstäbe hinsichtlich Lärmminderung und Wirtschaftlichkeit bei Abricht- und Dickenhobelarbeiten. Die bahnbrechende Felder-Eigenentwicklung basiert auf der Schneidengeometrie einer Spiralhobelmesserwelle und beeindruckt mit großen Spanräumen und speziellen Hartmetallschneiden mit vier Schneidfasen. Silent-Power bietet eine bis zu 20-fach höhere Schneidenstandzeit gegenüber konventionellen HSS-Schneiden. Mittlerweile gehört die Spiralmesser-Hobelwelle schon zum guten Ton in holzbearbeitenden Betrieben auf der ganzen Welt.
Eine der aktuell richtungweisendsten Innovationen ist PCS®, die patentierte Weltneuheit bei Sicherheitseinrichtungen für Formatkreissägen. Das Preventive Contact System erkennt menschliches Gewebe in der Gefahrenzone kontaktlos und lässt das Sägeblatt wie von Zauberhand in wenigen Millisekunden verschwinden. Die auf dem elektromagnetischen Abstoßprinzip basierende Funktionsweise ermöglicht eine bisher unerreichte, extrem kurze Reaktionszeit. Dabei ist es 100 Prozent beschädigungsfrei für Maschine und Sägeblatt – und auf Knopfdruck wieder einsatzbereit. PCS ist auf Wunsch als Erstausstattung mit der Format4 Formatkreissäge kappa 550 erhältlich.
Ein weiterer revolutionärer Erfolg der Felder Group ist die patentierte glueBox für die Format4® tempora F600 60.06 Kantenanleimmaschine. Sie macht die Verarbeitung von PUR-Klebern so einfach und unkompliziert wie nie zuvor. Anstelle des PUR-Klebers im Leimbecken von Kantenanleimmaschinen wird in der glueBox ein dünner PUR-Klebestreifen nahezu unsichtbar zwischen Kantenmaterial und Werkstück verschmolzen. Die PUR-Mankos wie komplizierte Verarbeitung, verschmutzte und verhärtete Leimbecken und lästige Reinigung sowie aufwändige Lagerung gehören mit glueBox der Vergangenheit an.
WEITERHIN AM PULS DER ZEIT Nach 66 Jahren ist die Felder Group mehr denn je am Puls der Zeit. „Am Markt entwickeln sich permanent neue Materialien, die nur mit Erfahrung und ständiger Forschung entsprechend wirtschaftlich und qualitativ bearbeitet werden können. Es gilt also, Trends zu erkennen und durch branchenübergreifende Produktentwicklung sowie mit Investitionen in neue Technologien am Ball zu bleiben. Egal, in welche Richtung sich die Märkte entwickeln, wir als Felder Group werden da sein“, geben Hansjörg und Martin Felder ein Versprechen für die Zukunft. Technische Daten und viele weitere Informationen finden Sie auf felder-group.com. PR

„Wir sind ein Unternehmen, das sich dem Ziel verschrieben hat, auf Augenhöhe zu agieren, verlässlich zu sein und den Mut zu haben, Neues zu wagen. Wir glauben daran, dass dies dem Zeitgeist entspricht, und haben auch keine Angst, dies immer wieder neu zu überdenken und uns zu hinterfragen, um bestmöglich auf die Marktgegebenheiten zu reagieren.“
MARTIN UND HANSJÖRG FELDER
DER GRÜNE DEAL
ATP architekten ingenieure – klimafit durch Integrale Planung
Wussten Sie, dass rund 40 Prozent aller CO2-Emissionen aus dem Bausektor kommen? Dass Häuser Energie verbrauchen, dem Klima schaden, Ressourcen vereinnahmen und Abfall erzeugen? Man stellt sich unwillkürlich die Frage: Muss das so sein? Was wäre, wenn Gebäude • mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen? • klimaneutral errichtet werden können? • als urbane Rohstofflager für die nächsten
Generationen dienen? • ihre Lebensdauer durch innovative Umnutzung verlängern?
Vieles sei heute längst möglich, sagt Thilo Ebert, TGA-Vorstand bei ATP architekten ingenieure (Bild). Er verweist auf Beispiele besonders zukunftsfähiger Gebäude, die bei ATP in „intensiven integralen Planungsprozessen“ entstanden sind. „Wir sind ein Netzwerk aus mehr als tausend Architekt*innen und Ingenieur*innen in Europa, die gelernt haben, über den Tellerrand ihrer eigenen Disziplin zu blicken. Wir entwerfen und planen nur noch simultan und auf Augenhöhe. Hier fließt das Know-how, hier übernimmt das gesamte Team Verantwortung. Es macht Spaß, gemeinsam erfolgreiche Bauten zu entwickeln.“
Immer dabei sind auch TGA-Expert*innen aus den eigenen Forschungsgesellschaften ATP sustain und ATP zero mit innovativen Strategien für nachhaltiges und klimaneutrales Bauen.
Der EU Green Deal sieht vor, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Nachhaltigkeit wird damit zum Muss. „Als integraler Planer und Digitalisierungsvorreiter gehen wir mit dem ATP Green Deal sogar noch einen Schritt weiter“, so Ebert. „Kein BIM-Modell verlässt unser Haus ohne eine zusätzliche klimaneutrale Idealvariante. Damit begleiten wir unsere Kunden*innen optimal in die Zukunft.“ PR
© ATP/BECKER

© ATP/BAUSE

THEURL
Das Holzunternehmen baute sein Bürogebäude mit Holzelementen aus der eigenen, 200 Meter entfernten Produktion. Holzbaupreis Kärnten (2020)


© ATP/PIERER
RINGANA CAMPUS
Eines der größten Geothermieprojekte Österreichs mit 160 Tiefbohrungen, Photovoltaik auf den Dächern deckt die Hälfte des Energiebedarfs, begrünte Dachflächen senken den Kühlbedarf. BigSEE Architecture Award (2021) TECHNOLOGIEZENTRUM SEESTADT 2 (TZ2)
ist ein Nearly-Zero-Emissions-Building im Passivhausstandard. ÖGNB Gold, klimaaktiv Gold (2019)
© ATP/KUBALL



© ATP/PALKÓ

© ATP/BAUSE
SWAROVSKI
Die „Kristallfabrik der Zukunft“ nutzt Grundwasser für ihre Kühlanlagen und speist die Lüftungsanlagen-Abwärme wieder zurück ins System. Streuobstwiese sowie begrünte Dachflächen. LEED Gold (2018) AUSTRO TOWER
Der Büroturm nutzt Flussenergie: Geheizt und gekühlt wird mit Wärmepumpen, die durch den benachbarten Donaukanal effizienter arbeiten als gewöhnlich. ÖGNI Platin (2022)
MARKAS
Das Headquarter fördert die Gesundheit der Nutzer*innen mit einem Tageslichtfaktor von über zwei und begrüntem Gartengeschoss. WELL-
Gold-Zertifizierung, Klimahaus-A-Zertifizierung in Südtirol, German Design
Award (2019)
ATP plant ressourcenschonend
ATP plant gesunde Lebensräume ATP plant CO2-neutral
ATP Green Deal
Nachhaltige Integrale Planung
ATP schützt Wasserressourcen ATP plant zirkulär
ATP plant klimaresilient
MAGDAS
In derGroßküche der Caritas wurden Abbruch- und Entsorgungsmaterialien und aufbereitetes Altholz (Up-/Re cycling) verwendet. Auch die Abwärme wird recycelt und dient der Heizung. ÖGNB-Gold,
BigSEE Interior Design
Award (2018)

© ATP
TIROLER VERSICHERUNG
Der Entwurf für das klimapositive Gebäude erfolgte entsprechend klimaaktiv- Gold-Standard. Ein konstruktiver Leichtbau sorgt für ca. 30 Prozent Reduktion grauer Emissionen. Ein begrünter Innenhof kühlt, Photovoltaik substituiert CO2-Emissionen maximal. Wettbewerb, 2. Preis (ex aequo).

© ATP/SCHALLER
VIEGA
Das Seminar- und Vertriebscenter mit Top-Ökobilanz erzeugt mehr Energie als es verbraucht. Die TGA wird nach einem umfassenden Monitoring von den Seminarteilnehmer*innen bewertet. BIM2FIM, DGNB-Platin, klimaaktiv-Gold (2021)
© ATP/KUBALL

WIRTSCHAFTSFAKTOR INDUSTRIE
Die Industrialisierung des Landes hat die Gesellschaft maßgeblich verändert, die wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig geprägt und sie immer wieder neu geformt. Tirols Industrie erbringt wahre Höchstleistungen – auch in herausfordernden Zeiten.
Die Industrie ist ein starker Wirkungssektor und der wertschöpfungsreichste Bereich des Landes. Über 420 Dienstgeberbetriebe beschäftigen rund 40.000 Frauen und Männer in gut bezahlten Ganzjahresarbeitsplätzen. Fast 70 Prozent der Produktion gehen in den Export, drei von vier Industriejobs hängen dabei von Auslandsaufträgen ab. Was in „normalen“ Zeiten wertvolle Arbeitsplätze sichert, wird aktuell zum Problem – neben anderen Faktoren wie dem generellen Fachkräftemangel, weltweiten Lieferkettenunterbrechungen und vor allem dem Damoklesschwert Energieversorgung. Die Effekte der rasant steigenden Teuerung stellen Bürger, aber auch Unternehmen vor riesige Herausforderungen. Die Lage ist vor allem in energieintensiven Industriebetrieben besorgniserregend. Die bereits jetzt reduzierten Erdgaslieferungen in manche Länder zeigen, dass die Gefahr eines russischen Lieferstopps deutlich gestiegen ist. Für die Industrie ist es deshalb wichtig, dass an höchster Stelle Vorbereitungen für einen drohenden Gasengpass getroffen werden und ein aktives Krisenmanagement betrieben wird. Gerade der produzierende Bereich braucht diesbezüglich so rasch als möglich Klarheit, denn besonders in Krisenzeiten ist Planbarkeit
© DIE FOTOGRAFEN
„Die Exportorientierung der Tiroler Industrieunternemen sichert nicht nur wertvolle Industriearbeitsplätze, sondern auch viele andere Jobs in der gewerblichen Wirtschaft. Dabei sind wir heute, aber auch in Zukunft, auf internationale Lieferketten und den Weltmarkt angewiesen.“

MAX KLOGER
für Unternehmen überlebenswichtig. So gut diese in der derzeitigen Situation eben zu bewerkstelligen ist.
KOMPLEXE INTERNATIONALE LIEFERKETTEN
In Österreich werden jährlich rund 8,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas verbraucht. Davon entfallen rund drei Milliarden auf die Industrie. Eine Einschränkung der Gaszufuhr würde sie folglich in besonders hohem Maß treffen. Kürzlich mahnte diesbezüglich die Chemische Industrie lautstark Vorbereitungen für den Ernstfall ein. Sie produziert einerseits systemrelevante Produkte wie Medikamente, Desinfektionsmittel oder Düngemittel, gleichzeitig ist sie wichtiger Zulieferer für alle anderen Industriesektoren. 96 Prozent der in der EU hergestellten Waren benötigen Vorprodukte aus der Chemie. Die Komplexität der Lieferketten wird dabei häufig unterschätzt und auch das oft herbeibeschworene Ende der Globalisierung wäre für die Industrie fatal.
Auch wenn die Coronapandemie gezeigt hat, wie wichtig regionale Produktion ist, die Arbeitsplätze erhält und Transportwege vermeidet, so ist eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit Voraussetzung für ein erfolgreiches Wirtschaften.
ES BLEIBT KOMPLIZIERT
Max Kloger, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Tirol, ist als Geschäftsführer der Tiroler Rohre GmbH unmittelbar mit der Situation konfrontiert und kennt die Problemfelder aus erster Hand. Die Tiroler Rohre haben selbst einen hohen Energiebedarf – an Strom, Gas und Koks zum Schmelzen des Altmetalls. Vor der Teuerung habe das Unternehmen je eine Million Euro im Jahr für Strom und Gas aufgewendet, für Letzteres sei der Preis mittlerweile drei Mal so hoch. Glaubt man Prognosen, könnte es sogar das Sechsfache werden. Für die heimische Politik muss nicht nur die Gasversorgung höchste Priorität haben, auch die Energiepreise verlangen nach raschen Maßnahmen.
Gleichzeitig braucht es auch ein achtsameres Wirtschaften seitens der Unternehmen, ein Umdenken habe diesbezüglich jedoch schon vor Corona stattgefunden, so Kloger: „Recycling, Upcycling und nachhaltiges Wirtschaften spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Der bewusste Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen fand schon vor der Pandemie statt, ist dadurch allerdings noch mehr in den Fokus der Menschen gekommen.“ Energieeffizienz ist nicht mehr nur eine Frage der Ökologie, sondern immer mehr der Ökonomie.
Tirols Wirtschaft gänzlich von Gas unabhängig zu machen, hält Kloger übrigens für möglich. Der Prozess aber dauere. Als Alternative sieht er vor allem die Wasserkraft, auch beim Wasserstoff ortet er Potenzial, wenngleich zu wenig Bewegung. „Die Energiepreissteigerungen in Europa sind nicht allein durch die Krise begründet, sondern auch durch den noch zu geringen Ausbau alternativer Energiegewinnung“, sagt er in einem kürzlich veröffentlichen Interview mit der Kronen Zeitung.
Bei den Tiroler Rohren indes investiert man bereits seit Jahren in das Thema Energieeffizienz, konkret etwa durch eine 9.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, die vor sechs Jahren auf dem Dach des Firmengebäudes installiert wurde. Sie versorgt das Unternehmen und gleichzeitig rund 300 Haushalte in der Region mit Energie. Außerdem wird die Abwärme der Gießerei genutzt, um sie ins regionale Fernwärmenetz einzuspeisen. Der Wirtschaftskammerobmann geht also mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie Lösungen aussehen können.
Dass es vorausschauende und nachhaltige Maßnahmen braucht, ist unbestritten. Selbst Betriebe mit guter Auftragslage müssen aktuell wegen fehlender Vormaterialien ihre Mitarbeiter zur Kurzarbeit anmelden, mancherorts muss die Produktion sogar ganz eingestellt werden. Hinzu kommen enorme Preisexplosionen, mangelnde Liquidität und teils bis ins Negative geschrumpfte Margen. Problembereiche sind neben Öl und Gas auch Stahl, Kupfer, Nickel, Aluminium und Kohle, im Fall der Tiroler Rohre wurde zum Beispiel der Schrottpreis zur Herausforderung, der sich seit dem Vorjahr fast verdreifacht hat. Dazu geben Lieferanten kaum noch Preisgarantien ab, was die Kalkulation zusätzlich erschwert. Es bleibt kompliziert und die derzeit einzigartige Gemengelage macht einen seriösen Blick in die Zukunft schwierig, dennoch bleiben Tirols Industriebetriebe weiterhin entschlossen, den Wirtschaftsstandort nachhaltig nach vorne zu entwickeln. PR







