20 Interviews zur Zukunft des Bauens
04 Im Anthropozän
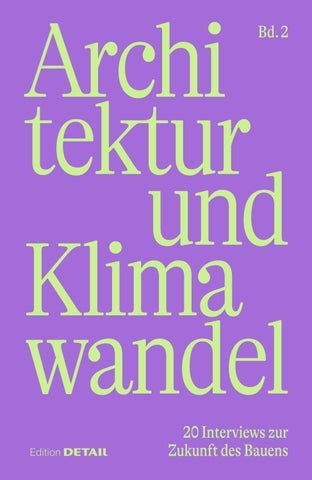
20 Interviews zur Zukunft des Bauens
04 Im Anthropozän
Gedanken zum Bestand
Zirkuläre Konzepte
10 Abriss is over
Anabelle von Reutern
20 Verstehen, was schon da ist
An Fonteyne
34 Mitwohnen statt Neubauen
Daniel Fuhrhop
44 Die Kunst des Pfropfens
Jeanne Gang
54 Spielregeln für ein neues
Zeitalter
Indy Johar
64 Seien wir behutsam und nicht zu roh zum Bestand
Paul Robbrecht
78 Vom linearen zum Kreislaufsystem
Dirk Hebel
90 Die Stadt als Wald
Sou Fujimoto
102 C2C: Müssen wir Bauen neu denken?
Nora Sophie Griefahn
114 Bauwende jetzt!
Luisa Ropelato
124 Boden gut machen
Mio Tsuneyama & Fuminori
Nousaku
134 Form Follows Availability
Dominik Campanella
Ressource Natur
146 Im Vertrauen auf lokale
Ressourcen
Viktoria Millentrup
156 Weniger Technik, mehr
Architektur
Elisabeth Endres
166 Wie der Lehmbau nach
Paris kommt
Régis Roudil
174 Bauen mit Binsen
Maria-Paz Gutierrez
184 Urbane Partituren
Maria Auböck & Janos Kárász
196 Welche Zukunft hat der Holzbau?
Hermann Kaufmann
210 Schritt für Schritt besser werden
Sinus Lynge
222 Das Beste ist zum Greifen nah
Carles Oliver Barceló
236 Gesprächspartner:innen
243 Autor:innen
Um die Ressourcenkrise zu bewältigen, müssen sich die Regelwerke und Wirtschaftsmodelle beim Bauen grundlegend ändern. Der britische Architekt und Sozialunternehmer Indy Johar beschreibt die Dimensionen des Umbruchs. Er ist Architekt und Mitbegründer von Dark Matter Labs. Die internationale Non-Profit-Organisation berät Regierungen, öffentliche
Einrichtungen und Privatunternehmen dabei, die institutionelle Infrastruktur der Gesellschaft neu zu definieren. Was das bedeutet, erläutert er im Interview mit Jakob Schoof.
In Ihrer Arbeit mit Dark Matter Labs geht es um Gesetzgebung und Eigentumsverhältnisse, Rohstoffkreisläufe und unser Verhältnis zur Natur. Was motiviert Sie dazu, sich mit solch grundlegenden Themen zu beschäftigen?
Als Architekt habe ich früher an Open-Source-Projekten wie WikiHouse gearbeitet, habe eine Open-Source-Möbelfirma mitgegründet und war an Sozialunternehmen beteiligt. Dabei ging es um Architektur mit unternehmerischem Hintergrund – in Eigeninitiative, nicht als Dienstleistung für einen Bauherrn. Eines habe ich dabei schnell gelernt: Form follows capital. Die Gestaltung von Architektur folgt der Verfügbarbeit von Kapital und der Struktur von Vertragsbeziehungen. Um den Herausforderungen der Ressourcenkrise gerecht zu werden, muss man solche Regeln und Organisationsstrukturen in der Architektur ändern. Deutlich wurde mir aber auch die lineare Denkweise, die solchen Strukturen zugrunde liegt. Sie geht von jahrelang unveränderten Rahmenbedingungen aus. Dabei wissen wir doch, wie volatil unsere Zukunft sein wird und dass uns in den Städten ein Temperaturanstieg von 3,5 und mancherorts 8 °C bevorsteht.
Was heißt das konkret?
Die meisten Länder Europas planen immer noch Neubauten in großem Umfang. Dafür steht uns aber gar nicht das erforderliche CO2-Budget zur Verfügung. Das World Resources Institute
hat errechnet, dass selbst eine stärkere Verwendung von Holz beim Bauen unsere CO2-Emissionen über Jahrzehnte hinaus erhöhen würde. Solange wir Holz so ineffizient nutzen wie im Moment, ist die Bilanz in vielen Fällen schlechter als bei Stahl oder Beton. Das heißt natürlich nicht, dass wir weiter mit Beton bauen sollten, sondern dass beide Lösungen inakzeptabel sind. Wenn man das zu Ende denkt, sind drei Dinge notwendig: Erstens ein Moratorium für Neubauten. Zweitens müssen sich unsere Vorstellungen von Komfort radikal wandeln. Drittens brauchen wir eine auf Biomaterialien basierende, regional organisierte Wirtschaftsstruktur, die auf Gebäudesanierungen statt auf Neubauten fokussiert ist. Dabei werden ziemlich sicher Leichtbauten im Mittelpunkt stehen, die gut recycelbar sind und zu einem hohen Grad aus Recyclingmaterialien bestehen. Auch die Zweckbestimmung unserer Gebäude wird sich verändern – von reinen Wohn-, Büro- oder Hotelgebäuden hin zu Strukturen, die alles drei sein können.
Sie arbeiten mit lokalen Institutionen zusammen, aber auch mit der Europäischen Union. Daraus schließe ich: Um bio-regionale Wirtschaftsstrukturen zu etablieren, müssen viele politische Ebenen zusammenwirken.
Richtig. Und man muss mehrere Systeme auf einmal betrachten: Für eine bio-basierte, regionale Wirtschaft muss sich auch unsere Lebensmittelversorgung ändern – hin zu pflanzlicher Ernährung, um landwirtschaftliche Flächen anders nutzen zu können als für den Anbau von Tierfutter. Auch die Agroforstwirtschaft wird dabei eine wichtige Rolle spielen. All das erfordert Änderungen in der europäischen Gesetzgebung. Denn der freie europäische Markt erlaubt im Moment keine Bevorzugung regionaler Lieferketten.
Ist ein Neubau-Moratorium denn realistisch? Der Gebäudebestand steht ja nicht immer dort, wo die Menschen leben wollen.
„Für Neubauten in großem Umfang steht uns gar nicht das erforderliche CO2-Budget zur Verfügung.“
In Europa stehen 33 % aller Gebäude zumindest teilweise leer. Das ist eine riesige Menge an grauen Emissionen, aus denen wir viel zu wenig machen. Überdies steigt der Flächenbedarf pro Kopf seit Jahrzehnten. Wir müssen die Qualität unserer Gebäude deutlich verbessern, ohne immer mehr Flächen in Anspruch zu nehmen. Und wir müssen über Investitionen in gemeinschaftlich genutzten Infrastrukturen sprechen. Wenn es in jedem Erdgeschoss einen Co-Working-Space und eine Gemeinschaftsküche gäbe, bräuchte man weniger Arbeitszimmer und Küchen in den Wohnungen. Dann würden Flächen frei, zum Beispiel für generationenübergreifendes Wohnen. Der demografische Wandel und die Frage, wie wir künftig Pflege organisieren, gehören schließlich zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Mir stellt sich bei alledem eine interessante moralische Frage: Wie definieren wir räumliche Gerechtigkeit? Ist es in Ordnung, Gebäude leer stehen zu lassen? Ist es in Ordnung, Ressourcen zu privatisieren, statt sie für das Gemeinwohl zu verwenden? Viele Menschen haben in den letzten Jahren mehr Geld mit ihrem Haus als mit ihrer Arbeit verdient, nur weil es am richtigen Standort stand. Wenn ich ihr Haus nehme und nach Sibirien versetze, was ist es dann noch wert? Nichts! Der Wertzugewinn dieser Häuser resultiert nur aus ihrer Nähe zu öffentlichen Gütern – Straßen, kulturelle Einrichtungen und andere Infrastruktur, für die die Allgemeinheit bezahlt hat.
Es geht also um Eigentumsfragen. Welche Alternativen zum Status quo gäbe es da?
Eine sehr weitreichende Vision sind Gebäude, die sich selbst gehören und für sich selbst Entscheidungen treffen können. Das klingt vielleicht wie Science-Fiction, ist aber mit künstlicher Intelligenz möglich. Und diese selbst getroffenen Entscheidungen wären dann maßgeblich dafür, wie das Gebäude genutzt wird und sich im Lauf der Zeit verändert. Andere Dinge wären heute schon umsetzbar, zum Beispiel partielle Allgemeingüter. Dabei könnten Sie das Eigentum an Ihrem Haus behalten, aber


Wie lassen sich leer stehende Flächen in der Stadt für die Gemeinschaft nutzen? Dieser Frage geht Dark Matter Labs im Projekt Re:Permissioning the City nach.
Interview
Sou Fujimoto
Sou Fujimotos Grand Ring für die Expo 2025 in Osaka soll den Holzbau in Japan wiederbeleben. Die Holzkonstruktion wird im Anschluss für Wohnbauten und Schulen wiederverwendet.
Ein Gespräch mit Frank Kaltenbach.
Im April wurde in Osaka die Expo mit ihrem Hauptgebäude eröffnet. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist es die größte Holzkonstruktion der Welt. Hatten Sie diesen städtebaulichen Maßstab schon im Blick, als Sie 2006 mit Ihrer Holzhütte Final Wooden House international berühmt wurden?
So etwas hätte ich mir wirklich nie träumen lassen. Ich lasse mich von Erfolgen lieber überraschen. Ich hätte ja nicht einmal damit gerechnet, den Masterplan für die Expo zu gewinnen. Aber natürlich ist es sehr spannend, in unterschiedlichen Maßstäben zu bauen.
Ihr 12 bis 20 Meter hohes, 60 000 Quadratmeter großes Hauptgebäude ist ein 30 Meter breiter Ring mit Grasdach und einem Durchmesser von fast 700 Metern, der sämtliche Länderpavillons umschließt.
Das Gebäude hat seinen Reiz durch die enorme Größe, das Raster von 3,60 Metern entspricht dagegen dem menschlichen Maßstab. Es geht also nicht um Monumentalität, sondern um die spannungsvolle Koexistenz von menschlichem und urbanem Maßstab. Auf Luftbildern sieht das Gebäude sehr abstrakt und unnahbar aus. Erst aus der Fußgängerperspektive werden die subtilen Variationen in der Raumbildung erlebbar, leichte Aufweitungen und Verengungen, ansteigende und abfallende Ebenen erzeugen eine überraschende Dynamik.
Weshalb sind Sie das Risiko eingegangen, ein so großes Gebäude aus Holz zu errichten, obwohl es in Japan gar keine Holzbauindustrie gibt?

Der Holzring ist nicht nur als starkes Symbol gedacht, sondern als riesige BauholzRessource. Die Konstruktion kann nach der Expo abgebaut und in unterschiedlich großen Abschnitten an anderen Orten wieder aufgebaut werden.
Bei meiner Arbeit in Europa, Nordamerika und Australien habe ich gesehen, wie rasant sich der Holzbau dort in den letzten Jahren entwickelt hat. Im Gegensatz zu dieser internationalen Entwicklung hin zu nachhaltigerem Bauen ist Japan komplett zurückgeblieben. Der Grand Ring setzt nicht nur das Motto der Expo „Unity in Diversity“ um. Er soll als Best Practice-Beispiel auch zum Bauen mit Holz ermutigen. 70 % des Bauholzes stammen von japanischen Zypressen und Zedern, die hier in heimischen Wäldern wachsen. Das restliche Drittel aus schottischer Kiefer kommt aus dem Ausland.
Sie gehen noch einen Schritt weiter. Nach der Expo soll die Megakonstruktion als einzelne Gebäude über ganz Japan verteilt werden.
Die Schwelle zum Holzbau soll so niedrig wie möglich sein, die Menschen sollen möglichst sofort damit beginnen können. Daher bieten wir einen fertigen Baukasten an. Der Holzring ist nicht nur als starkes Symbol gedacht, sondern als riesige Bauholz-Ressource. Seine Konstruktion ist so konzipiert, dass das gesamte Gebäude nach der Expo abgebaut und in unterschiedlich großen Abschnitten an anderen Orten wieder aufgebaut werden kann. Das Raster im Standardmaß von 3,60 Metern ist nicht nur für den Geschosswohnungsbau geeignet, sondern auch für Büros, Schulen und andere Einrichtungen.
Sind denn die Holzverbindungen für den Rückbau leicht zu lösen? Das große Holzdach der Expo 2000 in Hannover war mit massiven Stahlknoten verschraubt.
Traditionelle japanische Nuki-Holzverbindungen sind weder verklebt noch geschraubt, damit sie bei den vielen Erdbeben elastisch sind und die Standfestigkeit gewährleisten. Die Verbindungen des Holzrings nehmen sich diese alte Holzbautechnik zum Vorbild. Sie sind nur ineinandergesteckt und können so einfach gelöst und wieder zusammengebaut werden. Der
aktuelle Expo-Bau ist kein Dach, es ist ein Ring mit all seiner Symbolik. Eine Inspiration lieferte das Expodach in Osaka 1970 von Kenzo Tange. Das war eine riesige Scheibe als Stahlfachwerk, mit einem großen Loch in der Mitte, in dem der Turm der Sonne von Taro Okamoto stand. Dieser runde Ausschnitt, der den Himmel und die Wolken rahmt wie ein Bild, hat mich immer fasziniert. Für uns Japaner ist die wirkliche Realität die Leere. Für diese Leere des Nichts haben wir ein eigenes Wort: Ku.
Die Expo 70 war die vielleicht futuristischste Architekturschau aller Zeiten, die aus der Euphorie um die gelungene Mondlandung unglaubliche kreative Energien freisetzte. Ist uns diese Begeisterung für die Zukunft abhanden gekommen?
Nationale Stimmungslagen sind immer Schwankungen unterworfen. Auf die Begeisterung der Expo 70 folgte die Ölkrise. Dann ging es in Japan wieder aufwärts bis zum Platzen der Wirtschaftsblase. Wie in den frühen 1970er-Jahren sind wir heute erneut an einem Wendepunkt. Die Welt muss sich ändern und gemeinsam den Klimawandel aufhalten. Für mich gibt es also jeden Grund, auch heute wieder – trotz aller Krisen – begeistert zu sein. Dieser dringend erforderliche Wandel birgt ein kreatives Potenzial für alle, die mit Gestaltung zu tun haben. Ich glaube, wir können optimistisch in die Zukunft blicken, aber nicht mit einem blinden Optimismus, sondern sehr reflektiert und glaubwürdig. Wir Architekten können diesen Optimismus mit unserem Tun weitergeben.
Im Gegensatz zu Ihren anderen Gebäuden wirkt der Ring fast zurückhaltend.
Bei diesem Gebäude geht es nicht darum, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Im Gegenteil. Es soll den ruhigen Hintergrund bilden für all die laut schreienden Länderpavillons, Themenpavillons und die bunten Besucher aus aller Welt. Es geht

Traditionelle japanische Nuki-Holzverbindungen sind weder verklebt noch geschraubt, damit sie bei den vielen Erdbeben elastisch sind und die Standfestigkeit gewährleisten.
Interview
Elisabeth Endres
Klimagerecht bauen heißt für Elisabeth Endres Architektur und Gebäudetechnik als Einheit zu betrachten. Im Gespräch mit Frank Kaltenbach geht sie ihrer Frage nach: Wie viel Technik ist genug?
Sie wurden 2020 als Professorin für die Leitung des Instituts für Gebäude- und Solartechnik der Technischen Universität Braunschweig berufen. Weshalb haben Sie als erstes dessen Namen geändert?
Der jetzige Institutsname Bauklimatik und Energie der Architektur zeigt, dass wir die Themen Bauphysik, Haustechnik und Energie als Teil der Nachhaltigkeitsdebatte auch in der Lehre breit denken müssen. Ich komme aus der Architektur, nicht aus dem Maschinenbau oder der Energietechnik. Die Solartechnik ist ein wichtiger Aspekt für die Zukunft, in der Energiegewinnung wird alles auf Strom hinauslaufen, wir werden Verbrennungsmethoden auf ein Minimum reduzieren. Für mich beginnt die Fragestellung jedoch nicht bei der Gebäude- oder Solartechnik, es geht um viel mehr, nämlich um die Baukultur und wie wir leben werden. Meine Lehre und Forschung gliedert sich in drei Bereiche: Entwurf und daraus resultierende notwendige technische Ausstattung, Materialien und die darin gebundene graue Energie sowie die Erzeugung und Speicherung von Energie. Im Mittelpunkt steht die Herausforderung, mit möglichst wenig technischem Aufwand robuste und komfortable Gebäude zu schaffen, die nicht nur im Betrieb, sondern auch bei ihrer Herstellung und ihrer Entsorgung möglichst nachhaltig oder grundsätzlich sehr dauerhaft sind. In Zukunft muss also das Gebäude selbst mit seiner Materialität, der Raumaufteilung bis hin zu konstruktiven Details Gegenstand der Energie- und Klimaplanung werden. Zuerst einmal geht es um die Performance der Architektur, die lokalen Bedingungen, dann um die Diskussion der Anforderungen an Komfort und erst dann um die technischen Systeme. Wir müssen vernetzt denken – von der Energieerzeugung über die Gebäude bis hin zur Mobilität.
Wenn ich keine Stellplätze in Tiefgaragen bauen muss, spare ich viel Beton und damit viel CO2.
Wo treffen Sie dabei auf Widerstände?
Die Honorierung der Gebäudetechnikplanung orientiert sich immer noch prozentual an den Investitionskosten der technischen Anlagen. Wir brauchen eine Honorarordnung, diese ist wichtig. Allerdings sollten Anreize geschaffen werden, die zu ganzheitlichen Konzepten und Planungen führen und damit zur Honorierung für den interdisziplinären Prozess. Wir haben in einem Projekt einmal eine Prämie bekommen, weil wir in den 400er-Kosten durch eine gute und intensive Zusammenarbeit mit den Architekten weit unter den angepeilten Investitionen lagen. Das ist sinnvoll eingesetztes Geld ohne Wartungskosten.
Fehlen konkrete Gesetzesänderungen?
Wir brauchen ein neues Gebäudeenergiegesetz. Bisher bemisst der Staat die Förderungen in Milliardenhöhe am flächenbezogenen theoretischen Energiebedarf in der Einheit kWh/m2a für Niedrigenergiehäuser. Wie wäre es mit einer personenbezogenen Einheit Tonnen CO2 /Person? Dann wären einerseits die Materialität und Maßnahmen entscheidender und die Nutzer und Nutzerinnen in die Verantwortung einbezogen. Große Villen, in denen nur zwei Personen wohnen, würden anders bewertet werden als der urbane dichte Stadtraum. Andererseits könnte man kostengünstige dicht belegte Geschosswohnungsbauten ohne viel Technik und übertriebene Dämmstärken realisieren. Es müssten grundsätzlich Ziele statt der Maßnahmen beschrieben werden.
Reichen die bestehenden Zertifizierungslabels wie DGNB, Leed und Breeam nicht aus?

Mit wenig technischem Aufwand verwandelten gmp Architekten und IB Hausladen die alte Industriehalle in das Foyer der Münchner Isarphilharmonie.
Elisabeth Endres
Ich glaube nicht, dass der Mehrwert dieser Systeme das Zertifizieren ist, sondern die Begleitung des Prozesses. Ob man wirklich eine wahre und vergleichbare Bewertung von Nachhaltigkeit erreicht, bezweifle ich. In der Vergangenheit waren Strategien der Nachhaltigkeit sehr vom Effizienzgedanken geprägt und stützten sich maßgeblich auf Energiebedarfe. Das betrifft nicht nur die Zertifizierungen. Wenn in der Praxis Nutzer und Nutzerinnen die Fenster zur Dauerlüftung offenstehen lassen, geht der Verbrauch rasant in die Höhe. Es ist also wesentlich lebensnäher, Kennwerte nicht als absolute Größen festzulegen, sondern anstelle eines Optimums einen Korridor zu definieren, in dessen Bandbreite die einzuhaltenden Werte liegen müssen. Wenn bei technisch hochgerüsteten Gebäuden die Systeme versagen, funktionieren sie gar nicht mehr. Einfache Häuser mit wenig Technik, aber viel Speichermasse sind dagegen nicht so anfällig. Robustes und resilientes Bauen muss das Smart Home ablösen. Mit meinem Team im Ingenieurbüro IB Hausladen entwickle ich momentan auch ClimaDesign-Konzepte für hochtechnisierte Gebäude mit Doppelfassaden und Vollverglasungen. Aber auch in solchen Gebäuden geht es mit weniger Technik, indem man Ausbaustufen einplant, sodass nachgerüstet werden kann, wenn wirklich ein Problem auftaucht. Der Fokus sollte aber auch bei Hochhäusern auf nachhaltigen Sanierungen liegen.
Die Räume Ihres Lehrstuhls an der TU Braunschweig befinden sich in so einem marode wirkenden Hochhaus der Nachkriegsära.
Marode ist ja nicht die Stahlbetonkonstruktion, sondern nur die Fassade und der Innenausbau, deshalb ist das Haus aber nicht schlecht. Aus bauklimatischer Sicht ist nicht verständlich, weshalb jahrzehntelang Gipskarton an die Decke gehängt wurde, der die Räumhöhe minimiert und die Speicherfähigkeit der Massivdecken stark behindert. Vor allem wenn ein außen liegender Sonnenschutz nicht möglich ist. Wir haben innen alles
„Wir müssen uns komplett lösen vom Effizienzgedanken. Ich glaube nicht, dass man Nachhaltigkeit sinnvoll zertifizieren kann.“
Elisabeth Endres






















Herausgeberin
Dr. Sandra Hofmeister
Autor:innen
Florian Heilmeyer, Claudia Hildner, Sandra Hofmeister, Frank Kaltenbach, Julia Liese, Peter Popp, Jakob Schoof, Heide Wessely, Barbara Zettel
Projektleitung
Sandra Hofmeister, Anne Schäfer-Hörr
Redaktionelle Mitarbeit
Laura Traub
Schlusskorrektur
Sandra Leitte
Gestaltung
Claudia Scheer, Manuel Federl (Berlin, DE) → muskat.design
Herstellung
Simone Soesters
Reproduktion
ludwig:media (Zell am See, AT) → ludwigmedia.at
Druck und Bindung
Gutenberg Beuys Feindruckerei (Langenhagen, DE)
→ feindruckerei.de
Papier
Umschlag
Chromosulfatkarton 280 g Innenteil
Munken Print White 100 g
Dieses Produkt wurde aus Materialien hergestellt, die aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammen.
© 2025, 1. Auflage
Detail Architecture GmbH (München, DE)
→ books@detail.de → detail.de
ISBN:
978-3-95553-666-4 (Print)
978-3-95553-667-1 (E-Book)