Hello Future
25. – 29. Juni 2025 | Messe Frankfurt


25. – 29. Juni 2025 | Messe Frankfurt




VON MORGEN

Die ganz großen Namen der Automobilgeschichte kommen meist aus Deutschland, USA usw. Aber in der neuen Welt der Elektromobilität sorgt Mate Rimac für Furore, der aus einem Land stammt, das bislang nicht als Autohochburg galt: Kroatien.



Veranstaltung
SAFETY FIRST
Die Sicherheit von Batterien ist ein zentrales Thema der Elektromobilität. Testzentren prüfen neue Speichermodule auf Herz und Nieren. Partner Content | DEKRA




BIDIREKTIONALES LADEN SPART
MILLIARDEN
Elektroautos können viel mehr, als „nur“ leise und ohne Abgase zu fahren. Die Messe „The smarter E Europe“ 2025 wird dem Thema eine eigene Sonderschau widmen, um Chancen und Herausforderungen für die Mobilitätsund Energiebranche aufzuzeigen.
DIE STRASSE EROBERN












Röhrende Auspuffe und heulende Motoren, früher der Inbegriff von Coolness, verlieren zunehmend an Reiz.




AUSGABE #177
Account Manager: Benjamin Langer, Lukas Fengler, Kubilay Kayser Geschäftsführung: Nicole Bitkin, Jessica Bruns
Head of Content & Media Production: Aileen Reese
Redaktion und Gra�k: Aileen Reese, Nadine Wagner, Caroline Strauß, Negin Tayari
Text: Thomas Soltau, Katja Deutsch, Jakob Bratsch, Kirsten Schwieger, Frank Tetzel, Christian Kolb, Julia Butz
Coverfoto: © 2025 Bugatti Automobiles S.A.S., Tom Ziora
Distribution & Druck:
Die Welt, 2025, Axel Springer SE Contentway
Wir erstellen Online- und Printkampagnen mit wertvollen und interessanten Inhalten, die an relevante Zielgruppen verteilt werden. Unser Partner Content und Native Advertising stellt Ihre Geschichte in den Vordergrund. Die Inhalte des „Partner Content“ in dieser Kampagne wurden in Zusammenarbeit mit unseren Kunden erstellt und sind Anzeigen. Für die Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Die Formulierungen sprechen alle Geschlechter gleichberechtigt an.
Herausgegeben von:
Contentway GmbH | Neue Burg 1 | DE-20457
Hamburg
Tel.: +49 40 87 407 400
E-Mail: info@contentway.de
Web: www.contentway.de
Folge uns auf Social Media:
8. E-Roller & E-Motorrad
10. Batterie
14. Ladeinfrastruktur
16. Power2Drive
20. Flottenmanagement
22. Richtig Laden
CONTENTWAY.DE
Volle Sonnenpower für Haus und E-Auto Solarenergie hat sich zu einer zentralen Säule der erneuerbaren Energien entwickelt. Photovoltaikanlagen auf Hausdächern sind nicht nur eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Alternative zu fossilen Brennsto�en – sie laden gleichzeitig auch E-Autos auf.
Trotz eines spürbaren Anstiegs der Fahrgastzahlen im ÖPNV bleibt das Auto weiterhin das bevorzugte Verkehrsmittel der Deutschen. Das stellt Städteplaner, Unternehmen und Politik gleichermaßen vor Herausforderungen: Wie kann individuelle Mobilität aufrechterhalten werden, ohne dabei Umwelt und Infrastruktur über Gebühr zu belasten?
E-Mobilität gilt vielen als Antwort auf diese Frage. Und obwohl die Nachfrage nach E-Autos aktuell leicht rückläufi g ist, bleibt das Thema relevant. Neue Entwicklungen in der Batterietechnologie, innovative Fahrzeugkonzepte und Vorreiter wie Mate Rimac zeigen, dass die Reise hier längst nicht zu Ende ist. Es geht nicht mehr nur um mehr Reichweite, sondern um ein ganzheitliches Ökosystem. Besonders in Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und im ÖPNV gewinnen modulare Batteriesysteme an Bedeutung: skalierbar, fl exibel und anpassbar an unterschiedlichste Anforderungen.
ALLES AUS EINER HAND
INDIVIDUELL & HERSTELLERUNABHÄNGIG
KOMPETENZ & SICHERHEIT
CONTENTWAY.DE
Ungeeignete Stromnetze und das Vorankommen der E-Mobility
Ob Unternehmen auf E-Mobilität umstellen, hängt nicht nur von vorhandenen Ladesäulen, sondern auch vom Ausbau der Schnellladeinfrastruktur und leistungsstarker Stromnetze ab.
Auch auf zwei Rädern tut sich einiges. Nach dem Boom der E-Bikes gewinnen nun elektrisch betriebene Motorräder an Fahrt – gerade in urbanen Räumen, wo Platzmangel, Emissionen und Staus den Alltag prägen. Leicht, leise, emissionsfrei und ideal für die letzte Meile bieten sie eine echte Alternative zum Auto – auch für gewerbliche Einsätze. Doch ohne die passende Ladeinfrastruktur bleibt selbst das innovativste Fahrzeug ungenutzt. Gerade im ländlichen Raum fehlen oft flächendeckende Ladelösungen. Komplexe Tarifsysteme, uneinheitliche Bezahllösungen und fragmentierte Anbieterlandschaften erschweren zusätzlich den Umstieg – sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen mit Fuhrparkverantwortung.
All diese Entwicklungen zeigen: Business Mobility ist kein statisches Konzept, sondern ein dynamischer Prozess, der Technologie, Infrastruktur und Nutzerverhalten miteinander verknüpft. Wer heute die Mobilität von morgen gestalten will, braucht nicht nur innovative Produkte, sondern ganzheitliche Lösungen –und eine klare Vision.

Seite 16

Seite 12
ANZEIGE - ADVERTORIAL








Vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort!
Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36, 85591 Vaterstetten
T +49 8106 99 735-18 777
E info@ril-fuhrpark.de
ril-fuhrpark.de


























Ausgezeichnete Fahreigenschaften, präzises Handling und spürbar mehr Grip. In diese Qualitäten haben sich bereits zahlreiche renommierte Autohersteller verliebt, die unsere Reifen in ihrer Erstausstattung einsetzen. Erleben Sie die perfekte Verbindung von Fahrzeug und Straße – mit Nexen Reifen, die nicht nur bei jeder Fahrt überzeugen, sondern wie der N‘FERA Sport auch im ADAC-Test mit der Note „gut“ (2,4) ausgezeichnet wurden.



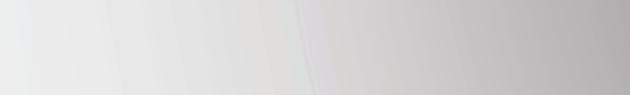













































EINLEITUNG
Mobilität ist für die Menschen von zentraler Bedeutung. Sie benötigen sie, um zur Arbeit zu kommen, Einkäufe zu erledigen, Freunde und die Familie zu besuchen oder auf Reisen zu gehen. Kurz gesagt: Ohne Mobilität ist ein modernes Leben kaum vorstellbar. Doch trotz dieser grundlegenden Bedeutung gibt es zahlreiche Herausforderungen, die Menschen, Politik und Hersteller beschäftigen und z. T. auch zunehmend belasten.
Foto: ADAC/Stefanie Aumiller
Der individuelle Verkehr mit dem Auto bleibt für viele Menschen unverzichtbar, insbesondere in ländlichen Gebieten. Auch wenn die Elektrifi zierung des Verkehrs voranschreitet, ist es unrealistisch, dass der Autoverkehr bis 2035 vollständig auf E-Autos umgestellt wird. Denn trotz der rasanten Entwicklung bei Reichweiten und Ladegeschwindigkeiten bleibt der Hochlauf der Elektromobilität hinter den Erwartungen zurück. Das liegt mitunter an den hohen Anschaff ungskosten für EAutos, aber auch an hohen Kosten für das öffentliche Laden. Solange E-Autos in der Anschaff ung teuer bleiben und die Ladepreise hoch sind, wird sich die E-Mobilität nicht in die Breite tragen lassen. Hier muss die Politik dringend eingreifen, etwa durch eine Senkung der Stromsteuer, eine angemessene Preisgestaltung der Tarife oder der Schaff ung einer Markttransparenzstelle, um den Wettbewerb bei den Ladepreisen zu fördern.
Eine zukunftsfähige Mobilität erfordert aber auch massive Investitionen sowohl in die Straßen- als auch in die Schieneninfrastruktur. Die Vernachlässigung dieser Bereiche hat bereits zu einer zunehmenden Unzufriedenheit bei den Verkehrsteilnehmenden geführt. Der Ausbau von Straßen und der öffentlichen
Verkehrsinfrastruktur muss dringend vorangetrieben werden, um die Mobilität der Zukunft sicherzustellen. Der Übergang zu einer klimafreundlicheren Mobilität darf allerdings nicht zu einer fi nanziellen Überlastung der Bevölkerung führen. Um die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen nicht zu gefährden, muss die Politik auch die sozialen Auswirkungen im Blick behalten. Ein zu hoher CO2-Preis und unrealistische Erwartungen an den Umstieg auf klimafreundliche Fahrzeuge gefährden die Akzeptanz von Verbrauchern. Stattdessen braucht es den Gedanken der Ermöglichung von Klimaschutz, etwa durch die Förderung alternativer Kraftstoffe und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zudem müssen die öffentlichen Verkehrsmittel deutlich attraktiver werden – durch zuverlässigere Verbindungen und eine faire Preisgestaltung.
Es braucht jetzt realistische Maßnahmen, die aber konsequent umgesetzt werden. Planbarkeit und Zuverlässigkeit sind wesentlich, um Verhaltensveränderungen und Investitionen zu fördern und den Klimaschutz im Verkehr voranzutreiben. Für den ADAC ist es deshalb entscheidend, dass es zukünftig eine klare und langfristige Strategie für die Mobilität gibt. Es geht darum, Maßnahmen zu ergreifen, die sowohl ökologisch als auch sozial ge-

14. Mai 2025 Zusmarshausen





Gerhard Hillebrand, ADAC Verkehrspräsident
Es braucht jetzt realistische Maßnahmen, die aber konsequent umgesetzt werden. Planbarkeit und Zuverlässigkeit sind wesentlich, um Verhaltensveränderungen und Investitionen zu fördern und den Klimaschutz im Verkehr voranzutreiben.
recht sind. Nur, wenn alle Verkehrsträger in einer ganzheitlichen Strategie berücksichtigt werden, können Erwartungen einerseits und nachhaltige Fortschritte andererseits erzielt werden. Es ist höchste Zeit, dass die Politik entschlossen handelt und eine Mobilitätspolitik verfolgt, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.















Wie lassen sich rechtliche Pflichten, steuerliche Vorteile und moderne Mobilitätsangebote wie Jobrad oder Mobilitätsbudget sinnvoll kombinieren? Und wie passt das zur neuen CSRD-Berichtspflicht?
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es am 14. Mai 2025 beim FORUM mobility & work SÜD in Zusmarshausen bei Augsburg.












Freuen Sie sich auf




• praxisnahe Vorträge und Mini-Seminare






• Testfahrten neuester Pkw- und Nutzfahrzeugmodelle








• interessante Aussteller








































• den Austausch mit Expert:innen und genießen Sie dabei unser erstklassiges Catering-Angebot.








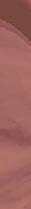





























































































Weitere Termine und Veranstaltungsorte finden Sie auf unserer Website.
Jetzt scannen & kostenfrei dabei sein! forummobilitywork.de

Die Sicherheit von Batterien ist ein zentrales Thema der Elektromobilität. Testzentren prüfen neue Speichermodule auf Herz und Nieren.
Batterien sind das Herzstück der Elektromobilität – und wie bei jedem Herz will man wissen, ob es zuverlässig schlägt. Doch was passiert, wenn’s heiß her geht? Genau das wird in spezialisierten Prüflaboren getestet. Hier geht’s zur Sache: drücken, durchlöchern, anzünden – natürlich unter streng kontrollierten Bedingungen. Kein Wunder, denn allein 2023 kamen laut KraftfahrtBundesamt über 800.000 neue E-Autos auf deutsche Straßen. Und alle brauchen einen Speicher, der nicht nur Strom liefert, sondern auch sicher bleibt. Laut
Feststoffbatterien gelten als Zukunft der Elektromobilität – mit höheren Energiedichten und Spannungen. Unsere Prüfstände sind auf diese Entwicklungen vorbereitet.
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung sind Batteriebrände heute sehr selten. Auch ein Verdienst der strengen regulatorischen Anforderungen und Prüfungen. Mittlerweile kommen auch stationäre Speicher, etwa fürs Eigenheim, häufiger auf den Prüfstand. Die EU will es seit 2024 ganz genau wissen. Das bedeutet mehr Tests, mehr Labore – und vor allem mehr Sicherheit für uns alle, wie Thomas Hucke, Leiter des DEKRA
Batterie Test Centers im brandenburgischen Klettwitz, bestätigt.
Was wird im neuen DEKRA
Batterie Test Center getestet?
Wir prüfen Batterien unter realen Extrembedingungen: von Nagelpenetration und Quetschtests bis zu Kälte- und Hitzesimulation. Die Tests dienen zum einen der gesetzlich vorgeschriebenen Typzulassung, werden aber zum anderen auch entwicklungsbegleitend angeboten.
Das Besondere: Alles geschieht an einem Ort – vom Crashtest bis zur Umweltprüfung. DEKRA ist ein akkreditiertes

Prüfzentrum und benannte Stelle für Fahrzeug- und Komponentenprüfungen sowie Homologationsprüfungen und bietet damit ein Komplettpaket, das in Europa einzigartig ist.
Wie wird das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum umgesetzt?
Das Testzentrum wird Sonnenenergie vom eigenen Gelände nutzen, ebenso ein intelligentes System zur Energierückgewinnung: Batterien in der Entladung speisen andere Prüfstände, sodass möglichst wenig neue Energie aus dem Netz bezogen wird. Eine Rauchgaswäsche filtert schädliche Emissionen bei Brandtests. Auch beim Kältemittel setzen wir auf CO₂ statt klimaschädlicher Gase –Nachhaltigkeit wird hier technisch mitgedacht. Zusätzlich wird das BTC, wie der gesamte Standort, über eine Biogasanlage mit Wärme versorgt.
Sind moderne Batterien noch brandgefährlich?
Nein. Zwar werden Sicherheitsgrenzen bewusst überschritten, um Risiken zu simulieren, doch heutige Speicher gelten im regulären Gebrauch als sehr sicher. Neue Batteriegenerationen verzichten zunehmend auf kritische Elektrolyte, was die Gefahr thermischen Durchgehens deutlich reduziert. Brände wie früher sind seltene Einzelfälle – meist Folge eines Unfalls oder unsachgemäßer Nutzung.
Wie bereitet sich DEKRA auf die nächste Generation von Batterien vor? Feststoffbatterien gelten als Zukunft der Elektromobilität – mit höheren Ener-
Neue Batteriegenerationen verzichten zunehmend auf kritische Elektrolyte, was die Gefahr thermischen Durchgehens deutlich reduziert.
DEKRA ist die weltweit größte unabhängige, nicht börsennotierte Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Als globaler Anbieter umfassender Dienstleistungen und Lösungen hilft das Unternehmen seinen Kunden, ihre Ergebnisse in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern. www.dekra.de

giedichten und Spannungen. Unsere Prüfstände sind auf diese Entwicklungen vorbereitet. Zwar ändern sich Elektrolyte – etwa durch Keramiken oder Polymere –die grundlegenden Teststandards bleiben aber gleich. DEKRA passt seine Prüfkapazitäten kontinuierlich an und kann auch große Speicher, etwa für Lkw oder Landmaschinen, zuverlässig testen.
Welche neuen Anwendungsfelder für Batterien rücken in den Fokus?
Uns ist letztlich egal, wo die Batterie eingesetzt wird – hauptsache, sie ist sicher. Neben Fahrzeugbatterien testet DEKRA künftig auch stationäre Speicher für Haushalte oder Netze sowie Akkus für Schiffe, Züge oder Arbeitsmaschinen. Seit 2024 verlangt die EU neue Zertifizierungen – und damit steigt der Prüfbedarf ständig. Auch kleinere Speicher unterliegen strengen Anforderungen. DEKRA deckt mit modularen Testsystemen alle Felder ab.
Wann startet das neue Batterietestzentrum am Lausitzring?
Die Eröffnung ist für Herbst 2025 geplant. Aktuell laufen die Errichtung der Gebäude und Infrastruktur sowie die Aufstellung der Prüfanlagen parallel. Wir wollen zeigen, dass wir liefern können. Das Ziel: volle Auftragsbücher und zufriedene Pilotkunden. Mit der „Safe Battery Experience“ am 8. und 9. Oktober wird das Zentrum der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Das ist eine gute Möglichkeit, sich über die Leistungsfähigkeit von DEKRA zu informieren.
Nachhaltige Mobilitätskonzepte bieten Lösungen für die Verkehrsprobleme in urbanen Gebieten und schonen darüber hinaus die Umwelt und das Portemonnaie.
Text: Kirsten Schwieger Foto: Segun Famisa/unsplash URBANE MOBILITÄT
Über 20 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen entstehen im Verkehr. Neben den klimaschädlichen Emissionen führt der Verkehr vor allem in urbanen Gebieten zu erhöhter Lärm- und Luftbelastung und sorgt für Staus, Stress und Zeitverlust. Laut Umweltbundesamt sind ungefähr ein Fünftel aller mit dem Auto zurückgelegten Wege kürzer als zwei Kilometer. Solche Strecken können meist problemlos – und oft sogar schneller – mit dem Fahrrad, Scooter oder zu Fuß zurückgelegt werden. Darüber hinaus nimmt der Bedarf an Straßen und Parkplätzen viel Raum ein, welcher für Grünflächen und Wohnungsbau fehlt. Für die Lösung von Verkehrsproblemen, den Klimaschutz und eine Verbesserung der Lebensqualität in den Städten, gewinnen alternative Mobilitätskonzepte an Bedeutung.
Die wohl Vielversprechendsten sind Konzepte rund um das Fahrrad. Die Förderung des Fahrradverkehrs trägt dazu bei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, die Luftqualität zu verbessern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu
verringern. Darüber hinaus führt der vermehrte Einsatz von Fahrrädern zu einer geringeren Belastung der städtischen Infrastruktur und fördert einen gesünderen Lebensstil. In Städten wie Kopenhagen, Amsterdam oder Utrecht hat sich das Fahrrad zu einem der Hauptverkehrsmittel entwickelt. Dies wurde durch den Ausbau von Fahrradwegen und sicheren Abstellmöglichkeiten sowie die Etablierung von Fahrradverleihsystemen forciert.
Neben dem notwendigen Ausbau der Infrastruktur existieren hierzulande bereits verschiedene Konzepte, die darauf abzielen, die Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel zu fördern. So machen Fahrradverleihsysteme wie das Bike-Sharing, Zweiräder für eine breite Bevölkerung zugänglich und sind ein attraktives Angebot für Einheimische, Touristen, Berufspendler und Kongress- oder Messebesucher. Das System der öffentlichen Leihfahrräder nach dem Selbstbedienungsprinzip hat sich ab Mitte der 1990er-Jahre in fast
Laut Umweltbundesamt sind E-Bikes mehr als 12-mal klimafreundlicher als das Auto. Für eine noch bessere Klimabilanz empfiehlt sich die Aufladung des Akkus mit Strom aus erneuerbaren Quellen.
allen großen Ländern der Welt etabliert. In Städten wie New York, Paris oder Wien rückte das Fahrrad durch derartige Verleihsysteme sogar wieder als Alltagstransportmittel in den Fokus. Auch in Deutschland sind Bike-Sharing Anbieter wie Nextbike und Call a Bike rasant gewachsen. Registrierte Nutzer können sich an großflächig verteilten Ausleihstationen via App gegen geringes Entgelt ein Fahrrad ausleihen und an einer anderen Station wieder abgeben. Es gibt auch stationslose Bike-Sharing-Systeme, bei welchen die Räder in größeren Zonen frei abgestellt werden können.
Auch das Konzept Dienstfahrrad-Leasing boomt, seit das Dienstbike im Jahr 2012 dem Dienstauto gleichgestellt wurde. Seit 2019 hat sich die Anzahl an Dienstfahrrädern laut Statista mehr als vervierfacht. Bei diesem Konzept können Arbeitnehmer einen Teil ihres monatlichen Bruttolohns gegen ein vom Arbeitgeber geleastes Fahrrad umwandeln. Das verringert die Sozialabgaben und spart Steuern, da nur die private Nutzung versteuert werden muss. Insbesondere bei höherpreisigen Rädern ist die absolute Ersparnis durch die Gehaltsumwandlung beachtlich. So sind dann auch ungefähr 80 Prozent der geleasten Diensträder E-Bikes. Diese sind auch für Pendler mit Arbeitswegen über 5 Kilometer interessant. Laut Umweltbundesamt sind E-Bikes mehr als 12-mal klimafreundlicher als das Auto. Für eine noch bessere Klimabilanz empfiehlt sich die Aufladung des Akkus mit Strom aus erneuerbaren Quellen.

Circa ein Fünftel aller mit dem Auto zurückgelegten Wege könnte meist problemlos und schneller mit dem Fahrrad, Scooter oder zu Fuß zurückgelegt werden.
Auch privat lassen sich Fahrräder leasen und am Ende der Laufzeit auf Wunsch übernehmen. Wer auf Dauer kein eigenes Fahrrad besitzen, aber für einen begrenzten Zeitraum ein funktionstüchtiges Rad fahren möchte, ist mit einem Bike-Abo gut bedient. Neben einem Reparaturservice bieten entsprechende Anbieter viel Flexibilität mit Mindestlaufzeiten ab einem Monat und kurzfristigen Kündigungsfristen. Einige Abo-Anbieter bieten sogar die Option eines Fahrradwechsels.
Eine weitere vielversprechende Alternative zum Auto stellt der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) dar. Städte wie Tokio, Wien oder Zürich machen vor, wie ein gut ausgebautes und zuverlässiges Netz aus Straßen-, U-Bahnen oder Elektro-Bussen den Autoverkehr deutlich reduzieren kann. Diese Systeme sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern ermöglichen oftmals eine kostengünstigere und schnellere Fortbewegung innerhalb der Stadt. Allerdings wird manch potenzieller Auto-Umsteiger durch Verspätungen oder lückenhafte Fahrpläne abgeschreckt. Hier wollen multimodale Mobilitätskonzepte eine Lösung bieten. Die intelligente Verknüpfung verschiedener Transportmöglichkeiten wie ÖPNV, Fahrrad oder E-Scooter wird meist mithilfe von Apps ermöglicht.
So sind insbesondere E-Scooter eine flexible Lösung für die sogenannte letzte Meile, den Weg von der Haltestelle bis zum endgültigen Ziel. Mithilfe einer App lassen sich die elektrisch betriebenen Roller entsperren und die gefahrenen Kilometer bezahlen. E-Scooter haben sich in vielen Großstädten schnell etabliert. Ein nachhaltiges Mobilitätskonzept stellen die Roller allerdings nur dar, wenn dafür das Auto stehen gelassen wird. Werden sie lediglich anstelle eines Fahrrads oder Fußwegs genutzt, sind sie laut Umweltbundesamt kein wertvoller Beitrag für die Verkehrswende. Neben den Umweltauswirkungen hängt die Zukunftsträchtigkeit von E-Scootern als Mobilitätskonzept auch von Faktoren wie deren Nutzbarkeit, Akzeptanz und Verletzungsrisiken ab.
Fakten Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung könnte der Treibhausgasausstoß im Nahbereich bis 2035 um 34 Prozent beziehungsweise 19 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente gesenkt werden. Voraussetzung dafür ist eine Verdreifachung des Radverkehrsanteils bei Strecken bis 30 Kilometer von bisher 13 auf 45 Prozent.
ELEKTRIFIZIERUNG
1.651.643 Elektroautos waren zum 1. Januar 2025 in Deutschland zugelassen – ein Rekord auf dem weiten Weg zur Dekarbonisierung des Individualverkehrs.
Text: Christian Kolb Foto: Chuttersnap/unsplash
Eine flächendeckend verfügbare Ladeinfrastruktur ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit Elektrofahrzeuge gekauft werden. I m März 2025 erreichten Elektrofahrzeuge nur einen Marktanteil von 16,8 Prozent der Neuzulassungen. Experten zufolge liegt dies nicht nur am Auslaufen der staatlichen Förderung im Dezember des Vorjahres, sondern auch an der nicht überall geklärten Frage, wo und wie man Elektroautos aufladen kann. Moderne Modelle erreichen mit einer Akkuladung eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern. Doch selbst, wer im Alltag beispielsweise an einer eigenen Ladesäule oder am Arbeitsplatz den Akku aufladen kann, ist bei Urlaubsreisen und ähnlichen
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 eine Million öffentliche Ladepunkte zu schaffen.
Fahrten auf eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur angewiesen. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 eine Million öffentliche Ladepunkte zu schaffen. Ein Ladepunkt bietet eine Lademöglichkeit für ein Auto – eine Ladesäule kann mehrere Ladepunkte umfassen. Die Bundesnetzagentur zählte z um 1. Februar 2025 insgesamt 161.686 Ladepunkte – ein Zuwachs von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während bisher vor allem Normalladepunkte mit einer Leistung bis 22 Kilowatt installiert wurden, gewinnen Schnellladepunkte mit einer Leistung von 50 bis 350 kW an Bedeutung. Diese können dafür geeignete Akkus schneller laden, sodass sie beispielsweise an Autobahnraststätten und vergleichbaren Orten zum Einsatz kommen, wo die Fahrzeuge nicht mehrere Stunden während des Ladevorgangs stehen. Doch nicht nur die Anzahl der Ladepunkte ist entscheidend, sondern auch ihre räumliche Verteilung. Während städtische Gebiete – insbesondere Metropolen wie Berlin, Frankfurt oder München – bereits über eine Vielzahl von Ladepunkten
verfügen, ist das Netz in ländlichen Regionen deutlich dünner. Dies macht die Elektromobilität für Menschen in diesen Regionen weniger attraktiv. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hat in den letzten Jahren an Tempo gewonnen – nicht nur durch staatliche Förderprogramme, sondern auch durch Investoren, die sich dem Aufbau von Ladepunkten verschrieben haben. Dass der Ausbau der Infrastruktur trotz politischer Zielsetzungen nicht noch schneller voranschreitet, liegt nicht nur an aufwendigen Genehmigungsverfahren, sondern auch an technischen und logistischen Hürden.
In manchen Regionen würde ein flächendeckender Ausbau von Ladesäulen das Stromnetz überlasten, sodass dort zunächst größere Investitionen in den Ausbau des Stromnetzes notwendig sind, bevor eine nennenswerte Anzahl an Elektroautos geladen werden kann. Perspektivisch können Elektroautos das Stromnetz auch entlasten. Beim bidirektionalen Laden können die Auto-Akkus sowohl Strom speichern als auch wieder abgeben.
Beim bidirektionalen Laden können die Auto-Akkus sowohl Strom speichern als auch wieder abgeben. So fungieren Elektroautos in Zukunft als Pufferspeicher für das Stromnetz.
So fungieren Elektroautos in Zukunft als Pufferspeicher für das Stromnetz. Ist viel Strom im Angebot – beispielsweise, weil der Wind weht und die Sonne scheint – kann man mit entsprechenden Verträgen günstig Energie tanken. Wird die produzierte Energie knapp, könnten Elektroautos einen Teil der in ihren Akkus gespeicherten Energie wieder abgeben und anderen Stromverbrauchern zur Verfügung stellen. Perspektivisch kann das Elektroauto so für seinen Besitzer sogar ein kleines Zusatzeinkommen generieren.

Röhrende Auspuffe und heulende Motoren, früher der Inbegriff von Coolness, verlieren zunehmend an Reiz.
Text: Katja Deutsch Foto: Diogo Cacito/pexels
Jah rzehntelang waren Motorradfahrende vor allem eins: zuerst zu hören, dann zu sehen, besonders nachts. Sobald die Ampel auf Gelb sprang, drehte man mit der rechten Hand den Gasgriff Richtung Körper, ließ den Motor aufheulen, gab ordentlich Gas – und ließ möglichst noch den Biker neben sich stehen. Seit den 1960er-Jahren gehörte das zur Straßenkultur. Einige besonders ambitionierte Fahrer konnten es sich nicht verkneifen, ihre Maschinen in der Innenstadt ein paar Hundert Meter aufsteigen zu lassen. Das Resultat: Fahrfreude für die einen, Lärmbelästigung für alle anderen, oft im Bereich der Schmerzgrenze.
Ein E-Motorrad beschleunigt am Ampelstart wie ein Blitz, direkt, kraftvoll, ohne Knattern, ohne Geheule. Die Fahrzeuge sind leicht, wendig und lassen sich spielerisch durch Stadt und Land manövrieren.
So schön das Motorradfahren auch ist –mit all seiner Freiheit, Flexibilität, dem Fahrspaß und der Leichtigkeit beim Parken – so nervenaufreibend ist häufig der Lärm, den viele Verbrenner verursachen. Doch es gibt eine leise und elegante Alternative, die sich zunehmend durchsetzt: E-Motorräder! Was für eingefleischte Biker vielleicht etwas „blutleer“ wirkt, empfinden viele Fahrer und vor allem Anwohnende als echte Wohltat. Statt dröhnendem Auspuff und röhrendem Motor gibt’s stylisches Design, Touchdisplay, App-Anbindung und GPS-Tracking. Und statt stinkender Abgase: sofortiges Drehmoment und lautlose Power.
Ein E-Motorrad beschleunigt am Ampelstart wie ein Blitz, direkt, kraftvoll, ohne Knattern, ohne Geheule. Die Fahrzeuge sind leicht, wendig und lassen sich spielerisch durch Stadt und Land manövrieren. Auch wirtschaftlich bieten E-Zweiräder Vorteile: Viele sind steuerfrei, brauchen zwar Strom und Versicherung, aber die Wartungskosten sind deutlich geringer als bei Benzinern. Während einfache E-Roller schon ab ca. 2.000 Euro zu haben sind, starten solide E-Motorräder meist bei 5.000 Euro. In manchen Bundesländern winken Förderprogramme oder Kaufprämien.
Probefahren ist Pflicht! Wie bei allen motorisierten Zweirädern gilt Helmpflicht, also auch bei E-Vespas und E-Rollern. Vor dem Kauf sollte man ein paar Dinge prüfen: Wie viele Kilometer schafft das
Fahrzeug realistisch? Wie verhält es sich bei Regen, Kälte, unebenen Straßen oder Steigungen? Welcher Akkutyp ist verbaut? Lässt er sich entnehmen? Gibt es Ersatz-Akkus und -teile? Wo wird geladen: Reicht eine Steckdose oder ist eine Wallbox erforderlich? Gibt es Schnellladesäulen in der Nähe?
Eine E-Vespa hat in der Regel 2 bis 4 kW Leistung und erreicht bis zu 45 km/h. Bei E-Motorrädern hängt Leistung und Tempo vom Modell (und Führerschein) ab: Ein Leichtkraftrad bis 11 kW Leistung (erfordert den Führerschein Klasse A1 / B196) schafft 90 bis 110 km/h, ein Mittel-
klasse-E-Motorrad bis 35 kW Leistung (erfordert den Führerschein Klasse A2) schafft schon 130 bis 160 km/h, und ein richtig leistungsstarkes E-Motorrad bringt oft 50 bis 80 kW auf die Straße, (erfordert den Führerschein Klasse A) und schafft mehr als 180 km/h, teilweise sogar 240 km/h.
Für schwache Nerven ist das nichts – aber für alle, die lieber pfeilschnell und fast lautlos unterwegs sind, ist es eine neue Art von Freiheit. Eine, die nicht auf Lärm, sondern auf Leistung, Design und Nachhaltigkeit setzt.

Viele E-Motorräder sind steuerfrei, brauchen zwar Strom und Versicherung, aber die Wartungskosten sind deutlich geringer als bei Benzinern.
Unsere Städte platzen aus allen Nähten – Stau, Verkehrslärm, Parkplatzmangel und schlechte Luftqualität sind an der Tagesordnung. Carsharing-Modelle sind eine gute Alternative zum eigenen Pkw, doch auch diese Autos beanspruchen viel Platz des öffentlichen Raums und verstopfen die Innenstädte ihrerseits.

Fahrräder und E-Bikes gelten längst als smarte Alternativen, manchmal jedoch sind die Wege schlichtweg zu weit, um sie auf Fahrradwegen zurückzulegen. Dabei gibt es noch eine andere, oft unterschätzte Option: E-Motorräder. Lautlos, flink und emissionsfrei könnten sie eine spannende Lösung für den urbanen Verkehrswahnsinn sein, gerade, wenn es sich um längere Wege handelt. Aber können sie wirklich einen spürbaren Beitrag leisten? Ralf Czaplinski, Country Manager von Zero Motorcycles, spricht im Interview über die Vorteile elektrischer Motorräder.
Was ist der Vorteil von Elektro-Motorrädern?
Die Vorteile von Elektro-Motorrädern decken sich prinzipiell mit denen von Elektroautos: Der Betrieb ist lokal emissionsfrei, man kann Elektro-Motorräder an jeder Steckdose/Wallbox aufladen und hat damit einen enormen Kostenvorteil gegenüber Verbrennungsmotoren, wenn man den Strom zuhause – idealerweise von der eigenen PV-Anlage – beziehen kann. Zudem ist der Wartungsaufwand deut-
lich geringer. Hinzu kommt – und das ist der größte zusätzliche Vorteil gegenüber E-Autos – der geringere Platzbedarf, Stichwort: Parkplatzsuche! Elektrische Motorräder überzeugen zudem mit deutlich mehr Leistung, was alle zu schätzen wissen, die täglich längere Strecken über Landstraßen und Autobahnen zurücklegen müssen.
Unterscheidet sich das Fahrverhalten stark vom klassischen Motorrad? Eigentlich nicht, im Gegenteil: Das Fahren wird grundsätzlich einfacher, da das Schalten entfällt. Hinzu kommt ein erhöhter Fahrspaß, da Elektromotoren (auch hier gilt die Analogie zum Auto) bei Bedarf aus dem Stand heraus kräftig beschleunigen können.
Was sind die Fahrvoraussetzungen?
Für Elektro-Motorräder gelten die gleichen Führerschein- und Versicherungsklassen wie für normale Motorräder. Ein wichtiger Vorteil für Elektro-Motorräder besteht jedoch darin, dass sie nach ihrer Dauerleistung und nicht nach ihrer Spitzenleistung eingestuft werden. In der Praxis haben viele Elektro-Motorräder daher kurzzeitig eine

höhere Leistung, die z. B. bei Überholvorgängen abgerufen werden kann – ein Plus an Sicherheit und Fahrspaß.
Wie lange dauert der Ladevorgang?
Das hängt – wie beim Auto auch – von der Ausstattung des jeweiligen Fahrzeugs ab. Mit dem optionalen Schnelllader sind die Zero-Motorräder in gut einer Stunde von Null auf 95 Prozent geladen.
Wie hoch ist die Akzeptanz?
Das hängt von den eigenen Ansprüchen ab. Wer mehr als die 200 bis 250 km Reichweite mit unseren Bikes braucht, oder einen Verbrennermotor hören und spüren will, der wird sich sicher schwertun. Aber all jene, die gerne mit viel Fahrspaß auf der Feierabendrunde leise durch die Natur rollen, sind nach der ersten Probefahrt sicher überzeugt. Und wer zuhause günstig laden kann, der spart nochmal richtig.
Zero Motorcycles wurde im Jahr 2006 in Santa Cruz, Kalifornien, vom ehemaligen NASA-Ingenieur Neal Saiki gegründet. Nach den ersten Produkten, die im Offroadsegment angesiedelt waren, hat das Unternehmen seine Angebotspalette ständig erweitert und bietet heute ein breites Portfolio in allen Leistungsklassen an, das sowohl Enduros als auch Straßenmotorräder mit und ohne Verkleidung umfasst. Zero Motorcycles ist Weltmarktführer bei Elektro-Motorrädern und gilt in der Branche als Innovationstreiber. www.zeromotorcycles.com

Join the global platform for cycling and ecomobility



25. – 29. Juni 2025
Messe Frankfurt
EUROBIKE Festival: 28. – 29. Juni


























































BATTERIEN
Es knistert in der Batteriebranche – und das nicht nur elektrisch. Was jahrelang wie ein technisches Nischenthema zwischen Forschungsförderung, Start-upTräumereien und Förderbescheiden dahinplätscherte, steht heute im Zentrum eines der spannendsten Industrie-Umbrüche der letzten Jahrzehnte. Wer denkt, es gehe bei Batterien nur um Akkus in Handys und Autos, hat nicht mit dem wachsenden Energiehunger von Bussen, Baumaschinen oder Fabrikhallen gerechnet – und schon gar nicht mit dem Tempo, das viele europäische Hersteller gerade vorlegen.
Text: Thomas Soltau Foto: Netze BW/unsplash
DViele Hersteller setzen auf Systembaukästen, mit denen sich Batteriemodule je nach Bedarf skalieren und konfigurieren lassen – sei es für den Bus mit beengtem Bauraum, für Baustellenfahrzeuge mit Sondermaßen oder für Containerlösungen zur Netzstabilisierung.
er globale Markt für Batteriespeicher wird laut BloombergNEF bis 2030 auf ein Volumen von über 620 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das bedeutet: eine Vervierfachung der heutigen Nachfrage. Allein im Verkehrssektor wird sich der Energiebedarf bis dahin fast verdreifachen. Und wo Nachfrage ist, rollt auch die Entwicklung. Vor allem in Europa wächst die Zahl der Unternehmen, die ausgereifte Technologieplattformen jetzt aus der Entwicklungs- in die Industrialisierungsphase bringen. Viele von ihnen haben in den letzten Jahren leise an Technologien getüftelt, während asiatische Konzerne bereits mit Volumenproduktion glänzten. Nun aber beginnen sie, die Bühne zu betreten – mit Produk-
ten, die genau auf jene Märkte zielen, die bisher oft vernachlässigt wurden.
Besonders bei Nutzfahrzeugen, also E-Bussen, schweren Trucks oder OffroadFahrzeugen, zeigt sich, was moderne Batteriesysteme heute leisten können – und leisten müssen. Es geht nicht mehr nur um Reichweite, sondern um Verlässlichkeit, Integration und Ladegeschwindigkeit. Wenn ein 40-Tonner in 15 Minuten auf 400 Kilometer geladen werden kann, ist das kein Wunschtraum mehr, sondern Realität – zumindest dort, wo auf immersionsgekühlte Hochleistungszellen gesetzt wird. Und auch bei stationären Speichern tut sich einiges: LFP-basierte Systeme mit über 8.000 Zyklen machen Speicherlösungen für Industrie und Gewerbe nicht nur wirtschaftlich, sondern endlich auch robust genug für den Dauereinsatz.
Auffällig ist der Trend zur Modularität. Viele Hersteller setzen auf Systembaukästen, mit denen sich Batteriemodule je nach Bedarf skalieren und konfigurieren lassen – sei es für den Bus mit beengtem Bauraum, für Baustellenfahrzeuge mit Sondermaßen oder für Containerlösungen zur Netzstabilisierung. Während klassische Automobil-Akkus oft auf Serienlogik getrimmt sind, entstehen hier
Es geht nicht mehr nur um Reichweite, sondern um Verlässlichkeit, Integration und Ladegeschwindigkeit.
Lösungen, die sich flexibel an Kundenwünsche anpassen lassen – und das in einer Qualität, die mit vollautomatisierten Fertigungslinien produziert wird. Der Vorteil: höhere Stückzahlen, niedrigere Kosten, bessere Verfügbarkeit.
Dass es dabei nicht bei Technik allein bleibt, zeigen strategische Allianzen mit Partnern aus dem Antriebs- und Fahrzeugbau. Wer Batterien liefern will, muss heute auch Integration mitdenken – und Software, Schnittstellen, Sicherheitskonzepte gleich mit. Gerade in Märkten wie Defense, Bau, Logistik oder Notstromversorgung sind Komplettlösungen gefragt, keine Puzzleteile. Kurzum: Die Batteriebranche ist erwachsen geworden. Und wer sie jetzt noch belächelt, sollte sich besser anschnallen – es könnte eine elektrische Überraschung werden.


Die E-Mobilität boomt – aber ohne leistungsstarke Batterien läuft nichts. Smarte Zellen, clevere Strategien und ein wachsender Markt machen das Akku-Business heißer denn je.
In Deutschland nimmt die E-Mobilität langsam, aber sicher, Fahrt auf. Mit 34.498 neu zugelassenen reinen Elektroautos allein im Januar 2025 verzeichnet das Kraftfahrt-Bundesamt ein sattes Plus von 53,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktanteil liegt bei 16,6 Prozent, Tendenz weiter steigend. Kein Wunder also, dass rund um die Zellfertigung, Technologieentwicklung und Energieeffi zienz derzeit so viel Dynamik herrscht. Herzstück dieser Entwicklung?
Ganz klar: die Batterie. Wer den Ladestecker noch für ein Nischenphänomen hält, sollte spätestens jetzt umdenken. Die Elektrifi zierung der Mobilität hat endgültig die Überholspur genommen. Auch, wenn der fl ächendeckende Ausbau der Ladeinfrastruktur noch einen großen Push benötigt, ist die Zuversicht groß – laut BDEW sind die Weichen für 15 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030 gestellt. Was bedeutet das für die Branche – und welche Rolle spielen leistungsstarke Batteriesysteme dabei?
Dr. Joachim Damasky, CEO der LION Smart GmbH und der E-Mobility AG, hat die Antworten.

Herr Dr. Damasky, vom Batterieprüfer zum Systemanbieter – wie kam es zum Wandel bei LION Smart?
LION Smart begann als Prüfunternehmen für Batterien – in einer Zeit, als Elektromobilität noch in den Kinderschuhen steckte. Während des Joint Ventures mit TÜV Süd entstand der Wunsch, sich nicht nur mit der Prüfung, sondern auch mit der Technologie selbst auseinanderzusetzen. Aus dem tiefen Verständnis darüber, welche Faktoren die Lebenszeit einer Batterie beeinflussen, entstand Know-how für langlebige Batteriesysteme. Ein Meilenstein war die Übernahme der Produktionslinie der BMW i3 Batterie – seither fertigt LION Smart diese Batterie nicht nur weiter, sondern entwickelt sie auch für mehr Reichweite und neueste Sicherheitsstandards kontinuierlich weiter.
Durch die modulare Bauweise bleibt die Lösung �exibel – für große und kleine Anwendungen.
Für welche Märkte sind Ihre Batteriesysteme besonders geeignet?
Auf Basis der BMW i3 Batterie bietet LION Smart Lösungen für Industriefahrzeuge, Busse, Arbeitsmaschinen und insbesondere für den Bereich Last-Mile-Delivery. Die Batterie bietet für diese Einsatzgebiete ideale Reichweiten & Be-
Über 250.000 Fahrzeuge nutzen die i3 Technologie und haben bereits mehr als 6 Mrd. km auf der Straße in einer Vielzahl von Klimazonen, Bedingungen, Höhenlagen und Geländeformen zurückgelegt. www.lionsmart.com
dingungen und ist dabei jederzeit sicher und robust. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen auch maßgeschneiderte Systeme inklusive eigener Batteriemanagementsystem-Technologie und immersionsgekühlter Lösungen für spezielle Anwendungen.
Wie gelingt die maßgeschneiderte Integration in Kundenfahrzeuge?
LION Smart kann bestehende Module fl exibel konfi gurieren – etwa für Lkw, die Batteriepacks zwischen den Fahrzeugrahmen benötigen, oder für Systeme mit 800 Volt. Auch komplette Showcars wurden bereits ausgerüstet. Kunden schätzen die hohe Anpassungsfähigkeit, die von Prototypen bis zu serienreifen Lösungen reicht. Wir fi nden für unsere Kunden immer die richtigen Lösungen.
Warum eignet sich die neue i3-Weiterentwicklung besonders für Nutzfahrzeuge und stationäre Speicher?
Die modernisierten Module kombinieren beste Energiedichte mit ökonomisch attraktiven Bedingungen. Das macht sie besonders attraktiv für Nutzfahrzeuge, die viel Energie auf begrenztem Raum benötigen. Stationäre Speicher profitieren von der Kombination aus Sicherheit, Performance und Langlebigkeit. Durch die modulare Bauweise bleibt die Lösung fl exibel – für große und kleine Anwendungen.
Was macht die immersionsgekühlte Hochleistungsbatterie so besonders?
Bei Hochleistungsanwendungen entsteht viel Wärme – die immersionsgekühlte Batterie von LION Smart nutzt eine nicht-leitende Flüssigkeit, um die Zellen

Die modernisierten Module kombinieren beste Energiedichte mit ökonomisch attraktiven Bedingungen.
direkt zu kühlen. Dadurch können Ladeund Entladeleistungen von mehr als 500kW im Sportwagen und bis zu 3MW in Lkws realisiert werden. In Vergleichstests konnte die Batterie ihre Leistung dauerhaft aufrechterhalten, während Serienlösungen schon früh thermisch limitiert waren.
Wie bewerten Sie den Stand der Ladeinfrastruktur in Deutschland? Trotz Fortschritten beim Schnellladen auf Autobahnen fehlt es vor allem in Wohnquartieren an fl ächendeckender Infrastruktur. Städte tun sich schwer, neue Flächen auszuweisen, und das Verteilnetz ist oft nicht auf hohe Ladeleistungen ausgelegt. Zudem sind hohe Preise an Schnellladesäulen ein Hindernis: Wenn die Kilowattstunde mehr als 50 Cent kostet, fahre ich mit Diesel billiger.





Die ganz großen Namen der Automobilgeschichte? Die kommen meist aus den Klassikern der Branche – Deutschland, USA, man kennt sie: Henry Ford, Ferdinand Porsche und Co. Aber in der neuen Welt der Elektromobilität sorgt jemand für Furore, der aus einem Land stammt, das bislang nicht gerade als Autohochburg galt: Kroatien.
Text: Eltjo Nieuwenhuis, Thomas Soltau
Foto: Tom Ziora
Mate Rimac heißt der Mann, Unternehmer und Ingenieur, der mit seinem Unternehmen Rimac Group die Spielregeln grundlegend verändert hat. Seine Mission? Den Elektroantrieb auf ein neues Level heben – und das ist ihm fast spielend gelungen. Rimac hat nicht nur das Hypercar neu definiert, sondern auch Bugatti übernommen und treibt mit revolutionären Ideen die Mobilität der Zukunft voran. Was treibt diesen Visionär an? Und was dürfen wir als Nächstes erwarten?
Eines dürfte klar sein: Rimac sprengt Grenzen. Der Rimac Nevera R ist kein Auto – er ist ein Statement. Ein Hypercar mit vier Elektromotoren – einem pro Rad – das mit 2.107 PS und satten 2.340 Nm Drehmoment in gerade einmal 1,74 Sekunden auf 100 km/h kata -
pultiert. Schluss ist erst bei 412 km/h. Damit düpiert er selbst die krassesten Verbrenner. Und das bei einer WLTPReichweite von 490 Kilometern, dank eines 108-kWh-Akkus.
Aber Rimac wäre nicht Rimac, wenn er sich damit zufriedengeben würde. In der Gerüchteküche brodelt es: Ein radikaler Einsitzer für die Rennstrecke soll in Arbeit sein – ein Fahrzeug, das die Grenzen von Aerodynamik und Tempo neu definiert. Noch sind die Details geheim. Nur so viel verrät Rimac: „Ich habe vor 16 Jahren mit meinem selbstgebauten Elektro-BMW angefangen, Rekorde zu brechen. Inzwischen waren es etwa 35 Weltrekorde – und da geht noch mehr!“
Bei Bugatti trifft Klassik auf Zukunft. Seit 2021 ist Rimac nicht nur CEO der Rimac Group, sondern auch von Bugatti Rimac. Seine Mission: die legendäre Marke Bugatti in die Zukunft führen –mit Respekt vor der Tradition, aber offen für neue Technologien. Der erste große Meilenstein: der Bugatti Tourbillon, ein
Ich habe vor 16 Jahren mit meinem selbstgebauten Elektro-BMW angefangen, Rekorde zu brechen.
Hybrid-Hypercar, das edles Handwerk mit modernstem Antrieb vereint. So soll die ikonische Marke in die nächste Phase ihres Bestehens geführt werden. Rimac beschreibt seine Philosophie so: „Wir wollen die DNA von Bugatti bewahren –Exklusivität, Präzision, Handwerkskunst – und gleichzeitig die Technologie von Morgen integrieren.“ Tradition und Innovation? Geht bei ihm Hand in Hand.
Doch es gibt noch mehr als nur Hypercars. 2026 startet ein ganz anderes Projekt: Verne, ein autonomes, elektrisches Robo-Taxi für urbane Mobilität. Entwickelt von Project 3 Mobility, bei dem Rimac Mitbegründer ist. Es ist Teil seiner größeren Vision: Technologie soll nicht nur extrem leistungsfähig, sondern auch praktisch und umweltfreundlich sein. „Die größte Veränderung ist nicht, was ein Auto antreibt – sondern wer es fährt oder besitzt“, sagt Rimac. „Autofahren und Autobesitz verschwinden nicht, aber es kommt eine neue Option hinzu: Fahren ohne Fahrer.“ Die Zukunft fährt eben elektrisch – aber nicht blind.
Mit Rimac Automobili hat er bereits bewiesen, dass Elektroautos weder langweilig noch limitiert sein müssen.
„Ich will Technologien entwickeln, die nicht nur krasser performen, sondern auch der Industrie und der Gesellschaft etwas bringen“, sagt er. Klar ist für ihn aber auch: „Elektroautos sind nicht die
perfekte Lösung für jede Situation – es wird Übergangsphasen und Ausnahmen geben. Aber in Sachen Energieeffizienz ist der Elektroantrieb unschlagbar. Und ich glaube an die Menschheit – am Ende setzt sich die logischste Lösung durch.“ Doch Rimac denkt weiter. Viel weiter. Für ihn ist Elektrifizierung nur ein Puzzleteil, ein Teil der Lösung. Der große Hebel liegt in der Energieerzeugung: „Wenn wir es schaffen, die Kernfusion zu meistern und unbegrenzt Energie zu erzeugen, dann spielt es keine große Rolle mehr, wie viel Energie wir für die Kraftstoffherstellung brauchen.“
Mate Rimac ist nicht nur ein Ingenieur, der schnelle Autos baut. Er ist ein Visionär, der die Mobilität neu denkt – vom Hypercar bis zum Robo-Taxi. Was Henry Ford für das Fließband war, könnte Rimac für die elektrische Mobilität werden. Und das ausgerechnet aus Kroatien. Verrückt? Vielleicht. Aber vor allem: ziemlich genial.
Ich will Technologien entwickeln, die nicht nur krasser performen, sondern auch der Industrie und der Gesellschaft etwas bringen.

LADEINFRASTRUKTUR
Fahrer von E-Fahrzeugen müssen rechtzeitig eine Schnellladesäule ansteuern. Den Überblick zu behalten, ist dabei nicht ganz einfach, denn es gibt unzählige Netzbetreiber mit unzähligen Tarifen.
Text: Katja Deutsch Foto: Shane West/pexels
Die Elektromobilität entwickelt sich in Deutschland rasant. Das bietet Nutzenden von E-Fahrzeugen auf der einen Seite große Chancen, konfrontiert sie jedoch auf der anderen Seite noch immer mit zahlreichen Herausforderungen, vor allem im Bereich der Ladeinfrastruktur, wo sie sich in einem zunehmend komplexen System zurechtfi nden müssen. Denn gefühlt ist ziemlich schnell die Anzeige im E-Fahrzeug im roten Bereich und das bedeutet: Schnellladesäule ansteuern!
Zum 1. Februar 2025 waren in Deutschland laut Bundesnetzagentur insgesamt 161.686 öffentliche Ladepunkte
in Betrieb. Davon entfielen 125.408 auf Normalladepunkte und 36.278 auf Schnellladepunkte mit mehr als 22 kW Leistung. Besonders stark wachsen aktuell sogenannte High-Power-Charger (HPC) mit über 299 kW. Hiervon gibt es aktuell rund 10.000 Stück. Europaweit stehen rund 750.000 Ladepunkte zur Verfügung, die sich überwiegend entlang von Autobahnen, in Innenstädten oder bei großen Einzelhändlern, Supermärkten und Discountern befi nden.
Trotz des Fortschritts ist der Ausbau auch in Deutschland noch nicht ausreichend. Bis zum Jahr 2030 fehlen Studien zufolge
Sehr praktisch ist die Installation einer eigenen Wallbox. Diese kostet inklusive Installation zwischen 1.000 und 3.000 Euro, wobei der Staat aktuell 900 Euro Förderung beisteuert.
rund 400.000 Ladepunkte, wenn Deutschland das Ziel von knapp 15 Millionen E-Autos erreichen will. Das Bundesverkehrsministerium nennt sogar einen Bedarf von bis zu 843.000 öffentlichen Ladepunkten, insbesondere in Städten, wo viele Menschen keinen privaten Stellplatz mit Stromanschluss besitzen.
Um Ladesäulen überhaupt fi nden zu können, brauchen Nutzende unterschied-

liche Lade-Apps. In Deutschland gibt es zahlreiche Netzbetreiber, darunter EnBW, E.ON und Tesla, jeder mit eigenen Tarifen und Zugangssystemen. Die Ladekarte eines Mobility Service Providers (MSP) ist dabei nach wie vor das gängigste Zahlungsmittel, während die Kreditkarte mit unter zehn Prozent Anteil kaum eine Rolle spielt. Zukünftig könnte „Plug & Charge“ eine nahtlose, automatische Lösung bieten. Viele Ladesäulen sind zwar bereits angebracht, können aber mangels Anschlusstermin gar nicht erst aktiviert werden. Oder sie werden angezeigt, sind aber funktionsuntüchtig. Was entlang von Autobahnen problemlos machbar ist – das Fahrzeug einfach an den nächsten Charger einstöpseln – führt in ländlichen Gebieten schnell zu Schweißausbrüchen, wenn im Umkreis von 40 Kilometern keine Ladesäule angezeigt wird.
An Schnellladestationen (DC) dauert ein Ladevorgang auf 80 Prozent etwa 30 bis 60 Minuten. Das eröff net Potenzial, besonders für gastronomische Angebote: Wer sowieso warten muss, schätzt die Möglichkeit, während dieser Zeit etwas zu essen oder zu trinken oder Einkäufe zu erledigen, anstatt nur in seinem Auto die Zeit „abzusitzen“.
Sehr praktisch ist die Installation einer eigenen Wallbox. Diese kostet inklusive Installation zwischen 1.000 und 3.000 Euro, wobei der Staat aktuell 900 Euro Förderung beisteuert. Während Hausbesitzer eine Wallbox meist problemlos installieren können, benötigen Wohnungseigentümer die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft.
Mit einem E-Fahrzeug unterwegs zu sein, hat ein sehr angenehmes und entspanntes Fahrerlebnis ohne Lärm und stinkende Abgase. Doch jenseits der Autobahnen kann das Auffi nden einer Schnellladesäule leider noch immer ziemlich stressig sein. Deshalb sind geeignete Apps das Mittel der Wahl.
Bis zum Jahr 2030 fehlen Studien zufolge rund 400.000 Ladepunkte, wenn Deutschland das Ziel von knapp 15 Millionen E-Autos erreichen will.


Die Elektromobilität in Firmenflotten entwickelt sich rasant: Viele Unternehmen setzen bei Neuanschaffungen zunehmend auf Elektrofahrzeuge, um ihre CO₂Emissionen zu reduzieren, Betriebskosten zu senken und von staatlichen Förderungen zu profitieren. Nicht nur aufgrund des Green Deals der EU, sondern auch zur Umsetzung eigener unternehmensinterner Nachhaltigkeitsziele, tauschen insbesondere große Unternehmen ihre Verbrennerfahrzeuge gegen Elektro- und Hybridfahrzeuge aus. In der Anschaffung sind Elektrofahrzeuge bislang teurer als Verbrenner, geringere Wartungs- und Energiekosten gleichen diesen Nachteil jedoch aus. Herausforderungen für Unternehmen ergeben sich häufig daraus, dass der Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur von den vorhandenen Netzkapazitäten abhängig ist. Auch die Abrechnung der vielen unterschiedlichen Ladetarife ist ein erheblicher betrieblicher Aufwand, der manche Unternehmer davon abhält, ihren klassischen Fuhrpark umzustellen.
Herr Dollberg, Sie sind CEO der energielenker Gruppe. Die energielenker Gruppe versteht sich als ganzheitlicher Lösungsanbieter für Unternehmen, die ihre Fahrzeugflotte auf E-Fahrzeuge umstellen. Welchen Nutzen bringt der Umstieg auf die Elektromobilität?
Die Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Die Betriebs- und Wartungskosten sind oft geringer als bei Verbrennungsmotoren. Zudem kann man in Kombination mit z. B. einer Photovoltaikanlage Elektromobilität wirklich nachhaltig gestalten und dabei durch intelligente Steuerung Einfluss auf die Wirtschaftlich-
Angebot und Nachfrage regeln den Markt und damit den Strompreis, doch das funktioniert nur, wenn das System intelligent genug ist, um zeitvariable Stromtarife zu erkennen.
keit der Elektromobilität nehmen.
Durch die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks wird gleichzeitig das nachhaltige Image des Unternehmens gestärkt, was sich positiv auf Kunden und Mitarbeitende auswirkt.
Wie unterstützen die energielenker Unternehmen beim Umstieg?
Die energielenker Gruppe versteht sich als bundesweiter 360°-Dienstleister im Bereich Elektromobilität und Photovoltaik. Wir bieten umfassende Leistungen, um unsere Kunden von der Konzeption über die Fachplanung und Umsetzung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung zu begleiten. Gerade die Betriebsführung und Abrechnung von Ladevorgängen kann komplex sein, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ihre privaten Elektrofahrzeuge am Standort laden dürfen. Hier bieten wir vollautomatische Lösungen an. Darüber hinaus entwickeln wir im Rahmen der energielenker solutions dynamische Lastmanagementsysteme und mit unserem Enbas auch Home Energy Management Systeme (HEMS), die ein optimales Laden ermöglichen. Unsere

Lösungen werden sowohl für das Lastmanagement größerer Ladeinfrastrukturen (z. B. in Parkhäusern) als auch für die optimale Steuerung der privaten Wallbox eingesetzt. Wir verbinden unterschiedliche Ladepunkte herstellerneutral.
Welchen Mehrwert bieten denn Ihre Produkte, um den Nutzen der Ladeinfrastruktur zu steigern?
Auf der einen Seite entlasten wir das Facility-Management und die Buchhaltung durch unsere Dienstleistungen. Ein weiterer Schwerpunkt von energielenker ist die intelligente Steuerung der Ladeinfrastruktur.
Mit unserem Produkt Lobas bieten wir ein dynamisches Lastmanagement an, um die Ladeleistung an die verfügbaren Stromkapazitäten anzupassen. So wird das Stromnetz nicht überlastet oder die Eigen-

Energielenker ist ein strategisch und ganzheitlich agierender Energiedienstleister. Ziel ist es, eine zukunftssichere und klimagerechte Energieversorgung für die jetzige und nachfolgende Generationen zu schaffen. www.energielenker.de
verbrauchsquote des PV-Stroms optimiert. Man verschiebt seinen Stromverbrauch zeitlich und spart Geld – ein Vorteil für Kunden und Netzbetreibende. Zweitens können wir mit unseren Produkten zeitvariable Tarife abbilden. Ab dem 1.1.2025 muss jeder Versorger einen zeitvariablen Stromtarif anbieten. Das bedeutet, dass der Strom in Stunden mit viel Sonne oder Wind deutlich günstiger angeboten werden kann. Angebot und Nachfrage regeln den Markt und damit den Strompreis, doch das funktioniert nur, wenn das System intelligent genug ist, um zeitvariable Stromtarife zu erkennen. Ergänzend kann jeder ab dem 1. April 2025 zeitvariable Netzentgelte nutzen. Dabei ist die Nutzung des Stromnetzes zu Zeiten geringer Netzauslastung deutlich günstiger – im Schnitt um sieben Cent! Ein dynamisches Lastmanagement wie Lobas ermöglicht das unmittelbare Laden der Fahrzeuge. Unser Produkt Lobas wird daher bei größerer Ladeinfrastruktur eingesetzt. Enbas hingegen ist ein Produkt für Ein- und Mehrfamilienhäuser und kann zusätzlich eine Wärmepumpe optimieren.

Die Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Die Betriebsund Wartungskosten sind oft geringer als bei Verbrennungsmotoren.

Elektroautos können viel mehr, als „nur“ leise und ohne Abgase zu fahren.
Text: Jakob Bratsch
Mit bidirektionaler Ladetechnologie (BiDi) können sie Strom speichern und ins Netz zurückspeisen. Eine aktuelle Studie von Transport & Environment (T&E) zeigt, dass dies für Europas Energieversorger und Autofahrer Einsparungen in Milliardenhöhe ermöglichen könnte. Die Einsparungen resultieren aus einer effizienteren Nutzung der Erzeugungskapazitäten und einem geringeren Kraftstoffverbrauch. Um das Potenzial dieser Technologie zu nutzen, sind jedoch geeignete regulatorische Rahmenbedingungen notwendig. Laut der T&E-Studie könnte das Einsparpotenzial für Energieversorger und Verbraucher in der EU bis zu 22 Milliarden Euro jährlich betragen, was etwa acht Prozent der Kosten für das EU-Energiesystem entspricht. Von 2030 bis 2040 könnte die BiDi-Technik EU-weit mehr als 100 Milliarden Euro einsparen, allein in Deutschland bis zu 8,4 Milliarden Euro jährlich.
Ein Grund für die hohen Einsparungen ist die Möglichkeit, mehr Strom aus erneuerbaren Quellen, insbesondere Solarstrom, in das Energiesystem zu

integrieren. Die Nutzung der Fahrzeugakkus könnte den Bedarf an teureren stationären Speichern in der EU um bis zu 92 Prozent senken und die installierte PV-Leistung um bis zu 40 Prozent steigern. Die Halter von Elektrofahrzeugen profitieren direkt vom bidirektionalen Laden, da sie mit geringeren Stromkosten rechnen können. Zudem dürfte die Lebensdauer der Fahrzeugakkus durch optimiertes Laden steigen. In Frankreich haben The Mobility House und Renault beispielsweise das erste Vehicle-to-Grid (V2G)-Angebot eingeführt. Besitzer eines V2G-fähigen Renault 5 können mit einer speziellen Wallbox kostenfrei laden und ihren Fahrzeugakku ins Energiesystem einspeisen. Dieses Angebot soll bald auch in Deutschland und dem Vereinigten Königreich verfügbar sein.
Im deutschen Markt gibt es jedoch noch Herausforderungen, wie den langsamen Roll-out von Smart Metern und die Notwendigkeit, einen passenden rechtlichen Rahmen zu schaffen. Der zweite Europäische Gipfel für bidirektionales Laden hat klare Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die nun umgesetzt werden müssen. Dazu gehört die Abschaffung der Doppelbelastung von zwischengespeichertem Strom durch Netzentgelte und die Sicherstellung, dass „grüner“ Strom seine Förderansprüche auch bei Zwischenspeicherung im Akku behält.
Die Messe „The smarter E Europe“ 2025 wird dem Thema eine eigene Sonderschau widmen, um Chancen und Herausforderungen für die Mobilitätsund Energiebranche aufzuzeigen. Die
Veranstaltung findet vom 7. bis 9. Mai 2025 in München statt und vereint vier Fachmessen: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. Die Sonderschau auf „The smarter E Europe“ wird dabei Produkte und Lösungen für das bidirektionale Laden präsentieren und Raum für Austausch und Networking bieten.
Fakten
The smarter E Europe vereint als Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft vier Fachmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) und findet vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Messe München statt. www.powertodrive.de/home
E-MOBILITÄT
Christian Heep, Vorstand im Bundesverband eMobilität (BEM), spricht im Interview über zentrale Strategien zur Förderung der Elektromobilität und ihre Bedeutung für die Verkehrswende in Deutschland.
Text: Frank Tetzel
Foto: Juice/unsplash
Welche strategischen Bereiche stehen derzeit im Fokus des BEM?
Wir setzen auf die systemische Transformation des Mobilitätssektors. Dabei liegt unser Augenmerk auf dem flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur, der Verknüpfung mit erneuerbaren Energien, klaren regulatorischen Rahmenbedingungen und der Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland.
Wie gestaltet sich der Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Ein leistungsfähiges Ladenetz ist entscheidend für die Akzeptanz der Elektromobilität. Wir fördern eine interoperable und benutzerfreundliche Infrastruktur, die intelligente Netzintegration, bidirek-
Die Verkehrswende ist ein zentraler Hebel, um CO₂Emissionen zu senken und die Luftqualität zu verbessern.
tionales Laden und Speicherlösungen umfasst. Bestehende Tankstellen sollen als multifunktionale Energiehubs umgerüstet werden.
In welcher Verbindung stehen E-Mobilität und erneuerbare Energien? Elektromobilität ist nur dann nachhaltig, wenn der Strom aus Wind und Sonne kommt. Daher muss eine direkte Verbindung zwischen Ladeinfrastruktur und erneuerbaren Energien geschaffen werden – unterstützt durch intelligente Netzsteuerung, lokale Erzeugung und Speicherlösungen. Regulatorische Anreize sollen Betreibende und Nutzende dazu motivieren, verstärkt Grünstrom zu verwenden.
Welche Rolle spielt die Verkehrswende im Klimaschutz?
Die Verkehrswende ist ein zentraler Hebel, um CO₂-Emissionen zu senken und die Luftqualität zu verbessern. Neben der Elektrifizierung des Straßenverkehrs setzen wir auf multimodale Verkehrskonzepte und die effiziente Nutzung vorhandener Infrastruktur.
Wie trägt E-Mobilität zur Stärkung der deutschen Wirtschaft bei?
Der Übergang zur Elektromobilität bietet Deutschland die Chance, sich von fossilen Technologien zu lösen und in Zukunftsbranchen zu investieren. Wichtige Bereiche sind hier die Forschung, Entwicklung und Produktion von Batterien, Ladeinfrastruktur und digitalen Mobilitätsdiensten – essenziell, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ist staatliche Förderung noch notwendig?
Ja, staatliche Förderungen bleiben essenziell, müssen aber zielgerichtet, degressiv und langfristig ausgerichtet sein. Sie sollen den Markthochlauf, den Infrastrukturausbau und die Forschung unterstützen –während gleichzeitig Subventionen für fossile Kraftstoffe reduziert werden müssen.
Wie sollten staatliche Fördermaßnahmen gestaltet sein? Es braucht eine Förderpolitik, die die Transformation gesamtheitlich betrachtet: Infrastruktur, Fahrzeugflotten, Speichertechnologien und Netzintegration. Gleichzeitig müssen regulatorische Hemmnisse abgebaut werden, etwa bei Netzentgelten oder Abgaben auf Eigenstromnutzung. Neben regulatorischen Rahmenbedingungen und politischer Lenkungswirkung sind sowohl monetäre als auch nicht-monetäre

Christian Heep, Vorstand im Bundesverband eMobilität (BEM)
Förderungen notwendig. Jeder investierte Euro zahlt sich langfristig aus, indem er Innovationskraft, Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Klimaschutz sichert.
Wie bewertet der BEM die erhöhten Zölle auf chinesische Elektroautos? Protektionismus ist kein zielführender Ansatz. Statt Handelsbarrieren sollten wir unsere eigenen Stärken in der Elektromobilität ausbauen, um die Wertschöpfung in Europa zu erhöhen und langfristig eine nachhaltige Industriepolitik zu verfolgen.
Fakten
Christian Heep ist Vorstand beim BEM und leitet Marketing, Medien, PR, Kommunikation, Politik, Messen und Events. Seine Leidenschaft für erneuerbare Energien und Elektromobilität inspiriert ihn zu innovativen Projekten für eine nachhaltige Mobilität.

AG/Christoph Papsch
Foto: Aral
Michael Brell, Senior Sales Manager Germany, Austria, Switzerland (DACH) bei bp/Aral
Herr Brell, seit Anfang des Jahres ziehen die Zulassungszahlen bei Elektrofahrzeugen wieder deutlich an. Sehen Sie darin ein Strohfeuer oder eine Trendwende? Innovationen setzen sich dann durch, wenn sie gegenüber der alten Technik echte Vorteile bringen. Speziell im Gewerbesektor haben wir diesen Punkt erreicht, denn E-Fahrzeuge erfüllen die Voraussetzungen für immer mehr Einsatzzwecke. Das spiegelt sich auch in den Zulassungszahlen wider. Einen Beitrag zur Alltagstauglichkeit der E-Mobilität leisten unsere Aral Fuel & Charge Tankund Ladekarten. Vor diesem Hintergrund ist dann der Umstieg auf E-Fahrzeuge keine
Ideologie, sondern schlicht und einfach eine gute Lösung für eine spezifische Transportanforderung.
Was macht Sie da so sicher?
Unter anderem eine von uns aktuell veröffentlichte Umfrage unter Mobilitätsprofis im gewerblichen Bereich. Im Pkw-Segment hat ein Großteil von ihnen schon selbst Erfahrungen mit E-Autos gemacht und auch bei den Truckern liegt die Quote bei über 50 Prozent. Das hat maßgeblichen Einfluss auf die Grundeinstellung, denn fast alle Umfrageteilnehmenden stufen die Fahrerfahrungen als positiv oder sehr positiv ein. Darüber hinaus muss E-Mobilität effizient, wirtschaftlich und alltagstauglich sein. Der Use-Case entscheidet schließlich darüber, welche Antriebsform gewählt wird.
Wie kann Aral eine schnellere Elektrifizierung unterstützen?
Durch ein Ladeangebot, das wirtschaftliche Verlässlichkeit, Tempo und Flexibilität miteinander verbindet. Das gelingt uns durch ein ultraschnelles Ladenetz an Aral-Tankstellen. Dort lässt sich je nach Fahrzeugtechnik in 10 Minuten die Energie für eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern laden. Unser Business Charging Festpreis sorgt dabei für Transparenz und Planungssicherheit.

Tank- und Ladekarten von Aral: Perfektes
Match für die Flotte
Tanken, laden, shoppen und obendrein PAYBACK-Punkte sammeln: In den Händen von Dienstwagenfahrern, Außendienstmitarbeitenden oder Flottenmanagern wird Aral Fuel & Charge zum Alleskönner. Denn mit der Tankund Ladekarte können konventionelle oder emissionsärmere Kraftstoffe getankt sowie Energie für E-Fahrzeuge geladen werden. Das bedeutet maximale Flexibilität für jeden Einsatzzweck.
Bei der Ladeinfrastruktur eröffnet Aral Fuel & Charge den Zugriff auf 99 Prozent aller in Deutschland zugänglichen Ladepunkte. In ganz Europa liegt die Akzeptanzquote bei rund 82 Prozent. Wenn es beim Laden ultraschnell gehen soll, ist das mehrfach ausgezeichnete Ladenetz von Aral pulse erste Wahl. Aktuell umfasst es 3.400 Ladepunkte an fast 500 Standorten mit einer Ladeleistung von teilweise bis zu 400 kW.
Gemeinsam mit dem Partner Vattenfall bietet Aral auch die Möglichkeit, eine eigene Ladeinfrastruktur auf dem Firmengelände oder bei Mitarbeitenden zu Hause aufzubauen. Vor allem die rechtssichere Rückerstattung von Ladekosten an Mitarbeitende, die das Fahrzeug zu Hause laden, vereinfacht das Flottenmanagement und die Analyse der Kosten deutlich. Außerdem können sowohl Fahrer als auch Flottenmanager im webbasierten „Aral Home Charging Reimbursement Portal“ die durch die geladene Energie entstandenen CO2-Emissionen der Flotte einsehen. Diese Angaben können die Basis für die Einhaltung der EU-Richtlinie zur einheitlichen Unternehmens-Nachhaltigkeits-Berichterstattung bilden. Die dafür notwendigen Details der genutzten Stromverträge können direkt im Portal ergänzt werden.
Zusätzlich zu den Services rund um die E-Mobilität bietet Aral natürlich weiterhin eine lückenlose Versorgung mit klassischen Kraftstoffen. Allein in Deutschland können die Tankkarten an rund 6.000 Stationen genutzt werden, in Europa sind es 30.000 Tankstellen.
Weitere Informationen gibt es unter: www.aral.de/fleet

NUTZFAHRZEUGE
Die Branche steuert auf einen Durchbruch bei E-Lkw bis 2030 zu – mit steigender Reichweite und Ladeleistung.
Text: Julia Butz
Foto: Lidia Volovaci/pexels
Die EU hat mit ihrem Automotive Action Plan im März dieses Jahres eine umfassende Strategie für die Transformation der Automobilindustrie vorgelegt. Ziel ist es, die Branche durch klimafreundliche Antriebe und digitale Innovationen zukunftsfest zu machen, um im globalen Wettbewerb, insbesondere mit China, Schritt zu halten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs – einem Schlüsselsektor für die europäische Wirtschaft, da sie für einen erheblichen Anteil der CO₂-Emissionen im Straßenverkehr verantwortlich sind. In ihrem Action Plan
setzt die EU auf eine Kombination aus verschärften CO₂-Zielen und milliardenschweren Förderprogrammen: Bis 2030 sollen die Emissionen neuer Lkw um 45 Prozent, bis 2040 sogar um 90 Prozent sinken. Busse des öffentlichen Stadtverkehrs sollen bis 2030 gänzlich emissionsfrei unterwegs sein. Um dies zu erreichen, fördert die EU u. a. gezielt Megawatt-Ladestationen (MCS), die das Laden von E-Lkw in unter einer Stunde ermöglichen. Technologiefortschritte, die eine funktionierende Praxistauglichkeit für die Elektrifizierung von Transport- und Logistikflotten maßgeblich vorantreiben.
gungsverfahren vor. Netzanschlüsse für Lkw-Ladeprojekte sollen dabei Priorität erhalten; die Bebauungsgenehmigungen für Ladestationen, insbesondere an Autobahnen und in Logistikzentren, deutlich beschleunigt werden.
Wahl zur CO₂-Reduktion sein und – bei Strombezug aus dem europäischen Netz – die niedrigsten Gesamtkosten über ihre Nutzungsdauer haben.
Bis 2030 sollen die Emissionen neuer Lkw um 45 Prozent, bis 2040 sogar um 90 Prozent sinken.
Doch das volle Potenzial lässt sich nur heben, wenn auch die Ladeinfrastruktur mit der Nachfrage Schritt hält. Bislang größtes Manko: der Großteil der (Schnell-)Ladepunkte ist nicht auf die Abmessungen von Lkw ausgerichtet und oftmals nur durch Abkopplung des Anhängers nutzbar. Auch die für Lkw geltende EU-Verordnung zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) fordert bis 2030 den schrittweisen Aufbau von mindestens 20.000 öffentlichen Lkw-Ladepunkten entlang der transeuropäischen Verkehrskorridore (TEN-V). Um diesen Ausbau zu beschleunigen, sieht der EU-Aktionsplan u. a. eine Vereinfachung der Genehmi-
Neben ökologischen Aspekten wird der Wechsel zu Elektro-Lkw auch aus wirtschaftlichen Anreizen zunehmend attraktiv. Die steigenden CO₂-Preise für fossile Energieträger, die seit 01.01.2025 bereits auf 55 Euro pro Tonne geklettert sind und mittelfristig voraussichtlich in einen verpflichtenden Emissionshandel übergehen, können die Betriebskosten für Diesel-Lkw signifikant erhöhen. Hinzu kommt die erhöhte Maut für Verbrenner-Lkw seit Dezember 2023, die den Kostendruck auf konventionelle Antriebe verstärkt. Im Gegenzug profitieren E-Lkw von Mautbefreiungen und Förderprogrammen, die die Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer eines Fahrzeugs (Total Cost of Ownership TCO) senken. Studien* zeigen, dass sich die höheren Anschaffungskosten von E-Lkw durch geringere Energiekosten, reduzierte Wartungsaufwendungen und staatliche Zuschüsse bereits nach vier bis sechs Jahren amortisieren. Demnach könnten 2030 E-Lkw in den meisten Fahrzeugklassen die kostengünstigste
* Studie der International Council on Clean Transportation (ICCT) 11/23: https://theicct.org/publication/total-cost-ownership-truckseurope-nov23/ und Studie der Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) i. A. der Umweltverbände Agora Verkehrswende und Transport & Environment T&E, 2022.
Neben ökologischen Aspekten wird der Wechsel zu ElektroLkw auch aus wirtschaftlichen Anreizen zunehmend attraktiv.
Fakten
Laut Strategy&-Studie „Batteryelectric trucks on the rise“ erreicht die E-Transformation im Transportsektor vor 2030 den Kipppunkt: Bis 2030 werden voraussichtlich 20 Prozent aller Busse und Lkw batterieelektrisch fahren. Bis 2040 könnten bereits 90 Prozent des Transports elektrisch betrieben sein.
Quelle: „Battery-electric trucks on the rise” von Strategy& lt. Statista Veröffentlichung 9/24

Ultraschnell, flexibel und intuitiv bedienbar: Zuverlässige und leistungsstarke Ladelösungen treiben die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten voran.
Vor dem Hintergrund der im Automotive Action Plan der EU und des Koalitionsvertrags der Bundesregierung bestätigten Ambitionen, E-Mobilität zu fördern und Infrastruktur beschleunigt auszubauen, lohnt ein Blick in den Markt: Was ist bereits verfügbar? Welche Hindernisse gibt es bei der Elektrifizierung von Flotten und wie lassen sich diese überwinden? ElektroLkw im Schwerlastfernverkehr benötigen neben Lademöglichkeiten im Depot auch eine gut ausgebaute und schnelle Ladeinfrastruktur unterwegs. Wenngleich es hier regulatorische Vorgaben für das Fernstraßennetz gibt, ist eine höhere Dynamik beim Ausbau der Infrastruktur erforderlich. Hierzu bedarf es eines verbesserten Zusammenspiels zwischen dem Stromanbieter und den beteiligten Behörden. Im Fernverkehr sind kurze Ladezeiten entscheidend, um die gesetzlichen Ruhezeiten der Fahrer optimal zu nutzen und die Betriebszeiten der Fahrzeuge zu maximieren. Aus diesem Grund gilt das Megawattladen (MCS –Megawatt Charging System) als zentrale Voraussetzung für einen nachhaltigen Schwerlastverkehr. MCS ermöglicht es, Elektro-Lkw innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrpausen (etwa 45 Min.) mit genug Energie für weitere 4,5 Stunden Fahrzeit zu versorgen. Erstmals wird so eine echte emissionsfreie Alternative zum Diesel-Lkw auch auf langen Strecken praktikabel.
Damit E-Fahrzeuge ihr Potenzial entfalten können, muss die Branche zentrale Herausforderungen der Ladeinfrastruktur gemeinsam lösen und die Rahmenbedingungen gezielt weiterentwickeln. ABB E-mobility unterstützt diesen Prozess aktiv. Als Marktführer in der Schnellladetechnologie trägt das Unternehmen mit seinen DC-Ladelösungen zu intelligenter, zuverlässiger und nachhaltiger Mobilität bei. Wie erst kürzlich bekanntgegeben, hat ABB E-mobility innerhalb von nur zwei Jahren ihr gesamtes Produktportfolio neu aufgestellt. In diesem Zusammenhang stellte das Unternehmen die neue Megawattlösung MCS1200 vor.

Mit einer Ladeleistung von bis zu 1.200 kW ermöglicht sie schweren Lkw-Fernverkehr mit Tagesreichweiten zwischen 600 und 800 Kilometern. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg für CO₂neutrale Transporte. „Der MCS1200 ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit führenden Lkw-Herstellern und eine Erweiterung unseres umfassenden Portfolios an Ladelösungen. Damit können wir wichtigen Herausforderungen begegnen, die bisher die breite Einführung von E-Fahrzeugen gebremst haben – insbesondere im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit“, so Michael Halbherr, CEO ABB E-mobility.
All-in-One Lösungen: Geringerer Platzbedarf, niedrigere Installationskosten, zukunftssichere Stromversorgung Basierend auf einem modularen Satz hat ABB E-mobility mit der A400 bereits im vergangenen Jahr die erste All-in-One-Lösung aus ihrer neuen A-Serie präsentiert. Das 400 kW-Ladegerät wird nun um die A200 und A300 ergänzt, die sich aufgrund der neuen Architektur einfach von 200 bzw. 300 kW auf bis zu 400 kW nachrüsten lassen. Damit kann ABB E-mobility noch flexibler auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse eingehen. Die mit integrierter Bezahlfunktion und cloudbasiertem Management ausgestatteten
Der MCS1200 ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit führenden Lkw-Herstellern und eine Erweiterung unseres umfassenden Portfolios an Ladelösungen. Damit können wir wichtigen Herausforderungen begegnen, die bisher die breite Einführung von E-Fahrzeugen gebremst haben – insbesondere im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit.
ABB E-mobility bietet zuverlässige und effiziente DC-Ladegeräte für Einzelhandelsstandorte, öffentliche Ladestationen und Flottendepots. e-mobility.abb.com
Ladestationen erlauben eine einfache Bedienung, hohe Verfügbarkeit und zuverlässigen Betrieb. Für Fahrer bedeutet dies ein Ladeerlebnis mit einer angestrebten Verfügbarkeit von 99 Prozent und deutlich reduzierte Wartezeiten.
Flottenbetreiber werden durch die technologischen und servicebasierten Maßnahmen dabei unterstützt, die Total Cost of Ownership (TCO) ihrer Elektrofahrzeugflotten entscheidend zu senken. Um eine bestmögliche Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sicherzustellen, steht bei ABB E-mobility bereits bei der Produktentwicklung die spätere Wartungsfreundlichkeit im Mittelpunkt – als integraler Bestandteil eines software- und servicezentrierten Gesamtkonzepts. Standardisierte Komponenten innerhalb der gesamten Produktfamilie ermöglichen eine effizientere Instandhaltung und reduzieren Reparaturzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Designs um das bis zu Sechsfache.
Ergänzt wird dieser Ansatz durch ein umfassendes Serviceangebot mit leistungsbasierten Service-Level-Agreements, definierten Reaktions- und Lösungszeiten sowie der vollständigen Anbindung aller Ladegeräte an die cloudbasierte Asset-Management-Plattform von ABB E-mobility. Diese erlaubt ein durchgängiges 24/7-Mo -
nitoring und – bei Bedarf – Vor-Ort-Service innerhalb von 24 Stunden.
„Die Ladelandschaft für Elektrofahrzeuge entwickelt sich über Einzelprodukte für spezifische Anwendungsfälle hinaus – wir entwickeln Plattformen, die über das gesamte Lade-Ökosystem hinweg konsistente Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bieten“, so Michael Halbherr. „Ob CPO oder Flottenbetreiber, ob im Nahverkehr oder für den Fernlastverkehr: Unsere Kunden profitieren von qualitativen, langlebigen und wirtschaftlichen Lösungen.“
Die Ladelandschaft für Elektrofahrzeuge entwickelt sich über Einzelprodukte für spezifische Anwendungsfälle hinaus – wir entwickeln Plattformen, die über das gesamte Lade-Ökosystem hinweg konsistente Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bieten.

FLEETMANAGEMENT
Durch Prozessoptimierung und digitale Helfer CO2-Einsparungen im Fuhrpark erreichen und die Mobilität der Zukunft nachhaltig gestalten.
Ein Großteil der Treibhausgasemissionen entsteht beim Fahren von Automobilen mit Verbrennungsmotoren; beim Abbremsen entsteht Bremsbelagabrieb bzw. Bremsstaub, einer der Quellen für Feinstaub-Partikel. Die EU-Einigung, bis 2035 die CO2-Emissionen von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf null zu reduzieren und die in diesem Zusammenhang geforderten European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die im Januar 2023 bereits in Kraft getreten sind, stellen für etliche Firmen eine Herausforderung dar. Die ESRS-Berichterstattungspfl icht stellt sicher, dass berichtspfl ichtige Unternehmen für die Auswirkungen ihrer Aktivitäten innerhalb der EU verantwortlich sind. Das betriff t auch das eigene Flottenmanagement und somit die gesamtheitliche Mobilitätsstrategie jedes Unternehmens. Zumal die Anforderungen an Nachhaltigkeit auch von Investoren und Kunden verstärkt eingefordert werden.
ERLEBEN SIE
DAS CHARGECLOUD ÖKOSYSTEM LIVE – AUF
DER POWER2DRIVE IN HALLE B6, STAND 334
Wie viel betrugen die durchschnittlichen CO2-Emissionen des eigenen Fuhrparks oder meiner Nutzfahrzeuge? Wie lang sind die jeweiligen Nutzungsphasen? Verfüge ich über eine optimale Flottenauslastung, wie hoch waren die Aufwände für Fahrzeugüberführungen und erfüllt mein Umwelt- und Energiemanagementsystem alle gesetzlichen Anforderungen? Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist es wichtig zu verstehen, welche Daten benötigt werden und entsprechende Mittel zur Erhebung dieser Daten einzusetzen. Dies kann auch dann gelten, wenn ein Unternehmen selbst nicht berichtspfl ichtig ist, von Partnern, Lieferanten oder Auftraggebern aber werden Daten und Informationen für eigene Berichte angefordert. Denn die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist so konzipiert, dass sie Informationen über die gesamte Wertschöpfungskette enthält. Schließlich spielen auch das Lieferantennetzwerk und der verursachte urbane Lieferverkehr für das Erreichen der Klimaziele eine entscheidende Rolle.
Fuhrparkmanager stehen daher heute vor der großen Herausforderung, die Fahrzeuglogistik nicht nur effi zient, sondern kurz- bis mittelfristig auch so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Mittels digitaler Lösungen können die Flottendaten, Umweltkennzahlen und -auswirkungen überwacht werden,


Fuhrparkmanager stehen heute vor der großen Herausforderung, die Fahrzeuglogistik nicht nur e�zient, sondern kurz- bis mittelfristig auch so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
um anhand dessen fundierte strategische Entscheidungen für die Wahl einzelner Mobilitätsentscheidungen in der eigenen Transportlogistik oder bei Frachtausschreibungen treffen und belegen zu können. Auch können zuvor festgelegte Kennzahlen für selbst gesteckte Ziele zur CO2-Emissionen-Reduzierung überprüft bzw. effi zienter gesteuert werden. Neben den Vorgaben für die Nachhaltigkeitsberichterstattung hilft Fuhrparksoftware gleichzeitig, die Performance des Fuhrparkmanagements zu steigern, Prozesse und Kosten zu optimieren und unterstützt bei der Einhaltung sämtlicher Vorschriften – auch, um immer mit den gesetzlichen Änderungen Schritt halten zu können.
Neben den bereits geltenden Gesetzesvorgaben will die EU-Kommission noch
strengere Grenzwerte für Schadstoffemissionen von Fahrzeugen einführen, die sich an den Vorgaben der WHO orientieren und geltende Standards ab 2030 vorsieht. Auch die Feinstaub-Grenzwerte, die u. a. ...
Lesen Sie den ganzen Artikel online auf: contentway.de
Fakten
CSRD-Richtlinie von hoher Fuhrpark-Relevanz: Ab 1.1.2024 gilt sie für alle Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, ab 1.1.2025 für alle über 250 und ab 1.1.2026 für alle Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten und Nettoumsatzerlösen von mehr als 750.000 €.
ANZEIGE - ADVERTORIAL
Das E-Mobility Ökosystem für grenzenloses Wachstum.
chargecloud ist Ihr Partner für einen verlässlichen, zukunftssicheren Betrieb sowie eine automatisierte, transparente Abrechnung von Ladeinfrastruktur. Ob für Ihre öffentliche Ladeinfrastruktur, Dienstleistungen für Unternehmen mit elektrischen Flotten oder für die Verwaltung Ihres eigenen Fuhrparks – skalieren Sie Ihr E-Mobility Business grenzenlos mit der chargecloud Softwarelösung und den ergänzenden Partnerangeboten des chargecloud marketplace: Intelligentes Flottenladen mit RiDERgy, die KI-Hotline für Ladeinfrastruktur mit Lemonflow.ai und Kreditkartenzahlung direkt an der Ladesäule mit Payter – live erleben und in Ihre Ladeinfrastruktur integrieren!
Gestalten Sie gemeinsam mit chargecloud die Zukunft der Mobilität.
Ihre Vorteile
• Herstellerunabhängige Anbindung
• White-Label Lösung
• Präzise Erfassung der Ladevorgänge
• Automatisierte Abrechnung
• Flexible Tarifgestaltung
Mehr






Aktuelle Gesetzesentwürfe zeigen: E-Mobilität ist kein Trend, sondern eine langfristige und geförderte Investition. Auch Unternehmensflotten nehmen zunehmend E-Autos in den Bestand. Vor allem aufstrebende Marken aus Asien und anderen Regionen überzeugen mit modernster Technik, kostengünstigen Extras und guten Sicherheitsfunktionen. Doch auch in Europa und den USA wird mit innovativer Technik um Marktanteile gekämpft. Nur beim Thema Werkstattnetz wird es oft schwierig, da viele Anbieter weder angemessene Ladelösungen noch einen umfassenden Service gewährleisten können. Bei ATU Flottenlösungen ist das anders: Reparaturen und Inspektionen von E-Autos spielen eine so zentrale Rolle, dass der Servicepartner den Automarkt nahezu flächendeckend abdeckt.
Wer den Fuhrpark seines Unternehmens mit elektrischen Autos erweitern möchte, hat in fast jeder Klasse deutlich mehr Auswahl als noch vor einigen Jahren. Im besten Fall wird er sogar von der EU subventioniert. Schließlich will die EUKommission den Ausbau der Elektromobilität massiv fördern, denn Firmenflotten machen rund 60 Prozent der Neuzulassungen aus und sind damit ein wichtiger Hebel, die Emissionen zu reduzieren. Doch viele Werkstätten in Deutschland sind nur auf die populären E-Auto-Marken eingestellt. Besonders bei weniger bekannten Herstellern können oft nur spezielle Partnerwerkstätten tätig werden. Vor allem im ländlichen Raum kann die geringe Dichte der dafür verfügbaren Werkstätten zum Problem werden – von langen Wartezeiten ganz zu schweigen. Für die Flottenfahrzeuge von jüngeren oder weniger populären Automarken ist die Wahl eines qualifizierten Servicepartners daher essenziell, um Leistungen wie Service, Garantieerhalt, Inspektionen, Reparatur und Ersatzteile zu gewährleisten.
ATU – herstellerunabhängig und flächendeckend
Für die Umstellung der Unternehmensflotten ist ein geeigneter Partner unverzichtbar: Ein Service-Experte für Elektroflotten, der den Markt herstellerunabhängig und flächendeckend bedienen kann – wie beispielsweise Deutschlands führende Werkstatt- und Fachmarktkette
ATU. Sie bietet ein deutschlandweites Werkstattnetz für modellübergreifende Inspektionen und Reparaturen sowie fachmännische Services an Hochvoltsystemen an. Dazu kommen ein bundesweites Ladenetz mit Elektro-Schnellladesäulen an rund 111 ATU Standorten sowie Beratung und Verkauf von Wallboxen, E-Mobilitäts-Zubehör und spezieller Reifen für E-Fahrzeuge.
Qualifiziert für Hochvoltsysteme
Dank vertiefender Qualifizierungen des Personals und Investitionen in die Technik sind alle ATU Filialen für die Anforderungen von Elektroflotten bestens gerüstet und mit modernen Multimarken-Diagnosetools ausgestattet. An jedem ATU-Standort sind außerdem mindestens zwei fachkundige Techniker für Hochvoltsysteme (FHV) der Stufe 2S. Sie können damit E-Autos mit Hochvoltsystemen inspizieren und reparieren. Das ist ein echter Vorteil gegenüber vielen
anderen Werkstätten. So gaben in einer Studie1 zwar 78 Prozent der freien Werkstätten an, bereits Dienstleistungen für Elektroautos anbieten. Doch sind nur 20 Prozent dieser Werkstätten für Arbeiten an Hochvoltsystemen unter Spannung qualifiziert. Einer weiteren Untersuchung zufolge waren das bis 2023 insgesamt nur rund 43.000 Personen2 in ganz Deutschland, was lediglich knapp 15 Prozent aller 280.000 Fachkräfte im Kfz-Werkstattbereich entspricht.
Offizieller Partner von VinFast und Aiways Die jüngst geschlossene Kooperation mit VinFast unterstreicht die Kompetenz und Erfahrung von ATU im Umgang mit nationalen und internationalen E-Fahrzeugen. Der erfolgreiche vietnamesische Autobauer auf Expansionskurs drängt immer stärker auf den europäischen und US-Markt und gewinnt erhebliche Marktanteile – gerade auch bei Autoflotten. Auf Basis der offiziellen Partnerschaft und der damit verbundenen herstellerspezifischen Wartungskompetenz werden jetzt vielfältige Garantie- und Servicearbeiten an VinFast-Fahrzeugen durchgeführt, wobei die Garantie vollständig erhalten bleibt – ein deutlicher Vorteil gegenüber vielen anderen Werkstätten am Markt. Die typischen Standardservice-Leistungen können an allen ATU Standorten durchgeführt werden. Komplexere Diagnosen und Reparaturen werden an den sieben Kompetenzzentren mit speziell auf VinFast-Fahrzeugen geschulten Kfz-Mechatronikern durchgeführt. Eine vergleichbare Kooperation gibt es beispielsweise auch mit dem chinesischen E-Automobilhersteller Aiways mit Hauptsitz in Shanghai.
Ausbau der Ladeinfrastruktur
Eine weitere Säule für das erfolgreiche Flottenmanagement bei E-Autos ist die flächendeckende und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur. ATU baut sie seit Jahren konsequent aus. Bereits heute sind mehr als 100 ATU Standorte mit Schnellladesäulen von Allego ausgestattet und gehört damit zum größten Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Europa. Damit die Unternehmensflotte überall komfortabel und zuverlässig unterwegs sein kann, investiert ATU auch in den kommenden Jahren weiter in den Ausbau des bundesweiten Ladesäulennetzes. So können immer mehr Firmen ihre Elektrofahrzeuge in kürzester Zeit aufladen.
1 Studie dazu: https://www.meyle.com/presse/detail/geschaeft-mit-e-mobilitaet/
2 https://www.autobild.de/artikel/elektroauto-werkstatt-finden-fuer-e-auto-reparatur-22222047.html?
Wenn Sie für Ihre E-Flotte einen Partner mit besonderen Management- und Infrastruktur-Qualifikationen suchen, sind Sie bei ATU genau richtig. Wir bieten Ihnen:
• Hersteller- und modellübergreifende Inspektionen und Reparaturen an Elektrofahrzeugen
• Qualifiziertes Fachpersonal der Stufe 2S für Arbeiten an Hochvoltsystemen
• Konstanter Ausbau eines bundesweites Ladenetz mit Elektro-Schnellladesäulen an rund 440 ATU Standorten
• Beratung und Verkauf von Wallboxen, E-Mobilitäts-Zubehör und spezieller Reifen für E-Fahrzeuge
Weitere Informationen unter atu-flottenloesungen.de und www.atu.de
TIPPS & TRICKS
Elektromobilität nimmt zu. Doch was für die Busse in Hamburg ein Kinderspiel ist – das Laden – kann private Fahrerinnen und Fahrer anfangs ziemlich verunsichern. Vorbereitung kann dabei helfen, diese neuen Abläufe zu verstehen.
Text: Katja Deutsch
Foto: Jesse Donoghoe/unsplash
Hamburg zeigt, wie es gehen kann: Bereits im Jahr 2024 war in der Hansestadt fast jeder vierte Bus des öffentlichen Nahverkehrs (HVV) elektrisch unterwegs, ganz ohne Abgase und nahezu geräuschlos. Damit setzt Hamburg Maßstäbe, denn im bundesweiten Vergleich liegt der Anteil elektrisch betriebener Busse gerade einmal bei zehn Prozent. Für viele andere Städte könnte Hamburgs Modell daher als Vorbild dienen.
Auch bei den Pkw tut sich einiges, allerdings mit gemischten Signalen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) meldete für 2024 rund 380.000 Neuzulassungen rein batteriebetriebener Fahrzeuge. Das sind etwa 144.000 weniger als im Vorjahr –ein deutlicher Rückgang, der vor allem auf den Wegfall der staatlichen Kaufprämie Ende 2023 zurückzuführen ist. Dennoch: Knapp 400.000 neue E-Autos sind beachtlich, und es ist zu erwarten, dass die Zulassungszahlen in den kommenden Jahren wieder deutlich steigen.
geladen werden, ist das Thema Laden für Privatnutzer oft mit Stress verbunden, zumindest anfangs. Tanken war über Jahrzehnte hinweg ein relativ unveränderter, eingespielter Prozess, den man bereits in der Fahrschule gelernt hat. Das Laden von E-Autos hingegen erfordert Einarbeitung in eine völlig neue, oft unübersichtliche Infrastruktur.
Eine zentrale Frage vieler Neulinge lautet: Wo kann ich mein E-Auto eigentlich laden? Anders als Tankstellen sind Ladepunkte häufig dezentral verteilt und stehen am Rande von Parkflächen an Supermärkten, in Parkhäusern, auf Firmengeländen oder in Wohngebieten. Wer keine eigene Wallbox zu Hause hat, muss daher seine Fahrten gut planen.
Zunächst muss eine passende, mit dem eigenen Fahrzeug kompatible Ladesäule gefunden werden, idealerweise mit akzeptabler Ladegeschwindigkeit.
Anders als Tankstellen sind Ladepunkte häufig dezentral verteilt und stehen am Rande von Parkflächen an Supermärkten, in Parkhäusern, auf Firmengeländen oder in Wohngebieten.
Die Vorteile eines E-Fahrzeugs liegen auf der Hand und ähneln jenen der elektrischen Busflotten: E-Autos machen unabhängiger von fossilen Brennstoffen, erzeugen beim Fahren keine CO₂-Emissionen, sind deutlich leiser und meist wartungsärmer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Gerade in lärmgeplagten Städten ist das ein echter Pluspunkt.
Doch während die 240 E-Busse der Hochbahn AG jede Nacht zuverlässig auf den firmeneigenen Busbetriebshöfen
Hinzu kommt die Unsicherheit beim Ladevorgang selbst: Wie funktioniert das Laden an öffentlichen Stationen? Brauche ich eine App, eine RFID-Karte oder reicht eine Kreditkarte? Welche Anbieter gibt es, wie sehen die Tarife aus, und wie hoch sind die Kosten pro Kilowattstunde? Die Vielzahl an Systemen und Abrechnungsmodellen kann schnell überfordern.
Viele Einsteiger erleben beim ersten öffentlichen Laden eine Ernüchterung: Einfach einstecken und losladen funktioniert leider nicht immer. Zunächst muss eine passende, mit dem eigenen Fahrzeug
kompatible Ladesäule gefunden werden, idealerweise mit akzeptabler Ladegeschwindigkeit. Dann folgt die Authentifizierung per App, Karte oder Kreditkarte. Und selbst wenn alles richtig eingerichtet ist, kann es zu technischen Problemen kommen, etwa wenn die Verbindung zur Säule abbricht, das Auto nicht erkannt wird oder der Ladevorgang mitten im Prozess abbricht. Oft ist unklar, ob das Problem beim Auto, beim Kabel oder an der Station liegt. Besonders unter Zeitdruck können solche Situationen frustrierend sein.
Wer sich für ein E-Auto entscheidet, sollte sich vorab gut informieren. Es lohnt sich, Erklärvideos anzusehen oder Erfahrungsberichte zu lesen. Denn: Hat man den Dreh einmal raus, wird das Laden zur Routine – und das elektrische Fahren zum echten Genuss.

Elektroautos erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Fahrzeug mit elektrischem Antrieb. Die Vorteile liegen auf der Hand: geringere Emissionen, leiser Betrieb und oft auch geringere Betriebskosten. Doch mit dem Umstieg auf ein E-Auto tauchen auch neue Fragen auf, insbesondere rund um das Thema Laden. Viele Neulinge in der Elektromobilität fragen sich: Ist das Laden kompliziert? Wo kann ich mein Auto eigentlich laden? Wie weit liegt die nächste Lade-Möglichkeit von meinem Haus, meinem Arbeitsplatz und anderen, oft angesteuerten, Orten entfernt? Wie funktioniert der Vorgang und wie bezahle ich eigentlich?
Diese Unsicherheiten zu Beginn sind verständlich, denn das Laden eines E-Autos unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich vom klassischen Tanken. Tankstellen sind weithin sichtbar – müssen aber extra angesteuert werden. Ladepunkte hingegen sind dezentraler verteilt und idealerweise genau da, wo E-Autofahrende sowieso parken – z. B. auf den Parkplätzen von Supermärkten. Ludolf von Maltzan, Business Manager bei E.ON Drive Infrastructure Deutschland, spricht im Interview darüber, welche Vorteile und Herausforderungen E-Autofahrende bei der Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur erleben und wie der Betreiber E.ON Drive Infrastructure darauf reagiert.
Die Anzahl der E-Autos auf Deutschlands Straßen wächst stetig an, so auch die notwendige Ladeinfrastruktur. Welche Veränderungen nehmen Sie für Ihr Geschäft wahr?
Mit dem wachsenden Anteil an E-Fahrzeugen steigt auch die Erwartung an eine flächendeckende, verlässliche und einfach nutzbare Ladeinfrastruktur. Deshalb gestalten wir unsere Ladeangebote so, dass sie sich in den Alltag der Menschen einfügen: beim Einkaufen, im Wohnviertel, in der Freizeit oder auf langen Fahrten entlang der Autobahn. Dafür kombinieren wir Ladestationen mit verschiedenen Ladegeschwindigkeiten – vom normalen Laden über Nacht bis zum besonders schnellen Laden unterwegs. Unser Ziel:
Ein Ladeerlebnis, das einfach, zuverlässig und für alle zugänglich ist.
Was ist Ihnen bei der Entwicklung von Ladeinfrastruktur besonders wichtig –aus Sicht der Nutzenden?
Für uns steht der Alltag der Menschen im Mittelpunkt. Wir sind überzeugt: Elektromobilität funktioniert nur dann wirklich gut, wenn das Laden selbstverständlich in den Tagesablauf integriert werden kann – ohne Umwege, ohne Hürden. Deshalb denken wir Ladeinfrastruktur vom Nutzenden her: Sie muss dort verfügbar sein, wo Menschen leben, arbeiten, einkaufen oder unterwegs sind.
Ladesäulen sind hochmoderne Technik. Was tun Sie dafür, dass sich alle Kunden im Umgang damit sicher fühlen?
Unsere Ladesäulen sollen für jede und jeden zugänglich und einfach zu bedienen sein. Die Steuerung erfolgt in der Regel über einen Bildschirm und ist sehr intuitiv. Selbstverständlich kann man mit den Apps und Ladekarten fast aller großen Anbieter bei uns laden. Dank Bezahlterminals kann man überwiegend an Schnellladesäulen einfach per Kreditkarte zahlen und braucht keine Apps und keinerlei Vertrag. Eine 24/7-Hotline hilft weiter, sollte es einmal Fragen geben.
Mit unserem erfahrenen Betriebsteam und regelmäßiger Wartung durch unsere Servicepartner sorgen wir dafür, dass unsere Ladestationen sauber, sicher und nutzer-
freundlich bleiben. Mit Hilfe KI-basierter Systeme analysieren wir kontinuierlich Betriebsdaten unserer Ladestationen, um mögliche Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu beheben.
Innenstädtischer, öffentlicher Raum ist hart umkämpft. Wo könnte man die vielen zusätzlichen Ladesäulen aufstellen? Wir bringen Ladeinfrastruktur dorthin, wo Menschen ohnehin im Alltag unterwegs sind – etwa zu Supermärkten, Fachmarktzentren wie Baumärkten oder Elektronikhändlern, Restaurants oder Hotels. Entscheidend ist dabei, dass die Parkplätze öffentlich zugänglich und idealerweise rund um die Uhr nutzbar sind. Denn an diesen Stationen dürfen nicht nur die Kundinnen und Kunden des jeweiligen Geschäfts laden, sondern jeder. So schaffen wir echte Mehrwerte für E-Autofahrerinnen und -fahrer, ohne zusätzlichen Flächenbedarf im innerstädtischen Raum zu erzeugen.
Wie groß ist so ein Ladepark? Wir bauen Ladeparks in ganz unterschiedlichen Größen, von kleinen Standorten mit vier Ladepunkten bis hin zu großen Anlagen mit bis zu 16 Ladepunkten. Im Rahmen des Deutschlandnetzes errichtet E.ON Drive Infrastructure Ladeinfrastruktur nach klaren Vorgaben des Bundes, je nach Bedarf in den Größen S bis XL. So entstehen in den kommenden Jahren an 170 Standorten des Deutschlandnetzes über 1.350 neue E.ON-Ladepunkte. Die Ladeleistung erreicht dabei bis zu 400 kW pro Ladepunkt, je nachdem, ob ein oder zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden.
Wo liegen die größten Herausforderungen?
Eine große Herausforderung liegt im Finden geeigneter Flächen. Wir sind deswegen immer auf der Suche nach Standortpartnern, auf deren Parkflächen wir Ladeinfrastruktur errichten können. Diese

E.ON Drive Infrastructure ist ein europaweit aktiver Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen plant, baut und betreibt Ladepunkte für Elektro-Pkw und Nutzfahrzeuge. Als Teil der E.ON-Gruppe bringt es umfassende Energieexpertise und Betriebserfahrung in die Mobilitätswende ein. www.edri.com

Elektromobilität funktioniert nur dann wirklich gut, wenn das Laden selbstverständlich in den Tagesablauf integriert werden kann – ohne Umwege, ohne Hürden.
erhalten dafür eine feste monatliche Miete und bieten ihren Kundinnen und Kunden wiederum einen attraktiven, neuen Service an. Zum anderen stellen langwierige Genehmigungs- und Planungsverfahren oftmals ein Hindernis dar. Im Sinne der Verkehrswende sollten wir in Deutschland hier mehr Tempo reinbekommen, um noch zügiger die benötigte Ladeinfrastruktur aufbauen zu können.
Wie entwickeln Sie die Ladeparks weiter und welche Innovationen testen Sie gerade?
Im Rahmen des Deutschlandnetzes werden an ausgewählten Standorten moderne T-förmige Leuchtelemente und Dächer mit Preis- und Belegungsanzeige, Sitzgelegenheiten, Sanitäranlagen und Snackautomaten integriert.
Zusätzlich werden auch spezielle Ladeplätze gebaut, etwa extra breite für Menschen mit Behinderung sowie lange Plätze für elektrische Nutzfahrzeuge und Autos mit Anhänger.
Ein Fokus liegt auf Benutzerfreundlichkeit: Unsere Ladesäulen bieten eine intuitive Bedienung, leicht verständliche Anleitungen auf den Displays, mehrsprachige Inhalte und künftig auch kurze Erklärvideos – besonders hilfreich für alle, die zum ersten Mal laden. Ein spezialisiertes Team arbeitet kontinuierlich daran, das Ladeerlebnis noch einfacher, zugänglicher und komfortabler zu gestalten.
Im Sinne der Verkehrswende sollten wir in Deutschland hier mehr Tempo reinbekommen, um noch zügiger die benötigte Ladeinfrastruktur aufbauen zu können.










