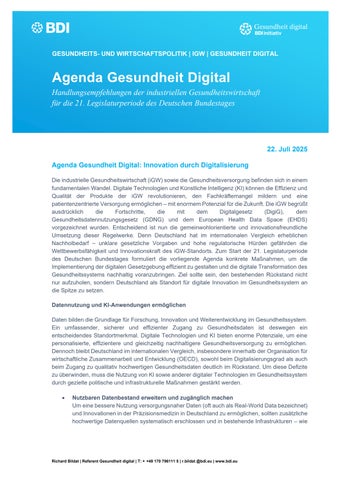Agenda Gesundheit Digital
Handlungsempfehlungen der industriellen Gesundheitswirtschaft für die 21. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages
22. Juli 2025
Agenda Gesundheit Digital: Innovation durch Digitalisierung
DieindustrielleGesundheitswirtschaft(iGW)sowiedie Gesundheitsversorgung befindensichineinem fundamentalenWandel.DigitaleTechnologienundKünstlicheIntelligenz(KI)könnendie Effizienzund Qualität der Produkte der iGW revolutionieren, den Fachkräftemangel mildern und eine patientenzentrierteVersorgungermöglichen – mitenormemPotenzialfürdieZukunft.DieiGWbegrüßt ausdrücklich die Fortschritte, die mit dem Digitalgesetz (DigiG), dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) und dem European Health Data Space (EHDS) vorgezeichnet wurden. Entscheidend ist nun die gemeinwohlorientierte und innovationsfreundliche Umsetzung dieser Regelwerke. Denn Deutschland hat im internationalen Vergleich erheblichen Nachholbedarf – unklare gesetzliche Vorgaben und hohe regulatorische Hürden gefährden die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des iGW-Standorts Zum Start der 21. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages formuliert die vorliegende Agenda konkrete Maßnahmen, um die ImplementierungderdigitalenGesetzgebungeffizientzugestaltenunddiedigitaleTransformationdes Gesundheitssystems nachhaltig voranzubringen. Ziel sollte sein, den bestehenden Rückstand nicht nur aufzuholen, sondern Deutschland als Standort für digitale Innovation im Gesundheitssystem an die Spitze zu setzen.
Datennutzung und KI-Anwendungen ermöglichen
Daten bilden die Grundlage für Forschung, Innovation und Weiterentwicklung im Gesundheitssystem. Ein umfassender, sicherer und effizienter Zugang zu Gesundheitsdaten ist deswegen ein entscheidendes Standortmerkmal. Digitale Technologien und KI bieten enorme Potenziale, um eine personalisierte, effizientere und gleichzeitig nachhaltigere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. DennochbleibtDeutschlandiminternationalenVergleich,insbesondereinnerhalbder Organisationfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), sowohl beim Digitalisierungsgrad als auch beim Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdaten deutlich im Rückstand Um diese Defizite zuüberwinden,mussdieNutzungvonKIsowieandererdigitalerTechnologienimGesundheitssystem durch gezielte politische und infrastrukturelle Maßnahmen gestärkt werden
• Nutzbaren Datenbestand erweitern und zugänglich machen UmeinebessereNutzungversorgungsnaherDaten(oftauchalsReal-WorldDatabezeichnet) und Innovationeninder Präzisionsmedizin in Deutschlandzu ermöglichen, sollten zusätzliche hochwertige Datenquellen systematisch erschlossen und in bestehende Infrastrukturen – wie
das Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ-Gesundheit) – eingebunden werden. Zwei Beispiele sind die NAKO-Gesundheitsstudie1 und die klinischen Krebsregister. Die NAKO bildet mit über 200.000 Teilnehmenden, umfassender Phänotypisierung und wachsender Multiomik-Datenbasis eine einzigartige Grundlage für KI-gestützte Forschung und personalisierte Medizin. Die klinischen Krebsregister erfassenbundesweit qualitätsgesicherte Versorgungsdaten zu Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Krebserkrankungen. Sie ermöglichen sektorenübergreifende Analysen und tragen maßgeblich zur Evaluation und Verbesserungder onkologischen Versorgung bei. Der geplante Ausbau dieser Register, etwa durchdieIntegrationmolekularerDaten,bietethohesPotenzialfürForschungundInnovation. Um das Potenzial klinischer Register vollständig zu heben, ist die zügige Verabschiedung eines Registergesetzes erforderlich. Es schafft die rechtlichen Voraussetzungen für eine einheitliche, qualitätsgesicherte und datenschutzkonforme Nutzung versorgungsnaher Registerdaten für Forschung und Versorgung. Die Industrie unterstützt dieses Vorhaben ausdrücklich, um evidenzbasierte Innovationen, insbesondere in der Onkologie und bei seltenen Erkrankungen, zu ermöglichen.
Entscheidend ist jedoch nicht allein der Ausbau solcher Datenquellen, sondern ihre aktive Nutzbarmachung. Dazu gehören der technische und rechtliche Anschluss an das FDZGesundheit, die Definition klarer Zugangsbedingungen sowie standardisierte Metadatenmodelle.NurdurcheinekoordinierteAnbindungforschungsrelevanterDatenquellen lässt sich das volle Potenzial für Versorgung, Forschung und Entwicklung heben.
• Datenqualität verbessern
Die elektronische Patientenakte (ePA) sollte zügig zu einer Plattform für strukturierte und qualitativ hochwertige Daten ausgebaut werden. Dafür sind verbindliche Standards für maschinenlesbare Formate in Bildgebung, Labordiagnostik und individuellen Therapien notwendig,umInteroperabilitätsicherzustellen.ZudembrauchtesklaregesetzlicheVorgaben füreinequalitätsgesicherteErfassung,etwadurchnachvollziehbareDokumentationsvorgaben und systematische Konsistenzprüfungen Nur durch einen einheitlichen Rahmen für Datenqualitätund-nutzung, können Echtzeit-und longitudinaleAnalysendenvollenMehrwert für Versorgung und Forschung entfalten.
Hierfür ist die konsequente Einführung international etablierter Standards wie HL7 FHIR und OMOP entscheidend Diese Standards ermöglichen die einheitliche Darstellung und maschinelle Verwertbarkeit von Gesundheitsdaten über Sektor- und Systemgrenzen hinweg. Wesentlich ist zudem, dass Leistungserbringer für den strukturierten Umgang mit digitalen Dokumentationssystemen sensibilisiert und geschult werden – nicht als Mehraufwand, sondern als Beitrag zur Versorgungsqualität. Entscheidend ist, dass diese Anforderungen nicht isoliert an einzelne Akteure gestellt werden, sondern Teil eines koordinierten Gesamtansatzes sind, der die Zusammenarbeit zwischen Politik, Industrie, Gesundheitsdienstleistern und IT-Anbietern systematisch stärkt.
• Effizienten Datenzugang und rechtssicheren Datenschutz gewährleisten
Das FDZ-Gesundheit benötigt klare Priorisierungsregeln, die alle Akteure – insbesondere bei Nutzenbewertungen und Erstattungsbetragsverhandlungen – gleichberechtigt berücksichtigen. Verbindliche und transparente Bearbeitungszeiten sind hierfür unabdingbar, um eine faire und planbare Nutzung für alle Antragsteller – unabhängig von ihrer institutionellen Herkunft – zu gewährleisten. Gleichzeitig darf die heterogene Auslegung der DSGVO-Prozesse nicht an anderer Stelle ausbremsen: Hier ist ein harmonisiertes Vorgehen
1 Weiterführende Informationen zur NAKO-Gesundheitsstudie unter: https://nako.de/studie/
auf nationaler und europäischer Ebene erforderlich, um eine klare und einheitliche Datenhandhabungzu gewährleisten. InDeutschland solltediesdurchdieHarmonisierungder Landesgesetze – insbesondere der Landeskrankenhausgesetze – sowie durch eine bundesweit einheitliche Auslegung der DSGVO unterstützt werden.
Dazu gehört auch die Stärkung einer zentralen Datenschutzaufsicht mit klar definierten Zuständigkeiten für Gesundheitsdaten, um rechtssichere Rahmenbedingungen für sektorenübergreifende Forschungs- und Versorgungsprojekte zu schaffen. Forschungsvorhaben müssen dabei unabhängig von der Trägerschaft – ob öffentlich oder privat – ermöglicht werden. Entsprechend ist die Gleichstellung privatwirtschaftlicher Forschung im Datenschutzrecht ausdrücklich zu verankern.
Ergänzend bedarf es praktikabler Vorgaben zur rechtssicheren Anonymisierung und Pseudonymisierung personenbezogener Daten, insbesondere auch für sensible Datenkategorien wie Bilddaten und Bioproben. Die Nutzung pseudonymisierter Bestandsdaten sowie der Einsatz von KI in Forschung und Versorgung erfordern klare technische Standards und einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen. Dies schließt ausdrücklichdieNutzungdieserDatenfürdasTrainingunddieValidierungvonKI-Algorithmen ein, um eine schnelle Überführung von Forschungsergebnissen in die Anwendung zu gewährleisten
Ein zentraler Baustein für die Datensouveränität der Patientinnen und Patienten ist die Einführung eines bundeseinheitlich anerkannten Broad Consent, der langfristige und wiederverwendbare Einwilligungen zur Nutzung von Gesundheitsdaten für definierte Forschungsbereiche rechtssicher ermöglicht. Auch beim Zugang zu europäischen Infrastrukturen wie dem EHDS sowie nationalen Systemenwie dem FDZ-Gesundheit müssen industrielle Anwendungen – etwa in der Versorgungsforschung, klinischen Studien oder der KI-Entwicklung – gleichberechtigt und praktikabel berücksichtigt werden.
• Innovationsfreundlichen IP-Rahmen für datenbasierte Gesundheitslösungen schaffen Um die Innovationskraft der iGW langfristig zu sichern, bedarf es eines innovationsfreundlichen Rahmens für den Schutz geistigen Eigentums. Insbesondere im Bereich datenbasierter Anwendungen und KI-gestützter Lösungen müssen klare Regelungen zum Patentschutz, zur Schutzfähigkeit von Algorithmen sowie zur Abgrenzung von Open Source und proprietären Technologien geschaffen werden. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutzrechten, Interoperabilität und Gemeinwohlorientierung ist hierbei essenziell. Deutschland sollte sich auf europäischer Ebene für die Harmonisierung von IP-Regeln im Gesundheitsdatenraum einsetzen, um Investitionssicherheit und Innovationsdynamik gleichermaßen zu fördern.
Eine inklusives Gesundheitsdatenökosystem aufbauen
Der EHDS und das GDNG bieten erste Ansätze, um ein interoperables und vertrauenswürdiges Datenökosystem zu schaffen. Dieses System hat das Potenzial, die Zukunft der Gesundheitsversorgung und -forschung zu revolutionieren, indem es Forschung und Versorgung verknüpft, Datensouveränität sicherstellt und ein klares Rahmenwerk für Interoperabilität, DatennutzungundSicherheitschafft.DieiGWnimmtinVersorgungundForschungeinezentraleRolle ein und sollte daher aktiv in die Entwicklung gemeinsamer Standards sowie die Entwicklung technischer und rechtlicher Grundlagen eingebunden werden
• Alle Akteure einbinden über das Konvergenzboard Gesundheit
Die iGW sollte als Partner bei der Festlegung verbindlicher Standards für Datenqualität und Interoperabilität einbezogen werden. Neben Routine- und Abrechnungsdaten müssen auch forschungsrelevante Datensätze aus verschiedenen Versorgungsbereichen genutzt werden können. Dabei geht es darum, Daten aus stationärer und ambulanter Primärversorgung, Laboren, klinischen Studien und Patientenregistern zu integrieren. Eine aktive Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschungseinrichtungen und der Politik ist essenziell, umdieBedürfnissedereinzelnenAkteurezuberücksichtigen.UmdieUmsetzungderdigitalen Gesetzgebung effizient zu gestalten und zum Gemeinwohl beizutragen, braucht es ein Konvergenzboard Gesundheit, das als koordinierende Plattform für alle relevanten Akteure dient. Erste Vorarbeiten hierfür wurden bereits im Zusammenschluss von Politik, Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft geleistet. Ziel ist es, die Abstimmung gemeinsamer, interoperabler bundesweiter Lösungen gezielt zu fördern. Große Aufgaben wie die EHDSImplementierung, der Forschungsdatenaustausch, klinische Studien oder die Erstellung von Metadatenkatalogen erfordern eine strukturierte, sektorenübergreifende Zusammenarbeit –genau hier kann ein solches Gremium entscheidende Impulse setzen. Dabei kommt es auf ein klares strategisches Rahmenwerk an, das Zuständigkeiten definiert, rechtlicheVorgabenabstimmtund politischeProzesse zwischenBund, LändernundRessorts wie Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) und Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) kohärent verzahnt Das Konvergenzboard soll ein Impulsgeber, eine Kooperationsplattform und konstruktiver Partnersein.GleichzeitigsolltedieBereitschaftzurMitgestaltungauch institutionellanerkannt werden: Die Industrie sollte in alle maßgeblichen Gremien zur Errichtung des Gesundheitsdatenökosystems systematisch einbezogen werden Um die notwendige Akzeptanz und Umsetzungskraft zu sichern, sollten Public-Private-Governance-Strukturen etabliert werden, die wissenschaftliche, industrielle und staatliche Akteure dauerhaft vernetzen. Solche Strukturen können zur Qualitätssicherung, zur gemeinsamen Priorisierung von Use Cases und zur Entwicklung interoperabler Werkzeuge beitragen
• Technische Konvergenz sichern und dabei Infrastruktur verlässlich gestalten
Damit ein interoperables und vertrauenswürdiges Gesundheitsdatenökosystem in der Praxis funktioniert, braucht es robuste technische Grundlagen, die über Einzelstandards hinausgehen. Notwendig ist ein verlässlicher Rahmen für Identitäts- und Berechtigungsmanagement, datensouveräne Infrastrukturmodelle und föderierte Datenarchitekturen. Eine besondere Herausforderung liegt in der intelligenten Verknüpfung von Daten aus unterschiedlichen Quellen – z. B. aus Versorgung, klinischer Forschung und Registern.HierfürsindinteroperableMetadatenkatalogesowiesektorenübergreifendnutzbare ID-Wallets notwendig, die eine eindeutige und kontrollierte Identifikation ermöglichen. Um die Steuerung von Zugriffen und Einwilligungen praktikabel zu gestalten, sind digitale ConsentLösungen mit standardisierten Schnittstellen erforderlich – wo möglich als Open-SourceKomponenten mit bundesweiter Gültigkeit. Ebenso ist die Möglichkeit zentralisierter Antragsprozesse, etwa gegenüber Ethikkommissionen, als digitale Lösung mit hohem Automatisierungspotenzial zu prüfen. Die Entwicklung solcher Basiskomponenten sollte gemeinsam durch Politik, Industrie und Wissenschaft erfolgen, koordiniert und langfristig tragfähig gestaltet sein. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) benötigen verlässlichenZugangzumodularen,wiederverwendbarenInfrastrukturkomponenten.AuchKIModelle sollten sie in datenschutzkonformen Sandbox-Umgebungen entwickeln und testen
können. Dafür braucht es einheitliche Governance-Vorgaben, transparente Zugangskriterien und eine zentrale Anlaufstelle für technische und regulatorische Unterstützung. Ein zentraler Baustein zur Sicherung technischer Interoperabilität und Infrastrukturstabilität ist die Weiterentwicklung der Gematik zu einer handlungsfähigen Digitalagentur. Sie sollte über ein klares Mandat zur Entwicklung, Koordinierung und Skalierung sektorenübergreifender Standards und technischer Basiskomponenten verfügen. Dazu gehört insbesondere die Verantwortung für offene Schnittstellen, einheitliche Datenformate und interoperable Infrastrukturkomponenten. Voraussetzung ist eine enge Zusammenarbeit mit Industrie, Leistungserbringern, Forschung und Verwaltung, um praxisnahe und tragfähige Lösungen entlang der gesamten Versorgungskette zu entwickeln und umzusetzen.
Digitale Transformation der Gesundheitsversorgung gestalten
Die digitale Transformation ist der zentrale Hebel, um die Gesundheitsversorgung in Deutschland leistungsfähiger,krisenfesterundnachhaltigerzugestalten.DieiGWträgtmitihrendigitalenLösungen wesentlich dazu bei, Effizienz, Qualität und Versorgungssicherheit zu verbessern – sowohl im Normalbetrieb als auch in Krisenzeiten.
• Digitalisierung nutzen und Effizienzen heben Ambulantisierung und sektorenübergreifende Versorgung erfordern digitale Behandlungsketten, die unterschiedliche Versorgungsbereiche technisch und inhaltlich miteinander verbinden. Dafür sind ein durchgängiger Datenaustausch und eine hohe Interoperabilität zwischen ambulanten und stationären Systemen zwingend notwendig. Gleichzeitig braucht es eine verlässliche Datengrundlage, die es ermöglicht, Versorgungsqualität und Behandlungsergebnisse systematisch zu erfassen, in Echtzeit auszuwerten und vergleichbar zu machen. Nur so lassen sich Qualität und Effizienz der Versorgung objektiv bewerten und gezielt verbessern. Ein solches datenbasiertes Steuerungswissen schafft die Voraussetzung für einen fairen Wettbewerb auf Basis medizinischerErgebnisse – anstellerein mengenorientierterAnreize – und stärktnachhaltige, patientenorientierte Versorgungsmodelle.
Entscheidend ist, dass die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass sektorenübergreifend nutzbare Versorgungsdaten unter Einhaltung hoher DatenschutzstandardsverfügbargemachtundfüreinequalitätsorientierteVersorgunggenutzt werden können. Interoperabilität sollte dabei nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich gewährleistet sein – als Grundlage für eine moderne, lernende Gesundheitsversorgung.
• Telemedizin und robotikgestütze Versorgungsmodelle
Damit Telemedizin dauerhaft ein integraler Bestandteil der Regelversorgung wird, sind klare und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen erforderlich. Die Vergütungssystematik sollte so weiterentwickelt werden, dass telemedizinische Leistungen – unabhängig von Indikation, Berufsgruppe oder Versorgungsform – fair, indikationsübergreifend und dauerhaft abrechenbar sind. Gleichzeitig braucht es einen innovationsfreundlichen Rechtsrahmen, der hybride Versorgungsmodelle – also die kombinierte Nutzung von Telemedizin und Präsenzversorgung – rechtlich absichert und ihre Integration in die Regelversorgung ermöglicht. Verlässliche Vorgaben für Finanzierung, Interoperabilität und Anbindung an zentrale Systeme wie ePA, TI und sektorenübergreifende Versorgungspfade sind dafür unerlässlich.NebenderTelemedizinbietenauchrobotikgestützteVersorgungsmodellegroßes Potenzial – etwa durch den Einsatz intelligenter Assistenzsysteme in Pflegeeinrichtungen. Solche Innovationen sollten ebenfalls in den innovationsfreundlichen Rechtsrahmen
aufgenommen und durch gezielte Anreizmodelle berücksichtigt werden. Dabei gewinnen neben datenbasierten Anwendungen zunehmend auch robotische Assistenzsysteme und empathiefähige KI-Lösungen an Bedeutung. Sie können unmittelbar zur Entlastung von Fachpersonal beitragen, die Versorgung stabilisieren und die Patientenerfahrung verbessern – insbesondere in Pflege, geriatrischer Versorgung und Palliativmedizin.
• Digitale Kompetenz stärken
Ein digital souveränes Gesundheitssystem braucht gut ausgebildetes Fachpersonal. Digitale Kompetenz sollte verbindlich in die medizinische und pflegerische Ausbildung integriert werden. Dabei sollte auch der gezielte Umgang mit robotischen Assistenzsystemen und KIgestütztenAnwendungenintegralerBestandteilvonAusbildung,StudiumundFortbildungsein – insbesondere im Bereich Pflege, Therapie und klinische Versorgung. Bund und Länder sollten gemeinsame Standards für Aus- und Weiterbildung schaffen, die medizinisch-pflegerische Praxis mit Daten- und Technologiekompetenz verbinden. Auch Fortbildungsangebote für bereits tätige Fachkräfte verdienen eine stärkere Förderung – etwa im Umgang mit KI, Datenethik oder digitalen Behandlungspfaden.
Über den BDI
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch Verantwortlichen. Damit unterstützterdieUnternehmenimglobalenWettbewerb.ErverfügtübereinweitverzweigtesNetzwerk in Deutschland und Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler Markterschließung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische Beratung für alle industrierelevanten Themen. Der BDI ist die Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er spricht für 39 Branchenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit rund acht Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf regionaler Ebene.
Impressum
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Breite Straße 29, 10178 Berlin www.bdi.eu
T: +49 30 2028-0
Lobbyregisternummer: R000534
Redaktion
Richard Bildat
Referent Gesundheit digital
T: +49 30 2028-1714
r.bildat@bdi.eu
Rabea Knorr
Leiterin Abteilung Industrielle Gesundheitswirtschaft
T: +49 30 2028-1495
r.knorr@bdi.eu
BDI Dokumentennummer: D2054