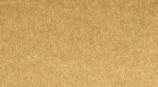

04-05/2025


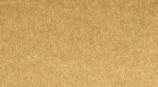

04-05/2025

Die wenigen Wasserstoff-Tankstellen in Österreich sind Geschichte. Ist damit auch der alternative Antrieb gescheitert? Was dafür spricht, was dagegen und wo Wasserstoff in der Mobilität durchaus sinnvoll genutzt werden kann.
ab Seite 8
Fuhrparkporträt: Zu Gast bei den ÖBB
Welche Herausforderungen die Österreichischen Bundesbahnen zu bewältigen haben ab Seite 32
Ford Nugget, Mercedes Marco Polo & VW California: Was sie können und was nicht ab Seite 66 Urlaubsreif? Großer Campervan-Vergleich
Leichte Nutzfahrzeuge: Neue Konzepte warten
Die neuesten TransporterModelle im Test und ein Blick in die nahe Zukunft ab Seite 39



























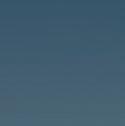



e-tron
Audi Vorsprung durch Technik
100% Audi A6. 100% elektrisch.












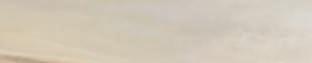



Der neue, rein elektrische Audi A6 Avant e-tron
Stromverbrauch kombiniert: 14,5-19,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO₂-Klasse: A. Symbolbild. Stand 04/2025.


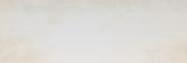

Es kommt mir vor, als wäre es gestern oder maximal vorgestern gewesen, aber am 24. Juni feiert die FLEET Convention tatsächlich bereits ihr 10. Jubiläum. Zehn aufregende und spannende Jahre, zehn Jahre, in denen die Veranstaltung gewachsen ist und wir an ihr. Zehn Jahre, in denen wir zusehen durften, wie unser „Baby“ heranwuchs und nun ins Teenager-Alter gelangt. Welche Highlights Sie heuer auf der FLEET Convention erwarten, lesen Sie auf der kommenden Doppelseite, auf Seite 14 lassen wir die zehn Jahre noch einmal kurz Revue passieren.
100. FLOTTE & neuer FLEET Drive
Dem nicht genug, feiern wir mit dieser Ausgabe noch ein weiteres Jubiläum. Diese Ausgabe der FLOTTE ist die 100. seit Gründung Ende 2011. Danke an dieser Stelle an das ganze Team, wir haben das Magazin als führenden Ratgeber für Fuhrparkund Flottenbetreiber etabliert und mit Zusatzprodukten wie „Fuhrpark kompakt“, „Nutzfahrzeug Kompass“, der Website flotte.at und der Plattform flotte-wissen.at deutlich aus-
gebaut. Und da Stillstand bekanntlich Rückschritt bedeutet, haben wir mit dem FLEET Drive bereits die nächste Veranstaltung in Vorbereitung. Notieren Sie sich gleich den
Wir feiern nicht nur die 10. FLEET Convention am 24. Juni in der Wiener Hofburg, sondern auch die 100. Ausgabe der FLOTTE.“
1. Oktober 2025 in Ihrem Kalender, dann findet in der Werft Korneuburg die erste Fahrveranstaltung der FLOTTE statt. Und die unterscheidet sich von anderen bekannten Formaten. Zum einen können sich die Besucher vorab auf www.fleetdrive.at registrieren und zu einem späteren Zeitpunkt Slots für Testfahrten mit ihren gewünschten
Modellen reservieren, zum anderen finden die Tests auf öffentlichen Straßen in und rund um Korneuburg – inklusive Autobahn – statt. Um das Fahrzeug richtig erleben zu können,
steht dabei ein Produktspezialist zur Seite, der die mittlerweile zahlreichen Features und Assistenzsysteme erklärt. Für Besucher der FLEET Convention ist die Teilnahme am FLEET Drive übrigens kostenlos möglich, alle anderen bezahlen einen Unkostenbeitrag von 49 Euro. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Sie sowohl auf der FLEET Convention als auch auf dem FLEET Drive begrüßen zu dürfen!
Was die vorliegende FLOTTE betrifft, so haben wir auch dieses Mal versucht, möglichst viel Infos hineinzupacken, neben dem NutzfahrzeugSchwerpunkt gibt es natürlich wieder neue Fahrzeugtests, ein humorvoller Rückblick auf 100 Ausgaben FLOTTE darf ebenso nicht fehlen.

Ich wünsche Ihnen wie immer gute Unterhaltung mit der neuen FLOTTE und freue mich, Sie in der Hofburg und in Korneuburg zu begrüßen!
Stefan Schmudermaier Chefredakteur FLOTTE

Auch der Tennisclub des Post SV Wien hat eine Flotte, eine CarsharingFlotte. Und die ist sogar kostenlos zu benutzen! Voraussetzung ist nur, das Gefährt am Ende der Fahrt wieder auf die dafür vorgesehenen Parkplätze zu stellen. Ehrensache, machen wir natürlich gerne!
Die FLEET Convention feiert heuer ihr 10. Jubiläum, im Vorjahr durften wir erneut über 800 Teilnehmer in der Wiener Hofburg willkommen heißen. 2025 zeigen wir Ihnen wieder unterschiedlichste Highlights aus den Bereichen Auto, Produkte und Dienstleistungen und präsentieren spannende Themen unabhängiger Referentinnen und Referenten im Großen Festsaal.
NEU: Buchen Sie ein exklusives Gespräch mit unseren Vortragenden!
Welcome Desk
ab 08:30 Eintreffen, Check-in, Frühstück
Catering „Motto“
10:20–10:30 Welcome
Christian Clerici, Stefan Binder, Geschäftsführer A&W Verlag &
Stefan Schmudermaier, Chefredakteur FLOTTE
Vorträge & Top-Speaker
10:30–10:55 Zahlen & Fakten zum österreichischen Flottenmarkt
Marc Odinius, Dataforce
10:55–11:25 Podiumsdiskussion: Aktuelle Herausforderungen
Melanie Schmahl, Bundesverband betriebliche Mobilität D Manfred Tutschek, Fuhrparkleiter ISS und weitere
11:25–11:30 News vom Fuhrparkverband Austria Henning Heise, Obmann
11:30–11:45 Mythen rund um die E-Mobilität
Helmut Geil, Geschäftsführer Dekra Österreich
11:45–12:05 Bidirektionales Laden & dynamische Strompreise

Erstmals bieten wir die Möglichkeit, einen exklusiven Einzeltermin bei unseren Vortragenden direkt auf der FLEET Convention zu buchen. Nutzen Sie dafür das Terminvereinbarungstool auf unserer Website www.fleetconvention.at und sichern Sie sich Ihr kostenloses Gespräch mit einem unserer Profis! Fahrzeug- & Gold-Partner





Christian Lechner, Green Energy Lab
Networking
12:05–14:05 Mittagessen, Catering „Motto“
Vorträge & Top-Speaker
14:05–14:10 Re-Opening Christian Clerici
14:10–14:35 FLOTTE-Fuhrparkstudie
Konrad Weßner & Stefan Reiser, puls Marktforschung
14:35–15:00 BEST4FLEET-Award
Stefan Schmudermaier, Chefredakteur FLOTTE
15:00–15:30 HR – So nutzen Sie Mobilität zur Mitarbeiterzufriedenheit
Toygar Cinar, RheinWest HR Solutions
15:30–15:35 Resümee
Christian Clerici & Stefan Binder, Geschäftsführer A&W Verlag
Networking ab 15:35 Lounge, Catering „Motto“ Programmänderungen vorbehalten!



Melanie Schmahl
Fuhrparkexpertin und stellvertretende Vorsitzende des deutschen Fuhrparkverbandes

Christian Lechner
Bidirektionales Laden und dynamische Stromtarife vom Projekt Green Energy Lab

Konrad Weßner
Der Gesellschafter von puls Marktforschung präsentiert die neue FLOTTE-Fuhrparkstudie

Manfred Tutschek
Der ISS-Fuhrparkleiter spricht in der Podiumsdiskussion zu aktuellen Herausforderungen



Fuhrpark-Verantwortliche
158 Euro (exkl. USt., inkl. Verpflegung)
Kombiticket
HR-Verantwortliche*
70 Euro (exkl. USt., inkl. Verpflegung)
*bei gleichzeitiger Buchung eines Tickets für Fuhrpark-Verantwortliche
Branchenbesucher nicht ausstellender Firmen*
438 Euro (exkl. USt., inkl. Verpflegung)
*max. 5 Tickets pro Unternehmen
www.fleetconvention.at
Kontakt: A&W Verlag GmbH
Inkustraße 1-7/4/2
3400 Klosterneuburg
Renate Okermüller
0664/138 16 89
info@fleetconvention.at
Silber-Partner


Toygar Cinar Vom HR-Profi gibt’s Tipps, wie man Mobilität zur Mitarbeitermotivation nutzen kann

Marc Odinius
Der Dataforce-Geschäftsführer bringt wieder spannende Zahlen zur Marktentwicklung

Helmut Geil
Der Dekra -ÖsterreichGeschäftsführer wirft einen Blick auf Mythen der E-Mobilität

Der (E-)Auto-Aficionado führt traditionell durch das Programm in der Hofburg








Aktuelles Thema 08
Quo vadis Wasserstoff?
FLEET Convention 14
Was Sie alles erwartet
Interview 20
Peugeot CEO Alain Favey im Gespräch
100 Ausgaben FLOTTE 22
Highlights, Flops & Nougatknödel
Fuhrparkverband Austria 26
Neue Fuhrparkleiter für Österreich
Interview 30
Dekra Ö-GF Helmut Geil
Fuhrpark-Porträt 32
ÖBB Rail&Drive
Ratgeber 36
Schadenmanagement, Teil 4
Vergleich 66
Ausflug mit drei Campingmobilen
Rückblick 72
75 Jahre VW Bully
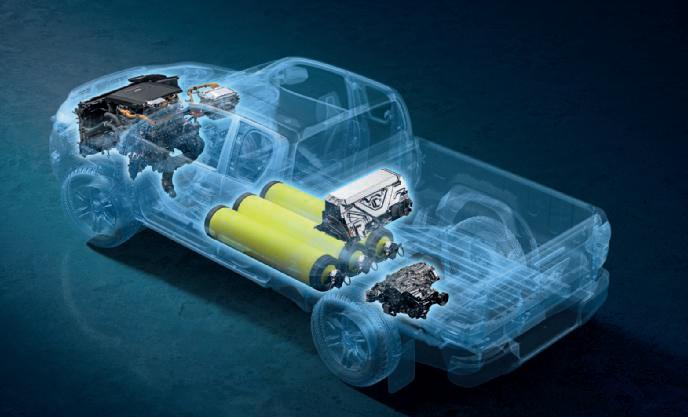


Kurzmeldungen
Aktuelles aus der Mobilitätswelt FLEET Convention 14
Alles zur Jubiläumsausgabe
Neue Modelle von beiden Marken
Ioniq 9 18
XL-E-Topmodell aus Südkorea Interview 20
Peugeot CEO Alain Favey im Gespräch
100 Ausgaben FLOTTE 22
Was kam, was ging, was blieb go-e 25
Studie zum E-Kaufverhalten
Fuhrparkverband Austria 26 Neue Fuhrparkleiter für Österreich
Fuhrparkmanagement
Dekra Ö-GF Helmut Geil im Gespräch Dekra-Schadendialog 31
Elektroautos im Fokus Fuhrpark-Porträt
Arval-Fuhrparkbarometer 35 Themen, die Fuhrparks bewegen
Teil 4
Ladelösungen
Zeichen auf Wachstum
Fahrzeugeinrichtung für E-Nfz




Mercedes eSprinter 43
Jetzt mit drei Akkuvarianten
Ford Pro 44
Alle Antriebe, eine Softwareplattform
Stellantis 46
Alle Modelle, viele Neuheiten
Toyota Proace Max Elektro 48
4,25 Tonnen mit B-Führerschein
Auto-News 49
Wichtige Neuerscheinungen
Schon gefahren
Renault 4 E-Tech Electric 50
Gelungene Neuauflage unter Strom
Audi A6 Avant 51
Business-Klasse neu interpretiert
Alfa Romeo Junior Q4 52
Schick, sparsam und Gatsch-tauglich
BYD Dolphin Surf 53
Kleiner Stromer, kleiner Preis
Jeep Avenger Allrad 54
Behände ins Gelände
Subaru Forester 55
Aufgefrischter Nippon-Klassiker
Peugeot E-3008 56
Das kann das BEV-Kompakt-SUV
Mitsubishi Outlander PHEV 57
Rückkehr des großen Japaners
Im Test
BMW i4 58
Stromlinie im doppelten Sinn
Mazda CX-80 59
Topmodell mit Sechszylinder-Diesel
Volvo EC40 60
Mit E-Motor zur Höchstform
Mini Aceman 61
Elektro-Crossover mit Sportler-Genen Dauertest-Zwischenbericht 62
So schlägt sich der BYD Sealion 7
Alpine A290 63
Die erste Elektro-Alpine
Porsche Taycan 64
Upgedatete Variante im Test
Freizeit-News 65
Was sonst noch wichtig ist
Camper-Vergleichstest 66
Ausflug mit drei Campingmobilen
Rückblick 72
75 Jahre VW Bulli
Kreuzworträtsel, aus der Redaktion und Impressum 74

Camping-Trio Rollende Bettenlager
Wasserstoff galt lange Zeit als vielversprechendste Alternative zu bereits etablierten alternativen Kraftstoffen. Gleichwohl fehlt es seit Jahren am entscheidenden Durchbruch. Wir klären den Stand der Dinge. Und zeigen die derzeitigen Probleme.
Text: Roland Scharf/Stefan Schmudermaier, Fotos: Toyota, Hyundai, stock.adobe.com/POLEX, Vector FX
Es gibt da einen alten Spruch in der Geschäftswelt: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr. Was derlei Erkenntnisse mit der Autowelt gemeinsam haben: Erdgas sagte man auch riesiges Potenzial voraus und obwohl die Industrie locker 20 Jahre mit immer neuen Modellen und blumigen Versprechungen versuchte, CNG zu etablieren, so endete dieser alternative Sprit im goldenen Buch der Erinnerungen. Und weil sich Geschichte wiederholt, sei die Frage erlaubt, ob Wasserstoff das gleiche Schicksal droht? Es ist nämlich so, dass sich an den grundsätzlichen Ideen und Ankündigungen in den letzten Jahre nichts in reale Konzepte gewandelt hat. Einzig, dass die OMV im April 2025 beschlossen hat, ihre fünf –und damit alle – H2-Tankstellen in Österreich nach wenigen Jahren wieder zu schließen und damit eine komplette Technologie an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds zu stellen, wirft ein neues Licht auf eine Technologie, deren Vorzüge wohl schwerer in die Tat umzusetzen sind, als es sich manch Politiker vorstellen könnte.

Es lag wohl auch am Henne-Ei-Prinzip, dass H2-Mobile einfach nicht in Schwung kommen wollten. Anders als bei BEV, bei denen man sich im Notfall mit einem Starkstromkabel behelfen konnte, benötigen Wasserstofffahrzeuge spezielle Tankstellen mit speziellen Tanks, in denen Wasserstoff lagert. Der muss erst einmal mit speziellen Tank-Lkw dorthin gebracht werden und dann benötigt es eine spezielle Mehrkolbenpumpe, um ein H2-Auto zu betanken, was an sich schon einmal eine Menge Energie verschlingt. Dazu kommt der relativ schlechte Wirkungsgrad der Brennstoffzelle von rund 70 Prozent, sodass das Kaufverhalten der angepeilten Klientel noch verhaltener war als angenommen. Dazu war die Auswahl an Modellen eher überschaubar. Toyota und Hyundai boten vereinzelt Fahrzeuge an, die an sich tadellos funktionier(t)en, aber aktuell schlicht öffentlich nicht mehr betankt werden können. In Wien gibt es immerhin die Möglichkeit, solch ein Fahrzeug direkt bei der Wien Energie mit Wasserstoff zu versorgen.
Von der Energiebilanz hat aus Erdgas gewonnener blauer Wasserstoff keine Chance.“
Wir blicken zurück: Es ist schon mehr als ein Jahrzehnt her, dass das Rennen um den Antrieb der Zukunft noch nicht so klar war wie heute. Elektro war in der Anfangsphase. Wasserstoff eine Idee, die typischen StromerSchwachpunkte einfach zu umgehen. H2 lässt sich leicht speichern, ein entsprechendes Auto ruckzuck betanken und die Reichweiten sind mit denen eines Benziners zu vergleichen. Es gab Ideen zu einem Tankstellennetz quer durch Europa entlang der Hauptrouten, sodass eine Durchquerung des Kontinents problemlos möglich sein soll. Vereinzelt setzten Hersteller konsequent auf diese Antriebsart und entwickelten sogar Serienautos, die allesamt tiefgekühlten, gasförmigen Wasserstoff in einem unter Hochdruck stehenden Tank mit einer Brennstoffzelle kombinierten, die H2 und Umgebungsluft in Wasser und elektrische Energie umwandelt, mit der ein kleiner Akku gespeist und in weiterer Folge ein Elektromotor angetrieben wird. Die andere Form des Vortriebs, Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor anstelle von Benzin zu zünden, lebt vorerst nur in den Entwicklungsabteilungen. Als dann auch noch in Österreich reguläre H2-Zapfsäulen in Betrieb gingen, schien das Match mit den BEV noch ziemlich offen.
Um die grundsätzliche Problematik vollständig zu erfassen, muss man noch einen Schritt zurück in der Produktion gehen. Wo Wasserstoff eigentlich herkommt. Damit das Konzept aufgeht, muss H2 natürlich „grün“ hergestellt werden. Für diese Elektrolyse benötigt es große Mengen an Energie, die mit Windrädern oder Wasserkraft bei uns aber nicht produziert werden können. Für Thiebault Paquet, Toyotas Wasserstoff-Chef in Europa, müsse grünes H2 also immer importiert werden, was natürlich erst wieder riesige spezielle Hochseetanker benötigt. Der sogenannte blaue Wasserstoff, der in der alten Welt hergestellt werden kann, ist technisch gesehen zwar genauso gut, er wird indes mittels Dampfreformierung aus Erdgas gewonnen, was von der Gesamtenergiebilanz also keine Chance hat. So gesehen ist es mehr als verständlich, dass sich kaum jemand auf dieses Thema einlassen wollte. Und strenggenommen dürfte es gar keinen großen Aufschrei geben, denn auch EU-intern war die geplante Vorgehensweise umstritten.
So legte der EU-Rechnungshof im Sommer 2024 einen Bericht vor, wonach die Europäische Union bei der Produktion grünen Wasserstoffs bislang „nur bescheidene Erfolge“ erzielt habe. Die vorgesehenen Werte für Import und Produktion bis 2030 (jeweils zehn Millionen Tonnen) seien zu ehrgeizig gewesen, wobei kritisiert werde, dass es entlang der Wertschöpfungskette noch Probleme gebe. Das könnte zu einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit in Schlüsselindustrien führen, stand in dem Bericht, genauso wie die Aufforderung an die Kommission, die Wasserstoffstrategie dringendst zu aktualisieren. Pikant: Der Rechnungshof meint, die angegebenen Ziele hätten auf politischem Willen und nicht auf soliden Analysen beruht. Zudem wird davon ausgegangen, dass bis 2030 generell nicht einmal zehn Millionen Tonnen H2 überhaupt von der Industrie gefordert werden.
Natürlich gibt es Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel das Engagement von Porsche in den Hochebenen von Chile, wo wirklich genug Wind vorhanden ist, um zahlreiche Windräder nur für den Zweck zu betreiben, Wasser in H2 und O zu spalten. Erst im April 2025 gab es ein Abkommen zwischen der EU und Chile, das die Finanzierung gleich mehrerer solcher Anlagen mit 216,5 Millionen Euro fördern soll. Ziel der Aktion: Dekarbonisierung der chilenischen Wirtschaft und Geschäftsmöglichkeiten für heimische und europäische Unternehmen. Klingt super. Unumstritten ist dieses Vorgehen aber nicht. Umweltschützer kritisieren etwa, dass allein in der Region Magallanes, dem südlichsten Teil des Landes, 13 Prozent des weltweiten Bedarfs an grünem Wasserstoff produziert werden sollen. Das entspräche rund 126 Gigawatt an benötigter Windkraft, was gut die doppelte Menge an Energie ist, die derzeit in ganz Deutschland aus Windkraft gewonnen wird. Kritisiert wird, dass durch die Vielzahl an Windrädern zahlreiche Vogelarten gefährdet werden, zumal die Mehrheit des produzierten H2 exportiert wird und vor allem private Investoren profitieren, kaum aber die heimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite betont die chilenische Umweltministerin Maisa Rojas, dass Umweltschutz eine Bedingung für die Entwicklung sei. Und trotzdem möchte man am Ziel festhalten, 2030 den billigsten Wasserstoff der Welt zu produzieren. Ein großes Vorhaben, konkurriert man hier schließlich nicht nur mit China, sondern auch mit Saudi-Arabien, die mit H2 den Ausstieg aus dem Erdölgeschäft schaffen wollen. Fakt ist: Grüner Wasserstoff wird benötigt, wenn auch nur für die Industrie. Denn in vielen Bereichen des Verkehrs ist man schon länger auf einem Scheideweg. Das Argument mancher Autohersteller, mit aus grünem Überschussstrom erzeugtem Wasserstoff ja Pkw betreiben zu können, greift zu kurz, solang die Industrie nicht genügend davon hat. Denn dort kann man bei vielen Anwendungen nicht auf Strom zurückgreifen, beim Auto aber sehr wohl.


Für Pkw ist das H2-Konzept zu komplex, die Infrastruktur zu aufwändig. Im Gegensatz zu Lkw. Nach wie vor ein Problem: Grüner Wasserstoff muss importiert werden


Je kleiner das Fahrzeug, desto mehr hat sich in den letzten Jahren die batterieelektrische Variante als bevorzugte Alternative durchgesetzt. Hierbei geht es aber nicht nur um die leichtere Verfügbarkeit grünen Stroms im eigenen Land. Das gesamte Handling mit Wallboxen, Schnellladern und zahlreichen Modellen am Markt ergibt eine praktischere und simplere Lösung. Und auch wenn man sich den News-Stand der Hersteller zum Thema H2 ansieht, so gibt es auf den jeweiligen Webseiten deutlich weniger Neuigkeiten über Wasserstoff-Pkw. Ähnlich sieht es in Österreich mit der Verfügbarkeit aus: Hyundai bietet den Nexus nur Firmenkunden an, die „direkt oder indirekt Bezug zum Thema Wasserstoff haben.“ Ganz im Gegensatz zu Toyota, die den Mirai der zweiten Generation ab 50.000 Euro netto normal zum Kauf feilbieten. Cédric Borremans, Geschäftsführer von Toyota Austria, glaubt weiter an Wasserstofffahrzeuge: „Hybrid-Modelle haben sich auch nicht von heute auf morgen durchgesetzt, sind jetzt aber voll etabliert. Wasserstoff ist vor allem für Lkw oder auch Boote und stationäre Generatoren ein Thema, aber auch für größere Pkw. Und es geht auch nicht um ein Match zwischen Batterie und Wasserstoff, wir benötigen beide Technologien im Kampf gegen

CO2.“ Borremans sagt aber auch dazu, dass all das in absehbarer Zeit kein Thema für Flotten sei. Die Ziele von Toyota betreffend liege man zwar in Europa hinter den Erwartungen, in China, Japan und Südkorea sehe die Sache aber schon anders aus. BMW hat das Interesse am Wasserstoff auch noch nicht aufgegeben, Prototypen eines H2-betriebenen X5 sind seit einiger Zeit unterwegs, 2028 soll das Serienmodell kommen; übrigens mit der Brennstoffzellentechnik von Toyota unter der Haube.
Geht es an den Schwer- und Fernverkehr, ist die Sachlage eine völlig andere. Hier ist eine große Reichweite genauso entscheidend wie schnelles Nachtanken unterwegs. Lange Standzeiten, um riesige Akkus zu befüllen, die zudem die Nutzlast empfindlich einschränken, kann sich kein Spediteur leisten, sodass hier verstärkt interessante Varianten zu finden sind. Hyundai zum Beispiel forciert den XCIENT, ein Lkw mit 180-kW-Brennstoffzelle, der einen 350 kW starken E-Motor antreibt. Für Roland Punzengruber, Managing Director bei Hyundai Österreich, sind gewisse Anwendungsfelder im Nutzfahrzeugbereich prädestiniert für den Wasserstoff-Antrieb: „Der erste XCIENT ist in Österreich bereits ausgeliefert. Der Hochlauf gestaltet sich wegen nicht existenter, flächendeckender, öffentlicher Tankinfrastruktur als sehr schwierig. Interesse für das Produkt ist jedoch absolut vorhanden, die TCO unter Berücksichtigung der THG-Möglichkeiten in Abhängigkeit der Laufleistung mit BEV und Diesel weitestgehend vergleichbar.“ So reichen die 31 Kilogramm Speichervermögen für 400 Kilometer, die vollständige Befüllung soll in acht bis 20 Minuten abgeschlossen sein. Die Frage ist nur: Wo? Für Punzengruber ist die Schließung der OMV-Tanksäulen kein echtes Problem: „Nein, das hat keinen Einfluss auf die H2-Strategie von Hyundai in Österreich, da erstens die Tankinfrastruktur für Nutzfahrzeuge nicht nutzbar ist, zweitens im Rahmen der ASFIRRegelung bis 2030 linear zehn Tankstellen regierungsseitig in Österreich errichtet werden müssen und drittens wir fest der Meinung sind, dass relevante Stakeholder der H2-Technologie in Österreich kurzfristig die OMV-Betankungsmöglichkeiten auffangen werden.“ BMW – eigentlich nicht im Nutzfahrzeugbereich vertreten –macht mit Iveco gemeinsame Sache, um die eigene Werkslogistik mit Wasserstoff aufzurüsten. So beginnt im Werk Leipzig ein Pilotprojekt mit zwei Sattelschleppern und mehr noch: Auch intern setzt man bei BMW auf Wasserstoff. So wurden mittlerweile fünf Indoor-Wasserstofftankstellen errichtet, mit denen zum Beispiel
Im Rahmen der ASFIR-Regelung müssen bis 2030 linear zehn Tankstellen in Österreich errichtet werden.“
Toyota sieht die Lösung in einem H2-Ökosystem, wo Produktion, Speicherung und Verwendung Hand in Hand gehen
Gabelstapler und Routenzüge versorgt werden. Liegt die Zukunft des grünen H2 also genau hier, einem schlauen Gesamtkonzept, in dem der Nutzer auch Teile der Infrastruktur betreibt? Auch Toyota bejaht das aktuell vorsichtig und verweist zum Beispiel auf eine Taxiflotte in Paris mit 1.000 Mirai, die an betriebseigenen Tankstellen tanken.


Zum Thema Lkw zählen im erweiterten Umfang auch Busse. Elvira Lutter von Verein Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion
Austria Power & Gas sprach im Zuge der Fachveranstaltung ELMotion davon, sich mit regionaler Produktion und Technik aus der EU gegen chinesische Batterietechnik in Stellung zu bringen. So würden die Wiener Linien auf Wasserstoff setzen, das Potenzial in Österreich sei entsprechend groß. Der Einwand aus dem Publikum seitens eines ÖPNV-Vertreters folgte aber prompt. So seien die für die Herstellung von Wasserstoff nötigen Elektrolyseure nicht wirtschaftlich, zudem könnte man die Anforderungen in Wien nicht mit dem Rest von Österreich vergleichen. Denn da sei der batterieelektrische Bus in allen Belangen die bessere Wahl.
Für Toyota ein riesiges Anliegen, an dem nicht nur eifrig geforscht und entwickelt wird. Die eigenen Brennstoffzellen sollen zudem an externe Kunden verkauft werden und für die nächste Generation plane man schon eine Kostenreduzierung von 37 Prozent. Auch hier zielt man auf Nutzfahrzeuge ab und genau dafür hat man für 2026 eine Zelle angekündigt, die haltbarer und günstiger sein soll als vergleichbare Dieselmotoren. Dazu passend werden standardisierte Tanks angeboten und auch zum Thema Elektrolyse gibt es was im Angebot. Cool hierbei ein Projekt in Thailand, das mit Biogas – gewonnen aus Hühnermist und Essensresten – H2 erzeugt. Aber Österreich? Bei Pkw sieht es vorerst mau aus. Wir haben bei Toyota angefragt, wie es mit den Mirai-Fahrern nun weitergeht: „Wir sind uns bewusst, dass bestimmte Mirai-Kunden in Österreich aufgrund der künftigen Schließungen von Wasserstofftankstellen möglicherweise Probleme beim Betanken haben. Allerdings wird es vermutlich alternative Betankungsmöglichkeiten für Kunden geben.“ Konkreter wurde man beim Thema Nutzfahrzeuge und brachte ein Beispiel aus Frankreich vor, wie ein derartiges Ökosystem funktionieren kann: „Ein gutes Beispiel für einen Öko-Cluster ist HySetCo (französisches Start-up; Toyota ist einer seiner Anteilseigner). HySetCo betreibt mehr als 500 Wasserstofffahrzeuge und bietet Miet- und alle damit verbundenen Dienstleistungen an. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von acht Wasserstofftankstellen in der Region Île-de-France, die monatlich mehr als 30 Tonnen Wasserstoff liefern.“ •



Besuchen Sie uns auf der Fleet Convention! 24. 6. 2025
Hofburg Wien



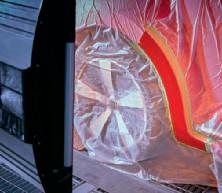
ARN-Partnerbetriebe in ganz Österreich sind Profis für die Reparatur von Karosserie-, Lack- und Glasschäden und bieten umfassenden Service für Ihren Fuhrpark.



Gratis App downloaden! Unser spezielles Service für Sie: Die KOSTENLOSE Unfallreparatur-App hilft Ihnen bei Unfall oder Blechschaden schnell und effizient weiter –Schritt für Schritt. 24/7-Unfall-Hotline: 0800/20 14 20 Auch

Mitten in Wien ein Auto kaufen? Das ist ab sofort möglich –aber nicht das primäre Ziel in der neuen „Cupra City Garage“.
Wayne Griffiths hatte schon vor einigen Jahren, als er die junge Marke Cupra installierte, das Ziel vorgegeben: Auch Wien braucht eine „City Garage“. Also machte sich das Team des Importeurs auf die Suche – und fand die Räumlichkeiten in der Maysedergasse 4, in der belebten Gegend zwischen Staatsoper und Albertina. Doch was ist eine „City Garage“? Mittendrin steht (zumindest) ein Auto, natürlich ein Cupra, rundherum sind Loungesessel und Tische. Angeboten werden spanische Spezialitäten (no na) und solche aus Wien und Umgebung.


Wer will, kann gemeinsam mit dem „Cupra Master“ (so heißen bei der spanischen Marke die Verkäufer) sein neues Auto konfigurieren; drei davon stehen in der nahen Garage am Neuen Markt für Probefahrten bereit. Doch das ist nicht das primäre Ziel. „Wir wollen da sein, wo auch unsere potenziellen Kunden sind“, hieß es bei der Eröffnung am 15. Mai. Sie sollen die eine oder andere Stunde im Lokal verbringen, in cooler Atmosphäre, bei guter Musik. Auch in anderen Städten – von Barcelona über Sydney und Berlin bis nach Mailand – gibt es solche Locations: Jede ist anders, jede ist den Örtlichkeiten angepasst. Doch gechillt sind sie alle, das gibt der Hersteller vor. Wien hat nun die 11. „Cupra City Garage“, Manchester wird Mitte Juni das Dutzend voll machen. Mit Ferdinand Querfeld steigt ein Vollprofi und gleichzeitig der Nachbar von via-à-vis (das „Crossfield’s“ und das „Café Mozart“) ein: Er war mit seiner Frau in Barcelona und hat sich durch das Tapas-Angebot gekostet. Das Ergebnis gibt’s ab sofort, Anfang Juli startet auch die Bar und macht in der „City Garage“ die Nacht zum Tag.

Škoda bringt den Octavia Combi neu mit 204-PS-TSI, 7-Gang-DSG sowie Allradantrieb nach Österreich und die erste Auslieferung erfolgt gleich an die ICE Hockey League, konkret an das Schiedsrichterteam – was für eine Kombination. Im Grunddurchgang der 25. Jubiläumssaison gewann der EC-KAC, um sich gemeinsam mit dem EC Red Bull Salzburg das Ticket für die Champions Hockey League 2024/25 zu sichern. Die jahrzehntelange Partnerschaft mit dem Eishockey-Sport bringt auch für die Fans Vorteile: Für ein Spiel der Wahl wurde vorab eine VIP-Erfahrung verlost, in die Eisarena Salzburg wurde die Gewinnerin samt Begleitung mit einem Škoda Kodiaq Sportline 4x4 chauffiert. Auch international ist man mit dem Sport verwoben, die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft wird zum 31. Mal in Folge unterstützt – Weltrekord für das längste Hauptsponsoring!
30 Jahre Erfahrung in den verschiedensten Führungspositionen in der automotiven Branche, so konnte Robert Dörr ein solides Netzwerk über ganz Österreich sowie international aufbauen. Nun ist der erfahrene Manager bei ChipsAway, seit 1. Mai 2025 in der Funktion des Chief Operating Officer (COO). Bei der österreichweit agierenden Kfz-Werkstattkette gehört auch die weitere Implementierung der prozessorientierten Standardisierung sowie das strategische Management zu seinen Aufgaben neben der operativen Leitung aller Standorte. „Ich freue mich über meine Rückkehr in die automotive Branche und Teil des Erfolgskurses von ChipsAway sein zu dürfen“, so Dörr, der davor bei einem Sanierungsspezialisten tätig war. „Nachhaltige und ressourcenschonende Instandsetzungsmethoden, Innovation, Nachwuchs und damit verbundene Aus-, Fort- und Weiterbildung stehen dabei im Fokus, um das Angebot ChipsAways noch weiter auszubauen – alles zur Zufriedenheit unserer Kun dinnen und Kunden!“ Clemens Ayasch, Managing Director ChipsAway, freut sich über den „wahren Profi und Kenner“ der KfzBranche.

Die erste Maybach Lounge des Landes hat eröffnet. Auf 120 Quadratmetern kann die Kundschaft in der Donaustadtstraße 51 in 1220 Wien nicht zuletzt das neueste Modell bestaunen: den Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series in einer der frischen Zweifarbenlackierungen. Niels Kowollik, CEO und Managing Director Mercedes-Benz Österreich Cars, spricht bei den Exponaten nicht von Fahrzeugen, „sondern über Meisterwerke, geschaffen für jene, die das Außergewöhnliche suchen.“

Mit dem 1. Juni 2025 hat die Hans Leeb GmbH den Vertrieb von Motorrädern der Marke CFMoto in Deutschland und Österreich übernommen. Bereits 2024 ging das ATV-Geschäft nach Wolfsberg und konnte sofort stark gesteigert werden. Punkto Händlernetzt plant man eine Ausweitung auf 150 Fachhandelspartner. Gemeinsame Stärken sollen ab 2026 in einem Joint Venture gebündelt werden.




Speziell umgebaute Hybrid-Fahrzeuge von Suzuki ermöglichen Kindern, im Rahmen der Aktion „Hallo Auto“ eigene Bremserfahrungen in einem Pkw zu machen. So können sie die Formel „Reaktionsweg plus Bremsweg ist Anhalteweg“ verinnerlichen. Partner der Aktion sind neben Suzuki Austria der ÖAMTC (Übergabe beim Mobilitätsclub in Wien) und die AUVA.

Sei nicht kopflos!
Mit einer Roadshow gegen „Kopflose“ touren KFV und AUVA durch Österreich. Auch mit Kino-Spots etc. soll darauf hingewiesen werden, wie schnell etwas passieren kann. Bei einer Ablenkung von etwa zwei Sekunden und einer konstanten Geschwindigkeit von 50 km/h werden pro Stunde rund 3.369 Kilometer „im Blindflug“ in Österreich zurückgelegt. Zugrunde liegt hier der Durchschnitt von 120.330 Nachrichten, die pro Stunde aus fahrenden Autos geschrieben werden.
804.500
Verletzte mit Spitalsbehandlung verzeichnete die Unfallbilanz 2024. Das ist ein Anstieg auf 3 Prozent. Inkludiert sind hier die 92.100 Verletzten aus dem Verkehrssektor.
Bim, oida!
Wie nimmt ein Straßenbahnfahrer seine Umgebung wahr, wie verhält sich der Bremsweg einer Bim mit teils 65 Tonnen Gewicht? Aus erster Hand eigneten sich 37 angehende Fahrlehrer aus mehreren Wiener Fahrschulen dieses Wissen an, um es ihren Fahrschülern besser vermitteln zu können. Die Wiener Linien ermöglichten diese Weiterbildung für mehr Verkehrssicherheit.


In den letzten zehn Jahren hat sich die FLEET Convention zur wichtigsten Veranstaltung rund ums Firmenauto in Österreich etabliert, wir blicken zurück.
Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Chris Hofer, Manfred
Seidl, Michi Hetzmannseder
Aller Anfang ist bekanntlich schwer, rückblickend betrachtet war die Entscheidung, eine Veranstaltung für Fuhrparkbetreiber und die zugehörige Branche auf die Beine zu stellen, aber goldrichtig. Es gab zwar auch schon vor zehn Jahren das ein oder andere Event, zumeist aber im Stil eines Seminars und ohne eine entsprechende Ausstellung. Die Vorbereitungen zu 1. FLEET Convention im Jahr 2015 begannen über ein Jahr davor, wir wurden dabei tatkräftig von echten Branchenkennern wie Henning Heise, Nikolaus Engleitner (beide damals heise fleetconsulting) und Christian Rötzer (TÜV) unterstützt. Unser erster Vortragsraum war im Forum, in dem nun seit mehreren Jahren Porsche Austria mit allen Marken vertreten ist. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, haben wir einen zweiten Raum samt Video-Liveschaltung angemietet.
Stetiges Wachstum
450 Teilnehmer und 37 Aussteller gaben sich bei der Premiere ein Stelldichein und schnell war klar, die FLEET Convention ist ein Format mit Potenzial. Bereits im Jahr darauf wanderte der Vortragssaal in den ersten Stock, zwei weitere Jahre später waren wir dann im Großen
Festsaal, der größten Räumlichkeit in der Wiener Hofburg, angelangt. Die Veranstaltung ist sowohl besucher- als auch ausstellerseitig gewachsen, 2023 und 2024 wurde die Hürde der 800 Teilnehmer geknackt. 2020 mussten wir die „FLEET“ pandemiebedingt schweren Herzens absagen, 2021 waren nicht mehr als 500 Teilnehmer in der Hofburg zugelassen. Aber auch die Aussteller zeigen sich zufrieden, heuer haben wir hier mit 65 Partnern einen neuen Rekord zu verzeichnen und decken das gesamte Themenspektrum vom Fahrzeug über Ladeinfrastruktur, Finanzierung, Vermarktung bis hin zu Telematik und mehr ab.
Unabhängiges Bühnenprogramm
Von der ersten Veranstaltung an war es uns wichtig, den Besuchern ein unabhängiges Vortragsprogramm zu bieten, auch wenn es nicht immer leicht war, dem Drängen so mancher Aussteller nachzugeben. Die Besucherbefragungen geben uns jedenfalls recht, auf unabhängige Experten zu setzen, das Feedback ist jedes Jahr aufs Neue erfreulich. Unabhängigkeit haben wir uns aber auch mit der seit 2023 jährlich durchgeführten Fuhrpark-Studie und dem BEST4FLEETAward auf die Fahnen geheftet. Bei uns wählen die Fuhrparkverantwort-

Im Laufe der Jahre hat sich die FLEET Convention in der Hofburg hochgearbeitet, fanden die Vorträge im ersten Jahr noch im Forum (Bild oben) statt, sind wir mittlerweile im Großen Festsaal angelangt



Zu den Fixpunkten der FLEET Convention zählen die Vorträge von Marc Odinius – keiner kann trockene Zahlen so spannend präsentieren wie der Dataforce-Chef – aber auch Podiumsdiskussionen und Moderator Christian Clerici dürfen nicht fehlen
lichen die Image-Sieger, nicht unsere Marketingabteilung. Gewährleistet wird das durch die Auslagerung von Studie und Award in die Hände der puls Marktforschung.
Maßgeblich zum Gelingen der FLEET Convention haben aber vor allem die Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter sowie die Partnerinnen und Partner in der Begleitausstellung, danke für die Treue! •
Wenn Flotte, dann richtig. Dacia bietet eine vielseitige Modellpalette, die ideal auf die Bedürfnisse von Firmenkunden abgestimmt ist. Vom kompakten, vollelektrischen Dacia Spring bis hin zum neuen Flaggschiff Bigster – alle Modelle bieten eine ideale Kombination aus Effizienz, Zuverlässigkeit und kostengünstigen Betriebskosten. Was ist Ihnen bei der Wahl der Flotte wichtig?
Der Dacia Spring Electric ist perfekt für städtische Einsätze. Mit einer Reichweite bis zu 225 km ist er ideal für kurze Strecken, wie sie in städtischen Gebieten oder bei mobilen Hilfsdiensten anfallen. Der Spring vereint Wirtschaftlichkeit mit lokal emissionsfreier Fahrt. Dank der kompakten Größe lässt er sich mühelos manövrieren und in engen Bereichen parken.
Der Dacia Sandero überzeugt Unternehmen mit hoher Effizienz, solider Ausstattung und geringen Betriebskosten. Ob im Außendienst oder im täglichen Stadtverkehr – er bietet zuverlässige Mobilität zu einem unschlagbaren Preis-LeistungsVerhältnis.

Wahl für Unternehmen, die ein solides Fahrzeug für unterschiedliche Anforderungen benötigen.


Der Dacia Spring Electric bietet kompakte Abmessungen und äußerst niedrige Unterhaltskosten, der Duster ist als Fiskal-Lkw vorsteuerabzugsfähig
Für Flottenkunden, die mehr Platz benötigen, bietet der Dacia Jogger flexible Lösungen. Mit bis zu sieben Sitzplätzen ist er die ideale Wahl für den Transport von Passagieren oder Gepäck. Ob als Taxi oder als Shuttle, mit Benzin- oder HybridAntrieb kombiniert der Jogger das Beste aus Van und SUV und bietet Unternehmen eine smarte und kostengünstige Option.
Der Dacia Duster ist der robuste Allrounder für anspruchsvolle Einsätze. Mit Allradantrieb und als Fiskal-Umbau erhältlich ist der Duster perfekt für die Arbeit auf Baustellen oder im Gelände. Seine Vielseitigkeit und das hervorragende PreisLeistungs-Verhältnis machen ihn zu einer ausgezeichneten
Der Dacia Bigster rundet das Portfolio nach oben ab. Mit seinem neuen Hybridantrieb und moderner Ausstattung, wie zum Beispiel der elektrischen Heckklappe oder dem Panorama-Glasdach, bietet der Bigster eine hervorragende Lösung für größere Flotten, die auf eine nachhaltige und komfortable Fortbewegung setzen. Der großzügige Innenraum und die ausdrucksstarke Silhouette machen ihn zur perfekten Wahl für Unternehmen, die ein leistungsstarkes SUV mit niedrigen Betriebskosten suchen.
Dacia bietet mit dieser Modellpalette eine exzellente Auswahl für Flottenkunden, die hohe Ansprüche an Wirtschaftlichkeit, Kostentransparenz und Flexibilität stellen. Mit attraktiven B2BAngeboten stellt Dacia sicher, dass Unternehmen nicht nur auf hervorragende Fahrzeuge, sondern auch auf ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis setzen können. Maßgeschneiderte Paketangebote – die Wartung und Verschleißteile inkludieren –erlauben eine genaue Kalkulation Ihrer Fuhrparkkosten. •
Weitere Details und Angebote zu allen DaciaModellen finden Sie auf unserer Business-Website www.dacia.at/unsere-angebote-geschaeftskunden
Im Toyota-Kosmos tummeln sich neue Modelle: Erstmals der Welt zeigen sich Toyota RAV4 HEV und PHEV sowie bZ4X
Touring BEV. Ihr Europa-Debüt geben Toyota Corolla Cross HEV und Lexus ES BEV/HEV.
Text: Petra Mühr, Fotos: Toyota, Lexus
Viele Wege führen nicht nur nach Rom, sondern auch zu Toyota. Im Sinne des „Multi-Pathway Approach“ hat die Toyota Motor Corporation in Brüssel zwei Welt- und zwei Europapremieren gleichzeitig gefeiert: Global voran der Toyota RAV4 HEV und PHEV sowie der bZ4X Touring BEV, ihr europäisches Debüt gaben Toyota Corolla Cross HEV und Lexus ES. „Wir haben im Verbund insgesamt etwa 100 Produkte. Für jedes Segment und für jede Region eine dezidierte Lösung, das ist ein bisschen auch die Philosophie von Toyota“, so André Schmidt, Head of Lexus Europe, „deswegen entwickeln wir auch unterschiedliche Batteriepfade, da gibt’s nicht nur eine Lösung.“ Aktuell setzt sich der Antriebsmix zusammen aus 37 Prozent Hybrid, 27,7 Prozent Benzin, 17,1 Prozent rein batterie-elektrisch, 8,4 Prozent Plug-in-Hybrid, 7,4 Prozent Diesel und 2,4 Prozent andere.
Den Flottenkunden freut’s demzufolge auf vielen Ebenen: Nicht nur jeder Antrieb, auch jedes Fahrzeug ist vom Mobilitätsanbieter zu haben. „Wir können also alles aus einer Hand anbieten“, unterstreicht Schmidt. „Möchte der Kunde beispielsweise drei Transporter, fünf funktionale Fahrzeuge und ein bis zwei Premiumfahrzeuge für die Geschäftsleitung, das haben wir. Finanzdienstleistung und Versicherung natürlich auch, wir bieten eine
gesamtheitliche Mobilitätslösung an. Das ist unsere Strategie.“
Die Ikone, der Toyota RAV4, punktet im Jahrgang 2026 mit 100 Kilometer Reichweite als Plug-in-Hybrid, mehr Batteriekapazität, schnellerem Laden und einem neuen wassergekühlten Wärmemanagementsystem. Er ist als HEV und PHEV sowohl mit Frontals auch Allradantrieb erhältlich (im ersten Quartal 2026).
Deutlich robuster und geräumiger als der Bz4x präsentiert sich der Bz4x Touring: Etwa 33 Prozent mehr Platz, mit 75-kWh-Batterie bis zu 560 Kilometer Reichweite (WLTP) und der 10-Jahres-Garantie für die Batterie. (Einführung in Europa: erste Jahreshälfte 2026).
Das neue Modelljahr des Corolla Cross verschreibt sich dem Fahrspaß: Erstmals ist er auch als GR-SportModell verfügbar. Der Lexus ES bietet alle Vorteile einer herkömmlichen Premium-Limousine. Zwei Antriebe ES 350e mit Frontantrieb und 165 kW/224 PS sowie ES 500e mit Allradantrieb und 252 kW/343 PS, bis zu 530 Kilometer Reichweite und ein sehr reduziert-minimalistischer und dennoch edler Innenraum mit Ottoman-Sitzen im Fond sorgen für entspanntes Reisen aller Insassen. •



Weltweit über 15 Millionen, europaweit mehr als 2,5 Millionen RAV4 wurden bislang verkauft; das neue als Plug-in- und Vollhybrid erhältliche Modell wird die Erfolgsstory fortsetzen
Der vielseitige bZ4X Touring fährt mit Frontund Allradantrieb, in zwei Leistungsstufen und bis zu 560 km weit


Der neue Jahrgang des Corolla Cross ist erstmals auch als GR-SportModell erhältlich; „Snow Extra“Modus in dieser Version mit intelligentem Allradantrieb inklusive




Der Fokus beim neuen Lexus ES liegt designtechnisch auf Klarheit und Eleganz; die elegante Strom-Limousine fährt entweder mit Vollhybrid- oder mit vollelektrischem Antrieb


Seit mehr als zehn Jahren betreibt die EVN mit über 3.300 eigenen Ladepunkten das größte Ladenetz in Österreich. Mit erfolgreichen Kooperationen, darunter Hofer, Spar, ASFINAG und XXXLutz, erweitert sich das Ladenetz kontinuierlich.
Seit Anfang April 2025 präsentiert sich die EVN E-Mobilität mit einem neuen Auftritt und den neuen Slogans #lovetodrive für die EVN Ladekarte und #lovetocharge für EVN Ladestationen. Mit drei neuen Ladetarifen werden die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer optimal abgedeckt:
#Drive Easy
Optimal für alle, die bevorzugt an EVN Ladestationen laden möchten. Dieser Tarif kommt ohne Grundgebühr und Bindung aus und bietet einen einheitlichen Ladepreis für alle EVN Ladestationen – ganz ohne Unterscheidung zwischen AC/DC- oder HPCLaden.
#Drive Smart
Ideal für alle Vielfahrerinnen und Vielfahrer, die auch außerhalb Österreichs unterwegs sind und von besonders günstigen Ladepreisen profitieren wollen. Neben dem EVN Ladenetz können E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer auf das umfangreiche Partnerladenetz zugreifen, das 90 Prozent aller öffentlichen Ladepunkte in Österreich und darüber hinaus mehrere tausend Ladepunkte im europäischen Ausland abdeckt.
#Drive Business
Der Ladetarif für Ihre Flotte. Auf einer einzigen Ladekarte haben Sie alle wichtigen Flottenfeatures wie Fahrzeugservices an UTAAkzeptanzstellen, Premiumreporting und vergünstigtes Laden je nach Absatzmenge vereint. So behalten Flotten-Managerinnen und -Manager stets den Überblick.
Und das Beste daran: Bei allen drei Ladetarifen entfällt während des Ladens an EVN Ladestationen die Standgebühr. Zudem profitieren Ladekarten-Kundinnen und -Kunden von einer Preisgarantie bis Ende 2025 und von einer Bindungsfreiheit.
Sie möchten mehr über die umfangreichen E-Mobilitätslösungen der EVN erfahren? Dann besuchen Sie das E-Mobilitätsteam der EVN am 24. Juni bei der Fleet Convention in der Hofburg und erfahren mehr über die neuen Tarife und die vielfältigen Vorteile. Lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten direkt am Stand beraten und entdecken Sie die Zukunft der Elektromobilität!
Nähere Informationen zu den Ladetarifen finden Sie auf www.evn.at/ladekarte-business Unter evn.at/flotte finden Sie Ihre persönliche Kontaktperson.

#Drive Business
Keine Bindung
Keine Standgebühren beim Laden*
Preisgarantie bis 31.12.2025
Treuevorteil je nach Absatzmenge
Inkl. Fahrzeugservices & Reporting Gültig in 4 Ländern (AT, IT, DE & HR)
Grundgebühr € 8,2500 / Monat
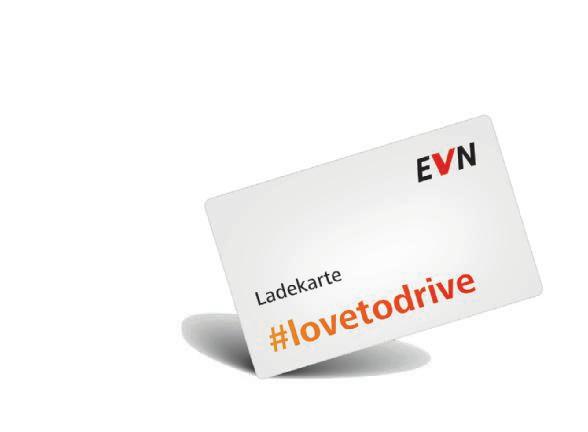

Er ist mehr als nur ein XL-SUV. Der Hyundai Ioniq 9 ist ein Statement auf Rädern. Business-Klasse neu interpretiert.
Text: Petra Mühr, Fotos: Hyundai
Hm. Eher Raumschiff oder Luxusyacht? Beide Assoziationen kommen einem beim ersten Rundgang sowie Probesitzen im neuen Hyundai Flaggschiff Ioniq 9. Auf alle Fälle bietet er enorm viel innovativen und durchgehend ebenen Innenraum, durch den er sich in Kombination mit seinen EV-Talenten sowohl als Team-Fahrzeug als auch als Premium-Shuttle eignet. Wahlweise ist der Ioniq 9 als Sechs- oder Siebensitzer erhältlich (in der mittleren Reihe kann man sich zwischen Dreierbank und zwei Einzelsitzen entscheiden), in der obligatorischen und leicht zugänglichen dritten Reihe finden Passagiere bis 1,89 Meter Körpergröße gut Platz. Der Kofferraum misst – je nach Belegung – 338 /620/1.323 bis zu 2.419 Liter. Zusätzlichen Stauraum bietet der Frunk mit Volumen von 52 (Allradmodelle) bis 88 Litern (Heckantrieb) sowie die verschiebbare Mittelkonsole mit von vorn und hinten zu öffnendem Staufach (darin zwei Ablagen mit 5,6 Liter und 12,6 Liter). So groß, so gut. Doch wie weit?
Fährt auch bei Kälte weit
Bis zu 620 Kilometer (WLTP; Heckantrieb) sollen aufgrund der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie mit 110,3 kWh Kapazität, niedrigen Luftwiderstandbeiwerts und der innovativen Plattform möglich sein.
Die Allradvarianten bieten ebenfalls wohlfeile 511 bis 557 Kilometer. Dass die Reichweite auch bei Kälte sich nicht ins Bodenlose reduziert, dafür sorgt ein innovatives Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystem (namens HVAC). Eine Wärmepumpe recycelt die Abwärme aus den Systemen und nutzt die Energie optimal. Dadurch sollen für den Ioniq 9 auch bei Außentemperaturen bis zu minus sieben Grad Celsius über 400 Kilometer Reichweite bei eingeschalteter Heizung möglich sein. Ähnlich beeindruckend auch die Ladezeit: An der 350-kW-Schnellladestation lädt er in nur 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Hervorhebenswert ist auch die Anhängelast. 1,6 (2WD) bis 2,5 Tonnen (4WD) nimmt der Ioniq 9 an den Haken. Damit die Reichweite kein Glücksspiel wird, optimiert ein intelligenter Anhängermodus basierend auf dem Anhängergewicht die Reichweitenvorhersage.
Drei Ausstattungsversionen gibt es. Entweder Heck- oder Allradantrieb. Sechs oder sieben Sitze. Zwischen drei Zusatzpaketen und Optionen darf ebenfalls gewählt werden. Preislich los geht’s bei 58.325 (exkl. MwSt.) für den Trend Line. Ja, der Ioniq 9 wirkt nicht nur wie ein Upgrade – er ist eins. •

Markante Silhouette und Beleuchtung, geräumiger LoungeInnenraum, drei raffinierte und komfortable Sitzreihen sowie reichlich Kofferraum


Die Einstiegsvariante ist ein heckgetriebenes Modell mit 160 kW/218 PS und schafft bis zu 620 Kilometer Reichweite; die Topversion 4WD Performance leistet 320 kW/435 PS, beschleunigt in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bringt’s auf 511 Kilometer


RANGER PLUG-IN-HYBRID ab € 38.790,– bzw. ab € 297,–mtl. bei Operating Leasing1
ab € 30.690,– bzw. ab € 300,–mtl. bei Operating Leasing1
Ford Ranger PHEV: Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert 3,1 l /100 km | CO2-Emission gewichtet kombiniert: 70 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 23,2 kWh/100 km | Elektrische Reichweite: 41 – 42 km | Ford E-Transit Custom: Stromverbrauch kombiniert: 22,1 – 24,6 kWh/100 km | CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km | Elektrische Reichweite kombiniert: bis zu 303 – 328 km (Prüfverfahren: WLTP)
Symbolfoto | Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter vom Listenpreis abzuziehender Nachlass (inkl. USt und NoVA), gültig auf ausgewählte, vollelektrische Nutzfahrzeug-Modelle. Aktion gültig bis auf Widerruf. 1) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Richtpreis bzw. Leasingrate inkl. NoVA exkl. USt, beinhaltet bereits Importeursnachlass sowie Ford Credit Bonus und Versicherungsbonus. Angebot ausschl. für Unternehmer bei Operating Leasing über Ford Credit, einem Angebot der Santander Consumer Bank und Abschluss eines Vorteilssets der Ford Auto-Versicherung (Versicherer: GARANTA Versicherungs-AG Österreich). Bank-übliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Laufzeit 48 Monate; 20.000 Kilometer/Jahr; Anzahlung 30 % vom Aktionspreis; zzgl. Gesetz. Vertragsgebühr (1,1 % der geleisteten Zahlungen). Freibleibendes unverbindliches Angebot, vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Ford-Partner.
Von 2012 bis 2017 war Alain Favey Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg, seit Februar 2025 verantwortet er als CEO die Geschicke von Peugeot. Wir trafen den Franzosen zum Interview. Text: Stefan Schmudermaier, Foto: Christian Hofer/FotobyHofer
Bei der Peugeot-Modellpalette geht es aktuell mit dem 208er los, oben ist beim 508er Schluss. Wäre da nicht an beiden Enden noch Luft? Auch Cabrio gibt es keines …
Ein Kleinwagen unter dem 208 ist schwierig, wir glauben nicht, dass das A-Segment wächst, zudem sehen wir uns im UpperMainstream-Segment. Wir sind weder Premium noch LowCost, daher sind wir mit den aktuellen Modellen gut aufgestellt. Mit einem Modell über dem 508 oder 5008 würden wir uns mit Premiummarken matchen, das macht auch keinen Sinn. Und was das Thema Cabrio betrifft, so wäre das natürlich toll, aber wir tun das nur, wenn sich die nötigen Investitionen rechnen.
Wie sieht generell Ihre Strategie für die Marke Peugeot aus?
Peugeot hat eine tolle Vergangenheit, die gerade neue Marken aus China nicht haben. Peugeot steht für viele Dinge wie Heritage, Design, Sport. Daher wollen wir zum Beispiel auch das legendäre Kürzel GTI wieder aufleben lassen. Es unterstreicht die Sportlichkeit, zum Start jene des 208. Die vollelektrische Version soll an den Urahn 205 GTI erinnern, auch wenn der Antrieb ein anderer ist, der Fahrspaß wird mindestens genauso groß, unter anderem mit einem entsprechenden Fahrwerk. Was den Marktanteil betrifft, müssen wir weiter zulegen, der Plan sind sieben Prozent, inklusive der leichten Nutzfahrzeuge.
haben damit gerechnet, dass die Umstellung schneller geht, aber der Punkt, wo „das Ketchup aus der Flasche kommt“, ist noch nicht erreicht.
Viele Kunden steigen aber auch wegen des höheren Preises und der Reichweite noch nicht auf E-Autos um, wie sehen Sie diese Argumente?
Zunächst einmal sind alle Autos teurer geworden, unabhängig vom Antrieb. Das ist natürlich auch verschiedenen Vorgaben geschuldet, die will ich auch gar nicht kritisieren. Aber die Technik hat ihren Preis. Wir haben beim E-3008 eine Reichweite bis zu 700 Kilometern (WLTP) erreicht, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da noch mehr nötig sein wird.

Alain Favey ist seit Februar 2025 CEO von Peugeot, Österreich ist er seit seiner Tätigkeit als Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg verbunden
Peugeot zählt ja zu den Vorreitern in Sachen Elektrifizierung, wie ist denn der Status quo beim BEV-Anteil und wo möchten Sie in zwei, drei Jahren sein?
In Europa liegen wir derzeit bei 14 Prozent, im Hinblick auf die EU-Strafzahlungen reicht das natürlich noch nicht aus. Österreich ist da ein Vorbild, hier liegt Peugeot bereits bei einem BEV-Anteil von 20 Prozent. Wir haben die breiteste Palette an E-Fahrzeugen und auch eine vollelektrifizierte Transporter-Range, das Potenzial ist also jedenfalls vorhanden. In zwei, drei Jahren wollen wir eine Verdopplung des BEV-Anteils auf rund 30 Prozent.
Was braucht es aus Ihrer Sicht aktuell noch, damit mehr Kunden auf E-Fahrzeuge wechseln?
Ein sehr wichtiger Baustein ist die Ladeinfrastruktur, hier muss noch mehr investiert werden. Und es braucht weiter Incentives, sowohl für die Infrastruktur als auch die Fahrzeuge. Alle Hersteller
Peugeot ist bei den Antrieben flexibler aufgestellt als andere Hersteller, ein großer Vorteil. Die Kunden haben bei uns die Wahl zwischen sparsamen MildHybriden, Plug-in-Hybriden – die neue Generation wird dann knapp 100 Kilometer rein elektrische Reichweite haben (WLTP) – und vollelektrischen Fahrzeugen. Unsere Multi-Energy-Plattformen erlauben es uns, rasch auf Kundenwünsche zu reagieren. Und dass wir fest an die E-Mobilität glauben, zeigt ein Pilotprojekt in Frankreich, das wir kürzlich gestartet haben. Wer sich einen elektrischen Peugeot kauft und innerhalb von drei Monaten draufkommt, dass er doch kein E-Auto möchte, kann problemlos auf einen Verbrennner wechseln: zufrieden oder Umtausch. Aber ehrlich gesagt wird das nicht passieren, wer einmal elektrisch fährt, bleibt dabei.
Als Teil der Stellantis-Gruppe greift man bei der Technik auf jene Bausteine zu, die auch den anderen Marken zur Verfügung stehen. Ist die Unterscheidung da ein Problem? Überhaupt nicht. Es ist ein großes Glück für Peugeot, dass wir auf die Technologie eines so großen Konzerns zugreifen können. Wären wir auf uns allein gestellt, hätten wir niemals so viele Modelle. Peugeot ist eine europäische Marke mit französischen Wurzeln, die sich auch beim Design von anderen Marken – egal ob innerhalb von Stellantis oder außerhalb – unterscheidet. •

Fuhrpark auf klimafreundliche E-Mobilität umstellen? Wien Energie macht den Umstieg einfach, wirtschaftlich und transparent.
Über eine Million Ladevorgänge an Wien Energie-Ladestellen im Jahr 2024 bestätigen: E-Mobilität erfreut sich zunehmend an Beliebtheit. Mit einem engmaschigen Ladenetz macht Wien Energie den Umstieg auf E-Mobilität einfach. Das nützt auch den Unternehmen – ganz egal, ob es sich um einzelne Firmenautos oder die gesamte Flotte handelt. Ihnen bietet Wien Energie maßgeschneiderte und smarte E-Ladelösungen – am Firmenparkplatz, zu Hause, unterwegs in Wien und an über 20.000 Ladestellen in ganz Österreich.

Klimaflott durch Wien … Elektrisch betriebene Flotten fahren nicht nur leise und emissionsfrei, sondern auch komfortabel durch die Stadt. Im Schnitt findet sich alle 400 Meter eine der über 2.200 öffentlich zugänglichen Ladestellen von Wien Energie. Und der Ausbau läuft auf Hochtouren: Bis Ende 2025 entstehen 900 weitere Wien Energie-Ladestellen im Großraum Wien, darunter vier weitere Schnellladeparks.
… laden in der Firma und zu Hause … E-Ladelösungen von Wien Energie für das Firmengelände machen den Umstieg besonders einfach – umfassende Beratung, Montage sowie laufender Servicesupport bei der Wartung der Ladeinfrastruktur inklusive. Mit flexiblen Ausbauoptionen, individuellen (AC- oder DC-)Ladestationen und transparenten Lade-Reports sorgt Wien Energie für einen reibungslosen Betrieb der E-Flotte. Um das Laden für die eigenen Mitarbeiter*innen
noch komfortabler zu machen, bietet Wien Energie auch Wallboxen für zu Hause oder intelligente Ladekabel an, durch die der KilowattstundenVerbrauch direkt verfolgt und die Kosten vom Unternehmen vergütet werden können.
… bei voller Kostentransparenz. Wer heute auf eine E-Flotte setzt, investiert nicht nur in den Klimaschutz, sondern auch in Wirtschaftlichkeit. Mit der Web-App Tanke Business behalten Unternehmen jederzeit die volle Kontrolle und den Überblick über sämtliche Ladevorgänge – und können die Kosten für zu Hause getätigte Ladungen direkt rückerstatten. Über die mobile App haben auch die Mitarbeiter*innen selbst all ihre Ladungen im Auge.
Die Vorteile der Wien Energie E-Flotten-Lösungen
• Komplettservice: Von der Planung und Installation bis hin zur regelmäßigen Wartung der Ladeinfrastruktur
• Flexible Ladeoptionen am Arbeitsplatz, zu Hause und unterwegs
• Zugriff auf 100 % Ökostrom
• Kontrolle der Ladevorgänge und Kosten über die Tanke Business-App
Mehr Informationen zu den Wien Energie Ladelösungen für Unternehmen: wienenergie.at/e-flotte
100 Ausgaben zu produzieren, liefert nicht nur Spaß, Spannung und spannende Geschichten. Es gibt auch Einblicke in den Alltag einer Redaktion. Und wie hoch der Stellenwert der Zahl 100 bei uns immer schon war. Eine nicht repräsentative Auswahl.
Text: Roland Scharf, Fotos: Chris Hofer, Xaver Ziggerhofer, Thomas Benda, Porsche, stock.adobe.com, Archiv
Mit einem derartigen Ladelevel zur Testrunde zu starten, das war bei Ausgabe 1 unmöglich – aus vielerlei Hinsicht: Vor allem waren im Jahre 2012, als die FLOTTE durchstartete, E-Autos noch mit bemitleidenswerten Reichweiten ausgestattet, die es schon unmöglich machten, von einer der raren Lademöglichkeiten zur Redaktion zu fahren, ohne gleich mehrere Prozent an Energie wegzuknabbern. Heute stehen uns 20 Ladesäulen direkt vor dem Büro zur Verfügung – und schon ist E-Mobilität das Einfachste der Welt.
Diese Geschwindigkeit erreichten wir mit keinem Test wagen schneller als mit dem Porsche Taycan Turbo S von 2020. 2,8 Sekunden für diesen Sprint sind auch heute noch brachial, zumal die anhaltende Elektromobilität das Drehmoment zu einem inflationären Gut gemacht hat – und gute Beschleunigungswerte keine Seltenheit mehr sind. So schnell zu sein wie dieser Porsche, erfordert aber schon mehr als einfach nur viel Leistung, sei es Traktion, Traktion oder – genau – eine gute Kraftverteilung. Wo wir das Spurtvermögen überprüft haben, ist leider nicht überliefert.

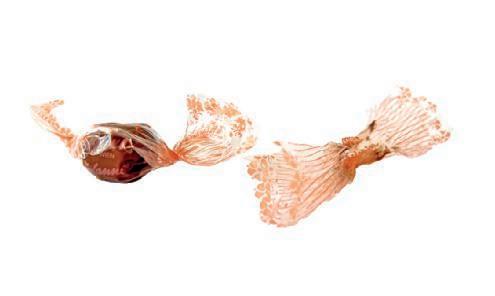
Schnappschüsse,
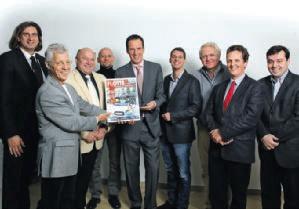
Diese Menge an Zuckerdoping benötigt unser bevorzugter Grafiker Bernd H. (vollständiger Name der Redaktion bekannt) für die finale Schlussproduktion einer FLOTTE-Ausgabe. Das sind immerhin zwei Tage voller Spaß, Spannung und Deadlines, an denen nie, aber wirklich noch nie alles so abgelaufen ist, wie es selbst der liberalste Zeitplan vorgesehen hätte. Gleichzeitig indes wird von H. die absolute Nougatknödelanzahl heftig dementiert. Wir haben daher noch einmal nachrecherchiert und können sagen: H. hat recht. Die Dunkelziffer dürfte sogar noch deutlich höher liegen! Übrigens... 100 Millisekunden liegen zwischen dem Nougatknödel links und dem Exknödel rechts.



Pro Stunde, wohlgemerkt, das schafft die Kaffee-Ape, die wir immer wieder bei der FLEET Convention aufgestellt haben. Nicht, dass es nicht noch mehr Nachfrage gäbe, aber rein technisch sind irgendwo die Grenzen gesetzt. Schließlich muss alles von Hand bedient, die Kaffeebohnen nachgefüllt, die Milch aufgeschäumt und der Papierbecher unter den Kaffeehahn gestellt werden. Dem Publikum hat’s dennoch immer gut gefallen, als ungezwungener und lockerer Plaudertreffpunkt etwas abseits des Geschehens.


So viel werden im Schnitt benötigt, um ein Cover analog nach eigenen Vorstellungen zusammenzubasteln. In einer Zeit vor KI hatte Chefredakteur Stefan Schmudermaier eine geniale Idee für ein Cover – die Umsetzung war aber grafisch gar nicht so easy. Also setzte er sich selber mit Schere und Uhu an den Tisch und klebte sich sein Wunsch-Cover selbst zusammen.
Das ist so ein Richtwert, wie oft bei einer größeren Geschichte der Auslöser gedrückt wird. Nehmen wir uns zum Beispiel einen Vergleich. Da wird gerne variiert, was die Perspektiven und Positionierungen der Protago nisten betrifft. Oft wirkt das fertige Bild dann nicht so toll wie die Idee dahinter, dann passt das Licht ewig nicht, es muss nachjustiert werden und so weiter. Ausschuss am Ende: an die 90 Prozent.


Zugegeben, mit ein paar mehr rechneten wir bei der ersten Ausgabe der FLEET Convention im Jahre 2015 schon. Wir betraten mit diesem Format völliges Neuland in Österreich und buchten deswegen auch nur einen kleinen Vortragsraum in den ehrwürdigen Gemäuern der Wiener Hofburg. Keiner wusste wirklich, ob das Konzept aufgehen würde. Nach 450 Anmeldungen konnten wir aber entspannen, die FLEET wurde zur Vorzeigeveranstaltung der gesamten Branche und benötigt mittlerweile längst den Großen Festsaal für die Vorträge.
Das ist in einer durchschnittlichen Ausgabe der FLOTTE nicht einmal ein ganzer Absatz. Daraus ergeben sich gut 650 Zeichen, was an die 8.000 Zeichen oder 1.200 Worte für eine Doppelausgabe bedeuten. Summa summarum ergeben sich somit je Heft eine Gesamtanzahl an kompetenten, wohldurchdachten und ausgefeilten 50.000 Wörtern – oder 326.000 Zeichen.

So lang benötigt man, um zwei Doppelvergaser, die 40 Jahre lang unbenutzt waren, zum Laufen zu bringen. Auch wenn es sich um ein Hobby handelt, wäre das handwerklich eine furchtbar schlechte Leistung, doch von der ersten Demontage, dem ersten Zerlegen, dem Reinigen, Dichtung-abkratzen, Zusammensetzen, dem zweiten Zerlegen, weil etwas nicht gepasst hat, bis hin zum Abdichten, Justieren und finalen Abstimmen bei einem Spezialbetrieb muss man alles in allem tatsächlich mit dieser Stundenanzahl rechnen. Ganz zu schweigen von der Suche nach Ersatzteilen, die meist auf Inseln abseits der EU und mit unfreundlichen Zollgebühren endet.




v. l.: Das erste FLOTTE-Team von 2011, drei sind bis heute noch dabei; Kühltransporter versehentlich als Ufo inszeniert, schaffte es nicht ins Heft; volle Automessen in Europa, ein Bild aus der Vergangenheit; Karikaturen waren lange Zeit Fixstarter in der FLOTTE;
Wahre Gründe für Dienstreisen des Chefredakteurs: alte Autos schauen; Autos vorschriftsmäßig auf Nutzbarkeit testen; eine Rubrik von früher war „Flottenpromis“, so auch 2012 mit der damals amtierenden Miss Austria Amina Dagi
Und das alle paar Stunden, hört sich für eine moderne Homepage nach nicht so viel an. Sehr wohl aber, wenn dieser Wert seit mittlerweile fünf Jahren eingehalten wird. Unsere mit Abstand erfolgreichste Geschichte im Netz ist und war der Vergleichstest „Das ist ja der Gipfel“ zwischen VW T6.1 und Mercedes V-Klasse von Mai 2020. Geschrieben von Chefredakteur Stefan Schmudermaier, erschien die Geschichte in Ausgabe 4/2020, also wirklich punktgenau vor dem Startschuss des ersten Corona-Lockdowns. Das Geheimnis ihres Erfolgs? Die Autos dürften als Neu- genauso begeistern wie als Gebrauchtwagen, was sie mittlerweile ja sind.

Mehr war für unsere Serie „Helden auf Rädern“, die auf www.flotte.at unter dem Freizeit-Kapitel läuft, nicht vorgesehen. Behandelt werden automobile Skurrilitäten und Rohrkrepierer, so viele wird es ja nicht davon geben. Dieses Format, das Anekdoten vor Fakten stellt, entwickelte sich auch auf unserer Zweitplattform motorline.cc zum absoluten Publikumsliebling, sodass sie seit vier Jahren ununterbrochen fortgeführt wird – und schon längst bei mehr als 150 Folgen liegt.

Weiter kam ein Redakteur, dessen Namen wir lieber verschweigen wollen, mit dem Fiat 500e Cabrio nicht. Zur Ehrenrettung des kleinen Italieners (nicht der Redakteur gemeint) sei dazugesagt, dass es sich um die kleine Variante mit 24-kWh-Akku gehandelt hat, der bei forscher Fahrweise im Winter einfach nicht mehr Kilometer schaffen kann.
So viel werden im Schnitt pro FLEET Convention nur an Kleinkram vom Redaktionsteam aus der Redaktion in die Wiener Hofburg und wieder retourgekarrt. Dabei geht es größtenteils um Kugelschreiber, Schlüsselbänder, Stoffsackerln und Formulare. Aufsteller, Beach Flags, Drucker und vor allem die aktuellen Ausgaben der FLOTTE sind hier nicht miteinberechnet, da diese allein mehrere 100 Kilogramm auf die Waage bringen und gesondert angeliefert werden.
Weiter kam ein frühes Test-Elektromobil nicht, als es für einen Test bei uns verweilte. Der Grund: Der Wählhebel versagte den Dienst. Der eigentliche Witz an der Sache: Der Abschleppwagenfahrer fuhr den Wagen dann ganz normal auf sein Fahrzeug. War es also womöglich doch nur ein Bedienfehler? Die Nachforschungen laufen noch, die Marke hüllt sich in Schweigen.
So viel muss un-sere Grafik pro Aus-gabe set-zen, damit das Layout nicht nur in-haltlich, son-dern auch optisch einen gu-ten Eindruck macht. Sonst wür-den alle Ge-schichten so merk-würdig abge-trennt aussehen wie die-se hier. Das ist aber in-sofern kein gr-oßes Prob-lem, da unser Gra-fiker sonst ke-ine Hob-bys hat. Keine 100 Schnappschüsse


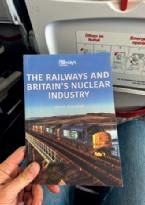

35 Jahre Age Gap – Rekord bei einem Vergleich; AntiFußballfan & Redakteur Roland Scharf mit FußballShirt seiner Lieblingsmarke; kurioseste Reiselektüre (nur geborgt); schwarzer Kater als unnahbares Spontan-Model, der uns für die nächsten 100 Ausgaben viel Glück bringen soll











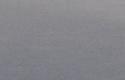
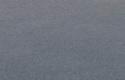

Bereits ein Fünftel aller Österreicher haben vor, ein E-Auto zu kaufen oder planen den Kauf. go-e unterstützt den Wandel mit innovativen Ladetechnologien. Text: Redaktion, Fotos: go-e
Geht es nach einer Umfrage von go-e, so wächst der Stellenwert der E-Mobilität bei Herrn und Frau Österreicher. 20 Prozent der Befragten nutzen bereits ein Elektroauto oder geben an, die Anschaffung eines solchen in der nächsten Zeit zu planen. Wichtig hierbei der Faktor Ladeinfrastruktur. Die Möglichkeit, zu Hause zu laden, wird als eine wichtige Voraussetzung genannt:
Laut go-e-Umfrage entscheiden sich immer mehr Österreicher für ein E-Auto; sehr wichtig für viele: Lademöglichkeit daheim


















































































































































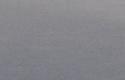




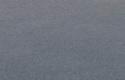

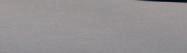


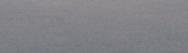
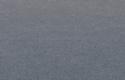








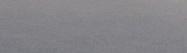
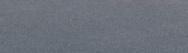




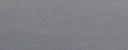

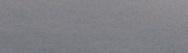

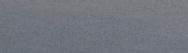



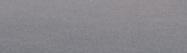








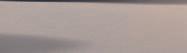
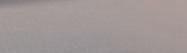
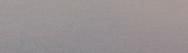


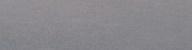



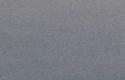
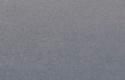
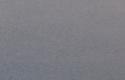
Anfang Mai ging der 4-tägige Kurs des Fuhrparkverbandes Austria zum geprüften Mobilitäts- und Fuhrparkleiter in seine siebente Runde.
Text & Fotos: FVA
Damit haben bis jetzt schon knapp 90 Teilnehmer erfolgreich diese Ausbildung gemeinsam mit dem WIFI Wien absolviert. Ein weiterer Meilenstein am Weg zu einem eigenen Berufsbild Fuhrparkleiter, speziell interessant für Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften. Wir haben uns mit den Teilnehmern unterhalten, um Reaktionen einzufangen.
Dietmar Hierlemann: „Ich wollte mein Fuhrparkwissen ausbauen und habe im Internet recherchiert, bin so aufs WIFI gestoßen und habe den Kurs gebucht. Am besten gefallen hat mir die geballte Fachkompetenz aller Vortragenden. Es ist das Who’s who an Dozenten in Österreich vertreten, dementsprechend kann man das maximale Wissen mitnehmen. Für mich waren sehr wichtig die Haftungsfragen, da ich selbst vor der Delegation als Fuhrparkleiter stehe.“
Elias Feurstein: „Nachdem ich diesen Kurs vom Fuhrparkverband gefunden habe, hat mein Chef gesagt, das ist eine gute Sache. So konnte ich buchen. Ich bin momentan als Disponent im Fuhrpark tätig. Ich hoffe, die erworbene Urkunde hilft mir, zum Fuhrparkleiter aufzusteigen.“
Christian Wotypka: „Ich habe bei der letzten Fleet Convention die Brandrede von Henning Heise gehört. Das hat mein Interesse geweckt. Ich wollte mehr über den Tätigkeitsbereich von Fuhrparkmanagern erfahren. Der Umfang der Tätigkeiten eines Fuhrparkleiters haben mich beeindruckt. Speziell die rechtlichen Aspekte, die von Dr. Brenner eindrucksvoll vorgetragen wurden,

FVA-Kursverantwortliche Rosemarie Pfann zeigt sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden
haben bei mir nachhaltigen Eindruck gemacht. Vieles davon kann ich in meiner Tagesarbeit umsetzen.“
Marlies Ries: „Mein Vorgesetzter war auf der Fleet Convention und er hatte die Idee, mich anzumelden, da es die einzige fundierte Ausbildungsmöglichkeit ist. Speziell das technische Wissen im Bereich der E-Mobilität hat mich sehr interessiert, da ich 350 Fahrzeuge verwalte und davon auch schon viele Elektrofahrzeuge. Trotzdem wir schon im Fuhrparkwesen sehr gut aufgestellt waren, gab es immer wieder Situationen, wo uns das Wissen gefehlt hat. Nach diesem Kurs können wir viele Lücken schließen.“
FVA-Vorstandsmitglied Rosemarie Pfann: „Wir haben jetzt den 7. Kurs absolviert und können wahrscheinlich noch heuer den 100sten geprüften Mobilitäts- und Fuhrparkleiter feiern. Es war erfreulich zu sehen, dass wie bei allen Kursen die Teilnehmer sehr interessiert und aufnahmebereit waren und selbst in den Pausen sich noch fachlich ausgetauscht haben. Der nächste Kurs ist vom 3. bis zum 6. November 2025. Da wir aus Qualitätsgründen nur eine beschränkte Teilnehmerzahl nehmen können, sollte man sich schon jetzt anmelden beim WIFI
Wien – Kursnummer 94260015“ •





40 Jahre Pirelli P Zero
Das legendäre UHP-Flaggschiff sorgt seit 1985 für besten Grip bei sportlichen Autos. Pirelli hat die fünfte Generation nun auf der Rennstrecke in Monza und bei Ausfahrten zum Comer See vorgestellt. Schließlich wird mit der Modellfamilie vom P Zero E (über 55 Prozent natürliche oder recycelte Materialien) bis zum P Zero Trofeo RS (Rennstrecke und Straße) ein breites Spektrum abgedeckt. Maßgeschneiderte Versionen gab und gibt es nicht nur für Ferrari, Pagani und Co, sondern auch für starke Fahrzeuge von Audi, BMW und Mercedes.

Bei
Alphabet Austria hat Fuhrparkverantwortliche zum Talk zur Zukunft der Mobilität nach Wien geladen.
Vielerorts ist die Unsicherheit rund um den Wechsel auf nachhaltige Mobilität groß, Alphabet Austria hat daher zur Veranstaltung „Your mobility. Made futureproof.“ ins Wiener Museumsquartier geladen. Als Gastgeber fungierten Mag. Kathrin Frauscher, CEO Alphabet Austria und COO Mag. Nikolaus Engleitner. Die beiden hatten hochkarätige Gastredner im Gepäck, so sprach Klaus von Moltke, Geschäftsführer des BMW Group Motorenwerk Steyr, über die Antriebsvielfalt, von sparsamen Verbrennern und neuen E-Fahrzeugen, die allesamt Technik aus Österreich verbaut haben. Auch an der Wasserstoffstrategie hält BMW fest. Andreas Baron, Chief ESG Officer Region Europe der BMW Group Financial Services, gab Einblicke rund um Nachhaltigkeitsanforderungen von Unternehmen an die Dienstleister, ein Thema, das stark in der Priorität steigt und viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Am Ende der Vorträge kam auch das Netzwerken nicht zu kurz, unterm Strich ein gelungener Abend.
An der Verkehrsdrehscheibe mit A4 (Turin–Triest) und A23 (Palmanova–Tarvis) liegt der neue Schnellladepark von Smatrics EnBW. Zwölf Ultraschnellladepunkte stehen in Palmanova nahe der slowenischen Grenze bereit, um Elektroautos bis 400 kW Ladeleistung zu gönnen. Thomas Landsbek, CEO von Smatrics EnBW, spricht von einem „weiteren wichtigen Meilenstein für grenzüberschreitende E-Mobilität in Europa.“ Für die Zukunft ist der Standort mit Erweiterungsmöglichkeiten gerüstet. Zusätzliche Ladepunkte sind bereits vorgesehen. Und: Zwei weitere Standorte mit je 16 HPC-Ladepunkten zwischen Venedig und Triest sowie zwischen Bergamo und Mailand sind derzeit in Planung.
Nach einem aktuellen Test von acht All-TerrainReifen der Dimension 225/65 R17 106 V zieht der ÖAMTC ein weitgehend negatives Fazit. „Keines der getesteten Produkte kommt an den Ganzjahresreifen heran, den wir als Referenz herangezogen haben“, erklärt Club-Techniker Steffan Kerbl. „Vor allem beim Bremsen auf nasser Fahrbahn haben wir teilweise eklatante Schwächen festgestellt. Eine ausdrückliche Empfehlung gibt es damit für keinen der getesteten All-Terrain-Reifen.“ Aber: Stehen öfters längere Touren in entlegene Gebiete mit unbefestigten Straßen am Plan, bieten die robusten All-Terrain-Reifen ein Plus an Pannensicherheit, sind bei Traktion und Haltbarkeit teils sogar Sommerreifen überlegen.





Der Autoglas-Spezialist Carglass erhöht kontinuierlich die Anzahl seiner Standorte in Österreich. Allein im ersten Halbjahr 2025 kommen fünf neue Filialen zum Netz dazu.
Text: Mag. Andreas Granzer-Schrödl, Fotos: Carglass, Mag. Andreas Granzer-Schrödl
Damit werden zur Jahresmitte 30 Standorte österreichweit zur Verfügung stehen. Neben der qualitativen Ausführung der Arbeiten im Bereich Scheibentausch und -reparatur steht für Carglass die Kundenzufriedenheit ganz oben auf der Prioritätenliste. „Wir wachsen trotz der angespannten Wirtschaftslage“, betonte Carglass-Österreich-Geschäftsführerin Galina Herzig bei der Eröffnung der neuen Filiale in Parndorf. Der Weg in die Zukunft scheint vorgezeichnet. „Wir wollen der beste Autoglas-Serviceanbieter in Österreich sein“, so Herzig.
Wir wachsen trotz der angespannten Wirtschaftslage.“
Geschäftsführerin Galina Herzig
40 Standorte im Endausbau
Auf die weiteren Expansionspläne ging Dusan Kalinic, Head of Sales and Expansion bei Carglass Österreich, ein. Im 2. Halbjahr 2025 sollen weitere Standorte folgen, im Endausbau sind 40 Filialen quer durch die

Carglass Österreich (v. r.): Geschäftsführerin Galina Herzig, Dusan Kalinic, Head of Sales and Expansion, und Viktoria Benda, Head of Operations v
Republik geplant. „Wir positionieren uns als Spezialist mit der größten Autoglas-Expertise in Österreich“, betont Kalinic. Mit den geplanten 40 Standorten in Österreich sieht man sich flächendeckend gut aufgestellt: „Eine noch stärkere Expansion ist nicht notwendig.“ Im Mittelpunkt steht die rasche Erreichbarkeit einer Filiale. „Kein Kunde in der Stadt soll länger als 20 Minuten und auf dem Land länger als 30 Minuten zu Carglass fahren“, unterstreicht Geschäftsführerin Herzig mit Verweis auf eine Optimierung des Angebotes in West-Österreich.
Reparatur vor Tausch
Im Rahmen seiner „Repair-FirstStrategie“ setzt Carglass vorrangig auf die Reparatur, die entsprechende Reparaturquote liegt in Österreich über 50 Prozent. Neben Kosteneinsparungen profitiert davon auch die Umwelt, denn eine Reparatur verursacht rund 75 Prozent weniger CO2 als der Einbau einer neuen Scheibe. Eine hohe Kompetenz schreibt sich das Unternehmen bei der Rekalibrierung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) zu. Dank einer Zusammenarbeit mit Bosch könnten 99 Prozent aller Fahrzeuge entsprechend rekalibriert werden, teilen die CarglassVerantwortlichen mit. Bei fast jedem zweiten vom Autoglas-Spezialisten betreuten Fahrzeug, konkret bei 47,5 Prozent, müsste nach dem Austausch der Windschutzscheibe neu kalibriert werden. „Die korrekte Rekalibrierung nach Herstellervorgaben ist essenziell – und genau hier liegt unsere ausgewiesene Expertise“, so die Geschäftsführerin.
Carglass Österreich beschäftigt gegenwärtig rund 150 Mitarbeiter und vermeldet rund 100.000 Kundenkontakte pro Jahr. •

Die Fahrzeugverwaltung von LapID optimiert Prozesse und gibt einen besseren Überblick über den Fuhrpark.
Text: Redaktion, Fotos: LapID
Die digitale Fahrzeugverwaltung von LapID soll Fuhrparkverantwortlichen mehr Zeit sowie einen besseren Überblick über ihren Fuhrpark bringen. Mit der digitalen Fahrzeugverwaltung erweitert die LapID Service GmbH ihr Produktportfolio. Bisher machten manuelle Prozesse, Outlook-Wiedervorlagen, Excel-Listen oder sogar physische Akten das Fuhrparkmanagement oft unnötig komplex und zeitaufwendig. Die digitale Lösung von LapID minimiert den Aufwand und verschafft Fuhrparkverantwortlichen einen besseren Überblick über die Verwaltung des Fuhrparks. Das Unternehmen bietet mit der Einführung der LapID Fahrzeugverwaltung seinen Kunden jetzt noch umfangreichere Funktionen. Fuhrparkmanager können Aufgaben und Termine effizient in einem System organisieren. LapID ermöglicht damit einen weiteren Schritt zur Automatisierung von Prozessen.
Alle Funktionen an einem Ort
Das LapID System bündelt alle essenziellen Funktionen, die Fuhrparkmanager für die Verwaltung ihrer Fahrzeugflotte benötigen. Dazu gehören neben der digitalen Fahrzeugakte ein Dokumentenmanagement, Leasingmanagement mit Prognosen und

Warnungen sowie ein umfangreiches Reporting. Ein besonderes Highlight ist das dynamische Aufgaben- & Terminmanagement, mit dem Fahrer an anstehende Aufgaben und Termine erinnert werden. Darüber hinaus können sogar Informationen, Dokumente und Bestätigungen eingeholt werden, beispielsweise die Abfrage von Kilometerständen. Hierfür haben Fuhrparkmanager die Möglichkeit, auf einen umfangreichen Pool von Vorlagen für Aufgaben und Termine zurückzugreifen oder sich individuelle Aufgaben und Termine zu erstellen. Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: „Unsere Lösung vereint alle essenziellen Funktionen der Fahrzeugverwaltung an einem Ort und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Umstieg von manuellen Prozessen zu digitalem Management reibungslos gestaltet. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass die Anwendung leicht zu bedienen ist und unseren Kunden echten Mehrwert bietet.“ •

in jedem Anwendungsfall

Dienstwagen zu Hause laden

Einfacher Energiezähler zur kWh genauen Abrechnung in Kombination mit RFID
Internetverbindung auch unabhängig von WLAN über Mobilfunk möglich
PV-Überschussladen

Besuche uns auf der FLEET Convention in der Wiener Hofburg und erfahre mehr über Flottenlösungen von go-e! 24. Juni 2025

Unternehmensstandort und des Dienstwagens zu Hause
Charger PRO CABLE Laden am
kWh genaue Abrechnung durch MID-konformen
Zähler (Umsetzung einer individuellen Preisstruktur möglich)
Internetverbindung für jeden Installationsstandort (über LAN, WLAN, Mobilfunk)
Integriertes 6 m Typ 2 Ladekabel
Die Prüfgesellschaft Dekra ist wohl vielen ein Begriff. Aber womit beschäftigt man sich dort und was hat man als Fuhrparkbetreiber davon? Wir haben Österreich-Geschäftsführer Helmut Geil zum Interview gebeten. Text: Stefan Schmudermaier, Foto: Dekra
Die Dekra – die Abkürzung steht für den ursprünglichen Namen „Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein“ – feiert heuer ihren 100. Geburtstag, wie kam es 1925 zur Gründung?
Damals ist die Technik immer mehr geworden und einige Fuhrwerker haben sich zusammengetan, um freiwillig mehr für die Sicherheit zu tun. Vorangetrieben wurde das Thema vom Großindustriellen Hugo Stinnes, damals mit großem Fokus auf das Automobil.
100 Jahre später ist Dekra deutlich breiter aufgestellt.

Dekra-Österreich-Geschäftsführer Mag. Helmut Geil (r.) erklärt im Gespräch mit FLOTTE Chefredakteur Stefan Schmudermaier die Aufgaben der Dekra
Wir sind mittlerweile ein weltweit agierendes Unternehmen mit 48.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 4,3 Milliarden Euro, die Dekra SE Dachgesellschaft ist die größte, größte nicht börsennotierte Expertenorganisation im TIC-Bereich (Testing, Inspection, Certification). Dem Verein gehören 20.000 Mitglieder an, sämtliche Aktivitäten werden aus dem eigenen Gewinn finanziert. In Österreich ist die Dekra seit 22 Jahren aktiv, vorwiegend im Prüfwesen und hier primär bei Lkw, darüber hinaus gibt es Kooperationen mit Werkstätten und Händlern rund ums Pickerl.
In den letzten Jahren ist das Angebot deutlich gewachsen, direkt und indirekt gibt es auch einige Anknüpfungspunkte zu Fuhrparks und Flotten.
Wir sind der größte Partner der Leasinganbieter, wenn es um die „end of term inspection“, also die Überprüfung bei der Rückgabe von Fahrzeugen geht. Wir schaffen Verständnis, was noch akzeptabel und was als Schaden einzustufen ist, mit einem Schadenkataloge als Grundlage. So sind Experten etwa bei Hödlmayer in Schwertberg im Einsatz, die alle Rückläufer und den jeweiligen Zustand erfassen. Dieser Prozess muss möglichst schnell gehen, schließlich kostet jeder Standtag den Leasinggeber Geld, zudem werden die Autos – je nach Kunde –bereits zwei Monate vor Rückgabe Abnehmern angeboten.
der ein sehr schnelles Ermitteln der SoH-Werte (State of Health) also der Gesundheitswerte der Batterie ermöglicht. Wir matchen die gewonnenen Daten mit jenen der aufwändigen Vermessung des Fahrzeugmodells im Neuzustand und können die Batterie daher sehr genau beurteilen. Im Unterschied zu anderen Tests aber entsprechend schneller, anders wäre es nicht möglich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen pro Tag 20 bis 25 Autos abnehmen. Was wir sagen können, ist, dass die Akkus in der Regel länger halten als gedacht und auch das Schnellladen nicht massiv schädlich ist. Natürlich gibt es auch Ausreisser, daher die Notwendigkeit des Tests.
Kann ein Fuhrparkbetreiber auf die Technologie zugreifen?
Wir werden diesen Batterie-Schnelltest künftig an allen DekraPrüfstellen in Österreich für circa 100 Euro anbieten, auch für Autohändler ist das ein wichtiges Tool.
Bei der Berechnung von Schäden arbeiten Sie ebenfalls an einem neuen Modell, mit Unterstützung von KI. Wie sieht das genau aus?
Gefüttert von DekraGutachten wird mittels KI eine sehr genaue Schadenhöhenprognose erstellt.“
Helmut Geil, Geschäftsführer Dekra Österreich
Dekra hat eine Beteiligung am Schweizer Unternehmen Spearhead, einem Spezialisten für Schadenmanagement. Gefüttert von DekraGutachten wird eine KI-gestützte Schadenhöhenprognose erstellt, mit einer sehr hohen Genauigkeit. Ziel dabei ist es, Prozesse zu beschleunigen und die Reparaturkette schneller in Gang zu bringen. Für den Flottenkunden bedeutet das, statt einer Woche nicht einmal 24 Stunden warten zu müssen, bis es zu einer Reparaturfreigabe und einem Ersatzfahrzeug kommt.
Für Leasingfahrzeuge interessant ist auch die virtuelle Vorabbesichtigung.
Die Fahrzeugrückgabe ist ja ein besonders sensibles Thema, nicht zuletzt bei den E-Fahrzeugen und dem Akku, der ja ein wichtiger Faktor beim Werterhalt ist. Absolut! Dekra hat daher auch einen Akku-Schnelltest entwickelt,
Es kommt in der Praxis immer wieder vor, dass Mitarbeiter Schäden am Auto nicht melden und es am Laufzeitende zu bösen Überraschungen kommt. Im Zuge eines Videocalls mit einem DekraSachverständigen wird in fünf bis zehn Minuten ein Kurzgutachten erstellt, welche rückgaberelevanten Schäden ein Fahrzeug aufweist. Damit kann rechtzeitig vorher noch die Versicherung informiert werden. •

Dekra Austria, CarVita, CarTV und Schadenmeister haben gemeinsam den Schadendialog ins Leben gerufen, Fokus der Erstausgabe war die E-Mobilität.
Text: Gerald Weiss, Foto: Stefan Schmudermaier
Ziel sei es, zentrale Akteure entlang des gesamten Kfz-Schadenprozesses zusammenzubringen und gemeinsam praxisnahe Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln, erklärte Mag. Helmut Geil, Geschäftsführer Dekra Austria, die Initiative zum Schadendialog, der Vertreter aus Versicherungen, Leasingunternehmen, Werkstätten und dem Sachverständigenwesen gefolgt waren.
Wachsende Elektromobilität „Elektromobilität hat in Österreich eine große Bedeutung, weil hier – nach Belgien – der zweitgrößte Flottenmarkt existiert. Wir sehen daher einen stark wachsenden E-Anteil“, analysiert Geil. Schadenbild und die Schadenfolgekosten würden sich von konventionell angetriebenen Fahrzeugen unterscheiden. Im Vortrag von Rainer Kühl vom KTI Kraftfahrzeugtechnischen Institut wurde unter anderem der Weg vom Unfallort zur Werkstätte beleuchtet. Batterieelektrische Pkw brennen deutlich seltener als VerbrennerModelle, es gibt allerdings ein deutlich höheres Risiko bei E-Scooter und E-Bikes. Schließlich wird beim batterieelektrischen Fahrzeug der größte Aufwand betrieben, um die Batterie zu schützen. „Selbst der Brand ist für die Feuerwehr handelbar. Entscheidend ist, dass die vielen Mythen aufgeklärt werden“, erklärt Kühl. Probleme sind oft eine unzureichende Gefährdungsklassifizierung, zu lange Quarantäne, falsche Gefahrengut-Deklaration beim Transport oder ressourcenverschwendende Entsorgung. „Es ist entscheidend, die tatsächliche Erforderlichkeit zu bestimmen. In der Praxis sind beschädigte Batterien ganz selten“, analysiert Kühl.
Qualifizierte Bewertung
So sind beschädigte E-Fahrzeuge grundsätzlich kein Gefahrengut, vielmehr braucht es eine qualifizierte Bewertung hinsichtlich der Gefährdung. Die Basis sind – sofern verfügbar – die Herstellervorgaben. „Wenn es keine Temperatur-Entwicklung gibt, ist nach 24 Stunden keine Quarantäne mehr nötig. Derzeit herrscht viel Unsicherheit bei den Werkstätten, wie gesagt ist in den meisten Fällen die Batterie aber in keiner Weise betroffen“, so Kühl. •

FLEET Convention 24. Juni 2025 Hofburg Wien (AT) Stand 14
Autos im Dienste der Österreichischen Bundesbahnen, das ist ein großes Thema. Die ÖBB haben alles in einer Gesellschaft gebündelt und nebenbei zwei große Umstellungen durchgeführt: einmal Elektro bitte.
Und das als Sharing-Modell obendrein.
Text: Roland Scharf, Fotos: ÖBB
Der Kundendienst hat sicher das größte Reservoir an kuriosen Kundenerfahrungen. Mit dieser Art von Anfragen hatte man bei den ÖBB indes auch noch nie zu tun: „In der Anfangsphase haben die Kunden bei unserem Callcenter angerufen, weil sie nicht gewusst haben, wie man das Auto überhaupt startet“, erinnert sich Alexander Klug an die Anfangsphase von zwei großen Transformationen im Bereich der ÖBB-Infrastruktur AG. Damals ging man nicht nur dazu über, Carsharing als letzte Etappe vom Zielbahnhof zum eigentlichen Ziel zu etablieren, sondern auch die Umstellung auf Elektromobilität zu forcieren. Klug, selbst E-Fahrer der ersten Stunde, kann sich noch gut an diese Phase des Probierens und Testens erinnern: „Ich habe damals leihweise einen E-Golf bekommen. VW selbst benötigte noch Fahrdaten, um diverse Dinge bei den Elektrofahrzeugen zu verbessern. Zu diesem Zweck bin ich den Golf gut zwei Jahre lang gefahren. Ja, und aus diesem Pilotprojekt sind mittlerweile fast 700 Fahrzeuge geworden.“


Unsere Philosophie: Weite Strecken fährt man mit dem Zug und steigt dann in ein E-Auto.“ Alexander Klug
Aber Moment, langsam: Die ÖBB und das Thema Auto? Das bedarf zuerst einer Begriffsbestimmung, denn hier geht es um weit mehr als nur um Wartungs-Lkw oder Vorstandslimousinen. Grundsätzlich kümmert sich die ÖBB Rail Equipment um alle vierrädrigen Belange der Bundesbahnen. Klug, Leiter des Fuhrparks Straße: „Wir kaufen alle Fahrzeuge, vermieten diese dann an die Konzerngesellschaften weiter und kümmern uns um Versicherung, Schadenmanagement sowie das Reparatur- und Reifenmanagement, wobei wir hier auf externe Partner setzen. Wir geben auch Tank- und Ladekarten aus. Kurz gesagt, wir stellen ein Rundum-Paket zur Verfügung, damit unsere Kunden sich möglichst wenig kümmern müssen. Und natürlich nehmen wir das Fahrzeug nach der Laufzeit zurück und verwerten es.“ Die Behaltedauer liegt grob zwischen vier und sieben Jahren, wobei als Faustregel gilt, je größer das Fahrzeug, umso länger wird es genutzt. Noch, denn auch hier könnte es Umwälzungen im Rahmen der Transformation geben, doch der Reihe nach. Wie kam es überhaupt zu dem radikalen Schritt, weg von fix zugeteilten Firmenwagen, hin zu abteilungsübergreifenden Sharing-Autos? „Wir haben nach Ein-

sparungspotenzialen gesucht. Dabei sind wir auf Carsharing gestoßen und haben darüber mit der Deutschen Bahn gesprochen, die damals schon mehrere Jahre Carsharing-Erfahrung hatte. Sie berichteten von bis zu 30 Prozent. Deshalb haben wir beschlossen, uns das genauer anzusehen. Sprich, wir haben gut 700 Fahrzeuge, verteilt auf alle Unternehmensstandorte, die zwar teilweise im Pool, aber nur innerhalb einer Abteilung verwendet wurden, gesellschaftsübergreifend freigeschaltet. Zudem durften die Mitarbeiter:innen die Fahrzeuge entgeltlich privat buchen. Und so haben wir seinerzeit 700 eingezogen und durch 500 Sharing-Autos ersetzt. Wir haben also die 30 Prozent Einsparungspotenzial umgesetzt. Was noch dazukommt: Ungefähr 420 unserer aktuell 600 Fahrzeuge sind heute auch von externen Kunden über ÖBB Rail&Drive buchbar – Tendenz steigend. Wir haben derzeit 9.000 bis 10.000 Buchungen pro Monat. Wenn man daraus die Auslastung 7/24 errechnet, dann liegen wir zwischen 25 und 40 Prozent. Das klingt jetzt nicht nach so viel, sind aber im Endeffekt acht Stunden täglich, die alle Fahrzeuge verbucht sind.“ Das ist aber erst der Anfang. So ist auch eine Kooperation mit der Deutschen Bahn geplant, damit zukünftig auch an einem Teil der Nightjet-Destinationen Autos über das ÖBB-System gebucht werden können. Was gut ist, denn es gibt immer mehr Firmenkunden, die ihre Mitarbeiter bei Rail&Drive registrieren, damit sie mit dem Zug fahren, um dann vor Ort in ein SharingFahrzeug umzusteigen.
Standortbedingt
Dass dabei Stromer bevorzugt werden, hat sich mittlerweile durchgesetzt. Klug: „Bei diesen haben wir günstige Preise mit niedrigen Kilometersätzen. Natürlich schauen wir uns auch an, wie viele Kilometer pro Vermietung gefahren werden, und das ist teilweise schon ganz erstaunlich. Die Kunden dürften ihre Reise unter Berücksichtigung der dafür benötigten Ladeinfrastruktur richtig planen.“ Die Callcenter haben also bei den externen Kunden definitiv gut gearbeitet. Und auch die interne Klientel hat sich mit der neuen Mobilität schon längst angefreundet. „Wir hatten am Anfang das Problem, dass die Reichweiten der Fahrzeuge noch sehr bescheiden waren. Da gab es seitens der Mitarbeiter:innen Bedenken, dass man irgendwo stehen bleibt und nicht mehr ans Ziel kommt. Entsprechend haben wir auch versucht, nicht jedem wahllos sein Fahrzeug wegzunehmen oder gegen ein Elektrofahrzeug auszutauschen, sondern nur dann, wenn der Wechsel sinnvoll und praktikabel schien. So sind die Bedenken relativ schnell abgebaut worden.“ Ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, ist der Umstieg dennoch nicht. Schließlich gliedert sich der ÖBB-Fuhrpark in unterschiedlichste Fahrzeugkategorien – vom Kleinwagen bis zum
schweren Lkw. Und da passen Stromer einfach nicht überall. Noch nicht. Klug: „Natürlich schauen wir laufend, welche ElektroFahrzeuge in unser Portfolio passen. Aber im NutzfahrzeugBereich ist es schwierig, einen elektrischen Ersatz zu finden, mit dem man dann auch wirklich dasselbe tun kann wie mit einem Verbrenner. Wir haben sehr viele Werkstätten-Einrichtungen verbaut und dabei dann oft Probleme mit der Nutzlast. Und auch die Reichweiten sind noch relativ eingeschränkt.“ Natürlich gibt es auch Einsatzgebiete, wo E-Nfz verwendet werden können, sagt Klug, und ebendort setzt man solche Modelle auch schon ein, sofern auch sonst alle Rahmenbedingungen passen: „Es gibt Standorte, an welchen wir gar keine Ladesäule bauen können, weil die Stromversorgung nicht adäquat oder der Aufwand zu hoch ist. Oder unsere Kolleg:innen müssen einfach zu große Distanzen zurücklegen.“
Individuelle Abdeckung
Stichwort Bestückung. Ein besonders spannendes Thema, welcher Bahnhof wie viele welcher Fahrzeugtypen bekommt. Denn hier kommen gleich viele Faktoren zusammen. Grundsätzlich handelt es sich um einen dynamischen Prozess: Bei der Standortauswahl spielen Faktoren wie Kundenfrequenz und Eigenbedarf natürlich eine entscheidende Rolle. Klug: „Einen neuen Standort beobachten und entwickeln wir nach der Eröffnung circa zwei Jahre. Wenn er sich dann nicht rechnet, nehmen wir ihn wieder vom Markt. So entwickelt sich unser Standortnetz laufend in die verschiedensten Richtungen. Die großen Bahnhöfe sind bereits abgedeckt, an den kleineren sind wir dran. Dazu haben wir eine

Im Endausbau ist für jedes Share-Fahrzeug von Rail&Drive eine Ladestation vorgesehen; zusätzlich sind je nach Standort auch Schnellladesäulen vorgesehen, inklusive eigener Ladekarte

Kooperation mit der ÖBB PV AG. Unser Angebot wird zum Beispiel an den ,ÖBB 360° ‘-Standorten berücksichtigt, an welchen es dann E-Scooter, Fahrräder und Autos auszuleihen gibt.“ Teilweise ist es aber gar nicht so einfach, die benötigte Anzahl an Parkplätzen zu bekommen. „Wir müssen dann auf Park-and-RideAnlagen ausweichen, wofür wir die Zustimmung des Landes und der Stadt benötigen. Manchmal kommt eine Kommune auf uns zu, um einen Bedarf anzumelden. Da unterstützen wir natürlich, soweit es uns möglich ist, wobei wir im Regelfall eine finanzielle Beteiligung der Kommune erwarten.“
Passend zur Elektro- gibt es auch eine Ladestrategie. „Grundsätzlich versuchen wir, bei den Dienstfahrzeugen jeweils zwei E-Autos mit einem Ladepunkt zu versorgen“, so Klug. „An größeren Standorten, an denen die Möglichkeit besteht, errichten wir auch einen Schnellladepunkt, damit auch Bereitschaftsfahrzeuge elektrisch betrieben werden können.“ Im Carsharing führt hingegen kein Weg an einem 1:1-Verhältnis vorbei, zudem betreibt man auch eine eigene Ladekarte. Für den Betrieb der Ladepunkte setzt man indes auf einen externen Partner.
Interessante Zugänge

Die Fahrzeugvarianten variieren bei Rail&Drive je nach Standort und sind abhängig von betriebsinternen Anforderungen und dem Bedarf der ShareKunden; bevorzugt werden jedoch E-Fahrzeuge genommen

Die Batterien halten länger, als alle glauben, nur hat sich das noch nicht herumgesprochen.“
Alle Zeichen auf E-Mobilität also, wo es möglich ist, doch hier kommt natürlich auch der Faktor Geld dazu. „Unsere Philosophie ist es, die großen Entfernungen mit dem Zug zurückzulegen, um dann, sollte man Anschlussmobilität benötigen, in ein Elektroauto einzusteigen. Damit werden die meisten unserer Fahrzeuge im Stadtgebiet oder im Umland einer Stadt eingesetzt. Das heißt, am Ende des Tages bräuchten wir leistbare E-Fahrzeuge, die wir im Carsharing-Betrieb auch rentabel führen und vermitteln können,“ erklärt Klug die derzeitige Problematik, „aber leider lag der Fokus der Hersteller in der Vergangenheit in erster Linie bei teuren High-End-Fahrzeugen, die 40.000 Euro und mehr gekostet haben.“ Selbstverständlich fließen auch die Erkenntnisse der letzten Jahre in die weitere Planung ein. Mechanische Defekte an E-Fahrzeugen? Kaum vorhanden. Sehr wohl aber ist in den meisten Fällen der Reifenverschleiß auf einem ganz anderen Niveau. Das hohe Drehmoment hinterlässt schließlich
doch seine Spuren. „Es kommt aber natürlich auch stark drauf an, wie der Lenker mit dem Fahrzeug umgeht.“ Ein schwieriger Punkt hingegen ist das Thema Restwert. Generell verkaufe man die alten Stromer nicht so gut wie Verbrenner, was für Klug der Grund ist, darüber nachzudenken, die Nutzungsdauer einfach zu verlängern. „Doch dann weiß wieder keiner, ob ältere E-Autos überhaupt noch zu verkaufen sind. Wir haben in der Vergangenheit auch schon überlegt, die Batterien auszubauen und zu stationären Speichern umzurüsten. Herausfordernd in der Umsetzung, aber definitiv ein interessanter Zugang.“ Aktuell ist aber die öffentliche Meinung über die Haltbarkeit der Traktionsbatterie das größte Dilemma. Denn echte Gründe für einen massiven Wertverlust kann man bei den ÖBB nicht erkennen. „Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen mit den Akkus gemacht“, erklärt Klug. „Wir lassen vor dem Verkauf der Fahrzeuge immer die Akkus testen. Und in den allermeisten Fällen liegt die Leistung noch bei über 90 Prozent der ursprünglichen Leistung und das nach vier bis fünf Jahren Nutzungsdauer. Die Batterien halten also länger, als alle glauben, nur hat sich das noch nicht herumgesprochen. Und das wird wohl noch etwas dauern.“ •
Unternehmen
Rail Equipment GmbH & Co KG
Fuhrpark
Marken: VW, Škoda, Seat, Kia, MAN, Ford, Maxus, Iveco
Anzahl Pkw: 1.650; Anzahl Nutzfahrzeuge: 2.807
Laufleistung: durchschnittlich 20.000 km/Jahr
Behaltedauer: 4 – 7 Jahre (Kauf)
Die heurige Studie des Arval Mobility Observatory zeigt, dass Unternehmen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin in ihre Flotten investieren.
Text: Stefan Schmudermaier, Foto: stock.adobe.com/Ali Hamza Tullah
Nachhaltigkeit, Effizienz und Arbeitgeberattraktivität als prägende Elemente, das ist die Kernaussage des aktuellen Fuhrpark- und Mobilitätsbarometers des Arval Mobility Observatory. Dazu wurden über 8.000 Entscheidungsträger – 300 davon in Österreich – befragt, die trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter gezielt in die Entwicklung ihrer Fuhrparks investieren.
Strategische Mobilität
92 Prozent rechnen in den kommenden drei Jahren mit einem stabilen oder wachsenden Fuhrparkvolumen, 16 mit Wachstum. Mobilität wird zunehmend als Instrument der Arbeitgeberattraktivität verstanden. 72 Prozent der Unternehmen haben eine Mobilitätsstrategie implementiert oder in Planung, mehr als die Hälfte bietet ihren Mitarbeitern mindestens eine Mobilitätslösung an. Besonders beliebt: Kostenersatz für Öffi-Nutzung (42 %), Zuschuss zu Autokosten (26 %) und flexible Automiete (21 %).
E-Mobilität
57 Prozent der heimischen Unternehmen setzen Autos mit alternativen Antriebstechnologien ein – Tendenz steigend. Die Gründe: niedrigere Kraftstoff- und Betriebskosten (32 bzw. 29 %), aber auch Umweltauswirkungen (31 %) sowie CSR-Ziele (29 %). Der Umstieg auf elektrische Nutzfahrzeuge hat sich hingegen leicht eingebremst. Trotzdem sehen fast zwei Drittel fehlende Ladelösungen als Bremsklotz. Viele entwickeln eigene Ladestrategien, die öffentliches, betriebliches und privates Laden umfassen. „Ohne durchdachte Ladeinfrastruktur bleibt Elektrifizierung Stückwerk. Arval begleitet Unternehmen bei ihrem Umstieg auf alternative Antriebe und berät bei allen Fragen zu E-Mobilität“, so Gregor Bilik, Geschäftsführer von Arval Austria.

In Österreich dominieren weiterhin Barkauf und Finanzierungsleasing.
Full-Service-Leasing bleibt stabil bei elf, 24 Prozent planen einen Umstieg oder Ausbau in den nächsten drei Jahren. Damit liegt Österreich hinter dem europäischen Durchschnitt, bei dem bereits 27 Prozent der Unternehmen Full-Service-Leasing nutzen, bei den deutschen Nachbarn sind es sogar 30.
Fuhrparkmanager gefordert
Die größten Herausforderungen für Fuhrparkmanager sind die Einführung alternativer Energietechnologien mit 32, die Eindämmung steigender Gesamtbetriebskosten mit 28 sowie die Anpassung an restriktive staatliche Maßnahmen zu Verbrennerautos mit 28 Prozent. Der Beitrag der Unternehmensmobilität zur CO2Reduktion greift noch langsam: 12 Prozent der Unternehmen haben sich konkrete Ziele zur Dekarbonisierung gesetzt, immerhin 28 beschäftigen sich damit. „Das Bewusstsein für die Vorteile ganzheitlicher Mobilitätskonzepte wird größer. Wir sehen darin einen wichtigen Schritt zu einem modernen, nachhaltigen und effizienten Fuhrpark“, so Bilik abschließend. •
Das Bewusstsein für die Vorteile ganzheitlicher Mobilitätskonzepte wird größer.“



Unser Servicepaket:
■ Individuell für alle Branchen
■ Praxisorientierte Planung
■ Nachgewiesene Sicherheit
■ Felxibles Baukastensystem
■ Immer perfekt organisiert Jetzt online konfigurieren oder unsere Experten stellen Ihnen die passende Lösung vor. Bott Austria

Im vierten und letzten Teil unserer Ratgeberserie von Gastautor und Fuhrparkprofi Andreas Kral geht es um die wichtigsten Begriffe der Schadenabwicklung bei geleasten Fahrzeugen und wann eine Auslagerung keinen Sinn ergibt.
Text: Andreas Kral, Fotos: stock.adobe.com/Natalia, Kral
Die Schadenabwicklung außer Haus zu geben, hat natürlich seine Vorzüge. Es gibt jedoch Grenzen der Auslagerung, die aufzeigen, dass es manchmal besser ist, selbst aktiv zu werden. Damit wollen wir uns dieses Mal vor allem beschäftigen.
Zum Beispiel im Falle einer etwaigen Ablehnung der Vergütung eines gegnerverschuldeten Schadens muss der Leasingkunde entscheiden, ob er das akzeptiert oder sich selbst mit dem gegnerischen Haftplichtversicherer auseinandersetzt und gegebenenfalls den Klagsweg beschreiten möchte. Naturgemäß trägt der Leasinggeber in solchen Fällen kein Prozessrisiko beziehungsweise übernimmt auch keine Kosten dafür. Ich selbst hatte einen Fall, bei dem der gegnerische Versicherer die Mehrwertsteuer bei einem beschädigten Pkw nicht bezahlen wollte und ich somit selbst aktiv werden musste. Letztendlich wurde die Mehrwertsteuer sowie die Anwaltskosten vom gegnerischen Versicherer übernommen.
Buchwert bei Restwert-/Operatingleasing Nicht unerwähnt ist zu lassen, dass bei Restwertleasingverträgen die Schadenabwicklung im Falle von beispielsweise Diebstählen oder Totalschäden völlig anders ist als bei Operating Leasingverträgen, bei denen der Restwert nicht bekannt ist und somit der aushaftende Buchwert – den der Kaskoversicherer in der Regel ersetzt – weder von diesem noch vom Flottenkunden genau nachvollzogen werden kann. Somit eröffnen sich „Gestaltungsmöglichkeiten“ für den Leasinggeber, der den ihm entstandenen Schaden gegenüber dem Kunden oder dem Versicherer einfach einfordert.
Beim Restwertleasing ist der Buchwert gemäß AGB immer nachvollziehbar, da geregelt ist, wie sich dieser ermittelt unter Berücksichtigung des dem Kunden bekannten Restwerts.
Definition Totalschaden
Auch ist es ein Unterschied, ob man sich bei Totalschäden an die Regelungen der Versicherer zu halten hat oder an die der Leasinggeber. Erstere haben in deren AGB geregelt, dass wenn der Marktwert und die Reparaturkosten den Wiederbe-
schaffungswert übersteigen, ein Totalschaden gegeben ist. Leasinggeber ziehen da oft schon viel früher die Reißleine und regeln in deren AGB dies wie folgt:
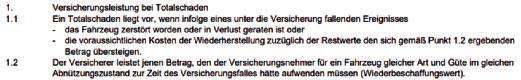
Grundsätzlich gilt: „Es ist stets eine Reparatur durchführen zu lassen, es sei denn, dass wegen Schwere oder Umfang der Schäden ein Totalschaden anzunehmen ist oder die voraussichtlichen Reparaturkosten 60 Prozent des Wiederbeschaffungswertes des Leasingfahrzeuges übersteigen. Im Falle des Diebstahls, Verlustes oder eines wirtschaftlichen oder technischen Totalschadens des Fahrzeuges (in der Regel bei schadensbedingten Reparaturkosten von mehr als 60 Prozent des Wiederbeschaffungswerts (entspricht Eurotax Einkauf)) sind beide Parteien berechtigt, den jeweiligen Einzelvertrag zum Ende eines Vertragsmonats außerordentlich zu kündigen.“

die Zeit dann zu überbrücken, bis sich automotiver Ersatz abzeichnet. Aber auch bei Pkw, wenn es das Modell nicht mehr neu gibt (Type, Motorisierung etc.).
Schäden bei Rückgabe Operating Leasing
Spannend wird es auch bei der Rückgabe der per Operating Leasing geleasten Fahrzeuge, weil der geforderte Rückgabezustand der Karosserie je Leasinggeber deutlich unterschiedlich ausfällt. Während die einen ein nahezu neuwertiges Fahrzeug erwarten und alle kleinen Dellen einzeln bewerten und dies auch als „Schadenersatz“, also zumindest ohne Mehrwertsteuer, verrechnen, sehen das andere pragmatischer und haben Abschläge auf alle Schadenkosten vorgesehen – abhängig von Alter und Laufleistung und auch ob Pkw oder KleinLkw, die ja meist mehr herangenommen werden. Dies zu Beginn einer Geschäftsverbindung zu klären, ergibt wirtschaftlich durchaus Sinn, wie viele Fuhrparkverwalter bekunden.
Merkantiler Minderwert on top
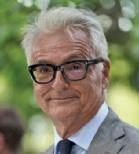
Naturgemäß ist man als Flottenkunde wenig begeistert, noch etwas zu bezahlen, wo im Falle des Eigenverschuldens der Kaskoversicherer aber eindeutig nicht aufkommt.
Es liegt an den Flottenkunden, zu entscheiden, ob für sie eine Auslagerung wirtschaftlich sinnvoll ist.“
Andreas Kral
Dann ist die Höhe ein Thema. Da wird oft bei zehn Prozent pauschaliert, was je nach Einzelfall völlig danebenliegen kann: Wenn etwa bei einem fünf Jahre alten Fahrzeug die Stoßstange durch Tausch zu erneuern, der Träger darunter aber nicht verbogen oder gestaucht ist, dann mit Sicherheit nicht. Es sind in der Branche Fälle bekannt, in denen vom Leasinggeber diese Wertminderung für den Ersatz von Windschutzscheiben verrechnet wurde. Da die mittlerweile durchaus 2.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer kosten können, wären dies immerhin 200 Euro pro Fall.
Einige Leasingfirmen verrechnen auch – trotz in deren Netzwerk fachmännisch reparierter Schäden – noch etwas zusätzlich, soweit die Beschädigung eine Wertminderung des Fahrzeugs verursacht hat. Doch ist dieser merkantile Minderwert rechtens und fair? Das kommt darauf an. Würde man – aber ohne Preisminderung – ein Fahrzeug kaufen wollen, welches mehrere teure Unfallschäden instandgesetzt bekommen hat während dessen Lebensdauer? Und wie würde man reagieren, wenn dies vor dem Kauf verschwiegen wird?
Wenn der Verkäufer die reparierten Unfallschäden dem potenziellen Käufer bewusst offenlegt und nicht – lediglich durch Vorlage des SV-Gutachtens, das die aktuellen noch nicht behobenen Schäden zeigt – verschweigt und es handelt sich um gröbere Unfallschäden, die die Karosserie entsprechend ver-

Im Falle eines Haftpflichtschadens bezahlt dies meist der gegnerische Versicherer – mit Einschränkungen, was Fahrzeugalter, Laufleistung oder Vorschadensfreiheit betrifft.
Den Leasingfirmen entstehen durch die in der Regel ja durchaus beschädigten Rückläufer tatsächlich Schäden. Fraglich ist allerdings, in welcher Höhe? Kein (meist gewerblicher) Käufer bietet um die Höhe der Unfallinstandsetzungskosten weniger für ein gebrauchtes Fahrzeug. Fast immer wird der Wagen nur um einen deutlich geringeren Betrag verkauft. Dieser „Minderwert“ sollte auch die Basis für den zu ersetzenden Schaden gegenüber dem Leasinggeber sein und nicht die aktuellen Schadeninstandsetzungskosten, noch dazu mit dem Stundensatz aus Wien, der aktuell der höchste in ganz Österreich ist. Zur Berechnung des Minderwertes gibt es auch entsprechende Programme, die Sachverständige ständig nutzen. Somit kann die Höhe auch im Einzelfall relativ genau ermittelt werden.
Es liegt nun an den Flottenkunden, zu entscheiden, ob für sie die Auslagerung auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Das Know-how der Fachleute der Leasingunternehmen sollte jenes vieler Fuhrparkverantwortlichen übertreffen. Die Entscheidung wird daher oftmals von vertraglichen Vereinbarungen und der Flottengröße sowie den Ressourcen beziehungsweise den vorhandenen Konditionen abhängen. •
Ob captive oder nicht, bei beiden Varianten ist es vielfach so, dass man die Reparaturkosten nicht vorfinanzieren muss. Im Zuge einer monatlichen Rechnung bekommt man den Selbstbehalt verrechnet beziehungsweise bei vorsteuerabzugsfähigen Fahrzeugen auch die Mehrwertsteuer vom Rechnungsbetrag. Und mit Glück auch die Kopie der Eingangsrechnung, bei der man dann mit nochmals etwas Glück auch die Arbeitszeit beziehungsweise Lackierkosten und Teilepreise nachvollziehen kann, so man dies möchte.
Seit mehr als 15 Jahren ist Keba einer der ganz großen Player in Sachen Ladeinfrastruktur. Wir haben CEO Stefan Richter in Linz getroffen und über neue Produkte sowie das Thema bidirektionales Laden gesprochen. Text: Stefan Schmudermaier, Foto: Keba
Keba war bisher für die AC-Wallboxen bekannt, jetzt hat man auch DC-Ladestationen im Programm. Deckt man nun alle Use-Cases rund ums Laden ab?
Keba war in der Tat bislang vor allem für ihre intelligenten ACWallboxen bekannt, ein Bereich, in dem wir seit 2009 technologisch führend sind und mit weit mehr als 500.000 Wallboxen im Einsatz den E-Mobilitätsmarkt stark geprägt haben. Durch die Kombination aus AC- und DC-Ladestationen von vier bis 480 kW bieten wir nun ein umfassendes Lösungsportfolio für sämtliche LadeUse-Cases, vom privaten Zuhause über gewerbliche und halböffentliche Anwendungen bis hin zum Hochleistungsladen im öffentlichen Raum, inklusive Monitoring und Lastmanagement – alles „Made in Austria“. Unser Ziel bleibt unverändert: Ladeinfrastruktur so einfach, intelligent und nachhaltig wie möglich zu gestalten.
herausragendes Merkmal ist die schnelle und einfache Installation: In der Regel ist die KeContact P40 in etwa 30 Minuten einsatzbereit. Möglich wird das durch die einfache 3-Punkt-Montage sowie die intuitive Konfiguration per Bluetooth und Keba eMobility App. Ein weiterer technologischer Fortschritt ist die integrierte Phasenumschaltung: Sie ermöglicht es, je nach Last und Energieangebot flexibel zwischen ein- und dreiphasigem Laden zu wechseln. Das ist insbesondere für PV-optimiertes Laden – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich – ein echtes Plus an Effizienz und Flexibilität.
Keba bietet AC- und DCLadestationen von 4 bis 480 kW samt Monitoring und Lastmanagement Made in Austria.“
Eine DC-Ladestation ist naturgemäß deutlich teurer als eine Wallbox. Kann es sich für Unternehmen und Fuhrparks trotzdem rechnen, eine solche aufzustellen?
Entscheidend ist der konkrete Anwendungsfall. Überall dort, wo Fahrzeuge in kurzer Zeit wieder einsatzbereit sein müssen – etwa bei Autobahn-, Raststätten- und Supermarkt-Parkplätzen, Lieferflotten, Taxibetrieben, Carsharing-Anbietern oder im gewerblichen Fuhrpark mit hoher Fahrzeugumschlagsfrequenz –, bieten DC-Ladestationen klare betriebswirtschaftliche Vorteile. Die deutlich verkürzten Ladezeiten ermöglichen eine höhere Fahrzeugverfügbarkeit und reduzieren Standzeiten, was sich unmittelbar in Effizienzgewinnen niederschlägt. Kurz gesagt: Wenn Ladegeschwindigkeit ein kritischer Faktor ist, kann sich der Einsatz von DC-Ladetechnologie für Unternehmen und Flotten – trotz höherer Anfangsinvestitionen – absolut rechnen.
Vor einigen Monaten kam die neue KeContact P40 Wallbox auf den Markt, wie ist der Rollout verlaufen? Mit der KeContact P40 haben wir einen wichtigen nächsten Schritt in der Weiterentwicklung unserer AC-Ladelösungen gesetzt. Aufbauend auf der bewährten und weiterhin erhältlichen KeContact P30 ist ein Produkt entstanden, das konsequent auf Nutzerfeedback und Installationspraxis ausgerichtet wurde. Ein

Das Thema bidirektionales Laden ist immer wieder in den Schlagzeilen, die P40 ist dafür bereits vorbereitet. Wann ist es Ihrer Ansicht nach mit der Umsetzung soweit?
Bidirektionales Laden – also die Möglichkeit, Energie nicht nur ins Fahrzeug zu laden, sondern auch wieder ins Haus oder Netz zurückzuspeisen – ist zweifellos eines der spannendsten Zukunftsthemen in der Elektromobilität. Die KeContact P40 ist bereits technologisch für diese Funktionalität vorbereitet, was bedeutet: Wenn die regulatorischen und technischen Rahmenbedingungen geschaffen sind, kann sie – je nach Markt und Fahrzeug – perspektivisch auch für bidirektionale Anwendungsfälle genutzt werden. Aus unserer Sicht ist die Umsetzung derzeit noch stark von externen Faktoren abhängig: etwa von der fahrzeugseitigen Unterstützung für Vehicle-to-Grid (V2G) oder Vehicle-to-Home (V2H), von der Standardisierung der Kommunikationsprotokolle sowie von rechtlichen und energiewirtschaftlichen Vorgaben. Wir rechnen damit, dass erste bidirektionale Anwendungsfälle im kleinen Maßstab – etwa im Bereich Vehicle-toHome bei PV-Nutzern – bereits in den nächsten 1–2 Jahren realisiert werden können. Mit der KeContact P40 haben unsere Kunden jedenfalls eine Wallbox, die zukunftssicher entwickelt wurde und bereits heute die technischen Voraussetzungen für bidirektionales Laden mitbringt. Auch im DC-Bereich engagieren wir uns bereits in ersten Forschungs- und Pilotprojekten und suchen aktiv den Austausch mit CPOs und Automotive-OEMs. •
Stefan Richter ist CEO der in Linz ansässigen Keba Energy Automation und damit auch für AC-Wallboxen und DC-Ladestationen verantwortlich

Der Markteintritt der neuen Technologie wird gerade vorbereitet
Wenn ein Elektrofahrzeug
Strom nicht nur aufnehmen, sondern auch wieder abgeben kann, kann es sich um bloßes Vehicle2Load (Auto lädt etwa das Elektrofahrrad auf) handeln oder um bidirektionales Laden. In dem Fall wird der gespeicherte Strom bedarfsgerecht an ein Gebäude oder an das öffentliche Stromnetz zurückgeben. Maxus arbeitet derzeit an der Markteinführung dieser Technologie in Europa und möchte künftig einen echten Mehrwert durch intelligente bidirektionale Ladelösungen bieten. Getestet wurde die Technologie bereits an den Modellen eDeliver 5, eDeliver 7 AWD und dem Pick-up eTerron 9. Immer in Kombination mit einer Ladestation

von der Firma Ambibox, die einen zertifizierten kompatiblen Lader nach DC-Standard mit bis 22kW Ladeleistung anbietet. Vorteil für Flotten: etwa, wenn sich das Fahrzeugdepot bei einem Warenlager oder Distributionszentrum befindet und der Strombedarf (teilweise) aus den Fahrzeugbatterien gedeckt werden kann. Aufladekosten können durch Einkünfte gegenfinanziert werden.

Quietschbunt kann man sich ihr nicht entziehen: Die ID. Buzz Bar wurde in Zusammenarbeit mit Lagermax und Czaika Schankanlagentechnik komplett neu konzipiert und gestaltet. Sie bietet eine Sonos-Box für feinen Sound, einen Riesen-Bildschirm im aufklappbaren Dach und selbst ein eigenes WLAN. Wer das vollelektrische Showcar mieten will, zahlt 700 Euro pro Tag oder eine WochenendPauschale von 1.500 Euro. Anfragen: www.vw-nutzfahrzeuge.at/id-buzz-bar

Jetzt kommt der ARI 901 mit Doppelkabine
Neuester Zugang im Portfolio von ARI Motors ist der ARI 901 mit fünf Sitzplätzen und Doppelkabine. Es handelt sich dabei um einen Elektrotransporter, der mit fünf verschiedenen Aufbauvarianten erhältlich ist, darunter Kofferaufbau, Pritsche und Kipper. 82 PS reichen für 100 km/h Spitzentempo, die Anhängelast beträgt 1.000 Kilogramm und das Ladevolumen 5,1 Kubikmeter (Kofferaufbau), die Ladefläche 3,2 Quadratmeter (Pritsche, Kipper). 260 Kilometer Reichweite sollen mit der 42-kWh-Batterie möglich sein, in 30 Minuten wird Strom für 80 Kilometer geladen.

SsangYong erfindet sich gerade neu, der mühsam erlernte Markenname (die Schreibweise!) weicht einem Kürzel: KGM für KG Mobility, was wiederum auf den Stahl- und Chemiekonzern KG Consortium hinweist, der bei den Südkoreanern nun das Sagen hat. Mit SUV in allen Größenklassen ist man schon jetzt ein Vollsortimenter, was Hochbeiner betrifft, und auch ein Diesel-Pick-up ist mit dem Musso Grand bereits im Angebot. Was beim Neustart fehlt, wird Ende des Jahres nachgereicht: der Elektro-Pick-up Musso EV, der mit einer 80,6-kWhBatterie passable Reichweiten bieten soll. DCSchnellladen mit 200 kW, ein Allradmodell mit Dual Motor folgt wohl 2026.




Bereits vor 15 Jahren zählte Renault mit dem Kangoo Z.E. zu den Vorreitern bei elektrischen Nutzfahrzeugen, die neuen Modelle Trafic, Estafette und Goelette sind nun aber nicht weniger als eine echte Revolution im Segment und überraschen mit coolen Lösungen und ultraschnellem Laden.
Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Renault
Als Renault bei der Nutzfahrzeug IAA im Herbst das Concept Estafette präsentiert hat, war noch nicht ganz abzuschätzen, wie viel Studie ein künftiges Serienfahrzeug in sich tragen würde. Wie wir bereits bei einem Termin in der Renault-Zentrale Guyancourt vor der eigentlichen Weltpremiere anlässlich der Nutzfahrzeugshow in Birmingham feststellen durften, ist das eine ganze Menge. Mit dem Nutzfahrzeug-Trio Estafette, Goelette und Trafic – bei allen weist der Zusatz „E-Tech Electric“ auf den vollelektrischen Antrieb hin –startet Renault in eine neue Ära.
Ultraschnelles Laden
Die sich zunächst technisch von so gut wie allem unterscheidet, was aktuell auf dem Markt ist. Die Basis aller drei Fahrzeuge ist eine SkateboardPlattform, die eine große Vielfalt bei den Aufbauten ermöglicht. Eine weitere Besonderheit ist die skalierbare und flexible Software-Architektur, die einfache Updates ermöglicht und – besonders wichtig – sich mit den Systemen der Nutzer verbinden lässt. Damit wird etwa die Bedienung eines

Die FLOTTE (l. Chefredakteur Stefan Schmudermaier) durfte als eines der wenigen Medien bereits vorab auf Tuchfühlung zu den neuen Renault-Modellen gehen, kurz vor seinem Abgang stand uns auch Nutzfahrzeug-Vorstand Heinz-Jürgen Löw (r.) für Fragen zur Verfügung
hauseigenen Logistik-Systems direkt über den Touchscreen im Fahrzeug ermöglicht, ohne dass es zusätzliche Installationen oder Geräte benötigt. Mehr als beachtlich ist aber auch die 800-Volt-Technologie, die erstmals bei Renault zum Einsatz kommt und bis dato auch bei den Pkw-Modellen noch nicht zu finden war. Über die genaue Ladeleistung gibt es zwar noch keine Informationen, über 200 kW gelten aber als gesetzt, die kleine Batterie soll in unter 20 Minuten von 15 auf 80 Prozent geladen sein.
Bis zu 450 Kilometer Reichweite Womit wir bei den Akkus angelangt wären. Renault bietet hier zwei Optionen je nach geplantem Einsatzgebiet. Im urbanen Bereich soll man mit der 60-kWh-Batterie und einer Reichweite von rund 350 Kilometern das Auslangen finden, zudem kommt diese dank LFP-Technologie (LithiumEisenphosphat) ohne Kobalt und Nickel aus. Im Gegensatz dazu basiert die größere 81-kWh-Batterie auf der Nickel-Mangan-Kobalt-Technologie, dank höherer Energiedichte sind hier rund 450 Kilometer möglich, ebenfalls basierend auf dem Trafic.
Revolutionärer Estafette
Vor allem der Estafette hebt sich stark von traditionellen leichten Nutzfahrzeugen ab. Mit einer Breite von 1,92 und einer Länge von 5,27 Metern bleibt die Grundfläche kompakt und auch in Innenstädten gut zu bewegen, außergewöhnlich ist die Höhe von 2,60 Metern. Im Visier hat man damit vor allem die Paketdienste auf der letzten Meile, die durch den Zuwachs der Online-Bestellungen in den letzten zehn Jahren ordentlich zugenommen
haben. Neben einem erhöhten Nutzwert hatte Renault auch die Ergonomie aus Fahrersicht im Visier, so bietet der Laderaum eine Stehhöhe von 1,90 Metern. Statt wie gewohnt zunächst auszusteigen und hinten oder seitlich in den Transportraum zu klettern, verbleibt der Fahrer im Auto, geht direkt in den Laderaum und verlässt das Fahrzeug dann über die rechte Schiebetür auf der für ihn zumeist sichereren
Seite. Auf einen normalen Beifahrersitz wurde verzichtet, im Regelfall unnötiger Ballast. Ein Klappsitz ermöglicht dennoch das Mitfahren einer zweiten Person im Bedarfsfall. Das Beladen des Estafette am Logistik-Hub erfolgt über ein Rollo am Heck, größere Pakete lassen sich dort auch entladen, ohne den zusätzlichen Platzbedarf einer Heckklappe oder von Flügeltüren.
Trafic noch alltagstauglicher
Auf gleicher Skateboard-Plattform wird auch der künftige Renault Trafic E-Tech Electric gebaut, das Verbrennermodell bleibt übrigens unverändert im Programm. Die Breite ist mit 1,92 Metern identisch mit Estafette und Goelette, als L1 mit einer Länge von 4,87 Metern liegt das Ladevolumen bei 5,1 Kubikmetern, die L2-Version mit 5,27 Meter Länge bringt es auf 5,8 Kubikmeter. Die Höhe wurde übrigens auf 1,90 Meter reduziert, was die problemlose Einfahrt in die allermeisten Tiefgaragen erlaubt. Das futuristische Styling wird von einem Leuchtenband samt hinterleuchtetem Logo sowie einer speziellen Windschutzscheibe geprägt. In der Art eines Triptychon



Estafette (o.), Goelette (l.) und Trafic E-Tech Electric (u.) basieren auf der neuen 800-Volt-E-Plattform und läuten auch softwareseitig eine neue Nutzfahrzeug-Ära ein

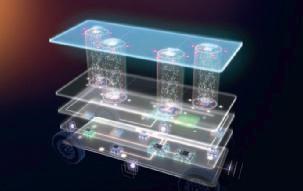
Die 800-Volt-Technologie ermöglicht ultraschnelles Laden, dank neuer Software-Architektur beiben die Fahrzeuge über Jahre up to date, was sich positiv auf die Restwerte auswirken soll.“
ist dank fast fließend ineinander übergehender Seitenflächen die Sicht deutlich besser, da breite A-Säulen entfallen. Gerade in der Stadt ein wichtiges Sicherheitskriterium. Ein
großes Augenmerk legten die Designer – wie auch bereits beim neuen Master – auf eine stromlinienförmige Aerodynamik, die den Verbrauch weiter senkt. Das Cockpit – bis auf den Beifahrerbereich nahezu ident mit dem Estafette – umfasst gleich zwei große Bildschirme, einen mit zehn Zoll hinter dem Lenkrad und einen Touchscreen mit zwölf Zoll in der Mitte des Fahrzeuges. Die jeansartigen Bezugsstoffe der Sitze kennt man in ähnlicher Form bereits aus dem elektrischen Renault 5, diese sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch sehr robust.
Der Goelette E-Tech Electric ist der Dritte im Bunde. Plattform und Fahrerkabine entsprechen dem des Trafic, die verstärkten Achsen erlauben Lasten bis zu 1,4 Tonnen. Das Fahrgestell kann entweder direkt bei Renault oder bei zertifizierten Umbauern bestückt werden und ermöglicht sogar Aufbauten mit über zehn Kubikmeter Ladevolumen. Auch ein verlängertes Fahrerhaus mit Platz für sechs Personen kann geordert werden. Alle drei Modelle sind mit vorausschauender Wartung ausgestattet, was die Planung für Fuhrparkleiter erleichtert und Kosten spart.
Produziert wird das Trio im RenaultWerk Sandouville, der Marktstart ist für 2026 geplant. •

Gemeinsam mit bott konfigurierte die naturenergie-Gruppe
Fahrzeugeinrichtungen speziell für die eigene E-TransporterFlotte. Schlüsselelement hierbei: das bei der vario3-Variante verbaute Aluminium.
Text: Redaktion, Fotos: bott
Elektromobilität ist schon längst keine Vision mehr, sondern in vielen Bereichen bereits gelebter Alltag. Das zeigt sich auch vermehrt im Bereich der Nutzfahrzeuge, in dem zum Beispiel die naturenergie Gruppe diesen Wandel als Anbieter von grünem Strom aktiv mitgestaltet. Die naturenergie Unternehmensgruppe bietet ganzheitliche Energielösungen und erzeugt sowie vertreibt erneuerbare Energie aus Wasserund Sonnenkraft. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereiche Photovoltaik, Wärme, Bauen und Wohnen sowie Elektromobilität. Das Tochterunternehmen naturenergie netze GmbH verantwortet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Stromverteilnetze.
Vielfach verbaut
So unterschiedlich die Teilbereiche, so vielfältig auch die Anforderungen an die Fahrzeugflotte und die verbauten Inneneinrichtungen. Dem eigenen Anspruch folgend wird natürlich auch intern der Klimaschutz großgeschrieben: Bereits 60 Prozent des aus gut 430 Fahrzeugen
bestehenden Fuhrparks sind bereits rein elektrisch betriebene Modelle. Und insbesondere der durch die Tochtergesellschaft naturenergie netze GmbH genutzte Teil der Flotte ist umfangreich mit Fahrzeugeinrichtungen von bott ausgestattet.
Nomen est omen
Meik Römer, bei der Unternehmensgruppe für den Fuhrpark zuständig, schätzt besonders die Qualität und das Material der Ausbauten: Durch den Einsatz von Aluminium ist das Gewicht der bott-vario3-Einrichtung sehr gering, ohne aber bei der Stabilität Abstriche machen zu müssen. Das sorgt nicht nur für eine größere Reichweite, sondern erhöht auch die mögliche Zuladung der Fahrzeuge, was bei Diesel als auch Elektro deutliche Vorteile bringt. Das ist aber noch nicht der einzige Grund, warum man sich für bott entschieden hat. „Wir haben verschiedene Servicefahrzeuge für unterschiedliche Zwecke“, erzählt Römer, „und mit bott arbeiten wir schon jahrelang zusammen. Ein guter Partner, vor allem für die E-Fahrzeuge, die


Für Meik Römer, zuständig bei naturenergie für den Fuhrpark, ist bott ein wertvoller Partner für Einrichtungen, vor allem für die E-Autos der Flotte eine Herausforderung waren.“ So konnten unter anderem die Inlays speziell angepasst werden, damit alles auch haargenau passt und jedes Werkzeug richtig sitzt. Ein Prozess, der nicht mit der Unterschrift unter dem Kaufvertrag endet – im Gegenteil, so Römer: „Das ist die Qualität des Marktführers. Und daher gibt es alle zwei bis drei Wochen zwischen bott und uns einen regelmäßigen Austausch.“ •

Der Mercedes eSprinter hat kürzlich ein Update erfahren und kommt nun mit drei Batteriegrößen, um möglichst viele Bedürfnisse abzudecken. Überzeugend auch die Variantenvielfalt.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Es kommt nicht von ungefähr, dass die Klasse der großen Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen – bei den Elektromodellen bis zu 4,25 Tonnen – auch Sprinterklasse genannt wird. Seit 1995 ist der Mercedes-Transporter für viele Unternehmen nicht mehr wegzudenken, in vielen unterschiedlichen Gewerken ist er täglich im harten Einsatz zu finden. Seit der letzten Generation ist auch eine vollelektrische Version zu haben, mit dem Facelift vor einigen Monaten hat diese ein umfangreiches technisches Update bekommen.
Drei Akkugrößen
Wichtigste Neuheit sind die nun drei Batteriegrößen, 56, 81 und 113 kWh ermöglichen den Transporteuren, die nötige Reichweite zu erzielen, ohne übers Ziel hinauszuschießen, schließlich kosten größere Akkus auch empfindlich mehr Geld. Rund 7.000 Euro netto beträgt der Aufpreis auf 81 kWh – die auch in unserem Testwagen verbaut waren –, 13.300 Euro kommen nochmals für die ganz große Batterie dazu, die aber nur mit langem Radstand und Hochdach kombinierbar ist. Auf 221 Kilometer Reichweite kommt
das Basismodell, das sich damit nur für urbane Aufgaben empfiehlt. Die goldene Mitte schafft schon 336 Kilometer nach WLTP, die Praxisreichweite hängt freilich maßgeblich von der Beladung und den äußeren Bedingungen ab. Der große Akku schafft bereits 447 Kilometer. Standardmäßig liegt die Höchstgeschwindigkeit aller Modelle übrigens bei 90 km/h, um sich auf der Autobahn Duelle mit Lkw zu sparen, sei die Option auf 120 km/h wärmstens empfohlen.
Laderaum: Große Vielfalt
Geladen wird AC mit elf kW, in acht Stunden ist unser Testauto somit wieder voll, ideal für das nächtliche Stromzapfen. Am DC-Schnelllader dauert es rund eine halbe Stunde, um von zehn auf 80 Prozent nachzuladen. Eine besondere Erwähnung verdient das Cockpit, das sich sehr hochwertig und individuell ausstatten lässt, der digitale Innenspiegel für 650 Euro ist ein Muss. Der Laderaum fasst zwischen 9,0 und 14,0 Kubikmeter, die Nutzlast geht bis zu 1.725 Kilogramm, maximal zwei Tonnen lassen sich an den Haken nehmen. Die Preisliste des eSprinters beginnt



Die Variantenvielfalt des eSprinters steht jener der Dieselmodelle um nichts nach, bis 14 m3 und 1.725 kg Nutzlast sind möglich; das Cockpit lässt sich sehr wohnlich einrichten
bei 43.605 Euro netto, unser Modell mit mittlerer Batterie und Hochdach in Select-Ausführung kam auf 55.258 Euro. Die vergleichbare Dieselversion 317 CDI Select mit 170 PS und Automatikgetriebe kommt – ohne NoVA –auf 46.509 Euro. •
Mercedes-Benz eSprinter Kasten
Grundmodell: Base 314 Normaldach 56 kWh Testmodell: Select 320 Hochdach 81
Leistung | Drehmoment 136 PS (100 kW) | 400 Nm 204
(150
| 400 Nm Dauerleistung | Gewicht
0–100 km/h | Vmax k. A. | 90 km/h/120 km/h k. A. | 90 km/h/120 km/h
Reichweite | Antrieb 221 km | Hinterrad 336 km | Hinterrad Ø-Verbrauch | Batterie 23,8 kWh | 56
|
Laden AC 11 kW, 5:30 h (0–100 %) 11 kW, 8:00 h (0–100 %)
Laden DC 115 kW, 28 min (10–80 %) 115 kW, 32 min (10–80 %)
Laderaum | Nutzlast 9,0 m3 | 993 kg 10,5 m3 | 981 kg
Basispreis | NoVA 43.605 € (exkl.) | 0
55.258 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Zuladung, Cockpit, Fahrleistungen, Anhängelast
Das vermissen wir: einen digitalen Rückspiegel (optional erhältlich)
Die Alternativen: die großen Stellantis-Nfz Ford Transit, Renault Master Werksangaben (WLTP)


Kein anderer Hersteller hat aktuell ein komplett elektrifiziertes Nutzfahrzeug-Portfolio mit gleich vier unterschiedlichen Modellen. Ford überzeugt aber nicht nur mit der Hardware, sondern auch der Ford Pro Software. Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Ford Pro
Beim Verkauf elektrischer leichter Nutzfahrzeuge hinken die Hersteller den selbst gesetzten Zielen oft hinterher. Zumeist nicht, weil die Produkte nicht zu den Anforderungen passen würden, sondern vielmehr deshalb, da die meisten Kunden offenbar noch nicht zum Umstieg bereit sind. Und vielfach nur den höheren Anschaffungspreis sehen, ohne die TCO im Blick zu haben, schließlich können sich die E-Nutzis durchaus heute schon rechnen, freilich abhängig vom Usecase und etwaigen Förderungen.



Gewachsen: Neuer E-Transit Courier Bei Ford hat sich in den letzten Jahren ordentlich was getan im Hinblick auf die Elektrifizierung leichter Nutzfahrzeuge. Mittlerweile ist bis auf den Transit Connect – das Modell entsteht in Kooperation mit VW und ist zumindest als Plugin-Hybrid zu haben – jedes Modell auch als E-Variante erhältlich. Ganz neu im Sortiment ist der E-Transit Courier, das kleinste Modell des Vollsortimenters. Wobei klein relativ zu sehen ist, gegenüber dem wirklich kompakten Vorgänger verfügt der neue Transit Courier über einen 25 Prozent größeren Laderaum, der nun zwei Europaletten fasst, dank Durchlademöglichkeit in den Beifahrerfußraum bis zu 2,6 Meter lange Gegenstände aufnehmen kann und ein Volumen von 2,91 Kubikmeter bereitstellt. Vorbildlich und bis dato eher die Ausnahme bei E-Nutzfahrzeugen: Ein Frunk mit 44 Litern erlaubt es, Ladekabel
Der Ford Transit Connect – auch als Plug-inHybrid – ist dank cleverer Klappbank im Fond als Transporter oder bis zu fünf Personen nutzbar

oder Autoapotheke und Pannendreieck nicht im Laderaum verstauen zu müssen.
Ausreichende Reichweite
Apropos Laden, der 43 kWh große Akku ist am Schnelllader mit 100 kW in 23 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen, mit einem WLTP-Durchschnittsverbrauch von 17,1 kWh kommt der E-Transit Courier knapp 300 Kilometer weit. Spannend: Laut den Daten vernetzter anderer FordFahrzeuge fänden 86 Prozent der aktuellen Kunden das Auslangen damit. Das Cockpit ist auf Pkw-Niveau, ein 12-ZollTouchscreen ist ebenso mit dabei wie eine kabellose Smartphone-Integration. Basierend auf dem deutschen Markt spart der Kunde gegenüber dem dieselgetriebenen Transit Courier bei 120 täglichen Kilometern jährlich 1.350 Euro ein.
Plug-in-Hybrid im Transit Connect
Der nächstgrößere Bruder Transit Connect wird bei Volkswagen gebaut und dort als Caddy verkauft, bis auf einen anderen Kühlergrill halten sich die Unterschiede beim Ford in Grenzen, auch technisch. Der neue Plug-in-Hybrid bringt es dank 19,7 kWh großer Batterie auf eine rein elektrische Reichweite von 119 Kilometern nach WLTP. Das in zwei Längen angebotene Modell schluckt bis zu 761 Kilogramm, verfügt über ein Volumen von 3,7 Kubikmetern und kann bis zu 1,5 Tonnen an den Haken nehmen. Besonders Clever ist das FlexCab-Modell, bei dem sich mit nur einem Handgriff die hintere Sitzbank hochklappen lässt, was aus einem Fünfsitzer einen Zweisitzer mit großem Laderaum zaubert. Im Vergleich zum Diesel lassen sich hier bei 80 täglich gefahrenen Kilometern 880 Euro jährlich sparen.
E-Transit Custom auch mit Allradantrieb
Der Ford E-Transit Custom entstammt ebenfalls der Kooperation mit Volkswagen, mit dem Unterschied, dass hier Ford den technischen Lead hat. VW hat das Design des Transporters allerdings nicht nur außen, sondern auch innen angepasst. Auch diesen Transporter – sowie sein Pkw-Pendant Tourneo Custom – gibt es in vollelektrischen Varianten mit einer Reichweite bis zu 327 Kilometern nach WLTP und demnächst auch vollelektrisch mit Allradantrieb.
Reichweitenupdate beim E-Transit auf 402 Kilometer
Der größte Ford Transporter in der Klasse der leichten Nutzfahrzeuge, der Transit, hat als E-Variante ein Update in Sachen Reichweite bekommen. Dank eines Akkus mit 89 nutzbaren Kilowattstunden sind 402 Kilometer nach WLTP möglich. Statt elf kann der E-Transit nun auch mit 22 kW in unter sechs Stunden laden, die DC-Ladepower wurde von 115 auf 180 kW angehoben, zehn auf 80 Prozent sind so in nur 28 Minuten nachgeladen. Für noch mehr Effizienz sorgt nun eine serienmäßige Wärmepumpe. Ford bietet den große Elektro-Transporter in 19 Varianten an, die maximale Zuladung beim Kastenwagen liegt bei 1.460 Kilogramm. Besonders praktisch: Für unterschiedliche Anwendungen lassen sich Elektrogeräte bis zu 2,3 kW Leistung direkt und autark an der Batterie des E-Transit betreiben.
Spritziges Fahrverhalten bei allen Modellen
Was das Fahrgefühl betrifft, so sind alle Modelle auch mit Zuladung erfreulich spritzig, gegen das hohe und sofort anliegende Drehmoment des Elektromotors hat der Dieselmotor jedenfalls keine Chance. Selbst der wirklich riesige E-Transit in L3H3 lässt sich flott bewegen, wie wir bei den ersten Testfahrten feststellen durften. Wie es mit den Reichweiten in der Praxis aussieht, werden wir bei ausführlichen Einzeltests in den kommenden Monaten eruieren.
Abseits der Fahrzeuge will Ford seine Kunden dazu animieren, die vielseitigen Features von Ford Pro zu nutzen. Bereits seit 2019 sind in allen Nutzfahrzeugen Modems verbaut, die unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Als Basisfunktion lässt sich das Fahrzeug mit einer App verbinden, mittels dieser nicht nur ver- und entriegelt werden kann, sondern auch der Akkustand beziehungsweise




und der E-Transit Custom
der Ladevorgang überwacht und die Vorklimatisierung aktiviert werden kann. Während immer mehr Kunden diese kostenlose Verbindung aktivieren, stecken darüber hinausgehende Services noch in den Kinderschuhen, gerade einmal zwei Prozent machen davon Gebrauch. Dabei könnten die Lösungen von Ford Pro nicht nur die Routenplanung optimieren, sondern sogar selbsttätig Servicetermine vereinbaren und das Fahrverhalten des Fahrers positiv beeinflussen, was sich wiederum auf die TCO auswirkt. Besonders beeindruckend: Einfachere Servicearbeiten kann der mobile Ford-Service sogar vor Ort machen, während das Fahrzeug etwa auf einer Baustelle steht und nicht benötigt wird. Allerdings wird dieser Service in Österreich aktuell noch nicht angeboten. •


Vier Marken mit je drei Modellen ergeben ein Portfolio, mit dem sich Stellantis zum Marktführer im Segment der leichten Nutzfahrzeuge aufgeschwungen hat. Auf den Lorbeeren ausruhen ist aber nicht drin:
4x4-Partner Dangel liefert eine elektrische Hinterachse und Wasserstoff ist ebenso noch ein Thema.
Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Oliver Hirtenfelder
Bei Nutzfahrzeugen bis 4,2 Tonnen gibt es weder in Österreich noch in Europa ein Vorbeikommen am Stellantis-Konzern.
Citroën, Fiat Professional, Opel und Peugeot sind kumuliert klar die Nummer 1. Ende 2024 wurde das gesamte Programm der leichten Nutzfahrzeuge aktualisiert, 2025 ist somit das erste volle Jahr mit dem brandneuen Line-up. Zeit, Stärke zu zeigen und das starke Portfolio auf einen Blick zu präsentieren. Schauplatz: Driving Camp Pachfurth in einem östlichen Zipfel Niederösterreichs.
Telematik: In Echtzeit verbunden Martin Riha, Manager Nutzfahrzeug Business Unit bei Stellantis Austria, unterstreicht in seiner Präsentation vor den Testfahrten noch einmal, dass es sich bei den letzten Änderungen um mehr als ein Facelift handelte. Natürlich wurde auch der Innenraum der Modelle für mehr Komfort optimiert, zusätzlich gibt es leistungsfähigere Konnektivitätssysteme und elektronische Fahrassistenzsysteme der nächsten

Combo, Berlingo, Doblo und Partner können ab sofort mit einer elektrischen Hinterachse von 4x4-Spezialist Dangel zum Allradler aufgerüstet werden
Generation. Sicheres, stressfreies Fahren steht im Fokus der vier Marken. Auch an die Fuhrparkbetreiber wurde bei den Updates gedacht: Sie sind in Echtzeit mit ihren Mitarbeitern verbunden. Drahtlose Konnektivität ermöglicht dabei Servicepakete wie vorbeugende Wartung, Eco-Drive-Coaching, EV-Routing und Lademanagement – alles zubuchbar und zum Kostensparen ausgelegt. Over-the-Air-Updates stehen ebenso bereit, ein Werkstattbesuch für neue Software oder Funktionen kann somit entfallen.
Um eventuelle Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten der Flotte zu reduzieren, ist moderne Telematik unabdingbar. Flottenmanagementdienste helfen hierbei. Sie können entweder als Rohdaten bereitgestellt oder in ein Service-Tool integriert werden. Die erwähnte Echtzeitkommunikation verfügt über ein fahrzeuginternes und interaktives Task-Management-Tool. Aufgabenzuweisung und Statusaktualisierungen können vor Ort also direkt über das Fahrzeug ablaufen.
Alle auch als BEV erhältlich
Alle vier Marken bieten je drei Nutzfahrzeug-Profis in den klassischen Segmenten. Und für alle gilt: Jedes Modell kann auch in einer vollelektrischen Version (BEV) auf den Firmenhof rollen. In den mittelgroßen E-Transportern sind Batteriepakete mit Kapazitäten von 50 oder 75 kWh Batteriekapazität verbaut. Reichweiten bis 350 Kilometer sind damit möglich. Bei den großen E-Transportern sind es dank 110 kWh bis 420 Kilometer Reichweite, was Stellantis zum Ausruf „Klassenbeste!“
veranlasst. Was die Kunden tatsächlich von den elektrischen Mitarbeitern auf vier Rädern halten, wird im nebenstehenden Interview verraten. Auch das Thema Wasserstoff wird dort angesprochen, schließlich sind bereits zwei Modelle fit, um mit H2 betankt zu werden. Beim Vivaro-e Hydrogen sind Reichweiten von mehr als 400 Kilometern möglich, der Movano-e Hydrogen knackt sogar die 500 Kilometer. Der WasserstoffBrennstoffzellenantrieb ist stets mit einer Plug-in-Batterie kombiniert.
Mit eXWD den Berg stürmen
Goran Maric, beim Importeur als Director B2B tätig, verweist vor Ort auf die Partner, mit denen sich individuelleAnforderungen umsetzen lassen, etwa Würth oder Zeko Mobility. Dangel ist bereits seit den 1980ern ein Begriff in Österreich, das französische Unternehmen läutet mit seiner elektrischen Hinterachse eine neue Ära ein. Die Modelle Opel Combo, Citroën Berlingo, Fiat Doblò und Peugeot Partner können damit ausgerüstet werden; vorerst nur die Dieselmodelle, die Stromer folgen. Auf den Offroad-Kursen in Pachfurth überzeugen wir uns, wie flott eXWD zupacken kann, wenn es nötig ist. Ein von 48-Volt-Batterien – sie laden sich während der Fahrt stets selbst auf – gespeister Elektromotor sorgt dafür, dass die Untersetzung immer den nötigen Grip bietet. Ein wenig erhöhte Bodenfreiheit und ein bisschen Schutz für den Unterboden zählen ebenso zum Paket, mit dem wir vor Ort steilste Steigungen in Angriff nehmen, um uns dann von einer Bergabfahrhilfe sachte nach unten begleiten zu lassen. Erkennt das System, dass die Haftung wieder passt, hat die Hinterachse spritsparend Pause. Mit den über einen Drehschalter anwählbaren Modi lässt sich das Level der Mithilfe steuern. „Auto“ ist im Alltag die beste Wahl, in einer feuchten Kurve etwa ist die sachte Hilfe aus dem Elsass (heute: Region Grand Est) willkommen. Mit „Low“ und „Lock“ können rutschige Passagen und extreme Bedingungen gemeistert werden. •
Elektromobilität ist bei den Kunden voll angekommen, meinen die NfzSpezialisten bei Stellantis Austria: Martin Riha, Manager Nutzfahrzeug Business Unit, und Goran Maric, Director B2B, im Interview.
Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Oliver Hirtenfelder
Mit dem Wegfall der NoVA für leichte Nfz werden Dieselmodelle ab Juli wieder deutlich günstiger. Wie sieht es vor diesem neuen Hintergrund mit dem Hochlauf der E-Mobilität aus?
Bei TCO-Vergleichen sind Fahrzeuge wie der Ducato mit beiden Antriebsformen etwa gleichauf, je nach Nutzungsart kann das vollelektrische Modell sogar günstiger sein. Gerade im Last-Mile-Bereich hat Elektro seine Zielgruppe, das ist beim Kunden voll angekommen und da gibt es auch keine Ängste mehr. In einem Kundengespräch geht es heute um Education, um den optimalen Bedarf. Für den einen ist das Elektromodell perfekt, für den anderen nach wie vor der Verbrenner. Mit unserem Portfolio können wir jedem Kunden das richtige Fahrzeug anbieten. Außerdem werden Car Policies seit Jahren schleichend elektrifiziert, die Kunden fragen proaktiv nach Elektromodellen. Man muss nicht mehr philosophieren, ob das überhaupt praxistauglich ist.
Wie sieht es mit der Dynamik im Markt der leichten Nfz aus?
Nachdem es 2021 viele Vorzugskäufe gab und es immer 48 Monate Vorlaufzeit gibt, steht jetzt wieder eine Drehung der Fuhrparks an – egal ob ICE oder BEV. Jede Firma wird das heuer erneut bewerten und wir denken, dass viele, die noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind, jetzt auf Elektromodelle umsteigen. Bestimmte Kennzahlen gibt es natürlich zu erreichen. Wir sind im neuen Retailersystem voll angekommen, sind hier die Benchmark. Man sieht es an den Marktzahlen.
Was sind die Erwartungen an die neuen Versionen mit Dangel-Allradantrieb?
Durch den Technologiechange auf den elektrischen Allradantrieb gab es eine kurze Pause von sechs Monaten. Aktuell sehen wir ein Potenzial von 400 Fahrzeugen für alle vier Marken, bisher waren es etwa 200 Fahrzeuge pro Jahr. Elektro-
modelle mit Allradantrieb gibt es in dieser Form nicht am Markt, damit können wir im Besonderen Flotten im Westen ansprechen. Die Österreichische Post ist zu 100 Prozent auf Elektromobilität umgestiegen, hier können wir mit Allrad im Nfz-Bereich eine Lücke füllen. Auch beim Verbrenner bietet der elektrische Allrad mit geringeren CO2-Werten einen Vorteil.
Wasserstoff: Was gibt es Neues?
Opel hat die Nutzfahrzeuge mit WasserstoffBrennstoffzellentechnologie im Wasserstoff-Kompetenzzentrum in Rüsselsheim entwickelt und ist der Pionier. Einen großen Vorteil gibt es dabei bei den Produktionskosten: bei Opel werden die gleichen Basisnutzfahrzeuge verwendet, nur die Antriebseinheit wird gewechselt, daher ist auch das Ladevolumen der Fahrzeuge unverändert. Das große Thema ist natürlich die Verfügbarkeit des Wasserstoffs, idealerweise des grünen Wasserstoffs, in Österreich. Für Unternehmen, die selbst ihren Wasserstoff produzieren und ihre Logistik dahinter haben, ist der Einsatz von Nutzfahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb eine gute Mobilitätslösung. Unternehmen, die keinen Zugang zu Wasserstofftankstellen haben, empfehlen wir Elektro-Nutzfahrzeuge, da man diese überall unkompliziert laden kann. •

Bei den Nfz-Probefahrten in Pachfurth konnten wir uns mit Martin Riha und Goran Maric über die aktuelle Marktsituation unterhalten

Der neue Toyota Proace Max ist elektrisch auch mit 4,25 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht zu haben. Dies bringt aber einige Einschränkungen mit, da das Fahrzeug dann als Lkw typisiert ist.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Auf den ersten Blick ist der Toyota Proace Max ein klassischer Kastenwagen. Auch auf den zweiten und den dritten Blick. Und doch handelt es sich hier um einen Lkw, jedenfalls aus juristischer Sicht. Denn das höchst zulässige Gesamtgewicht liegt hier bei 4.250 Kilogramm. Normalerweise ist beim B-Führerschein bei 3,5 Tonnen Schluss, aufgrund des Batteriegewichtes macht der Gesetzgeber hier aber eine Ausnahme, wer den B-Schein mindestens zwei Jahre besitzt, darf ohne Zusatzausbildung hinters Steuer. Umgekehrt gelten aber trotzdem die strengen Regeln eines Lkw. Will heißen, auf Autobahnen maximal 80 und auf Landstraßen höchstens 70 km/h, bei Tacho 90 ist der Transporter ohnedies abgeregelt. Auch das Ziehen von Anhängern ist mit dem B-Schein nicht erlaubt. Wer weiter als 100 Kilometer vom Unternehmensstandort wegfährt, muss zudem den Fahrtenschreiber aktivieren. Und auf der Autobahn heißt es Go-Box statt Vignette.
Top-Ausstattung im Select-Paket Wozu das alles, wird sich nun so mancher fragen. Nun, wie eingangs erwähnt, geht es hier um die erlaubte Zuladung. Mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen fällt die Zuladung des E-Modells mit
maximal 635 Kilogramm eher mager aus, als Lkw darf man indes 1.385 Kilogramm im je nach Länge 13 bis 17 Kubikmeter großen Laderaum verstauen. Somit hängt es vom Einsatzbereich ab, ob sich der Aufwand lohnt oder nicht. Egal ob leichtes Nutzfahrzeug oder Lkw, ein feiner Transporter ist der aus der Kooperation mit Stellantis stammende Proace Max aber in jedem Fall. Erst recht, wenn man sich das mit 1.920 Euro (netto) mehr als fair eingepreiste Select-Paket gönnt. Darin enthalten sind unter anderem Navi, Keyless Entry, Sitzheizung, Parksensoren rundum, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik und vieles mehr.
Stolze 424 Kilometer Reichweite
Auch beim Akku schöpft der Proace Max aus dem Vollen, satte 110 kWh fasst der und ist gut für Reichweiten bis zu 424 Kilometern nach WLTP. Die Ladeleistung von 150 kW ist ebenfalls fein, in 55 Minuten ist die Batterie von null auf 80 Prozent geladen. Der Preis der Lkw-Version liegt mit 64.590 Euro knapp 2.000 Euro über dem 3,5Tonner, der 180 PS starke Diesel samt Automatikgetriebe kostet im Vergleich dazu 60.210 Euro (alle Preise netto), noch inklusive NoVA in Höhe von 10.860 Euro, die ja ab 1. Juli fallen soll. •

Das Cockpit ist durchwegs hochwertig, das Select-Paket beinhaltet Navi, Klimaautomatik und vieles mehr; wer über 100 Kilometer vom Unternehmensstandort wegfährt, muss beim 4,25 Tonner den Fahrtenschreiber aktivieren



0–100 km/h | Vmax k.
Basispreis
Das gefällt uns: sehr hohe Reichweite, umfangreiche Ausstattung
Das vermissen wir: 10 km/h mehr Höchstgeschwindigkeit
Die Alternativen: alle baugleichen Transporter der Stellantis-Gruppe Werksangaben (WLTP)



Auf der FLEET Convention 2025 wird das neueste Elektromodell erstmals heimischem Publikum präsentiert.
Der am 6. März der Weltöffentlichkeit vorgestellte Volvo ES90 ist eine vollelektrische, Software-definierte Premiumlimousine, die über modernste Prozessoren verfügt, was sie zum rechenstärksten Fahrzeug macht, das Volvo je entwickelt hat. Dadurch wird die Messlatte für Sicherheit und Performance mithilfe von Daten, Software und KI auf ein neues Niveau gehoben. Darüber hinaus ist der ES90 das erste Volvo Modell mit 800-VoltLadetechnik, wodurch Ladezeiten verkürzt werden. Als Reichweite werden bis 700 Kilometer laut WLTP angegeben, in zehn Minuten

Die Hybridmodelle Captur und Symbioz von Renault bieten künftig 15 PS mehr Systemleistung. Sie sollen mit 25 Prozent Drehmoment-Anstieg ein besseres Ansprechverhalten, jedoch geringeren Kraftstoffverbrauch bieten.
Beide sprinten in unter zehn Sekunden auf 100 km/h. Beim Symbioz kommt darüber hinaus eine Mildhybrid-Variante dazu.
kann an einer 350-kW-Schnellladestation genügend Energie für weitere 300 Kilometer nachgeladen werden. Das Design kombiniert die Eleganz einer Limousine, die Flexibilität eines Schrägheckmodells sowie die leicht erhöhte Bodenfreiheit eines SUV. Drei Ausstattungslinien und drei Antriebsvarianten sind ab 69.990 Euro (exkl. 58.325 Euro) zu bestellen. Der Importeur verspricht Top-Business-Konditionen für Flotten, im Dezember dieses Jahres werden die ersten Fahrzeuge in den Schauräumen der österreichischen Volvo-Partner erwartet.

„Mit großer Reichweite, großzügigem Raumgefühl und digitaler Raffinesse auf Premium-Niveau erfüllt er höchste Ansprüche moderner Mobilität“, sagt Sarah Lamboj, CEO Smart Österreich, über den #5. Das neue BEV ist bei neun Partnern erhältlich und beginnt als Pro bei 49.000 Euro (exkl. 40.833 Euro). Höhere Linien mit 800-Volt-Techologie.

Ohne große Vorankündigungen bringt MG Motor Austria den neuen MGS5 auf den Markt. Das vollelektrische SUV, mit 4,47 Meter Länge ist somit etwas größer als der ZS EV und auch der aktuelle ZS Hybrid+. Bei der 49-kWhVersion nennt MG 340 Kilometer Reichweite, für die 64-kWh-Batterie heißt es: 480 Kilometer beim Comfort-Modell und 465 Kilometer beim Luxury. Die Ladeleistungen betragen 120 bzw. 139 kW, der Kofferraum schluckt 453 bis 1.441 Liter. Listenpreis ohne aktuelle Aktionen: ab 34.990 Euro (exkl. 29.158 Euro).

Als „Micra Mouse“ wurde er in Österreich populär, Ende 2025 lässt Nissan den Micra als Elektromodell auferstehen. Wie der Plattformbruder Renault 5 wird er in Douai (F) produziert, der Japaner hebt sich mit runder Leuchtengrafik optisch ab. Auch das markentypische e-Pedal mit Bremsungen bis zum Stillstand ist zusätzlich vorhanden.
Der Renault 5 hat die Herzen im Sturm erobert, mit dem elektrischen R4 bringt Renault nun den etwas pragmatischeren, aber alles andere als langweiligen großen Bruder, ein erster Test.
Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Stefan Schmudermaier, Renault
Man musste kein Prophet sein, um den Erfolg des Renault 5 abschätzen zu können, der kleine Elektro-Franzose ist in die Herzen der Österreicher gefahren, Platz 1 unter den E-Autos im ersten Quartal! Mit dem R4 kommt nun ein weiteres, auf der E-Plattform aufbauendes Fahrzeug auf den Markt, entsprechend hoch waren die Erwartungen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Versteht sich der R5 als kleiner, sportlicher Flitzer, bietet der R4 dank anderer Abstimmung mehr Komfort, behält aber seine flotte Beschleunigung (8,2 bzw. 9,2 Sekunden auf 100 km/h) bei. Sehr fein: Erstmals wurde ein Renault mit Wippen am Lenkrad zur Steuerung der Rekuperation ausgestattet. Insgesamt vier Stufen bis hin zum One-Pedal-Driving – also der Rekuperation bis zum Stillstand, ohne die Bremse zu betätigen – stehen zur Wahl.
Elektrisches Stoffdach
Ebenfalls eine Premiere im Konzern feiert das beleuchtete Renault-Logo an der Front, das ebenso wie die Scheinwerfer hinter einer riesigen Plexiglasabdeckung untergebracht ist, allerdings den Versionen Techno
und Iconic vorbehalten ist. Größtes Unterscheidungsmerkmal der beiden Varianten ist das Interieur. Während der Techno mit coolem Jeans-Stoff ausgeschlagen ist, kommt beim Topmodell Iconic Kunstleder auf Sitzfläche und Rückenlehne zum Einsatz. Ausstattungsfeatures, die beim Iconic Serie sind, lassen sich beim Techno nachrüsten, bis auf die unterschiedlichen Felgen und ein paar Kleinigkeiten sind die Autos dann nahezu ident. Das coolste Feature kommt erst Ende des Jahres, dann ist der R4 auch als „Plein Sud“-Version mit elektrischem „Fetzndachl“ (unter 1.700 Euro netto) zu haben. Ein geräumiger Kofferraum (420 bis 1.405 Liter) mit niedriger Ladekante ist immer dabei.
Bis 409 Kilometer Reichweite
Batterie- und Ladetechnik sind ident mit dem Renault 5, als Urban Range sind 308 Kilometer nach WLTP drin, 409 sind es mit dem größeren 52 kWh Akku. 11-kW-Wechselstromladen ist bei beiden Serie, die mit 150 PS gegenüber dem 122 PS Basismodell etwas stärkere Comfort Range Version lädt mit 100 kW am DC-Lader, das Grundmodell schafft 80 kW. In beiden Fällen ist die Batterie nach




einer halben Stunde von 15 auf 80 Prozent gefüllt. Preislich – ohne Berücksichtigung allfälliger Boni –geht’s bei netto 24.492 Euro los, das Topmodell kommt auf 30.325 Euro netto. Genau wie der R5 ist auch der R4 ein echter Europäer. •
Viele Details erinnern an den 1961 bis 1992 gebauten R4; großer Kofferraum mit 420 bis 1.405 Litern, im Herbst wird das Modell „Plein Sud“ mit elektrischem Stoffdach nachgereicht Renault
0–100 km/h | Vmax 9,2 s | 150 km/h 8,2 s | 150 km/h
Reichweite | Antrieb
Das gefällt uns: Qualität, Design, Platz & natürlich das Stoffdach
Das vermissen wir: versenkbare Kopfstützen im Fond
Die Alternativen: Kia e-Soul, Alfa Romeo Junior, Ford Puma Gen-E Werksangaben (WLTP)

Mit etwas Verspätung kommt der neue A6, der nun doch A6 heißen darf, demnächst auch zu uns. Und das als Mild-Hybrid, Allrad und natürlich auch Diesel.
Text: Roland Scharf, Fotos: Audi
Unbestritten kann gesagt werden, dass vom neuen A6 viel abhängt: Eine der Kernbaureihen der Marke, vielerorts vor allem als Firmenkombi hoch geschätzt, muss sich im ewigen Dreikampf gegen die bereits neu aufgelegten 5er BMW und Mercedes E-Klassen behaupten.
Vergleich macht reich
Die Basis bildet die PPF-Plattform (Premium-Plattform-Combustion), die auch unter den neuen A5-Modellen schlummert, ein Siebengang-DSG und die neueste 48V-MildHybrid-Generation beinhaltet. Heißt: Im Boost-Modus stehen kurzzeitig 230 zusätzliche Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung und die Batterie speist nicht nur den Startergenerator, sondern auch einen E-Motor im Antriebsstrang, dank dem bei niedrigem Tempo für kurze Zeit sogar rein elektrisches Fahren möglich ist. Das ist insofern cool, weil nicht nur das derzeitige Topmodell mit V6 und 367 PS darüber verfügen wird, sondern auch der 204 PS starke Vierzylinder-Diesel mit bewährten zwei Liter Hubraum und alles in allem dann 630 Newtonmeter Drehmoment. Damit kommt man schon souverän voran. Der Basismotor mit ebenfalls 204 PS, ganz ohne Hybridunterstützung und da als Benziner mit nur 340 Newtonmetern gesegnet, tut sich im
Vergleich spürbar schwerer, wobei das träge DSG seinen Teil dazu beiträgt.
Standardfahrwerk reicht Gestrafft hat Audi auch das Angebot: Es gibt vier Basisausstattungen –Basic, Tech, Tech plus und Tech pro –, die mit drei Ausstattungspaketen und nur wenigen Einzelextras kombiniert werden können. LED-Scheinwerfer sind Standard und wer mit dem Einlenkverhalten der überraschend gefühlsechten Lenkung nicht happy ist, kann zudem zur weiter optimierten Allradlenkung greifen. Nicht unbedingt notwendig ist das Luftfahrwerk, das Standard-SchraubfedernFahrwerk arbeitet schon komfortabelstraff genug. Stichwort Innenraum: Platz gibt es mehr als ausreichend, wenn auch nicht übermäßig, der Kofferraum ist mit rund 500 Liter Basisvolumen okay, aber nicht übermäßig groß. Dass das Cockpit praktisch nur aus Displays und Touchscreens besteht, bringt im Alltag dann doch das ein oder andere Bedien-Hoppala. Los geht es bei 66.199 Euro für den kleinen Benziner, gedieselt wird ab 69.151 Euro, der als Quattro 4.000 Euro mehr kostet. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der V6-Benziner mit 367 PS bei 91.701 Euro startet. Die echten Kracher wie S6 und RS6 werden nachgereicht –wann, lässt Audi aber noch offen. •

Displays im Cockpit sonder Zahl, leider kaum Knöpfe; Materialien könnten besser sein; Platz im Fond und Kofferraum mehr als ausreichend; cw-Wert mit 0,25 ausgezeichnet gut



Audi A6 Avant
Hubraum

Flotten-Tipp: TDI Testmodell: TFSI
Getriebe | Antrieb 7-Gang aut. | Front 7-Gang aut. | Front Ø-Verbrauch | CO2 5,1 l D | 133 g/km 7,2 l S | 164 g/km
Kofferraum | Zuladung 466–1.497 l | 518 kg
Basispreis | NoVA
|
Das gefällt uns: Sitzposition, Fahrverhalten, das Mild-Hybrid-System Das vermissen wir: ein paar Knöpfe und schönere Materialien, bitte Die Alternativen: Klassiker: BMW 5er Touring und Mercedes E-T-Modell Werksangaben (WLTP)
Ab sofort ist der Einstiegs-Alfa nicht nur mit Hybrid oder E-Antrieb zu haben, sondern auch mit Q4-Allrad.
Text: Achim Mörtl, Fotos: Alfa Romeo
Nach dem Junior Elettrica, vollelektrisch und bis zu 280 PS bestückt, und dem Ibrida mit Hybridantrieb vervollständigt Alfa nun mit dem Ibrida Q4 seine Angebotspalette mit Hybridtechnologie und Allradantrieb. Das 48-Volt-Hybridsystem liefert eine Systemleistung von 145 PS, gespeist aus einem 1,2-LiterDreizylinder-Turbomotor mit 136 PS. Pro Antriebsachse gibt’s einen 28,5 PS starken E-Motor dazu, der vordere ist übrigens direkt am 6-Gang-Automatikgetriebe angebaut. Dank eines Untersetzungsgetriebes kommen die 88 Newtonmeter Drehmoment des E-Motors an der Hinterachse mit 1.900 Newtonmeter an den Rädern an. Das reicht für einen Sprint von null auf hundert in 9,1 Sekunden, sorgt aber auch für ein Zusatzgewicht von rund 200 Kilogramm und 75 Liter weniger Kofferraumvolumen gegenüber der 2WD-Variante.
Mehr Fahrdynamik und Fahrmodi
Dafür gibt es aber vor allem fahrdynamische Vorteile. Zusätzlich zur kombinierten Antriebseinheit, also Benzinmotor und E-Motor an der Vorderachse, sorgt der E-Motor an der Hinterachse je nach Bedingungen und Fahrmodi für deutlich bessere
Traktion und auch verbesserte Fahrdynamik. Im Natural-Modus wird die Antriebsleistung variabel bis zu 90 km/h auf alle vier Räder verteilt, was in der Gesamtschau mit der nur im Ibrida Q4 verbauten MultilinkAufhängung an der Hinterachse vor allem das Untersteuern deutlich verringert, gleichzeitig das Einlenkverhalten verbessert, was schlussendlich einfach mehr Fahrdynamik und Fahrspaß garantiert! Im Q4-Mode gibt es bis 30 km/h bestmögliche Traktion durch permanenten Allrad, speziell für Schnee oder rutschigen Untergrund.
Power-Looping-System
Die Stromversorgung des E-Motors an der Hinterachse und somit die ständige Versorgung des Allrads wird durch das „Power-Looping“-System garantiert. Ist die 0,42-kWh-Batterie leer, wird durch einen Generator an der Vorderachse in Echtzeit Strom an die Hinterachse geliefert. In Summe einer vernünftige Erweiterung der Modellpalette, gibt es jetzt für jede Anforderung einen Alfa Junior. Preislich beginnt der Spaß bei 37.300 Euro, womit der Allradhybrid je nach Ausstattung zwischen 3.500 und 5.500 Euro über der frontgetriebenen Version liegt. •


Das Cockpit des Junior ist im typischen Stil von Alfa Romeo gehalten, das Platzangebot ist ordentlich; einzig beim Kofferraum muss man beim Q4 Abstriche machen, gegenüber dem 2WD hat er 75 Liter weniger
Hubraum
Leistung 136


Speciale Testmodell: Q4

Getriebe | Antrieb 6-Gang aut. | Vorderrad 6-Gang aut. | Allrad Ø-Verbrauch | CO2 4,8 l S | 109 g/km 5,1 l S | 119 g/km
Kofferraum | Zuladung 415–1.280 l | 485 kg 340–1.205 l |
Das gefällt uns: Plus an Traktion und Fahrspaß
Das vermissen wir: 75 Liter Kofferraumvolumen
Die Alternativen: Opel Mokka, Seat Arona, Ford Puma Werksangaben (WLTP)

BYD rundet mit dem Dolphin Surf die Modellpalette nach unten ab und überrascht mit viel Platz und Ausstattung sowie sehr erwachsenem Fahrverhalten.
Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Stefan Schmudermaier, BYD
Die Dreambuilder, wie sich die Mitarbeiter von BYD (Build your Dreams) selbst bezeichnen, haben in Österreich ganze Arbeit geleistet und sich viele neidvolle Blicke von anderen europäischen Märkten gesichert. Beim Gesamtmarktanteil liegt man bereits auf dem starken 15. Platz, unter den rein elektrischen Autos hält man sogar Platz drei. Und mit dem weiteren Produktfeuerwerk ist da sogar noch mehr drin. Mit dem Dolphin Surf rundet man die Modellpalette nach unten ab und bringt ein Fahrzeug im Kleinwagensegment auf den Markt, das technisch und preislich passen muss.
Gute Reichweite, feines Fahrwerk
Wir hatten bereits die Möglichkeit, den Surf zu fahren und schon beim Reinsetzen wird klar, dass sich sowohl die Designer als auch die Ingenieure richtig Mühe gegeben haben. Auch wenn für die ersten Kilometer nur das Topmodell Comfort zur Verfügung stand und das Basismodell Active ein paar ausstattungs- und materialtechnische Abstriche machen muss, technisch sind alle drei Varianten – das mittlere Modell heißt Boost – ident, abgesehen von der Batterie, die ist beim Surf-Einsteiger 30 kWh groß. Boost und Comfort bringen einen 43,2 kWh großen Akku mit. Die WLTP-
Reichweite liegt bei 220 bis 322 Kilometern, innerstädtisch sind 356 bis 507 Kilometer möglich. Der urbane Bereich ist auch das prädestinierte Revier des BYD, wenngleich er sich auch außerorts nicht verstecken muss, das Fahrwerk ist sehr gut, der Surf liegt satt auf der Straße. Die Beschleunigung von 11,1 beziehungsweise 9,1 Sekunden auf 100 km/h ist top.
Preishammer ab 16.658 Euro
Nicht ganz so flott geht das DC-Laden, hier muss man mit 65 beziehungsweise 85 kW das Auslangen finden, in 30 Minuten sind zehn auf 80 Prozent aber bei beiden Varianten geladen. Fein: AC-Laden klappt mit flotten elf kW. Hervorragend ist das Platzangebot im nur 3,99 Meter kurzen BYD Dolphin Surf, ich konnte sogar hinter dem auf meine 1,92 Meter eingestellten Fahrersitz Platz nehmen, Respekt! Also alles eitel Wonne? Nicht ganz, wir würden uns eine stärkere Rekuperation wünschen, es gibt leider nur eine Stufe. Und die Klimaanlage ist nur über den Touchscreen zu steuern, schade, dass man unwichtigere Funktionen auf echte Tasten gelegt hat. Stark wiederum der Preis, bei 16.658 Euro geht’s los, das reichhaltig ausgestattete Topmodell kommt auf 21.567 Euro, beides netto. •


Gute Materialien, eine feine Verarbeitung und vor allem beim Topmodell Comfort eine unglaublich umfangreiche Serienausstattung wissen zu gefallen; Kofferraum: 308 bis 1.037 Liter


BYD
Dolphin Surf Grundmodell: Active Topmodell: Comfort
Leistung | Drehmoment 88 PS (65 kW) | 175 Nm 156 PS (115 kW) | 220 Nm
Dauerleistung | Gewicht 35 kW | 1.294 kg 60 kW | 1.390 kg
0–100 km/h | Vmax 11,1 s | 150 km/h 9,1 s | 150 km/h
Reichweite | Antrieb 220 km | Vorderrad 310 km | Vorderrad Ø-Verbrauch | Batterie 15,5 kWh | 30,0 kWh 16,0 kWh | 43,2 kWh
Laden AC 11 kW, 3:30 h (0–100 %) 11 kW, 5:00 h (0–100 %) Laden DC 65 kW, 30 min (10–80 %) 85 kW, 30 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 308–1.037 l | 344 kg 308–1.037 l | 344 kg
Basispreis | NoVA 16.658 € (exkl.) | 0 % 21.567 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Platzangebot, Fahrleistungen, Preis-/Leistung
Das vermissen wir: stärkere Rekuperation, einfachere Klimasteuerung
Die Alternativen: Leapmotor T03, Dacia Spring, Hyundai Inster Werksangaben (WLTP)

Jeep steht seit über 80 Jahren für Freiheit, Abenteuer und echte
Geländekompetenz. Mit dem neuen Avenger 4xe bringt die Marke nun erstmals Allradtechnik in das B-SUV-Segment.
Text: Achim Mörtl, Fotos: Achim Mörtl, Jeep
Mit dem Marktstart des 4xe erweitert Jeep das Antriebsangebot des Avenger um eine Variante mit elektrifizierter Allradtechnologie. Herzstück ist ein 48-Volt-Hybridsystem, bestehend aus einem 1,2-LiterTurbomotor mit 136 PS sowie zwei Elektromotoren mit jeweils 21 kW an Vorder- und Hinterachse. Zusammen ergibt das eine Systemleistung von 145 PS, die Kraftübertragung erfolgt mittels 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt in 9,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 194 km/h.
Gelände? Bitte gerne!
Der Jeep Avenger 4xe zeigt im Gelände, was er kann, auch wenn die Teststrecke in Saalfelden nur einen Bruchteil seiner Fähigkeiten abbildete.
Dank Allradantrieb, Selec-Terrain-System, 210 Millimeter Bodenfreiheit (+ 10 mm), 400 Millimeter Wattiefe und Offroad-Winkeln von 22 beziehungsweise 35 Grad meistert der Avenger auch raues Terrain souverän. Die elektrisch angetriebene Hinterachse sorgt mit
bis 1.900 Newtonmeter Drehmoment dafür, auch anspruchsvollere Geländepassagen zu meistern.
Funktional und durchdacht
Neben seiner robusten Technik überzeugt der Avenger 4xe auch optisch. Neue Stoßfänger, Dachreling oder ein Unterfahrschutz machen ordentlich was her. Über die Jeep-App sind Fahrzeugstatus, Wartung und Echtzeitnavigation abrufbar – inklusive ChatGPT-Integration für Tourentipps, Geschichten und Routenempfehlungen. Highlight ist die Kooperation mit „The North Face“: Die auf 4.806 Stück limitierte Edition ist eine Hommage an den Mont Blanc. Die Einstiegspreise sind fair kalkuliert: 33.400 Euro für den 4xe Upland, 39.700 Euro für die „The North Face Edition“. •

Die Ausstattung der „The North Face Edition“ bringt Coolness innen wie außen, der 4xe-Allradantrieb macht den Avenger dank elektrischer Hinterachse zu einem echte Allradler Jeep Avenger Flotten-Tipp: 4xe Upland

Getriebe | Antrieb 6-Gang aut. | Allrad 6-Gang aut. | Allrad
Das gefällt uns: Geländefähigkeiten, coole Features
Das vermissen wir: eine vollelektrische Allradvariante
Die Alternative: mit Hybrid und Allrad nur der Alfa Romeo Junior Q4 Werksangaben (WLTP)

Der neue Jeep Compass der dritten Generation zeigt sich optisch markanter und technisch gereift. Die 4x4-Variante nutzt wie beim Avenger 4xe einen Elektromotor an der Hinterachse, der dank Untersetzung ein Drehmoment bis zu 3.100 Newtonmeter in der stärksten Version bereitstellt; feiner dosierbar und effektiver als klassische Systeme. Die Antriebspalette reicht vom 48V-Hybrid mit 145 PS über eine Plug-in-Hybrid-Variante mit 195 PS bis hin zur vollelektrischen Version mit bis 375 PS. Mehr Stauraum und Beinfreiheit sorgen für ein spürbares Raumplus. Der Compass bleibt mit einer Länge von 4,55 Metern dennoch kompakt, aber funktional. Die Produktion startet in Kürze, in Österreich erfolgt die Markteinführung im Herbst mit der First-Edition Version ab 40.200 Euro als Hybrid und ab 49.300 Euro für den Elektriker.
… bleibt er gelassen. Der neue Subaru Forester kombiniert als einer der letzten Kombis bewährte Offroad-Qualitäten mit noch mehr Sicherheit und Komfort.
Text: Petra Mühr, Fotos: Subaru
Er war bislang kein typisches Flottenfahrzeug, aber genau das könnte sich ändern. Denn der neue Subaru Forester bringt Eigenschaften mit, die in etlichen Fuhrparks gesucht, aber immer seltener gefunden werden: höhergelegte Kombi-Karosserie (220 mm Bodenfreiheit sind Bestwert in diesem Segment), permanenter Allradantrieb, Benzin-Mildhybridmotor, EyeSightFahrerassistenzsysteme – all das serienmäßig zu einem vernünftigen Preis. Zur Einführung locken sogar extra attraktive Aktionspreise (aktuell bis Ende Juni), die auch für Flottenkunden gelten: Der Basis-Forester fährt ab 41.490 statt 46.990 Euro in Ihren Diensten. Der 5.500-EuroAktionsrabatt gilt auch bei allen anderen Ausstattungsversionen.
Umfassend bestückt
Für Betriebe mit ländlichen Einsatzgebieten vom Energieversorger über Agrar- und Telekommunikationsbetriebe bis hin zu Blaulichtorganisationen ist die sechste Generation des robusten und geräumigen Allrounders eine interessante Option. Vom neuen Styling mit dynamischerer und souveränerer Linienführung punktet der neue Forester mit deutlich verbesserter Geräuschdämmung
und upgedateter Konnektivität (Android Auto und Apple CarPlay) für alle EyeSight-Fahrerassistenzsystem. Durch zusätzliche Mono-WeitwinkelKamera und Frontradar sind fünf neue Funktionen möglich. Allen voran ein Nothalt-System, das dann übernimmt, wenn der Lenker beispielsweise aufgrund eines medizinischen Notfalls nicht mehr in der Lage ist, das Fahrzeug zu bedienen.
Angenehmer pendeln
Komfortabel und praktisch für Vielfahrer sind auch die neu entwickelten Sitze. Der Fahrer sitzt bequemer und ermüdet weniger leicht. Zu den Highlights zählt zudem die gut drei Zentimeter höhere Öffnung der Heckklappe sowie deren Betätigung via Kick-Sensor. Auf der Test-Rundstrecke onroad und offroad freuen wir uns, heutzutage auch nicht an der Tagesordnung, über die angenehme Rundumsicht. Nicht ganz so fröhlich stimmt uns der Verbrauch. Die 8,1 Liter Herstellerangaben pendeln sich bei 8,5 bis 8,7 ein. Bei gemäßigtgemütlicher Fortbewegung wohlgemerkt. Doch dort, wo andere aufgeben, fährt der Forester weiter: Wer Wert auf Vielseitigkeit, Sicherheit und echte Geländetauglichkeit legt, sollte ihn nicht übersehen. •





Der robuste, sichere und komfortable Allrounder empfiehlt sich unter anderem als Dienstwagen für Mütter und Väter, die den Firmenwagen auch privat mit der Familie nutzen
Subaru Forester 2.0i

Flotten-Tipp:
Getriebe | Antrieb Lineartronic | Allrad Lineartronic | Allrad Ø-Verbrauch
Das gefällt uns: der traditionell-klassische Stil
Das vermissen wir: einen niedrigeren Verbrauch
Die Alternativen: Subaru Outback
Werksangaben (WLTP)
Peugeot verleiht E-3008 und E-5008 einen Allradantrieb, extrem wichtig in einem gebirgigen Land wie Österreich. Die Erwartungen sind hoch. Text: Mag. Heinz Müller, Fotos: Peugeot
Dual Motor nennen die Franzosen die beiden Versionen, die bald die ohnehin schon große Palette bei den Modellen E-3008 und E-5008 ergänzen. Beide Fahrzeuge sind wichtige Ertragsbringer für den Hersteller, den Importeur und die Retailer, wie die früheren Händler nach der Umstellung auf das New-RetailerModell seit fast zwei Jahren heißen. Die anfängliche Skepsis hat sich im Netz mittlerweile großteils gelegt; auch die Belieferung funktioniert nach Startschwierigkeiten nun wieder viel besser, hört man aus dem Netz.
Allrad soll neue Kunden bringen Das wirkt sich auch in den Neuzulassungen aus: Mit 2.529 Stück und einem Plus von 31,65 Prozent nach vier Monaten liegt Peugeot deutlich über dem Branchenschnitt von plus 7,41 Prozent. Geht es nach dem Importeur, soll das auch so bleiben: Immerhin stehen mit den Allradversionen des E-3008 und des E-5008 zwei wichtige Derivate kurz vor der Einführung. Was ist neu? Wie anfangs erwähnt, gibt es beim E-3008 und beim E-5008 – neben der ohnehin von der Vorderachse bekannten Maschine mit 213 kW – einen zweiten Elektromotor, der seine 112 kW automatisch auf die Hinterräder verlegt, wenn dies notwendig ist. Wer in der Einstellung „Sport“ fährt, kommt natürlich öfter

in den Genuss dieser Kraftentfaltung als jemand, der „Eco“ wählt. Wir haben dies mit dem E-3008 in einer durchaus flotten Runde durch den Schwarzwald ausprobiert und sind mit 18,4 kWh ausgekommen.
Preise? Bitte warten!
Nach Österreich kommen sowohl der E-3008 als auch der siebensitzige E-5008 mit Allradantrieb im Sommer, an den Preisen wird noch gefeilt. Da der Allradantrieb in einem Alpenland wie Österreich eine große Rolle spielt, erwartet man beim Importeur ein zusätzliches Volumen: „Kunden, die wir bisher noch nicht hatten oder die auf den Allrad gewartet haben.“
Übrigens: Ohne Allrad sind beide Fahrzeuge seit rund einem Dreivierteljahr auf dem Markt und belegen (inklusive Verbrenner) heuer im Peugeotinternen Ranking nach drei Monaten die Plätze drei (3008: 286 Stück) und fünf (5008: 198 Stück). Nun sollen es deutlich mehr werden. •

Peugeot


Lob für das Designteam: Der E-3008 sticht aus dem Einheitsbrei auf den Straßen hervor; der Innenraum ist durchdacht, es gibt noch Schalter wie damals für die wichtigsten Funktionen, man muss also nicht für jede Funktion in das x-te Untermenü
Flotten-Tipp:

Reichweite | Antrieb 526 km | Vorderrad 490
Laden AC 11 kW, 8:00 h (0–100
Laden DC 160 kW, 30 min (20–80
Kofferraum | Zuladung 440–1.250 l | 446 kg k. A.
Basispreis | NoVA 37.990 € (exkl.) | 0 % k. A. | 0 %
Das gefällt uns: das Design, die Beschleunigung, die Kurvenstabilität
Das vermissen wir: vorerst natürlich die Preise
Die Alternativen: Opel Grandland, VW ID.4, Škoda Enyaq Werksangaben (WLTP)

Mitsubishi gestaltet die Customer Journey nach alter Japaner
Sitte: Extras müssen beim Outlander nicht mühsam abgewogen werden, eine der vier Linien wird schon ins Konzept passen.
Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Mitsubishi Motors
Schauen wir uns den neuen Outlander, den Mitsubishi-Importeur Denzel im Offroadzentrum Brandlhof-Saalfelden präsentiert hat, kurz an. Stämmiger ist er geworden, auffälliger. Vor allem die Front macht nun mehr her, will nicht im SUVEinheitsbrei versinken. Hinten wiederum: ein dezentes Finale. Innen freut sich das Auge, weil es weiß, was die Finger erwartet: viele echte Tasten neben einem gut strukturierten Touchscreen.
Optionale Farbspiele
Der Outlander bietet keine Motorenauswahl, man hat sich auf einen Plug-in-Hybrid festgelegt, der einen 2,4-Liter-Benziner und E-Motoren vorn wie hinten kombiniert. Rein elektrisch lassen sich so über 80

Kilometer zurücklegen, egal in welcher Ausstattung. Da wären wir auch schon bei der Qual der Wahl, wenn man einen Outlander einflotten will: Nur Farben und eine ZweifarbOption stehen in der Extraliste. Sonst geht es rein um die vier Linien Inform, Invite, Intense und Diamond. Na gut, es gibt noch ein Luxury-Paket, aber dieses nur für das Topmodell. Man nennt es dann Diamond Luxury, wie eine fünfte Linie.
Yamaha-Sound immer dabei
Warum wir den Invite, also die zweite Linie, in unserem Datenkasten empfehlen? Fast könnte man beim Einsteiger bleiben, denn der bietet bereits ein schlüsselloses Schließund Startsystem, Zweizonen-Klima, Schaltwippen zur Veränderung der Rekuperation, eine 360-Grad-Kamera für gekonnte Einparkmanöver und eine Sicherheitsausstattung, die auch von den höheren Modellen nicht übertroffen wird. Doch Invite legt mit abgedunkelten Scheiben, LED-Nebelscheinwerfern, elektrisch verstellbarem Fahrersitz (samt Lendenwirbelstütze) sowie induktivem Smartphone-Laden noch einige wichtige Dinge obendrauf. Zudem lassen sich Hände (Lenkrad) und Popo (Vordersitze) an kalten Tagen effektiv wärmen, die Sitze sind aus



Das 4,72-Meter-SUV fühlt sich beim Fahren sehr kommod an, das Geländekönnen überzeugt; innen entfernt man sich vom Robusten, liefert hohe Qualität und Wohnkomfort
synthetischem Leder. Als technische Verbesserung gibt es noch zwei 220-V/1.500-W-Steckdosen im Fond und im Kofferraum. Fun Fact: Jeder (!) Outlander ist mit einer YamahaSoundanlage ausgerüstet. •
Mitsubishi Outlander Flotten-Tipp: Invite Testmodell: Diamond Luxury Hubraum | Zylinder 2.360 cm3 |
Leistung
| Batterie
Laden AC 3,5 kW, 6,5 h (0–100 %) 3,5 kW, 6,5 h (0–100 %)
Ø-Verbrauch | CO2 0,8 l S | 19 g/km 0,8 l S | 19 g/km
Kofferraum | Zuladung 498–1.404 l | 600 kg 498–1.404
Basispreis | NoVA
|
Das gefällt uns: die Entwicklung von der ersten Generation bis heute
Das vermissen wir: CCS-Schnellladen; hier ist es leider Chademo
Die Alternativen: Kia Sorento, Nissan X-Trail (HEV) Werksangaben (WLTP)

BMW hat den elektrischen i4 überarbeitet und dabei einige Details nachgeschärft. Im Praxistest weiß das Paket zu gefallen, auch wegen des schnellen Ladens und des großen Kofferraums.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Zugegeben, Grün zählt nicht unbedingt zu meinen absoluten Lieblingsfarben an Autos, dem BMW i4 passt das kräftige Sonomagrün aber ganz wunderbar, erst recht in Kombination mit der braunen Innenausstattung, dem M-Paket und den schicken Bicolor-Felgen in 20 Zoll. Großer Wermutstropfen: BMW verlangt für die Individuallackierung satte 4.100 Euro netto, da der Testwagen die 80.000-Euro-Marke knackt, sind das happige 4.920 Euro und somit das teuerste Einzelextra des gesamten Autos.
Durch und durch Premium
Im Innenraum hat nun der aus der 3er-Reihe bekannte Curved-Monitor Einzug gehalten, zudem finden sich ein neues Lenkrad, neue Leisten und eine erweiterte Ambientebeleuchtung. Verglichen mit den BMW-Neuerscheinungen kommen hier noch die alten Lenkradtasten zum Einsatz, die nicht nur haptisch hochwertiger sind, sondern auch mehr Funktionen bieten. So lässt sich mit einem Knopfdruck die Adaptivfunktion des Tempomaten ein- und ausschalten, was je nach Verkehrssituation sehr angenehm ist. In neueren Modellen muss man dafür ins Untermenü eintauchen. Was die Qualität von
Materialien und Verarbeitung betrifft, wirkt der i4 wie aus dem Vollen gefräst und wird dem Premiumanspruch voll gerecht. Was freilich auch für den Preis gilt. Die Liste startet mit dem i4 eDrive35 bei (alle Preise netto) 44.160 Euro, geht über den ebenfalls heckgetrieben eDrive40 für 51.380 Euro zu unserem allradgetriebenen xDrive40 für 64.908 Euro, 94.056 Euro brutto waren für unseren Testwagen fällig. Top-of-the-line ist der i4 M50 xDrive, den es ab netto 61.090 Euro gibt.
Über 400 Kilometer Reichweite
Leistung hat aber auch der Testwagen mehr als genug, die Fahrleistungen können sich mehr als sehen lassen. In 5,1 Sekunden zeigt der Tacho 100 km/h, 401 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment zeigen Wirkung. Dass dann die WLTP-Reichweite bis zu 546 Kilometern außer Reichweite liegt, ist auch klar. Wer’s nicht übertreibt, kommt aber über 400 Kilometer, das Nachladen geht mit maximal 205 kW flott vonstatten, in 30 Minuten ist der Akku von zehn auf 80 Prozent geladen, ein sehr ordentlicher Wert. Fahrdynamisch ist natürlich auch der i4 ein echter BMW, knackig agil, aber auch mit der nötigen Portion Komfort. •

Das Sonomagrün steht dem i4 hervorragend, erst recht in Kombination mit der braunen Innenausstattung; praktisch: die weit öffnende Heckklappe gibt einen geräumigen Kofferraum (470 bis 1.290 Liter) frei


BMW i4 Gran Coupé
Flotten-Tipp: eDrive35

Testmodell: xDrive40
Leistung | Drehmoment 286 PS (210 kW) | 400 Nm 401 PS (295 kW) |
|
Reichweite | Antrieb 500 km | Allrad 546 km | Allrad Ø-Verbrauch | Batterie 15,1 kWh | 67,1 kWh 16,7 kWh | 81,1 kWh
Laden AC 11 kW, 7:00 h (0–100 %) 11 kW, 8:30 h (0–100 %)
Laden DC 180 kW, 32 min (10–80 %) 205 kW, 30 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 470–1.290 l | 555 kg 470–1.290 l |
Basispreis | NoVA 44.160 € (exkl.) | 0 % 54.090 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Reichweite, Verbrauch, Kofferraumvolumen
Das vermissen wir: einen Frunk (gibt’s als Drittanbieter-Nachrüstlösung)
Die Alternativen: BYD Seal, Mercedes-Benz CLA, Tesla Model 3 Werksangaben (WLTP)
Mit dem CX-80 bringt Mazda ein neues Flaggschiff, das fünf Meter lange SUV zeigt sich hochwertig, der starke Dieselmotor erstaunlich sparsam, Platz gibt’s in Hülle und Fülle.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Am Mazda CX-80 haben sich auch redaktionsintern etwas die Geister geschieden, vor allem an der Größe und der Optik. Vor allem die Seitenansicht ist nicht die Schokoladenseite des wuchtigen SUV, es scheint, als ob die Designer nicht ganz wussten, was sie mit dem vielen Blech anfangen sollten. Front und Heck sind indes sehr gelungen und sprechen die typische Mazda-Designsprache, die man vom kleinen Bruder CX-60 bereits gut kennt. Mit dem ist der CX-80 auch technisch eng verwandt, mit dem Unterschied, dass es den 60er auch mit Hinterradantrieb und einem 200-PS-Diesel gibt.
Mehr Länge, mehr Sitze
Der Längenzuwachs von 25 Zentimetern kommt den Passagieren zugute, im Unterschied zum CX-60 gibt’s den CX-80 auch bis zu sieben Sitzplätzen, im Fall unseres Testautos waren es sechs, in 2/2/2-Bestuhlung. Vor allem im Fond geht es entsprechend komfortabel zu, zwei CaptainChairs mit Armlehnen zeugen davon. In Reihe drei lässt es sich zwar aushalten, kein Vergleich aber zu den Sitzen davor. Der Kofferraum ist mit 566 Litern ähnlich groß wie jener des CX-60 (570 Liter), erst bei komplett umgelegten Rücksitzen liegt der Unterschied dann bei immerhin 250 Litern. In Sachen Ausstattung gibt sich Mazda traditionell keine Blöße, bereits das Einstiegsniveau „Exclusive Line“ bietet 20-Zoll-Alufelgen, LED-Scheinwerfer, Head-up-Display, Navigationssystem und eine wahre Armada an
Assistenten. Unser Testwagen war mit der gehobenen Homura-Plus-Ausstattung bestückt, da gibt’s darüber hinaus noch Nappaleder, elektrisch verstellbare Sitze, adaptive Scheinwerfer, elektrische Heckklappe, Panoramaglasdach, Bose-Soundsystem und etliches mehr. Knapp 10.000 Euro Aufpreis sind allerdings auch kein Pappenstiel.
Ein Sechszylinder-Turbodiesel ist heutzutage mehr Ausnahme als Regel, selbst in großen Fahrzeugen. Das 3,3-Liter-Aggregat schnurrt nicht nur wie ein Kätzchen und sorgt für ordentliche Fahrleistungen, sondern auch für Überraschungen an der Tankstelle. Trotz sorglosem Alltagsbetrieb gönnte sich der Japaner nicht mehr als 6,3 Liter, ein Spitzenwert für das große Allrad-SUV.
Preislich geht’s bei 61.200 Euro für den Plug-in-Hybrid mit leider nur 61 Kilometer E-Reichweite los, unser Testauto brachte es auf 73.950 Euro. Vergleicht man den 3,3-Liter-AllradDiesel mit dem ident motorisierten CX-60, liegt der Aufpreis übrigens bei gerade einmal 4.100 Euro. Im Umkehrschluss sei aber die Frage erlaubt, ob man das Mehr an Auto tatsächlich benötigt oder nicht lieber doch zum handlicheren Auto greifen sollte. •





Die Homura-Plus-Ausstattung lässt keine Wünsche offen; statt eines mechanischen Wählhebels hätte wir uns einen gewünscht, der nicht jedesmal manuell in Park geschaltet werden muss
Leistung
Drehmoment 261 Nm + 270 Nm E-Motor 550 Nm ab 1.500/min
0–100 km/h | Vmax 6,8 s | 195 km/h 8,4 s | 219 km/h
Getriebe | Antrieb 8-Gang aut. | Allrad 8-Gang aut. | Allrad
Ø-Verbrauch | CO2 1,6 l S + 23,8 kWh | 35 g/km 5,7 l D | 148 g/km
Kofferraum | Zuladung 258/566/1.971 l | 649 kg 258/566/1.971 l | 650 kg
Basispreis | NoVA 61.200 € (inkl.) | 0 % 73.950 € (inkl.) | 11 %
Das gefällt uns: Fahrleistungen, Verbrauch, Platzangebot, Verarbeitung
Das vermissen wir: elektrischen Automatikwählhebel
Die Alternativen: Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe, Volvo XC90 Werksangaben (WLTP)

Geely-Tochter Volvo hat umgetauft und uns den nunmehrigen EC40 zum Test überlassen. Womit kann das kompakte SUV-Coupé im Segment punkten?
Text & Fotos: Mag. Bernhard Katzinger
Der Name ist der neuen Nomenklatur angepasst, so heißt das kompakte SUV-Coupé von Volvo nun EC40 und verliert den Zusatz „Recharge“, nachladen lässt er sich natürlich trotzdem weiterhin. Der komfortabel große Akku lässt sich in einer knappen halben Stunde schnellbeladen, damit lässt sich auch der im Test auffällig hohe Verbrauch leichter verschmerzen. Im Wien-SpeckgürtelMix mit kleinem Autobahnanteil pendelten die Verbräuche um 23 kWh/100 Kilometer. Insgesamt ist die „Langstreckentauglichkeit“ des Antriebs gegeben.
Wohnzimmer auf Rädern Überhaupt tut ein eventuell nötiger zusätzlicher Ladestopp weniger weh, wenn man fesch und komfortabel sitzt und das Bord-Entertainment passt. Ausgesprochener Pluspunkt des Volvo: Die Haptik im Cockpit erweist sich als ebenso einwandfrei wie die Konnektivität mit dem Smartphone. Die Bezüge aus „tailored wool“, welche aus Wolle und recyceltem Polyester besteht, ließe man sich auch am Sofa daheim gefallen. Zur Wahl der Fahrstufe greift man an schwedisches Kristallglas. Aus welchen Gebinden Getränke während der Ladepause
konsumiert werden, bleibt jedem selbst überlassen, aber eventuell lässt sich dabei ja darüber nachdenken, ob es je eine Marke besser geschafft hat, ihren Markenkern über mehrere Besitzwechsel hinweg beizubehalten.
Der performante Antrieb hebt den Wagen ebenfalls aus der Masse des Mitbewerbs: Mit 184 und 258 Pferdestärken befördern die beiden E-Maschinen das kompakte SUVCoupé in unter fünf Sekunden auf 100 und auch beim umgekehrten Vorgang flößt der Wagen sofort Vertrauen ein: Tritt man bei vielen Elektroautos in eher teigige Bremspedale, ist der Bremswiderstand im EC40 nahezu perfekt, eventuell sogar zu hart. Das simpel-skandinavische Design, das aufgeräumte Cockpit, die Reduktion auf (ein bisschen mehr als) das Wesentliche gefällt jedenfalls nach wie vor. Beim Platzangebot stört sich lediglich der mittlere Hinterbänkler am Kardantunnel, Zugeständnis an den auch als hybridisierten Verbrenner erhältlichen Plattformbruder XC40. Was sonst noch nervt, ist die Heckscheibe ohne Wischer. Und, dass es keine einzige kräftige Farbe zur Auswahl gibt. •

Einfachheit und angenehmer Materialmix machen Fahrten im EC40 zu empfehlenswerten Erlebnissen; der Frunk fasst 31 Liter und verfügt über einen „Extradeckel“




Das gefällt uns: ordentlicher „Punch“ und Bremsgefühl
Das vermissen wir: fröhlichere Farbauswahl
Die Alternativen: Cupra Tavascan, Škoda Elroq, Renault


Bislang war der Mini Clubman einer der coolsten Kombis, echter Nutzwert war nicht im Fokus. Mit dem Wegfall des Shooting Brakes wurde die Lücke für den vollelektrischen Aceman frei.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
So richtig Mini ist bei der BMWTochter streng genommen nur noch der Name, die Modelle sind über die letzten Jahre ordentlich gewachsen. Zudem wurde die Palette deutlich ausgeweitet. War es zu Beginn der bayerischen Übernahme lediglich der bekannte Dreitürer, gibt es aktuell darüber hinaus einen Fünftürer, ein Cabrio und das SUV Countryman, das es ebenso wie den Dreitürer auch vollelektrisch gibt. Neu im Programm ist der Aceman, den es wiederum nur elektrisch gibt und der in China vom Partner Great Wall Motors gebaut wird.
Unter 250 km bei Kälte
Der Aceman ist in drei Leistungsstufen zu haben, als „E“ mit 184 PS, als „SE“ mit 218 PS sowie als „John Cooper Works“ mit 258 PS. Alle Modelle geben die Kraft an die Vorderräder weiter. Während das Basismodell mit einer 38,5 kWh großen Batterie bestückt ist, verfügen die stärkeren über einen Akku mit 49,2 kWh. Unser Testmodell war ein SE, also die goldene Mitte. Und zugleich jenes Modell mit der größten Reichweite, 405 Kilometer nach WLTP. Auf unserer Testrunde bei vier Grad genehmigte sich der Aceman 18,7 kWh, umgelegt auf die Batterie also eine theoretische Reichweite von 260 Kilometern, im sorglosen Normal-
betrieb blieben davon zwischen 220 und 240 Kilometer übrig, also nur noch knapp die Hälfte des WLTPWertes. Die Ladegeschwindigkeit liegt bei 95 kWh, dank der nicht überbordend großen Akkus sind die aber dennoch nach einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent geladen.
Cooles Design, feiner Fahrspaß
Der Fahrspaß ist Mini-typisch groß, das Fahrwerk agil, ohne unangenehm hart zu sein. In flotten 7,1 Sekunden stehen 100 km/h auf der PlastikScheibe des Head-up-Displays sowie auf dem coolen, runden und extrem dünnen Display in der Mitte. Auf einer Länge von nur knapp über vier Metern darf man sich kein Raumwunder erwarten, die Platzverhältnisse sind dennoch okay, der Kofferraum schluckt 300 bis 1.005 Liter. Konnte man sich früher bei Mini in unzähligen Sonderausstattungen verlieren, gibt’s die Extras nun in Paketen, die je nach Grundmodell unterschiedlich viel kosten. Unser Testauto startete bei 30.542 Euro netto, addiert man das „All-Inclusive“-XL-Paket für 5.820 Euro und den „Favoured Trim“ für weitere 1.590 Euro, kommt man auf netto 37.952 Euro. Kein Schnäppchen, doch Coolsein war schon immer etwas teurer. •


Blickfang im Aceman ist der runde, dünne Touchscreen, der auch das (optionale) augmentedreality-Navi beinhaltet; Head-up-Display nur auf Plastikscheibe, Kofferraum mit 300 bis 1.005 Litern



Mini Aceman Flotten-Tipp: E Testmodell: SE
Leistung | Drehmoment 184 PS (135 kW) |
Dauerleistung | Gewicht 55 kW | 2.170 kg 65 kW | 2.235 kg
|
0–100
Reichweite | Antrieb 309 km | Vorderrad 405 km | Vorderrad Ø-Verbrauch | Batterie 14,1 kWh |
Laden AC 11 kW, 4:15 h (0–100 %) 11 kW, 5:30 h (0–100
Laden
Basispreis | NoVA
Das gefällt uns: cooler Auftritt, feiner Fahrspaß
Das vermissen wir: mehr Reichweite, vor allem bei Kälte
Die Alternativen: Jeep Avenger, Opel Mokka-e, Smart #1 Werksangaben (WLTP)
Unser Dauertestwagen BYD Sealion 7 trifft bereits manchen Artgenossen auf Österreichs Straßen und sorgt an der Ladestation oft für Gesprächsstoff mit denen, die ihn noch nicht kennen.
Text: Mag.
Bernhard Katzinger, Fotos: Lea Schmudermaier
Ich war anfangs geneigt, es als ExotenBonus zu verbuchen, aber nach dem zweiten, dritten anerkennendfragenden Kopfnicken an der Ladesäule setzte sich die Erkenntnis fest: Der BYD Sealion 7 erregt Aufmerksamkeit nicht nur als Novum, sondern sammelt auch Sympathiepunkte bei den Mit-(E-)Mobilisten ein. Kein Wunder bei der schnittigen CoupéLinie, den schmucken Rädern in den (leider) plastikverplankten Radhäusern und den versenkbaren Türgriffen.
Der Ritt auf dem Seelöwen
Die Komplimente freundlich zur Kenntnis nehmend, gebe ich im Lithium-Ionen-Gespräch zwar zu, dass unter besagter SUV-CoupéForm zwar der fürs Gepäck verfügbare Rauminhalt leidet, das menschliche Transportgut sich allerdings weder vorn noch hinten beklagen kann. Dazu kommen durchwegs hochwertige Materialien – luxuriös wäre zu viel gesagt – und ein großzügiges Panoramaglasdach zum Sternderlschauen bei Ladeweile. Apropos: Der große LFP-Akku (Sympathiepunkt für Kobalt-Abstinenz) des Testwagens saugte sich nach über 11.000 Kilo-
metern noch nie mit den beworbenen 230 Kilowatt voll, mein letzter Schnellladevorgang erfolgte an einer 150-kWSäule, deren Kapazität der Seelöwe brav ausschöpfte. So kann man auf großer Reise davon ausgehen, während einer durchschnittlichen Familienpause ausreichend Zusatzkilometer nachgeladen zu haben. Als „so mittel“ ist bis dato auch die Effizienz des (zu Redaktionsschluss noch winterbereiften) Wagens zu bewerten, unter 25 kWh/100 Kilometer fuhr ich den Seelöwen nur selten.
Im Gespräch mit Frau „Bibaidi“
Licht und Schatten liefert das Assistenz- und Infotainment-Kapitel. Geradezu nervig drängt sich „Isa“ (Intelligent Speed Assistant) in den Vordergrund, regelt Radio und Telefon kurz auf beinahe-stumm, um für begangene Temposünden zu strafen. Immerhin lassen sich die meisten der übereifrigen Piepserl mit der neuen Software-Version am Touchscreen schnell zum Schweigen bringen. Dafür schnattert der vierjährige Copilot (Sympathiepunkt für Isofix vorn) angeregt mit „Hey Bibaidi“ – an der Aussprache von BYD scheitern



Die 230 kW haben wir am Schnelllader zwar noch nicht erreicht, die Ladeleistung ist dennoch OK; Cooles Feature: Die Karaokefunktion verkürzt die Wartezeit beim Laden
auch Erwachsene – und lässt sich von der unsichtbaren Dame hinter dem rotierenden Bildschirm die Fahrt ver kürzen. Leider ist die Gesprächskapa zität der Sprachassistentin begrenzt, das könnte in Zeiten der KI kurz weiliger gehen. Eventuell eine Anre gung fürs nächste OTA-Update. •
BYD Sealion 7 Grundmodell: Comfort RWD
Leistung | Drehmoment 313 PS (230 kW) | 380 Nm
Dauerleistung | Gewicht

|
0–100 km/h | Vmax 6,7 s | 215 km/h 4,5 s | 215 km/h
Reichweite | Antrieb 482 km | Hinterrad 502 km | Allrad Ø-Verbrauch | Batterie 16,6 kWh | 82,5 kWh 18,2 kWh | 91,5 kWh
Laden AC 11 kW, ca. 8 h (0–100 %) 11 kW, ca. 9 h (0–100 %)
Laden DC 150 kW, 32 min (10–80 %) 230 kW, 24 min (10–80 %) Kofferraum | Zuladung 520–1.789+58 l | 410 kg 520–1.789+58 l | 410 kg Basispreis | NoVA 39.983 € (exkl.) | 0 % 43.733 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Platzangebot, Verarbeitung, Preis-Leistungsverhältnis
Das vermissen wir: großen Knopf, um Isa zum Schweigen zu bringen
Die Alternativen: Tesla Model Y, VW ID.5, Cupra Tavascan Werksangaben (WLTP)



Ein Auto aus der Kategorie „Wo warst du, als ich zwanzig war?“ Die Alpine A290 liefert den Beweis, dass Kraft und Agilität einander keineswegs ausschließen. Und gibt paradoxerweise eine mögliche Antwort auf die Frage, wozu Verbrenner heute noch gut sind.
Text & Fotos: Mag. Bernhard Katzinger
Es wird wenige überraschen, was von der Alpine A290 als markantester Eindruck im Testfahrergedächtnis übrigbleibt: Wow, das geht und zwar auch und vor allem „ums Eck“. Besser als die A110, fragen Sie? Lassen wir das. Besser als der zivile „Zwilling“, der Renault 5 E-Tech? Merklich, wenn man’s denn drauf anlegt, muss man aber nicht.
Aggro-Schnörkel
Die A290 ist vor allem im Kurvengeschlängel ein großer Wurf. Dort hebt sich bei motivierter Fortbewegung das wie ein Springteufel von Eck zu Eck spurtende Wägelchen vom Konzernbruder am deutlichsten ab. In puncto Agilität macht der Alpine keiner was vor, doch irgendwie fehlt bei artgerechter Katz-und-Maus-Ausfahrt ein

entsprechendes Motorengeräusch, so ungern ich es zugebe. Fahrwerk, Antrieb und Preis sind deutlich angeschärft, ansonsten geschieht die Alleinstellung grosso modo per Design-Entscheid. Das QuadratischBullige steht der Alpine zweifelsohne hervorragend – Geschmacksache, ob die Alpine-Designer in ihrer Begeisterung nicht in Details ein paar Mal zu oft in den Baukasten mit den AggroSchnörkeln gegriffen haben.
Daumen macht Kickdown
Beide Motorisierungen der A290 schöpfen Saft aus einer 52-kWhBatterie. Den Verbrauch beeinflusst wie üblich der Stromfuß maßgeblich mit, kalkulieren Sie als des Wagens würdiger Alpine-ist lieber nicht mit dem Katalogwert, eher mit guten 20 kWh/100 Kilometer. Die Ladekapazität gestattet Ihnen Pausen von einer halben Stunde.
Beim Kaffee an der Laderast dürfen Sie dann über Sinn und Unsinn des mit OV beschrifteten Scharfschalters am Volant nachdenken (steht für „overtake“ und setzt kurzfristig ein zusätzliches Quantum Vortrieb frei, ist also ein Kickdown-Pedal für den Daumen) oder wieso es eigentlich zwei Fahrmodi-Drehknöpfe im Lenkrad braucht (als Formel-1-Reminiszenz). •

Im Cockpit mischt sich konzerneigenes Knopferlmaterial mit eigenständigen Elementen und Drehreglern als Reminiszenz an das Formel-1-Engagement des Herstellers; der Kofferraum schluckt Klassenübliches


Alpine A290 Basis: GT Testmodell: GTS
Das gefällt uns: die Quadratur der Agilität
Das vermissen wir: den Handling-Parcours als Arbeitsweg
Die Alternativen: Mini SE und Aceman Werksangaben (WLTP)
Mit dem Facelift des Taycan hat Porsche vor allem Batterie und Ladeleistung optimiert, aber auch das adaptive Luftfahrwerk in Serie verbaut.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Der Taycan war 2019 streng genommen das bereits zweite Elektroauto aus dem Hause Porsche, das erste rollte bereits im Jahr 1900 als Lohner-Porsche über die Straßen, wenngleich nur sechs Jahre lang, die Entwicklungskosten waren zu hoch, zudem gab es Streitigkeiten ums Patent. Mittlerweile ist auch der Macan (sieheTest in der letzten FLOTTE) rein elektrisch unterwegs. Doch zurück zum Taycan. Der hat kürzlich ein Facelift erhalten und wurde dort und da leicht aufgefrischt. Von außen halten sich die Änderungen in Grenzen, das neue Modell unterscheidet sich etwa durch neue Scheinwerfer und Heckleuchten vom Vorgänger, auch innen sind die Neuerungen dezent ausgefallen, am auffälligsten – falls die Option angekreuzt wurde – ist das zusätzliche Display auf der Beifahrerseite.
Mehr Ladeleistung und Reichweite Deutlich mehr hat sich da schon unter dem Blechkleid getan, vor allem im Hinblick auf Batterie und Ladeleistung. Am Schnelllader kann der netto 82,3 kWh große Akku nun mit 320 kW geladen werden, gegenüber dem Vorgänger noch einmal um 50 kW mehr. Trotz etwas höherer Batteriekapazität konnte die Zeit von zehn auf 80 Prozent Akkustand von 37 auf 18 Minuten halbiert werden, eine starke Ansage.

Gleichzeitig ist es gelungen, die Reichweite spürbar zu steigern, so schafft unser Taycan 4S am Papier 560 Kilometer nach WLTP, rund 400 sind in der Praxis durchaus machbar. Freilich nur dann, wenn man den rechten Fuß unter Kontrolle hat. Was nicht immer leicht fällt, schließlich ist der Sprint auf 100 km/h in lediglich 3,7 Sekunden immer wieder ein Erlebnis.
Dass ein Porsche über eine gute Straßenlage verfügt, ist selbstredend, dennoch hat man im Zuge des Facelifts noch eins draufgelegt. So sind nun alle Modelle mit dem adaptiven Luftfahrwerk ausgestattet, das noch mehr Komfort bietet und auch die Nickbewegungen beim Beschleunigen und Bremsen reduziert, was ebenfalls den Passagieren zugutekommt. Die Preisliste startet nun bei 105.409 Euro, unser 4S ist ab 123.849 Euro zu haben, mit ein paar Extras ist die 150.000-EuroMauer schnell durchbrochen. •



Auch wenn optisch große Veränderungen mit dem Facelift ausblieben, (lade-)technisch hat der Taycan durchaus einen großen Sprung nach vorn gemacht
Porsche Taycan Basismodell: Taycan Testmodell: 4S
Leistung | Drehmoment
Dauerleistung | Gewicht
Reichweite | Antrieb 592 km | Hinterrad 560 km | Allrad
Ø-Verbrauch | Batterie 16,7
Laden AC 11 kW, 9:00 h (0–100

|
Laden DC 320 kW, 18 min (10–80 %) 320 kW, 18 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 407 l + 81 l Frunk | 695 kg 407 l +
Basispreis | NoVA 105.409 € (inkl.) | 0 % 123.849 € (inkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Auftritt & Antritt, Platzangebot, Ladegeschwindigkeit
Das vermissen wir: mehr Serienausstattung
Die Alternativen: Tesla Model S Plaid, Mercedes-AMG EQE, Audi e-tron GT Werksangaben (WLTP)


Nachdem laut ÖAMTC die sicherste Möglichkeit, ein Fahrrad zu transportieren, Systeme für die Anhängerkupplung sind, hat der Mobilitätsclub 13 solcher Produkte untersucht. „Alle Modelle haben im Test Ausweichmanöver mit 90 km/h ohne Probleme überstanden. Hier zeigt sich im Vergleich zu Tests aus der Vergangenheit ein Fortschritt“, erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Zehn Modelle schneiden mit „gut“ ab, sind daher echte Kaufempfehlungen. Mit „sehr gut“ toppt der Testsieger Uebler i21 das natürlich, zwei weitere Modelle fallen mit „befriedigend“

Japanische Kapselhotels haben Honda zum „Dream Pod“ inspiriert. Es handelt sich um ein Campingmodul für den CR-V für jede Jahreszeit – samt Kochstelle, Spülbecken und nach wie vor reichlich Platz. Benjamin Barakat war einer der ersten, die es ausprobieren durften, dieses spektakuläre Foto hat der Astrofotograf von seinem Campingtrip mitgebracht.


Kein Produkt ist beim ÖAMTC-Test für Fahrradheckträger durchgefallen, alle überstehen ein Ausweichmanöver
wenigstens nicht durch beim großen Test. Was gute Modelle wie eben den Uebler auszeichnet? Die sehr simple Montageart zum Beispiel und nicht zuletzt ein geringes Gewicht. 13,2 Kilogramm beim i21 stehen 21,1 Kilogramm beim Modell von Atera gegenüber. Bei den Halterungen für die Fahrräder gibt es ebenso Unterschiede. Kerbl warnt: „Nicht jede Befestigungsart eignet sich für jedes Fahrrad, Carbonrahmen reagieren beispielsweise empfindlich auf Druck.“ Er empfiehlt den Besuch im Fachhandel, um die verschiedenen Träger auszuprobieren.
Mit „Mind Set Win“ lässt uns Benevento Publishing auf 340 Seiten in die Köpfe von Sportlern mit Siegermentalität eintauchen. Lässig: Passende Podcasts machen das Ganze lebendiger. Ladenpreis: 30 Euro.
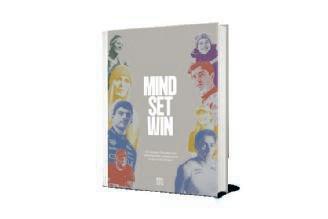
Mit dem mächtigen Revuelto (V12!) und dem SUV Urus SE haben die Italiener ihre Palette elektrifiziert, nun folgt der Temerario, der auf einen V8 als Sparringpartner für die drei E-Motoren setzt. 920 PS Systemleistung sind für 2,7 Sekunden auf 100 km/h gut. Was die Kunden bei der Vorstellung in Wien besonders wertschätzten: Es gibt endlich mehr Platz, um tatsächlich ein paar Trolleys unterzubringen. Der nächste Urlaub kann kommen.
99,99 Euro übrig? Dann schnellt der Ford F-150 Raptor von Carrera RC durch den Garten und das mit bis 18 km/h. Mit Luftreifen, Vollfederung und digitaler Proportionalsteuerung ist er einfach der Geländekönig, wenn auch im kleinen Maßstab (Länge: 39,5 Zentimeter). Bis 40 Minuten Fahrzeit sind möglich, die 2,4 GHzTechnologie gewährleistet eine störungsfreie Verbindung. Dream Pod: Sternbild Honda So ticken Gewinner



Der Camping-Boom reißt nicht ab, 2024 brachte das vierte Rekordjahr in Folge. Wer sein Campingfahrzeug nicht nur im Urlaub nutzen möchte, der kommt an den praktischen Campervans nicht vorbei. Wir haben die nagelneuen Modelle Ford Nugget und VW California mit dem gelifteten Mercedes Marco Polo verglichen.
Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Kevin Kada, Stefan Schmudermaier
Es ist noch ruhig im Donaupark Camping Klosterneuburg, als wir mit Ford Nugget, Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo und VW California Ocean zum Fotoshooting anrollen. Vereinzelt sind schon Gäste mit Wohnmobil, Wohnwagen oder auch Campervan angereist, so richtig beginnt die Saison aber erst im Mai. Gut für uns, so hatten wir die Möglichkeit, die Ruhe vor dem Sturm für unseren Vergleichstest zu nutzen. Die drei Fahrzeuge möchten so etwas wie ein Schweizer Messer sein, multifunktional und für alle erdenklichen Anwendungen tauglich.
8,5 Millionen Camping-Nächtigungen im Vorjahr
Camping boomt jedenfalls, auch in Österreich. Laut dem Portal camping.info gab es 2024 stolze 8,5 Millionen Übernachtungen auf heimischen Plätzen, das mittlerweile vierte Rekordjahr in Folge. Wenig überraschend war es die Corona-Pandemie, die dieser Reiseform einen ordentlichen Boost verschafft hat, konnte man dadurch

die in Hotels oft strikten Bestimmungen vermeiden und einen mehr oder weniger unbeschwerten Urlaub genießen. Ein Blick in die Statistik weist übrigens Kärnten mit 2,5 Millionen Nächtigungen als beliebtestes Bundesland der Campingfreunde aus, gefolgt von Tirol mit 2,4 Millionen und Salzburg mit knapp einer Million.
Campingauto und Daily Driver: Es kommt darauf an … Doch zurück zu unserem Test-Trio. Der besondere Reiz dieser oftmals auf Nutzfahrzeugen basierenden Spezies liegt darin, dass es sich nicht um Camper handelt, die jedes Jahr für ein paar Wochen genutzt werden und den Rest der Zeit in Hallen oder Garagen vor sich hindarben, sondern auch im Alltag genutzt werden können, wer es drauf anlegt, sogar als Daily Driver. Und hier beginnen sich unsere Testautos bereits voneinander zu unterscheiden. Grundsätzlich macht es nur bedingt Spaß, mit Autos dieser Größe in engen Innenstädten herumzukurven und einen Parkplatz zu
suchen. Da hilft es, wenn das Vehikel garagentaugliche Abmessungen vorweisen kann. Im Falle des Mercedes und des VW lassen sich dank einer Höhe von lediglich 1,99 beziehungsweise 1,97 Metern die allermeisten Garagen problemlos nutzen, auch wenn man beim Befahren intuitiv jedes Mal den Kopf einzieht, da man durch die hohe Sitzposition das Gefühl hat, an die Decke zu stoßen. Schwieriger wird die Sache mit dem Ford. Mit einer Höhe von 2,09 Metern – samt obligatorischer Markise –scheiden viele Garagen aus, da zumeist 2,05 Meter Einfahrtshöhe als Standard zu finden sind. Kleine Unterschiede gibt es auch bei den anderen Außenabmessungen. Der Ford ist 5,05 Meter lang, 1,99 Meter breit, der Mercedes misst 5,14 mal 1,93 Meter, der VW 5,17 mal 1,94 Meter, jeweils ohne Außenspiegel.
Wer in Garagen parkt, sollte einen Blick auf die Fahrzeughöhe werfen.“
im Heck verbaut ist, finden auf der Rückbank drei statt wie üblich nur zwei Personen Platz. Die sollten dann aber eher schmal gebaut sein, vor allem auf längeren Strecken. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es den California mit maximal sechs und den Marco Polo Horizon sogar mit sieben Sitzplätzen gibt, dann aber eben ohne Kochmöglichkeit, dafür mit mehr Alltagstauglichkeit. Die größte Variantenvielfalt bietet der California, hier reicht das Angebot vom einfachen Multivan (sechs Sitze) mit Hochdach über die Versionen Beach (fünf Sitze), Beach Camper und Coast bis hin zum von uns getesteten Ocean mit jeweils vier Plätzen.
(Nicht) nur klassischer Dieselantrieb

Im Vollausbau bietet nur der Ford fünf Sitzplätze
Umgekehrt punktet der Nugget mit fünf Sitzplätzen, was in Fahrzeugen mit Küchenzeile die Ausnahme darstellt. Da hier die Küche
Bei der Motorisierung liegt die Bandbreite relativ weit auseinander. Zwar setzen alle drei auf einen VierzylinderTurbodiesel, im VW leistet der aber 150 PS, jener des Ford bringt es auf 170 PS und im Mercedes gehen gleich 237 Pferde ihrer Arbeit nach. So dramatisch fallen die Unterschiede dann aber gar nicht aus, alle drei beschleunigen mehr als ausreichend flott, Rennen fährt








1 Großes Touchdisplay für verschiedene Parameter
2 Zweiflammiger Gasherd und kleine Spüle
3 Der Kühlschrank ist in einer Lade integriert
4 Ergonomisch sehr gutes Cockpit
5 Der Grundriss erlaubt nur ein schmales Bett
6 Heckküche mit Stehhöhe als Alleinstellungsmerkmal
7 Der Tischfuß wird im Boden verschraubt, dann die Platte angebracht, etwas unpraktisch beim Bettenbau
8 Manuelles Aufstelldach, mit Leiter zu erklimmen

man mit diesen Autos ja ohnedies keine. In Sachen Fahrverhalten geben sich alle drei keine Blöße, auch wenn der höhere Schwerpunkt nicht ganz unbemerkt bleibt, liegt man dennoch mittlerweile fast auf Pkw-Niveau. Überraschend deutlich dann die Ergebnisse auf unserer Verbrauchsrunde. Mit wirklich knausrigen 6,1 Litern hat der Volkswagen sogar die WLTP-Angabe unterboten, da kann der Ford mit 7,4 Litern nicht ganz mithalten. Auch die 7,9 Liter des Mercedes sind in Anbetracht von Fahrzeuggröße, Leistung und der Tatsache, dass er als einziger im Vergleich über Allradantrieb verfügt, kein schlechter Wert.
fünf Sitzplätze geräumige Heckküche einfacher Aufstieg ins Hochdach schwer zu schließende Heckklappe
Im sorglosen Alltagsbetrieb muss man rund einen bis eineinhalb Liter drauflegen. Aber es muss nicht unbedingt ein Diesel sein, VW bietet für den California ebenso einen Plug-in-Hybrid-Antrieb an, der nicht nur eine vollelektrische Reichweite von 91 Kilometern nach WLTP schafft, sondern – der elektrischen Hinterachse sei Dank – auch gleich einen Allradantrieb mitbringt. Und dank NoVA-Entfall ist der Ansteck-California sogar noch rund 2.500 Euro günstiger als der Selbstzünder. Mercedes bietet in dieser Modellgeneration der V-Klasse Marco Polo keinen voll- oder teilelektrisierten Antrieb an, Ford liefert einen Plug-in-Hybrid nach.
Kommen wir zum Innenraum und damit zum wohl wichtigsten Bereich in einem Campingfahrzeug. Das Cockpit kennt man aus den klassischen Van-Derivaten, alle drei Hersteller bieten eine gute Bedienung sowie – gegen Aufpreis – Annehmlichkeiten wie Navi, Smartphone-Anbindung und vieles mehr. Ein kleiner Kritikpunkt betrifft die Vordersitze, die aufgrund des drehbaren Untergestells allesamt nicht ganz so stabil fixiert wirken, wie man das normalerweise kennt, aber sich dafür eben mit wenigen Handgriffen zur Sitzgruppe umfunktionieren lassen. Beim Tisch gibt es unterschiedliche
Herangehensweisen. Die Tischfläche des Nugget sowie des zugehörigen Standbeins ist in der linken Schiebetür untergebracht, als einziges Fahrzeug verfügt der Ford damit gleich über zwei Tische, einen für drinnen und einen für draußen, dort mit weiteren zwei Campingstühlen, die wie beim California – der aber nur über einen Tisch für drinnen und draußen verfügt – in der Heckklappe untergebracht sind. Apropos Heckklappe, die ist selbst mit Stühlen und somit zusätzlichem Ballast sehr schwer zu schließen, nimmt man die Sessel heraus, ist es eine echte Plackerei, die Gasdruckfedern sind schlicht zu stark. Beim Marco Polo kostet das Set mit zwei Sesseln und Tisch 551 Euro Aufpreis. Ebenfalls optional sind eine elektrische Heckklappe und die Möglichkeit, das Heckfenster separat zu öffnen.
Geräumige Heckküche im Nugget

Mercedes-Benz V-Klasse
Marco Polo 300d 4Matic
hochwertiger Innenraum nivellieren mit Luftfederung
Heckklappe: Fenster zum Öffnen keine integrierte Campinggarnitur
Die Kochgelegenheiten sind ebenfalls unterschiedlich gelöst. Im Mercedes gibt es die klassische Küchenzeile, wodurch eine zweite Schiebetür entfällt. Beim California ist diese Zeile kürzer, womit auch links eine Schiebetür möglich wurde, dafür findet sich hier nur eine statt wie beim Mercedes und beim Ford zwei Kochstellen. Wie bereits eingangs erwähnt, ist das Layout des Nugget grundlegend anders. Das Aufstelldach öffnet nicht wie bei VW und Mercedes vorn, sondern hinten. Beim Ford manuell mit Gasdruckfedern, bei Mercedes und VW gegen Zuzahlung vollelektrisch. Tagsüber lässt sich auch im Ford die Zwischendecke hochklappen, hier aber zweigeteilt. Was den Vorteil hat, dass sowohl vorn als auch hinten eine Stehhöhe ermöglicht wird, was dem Nugget das mit Abstand beste Raumgefühl beschert. Die Heckküche wirkt dabei nicht nur geräumiger, sondern ist es auch und bietet ein Plus an wertvoller Ablagefläche. Der Kühlschrank ist bei Ford und VW als Ausziehvariante umgesetzt, beim Mercedes wird mittels Klappe von oben beladen.






1 Der Tisch läuft in einer Schiene an der Küchenzeile und wird ausgeklappt
2 Die Campingparameter sind im Navi zu finden
3 Zweiflammige Kochstelle und Spüle, schmutzempfindliche Hochglanzoberfläche
4 Der Kühlschrank ist mit Klappdeckel versehen
5 Feines Cockpit, unergonomische Lenkradtasten
6 Spezieller Topper als Unterlage gegen Aufpreis
7 Stauraum auch unter dem Bett
8 Einstieg ins Aufstelldach über die Vordersitze









Staufächer für alles Mögliche gibt es überall genügend, aufpassen muss man allerdings beim Beladen. Die erlaubte Zuladung ist generell nicht sehr üppig, gerade einmal 429 Kilogramm beim Mercedes, 457 sind es beim VW und 493 beim Ford. Beim California Plug-in-Hybrid sind es übrigens gar nur magere 322 Kilogramm. Wer zu viert verreisen möchte, stößt da schnell an Grenzen. Die gebremste Anhängelast liegt beim Ford bei 2,5 Tonnen, VW und Mercedes dürfen jeweils zwei Tonnen an den Haken nehmen.

1 Touchpanel für die wichtigsten Camping-Funktionen
2 Nur einflammiges Kochfeld und kürzere Küchenzeile, dadurch ist aber eine zweite Schiebetür möglich
3 Kühlschrank ausziehbar, ausklappbare Arbeitsfläche
4 Übersichtliches, hochwertiges Cockpit
5 Ausklappbare Matratze als Liegefläche
6 Hohes Bett erlaubt zusätzlichen Stauraum
7 Nur ein Tisch, der innen und außen verwendet wird
8 Das Hochdach wird über die Vordersitze erklommen
6

Spätestens wenn die Dämmerung Einzug hält, geht es an den Bettenbau. Im ersten Stock reicht es, die tagsüber nach oben geklappte Liegefläche abzusenken, im Erdgeschoß ist etwas mehr Arbeit nötig. Im Marco Polo und im California wird zuerst die hintere Bank ganz nach vorn geschoben, danach werden die Rücksitzlehnen nach hinten geklappt. Im Mercedes optional sogar elektrisch, nötig ist das aber nicht, erst recht, da es manuell deutlich schneller geht. Im Anschluss wird noch die Matratze nach vorn geklappt beziehungsweise ein dicker Topper aufgelegt, Leintuch drauf und fertig sind die Doppelbetten. Aufwendiger ist der Vorgang beim Nugget. Hier muss zunächst der Tisch wieder abmontiert werden, danach wird die Bank vorgeschoben, ein Zwischenteil ausgeklappt und fertig ist hier die Liegefläche, die übrigens bis ins gepolsterte Küchenkastl reicht und mit Abmessungen von 1,90 mal 1,20 Metern kürzer ausfällt als jene bei VW (1,98 x 1,06) und Mercedes (2,03 x 1,13). Auch unter dem Aufstelldach macht sich die Breite des Ford bezahlt, die Liegefläche beträgt hier 2,05 mal 1,25 Meter, da kommen VW (2,05 x 1,10) und Mercedes (2,05 x 1,13) nicht ganz mit. Der Ford Nugget hat noch ein weiteres großes Plus. Denn während man bei Marco Polo und California über die Vordersitze ins Hochdach klettern und dafür einigermaßen gelenkig sein muss, lässt
einfache Bedienung zwei Schiebetüren niedriger Verbrauch nur ein Tisch für innen & außen



| Zylinder
Leistung |
Getriebe | Antrieb
*Spezifikation entspricht nicht zwingend dem Testmodell. Der besseren Vergleichbarkeit geschuldet wurden Daten ähnlicher Modelle herangezogen. Werksangaben
Aufpreise für ausgewählte Extras in Euro inkl. MwSt.
Einen klaren Testsieger auszumachen, ist bei den drei Campervans ein Ding der Unmöglichkeit. Alle drei Autos haben ihre Vor- und Nachteile, wie man diese gewichtet, ist sehr individuell. Großes Plus beim Ford ist die Heckküche mit Stehhöhe, aber auch die Tatsache, dass der Nugget als einziges Modell mit vollem Campingausbau fünf Personen statt wie bei den anderen nur vier transportieren kann, könnte kaufentscheidend sein.
sich das obere Schlafgemach im Ford über eine einhängbare Leiter von der Heckküche aus erklimmen, was deutlich komfortabler ist. Bei allen drei Campern lassen sich übrigens Frischwasserstand, Batterieladung, Heizung, Beleuchtung und einige weitere Parameter über Touchdisplays abrufen und steuern. Mercedes hat die Funktionen im Navi integriert, VW und Ford in eigenen Displays im Innenraum.
Unter 100.000 Euro tut sich wenig bis nichts
Zum Schluss kommt der unangenehme Teil dieser multifunktionalen Fahrzeuge, der Preis. Wer ohne Küchenzeile das Auslangen findet, startet noch im fünfstelligen Bereich, wer echte Camper haben möchte, wird schnell sechsstellig. Der Ford Nugget startet mit guter Ausstattung bei 99.535 Euro, der Testwagenpreis lag mit stärkerem Motor und Automatik bei 111.062 Euro. Der VW California kostet mindestens 94.704 Euro, der Testwagen kam auf 123.185 Euro. Die Mercedes V-Klasse Marco Polo startet bei 97.530 Euro, unser Testwagen in Topmotorisierung mit Allradantrieb beginnt bei 111.266 Euro, das vollausgestattete Testauto brachte es auf über 160.000 Euro. Wer mit dem Ford liebäugelt, für den gibt’s eine Hiobsbotschaft. Kurz nach dem Test mussten wir erfahren, dass der Verkauf in Österreich mit Ende April 2025 eingestellt wurde. Allerdings lohnt sich der Import aus Deutschland, da sich trotz NoVANachzahlung ein ähnlicher Preis ergibt. Tipp: Wer auf den Plugin-Hybrid wartet, der in den nächsten Monaten in Deutschland starten soll, spart sich die NoVA voraussichtlich zur Gänze. •
701 (Paket)
Die Mercedes V-Klasse Marco Polo setzt ganz auf Luxus und bringt eine hochwertige Optik mit, die an manchen Stellen – Stichwort Klavierlack beim Kochfeld – aber kontraproduktiv ist. Die Luftfederung nivelliert das Fahrzeug automatisch, ein tolles, aber aufpreispflichtiges Feature. Der starke Motor samt Allrad könnte auch ein schlagendes Argument sein. Der VW California ist unterm Strich der beste Allrounder. Die verkürzte Küchenzeile ermöglicht eine zweite Schiebetür, auf dem Multivan aufbauend zeigt er sich beim Verbrauch vorbildlich und ist zudem als Plug-in-Hybrid zu haben. Und es gibt den California in verschiedensten Varianten für maximalen Nutzwert im Alltag. Egal welches Modell, günstig sind die Multifunktionsfahrzeuge allesamt nicht.


Symbol des Aufschwungs, Ikone der Freiheit und multifunktionales Flottenfahrzeug: Die Geschichte des VW Bulli ist eng verwoben mit gesellschaftlichen Werten und wirtschaftlichem Erfolg. Der Kult-Bus feiert seinen 75er.
Text: Petra Mühr, Fotos: Christian Houdek Photography
Ein Symbol des Wirtschaftswunders. Eine Ikone der Freiheit. Familienfahrzeug und Freizeitmobil. Kultobjekt und Lifestyle-Produkt. Vermittelt Gemeinschaftsgefühl. Ein multifunktionales Flottenfahrzeug. – Welches Auto kann das schon von sich behaupten? Dass es für den Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg ebenso steht wie für die Flower-Power der späten 60er und frühen 70er? Das von Handwerkern wie Businessleuten gleichermaßen geschätzt, in vielen Familien beim Hausbau ebenso eingesetzt wurde wie als Urlaubsbus und wie ein Familienmitglied geliebt und de facto in jedem Bereich eingesetzt wird? Der VW Bulli ist mehr als nur ein Fahrzeug, er ist ein kulturelles Phänomen, spiegelt gesellschaftliche Werte, Wandel und Sehnsüchte wider. Er prägt die europäische Mobilitätskultur seit 75 Jahren. –VW Nutzfahrzeuge feierte dieses Dreiviertel Jahrhundert gebührend mit einem imposanten Bulli-Treffen am Salzburgring. Von T1 bis T7, von Camper bis Rallye-Begleitfahrzeug versammelten sich rund 500 Autos und 10.000 Menschen auf der Rennstrecke.

Abgeleitet von einem werksinternen Transportfahrzeug wurde der erste Transporter schnell zum Hit; 24,5 PS stark, nach vier Jahren schon 100.000 Exemplare, ab 1956 dann in Hannover montiert; legendär der Samba mit bis 27 Fenstern
Ein echter Hackler
„Der Bulli hat Generationen inspiriert. Er steht sowohl für Bilderbuchgeschichten als auch für handfeste Geschäfte. Das war der Ausgangspunkt – und den darf man nicht vergessen“, so Lars Krause, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Ursprünglich stammt der Bulli vom sogenannten Plattenwagen ab, eine Pritsche basierend auf dem Käfer, die nur für den betriebsinternen Transport von Teilen im Stammwerk Wolfsburg diente. Der erste Prototyp war 1949 bereits betriebsbereit, von der Bauweise den hohen Belastungen jedoch nicht gewachsen. Für den Leiter Design bei Volkswagen Nutzfahrzeugen, Albert Kirzinger, hat persönlich mit dem T0 alles begonnen: „Viele Ideen sind dann mit den Kunden entstanden, die das Auto privat umgebaut haben.“ Prototyp Nummer zwei wurde entwickelt und wenige Monate später präsentiert, parallel dazu ein Bus mit Fenstern für den Personentransport gefertigt, den man damals noch schlicht Kombi nannte.


Deutlich größer und moderner glänzte der T2 zudem mit bis 70 PS, brauchbarem Fahrwerk und erstmals seitlichen Schiebetüren; Pritsche und Kombi gibt es weiterhin, Westfalia kümmert sich erstmals um professionelle Camping-Aufbauten

Die eckige Karosse bietet noch mehr Platz, dazu kommt erstmals eine Allradversion; der California wird zum Hit, genauso wie der Multivan – bis heute; cool auch der Durchgang nach hinten und erstmals wassergekühlte Motoren bis 112 PS

Eine Palastrevolution: Front- statt Heckmotor, Vorder- statt Hinterradantrieb; die Kunden liebten es, denn der T4 bot noch mehr Platz, Leistung und Komfort; erstmals drehbare und herausnehmbare Sitze, dazu kamen VR6 und TDI
Heiße 25
1951 rollte der erste Serien-Bulli vom Band in Wolfsburg. Mit Heckmotor, 25 PS, multi–funktionell – ein „Lieferwagen ohne Kompromisse“. Ein robustes, geräumiges und universell einsetzbares Arbeitsgerät für Handwerksbetrieb, Bäcker oder Behörde. Nur vier Jahre später waren bereits 100.000 Stück produziert. Bis heute wurden weltweit über 12,5 Millionen verkauft. Die sogenannten „Bulli-Bauer“ fertigen also nicht nur Liebhaberautos, der Bulli ist auch ein ökonomischer Erfolg.
Historisch führte jedes Modell eine Innovation ein: Nach dem T1 mit Heckantrieb und Schlafmöglichkeit folgte beim T2 die Schiebetür, die California-Idee mit Aufstelldach und Modulküche wurde beim T3 umgesetzt. Ab dem T4 wanderte der Motor für Crashsicherheit und Durchstiegsmöglichkeit nach vorn … Heute bietet der Bulli aka Multivan aka T7 fünf Fahrzeugkonzepte in einem Raum, was früher nur durch Umbauten realisiert wurde: ein modulares Raumkonzept mit Platz bis zu neun Personen, flexiblem Sitzsystem, Konferenznutzung, Transportmöglichkeit und als Campervan; mit Verbrenner, Plug-in-Hybrid- sowie vollelektrischem Antrieb: Transporter und Transporter Kombi, Caravelle, Multivan und California und den ID. Buzz bzw. ID. Buzz Cargo als Strom-Version.
Kein Wunder, dass der Bulli-Clan „rund 40 Prozent des Gesamtabsatzes bei Volkswagen Nutzfahrzeuge ausmacht“, schildert Miriam Walz, Markenleitung VW Nutzfahrzeuge. Laut Statistik Austria (deren Aufzeichnungen allerdings erst 1964 begann, also lang nach der Geburtsstunde des Bulli) wurden bei uns bislang 187.913 Fahrzeuge zugelassen, über 147.000 davon sind heute noch auf der Straße!
75 Jahre und (k)ein bisschen leise
Mit dem ID. Buzz hat VW den Bulli internationalisiert. Das elektrische Aushängeschild wird unter anderem in den USA, Australien, Taiwan und anderen Märkten verkauft – und ist bereits autonom im Testbetrieb, erzählt Krause. Und auch am T8 werde längst gearbeitet.
Erfolg, Freiheit, Zukunft sind nicht nur die DNA des Bulli, sondern „wir bedienen damit menschliche Grundbedürfnisse“, so DesignChef Kirzinger. „Wir bauen keine Autos, wir bieten Lösungsraum. Und die Ansprüche des privaten wie Firmen-Kunden steigen

Komplett neu konstruiert, der Bulli wird noch geräumiger und Pkwhafter; die Zweifarb-Lackierung kehrt zurück, ebenso wird „Bulli“ erstmals zum offiziellen Namen; Kombi, Caravelle, Multivan, California, das Angebot ist riesig

Aufwendige Weiterentwicklung des T5 mit neuen Motoren und digitalisiertem Cockpit; der luxuriöse Multivan Business ist der teuerste VW, den man konfigurieren konnte; in der Basis dennoch ein braver Kastenwagen, der alles mitmacht


Tausende Fans feierten den runden Geburtstag; Teileflohmarkt war ebenso Bestandteil wie Gewinnspiele und Ausfahrten auf dem Salzburgring




immer mehr.“ „Unsere Kunden sollen mit dem Fahrzeug Geld verdienen“, unterstreicht VW klar den wirtschaftlichen Nutzen des Multivan im Flottenalltag. Ob als Shuttle, Lieferfahrzeug, mobiles Büro oder Einsatzwagen (und bis zu fünf Jahre Garantie beim neuen Transporter): Das Konzept „Bus trifft Lieferwagen“ – kurz: Bulli – ist heute relevanter denn je. Die Erfolgsgeschichte wird mit dem T8 also fortgesetzt. •


Erstmals gemeinsam mit Ford entwickelt; flacher, breiter mit allen modernen Assistenzsystemen bestückt; auch als PHEV oder BEV erhältlich und neben Multivan und ID.Buzz nun ein Drittel der BulliFamilie; T8 wird bereits konstruiert

Optik im T1-Stil, Zweifarb-Lackierung, dazu vollelektrischer Antrieb; der ID.Buzz greift das ewig junge BulliThema neu auf; als GTX mit 340 PS stärker als jeder andere VW Transporter vor ihm; seit Kurzem auch in Langversion erhältlich
1. Beifall (Mehrzahl), oder Modell von Daihatsu
1. Beifall (Mehrzahl) oder Modell von Daihatsu
2. Welche Marke produzierte den Typ „100“?
3. Veranstaltungsort der 10. FLEET Convention
2. Welche Marke produzierte den Typ „100“?
4. Wo darf man maximal 100 km/h fahren?
5. Welche Marke feiert heuer ihr 130-jähriges Bestehen?
3. Veranstaltungsort der 10. FLEET Convention
6. Kurzwort für Beschleunigung auf 100 km/h
4. Wo darf man maximal 100 km/h fahren?
7. Golf-Erfinder, wird demnächst 100 Jahre alt (Nachname)
8. Welche Marke produzierte vor 100 Jahren den „4 PS“
5. Welche Marke feiert heuer ihr 130-jähriges Bestehen?
9. Bei welchem Rennen gab es vor 100 Jahren einen besonderen
6. Kurzwort für Beschleunigung auf 100 km/h
Start?
10. Welcher Kompakt-Kia hat 100 PS?
7. Golf-Erfinder, wird demnächst 100 Jahre alt (Nachname)
11. 100 Euro Strafe, wenn man es im Auto benutzt
12. Wieviele Nougatknödel verputzt unser Grafiker bei jeder Ausgabe
8. Welche Marke produzierte vor 100 Jahren den „4 PS“?
9. Bei welchem Rennen gab es vor 100 Jahren einen besonderen Start?
10. Welcher Kompakt-Kia hat 100 PS?
11. 100 Euro Strafe, wenn man es im Auto benutzt
12. Wie viele Nougatknödel verputzt unser Grafiker bei jeder Ausgabe?
Versuch macht kluch!
Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Gener https://www.xwords-generator.de/de

Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator https://www.xwords-generator.de/de
Das Wichtigste beim Autokauf ist neben Ankaufstest, Serviceheft und gutem Allgemeinzustand vor allem eins: die Probefahrt. In meinem Fall kann gesagt werden: Alle Punkte konsequent nicht befolgt … Nicht nur, dass ich meinen Polo blind, ohne Ankaufstest und Überprüfung der Unterlagen gekauft habe. Aufgrund des teilzerlegten Zustands ging sich auch nicht einmal eine Probefahrt aus. Umso glücklicher war ich, als ich im Rahmen eines Events im deutschen Ilsede zum 50. Polo-Geburtstag die Möglichkeit hatte, mit genau so einem Exemplar – Typ G40, Baujahr 1991 –, wie ich es vor 18 Monate gekauft habe, eine kleine Runde zu drehen. Man möchte ja schließlich wissen, was man sich da eigentlich in die Garage gestellt hat. Kurzes Fazit: Platzangebot passt, Leistung ist ausreichend vorhanden und sogar die Farbe ist hübsch, wenn der Wagen gewaschen ist und nicht irgendwo zugedeckt verstaubt. Zu meiner Verteidigung möchte ich bemerken, dass der Preis einfach zu verlockend war, um nicht zuzuschlagen. Jetzt heißt es erst einmal weiterschrauben, damit der Bolide zurück auf die Straße kommt. • (RSC)

Die Sommer-Ausgabe der FLOTTE steht natürlich ganz im Zeichen der Nachberichterstattung der FLEET Convention, aber nicht nur. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Fuhrparkmanagement & Finanzierung, Fuhrparksoftware & Telematik. Ebenso dabei: News aus der Branche, ein Blick in die Autowelt und ein Schuss Unvernunft …



Impressum: MEDIENINHABER, VERLEGER UND ANZEIGENVERWALTUNG A&W Verlag GmbH (FN 238011 t), Inkustraße 1-7/Stiege 4/2. OG, 3400 Klosterneuburg, +43 2243 36840-0, www.flotte.at, redaktion@flotte.at; Verleger: Helmuth H. Lederer (1937–2014); Geschäftsführer: Stefan Binder, MBA (Kfm. Verlagsleiter), +43 664 528 56 61, stefan.binder@awverlag.at, Verlagsleiter B2C, Prokurist & Chefredakteur: Stefan Schmudermaier, +43 664 235 90 53, stefan.schmudermaier@awverlag.at; Chef vom Dienst: Roland Scharf; Redaktionelle Mitarbeit: Mag. Andreas Granzer-Schrödl, Mag. Severin Karl, Mag. Bernhard Katzinger, Andreas Kral, Achim Mörtl, Petra Mühr, Mag. Heinz Müller, Roland Scharf, Xaver Ziggerhofer; Fotos: Kevin Kade, Mag. Severin Karl, Mag. Bernhard Katzinger, Roland Scharf, Lea & Stefan Schmudermaier, Xaver Ziggerhofer; Werk, Hersteller, Archiv; Coverfoto: stock.adobe.com/scharfsinn86; Lektorat: Renate Rosner, www.rosnerbuero.at, Anzeigenmarketing: Xaver Ziggerhofer (Ltg.), +43 664 235 90 51, xaver.ziggerhofer@awverlag.at; Winfried Rath, Alexander Keiler; Grafik: graphics – A. Jonas KG, Inkustraße 1-7/Stiege 4/2. OG, 3400 Klosterneuburg, office@jonas.co.at; Druck: Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn, Wiener Straße 80; Bezugspreis: Jahresabonnement (6 Ausgaben), Inland: 56,40 Euro inkl. Steuern und Porto; Gerichtsstand: LG Korneuburg; Verbreitete Auflage: 20.806 Stück; Erscheinungsweise: Februar/März, April/Mai, Juni/Juli, September, Oktober/November, Dezember/Jänner mit Supplements laut Mediadaten 2025; Grundlegende Richtung: unabhängige Fachzeitschrift für österreichische Firmenautobetreiber; Der besseren Lesbarkeit halber verzichten wir auf die Verwendung mehrerer Geschlechtsformen, bei Personenbezeichnungen sind immer alle Geschlechter (m/w/d) gemeint.

Der erstmals exklusiv für Fuhrparkverantwortliche durchgeführte FLEET Drive am 01. Oktober 2025 in der Werft Korneuburg bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Fahrzeuge an einem Tag zu testen. Fuhrparkverantwortliche können vorab Slots für Testfahrten buchen, die 15 Minuten dauern und auf öffentlichen Straßen inklusive Autobahn durchgeführt werden. Ein Produktspezialist begleitet Sie auf der Testfahrt und beantwortet all Ihre Fragen.
Tickets
49 Euro inkl. Verpflegung (exkl. MwSt.)
Besucher der FLEET Convention nehmen KOSTENLOS am FLEET Drive teil!



Freude am Fahren. 100 % elektrisch.

BMW iX xDrive60: Energieverbrauch, kombiniert WLTP in kWh/100 km: 17,9–21,9; Elektrische Reichweite, WLTP in km: 563–701. Symbolfoto. bmw.at/iX
* Reichweite abhängig von unterschiedlichen Faktoren, insbesondere: persönlicher Fahrstil, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Heizung/Klimatisierung, Vortemperierung.