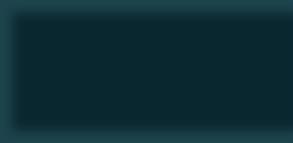



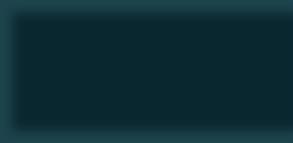



Wer kann und wer will?







Theodor Kozlowski wurde am 5. Januar 1824 in Berlin geboren und starb am 24. November 1905 in Eberswalde. Kozlowski, ausgebildeter Bauingenieur, wurde im April 1866 Direktor der Elbstrombaudirektion beim Oberpräsidenten in Magdeburg. Er setzte sich unter anderem für die durchgehende Kettenschi fahrt auf der Elbe ein. Im Jahre 1880 wurde er nach Berlin versetzt und trug den Titel eines Geheimen Oberbaurats. Zu seinen Ehren wurde in Magdeburg ein Denkmal in Form eines Obelisken errichtet mit der Inschrift:
DEM ERSTEN ELBSTROM-BAUDIRECTOR

GEHEIMEN OBER-BAURATH
THEODOR KOZLOWSKI
DIE DANKBARE ELBESCHIFFFAHRT
1866 – 1880.



Es fällt in diesen Zeiten nicht leicht, Optimismus auszustrahlen. Krisen, wo immer man hinschaut, schlechte Stimmung, kaum Hoffnung auf Besserung. Wenn die Hälfte des wirtschaftlichen Erfolges Psychologie ist, wie manche behaupten, dann ist es um Deutschland schlecht bestellt. Betrachtet man die Wirtschaftsstruktur der Republik, dann sind zwar die großen Namen der Automobiloder der Chemieindustrie ständig in den Schlagzeilen, aber der Börsenindex DAX beinhaltet gerade mal 40 Unternehmen. Bis zum September 2021 waren es 30. Und das hat einen Grund. Der Umsatz Einzelner macht nicht die Wirtschaftskraft eines Landes aus. In Deutschland gab es 2021 etwa 3,15 Millionen kleine und mittelständische Firmen, somit über 99 Prozent. Damit wird schnell klar, wer das Bruttosozialprodukt erwirtschaftet. Die kleinen und mittleren Firmen sind das Rückgrat der Wirtschaft.
Allerdings: Kleine Unternehmen sterben leise. Kaum jemand nimmt Notiz davon. Doch inzwischen ist es ein Massensterben. Die Politiker sollten begreifen, dass man sich auch um die Kleinen kümmern sollte, beispielsweise mit vorteilhaften Energiepreisen. Die Gründe für jährlich Hunderte und Aberhunderte Unternehmen in Sachsen-Anhalt, die die Firmentür für immer verschließen, sind vielfältig. Gern konzentriert man sich auf die Demografie. Dafür kann schließlich keiner. Und tatsächlich ist es eine große Zahl, die keinen Nachfolger findet. Aber wie attraktiv ist es, sich mit aller
Kraft unübersehbar zu verschulden, die Risiken einer Pleite und schlaflose Nächte auf sich zu nehmen? Fachkräfte werden an allen Ecken gesucht. 60 oder 70 Wochenstunden arbeiten, oder lieber eine Vier-Tage-Woche lang? Geld ist nicht alles.
Zahllose Portale, Netzwerke, Verbände und Kammern verkünden unisono, wie Selbständigkeit glücklich macht, wie wichtig die eigene Entscheidungsfreiheit ist, die Selbstbestimmtheit. Die das verkünden, waren meist nie selbständig.
Trotzdem: Bei den Recherchen, und das ist auf den Themenseiten zu lesen, finden sich immer wieder Menschen, die dieses Risiko eingehen. Ihnen haben wir eine Stimme gegeben, um damit auch anderen Mut zu machen. Alle haben übereinstimmend gesagt, dass sie diesen Schritt zur eigenen Firma immer wieder machen würden. Das gilt übrigens auch für
Allerdings sind das alles Erfolgsgeschichten. Gern hätten wir auch gezeigt, wenn es jemand nicht geschafft hat. Aber die wollten nicht. Es ist nach wie vor offenbar eine Schande, gescheitert zu sein. Und außerdem, das hat Bertolt Brecht gesagt, sieht man immer die im Licht, aber die im Schatten nicht.
Viel Spaß beim Lesen wünscht …

Rolf-Dietmar Schmidt Chefredakteur und Herausgeber

Rolf-Dietmar Schmidt
Chefredakteur und Herausgeber
Aboservice:
Tel. 0391 25 85 75 11 abo@aspekt-magazin.de
Redaktion:
Tel. 0391 25 85 75 11 redaktion@aspekt-magazin.de
ist eine Publikation des Herausgebers
Rolf-Dietmar Schmidt

06
Foto des Monats

08
HandballerSportstunde

09
Transfer-Center in Halle

10
Titel „Ich würde es wieder machen“

14
Wassersto -Technik im Real-Test



Leserbriefe/Sonstiges
Kolumne: Der Krimi ist nicht umzubringen
SACHSEN-ANHALT AKTUELL Aufschwung nicht in Sicht
und Handballer in der Sportstunde
TITELTHEMA
Nachfolge: „Ich würde es wieder machen“
des Familienbetriebs.
WIRTSCHAFT
Energiepark Bad Lauchstädt
Von E-Signature zur Vertragssoftware.
Ho nungsträger Magnesium
AGENTUR FÜR ARBEIT
Gesundheit und Wiedereingliederung .
Pflegeberufe sind gefragt
Jobbörse für Produktionsberufe
Von Frauen für Frauen
WISSENSCHAFT
Pflanzen mit Strom füttern
NATUR UND UMWELT
„Werkzeugkasten“ für Ohre und Wanneweh.
Die Ackerschmalwand heilt sich selbst
12
14
16
22
HARTE FAKTEN
Geraer Rentner haben das meiste Geld
ENERGIE
Wieder eine „Grüne Hausnummer“
„Zwickmühle“:
18
..18
19
..19
22
20
24
frech und angenehm unanständig
aspekt, April 2024, Seite 10 Vom Vorschussverein zur stärksten Wirtschaftsorganisation
Super Idee
Ich habe mit großem Interesse den Artikel zu den Genossenschaften gelesen. Schade, dass sie nichts über die Konsum-Genossenschaft in der DDR geschrieben haben. Dort gab es bei jedem Einkauf im Konsum Wertmarken in der Höhe der Kaufsumme. Die haben wir in ein Heft geklebt, das dann, ich glaube einmal im Jahr, kontrolliert wurde. Dann hat man seinen Anteil am Umsatz als Bargeld ausgehändigt bekommen. Das war jedes Mal eine Riesenfreude. Wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, war das eine Superidee zur Kundenbindung.
Elvira Jänicke, Magdeburg
Eine Chance für die Zukunft
Es ist schon interessant, dass es die Genossenschaften in fast 200 Jahren immer gescha t haben, zu überleben. Weder der Erste oder Zweite Weltkrieg, die Nazis, noch die DDR haben es gescha t, diese gemeinschaftliche Wirtschaftsform zu verdrängen. Nicht mal der Kapitalismus, der mit der Verelendung der Massen erst die Idee letzten Endes hervorbrachte, hat das gescha t. Und jetzt, wo es wieder jede Menge Elend gibt, zeigt sich eine Renaissance des Genossenschaftsgedankens. Wahrscheinlich ist es die einzige Wirtschaftsform, die auch einer künftigen Gesellschaft eine Chance böte.
Karl-Friedrich Braunherr, Hannover
aspekt, April 2024, Seite 12
Die Gemeinschaft scha t die Stärke
Der Schatz im Keller
Das Interview mit Herrn Fabig von der Volksbank Magdeburg, also einer Genossenschaftsbank, hat alte Erinnerungen wachge-

Eine ganze Welt aus Playmobil-Figuren ist im Jahrtausendturm des Elbauenparks
Magdeburg zu sehen. Anfassen geht leider nicht, denn die wertvollen Dioramen eines Hamburger Künstlers sind hinter Glas sicher. Allerdings gibt es kleine Tische mit vielen Figuren, an denen die Kleinen nach Herzenslust spielen können.
rufen. Meine Eltern, die schon lange tot sind, hatten ein kleines Geschäft in MagdeburgSudenburg. Mein Vater musste abends nach Feierabend mit dem Bargeld aus der Kasse in die Otto-von-Guericke-Straße zur Volksbank und dort einen Metallzylinder, in dem das Geld war, von außen durch einen Schlitz in der Hauswand einwerfen. Für mich als Kind war das unglaublich spannend, denn ich stellte mir vor, was für Schätze da wohl in dem dunklen Keller liegen würden.
Anna-Maria Stotzki,
Harzgerode
aspekt, Ausgabe April 2024, Seite 16 Deutsche Interessen in Europa berücksichtigen
Was qualifiziert einen Menschen, im Europaparlament Sachsen-Anhalts Bevölkerung zu
vertreten? Ihr Interview mit der CDU-Spitzenkandidatin enthält leider nur Allgemeinplätze zu den Vorhaben und Aufgaben, die sich Alexandra Mehnert vorgenommen hat. Deshalb habe ich mir im Internet den Lebenslauf angesehen. Woher nimmt jemand, der o enbar in seinem Leben noch nie einen Betrieb zum Arbeiten von innen gesehen hat, das Selbstbewusstsein, für die Wirtschaft und die Landwirtschaft zu sprechen? Jemand, der noch nie das Geld am Monatsende tatsächlich selbst erwirtschaften musste, weiß doch gar nicht, was das bedeutet.
Gerald Janocha, Berlin

Das Böse zieht die Menschen magisch an. Zwar möchte man davon nicht betro en sein, aber es verursacht einen leichten, angenehmen Schauder, wenn man so aus sicherer Distanz beobachten kann, wie schlecht die Welt ist.
Wie anders ist die Faszination des Verbrechens zu erklären, das seit Jahrhunderten in Büchern und in jüngerer Zeit zusätzlich allabendlich auf dem Fernsehschirm das Publikum in den Bann schlägt. Der Krimi ist nicht umzubringen. Er liegtnachwievorinderGunstganzvorn,weshalbdasFernsehen,obnunö entlich-rechtlichoderprivat,demMorden und Metzeln mindestens so viel Sendezeit einräumt, wie den unzähligen Talk-Shows oder Florian Silbereisen. Tote bringen noch mehr Quote.
Wohlgemerkt Tote. Jegliche andere Form der Kriminalität –und da gibt es noch einiges – scheint den Zuschauer bei weitem nicht so zu interessieren. Woher kommt diese Sehnsucht nach Mord und Totschlag? Oder ist das vielleicht nur das Ansinnen der Fernsehmacher? Warum hat ein Heiratsschwindler oder ein Geldfälscher nicht ebenso ein Recht auf mediale Aufmerksamkeit?
Man braucht gar keine wissenscha liche Untersuchung, um festzustellen, daß es seit Jahren in den Fernsehkrimis ausschließlich um Leichen in jeder Form geht. Trotzdem haben sichLeutehingesetztundgezählt.WievieleKrimiszeigtallein das ö entlich-rechtliche Fernsehen in einer Woche, wie viele Tote kommen darin vor?
Das Ergebnis ist, von kleineren Schwankungen abgesehen, recht stabil. Selbst an traditionellen Feiertagen der Nächstenliebe wird virtuell gemordet, was der Bildschirm hergibt. Und so kommt man auf die stattliche wöchentliche Zahl von etwa 70 gewaltsam aus dem Leben beförderten Personen. Nicht berücksichtigt ist dabei, daß in den Kinos zwischen Pop Corn und Cola das Leinwand-Blut ebenfalls in Strömen ießt. Und wem das alles nicht reicht, der kann beim Streamen oder in
einer Mediathek das alles wiederholen.
Bleibt man beim „Bildungsfernsehen“, dann sind das knapp 300 Fernsehleichen im Monat und so grob über den Daumen in zehn Jahren dreieinhalb Tausend, die das Zeitliche unfreiwillig gesegnet haben.
Ein Junge von zehn Jahren, regelmäßigen Fernsehkonsum vorausgesetzt, hat als junger Mann von 20 Jahren bereits miterlebt, wie die Bevölkerung einer Kleinstadt brutal aus dem Leben gebracht wurde. Geht er dann auch noch ö er ins Kino, oder hat er gar ein passendes Computerspiel, dann wird schnell eine Großstadt daraus. Und da soll einem nicht angst und bange werden?
Man stelle sich nur einmal vor, ein vernun begabtes Wesen will die Erde besuchen und versucht, sich vorab ein Bild von den Menschen über die leicht zu empfangenden Fernsehprogrammezumachen.EswürdevermutlichdasGrausenpacken. Vielleicht hat uns deshalb noch keines besucht. Und dabei haben die Inhalte der täglichen Krimis überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Morde sind in der Kriminalstatistik das seltenste vorkommende Delikt. Die Zahl bewegt sich so um die 300 aufgeklärte Fälle in Deutschland, allerdings für ein ganzes Jahr. Soviel verbrauchen die Fernsehkrimi-Macher in einem Monat! Und was sollen sie dann in den übrigen elf Monaten zeigen? Heiratschwindler? Geldfälscher? Ladendiebe?
Ein Kriminalpsychologe hat mal den Vorschlag gemacht, man möge den Krimiautoren so eine Art Deliktquote vorgeben, die sich an der Zahl und Art der Taten orientiert und so ziemlich genau die Realität wiedergäbe.
Der Vorschlag wurde ziemlich schnell abgeschmettert. Warum? Wer will schon dauernd Tatorte mit Bankern sehen …
Die AOK Sachsen-Anhalt und der Handballverein SC Magdeburg arbeiten zusammen, um Kinder und Jugendliche an Schulen für mehr Bewegung und gesunde Ernährung zu begeistern. Handball-Star und SCM Youngsters Trainer Christoph Theuerkauf geht dafür höchstpersönlich an die Schulen für eine gesunde Sportstunde.
„Besonders während der Pandemie litten viele Kinder und Jugendliche an Bewegungsmangel“, sagt Klaudine

Schönemann-Rach, Netzwerkkoordinatorin Gesundheit bei der AOK Sachsen-Anhalt. „Heute leiden mehr Kinder und Jugendliche an Adipositas, und in den letzten zehn Jahren haben sich Diabetes-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt verdoppelt.“
Aus diesem Grund wird der Handballstar und Trainer der Youngsters des SC Magdeburg, Christoph euerkauf, landesweit eine gesunde Sportstunde an Schulen durchführen. „Wir gehen

aus
Die Stimmung im Handwerk im Kammerbezirk Magdeburg liegt im Frühjahr 2024 deutlich unter den Vorjahreswerten. Insgesamt gaben nur 40 Prozent der Betriebe eine gute Geschä slage an, im Vorjahr sagte das noch jeder Zweite. Auch die Erwartungshaltung der Betriebe bleibt von Unsicherheit geprägt, die Zukun wird eher pessimistisch beurteilt: Aktuell erwarten 20 Prozent eine Verschlechterung der Lage, im Vorjahr waren es nur 14 Prozent. Das ist das Ergebnis der Frühjahrskonjunkturumfrage, die die Handwerkskammer in Magdeburg vorlegte.

gemeinsam mit der AOK in die Schulen und sind mit den Schülerinnen und Schülern mit viel Spaß sportlich aktiv“, so euerkauf. „Dabei steht nicht nur die Bewegung im Vordergrund. Wir vermitteln auch Wissen über gesunde Ernährung, Entspannung und wie wichtig regelmäßige Bewegung für das Wohlbe nden ist.“

Der „Klassenraum der Zukunft“ in der Niederlassung von Dell Technologies in Halle/Saale wurde Ende April eingeweiht. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt von Dell und Intel. Ziel ist es, Lehrkräfte von Schulen, Berufsschulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen fit für die Nutzung moderner Technologien im Unterricht zu machen. Vor Ort soll demonstriert werden, wie moderner Unterricht aussehen kann. So wird unter anderem vermittelt, wie KI, Robotik, Drohnen oder der 3D-Druck in den Unterricht integriert werden können.


Foto: (re.) Der Präsident der Handwerkskammer Magdeburg, Andreas Dieckmann aus Elbingerode, neben ihm Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der HWK Magdeburg.


Rund 21,5 Millionen Euro stehen für die Gründung des „European Center for Just Transition Research and Impact-Driven Transfer“ (JTC) an der Martin-LutherUniversität Halle bereit. Ziel ist es, forschungsbasierte Lösungen für den Strukturwandel in SachsenAnhalt zu entwickeln, etwa im Bereich der Kreislaufwirtscha oder sozialer Innovationen. Die Mittel für das Projekt stellt das Land Sachsen-Anhalt über den „Just Transition Fund“ der Europäischen Union bereit.
Uni-Rektorin Becker sagte: „Das JTC ist für die Universität Halle und die Region eine einmalige Chance: Mit der Förderung wollen wir unsere Kompetenzen in den Forschungszweigen ausbauen, die für die Bewältigung des Strukturwandels von wesentlicher Bedeutung sind. Gemeinsam mit den vier Landkreisen im Süden Sachsen-Anhalts werden wir neue Impulse für eine wirtscha liche und gesellscha liche Entwicklung setzen. Das ist eine spannende Aufgabe und eine große Verantwortung, die wir gerne übernehmen.“
Das eater Magdeburg sucht für das Festival „eXoplanet“ nach innovativen künstlerischen Projekten in der Sparte Neues Musiktheater und lobt einen Wettbewerb für aufstrebende künstlerische Teams aus. Bis Ende Mai 2024 können Projektentwürfe eingereicht werden.EineinternationaleJurywählt aus den Einsendungen das interessanteste Projekt aus. Die Siegesproduktion erhält eine Förderung in Höhe von 10 000 Euro und wird während eines Festivals vom 9. bis 11. Mai 2025 in Magdeburgaufgeführt. Mit dem Festival „eXoplanet“ etabliert das eater Magdeburg einen Ort für Neues Musiktheater in Mitteldeutschland. Dabei liegt der Fokus auf performativen, musikdramatischen Formaten, die eingefahrene Seh- und Hörgewohnheitenhintersichlassen.EinenBlickins Zukun slabor gewährt der Wettbewerb für ein innovatives Musiktheaterprojekt der freien Szene: Der Wettbewerb richtet sich an interdisziplinär arbeitende Künstler und Praktiker aller Fachrich-
tungen aus Sachsen-Anhalt oder dem Rest der Welt. Es können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen teilnehmen, die performative oder installative Projekte oder Interventionen entwickeln. Die Projekte sollen Geschichten erzählen, wobei der erzählerische Impuls aus der Musik kommt.
Jede Form des künstlerischen Ausdrucks ist zugelassen – je interdisziplinärer, desto besser. Erwünscht sind ausdrücklichProjekte,diesichkünstlerisch mit dem Stadtraum, seinen Menschen und seinen Besonderheiten auseinandersetzen. Der Au ührungsort soll sich außerhalb der üblichen Spielstätten des eaters be nden.
Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2024 an die E-Mail-Adresse intendanz@ theater-magdeburg.de gerichtet werden. Die Bewerbung sollte ein aussagekräftiges Dossier mit einer Projektbeschreibung und einem Finanzplan sowie einen kurzen biogra schen Überblick mit Kontaktdetails beinhalten. Bildmaterial isterwünscht,abernichtverp ichtend.
Für Unternehmen in Sachsen-Anhalt wird es in den kommenden Jahren verstärkt darauf ankommen, möglichst energiee zient und klimaneutral zu produzieren. Damit die klimaneutrale Transformation der Wirtscha im Land weiteren Schwung aufnimmt, hat das Energieministerium das Förderprogramm „Sachsen-Anhalt ENERGIE“ für Unternehmen neu aufgelegt. Mit insgesamt 42 Millionen Euro unterstützt das Ministerium kleine, mittlere und große Betriebe unter anderem bei der energiee zienten Sanierung von Gebäuden, dem Austausch ine zienter
technischer Anlagen sowie der Installation erneuerbarer Energiequellen für die Versorgung mit Strom und Wärme. Förderanträge können Unternehmen ab sofort bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) stellen.
Die Fördersätze richten sich dabei nach der Unternehmensgröße. Kleine Betriebe erhalten bis zu 50 Prozent, mittlere bis zu 35 Prozent, große Unternehmen bis zu 20 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Der Höchstbetrag liegt bei einer Million Euro, zudem müssen die Projekte innerhalb Sachsen-Anhalts umgesetzt werden.
Kleine Firmen sterben leise. Die Gründe sind vielfältig, aber oft sind es gar nicht wirtschaftliche Gründe, die zum Aufgeben zwingen, sondern schlichtweg das Alter. Wohl denen, die in ihrer Familie jemanden haben, der die Firma übernehmen wird. Aber häufig ist das nicht der Fall. Dann ist die Nachfolgeregelung ein Problem.
Die Generation der Macher, die zur Wende in Deutschland mutig und in den besten Jahren die Selbständigkeit in die Hand genommen haben, sind inzwischen ergraut. Und es sind tausende Unternehmen allein in Sachsen-Anhalt, die zur Übernahme anstehen.
Wer heute ein Unternehmen gründen will, sollte genau überlegen, ob es nicht vielleicht klüger und einfacher wäre, einen Betrieb zu übernehmen. Vieles von dem, was bei einer Gründung mit großem Aufwand gescha en werden muß, ist in einer etablierten Firma schon vorhanden.
Aufrufe und Netzwerke zur Unternehmensnachfolge sind wichtig und richtig. Überzeugender sind aber vielleicht ein paar Beispiele. Einige davon sind auf dieser und den Folgeseiten zu finden.
„Ich würde es wieder machen ...“
Claudius Borgmann ist viel in der Welt herumgekommen. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur hat zuletzt vier Jahre lang als Geschäftsführer in einem amerikanischen Konzern der Chemieindustrie gearbeitet. Mit Metallbearbeitung kennt er sich aus, hat in dieser Branche gelernt. Doch nur auszuführen, was andere ihm sagen, das liegt ihm nicht. Er will selbst gestalten, die Prozesse in der Hand behalten, Entscheidungen tre en. Da lag der Gedanke, sich selbständig zu machen, nahe. Das Ergebnis heißt FREROtec KG Erodier- und Zerspanungstechnik. Aber der Weg dorthin war nicht einfach ...
Claudius Borgmann denkt bei all seinen Entscheidungen gründlich nach, analysiert genau die Umstände und Bedingungen, bezieht eventuelle Probleme und Schwierigkeiten mit ein, macht einen genauen Plan, eben wie ein Ingenieur an eine Aufgabe herangeht. Das galt selbstredend auch für diese Entscheidung, Unternehmer zu werden.
Noch jung genug, auch wenn nicht mehr ganz jung, das bewog ihn, statt einer Unternehmensneugründung über die Übernahme einer Firma nachzudenken. Auch die Branche stand dank seiner fundierten Ausbildung fest, das betriebswirtscha liche Knowhow hatte er mit dem Studium der Betriebswirt-
scha ebenfalls verinnerlicht. Kurz: Ideale Voraussetzungen ein Unternehmen mit Perspektive zu nden, das aus Altersgründen des Vorbesitzers abzugeben wäre.
Von allen Seiten war zu hören, dass eine Vielzahl von Firmen zur Übergabe bereitstünden. Das stimmt, aber darunter genau die richtige zu nden, ist gar nicht so einfach. Wegen der Familie sollte es schon im Umkreis von Magdeburg sein, die richtige Größe haben und auch von der Mitarbeiterstruktur passen. Immerhin bringt ein neuer Inhaber auch neue Ideen, Veränderungen in den Abläufen und vieles andere mit. Eine Belegscha , die eventuell mit dem alten Inhaber „mitgealtert“ ist, gewöhnt
sich nicht in jedem Fall schnell und ohne Widerstände an den „neuen Besen“, der angeblich so gut kehrt.
„Die Suche war alles andere als einfach“, so Claudius Borgmann. „Ich habe die Nachfolgebörsen gewälzt, die IHKZeitschri durchforstet, im Internet recherchiert, aber bis ein Unternehmen gefunden war, das meinen Vorstellungen entsprach, das hat gedauert. Und um ganz ehrlich zu sein: Es gehört auch eine Portion Glück dazu, das Richtige zu nden.“
Claudius Borgmann hatte Glück. In Gernrode im Harz, nicht ganz nahe an Magdeburg, aber auch nicht zu weit, fand er die Metallbearbeitungs rma von Dieter Frenkel, die seinen Vorstel-

lungen entsprach. Das Gespräch mit dem Alteigentümer dauert nicht einmal sehr lange. Der hatte mit einer Übernahme schon einmal nicht die besten Erfahrungen gemacht und war entsprechend entgegenkommend, nun einen ernstha en Interessenten und Fachmann für die Fortführung seines Lebenswerkes gefunden zu haben. Schnell war beiden Parteien klar, dass man sich einig werden würde.
Aber das war noch nicht alles. Schließlich bedeutet so ein Lebenswerk für den bisherigen Besitzer etwas anderes als für den Käufer. Beim Geld hört die Freundscha auf, heißt es im Volksmund, also sind die Verhandlungen darüber erfahrungsgemäß bei einer Firmenübernahme eine große Hürde. Aber auch die nahmen die Beiden.
„Ich habe viel Zeit im Unternehmen verbracht, habe mitgearbeitet, Akten gewälzt, gerechnet, mir die Abläufe und Bedingungen angesehen. Es war ein Glück, das ich an der Technischen
Universität Braunschweig ein Kombinationsstudium aus Maschinenbau und Betriebswirtscha gemacht habe. Das kam mir bei der realen Beurteilung des Unternehmenswertes sehr entgegen. Mit diesem fachlichen Wissen konnte ich auch den Vorbesitzer überzeugen. Trotzdem gehört jede Menge gegenseitiges Vertrauen dazu, den monetären Teil auch sauber abzuwickeln.“ Die Finanzierung einer so weitreichenden Entscheidung einer Firmenübernahme ist auch bei Vorlage aller Daten und selbst bei guter Eigenkapitallage häug ein Problem. Nicht jede Bank önet bereitwillig alle Türen und fördert Eigeninitiative und Unternehmertum. Diese Erfahrung musste auch Claudius Borgmann machen. Häu g fehlt auch einfach die Fachkenntnis, um Finanzierungen nicht nur nach Zahlen, sondern auch nach Branchenerfahrung beurteilen zu können.
Nach mehreren Anläufen und Absagen bekam er von der regionalen Spar-
kasse, ankiert durch den Einstieg der Mittelständischen Beteiligungsgesellscha und der Bürgscha sbank, eine Finanzierungszusage für den Firmenkauf. Bis zur vollständigen Bearbeitung und der Auszahlung auf das Geschä skonto dauerte es dann noch drei Monate, die auch der Alteigentümer abwarten musste.
Auch das erfordert viel Vertrauen, wenn man jemanden, der schließlich aus Altersgründen sein Unternehmen verkau hat, immer wieder vertrösten muss. Letztlich hat alles geklappt. Seit mehr als zwei Jahren nimmt die Firma FREROtec in Gernrode eine erfreuliche Entwicklung.
„Ich würde es wieder machen“, erklärt Claudius Borgmann voller Überzeugung und mit Blick auf seine Mannscha von inzwischen 20 Mitarbeitern. Bei so viel Tatkra und klugem Management dür e das sicher gelingen.
Der Meistertitel genießt in Deutschland und weit darüber hinaus hohes Ansehen. Er ist nicht nur die Garantieurkunde für exzellente Fachkenntnisse, sondern auch für die Fähigkeit, einen Betrieb zu leiten und Lehrlinge auszubilden.
Dorit Elmenthaler, Installateur- und Heizungsbauermeisterin
110 Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister haben kürzlich in Magdeburg ihre Meisterbriefe erhalten. Ganz sicher werden viele von ihnen die Chance nutzen, eine Firma zu gründen, vielleicht den Familienbetrieb weiterzuführen, oder eine Handwerksfirmazuübernehmen,die aus Altersgründen aufgeben muss.
Der Präsident der Handwerkskammer Magdeburg, Andreas Dieckmann, fasste das in einem wichtigen Satz zusammen: „Sie sind unsere Zukunft.“ Und er verwies darauf, dass diese jungen Meisterinnen und Meister den Fortbestand des Handwerks einschließlich aller, die unmittelbar damit zu tun haben, verantworten und gestalten würden.
Wie man sich beispielsweise in einem Familienbetrieb auf diese Aufgabe vorbereitet, dass erfuhr Autorin Anja Gildemeister in einem kleinen Ort in der Nähe von Zerbst.
Zwölf Jahre alt war Dorit Elmenthaler, als ihr Vater Hartmut Schmidt in Straguth bei Zerbst eine Firma für Heizung, Lüftung und Sanitär gründete.

„Ich bin da mit reingewachsen. Mein Vater hat es gut verstanden, mich für technische Dinge zu interessieren und zu motivieren“, sagt die heute 44-Jährige.
Auf der Baustelle verdiente sich Dorit Elmenthaler ihren Moped-Führerschein. Und auch im Büro des Betriebs arbeitete sie an der Seite ihrer Eltern schon in der Schulzeit regelmäßig mit.
Nach dem Abitur studierte sie in Bernburg Betriebswirtschaftslehre. „Das lag mir und dadurch konnte ich mehr betriebswirtschaftliches Wissen in unsere Firma holen“, sagt Dorit Elmenthaler, die während des Studiums weiterhin im Familienbetrieb arbeitete. Familie, Freunde, Sport- und Karnevalsverein in der Heimat ließen sie ein echtes Studentenleben nicht vermissen.
Nach dem Diplom folgte eine Lehre zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, ihr Vater bestand darauf. Fortan teilte die Betriebswirtin mit 16- bis 18-jährigen Schul- und Werkbank. „Ich habe das nicht bereut, und es hat auch Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gut ergänzt und viel gelernt. Und die Männerwelt ist doch oft unkomplizierter“, sagt Dorit Elmenthaler.
Ähnliche Erfahrungen hat sie jetzt in der Meisterschule gemacht. Mittlerweile verheiratet und Mutter zweier Kinder, legte sie 2017 den Ausbil-
dungsschein für Ausbilder, kurz, den AdA-Schein ab und absolvierte dann ab 2022 in Vollzeit die Teile I und II. Der betriebswirtschaftliche Teil III wurde ihr aufgrund ihres Studiums erlassen.
„Die Fach-Theorie fiel mir nicht schwer, hier konnte ich noch viel Wissen erwerben. Vor der Fachpraxis hatte ich Respekt, obwohl ich davor zwei Jahre lang fast ausschließlich auf der Baustelle gearbeitet hatte. Doch unsere Dozenten haben uns hier fit gemacht und meine Mitschüler haben mich unterstützt, das war wirklich Gold
wert. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das geschafft habe“, strahlt sie. Wenn ihr Vater soweit ist, möchte Dorit Elmenthaler den Familienbetrieb übernehmen, zusammen mit ihrem Bruder, der auch im Unternehmen arbeitet. „Bis dahin muss ich noch viel lernen“, sagt sie und hat sich auch vorgenommen, betriebliche Abläufe zu digitalisieren und Fachkräfte zu gewinnen. Wichtig ist ihr, gemeinsam mit den Mitarbeitern Lösungen zu finden. Vielleicht macht sie irgendwann die Weiterbildung zur Energieberaterin. Aber jetzt freut sie sich darauf, „einfach nur arbeiten“ zu können.










Das Konsortium um den Energiepark Bad Lauchstädt freut sich über den Gewinn des H2Eco Awards 2024. Auf dem Foto (v.l.n.r.): Dr. Jochen Köckler (Deutsche Messe AG), Udo Philipp (Staatssekretär im BMWK), Dr. Jörg Nitzsche (DBI), Cornelia Müller-Pagel (Projektleiterin des Energiepark Bad Lauchstädt und VNG AG), Prof. Dr. Hartmut Krause (DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg), Dr. Ralf Borschinsky (ONTRAS), Xenia Papst (Elektrolyse Mitteldeutschland Gmbh und Uniper), Falk Zeuner (Terrawatt) und Werner Diwald (DWV).

Der Energiepark Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt ist als Leuchtturmprojekt der Energiewende diesjähriger Gewinner des H2Eco Awards, der auf der HANNOVER MESSE 2024 verliehen wurde. Der H2Eco Award wird vom Deutschen Wassersto -Verband e. V. und der Deutschen Messe AG ausgeschrieben und steht unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsminister Dr. Robert Habeck.
Der Energiepark Bad Lauchstädt ist als Leuchtturmprojekt der Energiewende diesjähriger Gewinner des H2Eco Awards.
Cornelia Müller-Pagel, Projektleiterin des Energiepark Bad Lauchstädt sowie Leiterin Grüne Gase der VNG AG und Professor Dr. Hartmut Krause, Geschäftsführer Ressort Wissenschaft & Bildung des DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, nahmen die Auszeichnung im Namen der insgesamt sieben Konsortialpartner des Vorhabens auf der Bühne des Public Forum Hydrogen + Fuel Cells EUROPE entgegen.
Projektleiterin Cornelia Müller-Pagel freute sich über die Auszeichnung:
„Wir sind unheimlich dankbar für diese Auszeichnung. Seit dem Spatenstich im vergangenen Jahr haben wir bereits bedeutende Meilensteine, wie etwa Deutschlands ersten Liefervertrag für grünen Wassersto oder das Richtfest für das Gebäude des 30-MWGroßelektrolyseurs erreichen können. Inzwischen steht die erste Wertschöpfungsstufe, der Windpark mit acht Windenergieanlagen und einer Leistung von 50 Megawatt, bereits kurz vor der Fertigstellung. Dieser Preis zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens für die Zukun des grünen Wassersto s in Deutschland. Ein großer Dank geht an dieser Stelle auch
indieRundederPartner,diemitunsfür den Energiepark Bad Lauchstädt brennen. Der H2Eco Award ist ein weiterer Ansporn, unseren Weg mit all unserer Begeisterung und Energie fortzusetzen.“
Professor Krause und sein Team des Gastechnologischen Instituts Freiberg begleiten den Energiepark Bad Lauchstädt wissenscha lich. Auch er zeigte sich hocherfreut über die Auszeichnung: „Das große Interesse und die Unterstützung für unser Vorhaben be ügeln uns bei der täglichen Projektarbeit auf dem Weg der Realisierung des Energiepark Bad Lauchstädt. Als Reallabor der Energiewende ist der Energiepark Bad Lauchstädt ein Leuchtturm und hat viele andere Wassersto projekte

Ein gemeinsames

Der H2Eco Award ist mit einem Preisgeld von 5000 Euro dotiert und wird an ein Projekt verliehen, das einen relevanten energiewirtscha lichen Beitrag zum Hochlauf der Wasserstowirtscha leistet. Das Preisgeld kommt Initiativen zugute, die sich im Kleinen um das ema bemühen. In diesem Jahr erhält das Spendengeld die Heinze Akademie in Hamburg. Sie bietet einen zerti zierten Ausbildungskurs für ukrainische Flüchtlinge an, um diese im Bereich der Wassersto wirtscha als Fachkrä e auszubilden.
gen – für eine technologisch starke und zukunftsorientierte Wassersto region in Mitteldeutschland und eine erfolgreiche Sektorenkopplung in der gesamten Bundesrepublik. Nachdem das Projekt im September 2021 o iziell gestartet ist, standen in der ersten Projektphase Planungen und Genehmigungen im Fokus. Diese erste Phase konnte mit einer positiven Investitionsentscheidung der Konsortialpartner abgeschlossen werden. Die im Juni 2022 gestartete zweite Projektphase, in der die bauliche Umsetzung im Vordergrund steht, konnte ö entlichkeitswirksam im Beisein der Ministerpräsidenten Sachsens und Sachsen-Anhalts mit dem 1. Spatenstich begonnen werden. Dazu werden vor allem die acht Windenergieanlagen sowie der Elektrolyseur errichtet. Zudem laufen die Maßnahmen zur Umstellung der Transportleitung. Es folgt die Errichtung der Forschungsanlage zur Gasmessung und Gasreinigung. Die Inbetriebnahme aller Teilanlagen ist für das Jahr 2025 geplant. angestoßen. Er ist eine einmalige Gelegenheitfüruns,neueTechnologienund Lösungen unter realen Bedingungen zu erproben und das im industriellen Maßstab. Wir wollen zukun sweisende Konzepte zur sicheren und klimaneutralen Energieversorgung mit Grünem Wassersto schnellstmöglich in Deutschland auf den Weg bringen.“
Die Projektpartner investieren insgesamt 210 Millionen Euro, die eine Förderung als „Reallabor der Energiewende“ mit 34 Millionen Euro aus dem Energieforschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtscha und Klimaschutz enthält.
Der Energiepark Bad Lauchstädt ist ein großtechnisch angelegtes Reallabor als Gemeinschaftsprojekt von SachsenAnhalt und Sachsen zur Erzeugung von Grünem Wassersto sowie dessen Speicherung, Transport, Vermarktung und Nutzung. Als Reallabor der Energiewende wird dabei erstmalig die gesamte Wertschöpfungskette von Grünem Wassersto im industriellen Maßstab erprobt. Mit einer Großelektrolyse-Anlage von bis zu 30 Megawatt wird unter Einsatz von erneuerbarem Strom aus einem nahe gelegenen Windpark Grüner Wassersto produziert. In einer eigens dafür vorbereiteten Salzkaverne zwischengespeichert, kann der Grüne Wassersto über eine umgestellte Gaspipeline in das Wasserstonetz der in Mitteldeutschland ansässigen chemischen Industrie eingespeist und perspektivisch für urbane Mobilitätslösungen eingesetzt werden. Das Reallabor trägt so dazu bei, diese Zukunftstechnologien rund um Grünen Wassersto zu erforschen und zur Marktreife zu brin-

Die Übernahme eines bestehenden Unternehmens ist eine der Möglichkeiten, wirtschaftlichen Erfolg als Unternehmer zu erzielen. Die Gründung eines Unternehmens ist ebenfalls in dieser Hinsicht interessant. Die Statistik bescheinigt diesem Weg allerdings ein höheres Risiko, denn jede dritte Neugründung übersteht danach die ersten zwei bis drei Jahre der Gründungsphase nicht. Aber bange machen ist kein guter Ratgeber, noch dazu, wenn wie in unserem Beispiel Technologien der Zukunft genutzt werden.
Seit der Einführung der ersten elektronischen Signatur in den 1990er Jahren hat die Welt einen langen Weg zurückgelegt. Bereits früh wurden die sogenannten „eSignatures“ als bequeme Möglichkeit angesehen, ein Dokument zu unterschreiben – der Siegeszug ließ allerdings lange auf sich warten.
Mit dem technologischen Fortschritt und der zunehmenden Digitalisierung der Welt gehören elektronische Signaturen als Insellösung jedoch bereits wieder zum alten Eisen. In der vernetzten Gesellschaft heute geht der Trend zu ganzheitlichen Lösungen, die Prozesse in ihrer Gesamtheit abbilden können. Dieses Umstands sind sich
auch die beiden Gründer von top.legal, Bernhard Stippig und Alexander Baron, bewusst und stellen die Norm der eSignatur-Plattformen in Frage.
Jenseits tradierter Pfade wollen die Unternehmer etwas Neues schaffen: Sie verändern die Praxis der elektronischen Vertragsabschlüsse und revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen Verträge verhandeln und unterschreiben. Durch den Einsatz modernster Software, eine Kombination aus eigener Forschung und verfügbarer Studien sowie Algorithmen und künstlicher Intelligenz, machen sie die Verhandlung und den Abschluss von Verträgen schneller und wertvoller als je zuvor.
Geschichte und Relevanz der eSignature
Die elektronische Signatur – obwohl sie schon seit den 90er Jahren existiert – hat sich erst mit Corona zu einem immer beliebteren Mittel zur Unterzeichnung von Dokumenten entwickelt und bietet denjenigen, die sie verwenden, erhebliche Vorteile, wie Bequemlichkeit, schnellen Zugri und Sicherheit. Da Dokumente fast ausschließlich digital erstellt werden, lag der Schluss für viele Unternehmen nahe, auch für die Unterschri auf So ware zu setzen, um das Ausdrucken der Dokumente und den Post-Versand zu vermeiden. Auch wenn die Technologie der elektronischen Signatur kein technisch hochtrabendes Konzept ist, brauchte sie Jahrzehnte, um sich einer
weiten Verbreitung zu erfreuen. Die Bedeutung einer Unterschri liegt im Wesentlichen darin, dass sie als rechtsverbindlichesZeichenfüreineZustimmung und Absicht gesehen wird. Mit einer Unterschri bestätigendieParteien,dasssie den Inhalt eines Dokuments gelesen und verstanden haben und bereit sind, für die darin enthaltenen Bedingungen und Konditionen einzustehen und gleichzeitig auch zur Verantwortung gezogen zu werden.
Unabhängig davon, ob es sich um eine handschri liche Unterschri oder eine elektronische Signatur handelt, dient die Unterschri als eindeutige Kennung eines Unterzeichners und bietet ein probates Mittel zum Nachweis der Authentizität und Gültigkeit eines Dokuments. Im rechtlichen Kontext dienen Unterschriften als Beweis für eine Vereinbarung und können auch vor Gericht verwendet werden, um die Bedingungen eines Vertrags durchzusetzen. Daher spielen Unterschri en in der Geschä s- und Finanzwelt sowie bei anderen vertraglichen Beziehungen eine entscheidende Rolle, da sie dazu beitragen, Vertrauen zu scha en und die Rechte und Interessen aller beteiligten Parteien zu schützen. Dennoch ist die letztliche Unterschri eines Vertrags lediglich ein kleiner Part im größeren Prozess eines Vertragsabschlusses.
Die Vertragssoftware als Allrounder
Eine vollwertige So ware zur Verwaltung von Verträgen bringt ganzheitlichen Mehrwert, der über eine einfache eSignature hinausgeht. Einer der größten Vorteile einer Vertragsso ware ist die Möglichkeit, den gesamten Vertragsprozess ohne ständige Zuhilfenahme der Rechtsabteilung oder externen Kanzleien zu automatisieren. Von der selbstständigen Erstellung von Verträgen über die Verhandlung bis hin zur elektronischen Unterschri rationalisiert die So ware
den gesamten Prozess und macht ihn efzienter. Dies spart nicht nur Zeit, sondern verringert auch das Risiko menschlicher Fehler und gewährleistet, dass alle Verträge korrekt und rechtsverbindlich sind.
„Wenn die elektronische Signatur das Messer ist, ist eine Vertragsso ware die Küchenmaschine. Ein Messer löst einige grundlegende Probleme, aber Unternehmen sehen sich ab einer gewissen Größe mit einer Vielzahl von wiederkehrenden Herausforderungen konfrontiert, die sichnichtmehrmiteinfachenToolsund Insellösungen bewerkstelligen lassen. An dieser Stelle setzt das ganzheitliche Konzept einer Vertragsso ware an“, erläutert Alexander Baron, Gründer und Chief Revenue O cer von top.legal. Die Vorteile einer Vertragsso ware sind unter anderem die zentrale Vertragsablage für erstellte, verhandelte und unterschriebene Verträge sowie die Analyse unterschriebener Verträge ohne mühsames Durchforsten von Papierstapeln und E-Mails. Weiterhin die einfache Integration mit anderen Systemen, wie beispielsweise ein CRM, also Kundenbeziehungsmanagement beziehungsweise Kundenp ege, oder eine Buchhaltungsso ware, die direkte Verhandlung von mehreren Verträgen gleichzeitig über eine professionelle Ober äche ermöglicht, wobei externe und interne Verhandlunggetrenntwerden.Wichtigsind auch die Zugri srechte für abgelegte und zu verhandelnde Verträge oder die für die Freigabe, Verhandlung und Unterschri von Verträgen.
Lernende Verhandlungssysteme im Vertrieb sind die Zukunft
In Zukun wird der Einsatz von Verhandlungssystemen wahrscheinlich noch wichtiger für den Verkaufserfolg werden, da die Käufer immer informierter und anspruchsvoller werden. Außerdem verändert sich die Technologie
der Vertriebslandscha – das heißt, sie wird komplexer. Vertriebsmitarbeiter verkaufen bereits jetzt eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, deren rechtlicher Rahmen sich mit jeder Verhandlung verändert. Mitlernende Verhandlungssysteme können einmal freigegebene Änderungen in die nächste Verhandlungsrunde einspielen, wenn dies mit einem positiven Ergebnis in der Verhandlung einhergeht. ZurückliegendeVerhandlungsergebnissewerdendazu genutzt.
Eine Vertragsso ware kann Vertriebsmitarbeiter somit in die Lage versetzen, selbstbewusst und unabhängig Verträge auszuhandeln. Durch die Bereitstellung einer intuitiven Benutzerober äche und schrittweiser Anleitungen kann die Soware den komplexen Prozess der Vertragserstellung und -verhandlung vereinfachen.SokönnendieMitarbeiterdie wichtigsten Vertragsbedingungen und -klauseln besser verstehen und mögliche Risiken oder Verhandlungsbereiche schnell erkennen.
Durch den Zugri auf eine Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen und Klauseln können Angestellte problemlos Verträge entwerfen, die ihren speziellen Anforderungen entsprechen, ohne dass sie über umfassende juristische Kenntnisse verfügen müssen. Durch die Automatisierung vieler zeitaufwändiger Aufgaben im Zusammenhang mit der Vertragsverwaltung, wie zum Beispiel die Nachverfolgung von Änderungen, die Erstellung von Berichten und die Einholung von Genehmigungen, können sich zudem auf die wichtigsten Aspekte des Verhandlungsprozesses konzentriert werden. Kurz gesagt, eine Vertragsso ware kann Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, Geschä e e zienter und e ektiver abzuschließen und gleichzeitig die Notwendigkeit verringern, dass Rechtsteams in jeden Schritt des Prozesses eingebunden werden.


Arbeitslosigkeit macht etwas mit den Betro enen. Indem sich arbeitslose Menschen mit ihrem Gesundheitsverhalten auseinandersetzen, sich und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun, kommen sie der (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt einen guten Schritt näher. In Sachsen-Anhalt arbeiten seit 2017 Jobcenter und Agenturen für Arbeit gemeinsam mit den gesetzlichen Krankenkassen und der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. an diesem Vorhaben.
ImJahr2023beteiligtensichinsgesamt sieben Jobcenter der Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Harz, Jerichower Land, Mansfeld-Südharz, Wittenberg sowie der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau und der Landeshauptstadt Magdeburg sowie der Agentur für Arbeit SachsenAnhalt Süd an diesem Programm. Die Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern in Städten und Gemeinden vor Ort und die Vernetzung mit Kooperationspartnern in den Kommunen ermöglichten im Vorjahr insgesamt 659 arbeitslosen Menschen die Teilnahme an klassischen Präventionskursen. Dazu gehörten beispielsweise Rückenschule, Aqua tness oder Yoga. Hinzu kamen gesundheitsförderliche Gruppenangebote zu emen wie gesunder Ernährung, (Wild-)Kräuter für den Alltag oder Stressbewältigung sowie individuelles
Gesundheitscoaching. Dabei wird deutlich, dass das Programm nach der Corona Pandemie wieder gut angelaufen ist und sich die Zahl der Nutzer mehr und mehr dem Ergebnis von 2019 mit insgesamt 711 Teilnehmern annähert. Besondere Erfolge verzeichneten die insgesamt fünf Gesundheitstage mit 462 Interessenten in Zerbst, Köthen, DessauRoßlau, Bitterfeld-Wolfen und Burg sowie die Beteiligung an der Messe „Jobs für Eltern“ in der Lutherstadt Wittenberg. Weiterhin wurden 41 Vermittler im Rahmen der Halbtagesschulungen zu den Zusammenhängen von Arbeitslosigkeit und Gesundheit sensibilisiert, um zukün ig die Gesundheitsberatung in den Vermittlungsgesprächen gezielter anzugehen. Die Betreuung und Vermittlung von Flüchtlingen aus der Ukraine stellten für die Jobcenter und Agentur

für Arbeit eine besondere Herausforderung dar. Um der Zielgruppe den Zugang zum deutschen Gesundheitssystem von Beginn an zu erleichtern und ihnen eine Möglichkeit zu bieten, ihre individuellen Ressourcen sowie vorhandene Angebote vor Ort besser kennenzulernen, boten die Jobcenter DessauRoßlau und Magdeburg Interessenten ein spezielles Gruppenangebot an. Dabei lernten Menschen mit Fluchterfahrung Methoden kennen, wie sie auf sich

selbst und ihre Bedürfnisse achten und dadurch ihr individuelles Wohlbe nden fördern können. In diesem Jahr ist eine Umsetzung des Angebotes an allen beteiligten Standorten in Sachsen-Anhalt vorgesehen.
Pflegeberufe sind gefragt
Viele Unternehmen der Region bieten attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten, können ihre Arbeitsstellen jedoch nicht immer sofort mit dem passenden Bewerber besetzen. Unternehmen der Pflegebranche sind aufgrund des demografischen Wandels in besonderem Maße davon betroffen.
In den Räumen des Mehrgenerationenhauses EHFA in Haldensleben fand im Frühjahr eine Jobbörse für Berufe im Verarbeitende Gewerbe und der Produktion statt. Veranstaltet durch die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord und das Jobcenter Börde mit zahlreichen UnternehmenderRegiongingeshiervor allem um Berufe in der Produktion, die häu g auch für einfache Qualikationen gut geeignet waren. Die Zielgruppe waren Menschen, die aktuell keine Beschä igung hatten oder die sich beru ich verändern wollten.
Und das Interesse war durchaus vorhanden. „Die Besucher konnten sich während der Veranstaltung bei den ausstellenden Unternehmen über die Anforderungen und Beschä igungsmöglichmöglichkeiten in verschiedenen Berufen in der Produktion informieren und die Gelegenheit nutzen, sich persönlich vorzustellen“, erklärte Ste en Kellner, Teamleiter im gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord und des Jobcenters Börde. „Quereinstiege waren möglich, und auch ge üchteten Menschen mit aus-
„Fragen zu einem geplanten Jobwechsel, zu drohender Arbeitslosigkeit, zu Weiterbildungswünschen oder zum beru ichen Wiedereinstieg nach einer Familienphase sind emen, die Frauen immer wieder bewegen“, weiß Sophie Isabell Jehmlich, Beau ragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der Agentur für Arbeit
Sachsen-Anhalt Nord.
Deshalb boten die Agentur für Arbeit
Sachsen-Anhalt Nord und die Job-
center Landeshauptstadt Magdeburg, Stendal und Jerichower Land eine Telefonaktion speziell von Frau zu Frau an. „Kleine Anliegen konnten meist sofort geklärt werden. Waren intensive Beratungen gewünscht, vereinbarten wir einen Termin für ein Gespräch vor Ort“ ergänzt Jehmlich.
Beantwortet wurden Fragen zu aktuell am Arbeitsmarkt verfügbaren Stellen sowie Sachverhalten, die sich auf die berufliche und familiäre Situation der
reichendem Sprachniveau boten sich hier häu g gute Einstiegschancen in den Arbeitsmarkt“, ergänzte er. ImLandkreisBördewarenzuletztfast 400 Arbeitsstellen im Verarbeitenden Gewerbe gemeldet.
Die Tätigkeiten sind vielfältig und umfassen zum Beispiel Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung, in der Kunststo - und Metallbearbeitung oder im Bereich Automotiv. Diese Vielfalt wurde auch durch die an der Jobbörse beteiligten Unternehmen und die Arbeitsstellen, die die Firmen mitbrachten, deutlich.
Anfragenden bezogen. Dabei konnte auf einen großen Fundus an Erfahrungen und ein gut funktionierendes Netzwerk zurückgegriffen werden. „Arbeitslosigkeit ist häufig vermeidbar oder schneller zu beheben, wenn Lösungen für Probleme, die die Beschäftigungsaufnahme oder eine Weiterbeschäftigung erschweren, schnell gefunden werden“, sagt Sophie Jehmlich.
Eine Ausbildung oder berufliche Tätigkeit in einem Pflegeberuf bieten daher beste Beschäftigungsmöglichkeiten und Perspektiven in Berufen mit Zukunft.
Interessierte hatten im April im Alten Rathaus Magdeburg die Gelegenheit, mit verschiedenen Unternehmen und Bildungseinrichtungen der Pflegebranche ins Gespräch zu kommen. Quereinstiege sind möglich, und auch geflüchteten Menschen mit ausrei-
chendem Sprachniveau bieten sich hier häufig gute Einstiegschancen in den Arbeitsmarkt.
Gerade weil die Sicherung von Pflegefachkräften so wichtig ist, standen neben den beteiligten Unternehmen auch Ansprechpartner des gemeinsamen Arbeitgeberservices der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord und des Jobcenters der Landeshauptstadt Magdeburg, des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben sowie der Landeshauptstadt Magdeburg vor Ort für Fragen zur Verfügung.
Der Magdeburger Pflegestammtisch veranstaltete bereits zum sechsten Mal den „Tag der Pflegeberufe“. Im Pflegestammtisch sind rund 35 Einrichtungen und Institutionen, unter anderem auch die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord und die Landeshauptstadt Magdeburg, organisiert.
Früher mäanderten Ohre und Beber fröhlich durch die Landschaft. Auf ganz alten Karten kann man das gut sehen. Jetzt sind die Flüsse und ihre Nebenarme oft begradigt, die Ufer ordentlich befestigt und steil abfallend – kurz gesagt, einfach unnatürlich.

Ohre, Beber, Garbe, Olbe, Wanneweh und andere Zu üsse oder Bäche durch ießen hauptsächlich den Landkreis Börde, den Altmarkkreis, zum Teil auch das Stadtgebiet Magdeburg und ein wenig auch den Landkreis Gi orn in Niedersachsen.
Nun sollen, wie es die Europäische Wasserrahmenrichtlinie vorsieht, alle Fließgewässer in einen naturnahen und durch Artenvielfalt geprägten Zustand, mit einer guten Wasserqualität versetzt und nachhaltig gesichert werden. Bis 2027 müssen demnach auch in Sach-

sen-Anhalt alle Gewässer einen „guten ökologischen und chemischen Zustand“ aufweisen. Dazu werden sogenannte Gewässerentwicklungskonzepte erstellt. Kürzlich wurden in Bornstedt erste Analysen und Planungen zum Gewässerentwicklungskonzept „Ohre/Beber“ mit den Akteuren an den Flussläufen, besonders den Landwirten aber auch Anglern, besprochen.
Eingeladen hatte die Landgesellscha Sachsen-Anhalt sowie der mit der Projektsteuerung für das Gewässerentwicklungskonzept „Ohre/Beber“ beau ragte verantwortliche Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtscha Sachsen-Anhalt. Moderiert wur-
Karl-Heinz Jährling vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt erläutert den Landwirten das Vorhaben Gewässerentwicklungskonzept.

de die Versammlung von Lars Appelt von der Landgesellscha . Viele Unklarheiten bewegten die Zuhörer in diesem Zusammenhang, fürchtet man doch Unsicherheiten in Bezug auf die Flächennutzung und den Wasserhaushalt der Acker ächen.
Bereits Anfang März trafen sich schon einmal rund 50 Experten in Schackensleben zu einer Gewässerentwicklungskonzept-Vorstellung. Damals waren nur Vertreter der Kommunen, der unteren Naturschutzbehörden, von Naturschutzverbänden, Bauernverbänden, Forstämtern, Biosphärenverband, Wissenscha ler und andere geladen. Diesmal in Bornstedt stand der Dialog mit den Bauern im Vordergrund. Das Projektgebiet umfaßt insgesamt eine Fläche von 1 602 Quadratkilometern. Die im Konzept zu bearbeitenden Projektgewässer belaufen sich auf eine Länge von 279 Kilometern. Ziel des Konzeptes zur Gewässerentwicklung ist die Wiederherstellung oder Erhaltung
der natürlichen Funktionsfähigkeit der Flüsse, der Landscha ringsherum, inklusive der Überschwemmungsgebiete mit möglichst geringen Eingri en, kurz gesagt naturnah, dynamisch und nicht homogen.
Dazu wird im Rahmen des Gewässerprojektes der Zustand ermittelt. Die Planungsbüromitarbeiter untersuchen Flußläufe, Wasserlebewesen, Wasserp anzen und Fische sowie chemische und physikalische Parameter. Auch unüberwindbare Wanderbarrieren für Fische und Kleinlebewesen im Gewässer werden erfaßt. Es gilt aufzuzeigen, wo Gewässer naturnah gestaltet und unterhalten werden können sowie Vorschläge für geeignete Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung zu unterbreiten. Die Maßnahmen müssen praxistauglich sein und unbedingt mit den regionalen Akteuren abgestimmt werden. Dazu dienten diese ersten Sitzungen der „Projektbegleitenden Arbeitsgruppe GEK „Ohre/ Beber“.
Die Arbeit begann im Januar 2024 und wird im Dezember 2024 abgeschlossen sein. Die ö entliche Auslegung erfolgt ab Oktober. Erste Ergebnisse und Einzelheiten zum Gewässerentwicklungskonzept sind für alle, besonders aber für die Bauern, die in Flußnähe ihre Böden bearbeiten, auf der Internetseite www.gek-ohre-beber.de nachzulesen. Jeder sollte prüfen, inwieweit er betro en ist und Vorschläge unterbreiten. Auf der Internetseite gibt es auch die interaktive Karte, auf der Hinweise eingearbeitet werden können. Das Konzept enthält eine Prioritätenliste, einen „Werkzeugkasten“, aus dem Firmen oder Kommunen später einzelne Stücke als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Flächenversiegelungen entnehmen können.
Jörg Schickho vom leitenden Planungsbüro steht aber auch für alle Anfragen, Probleme und Hinweise zum Projekt zur Verfügung unter der Mailadresse: schickho @ihu-stendal.de
Batterien sind im Kampf gegen fossile Brennsto e nicht mehr wegzudenken – auch von ihnen hängt die Energiewende ab. Doch ihre Herstellung braucht viel Energie, die verwendeten Materialien sind selten, zudem sind Batterien schwer zu recyceln. Gleich mehrere Forschungsgruppen am Institute of Science and Technology Austria arbeiten daher an neuen, umweltfreundlicheren und e izienteren Batterien.
Man ndet sie in Handys, Laptops und Elektroautos – Lithium-IonenBatterien, auch Li-Ionen-Batterien genannt. Trotz jeder Menge Vorteile sorgt die Technologie für zahlreiche Probleme: Die in den Batteriezellen verwendeten Metalle – vor allem Kobalt und Lithium – können nur an wenigen Orten auf der Welt gewonnen werden. Dafür werden Ökosysteme zerstört, Menschen schu en unter katastrophalen Arbeitsbedingungen und die Industrie ist stark abhängig von einer fragilen Lieferkette, bei der ein plötzlicher Abbruch drastische Folgen hätte. Forschungsgruppen im Bereich der Chemie und Physik am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) versuchen, diese Probleme zu lösen. Sie sind auf der Suche nach neuen Materialien, um Batterien nachhaltiger zu machen.
Recycling durch die Natur 2021 war das erste Jahr, in dem die Kosten für Li-Ionen-Batterien gestiegen sind. „Der Grund dafür ist der Engpaß bei Materialien wie Kobalt und Lithium, die essenziell für Li-Ionen Batterien sind, sowie ihre sprungha angestiegene Nachfrage“, erklärt Stefan Freunberger, Assistenz Professor am ISTA. Die gute Nachricht: Man kann Kobalt ersetzen. Genau das versucht Freunberger. Seine Forschungsgruppe konzentriert sich darauf, Batterien aus reichlich
vorhandenen Elementen zu entwickeln, die genauso leistungsfähig sind wie LiIonen-Batterien. Dabei setzen sie auf Materialien, die aus Elementen wie Kohlensto , Wassersto und Sauersto bestehen und aus organischen Quellen stammen.
Auch anorganische Elemente, wie Schwefel untersuchen die Forscher. Die verwendeten Materialien könnten im Gegensatz zu kobalt-basierten Materialien vollständig von der Natur recycelt werden. Auch der Gesamtenergiebedarf für die Batterieherstellung kann reduziert werden.
„Normalerweise verbraucht die Herstellung von Li-Ionen-Batterien viel Energie und hat einen großen CO2Fußabdruck. Durch die Verwendung der richtigen Materialien können diese Werte deutlich gesenkt werden“, so Freunberger. „Wenn alles gut geht, werden wir schon in wenigen Jahren funktionale Batterien aus organischen Elementen haben. Unsere Ergebnisse sind sehr vielversprechend“, resümiert Freunberger. Unterstützt werden die Forscher in ihrem ehrgeizigen Vorhaben durch einen ERC Proof of Concept Grant, der bei der Bewertung des kommerziellen Potentials von Forschungsergebnisse hil .
Magnesium: Der Ho nungsträger Ein Material, das umweltschonend abgebaut werden könnte, ist Magnesium. Es ist zudem eines der zehn häu-
gsten Elemente der Erdkruste. Um dieses silbrig glänzende Leichtmetall dreht sich „MAGNIFICO“. Bei diesem Projekt arbeiten Forscher des ISTA mit Kollegen des Austrian Institute of Technology (AIT) zusammen und werden von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellscha (FFG) unterstützt. Gemeinsam wollen sie eine neue Technologie implementieren, bei der Magnesium das Lithium in Batterien ersetzt. Die Herausforderung: Magnesium hat zwar die richtigen elektrochemischen Eigenscha en, jedoch sind Magnesiumanoden mit den meisten Elektrolyten – dem Medium, welches den Strom uß in der Batterie ermöglicht – nicht kompatibel. Magnesium zersetzt den Elektrolyten, wodurch die elektrische Leitfähigkeit eingeschränkt wird. Ziel der Wissenscha ler ist es, die Anode abzuschirmen und so zu verhindern, daß der Elektrolyt zersetzt wird.
ISTA-Assistenz Professorin Bingqing Cheng und ihre Forschungsgruppe tragen mit Hilfe von Berechnungen und maschinellem Lernen dazu bei, die Eigenscha en von Materialien zu verstehen und vorherzusagen.
Industrielle Batterien neu gedacht Während Li-Ionen-Akkus vor allem in den zahllosen Elektrogeräten unseres Alltags verbaut sind, denkt die Forschungsgruppe von Verbund Professorin Maria Ibáñez am ISTA größer. „Industrieunternehmen haben den

höchsten Energiebedarf“, erklärt Postdoc Mario Palacios Corella. „Unser Ziel ist es, sie mit einer neuen, nachhaltigeren Redox-Flow-Batterietechnologie zu versorgen.“
Herkömmliche Redox-Flow-Batterien enthalten eine ionenselektive Membran, die als Na on bekannt ist. Diese sehr langlebige Chemikalie ist nicht nur teuer, sie hat auch gravierende negative Umweltauswirkungen. Die neuen Batterien, an denen die Forscher in Klosterneuburg im von der EU geförderten Projekt „MeBattery“ mitarbeiten, kommen ganz ohne diese Trennmembran aus. Dazu experimentiert die Gruppe
mit verschiedenen chemischen Substanzen und deren Fähigkeit, sich zu vermischen und elektroaktive Materialien zu bilden.
„In Redox-Flow-Batterien werden chemische Stoffe, die Elektronen aufnehmen oder abgeben können, in Elektrolyten gelöst und in zwei verschiedenen Tanks gelagert“, so Corella. Wenn Energie benötigt wird, werden die Elektrolyte in eine Reaktionskammer gepumpt. Dort sind beide Elektrolyte durch eine Membran getrennt. Diese ermöglicht den Fluß der Ionen, nicht aber den der gelösten chemischen Stoffe. Spontane elektrochemische
Reaktion, die auf beiden Seiten der Membran stattfinden, führt zu einem Elektronenfluß und damit zur Stromerzeugung. „Indem wir die physikalischen Eigenschaften der Elektrolyte ausnutzen und mit ihrer Mischbarkeit spielen, können wir die Membran entfernen. Das ist ein Durchbruch“, erklärt der junge Chemiker weiter. Von reichlich verfügbaren Elementen, als Ersatz für seltene Metalle, bis hin zu gänzlich neuen Materialien – mit ihren innovativen Ansätzen arbeiten die Wissenscha ler am ISTA an den Grundlagen umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Energiesysteme.
Pflanzen sind sehr widerstandsfähig und überleben auch in rauen Umgebungen. Das liegt unter anderem am bemerkenswert e izienten Wundheilungsprozess – den Wissenschaftler schon seit mehr als hundert Jahren untersuchen. Eine neue Studie des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) zeigt nun, dass der Prozess weniger kompliziert ist als gedacht und durch Druck sowie mechanische Kräfte angetrieben wird.
P anzenzellen sind äußerst starr. Wie ZiegelsteineineinerMauererlaubtdiese Eigenscha den P anzen, ihre Form beizubehalten und gegen die Schwerkra anzukämpfen. Wie in jedem anderen lebenden Organismus kann es trotzdem zu Verletzungen kommen, zum Beispiel durch Wind oder Abgrasen. Während Menschen und Tiere über Zellen verfügen, die sich mit dem Blut bewegen, um Wunden zu erkennen und zu heilen, mussten P anzen aufgrund ihrer Starrheit und Unbeweglichkeit einen gänzlich anderen Mechanismus entwickeln. Eine Studie von Lukas Hoermayer und Kollegen, auch aus den Gruppen von Jiří Friml, Eva Benková und Carl-Philipp Heisenberg am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) fand es nun heraus.
Die Wissenscha ler verletzten die sogenannte Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) mit einem Laserstrahl und analysierten den anschließenden Wundheilungsprozess auf mikroskopischer Ebene. Nach einer Verletzung formt sich das Gewebe sofort um und veranlasst die Zellen, sich zu teilen und die Wunde zu verschließen.
Lukas Hoermayer interessierte sich schon immer für die Natur. Aufgewach-
senaufdemLand,verbrachteervielZeit zwischen Feldern und Weinbergen. Seine wissenscha liche Neugier an P anzen entwickelte sich jedoch erst später während seines ISTernship Praktikums. „Seitdemhatmichdas emanichtmehr losgelassen“, so Hoermayer. Als PhDStudent in Jiří Frimls Forschungsgruppe erforschte er die Wundheilung in P anzen–eine ematik,dieWissenscha ler schon seit mehr als einem Jahrhundert beschä igt. Nun fand er einen Teil der langersehnten Lösung.
In der Wurzel stehen die P anzenzellen unter hohem Druck. Wenn das Gewebe beschädigt wird, sterben Zellen ab. Sie platzen auf und Druck entweicht. Dadurch entsteht eine Lücke, die so schnellwiemöglichgefülltwerdenmuss. Sofort reagieren benachbarte Zellen und „strecken“ sich in den Spalt hinein. „Das ist wie zwei Lu ballons, die aneinandergepresst sind. Wenn einer der beiden explodiert, verformt sich der andere sofort in Richtung des Geplatzten, um den Druck auszugleichen“, erklärt Hoermayer. Die Zellen dehnen sich aus und beginnen sich (im Gegensatz zu Lu ballons) zu teilen. So entstehen neue Zellen, die schließlich die Wunde verschließen. In der Wurzel teilen sich Zellen norma-

lerweise ausschließlich nach unten wegen des Ein usses der Schwerkra .HiersindsiejedochinderLage, dies in mehreren Richtungen zu tun. Aber wieso?
Hoermayer und die Forscher hemmten bestimmte Moleküle, von denen angenommen wurde, dass sie diesen speziellen Teilungsprozess beein ussen. Die Wundheilung blieb aber unverändert. „Zu unserer Überraschung funktionierte der Prozess weiterhin einwandfrei“, so Hoermayer. Daher verlagerte sich der Fokus auf die mechanischen Aspekte. Um diese zu visualisieren, nutzten die Wissenscha er ein speziell entwickeltes Mikroskop, das mit einem Laser ausgestattet war. Der Laserstrahl verletzte das P anzengewebe; die darau olgenden Ereignisse auf mikroskopischer Ebene wurden detailliert aufgezeichnet.
Durch die Analyse des Videomaterials entdeckten die Forscher, dass Mikrotubuli – dynamische Proteinstrukturen in der Zelle, die während der Teilung bei der Trennung des
genetischen Materials helfen – auf mechanische Veränderungen reagieren. Wenn die Zellen gedehnt werden, positionieren sich die Mikrotubuli neu und legen die Ausrichtung der Zellteilung fest, was diese darau in auslöst.
„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die schieren mechanischen Krä e, die durch die Dehnung der Zellen entstehen, die Zellteilung bei der Wundheilung antreibt“, erklärt Hoermayer.
Ähnlich wie andere aktuelle ISTAPublikationen zeigt diese Studie, dass
die Gewebeentwicklung und -regeneration durch Prinzipien der Mechanik erklärt werden können. Außerdem unterstreicht sie einmal mehr die äußerst
e ziente Wundheilung der P anzen. Eine notwendige Tatsache, da sie ständig den Elementen Natur ausgesetzt sind und aufgrund des fortschreitenden Klimawandels noch mehr an Bedeutung gewinnt.
Angesichts der umweltbedingten Herausforderungen birgt das Verständnis der Wundheilungs- und Regenerations-

Nach seiner Forschung in Jiří Frimls (rechts) Forschungsgruppe, hier in der Plant Facility, am ISTA, arbeitet Lukas Hoermayer (links) nun als Postdoc an der Universität Lausanne, Schweiz.
prozesse von P anzen viele Möglichkeiten für die Landwirtscha . „Landwirte könnten diese Details bei der Umstellung auf widerstandsfähigere Kulturen und robuste P anzen für raue Bedingungen wie extrem salzhaltige oder sandige Böden berücksichtigen“, erklärt Hoermayer. DieOptimierungundFörderung des natürlichen Regenerationsprozesses trägt dazu bei, die Landwirtscha nachhaltiger zu gestalten, da der Verzicht auf Chemikalien die Auswirkungen auf die Umwelt verringern könnte.



Pflanzen lieben Pink. In der Plant Facility am ISTA werden Tausende von Setzlingen der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) zu Forschungszwecken gezogen. Pinkes Licht (Kombination aus blauem und rotem) fördert das Wachstum der Pflanzen ähnlich wie Sonnenlicht.







Die Rente mit 72 als FDP-Vorschlag hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Dabei ist das schon lange möglich. Wer nach der Regelarbeitszeit seinen Job nicht aufgibt, kann zusätzliche Rentenpunkte sammeln. Neuerdings können Rentner sogar in unbegrenzter Einkommenshöhe weiterarbeiten. Wo also ist das Problem? hat einige Fakten dazu zusammengetragen.




■ Man geht in Deutschland wieder früher in Rente. Der Abstand zwischen dem durchschnittlichen Renteneintrittsalter und der gesetzlichen Regelaltersgrenze nahm zuletzt wieder zu.
■ Männer bezogen 2020 mit durchschnittlich 64,1 Jahren erstmals eine Altersrente, Frauen mit 64,2 Jahren. Die Regelaltersgrenze betrug 65,8 Jahre.
■ Mit der Rentenform des Jahres 1972 wurden die Vorruhestandsund Frühverrentungsmöglichkeiten deutlich erweitert. Das wurde rege genutzt. Einen Tiefpunkt gibt es 1982 mit 62,3 Jahren für Männer und 61,5 Jahren für Frauen.

■ Danach wurden finanzielle Abschläge bei Frühverrentungen ab 1997 eingeführt.
■ Die Zahl der Deutschen, die 65 Jahre und älter sind, wird immer größer.
■ 1950 fiel jeder elfte Bundesbürger in diese Altersgruppe – 2019, plus DDR-Bevölkerung, traf das bereits auf jeden fünften zu.
■ Etwa 6,1 Prozent der EU-Bürger arbeiten, obwohl sie das Rentenalter von 65 Jahren bereits erreicht haben – das entspricht rund 5,7 Millionen Menschen.
■ Vor allem in Skandinavien und den baltischen Ländern bleibt man trotz fortgeschrittenen Alters im Beruf. In Estland sind beispielsweise rund 16,7 Prozent der über 65-Jährigen erwerbstätig. In Lettland und Schweden sind es etwas über 13 Prozent, Dänemark verzeichnet knapp elf Prozent Erwerbstätige in der Altersgruppe 65plus.

■ Auch Deutschland liegt über dem EU-Durchschnitt – hierzulande arbeiten rund 8,4 Prozent der Bevölkerung im Rentenalter weiter.

■ Rund 42 Prozent der Rentner in Deutschland haben weniger als 1 250 Euro netto im Monat, jeder Vierte weniger als 1 000 Euro. Das reicht nur für das Nötigste. Frauen sind dabei stärker von Altersarmut gefährdet als Männer.
■ Die Kaufkraft der Rente schwankt regional um bis zu 70 Prozent. So stehen Rentnern im Eifelkreis Bitburg-Prüm preisbereinigt nur 856 Euro zur Verfügung. In der thüringischen Stadt Gera hingegen – dem Ort mit dem bundesweit höchsten ökonomischen Lebensstandard für Rentner – sind es 1 437 Euro. Die Rentenkaufkraft im Osten ist höher als im Westen.



FamilieEberlingausBadBibraimBurgenlandkreiswurdemiteiner„Grünen Hausnummer Sachsen-Anhalt“ ausgezeichnet. Das Einfamilienhaus, erbaut 2022, erreicht KfW-E zienzhausStandard 55 und weist somit einen um mindestens 45 Prozent reduzierten Primärendenergiebedarf gegenüber demzugehörigenReferenzgebäudeauf. Dieser Bedarf wird durch eine LuWasser-Wärmepumpe gedeckt. Eine Photovoltaikanlage liefert den dafür notwendigenStrom.
Überreicht wurden das individuell angefertigte Hausnummernschild und eine Urkunde als Anerkennung für besonderes Engagement im Interesse des Klimaschutzes durch Energiestaatssekretär omas Wünsch, Landrat Götz Ulrich,
die stellvertretende Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde An der Finne, Katrin Alt, den Bürgermeister von Bad Bibra, Frederik Sandner, LENA-Geschä sführer Marko Mühlstein sowie Birgit Hartmann von der Architektenkammer Sachsen-Anhalt.
Energiestaatssekretär omas Wünsch sagte: „Um den Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden Jahren weiter zu senken, müssen wir Gebäude energiee zient bauen oder sanieren. Mit der Verleihung der Grünen Hausnummer machen wir auf Hauseigentümer in Sachsen-Anhalt aufmerksam, die beispielha voran gehen. Zu ihnen zählt auch Familie Eberling. Für eine erfolgreiche Wärmewende brauchen wir möglichst viele Menschen, die auf gute
(v.li.n.re.) Landrat des Burgenlandkreises Götz Ulrich, die Familie Enerling aus Bad Bibra, Sachsen-Anhalts Energiestaatssekretär Thomas Wünsch, LENA-Geschäftsführer Marko Mühlstein sowie Birgit Hartmann von der Architektenkammer Sachsen-Anhalt.
Gebäudedämmung und e ziente Heiztechnik setzen.“
LENA-Geschä sführer Marko Mühlstein ergänzte: „Um die Klimaziele zu erreichen, zählt das Engagement eines jeden Einzelnen. Gelungene Beispiele wie dieses der Familie Eberling regen zum Nachahmen an. So ho en wir, dass zukün ig noch viele weitere Gebäude hier im Burgenlandkreis und in ganz Sachsen-Anhalt mit einer Grünen Hausnummer ausgezeichnet werden. Nicht zuletzt lohnt sich die Investition in ein energiee zientes Wohngebäude mehr denn je: für den Klimaschutz und den eigenen Geldbeutel!“, betonte Mühlstein. Alle Informationen zum Wettbewerb und zur Bewerbung www.gruenenummer.de
Tue Gutes und rede darüber – diese Au orderung richtet sich in diesem Jahr besonders an Schulen in Sachsen-Anhalt, denn die neue Auflage des Klimaschutz-Wettbewerbs steht unter dem Motto „Voll kommunikativ!“.
Gesucht werden Schulen, die Energie- und Klimaschutzthemen sowie die Kommunikation darüber nachhaltig im Schulalltag verankern.
Dafür gibt es viele Möglichkeiten: Denkbar sind beispielsweise die Gestaltung motivierender Au leber, die Au ührung von eaterstücken, der Au au von Energieteams oder die EinrichtungeinerRubrikfürKlimaschutz in der Schulzeitung. Ausgezeichnet werden können dabei sowohl bereits durchgeführte KommunikationsformatealsauchgeplanteAktivitäten.
Klimaschutzminister Armin Willingmann wirbt für eine Teilnahme: „Beim Klimaschutz kann jeder mitmachen. Auch an Sachsen-Anhalts Schulen ist die Einsparung von Energie und CO2 sowie die Sicherung der Artenvielfalt ein großes ema. Wenn interessierte Schülerinnen und Schüler auf engagierte Lehrkrä e tre en, können tolle Projekte entstehen. Über diese sollte man dann auch sprechen, um Mitstreiter zu motivieren und Nachahmer zu nden. Beim diesjährigen Wettbewerb können daher alle Schulen ihre Kommunikationsstärke in Bezug auf Energie und Klimaschutz unter Beweis stellen.“
Mit dem Preisgeld von insgesamt 19 000 Euro sollen drei Grundschulen und drei Sekundarschulen bzw. Gymnasien ausgezeichnet werden. Der Wettbewerb „Klimaschutz – voll kommunikativ!“ wird vom Klimaschutzministerium und der Landesenergieagentur SachsenAnhalt (LENA) ausgelobt. Bewerbungen sind vom 15. März bis zum 30. September 2024 möglich. Weitere Informationen und ein digitales Anmeldeformular nden sich auf den Internetseiten der LENA unter: https://www.sachsen-an halt-energie.de/de/anmeldeformularzum-schulwettbewerb-2024-klima schutz-voll-kommunikativ.html
Der Wettbewerb war erstmals 2022 ausgelobt worden, damals unter dem Motto „Klimaschutz – voll wirksam!“. Gesucht wurden investive Projekte, die den Ausstoß an Treibhausgasen nachweislich senken. Überzeugen konnten dabei das Landesgymnasium für Musik Wernigerode (Landkreis Harz), das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel), die

„Sachsen-Anhalt ENERGIE“ mit 42 Mio. Euro Fördermitteln wieder gestartet
Unternehmen mit Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt können ab sofort wieder Anträge im Rahmen des Förderprogramms „Sachsen-Anhalt ENERGIE“ stellen.
Zu den förderfähigen Maßnahmen zählen unter anderem der Ersatz von ineffizienten Anlagen und Aggregaten, die energetische Optimierung von Prozessen sowie Investitionen in Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien.
Die Förderquote für kleine Unternehmen beträgt bis zu 50 Prozent, während mittelständische Unternehmen bis zu 35 Prozent und große Unternehmen bis zu 20 Prozent Zuschuss für die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen erhalten können.
Für weitere Informationen nehmen Sie gern Kontakt zur LENA auf.
Kontakt:
Tel.: +49 391 5067-4039
E-Mail: best-practice@lena-lsa.de www.lena.sachsen-anhalt.de
Adam-Olearius-Sekundarschule Aschersleben (Salzlandkreis) sowie die Grundschulen Klostermansfeld und Helbra (LandkreisMansfeld-Südharz).
Die Bandbreite der ausgezeichneten Projekte reichte vom Austausch alter Umwälzpumpen und Umstellung auf energiesparende LED-Beleuchtung, über den Bau von Handy-Ladestationen aus gebrauchten Solarmodulen und eines großen Insektenhotels, bis hin zu Fassadenbegrünung oder einer optimierten Verkehrsführung, um CO2-Emissionen zureduzieren.

Am 4. Mai ist es wieder soweit. Die Grüne Messe im Magdeburger Klosterbergegarten und in den Gruson Gewächshäusern zieht wie immer von 10 Uhr bis 17UhrBesuchervonNahundFernan,die sich auf einen erlebnisreichen Tag freuen - mit frischen Ideen, die das Leben in und um Magdeburg noch ein Stück nachhaltiger machen. Gemeinsam mit über 40 regionalen Aussteller präsentieren die SWM in diesem Jahr smarte Lösungen, Angebote und Dienstleistungen für mehr Energiee zienz und Klimaschutz. Ein Highlight: SWM Photovoltaik-Anlagen imRundum-Sorglos-Paket.
Energie in ihrer leckersten Form gibt es an vielen Ständen mit gesunden Spezialitäten aus der Region zum Kosten und Ausprobieren.
Im Blauen Salon des Gesellscha shauses wird es eine Reihe an Fachvorträgen geben, an denen Interessierte ohne Anmeldung teilnehmen können. Die emen? Um 11 Uhr geht es um Wärmepumpen mit Rene Herbert, Energieberater bei SWM, eine Stunde später stehenspeziellePhotovoltaik-Lösungender

SWM mit Matthias Polanetzki im Mittelpunkt. Um 13 Uhr erfährt man alles über den Ofen Führerschein mit Robert Koch von der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt, und um 14 Uhr geht es nocheinmal um Photovoltaik-Lösungen der SWM.
Am Stand der Magdeburger Städtischen Werke beraten Experten interessierte Besucher zum ema Energiesparen und zu den Produktangeboten Photovoltaik, Wärmepumpe oder zur SWM-Mietheizung. Am Kanal-SpülFahrzeug gibt es einen Einblick in den Joballtag bei SWM.
Wer sein Brunnenwasser auf pH-Wert, Leitfähigkeit, Nitratgehalt, Eisengehalt, Mangangehalt und Härtegrad testen lassen möchte, ist am SWM-Stand ebenfalls richtig. Wer sich bei den Magdeburger Stadtwerken übrigens mit der SWM-App registriert hat, der zahlt für die Brunnenwasserprobe nur zehn statt 20 Euro. Ganz neu auf der Grünen Messe ist um 15 Uhr eine Fahrradversteigerung. Auch für Kinder gibt es ein nachhaltigesProgramm.SosindzumBeispiel
Eindrücke von der Grünen Messe im Vorjahr.
mit den SWM-BlitzKitz spannende Experimente rund um das ema Energie mitzuerleben, man kann Bienen basteln, Alpakas bestaunen oder eine Runde Ponyreiten. Für sportliche Bewegung sorgen die Mitmach-Aktionen im Grünen, dem schönsten Fitnessstudio der Welt „NaturImPuls“.
Zahlreiche Zusatzvorteile werden übrigens SWM-Kunden geboten, die sich bereits in der SWM-App registriert haben. Darüber hinaus locken Besucher der Grünen Messe App-Besitzer sowie drei weitere Personen bei freiem Eintritt in die Gruson Gewächshäuser, mit einem gratis Sto eutel am SWM-Infostand, einer leckeren Brause am Stand der Brauserei Gommern als kleine Erfrischung sowie zahlreichen weiteren Überraschungen.
Weitere Informationen zur Grünen Messe gibt es unter www.gruene-messe.de
Der SWM Marktplatz mit nachhaltige Ideen aus der Nachbarschaft
So macht Energiesparen Spaß: Über 40 regionale Aussteller:innen und wir bieten smarte Lösungen für Energiee昀昀izienz und Klimaschutz. Unser Highlight: SWM Photovoltaik-Anlagen im Rundum-sorglos-Paket. Energie in ihrer leckersten Form gibt es an vielen Ständen mit gesunden Spezialitäten aus der Region zum Kosten und Ausprobieren.


















4. Mai

Klosterbergegarten





10 – 17 Uhr, im Klosterbergegarten www.gruene-messe.de






















Tomorrow Labs, so heißt das neue Wissenscha sfestival von Magdeburg. Hier tre en Wissenscha und Zukun sfragen auf Musik und Kultur: Am 8. Juni präsentieren Magdeburger Wissenscha seinrichtungen von 16 bis 21 Uhr ihre aktuelle Forschung in entspannter Atmosphäre auf dem Festivalgelände am Wissenscha shafen. AufderzentralenBühnegibtesMusik, Experimente, Talks und Shows. Alles dreht sich um die Frage: „Wie wollen wir in Zukun leben und arbeiten?“
Unter dem Titel „What will tomorrow be like?“ (Wie wird es morgen sein?) stehen vier emenwelten (Labs) im Mittelpunkt: Gesundheit, Technologie,

Erde und Gesellscha . Eingeladen sind alle, die sich mit spannender Forschung aus ihrer Stadt auseinandersetzen und dabei Hochschulen, Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen kennenlernen wollen. Zu erleben sind Forschungsprojekte, Exponate zum Anfassen, interaktive Experimente, Dialoge und Bühnenshows. Anschließend lädt Tomorrow Labs zur A ershowparty ein.

Informationen zum Programm finden alle Interessierten ab Anfang Mai auf der Internetseite der Tomorrow Labs unter https://tomorrowlabs. magdeburg.de. Die Social-MediaKanäle (Facebook: Tomorrow Labs, Instagram: @tomorrow_labs_ magdeburg) informieren über weitere Programm-Höhepunkte.
Zum Tomorrow Labs Festival wird der Wissenscha shafen als Wissens- und Zukun sort erlebbar. Die Otto-vonGuericke-Universität, die Hochschule Magdeburg-Stendal und alle Magdeburger Forschungsinstitute präsentieren sich mit aktuellen Forschungsprojekten und zeigen, woran sie gerade arbeiten. Auch die ansässigen Einrichtungen und Unternehmen ö nen an diesem Tag für Besucher ihre Türen.
Zehn MINT-Talente, MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, aus Sachsen-Anhalt qualifizieren sich für das 59. Bundesfinale von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb.
Für den 59. Bundeswettbewerb von Jugend forscht haben sich zehn junge MINT-Talente aus Sachsen-Anhalt quali ziert. Die Landessieger wurden in Halle (Saale) ausgezeichnet. Beim diesjährigen Landeswettbewerb, ausgerichtet von der TGZ Halle Technologie- und Gründerzentrum Halle GmbH und der ECH Elektrochemie Halle GmbH, präsentierten 35 junge Forscher und Forscherinnen insgesamt 20 Projekte.
Der Landessieg im Fachgebiet Arbeitswelt ging an Janusz Kohnert (16), Frederik Tiede (16) und Tessa Maleen Seyfert (17). Am Schülerforschungszentrum Halle (Saale) entwickelten sie eine umweltfreundliche Kühlbox für Zahnarztpraxen. In dieser können Medikamente unkompliziert und sicher transportiert werden. Die benötigte Energie für die thermoelektrische Kühlung liefert ein Fotovoltaik-Modul.
Jette Pohl vom Georg-Cantor-Gymnasium Halle (Saale) siegte im Fachgebiet Biologie. Die 16-Jährige ging der Frage nach, ob sich klimatische Veränderungen in ihrer Heimatstadt anhand des Blatt- und Blütenaustriebs von Winterlinden im Zusammenhang mit der Lu temperatur nachweisen lassen. Dazu führte sie über einen Zeitraum von zwei Monaten an zehn verschiedenen Standorten im Stadtgebiet sowie in Randlagen Messungen und Beobachtungen an Bäumen durch.

Im Fachgebiet Geo- und Raumwissenscha en überzeugte Maximilian Maurer (18) von der Landesschule Pforta in Naumburg die Jury. Am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover analysierte er das sogenannte nichtgeometrische tilt-to-length coupling (TTL). Dabei handelt es sich um den Kreuzkupplungse ekt zwischen zwei sich gegenseitig überlagernden Strahlen – eine der bekanntesten Fehlerquellen in der Laserinterferometrie im Weltraum. CarlFriedrichDornheim(18)undAnna Elisabeth Dornheim (14) vom Wernervon-Siemens-Gymnasium Magdeburg programmierten eine Smartphone-App,
dieesermöglicht,Tre erimSchießsport präzise auszuwerten. Die Messung der getro enen Ringe auf der Zielscheibe erfolgt dabei auf ein Zehntel genau. Die App ist günstiger als die Auswertungstechnik, die bislang bei Wettkämpfen eingesetztwird,undwärefürjedermann verfügbar. Die beiden siegten im Fachgebiet Mathematik/Informatik.
Durch Windkra anlagen werden immer wieder Vögel getötet. Physik-Landessiegerin Anne Marie Bobes (17) vom Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg willhierAbhilfescha enundanalysierte anhand eines selbst entworfenen mechanischen Modells die Aerodynamik des Vogel ugs. Ihre Erkenntnisse im Bereich des Gleit ugs könnten als Basis zur Optimierung der Abschaltmechanismen von Windrädern dienen.
Den Landessieg im Fachgebiet Technik errangen Dana Karatkevich (17) und Oliver Fritz Oberender (16) vom Winckelmann-Gymnasium Stendal. Die jungen Forscher konstruierten eine kleine Windkra anlage als Primärenergiequelle für private Haushalte. Durch Anbringen eines speziellen Vorbaus vor dem Rotor konnten sie den Wirkungsgrad des Systems entscheidend verbessern. Nach den Landeswettbewerben ndet das 59. Bundes nale vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 in Heilbronn statt. Gemeinsame Ausrichter sind die Sti ung Jugend forscht e. V. und das Science Center experimenta als Bundespate.
Mit speziellen Testaufgaben einer speziellen App auf dem Smartphone lassen sich „leichte kognitive Beeinträchtigungen“ – die auf eine Alzheimer-Erkrankung hindeuten können – mit hoher Genauigkeit erkennen. Das berichten Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen e.V. (DZNE), der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und der US-amerikanischen University of Wisconsin-Madison gemeinsam mit dem Magdeburger Unternehmen neotiv.
Ihre Studie beruht auf Daten von 199 älteren Erwachsenen. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial mobiler Apps für die Alzheimer-Forschung, klinische Studien und die medizinische Routineversorgung. Die hier untersuchte App wird inzwischen Arztpraxenangeboten,umdieFrüherkennung von Gedächtnisproblemen zu unterstützen.
Störungen des Erinnerungsvermögens sind ein wesentliches Symptom der Alzheimer‘schen Erkrankung. Es ist daher naheliegend, dass der Schweregrad und die zeitliche Entwicklung solcher Gedächtnisprobleme bei der Diagnose der Erkrankung und in der AlzheimerForschung eine zentrale Rolle spielen. In der aktuellen klinischen Praxis werden solche Gedächtnistests unter Anleitung einer medizinischen Fachkra durchgeführt. Die untersuchten Personen müssen dabei schri lich oder im Zwiegespräch standardisierte Aufgaben lösen: sich zum Beispiel Wörter merken und wiederholen, spontan möglichst viele Begri e zu einem bestimmten ema nennen oder nach Vorgaben geometrische Figuren zeichnen. Alle diese Tests erfordern zwingend eine professionelle Betreuung, ansonsten sind die Ergebnisse nicht aussagekrä ig. Diese Tests können daher nicht alleine, etwa zu Hause, durchgeführt werden.
Professor Emrah Düzel, Neurowissenscha leramDZNE-StandortMagdeburg und an der Universitätsmedizin MagdeburgsowieUnternehmerinderMedizintechnik,plädiertfüreinenneuenAnsatz: „Es hat Vorteile, wenn man solche Tests selbstständig durchführen kann und erst zur Auswertung der Ergebnisse eine Praxisaufsuchenmuss.Sowiemandaszum Beispiel von einem Langzeit-EKG kennt. Solche Testungen ohne Aufsicht würden helfen, klinisch relevante Gedächtnisstörungen im Frühstadium zu erkennen und Krankheitsverläufe engmaschiger zu erfassen, als es heute möglich ist. Angesichts jüngster Entwicklungen in der Alzheimer- erapie und neuer Behandlungsmöglichkeiten wird eine frühzeitige Diagnose immer bedeutsamer.“
Vergleich zwischen Selbsttest und unter Klinik-Aufsicht
Neben seiner Tätigkeit in der Demenzforschung ist Düzel auch „Chief Medical O cer” von neotiv, einem Magdeburger Start-up, mit dem das DZNE seit mehreren Jahren kooperiert. Das Unternehmen hat eine App entwickelt, die eigenständige Gedächtnistests ermöglicht, ohne dass dafür eine professionelle Betreuung erforderlich ist. Die So ware läu auf Smartphones und Tablets und ist wissenscha lich validiert. Sie wird in der Alzheimer-Forschung verwendet und inzwischen auch als diagnostisches Hilfsmittel für Arztpraxen zur frühzeitigen Erkennung leichter kognitiver Beeinträchtigungen angeboten. Im Fachjargon spricht man auch von

„Mild Cognitive Impairment“ – kurz: MCI. Zwar beeinträchtigt MCI den Alltag der betro enen Personen nur wenig, allerdings haben sie ein erhöhtes Risiko innerhalb weniger Jahre eine AlzheimerDemenz zu entwickeln.
Dr. David Berron, Forschungsgruppenleiter am DZNE und zugleich Mitgründervonneotiverläutert:„AlsBestandteil der Validierung haben wir sowohl dieses neuartige Testverfahren, das keine direkte Aufsicht benötigt, als auch eine etablierte neuropsychologische Untersuchung in der Klinik angewandt. Dabei hat sich gezeigt, dass die neue Methode mit klinischen Untersuchungen vergleichbar ist und leichte kognitive Beeinträchtigungen, auch bekannt als MCI, mit hoher Genauigkeit erkennt. Diese Technologie hat ein enormes Potenzial, Ärztinnen und Ärzten Informationen zur Verfügung zu stellen, die sich bei einem Patientenbesuch in der Klinik nicht ermitteln lassen.“
Teilnehmer aus Deutschland und den USA An der aktuellen Studie nahmen insgesamt 199 Frauen und Männer im Alter über 60 Jahren teil. Sie waren entweder in Deutschland oder den USA zu Hause und jeweils in eine von zwei Langzeituntersuchungen eingebunden, die sich beide mit Alzheimer – der häu gsten Demenzerkrankung – befassen: der sogenannten DELCODE-Studie des DZNE beziehungsweise der WRAPStudie der University of WisconsinMadison. Die Studiengruppe spiegelte unterschiedliche kognitive Zustände wider, die in der Praxis vorkommen: Sie umfasste Personen, die kognitiv gesund waren, Menschen mit MCI, sowie andere mit subjektiv empfundenen, jedoch
nicht messbaren Gedächtnisbeschwerden. Grundlage für die Diagnose waren Untersuchungen nach einem etablierten Verfahren, das unter anderem Gedächtnis- und Sprachaufgaben beinhaltet. Außerdem führten alle Probanden über einen Zeitraum von mindestens sechs Wochen mehrfache Gedächtnistests mit der neotiv-App durch. Dazu nutzten sie eigene Smartphones oder Tablets. Die Probanden testeten sich selbstständig – und dort, wo immer es ihnen gelegen kam.
„Die meisten unserer WRAP-Teilnehmer konnten die digitalen Aufgaben eigenständig erledigen und waren mit den Aufgaben und der digitalen Plattform zufrieden“, sagt Lindsay Clark von der University of Wisconsin-Madison. Die promovierte Neuropsychologin leitet dort die Studie „Assessing Memory with Mobile Devices“.
Bilder merken und Unterschiede erkennen
„Die Testung mit der neotiv-App ist interaktiv und umfasst drei Arten von Gedächtnis-Aufgaben. Damit werden jeweils unterschiedliche Bereiche des Gehirns angesprochen, die in verschiedenen Phasen einer Alzheimer-Erkrankung betro en sein können. Dahinter steckt langjährige Forschungsarbeit“, erläutert Düzel. Im Wesentlichen geht es bei diesen Tests darum, sich Bilder zu merken oder Unterschiede zwischen Bildern zu erkennen, die von der App eingeblendet werden. Anhand eines eigens entwickelten Parameters konnte das deutsch-amerikanische Forschungsteam die Ergebnisse der App mit den Befunden der etablierten, klinischen Methode vergleichen.
„Unsere Studie zeigt, dass sich mit diesem digitalen Verfahren Gedächtnisbeschwerden aussagekrä ig beurteilen lassen“, so Düzel. „Deuten die Ergebnisse des digitalen Tests darauf hin, dass eine für MCI typische Gedächtnisstörung vorliegt, ebnet dies den Weg für weitere klinische Untersuchungen. Weisen die Testergebnisse darauf hin, dass die Gedächtnisleistung im altersspezi schen Normalbereich liegt, kann man vorerst Entwarnung geben. Und für die Alzheimer-Forschung bietet sich hier ein digitales Instrument zur Beurteilung der kognitiven Fähigkeiten, das in klinischen Studien eingesetzt werden kann. In Deutschland, den USA, Schweden und anderen Ländern geschieht dies bereits.“
Weitere Untersuchungen sind in Vorbereitung oder schon angelaufen. Der neuartige Gedächtnistest soll an noch größeren Studiengruppen erprobt werden, zudem wollen die Forscher untersuchen, ob sich damit die Entwicklung einer Alzheimer-Erkrankung über einen längeren Zeitraum verfolgen lässt. Berron: „Informationen darüber, wie schnell das Gedächtnis mit der Zeit nachlässt, sind für Ärzte und Patienten wichtig. Sie sind auch für klinische Studien relevant, da neue Behandlungen darauf abzielen, die Geschwindigkeit des kognitiven Abbaus zu verlangsamen.“ Der Neurowissenscha ler beschreibt die Herausforderungen: „Um solche Selbsttests weiterzuentwickeln, müssen die klinischen Daten eines Patienten mit Selbsttests außerhalb der Klinik, aus dem Alltag, verknüp werden. Das ist keine leichte Aufgabe, aber wie unsere aktuelle Studie zeigt, macht das Forschungsfeld dabei Fortschritte.“
Schweiß hat wegen seines Geruchs einen sehr schlechten Ruf. Unsere Vorfahren haben das vielleicht anders empfunden, ohne Deodorant und ständiges Duschen. Das war wohl nicht unbegründet, da der Schweiß für den menschlichen Körper wichtige Funktionen erfüllt, die oft übersehen werden.
Schweiß reguliert die Körpertemperatur
Ein ausgeglichener Wärmehaushalt ist entscheidend, um eine optimale Funktionsweise des Organismus sicherzustellen. Dabei ist ein wichtiger Mechanismus zur Kühlung des Körpers die Produktion von Schweiß. Schweiß wird von den Schweißdrüsen auf der Haut produziert und verdunstet dann von der Hautober äche. Diese Verdunstung entzieht dem Körper Wärme und trägt zur Abkühlung bei.
Schweiß beseitigt „Abfallprodukte“ des Körpers
Ob Harnsto durch die Nieren, Kohlendioxid durch die Lunge oder eben Sto wechselprodukte durch den Schweiß – das Ausscheiden von „Abfallprodukten“ ist ein lebenswichtiger Prozess, der das innere Milieu des Körpers im Gleichgewicht hält. Schweißdrüsen scheiden Alkohol, Harnsto , Arzneimittelreste und weitere Gi sto e aus. Schwitzen allein reicht allerdings nicht aus, um alle „Abfallprodukte“ des Körpers zu beseitigen.
Schweiß wirkt wie eine „natürliche Hautpflege“
Schweiß wirkt wie eine „natürliche Hautp ege“, indem er die Haut kühlt, befeuchtet und den ph-Wert reguliert. Er enthält mikrobielle Substanzen, die das Wachstum von Bakterien und Pilzen auf der Haut hemmen. Dennoch kann Schweiß auch die Haut belasten, wenn er zu stark oder zu lange auf der Haut bleibt. Dann weicht er die Hornzellenschicht der Oberhaut auf und schwächt die Hautbarriere.
Schweiß wehrt Krankheitserreger ab SchweißwehrtKrankheitserregerab,indemerdenph-Wertder Haut senkt und antimikrobielle Substanzen enthält. Der saure Schweiß bildet zusammen mit den Bakterien und Pilzen, die die Haut besiedeln, eine natürliche Barriere gegen Eindringlinge. Außerdem produzieren einige Schweißdrüsen sogenannte antimikrobielle Peptide, die Bakterien, Viren und Pilze direkt abtöten und inaktivieren können. Schweiß ist also ein wichtiger Teil des Immunsystems, das den Körper vor Infekten schützt.

Schweiß ist nicht mehr gesund, wenn … Kommt es zu einer dauerha erhöhten Schweißproduktion, ohne dass genug Flüssigkeit und Salze durch Trinken ausgeglichen werden, kann es zu Dehydrierung, Kreislaufproblemen und Hitzschlag führen. Starkes Schwitzen kann auch ein Symptom für eine Krankheit sein und auf Hyperhidrose hindeuten, genauso wie eine verminderte Schweißproduktion auf eine Anhidrose hindeuten kann, was zu einer Überhitzung des Körpers führen kann. Ratsam ist es in beiden Fällen einen Arzt aufzusuchen und die Ursachen abzuklären.
Die meisten seltenen Erkrankungen sind angeboren – so auch die CPAM (congenital pulmonary airway malformations). Dabei handelt es sich um Atemwegsfehlbildungen der Lunge, die bereits bei einigen betro enen Neugeborenen zu schweren Atemproblemen führen und mit einem erhöhten Risiko für Lungenkrebs verbunden sein können. Forschern der Medizinischen Hochschule Hannover und der Universitätsmedizin Magdeburg ist es jetzt in einer Studie gelungen, genetische Ursachen der Erkrankung herauszufinden.
Zysten durchsetzen das Lungengewebe
Die CPAM sind zwar selten, gehören aber zu den häu gsten angeborenen Lungenfehlbildungen. Es gibt unterschiedliche Typen der Erkrankung, die sich schon während der Embryonalphase im Mutterleib entwickelt. Bei der häu gsten Form ist das Lungengewebe von großen Zysten durchsetzt, deren Wachstum negative Auswirkungen auf den Blutkreislauf und die Atmung des Neugeborenen haben kann. Ist das der Fall, müssen die betro enen Kinder schon früh operiert werden.
Der Ursache auf der Spur
Auf der Suche nach der Ursache der CPAM ging das Forschungsteam folgender Hypothese nach: Verantwortlich für die Lungenfehlbildungen sind Varianten in krebsassoziierten Genen des sogenannten RAS-MAPK-Signalwegs, die während der vorgeburtlichen Lungenentwicklung im Lungenepithel auftreten. Diese Varianten stören die normale Lungenentwicklung und führen in betro enen Lungenabschnitten zu einer Fehlentwicklung und dadurch zu einer Fehlbildung der Lunge.
Hypothese bestätigt
In ihrer Studie untersuchten die Wissenscha ler CPAM-Gewebeprobenvoninsgesamt43Kindernhistologischundgenetisch. AlledieseKinderwarenindenvergangenen20Jahrenaufgrund einer CPAM an der Klinik für Kinderchirurgie der MHH operiert worden. Die Operation von Lungenfehlbildungen gehört zur Kernkompetenz der Klinik. Das Ergebnis der Gen-Analyse: In den Gewebeproben von fast 60 Prozent der jungen Patienten konnten Varianten in Genen des RAS-MAPK-Signalwegs nachgewiesen werden – die Hypothese des Forschungsteams konnte damit bestätigt werden. Insbesondere das Gen KRAS war von Varianten betro en. Die Kinder mit einer KRAS-Variante hat-

ten einen statistisch schwereren Krankheitsverlauf als Kinder ohne diese.
Ergebnisse tragen zu besserer Diagnostik bei
Die Arbeit wurde im American Journal of Respiratory and critical Care Medicine verö entlicht. „Die Ergebnisse sind klinisch wichtig, sie tragen zu einer besseren Diagnostik der CPAM bei und können möglicherweise auch die erapie der Erkrankung verbessern“, erklärt Professor Dr. Christian Kratz, Direktor der Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie und Initiator der Studie. „Die Verö entlichung war nur durch die fantastische Zusammenarbeit der vielen beteiligten Personen unterschiedlicher Institute und Kliniken möglich“, betont er. Dr. Denny Schanze, Laborleiter am Institut für Humangenetik Magdeburg, ergänzt: „Wesentlich für die erfolgreiche Au lärung der genetischen Ursache der Erkrankung war der Einsatz von modernen Ultradeep-NGS-Sequenzierverfahren.“ Erstautor der Studie ist Jonas Windrich, Medizinstudent im zehnten Semester. Die Arbeit entstand im Rahmen seiner Promotion. „Ich habe bei dem Projekt viel über wissenscha liches Arbeiten gelernt und möchte meine spätere Tätigkeit als Arzt unbedingt mit der Forschung verknüpfen“, sagt Windrich.
Kooperation zwischen Hannover und Magdeburg
An der Studie beteiligt waren an der Medizinischen Hochschule Hannover die Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, das Institut für Pathologie, die Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie, die Klinik für Kinderchirurgie und der Arbeitsbereich Kinderradiologie des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Von der Universitätsmedizin Magdeburg war das Institut für Humangenetik beteiligt.








Die diesjährige 27. Auszeichnungsgala für junge Künstler im Magdeburger Opernhaus war ein ganz besonderes Ereignis. Die Tradition dieser besonderen Form der Ehrung der künstlerischen Leistung durch den eater-Förderverein besteht schon viele Jahre, aber selten waren die Laudatoren, die teilweise von weit her angereist waren, so persönlich, so nah an den Geehrten. Das machte die Auszeichnungen für die Schauspielerin Marie Joelle Blazejewski, den Tenor Adrian Domarecki oder den Tänzer Joshua Hunt - alles Mitglieder des Magdeburger eaterensembles, denen die Preise des Fördervereins eater Magdeburg für ihr hervorragendes künstlerisches Wirken verliehenwurde,solebensnahundvertraut.
In geheimer Wahl hatte eine Jury die drei Preisträger gekürt. Die Mitglieder des Fördervereins wählten zudem die Schauspielerin Iris Albrecht für die Auszeichnung mit dem Freundespreis, der für besondere
Verdienste für das eater Magdeburg verliehen wird. Kaum eine Inszenierung am Magdeburger Schauspielhaus kommt ohne die charismatische Künstlerin aus, der übrigens als erste Schauspielerin die Berufsbezeichnung „Kammerschauspielerin“ der Stadt Magdeburg verliehen wurde. Vor einigen Jahrzehnten in Quedlinburg geboren, absolvierte sie ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Ursprünglich, so erzählte sie launig, wollte sie eigentlich gar nicht nach Magdeburg, sondern hatte auf dem Weg nach Halberstadt hier auf dem Hauptbahnhof einen Aufenthalt, sah ein Plakat des eaters Magdeburg und dachte sich, man könne sich auch hier mal bewerben. Welch ein Glücksfall für die Elbestadt, der sie dann auch weitestgehend treu geblieben ist. Seit der Spielzeit 2001/2002 ist Iris Albrecht festes Ensemblemitglied am eater Magdeburg.
Bei der festlichen Gala Mitte April im Magdeburger Opernhaus wurden diese vier Preise nun vergeben. Die
jungen Künstler gehören damit zu dem illustren Kreis der schon über 80 Preisträger. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 1 500 Euro dotiert.
„Die Preisgala ist nur einer der Schwerpunkte in unserer Vereinsarbeit“, sagte Michel Redlich, der Vorsitzende des Vereins. Mit annähernd 200 Mitgliedern will der Verein die eaterbegeisterung bei den Bürgern der Stadt und der Umgebung steigern, bei vielen auch erst wecken.
„Den ersten Besuch im Ballett oder in der Oper – den vergisst man nicht. eater ist immer auch ein bisschen eine Welt in der Welt, o kann man hier den Alltag auch mal für ein paar Stunden hinter sich lassen.
Mit seinen Ideen und Projekten will der Verein Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen erreichen. Genannt seien die Reihe ´ emaTisch´, die eaterpatenscha en und die Förderpreisgala. Um diesen Anspruch zu erfüllen, müssen immer wieder Förderer gewonnen werden.“
Vom 27. Mai bis zum 2. Juni laden die Magdeburger Domfestspiele mit einem abwechslungsreichen Programm ein. Zwei Jubiläen stehen dabei im Fokus: Die Ottostadt feiert 500 Jahre Reformation und das Konservatorium Georg Philipp Telemann seinen 70. Jahrestag der Gründung.
Eröffnet werden die 16. Magdeburger Domfestspiele von WalterPlatheundOttoReutter.DerSchauspielerschlüpft in die Rolle des „Königs der Humoristen“, präsentiert die 80 Jahre alten Attacken Reutters auf die menschlichen Schwächen und tritt damit im Dom den Beweis an, dass sie immer noch zeitlos glänzen.
An den folgenden Tagen präsentieren sich mit einem humorvollen Konzert die MozART group, ein Streichquartett aus Warschau, oder Johannes Wasikowski, dem aus Halberstadt stammenden Magier am Klavier. In Magdeburg wird er Stücke von seinem Debut-Album „Taumorgen“ spielen. Stefan Jürgens kommt mit seinem erfolgreichen LiveProgramm „so viele farben“ in den Magdeburger Dom. Am 31. Mai rückt das Festkonzert eines der zentralen Themen der diesjährigen Magdeburger Domfestspiele in den Fokus. 1954 begann mit der Eröffnung des Konservatoriums Georg Philipp Telemann eine Erfolgsgeschichte. Seit 70 Jahren werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene an einer der größten Musikschulen Sachsen-Anhalts zum Musizie-







ren angeregt. Das zweite große Jubiläum, das dieses Jahr in der Ottostadt gefeiert wird, sind 500 Jahre Reformation in Magdeburg. Am 26. Juni 1524 hielt Martin Luther eine Predigt in der Magdeburger Johanniskirche. Kurze Zeit später wechselte die Stadt zum evangelischen Glauben. Dieses historisch bedeutende Ereignis wird 2024 mit einer Vielzahl von Veranstaltungen gewürdigt.
Mit Wolfgang Amadeus Mozarts berühmter Krönungsmesse im Zentrum erwartet die Gäste ein Konzert mit festlichen Klängen. Der Domchor singt unter Mitwirkung der Domsingschule mit seinem neuen Leiter Domkantor Christian Otto, der für diesen Abend das Werk seines Lieblingskomponisten ausgesucht hat.
Den krönenden musikalischen Abschluss bilden am Sonntag die Auftritte von Professorin Anna-Victoria Baltrusch an der Orgel, und des Bundesjuristenorchesters unter der Leitung des Dirigenten Georg Dücker beweist, dass Juristen sich nicht nur mit Gesetzen und Paragrafen auskennen.


Die Erwartungen an die erste Ballettgala des Magdeburger Ballettdirektors
Jörg Mannes waren hoch. Aber die wurden durch ein rauschendes Fest ganz unterschiedlicher Tanzsprachen im Magdeburger Opernhaus noch weit übertro en. Mit minutenlangen stehenden Ovationen auf allen Rängen dankte das Publikum für ein Ballettereignis der Sonderklasse.
Einen besseren Auftakt für die festliche Gala hätte man sich gar nicht wünschen können. Mit einer Szene aus dem Ballett „Schneewittchen“ von Jörg Mannes, das bei seiner Premiere in Magdeburg vor einiger Zeit schon einmal begeistert gefeiert wurde, eröffnete der Tänzer Joshua Hunt aus der Compagnie des Magdeburger Theaters das Tanzfest. Wenige Tage zuvor hatte er den Preis des TheaterFördervereins in der Sparte Ballett für junge Künstler erhalten. Nun konnte er den Reigen seiner Kollegen, darunter auch zahlreiche international geschätzte Tänzer, eröffnen. Jörg Mannes hatte zuvor selbst von der Bühne seinen Wunsch erläutert, die Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten in ganz verschiedenen Tanzsprachen in einer Gala zu präsentieren. Jeder Choreograph hat eine eigene Handschrift, erzählt die Geschichten mit tänzerischen Mitteln auf seine Art und lässt Emotionen höchst unterschiedlich auf das Publikum wirken. Jörg Manns „Urlicht“ nach der Musik von Gustav Mahler tanzten Francesca Raule und Stefano Sacco. Kammersängerin Undine Dreißig hatte dabei die Aufgabe, mit ihrem Gesang die Tänzer und das Orchester unter der Leitung von Svetoslav Borisov zu begleiten. Jeder ließ dabei den anderen Kunstgattungen so viel Raum, dass
in der Gesamtheit ein beeindruckend harmonisches, beinahe fragiles Gesamtwerk entstand, das gerade durch seine Zurückhaltung enorme Wirkung entfaltete.
Ganz anders „Love Song“ nach einer Choreographie von Andrey Kaydanovskiy. Mit den Mitteln des modernen Tanzes und der Musik von Jaques Brel boten Simone Messmer und Orazio Di Bella, beide Solisten von Ballett am Rhein, die ungestüme Gefühlswelt auch sexueller Liebe in einem beeindruckenden Pas de Deux. Mit Humor und Unbekümmertheit übertanzten sie gekonnt das Tabu dieser Form des Ausdrucks großer Gefühle im Ballett. Das geschah mit sehr viel Leichtigkeit, die schnell auf das begeisterte Publikum ausstrahlte.
„Schubert“ ist der knappe Titel einer Choreografie von Jörg Mannes. Der Magdeburger Ballettdirektor hat eine besondere Beziehung zu der Musik des Komponisten Franz Schubert. Die Auseinandersetzung mit dem Tode und dem Leben hat in seinem Schaffen schon seit Jahren einen Platz. Anastasiya Kuzina und Marco Marangio aus der Magdeburger Ballettcompagnie tanzten nach einer Schubertschen Klaviersonate eine Szene.
John Neumeier gehört zu den großen Namen unter den internationalen Choreographen. Der 85 Jahre alte
Amerikaner ist seit 1973 Ballettdirektor und Chefchoreograph des Hamburg Ballett. Die Italienerin Silvia Azzoni, Erste Solistin am Hamburg Ballett, und der Ukrainer Alexandre Riabko, Erster Solist am Hamburg Ballett, tanzten bei dieser opulenten Gala den Pas de Deux aus dem Stück „Sylvia“ von John Neumeier und wurden für diese Präsentation einer eher klassischen Ballettsprache begeistert gefeiert.
Einen absoluten Höhepunkt der Ausdrucksmöglichkeiten durch den Tanz boten allerdings die Französin Chloé Albaret und der portugiesische Tänzer und Choreograph César Faria Fernandes. Beide waren eng mit den zwei Compagnien des renommierten Nederlands Dans Theater verbunden und arbeiten derzeit freiberuflich. Chloé Albaret tanzte dort in der Compagnie1 bis 2022, César Faria Fernandes machte sich im Nederlands Dans Theater vor allem als Choreograph, aber auch als Tänzer einen Namen.
Beide tanzten nach einer eigenen Choreographie und der Musik von Pink Floyd. „TwoFold“ hieß das Stück und war in seinem Ausdruck von einer solchen Spannung, dass einem der Atem stockte. Ihre Körper blieben beständig verbunden und hinterließen trotzdem eine Leichtigkeit, die der Schwerkraft spottete.
Die Internationale Ballett-Gala wartete danach mit weiteren Höhepunkten auf. Da waren die Ausschnitte aus dem Erfolgs-Ballett „Borgia“ von Jörg Mannes, das Pas de Deux aus „Giselle“, bei dem Simone Messmer und Orazio Di Bella bewiesen, dass sie auch klassische Perfektionisten sind, oder „Granny“ von Jörg Mannes mit dem Adagio aus „Der Tod und das Mädchen“ nach Franz Schubert, getanzt von Chiara Amato aus der Magdeburger Compagnie. Große Namen und berühmte Ballett-Compagnien warteten mit dem Pas de Deux aus „Le Corsaire“ mit Shiori Kase und Francesco Gabriele Frola, beide vom weltberühmten „Lead Principals English National Ballet“ und dem „Adagietto“ von John Neumeier mit Silvis Azzoni und Alexandre Riabko auf.
Das Finale dieses rauschenden Ballettfestes zeigte dann, dass der Magdeburger Ballettdirektor ein geborener Wiener ist. Ganz in dieser Tradition endete begeistert mit rhythmischem Klatschen des Publikums der Abend im Radetzky-Marsch, zu dem alle Tänzer in einer Mannes-Choreographie noch einmal auftraten.
Das geschah nicht klassisch und auch nicht modern – aber sichtbar mit sehr viel Vergnügen.

Einen der Höhepunkte der Ballettgala boten die Französin Chloé Albaret und der portugiesische Tänzer und Choreograph César Faria Fernandes. Beide waren eng mit den zwei Compagnien des renommierten Nederlands Dans Theater verbunden, tanzen derzeit freiberuflich. Sie zeigten bei der Gala eine eigene Choreographie zur Musik von Pink Floyd. „TwoFold“ hieß das Stück. Das Foto zeigt sie in einem anderen Stück „Vanishing Twins.


„Au weia“, das gibt Ärger, denn „darf man das noch sagen?“ Man darf es nicht. Aber das kümmert Marion Bach und Heike Ronniger sowie alterierend Christoph Deckbar und Oliver Vogt einen …, nein, natürlich nicht. Schließlich sind die Kabarettistinnen und Kabarettisten der „Magdeburger Zwickmühle“ absolut gendergerecht auf satirischpolitischem Niveau mit ihrem neuen Programm „Kein Verstand in Sicht“.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Für das Textbuch von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel gilt das nicht, dann schon eher für die politischen „Größen“ unserer Zeit, die grundsätzlich jeden Eisberg auf der Kreuzfahrt der Kabarettgranden durch das tosende Meer des Weltgeschehens rammen. Frank Voigtmann hat bei diesem Programm die gefährliche Aufgabe übernommen, die Frauenpower mit jeweils einem alternierenden Mann durch die Untiefen zu steuern, ohne dass sie wegen der fehlenden Rettungsboote samt Kreuzfahrtschiff unter- oder wenigstens über Bord gehen.
Und das ist wahrlich eine Mammutaufgabe, denn die beiden seefahrenden Damen sprühen vor Energie, schrecken vor nichts zurück, jodeln, dass man meint in den bayerischen Alpen zu sein, lassen die Männer von In ation und Rezession singen, um dann mit unschuldigem AugenaufschlagdasKinderlied„DreiChinesen mit dem Kontrabass“ zu intonieren. So viel Intoleranz gegenüber Minderheitenistkaumnochzuertragen,aber die beiden hätten am liebsten noch
einen schwarzen Jim Knopf zusammenmitLukasdemLokomotivführer, vielleicht auch noch den Struwwelpeter. Solche Kinderbuchauthentizität kann man einfach nicht dulden, noch dazu, wenn die gesamte Kulturprominenz aus Stadtgewalt und Puppentheater der Premiere die Ehre erweist.
Aber sei´s drum: Marion Bach lässt folgerichtig die Puppen tanzen, mit einer übrigens ausgesprochen gelungenen Adaption einer In uencerin, die ein wenig an Zirkus oder wenigstens Rummel, wie man in Magdeburg zu Messe sagt, erinnert. Man glaubt ihr unbesehen, dass jeder Deutsche im Jahr 60 Kleidungsstücke kau , und vor allem, dass sie 80 wieder zurückschickt. Nicht nur die In uencerin ist ein Hinweis darauf, dass die neue Zeit in die altehrwürdige Zwickmühle eingezogen ist. Die ganze Vorstellung wirkt frisch, frech und angenehm unanständig. Voll krass für junge Leute, und es ist alles in der CloudsetztHeikeRonnigernocheins drauf.


Ganz ernstha : Zusammen mit den singenden Musikern gelingt es den beiden Kabarettistinnen Dinge anzusprechen, die junge Leute interessieren, ohne in Comedy abzudriften. Junge Leute (im Publikum vorhanden) können auch über sich selbst lachen, ist die Erkenntnis und ein wichtiger Generationen-Schritt.
Das bedeutet nicht, das politischsatirische Kabarett ach zu bügeln, sondern mit neuen emen „aufzupeppen“,woranmanmerkt,dassauch der Autor dieser Zeilen davon angesteckt wurde.

Nichtsdestotrotzdarfdieklassische Linie nicht verloren gehen – die Mischung machts, um neue Zuschauergenerationen zu gewinnen. Obwohl: Wenn sich die beiden Grand Dames mit einem 3D-Drucker einen Mann drucken und dazu „Sexgott“ von Ohrenfeindt rocken, dann bleibt ohnehin kein Auge trocken, und das Publikum johlt vor Begeisterung – ganz gleich, wie alt.
„Kein Verstand in Sicht?“ Stimmt nicht, zumindest nicht bei den Kabarettisten. Alle anderen sollten unbedingt hingehen. Vielleicht hil ´s.


Der Krieg in der Ukraine sorgt für Ungewissheit beim Warenverkehr zwischen Ost und West. Noch rollen Züge über Russland, doch alternative Transportwege sind gefragt. Einige Logistiker setzen mittlerweile auf den Mittleren Korridor, welcher China über Zentralasien, das Kaspische Meer, den Südkaukasus und wahlweise das Schwarze Meer oder die Türkei mit Europa verbindet.
Kürzlich kündigte ein Vertreter der aserbaidschanischen Eisenbahn an, dass eine Güterbahnstrecke im Osten Georgiens bald vollständig ausgebaut sein wird. Warum ist das wichtig? Die Bahnstrecke ist Teil der Güterverbindung zwischen Aserbaidschan, Georgien und der Türkei, der BakuTiflis-Kars-Bahn, auch BTK genannt. Die BTK wiederum ist ein entscheidendes Puzzlestück im so genannten Mittleren Korridor, der Güterverbindung zwischen Europa und China mit weitreichenden Auswirkungen auf die Volkswirtschaften der Regionen Zentralasien und Westasien.
Das häufige Umladen und die vielen Grenzen machen die Route aber zeitaufwendig und teuer. Auch die Kapazitäten sind bisher beschränkt. Aber zahlreiche Ausbauprojekte entlang der
Blick auf Georgiens Hauptstadt Tiflis. Georgien ist ein Staat an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien. Die ehemalige Sowjetrepublik umfasst Bergdörfer im Kaukasus ebenso wie Strände am Schwarzen Meer. Georgien sieht sich künftig als Drehscheibe des Mittleren Korridors für den Handel zwischen den westlichen Ländern und China, wenn durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen diese Route nicht vollends genutzt werden kann.
Strecke und die mögliche Förderung im Rahmen der europäischen Infrastrukturoffensive Global Gateway zeigen, dass der Mittlere Korridor internationalen Rückenwind genießt. Drei Faktoren tragen zur Belebung der transkaspischen Transportroute bei: Chinas Interesse an einer international verzweigten Transportinfrastruktur für den Warentransport in Richtung Europa als Teil der One Belt, One Road-Seidenstraßenprojektes; die auf Exporte ausgerichtete Wirtschaft Zentralasiens; die Umleitung des Güterverkehrs China – Europa vom nördlichen auf den mittleren Korridor als Reaktion auf die gegen Russland verhängten Sanktionen und damit zusammenhängenden Unsicherheiten im Transportgeschäft auf der Route via Russland/Belarus. Letzteres treibt den
Ausbau des Mittleren Korridors aktuell besonders voran.
Der Mittlere Korridor ist eine Abzweigung der Neuen Seidenstraße, dem größten Infrastrukturvorhaben der Welt. Im Jahr 2013 von China ins Lebengerufen,habenbishermehrals140 Länder und Dutzende internationale Organisationen Kooperationsabkommen oder Unterstützungserklärungen unterzeichnet. Der Korridor verbindet China über Kasachstan, überquert das Kaspische Meer vom Hafen Aktau in Kasachstan zum Hafen Baku in Aserbaidschan und nimmt dann die eingangs erwähnte Route Baku-Tiflis durch Georgien nach Kars in der Osttürkei. Von dort kann die Fracht durch die Türkei unter dem Bosporustunnel auf europäisches Territorium gelangen. Seit einigen Jahren gewinnt auch die-





ser mittlere Korridor an Bedeutung, da viele Logistik- und Transportunternehmen die nördliche Route über russisches Territorium aus Angst vor den westlichen Sanktionen gegen Russland meiden.
Mittlerer Korridor ist kein Ersatz
Der mittlere Korridor ist jedoch bei weitem kein gleichwertiger Ersatz oder eine Ausweichmöglichkeit, wenn die Nordroute auf Probleme stößt. Hindernisse müssen nicht immer Sanktionen sein, es können auch die in letzter Zeit dramatisch gestiegenen Frachtraten für Standardcontainer auf dem Seeweg sein. Die Transportkapazitäten des Mittleren Korridors müssen allerdings noch ausgebaut werden. Das Megaprojekt wird in erster Linie als gigantisches Investitionsvorhaben gesehen, das Handelsvolumen, die Produktionskapazitäten, die Infra-
struktur und den Technologieeinsatz der regionalen Volkswirtschaften von der Türkei über den Kaukasus bis nach Aserbaidschan und Zentralasien anzukurbeln.
Ende letzten Jahres sorgte die Weltbank mit der Veröffentlichung ihres Berichts „Middle Trade and Transport Corridor“ für einiges an Aufmerksamkeit. Die Modelle der Weltbank prognostizieren eine Verdreifachung des Frachtvolumens und eine Halbierung der Transitzeit auf dem Mittleren Korridor bis 2030.
Laut der Weltbankstudie wird der Handel zwischen Europa und Kasachstan sowie zwischen Europa und China den größten Anteil ausmachen. Allerdings liegt das Volumen nur im unteren einstelligen Bereich des Gesamtvolumens zwischen Europa und China. Typische Güter sind Düngemittel, Metalle, Maschinen, Chemikalien und andere Pro-

dukte mit hoher Wertschöpfung. Neue Infrastrukturinvestitionen werden die Importe und Exporte der beteiligten Länder beschleunigen und potenzielle neue Märkte im Nahen Osten, Nordafrika, Südasien und Südostasien erschließen, so die Prognose.
Die Betreiber des Mittleren Korridors sehen den Mittleren Korridor als Alternative zu etablierten Routen zwischen Asien und Europa. Doch westliche Firmen erleben ihn als langsam und unzuverlässig.
Heinrich Kerstgens, Direktor Vorstandsprojekte für die deutsche Rhenus-Gruppe, ist mit dem Mittleren Korridor nicht sehr glücklich.
„Der politische Wille, die Route auszubauen, ist bei den Regierungen da“, so Kerstgens. „In der Realität aber ist der multimodale Transport mit Bahn, Lkw und Schiff durch mehrere Länder noch langsam und unzuverlässig.“
Bauen, ob nun Wohnungen, Brücken oder Straßen, ist ein vieldiskutiertes Thema. Die einen klagen, dass es zu wenig Wohnungen gäbe, die anderen möchten lieber abreißen, denn die Altschulden drücken.
Das WIRTSCHAFTSMAGAZIN AUS UND ÜBER SACHSEN-ANHALT erscheint monatlich.
Mittagstraße 16p
39124 Magdeburg



Wenn Großinvestitionen anstehen, wie in Magdeburg mit Intel, dann drängeln sich auf einmal Bauinvestoren und suchen Grundstücke, die vorher niemand haben wollte.
Aber die Bauindustrie und das Bauhandwerk haben erhebliche Sorgen. Da sind die Fachkräfte, die Materialpreise oder Energie. Und in den Städten weiß man momentan nicht, wie die Wärmeversorgungsplanung für Fernwärme fertiggestellt werden soll.
Probleme über Probleme. Einige davon spielen in der nächsten Ausgabe von eine Rolle.



am Kiosk ausverkauft?
Das ist ärgerlich.Mit einem Abonnement ist man diesen Ärger los. Jeden Monat finden Sie Ihre pünktlich im Briefkasten. Nur die folgenden Zeilen ausfüllen und ab in die Post. Oder Sie nutzen den Abo-Service ganz rechts unten auf dieser Seite. Dort werden Sie auch persönlich beraten. Ja, ich will ein Jahres-Abo mit 12 Heften im Jahr zum aktuell gültigen Bezugspreis von 46,41 Euro (inkl. gesetzl. MwSt. und Porto). Die Bezugszeit verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn ich nicht sechs Wochen vor Ablauf eines Bezugsjahres schriftlich beim Verlag kündige. Die Angaben sind freiwillig und die Verarbeitung der Daten unterliegt der EU-DSGVO. Bitte beachten Sie dazu auch die Datenschutzerklärung, den Haftungsausschluss und die AGB im Impressum auf der Internetseite.
Tel. 0391 25857511
redaktion@aspekt-magazin.de www.aspekt-magazin.de
Herausgeber und Chefredakteur Rolf-Dietmar Schmidt, v.i.S.d.P.
Autoren
Bernd Lähne, Wiebke Peters, Katharina Stelzer, Sabine Seidler, Sven Richter, Kai Lenski, Wolfgang Francke, Anja Gildemeister
Layout Kreativbüro 2D, Magdeburg www.kreativbuero-2D.de
Druck
Klicks GmbH, Ilmenau
Vertrieb und Abonnenten
Tel. 0391 25857511
Werbeberatung/Anzeigen
Tel. 0391 25857511
ISSN 2190-4464 , ängeln sich uchen ugen.
Nachdruck oder elektronische Verarbeitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos, Grafiken oder elektronische Dateien wird keine Haftung übernommen.
Für Verstöße durch Autoren oder Fotografen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haften ausschließlich die Urheber der Texte oder Bilder.
Einzelpreis je Ausgabe
Deutschland: 3,50 Euro
Ausland: 4 Euro plus Versand, Jahresabonnement: 46,41 Euro (inkl. gesetzl. MwSt. und Porto)


Sie erhalten aspekt drei Monate lang zur Probe kostenfrei!
KEIN RISIKO Nach dieser Zeit endet das Probeabonnement automatisch!


Gerd Klinz, Geschäftsführer eines Sanitätshauses mit zehn Filialen in Sachsen-Anhalt
Unser Land. Unsere Versicherung. oesa.de