
5 minute read
Ich bin Flexitarier
from Neu Nota Bene 17
by Mateo Sudar
Als ich diesen Satz zum ersten Mal gesagt habe, meinte ich es eher scherzhaft. Ich fand den Namen lustig und wollte damit ausdrücken, dass ich in meiner Ernährung gerne flexibel bin. Auch vielleicht, weil ich mich nicht gerne zu 100 % festlege.
Ich esse überwiegend vegetarisch, mag keine Wurst auf dem Brot, habe nicht das Gefühl mir fehlt etwas, wenn auf dem Teller kein Riesensteak liegt, finde es spannend, auch Gerichte mit Tofu, Seitan oder Tempeh auszuprobieren, habe sogar vegane Kochbücher zu Hause – aus reinem Interesse und weil darin auch tolle Rezepte enthalten sind.
Advertisement
Aber dann gibt es die Tage, an denen ich Appetit auf ein leckeres Reh- gulasch oder eine „echte“ Bolognese mit Gehacktem statt Gemüse habe. Ab und an grille ich gerne mal Lammfleisch oder ein Lachssteak oder stecke mir gedankenverloren ein Stück Schinken in den Mund, während ich für die Familie koche.
Als „echter“ Vegetarier hätte ich dann jetzt ein Problem, ich würde mir untreu werden. Aber wenn ich Flexitarier bin, gibt es mir die Freiheit, genau das zu tun: ab und zu Fleisch zu essen. Nicht immer, weil ich weiß, dass zu viel davon dem Körper gar nicht guttut.
Warum? Weil zu viel Harnsäure aus dem Fleisch Gicht und Rheuma fördern kann. Weil im Fleisch viele gesättigte Fettsäuren enthalten sind, die sich ne- gativ auf die Blutfettwerte auswirken können. Weil im Fleisch aufgrund der Massentierhaltung Antibiotikarückstände enthalten sind, die ich dann mit der Nahrung aufnehme, was ich nicht möchte. Auch weil durch die vielen Antibiotikagaben die zu bekämpfenden Erreger resistent werden und somit die Medikamente, wenn sie wirklich gebraucht werden, ihre Wirksamkeit verlieren.
Ja und überhaupt, mit der Massentierhaltung bin ich nicht einig. Viele Tiere, die zusammengepfercht auf engem Raum unter ziemlich schlechten Bedingungen dahinvegetieren. Es gibt keinen Auslauf, es entsteht die Gefahr von Krankheiten. Ohne Betäubung werden Schweine kastriert, Hähnchen werden geschreddert, da es zu teuer ist, sie aufzuziehen, wenn Legehennen gewünscht werden. Fische und andere Meerestiere sterben, weil sie als Beifang in Fischernetzen hängen bleiben, aber zum Verzehr nicht gedacht sind und dann tot über Bord gekippt werden. Generell überfischte Meere und und und…. Da braucht es nur ein bis zwei Dokumentarfilme zu dem Thema und wenn man nicht ganz abgestumpft ist, vergeht einem völlig die Lust, Fleisch zu essen.
Dazu kommt noch der Gedanke an den ökologischen Fußabdruck. Ein sehr großer Teil der Treibhausgasemmission entsteht durch tierische Lebensmittel. Und der Wasserverbrauch, der z. B. für die Erzeugung eines Kilogramms Rindfleisch gebraucht wird, liegt mit 15.500 Liter extrem hoch. Im Vergleich dazu sind für ein Kilogramm Kartoffeln nur 900 Liter nötig.
Inzwischen ist Flexitarier ein Begriff, der sowohl im Duden als auch bei Wikipedia zu finden ist. Der Duden definiert den Flexitarier als „Person, die sich überwiegend vegetarisch ernährt, aber auch gelegentlich hochwertiges, biologisch produziertes Fleisch zu sich nimmt“. Flexitarier bezeichnen sich auch als „Teilzeit-Vegetarier“ oder „Wochenend-Vegetarier“.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) bezieht Stellung zu dem Thema. Helmut Heseker, Präsident der DGE, geht davon aus, dass Flexitarier gesünder leben. Sie würden insgesamt weniger Fleisch essen und sich damit den Empfehlungen der DGE von 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche nähern. Laut Heseker sei die „flexitarische Ernährung genau das Richtige“, da alle lebenswichtigen Nährstoffe aufgenommen würden und ein Mangel an Mineralstoffen oder Vitaminen nicht drohe. Wer insgesamt weniger Fleisch und insbesondere weniger rotes Fleisch und weniger verarbeitete Fleischprodukte esse, senke sein Risiko für koronare Herzerkrankungen, Diabetes mellitus und Krebs (Quelle Wikipedia)
Also habe ich instinktiv doch schon einiges richtig gemacht. – und das möchte ich auch weiterhin tun. Wenn ich Fleisch esse, soll es dem Tier gut gegangen sein, es soll nicht Panik erleiden, in irgendwelchen Lastwägen transportiert und muss auch nicht vom Ende der Welt hergeflogen werden.
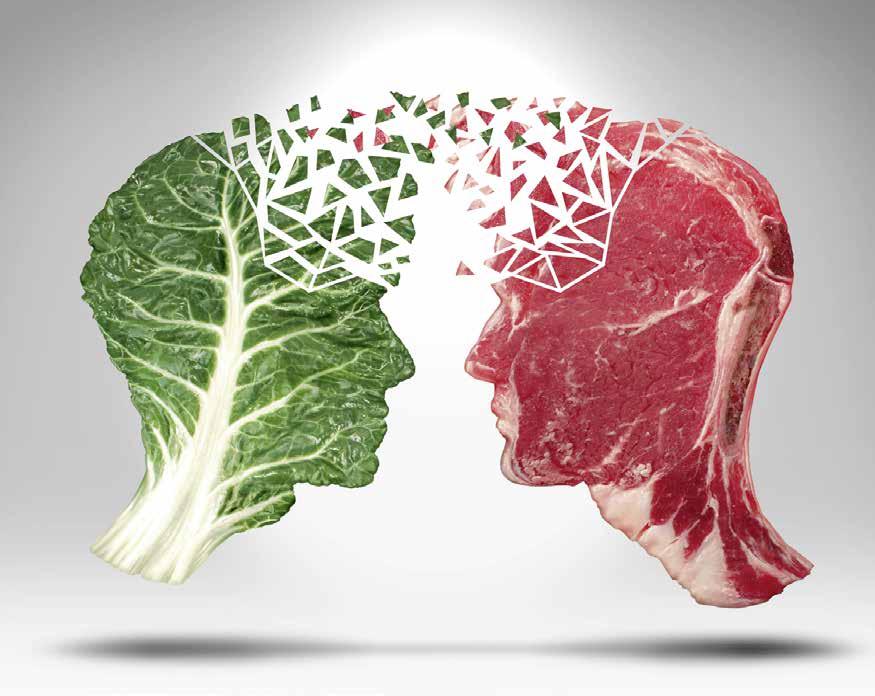
Wenn ich die Möglichkeit bekomme, Fleisch direkt vom Förster zu bestellen, der das Reh frisch erlegt hat, dann bestelle ich da. Wildtiere brauchen keine Antibiotika und durften bis zu ihrem Tod in der freien Wildbahn leben. Beim Metzger meines Vertrauens kann ich Fleisch von den umliegenden Dörfern kaufen, dieser Metzger schlachtet die Tiere auch selbst vor Ort. Die Eier hole ich direkt vom Bauernhof oder aus dem Eierautomat. Der wird inzwischen mit Eiern von freilaufenden Hühnern der Gegend in Bioqualität bestückt oder ich unterstütze die Initiative Bruder Hahn (https://www.bruderhahn.de/), die in die Aufzucht der jungen Hähne investiert. Greenpeace veröffentlicht Broschüren darüber, welche Fischarten besonders bedroht sind und welche man noch unbedenklich essen kann. Auch auf gute Bioqualität kann man beim Einkauf von tierischen Lebensmitteln achten.
Weiß ich im Restaurant nichts über die Herkunft des Tieres das auf meinem Teller landet, dann entscheide ich mich immer öfter für ein vegetarisches Gericht. Und auch wenn ich zu Hause „begeisterte Fleischesser“ habe, kommt oft genug vegetarisches Essen auf den Tisch, meistens schmeckt es ihnen auch und nur selten wird das Fleisch vermisst.
Das ist das Schöne am „Flexitariersein“
– meine Bedürfnisse und das Tierwohl unter einem Hut zu vereinen. Und genau dazu möchte ich Mut machen, denn zwei Halbzeitvegetarier sind doch im Prinzip schon ein Ganzer und damit kann man viel für Tier und Umwelt bewirken.
Bianka Zielke
Gut 100.000 Pfleger fehlen laut einem Gutachten in Altenheimen. Die Forscher meinen auch: Auffangen könnte man den Mangel zum großen Teil mit Assistenzkräften – wenn man die Aufgabenverteilung ändert.
Mit Assistenten gegen den Pflegenotstand?
Von Michael Weidemann, ARD-Hauptstadtstudio
In Deutschlands Pflegeheimen herrscht Personalnot, weil es zwar immer mehr fertig ausgebildete Fachkräfte gibt, aber noch mehr aktive Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden. Die daraus resultierende Lücke hat ein Gutachten der Universität Bremen nun auf gut 100.000 Pflegerinnen und Pfleger beziffert.
Doch ein Teil der Personalprobleme in den Einrichtungen ließe sich deutlich abmildern, wenn die Aufgaben dort gezielter verteilt würden, so die Analyse der Gutachter. Derzeit würden viele Aufgaben, die ebenso gut von Assistenzpersonal ausgeführt werden könnten, von voll ausgebildeten Fachkräften übernommen – und die sind bekanntlich besonders knapp.
Die Auftraggeber der Studie – die Spitzenverbände der gesetzlichen Pflegekassen, privaten Heimbetreiber und der Freien Wohlfahrtspflege – teilen diese Erkenntnis. Zu oft würden sich hochqualifizierte Pflegerinnen und Pfleger um eher einfache Betreuungsabläufe kümmern, moniert Gernot Kiefer vom Spitzenverband der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. „Eine Person mit Pflegegrad 1 braucht vielleicht nicht so häufig eine hochqualifizierte Pflegekraft, aber sicherlich regelmäßig und mit großer Zugewandtheit eine PflegeAssistenzkraft.“
Verbände wollen
Aufgabenverteilung verändern
Dem Gutachten folgend wollen die Verbände nun in Kooperation mit den Landesregierungen die Verteilung der Aufgaben in den Alten- und Pflegeheimen verändern. Dadurch könnten Stress und Hetze verringert und der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden, glaubt der Präsident des Bundesverbandes der privaten Heimbetreiber, Bernd Meurer: „Insbesondere die Attraktivität des Berufes wird steigen, wenn eine Fachkraft nur noch Fachkraftaufgaben zu verrichten hat – und gegebenenfalls mehr anleitend, delegierend und kontrollierend tätig ist. Diese Umorganisation – die Herausnahme der Fachkraft aus den Assistenzleistungen – führt dazu, dass wir mehr Assistenten brauchen.“
Insgesamt müsste der Personalbestand in allen Einrichtungen um durchschnittlich 36 Prozent gesteigert werden, um langfristig eine angemessene Betreuung garantieren zu können, haben die Gutachter der Uni Bremen errechnet. „Wichtigstes Instrument hierfür ist die Anhebung der Pflegeschlüssel, um die Zahl der Beschäftigten pro pflegebedürftige Person zu erhöhen“, heißt es in der Analyse.
Frage der Finanzierung
Auf konkrete Vorschläge des Gutachtens – etwa im höchsten Pflegegrad 5 jede Pflegekraft rechnerisch nur noch 1,8 statt derzeit 2,5 Bewohner betreuen zu lassen – wollen sich die Spitzenverbände zwar nicht einlassen. Klar sei aber, so Maria Loheide als Vertreterin der Freien Wohlfahrtspflege, dass man hier eine Veränderung und eine Verbesserung des Personalschlüssels brauche.
„Genauer hingucken, wer macht welche Aufgaben – das wird die Herausforderung sein. Da müssen wir ran. Und da müssen wir zu deutlich spürbaren Verbesserungen kommen. Das ist natürlich auch eine Frage, wie wird das dann finanziert?“
Und genau da kommen die Länder und Kommunen ins Spiel. Denn sie müssten die verbesserten Schlüssel nicht nur absegnen – sondern als Sozialhilfeträger auch mitfinanzieren.
Bei dem Gutachten der Universität Bremen handelt es sich um den 2. Zwischenbericht im Projekt zur Entwicklung eines Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeirichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben gem. § 113c SGB XI (PeBeM). Der Abschlussbericht soll im Juni 2020 vorgelegt werden.
Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: q Gesetzlicher Auftrag q Insgesamt haben 241 Pflegefachpersonen 59
Einrichtungen in 15 Bundesländern vorort begleitet („beschattet“), um den Personalbedarf zu ermitteln q Zeitraum: April-Oktober 2018 q Insgesamt wurden 509 Schichten, davon 50 Nachtdienste und 36 Wochenenddienste, beschattet q Zusammenfassende
Einschätzung: Es fehlen 120.000 Pflegefachkräfte!
Am 25. Februar 2020 nahmen der GKV-Spitzenverband, der bpa Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. in einer gemeinsamen Pressekonferenz zu den Ergebnisse des Bremer Gutachtens Stellung. Hier Auszüge aus der gemeinsamen Pressemitteilung:








