

Reden wir doch drüber!
Die freiwillige Herkunftskennzeichnung macht die Rechnung MIT den Tiroler Wirtinnen und Wirten.
INHALTSVERZEICHNIS
SAI SON
4 Nachhaltige Vorreiterrolle
Kommentar von LR Mario Gerber
DAS GRÜNE 3 × 1
5 Am Tiroler Weg in die Zukunft
Editorial von Karin Seiler
7 Identität Tirol
Tobias Morettis Erler

Rede 9 Jahre später
16 „Eine neue Vision im Alpentourismus“
Interview mit Tourismusexperte Harald Pechlaner
MOBILITÄT
22 „Touristiker:innen ist es ja nicht egal, wie Gäste anreisen“
Interview mit Markus Mailer, Verkehrsexperte der Universität Innsbruck
26 Ein Thema für alle Mit Mobilität zum Erfolg
ARBEIT
38 Best Practice Hotels und TVB als attraktive Arbeitgeber
KLIMA
52 Grüne Gewissensfrage
Der Weg hin zum klimafitten Lebensraum
62 „Wir müssen Themen proaktiv angehen“
Interview mit Karin Seiler, Geschäftsführerin Tirol Werbung

64 Große Leinwand in Tirol
Im Gespräch mit Cine Tirol
IMPRESSUM
Die SAISON wöchentlich als Newsletter: saison.tirol/ newsletter

SAISON Tourismusmagazin, Nr. 1/2023 (72. Jahrgang)
Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: Tirol Werbung, Maria-Theresien-Straße 55, 6020 Innsbruck • Mit der Produktion beauftragt: TARGET GROUP Publishing GmbH, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck • Chefredakteur: Michael Steinlechner • Redaktion: Daniel Feichtner, Susanne Gurschler, MA, Anna Kirchgatterer, Barbara Kluibenschädl, Esther Pirchner, Lisa Schwarzenauer, Eva Schwienbacher • Grafik: Sebastian Platzer, BA, Lisa Untermarzoner
MARKUS MAILER

30 Der Weg ist das Ziel
Das neue Tiroler
Anreisetool GRETA
66 Tourismusforum
Im Zeichen der Nachhaltigkeit
70 Tirol Touristica Vorstellung der diesjährigen Gewinner:innen

Anzeigenverkauf: Wolfgang Mayr, w.mayr@target-group.at • Anschrift Verlag: Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck, Tel. 0512/ 58 6020, Fax DW -2820, redaktion@target-group.at Geschäftsführung Verlag: Mag. Andreas Eisendle, Michael Steinlechner • Druck: Intergraphik GmbH, Innsbruck • Coverfoto: Shutterstock.com
Die Informationen zur Offenlegung gemäß § 25 MedienG können unter der URL https://saison.tirol/info/impressum abgerufen werden.
„Den höchsten Impact auf den Verkehr in Tirol haben immer noch die Einheimischen“
NACHHALTIGE VORREITERROLLE
 L iebe Tirolerinnen und Tiroler!
L iebe Tirolerinnen und Tiroler!
Ist der Tiroler Tourismus zukunftsfit? Diese Frage wurde mir in meiner bisherigen Amtszeit als Tourismuslandesrat bereits des Öfteren gestellt. Meine Antwort darauf lautete stets: Ja. Denn der Tiroler Tourismus ist vielseitig und anpassungsfähig. Das hat sich in der Geschichte des heimischen Tourismus schon mehrmals gezeigt, zumal es immer wieder Herausforderungen gegeben hat, die jedoch immerzu mit Bravour gemeistert wurden.
Um auch weiterhin das Beste für den Tourismus hervorzubringen, muss es unser persönlicher Anspruch sein, Tirol weiterhin als touristische Vorreiterregion im Alpenraum sowie als Vorbild für andere Regionen zu positionieren. Unser zentraler Wegweiser ist dabei der Tiroler Weg. Wir müssen gegenwärtige Herausforderungen, gesellschaftliche Entwicklungen sowie Trends und damit verbundene Chancen erkennen und bereits heute an Lösungen für morgen arbeiten. Tirol ist hier bereits fortschrittlich unterwegs: So haben wir beispielsweise Anfang dieses Jahres ein Future-Lab eingerichtet, das sich Innovationen sowie Entwicklungen und ihrem touristischen Potenzial widmet. Themen wie der Klimawandel und mögliche Anpassungsstrategien oder eine Vereinheitlichung des öffentlichen Verkehrsnetzes stehen dabei im Zentrum. Um relevante Themen sowie Know-how im Bereich Nachhaltigkeit zu bündeln, wurde zudem das „Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit“ geschaffen.
Was es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten jedenfalls braucht, ist Mut zur Veränderung, einen noch größeren Fokus auf Qualität sowie eine
Ausrichtung hin zum Ganzjahrestourismus. Unser Ziel bei der verantwortungsvollen Weiterentwicklung des Tiroler Tourismus ist es, einerseits Strukturen, die sich bereits seit langer Zeit bewähren, zu erhalten und andererseits Herausforderungen wie den Klimawandel als nachhaltige Chance zu sehen. Auf diesem Weg lassen wir die Tiroler Tourismusbetriebe nicht alleine: Im Rahmen der Tiroler Tourismusförderung, die Teil der Tiroler Wirtschaftsförderung ist und mit Anfang Februar dieses Jahres neu aufgelegt wurde, unterstützen wir die Tiroler Betriebe in vielen Bereichen – darunter beispielsweise auch bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit.
Ich bin mir sicher – der Tiroler Tourismus ist zukunftsfit und wird auch künftig eine tragende Säule der Tiroler Wirtschaft bleiben.

AM TIROLER WEG IN
DIE ZUKUNFT
Der abgelaufene Winter hat mit einer soliden Bilanz geendet. Sowohl die Gästezahlen als auch jene der Nächtigungen lagen nur wenige Prozent unter den Werten der Vorcoronazeit. Und die Aussichten für den Sommer nähren ebenfalls Zuversicht. Also weiter wie bisher? Mitnichten. Die zufriedenstellende Auswertung und Prognose entlang quantitativer Kennzahlen können die qualitativen Diskussionen rund um den Tourismus nicht überdecken. Im Herbst gab es Debatten, ob touristische Angebote aufgrund der Energiesituation zurückgefahren werden müssen. Dann folgte eine Saison mit wenig Naturschnee, die einen umfassenden Diskurs lostrat. Insbesondere die Frage, ob Tirols Wintertourismus Zukunft hat, war omnipräsent. Derzeit beschäftigen uns der Mehrbedarf an Arbeitskräften und die Teuerung. Aber egal, welches Thema gerade aktuell ist, meine Antwort ist immer d ie gleiche: Tirols Tourismus hat in seiner weit mehr als hundertjährigen Geschichte immer wieder bewiesen, dass er mit Herausforderungen umgehen kann und diese erfolgreich meistert. So auch diesmal. Nicht umsonst sind wir das führende Urlaubsland in den Alpen .
Das Bild, das in der Öffentlichkeit gerne von unserer Branche gezeichnet wird, dass wir stur am immer Gleichen festhalten, stimmt so nicht. Es wäre auch fatal, wenn wir nach einem „business as usual“ streben würden. Der Veränderungsprozess ist schon längst in Gang. Unsere Branche investiert seit Jahren in Ausbau und Ausweitung von Angeboten, um die Entwicklung hin zu einem Ganzjahrestourismus zu lenken und sich breit, stabil und oftmals wetterunabhängig aufzustellen.
A ngesichts massiver Veränderungen – Stichwort Klima, Stichwort Demografie und noch viele mehr –darf es keine Denkverbote geben. Wir müssen den Mut

haben, neue Wege zu gehen. Mit der Tourismusstrategie „Tiroler Weg“ haben wir eine entsprechende Richtschnur. Die Tirol Werbung ist dabei in einer führenden Rolle, um Ziele und Maßnahmen dieser Strategie auf den Boden zu bringen. Dafür haben wir das Unternehmen in den vergangenen Monaten strategisch neu ausgerichtet und strukturell neu aufgestellt – unter anderem mit einem Future Lab oder einem Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit.
Eines ist in diesem Zusammenhang aber auch klar: Das schaffen wir nicht allein. Die vielfältigen Herausforderungen können wir nur gemeinsam als Branche bewältigen. Zukunftsfähigkeit ist vor allem auch eine Frage der Kooperation.

10 WOHNUNGEN
2 bis 4 Zimmer


NACHHALTIGES ENERGIEVERSORGUNGSKONZEPT Grundwasserwärmepumpe
10 TIEFGARAGENPLÄTZE JETZT IM VERKAUF Fertigstellung Ende 2023
ERST IST DA NICHTS, DANN EIN ZUHAUSE.
BAUGRUND GESUCHT.
Wahre Werte – gebaut aus Überzeugung. Wir sind ein österreichischer Bauträger, der hochwertigen Wohnbau für Generationen realisiert. Für zukünftige Projekte in Wien und Tirol sind wir auf der Suche nach passenden Liegenschaften – bebaut oder unbebaut.


AKTUELLER DENN JE

Noch lebhaft vor unserem inneren
Auge steht Tobias Moretti anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums der Tirol
Werbung auf dem Podium in Erl.
Mit seiner Rede „Wann isch genug genug“ warf er einen kritischen Blick auf den touristischen Wandlungs- und Identitätsprozess in Tirol.
Neun Jahre sind seither vergangen: Wie und was hat sich seitdem verändert? Fünf Akteur:innen aus dem Tiroler Tourismus ziehen ihr persönliches Resümee.
WANN ISCH GENUG GENUG? UND: WANN ISCH OANS MEHR ALS KOANS ?
Wenn selbst ein Peter Habeler als eine der Bergsteiger-Persönlichkeiten des Jahrhunderts gemeint hat, dass er schlichtweg Angst hat, wenn er in unsere Zukunft schaut hier in Tirol, hat mich das sehr bewegt. Das hat sicher weniger damit zu tun, dass er ein ängstlicher Mensch wäre, sondern wohl eher damit, dass ein besonnener Mensch vielleicht eigentlicher in die Zukunft schaut.
Ich habe auch weder Angst vor der Google-Brille noch vor den Selfies noch vor sonstigen Innovationen. Nur wenn man, was die Brille betrifft, von Demokratisierung der Wahrnehmung spricht, dann weiß ich, dass die zukünftige Wahrnehmung sicher die von sich selbst ist und nicht die der Eindrücke dieses Landes.
Ich bin beeindruckt von der Gesamtleistung und von allem, was die Touristologie da so alles durchanalysiert hat, alles digital und technisch top aufgestellt, alles einbindet. Sie hat also den Schwung der Zeit mitgenommen. Kann nur sein, dass der Touristiker sich damit grad selber abschafft, weil es ihn nimmer braucht.
E s ehrt mich sehr, dass Joe Margreiter mich gebeten hat, zur 125-Jahr-Feier der Tourismuswerbung in Tirol im Festspielhaus Erl etwas zu sagen. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso weniger fiel mir ein. Denn dazu ist der Tourismus

mittlerweile ein zu komplexes Fachgebiet mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Wozu ich eigentlich Lust gehabt hätte, wenn man das hier alles so hört und sieht, Qualitätstourismus, Hochglanz alles (und die Menschen hier bemühen sich ja wirklich sehr darum), wäre ein kleiner Dokumentarfilm à la Ulli Seidl gewesen: nur 15 Minuten, über lautere kreative Absichten – und das, was dann als Realität dabei herauskommt. Eine Gegenüberstellung.
ALMHÜTTEN UND PALÄSTE
Ich bin kein Touristiker, ich kenne mich damit nicht aus, finde aber all diese Strategien auch überzeichnet: Destinationsmanagement, Innen-Marketing, Außen-Marketing oder all diese Wortungetüme wie Markenidentität, an sich schon ein abstruser Begriff. Ich sehe nur, dass die Panorama-Paläste auf den Gipfeln, in denen sich die Touristiker, die Gemeinderäte, die Bürgermeister und Architekten verewigen, leer sind und man in den kleineren gemütlichen Hütten nie einen Platz kriegt, weil alle hinwollen.
Ja, Markenidentität – was heißt denn das? Was ich kenne, ist „Identität“, also erst einmal ohne Marke: Identität als Prägung des Seins durch die Kultur, durch die Menschen, durch die Landschaft, die einen hervorgebracht haben. Diese Prägung ist für mich selbstverständlich, also nicht aus einer Konstruktion heraus, sondern sie ergibt sich von allein, aus der Lebenswirklichkeit, wie bei den meisten hier, die nicht nur im ländlichen Raum leben, sondern mit ihm leben – und auch von ihm leben.
Dass mich das Thema „Identität“ in diesem Zusammenhang nicht loslässt, hat ja auch damit zu tun, dass sich der Tourismus immer, auch in der modernen Vermarktung, auf das bäuerliche Umfeld und die bäuerliche Prägung beruft: starkes Land, starke Menschen, kantige Menschen, Eigenheiten. Aber gleichzeitig distanziert er sich in seiner Verspreizung und weicht diese Eigenheit wieder auf. Das kommt davon, wenn man Markenidentität mit Identität verwechselt.
Eigenheit erzeugt immer die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Und der
Reiz des Reisens lag und liegt bis heute in der Begegnung mit der jeweiligen Eigenheit des Anderen, anderen Regionen, anderer Gegend, anderem Klima, anderen Kulturen – aber immer in der Authentizität des Anderen.
Zu Zeiten von Sepp Schluiferer im Jahr 1907 hatte das Tirolische noch seinen „exotischen“ Reiz, fern von Europa, für Preußen, Rheinländer und sonstige, und der einzelne Tiroler (damals noch nicht kollektiv im Verband auf Marketing programmiert) verstand es, diese Exotik in einer Art individuellem Marketing ökonomisch und für Eroberungen aller Art zu nutzen. Als „jottvoll ursprüngliche Menschen“ sind wir heute nicht mehr glaubwürdig zu vermarkten. Als wir vor 25 Jahren die Piefke-Saga gemacht haben, haben alle, die Touristen und die Tourismus-Arbeiter, sich damit identifiziert. Die Touristiker nicht: Die fühlten sich offiziell in ihrer Existenz so bedroht und so gefährdet, dass der Andreas Braun damals kurz vor seiner noch vorzeitigeren Abwahl stand.
Welcher Tourist sucht was? Es gibt ja kein einheitliches Bild mehr. Es gibt nach wie vor Gäste, die suchen hier etwas, was sie zuhause nicht haben: eine Kongruenz, eine Übereinstimmung zwischen der Lebenswelt – der Landschaft, der Kultur – und ihren Bewohnern. Diese Übereinstimmung ist nichts anderes als Authentizität.
EIN DIENER SEINER HERREN
Zu diesem Traditionsmodell des Gastes kommen aber ganz andere Schichten: Die jungen „User“, die, obwohl sie sich nicht auskennen, auch im alpinen Bereich Anspruch auf ihre Gaudi haben wollen, alle Ressourcen gnadenlos ausnutzen, ohne Rücksicht auf Verluste, und das gleich posten; und da setzen wir auch nichts dagegen, sondern warten erst einmal ab. Dann haben wir die Russen, die ihr Hauptinteresse auf die Exklusivität des Standorts legen. Gut ist nur, was teuer ist. Und die Versuchung angesichts dessen, was da im Lande bleibt, ist riesig. Und wir verbiegen uns bis in alle Windungen hinein. Mit einem Bein sind wir traditionell, mit dem anderen hip, mit dem
dritten ein lächelnder Diener seiner Herren. E s ist mir schon klar, dass sich der Tourismus hat verändern müssen, dass das Marketing sich vor der Kurzfristigkeit und dem rasanten Lebenstempo seiner Zielgruppen nicht verschließen kann: Heute entscheidet einer am Mittwoch, wo er am Freitag sein will, will dort aber gleich wieder weg, sobald die Selfies geschossen und gepostet sind. Ich kann und will die Flüchtigkeit, die Kurzlebigkeit und die Geschwindigkeit der neoliberalisierten Welt weder ignorieren noch sonst was, aber eines muss einem klar sein: Wenn man sich ihr immer unterordnet, ihr keinen Standpunkt entgegensetzt, ihr immer hinterherhinkt (immer noch was mitnehmend), dann wird unsere Identität, die gewachsene Lebenswelt, aussterben. Und dann wird’s schwierig, den Friedhof zu vermarkten.
NORDKETTE ÜBERLEBT MARKE
T irol ist ein starkes Land, mit hoffentlich noch mutigen und nicht zu biegsamen Menschen. Ein Land, das schon da war, ehe es als Marke definiert wurde. Und dieses Land wird es noch geben, wenn alle Werbekonzepte längst Geschichte sind. Es spricht zumindest geologisch einiges dafür, dass die Nordkette eine höhere erdgeschichtliche Lebenserwartung hat als die Markenstrategie.
Tourismus ist in unserem Lande zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor geworden. Und so wie unser gesamtes globalisiertes Wirtschaftssystem, huldigt er dem Dogma grenzenlosen Wachstums: mehr an Nächtigungen, mehr an Aktivitäten etc.
I n diesem Denkmuster aus dem 19. Jahrhundert, dass alles immer mehr werden muss, ist jeder von uns, ob er will oder nicht, immer noch verhaftet. Die meisten ziehen daraus auch ihre Existenzberechtigung, ihre Lebensleistung. Aber: Dieses Land, unsere Ressource, unser Lebensraum – wird nicht mehr. Wenn wir ihn dauerhaft erhalten wollen, und zwar auch als Wirtschaftsfaktor, müssen wir uns genau zwei Fragen stellen, die in diesem Muster nicht vorgesehen sind: Wann isch genug genug? Und: Wann isch oans mehr als koans?
GEDANKEN ZUR REDE
Benjamin Parth
Haubenkoch im Gourmetrestaurant Stüva in Ischgl
Die Rede von Tobias Moretti in Erl ist fast zehn Jahre her. Nichts davon ist alt. Vieles davon berührt, wirkt zeitlos, klingt aktuell, als wäre sie eben erst verfasst worden. Angesprochen sind grundsätzliche Fragen rund um unsere Identität, Qualität und das permanente Streben nach Mehr. Das liest sich heute vielleicht auch deshalb so modern, weil die damalige Kernfrage die gegenwärtige gesamtgesellschaftliche Stimmungslage nicht erst seit dem Auftauchen der Klimakleber:innen fast prophetisch, jedenfalls aber pointiert auf den Punkt bringt: „Wann isch genug genug?“

Ein stures Weitermachen wie bisher ist angesichts der großen
Umbrüche in keiner Branche möglich –auch nicht im Tiroler Tourismus. Und doch bleiben grundsätzliche Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen gleich. Je schneller sich das Rad der digitalen Innovationen dreht, künstliche Intelligenzen unser Leben zu dominieren beginnen, desto mehr wollen wir den Ausgleich, die Flucht aus dem Alltag, die Stille der Natur, aber auch die Ausgelassenheit unter Freun d:innen
Welchen Wert haben Veränderungen, welchen Werten bleiben wir dabei treu?
Wer Spitzengastronomie betreibt, muss eindeutige Antworten finden: Seine Herkunft kennen, aber nicht gefangen sein in Traditionen. Seinen
Standpunkt definieren, dennoch weltoffen sein, seine einzigartige kulinarische Sprache entwickeln und mit Qualität überzeugen. Wer diesen Weg gefällig gehen will, um es allen recht zu machen, huldigt vordergründig dem Streben nach Wachstum. Wer seine kantige Eigenart hingegen zeitgemäß kultiviert, kann nie alle begeistern – die wenigeren aber mit Sicherheit überzeugender.
Die Hassliebe der Tiroler:innen zum Tourismus ist immer noch salonfähig. Unser prominentester Wirtschaftszweig bietet viel Stoff für Lob, Tadel und Drehbücher. Und doch: Zwischen 2014 und jetzt hat sich krisenbedingt viel getan. Ungeschriebene Gesetze und Dogmen der Branche wie: „Kein Ruhetag möglich!“, „Immer verfügbar sein!“, „Mehr ist mehr!“, „Ein Schnitzel muss aus Fleisch sein!“ , können von heute auf morgen sehr wohl über Bord geworfen werden. Weil es auch anders geht. Und weil es trotzdem weitergeht.
Als Mutter von vier Kindern und Touristikerin habe ich mich nach meinem Studium bewusst für die Hotellerie entschieden. Entgegen von Vorurteilen sehe ich in dieser Branche eine gute
Vereinbarkeit von beiden Lebensbereichen. Dass ich hierfür einen Betrieb in der Innenstadt von Innsbruck übernehmen durfte, war Glück. Dass ich es geschafft habe, die Betriebsleistung zu vergrößer n, war eine Kombination aus Fleiß, Geschick und vor allem der Liebe zu meinem Beruf. Tagtäglich treffe ich auf Menschen aus aller Welt und darf ihnen ein Stück Heimat in der Ferne sein. Gelebte Gastfreundschaft ist (m)eine Existenzgrundlage. Funktionierender Tourismus ist Basis für viel Wohlstand und Gelungenes im Erlebensraum Tirol. Egal welcher Branche zugehörig: Wir sitzen alle im selben Boot. Dass man auf ein persönlich und mit einem Lächeln serviertes (veganes) Schnitzel heute sogar noch etwas
Katharina Schnitzer-Zach

Obmann Stellvertreterin des Innsbruck Tourismus und Gastgeberin im Hotel Zach
länger warten muss, daran werden sich Einheimische und Tourist:innen noch mehr gewöhnen müssen. Aufrichtige Servicebereitschaft gegenüber dem Gast, glaube ich, wird der wahre Luxus im Tourismus. Eine Gesellschaft, in der Wohlstand und Wohlbefinden auf Augenhöhe gestellt sind, hat Schwierigkeiten, genügend leistungsbereite Mitarbeiter:innen zu finden. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die im Tourismus Beschäftigten wieder stolzer sind auf das, was sie können, was sie leisten und an Beitrag zum Wohlgefühl der Gäste und Wohlstand der Gesellschaft beitragen.
Ich kann mich noch gut erinnern –damal s, bei der 125JahrFeier in Erl, saß ich im Publikum. Alle waren freudig gestimmt und stolz darauf, was Tirol im Tourismus erreicht hat. Wir haben uns selbst gefeiert, uns (gegenseitig) auf die Schulter geklopft und uns bestätigt, wie großartig wir das Land Tirol positioniert haben. Als Spitzenreiter, Modellregion, Tourismushochburg.
Dann kam Tobias Moretti auf die Bühne. Er mahnte uns, kritisierte genau jene Details, die wir Touristiker:innen immer so gerne mit Klischees und bester Werbung zu übertünchen versuchen. Schon damals sprach er vom Dogma
Michaela Gasser-Mark
Unternehmensberaterin und ehemalige Geschäftsführerin beim TVB Tiroler Oberland
des grenzenlosen Wachstums und stellte die Frage: „Wann ist genug genug?“ Wer hätte gedacht, dass es fast ein Jahrzehnt dauern würde, bis seine Worte auch von namhaften Touristiker:innen endlich in den Mund genommen werden? Wir sprechen heute vom wertvollen Lebensraum. Die Tirol Werbung muss sich unter anderem um Tourismusgesinnung und Fachkräftemangel kümmern. Einige Destinationen sehen endlich die Chance, das Ruder herumzureißen und umsichtig zu handeln. Auch wenn wir das „Unwort“ schon fast nicht mehr hören können, geht es doch tagtäglich um eine nachhalti
ge(re) Ausrichtung. Heute frage ich: Wann ändern wir unser „Sovielwiemöglich“ in ein „So vielwienötig“?
Gut möglich, dass es noch ein paar Tobias Morettis braucht, die uns den Spiegel vorhalten. Aber jetzt ist definitiv nicht mehr die Zeit, dagegen zu halten, massive Probleme kleinzureden und ständig polternd auf den Tisch zu hauen. Wir müssen demütiger werden und uns wieder darauf besinnen, warum wir eines der gastfreundlichsten Länder dieser Erde sind. Weil wir es gerne sind und weil wir unseren Lebensraum zu schätzen wissen!

Einen Kommentar zu einer Rede abzugeben, die vor neun Jahren gehalten wurde, ist eine spannende Aufgabenstellun g, und dass ich mich tatsächlich noch gut an die Rede von Tobias Moretti im Rahmen der 125JahrFeier der Tirol Werbung erinnere, zeugt von der Qualität der Rede und des Redners. „Wann ist genug genu g? Und: Wann ist oans mehr als koans? “ ist mir wörtlich in Erinnerung geblieben.

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Tourismus ist in Tirol fast schon so alt wie der Tourismus selbst. Die richtige Balance zwischen Lebens , Natur und Wirtschaftsraum zu finden ist ein an
haltender Prozess. Meiner Meinung
nach könnte die Diskussion versachlicht werden, denn die wesentlichen Skigebietserschließungen fanden in Tirol in den 1970er , 1980er und 1990erJahren statt und es gibt nicht mehr viele Akteur:innen im Tourismus, die ein quantitatives Wachstum anstreben. Die touristisch finanzierten Infrastrukturen von den Seilbahnen über gut ausgebaute Rad und Wanderwegenetze bis hin zu den Bädern und dem öffentlichen Nahverkehr sind auch für die Einheimischen ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Freizeitgestaltung. Der romantisierende Blick zurück auf Tirol in der Nachkriegs
zeit lässt die bittere Armut außer Acht, die damals in vielen Tälern geherrscht hat. Hier war der Tourismus tatsächlich eine einmalige Chance, um die ländlichen Regionen wirtschaftlich und strukturell zu entwickeln. Auf die volkswirtschaftliche Frage, ob marktwirtschaftliche Systeme auf ständiges Wachstum angewiesen sind und die ständig steigenden Steuereinnahmen aus der Wirtschaft benötigt werden, um das ebenfalls stetig wachsende Sozial , Bildungs und Gesundheitssystem zu finanzieren, gibt es meines Wissens keine einfache Antwort. Ich bin der Meinung, der Tiroler Tourismus ist besser als sein Ruf. Die Unternehmen sind klein strukturiert und regional verankert. Der Wirtschaftszweig ist relativ ressourcenschonend und die CO2Bilanz fällt im Vergleich zu anderen Destinationen aufgrund der durch
Klier der Wintersport Tirol AG & CO Stubaier Bergbahnen KGschnittlich kürzeren Anreisedistanz weniger negativ aus. Aber natürlich gibt es auch Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen . Attraktivere Arbeitsbedingungen für einheimische Mitarbeiter:innen, emissionsarme Alternativen für die Anreise, eine offene Diskussionskultur zu den Vor und Nachteilen für die einheimische Bevölkerun g, und um wieder konkret auf die Rede von Tobias Moretti zurückzukommen: Wir müssen sicher nicht jedem Marketingtrend hinterherlaufen, aber die Marke Tirol, die nicht an die Stelle unserer Identität tritt, sondern auf dieser aufbaut, selbstbewusst und modern weiterentwickeln. Ich bin davon überzeugt, dass eine Gesellschaft, die keine Weiterentwicklung mehr zulässt, sich nur noch um die Bewahrung des Vorhandenen sorgt und jeder neuen Idee negativ gegenübertritt, in jeder Hinsicht verarmt.
Wann ist genug genug? “ , fragte Tobias Moretti die Festgäste zu 125 Jahre Tirol Werbung. Das war 2014 und doch sind viele Themen heute noch aktuell.
Tourismus bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Politik und öffentlicher Wahrnehmung. Das bleibt nicht konfliktfrei. Herr Moretti hat 2014 von Ausgewogenheit gesprochen, heute nennen wir es Nachhaltigkeit.


Die Tourismusindustrie trägt zum Wohlstand unseres Landes bei und in manchen ruralen Gegenden ist es eine der wenigen Optionen zur Landflucht. Gleichzeitig – wie in jeder Industrie – gibt es auch negative Externalitäten und wir sind angehalten,

diese anzuerkennen. Wenn wir den Tourismus in die Pflicht nehmen, sollten wir aber auch hinterfragen, wer denn DER Tourismus ist. Sind wir nicht alle regelmäßig Nutznießer:innen der touristischen Entwicklungen und selbst Tourist:innen? Und ist es nicht die Summe der Tiroler und Tirolerinnen, die den Tiroler Tourismus ausmachen?
Somit sind es am Ende wir selbst, die entscheiden, wie unser Lebensraum sich entwickelt. Und haben somit auch selbst die Freiheit, aber auch die Verantwortung, was damit passiert.
Ja, es sind herausfordernde Zeiten. Gerade deshalb braucht es für die touristischen Herausforderungen in unserem Land „realis tische Optimist:innen
Viktoria
Veider-Walser

Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus
Menschen, die daran glauben, dass die Dinge besser werden können, und selbst einen Beitrag leisten. Sowohl individuell als auch institutionell. Beim Realismus bleibend – der Tiroler Tourismus wird die Welt nicht allein retten können. Aber wir können unseren Beitrag leisten, im kollektiven Bemühen um ein gutes Leben in unserem Land. Moretti hat seine Rede mit der Angst begonnen. Heinz Zak ist gerade bei mir zu Besuch. Ob er Angst vor der Zukunft hätte, frage ich ihn. „Nein, hatte ich noch nie“ , meint er glaubhaft. Eine nachahmenswerte Einstellung.

Der neue vollelektrische



Jetzt bei uns
Gewerbliche Mobilität in einer neuen Dimension. Die Zukunft ist flexibel: Mit 3,9 Kubikmetern Ladevolumen holt der ID. Buzz Cargo alles aus seiner kompakten Grundfläche heraus. Gemeinsam mit der Schnellladefunktion und einem Wendekreis von nur 11,09 m bleibt Ihr Unternehmen damit auch in der Stadt flexibel.
Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 20,5–24,6; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 0. Symbolfoto.

NEUE VISION IM ALPENTOURISMUS

Zur Person: HARALD PECHLANER
hat an der Universität Innsbruck im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Tourismus habilitiert, er ist Professor für Tourismus an der Katholischen Universität EichstättIngolstadt sowie Leiter des Center for Advanced Studies von EURAC Research in Bozen. Derzeit ist er auch wissenschaftlicher Leiter am Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes in Berlin.
Der Tourismusexperte Harald Pechlaner ist überzeugt, dass es neue Erzählungen braucht, um die Begeisterung für Tourismus neu zu wecken, wir uns dem Ende der Wachstumsspirale nähern und erfolgreiche Tourismuspolitik vor allem auch soziale Komponenten berücksichtigen sollte. In der gegenwärtigen „Phase der Transformation“ erkennt Pechlaner viele Chancen für notwendige Korrekturen und Anpassungen.
Das Gespräch führten Stefan Kröll und Florian Neuner
und Diskussionen
In seiner mittlerweile legendären Erler-Rede zum 125-Jahr-Jubiläum der Tirol Werbung meinte Tirols Schauspielikone Tobias Moretti, dass die Tourismuswirtschaft immer noch dem Dogma grenzenlosen Wachstums huldige. Hat sich das angesichts der Nachhaltigkeitsdebatten und des Wertewandels verändert? HARALD PECHLANER : Wir sind immer noch in dieser Spirale. Ich glaube allerdings, dass wir in eine Phase der Transformation eingetreten sind. Die Debatten und Diskussionen deuten an, dass wir uns nicht mehr in einem klassischen Korridor des Wachstums befinden und gerade eine neue Vision für einen zukunftsfähigen Tourismus entsteht.
Hat das auch damit zu tun, dass sich die Wertehaltung der jungen Menschen geändert hat? Es sind jedenfalls mehrere Faktoren. Die Krisen, die auf globaler Ebene auf uns einwirken, spüren wir auf regionaler Ebene enorm. Etwa die Gesundheitskrise wie die Pandemie, aber auch die Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir schon 2008/09 erlebt
haben. Dann gibt es andere Verwerfungen, die wir anfangs nicht so schnell wahrgenommen haben, wie die demografische Krise – Stichwort Fachkräftemangel. Zudem haben wir eine Wertekrise. Das betrifft insbesondere die junge Generation, die mit anderen Überlegungen in die Zukunft blickt, wie es die Elterngeneration getan hat. Alt und Jung spüren, dass sich auch das Reisen verändert und mit einer neuen Vorstellung von Lebensqualität möglicherweise das eine oder andere passiert, das nicht wirklich zukunftsfähig ist.
Über die Zukunft des Alpentourismus gibt es hitzige Debatten. Ich bin überzeugt, dass der alpine Tourismus eine Zukunft hat. Ich bin aber auch überzeugt, dass sich der alpine Tourismus anpassen muss. Das hat vor allem mit der Tourismusintensität zu tun, die wir im Alpenraum erleben. Wir sind nun mal eine schöne Ecke in Europa und wir sind deshalb auch begehrt. Wir spüren, dass sich da die Dinge auch ändern müssen, wenn etwa die Lebenswelt der einheimischen Bevölkerung in touristisch attraktiven Regionen immer teurer wird. Ein weiterer Hinweis ist sicherlich auch die Mobilitätsfrage. Die großen Verbindungen zwischen Nord und Süd laufen durch den Alpenraum. Das zehrt auch an der Akzeptanz gegenüber dem Tourismus. Es sind einfach immer weniger Menschen, die unmittelbar vom Tourismus leben. Und das hat auch etwas mit Akzeptanz oder mit dem Wegbrechen von Akzeptanz zu tun.
„Die Debatten
deuten an, dass wir uns nicht mehr in einem klassischen Korridor des Wachstums befinden und gerade eine neue Vision für einen zukunftsfähigen Tourismus entsteht.“
HARALD PECHLANER
Gibt es in Bezug auf Akzeptanz positive Ansätze? In Südtirol – wie auch in anderen Alpenregionen – versucht man, das quantitative Wachstum zu verlangsamen. Dazu gibt es jetzt auch Gesetze, Regelungen, die durchaus in das quantitative Wachstum einschneidend einwirken. Ein anderer Versuch sind Besucherlenkungssysteme, bei denen wir erst am Anfang stehen. Das Dritte sind Einschränkungen im Mobilitätsbereich. Hier hat nicht zuletzt auch Tirol versucht, im Rahmen der „Korridorisierung“ die Gäste auf Kurs bzw. auf der Autobahn zu halten. Die Krise, die ich bisher noch nicht genannt habe, ist die Klimakrise. Sie zwingt uns, gerade im Bereich der Mobilität nach neuen Lösungen zu suchen. Hier brauchen wir große Lösungen, die nur grenzüberschreitend erfolgen können.
Wie können Lösungen konkret aussehen? Ich sehe etwa technologische Entwicklungen mit alternativen Antrieben oder den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Aber ich bin auch Realist. Gerade im ländlichen Raum wird es nicht gelingen, die große Masse an Menschen mit dem öffentlichen Personennahverkehr von den zentralen Knotenpunkten verteilen zu können. Ich sehe uns daher auch in eine Phase eines normativen Tourismus eintreten, denn es wird zunehmend Verbote und Gebote geben. Letzthin hat man etwa in Portofino weitreichende Maßnahmen gesetzt. Die Leute werden
zunehmend in Korridore gelenkt und angehalten, sich nach bestimmten Mustern zu verhalten. Das heißt, es wird nicht mehr jedem möglich sein, wann auch immer man möchte, einen Ort zu besuchen.
Mit Blickrichtung Zukunft und vor dem Hintergrund des Klimawandels, wie wird sich das alpine Angebot im Sommer wie im Winter verändern? Ich bin der Ansicht, dass es Wintertourismus weiterhin geben wird. Dieser wird sich aber räumlich verlagern. Wenn wir jetzt den klassischen Wintersport betrachten, denke ich, dass es zu einer Verbreiterung und Diversifizierung des Angebots kommen wird. Das wird bestehende Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten belasten, weil es relativ einfach war zu sagen: „Hier haben wir Aufstiegsanlagen und jetzt braucht es noch Beherbergungsunternehmen oder umgekehrt.“ Die Geschäftsmodelle werden schwieriger werden, die Angebote vielfältiger. Das bedeutet, dass ich mir künftig sehr gut überlegen muss, welches Produkt in Zukunft noch welche Wertschöpfung bringen kann.
Ist das Werben um Arbeitskräfte mittlerweile vielleicht wichtiger als das Werben um Gäste? Ja, das könnte man durchaus sagen. Ich glaube allerdings, dass wir es uns im Tourismus zu einfach machen. Einfach nur zu sagen, wir haben jetzt einen dramatischen Arbeitskräftemangel, ist zu wenig. Das zentrale Narrativ im Alpenraum und damit auch in Tirol heißt bis heute: Der Tourismus hat Wohlstand ins Land gebracht. Nur, diese Erzählung findet bei jungen Menschen keinen Anklang mehr. Es bringt heute keinen Menschen mehr dazu, sich für die Idee zu begeistern, dass man in einem People Business, wie es der Tourismus ist, auch unglaublich schöne Arbeitserfahrungen machen kann. Es ist uns nicht gelungen, den jungen Menschen über neue Erzählungen die Zukunft des Tourismus und die Sinnhaftigkeit von Tourismus zu erklären.
Wie schaffen wir es dann, die Begeisterung wieder zu steigern, die Tourismusgesinnung zu heben? Ich glaube, dass der Tourismus seine Grenzen erreicht hat und dass das größte Problem des Alpenraums tatsächlich die
„Wer Tourismuspolitik macht, muss eigentlich auch Sozialpolitik machen und nicht nur Wirtschaftspolitik.“
HARALD PECHLANER
Tourismusgesinnung und die Akzeptanz darstellen, die uns wegzubrechen drohen. Deswegen ist es notwendig, das Ganze mit Fragen der Lebenswelten der Einheimischen stärker zu verknüpfen. Das sind Fragen, die betreffen, ganz simpel gesagt, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung, beispielsweise den Wohnraum. Wir müssen erkennen, dass der Tourismus eigentlich vor allem auch eine Sozialpolitik erfordert. Zugespitzt könnte man sagen: Wer Tourismuspolitik macht, muss eigentlich auch Sozialpolitik machen und nicht nur Wirtschaftspolitik.

Blickt man in die Tourismusgeschichte, so war diese geprägt von Pionier:innen der Erschließung bzw. der Infrastruktur. Welche Pionier:innen braucht es in der gegenwärtigen Phase? Ich glaube, wir sind uns alle einig. Die Pionier:innen waren die Menschen, die die Unternehmen aufgebaut haben und tatsächlich Wohlstand in die Täler und Regionen gebracht
haben. Jetzt hat sich die Welt aber verändert, und die Pionier:innen, die wir heute brauchen, sind sicherlich jene der Vernetzung. Gemeint sind aber nicht Pionier:innen der Vernetzung, die mit Lobbyismus Interessen gegenüber einer Bevölkerung durchsetzen, die mit dem Tourismus nicht viel am Hut hat. Vielmehr braucht es Pionier:innen der Vernetzung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, völlig egal, ob sie mit dem Tourismus zu tun haben oder nicht. Das Thema „Nachhaltigkeit“ u mfassender zu verstehen, wäre auch eine Pionierleistung, die vor allem auf unternehmerischer Ebene gefragt sein wird. Wir sehen in vielen Regionen im Alpenraum sehr gute Beispiele, wie einzelne Unternehmer:innen das Thema in die Hand nehmen und ein gesamthaftes Angebot schaffen, für das die Menschen im Übrigen auch bereit sind, mehr zu zahlen.
MOBILITÄT

Mobilität ist eine Herausforderung, die Tirol besonders trifft – wegen seiner geografischen Struktur und Lage. Und weil Reisen ein Kernaspekt der hiesigen Wirtschaft ist. Dahingehend wurde bereits viel geleistet. Aber es gibt auch noch viel zu tun.

NICHT EGAL,
„TOURISTIKER:INNEN IST ES JA WIE GÄSTE ANREISEN“

Zur Person:
MARKUS MAILER
Arbeitsbereichsleiter für intelligente Verkehrssysteme am Institut für Infrastruktur der Universität Innsbruck, wo er zudem als Mitglied des Forschungszentrums Tourismus und Freizeit tätig ist.
Wie ist die Tiroler Infrastruktur im öffentlichen Verkehr aufgestellt? MARKUS MAILER: Die Raumstruktur in Tirol ist für den öffentlichen Verkehr eigentlich vorteilhaft. Täler bieten immer die Möglichkeit, sie gut mit Linien zu erschließen – und das sehr kompakt. Nur rund zwölf Prozent der Landesfläche sind besiedelbar. Deswegen lebt ein Großteil der Menschen hier gebündelt auf sehr engem Raum. Und das ist für den ÖV immer gut. Dann geht es aber natürlich auch immer um das Angebot, also wie dicht der Fahrplan ist zum Beispiel. Auch da stehen wir recht gut da. Aber es kann natürlich noch besser werden. Dazu kommen Lagen, die nicht so dicht besiedelt oder schwer zu erschließen sind. Da versucht man mancherorts, wie in der Region Wattens, mit dem Regioflink gerade neue Lösungen.
Darf, kann und muss öffentlicher Verkehr rentabel sein? ÖV ist normalerweise eine Aufgabe, die die öffentliche Hand per Gesetz übernimmt. Früher war das die Daseinsgrundversorgung. Aber er sollte deutlich mehr sein als eine Versorgung für Menschen, die keine andere Möglichkeit haben. Es braucht ein Angebot, das auch für jene attraktiv ist, die wahlfrei sind. So entsteht eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Und dieser deckt seine Kosten ja auch nicht selbst ab – weder was die Infrastruktur noch was den Raumanspruch oder die Umweltfolgekosten betrifft. Aber diese Kosten sind in keiner Bilanz direkt zu sehen. In Wirklichkeit haben wir also zwei unrentable Systeme. Nur ist der ÖV aus Nachhaltigkeits-, aus Klima- und Energie -
perspektive heraus effizienter. Und dementsprechend ergibt es auch Sinn, dorthin zu investieren, um ihn qualitativ hochwertig und attraktiver zu machen.
Also geht es um Überzeugungsarbeit? Genau. Eine Dienstleistung wird dann geschätzt, wenn die Qualität passt. Es gibt oft die Frage, ob ÖV mehr genutzt wird, wenn er gratis ist. Da würde ich sagen: Das macht ihn noch unrentabler und senkt die Qualität, was geringere Kundenzufriedenheit zur Folge hat. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Ein gutes Dienstleistungsangebot darf auch etwas kosten. Das sind dann Euros, die wir in die Qualität, in das Angebot und auch in die Dekarbonisierung stecken können. Qualität kostet einfach. Eine gewisse Nutzerfinanzierung sollte es schon geben – aber das Resultat muss auch den Nutzer:innen zugutekommen.
Und wer ist in der Pflicht, für die restliche Finanzierung zu sorgen? Das ist zum einen die öffentliche Hand. Und zum anderen auch der Tourismus, der das ja schon tut. Tourismusbetriebe und Bergbahnen haben ja durchaus ein Bewusstsein, welche Leistung der ÖV bringt und welchen Stellenwert er hat. Und sie finanzieren ihn auch entsprechend mit. Es ist ja auch nicht so, dass das Angebot für die Gäste kostenlos wäre. Nur sind diese Beiträge oft versteckt. Und von der damit einhergehenden Erweiterung des Angebots profitieren auch die Einheimischen. Man nehme das Ötztal, wo in der Saison ein Zehn-Minuten-Takt existiert, der vergleichbar mit dem in Städten ist. Das ist auf den Tourismus zurückzuführen, hilft
Markus Mailer beschäftigt sich an der Universität Innsbruck mit der Entwicklung und Planung intelligenter Verkehrssysteme. Wo die Probleme spezifisch in Tirol liegen, welche Lösungsansätze es gibt und warum öffentlicher Verkehr nicht rentabel sein muss, verrät er im Interview.Das Gespräch führte Daniel Feichtner
aber auch den Einheimischen. Und die muss man da auch entsprechend ins Boot holen.
Und wie steht es um die viel zitierte letzte Meile? Wer ist hier zuständig? Die kann, denke ich, durchaus von beiden Seiten geschlossen werden. Zum einen ist es den Touristiker:innen ja nicht egal, wie Gäste anreisen. Man versteht inzwischen schon, dass eine Reise als Gesamterlebnis gesehen werden muss, das mit der Überlegung beginnt, wie man anreist, wie man sich vor Ort bewegt, aber auch, wie zum Beispiel mit dem Gepäck verfahren wird. Und umgekehrt muss sich natürlich auch die ÖBB Gedanken machen, wie die Gäste mit der Bahn zum Ziel kommen. Wobei das ja nicht mit der letzten Meile beginnt, sondern schon mit der ersten – und mit jedem Umstieg unterwegs. Erst wenn all diese Lücken geschlossen sind, gewinne ich als Bahnanbieter neue Kund:innen.
Für die Hoteliers – oder auch für eine Tourismusregion – ist das aber keine unlösbare Aufgabe, zum Beispiel ein Bahnhofsshuttle anzubieten. Aber es reicht auch noch nicht, wenn die Anreise lückenlos geschlossen ist und die Gäste dann zwar im Hotel sind, von dort aus aber keinen Bewegungsradius haben. Deswegen ist Mobilität immer ein Gesamtthema, das sich nicht segmentieren lässt – und bei dem alle am selben Strang ziehen müssen.
Sehen Sie beim Tiroler Verkehrsnetz noch Ausbaupotenziale? Das Tiroler Verkehrsnetz ist nicht wirklich ein Netz. Durch die Tälerstruktur verläuft hier alles gebündelt auf wenigen Achsen. Und dort überlagert sich der tägliche Verkehr der Einheimischen
mit dem Gästeverkehr. Das darf man nicht unterschätzen. Wir reden viel über die klassischen Reisetage. Aber wenn man 50 Millionen Übernachtungen herunterbricht, führt das dazu, dass im Schnitt 20 Prozent mehr Menschen in Tirol sind –und das natürlich nicht gleichmäßig, sondern mancherorts mit deutlich höherem Anteil. Wenn sich deren Mobilität dann mit der Einheimischenmobilität kombiniert, haben wir auch unter der Woche Probleme. Dazu kommt dann noch der lokale Güterverkehr sowie Lkw- und der Urlauber:innen-Transitverkehr. Und das alles auf denselben Netzen.
Diese Infrastruktur weiter auszubauen ist nur begrenzt möglich, wenn überhaupt. Viel wichtiger ist es, die Alternativen, die man bietet, klug zu wählen. Man kann den Verkehr wie kommunizierende Gefäße betrachten: Gelingt es, 10 oder 20 Prozent der Menschen ein Angebot zu machen, zu einem Zeitpunkt nicht am Straßenverkehr teilzunehmen, werden dort Kapazitäten frei. Das kann durch die Verlagerung auf die Schiene geschehen, aber auch durch Homeoffice-Regelungen. Man muss nicht das Verhalten aller ändern, aber man muss den begrenzten Raum, der zur Verfügung steht, effizient nutzen.
In welchem Verhältnis steht der touristische zum Transitverkehr? Rein nach Zahlen ist das ganz klar: Auf den sehr prominent diskutierten Lkw-Transit entfallen 2,5 Millionen Fahrten pro Jahr am Brenner. Dagegen stehen je 25 Millionen An- und Abreisen. Und da ist der Urlaubertransit Richtung Gardasee oder Meer noch nicht ink ludiert. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Auch wenn der Lkw-Transit von der Größenordnung her klein erscheint, ist seine Wirkung an bestimmten Tagen und in bestimmten Situationen enorm – auch was die Umweltfolgen betrifft. Dementsprechend ist es durchaus notwendig, da einzugreifen, besonders an Tagen, wo es Überlagerungen mit der Anund Abreise gibt.
Also wäre es ein Ansatz, Transit zugunsten des Tourismus einzuschränken? Der Transit ist immer der „böse Bube“. Denn Transitverkehr fließt per Definition immer durch, ohne Wertschöpfung zu hinterlassen. Das war früher anders, als hier übernachtet werden musste. Mittlerweile bleibt aber nur noch der Tanktourismus. Ansonsten hat Tirol alle Nach-, aber keine wirklichen Vorteile. Dementsprechend will man sich natürlich auf den Ziel- und Quellverkehr konzentrieren, bei dem man, wenn man schon die Folgen erleben muss, auch profitiert. Also wird es nötig sein, die negativen Auswirkungen im Rahmen zu halten, soweit das in einem europäischen Gemeinschaftsland überhaupt möglich ist. Denn was für Tirol Transit ist, ist aus EU-Sicht einfach Binnenverkehr. Und man darf nicht vergessen: Den höchsten Impact auf den Verkehr in Tirol haben immer noch die Einheimischen.
Ist es überhaupt möglich, das öffentliche Angebot so auszubauen, dass die vielen Stakeholder alle davon profitieren? Man kann kein einzelnes Angebot schaffen, das allen gerecht wird. Wenn es eine Wunderlösung gäbe, würde die überall angewandt werden. Stattdessen muss an vielen kleinen Rädern gedreht und ganz viele Puzzleteile kombiniert werden. Wir werden verschiedenste Angebotsbausteine finden müssen, die den unterschiedlichen Gruppen gerecht wer-
„Den höchsten Impact auf den Verkehr in Tirol haben immer noch die Einheimischen.“
MARKUS MAILER
den und die für eine gewisse Entzerrung sorgen. Die Probleme entstehen im Endeffekt ja dort, wo Belastungsgrenzen überschritten werden. Deswegen müssen dort, wo zum Beispiel Einheimische tagtäglich unterwegs sind, Alternativen entstehen. Aber die vielen Stakeholder sind natürlich eine besondere Herausforderung. Denn sie alle haben eine eigene Zielsetzung. Und diese müssen verstanden und so sortiert und angegangen werden, dass Zielkonflikte aufgelöst werden. Dann können auch Angebote geschaffen werden, die sich gegenseitig ergänzen.



Und wie wird sich der Individualverkehr weiterentwickeln? Man muss immer bedenken: Es gibt zwei Formen von Individualverkehr. Den motorisierten, von dem man in der Regel spricht. Aber auch Fußgänger:innen und Radfahrer:innen sind Individualverkehr. Wir werden es schaffen müssen,
in unseren Verkehrssystemen effizienter zu werden. Und da sind Radfahrer:innen und Fußgänger:innen die nachhaltigste Lösung, egal ob im Hinblick auf Umwelteinflüsse oder Flächen- und Energiebedarf. Der motorisierte Individualverkehr wird effizienter, wenn mehr Menschen ein Fahrzeug nutzen – womit wir schnell beim Bus sind. Kurz gesagt, darf der individuelle Verkehr – mit dem Rad oder zu Fuß – gerne zunehmen, während der Autoverkehr reduziert werden muss.
Um das zu erreichen, brauchen wir nicht zuletzt bessere Grundvoraussetzungen für die effizienten Alternativen. Und das wird nicht einfach. Das System, das wir heute haben, ist über Jahrzehnte gewachsen. Wir bauen unsere Städte seit der Nachkriegszeit autogerecht. Um das jetzt rückgängig zu machen, müssen wir mit ähnlicher Konsequenz handeln – aber deutlich schneller.
„Deswegen müssen dort, wo zum Beispiel Einheimische tagtäglich unterwegs sind, Alternativen entstehen.“MARKUS MAILER
EIN THEMA FÜR ALLE
Tirol macht bereits so manches richtig, was touristische Mobilität angeht. Doch sowohl im Großen als auch im Kleinen gibt es noch viel Verbesserungsbedarf.

Verkehr ist Grundvoraussetzung für wirtschaftliches Wachstum – egal ob es um den Transport von Waren oder die Mobilität von Menschen geht. Entsprechend privilegiert ist Tirol seit jeher mit seiner Lage an einer transeuropäischen Verkehrsachse. Zumindest in der Theorie. Doch mittlerweile entwickelt sich diese Situation zusehends zum Nachteil. „Insbesondere wenn starke Einheimischenmobilität auf Gäste-An- und -Abreise sowie Personen- und Dienstleistungstransit trifft“, meint Patricio Hetfleisch, Bereichsleiter für Marketing und Kommunikation der Tirol Werbung. Er setzt sich mit der Thematik im Projekt „Customer Centric Mobility“ auseinander, das im Rahmen des Tiroler Tourismusdialogs den Status quo erheben, die Kernproblematiken erörtern und Empfehlungen abgeben soll.

AUTO-ZENTRIERT
„Unsere Erreichbarkeit ist Fluch und Segen“, attestiert er. „Besonders im Hinblick auf deutsche Gäste, unser traditionell wichtigstes Marktsegment.“ Denn diese wissen nicht nur die Nähe zu schätzen. Sie reisen auch besonders gerne individuell an. Alleine sind sie damit nicht. Im Sommer kommen ganze 93 Prozent aller Urlauber:innen mit dem Auto nach Tirol. Mit entsprechenden Folgen für die Verkehrssituation. Dabei wäre das öffentliche Angebot gut, meint Hetfleisch – wenn auch noch nicht optimal. „Die verlässlichen Frequenzen im Halbstundentakt, die öffentliche Mobilitätsangebote gerade für Urlauber:innen richtig interessant machen, werden bei Weitem noch nicht in allen Regionen umgesetzt. Da gibt es noch einiges zu tun.“
ETABLIERTE KOMPETENZ
Dass es auch anders geht, beweist der Winter. Dann setzen „nur“ 83 Prozent aller Gäste auf das eigene Auto –und das, obwohl Winterurlauber:innen in der Regel mehr Gepäck dabeihaben. „Das liegt nicht zuletzt am sehr gut ausgebauten und etablierten Skibus-Angebot“, ist Hetfleisch überzeugt. Denn die Wintersportler:innen wissen, dass sie ohne eigenes Auto vom Hotel ins Skigebiet und wieder zurück kommen – und das bequemer, als wenn sie selbst fahren würden. Dass das im Sommer nicht funktioniert, liege zum Teil am noch nicht ausreichend entwickelten Angebot. Aber die fehlende Convenience ist nicht der einzige Aspekt. Es scheitert auch am Bekanntheitsgrad: „Die Herausforderung ist: Wie bekommen wir unser schon sehr gutes Öffi-Angebot zu jenen Gästen kommuniziert, die bis dato die Anreise oder Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht im Mindset haben“, sagt Hetfleisch.
KOMMUNIKATIONSHÜRDEN
Oberflächlich betrachtet, handelt es sich dabei also um ein Kommunikationsproblem. Doch dahinter verbirgt sich mehr. Denn das Skibus-Angebot ist ein Sonderfall: Sein relativ geradliniger Zweck ist es, eine große Menge Menschen zu relativ wenigen neuralgischen Punkten zu transportieren. Dementsprechend muss es im Kern nur drei Stakeholdern – Wintersportler:innen, Hotels und Seilbahnen beziehungsweise Skigebieten – gerecht werden. Im Sommer ist das Angebot – und damit auch die Ziele – deutlich diversifizierter. Und das macht es schwierig, Lösungen zu finden, insbesondere aus der Warte des Tourismus. Denn die Branche ist zwar auf

„Unsere Erreichbarkeit ist Fluch und Segen.“
PATRICIOHETFLEISCH, BEREICHSLEITER MARKETING UND KOMMUNIKATION, TIROL WERBUNG
Gäste und deren Mobilität angewiesen und könne beziehungsweise müsse Impulse dazu bieten, aber „die Verantwortung für den Andrang der Individualmobilität trägt sie nicht. Und die damit verbundenen Probleme wird sie alleine auch nicht lösen können“, meint er. Vielmehr betreffen die dafür nötigen Maßnahmen das gesamte öffentliche Mobilitätsangebot – und damit viele zusätzliche Interessengruppen: Urlauber:innen ebenso wie Einheimische, Pendler:innen und damit nicht zuletzt im Tourismus Beschäftigte, die Logistik, Anrainer:innen und viele mehr.
GEMEINSAME ZIELE
Zusätzlicher Hemmschuh, sowohl bei der eigentlichen Lösungsfindung als auch der Kommunikation, ist die fragmentierte Anbieterlandschaft. „Anstatt landesoder bezirksweit koordiniert zu werden, verhandeln in Tirol die 34 Tourismusverbände jeweils eigenständig Zehn-Jahres-Verträge mit dem Verkehrsverbund aus“, erklärt Hetfleisch. „Das schafft eine Vielfalt, die unmöglich kommuniziert werden kann, insbesondere international.“ Denn die Entscheidung, auf das eigene Auto im Urlaub zu verzichten, muss logischerweise bereits bei der Planung und noch lange vor der Abreise fallen. Und das kann nur geschehen, wenn Gäste über die Angebote informiert sind, und denen auch vertrauen. „Aber um das zu erreichen, brauchen wir ein gemeinsames Ziel, das Pendler:innen, Einheimische und Gäste umfasst, funktioniert und auch so kommuniziert werden kann.“
VON BEIDEN SEITEN
Ä hnlich sieht das Brigitte Hainzer. Es fehle sowohl an einer koordinierten Bedarfserfassung, die alle Interessen abdeckt, als auch an einer Instanz, Maßnahmen

überregional umzusetzen. „Es braucht einen Kümmerer“, bestätigt die Tourismusberaterin. Sie coacht seit 2014 Unternehmen zum Thema Kommunikation klimafreundlicher Mobilität. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass es für die Touristiker:innen selbst nichts zu tun gäbe. Im Gegenteil: „Auch regional kann einiges beigetragen werden. Vor allem Unterkunftsbetriebe sind eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Informationsquelle bei der Urlaubsplanung, also genau dann, wenn die Entscheidung für oder gegen das eigene Auto fällt.“

Direkt auf Hotelwebsites präsentierte Zugverbindungen und Mobilitätsangebote vor Ort wären also der ideale Impuls – zumindest in der Theorie. Praktisch ist das allerdings mit viel Aufwand verbunden, für den es auf betrieblicher Ebene oft an Ressourcen fehlt. Hier könnten aber TVBs aktiv werden, schlägt sie vor. „Stellen sie alle regionalen Mobilitätsangebote als einfach integrierbare Datensätze zur Verfügung, wäre das eine Lösung, von der alle profitieren. Werden die Informationen zentral erstellt und dann dort präsentiert, wo sie Gäste erreichen, hätte das den größten Effekt bei geringem Aufwand.“
GEHEIMTIPPS STATT STANDAR DT OUR
Damit endet der Vorteil des direkten Drahts zum Gast aber noch lange nicht. Insbesondere weil es beim Thema
„Betriebe sind eine wichtige Informationsquelle genau dann, wenn die Entscheidung für oder gegen das eigene Auto fällt.“
BRIGITTE HAINZER, TOURISMUSBERATERINRegio-Taxis, Wandershuttles und mehr sind ein gutes Argument für Gäste, auf das eigene Auto zu verzichten.
Urlaub eben nicht nur um Information, sondern auch um Emotion und Inspiration geht, haben gerade die Betriebe oft mehr Einfluss auf Mobilitätsentscheidungen, als man glauben würde. Und gerade an adäquaten Inspirationen vor Ort fehlt es oft noch, meint Hainzer. Während im Tourismus an Aspekte wie Gästekarten, öffentliche Mobilität und mehr bereits gedacht werde, „wird die aktive Mobilität bislang vernachlässigt“, sagt die Expertin. Dabei könnten gerade Angebote vor der eigenen Haustür von Hotels individuell gestaltet und nicht zuletzt als Alleinstellungsmerkmal präsentiert werden. „Man kann seine Gäste natürlich zu den Standard-Highlights schicken. Aber ebenso gut kommen Geheimtipps an, die von der Unterkunft aus zu Fuß erreichbar sind.“ Das habe dann das Flair einer gewissen Exklusivität – gepaart mit dem Vorzeigeeffekt, dass es eben auch ohne Auto gehe. Unterstützend dazu können Betriebe mit Leih-Rädern und -E-Bikes punkten und so die aktive Vor-Ort-Mobilität forcieren. „Und dann kommt noch eine Vielzahl von anderen Aspekten im Conveniencebereich dazu. Wandershuttles und Hüttentaxis sind bequem, ersparen Stress ebenso wie Parkgebühr. Und es muss bei der Kulinarik auch nicht auf Alkohol verzichtet werden.“ All das seien Dinge, die an der Rezeption kommuniziert werden können.
RICHTIG VORGEMACHT
Doch um öffentliche Mobilität richtig und glaubwürdig empfehlen zu können, müssen die Mitarbeiter:innen wissen, wovon sie sprechen. Denn nur wer aktiv Angebote nutzt, kann diese auch authentisch weiterempfehlen. „Aber dazu muss die Möglichkeit geboten werden“, sagt Hainzer. „Das geht nur, wenn Bus- und Bahn-Angebote so ausgebaut sind, dass Tourismusbeschäftigte sie selbst verwenden, um damit beispielsweise in die Arbeit zu kommen.“ Doch sind die Gastgeber:innen einmal von den Möglichkeiten überzeugt, ist die Chance groß, dass sie ihre Begeisterung auch an die Gäste weitergeben.
ZUKUNFTSORIENTIERT
S o sind die Interessen rund um das Thema Mobilität nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen eng verschränkt – was die Entwicklungen von Lösungen nicht einfacher macht. Doch gelänge Tirol und damit auch dem Tourismus die Mobilitätswende, hätte das positive Konsequenzen, sogar über Umwelt-, Klima- und
Maßnahmen wie Leih-Räder oder -E-Bikes, die die aktive Mobilität fördern, sind unterstützende Ergänzungen zur öffentlichen Mobilität, die auf Betriebsebene umgesetzt werden können.
Landschaftsschutz hinaus. Denn so manche von Tirols Stammgästen kommen in die Jahre und für einige von ihnen dürften lange Autofahrten auf kurz oder lang zum Ausschlusskriterium bei der Wahl der Urlaubsdestination werden. Dazu kommt die Entwicklung gerade im urbanen Raum. Dort haben gerade im jüngeren Segment bei Weitem nicht mehr alle potenziellen Gäste einen Führerschein. „Schaffen wir jetzt adäquate, lückenlose Mobilitätsangebote, kann uns nicht nur eine Gästegruppe länger erhalten bleiben“, gibt Hainzer zu bedenken. „Wir haben auch die Chance, eine neue zu erschließen.“


DER IST DAS WEG ZIEL
Urlauber:innen wollen schnell, unkompliziert und vor allem stressfrei in die Berge reisen. Das Tiroler Anreise-Tool GRETA bringt sie zielgenau dorthin und hat dabei auch noch die Umwelt im Blick.
GRETA –GREEN TRAVEL ALTERNATIVES

ist ein Routenplanungs-Widget , das auf der betriebseigenen Website implementiert werden kann und Gästen mit wenigen Klicks eine entspannte, umweltfreundliche Anreise anzeigt. Es passt sich dem jeweiligen Homepage-Design an und kann mit selbst gewählten POIs (Points of Interest) der Umgebung gefüttert werden. GRETA lässt sich auch in Newsletter und Buchungsbestätigungen einbauen und ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur klimafreundlichen Urlaubsdestination
Nachhaltigkeit spielt in Zeiten des Klimawandels für Tourismusregionen eine immer größere Rolle. Viele kleine und gar nicht so kleine Stellschrauben müssen gedreht und nachjustiert werden, um einen Betrieb klimafit zu machen und ihn im Einklang mit der Natur zu positionieren. Dazu gehört längst auch, Gäste bei einer möglichst nachhaltigen Anreise zu unterstützen. Hier setzt das neue Tool an, das in Tirol entwickelt wurde und Gästen eine zielgenauere und vor allem grünere Anfahrt ermöglichen soll. Drei Tiroler Tourismusverbände haben das Widget bereits im Einsatz, in St. Anton, im Wipptal und im Kaiserwinkl lässt sich schon jetzt eine nachhaltige wie zeitgemäße Anreise mit Green Travel Alternatives (GRETA) planen.
DIE BESTE ROUTE IN DIE FERIEN
Wie bringen wir unsere Gäste unkompliziert ins Land und was können wir tun, um die Auswirkungen auf die Umwelt dabei möglichst gering zu halten? GRETA will einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, diese zwei dringenden Fragen des Tourismus zu lösen. Dazu wird das Web-Widget auf der Website des Tourismusbetriebs integriert. So können Urlauber:innen schon bei der Buchung ihre Reisedaten eingeben und erhalten sofort die Anreiseroute mit dem geringsten ökologischen Fußabdruck und zudem auch weitere alternative Möglichkeiten. „Das bedeutet, dass den Gästen die umweltfreundlichste Variante als erste Wahl angeboten wird, die in vielen Fällen auch die stressfreiste ist.“, erklärt Ingrid Schneider, Bereichsleitung Nachhaltigkeit & Partnerschaften in der Tirol Werbung, ein Kernfeature
INGRID SCHNEIDER, BEREICHSLEITUNG NACHHALTIGKEIT & PARTNERSCHAFTEN IN DER TIROL WERBUNG

des neuen Anreise-Tools. „Im besten Fall kennt GRETA eine schnelle, angenehme und zugleich klimafreundliche Alternative, an die Reisende selbst vielleicht noch gar nicht gedacht haben“, ergänzt Schneider. GRETA kann so einen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen leisten, entfällt doch der größte Anteil dieser auf die Urlauberanreise.
VOM ERSTEN BIS ZUM LETZTEN METER
GRETA warnt vor Staus, hat das Wetter im Blick und zeigt im Vorfeld an, mit welchem Transportmittel ein angenehmerer und klimafreundlicherer Weg möglich wäre. Im Unterschied zu anderen Routenplanern hört eine alternative Anreise mit der Bahn für GRETA aber nicht am Bahnhof auf. Mit Sitz in den Tiroler Bergen kennt sich das Web-Widget besonders gut mit dem Regionalverkehr aus und findet auch den kleinen Dorfbus abseits der Hauptverkehrsrouten. Zudem kann sogar das eigene Hotelshuttle in das Planungstool integriert werden, sodass den Urlauber:innen eine nahtlose Verbindung von der eigenen Haustür bis direkt zur Urlaubsunterkunft angezeigt wird. Diese individuelle Servicierung und Unterstützung der Anreiseplanung unterstreicht einmal mehr die Tiroler Gastfreundschaft und Servicequalität. Ein schöner Nebeneffekt: In Zeiten limitierter Personalressourcen liefert diese einfache Software-asa-Service-Lösung Antworten auf Fragen, die bisher von Mitarbeiter:innen behandelt werden mussten.
Damit GRETA möglichst schnell und breit Einsatz im Tiroler Tourismus findet, ermöglicht die Tirol Werbung die Nutzung des Services für die Sommersaison (drei Monate lang) kostenlos.
Probieren geht über Studieren!
Nutzen Sie als Tourismusbetrieb GRETA drei Monate kostenlos.
So geht’s:
über ihren zuständigen Tourismusverband
2. Code auf www.greta.travel eingeben und GRETA ganz einfach auf der eigenen Website implementieren
„Im besten Fall kennt GRETA eine schnelle, angenehme und zugleich klimafreundliche Alternative, an die Reisende selbst vielleicht noch gar nicht gedacht haben.“1. Tourismusbetriebe erhalten den Code zur kostenlosen Nutzung 3. GRETA drei Monate lang gratis ausgiebig testen. 4. Nach den drei Monaten kann man GRETA für 22 Euro pro Monat oder 198 Euro pro Jahr weiternutzen.
„Ein guter Weg“
Alois Rainer, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft bei der WK Tirol, spricht im Interview über die Herausforderungen des Tourismus, die Verknüpfung mit Menschen und Wirtschaft und die Möglichkeiten, die in Innovationen liegen.

Zur Person: ALOIS RAINER
ist Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft bei der Wirtschaftskammer Tirol. Mit 20 hat er den Gasthof Post in Strass im Zillertal übernommen – ein Familienbetrieb in fünfter Generation.
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Laut Umweltbundesamt ist der Tourismus für etwa 1,5 Prozent des Energieverbrauchs in Österreich zuständig –der Wintertourismus für 0,9 Prozent.
Ti rol gehört in Sachen Tourismus zur absoluten Weltspitze. Was bedeutet der Tourismus für das Land?
Der Tourismus ist in Tirol eng mit dem Land verbunden. Das kommt unter anderem daher, dass er historisch gewachsen und kein autonomer Wirtschaftszweig ist, sondern eng mit allen anderen Faktoren verknüpft ist. Die Vorteile eines florierenden Tourismus merken somit natürlich unsere Gäste, aber eben auch die einheimische Bevölkerung. Tourismus ist viel mehr als nur der Gast, der zu uns kommt – das ist den Tiroler:innen bewusst.
Was kann die Wirtschaft tun, damit die Richtung weiterhin stimmt?
Eigentlich zeigen wir bereits, was getan werden muss und kann. Wir haben nämlich in den letzten Jahren wieder auf die Herausforderungen der Gegenwart geantwortet und in unseren Betrieben für einen Qualitätsschub gesorgt: Fotovoltaikanlagen, Wärmepumpen, E-BikeVerleih, E-Autovermietung, Hotelshuttles. Unternehmer:innen haben viel Geld in die Hand genommen, um hier einen Mehrwert zu schaffen. Und da haben wir nur über das touristische Angebot gesprochen – jenes
für Mitarbeiter:innen und die, die es noch werden wollen, hat auch ganz neue Standards erreicht.
Wie geht der Tourismus mit Innovationen um? Sind die Rahmenbedingungen gegeben, damit diese ermöglicht werden?
I nnovationen sind ein Symptom für Wandel – dem wir permanent unterzogen sind. Neueste Entwicklungen müssen wir immer im Auge behalten und fördern, damit wir weiterhin die Richtung vorgeben können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Es gibt das Wasserstoffzug-Projekt der Zillertalbahn. Wenn man dieses realisiert, in weiterer Folge dann die anderen Öffis samt den Bussen mit Wasserstoff betreibt, bietet man dem Gast die Möglichkeit, seinen Urlaub komplett umweltschonend mit öffentlichen Verkehrsmitteln abzuwickeln, ohne Scherereien, ohne Schwierigkeiten. I rgendwann vielleicht kann man sich überlegen, auch die Pistenraupen mit Wasserstoff zu betreiben.
Da wären wir schon beim Thema Mobilität. Wie wird man in Zukunft mit den Herausforderungen umgehen, die diese mit sich bringt?
Eine Sache ist ganz klar: Es gibt nicht die eine Lösung, um das Verkehrsnetz zu entlasten. Dreht man aber an allen möglichen Schrauben, wie ich in meiner letzten Ant-
wort bereits angedeutet habe, und noch an weiteren, wie zum Beispiel dem Straßenbau und Umfahrungen, kann man hier eine spürbare Beruhigung hervorrufen. Das ist unser Ziel.
Wo befindet sich Tirol auf dem Tiroler Weg und wohin führt dieser – vor allem aus der Sicht der Arbeitgebe r:innen? Der Tiroler Weg ist ein guter Weg (lacht). Vieles, das hinter den Kulissen passiert, bekommt man kaum mit. Die Tourismusbetriebe sind in Sachen Arbeitszeitflexibilität eigentlich Vorreiter: Wir antworten damit auf die Bedürfnisse der neuen Generation an Arbeitnehmer:innen, ohne die Qualität unseres Angebots darunter leiden zu lassen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen wir ganz neue Akzente und kämpfen gegen Lebensmittel- und Energieverschwendung. Hier sehe ich die Politik in der Pflicht, weitere Anreize zu schaffen, um dahingehende Innovationen zu fördern.
Vielen Dank für das Gespräch.
SPARTE TOURISMUS UND FREIZEITWIRTSCHAFT TIROLER WIRTSCHAFTSKAMMER
Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck
Tel.: 05 90 90 5-1220
E-Mail: tourismus@wktirol.at www.wko.at
VORZEIGEPROJEKTE
Das Fünf-Sterne-Wellness- und Luxushotel Stanglwirt in Going gilt als Good-Practice-Beispiel für das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, wenn es um Energiemanagement geht. Gründe dafür:
• Eigenes Biomasse-Heizkraftwerk
• Wärmepumpenanlage
• Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnungsfunktion
• 100-prozentiger Bezug von Ökostrom aus Tiroler Wasserkraft
Das Alpenresort Schwarz in Mieming gilt als Vorreiter in Sachen SDG (Sustainable Development Goals) , die als Maßstab der Entwicklung allumfänglicher Nachhaltigkeitsentwicklung gelten. Im Haus kümmert sich ein eigenes Team darum, dass die vorgegebenen Ziele erreicht werden. Dafür wurde das Alpenresort mit dem Österreichischen und Europäischen Umweltzeichen ausgezeichnet
Genuss Box – eine Tiroler Initiative zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung
Bei Food Waste Hero , einem WIFIKurs, können die Teilnehmer:innen lernen, was Ursachen und Lösungen beim Thema Lebensmittelabfall sind, und Tools zur Lebensmittelabfallvermeidung kennenlernen.
„Wir antworten damit auf die Bedürfnisse der neuen Generation an Arbeitnehmer:innen, ohne die Qualität unseres Angebots darunter leiden zu lassen.“
ALOIS RAINER
ARBE I
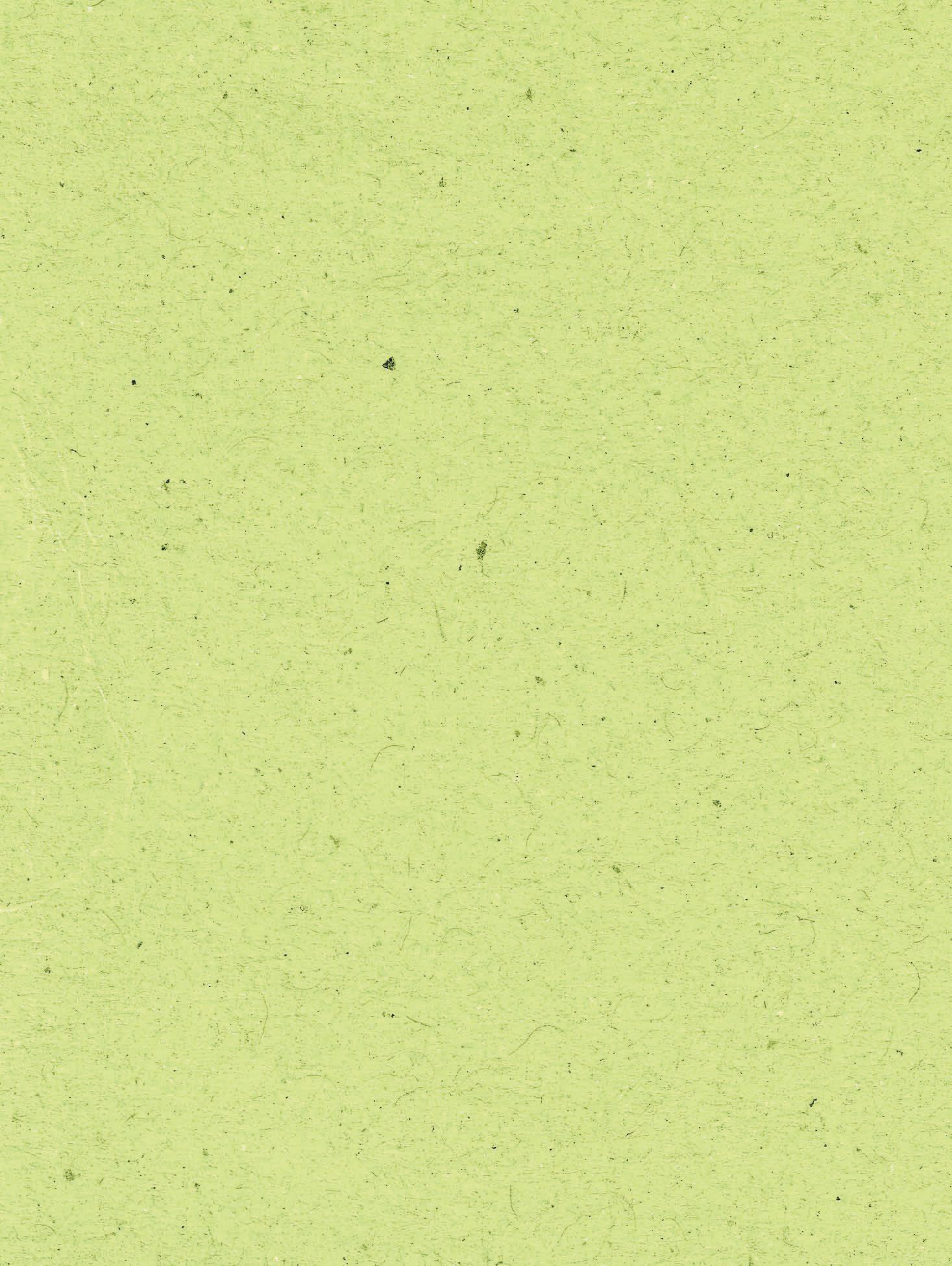
Um im Wettbewerb um Arbeitskräfte die Nase vorne zu haben, setzen Tirols Tourismusbetriebe und -regionen auf innovative Angebote, wie Mitarbeiter:innenkarten, Weiterbildung und Gesundheitsvorsorge.

DAS GEWISSE
ETWAS
Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, braucht es im Tourismus heute weit mehr als noch vor ein paar Jahren: Flexible Arbeitszeiten, Mitarbeiterhäuser und besondere Freizeitangebote sind nur ein paar der Benefits, mit denen Hotels um die besten Arbeitskräfte werben.
Gute Mitarbeiter:innen zu finden, die zum Betrieb passen und im Idealfall langfristig bleiben, ist aktuell eine der größten Herausforderungen in der Tourismusbranche. Fast überall werden Fachkräfte gesucht, was umgekehrt bedeutet, dass sich potenzielle Mitarbeiter:innen sehr genau überlegen können, wo sie hingehen: Passt das Angebot bei einem Betrieb nicht, muss man keine große Angst haben, nicht bei einem anderen fündig zu werden. Was kann man also tun, um Arbeitskräfte anzuziehen und zu halten? Hier kommt das Schlagwort Benefits ins Spiel: Es zählen nicht nur klassische Aspekte wie Gehalt, Arbeitsort und Image des Unternehmens, sondern auch, was sich Betriebe zusätzlich einfallen lassen, um die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Mit-
arbeiter:innen zu steigern. Diese Vorteile können ganz unterschiedlich ausfallen, damit sie wirken, müssen sie allerdings zum Unternehmen und der Lebensrealität der Mitarbeiter:innen passen, wie drei BestPractice-Beispiele aus Tirol zeigen.

STÄRKUNG NACH INNEN UND AUSSEN
Im Alpenresort Schwarz in Mieming setzt man auf ein sehr umfassendes Angebot: Neben Teamevents, Ermäßigungen bei Partnerbetrieben und der Unterkunft in einem eigenen Teamhaus liegt der Fokus hier vor allem auf dem Wohlbefinden und der Weiterentwicklung der Mitarbeiter:innen. „Unser Grundziel ist, mit diesen Benefits unsere bestehenden Mitarbeiter:innen zu unterstützen und zu stärken“, erklärt HRManagerin Sabine Defrancesco den Ansatz
des Tourismusbetriebs. Der Bedarf werde aus regelmäßigen Gesprächen und gezielten Mitarbeiter:innenbefragungen erhoben und das Angebot laufend auf die Bedürfnisse des Teams angepasst. „Aber es ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man das auch nach außen kommunizieren und damit das Employer Branding stärken kann.“

Ein wichtiges Thema seien flexible Arbeitszeitmodelle, erzählt sie. „60 Prozent unserer Belegschaft sind Frauen, deshalb war das immer schon ein Thema bei uns, ohne dass wir das als großen Benefit ausgewiesen haben.“ Das gelte aber nicht nur für Familien, sondern besonders auch für die jüngere Generation, die sich neben der Arbeit oft weiterbilden und beispielsweise studieren möchte, und ältere Mitarbeiter:innen, die gern die Altersteilzeit in Anspruch

nehmen. Man sei hier sehr offen, die Zeiten so zu gestalten, dass es zur jeweiligen Lebenssituation passe. Die Vereinbarkeit für Familien werde zusätzlich durch eine kostenlose Betriebstagesmutter unterstützt.
NUR NICHT STEHEN BLEIBEN
Zwei weitere große Punkte im Benefit-Angebot sind die betriebliche Gesundheitsvorsorge, die von regelmäßigen Fitness- und Wellnessprogrammen bis hin zur kostenlosen Inanspruchnahme von Business-, Lebens- und Sozialberatung reicht, und die regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter:innen. Letzteres wird unter der Dachmarke Schwarz-Campus zusammengefasst und inkludiert sowohl In-House-Schulungen als auch Kurse bei externen Anbietern. In diesem Rahmen stehen jedem Vollzeitmitarbeiter 600 Euro pro Jahr zur Verfügung, die er oder sie zusätzlich zu betriebsinternen Schulungen individuell in die Aus- und Weiterbildung investieren kann. „Die Weiterbildungsbedürfnisse werden durch Jahres- und Entwicklungsgespräche erhoben, aber auch durch Mitarbeiter:innenbefragungen und Rückmeldungen unserer Gäste, wo sie Bedarf sehen“, erklärt Defrancesco. Es würden aber auch aktuelle Branchentrends berücksichtigt werden, um das Angebot für die Gäste regelmäßig weiterentwickeln zu können.
Der Blick nach außen und vorne sei generell wichtig, besonders in Bezug auf die Mitarbeiter:innen, sagt sie. „Man muss am Ball bleiben und immer im Blick behalten, welche Veränderungen es gibt, gerade jetzt
„Unser Grundziel ist, mit diesen Benefits unsere bestehenden Mitarbeiter:innen zu unterstützen und zu stärken.“
SABINE DEFRANCESCO, HR-MANAGERIN ALPENRESORT SCHWARZALPENRESORT SCHWARZ
mit New Work, und welche Anforderungen neue Generationen haben. Das ist, denke ich, der entscheidende Faktor, um attraktiv zu bleiben.“
BUNTE MISCHUNG
Auch im Stanglwirt setzt man bewusst auf umfassende Benefits, erzählt Lisa-Marie Ponholzer aus dem Human-ResourcesTeam: „Es ist die Mischung, das Rundumpaket, das es attraktiv macht.“ Dazu gehören beispielsweise die 2020 eröffnete Mitarbeiter:innenresidenz, ein kostenloses Wellness- und Fitnessangebot, Kooperationen mit Betrieben aus der Region und eine hauseigene Weiterbildungsinitiative. Im

STANGLWIRT
Das Fünf-Sterne-Hotel Stanglwirt in Going ist Hotel und Bio-Bauernhof in einem und wird in zehnter Generation von Balthasar Hauser und seiner Familie geführt.
Rahmen der sogenannten Talenteschmiede wird auf individuelle Ausbildungswünsche eingegangen, zusätzlich werden Schulungen zu allgemeinen und abteilungsspezifischen Themen, aber beispielsweise auch Sprach-, Leadership- und Erste-Hilfe-Kurse angeboten – sowohl in Person als auch über eine eigene e-Learning-Plattform, die kostenlos und zeitunabhängig genutzt werden kann. Sehr gut angenommen werde momentan außerdem die Möglichkeit, im Rahmen eines Pilotprojektes kostenlos EAutos auszuleihen.
Besonders attraktiv sei aber, dass es sich beim Stanglwirt um einen Ganzjahresbetrieb handelt, der fast allen Mitarbeiter:innen eine im Tourismus immer noch eher unübliche Fünftagewoche bietet – und um einen Familienbetrieb mit klar definierten Werten. „Es braucht Benefits, aber wenn die Werte und das Klima nicht passen, reicht das nicht, um Mitarbeiter:innen zu halten“, sagt Ponholzer. „Die finanziellen Benefits sind zwar wichtig, aber das Arbeitsklima und die Wertschätzung, die man im Arbeitsalltag erlebt, haben noch mal einen viel höheren Stellenwert.“
GRUNDVORAUSSETZUNGEN
Das betont auch Daniel Ganzer, Geschäftsführer des Naturhotel Outside in Matrei in Osttirol: „Das Wichtigste sind Arbeitszeit-Flexibilität und die Wertschätzung im Team. Das ist deutlich gewichtiger als die einzelnen Benefits.“ Man habe relativ viele Teilzeitkräfte im Team sowie einen sehr

„Es braucht Benefits, aber wenn die Werte und das Klima nicht passen, reicht das nicht, um Mitarbeiter:innen zu halten.“
LISA-MARIE PONHOLZER, HR-TEAM STANGLWIRT
hohen Anteil an einheimischen Mitarbeiter:innen, was beides nur dank flexibler Arbeitszeitmodelle und der damit zu vereinbarenden Kinderbetreuung möglich sei. „Wir gehen stark auf individuelle Bedürfnisse ein, und das funktioniert.“ Diese Bemühungen seien auch ein Grund dafür, dass die Mitarbeiter:innen in der Regel sehr lange im Betrieb bleiben.

Klassische Benefits wie Preisvorteile bei Partnerbetrieben, ermäßigte Übernachtungspreise für Freund:innen und Familie und die kostenlose Nutzung der Fitness- und Wellness-Infrastruktur seien aber natürlich schöne Zuckerl, die man gerne anbiete. „Wir versuchen, uns laufend zu verbessern, und halten bezüglich Benefits auch immer die Augen offen“, sagt der Hotelier. Einfach mit Sachwerten überschütten würde man das Personal aber nicht: „Wir schauen sehr genau auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen und auch darauf, was zu uns passt und wirklich einen Mehrwert schafft.“
Für die Zukunft will Ganzer besonders das Thema Mitarbeiter:innenunterkünfte stärker forcieren und ausbauen. „Wir haben aktuell viele Einheimische im Betrieb, die keine Unterkunft im Hotel benötigen, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass das immer so bleibt“, erzählt er. Man sei hier im Wettbewerb mit sehr vielen Tourismusbetrieben, die insbesondere in dem Bereich viel investieren würden, deshalb sei es notwendig, sich hier entsprechend zu bemühen.
HOTEL OUTSIDE
Das von der Familie Ganzer geführte Vier-Stern-SuperiorHotel Outside in Matrei in Osttirol beschäftigt aktuell rund 30 Mitarbeiter:innen. Es wurde unter anderem mit dem Top Company Award und dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.
BELIEBTE BENEFITS
+ Flexible Arbeitszeiten

+ Fünftagewoche
+ Betriebliche
Gesundheitsvorsorge
+ Weiterbildungsangebot
+ Mitarbeiter:innenunterkunft
+ Möglichkeit, das Fitness- und Wellnessangebot zu nutzen
+ Ermäßigungen bei Partnerbetrieben
+ Freizeitmöglichkeiten
+ Ermäßigungen für Familie und Freund:innen
+ Kostenlose Kinderbetreuung im Betrieb
+ Ermäßigte Öffi-Nutzung
„Das Wichtigste sind Arbeitszeit-Flexibilität und die Wertschätzung im Team. Das ist deutlich gewichtiger als die einzelnen Benefits.“
DANIEL GANZER, GESCHÄFTSFÜHRER NATURHOTEL OUTSIDE
MEHR ALS EIN ARBEITSORT
Tirols Tourismusregionen werben längst nicht mehr nur um Gäste, sondern in Zeiten des Arbeitskräftemangels auch um Mitarbeiter:innen – zum Beispiel mit speziellen Mitarbeiter:innenkarten. Mit günstigem Zugang zu zahlreichen Angeboten will man motivierte Menschen finden und halten.

Zur Person: MATHIAS SCHULER verantwortet als Abteilungsleiter das Destination Employer Branding im TVB Paznaun – Ischgl.

Drei TVB zeige n, wie :
T VB Pazna un – Ischgl: CREW Card
2.900 Mitarbeiter:innenkarten wurden in der Wintersaison 2022/23 ausgestellt.
EIN TAL, VIELE MÖGLICHKEITEN
Was im Rahmen eines Pilotprojektes in der Wintersaison 2018/19 entstand, ist nun fixer Bestandteil des Destination Employer Brandings im TVB Paznaun –Ischgl: die Paznaun – Ischgl CREW. Mit der im Zuge dieses Projektes eingeführten Mitarbeiter:innenkarte, die Zugang zu Vergünstigungen bei Freizeitaktivitäten und Schulungen ermöglicht, will der TVB seinen Beitrag gegen den Personalmangel leisten: „Das ist ein Hebel, bei dem wir als TVB ansetzen können. Zusätzlich zu den Zuckerln, die Betriebe bereits bieten, wie höheres Gehalt oder andere Benefits“, erklärt Mathias Schuler, Abteilungsleiter Employer Branding im TVB Paznaun –Ischgl.
Erhältlich ist die Karte online und mit Bestätigung des Arbeitgebenden für alle Angestellten im Paznaun – unabhängig von der Branche und der Arbeitsdauer. Falls jemand nur kurz bleibt, wird die Karte nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses vom Betrieb eingesammelt.
BEWÄHRTE METHODEN
Die Karte ist Teil der Kampagne Paznaun –Ischgl CREW, mit der der TVB um Mitarbeiter:innen wirbt. Ausgespielt wird sie in den wichtigsten Herkunftsmärkten der Region. „Wir setzen auf die gleichen Methoden, die sich auch schon bei unseren Gästen bewährt haben“, erklärt Schuler. „Es ist Aufgabe des TVB, beide anzusprechen. Denn wenn morgens niemand Frühstück macht und abends niemand kocht, können wir auch keine Gäste mehr bewirten.“ Die Zielgruppe seien hauptsächlich die Generationen Y und Z, im
Prinzip aber alle potenziell Interessierten. Denn der Altersmix habe sich seit Corona stark verändert. „Während vor der Pandemie ein Großteil der Mitarbeiter:innen zwischen 20 und 30 Jahre alt war, haben wir mittlerweile fast gleich viele 20- wie 50-Jährige.“
Bei den Mitarbeiter:innen kommt die CREW Card laut Schuler gut an. In der abgelaufenen Wintersaison wurden 2.900 Karten ausgestellt. Auch seitens der Betriebe kommen viel Zuspruch und positives Feedback. Aktuell wird daran gearbeitet, das Angebot weiter zu digitalisieren, um den Zugang für Unternehmen und Personal zu erleichtern. Zudem gibt es neue Ideen, deren Umsetzung geprüft wird.

„Wenn morgens niemand Frühstück macht und abends niemand kocht, können wir auch keine Gäste mehr bewirten.“
MATHIAS SCHULER
Achensee Tourismus: DahoamCard
Zur Person: KATRIN RIESER ist Themen- und Projektmanagerin von Job-Life Achensee

110
Unternehmen sind auf der Plattform Job-Life Achensee registriert, knapp 70 Prozent davon aus dem Tourismus.
ARBEITS- UND LEBENSRAUM
2018 startete Achensee Tourismus gemeinsam mit Arbeitgeber:innen und -nehmer:innen, Gemeinden, Expert:innen und der Politik das Regionalentwicklungskonzept Job-Life Achensee mit dem Ziel, die Region als attraktiven Arbeits- und Lebensraum zu vermarkten. Herzstück ist eine Serviceplattform für Betriebe und Mitarbeiter:innen, auf der beispielsweise Jobs inseriert bzw. gesucht, aber auch Freizeitmöglichkeiten präsentiert werden. Zu finden sind dort auch die Angebote, die mit der sogenannten DahoamCard genutzt werden können. Wie diese funktioniert, erklärt Katrin Rieser, Projektmanagerin von Job-Life Achensee. „Alle Achenseebewohner:innen sowie Arbeitnehmer:innen der Region können in den Genuss der Vorteile dieser Karte kommen. Sie kann in der eigenen Wohnsitzgemeinde bzw. in der Gemeinde des Arbeitgeberbetriebs kostenlos abgeholt werden.“

Mit dem Projekt und der Karte der Region wollen die Gemeinden mit dem Tourismusverband Achensee auf die Veränderungen und Anspannungen am Arbeitsmarkt reagieren. Denn: „Wie in anderen Regionen sieht sich nicht nur der Tourismus seit einigen Jahren mit einem ausgeprägten Mitarbeiter:innenmangel konfrontiert, auch andere Branchen am Achensee stehen vor dieser Herausforderung“, sagt Rieser.
RESTART NACH PANDEMIE
Nach einer pandemiegeschuldeten ruhigeren Phase will man mit Job-Life Achensee wieder voll durchstarten. Neue Attraktionen sollen bei der DahoamCard dazukommen. Im Moment gibt es beispielsweise Vergünstigungen bei Deutschkursen, Fitnessangebote oder eine digitale Park- und Langlaufsaisonkarte. Betriebe und Mitarbeiter:innen profitieren laut Rieser von dem Projekt. „Betriebe erhalten über die Plattform eine Bühne, um sich am umkämpften Arbeitsmarkt zu präsentieren und mit potenziellen Mitarbeiter:innen auszutauschen. Des Weiteren können wir die Region Achensee überregional und branchenunabhängig positionieren und als attraktiven Arbeits- und Lebensraum etablieren.“ Arbeitnehmer:innen würden hingegen Antworten auf relevante Fragen bekommen.
Derzeit haben sich rund 110 Unternehmen auf der Plattform Job-Life Achensee registriert, knapp 70 Prozent davon kommen aus dem Tourismus. „Job-Life Achensee erfährt bei den bestehenden Mitgliedern einen großen Zuspruch. Das bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Rieser.
„Betriebe erhalten über die Plattform eine Bühne, um sich am umkämpften Arbeitsmarkt zu präsentieren und mit potenziellen Mitarbeiter:innen auszutauschen.“
KATRIN RIESER
Region Seefel d: Teamcard
EINE KARTE, ZWEI VARIANTEN
Seit Dezember gibt es auch in der Region Seefeld eine Teamcard für Arbeitnehmer:innen der Region. „Die Idee hinter der Teamcard ist, dass Mitarbeiter:innen ein gebündeltes Angebot bestehend aus Freizeit-, Sport- und Bonusangeboten bekommen,“ erklärt Raphael Chrysochoidis, der im TVB Seefeld das Projekt verantwortet. Gemeinsam mit einem Tourismusberatungsunternehmen hat der TVB die Mitarbeiter:innenkarte im Laufe des vergangenen Jahres entwickelt und in einem weiteren Schritt interessierte Betriebe als Leistungsträger für das Projekt an Bord geholt.

Erhältlich ist die Teamcard Chrysochoidis zufolge in zwei Varianten: als Basiccard, also einer Art Schnupperkarte, um 49 Euro sowie als Premiumcard um 385 Euro mit einer Vielzahl von verschiedenen Leistungen. Betriebe in der Region können die Karte für ihr Personal erwerben –die Basiccard etwa als Extra im Recruitingoder Onboarding-Prozess oder die Premiumversion als Bonus für Langzeitmitarbeiter:innen, nennt Chrysochoidis zwei Anwendungsbeispiele. „Wichtig war uns von Anfang an, kein Konkurrenzmodell zu bestehenden Saisonkarten zu schaffen. Wenn jemand beispielsweise den ganzen Winter nur auf Skiern unterwegs ist, dann ist auch weiterhin die Saisonkarte bei den Bergbahnen die erste Wahl.“
WIN-WIN-SITUATION

Nutzen können die Karte alle Personen, die in der Region angestellt oder selbstständig tätig sind, sowie Gemeinde- und Lehrpersonal. „Mit diesen Voraussetzungen können wir sicherstellen, dass das Projekt auch wirklich ein Mehrwert für die Region hat“, erklärt der Projektleiter. Über die TeamCard-App kann der TVB den Erfolg der Karte evaluieren und am Ende der Saison mit den Betrieben abrechnen. „Das Projekt ist gut angelaufen und kommt bei den Unternehmen auch schon an, befindet sich aber noch in der Anfangsphase. Mitarbeiter:innen und Unternehmen müssen noch sensibilisiert werden“, resümiert Chrysochoidis. Der Nutzen ist für ihn klar: „Arbeiter:innen können zu einem guten Preis die Region und ihre Möglichkeiten kennenlernen und ihre Erfahrungen an Gäste weitergeben und werden so zu Botschafter:innen der Region Seefeld. Betrieben hingegen steht ein zusätzliches Instrument zur Mitarbeiter:innenakquise bzw. -bindung zur Verfügung.“
2 VARIANTEN
gibt es bei der Teamcard: eine Basiccard als Schnupperkarte und die Premiumcard mit einer Vielzahl von vergünstigten Leistungen.
„Arbeitnehmer:innen können zu einem guten Preis die Region und ihre Möglichkeiten kennenlernen und ihre Erfahrungen an Gäste weitergeben und werden so zu Botschafter:innen der Region Seefeld.“
RAPHAEL CHRYSOCHOIDIS
„Ein erster Schritt ist getan“
Tourismusberater und Autor Richard Bauer sieht Tirols TVB hinsichtlich ihrer Bemühungen als Vorreiter im Alpenraum. Luft nach oben besteht noch bei der Bekanntheit und im Communitymanagement, sagt Bauer im Interview.
Das Gespräch führte Eva Schwienbacher
Zur Person: RICHARD BAUER ist Inhaber und Gründer eines Wiener Beratungsunternehmens für Zukunftsfragen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, seit über 25 Jahren ist er im Tourismus tätig, Lektor an Hochschulen und Buchautor („Fachkräfte finden und binden“ und „Tourismus nach Covid-19“, Lindeverlag).

Er berät Regionen und Betriebe u. a. zu Zukunftsstrategien und Employer Branding.
Die Anzahl der Beschäftigten im Tourismus ist laut WK Tirol seit 2015 um 40 Prozent gestiegen. Trotzdem fehlen der Branche Arbeitskräfte. Was ist das Problem? RICHARD BAUER: In allen Branchen in ganz Europa fehlen Mitarbeiter:innen. Laut WKO sind die offenen Stellen von 2021 auf 2022 um 41 Prozent gestiegen. Was wir hier dazurechnen müssen, ist der höhere Teilzeitfaktor, das heißt, um künftig die offenen Stellen in Österreich zu besetzen, brauchen wir mehr Personen. Die Gründe sind einfach: einerseits die demografische Entwicklung – wir haben geburtenschwache Jahrgänge, viele gehen in Pension und weniger Erwerbstätige kommen nach. Andererseits spielt auch die steigende Akademisierung eine Rolle – es fehlt der Nachwuchs bei den Lehrkräften. Schließlich ist der Konkurrenzdruck am Arbeits-

markt enorm, da alle neue Mitarbeiter:innen suchen.
Tiroler TVB versuchen, mit Destination Employer Branding und Angeboten wie Mitarbeiter:innenkarten Leute zu finden und binden. Wie bewerten Sie solche Maßnahmen?
In Bezug auf Mitarbeiter:innenkarten sind Tirols TVB im Alpenraum sicher Vorreiter. Sie bieten die Möglichkeit, dass Personen emotional an die Marke gebunden werden. Das ist die beste Versicherung gegen den Mitarbeiter:innenmangel. Positiv ist, dass die Karten mit den Freizeitmöglichkeiten in der Region verknüpft sind und dadurch klar wird, wofür die Region in Tirol steht – so können sich die TVB untereinander unterscheiden und glaubwürdig Markenbotschafter:innen ausbilden. Luft nach oben besteht noch in der Bekanntheit.
Es ist wichtig, dass Menschen die Marke kennen, noch bevor sie auf Arbeitssuche sind. Sobald die Jobsuche gestartet ist, konkurrieren Betriebe mit zu vielen anderen Arbeitgeber:innen.
Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf? Mit der Karte ist ein erster Schritt getan. Ein zweiter wichtiger Schritt ist das Communitymanagement. Wir wissen, dass sich die Menschen nicht zuletzt aufgrund der Coronapandemie immer stärker nach Gemeinschaft sehnen. Diesem Wunsch können TVB begegnen, indem sie Mitarbeiter:innen, Unternehmen und Einheimische einer Region miteinander vernetzen.
Wie kann das gelingen? Die TVB können dazu beitragen, dass neue Mitarbeiter:innen, die von außerhalb kommen, in einer Region gut integriert werden. Da geht es um einfachste Unterstützungen, wie bei Behördengängen oder Sprachkursen. Entscheidend ist auch, ihnen und deren Familien Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Wenn sich jemand weiterentwickeln oder umorientieren möchte, macht es Sinn, Alternativen in der Region oder aber in einem anderen Ort in Tirol ausfindig zu machen. Besser ist ein Wechsel innerhalb des Bundeslandes, als dass er bzw. sie Tirol ganz verlässt. Die Aufgabe ist, hier ein Netzwerk zu schaffen. Da hat der Tourismus in Tirol den entscheidenden Vorteil, dass er kleinstrukturiert ist und in Familienbetrieben die Beziehung zwischen Mitarbeiter:innen und Inhaberfamilie oft automatisch gegeben ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
„Es ist wichtig, dass Menschen die Marke kennen, noch bevor sie auf Arbeitssuche sind.“
RICHARD BAUER
Wedls Erfolgsgeschichte wird mit neuem Markenauftritt fortgeschrieben
1904 in Tirol gegründet, heute österreichweit aktiv
St arke Marken zeichnen sich durch eine solide Markenpositionierung aus, und ihr USP (Unique Selling Proposition) bzw. ihre Alleinstellungsmerkmale sind klar definiert. Für Lorenz Wedl, Mitglied der Geschäftsführung beim heimischen Gastro-Großhändler, gelten folgende Unternehmenswerte: „Unsere Erfolgsgeschichte als Familienbetrieb ist geprägt von Verantwortung und Traditionsbewusstsein.“ 1904 in Tirol gegründet, ist das in Österreich zu den Top 10 zählende Großhandelsunternehmen im Lebensmittelbereich seit jeher eng mit den heimischen Regionen verbunden. „Höchste Qualität im Bereich Dienstleistung und Produktsortiment, ein attraktives und sicheres Arbeits- und Einkaufsumfeld gepaart mit kontinuierlicher Innovation, Nachhaltigkeit und Vertrauen sind die Ingredienzien des Markenversprechens, das Wedl vor fast 120 Jahren seinen Kund:innen und Mitarbeiter:innen gegeben hat und seitdem hält“, so Leopold Wedl, ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung.
UMSTELLUNG ERFOLGT SUKZESSIVE
Der bisherige Markenauftritt mit dem prägnanten Logo in kräftigem – österreichi-
schem – Rot bestand seit 1970. Durch den erfolgten Relaunch von Logo und Corporate Design, der nach und nach in allen Unternehmensbereichen, an allen 8 Standorten und an der gesamten LKW-Flotte umgesetzt wird, präsentiert sich Wedl in einem frischen Look und einem ganzheitlichen und homogenen Markenauftritt. Die neue Bildsprache ist elegant, zeitlos und reduziert, wobei die Wiedererkennbarkeit der Marke im Vordergrund steht. Die stringente und gleichzeitig behutsame Überarbeitung des Markendesigns spiegelt sich auch im neuen Logo wider, das durch ausgewogene Proportionen in einem hellen Rotton auf die österreichische Heimat des Unternehmens
verweist. Für die kreative Umsetzung des neuen Markenauftritts von Wedl zeichnet eine Tiroler Agentur verantwortlich.
WEDL HANDELS-GMBH



Leopold-Wedl-Str. 1, 6068 Mils bei Hall in Tirol
E-Mail: info@wedl.com wedl.com
Bis Ende Juli wird der Wedl-Fuhrpark auf das neue Corporate Design umgestellt.„Tiroler Genussgutschein jetzt in über 300 Betrieben einlösbar“
Ab sofort gibt es den neuen „Tiroler Genussgutschein“, der sowohl in allen Tiroler Wirtshauskulturbetrieben als auch in ausgezeichneten „Bewusst Tirol“ Betrieben verwendet werden kann. Die Genussgutscheine werden über den Webshop unter www.tiroler-wirtshaus.at oder unter www.bewusst.tirol online generiert und können selbst ausgedruckt werden.
Mit der Erweiterung des Genussgutscheinsystems um die „Bewusst Tirol“ Betriebe eröffnet sich mit rund 300 einlösenden Mitgliedbetrieben eine neue Dimension des gastronomisch-touristischen Angebotes, das es so in keinem anderen Bundesland gibt!“, betont Andreas Mair, Obmann der Tiroler Wirtshauskultur. Der Gutschein verspricht ein Stück Genuss und Entspannung, der an Familie, Freund:innen, Geschäftspartner etc. verschenkt werden kann und gleichzeitig die lokale Wirtschaft unterstützt. Die Tiroler Genussgutscheine sind in insgesamt 300 Betrieben sowohl für Konsumation als auch
für Übernachtungen, für alle Leistungen, die im jeweiligen Betrieb angeboten werden, einlösbar.
S eit rund 30 Jahren besteht nunmehr der Verein „Tiroler Wirtshauskultur“. Die grundlegendsten Elemente der Initiative sind die Liebe zur Tiroler Kost, Frische der verwendeten Produkte und besonderes Augenmerk auf authentische Atmosphäre und Architektur.
„ Seit vielen Jahren bietet die Tiroler Wirtshauskultur Genuss auf höchster Ebene. Die ‚Tiroler Wirtshauskultur ‘ vereint dabei Wirtshäuser unter ihrem Dach, die sich zu Tradition und Regionalität be -
kennen. Ob gemütlich, urig oder gehoben, das Tiroler Wirtshaus ist so vielfältig wie das Land selbst. Mit der Ausweitung auf die ‚ Bewusst Tirol‘ Betriebe wird jetzt der Gutschein für Einheimische und Gäste noch attraktiver, so Matthias Pöschl, GF Agrarmarketing Tirol.
Die Initiative „Bewusst Tirol“ der Agrarmarketing Tirol zeichnet Gastronomiebetriebe aus, die nachweislich verstärkt auf Produkte aus der Region setzen und so die Tiroler Wirtschaft und Landwirtschaft nachhaltig stärken und fördern. Die „Bewusst Tirol“ Münze ist ein Wegweiser für Konsument:innen und Gäste, die Tirol am Teller genießen möchten.

AGRARMARKETING TIROL GMBH

Maria-Theresien-Straße 57/3, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512 575701
E-Mail: office@agrarmarketing.tirol
www.qualitaet.tirol
Tiroler GENUSSGUTSCHEIN
JETZT
GLEICH VERSCHENKEN!
Die Agrarmarketing Tirol und der Verein „Tiroler Wirtshauskultur“ haben den Tiroler Genussgutschein weiterentwickelt. Damit verschenken Sie besondere Genussmomente – ob an Familie Freunde, Geschäftspartner oder als kleines Dankeschön – und unterstützen die lokalen Betriebe in Tirol.


Der Tiroler Genussgutschein kann bei insgesamt 300 „Bewusst Tirol“ - und „Tiroler Wirtshaus“-Betrieben eingelöst werden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schenken und Genießen!
KL I

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sind im Tourismus gefragt.
Mit großen Sprüngen und kleinen Schritten gehen Tourismusverbände und Hotels den Weg hin zum klimafitten Lebensraum.


Umdenken auf allen Ebenen
Die Vorgabe war eine gesetzliche: Jeder Tourismusverband in Tirol muss laut Tourismusgesetz einen Nachhaltigkeitskoordinator bestellen, der den Geschäftsführer berät, unterstützt und Bericht abgeben muss. Im Ötztal Tourismus übernimmt Raphael Kuen als Lebensraummanager diese Aufgabe und entwickelte dafür eine umfassende Strategie.
In seinem früheren Beruf fuhr Raphael Kuen bis zu 50.000 Kilometer pro Jahr, als Lebensraummanager im Ötztal Tourismus hat er sein Büro im Mesnerhaus in Längenfeld und geht ein paar hundert Meter von zu Hause zu Fuß zur Arbeit.
Seit Herbst 2022 ist Raphael Kuen in seiner neuen Funktion im Ötztal tätig und lebt die Idee, die Region nachhaltiger u nd klimafreundlicher zu gestalten, gleich selbst vor. Die Entscheidung, seinen früheren Beruf als Geschäftsführer beim Tiroler Grauviehverband und Vorstand in der Rinderzucht Tirol Genossenschaft aufzugeben, traf er
unter anderem, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, zu Fuß zur Arbeit in Längenfeld gehen zu können und überhaupt das Tal zu einem „lebenswerten, klimafitten und enkeltauglichen“ Lebensraum zu machen.
A ls Lebensraummanager konnte Kuen an bereits bestehende Projekte anknüpfen, beispielsweise an das Programm „Genussbotschafter*in Ötztal“, in dem Gastronomiebeschäftigte die Produzent:innen im Tal besuchen, deren Produkte kennenlernen und viel über die Verarbeitung und Vermarktung erfahren. In puncto Mobilität hat die Region einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr und einen durchgehenden Radweg vorzuweisen, auf anderen Gebieten ist hingegen noch viel zu tun.
NACHHALTIGKEIT ALS UMFASSENDES PROJEKT
Dazu entwickelte Raphael Kuen mit Unterstützung der Nachhaltigkeitsforscherin Ines Omann und des Beraters Georg Tappeiner eine Strategie, die viele Handlungsfelder
Das Ziel ist, den Lebensraum Ötztal für seine Kinder und die nachfolgenden Generationen so gut und lebenswert zu erhalten wie möglich.
umfasst: Mobilität, Klima – Kultur – Landschaft, Energie, soziale Nachhaltigkeit und regionale Kreisläufe werden einbezogen. Kuen und seine Mitarbeiterin Nadine Grüner stehen im Dialog mit der Bevölkerung, Initiativen, Vereinen und Unternehmen und vernetzen sich mit den Nachhaltigkeitskoordinator:innen der anderen Tourismusregionen. Workshops, Schulungen und Projekte in allen Bereichen sind in Planung. Das Ziel im kommenden Jahr ist die Zertifizierung der Region mit dem Umweltzeichen oder einem anderen Gütesiegel.
Eine der ersten Veranstaltungen in diesem Prozess war ein Vortragsabend mit dem Klimaforscher Marcus Wadsak im April 2023 in Obergurgl, bei dem Kuen unter dem Titel „Lebensraum Ötztal – machen wir
uns gemeinsam auf den Weg!“ sein Konzept vorstellte. Der Green Event zog zahlreiche Menschen aus dem Ötztal an, die anschließend Zukunftsideen sammelten: Von der Verkürzung der Wintersaison über reduzierte Übernachtungspreise für Gäste, die mit Bahn oder Bus anreisen, einen Stopp der Bodenversiegelung, die Beratung von Betrieben zum Klimaschutz bis hin zur Errichtung von Windkraftanlagen in den Bergen reichten die Vorschläge. Vieles soll, wenn es nach Raphael Kuen geht, mit Partner:innen aus dem Tal umgesetzt werden. Das mittelfristige Ziel ist ein allgemeines Umdenken, betont er. „In zehn Jahren möchte ich erreicht haben, dass die Frage nach den Auswirkungen auf den Lebensraum bei allem, was wir tun, Routine ist.“

„Es geht darum, auf positive Weise zum Umdenken anzuregen.“
RAPHAEL KUEN, LEBENSRAUMMANAGER IM ÖTZTAL TOURISMUS
ZILLERTALERHOF ALPINE HIDEWAY
Nachhaltigkeit ist bunt

Aus einem gewöhnlichen VierStern-Hotel in Mayrhofen machten
Franz-Josef und Katharina Perauer
in wenigen Jahren ein Vier-SternSuperior-Designhotel mit EU Ecolabel, Österreichischem Umweltzeichen und großer Strahlkraft: den Zillertalerhof
Alpine Hideway.
Wie sieht unser Designhotel der Zukunft aus? Diese Frage stand am Anfang, als Franz-Josef und Katharina Perauer 2019 begannen, den Zillertalerhof in Mayrhofen umzugestalten. Das bedeutete nicht nur ein modernes optisches Design, sondern eine neue strategische Ausrichtung. Jeder Bereich des Unternehmens wurde auf Herz und Nieren geprüft und viele große und kleine Veränderungen vorgenommen. Das beginnt bei der Energie, die vorrangig aus nachhaltigen Quellen wie Wasserkraft, Photovoltaik und einem eigenen Blockheizkraftwerk kommt, und setzt sich beim Einkauf und der Vermeidung von Müll fort. Ein Beispiel, wie genau sich die Hoteliers mit jedem Detail befassten, ist das Frühstücksbüffet, an dem sich nun statt der weltbekannten Haselnusscreme eine ohne Palmöl und mit kürzeren Lieferweg findet und Milchprodukte, Müsli, Honig, Wurst und Käse aus dem Zillertal und dem übrigen Tirol angeboten werden. So viel wie möglich wird regional und saisonal gekauft und möglichst nur in den benötigten Mengen. Ähnliches gilt für die biologisch verträglichen Reinigungsmittel von einem Tiroler Hersteller, die hauseigene Kosmetiklinie und die Kleidung aus BlueEconomy-Textilien, die das Unternehmen seinen Mitarbeiter:innen stellt.
DAS MAGISCHE DREIECK
Das verweist darauf, dass das Hotelierspaar unter Nachhaltigkeit nicht nur die Schonung von Ressourcen oder grüne Energie versteht, sondern ein vielfältig wirksames Thema. „Wir haben unser Konzept auf das ‚magische Dreieck‘ zugeschnitten“, erläutert Franz-Josef Perauer. Neben den Hotelgästen galt das Augenmerk auch den Mitarbeiter:innen, die im Betrieb „Mitgastgeber“ genannt werden, sowie den Lieferant:innen und Partner:innen. Gerade in Zeiten, in denen Personal so gesucht ist wie selten, müsse

man schauen, dass man die Absprungrate niedrig halte. Ein Bestreben ist daher, aus dem Hotel mit zwei langen Saisonen einen Ganzjahresbetrieb zu machen. Bei der Zertifizierung mit dem EU Ecolabel erwies sich diese Herangehensweise als Segen, fließen in die Bewertung doch nicht nur der Umgang mit Natur und Ressourcen, sondern auch mit den Angestellten mit ein.
M indestens ebenso brennend wie das Thema Mitarbeitermangel ist im Tiroler Tourismus das Thema Verkehr. Zahlreiche Täler, allen voran das Zillertal, leiden unter Staus, Lärm und schlechter Luft. Zwar kann man nicht jeden Gast davon überzeugen, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen soll, doch jene, die Öffis nutzen, können Vergünstigungen erhalten, etwa durch Preisreduktionen, Wellnessgut-
scheine oder einen Drink an der Bar. Das Gleiche gilt für Gäste, die ab und zu auf die Zimmerreinigung verzichten, indem sie das Schild „Be our green guest“ außen an die Tür hängen und so mithelfen, Ressourcen an Personal und Reinigungsmitteln zu sparen. Wie gut solche Angebote angenommen werden, überrascht selbst den erfahrenen Tourismusunternehmer Perauer und bestärkt ihn darin, seine Vorstellung von Nachhaltigkeit weiterhin nach außen zu tragen: „Nachhaltigkeit muss nicht langweilig, öde, fad, grau, hellbraun oder beige sein“, sagt er. „Nachhaltigkeit ist cool, lässig, bunt, fröhlich und erfrischend. Wir wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit sexy ist, und dieser Gedanke kommt bei unseren Gästen gut an.“
www.zillertalerhof.at
Die Ente darf in die Badewanne, die Wände sind bunt. Nachhaltigkeit ist im Zillertalerhof ein positives Lebensgefühl.

„Wir setzen viele Schritte, die gut für Natur und Umwelt sind.“
FRANZ-JOSEF PERAUER, ZILLERTALERHOF ALPINE HIDEAWAY
Vom Traditionshaus zur flexiblen Hotelkette

2006 öffnete das erste „Harry’s Home“ in Graz seine Pforten, weitere Häuser in ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz folgten. Hinter der Idee vom flexibel anpassbaren Angebot für (fast) jeden Gast steht die Tiroler Unternehmerfamilie Ultsch.
Wer selbst viel reist, weiß, dass die Anforderungen, die man an einen Beherbergungsbetrieb stellt, nicht immer die gleichen sind. Sie variieren je nach Zweck und Ziel der Reise, Dauer des Aufenthalts und danach, ob man alleine, mit der Familie oder mit Freund:innen unterwegs ist. Die Vielfalt an Motiven, die Menschen zu einer Reise bewegen, ist etwa für die Tirol Werbung jener Leitfaden, an dem sie sich bei ihrer Neuausrichtung orientiert hat. Für den Tiroler Tourismusunternehmer Harald Ultsch gaben die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste Mitte der 2000er-Jahre den Ausschlag, eine neuartige Hotelkette zu entwickeln. 2006 setzte er seine Idee mit dem ersten Harry’s Home in Graz um, zwölf weitere Häuser u. a. in Linz, Wien, Telfs, Zürich, München und Berlin folgten. Lienz und Salzburg erhalten in naher Zukunft ein Harry’s Home, Graz ein weiteres in der Innenstadt. Ultsch stammt aus einer Hoteliersfamilie: Das Stammhaus Schwarzer Adler in Innsbruck, das traditionsreich, aber eben auch wenig flexibel ist, führt er in vierter Generation. Seine Frau Sonja-Sophie, die Söhne Florian und Fabian sowie Tochter Valentina sind ebenfalls im Unternehmen tätig.
„ Harry’s Home“ basiert demgegenüber auf der Idee, dass Ausstattung und Dienstleistung variabel sind. „Create your stay“, lautet das Motto. „Wir bieten dem Gast die wichtigen Dinge an“, erklärt Ultsch, „und lassen ihn selbst wählen, was er haben möchte.“ So nehmen die einen alle Dienstleistungen von der Rezeption über die Bar bis zur Zimmerreinigung in Anspruch. Die anderen wohnen lieber in einem Apartment mit Küche,
Ob mit oder ohne Küche, mit oder ohne Dienstleistungen, für Familien, Geschäftsreisende oder Freund:innen – das Harry’s Home in Telfs und die anderen Standorte der Kette bieten hohe Flexibilität.
bleiben über längere Zeit und versorgen sich selbst. „Wir haben Family and Friends Zimmer für bis zu fünf Personen, große Spielzimmer für Kinder von einem bis elf Jahren, Seminarräume, Plätze für Coworking, die Natur vor der Haustür und anderes mehr.“ Manches Angebot, das in der unmittelbaren Umgebung vorhanden ist, wird eingebunden, etwa das öffentliche Schwimmbad in Telfs und weitere Sportanlagen. So können die Häuser „zu 90 Prozent gleich“ konzipiert sein und müssen nur in Details an den jeweiligen Standort angepasst werden.
NAH AN DER BAHN
Ein großer Vorteil der meist innerstädtischen Hotels ist, dass sie direkt am Bahnhof oder nur ein paar Gehminuten davon entfernt liegen. Die Anreise mit dem Zug ist also problemlos – was von Reisenden mit Klimaticket besonders gerne genutzt wird. Ein wenig anders verhält es sich beim Harry’s Home in Telfs, das dafür mit seiner Lage zwischen Seefeld, Ötztal, Mieminger Plateau und Innsbruck punktet und so für Sportbegeisterte, Kulturinteressierte und Kongressteilnehmer:innen gleichermaßen geeignet ist.

MIT SPARSAMEM UMGANG ZUR ZERTIFIZIERUNG
Neben ihrer Flexibilität zeichnen sich alle Harry’s Home Hotels dadurch aus, dass sie selbstverständlich Maßnahmen zum Klimaschutz setzen. „Man muss dazu die Welt nicht neu erfinden, sondern einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen pflegen“, sagt Harald Ultsch. Alles, was man beeinflussen kann, ist darauf ausgerichtet, vom regionalen Einkauf über die Müll-
entsorgung bis zur Verwendung von Energie. „Wir haben uns immer schon so verhalten“, erzählt Ultsch und begründet damit die Entscheidung, alle Hotels mit einem überregional gültigen Label zertifizieren zu lassen. Harry’s Home ist seither die einzige Hotelgruppe in Österreich, die für jedes Haus das EU Ecolabel erhielt. 2023 verliehen das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, die Wirtschaftskammer Österreich und die Österreich Werbung zudem den „Young Professionals: Best Practice Award“ an Harry’s Home. Solche Zertifizierungen und Auszeichnungen „beeinflussen vielleicht nicht die ultimative Kaufentscheidung“, sagt Ultsch, „aber es ist ein starkes Signal an unsere Gäste und Lieferant:innen .“
www.harrys-home.com

„Wir haben uns schon immer ressourcenschonend verhalten, daher war es auch kein Problem, eine überregionale Zertifizierung zu erhalten.“
HARALD ULTSCH, HOTELIER SCHWARZER ADLER, DAS ADLERS UND HARRY’S HOME
Unverwechselbar
und regional im Zentrum
Als Stadthotel in einer Durchreisedestination hat Das Innsbruck andere Voraussetzungen als Tourismusbetriebe in einem Wintersportort am Talschluss. Geschäftsführer Stefan Ischia setzt auf hohe Flexibilität, Unverwechselbarkeit und Unterstützung bei der Aufenthaltsgestaltung.


Ku rzfristige Planung und ein vielfältiges Angebot sind im Städtetourismus mehr gefragt denn je. Dem Gästewunsch, dass „immer alles verfügbar sein soll“, kommt Das Innsbruck mit verschiedenen Angeboten nach, erzählt Stefan Ischia. Der Pool ist 24 Stunden am Tag geöffnet, die Sauna bis Mitternacht. Dass der Hotelbetrieb mitunter energieintensiv ist, ist Stefan Ischia bewusst, ihm sei aber wichtig, ehrlich damit umzugehen. Einen Schritt, Ressourcen zu sparen, setzte er mit dem Umstieg von Gas auf Wärmepumpen und Fernwärme.
E-Mountainbikes können im Hotel ausgeliehen werden, was dem veränderten Mobilitätsverhalten der Gäste entgegenkommt. Viele reisen aus Österreich mit dem Klimaticket an und erhalten die Welcome Card bereits vorab, um bei der Ankunft den ÖPVN in der Stadt kostenlos nutzen zu können. Wer mit dem Auto kommt, lässt es in der Regel während des gesamten Aufenthalts in der Garage stehen.
Möglichkeiten, seine Tage in Innsbruck interessant zu gestalten, bietet der Aufenthaltsplaner, den Ischia auf der Website des Hotels zur Verfügung stellt. Die Empfehlungen zu Museen und Wanderungen, Skigebieten und Festivals nehmen Reisende gerne an und verbinden Städtetrip und Aktivurlaub miteinander. Zudem schätzen sie die Innsbruck Card und den Ski plus City Pass und buchen mitunter eine weitere Nacht, um alle Möglichkeiten der Region ausschöpfen zu können. Verbesserungspotenzial ortet Ischia beim Ganzjahresangebot, etwa bei den Betriebszeiten von Schwimmbädern und Bergbahnen.
GOLD, WASSER, GIN
I m Haus selbst legt Stefan Ischia Wert darauf, die Charakteristika von Innsbruck

und Tirol hervorzuheben. Das Hoteldesign spielt mit einem goldenen Pool und Goldelementen in der Junior Suite auf das Goldene Dachl an. In den Zimmern finden Gäste Flaschen und Aufsteller mit dem Hinweis auf das ausgezeichnete Innsbrucker Trinkwasser vor und in der Bar werden Tiroler Gin und Rum angeboten. Fleisch und Fisch kommen aus Österreich, weitere Produkte bis hin zu Bettwaren aus regionaler Produktion kommen nach und nach dazu.

Unverwechselbare Designelemente in den Zimmern wie ein Hängestuhl oder eine besondere Badewanne spielen hier mit hinein, ebenso Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Durch Mülltrennung in den Gästebereichen konnten 55 Prozent Restmüll eingespart werden, von der Minibar wurde auf eine Maxibar umgestellt,
Einwegprodukte wurden abgeschafft oder –wie das Beispiel der kompostierbaren Badeschlappen zeigt – durch nachhaltigere Lösungen ersetzt.
Das Ziel ist, das Österreichische Umweltzeichen zu erreichen. Das größere Serviceangebot ist ein Faktor, der den Bedarf an Mitarbeiter:innen erhöht hat. Ein anderer ist, dass mehr Beschäftigte als früher in Teilzeit arbeiten wollen. Ein wertschätzender Umgang mit den Angestellten, Dienstpläne, die vier Wochen im Voraus erstellt werden, unbefristete Verträge und höhere Löhne gewährleisten aber, dass das Personal im Hotel Das Innsbruck dauerhaft gute Rahmenbedingungen vorfindet und gerne bleibt.
www.hotelinnsbruck.com
Designelemente wie ein Hängestuhl oder eine Badewanne aus Marmor tragen zur Buchungsentscheidung bei.
„Wir sind dabei, das Reisen nachhaltiger zu machen.“
STEFAN ISCHIA, GESCHÄFTSFÜHRER HOTEL DAS INNSBRUCK
#wirsindKitzbühel
Kitzbühel soll zum Sehnsuchtsort für alle werden
Im Jahr 2020 stand der Tourismus für kurze Zeit still. Eine herausfordernde Zeit, in der sich Kitzbühel Tourismus die Frage stellte, wie Strategieentwicklung im Einklang diverser Interessen gelingen kann. Darauf aufbauend, wurde ein Markenbildungsprozess ins Leben gerufen – mit der Grundidee: Alle können sich aktiv an der Entwicklung des Freizeit-Lebensraumes beteiligen. Mittels einer angelegten Befragung, zahlreichen Interviews, Workshops und Diskussionen wurde ein Zukunftsbild geschaffen, das nun die Grundlage für strategische Entscheidungen des Aufsichtsrates von Kitzbühel Tourismus bildet.
Auch wenn sich einige gesellschaftliche Veränderungen bereits vor der Pandemie abzeichneten, so wurden sie durch diese doch teilweise verstärkt oder beschleunigt. Kitzbühel Tourismus rief daher zur gemeinsamen Destinationsentwicklung auf. Rund 70 engagierte Kitzbüheler:innen überlegten, wie sich eine Premium-Marke in einer VUCA-Welt transformiert, ohne Werte und Historie zu verlieren. Das Ziel war, eine proaktive strategische Weiterentwicklung der Marke zu forcieren, welche neue und alte Sehnsüchte der Gäste und Besucher:innen in einem konsistenten Rahmen abbildet.
TRADITION UND INNOVATION




Nach einer umfassenden Evaluation des Status quo mit über 1.200 Befragten wurde
„Gemeinsam ein Verständnis für Markenwerte sowie Identität zu kreieren und gleichzeitig den Nexus zu neuen Bedürfnissen und Trends zu schaffen, war eines der großen Ziele des Markenbildungsprozesses.“
nach intensiven und teils spannungsgeladenen Diskussionen ein großer Meilenstein geboren: ein gemeinsames Verständnis für die künftige Entwicklung des touristischen Kitzbühels. Dabei entstanden ist ein Zukunftsbild mit fünf Erfolgsmustern und einem gemeinsamen Leistungskern. Während bei bereits erfolgreichen Produkten weiter an Qualität und Spitzen-
DR. VIKTORIA VEIDER-WALSER, GESCHÄFTSFÜHRUNG KITZBÜHEL TOURISMUS
Wie Destinationsentwicklung zukunftsgerichtet gestaltet werden kann, zeigt das co-kreative Pilotprojekt #wirsindKitzbühel.
Teilnehmer:innen Markenbildungsprozess
leistungen gearbeitet werden soll – Stichwort „Outdoor Active“ und „Culinary Delights“ –, wurden im Zukunftsbild auch Trendthemen berücksichtigt, wie das noch in den Kinderschuhen befindliche Thema „Workation“. Alles, was aus diesem neuen Zukunftsbild von Kitzbühel Tourismus entsteht, dient einem Zweck: Kitzbühel als Lebensraum noch attraktiver zu machen (My preferred Place for Being) – für Gäste ebenso wie für Einheimische, Zweitheimische und Mitarbeiter:innen.
SICHTBARE ERFOLGE
Um auch Taten folgen zu lassen, wurde in spezifischen Arbeitsgruppen an konkreten Leuchtturmprojekten und Produkten gearbeitet, die auf alle Erfolgsmuster einzahlen. Besonders erfolgreich gestaltete sich das Forcieren von Quick Wins und konkreten Pro -
jekten, wie beispielsweise die wöchentlich stattfindende Sommerveranstaltung „PURA VIDA“, „KITZ Kulinarik x Piemont“ im Oktober, die Nachwuchsinitiative „Kitzbühel Klassik“ gemeinsam mit Elīna Garanča und der Wiener Staatsoper sowie eine regionsübergreifende Produktentwicklungsinitiative im Bike- und Running-Segment.
OWNERSHIP UND START-UP-FLAIR








Um dem Spirit darüber hinaus auch künftig Rechnung zu tragen, wurde ein Steuerungsgremium ins Leben gerufen, welches unkompliziert und schnell Anschubfinanzierungen und Unterstützung von möglichen Leuchtturmprojekten bereitstellt. Ein erstes Zukunftsprojekt mit Namen „Metagonia“ – eine Konferenz zum Thema digitale Welten – ist bereits für Oktober 2023 in Kitzbühel geplant.
5 ERFOLGSMUSTER
• Outdoor Active
• Inspiring Networks

• Culinary Delights
• New Premium
• The Best Workaktion
Experience in the Alps
Alle Informationen zum Markenbildungsprozess finden Sie unter marke.kitzbuehel.com

KITZBÜHEL TOURISMUS

Hinterstadt 18, 6370 Kitzbühel

Tel.: 05356 66660
E-Mail: info@kitzbuehel.com
www.kitzbuehel.com
„WIR MÜSSEN THEMEN PROAKTIV ANGEHEN“








Um die besten Antworten auf aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen des Tourismus in Tirol zu finden, hat sich die Tirol Werbung neu aufgestellt. Die Leitlinien dazu gab der Tiroler Weg vor, neben Marketing spielen Forschung und Innovation sowie Nachhaltigkeit und Partnerschaften die Hauptrolle, erzählt Geschäftsführerin Karin Seiler im Interview.

Das Gespräch führte Esther Pirchner

SAISON: Die Tirol Werbung hat sich neu strukturiert. Ist die Kernaufgabe dieselbe? KARIN SEILER: Das Herzstück der Tirol Werbung ist Marketing und wird es auch immer sein. 50 Prozent aller Ressourcen und 70 Prozent des Budgets fließen in diesen Bereich. Von diesen Marketinggeldern wenden wir schon heute 90 Prozent im Online-Marketing auf, wo man sehr zielgruppengenau arbeiten kann. Wir sind vom klassischen Marktmanagement weggegangen. Stattdessen haben wir über die Motivforschung die drei wichtigsten Zielgruppen ausgemacht: verbundene Energiebündel, anspruchsvolle Reisefans und erholungsuchende Familien. Unsere Mitarbeiter:innen denken sich in diese Zielgruppen hinein und schauen, welches Produkt sie brauchen.
Welche anderen Bereiche decken Sie ab? Im Bereich Forschung und Innovation betreiben wir Marktforschung und kümmern uns um das Themenmanagement. Neu gegründet wurde das Future Lab, in dem fünf Mitarbeiter:innen an den langfristig wesentlichen Themen arbeiten. Sie kümmern sich jeweils um ein bestimmtes Problem und führen dazu Projekte mit vielen Stakeholdern durch.
Der andere wichtige Bereich umfasst Nachhaltigkeit und Partnerschaften, dazu gehören Cine Tirol, das Convention Bureau Tirol und das Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit, in dem mittlerweile acht Personen arbeiten. Seine Gründung basiert auf der Erkenntnis, dass wir bestimmte Themen proaktiv angehen müssen. Auch da pflegen wir viele verschiedene Partnerschaften auf unterschiedlichen Ebenen.
Stichwort Nachhaltigkeit: Die TVBs sind seit Kurzem gesetzlich verpflichtet, Nachhaltigkeitskoordinato r:innen zu beschäftigen. Welche Rolle kommt der Tirol Werbung dabei zu? Einen
KARIN SEILER, GESCHÄFTSFÜHRERIN

Teil unserer Aufgaben sehen wir – im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit – darin, die Koordinator:innen miteinander zu vernetzen. Wir versuchen, dort zu helfen und zu informieren, wo für alle der gleiche Bedarf besteht, zum Beispiel in Bezug auf Zertifizierungen oder die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten.
Welche Themen bearbeitet die Tirol Werbung vorrangig? Im Tiroler Weg sind vier Leitlinien und 16 Handlungsfelder festgelegt. In Absprache mit dem Land Tirol kümmern wir uns um drei große Themenkreise: Arbeitskräfte, Klimawandel und Mobilität. Dazu wurde die Tirol Werbung mit mehr Geld ausgestattet. Das zeigt mir, dass die Politik diese Themen ernst nimmt.
Bleiben wir gleich beim Arbeitskräftemangel –ein Dauerbrenner? Ja, das Thema wird uns noch über Jahre beschäftigen. Im Tourismus ist der Bedarf um 40 Prozent gestiegen, auch weil das Angebot intensiviert wurde und viele Betriebe auf eine höhere SterneKategorie umgestiegen sind. Wir haben uns mit AMS und Wirtschaftskammer vernetzt
und arbeiten derzeit an einem Tool, mit dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer:innen niederschwellig und einfach in Kontakt treten können und das wir auch im Ausland für interessierte Arbeitsuchende einsetzen können. Ein weiteres Problem ist nämlich, dass sich das gastronomische Angebot bei einem Rückgang von Arbeitskräften reduzieren wird. Und wenn die Gäste keine Restaurants mehr vorfinden, kann das zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Urlaubserlebnisses führen.
Wo setzt die Tirol Werbung beim Thema Klimawandel an? Auf der Angebots- und Produktseite ist die Frage: Wie gehen wir langfristig damit um, wenn die schneearmen Winter häufiger werden und die Nachfrage nach Skifahren stabil bleibt oder steigt?
Und es geht um die Tourismusgesinnung. Immer mehr sagen, dass wir, statt Skigebiete zu erweitern und zusammenzuschließen, nicht mehr größer werden sollten.
Hier spielt auch die Frage der Mobilität herein. Es geht nicht nur um die Umstellung auf die Schiene, auch Qualität und Angebot von ÖBB und VVT müssen verbessert werden. Zugleich denken wir die letzte Meile und die Mobilität vor Ort mit. Mit dem VVT verfolgen wir die Vision einer gemeinsamen Tirol Card, die den öffentlichen Verkehr inkludiert. Solche Ideen entstehen, indem wir die Perspektive des Gastes einnehmen, der auch keine Tourismusverbands-Grenzen kennt.
In welchem Zeitraum lassen sich solche Pläne umsetzen? Manche Themen werden uns Jahre beschäftigen, andere lassen sich rasch erledigen. Wir nehmen den Tiroler Weg sehr ernst und haben deswegen im Unternehmen auch die Ressourcen aufgebaut, um die Ziele zu erreichen.
Vielen Dank für das Gespräch.
„Unser Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit kümmert sich um die drei großen Themenkreise: Arbeitskräfte, Klimawandel und Mobilität.“
GROSSE LEINWAND IN TIROL
Der Bergdoktor, James Bond und Ed Sheeran – sie alle haben in Tirol gedreht. Die Geschichten sind aber noch lange nicht zu Ende erzählt. Ein Gespräch mit Johannes Köck, Leiter der Cine Tirol Film Commission, und Angelika Pagitz.
Wie oft gehen Sie ins Kino, Herr Köck? KÖCK: S ehr oft. Für mich war Kino im Kulturbereich immer schon das Spannendste. Speziell das Leokino und der Cinematograph – was die für Filme nach Innsbruck gebracht haben, das war für uns junge Menschen damals großartig.
Was wird aktuell in Tirol produziert? KÖCK: Mitte April hatten wir eine große Streamerproduktion – einen Weihnachtsfilm – bei uns in Tirol. Es ist natürlich kühn, Mitte April einen Weihnachtsfilm zu produzieren. Aber wir können am Gletscher bis in den Mai hinein noch winterliche Rahmenbedingungen schaffen. Anfang Mai hat eine Tiroler Spielfilmproduktion begonnen, die zur Gänze in Tirol realisiert wird. Dazu kommen noch die zahlreichen Werbefilmproduktionen, Dokumentarfilme und Musikvideos.
Was fällt für Sie in die Vorbereitung eines Films? KÖCK: Wir sind vor allem in der Phase der Akquisition tätig, das heißt, wir reisen zu wichtigen Filmfestivals – Berlin, Cannes, die Diagonale in Graz, im Herbst nach London –, treffen dort Filmschaffende und schlagen ihnen Tirol als möglichen Drehort vor. Wenn ihnen
das gefällt, helfen wir mit unserem Locationarchiv mit rund 700 potenziellen Drehorten. Für ausgewählte Filmprojekte können wir dann außerdem einen Produktionszuschuss leisten. In der Phase verknüpfen wir die Produzent:innen mit den Tiroler Filmschaffenden, die dann einzelne Positionen besetzen können. Während der Dreharbeiten machen wir Setbesuche und Pressetermine vor Ort. Wir begleiten das Projekt bis zur Premiere. Es gibt Filme, mit denen sind wir sieben Jahre oder in Einzelfällen sogar länger beschäftigt.
Wenn wir über Drehorte sprechen – eines fehlt ja in Tirol, das ist ein Filmstudio. KÖCK: Genau, ein professionelles Filmstudio fehlt. Das würde das Filmland Tirol noch mal einen großen Schritt voranbringen. Wir sehen das weltweit: Filmstudios sind aus mehreren Gründen ein Anziehungspunkt: Als Back-up für Schlechtwettersituationen oder im Fall von schwer zugänglichen Drehorten bzw. im Rahmen von „Virtual Productions“ kann man vieles im Studio vorbereiten. Unsere Vision ist, dass sich um dieses Filmstudio dann andere Gewerke ansiedeln: Kamera, Licht, Kostüm – sodass man von einem Standort aus vieles beziehen kann, das für die Filmproduktion wertvoll ist.
Nachhaltigkeit wird auch am Filmset immer mehr gefordert. Was heißt Green Filming? PAGITZ: Die Filmbranche wird als eine der CO2-intensivsten gesehen – zum Beispiel sind oft viele Flüge notwendig. Green Filming setzt Maßnahmen, um Filme nachhaltiger zu produzieren. Das geschieht zum Beispiel durch Mülltrennung auch am Set, Anreise mit dem Zug, regionale und Bio-Lebensmittel beim Catering. Das kann man bei weiteren Bereichen umsetzen – zertifiziertes Make-up, Kostüme secondhand kaufen oder sich an Fundi bedienen.


Was heißt das konkret für Tirol? PAGITZ: Wie haben ja unsererseits mit Green Filming Tirol schon eine Informationsplattform für nachhaltige Drehvorhaben in Tirol geschaffen. Da findet man zum Beispiel zertifizierte und nachhaltige Hotels, regionale Lebensmittelhersteller und weitere zweckdienliche Informationen. Seit 2017 gibt es außerdem das österreichische Umweltzeichen für Green Producing. Die erste Produktion, die in Tirol mit diesem zertifiziert wurde, war die TV-Serie „Soko Kitzbühel“ (2019).

Kommt jetzt der Green-Filming-Boom? PAGITZ: Durch das neue Anreizsystem können Produktionen auf einen Green-Filming-Bonus zurückgreifen, dadurch wird das Thema auch immer allgegenwärtiger. Denn wenn man die fünf Prozent abholen will, muss man einfach gewisse Kriterien erfüllen. Das ist sehr viel Geld und darauf werden die Produzent:innen auch achten. Ich bin überzeugt davon, dass es zum Standard wird, Filmproduktionen unter nachhaltigen Aspekten zu realisieren.
Welche Geschichte müsste man in Tirol noch erzählen?
KÖCK: Das ist zum Beispiel die Lebensgeschichte des Pfarrers Franz Senn. Er wurde im Ötztal geboren und
war in Vent als Priester tätig. Senn hat die Armut der Menschen auf über 2.000 Meter erlebt und überlegt, wie man das verbessern kann. Er hat gegen viel Widerstand Gäste nach Vent gebracht und das Tal geöffnet. Das ist eine Geschichte, die bis heute nachwirkt. Mit solchen Ideen treten wir auch an Produzent:innen und Drehbuchautor:innen heran und versuchen, das anzuschieben. Ich bin ein großer Fan von wahren Geschichten, meiner Ansicht nach ergeben die die besten Filme.
Welche Ideen gehen noch mit Ihnen spazieren und auf den Berg? KÖCK: Es gibt zwei Begriffe, die mich gerade begleiten – zum einen Dankbarkeit, dass die Idee der Cine Tirol Film Commission so aufgegangen ist. Das andere ist die Freude. Wenn der Film auf der großen Leinwand ist und man erkennt, welche Rolle das Filmland Tirol und die Unterstützung durch Cine Tirol gespielt haben, dann ist das ein unheimlich freudvolles Gefühl.

Vielen Dank für das Gespräch.

TOURISMUSFORUM
Grüner Branchentreff: Tiroler Tourismusforum 2023 im Zeichen der Nachhaltigkeit
Der grüne Teppich am Eingang ließ es schon vermuten: Das Thema Nachhaltigkeit bildete das Leitthema des 45. Tiroler Tourismusforums am 21. Juni. Einig waren sich die Vortragenden darin, dass Nachhaltigkeit nie eindimensional betrachtet werden kann, sondern immer aus mehreren Aspekten besteht. Deshalb stand auch das Tourismusforum heuer unter dem Motto „50 Shades of Green. Wie nachhaltiges Wirtschaften den alpinen Tourismus prägt“. Rund 300 Gäste aus der Tourismusbranche, Wirtschaft und Politik folgten der Einladung der Tirol Werbung in den Congresspark Igls.
Für Tourismuslandesrat Mario Gerber war es eine Premiere – er war heuer zum ersten Mal in dieser Funktion beim Tourismusforum. Seine Botschaft an die Branche: Optimistisch in die Zukunft zu schauen und trotz Herausforderungen rund um Personal und Klima den Wandel als Chance zu begreifen. Auf verschiedenen Schattierungen von Nachhaltigkeit und die Auswirkungen auf die Betriebe ging im Anschluss Keynote-Speakerin Xenia zu Hohenlohe ein.
A nschließend erläuterte die Geschäftsführerin der Tirol Werbung Karin Seiler die neue Strategie der Landestourismusorganisation und die damit verbundene Strukturanpassung, um den Zielen der
Tourismusstrategie „Tiroler Weg“ bestmöglich gerecht zu werden. Teil dieser neuen Struktur ist ein eigenes Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit, das sich mit Anfang des Jahres formiert hat. „Dort bearbeiten wir die Nachhaltigkeit in ihrer Gesamtheit und berücksichtigen sowohl die ökologischen und ökonomischen als auch die sozialen Aspekte. Daher haben wir neben Themen wie der Mobilität, wofür wir ein innovatives, ökologisches Anreisetool entwickelt haben, auch die Arbeitskräfte im Fokus“, erläuterte Seiler. Zudem wurde ein Future Lab gegründet, das sich um übergeordnete Zukunftsthemen kümmert – unter anderem wie man mit klimawandelbedingt schneearmen Wintern umgeht.
Das Thema Nachhaltigkeit prägte aber nicht nur die Veranstaltung, sondern bildet auch das Hauptkriterium für den Tourismuspreis Tirol Touristica, der heuer an den vom TVB Osttirol ins Leben gerufenen Iseltrail ging. Den Nachwuchspreis erhielt Anna Servis, Gründerin und Betreiberin des Restaurants milsano in Mils (mehr dazu auf den Seiten 70 und 71).
S chon im Vorfeld des Tourismusforums diskutierten Expert:innen im Rahmen der Initiative Perspektiven Tirol der Lebensraum Tirol Holding darüber, wie nachhaltiges Urlauben gelingen kann.
Karin







Philip Haslwanter (GF Bergbahnen Kühtai), Rainer Schultes (Obmann TVB Pitztal), Alexander von der Thannen (Obmann TVB Paznaun-Ischgl, v. l.)


Tirol,
Benjamin Kneisl (Obmann Ötztal Tourismus), Christian Schnöller (GF Area 47) und Andreas Jenewein (Obmann TVB Silberregion Karwendel, v. l.)




Landwirtschaftskammer-Präsident

Josef Hechenberger und Landesbäuerin
Helga Brunschmid

Hermann Erler (GF Tux-Finkenberg), Roland Volderauer (GF TVB Stubai), Ingrid Schneider (Tirol Werbung), Adrian Siller (Obmann TVB Stubai, v. l.).


Thomas Schroll (GF Nordkettenbahnen) mit der Hotelierfamilie Ultsch: Harald, Valentina und Florian (v. l.)

Michael Kohler (GF TVB Lechtal), Geschäftsführer Ronald Petrini und Marketingleiterin Sandra Schneider (beide TVB Reutte), Johannes Köck (Leiter Cine Tirol, v. l.)







Gewinner:innen des Tirol Touristica
Das Voting ist abgeschlossen, die Jury hat ihr Urteil gefällt. Die diesjährigen Gewinner:innen des Touristica-Preises stehen fest. Das Projekt Iseltrail holt die begehrte Auszeichnung nach Osttirol. Den Nachwuchspreis konnte sich dieses Jahr Anna Servis mit ihrem Restaurant milsano in Mils bei Innsbruck sichern.
Das Projekt Iseltrail
Entlang des nachhaltigen Weiterwanderweges kann der Osttiroler Gletscherfluss hautnah und umweltschonend erlebt werden.
DIE WICHTIGSTEN
KRITERIEN FÜR DEN
HAUPTGEWINN:
+ Positiver Beitrag zu Klima-, Natur- oder Umweltschutz
+ Förderung des bewussten Miteinanders von Gästen und Einheimischen
+ Beitrag zur regionalen Wertschöpfung
+ Beitrag zum familiengeprägten und kleinstrukturierten Tourismus
+ Beitrag zur Mitarbeiter:innenbindung und -zufriedenheit
Der Iseltrail startet in Lienz an der Mündung der Isel in die Drau. Von dort zieht sich der 80 Kilometer lange Weitwanderweg bis zum Gletschertor des Umbalkees auf 2.500 Höhenmeter. I nitiiert vom Tourismusverbund Osttirol in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Hohe Tauern wurde dieser im Oktober 2022 feierlich eröffnet. Ziel war es, den Wildfluss für Gäste und Einheimische mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz erlebbar zu machen. Laut Österreich Werbung sei der Trail eine „Errungenschaft im Naturerlebnisbereich“ und wurde zu einem der Leitthemen des letzten Jahres ernannt.


NACHHALTIG AM WEG
Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit befinden sich an jedem der fünf Etappenziele und an allen Orten entlang der Strecke Trinkwasserbrunnen. Damit sollen Plastikflaschen und Müll vermieden werden. Ein weiterer Beitrag für die Umwelt wird durch die kostenlose Benützung der öffentlichen Postbusse geleistet, um
klimafreundlich an die Standorte der jeweiligen Etappen zu gelangen. Dadurch soll die Aufenthaltsdauer in den Herbergen verlängert und Individualverkehr reduziert werden.
Bereits in den vergangenen Jahren wurde ein Zuwachs an Nächtigungen in der Iseltrail-Region verzeichnet. Manche Betriebe können mittlerweile die Hälfte ihrer Nächtigungen im Sommer auf den Weitwanderweg zurückführen. Auch die Gastronomiebetriebe und Jausenstationen profitieren von der erhöhten Frequenz.
Ganz im Sinne des Hauptmotives „Die Natur in Szene und in Wert setzen“ kann entlang des Iseltrails auf Aussichtsplattformen die Umgebung bewundert werden. Ein besonderes Highlight ist die Hängebrücke mit einer Länge von 110 Metern über die Iselschlucht im Virgental.

Die Position Osttirols als Entschleunigungs- und Erholungsregion soll mit diesem Projekt weiter gestärkt werden. Gerade auch bei inländischen Gästen aus Nordtirol kommt der Iseltrail gut an. Darauf sei man besonders stolz.

Nachwuchspreis-Gewinnerin
Der Nachwuchspreis geht in Kooperation mit der Hypo Tirol Bank an eine Einzelperson bis maximal 30 Jahre, die mit ihrer Arbeit den Tiroler Tourismus bereichert und Mehrwert schafft.
Die gelernte Touristikerin Anna Servis kann wohl als absolutes Nachwuchstalent bezeichnet werden. Trotz schwieriger Anfänge konnte sie mit ihrer Idee bestehen und verzaubert in ihrem Café und Restaurant milsano im Milser Dorfkern mit Regionalität, Qualität und bestem Service. Besonderheit ist der einzigartige Feuergrill im Zentrum des Lokals, wo mit Buchenholz heimisches Fleisch, Rippchen und Burger am offenen Feuer zubereitet werden.
SCHWERER START
Mit bereits 24 Jahren wagte Anna Servis mit ihrer Schwester Julia den Schritt in die Selbstständigkeit. Anfänglich begann die Reise zu fünft. Doch einen Monat vor Eröffnung stiegen zwei der Gesellschafterr:innen aus dem Projekt aus. Die Eröffnung des Lokals verlief aber trotzdem gut, die Gäste „überfluteten“ das Restaurant förmlich. Die nächste Herausforderung ließ jedoch nicht auf sich warten. Der Sous-Chef kündigte schon wenige Tage nach der Eröffnung. Annas Schwester musste in der Küche einspringen. Diese konnte nach einem kurzen Crash-Kurs des Küchenchefs Marco den Platz fast nahtlos einnehmen. Ein Start, der wohl trotz Erfolg alles andere als leicht war.
REGIONAL IN FAMILIENHAND
Mittlerweile führt die junge Gastronomin das milsano nur mehr mit ihrer Schwester. „Im Tourismuskolleg Innsbruck entdeckte ich meine Leidenschaft für den Tourismus. Darauf aufbauend konnte ich in den letzten Jahren der Selbstständigkeit meine Qualitäten als Gastgeberin und Gastronomin stetig weiterentwickeln“, beschreibt Anna Servis. Besonders stolz sei sie auf ihr motiviertes Team und die Regionalität in ihrem Restaurant. Brot, Gemüse und Fleisch bezieht sie von Betrieben aus der Region, und das wüssten ihre Gäste zu schätzen.
Steckbrief:
ANNA SERVIS

milsano – Cafe I Bar I
Restaurant I Feuergrill
Dorfplatz 1, 6068 Mils




