KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
Der Hype um die Technologie schreckt viele ab. Wo die wahren Chancen liegen


KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
Der Hype um die Technologie schreckt viele ab. Wo die wahren Chancen liegen

Lisa Stuhler verfolgt einen kühnen Plan: Fast ohne Eigenkapital will sie ein etabliertes Unternehmen kaufen. Ihr Kalkül: Zehntausende Firmen brauchen einen Nachfolger

SetzenSie auf hohe Leistung im Unternehmen. Mitdem neuenvollelektrischen CLA und einer Reichweitevon bis zu 792 km (WLTP)* erreichen Sie mühelosauch weit entfernte Außentermine.Dank demKI-gestützten InfotainmentsystemMBUX bleiben Sie dabei auch so erreichbar,als wärenSie im Büro.
Eine Klasse für sich.
Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ Technologie|Energieverbrauch kombiniert (WLTP): 14,1–12,2 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0g/km;CO₂-Emissionsklasse: A*
*Die tatsächliche Reichweite hängt vonzahlreichenFaktoren wie insbesondereder individuellen Fahrweise, Umgebungsbedingungen, dem Alterungsprozess derBatterie, Nebenverbrauchern, wie beispielsweise der Klimatisierung, Sonderausstattungen, Bereifung, Zuladung, demStreckenprofil ab und kann daher vomangegebenenWLTPWert abweichen.


Es ist viel los in der deutschen Wirtschaft – und ebenso in unserem Magazin.
In zwei Beiträgen über künstliche Intelligenz zeigen wir den Nachholbedarf, aber auch eine große Chance für unsere Industrie. Im Gespräch mit der Kieser-Witwe und dem heutigen Chef des Fitnesskonzerns wird klar: Nachfolge ist schwer, aber mit Vernunft machbar. Und eine junge, kluge Unternehmerin beweist: Mittelständler kann man sogar ohne viel Eigenkapital erwerben –und dadurch retten. Viel Freude beim Lesen und Nutzen.
Kennen Sie schon unseren Newsletter?
Abonnieren Sie ihn hier:
Ihr Team von ZEIT für Unternehmer
www.zeitfuerx.de/unternehmer
MITTELSTANDSSTUDIE
Wer in KI investiert, geht eine Wette auf die Zukunft ein. Wann lohnt sich das Risiko? 6
TECHNOLOGIE
Deutschland hat das Rennen um KI noch nicht verloren, glaubt der Gründer Viacheslav Gromov. Dabei setzt er ausgerechnet auf den Mittelstand 12
KI-KOLUMNE
Wer einen Handwerker buchen will, bekommt das Angebot bald von dessen schlauen Assistenten 16
WIRTSCHAFTSPOLITIK
Die Bundesregierung pumpt Milliarden in die Infrastruktur, Unternehmen hoffen auf Aufträge. Aber mehrere Probleme bremsen den Plan 18
WETTBEWERB
Der Industriebäcker Harry-Brot expandiert immer weiter. Überrollt er jetzt die kleinen Betriebe? 22
DOPPEL-INTERVIEW
Gabriela Kieser und ihr Nachfolger Michael Antonopoulos erklären, warum man leiden muss, um Erfolg zu haben 26
DIE ERFINDUNG MEINES LEBENS
Eine Drohne, die Rehkitze rettet 32
FOTOSTORY
Zu Besuch bei einem Unternehmer, der in der Provinz Schreibtische und Betten für Großstädter herstellt 34
TITELTHEMA & SCHWERPUNKT FINANZIERUNG
Tausende Mittelständler finden keine Nachfolger und stehen zum Verkauf. Wie man solch eine Firma übernimmt – auch ohne viel Eigenkapital 40
Unterwegs mit einem Fintech-Unternehmer, der Bargeld endgültig überflüssig machen will 48
Der Klimawandel kann Unternehmen ihre Gewinne kosten. Wieso sichert sich niemand dagegen ab, obwohl es dafür sogar Fördermittel gibt? 52
KLIMACHECK
Die Vorstände der HHLA haben ihre Umweltziele zu 580 Prozent erfüllt und bekamen dafür einen schönen Bonus. Und wie hilft das dem Klima? 56
NACHHALTIGKEIT
Ein Unternehmer dokumentiert weiter akribisch die Klimawirkung seiner Firma, obwohl er nicht mehr müsste. Ist der von Sinnen? 58
WELTWIRTSCHAFT
Die geopolitischen Krisen machen vor allem den Maschinenbauern schwer zu schaffen. Zwei Unternehmer halten dagegen. Was kann man von ihnen lernen? 62
TO-DO-LISTE UND IMPRESSUM 66
KI-UNTERNEHMER VIACHESLAV GROMOV, SEITE 12

Sie wollen viele Menschen gesünder machen – und manche zu Millionären S. 26
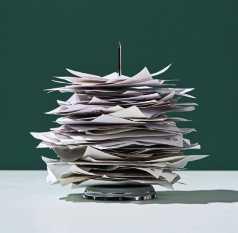
Wenn die Papierberge wachsen, steckt oft Brüssel dahinter S. 58
Wo die Firmen ihren Sitz haben, die in dieser Ausgabe vorkommen
Olaf Klinger
Senior Media Consultant Industrie, Mobilität & Logistik +49 160-3686302 olaf klinger@zeit de
Diese Ausgabe enthält in Teilauflagen Publikationen von folgenden Unternehmen: Deutsches Kinderhilfswerk e. V., 10117


talent.zeit.de/ ansprechpartner/ Jetzt Ansprechpersonfür Ihre Branche finden!

fünf Jahren voll auf KI gesetzt
KI ist in den Unternehmen angekommen, aber manche Manager verschlafen den Trend. Und viele rätseln noch: Wie lässt sich mit der Technologie Geld verdienen?
Jetzt zeichnet sich ab, wo sie hilft – und wo eher nicht
VON NELE JUSTUS
Wer mit einem Fernbus der Marke Flix in die Ferien fährt, merkt womöglich gar nicht, wie viel Technologie hinter der Reise steckt. Wenn man stundenlang durch die Nacht fährt, die Rückenlehne nur leicht nach hinten gekippt, den schnarchenden Sitznachbarn neben sich, ist es einem wahrscheinlich egal, dass dem Busfahrer eine künstliche Intelligenz geholfen hat, die schnellste Route zu finden, als ein Stau anstand. Dass der Preis, den man fürs Ticket gezahlt hat, von einer KI ermittelt wurde, damit die Busse möglichst vollständig ausgelastet sind, und dass es eine KI war, die berechnet hat, welche Busse wo und wann eingesetzt werden, damit man von Aachen oder Zwickau bis nach Cannes oder Rimini reisen kann.
»Als Flixbus 2013 an den Start ging, hat man die Netzwerkplanung noch mit einer Excel-Tabelle gemacht«, sagt Hanna Huber, die Technologiechefin des Münchner Unternehmens. Damals gab es bei Flix auch nur 300 Direktverbindungen, alle innerhalb Deutschlands. Heute sind es 400.000 Busverbindungen täglich, überall auf der Welt. Da kommt man mit einer Excel-Tabelle
Wnicht mehr hinterher. Also haben Hubers Leute ein KI-System entwickelt, das bei der Netzwerkplanung unterstützt. Die Algorithmen lernen anhand von Daten wie den tatsächlichen Fahrzeiten, Baustellen auf der Strecke oder Standzeiten an den Haltestellen und helfen dann beispielsweise dabei, dass Flix das Set von Buslinien mit zehn statt zwölf Bussen bedienen kann – und die Fahrer dennoch die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten einhalten.
KI, die nicht halluziniert oder von der Arbeit ablenkt, sondern sich wirklich rechnet: Danach suchen viele Firmen im Moment. Das zeigt die große Mittelstandsstudie von ZEIT für Unternehmer und der Stiftung In guter Gesellschaft, deren Ergebnisse wir in dieser und den beiden vorangegangenen Ausgaben als Teil unserer Initiative »Deutschland gestalten« vorstellen. Für die Studie hat das Analyse- und Beratungsunternehmen Aserto Unternehmerinnen und Unternehmern aus ganz Deutschland mehr als 30 Fragen gestellt, mehr als 1.000 haben sich beteiligt.
Dabei zeigt sich, dass die Firmenlenker im Land bei Weitem nicht so skeptisch auf den digitalen Fortschritt blicken, wie man es

»Nur weil KI ein Buzzword ist, werden wir sie nicht überall einbauen«
Hanna Huber, CTO von Flix, sieht KI als eine weitere Technologie, die sich nur lohnt, wenn sie einen Mehrwert bietet
Unsere Mittelstandsstudie zeigt: 72 Prozent der Unternehmer setzen KI bereits ein. Die Mehrheit von ihnen experimentiert aber noch damit herum
vielleicht erwartet hätte. Etwa drei Viertel der Befragten setzen bereits KI ein. Sie begegnen der neuen Technologie überraschend optimistisch, und etwa zwei von drei Befragten bewerten sie als Chance für den Standort Deutschland, für ihr Unternehmen und auch für sich selbst (siehe Grafik auf Seite 9).
Allerdings experimentiert bisher ein Großteil mit der neuen Technologie, nur 30 Prozent der Befragten setzen sie systematisch ein. Die größeren Unternehmen tun sich damit deutlich leichter als die kleineren. Oft mangelt es noch an der richtigen Strategie. Zu komplex finden viele das Thema, ihnen fehle die Zeit oder das Know-how, um sich damit auseinanderzusetzen. »Die Vielzahl der Möglichkeiten ist herausfordernd«, kommentiert ein Teilnehmer der Umfrage.
Viele Unternehmer suchen deswegen den Austausch mit anderen – etwa im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Dort findet an einem Sommertag der KI-Gipfel statt, den die Berliner Beratungsfirma A11 ausrichtet, die normalerweise Start-ups und Mittelständler bei Wachstum und KI-Strategie unterstützt. Sie preist das Event als »wichtigste Bühne für angewandte KI« an und als »Treffpunkt für Macher«, mit »praxisnahen Use Cases«, »Quick Wins« und »Hands-onSessions mit Experten«.
wir nicht anfangen, sie überall einzubauen.« Und: »Wenn man versucht, jeden Ball zu erwischen, der da rumfliegt, vergisst man schnell, dass man ein Kerngeschäft hat und dort das Geld verdienen muss.«
Das Kerngeschäft von Flix ist, Menschen von A nach B zu transportieren. »Die Leute buchen uns, weil wir sie zu attraktiven Preisen durch die Welt fahren. Das überzeugt sie –und nicht, wie wir dahin kommen«, sagt Huber. Mehr als 90 Millionen Fahrgäste in 44 Ländern waren das im vergangenen Jahr. Blickt man in die Bilanz für 2023, sieht man: Zwar machte Flix damit rund zwei Milliarden Euro Umsatz und erzielte mit seinem operativen Geschäft einen Gewinn, trotzdem blieb unterm Strich ein Verlust übrig, wenn man Steuern, Zinskosten und besonders die Abschreibungen auf Busse abzieht. Das spiegelt wider, wie hart umkämpft der Markt ist, in dem das Unternehmen mit seinen grünen Bussen und Zügen agiert. »Wir bieten sehr günstige Preise an«, sagt Huber. Deswegen ist das Volumen groß, aber die Marge klein.
experimentelle Nutzung systematische Nutzung bisher keine Nutzung
aller Befragten, die KI nicht nutzen, sehen in ihr eine Chance für ihr Unternehmen
Eine davon ist Hanna Huber. In einem Raum im zweiten Stock stehen Menschen in Anzughosen und mit hochgekrempelten Hemdsärmeln dicht gedrängt bis zur Tür, um zu hören, was sie zu sagen hat. Viele haben ihr Handy gezückt, um Notizen oder Fotos von den Charts zu machen, die Huber hinter sich an die Wand wirft. Huber ist Pragmatikerin, denkt stets lösungsorientiert, redet immer Klartext und lässt sich selten aus der Ruhe bringen. Deswegen stimmt sie nicht so recht ein in die KI-Euphorie, die hier um sich greift. Seit 20 Jahren begleitet sie Unternehmen wie die Handelsplattformen Otto und Zalando bei der digitalen Transformation. Für sie ist KI »auch nur eine Technologie«. Sie will keine von diesen Storytellern sein, die gerade die Feeds auf LinkedIn vollschreiben und KI als Heilsbringer anpreisen. »Ja, es ist total sinnvoll, sich damit zu beschäftigen«, sagt Huber. Aber sie sagt auch: »Nur weil KI ein Buzzword ist, werden
Für Hubers Arbeit heißt das, dass sie mit ihren 500 Tech-Mitarbeitern immer versuchen muss, die technologisch beste und gleichzeitig kostengünstigste Lösung zu bauen. KI ist dabei ein Mittel zum Zweck, das Huber nur einsetzen will, wenn es nachweislich Mehrwert schafft. Also etwa in der Netzwerkplanung. Oder bei der Preisgestaltung. Auch im Customer-Service werde KI bei Flix relevanter. »Spracherkennung, Übersetzungen, das Zusammenfassen von längeren Nachrichten, all das sind Paradebeispiele, bei denen man generative künstliche Intelligenz gut nutzen kann«, erklärt Huber. In Indien und Amerika lässt sie gerade zwei unterschiedliche Systeme gegeneinander laufen und testet, wie gut sie die Inhalte verstehen und ob sie tatsächlich die Probleme der Kunden im Chat lösen. Auch die Dokumentenablage oder interne Einkaufsprozesse könne man mit künstlicher Intelligenz automatisieren, um die Fachabteilungen zu entlasten. »Da sind wir noch auf der Reise.«
Auf der Reise zu sein, bedeutet auch: experimentieren. Schauen, welche Tools es gibt und wie man sie für sich nutzen kann. »Wir stecken in einer Phase, in der der
Markt für KI-Lösungen explodiert«, sagt Huber. »Wir wollen uns nicht zu früh auf eine Sache einschießen, die in ein, zwei Jahren wieder überholt sein kann. Lieber bewahren wir uns eine gewisse Unabhängigkeit.« Am Ende von Hubers Vortrag steht deshalb das Plädoyer, sich nicht von FOMO, der fear of missing out, anstecken zu lassen. Und man spürt ein Aufatmen im Raum. Weil bei all dem Gerede darüber, wie KI die Wirtschaft und die Welt verändern wird, viele die Angst erfüllt, sie hätten den Anschluss schon verpasst.
Einer, der das gut einschätzen kann, ist Sigurd Schacht. Der Professor ist der Studiengangsleiter für Angewandte Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation an der Hochschule Ansbach. Beim Programmieren und Auswerten seiner Forschungsexperimente lässt er sich regelmäßig von KI-Agenten unterstützen. Und auf dem Weg von der Arbeit nach Hause unterhält er sich in seinem Auto gern mit ChatGPT. Seit drei Jahren hilft er mit dem staatlich geförderten Digitalzentrum Franken mittelständischen Unternehmen bei KI-Projekten. Seine Beobachtung: »Verglichen mit den Großkonzernen, hängt der Mittelstand in etwa fünf Jahre hinterher.« Ist es deshalb schon zu spät?
Nein, meint Schacht. »Die deutschen Unternehmen, all die Marktführer und Hidden Champions, sollten aber jetzt die Voraussetzungen schaffen, damit Wettbewerber aus dem Ausland nicht an ihnen vorbeiziehen.« Wer KI nutzt, könne von Effizienzsteigerungen profitieren, die man in niedrigere Preise umsetze, sagt er. Als Basis dafür bräuchten die Unternehmen allerdings Daten. Denn ohne Daten keine KI, so lautet die simple Regel. »Wenn in meinem Betrieb die Papierakte noch von links nach rechts getragen wird, muss ich jetzt meine Hausaufgaben machen«, sagt er. Heißt: Informationen digitalisieren, aufbereiten, verwertbar machen.
Bei seinen Gesprächen mit Mittelständlern erlebe er oft ein Gefühl der Überforderung, sagt Schacht. Viele seien geplättet von der Informationsflut und den vielen Möglichkeiten. »Und das lähmt.« Deswegen versucht er, mit einfachen Beispielen KI erlebbar zu machen und sie damit zu entmystifizieren. »Es bringt nichts, wenn ich mich vor die
Mitarbeiter stelle und eine schöne Rede halte. Dann finden das zwar alle spannend, aber sobald sie am Schreibtisch sitzen, machen sie doch alles so wie vorher.« Man müsse die Mitarbeiter ausprobieren lassen. Und Fehler erlauben. Nur so könnten sie rausfinden, wie eine KI tickt. Und welche Fähigkeiten ihnen fehlen, um sie sinnvoll einzusetzen.
Wenn er Workshops in Unternehmen abhält, versucht er, alle Mitarbeiter und Abteilungen mitzunehmen, damit sich keiner übervorteilt fühlt. Er sammelt ihre Ideen für KI-Projekte und sortiert sie nach Komplexität, Wirksamkeit, Nutzen und Kosten. Damit identifiziert er das Projekt, das am ehesten effizient, nutzbar und leicht umzusetzen ist. Statt den Fehler zu begehen, den viele nach seiner Erfahrung machen: »Sie suchen sich einen hochkomplexen Prozess aus und versuchen diesen mit KI zu lösen.« Zu viel zu wollen, gehe meistens nach hinten los. Und das zeige sich oft erst nach einer Weile. »Man befindet sich immer in einem Vertrauens- und Experimentiermodus«, sagt Schacht. »Jedes Pilotprojekt ist erst mal eine Wette auf die Zukunft.« Womöglich werden viele dieser Wetten nicht aufgehen. Mindestens 30 Prozent der Projekte mit ChatGPT und Co. würden die Unternehmen bis Ende 2025 einstellen, prognostiziert das Beratungsunternehmen Gartner. Selbst Sam Altman, der Chef der ChatGPT-Mutterfirma OpenAI, sagte im August, dass sich rund um die vielen KIFirmen eine Blase bilde. So wichtig KI auch sei, seien die Erwartungen wohl übertrieben.
Tatsächlich häufen sich die Geschichten vom Scheitern. Das schwedische FinanzUnternehmen Klarna machte etwa im Mai mit seinem KI-Reinfall Schlagzeilen. Es hatte 700 Mitarbeiter im Kundendienst entlassen und durch Chatbots ersetzt. Aber die Kunden waren so unzufrieden, dass der CEO Sebastian Siemiatkowski gegenüber Bloomberg mitteilte, er wolle nun doch wieder »in menschliche Unterstützung investieren«. Matthias Feistel und sein Mit-Geschäftsführer Martin Groschke sind die Wette auf KI vor fünf Jahren eingegangen. Schon 2020 taten sie, wovor viele Unternehmer noch zurückschrecken: Sie krempelten ihr Geschäftsmodell um und setzten voll auf KI. Als sie
Dieser Anteil der Befragten (in Prozent) sieht in den Fortschritten bei der KI
… eine (große) Chance … … teils eine Chance, teils eine Bedrohung … … eine (große) Bedrohung
der 18- bis 44-Jährigen sehen in KI eine Chance für ihre Firma, aber nur 63 Prozent der Befragten über 60. Frauen sind skeptischer als Männer

Schlaue Kamera: Die KI befindet sich im Inneren auf einem Chip
Wofür die Befragten unserer Studie KI einsetzen:
um Risiken zu bewerten
im Supply-Chain-Management
Einsatz von KI
kein Einsatz von KI (Angaben in Prozent)
Prozent der Befragten wünschen sich eine (deutlich) strengere Regulierung von KI. Was auffällt: Es sind vor allem jene, die KI bisher nicht nutzen
ihre Firma im Jahr 2015 übernahmen, war es noch ein kleiner Onlinehandel für Rückfahrkameras. Doch nun entwickelt und vertreibt Luis Technology aus Hamburg KI-KameraSysteme für Nutzfahrzeuge und Maschinen, die in Echtzeit Personen erkennen können, um Unfälle zu vermeiden. 2023 wurden rund 18.500 Menschen in Deutschland auf Firmengeländen durch Industriefahrzeuge verletzt, sieben verstarben. Solche Unglücke soll ihre Technologie verhindern. »Wir geben den Maschinen mit unserer Kamera ein Auge und mit der KI ein Gehirn«, sagt Groschke. Jetzt kann das Müllfahrzeug erkennen, ob jemand hinten auf dem Trittbrett steht, bevor es weiterfährt. Oder der Kipplaster sieht, ob ein Mensch in der Baugrube steht, bevor er seine Ladung ablässt. Und der Gabelstapler bremst automatisch ab, wenn im Lager ein Arbeiter seinen Weg kreuzt.
Der Strategiewechsel hat erst mal viel Geld gekostet, mehr als elf Millionen Euro hat die Firma in den vergangenen fünf Jahren in die Entwicklung investiert, das entspricht einem Fünftel der jährlichen Einnahmen. Doch es hat sich offenbar gelohnt: 2022 lag der Umsatz von Luis noch bei acht Millionen Euro, in diesem Jahr wird das Unternehmen voraussichtlich die 20-Millionen-Grenze knacken. 83 Prozent davon macht die Firma mit ihren neuen Systemen.
Los ging die Neuausrichtung mit einem Abbiegeassistenten für Lkw, den sie mit einer KI-Kamera ausgestattet hatten, die Fahrradfahrer und Fußgänger erkennen konnte. »Daraufhin haben uns immer mehr Kunden angesprochen«, sagt Feistel. Fahrzeugbauer und Maschinenhersteller wollten wissen: Wenn eure Kamera Fahrradfahrer erkennt, kann man sie dann auch für unsere Einsatzzwecke trainieren? Natürlich gehe das – wenn man die KI mit den richtigen Daten füttert.
Hunderttausende Bilder sind nötig, um das zu tun. Weil die KI, die später auf einen Chip gespielt und so in die Kamera eingebaut wird, erst mal lernen muss, was ein Mensch ist und was nicht. Und das in jeder erdenklichen Situation. »Wir machen bei unseren Kunden Aufnahmen unter Realbedingungen. Von den Menschen, von Schildern, von Pollern oder ähnlichen Gegenständen, die dort häufig zu sehen sind. Und auch von der
Baugrube, der Baustelle oder dem Lager«, erklärt Groschke. »Und diese Bilder benutzen wir als Grundlage, um sie in eine virtuelle Welt zu setzen und dort weiterzuverarbeiten.« So kann man simulieren, wie die Baustelle sich mit der Zeit verändert, wie erst das Fundament gegossen wird oder wie es aussieht, wenn die Wände hochgezogen werden. Man kann Bilder zu den unterschiedlichsten Tageszeiten erzeugen, mit Regen, Schnee oder Sonne. Und man kann Menschen überall in diesem Raum positionieren, sie drehen und wenden und ihnen unterschiedliche Arbeitskleidung anziehen. »Je vielfältiger wir trainieren, desto besser wird die KI.«
Wie gut sie dann wirklich ist, überprüft die Firma vor Ort beim Kunden. Und alle zwei Wochen mit einem Berliner Schauspielensemble. In ihrem Studio – viel grauer Beton, weiße Wände, schmale Fenster –tanzen die Frauen und Männer eine seltsame Choreografie. Im Takt hocken sie sich hin, drehen sich langsam um die eigene Achse, stehen auf, lassen sich fallen und krümmen sich zusammen. Sie halten eine Plastikbox vor den Oberkörper, vor das Gesicht und auch vor die Beine – alles, um zu testen, ob die Kamera sie erkennen kann, selbst wenn der Kopf oder die Beine verdeckt sind.
Liebherr, Linde und Still zählen mittlerweile zu den Kooperationspartnern von Luis Technology. Im vergangenen Jahr waren Feistel und Groschke auf Japan- und Amerika-Tour, um für sich zu werben. Die zwei sind überzeugt, dass KI jenseits von ChatGPT noch sehr viel Mehrwert erzeugen wird: Mit ihr werden Bagger autonom baggern können, werden Kräne sich fernsteuern lassen, Müllmaschinen ohne menschliche Hilfe Abfälle einsammeln und aufsaugen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.
Hinweis: Die Mittelstandsstudie ist eine gemeinsame Initiative von ZEIT für Unternehmer und der Stiftung In guter Gesellschaft. Sie unterstützt die Befragung sowie die wissenschaftliche Auswertung durch das Analyseund Beratungsunternehmen Aserto finanziell. Die Ergebnisse werden der Redaktion in anonymisierter Form unentgeltlich bereitgestellt, auf ihre Veröffentlichung hat die Stiftung keinerlei Einfluss.


Scannen Sieden QR-Code und melden Siesich jetzt an!


DerMittelstand istdas Rückgrat derdeutschenWir tschaft –doch zwischen Forschung undpraktischer Anwendung vergehtoft wertvolle Zeit.Dabei istdas Potenzial längst vorhanden. Wasbraucht es also,damit aus Exzellenzforschung wir tschaftliche Innovationen werden?Wie bleibtDeutschland bei KI undRobotikkonkurrenzfähig? Undwie kann der Mittelstand ganz konkretvon denEntwicklungen in Heilbronn profitieren?
»RETHINK.MIT TELSTAND« am 21.Oktober2025 auf dem TUMCampus Heilbronn zeigt, wieneues Wissen in Wertschöpfung übersetztwird. MitErfolgsgeschichten, Praxisbeispielen und Einblicken in einen europäischen Zukunftshub: dasAI-ValleyHeilbronn.

Prof.Dr. Ali Sunyaev Vizepräsident, Professor für Information Inftrastructures, Technische Universität München, TUM Campus Heilbronn

Christine Grotz
Geschäftsführende Gesellschafterin, WEBER-HYDR AULIKGmbH

MirkoHolzer
Innovationsmanager, Bundesagenturfür Sprunginnovation SPRIND GmbH

Prof.Dr. Christine Eckert Professorinfür Marketing Analytics, Technische Universität München, TUM Campus Heilbronn

Christian Ruf
Direktor Digital& Innovation, VfBStuttgart 1893 AG
Künstliche Intelligenz, die auf Chips in Produkten integriert wird, könnte Deutschland weltweit nach vorne katapultieren, glaubt Viacheslav Gromov. Wenn nur nicht die Zeit so knapp wäre

Viacheslav Gromov, 26, ist der Gründer und CEO von Aitad. Mit seiner Firma macht er Maschinen schlau, indem er KI auf Mikrochips bringt. So kann sie prinzipiell überall eingesetzt werden, wo Sensoren verbaut werden. Damit hält er für möglich, was andere schon längst abgeschrieben haben: dass die Deutschen das Technologierennen gegen China und die USA doch noch gewinnen könnten.
ZEIT für Unternehmer: Herr Gromov, Deutschland klagt über seinen Rückstand in der künstlichen Intelligenz. Sie sagen, wir hätten da noch einen großen Trumpf in der Hand. Eine Chance zur Weltmarktführung. Wirklich?
Viacheslav Gromov: Ja. Bei der generativen KI wie etwa ChatGPT wurden wir schon zu Anwendern degradiert. Die Entwicklung der Grundlagen dafür findet in den USA und China statt – mit den Userdaten der großen Plattformen, die viel investieren und kaum Rücksicht auf Datenschutz nehmen müssen. Da bleiben uns die Industriedaten. Hier kommt die sogenannte dezentrale KI ins Spiel. Die verarbeitet die Daten direkt in den Produkten und schickt sie nicht in die Cloud.
Und doch ist es ja so: Amerikaner und Chinesen investieren Hunderte Milliarden in die KI. Kann Deutschland da überhaupt etwas ausrichten?
Da muss man unterscheiden: Die Milliarden fließen eben in die generative KI, die Sprache, Texte, Bilder erzeugt. In die andere, die sogenannte diskriminative KI wird bisher wenig investiert. Diese KI findet Muster, optimiert Prozesse, prüft Qualität und unterstützt unser westliches Serviceverständnis durch Vorhersagen von Ausfällen. Und da haben wir eben – noch! – die meisten Daten, weil bei uns die Industrie bereits stark automatisiert ist. Anders als in China, wo die Lohnarbeit immer noch günstiger ist. Oder in Amerika. Außerdem sind die Daten größtenteils unreguliert. Daher haben wir wirklich die Chance, hier die Führung zu übernehmen.
Aber nur, wenn wir anders sind als üblich: sehr schnell.
Es gibt ein Haltbarkeitsdatum. In zwei bis vier Jahren, wenn immer mehr Robotik und
humanoide Roboter auch in China genutzt werden, ist es mit unserer Führungsrolle bei den Industriedaten vorbei. Dann haben andere die besseren Trainingsdaten, also sozusagen die Schulungsunterlagen für KI. Konzerne wie Microsoft könnten dann doch immer noch in Deutschland aktiv werden. Oder?
Die Mentalität bewahrt die hiesige Industrie davor, sensible Daten über Konstruktionen und Produktionen mit solchen Konzernen zu teilen. Sie sorgt sich berechtigterweise um Datenhoheit und Knowhow. Und auch davor, erpressbar zu werden durch Cloudanbieter wie Amazon, die als Oligopolisten die Preise erhöhen können, ohne dass es wirklich Alternativen gibt. Aber es ist ja auch so: In der Industrie sind viele Prozesse so schnell, dass die Zeit zum Hin- und Herschicken an die Server in Amerika zu lang wäre. Da muss die Technik blitzschnell entscheiden, ob beispiels-
weise ein Chemieprozess richtig abläuft oder eine Flasche richtig gefüllt ist und so weiter. Okay, die deutsche Industrie hat da also theoretisch einen Vorteil. Aber wie offen sind die deutschen Mittelständler überhaupt für KI und die Verwertung ihrer eigenen Daten?
Da scheiden sich in der gegenwärtigen Krise die Geister. Es gibt lethargische Unternehmen, die eher stillstehen, Kurzarbeit machen. Und es gibt die, die wirklich den Sprung wagen, wie in den goldenen Zeiten der deutschen Industrie. Sie wollen nach vorne, wollen KI und sind mutig.
Ein Wagnis bleibt es für jeden Mittelständler trotzdem.
Weil es um komplexe Fragestellungen geht. Und weil KI richtig Geld kosten kann. Eine Projektentwicklung bei uns kostet zwischen 100.000 und 600.000 Euro. Da müssen die Entscheider wirklich dahinterstehen. Denn erst wenn man das künstliche Gehirn trai-
niert hat, stellt sich heraus, wo es wie gut lernt und was funktioniert oder eben nicht. Die Datenwissenschaftler bei uns laufen neunmal am Tag gegen eine Wand, beim zehnten Mal geht dann eine Tür auf. Sich auf diese Reise zu begeben, auf der manches schiefläuft und anderes sehr erfolgreich ist, erfordert ein neues Zeitalter des Unternehmermuts. Viele müssen da noch an ihrer Mentalität arbeiten.
Sie unterscheiden also zwischen mutigen und müden Mittelständlern. Sind die einen junge Unternehmer, die anderen ältere, um ein Klischee zu nennen? Die einen Techies und die anderen eher Handwerker? Oder was kennzeichnet die beiden Gruppen?
Bei Familienunternehmen ist die Familie selbst oft ein Flaschenhals für Entscheidungen. Dann ist die Frage: Sind die Mitglieder jetzt vorsichtig und langsam, oder sind es Ermöglicher, die an den Nutzen glauben,
Sind Siebereit, KI wirklich sinnvoll einzusetzen?
DieZukunft IhresUnternehmensentscheidet sich im HR –und darin, wieeffizientdas Potentialvon Künstlicher Intelligenzhiergenutzt wird.
DerkompakteKI-Readiness-Checkvon Personio hilft Ihnendabei,IhreAusgangslagerealistisch einzuschätzen undgezielt dienächstenSchritte abzuleiten.
Jetztkostenlosherunterladen personio.de




Mut haben und Geld einsetzen? Häufig hat das etwas mit den Erfahrungen in der Firmenhistorie zu tun. Wir sprechen oft mit Mittelständlern, die sagen: Ja, mein Vater hat sich damals auch getraut, in die digitale Welt einzusteigen oder den ersten Roboter einzukaufen. Manchmal ist es auch der Blick in den Abgrund, der Innovationen hervorbringt.
Im Jahr 2018 haben Sie begonnen, Mittelständler bei digitalen Fragen zu beraten. Wie verlief dann der Weg zum KIUnternehmer?
Ich habe als Student Neurologie-Vorlesungen besucht und gesehen, dass beim KIVorbild Mensch die größte kognitive Leistung oft nicht im Gehirn stattfindet, sondern dezentral in der Haut. Dort sind Millionen Sensoren, deren Impulse nicht ans Hirn geschickt werden, die Intelligenz sitzt direkt im Nervensystem. Ein Beispiel: Wenn ich Ihnen auf den großen Zeh steige, meldet sich dezentral Ihr Rückenmark und sagt: »Schau mal runter.« Das lässt sich auf die Technologie übertragen. Ich habe gesehen, dass große Datenmengen dort schon an Ort und Stelle verarbeitet werden müssen, sonst würde man das Zentralhirn überlasten. Nur war ich vor sieben Jahren noch ein bisschen zu früh dran. Die ersten Kunden zu finden, war sehr hart. Ich musste betteln, betteln, betteln.
Heute melden sich die Unternehmen bei Ihnen?
Ja, aber wir erleben auch Rückschläge. Ein Drittel unseres Geschäfts hat die Autoindustrie ausgemacht, doch die ist zur Jahreswende richtig abgestürzt. Viele unserer Ansprechpartner aus den KI-Abteilungen wurden entlassen. Man hat das Gefühl, die Branche hat schon resigniert, weil China insgesamt so stark ist. In solch einem Fall dauert es, bis man neue Branchen auftut. Das haben wir nun mit dem Einzelhandel und den erneuerbaren Energien getan. Viele Industrieprodukte, viele Maschinen operieren schon lange mit Sensoren. Welchen Quantensprung wollen Sie ermöglichen?
Der Unterschied ist, dass die KI aus enormen Datenmengen sehr komplexe Muster erkennt. Die Sensoren intelligent zu ma-
chen, bedeutet, dass man auf einmal mehr sieht, mehr riecht, mehr hört, mehr spürt. Haben Sie Beispiele für solche besonderen Leistungen?
Wir haben etwa Duschen beigebracht, zu erkennen, wer duscht oder wann jemand stürzt und Hilfe braucht. Dafür haben wir den Landespreis für KI in Baden-Württemberg gewonnen. Wir haben auch Küchenherde darauf trainiert, zu riechen, was gekocht wird, um das Anbrennen zu verhin-
baren, das man braucht, um die rasanten KI-Zyklen mitzugehen. Wir sind da eher wie ein Schnellboot.
Wie schnell wird es gehen, bis Ihre Innovationen die breite Masse erreichen und in jedem Haushalt angekommen sind?
»Die ersten Kunden zu finden, war hart. Ich musste betteln, betteln, betteln«
Viacheslav Gromov über die Anfänge mit einer Technologie, die noch heute viele mit Skepsis betrachten
Ein paar Jahre. Wir bringen Intelligenz in jedes Gerät, in jedes Auto, in jede Maschine. Und zwar so, dass man es als Anwender gar nicht spürt. Dann kann Ihr Auto bestimmte Entscheidungen besser treffen als Sie, weil Sie vielleicht gerade unaufmerksam sind. Ich wette, dass dezentrale KI in zehn Jahren mehr als 50 Prozent des KI-Markts ausmachen wird, weil die intelligenten Chips in Wasserkochern, in Maschinen und in unseren Smartphones in Masse mehr ausmachen werden als die wenigen, aber riesigen Server, die Amazon und Co. betreiben.
Wenn Ihre Wette aufgeht, kann man dann sagen: Sie bauen gerade den nächsten deutschen Digitalkonzern – den ersten seit SAP?
Wir haben Größenvorstellungen, ja, aber keinen Größenwahn. Wir wollen wachsen. Ganz konkret wollen wir uns jedes Jahr verdoppeln. Die Frage ist, ob und wie viele weitere Player in unserem Markt dazukommen. Unser Ziel ist es, ein großer Mittelständler zu werden, nicht das nächste Apple. Aber braucht es nicht gerade heute diesen unbedingten Drive, diesen Größenwahn, der Kalifornien von BadenWürttemberg unterscheidet?
dern. Gerade sitzen wir an Bohrmaschinen von mehreren Herstellern, die lernen, wie sie in welchen Fällen zu bohren haben –möglichst ohne menschliches Zutun. Warum machen die großen Hersteller so etwas nicht selbst?
Sicherlich wollen das einige. Manche probieren es auch. Aber in der Breite ist das noch längst nicht angekommen. Und bei einigen Konzernen merken wir, dass deren Strukturen sie zu langsam machen. Die kommen mit veralteten Vorstellungen und hundertseitigen Lastenheften auf uns zu. Das lässt sich mit dem Tempo nicht verein-
Ich glaube, der Größenwahn hat uns nicht gutgetan, wie man ja auch an der Automobilbranche sehen kann. Es würde uns besser stehen, ein paar Schritte zurückzugehen. Ja, ich sehe exponentielle Wachstumskurven, weil weder die KI-Verordnung der EU noch der Datenschutz in Deutschland den Industriedaten Fesseln anlegen. Und ja, ich glaube, wir können mit diesen Daten den Sprung nach vorne schaffen. Aber als werteorientierter Unternehmer ist mein Ziel nicht, zu wachsen, wachsen, wachsen, koste es, was es wolle. Mir ist es wichtiger, die Gesellschaft und die Wirtschaft voranzubringen und dabei Alternativen zu den anderen beherrschenden Polen zu bieten. Die Fragen stellten Uwe Jean Heuser und Nele Justus




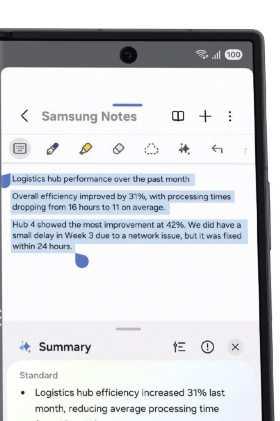

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst auch für white-collar workers wichtig, also in Bürojobs. Mal davon abgesehen, dass die Weiße-Kragen-Dichte in vielen Büros rapide abnimmt, ist das Wörtchen »auch« in diesem Satz bemerkenswert. Auch. Als ob in handwerklichen Berufen die KI längst das Ruder übernommen hätte.
Hat sie natürlich nicht. Chatbots und KI-Agenten können vieles, aber Fliesen legen gehört bisher nicht dazu. Daran ändert auch Julian Wiedenhaus erst mal nichts. Doch seine KI hilft Handwerkerinnen und Handwerkern dabei, zu kalkulieren, wie viele Fliesen sie für ein bestimmtes Bad brauchen –und verschafft ihnen Zeit, um sie zu verlegen.
Gemeinsam mit Alexander Noll und Richard Keil hat er im Jahr 2020 in Hamburg das Unternehmen Plancraft gegründet. Mittlerweile haben die drei mehr als 100 Mitarbeiter, und vor einigen Wochen haben sie 35 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Plancraft verkauft im Abomodell Soft ware, die sich speziell an kleine Handwerksbetriebe richtet. Man kann damit Angebote erstellen, Arbeitszeiten erfassen oder Nachrichten an Mitarbeiter verschicken. Und manches davon geht – KI sei Dank –per Stimme.
Zum Beispiel gibt es eine Funktion, um das sogenannte Aufmaß beim Kunden per Spracheingabe zu erfassen. Wenn Sie diesen Text lesen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Sie einen weißen Kragen tra gen oder zumindest im Büro arbeiten und – wie ich vor dem Gespräch mit Wiedenhaus – nicht genau wissen, was ein Aufmaß ist. Um beim Beispiel des Fliesenlegens zu bleiben: Wenn ein Handwerker in Ihr Bad kommt und notiert, wie viele Quadratmeter Fliesen er braucht, ob Vorsprünge, Winkel und Ecken beachtet werden müssen – das ist das Aufmaß. Es ist die Basis für das Angebot und die Vorbereitung für die Arbeit, die schließlich in Ihrem Bad ausgeführt wird.



Diese Informationen kann man der App von Plancraft diktieren. Durch ein integriertes Sprachmodell versteht sie, was gesprochen wird, und kann einordnen, was eine Zahl ist, was eine Beschreibung und was eine Anweisung an die Kollegen.
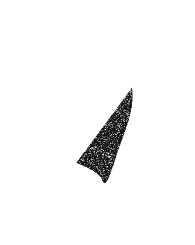




Wenn man den Chefs großer Techfirmen zuhört, bekommt man mitunter den Eindruck, die KI müsse nur immer intelligenter und leistungsfähiger werden, und dann löst sie, fast magisch, alle möglichen Probleme. Im Gespräch mit Wiedenhaus wird klar: Seine Herausforderung ist weniger, die KI leistungsfähiger zu machen, sondern daraus ein Produkt zu bauen, das seine Zielgruppe wirklich nutzen will. Denn das Handwerk ist eine verhältnismäßig konservative Branche, in der viele noch keine KI und überhaupt wenig Soft ware nutzen und zögern, damit loszulegen. »Unsere Aufgabe ist es deshalb, die Übersetzung so gut zu machen, dass wir jedes Gewerk und seine Spezifika abbilden können«, sagt Wiedenhaus.
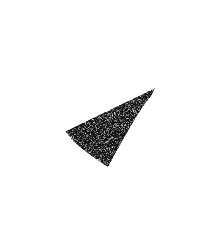







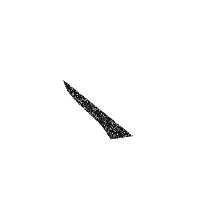



Nicht alles, wo KI draufsteht oder drinsteckt, bringt Sie weiter. Manches aber sehr.
Und das schaut sich unser Kolumnist Jakob von Lindern aus dem Digitalressort der ZEIT in jeder Ausgabe an. Wenn Sie ihm erzählen wollen, was Ihre KI so kann, schreiben Sie ihm an jakob.vonlindern@zeit.de
Dafür sei es wichtig, dass möglichst viele Anwendungen aus einer Hand kommen. Und dass sie wirklich Zeit sparen oder Dinge ermöglichen, die sonst hinten runterfallen würden, schließlich ist das Handwerk einer der Bereiche, wo die meisten Fachkräfte fehlen. Wiedenhaus erzählt etwa vom automatischen KI-Anrufbeantworter. Der nimmt Kundenanfragen auf, bereitet den Entwurf eines Angebots vor und entlastet so den Geschäftsführer, dessen Telefon nicht mehr ständig klingelt.
Um seine KI zu verbessern, muss Wiedenhaus wissen: Welche Anforderungen hat ein Tischler, welche ein Elektriker? Um für solche Dinge ein Gefühl zu bekommen, muss man auch mal rausgehen. »Wir verbringen viel Zeit mit einigen unserer Kunden und stellen uns daneben, wenn sie unsere Soft ware nutzen«, sagt Wiedenhaus. Dafür braucht es dann doch noch den Menschen. Genauso wie beim Fliesenlegen.




Gemeinsam an die Zukunft denken:Wer sein Unternehmen an die nächste Generation übergeben und erfolgreich ins Morgen führen will, steht nicht nu rv or finanziellen Fragestellungen. Gesucht wird ei nK onzept, welches das gesamte Lebenswerk und dieFamilie mitinden Blick nimmt. Erfahren Si ei mp ersönliche nG espräch mit IhrenPrivate Banking Beraterinnenund Beratern der Sparkasse mehr über unser eh olistisch gedachten Konzepte im Generationenmanagement.
„ „ IstZeit Geld? Oder istGeld Zeit?
Denken wir gemeinsamweiter.
Deutsche Baufirmen fragen sich:
Wie schnell kommt das Geld von der Regierung?
Und sie sorgen sich, dass nur die Riesen profitieren.
In Münster zeigt ein Unternehmer, wie man Gas gibt
VON CAROLIN JACKERMEIER
Wenn Thomas Echterhoff zeigen will, wie man Geld schnell und zuverlässig in Zukunft verwandeln kann, dann streift sich der Unternehmer eine orangefarbene Warnweste über den Anzug. Er nimmt einen mit an eine Kreuzung im Süden Münsters und zeigt auf zehn Meter hohe Betonpfeiler. »Diese Brücke haben wir in nur sieben Wochen abgerissen und neu aufgebaut«, sagt Echterhoff, 58. Eine Rekordzeit sei das gewesen. Sein Unternehmen, die Bauunternehmung Gebr. Echterhoff, hat den Auftrag, zwei Brücken am Knotenpunkt der B51 auszutauschen. Sie waren zu marode, um die Last von Tausenden Autos zu tragen, die hier täglich entlangfahren. Die erste steht, jetzt folgt die Hauptbrücke. Läuft alles nach Plan, wird sie im Herbst 2026 fertig sein – zwei Jahre früher, als ursprünglich geplant. »Das macht mich schon stolz«, sagt Echterhoff.
In fünfter Generation arbeitet Echterhoffs Familienunternehmen aus Westerkappeln daran, Deutschlands Verkehrswege wieder fit
zu machen. Begonnen hat alles 1860 mit einem kleinen Baubetrieb im Tecklenburger Land. Getrieben durch die Industrialisierung, baute der Schachtmeister Gottlieb Dietrich Echterhoff Eisenbahngleise, Straßen, Kanäle. Später folgten Spezialbauten für Zechen und Häfen. Heute beschäftigt die Echterhoff-Baugruppe mehr als 700 Mitarbeiter an zehn Standorten in Deutschland. Der gefragteste Einsatzort: marode Brücken. Deutschlandweit 4.000 Stück galten laut dem Bundesverkehrsministerium bereits 2022 als besonders sanierungsbedürftig, Umweltverbände sprechen sogar von viermal so vielen. Die Brücken zeigen gut den allgemeinen Investitionsstau im Land. Um den aufzuholen, hat die Bundesregierung das Sondervermögen Infrastruktur auf den Weg gebracht. 500 Milliarden Euro sollen in den kommenden zwölf Jahren zusätzlich zum regulären Haushalt investiert werden, ein Großteil davon in Schienen, Brücken und Straßen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte im Mai angekündigt, dass schnell »die Bagger rollen sollen«. Das klang gut. Doch kurz darauf stoppte die bundeseigene Autobahn GmbH überraschend die Ausschreibungen für das laufende Jahr, weil der Bundeshaushalt für 2025 noch nicht verabschiedet war und damit die Finanzierung fehlte. Per Sonderbeschluss sollen nun doch ein paar Mittel in die drängendsten Sanierungen fließen. Anfang September setzte Klingbeil einen Beirat aus Unterneh-

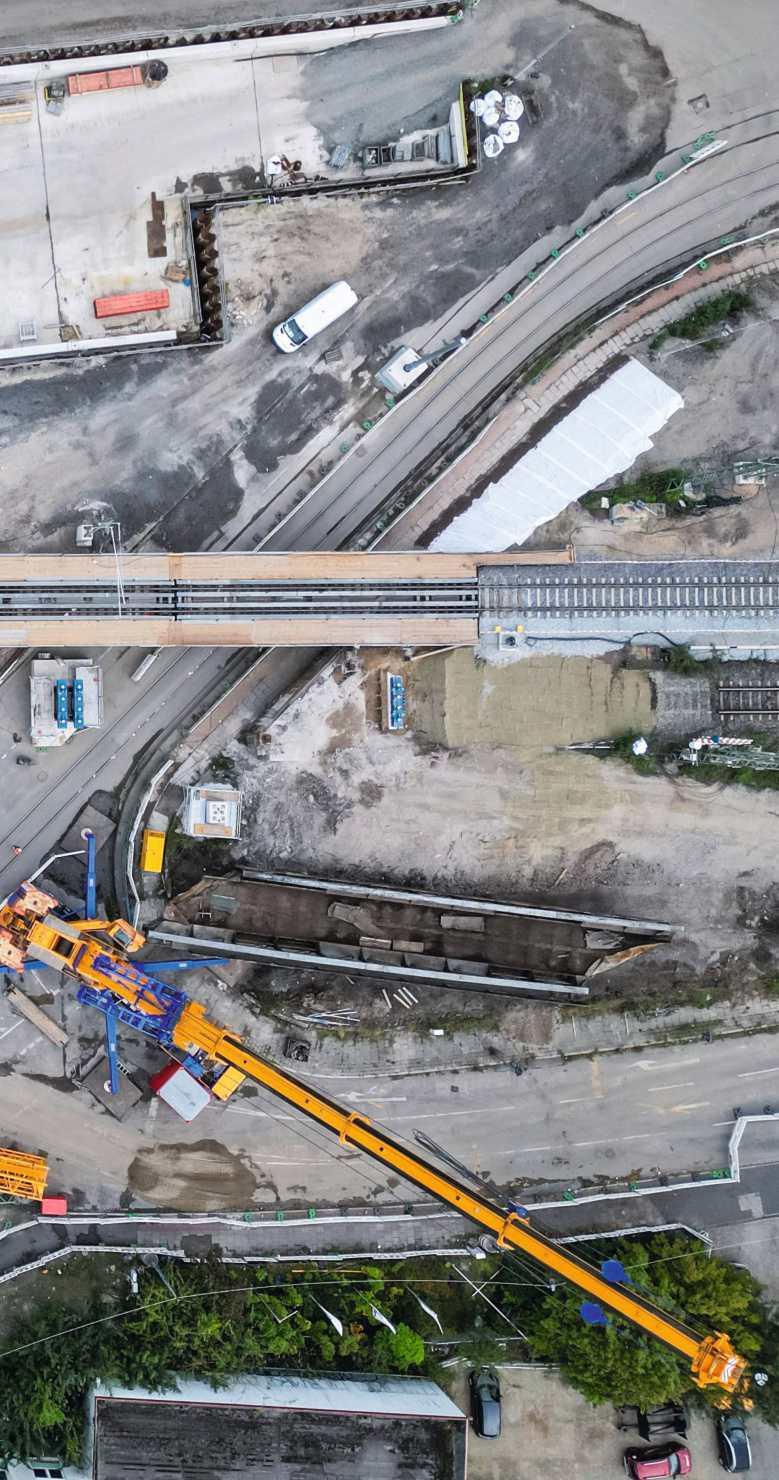
Tausende Brücken sind sanierungsbedürftig. Hier wird eine 110 Jahre alte Eisenbahnüberführung ersetzt
mern und Wissenschaftlern ein, der helfen soll, die Milliarden sinnvoll einzusetzen. Das Geld sei nun da, die Umsetzung aber kein Selbstläufer, sagte er gegenüber dem Handelsblatt. Und auch Verbände befürchten schon exzessive Bürokratie und eine zögerliche Verteilung der Gelder. Die Stimmung im Bauhauptgewerbe hat sich zwar laut dem Geschäftsklimaindex des ifo-Instituts im Juli leicht gebessert, sie liegt aber immer noch deutlich im negativen Bereich. Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der Deutschen Bauindustrie, warnt, dass Unternehmen trotz des riesigen Sanierungsbedarfs Aufträge fehlen.
Wie kann das sein? Ist das Sondervermögen der »Papiertiger«, vor dem Verbände warnen? Oder können Mittelständler von neuen Aufträgen aus der »Investitionsoffensive für das ganze Land« – so nennt die Bundesregierung ihr Vorhaben – profitieren?
Baustelle I: Die Vergabeverfahren
Auch wenn Thomas Echterhoff mittlerweile Hunderte Baustellen erlebt hat, ist er bei einer wie der in Münster immer noch angespannt. Sie ist ein Vorzeigeprojekt der Echterhoff-Baugruppe, das Lokalfernsehen hat berichtet, der Bürgermeister schaut regelmäßig vorbei. Alles muss stimmen, um den straffen Zeitplan zu erfüllen: Klappt die Brückensprengung? Stimmen die Berechnungen aus dem digitalen Modell? Passen die vorproduzierten Betonteile zusammen?
Möglich macht die kurze Bauzeit eine Expressbauweise, auf die das Unternehmen mehrere Patente hält. Die Betonmodule werden in einer Fertigungshalle gegossen und vor Ort nur noch zusammengesetzt. Ähnlich wie Lego, nur mit individuellen Bausteinen. »Wir zeigen, dass schnelles Bauen in Deutschland geht«, sagt Echterhoff. Der Haken: Der Transport der Fertigteile, die Montage der großen Kräne und die Wochenend- und Schichtdienste der Arbeiter sorgen dafür, dass die Bauweise bis zu 20 Prozent teurer ist als bei herkömmlichen Brücken. Dadurch werde Echterhoffs Firma bei Ausschreibungen häufig nicht berücksichtigt. »Aufträge sollten nicht nur nach Preis, sondern nach Bauzeit vergeben werden«, sagt Echterhoff. Obwohl der Modulbau teurer sei, verringere die kürzere Bauzeit volkswirtschaftliche Kosten, da Gleise und Straßen schneller wieder nutzbar seien, weniger Staus entstünden und der CO₂-Ausstoß sinke.
Normalerweise läuft das Ganze so: Bei Brückensanierungen schreibt der Auftraggeber – meist die Autobahn GmbH oder eine Landesbehörde – das Projekt öffentlich aus, mit detaillierten Plänen, Fristen und Anforderungen. Bauunternehmen geben Angebote ab, die nach verschiedenen Kriterien bewertet werden. Oft sind die Projekte in einzelne Gewerke unterteilt, das kommt vor allem kleineren Mittelständlern zugute. Das Problem: Je differenzierter die Vorgaben, desto länger dauern die Verfahren, ein bis zwei Jahre sind durchaus üblich.
»Wir müssen bei der Beschaffung auf mehr Geschwindigkeit setzen«, sagt Moritz Püstow von der Unternehmensberatung KMPG. Etwa indem Planungsbüros und Bauunternehmen von Beginn an gemeinsam arbeiten, statt die Bauphase erst nach der fertigen Planung auszuschreiben. Statt streng nach fachlichen Zuständigkeiten mit diversen Abstimmungsschleifen sei es effizienter, in Projektteams zu arbeiten. Statt kleinteilig in einzelne Gewerke aufgeteilt, könnten größere Projekte als Komplett-Aufträge an Unternehmen vergeben werden.
Allerdings nützt das besonders Baukonzernen wie Hochtief oder Strabag, die Großaufträge dank ihrer Kapazitäten leichter übernehmen können. Da überrascht es we-
der Leser von ZEIT für Unternehmer gaben in einer Umfrage an, das Sondervermögen Infrastruktur erhöhe ihre Bereitschaft zu investieren
nig, dass die Aktienkurse der beiden Firmen von Januar bis Anfang September 2025 um mehr als 50 Prozent gestiegen sind. Kleinere Unternehmen haben es schwerer, solange sie sich nicht zu Konsortien zusammentun. Daher gibt es auch Kritik an den Ausgabeplänen: »Der Mittelstand muss bei den Ausschreibungen auch zum Zug kommen«, fordert Rainer Kambeck, der beim DIHK den Bereich Wirtschafts- und Finanzpolitik leitet.
Baustelle II: Die Bürokratie
Auf der Baustelle bei Münster zündet sich Echterhoff einen Zigarillo an und stapft unter der Expressbrücke hindurch zur Hauptbrücke. Handwerker schweißen an riesigen Metallpfeilern, am Straßenrand lagern Dutzende Querstreben aus Holz, die in den kommenden Tagen verbaut werden.
Der Bauingenieur hält gemeinsam mit seiner Schwester Jutta Echterhoff-Beeke die Anteile am Familienunternehmern, in der Leitung sitzen vier weitere Geschäftsführer. Die Firma arbeitet fast ausschließlich für öffentliche Auftraggeber, 80 Prozent der Projekte sind Infrastrukturbauten wie Brücken und Tunnel. Trotz wachsender Umsätze ist der Gewinn des Unternehmens zuletzt von 6,9 Millionen auf 3,2 Millionen Euro um mehr als die Hälfte eingebrochen, wie ein Blick in die Unternehmensbilanz aus dem Jahr 2023 zeigt – unter anderem aufgrund der steigenden Energie- und Rohstoffkosten. Aktuell seien die Auftragsbücher zwar gut gefüllt, sagt
der Bauingenieur, aber er hoffe trotzdem, vom Sondervermögen zu profitieren. Der Chef ist nur noch selten auf Baustellen unterwegs, die meiste Zeit verbringt er am Schreibtisch oder in Meetings. »In den letzten Jahren ist der Verwaltungs- und Berichtswust immer größer geworden«, sagt Echterhoff. Die Firma lässt sich zum Beispiel von der Rating-Agentur Ecovadis in Sachen Nachhaltigkeit zertifizieren und erstellt eigene Berichte, trotzdem sollte nach einem alten EU-Gesetzesvorschlag eine weitere Nachhaltigkeitsprüfung durch Wirtschaftsprüfer erfolgen. »Das operative Geschäft kommt dabei häufig zu kurz«, sagt Echterhoff. Auch die Auflagen auf dem Bau würden komplexer, etwa der strengere Natur- und Bodenschutz, Dokumentationspflichten für die Arbeiter oder Richtlinien zur Baustoffentsorgung.
Auch wenn Branchenverbände schnellere Genehmigungsprozesse einfordern, sind die Baufirmen von den bürokratischen Hürden beim Sondervermögen nur indirekt betroffen. Bereits bevor Unternehmen wie Echterhoff einen Auftrag bekommen, durchlaufen Infrastrukturprojekte verschiedene Verfahren: Bedarfsermittlung, detaillierte Planung, Umweltprüfung und Bürgerbeteiligung. Erst danach folgt die Ausschreibung. Bis tatsächlich gebaut wird, können mehrere Jahre vergehen. Je langsamer die Prozesse, desto später bekommen die Unternehmen Aufträge. Bis das Geld aus dem Sondervermögen im Mittelstand ankommt, kann es also dauern. Schon heute sind Bund, Länder und Kommunen aus Sicht von Experten damit überfordert, Infrastrukturprojekte umzusetzen. Eine Veröffentlichung des Bundesrechnungshofs aus dem April zeigt: Die Autobahn GmbH hat von den für 2024 geplanten 280 Modernisierungsmaßnahmen gerade einmal 69 realisiert. Nicht einmal ein Viertel. »Geld alleine reicht nicht, die Verwaltungsprozesse müssen dringend vereinfacht und digitalisiert werden«, sagt der Mittelstandsexperte Rainer Kambeck. Er sei jedoch skeptisch, dass das bald passiert.
Eigentlich wollte schon die Ampelregierung die Genehmigungsverfahren vereinfachen, auch die neue Bundesregierung hat das angekündigt. Im Beschleunigungsmonitor beobachtet die DIHK 54 Maßnah55 %
men aus dem Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern seit November 2023. Mit den Gesetzesmaßnahmen sollen zum Beispiel Klagemöglichkeiten eingeschränkt oder verbindliche Fristen und Stichtagregelungen eingeführt werden. Bis Juni dieses Jahres wurde allerdings nur jedes fünfte Vorhaben teilweise oder ganz umgesetzt. »Es braucht dringend durchgreifende bürokratische Reformen«, sagt der DIHKMann Kambeck. »Die Milliarden dürfen nicht dazu führen, dass der Druck, effizienter und innovativer zu werden, nachlässt.«
Jens Boysen-Hogrefe sieht das ähnlich: »Der Flaschenhals sind die Prozesse in der Verwaltung, hier fehlt seit Jahren Personal«, sagt der Ökonom vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Allerdings warnt er davor, die Planungsverfahren zu überstürzen. »Das Ziel sollte nicht sein, möglichst schnell möglichst viel Geld auszugeben.« Es sei wichtig, die Mittel zielgenau zu investieren. »Sonst werden am Ende schöne Fußgängerzonen subventioniert, statt marode Brücken saniert.« Damit würde der erhoffte Wirtschaftsboom ausbleiben.
Ohnehin rechnet Boysen-Hogrefe damit, dass sich das Sondervermögen frühstens in ein bis zwei Jahren auf die Wirtschaftsleistung auswirkt. »Entscheidend ist, was bleibt, wenn sich der Baulärm gelegt hat«, sagt er. Also ob Deutschland dann wirklich digitaler, mobiler und zukunftsfähiger ist. Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaft zufolge könnte die Wirtschaftsleistung infolge des Milliarden-Pakets ab dem Jahr 2027 um mehr als zwei Prozent steigen.
Ein wenig deutet sich das schon an. Im Tiefbau stieg die Kapazitätsauslastung in diesem Jahr langsam, aber stetig auf 73,4 Prozent im August. Damit lag sie allerdings immer noch unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das hat das ifoInstitut in einer Konjunkturumfrage erhoben. Die Auslastung werde in den kommenden Jahren zwar steigen, prognostiziert das Institut, aber das werde Zeit brauchen. Aus Sicht des Forschers Boysen-Hogrefe seien die 500 Milliarden Euro auf zwölf Jahre gerechnet auch nicht sonderlich viel Geld: »Es geht primär darum, Löcher zu stopfen.«
73,4 %
betrug die Kapazitätsauslastung der Tiefbaufirmen im August – ein unterdurchschnittlicher Wert. Aber ihre Erwartungen haben sich seit dem Frühjahr aufgehellt
ändert. Anfang des 20. Jahrhunderts boomte der Straßenbau, nach dem Zweiten Weltkrieg half das Familienunternehmen beim Wiederaufbau des Landes. Die Firma gründete eigene Kies- und Asphaltmischwerke, später folgten Maschinenparks, Fertigteilwerke und Beteiligungen an verschiedenen Baufirmen. Heute ist die Gruppe mit rund 1.000 Mitarbeitern eines der größten Bauunternehmen Baden-Württembergs.
Von den Bauunternehmen, die ZEIT für Unternehmer angefragt hat, möchten sich die meisten nicht zum Sondervermögen äußern. Und diejenigen, die sich einlassen, sind skeptisch: Die Peter Gross Bau GmbH, eines der größten Familienunternehmen im Bausektor, erwartet erst in zwei bis drei Jahren Effekte durch das Sondervermögen. Auch die niedersächsische Matthäi Gruppe geht nicht davon aus, dass sich durch die neuen Milliarden ihre Auftragslage kurzfristig ändert. Das führt auch dazu, dass sich die Unternehmen mit Investitionen zurückhalten. Philipp Gross, Geschäftsführer der Peter Gross GmbH aus St. Ingbert im Saarland formuliert es so: »Wir werden unsere Kapazitäten nicht aus reiner Zuversicht erhöhen.« Und selbst wenn die Betriebe aufstocken wollen, müssen sie erst mal Personal finden.
Baustelle III: Die Fachkräfte Bernd Kopf hat sich für die Videoschalte aus dem Konferenzraum seiner Firmenzentrale in Lahr zwischen seinen goldumrahmten Vorgängern platziert: links sein Großvater Otto Vogel mit blauer Krawatte, rechts sein Vater Armin Kopf mit dem roten Pendant, beide in schwarzem Anzug. Bernd Kopf, der Chef der Vogelbau-Gruppe, hingegen grüßt im T-Shirt, seine Haare hat er zu einem strammen Dutt geknotet und an den Seiten auf wenige Millimeter rasiert.
Seit Kopfs Opa die Firma vor fast 100 Jahren gegründet hat, hat sich vieles ver-
Allerdings fällt es Kopf immer schwerer, Leute zu finden. Interessierte Auszubildende seien rar, viele würden abbrechen oder könnten aufgrund mangelnder Leistungen nicht übernommen werden. Und mit ungelernten Helfern komme man nicht weit: »Menschen arbeiten heute mit Maschinen, nicht mehr mit der Schaufel in der Hand«, sagt der Unternehmer. »Wir brauchen Fachkräfte, die ihr Handwerk verstehen.«
Kopf mangelt es etwa an Baugeräteführern, Tief- und Straßenbauern und Betonfertigteilbauern. »Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass heute niemand mehr bereit ist, am Wochenende, nachts und bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten«, sagt Kopf. Auf dem Vergleichsportal Kununu bewerten Mitarbeitende die Work-Life-Balance bei der Firma mit nur 2,8 von 5 Sternen und beklagen Arbeitspensen von mehr als 40 Wochenstunden. »Wir können nicht von heute auf morgen aufholen, was Jahrzehnte auf Verschleiß gefahren wurde«, sagt Kopf. »Ich brauche langfristig Planungssicherheit, es bringt nichts, einmalig Geld auszuschütten.« Also probiert Kopf immer wieder neue Recruiting-Kanäle aus, seit Kurzem ist sein Unternehmen auf LinkedIn vertreten. Seit 2024 nimmt es an einem Sonderprogramm der Handwerkskammer teil, das Lehrlinge aus Indien vermittelt. »Das funktioniert super, die indischen Azubis sind top motiviert«, sagt Kopf. Auf ihrer Website lockt die Firma Lehrlinge mit übertariflichen Vergütungen, Mitarbeiter-Rabatten für Fertighäuser, Angelkarten für den firmeneigenen Baggersee und privater Nutzung eines Grillplatzes im Kieswerk. Und sie wirbt in einem Imagefilm mit heroischer Musik um Nachwuchs, der Deutschland transformieren und die Welt von morgen gestalten will. Vielleicht hilft das Sondervermögen dabei ja ein bisschen.

Harry ist der mächtigste Bäcker des Landes: Das Unternehmen beliefert immer mehr Supermärkte mit seinem vorgebackenen Brot. Gelingt das nur auf Kosten der guten alten Handwerksbäcker? VON MARCUS ROHWETTER
In den Backstationen der Supermärkte liegen sie: duftende Brote, Brötchen, Laugenstangen und Baguettes. Sie warten darauf, mit einer angeketteten Zange herausgefischt und in Tüten gepackt zu werden. Das ist die Mittelklasse der Backwaren. An einen Handwerksbäcker kommt zwar nicht heran, was kurz vor Ladenöffnung noch ein paar Minuten im Supermarktofen fertig erhitzt wird. Aber besser als viele der abgepackten Brote im Regal gegenüber schmeckt es allemal. »Prebake« nennen Profis das.
Brot ist uralt, das wichtigste Grundnahrungsmittel seit Tausenden von Jahren. Heute gilt es als regionales Produkt, so wie Bier, das immer auch eine Heimat braucht und am besten gleich von nebenan kommt. Umso erstaunlicher ist die gewaltige Logis-
tik der modernen Produktion: Rechnerisch hat jedes Supermarktbrot 136 Kilometer mit dem Lkw hinter sich, gefahren auf einer von 926 exakt geplanten Strecken, die zu 10.000 Verkaufsflächen im ganzen Land führen. Jedenfalls, wenn es vom Marktführer kommt – einem Unternehmen, das sich im ganzen Land ausgebreitet hat wie ein Hefeteig bei Idealtemperatur.
Gesteuert wird das alles nämlich nicht aus den Firmenzentralen der Supermarktketten, sondern aus Schenefeld. Aus einem schmucklosen Bauriegel im Speckgürtel von Hamburg, auf dessen Parkplatz Lastwagen mit der Aufschrift »Frisch wie Harry« langsam rein- und rausfahren. Dermaßen unaufdringlich wirkt das Familienunternehmen Harry-Brot GmbH, dass man
leicht übersehen kann, welchen Aufstieg es hinter sich hat. Und was noch vor ihm liegt. Vorweg: Harry ist kein Vor- oder Spitzname. Vor 337 Jahren, am 9. Mai 1688 nämlich, wurde Johann Hinrich Harry als Meister beim Bäckeramt Hamburg-Altona eingetragen. Daraus wurde der deutsche Marktführer für Brot und Backwaren, ein Industriebäcker mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden Euro. Er gehört noch immer den Familien Holthausen und Blohm-Harry. Die reden aber nicht gern.
Es empfängt stattdessen Frank Kleiner, 54, einer der Geschäftsführer von HarryBrot, in einem Konferenzraum: Blick auf den Parkplatz, an der Wand ein großes Schwarz-Weiß-Foto, darauf ein Brot. Außer der frischen Ware für die Backstationen
produziert Harry viel Abgepacktes: Schnittbrot »1688« (ein Dutzend Sorten). »Körner Balance«-Toast. »Sammy’s Super Sandwich«. Außerdem Brioches und Hotdogbrötchen. Und als stagnierte die Wirtschaft des Landes nicht seit drei Jahren, sind sie hier bei Harry ziemlich entspannt. Geschnitten Brot verkauft sich eben wie geschnitten Brot. »Wir erwarten 2025 eine stabile Lage«, sagt Kleiner.
Das dürfte natürlich auch daran liegen, dass Produkte der industriellen Großbäcker günstiger sind als die der traditionellen Handwerksbäcker. Verbraucher, die unter steigenden Lebensmittelpreisen leiden, weichen dann eher auf die Alternative aus. Steigende Kosten dürften indes auch Harry betreffen – etwa fürs Personal. Erst Ende August einigte sich der Verband der Großbäcker mit der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) auf einen neuen Tarifvertrag für die nordwestdeutsche Industrie. Um das Lohnplus von insgesamt 5,6 Prozent sowie Einmalzahlungen durchzusetzen, wurde mehrfach gestreikt. Auch in einem Werk von Harry.
Im Gegensatz zu den Eigentümern muss Kleiner schon beruflich reden. Er ist für Marketing und Vertrieb zuständig und soll anpreisen, was die 71 Backlinien an zehn Standorten so alles durch die Öfen schieben. Und das macht er offenbar recht erfolgreich: Seit der Pandemie ist der Umsatz um 30 Prozent gewachsen. Abgesehen von einer kleinen Delle 2024, was aber an gesenkten Preisen und nicht an einem Rückgang der verkauften Brote gelegen habe, wie Kleiner beteuert. Aktuell gingen die Menschen sogar wieder häufiger einkaufen. Das merke man an der Verschiebung innerhalb der Kategorien. »Bei verpackter Ware mit längerem Mindesthaltbarkeitsdatum erwarten wir einen leichten Rückgang, bei Backstationen hingegen ein Wachstum«, sagt Kleiner. Wer frischer kauft, hamstert nicht mehr.
Dass Harry ein Mittelding ist zwischen Bäcker und Logistikfirma, macht die Expansion kompliziert. »Wenn Sie Schokoriegel herstellen, können Sie ganz Europa von zwei Werken aus beliefern, denn die Ware wird unterwegs nicht schlecht. Aber frisches Brot, das am Abend gebacken wird, muss
Euro Umsatz erzielten die 8.912 handwerklichen Bäckerei-Betriebe in Deutschland im Jahr 2024. 2014 gab es noch 12.611 Betriebe
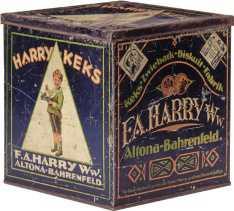
In solchen Boxen verpackte Harry um das Jahr 1900 Zwieback, der auf Schiffen als Verpflegung diente
innerhalb weniger Stunden am Ziel sein«, sagt Kleiner. Das Unternehmen Harry beschäftigt heute nach eigenen Angaben »etwas über 1.000 Fahrer« und nicht ganz so viele Bäcker, wobei die Firma die genaue Zahl nicht verraten mag. Man darf davon ausgehen, dass es deutlich weniger sind. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Mitarbeiter in den Produktionsanlagen ohnehin eher mit Maschinen umgehen können müssen als mit Teig. Aber die Besonderheit dieses Geschäfts ist klar: Produktion und Logistik müssen gleichzeitig wachsen. Das funktioniert so: Im Frühjahr hat das Kartellamt Harry erlaubt, Glockenbrot zu übernehmen, eine Tochtergesellschaft von Rewe. Die Supermarktkette will nicht mehr selbst backen, stattdessen soll Harry Rewe künftig auch von den neuen Standorten Frankfurt und Bergkirchen bei München aus beliefern. Was es den Schenefeldern erlaubt, stärker nach Süddeutschland zu expandieren.
Backwarenmäßig ist Deutschland in Nord und Süd geteilt. Der Norden war immer schon stark von der Industrie geprägt, im Süden gibt es traditionell relativ viele Handwerksbäcker. Doch der Strukturwandel läuft. Die Kleinen leiden besonders darunter: In den vergangenen zehn Jahren sankt die Zahl der handwerklichen Betriebe um 30 Prozent auf 8.912, die der Beschäftigten um 15 Prozent auf 235.000. Immerhin ist die Zahl der Auszubildenden 2024 erstmals seit Langem wieder gestiegen.
Euro Umsatz erzielte Harry-Brot im Jahr 2024. Mit seinem Brot versorgt das Unternehmen rund 10.000 Backstationen
Die Branchenstruktur verschiebe sich »weiter in Richtung der Großen«, bestätigt die Beratungsfirma wmp, die, unterstützt von der Gewerkschaft NGG und der HansBöckler-Stiftung, erst im Frühjahr die Entwicklung im Backgewerbe analysiert hat. Dass ein Brot-Riese wie Harry so enorm wächst, möchte man beim Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks nicht kommentieren. Wetterten die Handwerksbäcker kurz nach der Jahrtausendwende noch gegen die zunehmende industrielle »Massenbrothaltung«, scheinen sie sich nun mit der neuen Realität abgefunden zu haben. Als Totengräber der Handwerksbäcker sieht sich Kleiner erwartungsgemäß nicht. »Die Anlässe für den Brotkauf variieren, es
gibt kein Entweder-oder«, sagt der Manager. Schulbrot würden die Menschen eher im Supermarkt kaufen, die Sonntagsbrötchen für das gemeinsame Familienfrühstück eher beim Handwerksbäcker. »Beides hat beim Verbraucher seine Berechtigung.«
Ein weitaus größeres Problem als das zumindest halbwegs planbare Wachstum ist der Klimawandel. Auch Harry will klima neutral werden. Was leichter gesagt ist als getan. Wegen der Öfen. Und wegen der Felder.
»Der allergrößte Teil unseres CO₂-Fußabdrucks entsteht in der Lieferkette beim Getreideanbau und da vor allem bei der Düngung«, sagt Kleiner. Ohne Dünger keine Landwirtschaft im heutigen Stil. Doch die Herstellung von Mineraldünger erfordert viel Erdgas und verursacht zwei bis fünf Prozent aller Treibhausgas-Emissionen weltweit.
Harry hat mit klimafreundlichen Alternativen experimentiert. In der Saison
2023/24 setzten Vertragsbauern auf 1.600 Hektar grünen Dünger ein, für den erneuerbare Energien und Wasserstoff verwendet wurden. Ohne Ertragseinbußen sei der CO₂-Fußabdruck des Getreides so um bis zu 30 Prozent gesenkt worden, der einer Packung »Sammy’s Super Sandwich« im Ergebnis um sieben Prozent. »Technisch geht vieles«, sagt Kleiner. »Die größte Herausforderung bleibt jedoch die Kostenfrage.«
Damit verglichen ist die Backofenfrage relativ leicht zu beantworten. Bislang laufen sie mit Gas. »Stand heute könnten wir technisch nicht kurzfristig umstellen«, sagt Kleiner. »Und: Solange die fossile Energie so günstig ist wie bisher, wird es für viele Unternehmen den Druck dazu nicht geben.«
Mit Wasserstoff betriebene Öfen sind denkbar. So wie bei mancher Gasheizung im Keller, die jetzt schon »H₂ ready« ist. Doch um Wasserstoff zu verbrennen, müsste er im großen Stil vorhanden sein.
Und es sieht nicht so aus, als werde das überall zu einem bezahlbaren Preis in naher Zukunft möglich sein.
Andere Idee: Thermoöl-Öfen. Die sind nicht neu, schon in den 1960er-Jahren wurde darüber diskutiert, sie erinnern an eine klassische Zentralheizung. Heißes Öl wird dabei durch einen geschlossenen Kreislauf geleitet, gibt die Hitze im Backofen ab und kommt dann kühler wieder zurück. Erhitzt wird das Öl typischerweise mit Gas, doch Strom wäre ebenso möglich. »Das scheint perspektivisch eine Lösung zu sein, aber da muss die Technologie noch deutlich besser werden«, sagt Kleiner. Noch sei das Verhältnis von reingestecktem Strom zu erzeugter Wärme zu gering. Es geht also wieder ums Geld.
Aber da sieht man schon, was für Fragen man sich stellen kann, bei einem scheinbar so simplen Produkt wie Brot, das die Menschen schon seit Jahrtausenden backen.
DieBusinessPlatinumCardmit GetMyInvoicesautomatisier tdie Belegsuche undspart Zeit beider Abrechnung.
Jetztmit 200.000 Membership Rewards® Punk tensichern:bis 01 .1 2. 2025*


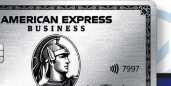


Die Fitnesskette Kieser arbeitet mit Franchisenehmern zusammen, nicht ohne Konflikte.
Gabriela Kieser und ihr Nachfolger Michael Antonopoulos erklären, warum sich das auszahlt –und weshalb man beim Krafttraining leiden muss

Gabriela Kieser war einverstanden: Das Interview mit ihr und Michael Antonopoulos kann in ihrem Privathaus in Zürich stattfinden. An genau dem runden blauen Tisch in der Küche, an dem früher alle wichtigen Entscheidungen der Fitnesskette Kieser besprochen wurden. Damals, als Gabriela Kiesers Mann, der Firmengründer Werner Kieser (1940–2021), noch lebte, sie noch Miteigentümerin war und Antonopoulos als ihr Geschäftsführer zum Rapport antreten musste. Und wie damals hat Kieser einen Salat zubereitet, aus Roter Bete und Walnüssen.
Frau Kieser, Herr Antonopoulos, seit Jahren versuchen Sie, den Menschen den Spaß am Sport zu verderben. Warum?
Gabriela Kieser: Wir verderben den Spaß nicht, wir ermöglichen ihn! Sie brauchen eine gute Muskulatur, um leistungsfähiger zu sein, weniger Schmerzen zu haben und gesund zu bleiben.
Michael Antonopoulos: Deswegen sind
Kieser-Studios keine Muckibuden mit lauter Musik und Saftbar, sondern bieten gesundheitsorientiertes Krafttraining an.
Frau Kieser, von Ihnen stammt der Satz: Kieser verkauft Schweiß und Tränen. Muss ich leiden, um glücklich zu werden?
Kieser: Ja! Ab 30 baut Ihr Körper ab. Wenn Sie bis ins hohe Alter fit bleiben wollen, dann müssen Sie regelmäßig hart an sich arbeiten. Aber es ist doch dort reizvoller, wo man mit netten Menschen was trinken kann ...
Kieser: Nein. Das können Sie nach dem Training in Ihrer Lieblingskneipe machen.
Antonopoulos: Wenn Sie ein Studio von Kieser besuchen, sollen Sie fokussiert trainieren. Ihren Einkauf im Supermarkt unterbrechen Sie ja auch nicht für einen Kaffee in der Lounge. Sie wollen ihn abhaken. Wie trainieren Sie selbst?
Kieser: Zweimal die Woche, 30 bis 35 Minuten an 10 bis 12 Maschinen. Das reicht in der Regel.
Welche Maschine mögen Sie besonders?
Kieser: Mögen? Jede ist anstrengend. Die schlimmste ist die Torso-Rotationsmaschine, die hasse ich wirklich.
Und die tun Sie sich jedes Mal an?
Kieser: Manchmal ist der innere Schweinehund stärker. Aber Sie müssen wissen: Die
Mitglieder zählten die 9.217 deutschen Fitnessstudios 2024 nach Berechnungen der Unternehmensberatung Deloitte. Ein Höchststand. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren es noch 9,5 Millionen
Antonopoulos: Und viele unserer Trainingsmaschinen haben wir selbst entwickelt. Etwa eine für das untere Sprunggelenk, die unheimlich wichtig ist, weil viele Menschen im fortgeschrittenen Alter umknicken.
Kieser: Wir haben auch eine Maschine konstruiert, mit der Sie Ihren Beckenboden trainieren können, öffentlich im Trainingsraum ohne Schamgefühle. Wir bieten Spezialitäten, die finden Sie sonst nirgends. Für Ihre medizinische Kräftigungstherapie muss man aber extra zahlen. Warum?
Kieser: Weil ein Arzt oder Physiotherapeut Sie durch ein Training an einer speziellen Rückenmaschine begleitet, in die Sie wie in einen Schraubstock eingespannt werden. Wie verlockend!
Maschinen, die man nicht gern hat, sind die wichtigsten!
Schwärmen Sie doch mal von Ihrer letzten Trainingssession.
Kieser: Wenn ich im Training wirklich an meine Grenzen komme, dann gehe ich richtig beschwingt nach Hause. Das ist ein besseres Gefühl, als wenn man auf einer Liege herumgelungert, im Solarium geschwitzt oder an einer Bar herumgestanden hat. Ihr spartanisches Angebot kostet 69 Euro im Monat – deutlich mehr als die 47 Euro, die deutsche Studios im Schnitt verlangen. Und es ist etwa so viel, wie man bei der Onlineplattform Urban Sports Club für eine Mitgliedschaft bezahlt, bei der man unter vielen Aktivitäten und Studios wählen kann ...
Antonopoulos: Moment. Wenn Sie bedenken, dass Sie bei uns fast so eng wie in einem Personal Training unterstützt werden, dann sind 69 Euro günstig.
Diese Betreuung macht Kieser besonders?
Kieser: Begleitung! Betreuung ist ein Schimpfwort bei uns. Wir begleiten Menschen, die etwa Rückenprobleme oder Osteoporose haben oder beidem vorbeugen wollen.
Kieser: Es ist gewöhnungsbedürftig, aber nicht schmerzhaft. Auf diese Weise können Sie gezielt die tiefe Rückenmuskulatur trainieren, ohne dass diese von anderen Muskeln entlastet wird. So können Sie einer funktionellen Instabilität Ihrer Wirbelsäule vorbeugen – und womöglich sogar einem chirurgischen Eingriff zuvorkommen. 80 Prozent der Anwender haben danach weniger oder keine Rückenbeschwerden mehr.
Trotzdem wirbt Kieser mit dem Slogan: Es kommt die Zeit, da braucht es Kieser. Plakate zeigen einen älteren Herrn. Wollen sie die jüngeren Kunden gar nicht?
Kieser: Doch, natürlich. Als ich mit 19 mit dem Training begonnen habe, wollte ich etwas für meine Figur zu tun. Die äußere Erscheinung ist vielen jungen und weniger jungen Menschen eine wichtige Motivation fürs Krafttraining.
Antonopoulos: Unsere Neukunden sind im Schnitt 50 Jahre alt, etwa zehn Jahre älter als in anderen Studios. Darauf sind wir stolz. Die Babyboomer sind unsere wichtigste Zielgruppe. Sie wird dank des demografischen Wandels überproportional wachsen und hat ein intrinsisches Interesse an Gesundheit und Langlebigkeit. Obwohl Training so wichtig ist, haben Sie den Begriff kürzlich aus Ihrem Logo verbannt. Da steht nur noch Kieser. Warum? Antonopoulos: Weil wir unsere Leistungen erweitern. In allen unseren Studios erhalten Sie jetzt auch Nährstoffberatung und in ersten auch Physiotherapie.
Kieser: Unter therapeutischer Anleitung und mit dem gezielten Rückentraining erreicht der Kunde mehr Kraft und hat weniger Beschwerden. Mit dem Training kann er das Therapieresultat erhalten und ausbauen.
Dieses Konzept funktioniert wunderbar.
Dann komme ich als Patient, für den die Krankenkasse zahlt – und werde zum Kunden, weil der Physiotherapeut mir zum Training bei Ihnen rät? Clever.
Antonopoulos: Das Konzept hilft Menschen, die nach einer Physiotherapie sonst fälschlicherweise einfach fallen gelassen werden. Und natürlich müssen wir die Patienten mit einem sehr guten Angebot überzeugen, Mitglied zu werden.
Zahlt sich diese Strategie schon aus?
Antonopoulos: Unser Umsatz hat das Niveau von 2019 erreicht, obwohl wir noch etwas weniger Mitglieder haben als vor der Pandemie. 2025 entwickelt sich sehr gut. Sie peilen zehn Prozent Umsatzplus an.
Antonopoulos: Wir werden dieses Ziel womöglich übertreffen und erwarten 200 Millionen Euro Umsatz. Das erlaubt uns dann, weiter zu investieren. In neue Standorte, aber auch in die Entwicklung neuer Maschinen. Das hatten wir in der Pandemie zurückgestellt, um liquide zu bleiben.
Nach einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte wächst die Zahl Ihrer Kunden langsamer als die mancher Wettbewerber wie etwa der LifeFit Group, zu der die Marke FitnessFirst gehört. Und das, obwohl Ihre Zielgruppe der älteren Menschen so stark wächst. Warum profitieren Sie nicht stärker?
Antonopoulos: Uns geht es nicht darum, möglichst viele neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, sondern darum, sie möglichst lange zu halten. Im Schnitt bleiben sie 84 Monate, also sieben Jahre! Davon träumen die Fitnessdiscounter, von denen einige jedes Jahr 50 Prozent ihrer Kunden ersetzen müs-
DieManagement-Buy-In-Plattfor m, vonUnter nehmer n, fürUnter nehmer.
Ob Sieauf derSuche nach demricht igen Nachfolger sind oder einerwerdenwollen, AIAbringtdie best en Unternehmermit denbestenUnt ernehmen zusammen.
WirermöglichenerfahrenenFührungskräft en,KMUs mitNachfolgebedarf zu übernehmen undalsCEO undMit eigent ümer einzusteigen.
Fürweitere Informat ionen www.aia-mbi.com
sen. Dagegen erneuern 75 Prozent unserer Kunden ihre Verträge. Darauf sind wir stolz. Ihre Bilanz zeigt, dass Erlöse aus dem Verkauf von Waren und Getränken für Sie irrelevant sind. Andere Ketten verdienen jeden Monat fünf Euro pro Mitglied damit. Warum lassen Sie sich das entgehen?
Kieser: Anfang der Achtzigerjahre haben wir in den Studios Energydrinks und Kaffee verkauft und Sonnenbänke und Saunas angeboten. Aber weil das die Menschen vom Training ablenkt, hat Werner das damals alles wieder abgeschafft.
Antonopoulos: Wir könnten unseren Mitgliedern sicher alles Mögliche verkaufen. Aber wir bieten nur das an, was der Gesundheit unserer Kunden nützt.
Also können Sie nur wachsen, indem Sie expandieren. Aber aus Spanien und Großbritannien haben Sie sich zurückgezogen. Auch Ihre Pläne, in China zu starten, haben Sie gestoppt. Warum?

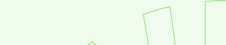



Antonopoulos: Wir arbeiten in jedem Land mit einem Generalpartner zusammen, auf dessen Engagement es besonders ankommt. Das klappt nicht immer, oft aber schon – etwa in Australien, wo es inzwischen mehr als 30 Kieser-Standorte gibt. Wann versuchen Sie es in den USA, wo Werner Kieser schon 1978 Maschinen gekauft hat?
Antonopoulos: Werners Vision lautete: Wir wollen die Welt kräftigen. Deswegen suchen wir immer nach neuen Märkten, allerdings ohne Zeitdruck. Japan etwa könnte interessant sein. Es ist eine überalterte Gesellschaft, und das Design der Kieser-Studios ist fast japanisch. Die USA sind natürlich auch sehr reizvoll. Warum so zögerlich? In Ihrem FranchiseModell tragen doch die Generalunternehmer und Studiobetreiber die Risiken ... Antonopoulos: Wir beteiligen uns durchaus und gehen mit ins Risiko. Aber natürlich brauchen die Partner am Ort Ressourcen, um in Maschinen und Marketing investieren zu können.
Wie viel Geld müsste ich mitbringen, um bei Ihnen Franchisenehmer zu werden?
Antonopoulos: Sie müssten 800 bis 1000 Euro pro Quadratmeter investieren, um das Studio zu gestalten. Sie müssten außerdem Maschinen im Wert von etwa 350.000 bis 400.000 Euro kaufen. Und Sie bräuchten Kapital, um den Betrieb vorzufinanzieren. Das ist nicht wenig, selbst wenn Ihre Bank sich beteiligt. Hier unterstützen wir umfassend und finden gemeinsam Lösungen. Das klingt nach Risiko. Wo liegt die Chance?
Kieser: Wenn Sie ein Kieser-Studio aufbauen, dann bieten Sie vielen Menschen einen großen Nutzen.
Antonopoulos: Sie tun etwas Sinnvolles und verdienen Geld dabei.
Kieser: Manche unserer Franchisenehmer haben echte Tellerwäscher-Karrieren gemacht: Sie haben als Instruktoren angefangen, konnten sich an einem Studio beteiligen und wurden selber Franchisenehmer. Um Geld zu sparen und nahe beim Studio zu sein, haben sie teils zu Beginn darin übernachtet. Dann wurden sie reich. Wir haben schon Menschen zu Millionären gemacht.
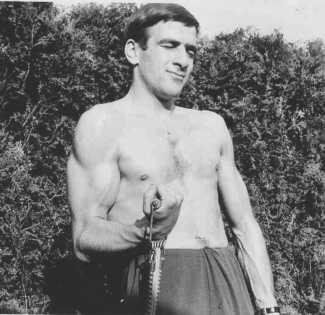
Antonopoulos: und das Trainingsangebot mit Physiotherapie verknüpft, als das noch eine klare Konzeptabweichung war. Mit welcher Konsequenz?
Antonopoulos: In solchen Fällen kündigen wir den Vertrag in der Regel. Aber unser Generalunternehmer hat uns erklärt, dass dieses Modell in Australien viel besser funktioniert, und uns überzeugt, es auszuprobieren. Er hatte recht.
2010 kam es zum Bruch mit dem Generalunternehmer für die Schweiz, der alle dortigen 19 Kieser-Studios betrieben hat. Kieser: Es gab Kommunikationsprobleme. Und er hatte die Studios nicht mehr so weiterentwickelt, wie Werner sich das vorgestellt hat. Also hat Werner beschlossen, den Vertrag auslaufen zu lassen und in der Schweiz selbst Studios zu betreiben. Oder, Michi?
Antonopoulos: Ich habe es etwas anders in Erinnerung. Es wäre besser gewesen, sich zu verständigen, als sich zu trennen. Wirtschaftlich war das ein fataler Fehler.
Fatal? Inwiefern?
Wie ist es für Sie, mit so vielen anderen Unternehmern zusammenzuarbeiten?
Kieser: Das ist die anspruchsvollste Form des Managements, weil unsere Partnerinnen und Partner ihr Geld in eine Marke und ein Konzept investieren, die nicht ihre eigenen sind. Denen können Sie nicht wie Angestellten Aufgaben zuweisen. Die müssen Sie überzeugen – immer wieder. Wollen die nicht überall mitreden?
Kieser: Davon kann Michi ein Lied singen!
Antonopoulos: Franchisepartnerschaften sind wie Ehen, halten aber oft länger. Wichtig ist es, dass Sie die Partner beteiligen, ihre Ideen ernst nehmen. Unsere Schultermaschine etwa geht auf den Vorschlag mehrerer Partner zurück. Aber ich muss auch Entscheidungen treffen, die nicht alle gut finden. Geben Sie uns ein Beispiel ?
Antonopoulos: Jeder Franchisenehmer zahlt in einen Fonds ein, der das gemeinsame nationale Marketing finanziert. Das Ergebnis finden naturgemäß nie alle gleich gut. Und falls der Erfolg einer Kampagne ausbleibt, gibt es Kritik.
In Australien hat Ihr Generalunternehmer mal gegen Ihre Vorgaben verstoßen ...
Antonopoulos: Weil es ausgerechnet in unserem Heimatmarkt auf einmal keine KieserStudios mehr gab und wir neue eröffnen mussten – in Konkurrenz zu unseren alten Studios, die der Unternehmer weiter betrieben hat. Er musste ja nur das Logo austauschen! Sie waren da gerade CEO geworden ...
Antonopoulos: ... und musste Werners Entscheid erst mal allen erklären. Das war nicht leicht. In solchen Situationen haben wir hier an diesem Tisch lange diskutiert
Kieser: ... und ich habe das Protokoll geschrieben ...
Antonopoulos: ... was sehr wichtig war, denn was im Protokoll stand, das galt (lacht) Konnten Sie sich denn überhaupt durchsetzen, als ein CEO gegen zwei Inhaber?
Antonopoulos: Die beiden waren sich ja nicht immer einig ...
Kieser: ... und du musstest nur abwarten, während wir diskutiert haben.
Antonopoulos: Irgendwann habt ihr fragend geschaut, wessen Partei ich ergreifen würde (lacht).
Und dann haben Sie sich gegen Werner Kieser verbündet?
Antonopoulos: Ganz subtil. Werner hat zum Beispiel mal über eineinhalb Jahre an
einer neuartigen Bizeps-Maschine getüftelt, die Entwicklungskosten gingen ins Nirwana. Das hätte ein Fiasko werden können. Also habe ich Gabi signalisiert: Du, wir müssen da einen Schlussstrich ziehen.
Und haben ihm die Maschine ausgeredet?
Antonopoulos: Ja, aber natürlich so, dass jeder sein Gesicht wahren konnte. Ich konnte Werner ja auch verstehen: Seit dem Start von Kieser hat er mit Leidenschaft Maschinen konstruiert und Menschen für den Kraftsport begeistert. Obwohl sein Vater ihm den Plan ausreden wollte, ist er als junger Mann das Wagnis eingegangen.
Kieser: Sein Leitspruch war: Man gibt nicht auf, das ist unanständig. Das erklärt seinen Erfolg genauso wie die Tatsache, dass er sich manchmal zu sehr in Ideen verbissen hat.
Wie skeptisch waren Sie denn, als Sie ihn mit 19 kennengelernt haben?
Kieser: Ich bin im noblen Quartier am Zürichberg aufgewachsen. Er hat im Arbeiterviertel ein Kraftstudio betrieben, damals eine eher anrüchige Sache. Meine Freundinnen haben gesagt: Jetzt spinnst du völlig, dass du dich auf den einlässt. Aber ich habe mich verliebt und an ihn geglaubt. Als ich nach meinem Medizinstudium 1990 eine Arztpraxis über einem Studio aufgemacht und dort medizinische Kräftigungstherapie angeboten habe, wurde ich Teil der Firma. Das Unternehmen wurde unser Kind.
In der Firmenchronik auf der Website taucht Ihr Name aber nur zweimal auf.
Kieser: Ich stehe nicht so gern im Rampenlicht. Werner war eher der Visionär, der gerne vor der Kamera über seine Mission gesprochen hat. Ich habe nach meinem Medizinstudium noch einen MBA gemacht, um das notwendige Rüstzeug für die Unternehmensführung zu lernen.
Antonopoulos: Du warst unheimlich wichtig, weil du die Zahlen im Blick behalten hast.
Wie groß ist die Lücke, die Werner Kieser hinterlassen hat, als er im Mai 2021 so plötzlich gestorben ist?
Kieser: Die Lücke ist sehr groß. Aber ich lebe weiter, und zwar gut. Ich trainiere regelmäßig, und ich habe mit dem Malen angefangen. Für das Unternehmen musst du das beantworten, Michi
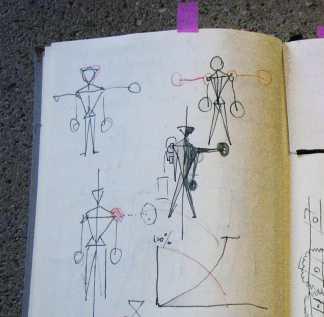
Werner Kieser entwarf viele Trainingsgeräte selbst, 1999 etwa dieses Gewichtssystem
Antonopoulos: Werner werden wir nie ersetzen können. Aber dank seiner Bücher können wir auf viele seiner Ideen zurückgreifen. Und wir haben bereits lange vor seinem Tod darauf hingearbeitet, das Unternehmen so aufzustellen, dass es auch ohne ihn eine erfolgreiche Zukunft hat. Nach vielen Jahren als Chef haben Sie die Firma 2017 zusammen mit einem Partner übernommen und erst mal die Schweizer Studios zurückgeholt, die 2010 abtrünnig geworden waren.
Antonopoulos: Das ging etwas leichter, weil Werner nicht mehr beteiligt war. Frau Kieser, Ihr Mann war damals schon 77, Sie aber waren erst Ende 50. Warum wollten Sie nicht allein weitermachen?
Kieser: Die Beziehung zu meinem Mann hätte das wohl nicht überlebt. Der hätte mir zu Hause vermutlich immer wieder gesagt: Tu dies, lass das. Es war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Also haben Sie und Werner sich damals gefreut, endlich mehr Zeit füreinander und Ihr Haus in den Alpen zu haben?
Kieser: Gefreut haben wir uns nicht! Michael musste uns zu unserem Glück zwingen (lacht)
Antonopoulos: Zwingen? Ich habe euch überzeugt: Als Unternehmer darf man die Frage nicht zu lange aufschieben, was werden soll, wenn man mal nicht mehr ist oder nicht mehr kann.
Kieser: Wir hatten keine Kinder und wollten die Firma auf keinen Fall an eine seelenlose Private-Equity-Firma verkaufen. Du hingegen kanntest uns und das Unternehmen als Geschäftsführer seit Jahren. Das war eine ideale Konstellation.
Antonopoulos: Dass wir heute hier zusammensitzen, zeigt das auch. Bei aller Sympathie: Wie hart haben Sie über den Kaufpreis verhandelt?
Kieser: Er wollte weniger bezahlen, wir wollten mehr haben. Irgendwann haben wir uns geeinigt. Wie bei jedem Geschäft –nur dass er im Fall unseres Unternehmens die Zahlen besser kannte als wir (lacht) Welchen Betrag haben Sie vereinbart?
Antonopoulos: Das behalten wir für uns. Als Werner Kieser gegründet hat, musste er sich Geld leihen. Haben Sie sich auch verschuldet, um die Firma zu kaufen?
Antonopoulos: Klar. Ich konnte das nicht aus der Portokasse zaubern. Und ich habe keinen reichen Reederei-Onkel in Griechenland. Deswegen habe ich mich mit Nils Planzer zusammengetan, einem Unternehmer, mit dem ich schon lange befreundet bin. Frau Kieser, verfolgen Sie noch, wie Michael Antonopoulos die Firma führt?
Kieser: Ich gehe ja immer noch trainieren und bekomme auch mit, wie es läuft. Und ab und an kommt Michi hier an diesen Tisch. Ich mache einen Salat. Dann reden wir. Das schätze ich sehr.
Wie würde Werner Kieser heute auf das Unternehmen schauen?
Kieser: Er würde wohl damit fremdeln, dass die Studios im deutschsprachigen Raum jetzt auch eine individuelle Nährstoffberatung anbieten ...
Antonopoulos: weil viele unserer Kundinnen und Kunden sich gesünder ernähren, abnehmen und an ihrer Körperzusammensetzung arbeiten wollen.
Kieser: Du machst schon ein paar Dinge anders. Aber alles in allem wäre Werner wohl ganz zufrieden.
Die Fragen stellte Jens Tönnesmann
Martin Israel hat in Greifswald ein Start-up gegründet, das mit Drohnen Wildtiere vor Mähmaschinen schützt. Eine Erfolgsgeschichte gegen alle Widerstände
VON CAROLYN BRAUN
Rehkitze schützen: klingt nicht gerade nach einem guten Geschäftsmodell.
43-jähriger Forscher ohne Erfahrung in der Wirtschaft: klingt nicht wie ein Typ, der erfolgreich eine Firma gründet.
Drohnen: klingt nach den Flugrobotern, die nur zerstören können.
Martin Israel widerlegt das alles – mit einer Idee, die sein Leben prägt.
Die Geschichte geht los, als der Elektround Informationstechniker 2008 als Forscher beim Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen anfängt. Er ist ein großer Tierfreund und findet eine besondere Forschungsnische: Rehkitze. Die verstecken sich im hohen Gras, sind mit ihrem gepunkteten Fell schwer auszumachen, stellen sich gern tot und geben keinerlei Geruch ab. Was sie vor Fressfeinden schützt, aber auch dafür sorgt, dass jedes Jahr mehr als 100.000 von ihnen bei der Wiesenmahd übersehen und verletzt oder getötet werden.
Das wollen Israel und seine Forscherkollegen verhindern: »Wir haben eineinhalb Jahre lang herumprobiert, auch Patente angemeldet«, sagt Israel, »aber es blieb unbefriedigend.« Dann kommt er darauf, die Rehe mit Drohnen zu orten, das allein sei damals »etwas ganz Neues und Spektakuläres« gewesen. Dazu rüsten sie die Flugroboter mit Wärmebild kameras aus. Denn einzig die Wärmestrahlung der Tiere macht sie sichtbar. Im Jahr 2010 bauen die Forscher um Israel für 30.000 Euro ihr erstes System auf – und retten das erste Kitz.
Das gefällt auch anderen. Das Bun desforschungsministerium finanziert das Projekt, Landmaschinenhersteller und Hochschulen unterstützen Israel ebenfalls. Der entwickelt die Idee weiter: Inzwischen liefern die Drohnen die GPS-Koordinaten der Rehe, so lassen sich mehr von ihnen in
kürzerer Zeit retten. »Wir fliegen mit einer Drohne einen Hektar pro Minute, schaffen effektiv 20 bis 30 Hektar pro Stunde, bei größeren Feldern geht’s noch schneller«, rechnet Israel vor. Bis 2015 promoviert er zum Thema »fliegende Wildretter«.
Und Israel ist als Forscher ganz zufrieden. Doch dann kommt ihm das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in die Quere. Das DLR kann seine Stelle nicht entfristen, und so steht er plötzlich ohne Job da. Also gründet Israel zusammen mit seinem Partner Tobias Dahms in Greifswald das Unternehmen Thermal Drones, das DLR unterstützt ihn. Allerdings: »Am Anfang war es eine totale Katastrophe«, erinnert sich Israel. Nicht nur unternehmerisch. Ende 2020 erhält er eine Krebsdiagnose. Ein 14 Zentimeter großer Tumor in seiner Lunge. 30 Prozent Überlebenschance.

sich Rehkitze orten und vor Landmaschinen retten
Über die Zeit seiner Erkrankung erzählt Israel nicht viel. Entscheidend ist: Er überlebt. Genau wie seine Firma. Auch weil Israel seine eigenen Kosten anfangs durch Krankengeld, Erwerbsminderungsrente und Arbeitslosengeld decken kann. 2021 zieht das Geschäft an. Dieses Jahr dürfte Thermal Drones nach eigenen Angaben um die 250 Drohnen verkaufen, zwölf Mitarbeiter beschäftigt die Firma inzwischen. Die Drohnen fertigen sie nicht mehr selbst, sondern nutzen die günstigeren Produkte des chinesischen Herstellers DJI. Der wichtigste Service ihrer Software seien das EchtzeitGeo-Tracking und der Datenaustausch zwischen allen beteiligten Personen, erklärt Israel. »Seit 17 Jahren bin ich da inzwischen dran«, sagt der heute 49-Jährige. Immer noch kriege er so viel zurück: »Wenn man ein zwei Wochen altes Rehkitz rettet und aus der Wiese trägt, schreit es manchmal wie ein Menschenbaby nach seiner Mutter.« Da merke man dann, wie verletzlich und hilflos es sei.

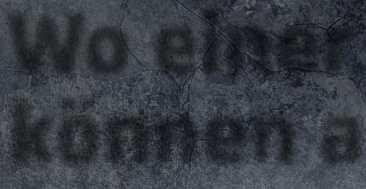
übergab 2022 an

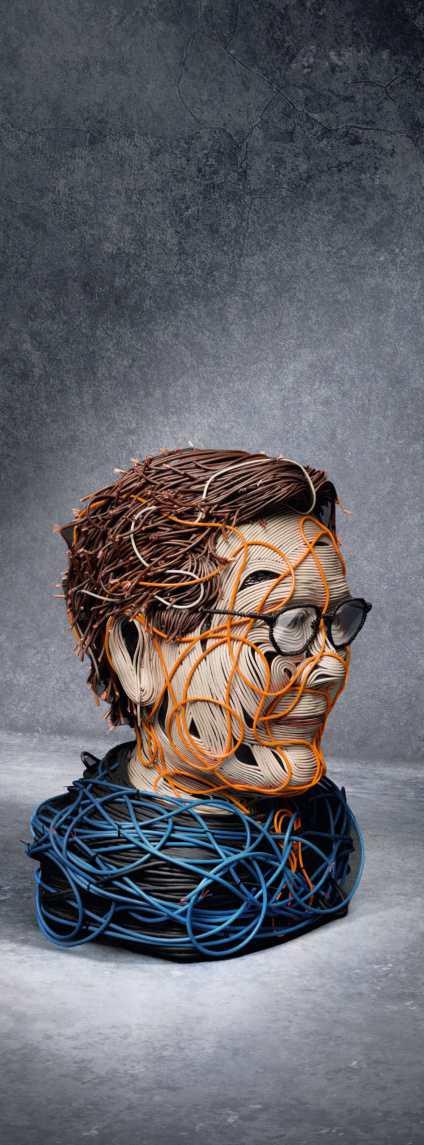









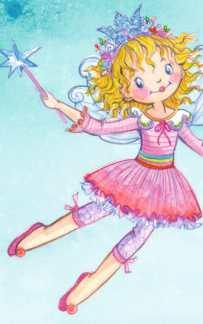






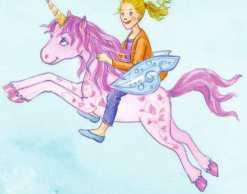




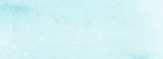


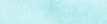




Wolfgang Hölker,Gründer& Verleger Dr.Lamber tScheer, geschäf tsführenderGesellschafter JohannaHölker &Louisa Hölker,Geschäftsleitung

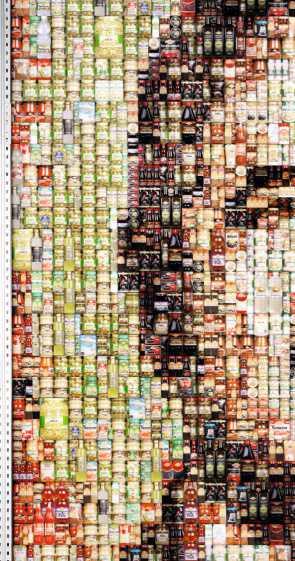








So unterschiedlic hu nser eK und:innen sind ,s oi ndividuell begleiten wir sie in allen Phasen derUnternehmensübergabe. Dieser komplexeProzess verlangtnachmaßgeschneider ten Lösungen, Know-how undFingerspitzengefühl. Sprechen Siemit unseren Nachfolgespezialist:innen.





1 In den Möbeln steckt viel Handarbeit. Hier legt der Mitarbeiter Stefan Wilms Holzplatten so auf der Säge zurecht, dass kaum Verschnitt entsteht
2 Dann übernimmt Malte Hinrichs an der Fräse. Die kostet so viel wie ein Einfamilienhaus und macht den Job, für den früher fünf Maschinen nötig waren
3 Mit unterschiedlichen Aufsätzen fräst sie millimetergenau Fugen und Bohrlöcher für die spätere Montage

In einer Kleinstadt in Friesland produziert das Familienunternehmen Müller Möbelwerkstätten minimalistische Designmöbel für Großstädter mit wenig Raum
VON NAVINA REUS; FOTOS: JEWGENI ROPPEL


4 Die 50 Mitarbeiter von Müller stellen jedes Jahr 25.000 Möbelstücke her. Deren Einzelteile werden in einer von 24 Farben lackiert. Die Unterdruckkammer verhindert, dass sich unschöne Staubpartikel festsetzen
5 Danach müssen die Elemente für zwölf Stunden trocknen und werden im Anschluss – wenn nötig – für den schönen Schein poliert
6 In der Montagehalle findet alles zusammen, was zusammengehört: Die Mitarbeiter setzen Schrauben, Verschlüsse, Scharniere und Dübel ein. Dann verpackt die Pappkartonanlage jedes Teil passgenau. Aufs Jahr gerechnet, verbraucht Müller so viel Wellpappe, dass man damit 17 Fußballfelder abdecken könnte



7
7 Manche Möbel nehmen vor dem Versand einen Umweg über die hauseigene Polsterei. Seit 2020 stellt Müller auch alle gepolsterten Produkte wieder selbst her – wie vor 100 Jahren
8 Drei Wochen nach der Order können Kunden die Möbel aufbauen – etwa diesen Sekretär namens »Plane« des Designers Felix Stark. Der Preis ist das Einzige, was bei Müller nicht minimalistisch ist: Allein der Tisch kostet 1.102 Euro

8
Designmöbel herstellen – ganz ohne eigene Designerinnen und Designer? Für Jochen Müller ergibt das durchaus Sinn. Er leitet die Müller Möbelwerkstätten in Bockhorn und ist Chef von 50 Beschäftigten. Im Stammhaus der Firma, das seine Urgroßeltern 1898 errichtet haben, beantwortet Müller den Fragebogen, der jede Fotostory von ZEIT für Unternehmer begleitet.
Was macht Ihre Produkte aus?
Jochen Müller: Unsere Möbel entstehen aus der Funktion heraus. Ihr reduziertes Design verleiht ihnen eine eigenständige Ästhetik – minimalistisch, puristisch und gleichzeitig leicht verständlich. Sie führen Ihr Unternehmen in fünfter Generation. Was ist besonders schön in einem Familienbetrieb?
Die besondere Atmosphäre. Man kennt sich gut, arbeitet kollegial zusammen und profitiert von kurzen Entscheidungswegen. Gleichzeitig erfährt man als Familienunternehmer viel Wertschätzung von außen –das motiviert ungemein.
Was ist die größte Herausforderung für Sie als Unternehmer?
Die richtigen Produkte zu identifizieren. Wir bekommen ständig spannende Vorschläge, aber nicht alles passt zu unserem Markt oder lässt sich sinnvoll umsetzen. Ich muss das auswählen, was unseren Kundinnen und Kunden den größten Nutzen bringt und was wir gleichzeitig wirtschaftlich produzieren können. Manchmal fühlt es sich an wie ein Spiel mit hohem Einsatz: Trifft man die richtige Wahl, geht es aufwärts – liegt man daneben, wird es riskant.
Woran wäre Ihr Betrieb fast gescheitert?
Zum Glück stand unser Unternehmen nie wirklich vor dem Aus. Aber als mein Vater die Firma noch allein führte, brach ein Großkunde weg – und mit ihm 35 Prozent

Jochen Müller, 42, führt die Geschäfte zusammen mit seiner Frau Katja Müller
des Umsatzes. Das war ein Schock. Seitdem haben wir die Abhängigkeiten stark reduziert: Wir beliefern heute viele Händler und verkaufen auch direkt an Endkunden. Unser größter Kunde macht nur noch einen kleinen Teil unseres Geschäfts aus. Sie arbeiten nur mit freien Designern zusammen. Wieso?
Das hat Tradition: Die Entscheidung fiel schon in den 1960erJahren. Ich finde sie nach wie vor wertvoll, weil wir so frische Perspektiven von außen bekommen. Unsere Möbel entstehen auf dem Land, werden aber in den Städten genutzt – dort, wo unsere Designerinnen und Designer zu Hause sind. Wie wichtig sind Designpreise für Sie?
Sie sind für uns ein PRWerkzeug. Ihre größte Bedeutung haben sie außerhalb Deutschlands – etwa in Südkorea, wo »Made in Germany« wertgeschätzt wird und Preise diesen Ruf noch unterstreichen. Sie haben 2018 Ihre Marke geändert. Warum war der Relaunch nötig?
Um unsere internationale Ausrichtung zu unterstützen. Unser ursprünglicher Name »Müller Möbelwerkstätten« war im Ausland schwer auszusprechen. Gleichzeitig wollten wir unsere Kernidee – Möbel zu entwickeln, die Wohnen auf kleinem Raum erleichtern –deutlicher in der Marke verankern. Daraus ist Müller Small Living entstanden. Was hat das gebracht?
Es hat unsere Sichtbarkeit erhöht. Heute findet man unser Logo bei Händlern im Schaufenster – oft direkt neben international bekannten Marken. Früher waren unsere Kataloge eher im Hintergrund versteckt. Vervollständigen Sie diesen Satz: Müller Small Living wäre nichts ohne ... ... die Stapelliege. Ein Bett, das sich einfach und platzsparend übereinanderstapeln lässt und das man einzeln, als Doppel oder als zusätzliches Gästebett nutzen kann. Der Designer Rolf Heide hat sie 1966 für uns entworfen, und sie ist unsere Ikone und ein Stück Identität. Sie war unsere Eintrittskarte in die designorientierte Einrichtungsbranche und ist mit mehr als 100.000 produzierten Exemplaren bis heute unser erfolgreichstes Modell.
Wie blicken Sie auf die Konkurrenz?
Wettbewerb hält uns wach und bringt Bewegung ins Geschäft. Was mich aber ärgert, sind Plagiate. Wenn jemand unsere Ideen übernimmt und daran verdient, kann ich das nicht gelassen hinnehmen.
Welchen Unternehmer würden Sie gerne mal zum Business-Lunch treffen?
Bill Gates. Sein Aufbau von Microsoft ist eine unternehmerische Meisterleistung, auch wenn er dabei sicher nicht zimperlich war. Spannend finde ich, dass er heute mit seiner Stiftung zeigt, wie man wirt schaft liche Macht in gesellschaftliche Verantwortung übersetzen kann.
Die Fragen stellte Navina Reus

Die wirtschaftliche Lage bleibt angespan nt
Laut der aktuellen DIHK -K onjunkturum f ra ge 1 belas te nv or allem die sch wa che Nach fr ag e, hohe Ener gie- und Ro hs to ffp re ise ,d er Fa chkr äft emangel so wie wirtschaftspolitische Unsicherheit en die En tw icklung vieler Un te rnehmen. Ei nV ie rt el der be fr ag te nB et ri eb es ch ät zt die eigene Geschäftslag ea ls schlech te in. Und au c h die Finanzierungssitua tion is tb ei 43 Pr oz en t angespann t–o ft auf grund vo nL iquiditä tsengpässen, Fo rd erungsaus fä llen oder Eigen ka pitalrück gang.
Gleichz eitig is te sw eit erhin sch wierig, an klassisches Fr emdk apita lz ug el a ngen. Di e Kf W- if o-Kredithür de 2 ze igt: Ein Drit te ld er KM U emp finde td ie Kredit ve rhandlungen mit Ba nk en als re st riktiv –e in Höchs tw er ts eit Beginn der Erhebung im Jahr 20 17
Finanzierung pe rG ebr auch tmaschinen, Fu hrparks und Wa re nlager Trot zo der ger ade we gen des vo la t ilen U mf elds is te sf ür viel eU nt ernehm en en tsc h ei dend ,i n da se igen eW achs tu mz ui nv es tier en –s chon allein ,u mw ett be we rbs fä hig zu bleiben und am Markt zu be st ehen. Häufig geh te se tw a darum, Lagerflächen zu erw eit ern, Digitalisierungspr ojekt eu mzuse tz en oder neue Märkt e zu er sc hl ie ßen. Um solche Vo rh ab en ku rz -b is mit te lfris ti gu ms et ze nz uk önnen, br auc ht es jedoch ve rlässlich eL iquiditä tsquellen.
In sb eso nd er ef ür Un te rneh me n, di eü be r we rthaltige Ve rmögensgegens tände ve rfügen, eröffnen sich über bonitä tsunabhängige Finanzierungs lö su ngen wi eS al e& Le as eB ac k( SL B) oder Asse tB ased Cr edit neue Handlungsspielrä um e. So ze igt et wa ein Pr axis fa ll einer Un te rnehmensgruppe aus Nor drhein-We st fa len, wie mit SLB Wa chs tumspr ojekt ef inanzier tw er den kö nnen. Di eG ruppe ,d ie sich auf die He rs te llung un dVer arbeitun gvon Pr äzisionss tahlrohren für die Au to mo bi lbr an che sp ez ia li si er th at ,s ta nd vo rd er Au fg abe ,n eue Pr ojekt ez ur Stärk ung de rM arktposition u n dW et tbe we rbs fä higk eit auf den We gz ub ringen. Um die dazu nö tigen
M it te lb er ei tz us te ll en un dz ug le ic hf le xi bel zu bleiben, en tschied sich die Gruppe für eine objektbasiert eF inanzierung per SL B. Im Rahmen dieser wurden hoch we rtige ,b ereits abgeschriebene Maschinen an den Finanzierun gspa rtner ve rk auft und unmit te lbar zurüc kg eleas t. So wu rd eg eb un dene sK apit al fr ei gese tz t, oh ne das sd er Be trieb un te rbrochen we rd en muss te Die liq u iden M it te ls te hen den einz elnen Gesellschaft en der Gruppe nun als Wo rking Capital zur Ve rfügung.
Asse tbasiert eF inanzierungsmodelle ku rz erklärt
•B ei Sa le &L ease Ba ck ,k ur zS LB ,h andel t es sich um eine Spezialf or md es Le asings, die es Mit te ls tändlern ermöglich t, ihre we rthaltigen, mobilen und sek undärmarktfä higen Maschinen, Anlagen und Fu hrparks zu ve rk auf en und direkt zurückzuleasen
Dadurch wir dL iquiditä tf re igese tzt. Die Asse ts ve rbleiben im Un te rnehmen und kö nnen ohne Un te rbrechung we it er genutzt we rd en.
• Beim Asse tB ased Cr edit kö nne nU nt ernehmen nic ht nur ihr Anlage-, sondern auch ihr Umlauf ve rmöge na ls Sicherhei tf ür eine ku rz -b is mit te lfris tige Spezialfinanzierung eins et ze n. Vo ra usse tzung: Die eingese tzt en Asse ts aus Handels- und Fe rtigw arenlage r, Maschinenpark, Sa ch we rt en oder Immobilien sin dwerthaltig und markt gängig.
Die MaturusFinance GmbH ist eine Finanzierungsgesellschaft,die objektbasierteLösungen anbietet, um Unternehmen zu Liquiditätzu verhelfen.Sie istAnsprechpartnerin fürMittelständler,die banken- und bonitätsunabhängige Wege der Finanzierung suchen. Die Gesellschaft hatihren Sitz in Hamburg, Deutschland, undist seit2015auch in Österreich vertreten.
maturus-finance.com


Wer Unternehmer werden will, muss nicht selbst gründen.
Tausende Firmen stehen zum Verkauf. Braucht man eigenes Geld dafür? Oder geht es auch ohne?
VON JENS TÖBBEN; FOTO: ROBERT FISCHER

Lisa Stuhler, 33, sucht den »Jackpot«: einen Mittelständler, den sie übernehmen kann
Der Betonklotz, der mal eine Kita werden soll, ähnelt mit seinen 106 mannshohen Öffnungen einem Schweizer Käse in Grau. In eins der Löcher tritt vorsichtig Rasmus Rieger, guckt runter, winkt hoch. »Hereinspaziert.« Rieger ist der Chef der Firma F&G Bauelemente, die die Löcher mit Fenstern stopfen soll.
Es ist ein nieseliger Vormittag in Frankenthal, Rheinland-Pfalz. Wer über Dutzende Pfützen nach oben steigt, entdeckt noch einen Mann, der sich in die Lücke beugt. Er trägt eine Fleecejacke und nimmt die Maße, gibt sie an Rieger durch. »Eins, vier, neun, fünf.« Rieger kritzelt in seinen Block. Der Mann im Fleece dreht sich um, drückt einem kurz die Hand und stellt sich vor: »Grüßung.«
Michael Grüßung ist Riegers Angestellter. Wobei: Das ist nur die halbe Wahrheit. Grüßung, 64 Jahre alt, hat das Unternehmen gegründet, gepäppelt, aufgebaut. Er ist das »G« im Firmennamen. Vor einem halben Jahr hat er seine Firma an Rasmus Rieger übergeben. Obwohl der vorher noch nicht bei dem Unternehmen arbeitete oder, ja, überhaupt etwas mit Baustellen zu tun hatte.
Rasmus Rieger, 41 Jahre alt, kommt eigentlich aus der Autobranche, bei Konzernen hat er zwischenzeitlich mehrere Hundert Mitarbeiter koordiniert. »Auch als Topmanager hast du immer noch vier Ebenen über dir«, sagt Rieger. »Das wollte ich nicht mehr.« Er wollte selbst Unternehmer werden. Im März kaufte er F&G Bauelemente.
Seitdem tourt Grüßung mit Rieger durch Deutschland, um ihn einzuarbeiten. Die Baustellen von F&G erstrecken sich von Potsdam bis Starnberg, von Chemnitz bis Frankenthal. Der Hauptsitz liegt in Schleusingen, Thüringen. Die Baustellen zu besuchen, ist bei F&G Chefsache. Seit April: Riegers Sache.
Zur Mittagspause nehmen Grüßung und Rieger in der Siederklause Platz, einem bürgerlichen Lokal, das Bingo, Grillabende und sechs verschiedene Schnitzel anbietet. Während Grüßung einen Vorspeisensalat isst, erzählt er von dem Unternehmen, das ihm so lange gehört hat. Die vergangenen 35 Jahre hat er F&G gewidmet. Was mit vier Personen und Rollladenverkäufen startete, wuchs zwischenzeitlich auf 70 Mitarbeiter an, heute

Rasmus Rieger, 41, hatte keine Gründungsidee. Also suchte er ein Kaufobjekt
sind es etwa 40. Mittlerweile gehören neben Fenstern auch Brandschutztüren und Metallarbeiten zum Sortiment. Die vergangenen Jahre liefen gut, auch 2023 bilanzierte das Unternehmen noch einen Gewinn von 240.000 Euro.
Trotzdem fand Grüßung jahrelang keinen Nachfolger, auch nicht in der eigenen Familie. So geht es vielen Unternehmern. Der deutsche Mittelstand steht vor der Rente, 39 Prozent der Inhaber sind über 60 Jahre alt. Dass ihre Kinder die Firma übernehmen, ist nicht mehr selbstverständlich. Das Nachfolgeproblem wächst. Allein in diesem Jahr suchen 215.000 Unternehmen neue Chefinnen und Chefs, schätzt das Mittelstandspanel der KfW-Förderbank. Das bremst die Wirtschaft und stresst die Inhaber, die wie Grüßung gerne in den Ruhestand gehen wollen.
Und es lockt Vermittler auf den Plan. Es gibt mittlerweile Dutzende Onlineportale für Unternehmer, die aufhören wollen, Unternehmer zu sein – und Menschen, die Unternehmer werden wollen. Sie sollen hier zusammenfinden, ein bisschen wie bei DatingApps. Nur dass es statt um Hobbys, Haarschnitt und Größe um Gewinn, Umsatz und Standort geht. Wellnesshotels, Fuhrparks, Goldhändler: Für jeden ist etwas dabei. Damit die Konkurrenz nichts mitkriegt, werben die Firmen anonym und preisen sich so attraktiv wie möglich an. Etwa so: »Marktführer im Elektrofachhandel mit exzellentem Serviceangebot«. Elf Mitarbeiter, in NRW, Gewinn von 400.000 Euro im Jahr.
Kai Hesselmann lebt davon, solche Firmen an den Mann zu bringen. Er leitet das Unternehmen DealCircle, mit dem Käufer und Verkäufer zusammenfinden sollen, etwa auf der Plattform Amber. 1.400 Deals habe DealCircle so 2024 vermittelt, sagt der Unternehmer. Das klingt nach einer Menge. Allerdings ist es wenig, gemessen an der Zahl von rund einer Million Profilen, die Nutzer dort bereits angelegt haben sollen. Doch die Summen bei den Deals sind ordentlich. Etwa 350 Millionen Euro gingen bei den Käufen allein im vergangenen Jahr über den Tisch. DealCircle bekommt jeweils zwei Prozent Provision. »Wir hoffen in diesem Jahr auf einen Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe«, sagt Hesselmann.


Leistu ng sf äh ig keit bedeutet fü ru ns, Herausforderunge ni nC hancen zu verwandeln .
DasjapanischeHandwerkKintsugiverbindet Bruchs tückemit Gold und schafft so etwasEinzigartiges und Besseres. Dies ist füruns In spiration: Gemein sammit un seren Kunden entwickeln wirindividuelleLösungen, diezukunft ssichere Strukturen ermö glichen. Er fahren Sie, wiewir Leis tung sfähigkeit sichern unter firmenkunden.dzbank.de


Im Idealfall schreibt man dem Unternehmer, redet, trifft sich und einigt sich auf einen Preis. Auch Rasmus Rieger klickte sich Ende 2023 durch die Firmenprofile. »Da hab ich echt skurrile Dinge erlebt«, erzählt er. »Manche Inhaber haben ihr eigenes Unternehmen schlechtgeredet. Man hatte das Gefühl, die wollen gar nicht verkaufen.«
Ein Match ist die Ausnahme. Manchmal passt es menschlich nicht, die Qualifikation des Käufers stimmt nicht, oder der Blick in die Bilanz verdirbt das Interesse. Für ein Drittel der Nachfolgen ist der Kaufpreis eine Hürde, zeigt das KfW-Mittelstandspanel. Dabei haben die Inhaber Zeitdruck, weil sie in den Ruhestand wollen oder nicht gesund sind. »Viele kümmern sich zu spät um die Nachfolge«, sagt Kai Hesselmann von DealCircle. »Die Käufer können sich dagegen Zeit lassen.«
Für Rasmus Rieger waren Standort, Branche und Zahlen wichtig. Als er F&G entdeckte, konnte er alle drei Kriterien abhaken. Der Firmensitz Schleusingen liegt nur 35 Kilometer von Riegers Wohnort Coburg entfernt. In der Metallsparte hatte er durch die Automobilbranche bereits Erfahrungen, auch die Zahlen seien über die Corona-Jahre stets gut gewesen, die Mitarbeiterzahl und die Gewinne hätten auch gestimmt. »Es ist fast schon schade, dass es so früh gut gepasst hat«, sagt Rieger, »eigentlich hätte ich noch gern zwei, drei andere Unternehmen gesehen.«
Entspannt waren die Verhandlungen trotzdem nicht. Sie starteten mit einem holprigen Videocall zwischen Rieger und Grüßung im Mai 2024. Rieger besuchte die Firma danach, zwischen Juni und Oktober liefen die Gespräche vor allem über die Berater der beiden. Im Oktober fingen Rieger und Grüßung an, sich alle zwei Wochen zu treffen. »Anfangs gab es da Skepsis auf beiden Seiten«, sagt Rieger. Klar, der eine will was kaufen, der andere verkaufen. Welcher Statistik kann man vertrauen, welche Details sind aufgehübscht? »Bis kurz vor der Vertragsunterschrift liegen die Nerven blank«, sagt Rieger. »Mit der Unterschrift ändert sich das. Ab dann läuft man nicht mehr gegeneinander, sondern in die gleiche Richtung.«
Wie teuer Unternehmen sind, dazu gibt es wenige konkrete Zahlen. Eine KfW-Studie aus 2019 zeigt, dass die Hälfte der Mittelständler, die ihre Firma verkaufen wollten, mehr als 175.000 Euro wollten, 15 Prozent sogar mehr als eine Million. Das Geld holt man am besten aus verschiedenen Quellen. Hier ein Überblick:
Experten empfehlen, den Firmenkauf mit 15 bis 20 Prozent Eigenkapital zu finanzieren. Das können mehrere Zehntausend oder Hunderttausend Euro sein. Wer dafür alle Ersparnisse plündern oder sogar Verwandte anhauen müsste, sollte sich die Sache noch mal überlegen.
Um mehr Eigenkapital aufzustellen, kann man sich von Investoren helfen lassen, die einen Teil des Kaufpreises bezahlen und dafür Firmenanteile erhalten. Manchmal fordern sie dafür Mitsprache. Solche Investoren engagieren sich oft nur auf Zeit und erwarten spätestens beim »Exit« eine Rendite.
Die meisten Käufer kommen um einen Bankkredit nicht herum. Seine Konditionen hängen von der Größe des Unternehmens, seiner Geschäftslage und seinen Aussichten und dem Nachfolger ab. Die Bank will eine gute Bonität und einen stimmigen Plan fürs Unternehmen sehen. Banken sichern sich oft über Bürgschaftsbanken ab, die zur Not für den Kredit einspringen können.
Verschiedene Länder und die KfW vergeben Förderkredite, auch diese Institute erwarten tragfähige Konzepte. Neben den Übernahmekosten sind Kosten für Investitionen, Betriebsmittel oder Warenlager förderfähig.
Der scheidende Unternehmer kann einen Teil des Kaufpreises als Verkäuferdarlehen gewähren, dann wird er quasi erst nachträglich bezahlt.
Rieger und Grüßung einigten sich auf einen niedrigen siebenstelligen Kaufpreis, genauer wollen sie das nicht sagen. Aber für ein Unternehmen der Größe von F&G ist das nicht ungewöhnlich. Rieger selbst hat 15 Prozent davon direkt gezahlt, die restlichen 85 Prozent finanzierte er durch einen Kredit und die Förderung einer Aufbaubank. Dieses Darlehen ist wiederum durch eine Bürgschaft der Thüringer Landesbank abgesichert, das senkt das Risiko für die Bank. Wenn F&G weiter solche Gewinne erzielt wie bisher, kann Rieger den Kredit in zehn Jahren tilgen. Grüßung ist dann schon lange im Ruhestand, ab diesem Oktober reist Rieger erst mal ohne ihn von Baustelle zu Baustelle.
Geld ist die größte Hürde beim Unternehmenskauf. Wer ein profitables Unternehmen kaufen will, braucht meist viel Eigenkapital, einen Fachhintergrund und eine gute Bonität, um die Bank zu überzeugen. Vier von zehn Interessierten haben Finanzierungsprobleme, zeigt eine Umfrage der DIHK. Doch in Europa verbreitet sich ein Konzept, das auch Menschen ohne viel Geld den Einstieg ermöglichen soll.
Man merkt Lisa Stuhler gar nicht an, dass sie einen Flug hinter sich hat. In der Lobby eines Co-Working-Space in München schreitet die 33-Jährige einem energisch entgegen, lächelt, führt herum; vorbei an Gruppen aus jungen Hemd- und Gelhaarträgern, am Billardtisch und den plumpsgeeigneten Couches in ein Zehn-Quadratmeter-Büro, tapeziert mit Notizzetteln. An der Wand hängen motivational quotes, natürlich auf Englisch. An Lisa Stuhler schreit alles Start-up. Aber sie will in den Mittelstand. Das Zeug dazu sollte sie haben. Sie ist die erste Akademikerin der Familie, hat einen Einser-MBA von der TU München und hat auch in Peking studiert. Sie war in der PR, bei Strategieberatungen, Agenturen und Familienunternehmen. Auch mal ein halbes Jahr bei der Finanzfirma Wirecard, die im Juni 2020 pleiteging. »Da wirst du krisenresistent«, sagt Stuhler. Auch gegründet hat sie, das hat aber nicht geklappt. »Ich bin besser darin, ein Unternehmen von eins auf zehn zu bringen als von null auf eins.«
Nur: Lisa Stuhler fehlt das Geld für ein eigenes Unternehmen.

Nutzen Sieden Investitions turbofür Nachhaltigkeit , Innovation undDigit alisierung.


DerFörderkreditfür IhrUnter nehmen: NRW.BA NK .Inves tZukunft








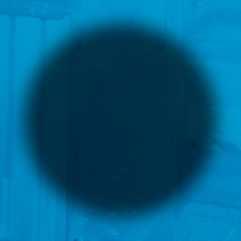





Die Lösung ist ein sogenannter SearchFund. Das Konzept kommt aus den Achtzigerjahren und stammt von einem HarvardProfessor. Er überlegte, wie er seine jungen, talentierten MBA-Absolventen schnell in Führungspositionen bringen könnte, ohne dass sie dafür ein Unternehmen gründen müssten. Seine Idee: Die Absolventen übernehmen die Firmen von scheidenden Inhabern, und Investoren finanzieren nicht nur den Kauf, sondern schon die Suche. Als Gegenleistung bekommen die Geldgeber Firmenanteile, der »Searcher« erhält nur zwischen 20 und 30 Prozent.
So läuft es auch bei Lisa Stuhler. Mit Geld von 18 Investoren und einem Eigenanteil von 36.000 Euro hat sie zwei Jahre Zeit, ein Unternehmen für sich zu finden. In ihrem Büro arbeitet sie daran, in Vollzeit mit zwei Praktikanten. 540.000 Euro hat Stuhler zur Verfügung, nur um erst einmal ein Unternehmen zu finden. Entsprechend perfektionistisch geht sie die Suche an.
An der Wand in ihrem Büro hat Stuhler einen Phasenplan aufgeklebt, mit kleinen Etappenzielen wie »Positive Dating«, »Indicative Offer« oder »Jackpot!«. Sie sucht seit Januar, und zwar ein Unternehmen im deutschsprachigen Raum und eher eine Agentur als eine Schraubenfabrik. Etwa 1.500 Unternehmen hat sie nach eigenen Worten angeschrieben, etwa hundert Gespräche habe sie geführt. Nur für zehn Unternehmen entwickelte sie ein Angebot.
Zwei Jahre und eine halbe Million Euro: Man könnte das für pompös halten. Aber Sebastian Junge widerspricht: »Zwei Jahre sind sehr wenig Zeit«, sagt der Professor, der am Lehrstuhl für Unternehmensführung an der Uni Nürnberg zu Search-Funds forscht. »Die Searcher müssen den Fonds aufsetzen, viele Unternehmen anschreiben, sich mit vielen Unternehmen treffen und die Zahlen gründlich prüfen.« In 30 Prozent der Fälle scheitere die Suche sogar komplett.
Junge öffnet eine PowerPoint-Präsentation, in der er ein paar Zahlen zusammengetragen hat. Search-Funds fördern vor allem Jungtalente. Der durchschnittliche Searcher ist wie Lisa Stuhler 33 Jahre alt, kommt aus der Berater- oder der Finanzbranche, und gendern kann man sich fast sparen: 93 Pro-
32 %
der Mittelständler sehen im Kaufpreis und in den Zahlungsmodalitäten eine Hürde bei der Suche nach einem Nachfolger. Und ...
zent sind männlich. Laut Daten der spanischen IESE Business School gibt es inzwischen 20 Search-Funds in Deutschland. Weltweit sind es 1.000, davon zwei Drittel in den USA.
Gerade der deutsche Mittelstand sei für Search-Funds attraktiv, sagt Sebastian Junge: »Dort gibt es häufig noch Potenziale, den Betrieb digitaler und globaler aufzustellen.« Dazu komme: Viele Mittelständler seien skeptisch gegenüber Investoren, weil die nicht den Eindruck vermitteln würden, »den sozioemotionalen Wert des Unternehmens zu schätzen«, wie Junge es formuliert. Searcher wie Lisa Stuhler seien authentischer, sie könnten Investoren also die Tür öffnen. Inwieweit sich das für die Investoren lohnt, ist unklar: »Das Konzept ist in Europa noch zu jung und zu selten, um seriöse Aussagen über die Renditen zu treffen«, sagt Jürgen Rilling. Der 57-Jährige ist einer der ersten Search-Fund-Investoren in Europa, etwa 70 Suchen hat er finanziert.
In der kleinen Szene kennt man Jürgen Rilling. Wöchentlich bekommt er Anfragen, ob er eine Suche fördern wolle. Wie viel er tatsächlich investiert, will er nicht verraten. Rilling ist interessiert an Toptalenten. »Searcher müssen drei Eigenschaften mitbringen«, sagt er: »humble, smart, driven« –bescheiden, klug, zielstrebig. Er sieht sich selbst als Mentor für die jungen Unternehmer, das schätze er an dem Modell, über eine gute Rendite freue er sich aber auch. Dass SearchFunds das Nachfolgeproblem lösen können, glaubt Rilling nicht: »Sie sind ein Traum, aber nur für wenige.« Es gebe nicht genug geeignete Unternehmen und geeignete Searcher.
19 %
haben Schwierigkeiten, die Finanzierung einer Übernahme sicherzustellen. Das hat das Mittelstandspanel der Förderbank KfW ergeben
Zumindest bei Lisa Stuhler könnte es bald so weit sein. Sie hat eine Medienagentur gefunden. Wenn alles klappt, ist Stuhler bei Erscheinen dieses Artikels Unternehmerin. Das heißt – wenn sie die Investoren auch von dem Einstieg überzeugen kann. Stuhler stehen dann 20 Prozent der Anteile zu: ein Drittel davon am Anfang, eins nach fünf Jahren, eins, wenn sie Erfolge erzielt. Drei »Wachstumshebel« habe sie schon identifiziert, schreibt sie per Mail.
Und wenn es mit der Agentur nicht klappt? Dann sucht sie eben weiter. Alternativen gibt es ja reichlich.
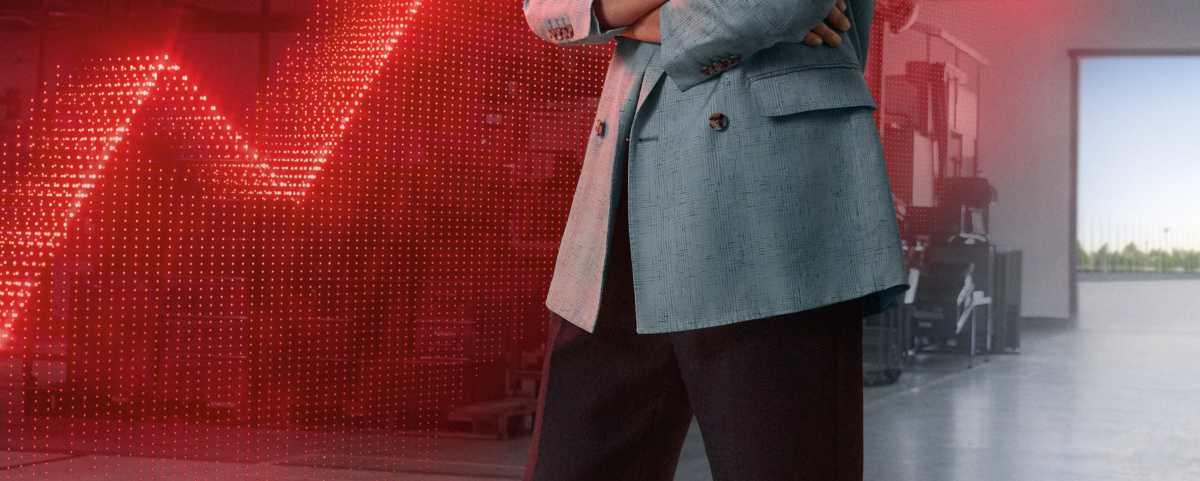


DieMärkteändern sich .I hr Un te rnehme n bleibt stark.
Mitder SparkasseanIhrer SeitesindSie fürkommende Herausforderungen bestensaufgestellt:jederzeit und überall. sparkasse.de/unternehmen
Weil’s um mehr alsGeldgeht.

Pulsnitz ist für Pfefferkuchen bekannt. Wer hätte gedacht, dass hier in einer alten Weberei ein erfolgreiches Finanzunternehmen sitzt?
Er vertickte Computer, betrieb Kneipen und machte in Immobilien. Heute führt Hans-Peter Weber eine Firma, die oft mitmischt, wenn man bargeldlos bezahlt. Unterwegs mit einem, der weiß, was man mit Geld anstellen kann
VON KATHI PREPPNER
Hans-Peter Weber, 59, lässt sich von Problemen grundsätzlich nicht abschrecken, von komplizierter Bürokratie ebenso wenig wie von gammeligen Gemäuern. Er steht im Innenhof seiner Firmenzentrale vor einer steinernen Bank, in deren Vorderseite römische Ziffern geritzt sind: gebaut im Jahr 1821. Dann deutet er auf das Gebäude, in dem sein Unternehmen heute sitzt. »Und das ist sogar noch ein paar Jahre älter.«
15 Jahre lang hat Weber die ehemalige Weberei im sächsischen Pulsnitz mit ihren gut 8.000 Quadratmetern saniert. Stück für Stück. Das alte Kontorhaus war denkmalgeschützt, da gab es viele Auflagen. Und dann war auch noch der Schwamm drin. Auch in den großen Fabrikgebäuden gab es viel zu tun. »Aber heute ist das alles vergessen«, sagt der Unternehmer. Heute sitzen die Sales-Channel-Manager und Marketing-Kollegen, die Produktmanager und die Pressesprecherin in dem einen dieser großen Gebäude mit den Rundbogenfenstern und den Säulen zwischen den Schreibtischen, in dem er auch eine Zeit lang gewohnt hat. Und Weber kann sich endlich um andere Baustellen kümmern.
Mit Secupay hat er vor 25 Jahren einen Zahlungsdienstleister gegründet, mit dem der CEO schon so manche regulatorische Hürde genommen hat. Denn immer, wenn es in Deutschland um Finanzen geht, gehört viel Bürokratie dazu. Da gibt es Bestimmungen gegen Geldwäsche, Berichtsund Wirtschaftsprüfer-Pflichten und immer wieder neue Regeln, mit denen Weber sich beschäftigen muss.
Secupay bietet Unternehmen und Behörden ein ganzes Spektrum an Zahlungsoptionen an: etwa den Stadiondeckel bei Borussia Dortmund, mit dem Fans bargeldlos zahlen können, die Bezahlkarte für Geflüchtete, die gerade in 14 Bundesländern eingeführt wird, oder die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Crowdfunding-Plattform Bettervest. Mehr als 42 Millionen Transaktionen mit einem Volumen von rund zwei Milliarden Euro führte das mittelständische Unternehmen 2024 für seine Kunden durch und machte damit knapp 19 Millionen Euro Umsatz. Begleitet man Weber einen Tag lang, dann merkt man: Er ist jemand, der weiß, was man mit Geld anstellen kann, damit es sich vermehrt.
Die Baustelle, um die sich Weber um zehn Uhr morgens an einem sonnigen Donnerstag kümmern muss, lautet: den Deal mit Cashlink weiter vorantreiben. Dafür wartet an einem Besprechungstisch im zweiten Stock bereits Tim Sauer auf seinen Chef. Er will ihm ein Update zu den Verhandlungen mit dem Finanzdienstleister geben. Das Unternehmen aus Frankfurt am Main macht Wertpapiere digital handelbar, indem es sie als sogenannte Token auf einer Blockchain abbildet, also auf einer Datenbank, die von einer Vielzahl von Rechnern gemeinsam verwaltet und fortgeschrieben wird. Die Technologie soll es Firmen ermöglichen, schneller Kapital aufzunehmen, und Anlegern, flexibler zu investieren. Weber hofft, als Zahlungsdienstleister mitzumischen und von einem wachsenden Markt zu profitieren.
Nur: Der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet. Sauer ruft seine Folien auf dem Bildschirm an der Wand auf. Zu sehen ist ein Schaubild. Es zeigt, wie der Deal laufen soll: Cashlink verwahrt Kryptowährungen für Kunden, Secupay führt die Steuern ans Finanzamt ab. Sauer reicht das nicht: »Es wäre gut, wenn wir auch Zahlstelle sein dürfen«, sagt er, also wenn die Beträge für Zins oder Tilgungszahlung direkt an Secupay fließen können und nicht ein weiterer Dienstleister involviert ist. »Schenk soll das für uns verhandeln«, entgegnet Weber und meint die Kanzlei, die Secupay in Steuerfragen berät. Denn die sind so komplex, dass Rechtsberatung notwendig ist. Dann widmet sich der Chef dem nächsten Thema. Weber ist einer, der Chancen erkennt und den Mut hat, sie zu ergreifen. In der DDR aufgewachsen, machte er zunächst eine Ausbildung zum Nähmaschinenmechaniker. Als Gesellenstück baute er eine Maschine von 1911 in einen Schleifautomaten um. Aber gleich nach der Wende fing Weber an, Computer aus dem Arbeitszimmer seines Vaters in der Dresdner Südvorstadt zu verkaufen. Weber Datentechnik nannte er sein Geschäft. Sobald er ein bisschen was eingenommen hatte, sei er erst einmal in den Urlaub gefahren, sagt Weber und lacht: »Damals war mir Work-LifeBalance noch wichtig.«
Bald konnte er einen Computer-Großhandel in der Äußeren Neustadt übernehmen. Dafür lieh Weber sich 200.000 D-Mark von einem Freund, weitere 200.000 Mark kamen von der Bank, seine

Mutter bürgte für ihn. Sich bei Freunden und Familie zu verschulden, ist riskant: Wenn so eine Wette nicht aufgeht, kann das Beziehungen zerstören. Doch Weber sagt, er habe die Schulden schnell zurückzahlen können. Schon bald habe er eine Million Mark Umsatz im Monat gemacht. Die Zeit nach der Wende war eben auch eine Phase, in der auf einmal viel möglich war: Es gab reichlich Leerstand, Menschen eröffneten Kneipen oder Discos, zum Teil illegal. Die Goldgräberstimmung habe damals auch ihn gepackt, sagt Weber. Er machte mehrere Kneipen auf, darunter das Café Europa, das es heute noch gibt.
Es folgte, was Weber seinen Hans-imGlück-Moment nennt: Er verkaufte das Computergeschäft und investierte in zwei Immobilien. »Die waren beide quasi wertlos«, erzählt Weber. »Aber so habe ich Sanieren und Bauen gelernt.« Und wie man Bürokratie bewältigt, schließlich gibt es auch beim Bauen so manche Auflagen. Das hilft ihm jetzt in der Finanzwelt, die sehr reguliert ist, um etwa Anleger und Sparerinnen vor windigen Anlageprodukten und Finanzinstitute vor Betrügern und Geldwäschern zu schützen. An diesem Vormittag beschäftigt ihn wieder einmal eine EU-Verordnung, der Digital Operational Resilience Act (Dora), der im Januar in Kraft getreten ist und die IT von Finanzinstituten widerstandsfähiger machen soll. »Wie das Lieferkettengesetz hoch hundert«, erklärt der Chef. Um die Vorgaben umzusetzen, hat Weber drei Personen in Vollzeit eingestellt. »Es macht einfach sehr viel
»Bürozwang
Das Homeoffice verbieten? Hans-Peter Weber, der Chef von Secupay, hält davon nicht viel. Solche Vorgaben zeigten, dass viele Unternehmen bei der Digitalisierung noch einen Weg vor sich hätten
Arbeit, wenn jeder eine Sicherheit dafür haben will, dass seine Entscheidung nicht angegriffen werden kann«, sagt Weber. So werde das Land langsam und unflexibel und außerdem »weniger spaßig«. Aber der Unternehmer will sich davon nicht entmutigen lassen. »Vielleicht bin ich zu optimistisch«, sagt er und grinst. »Gibt’s das?«
11.30 Uhr, Weber schaltet sich von seinem Büro aus ins nächste Meeting, weil zwei der drei Mitarbeiter im Homeoffice sind. Er hält überhaupt nichts von Anwesenheitspflicht im Büro oder Quoten fürs Homeoffice, dafür umso mehr von Freiheit und Flexibilität. Die knapp 100 Mitarbeitenden dürfen so oft von zu Hause aus arbeiten, wie sie möchten.
Auch für sich nimmt Weber das in Anspruch: An den meisten Wochentagen arbeitet er zu Hause in Dresden, im Sommer auch mal in der Loggia. »Das Schöne am Homeoffice ist, dass ich immer für die Familie da bin, wenn etwas ist«, sagt Weber. Zusammen haben er und seine Partnerin acht Kinder, sie leben als Patchworkfamilie. Vier Kinder sind schon aus dem Haus. Immer donnerstags zieht der Unternehmer morgens seine Fahrradmontur an und fährt die 28 Kilometer nach Pulsnitz.
Dort mischt er sich dann auch in die Details ein. Etwa als ihm drei Mitarbeiter an diesem Tag die Masken einer neuen Plattform vorstellen, auf der Nutzer sich für Secupay registrieren können. Die Farben gefallen ihm nicht, es ist noch zu viel Rot. Und die Angabe der E-Mail-Adresse solle kein Muss sein, findet Weber, »wir
wollen, dass viele durchkommen«. Die Kollegen schreiben mit, es bleiben einige To-dos. »Ich guck’s mir heute Abend an«, sagt der Chef, »über den Tag schaffe ich das nicht mehr.«
Was er immer schaffen will: donnerstags Mittagessen mit seinem Team. Weber sitzt dann zwischen seinen Leuten, er ist einer von ihnen. Bei denen scheint das anzukommen. Auf der Plattform Kununu bewerten die Beschäftigten Secupay relativ gut, ein ITler lobt die »herzliche Umgangsweise«, man duze sich »inklusive Chefetage«.
Nachmittags steht ein Meeting zum Markenauftritt in Webers Kalender. Man merkt: Weber, der sich eigentlich etwas mehr rausziehen will aus dem Operativen, mischt fast überall mit. Logo, Farben und Typografie sollen zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens aufgefrischt werden, dafür hat Secupay eine externe Agentur beauftragt. Seriosität und Sicherheit soll der neue Auftritt ausstrahlen – das ist Menschen wichtig, wenn es um ihr Geld geht. Weber ist noch nicht zufrieden, die richtige Farbkombination ist für ihn noch nicht dabei: »Ich glaube, da müssen wir noch mal ran.« Am Abend findet ein Sommerfest auf dem Gelände von Secupay statt. Als einer der Betriebsräte erzählt, dass sie sich an 141 Gesetze zu halten hätten, wird Weber nachdenklich. Er empfinde es als einen immensen Druck, so viele Regeln beachten zu müssen. Nach dem zweiten Grillwürstchen verabschiedet er sich, zieht sich die Fahrradkleidung an und radelt zurück nach Dresden. Er muss ja heute Abend noch arbeiten.


Ganzheitlich: Unsere Entrepreneur &E nterprise Beratung betrachtet Sie und Ih rU nternehmen al sE inheit und erarbeitet Lösunge nf ür Ih rp rivates un du nternehmerisches Ve rmögen.
Für ein effizientes Management Ihres Gesamtvermögens ist die vollständige Betrachtung aller Vermögenswerteunerlässlich. Daher unterstützt Sie ein Team aus Vermögens- und Firmenkundenberatern objektiv,umfassend und lösungsorientiert. Vielfältige Finanzdienstleistungen aus beiden Bereichen stehen Ihnen zur Verfügung
Mehr erfahre nS ie au fb ethmannbank-unternehmen.de Echt. Nachhaltig.Privat.


Ach, der zieht bestimmt vorbei

Hitzewellen, Fluten und Stürme werden häufiger und heftiger.
Der Klimawandel bedroht viele Unternehmen. Es gibt Angebote, um Firmen zu helfen – doch kaum eine nimmt sie wahr VON CAROLIN JACKERMEIER
Den eigenen Betrieb, der schon einmal überschwemmt wurde, vor den Folgen des Klimawandels schützen? Klingt naheliegend, aber der Unternehmer aus dem Rheinland ist entrüstet: Allein die Frage sei schwierig, schreibt er in einer Mail. Sie unterstelle, dass wirtschaftlich alles super laufe. Dabei kämpften viele Unternehmen gerade damit, überhaupt zu überleben. In Zeiten wie diesen stehe die Wirtschaft vorne! Nur wenn Zeit und Geld vorhanden seien, könne man sich um alles andere kümmern.
Die Antwort des Mannes, der hier nicht namentlich genannt werden soll, überrascht. Als vor vier Jahren die Ahr, die Inde, die Erft und andere Flüsse über die Ufer traten, stand auch sein Firmengelände unter Wasser, zehn Monate lang musste er sein
Firmengebäude sanieren. Mit Unterstützung einer Klimaberatungsstelle hat das Unternehmen daraufhin eine Starkregenberechnung in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Gebäude sind in der 3DSimulation von blauen Strömen umgeben, sie könnten bei extremem Regen wieder geflutet werden. Trotzdem findet der Chef: Unternehmen haben gerade größere Sorgen als das Klima. Darin spiegelt sich ein großes Missverständnis: Klimaresilienz hat weniger mit ökologischem Engagement zu tun als mit dem profanen Schutz der Existenzgrundlage. Bei der Flut im Ahrtal im Jahr 2021 entstand allein für die Wirtschaft ein Sachschaden von mehr als einer halben Milliarde Euro. Am schlimmsten traf es kleine Firmen. Die Flut zerstörte Gebäude, Maschi

„Wennein wichtigerKunde mal nicht zahlt, könnten wirimschlimmsten Fall in die Insolvenz gehen.“
Dirk Johannsen, Geschäftsführer Pillat Bau
Die schwierige Wirtschaftslage hat die Zahl derInsolvenzen in den vergangenenMonaten nach oben schnellen lassen.
Das Risiko vonForderungsausfällen wächst. Und das in einer Zeit, in der liquide Mittel wichtigerdenn je sind. Schließlich gilt es nicht nur aktuelle Projekte erfolgreich zu realisieren, sondernauchindie Zukunft zu investieren. Dazu brauchen Unternehmen finanziellen Freiraum.
Einen wichtigenBeitrag dazu leisten Bürgschaften, die dieKreditlinie nicht belasten, sowie ein wirksamer Schutz gegen Forderungsausfälle. Beide Instrumente sichern finanzielle Handlungsspielräumeund damitWiderstandsfähigkeit in herausfordernden Zeiten.
Als einer der größtendeutschen Kreditversicherer ist R+V hier Partner fürden Erfolg.
Jetzt mehr zumThema erfahren und das PraxisHandbuchResilienz kostenfrei runterladen: resilienz.ruv.de
Wirbetrachten auchIhrepersönliche Situation WE RT SCHÖPFUNGSKETTE

Wie sich der Klimawandel auf den Wohlstand auswirkt, hängt davon ab, wie stark er ausfällt – und wie gut wir uns anpassen. Die Grafik zeigt Berechnungen der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung für das Bundeswirtschaftsministerium aus dem Jahr 2022:
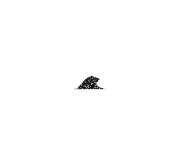
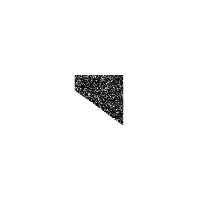


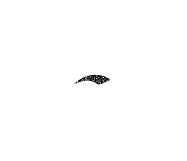
mittlerer
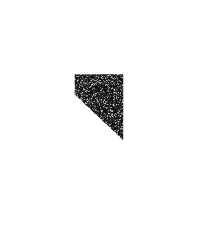




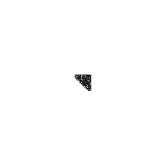
nen und Waren. Viele Betriebe haben wieder aufgemacht, andere aber mussten aufgeben, der Wiederaufbau der Region wird noch Jahre dauern. Die Kosten für klimabedingte Schäden haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt, rechnet auch eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group vor. Und: Bis 2050 könnten die Risiken des Klimawandels zwischen 5 und 25 Prozent der Unternehmensgewinne bedrohen. Sich vor Klimaextremen zu schützen, ist also auch wirtschaftlich mehr als sinnvoll.
Agenturen und Forschungseinrichtungen bieten sogar passende Beratungsprogramme für Firmen an, oft werden sie öffentlich gefördert. Das Problem: »Die Investitionsbereitschaft für Klimaanpassungsmaßnahmen steht bei vielen Unternehmen hintenan«, sagt Ulrich Eimer, Chef von Climaticon. Die Berliner Firma bietet Workshops und Austausch für kleine und mittelständische Unternehmen an, in denen sie lernen, wie sie ihre Firma und Mitarbeiter konkret vor den Folgen des Klimawandels schützen können. Mit dem Projekt »Klima Profit«, das vom
Veränderung des BIP in Milliarden Euro bis 2050
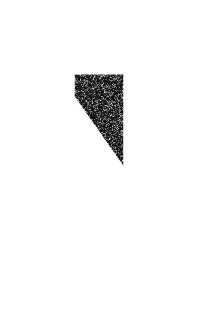

ohne Anpassung mit Anpassung
Land NRW kofinanziert wird, soll es die Betriebe »fit für den Klimawandel« machen. Das bedeutet zum Beispiel: Dächer begrünen für besseren Hitzeschutz, Versickerungsanlagen oder Schutzdämme gegen Fluten und Starkregen bauen, Windschutzhecken als Schutz vor Stürmen pflanzen. Und klar kostet das. Aber die Unternehmen müssen das nicht allein finanzieren: Das Land NRW bezuschusst solche Ausgaben mit bis zu 60 Prozent. Auch Kommunen fördern ortsansässige Unternehmen. Eimer und sein Team helfen sogar beim Ausfüllen der Förderanträge. Und doch: Aktuell lässt sich dazu kein Unternehmen von seiner Firma beraten.
»Oft führt erst die eigene Betroffenheit zu höherer Beratungsbereitschaft«, sagt der 57Jährige. Von den 14 Firmen, die bisher im Rahmen von Klima Profit beraten wurden, habe danach kaum eine Maßnahmen umgesetzt. Zwar ist die Beratung für die Unternehmen kostenlos, sie müssten danach aber in Vorkasse für die Dämme, Becken oder Begrünung gehen, ohne dass sich das unmittelbar auszahlt. Dabei finanzieren Förderbanken solche Vorhaben gerne.
Die bundeseigene Förderbank KfW etwa bietet für Klimaanpassungsmaßnahmen günstige Zinsen und Tilgungszuschüsse.
»Viele haben Angst vor noch mehr Bürokratie«, sagt Eimer. Für die Klimarisikoanalysen müssen die Firmen Zugang zu den Gebäuden gewähren, für die Förderanträge verschiedene Unterlagen einreichen, das schrecke viele ab. Auch eine aktuelle KPMG Studie in der Logistikbranche zeigt, dass drei von vier Unternehmen die steigenden Klimarisiken zwar wahrnehmen, aber eher als weitere regulatorische Auflage denn als Managementaufgabe betrachten.
Das Land NRW hat gerade neue Förderrichtlinien für die Beratung zur betrieblichen Klimaanpassung verabschiedet. Kommunen können die Beratung bei Klima Profit ab November beantragen, sobald mindestens fünf Firmen in ihrem Einzugsgebiet interessiert sind. Eimer hofft, dass so mehr Betriebe aktiv werden. Klimaanpassung bedeute viel mehr, als Gebäude zu sanieren: »Sie macht Unternehmen langfristig wettbewerbsfähiger und hilft dabei, Fachkräfte zu sichern.«
WirM enschenübersehen meistdie stillenLeistungsträger derNatur. Tagtäglich sind sieimEinsatz füruns ,ohnee szuwissenodergar zu berechnen. Würden siee stun:E sgehtumMilliarden-Euro-Summen
Spatzenfressen Körner vonden Felde rn .1 95 8wirdd ah er in Ch in ad er »S pa tz enk ri eg «a us geru fe n, ru nd zwei Milliarden der Vögelwerden getö te t. Wa sd ab ei üb er se he nw ir d: Sp at ze nm ögen vo ra ll em In se kten , di es ic hn un ve rm ehren .I me rs te n sp at ze nl os en So mm er fr es se n Sc hw är me vo nH eu sc hr ec ke nd ie Felder ratzekahlleer. VieleMenschen hungern–verhungernsogar DerK rieg gegendie Spatzenzeigt eind ring li ch ,wel ch eKon se qu enze n drohen ,wenn der Mensch willkürlich in ökologischeSysteme eingreif t. Wie komplexderen Wechselbeziehungen sind,wirdseltenrealisier t, daherwer-
DR EI
FR AG EN AN
?

©picturealliance/dpa
DR .ECK ARTVON
HI RSCH HAUS EN is tA rz t, Wi ss en schaft sjou rna li st un dG rü nd er der Stif tu ng Ge su nd eE rd e– Ge su nd e Me ns ch en .M it der Ka mp ag ne
»Echte Le is tu ng strä ge r« ze ig t er mitü berra sche nd en Fa kten , wieg ru nd le ge nd bi o lo gi sche r Ar te nreichtu mf ür di eW ir tschaft is t.
denauchdie wirtschaftlichen Auswirku ng en ig no ri er t. Wa skeine nP re is hat, scheintwer tlos zu sein .Warum sich also Gedanken machen?Nun ja: 80 Prozentd er wi chti gs te nKultu rpf la nz en si nd vo nt ie ri sc he nB estäubern wieBienen, Käfern ,Fledermäusen undNacht falternabhängig. Müsstendiese Leistungen maschinell erbracht werden ,würde dasweltweit ru nd 50 0M illiarde nD olla rkos te n–Jahr fürJahr
Si ch tb ar we rd en so lc he Ko st en er st,wenn dietie rische nH elfe rihre Le is tu ng en eb en ni ch te rb ri ng en Weil ihnendie Lebensräumegenommenwerden .Weilihn en mitPestizi-
de ne be nf alls zu ge setz twird. We il eing es ch le ppte Fein de sied ezimieren. Dabeiist gerade diebunte Fülle vonTierenund Pflanzender Garant fürFruchtbarkeit, Funk tionalität und Resilienz. Unddamit fürwir tschaf tlichen Er folg .Das zeigtsichneben der Bestäubung beim natürlichenP flanze ns ch ut z, be im In -S ch ac h- Ha lten vo nS ch äd li ng en un dn ic ht zu le tz t durchbessere Böden. DasZielmuss se in :m ehr Ar te nv ie lf al t. De rWeg dorthin: kleinere Strukturen ,weniger Pestizideund mehr Brachflächen. Damitdie Leistungsträgerweiterhin ihre Leis tung erbringen. Unbezahlt, aber unverzichtbar.

IM PR ES SU M: Verantwortlich fürden redaktionellen Inhalt: Zeitverlag Gerd BuceriusGmbH &Co. KG,Helmut-Schmidt-Haus, Speersort 1, 20095Hamburg Geschäftsführung: Dr.RainerEsser,IrisOstermaier Christian Röpkeund Nils vonder Kall Realisierung: Studio ZX GmbH –Ein Unternehmen der Zeitverlagsgruppe Geschäftsführung: IlianeWeiß, Dr.Mark Schiffhauer, Lars Niemann Projektmanagement: Stefanie Eggers Redaktion: Michael Prellberg Grafik: Jörg Maaßen Lektorat: Egbert Scheunemann Chief SalesOfficerZEIT Advise: Lars Niemann HeadofSales NPO: Christine Kühl,christine.kuehl@zeit.de Senior MediaConsultantNPO: Duda Zeco,duda. zeco@zeit.de Media ConsultantNPO: RosannaRomano, rosanna.romano@zeit.de Art Direction: DietkeSteck Produktmanagement: Elisabeth Becker Anzeigenpreise: Preisliste Nr.70vom 1. Januar 2025
We ri st fü rSie ei nech te r
Leis tu ng st räger?
DieInsek ten! Wassie allein für dieBestäubungleisten,wirdauf 500 Milliarden Dollar proJahr geschätzt. DieLeistungender Naturerscheinenuns wieselbstverständlich.Sindsie aber nicht. Jede dritte Insektenar tist akut bedroht. KeineDrohne, keineKI, kein Mensch kann das, waseine Bienekann. Wenn sieMindestlohn bekäme,würde einGlas Honig300.0 00 Euro kosten Siewid me ns icha ls Ar zt de r pl an et aren Gesu nd he it ,was he ißtd as?
WirallebrauchenLuf t, Wasser, essbareP flanzen underträgliche
Temperaturen.Unser menschliches Lebenund unsere Wirtschaft beruhenauf Grundlagen,die wir nichtherstellen, geschweige denn ersetzen können.Wir brauchen Ar tenreichtumauchals Innovationsmotor!Über50Prozent der Antibiotikaund Krebsmittelberuhenauf Er findungen derNatur Aufunserem Plakat istdie Eibe –ein Lebensretter undMilliardengeschäft in derChemotherapie. Ar tenreichtumsichert unsWir tschaftsleistung undGesundheit. Wiel äs st sich de rb ed ro hte Ar te nreich tu me rh al te n?
Wirerleben derzeitdas größte Ar tensterben seit denDinosauriern, dummer weisesindwir der
STIF TU NG GE SU ND EE RD E– GE SU ND EM EN SCHE N c/oP ub lixg Gm bH |H erma nn str. 90 |120 51 Be rlin
Te l. :+49 (0)1 62 97 17 25 3 ko nt ak t@ stif tung -g egm.de echte-leis tung strä ge r.de
Meteorit undder Dino gleichzeitig. AlsKindmussteich beilängerenAutofahrten dieScheibe putzen–das kennen Kinder heute nichtmehr. Dabeigibtesohne tropischeMückenauchkeine Schokolade!Meine Stif tung GesundeErde– GesundeMenschen hatzusammenmit renommiertenE xper tenfünfstrategische Empfehlungen formuliert.E s brauchtpolitischePriorität, Investment saus derWir tschaf t undprivatesKapital,umdie Juwelendes Ar tenreichtums jetzt zu schützen.Dafür brauchen wir nurein Prozentdes globalen BIP. Sollte unsein gutesLeben das nichtwer tsein?

Hier analysieren wir in jeder Ausgabe ein Unternehmen. In Folge 9 ist es der Hamburger Hafen, dessen Emissionen sich auf alle Mittelständler auswirken, die dort Waren verschiffen. Allerdings verschweigt der größte Terminalbetreiber einen wichtigen Wert
VON KRISTINA LÄSKER
Das Unternehmen:
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)
Direkter CO₂-Ausstoß, der sogenannte Scope 1: 55.334 Tonnen
Indirekter CO₂-Ausstoß aus eingekaufter Energie, Scope 2: 43.269 Tonnen
Indirekter CO₂-Ausstoß von Zulieferern, Dienstleistern und Kunden, Scope 3: keine Angabe
CO₂-Ausstoß Scope 1 und 2: 98.603 Tonnen
Quelle: Geschäftsbericht und Vergütungsbericht 2024
Klimaziele:

der Science-Based-Targets-Initiative bei der HHLA als erreicht, wenn 90 Prozent der eigenen Emissionen und aus dem Einkauf von Energie (Scope 1 und 2) auf null sind. Den Rest werde man kompensieren.
Was auffällt: Die HHLA möchte keine Angaben dazu machen, wie hoch ihr indirekter CO₂-Ausstoß ist, der bei Zulieferern, Dienstleistern und Kunden entsteht (Scope 3) – obwohl sie die nötigen Daten erhebt. Die gesetzlichen Vorgaben sähen keine Offenlegung vor, heißt es beim Unternehmen. Tilman Massa vom Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre hält das für »eine billige Ausrede«. Transparenz täte der HHLA gut, sagt er. Ansonsten sei sie schwer mit anderen vergleichbar. Tatsächlich entstehen bei Logistikkonzernen die meisten Emissionen bei Lieferanten und Kunden. Und wie nachhaltig die HHLA wirtschaftet, wirkt sich umgekehrt auf die Klimabilanz Tausender Mittelständler aus, die ihre Waren über den Hamburger Hafen verschiffen. Da könnte öffentlicher Druck also durchaus helfen.

Eigentümer und Produkte:

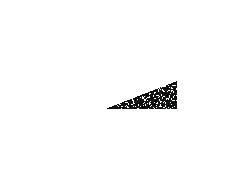
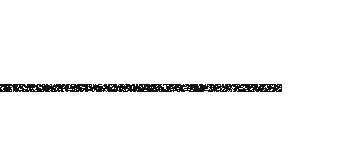
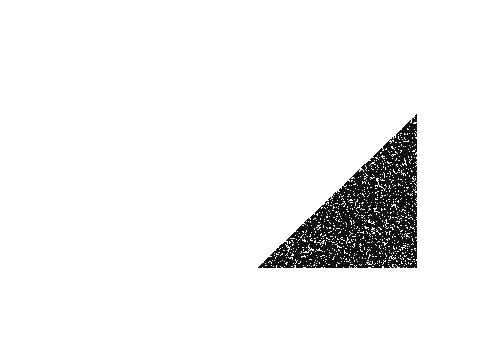
Bis 2030 möchte die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) die CO₂-Emissionen bei direkten Ausstößen (Scope 1) und indirekten Ausstößen (Scope 2) um mindestens 50 Prozent senken, verglichen mit 2018. Das Unternehmen sieht sich nach eigenen Angaben als »Wegbereiter für mehr Nachhaltigkeit« in der Logistikbranche und habe seine CO₂-Emissionen im Vergleich zum Ausgangswert 2018 bereits um 42 Prozent verringern können. Bis 2040 möchte die HHLA klimaneutral wirtschaften. Der Nachhaltigkeitschef Jan Hendrik Pietsch räumt zwar ein, dass es danach noch »nicht vermeidbare Emissionen« gebe – etwa solche, die auf nicht elektrifizierten Schienennetzen entstehen. Aber die Klimaneutralität gilt in Absprache mit
Die HHLA betreibt drei der vier Containerterminals in Hamburg und Terminals in Odessa, Tallinn und Triest. Das zweite große Standbein ist die Güterbahn-Tochter Metrans. Die HHLA gehörte seit ihrer Gründung im Jahr 1885 der Stadt, nach dem Börsengang 2007 sank deren Anteil auf 70 Prozent. Ein Fehler: Der Hafen verlor Marktanteile und die Stadt an Einfluss. Um den Hafen zu beleben, fädelte die rot-grüne Hamburger Regierung 2023 im Alleingang einen Teilverkauf der HHLA an die Schweizer Reederei MSC ein. Künftig soll Hamburg 50,1 Prozent halten und MSC den Rest. Für das Klima könnte das schlecht sein, meint der Aktionärsschützer Massa: »Bei MSC spielt Klimaschutz keine große Rolle.« Auch die HHLA engagiere sich nun womöglich weniger.




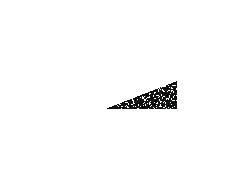

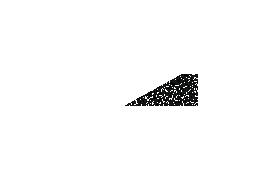
Der Konzern stand 2024 trotz Unsicherheiten im Welthandel ganz solide da: Der Umsatz kletterte um knapp elf Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen sprang um fast 23 Prozent auf 134 Millionen. Allerdings lag das auch an einmaligen Effekten: Weil Container wegen gestörter Lieferketten länger auf den Terminals lagen, bekam die HHLA mehr Lagergeld.
Was war der Anstoß für mehr Klimaschutz?
Die Initiative sei vom Vorstand gekommen, sagt der Nachhaltigkeitschef Pietsch. 2008 ließ das Gremium eine Klimabilanz und Maßnahmen entwickeln. Ziel: Energie und Kosten sparen und den Hafen als nachhaltig positionieren. Zunächst sollte der CO₂-Ausstoß pro Container bis 2020 um 30 Prozent sinken. Das gelang, und bis 2024 nahm er um etwa 60 Prozent ab. Den konkreten Wert verschweigt die HHLA aber. 2018 änderte sie die Ziele: Jetzt soll der absolute CO₂-Ausstoß sinken, unabhängig von der Zahl der Container. Das erschwert die Vergleichbarkeit.
Was schadet dem Klima am meisten?
Gut ein Drittel der Treibhausgase entsteht auf den Terminals. Die größten Klimasünder sind Portalhubwagen: Sie können umherfahren und mehrere Lagen hoch stapeln. Das Umladen der Boxen erledigen oft mobile Kräne mit Teleskoparm. Beide werden mit Diesel betrieben. Zudem entsteht CO₂ bei den Transporten der Bahntochter Me trans, etwa durch Diesel-Lokomotiven im Rangierbetrieb.

generelle Umstieg auf grünen Strom im Konzern, so geschehen 2024 an den Hamburger Standorten. Standorte wie Estland, Tschechien oder Ungarn sind noch nicht ganz umgestellt, betreiben aber Fotovoltaik-Anlagen.
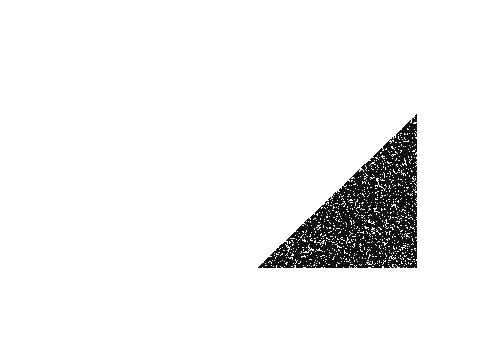
Entscheidend für mehr Klimaschutz ist die Elektrifizierung der Umschlagplätze in den Häfen. Das Terminal Altenwerder (CTA) ist seit 2022 vom TÜV Nord als klimaneutral zertifiziert, die Fahrzeuge dort fahren mit Ökostrom. Der Rest an unvermeidbaren Emissionen wird kompensiert durch Zertifikate für Windkraftprojekte in der Türkei. Am größten Terminal in Hamburg, dem Burchardkai, will die HHLA bis nächstes Jahr 116 Portalhubwagen durch E-Fahrzeuge ersetzen.
Was kostet es?
Investitionen: 2024 hat die HHLA etwa 275 Millionen
Was sind die wichtigsten Maßnahmen?
Die HHLA wolle Container-Transporte weiter vom Lkw auf die Schiene verlagern und Güterzüge öfter mit Ökostrom betreiben, sagt Pietsch. Ein großer Hebel ist der
zu 580 (!) Prozent erreicht. War die vielleicht zu niedrig?
Bürokratie-Wahnsinn: Die EU-Vorschriften zum Klima schutz seien sehr umfangreich und kleinteilig, sagt Pietsch. Der Aufwand zum Erheben der Daten sei enorm.
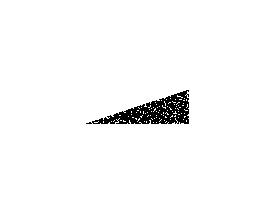

Wer nachts über den Hamburger Hafen fliegt, sieht dunkle Flächen. Das sind Lager, die nun per LED beleuchtet werden und nur bei Aktivität. Eine kleine Umstellung mit großer Wirkung fürs Klima, sagt Pietsch.



Anerkennung: Das Terminal Altenwerder erhielt 2022 den Sustainable Impact Award. Zudem war die HHLA 2023 Finalistin beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

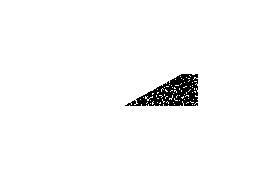

Weil die EU sie zwang, steckte eine Firma viel Mühe in ihren Nachhaltigkeits bericht. Plötzlich ist unklar, ob der noch gebraucht wird. Irre? Der Chef sieht es positiv
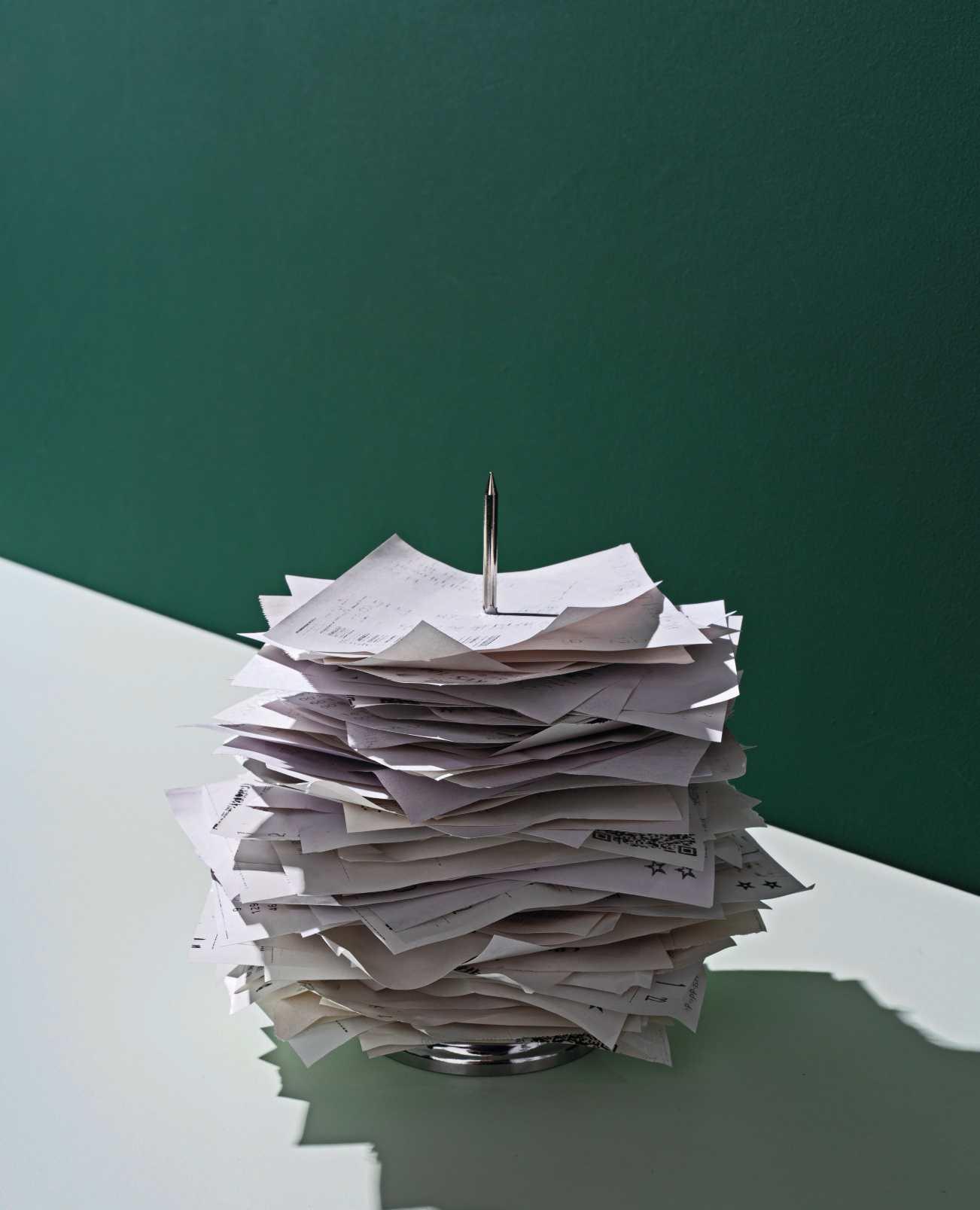
Die EU verfolgt hehre Ziele – und sorgt dabei oft für viel Bürokratie
Stefan Haibachs Welt veränderte sich an einem Mittwoch im Februar. Bis dahin war für ihn immer klar gewesen, dass er als Chef die richtige Entscheidung getroffen hatte, als es um das große Thema Nachhaltigkeit ging. Dass es richtig war, sein IT-Unternehmen voll auf die umfangreichen Berichtspflichten einzustellen, die von der EU kommen sollen. Dass es richtig war, Tausende Euro und viele Arbeitsstunden zu investieren.
Und lange Zeit sah das alles auch richtig aus. Unternehmen, die mindestens zwei der drei folgenden Bedingungen erfüllen, sollten 2026 einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen: Bilanzsumme über 25 Millionen Euro, Nettoumsatzerlöse über 50 Millionen Euro und mehr als 250 Mitarbeiter. Gut 50.000 Firmen hätte das in Deutschland betroffen. So wollte es die Europäische Kommission. Und weil so ein Bericht aufwendig ist, haben sich viele früh darauf vorbereitet.
Dann kam jener 26. Februar, und Valdis Dombrovskis, der für Handel zuständige EU-Kommissar, sagte die Revolution der Nachhaltigkeitsberichterstattung kurzerhand ab. Die Welt verschiebe sich gerade vor unseren Augen, sagte er. Und da verschiebt eben kurzerhand auch die EU ihre Pläne. Man müsse nun ein »wettbewerbsfähiges Europa« bauen, so Dombrovskis. Dann sprach er die alles verändernden Worte: »Wir haben heute vorgeschlagen, die Anwendung der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen, die noch nicht mit der Berichterstattung begonnen haben, zu verzögern, indem wir die Uhr anhalten.« Auf Englisch klingt
gerade der letzte Teil des Satzes eingängiger: »stop the clock«, also »alles auf Halt«.
Das Pausieren der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ist nur eine Maßnahme der EU-Kommission, um Firmen das Leben zu erleichtern. Sie bündelt gerade viele Maßnahmen in Rechtsakten, die als Paket beschlossen werden. Omnibus wird diese Vorgehensweise im Brüsseler Sprech genannt. So geht es im gleichen Atemzug auch um die europäische Lieferkettenrichtlinie. EU-Parlament und Europäischer Rat stimmten den Vorschlägen zum Pausieren der CSRD bereits zu. Es gibt zwei Lesarten für Dombrovskis’ Sätze. Zum einen verursacht so etwas Chaos, es ist so ziemlich das Gegenteil von verlässlicher Politik. Zum anderen aber empfanden viele die Auflagen ohnehin als zu umfangreich. Fest steht: Diejenigen, die sich mit der Umsetzung Zeit gelassen haben – oder zu faul waren –, können jetzt aufatmen. Sie müssen sich nicht mehr mit den Brüsseler Vorgaben rumärgern. Wie viele Firmen doch weiter berichten wollen oder einen Mittelweg suchen, ist schwer zu sagen. Viele Mittelständler halten sich zwar bedeckt, aber die Berater spüren schon, wie ihnen Aufträge wegbrechen. Kaum einer in Deutschland kann das so gut überblicken wie Alexander Kraemer. Er ist selbst Nachhaltigkeitsmanager und Mitgründer der Sustainability People Company, mit der er Firmen und Nachhaltigkeitsexperten zusammenbringen möchte. »Mein Telefon stand nach dem Omnibus-Vorschlag nicht
mehr still«, berichtet er. »Viele hatten Sorge, dass ihnen nun Mandate wegfallen.«
Und dann sind da Menschen wie Stefan Haibach, die doch eigentlich alles richtig gemacht haben. Klar, auch er hätte das Projekt seiner Firma komplett auf Eis legen können. Sie dürfte ohnehin nicht besonders umweltschädlich unterwegs sein. Die ITSG – deren voller Name Informationstechnische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung lautet – entwickelt und betreibt IT-Lösungen vor allem für ebendiese Krankenkassen. Die sind auch gleichzeitig Gesellschafter des Unternehmens. Meldet ein Arbeitgeber zum Beispiel seine Mitarbeiter krank, läuft das über die Schnittstellen der ITSG. Das Unternehmen erzeugt mit seiner Soft ware nach genauen rechtlichen Vorgaben auch die Versichertennummer auf der Karte von gesetzlich Krankenversicherten.
Das Projekt ganz abblasen wollten weder Haibach noch seine Nachhaltigkeitsbeauftragte Sabine Spremberg. Zu viel Zeit, zu viel Mühe hatte es schon gekostet. Zudem sieht Haibach einen wirtschaftlichen Nutzen: Wenn sich durch das Erheben von Nachhaltigkeitsdaten auch Einsparpotenziale finden lassen, dann lohne sich das auf jeden Fall, sagt der 56-Jährige in seinem Büro in Frankfurt.
Also entschieden sie vor zwei Monaten, weiterzumachen. Wenngleich auch etwas anders als vorher: Die ITSG macht weniger, dies dafür aber besser. Zwar berichtet sie weiter in den Kategorien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, doch hält sie
sich dabei an den deutlich kleineren VSMEStandard. Den hat die EU für all jene Mittelständler entwickelt, die eigentlich nicht berichten müssen, es aber freiwillig doch wollen; VSME steht für »Voluntary sustainability reporting standard for non-listed small and medium-sized entities«. Ein wichtiger Unterschied zu den opulenten und oft gehassten Standards der CSRD: »Wir brauchen nun nur noch 80 Datenpunkte statt 800«, sagt Spremberg.
Eine andere Pflicht aus der CSRD wollen Haibach und Spremberg aber beibehalten: die doppelte Wesentlichkeit. Die besagt, dass Firmen nicht nur beachten sollen, wie sich ihr Geschäft beispielsweise auf den Klimawandel auswirkt – sondern auch, wie sich der Klimawandel auf sie selbst auswirkt. Naturkatastrophen befürchten Haibach und Spremberg nicht, aber die Frage, wie attraktiv sie als Arbeitgeber sind, wollen sie nun stärker in den Blick nehmen.
ANZEIGE
Im Prinzip lässt sich das so zusammenfassen: Haibach macht mit der Berichterstattung so weiter, wie er sie für sinnvoll hält. Das kostet weniger Zeit und Nerven – und bringt bestenfalls brauchbare Ergebnisse.
Möglich ist das nur, weil Haibach und Spremberg das Ganze von Anfang an gut strukturiert haben. Statt blind draufloszulaufen, setzten sie sich vor anderthalb Jahren – damals noch im Glauben an die CSRD –mit Rüdiger Senft zusammen, einem externen Nachhaltigkeitsberater. Sie schauten, welche Nachhaltigkeitsthemen wesentlich für die ITSG sein könnten: Ist es der Stromverbrauch? Als eine Firma, die drei Rechenzentren nutzt, wäre das möglich. Wie steht es um die Diversität im Unternehmen, wie um die Mitarbeitergesundheit, was gilt es bei den Zulieferern zu beachten?
»Ohne externen Berater wäre das Projekt für uns erst mal nicht zu stemmen gewesen«, sagt Sabine Spremberg. Sie hat, typisch für
Seit mehr als30Jahrenzeichnet derInnovationswettbewerb TOP100 die innovativstenMittelständler Deutschlands aus.
Sie werden durchein unabhängiges, wissenschaftliches Benchmarking ermittelt und erhaltendas begehrte TOP100-Siegel –die Eintrittskarte zum Netzwerk derBesten.
einen Mittelständler, ohnehin noch zahlreiche weitere Aufgaben: Sie ist nicht nur Nachhaltigkeitsbeauftragte, sondern auch Gruppenleiterin »Zentrale Verwaltung« und unterstützt den Abteilungsleiter im Controlling. »Wir haben von anderen Firmen mitbekommen, dass sie direkt losgerannt sind und Daten eingesammelt haben. Das wollten wir unbedingt vermeiden«, berichtet Spremberg. Das ist es auch, was Senft all seinen Kunden rät: erst eine eigene Analyse machen, dann mit den Befragungen loslegen. »Alles andere führt nur zu langen Excellisten, überfordert die Befragten und bringt kaum Erkenntnisse«, sagt der 55-Jährige. Unter der Anleitung von Senft kontaktierte Spremberg verschiedene entscheidende Ansprechgruppen: die eigenen Mitarbeiter, einige Lieferanten und die Gesellschafter, die gleichzeitig auch Hauptauftraggeber sind. »Für mich war das alles Learning by Doing«, sagt sie heute.
HIER BEGINNT IHRVORSPRUNG: top100.de/infopaket
In einem Workshop mit Mitarbeitern diskutierte sie über Umweltschutz, soziale Aspekte, die Unternehmenskultur. »Da sind teilweise sehr interessante Vorschläge rausgekommen«, berichtet Spremberg. So prüft die ITSG gerade, ob eine Dachterrasse eingerichtet werden könnte. Einfach wird das nicht, denn direkt nebenan verläuft die Autobahn 661, und die Behörden machen Auflagen, damit nichts auf die Straße geweht werden kann. Auch ein Betriebskindergarten stand schon zur Diskussion. Sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, bringt eben neue Erkenntnisse über das eigene Unternehmen.
Fertig ist die Arbeit damit nicht. Bisher gibt es nur das Inhaltsverzeichnis als Gerüst für den eigenen Bericht. Einige Kapitel sind auch schon ausgefüllt, andere nicht. Auf Seite 23 findet sich ein Diagramm: Auf der waagerechten Achse geht es um die Relevanz für das Unternehmen, auf der senkrechten um die Relevanz für die Stake
ANZEIGE
holder. Biodiversität, Abfall und Umweltstandards identifizierten Spremberg und ihr Team so als unwesentlich, die Nutzung erneuerbarer Energien, ComplianceFragen und Arbeitgeberattraktivität aber zum Beispiel als relevant.
Nun geht es für Spremberg darum, immerhin 80 Datenpunkte einzusammeln, die hinter diesen Stichpunkten stecken. Wie sich zum Beispiel die Scope3Emissionen messen lassen, also jene entlang der Lieferkette, ist schwer zu sagen, das will sie erst im letzten Quartal des Jahres angehen. Kennzahlen zur Beschäftigung lassen sich leichter ermitteln. Und die Angabe, wie viele Schulungen ITSG machen wird, ist schon geklärt.
Es kann sein, dass sich für einzelne Fragen keine brauchbaren Daten finden lassen. Aber dann ist das eben so. Der Mehrwert für die ITSG liegt ohnehin erst mal woanders. »Man lernt bei alldem unfassbar viel über sein Unternehmen«, sagt Stefan Hai
bach. Da muss es längst nicht nur um Umweltfragen gehen. Was etwa brauchen Mitarbeiter, um zufrieden zu sein? »Der Fachkräftemangel im ITBereich ist groß«, sagt Haibach. »Wenn ich es da schaffe, Mitarbeiter langfristig zu halten, profitiert das Unternehmen.« Einen neuen Mitarbeiter zu rekrutieren und einzuarbeiten, koste Zeit und Geld. »Genau deshalb finde ich, dass sich ein Nachhaltigkeitsbericht unmittelbar auf die GewinnundVerlustRechnung auswirkt«, sagt Haibach.
Das ganze Projekt dürfte die ITSG am Ende um die 70.000 Euro kosten, schätzt der Chef. »Wenn es mir dadurch aber gelingt, jährlich fünf Prozent weniger Strom zu verbrauchen, dann hat sich das in vier bis fünf Jahren ausgezahlt.« Bei der ITSG also haben sie sich mit dem Hin und Her in Brüssel arrangiert. Sie sehen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung viel mehr als nur eine lästige Übung.

DieEvents fürRecruiting & Employer Branding:
27.& 28. November 2025| Köln 13.Mai 2026 | Stuttgart
21.Mai 2026 | Hamburg 03.Juni 2026 | München
25. Juni 2026| Frankfurt 02. Juli2026 | Berlin 26. &27. November 2026| Köln NEU
Sichtbar sein, bevor wichtig eS tellen unbesetzt
Viele mittelständische Unternehmenstehen heute vor einer zentralen Herausforderung: Sie haben attraktive Jobs, starke Werte und echtes Entwicklungspotenzial– aber dierichtigenTalente wissen nichts davon.
Der demografischeWandelist längst Realität. Mitden Baby-Boomern verabschiedetsich ein großerTeilerfahrener Fach- und Führungskräfte. Gleichzeitig rückt eine neue Generationnach, die
andere Maßstäbe fürArbeitgeber setzt.
Wieerreichen Unternehmen die richtigenTalente, bevores andere tun?
KarriereEvents bieten hier eine wirksame Plattform: Persönliche Begegnungen ersetzen digitaleFilterund zeigen im direkten Gespräch, welche Talente zum Unternehmen passen. Der AbsolventenkongressbietetUnternehmen die perfekte Plattform, um gezielt
Studierende, Absolvent:innen undYoung Professionals anzuwerben.
Seit über 30 Jahren bringt der Absolventenkongressals größte Karriere-Event-Reihe fürYoung Talents in Deutschland passende Matches zusammen.
Unternehmen,die an Karriere Events teilnehmen, stärken ihrEmployer Branding nachhaltig. Wer alsArbeitgeber präsentist,verankertsich
frühzeitig im Bewusstsein von Young Talents –lange bevor eine Bewerbunggeschrieben wird.

Jetztalle Event-Vorteile, Impressionen und mehr entdecken!
www.staufenbiel.de/b2b
Carl Martin Welcker stellt Drehspindel-Automaten für Fabriken in aller Welt her

Exportabhängige Firmen leiden besonders unter der Wirtschaftskrise. Zwei Unternehmen in Köln kämpfen ganz unterschiedlich gegen sie an. Kann man von ihnen etwas lernen?
VON LARS-THORBEN NIGGEHOFF
An den Poller Wiesen in Köln wirken die Sorgen um die Weltlage weit weg, am Rheinufer sitzen Menschen beisammen und chillen. Doch für die Krise muss man nur die Straßenseite wechseln. In einem Reformarchitekturbau residiert hier, in der Alfred-Schütte-Allee, das Unternehmen Alfred H. Schütte. Seit 1910 – und das merkt man schon im holzverkleideten Treppenhaus, durch das man zu Konferenzräumen im ersten Stock hinaufsteigt.
Dort empfängt Carl Martin Welcker, Urenkel des Firmengründers und Namensgebers und seit 1993 geschäftsführender Gesellschafter. »Ich habe so viele Krisen erlebt«, sagt der 65-Jährige, »aber bisher keine, die sich so lange gehalten hat.«
Diese Erfahrung teilen viele Unternehmer. Auf die Coronapandemie mit ihren Lockdowns und Lieferengpässen folgte der Angriff Russlands auf die Ukraine, der die Energiekrise auslöste, woraufhin erst die Preise stiegen und dann die Zinsen und die Löhne. Und seit Donald Trump Zölle ankündigt, aussetzt, verschiebt und verhängt, haben viele Firmen Absatzrückgänge erlitten. Die Unsicherheit hat enorm zugenommen, beobachtet Alexander Börsch. Der Chefvolkswirt der Unternehmensberatung Deloitte führt viele persönliche Gespräche mit Unternehmern: »Am meisten beschäftigen sie aktuell die geopolitischen Entwicklungen, also die strukturellen Herausforderungen zwischen den USA und China, aber auch die Folgen der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten«, sagt Börsch. Dazu kämen diverse Handelskonflikte und Sanktionen.
Besonders belastet: Deutschlands Maschinenbauer, die sehr exportorientiert sind. Für 2024 verzeichnete der Verband der Maschinenbauer VDMA einen Rückgang bei fast allen wichtigen Kennzahlen. Er berichtet von sinkenden Ausfuhren und Stellenabbau, die Branche stehe unter »erheblichem Druck«.
Eine Idee, wie man den Risiken all dieser Krisen vorbeugt, findet man auch im Reich von Carl Martin Welcker, der einer jener exportorientierten Maschinenbauer ist. Für eine andere muss man den Rhein nur ein paar Kilometer hochfahren.
Wer in Welckers Konferenzraum in Köln-Poll Platz nimmt, kann die Familienbande auf einem großen Stammbaum nachvollziehen, der dort an der Wand hängt. Der Unternehmer sagt, man sei quasi aus Tradition Technologieführer: »Wir bauen die Königin der Maschinen«, Konkret meint Welcker damit die Mehrspindel-Drehautomaten, die Schütte hier fertigt und in die ganze Welt verschickt. In anderen Fabriken fungieren sie als eine Art Mini-Fließband oder -Karussell: Jede Spindel hält ein Werkstück, das dann nach und nach mehrere Fertigungsschritte durchläuft. Gebraucht wird die Maschine vor allem für kleinere Teile,
37 %
der Unternehmen klagten im Sommer laut ifo Institut über zu wenig Aufträge. Im Maschinenbau waren es sogar 46 Prozent
also etwa Schrauben, Ventilkörper und Lagerringe.
Rund 100 Millionen Euro Umsatz macht Schütte damit zurzeit, 40 Prozent davon im Ausland. Und laut seiner letzten veröffentlichten Bilanz erzielte es noch 2023 einen Gewinn nach Steuern von fünf Millionen Euro. Im Geschäftsbericht stellte das Unternehmen allerdings schon damals fest, dass der Auftragseingang »schwächelte« und von 103 auf 63 Millionen Euro gesunken sei. »Wegen des ordentlichen Auftragsbestandes« habe das dem Unternehmen und seinen 600 Mitarbeitern aber nichts anhaben können.
Nicht nur von diesem Puffer profitiert das Unternehmen. Es hat auch einen Vorsprung, auf dem es sich allerdings nicht ausruhen kann. Denn Schütte ist nicht
die einzige Firma auf der Welt, die Mehrspindel-Drehautomaten baut, sieht sich aber weit vorne. »Unsere Maschinen sind schneller und genauer als die der Konkurrenz«, sagt Welcker. Das lässt sich Schütte vergüten, die Geräte sind teurer als die anderer Hersteller.
Dazu kommt: Die Maschinen sind nur für Kunden interessant, die Präzisionsteile in hoher Stückzahl herstellen – und von diesen Firmen gibt es nicht so viele. Die genaue Zahl der Automaten, die das Werk in Köln-Poll verlassen, verrät Schütte nicht, mehr als 100 im Jahr sind es aber wohl nicht. Und wer bereits eine siebenstellige Summe für eine Maschine zahlt, der stört sich im Zweifel auch nicht an Aufpreisen von mehreren Zehntausend oder gar Hunderttausend Euro.
Einfach kopieren lässt sich das SchütteModell also nicht: »Am Anfang steht meistens eine geniale Erfindung, die kann man nun mal nicht erzwingen«, sagt der Unternehmer Welcker. Aber es gebe Wege, dafür zu sorgen, dass die eigene Firma nicht zurückfalle. »Die Mitarbeiter müssen Freiraum bekommen, und jeder Teilbereich muss genau im Auge behalten, was gerade aktuell ist.« Bei Materialien, Produktionsverfahren, Steuerungssoft ware gebe es ständig Innovationen. Diese müsse man finden, verstehen und dann zügig ins eigene Produkt einarbeiten, damit man nicht überholt werde. Das kostet natürlich Geld: Laut Geschäftsbericht hat Schütte im Jahr 2023 rund eine Million Euro investiert. Und man muss als Chef schon mal dem Rat seiner Mitarbeiter folgen, die mitunter mehr Ahnung haben. Ein Konstruktionsleiter habe in einem Jahr mal 40.000 verschiedene Artikel ins Sortiment aufgenommen, »das fand ich irre«, erinnert sich Welcker. »Aber er sagte: Herr Welcker, wenn wir immer weiter die gleichen Teile einbauen und nichts Neues probieren, sind die Kunden weg.«
Die herausgehobene Stellung hat für Schütte aber einen unschönen Nebeneffekt: Das Unternehmen muss sich mit Ausfuhrbeschränkungen auseinandersetzen. Der Deloitte-Ökonom Alexander Börsch kennt das Problem: »Technologisch
führend zu sein, ist zwar gut und macht einen resilienter gegenüber geopolitischen Schwankungen«, sagt er. Allerdings stünden insbesondere im Hightech-Bereich Investitionen und der Handel unter stärkerer politischer Beobachtung. Im Verhältnis zu China ist das seit Jahren ein Thema, auch deutsche Firmen dürfen nicht alles nach Belieben ausführen. Das betrifft vor allem sogenannte Dual-UseGüter, die sowohl militärisch als auch zivil einsetzbar sind. Dazu zählen auch Werkzeugmaschinen mit hoher Präzision, wie sie Schütte unter anderem produziert.
Schütte muss deswegen immer wieder Anträge beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle stellen, wenn es in bestimmte Länder exportieren möchte – etwa nach China, aber auch in andere wichtige Märkte wie die Türkei, Indien oder Südamerika. Auch wenn die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hat, Ausfuhrgenehmigungsprozesse zu »vereinfachen und beschleunigen«, dauere die Bearbeitung dieser Anträge manchmal Monate, sagt Firmenchef Welcker. Die damit einhergehende Unsicherheit akzeptierten nicht alle Kunden: »Statt zu warten, nehmen sie dann eben das zweitbeste Produkt, das dafür dann sofort kommt.« Die beste Technologie zu bieten, hilft also – aber es reicht nicht unbedingt.
Eine andere Strategie hat die Firma Igus. Das Gelände des Unternehmens liegt 20 Minuten rheinaufwärts in KölnLind. Bevor man den Haupteingang erreicht, passiert man Hallen der Firma, gut zu erkennen an den markanten gelben Bauelementen, die Igus verbaut. Das Unternehmen stellt dort Kunststoffgleitlager und Energieführungsketten her. Die Gleitlager findet man in Maschinen und Fahrzeugen, wo sie meist zwei Bauteile miteinander verbinden, die sich dann gleitend bewegen. Energieführungsketten wiederum schützen Leitungen und Schläuche, die sich mit Maschinenteilen bewegen, und verhindern so Kabelbrüche.
Diese Produkte sind weltweit nachgefragt, erklärt Artur Peplinski. »Als ich hier 1997 anfing, waren wir in sieben Ländern mit eigenen Filialen präsent, heute sind es
37«, sagt der Igus-Geschäftsführer. Die Internationalisierung zahlt sich aus, der Umsatz stieg in den vergangenen 30 Jahren von etwa 48 Millionen auf eine Milliarde Euro, davon erwirtschaftet Igus circa 56 Prozent im nichteuropäischen Ausland. Die Anzahl der Mitarbeiter wuchs auf über 5.000. Und trotz der aktuellen Polykrise investiert Igus weiter: Die Zentrale in Köln hat es jüngst erweitert, in neue und bestehende internationale Standorte von den USA bis Japan flossen von 2020 bis 2024 rund 450 Millionen Euro. Igus setzt auf einen Weg, der Unternehmen in Zeiten von Zollkonflikten ebenfalls helfen kann: Das Unternehmen
3,9 %
weniger als im ersten Halbjahr 2024 haben deutsche Firmen von Januar bis Juni 2025 in die USA exportiert. Die Ausfuhr von Maschinen sank um 7,9 Prozent
sucht permanent nach neuen Märkten, um nicht zu abhängig von einzelnen Ländern und deren mitunter unberechenbaren Politikern zu werden.
Alexander Börsch von Deloitte hält Diversifizierung für eine gute Taktik und beobachtet, dass sich die Prioritäten dabei verschieben. »Nach der Finanzkrise gab es ein Jahrzehnt lang eine große Welle Richtung China, die ist zunehmend abgeflacht«, sagt er. In der jüngeren Vergangenheit seien die Vereinigten Staaten für die deutsche Exportwirtschaft immer wichtiger geworden. Nun stünden zunehmend asiatische Märkte im Fokus: »Indien, Indonesien, Vietnam, aber auch Japan und Südkorea sind die Märkte, für die wir das größte Exportwachstum in den kommenden zehn Jahren prognostizieren.«
Bei der Expansion ins Ausland kann allerdings vieles schiefgehen, wie Artur Peplinski von Igus aus Erfahrung weiß, selbst in nahe gelegenen Staaten können sich die Regeln, die Kultur, die Bedingungen sehr von den hiesigen unterscheiden. »Als wir vor rund 20 Jahren den Schritt nach Schweden wagten, haben wir die kulturellen Unterschiede völlig unterschätzt«, sagt der Firmenchef. Überstunden etwa seien in Schweden kaum gemacht worden, und die Arbeitszeiten, die Peplinski von seinen Mitarbeitern in Deutschland gewohnt war und nun von denen in Schweden erwartete, seien auf völliges Unverständnis gestoßen. »Das war eine harte Lektion, die wir lernen mussten«, sagt Peplinski.
Als Konsequenz stellt Igus stets nur lokale Kräfte ein und entsendet selten deutsche Manager an die internationalen Standorte. Vor Ort agieren sie dann als eine Art Pfadfinder, die die örtlichen Besonderheiten auskundschaften. Wie gut das funktioniert, merkt Peplinski in Indien. Das Land finden viele deutsche Unternehmen gerade interessant: Laut einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der DeutschIndischen Handelskammer aus dem Juni planen acht von zehn deutschen Unternehmen bis 2030 Investitionen in Indien als Reaktion auf geopolitische Spannungen. Das sei ein neuer Höchstwert.
Während manche Firmen sich in Indien allerdings schwertun, vermeldet Igus im bevölkerungsreichsten Land der Welt zweistellige Wachstumsraten und baut den Standort aus. So hat man die Produktionsfläche in Bangalore durch einen neuen, 16.000 Quadratmeter großen Campus verdreifacht, Berichten zufolge für zwölf Millionen Euro. Dabei passt sich das Unternehmen an die Bedingungen vor Ort an: Igus mietet Bauland, Kaufen sei aufgrund unklarer Besitzansprüche und fehlender Katasterdaten »ein zeitraubender Albtraum«, sagt Peplinski. Aber solche Albträume sind wohl das kleinere Übel, wenn die geopolitische Großlage einen ohnehin nicht gut schlafen lässt.







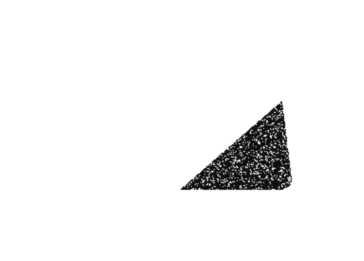



Manchmal müssen Sie den Schmerz umarmen. Das finden zumindest Gabriela Kieser und ihr Nachfolger Michael Antonopoulos, die mit ihrer Fitnesskette darauf setzen, dass man sich beim Training anstrengt (S. 26). Um Ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, rät Sigurd Schacht, Professor für Angewandte KI, zu Experimenten mit der Technologie. Er hat auch gleich ein paar Hausaufgaben für Sie (S. 6). Und: Warum es sich lohnen könnte, jetzt in Internationalisierung zu investieren, um heil durch die geopolitischen Krisen zu kommen, lesen Sie ab Seite 62.
Gibt es bei Ihnen eine Anwesenheitspflicht im Büro? Der Fintech-Chef Hans-Peter Weber aus Pulsnitz ist überzeugt, dass Sie darauf verzichten und lieber auf Digitalisierung setzen sollten, um die Mitarbeiter zu Bestleistungen zu motivieren (S. 48). Sie wollen den Nachhaltigkeitsbericht zu den Akten legen, weil die EU Sie plötzlich nicht mehr in die Pflicht nimmt? Halt! Der IT-Unternehmer Stefan Haibach kann Ihnen den wirtschaftlichen Nutzen erklären, den ihm die Brüsseler Bürokratie eingebracht hat (S. 58).





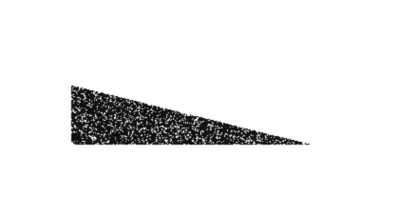


Papierkram bleibt lästig, keine Frage. Aber wenn Sie Fördergelder brauchen, um Ihr Unternehmen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen, gibt es Menschen, die Ihnen beim Ausfüllen der Anträge behilflich sind (S. 52). Und wenn Sie noch mehr Manpower benötigen, etwa bei der Produktentwicklung, dann halten Sie es doch wie Jochen Müller. Der Möbelbauer arbeitet ausschließlich mit freien Designern zusammen (S. 38). Zugegeben: Manchmal können einem nur noch höhere Mächte weiterhelfen. Wieso es Drohnen braucht, um Rehkitze zu retten, lesen Sie auf Seite 32.
Herausgeber: Dr. Uwe Jean Heuser Chefredakteur: Jens Tönnesmann Art-Direktion: Haika Hinze Redaktion: Nele Justus Autoren: Carolyn Braun, Carolin Jackermeier, Kristina Läsker, Jakob von Lindern, Lars-Thorben Niggehoff, Kathi Preppner, Navina Reus, Markus Rohwetter, Jan Schulte, Jens Többen Gestaltung: Christoph Lehner Bildredaktion: Amélie Schneider (verantwortlich), Navina Reus Redaktionsassistenz: Andrea Capita, Katrin Ullmann Chef vom Dienst: Dorothée Stöbener (verantwortlich), Imke Kromer, Mark Spörrle Textchef: Johannes Gernert (verantwortlich), Anant Agarwala, Anita Blasberg, Dr. Christof Siemes Infografik: Pia Bublies (frei) Korrektorat: Thomas Worthmann (verantwortlich), Oliver Voß (stv.) Dokumentation: Mirjam Zimmer (verantwortlich) CPO Magazines & New Business: Sandra Kreft Director Magazines: Malte Winter Vertrieb: Sarah Reinbacher Marketing: Elke Deleker Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen: Silvie Rundel Herstellung: Torsten Bastian (Ltg.), Oliver Nagel (stv.) Anzeigen: ZEIT Advise, www.advise.zeit.de Anzeigenpreise: Es gilt die ZEIT-für-Unternehmer-Anzeigenpreisliste Nr. 3 vom 1. Januar 2025
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg Anschrift Verlag und Redaktion: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg; Tel.: 040/32 80-0, Fax: 040/32 71 11; E-Mail: DieZeit@zeit.de Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: produktsicherheit@zeit.de
1 3 / 1 1 / 2 0 2 5 B o l l e Fe s ts ä l e , B e r l i n
Vonder neuen Rolle unsereswirtschaftlichen Wertesystems über die Zukunft von Nachhaltigkeit, Diversität undFührung bis zum menschendienlichenEinsatz von KI: Entdeckedie Themen undKöpfe, die man heute im Blick haben sollte,um dasMorgen zu gestalten. Sei dabeiam13. November in Berlin. Wirfreuen unsauf dich!
Unter anderem auf unserer Bühne:




J e n s L ö h m a r
Chief Technology Officer Continental Europe &DACH, workday

D r A l ex a n d r a K r o n e
Geschäftsführerin, GAMOMATDevelopment




J a ko b S c h ö f fe l
Chief Executive Officer, Schöffel GmbH &Co. KG


C h r i s t i a n F r i e d r i c h
Geschäftsführer Digital Learning Solutions, Haufe Akademie

S te f f i H e i n i c ke
Senior Vice President Guest Experience, AIDA




P r o f. D r. F r e d e r i k S c hw e r te r
Associate Professor für Mikroökonomie, Frankfurt School of Finance & Management
J e t z t T i c ke t s i c h e r n !




J e n s Vo g t
Lead Partner,Leadership Advisory, Heidrick &Struggles




Ta n j a M e r k l
Fregattenkapitän, Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr




A n to n i o P a y a n o
Leiter Talent Impact der Bayer AG, Bayer AG

b 1 . d e / w o r k- aw e s o m e
Rechnungbezahlt.
Belege gescannt und schonverbucht.
MitLexware.