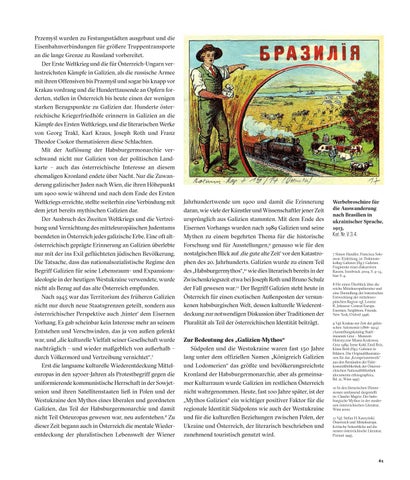Kat_Gal_Kern_1bis255_Layout 1 09.03.15 14:29 Seite 61
Przemyśl wurden zu Festungsstädten ausgebaut und die Eisenbahnverbindungen für größere Truppentransporte an die lange Grenze zu Russland vorbereitet. Der Erste Weltkrieg und die für Österreich-Ungarn verlustreichsten Kämpfe in Galizien, als die russische Armee mit ihren Offensiven bis Przemyśl und sogar bis knapp vor Krakau vordrang und die Hunderttausende an Opfern forderten, stellen in Österreich bis heute einen der wenigen starken Bezugspunkte zu Galizien dar. Hunderte österreichische Kriegerfriedhöfe erinnern in Galizien an die Kämpfe des Ersten Weltkriegs, und die literarischen Werke von Georg Trakl, Karl Kraus, Joseph Roth und Franz Theodor Csokor thematisieren diese Schlachten. Mit der Auflösung der Habsburgermonarchie verschwand nicht nur Galizien von der politischen Landkarte – auch das österreichische Interesse an diesem ehemaligen Kronland endete über Nacht. Nur die Zuwanderung galizischer Juden nach Wien, die ihren Höhepunkt um 1900 sowie während und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erreichte, stellte weiterhin eine Verbindung mit dem jetzt bereits mythischen Galizien dar. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die Vertreibung und Vernichtung des mitteleuropäischen Judentums beendeten in Österreich jedes galizische Erbe. Eine oft altösterreichisch geprägte Erinnerung an Galizien überlebte nur mit der ins Exil geflüchteten jüdischen Bevölkerung. Die Tatsache, dass das nationalsozialistische Regime den Begriff Galizien für seine Lebensraum- und Expansionsideologie in der heutigen Westukraine verwendete, wurde nicht als Bezug auf das alte Österreich empfunden. Nach 1945 war das Territorium des früheren Galizien nicht nur durch neue Staatsgrenzen geteilt, sondern aus österreichischer Perspektive auch ,hinter‘ dem Eisernen Vorhang. Es gab scheinbar kein Interesse mehr an seinem Entstehen und Verschwinden, das ja von außen gelenkt war, und „die kulturelle Vielfalt seiner Gesellschaft wurde nachträglich – und wieder maßgeblich von außerhalb – durch Völkermord und Vertreibung vernichtet“.7 Erst die langsame kulturelle Wiederentdeckung Mitteleuropas in den 1970er-Jahren als Protestbegriff gegen die uniformierende kommunistische Herrschaft in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten ließ in Polen und der Westukraine den Mythos eines liberalen und geordneten Galizien, das Teil der Habsburgermonarchie und damit nicht Teil Osteuropas gewesen war, neu auferstehen.8 Zu dieser Zeit begann auch in Österreich die mentale Wiederentdeckung der pluralistischen Lebenswelt der Wiener
Jahrhundertwende um 1900 und damit die Erinnerung daran, wie viele der Künstler und Wissenschaftler jener Zeit ursprünglich aus Galizien stammten. Mit dem Ende des Eisernen Vorhangs wurden nach 1989 Galizien und seine Mythen zu einem begehrten Thema für die historische Forschung und für Ausstellungen,9 genauso wie für den nostalgischen Blick auf ,die gute alte Zeit‘ vor den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Galizien wurde zu einem Teil des „Habsburgermythos“,10 wie dies literarisch bereits in der Zwischenkriegszeit etwa bei Joseph Roth und Bruno Schulz der Fall gewesen war.11 Der Begriff Galizien steht heute in Österreich für einen exotischen Außenposten der versunkenen habsburgischen Welt, dessen kulturelle Wiederentdeckung zur notwendigen Diskussion über Traditionen der Pluralität als Teil der österreichischen Identität beiträgt. Zur Bedeutung des „Galizien-Mythos“ Südpolen und die Westukraine waren fast 150 Jahre lang unter dem offiziellen Namen „Königreich Galizien und Lodomerien“ das größte und bevölkerungsreichste Kronland der Habsburgermonarchie, aber als gemeinsamer Kulturraum wurde Galizien im restlichen Österreich nicht wahrgenommen. Heute, fast 100 Jahre später, ist der „Mythos Galizien“ ein wichtiger positiver Faktor für die regionale Identität Südpolens wie auch der Westukraine und für die kulturellen Beziehungen zwischen Polen, der Ukraine und Österreich, der literarisch beschrieben und zunehmend touristisch genutzt wird.
Werbebroschüre für die auswanderung nach Brasilien in ukrainischer sprache, 1913, Kat. Nr. V.3.4.
7 Simon Handler, Francisca Solomon: Einleitung, in: Doktoratskolleg Galizien (Hg.): Galizien. Fragmente eines diskursiven Raums, Innsbruck 2009, S. 9-14, hier S. 9. 8 Für einen Überblick über die reiche Mitteleuropaliteratur und eine Darstellung der historischen Entwicklung der mitteleuropäischen Region vgl. Lonnie R. Johnson: Central Europe. Enemies, Neighbors, Friends, New York/Oxford 1996. 9 Vgl. Krakau zur Zeit der galizischen Autonomie (1866–1914) (Ausstellungskatalog Stadtmuseum Graz – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Graz 1989; Irene Kohl, Emil Brix, Klaus Beitl (Hg.): Galizien in Bildern. Die Originalillustrationen für das „Kronprinzenwerk“ aus den Beständen der Fideikommißbibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek (documenta ethnographica, Bd. 2), Wien 1997. 10 In den literarischen Dimensionen umfassend dargestellt in: Claudio Magris: Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur, Wien 2000. 11 Vgl. Stefan H. Kaszyński: Österreich und Mitteleuropa. Kritische Seitenblicke auf die neuere österreichische Literatur, Poznań 1995.
61