

Hotelier e




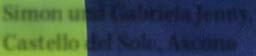

Sie führten das

Sonnenschloss in eine goldene Zukunft

Politisches
Historisches Hotels im Krieg



Booking: Aus für die Knebelverträge
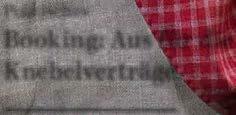
Simon und Gabriela Jenny, Castello del Sole, Ascona
















Ihr Hotelbäcker.


Da greift man gerne zu: Mit viel Leidenschaft und Bäckerstolz produzieren wir als eigenständiges Schweizer Familienunternehmen ein breites Sortiment tiefgekühlter Feinbackwaren sowie Konditoreiprodukte und beliefern damit die ganze Schweiz. So können Sie Ihre Gäste jederzeit verwöhnen.


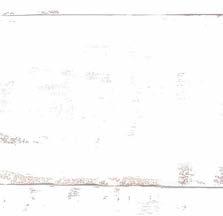


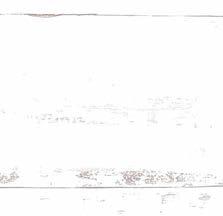
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf romers.swiss oder Ihren Anruf unter 055 293 36 36.



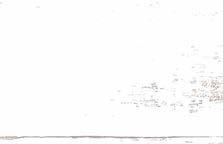



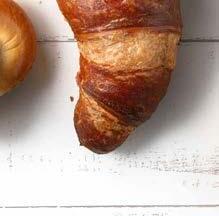




Hotel-Mobile
Ein Hauch, ein Schlag, eine Erschütterung, ein achtloses Vorbeigehen, ein bewusstes Anstossen – und das Mobile bewegt sich. Sanft oder turbulent. Kaum wahrnehmbar, oder es droht auseinanderzureissen. Dann dauert es eine gewisse Zeit, bis es wieder in der Balance ist.
Balanciert sein bedeutet nicht Ruhe. Im Gegenteil, es ist höchste und permanente Präsenz, dauernde Bewegung und Anstrengung. Balance ist immer nur vorläu g und eher nur für kurze als für lange Zeit erreichbar. Die nächste «Störung» kommt bestimmt, ja, sie ist immer schon im Anzug.
Das Mobile eignet sich als Modell für ein Hotel ebenso wie für das Redaktionskonzept unseres Fachmagazins. Ja, es scheint mir das beste Konzept für ein lebensnahes, lebendiges Magazin zu sein. Ein Konzept «wie das wirkliche Leben» im und ums Hotel herum.
«Hotelier»:«Hotelière»1 stellt das Hotel-Mobile in all seinen Facetten dar. Wird ein Mobile-Element oder das ganze Mobile-System irgendwie in Schwingung versetzt, gilt es, diese Bewegung im Magazin wahrzunehmen, aufzugreifen und zu begleiten. Dabei soll das komplexe, komplizierte, feine, wirtschaftliche, freizeitliche, genüssliche, anstrengende, politische, ästhetische, durch und durch menschliche Konstrukt, dieser einzigartige Hotel-Kosmos, publizistisch balanciert daherkommen.

Das Ausgewogensein einer Zeitschrift – wie beim Mobile – ist nur über die Zeit möglich; nicht in jedem Artikel, nicht in jeder Heftausgabe. Erreicht wird die vorläu ge Balance der verschiedensten selbst- und fremdbestimmten Mobile-Elemente durch kreatives, kritisch-konstruktives Zusammenwirken verschiedenster Personen, Ideen, Absichten oder Interessen der Leserschaft und der Inserenten.
Garantien gibt es dafür nicht. Aber ein Versprechen will ich hier abgeben. Unsere Zeitschrift «Hotelier»: «Hotelière» – dafür werden wir uns anstrengen – soll immer wieder überraschen, «zufällig» sein, (un-)berechenbar, auch bildend, genussvoll, träumerisch, innovativ und vieles mehr sein. Einzig langweilig darf das Magazin nie sein. Nehmen Sie uns beim Wort.

Dr. Hilmar Gernet Chefredaktor






Mittendrin: Politisches
58 Knebelverträge
64 Nicolo Paganini
70 Mediensteuer
72 Frontex
Inspirieren: Historisches
74 Hotels im Krieg
88 Interview Andreas Züllig
Sich anstrengen: Bildendes
94 Hotelfachschule Luzern 96 Hoteliers
Ausgezeichnetes
99 Hundehotel
Vereinigung Diplomierter Hoteliers VDH
100 O zielle
Verbandsmitteilungen



Sommelier Verband Schweiz SVS
Marktliches Auf den SchlussPunkt gebracht
Fragen von Karl Wild

Willkommen im Paradies: Zufahrt zum Ferienschloss der Superlative.


«Wir
gerieten damals in eine andere Welt»
Sie waren im vergleichsweise bescheidenen Hotel Hof Maran in Arosa, als sie vor 20 Jahren völlig überraschend den heiss begehrten Job im Luxushotel Castello del Sole in Ascona erhielten. Behutsam, unaufgeregt und souverän machten Simon und Gabriela Jenny aus dem einst recht steifen Sonnenschloss ein Ferienhotel der Superlative, das seinen Stil gleichwohl bewahrt hat.
Text: Karl Wild Bilder: Stefania Giorgi / e Living Circle

Die Luxushotellerie von Ascona lässt sich an Qualität und Glamour nur mit jener von St.Moritz oder Gstaad vergleichen. In den 90er-Jahren war es Hans C. Leu, der mit seinem Albergo Giardino für Furore sorgte und es zum besten Ferienhotel der Schweiz machte. Fünf Jahre lang stand das Giardino an der Spitze der besten Ferienhotels im Land. Dann hörte Leu auf, das Giardino verlor Rang eins an das benachbarte Eden Roc. Dort hatte Selfmade-Milliardär Karl-Heinz Kipp seinen Palast am See mit über 100 Millionen Franken herausgeputzt und ihn weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Der Dritte im Bund der Traumherbergen von Ascona war das Castello del Sole. Das Sonnenschloss, an dem sich die Geister lange schieden.
Simon und Gabriela Jenny.


Der exklusive Privatstrand La Piagga aus der Vogelperspektive.

Auf den neuen, exklusiven Strandmöbeln, Lounges und Liegen lässt sich träumen wie im tiefsten Süden.
Direkt am Wasser, die Füsse im Sand und die warme Sonne auf der Haut.
Sie schauten sich die neue Welt in Ruhe an und begannen, diese behutsam zu verändern.
Für die einen war es eine wunderbare Oase der Ruhe, für andere überaltert und langweilig. Ein Lachen falle dort unangenehm auf, wussten Lästermäuler. Eine makabre Legende besagt, an den frei gewordenen Fensterplätzen im Hotelrestaurant sei zu Beginn der Saison jeweils erkennbar gewesen, wie viele Stammgäste innert Jahresfrist das Zeitliche gesegnet hatten. Anspruch auf die frei gewordenen Tische hätten jeweils jene Gäste erhoben, die es in den Jahren davor schon bis in Reihe zwei gescha t hatten; es habe gar eine Warteliste existiert. Wie auch immer: Die Auslastung im Castello war in Ordnung. Die Besitzerin, Kunst und Musikmäzenin Hortense Anda-Bührle, war zufrieden. Die Frau, die einst die reichste der Schweiz war, wollte keine Veränderungen.
Eines Tages freilich wären die Stammgäste aus biologischen Gründen weggeblieben. Der Zeitpunkt für einen Neustart war deshalb ideal, als Castello-Direktor Bruno Kilchenmann vor 20 Jahren in Pension ging. Rund 70 Personen aus ganz Europa bewarben sich für den Posten, darunter auch prominente Namen. Das Staunen war entsprechend gross, als Simon Jenny und seine Frau Gabriela das Rennen machten. Ausgerechnet zwei, die den vergleichsweise bescheidenen Hof Maran geleitet hatten. Ein 4 -Stern-Haus oberhalb von Arosa, das hauptsächlich von Wanderern, Hündelern und Jassern lebte. Und wo sich mit Einbruch der Dämmerung Fuchs und Haase gute Nacht sagten.
Doch die Wahl erwies sich als goldrichtig. «Wir gerieten in eine andere Welt», erinnern sich die Jennys – und taten genau das, was getan werden musste. Sie schauten sich die neue Welt in Ruhe an und begannen, diese behutsam zu verändern. Zuerst entfernten sie die Verbotstafeln, die an jeder zweiten Ecke standen, stellten ein neues, hoch motiviertes Team zusammen – und nicht zuletzt entdeckten sie den «vergessenen» Privatstrand. Obwohl der See nur durch den prächtigen, hoteleigenen Park mit uralten Bäumen vom Hotelkomplex getrennt ist, wurde der Beach kaum wahrgenommen. Das ist umso erstaunlicher, als es sich um einen naturbelassenen, umwerfend schönen und breiten Sandstrand inmitten von subtropischer Vegetation handelt. Gesäumt von mannshohem Schilf und belebt von Schwänen, Enten, Vögeln und allem, was da so kreucht und eucht.
Heute ist der Privatstrand La Piagga ein malerisches Refugium mit der Aura der Einzigartigkeit. Idyllisch, charmant, natürlich, lieblich, einfach atemberaubend schön. Im Sommer lässt sich in den neuen, exklusiven Strandmöbeln, Lounges und Liegen träumen wie im tiefsten Süden, mit einem Drink aus der Snack Bar La Spiagga in der Hand sowieso. Und hat man das süsse Dolcefarniente mal satt, lassen sich mit dem Kanu, dem Paddel, dem Pedalo oder dem Motorboot die örtlichen Gewässer erkunden. Die eigenen Instruktoren Samuele und Franco sind Wassersport-

Entspannen im prächtigen, hoteleigenen Park mit uralten Bäumen.

Kulinarik der Extraklasse unter freiem Himmel im Restaurant Tre Stagioni.


Zeitlos eleganter Einrichtungsstil trifft auf Wohlfühlatmosphäre.
Spezialisten, die auch Anfängern und Kindern den Spass auf dem Wasser vermitteln.
Im «Karl Wild Hotelrating Schweiz», das für die Branche massgeblich ist, steht das Castello del Sole zum vierten Mal in Folge an der Spitze der besten Ferienhotels im Land. Das erstaunt deshalb kaum, weil das Resort eine ganze Palette unschlagbarer Trümpfe ausspielen kann. So werden auf dem 150 Hektar grossen eigenen Landwirtschaftsbetrieb Terreni alla Maggia Reis, Hartweizen und Mais angebaut. Im feinen Shop auf dem Bauerngut, nur wenige Schritte vom Hotel entfernt, werden Risotto, Polenta, Mehle, Gewürze, Honig und vieles mehr angeboten. Aber auch Bier, Whisky, Gin und Grappa. Alles aus eigener Produktion. Und dann natürlich der Wein: Auf einer Fläche von 10,5 Hektaren wird eine repräsentative Auswahl an Weinen angebaut, die die Terreni alla Maggia unter die 150 besten Schweizer Winzer gebracht hat.
Nachdem Hortense Anda-Bührle vor einigen Jahren verstarb, übernahm Sohn Gratian Anda auch das Hotelgeschäft der Familie. Anda gründete den Living Circle und ernannte mit Jürg Schmid, dem früheren Chef von Schweiz Tourismus, eine Branchenikone zum VR-Präsidenten.
Unter dem Dach des kleinen, feinen Living Circle sind neben dem Castello unter anderem die 5-Stern-Häuser Storchen und Widder in Zürich sowie das Alex Lake Zürich in alwil zusammengefasst. Und Anda sorgte gleich für einen weiteren Ruck im Castello: 1000 Meter über dem Lago Maggiore kaufte er das Rustico del Sole, ein Anwesen zwischen Himmel und Erde mit spektakulärer Aussicht aufs Tal, einen ungemein romantischen Fleck für exklusive Momente im Freundeskreis. Das kleine Paradies erreicht man direkt vom HotelHeliport des Castello mit einem tollen Helikopter ug über die wilde VerzascaSchlucht. Für den Private Lunch im Rustico ist dann das Team von Starkoch Mattias Roock zuständig.
Am Abend wirkt Roock wieder in seiner berühmten Locanda Barbarossa im Castello. Dort hatte zuvor Othmar Schlegel einen Michelin-Stern erkocht, und als er vor gut fünf Jahren in Pension ging, wurde Roock sein Nachfolger. Es war ein Lottosechser. Der junge Hamburger mit Leidenschaft für die mediterrane Küche beliess die Klassiker seines Vorgängers klugerweise auf der Karte, erweiterte diese mit neuen, geschmacklich glattweg fantastischen Kreationen und erhielt ebenfalls den Michelin-Stern. 2018 wurde der hoch-
Hier nicht nur erlaubt, sondern erwünscht: «Il dolce far niente.»





In den Restaurants sorgt Sternekoch Mattias Roock für Glücksmomente.

Das Superior Double Room mit Balkon ist eines der 37 Doppel- und Einzelzimmer.
begabte, bescheidene Künstler am Herd bereits als Schweizer Koch des Jahres ausgezeichnet. Und die Begeisterung der Gäste in der Locanda Barbarossa steigt bis heute von Jahr zu Jahr.
Auch die Belegung des Hotels ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Daran sind Simon und Gabriela Jenny massgeblich beteiligt. Mit einer unglaublichen Zuverlässigkeit, Zähigkeit und Unaufgeregtheit scha ten sie es, das Haus trotz vielen Veränderungen und Anpassungen an die Zeit in jeder Hinsicht stets auf höchstem Niveau zu halten und es mit klaren Vorstellungen in die Zukunft zu führen. Wobei das Castello eigentlich kein Haus ist, sondern ein wunderbarer Komplex mit einem grossen Weiterentwicklungspotenzial. Dass die Möglichkeiten längst nicht ausgeschöpft sind, weiss Gratian Anda, der die Liebe zu den Hotels von seiner Mutter geerbt hat, sehr genau. Seine Zukunftspläne benötigen noch etwas Zeit, aber sie haben es in sich. Allein schon die vorgesehene neue Zufahrt durch den hoteleigenen Landwirtschaftsbetrieb dürfte zum Erlebnis werden. Derart eindrücklich präsentieren sich nur die Zufahrten zu den schönsten Weingütern in Südafrika.
Man wird noch einiges hören vom Castello del Sole. Und auch vom Living Circle. Dieser hat sich vor Kurzem mit der Caminada Group des weltberühmten Starkochs Andreas Caminada zusammengetan. Malt man sich aus, welche Synergien sich aus dieser Kooperation ergeben, bleibt nur ein Fazit: Der Deal ist ein Geniestreich.



Neue Naturerlebnisse
Das Castello hat auf diese Saison hin neue Natur- und Genusserlebnisse zusammengestellt.
Rice and Wine Talk
Eine Reise in die wunderbare Welt des Reises und des Weins der Terreni alla Maggia. Alles Wissenswerte in 33 Minuten.
Take a Walk with Mother Nature Sehen, riechen, fühlen und schmecken, was auf den Feldern der Terreni alla Maggia gedeiht und reift. Ein inspirierender Parcours in 33 Minuten (abkürzen erlaubt).
Apecar Weindegustation
Jeden Freitagmittag Degustation von vorzüglichen Tropfen aus dem eigenen Landwirtschaftsbetrieb.
It’s Cocktail o’Clock
Mixen von ausserordentlichen Cocktails mit Zutaten aus den eigenen Feldern, gemeinsam mit den Barchefs.
Tree Walk im Park
Spaziergang durch den weitläufigen Park, wobei der Gärtner spannende Geschichten erzählt.
Birdwatching Walk
Ein Teil der Parkanlage ist Naturschutzgebiet. Vogelbeobachtung auf eigene Faust oder mit einer Expertin.

Das Spa des Castello bietet auf 2500 m² ein unver gleichliches Wellnes- und Beauty-Vergnügen.

Living Circle und Caminada Group: die Traumhochzeit des Jahres

Ende März gaben die Caminada Group und e Living Circle ihre neue Zusammenarbeit bekannt. Es ist die Traumhochzeit des Jahres in der Branche. Gemeinsam erwarben Andreas Caminada und Gratian Anda von der Heinrich-Schwendener-Stiftung die von der Caminada Group betriebenen Liegenschaften im bündnerischen Fürstenau und gründete dazu die Schloss Schauenstein AG mit Sitz in Fürstenau. Durch den angekündigten Immobilienkauf entsteht die perfekte Zukunftslösung für Fürstenau. Die Partner streben eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen an und bauen den Standort Fürstenau aus.
Neben dem Kauf der Immobilien in Fürstenau erwirbt der Living Circle von Gratian Anda auch eine Minderheitsbeteiligung an der Betriebsgesellschaft Caminada Group AG. Der Verwaltungsrat der Caminada Group AG setzt sich neu aus Sarah Caminada, Andreas Caminada, Jürg Schmid und Gratian Anda zusammen. Andreas Caminada: «Wir bewirtschaften das Schloss Schauenstein als Pächter seit 2003 und haben über die Jahre erfolgreiche und nachhaltige Konzepte für die Nutzung der umliegenden historischen Gebäude entwickelt. Unsere Energie und Leidenschaft für Fürstenau haben sich für uns immer wie etwas Eigenes angefühlt.» Der selbstständige Spitzengastronom verrät, dass er nach Bekanntwerden der Verkaufsabsichten der heutigen Vermieterin aktiv auf e Living Circle zugegangen sei. «Ich freue mich sehr, dass durch den Kauf nun tatsächliches Eigentum an den von uns betriebenen Liegenschaften entsteht und wir heute gemeinsam mit e Living Circle eine neue Zukunft am Standort Graubünden ankünden dürfen.»
In Fürstenau betreibt die Caminada Group das mit drei Michelin-Sternen dekorierte Restaurant im Boutique Hotel Schloss Schauenstein, das vegetarische Fine-Dining-Restaurant Oz sowie das Bündner Gasthaus Casa Caminada mit Restaurant, Zimmern und Bäckerei. Fürstenau ist durch den Erfolg von Andreas Caminada, der zu den weltbesten Köchen zählt, berühmt geworden als Ort für höchste Gastgeberkul-
tur und besondere Genusserlebnisse. Mit Blick auf die neue Partnerschaft unterstreicht Caminada das grosse Potenzial der Allianz: «Mit e Living Circle gewinnen wir einen starken Partner, der in seinen Hotels und seinem Gastronomieangebot auf Spitzenqualität, regionale Verankerung und Produkte aus der eigenen Landwirtschaft setzt. Das passt perfekt zu unseren Maximen und gibt uns gleichzeitig zusätzlichen unternehmerischen Spielraum.»
Die Caminada Group Fortan bündelt die neu gegründete Caminada Group alle Unternehmungen von Andreas und Sarah Caminada. Die Caminada Group mit Unternehmenssitz in Fürstenau hat ihren Ursprung in der 2003 von Andreas Caminada gegründeten und stetig weiterentwickelten Genuss-Werkstatt. Zur Caminada Group gehört neben dem Schloss Schauenstein, dem Fine-Dining-Restaurant Oz und dem Bündner Gasthaus Casa Caminada auch das Atelier Andreas Caminada zum Vertrieb von Eigenerzeugnissen. Dazu kommt die 2015 von Andreas und Sarah Caminada gemeinsam gegründete AC Lizenz AG mit aktuellen Lizenznehmern für IgnivKonzeptrestaurants in St. Moritz, Zürich, Bad Ragaz und Bangkok. Im Besitz der Caminada Group be ndet sich seit 2022 auch die Mammertsberg Gastro AG, die das Hotel und Restaurant Mammertsberg mit geplanter Wiedererö nung im September 2022 im thurgauischen Freidorf betreibt.
e Living Circle Group
Die Gruppe setzt sich aus vier Hotels, drei landwirtschaftlichen Betrieben, einem Restaurant sowie einem Rustico zusammen. Dies sind das Castello del Sole in Ascona, das Widder Hotel und der Storchen in Zürich sowie das Alex Lake Zürich in alwil. Dazu kommen das Restaurant Buech in Herrliberg, das Rustico del Sole in Ascona und die Landwirtschaftsbetriebe Schlattgut in Herrliberg, die Terreni alla Maggia in Ascona und das Château de Raymontpierre in Vermes. e Living Circle Group be ndet sich im Besitz der Familie von Gratian Anda.

Direktion für das neue Hotel Maistra160 in Pontresina steht
Irene und Martin Müller übernehmen die Direktion des sich noch im Bau be ndenden Hotels Maistra160 in Pontresina. Das erfolgreiche Hotelier-Paar führt zurzeit das Hotel Castell in Zuoz. Bereits im Oktober dieses Jahres werden die beiden mit ins neue Projekt einsteigen. Die Erö nung des Maistra160 ist auf den Sommer 2023 geplant.
Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: zVg
Bettina und Richard Plattner – die Besitzer, Initianten und Bauherren des Hotelprojektes Maistra160 mitten im Feriendorf Pontresina – freuen sich, dass die Frage nach der Direktion des ambitionierten Hotelprojektes so früh und mit einer optimalen Besetzung geregelt werden konnte. Irene und Martin Müller führen seit 2015 das Hotel Castell in Zuoz – einen Leuchtturm der Engadiner Hotellerie. Davor leiteten Müllers fünf Jahre lang erfolgreich das Parkhotel Bellevue in Adelboden.
Zwei neue Bauten: Hotel und Mitarbeiterhaus
Das Maistra160 wird von Grund auf neu gedacht und aufgebaut. Mitten im Dorfkern von Pontresina, an der Via Maistra 160, an der Stelle des ehemaligen Hotels Post, entstehen 36 Zimmer und zehn Wohnungen. Mit viel Convenience orientiert sich das Angebot am neuen Ferienverhalten und liefert Antworten auf die Bedürfnisse einer mobilen, individualisierten und multioptionalen Gesellschaft. Der Stil ist hochalpin, puristisch und funktional. Er trägt die Handschrift des renommierten Bündner Architekten Gion A. Caminada. Das 4-Sterne-Haus wird unter anderem über ein Restaurant mit Terrasse, eine Bar, einen Workspace und eine Bibliothek, einen Fitness- und Yoga-Raum sowie eine Spa-Landschaft und ein o enes Atrium verfügen.
Gleichzeitig mit dem Hotel Maistra160 wird in Pontresina auch ein eigenes Mitarbeiterhaus erstellt. Die Chesa Curtinella besteht aus 19 Einheiten mit Studios und Wohnungen, Garten, Fitness- und Gemeinschaftsraum. Damit soll neben einer optimalen Arbeits- auch eine hohe Lebensqualität für Mitarbeitende geschaffen und schon im Vorfeld auf den akuten Fachkräftemangel in der Hotellerie reagiert werden.
Plattner & Plattner neu mit 200 Betten Mit ihren Alpine Lodges hat das Hotelier- und Unternehmerpaar Bettina und Richard Plattner bereits vor zehn Jahren frischen Wind in die Engadiner Ferienlandschaft gebracht. Die stilvollen Ferienwohnungen in moderner alpiner Architektur bieten Geborgenheit und ein unabhängiges Feriendesign. Drei Lodges mit eigenem Fitness- und Wellnessbereich stehen in Pontresina zentral zur Verfügung – verschiedenste Zusatzleistungen vom gefüllten Kühlschrank bis zum Personal Trainer können individuell dazugebucht werden. Seit bald 30 Jahren sind Bettina und Richard Plattner ein eingespieltes Team mit viel Erfahrung als Führungsduo in der Hotellerie. Plattner & Plattner besitzt und betreibt nach Fertigstellung des Hotels Maistra160 ein Beherbergungsunternehmen mit rund 200 Betten.
Bettina und Richard Plattner, Eigentümer des Hotel Maistra160, mit der gewählten Direktion Irene und Martin Müller.
Internationaler Frauentag ist auch Marketing: Relais & Châteaux feierte
Geschäftsführerinnen
Der Internationale Frauentag (8. März) bot Relais & Châteaux den Anlass, um weibliche Führungskräfte der weltweiten Vereinigung von 580 Hotels und Restaurants zu feiern. Fünf Geschäftsführerinnen sprachen über ihre Fähigkeiten, ihre Stärken und ihre Visionen. Darunter auch zwei Geschäftsführerinnen aus der Schweiz: Anna Metry, Zermatt, und Barbara Gibellini, Lugano.
Text: bearbeiteter zVgText
Digitalisierung und WorkLifeBalance sind zentrale Themen, denen sich die beiden Managerinnen in den Relais& ChâteauxDestinationen Zermatt und Lugano widmen. Nicht nur am Internationalen Frauentag. «Ich liebe die Vielseitigkeit meines Berufs», sagte Anna Metry, Direktorin im Chalet Hotel Schönegg in Zermatt.
Konkret spricht sich den damit verbundenen Spagat zwischen dem «Menschlichen», wie sie es nennt, und dem Technischen an. «Es gibt viele Bereiche, die mittlerweile digitalisiert sind. Von den Reservationsplattformen über das GästeFeedback und die Schlüsselkarte bis zum SpaBereich. Da gilt es, überall à jour zu sein, den Überblick zu behalten.» Das ist herausfordernd, birgt aber auch Potenzial: «Ich hoffe, dass durch die fortschreitende Digitalisierung viele Prozesse einfacher werden und wieder mehr Zeit für die Gästebetreuung selbst bleibt», so Metry weiter.
Der Kontakt mit Menschen aus aller Welt mache ihre Arbeit zum «schönsten Job, den es gibt», findet Barbara Gibellini, General Manager der Villa Prinicipe Leopoldo in Lugano. Die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein. Seit Gibellinis Stellenantritt hat sich in dem Fünfsterne
hotel am Luganersee so einiges getan. «Um unsere Angestellten bei der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie besser zu unterstützen, haben wir Teilzeitarbeit eingeführt. Das war nicht einfach und hat ein Umdenken im Hinblick auf die Schichten verlangt», erläutert Gibellini. «Das hat zwar seinen Preis. Aber es lohnt sich, wenn wir dadurch wertvolle Mitarbeitende behalten können.»
WorkLifeBalance, das zeigten auch die Gespräche mit Geschäftsführerinnen in Italien, Irland oder Indien, ist ein zentrales, ein internationales Thema. Die Branche erlebe hier eine Metamorphose. Freie Wochenenden und Abende müssen Wirklichkeit und nicht nur Wunschtraum sein oder unbedingt werden. Zudem habe der Wert Nachhaltigkeit während der Pandemie an Bedeutung gewonnen.
Philippe Gombert, Präsident von Relais & Châteaux, kündigte Ende letzten Jahres anlässlich des 51. jährlichen Kongresses an: «Unsere Stellen müssen optimale WorkLifeBalance bieten und Raum für Lebensfreude lassen.» Die Dringlichkeit, Männer und Frauen in der Branche gleich zu entlohnen, wurde von ihm betont. Zudem müsse den Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben werden, ihre Arbeitszeiten anzupassen, und ihnen müssen Karrieremöglichkeiten angeboten werden.

Das Hotel Castell in Zuoz wird neu von Christine Abel und Matthias Wettstein geführt.
Hotel Castell in Zuoz mit neuer Führung

Die beiden erfahrenen Hoteliers Christine Abel und Matthias Wettstein übernahmen 2022 die Führung des Vier-Sterne-Superior-Hotels Castell in Zuoz. Das bisherige Direktionspaar Irene und Martin Müller zog nach sieben Jahren nach der Wintersaison weiter.
Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: zVg
Das bei Familien, Sportlern und Kunstliebhabern beliebte Hotel Castell in Zuoz hat ein neues Direktionspaar. Im April 2022 übergaben Irene und Martin Müller die Rolle der Gastgeber an Christine Abel und Matthias Wettstein. Das eingespielte neue Direktionspaar blickt auf langjährige und internationale Erfahrungen in der Hotellerie zurück. Zuletzt verantworteten sie gemeinsam die operative Führung des Sorell Hotels Tamina in Bad Ragaz. Davor leiteten sie erfolgreich über mehrere Jahre das Maiensässhotel Guarda Val auf der Lenzerheide.
Neue Herausforderung in der Hotellerie «Wir freuen uns auf die neue Herausforderung im idyllischen und facettenreichen Hotel Castell. Es wurde mit Herzblut und Passion geführt, und diesen Schwung nehmen wir gerne mit», sagen Christine Abel und Matthias Wettstein. Noa Bechtler, Verwaltungsratspräsidentin der Castell Zuoz AG, freut sich auf die neuen Gastgeber: «Mit Christine Abel und Matthias Wett-
stein haben wir zwei erfahrene Hoteliers gefunden, die die Werte des Castells perfekt verkörpern. Sie werden unser alpines Kunsthotel erfolgreich weiterführen.»
Das Castell in Zuoz gilt als Inbegri einer gelungenen Hotelwelt, die Kunst, Natur, Kulinarik und Wohlbe nden integriert. Highlights sind beispielsweise die sinnliche Rote Bar, gestaltet von der Architektin Gabrielle Hächler und der Künstlerin Pipilotti Rist; die leicht federnde Sonnenterrasse des japanischen Künstlers Tadashi Kawamata; der o ene Turm – eine Lichtinstallation mit Blick zum Himmel – des US-Künstlers James Turrell oder das Hamam, wo sich orientalische Badekultur mit alpiner Hotelwelt vereinigt.
Ein grosses Dankeschön geht an das bisherige Direktionspaar Irene und Martin Müller, die das Hotel per Ende Wintersaison verlassen: «Durch ihren unermüdlichen Einsatz, die innovativen Ideen und die herzliche Hotelführung haben sie das Castell zu einem der beliebtesten Hotels im Engadin entwickelt», lobt Bechtler.
Mix aus Mut und Meisterschaft: Casa Martinelli
AText: Hilmar Gernet Bild: zVg
ngefangen hat es vor 14 Jahren. Monika Gmür, Tochter des bekannten und 2004 verstorbenen Theater-, Musical- und Kabarettautors Hans Gmür, damals 54 -jährig, zog vom Zürichsee nach Maggia im Tessin. So weit, so uninteressant. Der mutige Teil ihres Entschlusses bestand darin, den Neubeginn mit dem Traum zu verbinden, ein eigenes Hotel zu verwirklichen.
Vor zehn Jahren, nach intensiver und langjähriger Planung, eröffnete Monika Gmür ihr schmuckes Boutique-Hotel unter dem Namen Casa Martinelli. Stararchitekt Luigi Snozzi hat das über 300 -jährige Tessinerhaus sanft renoviert und mit einem zweistöckigen Kubus aus Beton ergänzt.
Entstanden ist eine idyllische Oase, wo schon viele Gäste – darunter auch viele bekannte Persönlichkeiten – ihre freie Zeit genossen haben. Marc Sway, Walter Andreas Müller, Alain Berset oder Jürg Randegger liessen im Casa Martinelli schon ihre Seele baumeln.
Mit der Architektur des Casa Martinelli ist Luigi Snozzi ein beeindruckendes Beispiel kreativer, angewandter Gestaltung gelungen. Ihm ist es gelungen, alle relevanten Ansprüche des Hauses wirkungsvoll zu vereinen: Innovation und Bewahrung, Kultur und Natur, Gegenwart und Vergangenheit. Der Mix aus dem Mut der Gastgeberin und der Meisterschaft des Architekten hat ein charmantes Bijou kreiert. Es darf mit Stolz auf die ersten zehn Jahre zurückblicken.
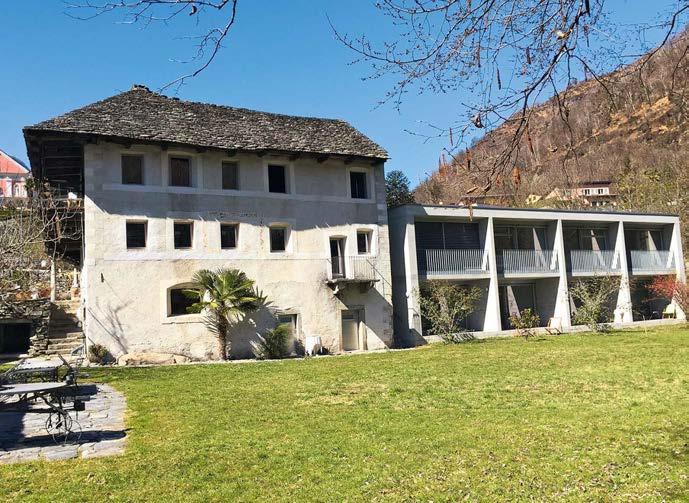
Dem Architekten Luigi Snozzi gelang die Symbiose von gestern und heute.

Frisches Design.
Hotel Seidenhof und Restaurant Enja setzen frische Akzente mitten in Zürich
Nach mehrmonatigem Umbau ö nete Anfang März das Hotel Seidenhof wieder seine Türen. Mit dem 4-Sterne-Hotel entstand im Herzen von Zürich ein lebendiger Tre punkt für Reisende aus dem In- und Ausland. Neben dem Boutique-Hotel lädt das neue Restaurant Enja im gleichen Haus mit innovativer Kochkunst auf o enem Feuer zu einer genussvollen Auszeit.
Text: bearbeiteter zVg-Text Bilder: zVg

Das geschichtsträchtige Hotel Seidenhof erstrahlt nach fast zwei Jahren Umbauzeit in neuem Kleid. Am 4. März 2022 wiedererö net, erwartet das Hotel die Gäste mit 78 stilvoll eingerichteten Boutique-Zimmern für Kurz- und Langzeitaufenthalte. Liebevoll gestaltete Details erinnern an die Geschichte des Hauses inmitten des einstigen Zentrums der europäischen Seidenindustrie. «Der Seidenhof ist seit 1902 Tre punkt für Menschen aus aller Welt, und wir freuen uns sehr, wieder Gäste im frisch renovierten Haus willkommen zu heissen und diese Tradition fortzuführen», so omas Kleber, COO Hotels der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, zu der das Hotel Seidenhof als Teil der Sorell Hotels gehört. Persönlich geführt wird das Haus von Matthias Ramer, der als Cluster General Manager gleichzeitig auch für das 2020 erö nete Sorell Hotel St. Peter in Zürich verantwortlich ist.
Kulinarische Höhen üge im Restaurant Enja
Im Erdgeschoss des Hotels lädt die Bar ganztägig zu spannenden Begegnungen mitten im Kreis 1 ein, morgens mit Ka eespezialitäten und abends zum Apéro
Der Seidenhof traditionell und markant.
Gemütlich wohnlich.



Man trifft sich unaufgeregt.
Business wie daheim.
mit feinen Häppchen. Kulinarische Höhenüge verspricht das angrenzende Restaurant Enja. Saisonale und regionale Zutaten, insbesondere Gemüse, Kräuter und Früchte, stehen beim Team um Küchenche n Jessica Maggetti und Gastgeber Benjamin Schmid im Mittelpunkt. Auch Fleisch- und Fischliebhaber:innen kommen mit lokalen Spezialitäten auf ihre Kosten. «Wir möchten mit unseren auf o enem Feuer zubereiteten Kreationen überraschende kulinarische Akzente in der Zürcher Restaurantszene setzen», so omas Kleber. Auf der Speisekarte nden sich beispielsweise Sellerie in der Kohle gegart mit Hummus, Selleriebrösmeli, Randenpickles und Limettensauce oder grillierter Rotschmierkäse von Jumi mit Rotkabis, Schmorzwiebeln, Zwiebelcon t und Bratkarto eln. Die Köstlichkeiten werden ab Sommer 2022 auch im
begrünten Innenhof serviert, der als ruhige Oase zu erholsamen Stunden mitten im Grossstadtdschungel einlädt.
Strategische Weiterentwicklung
Die Hotelgruppe Sorell Hotels Switzerland, aktuell mit 16 Hotels, hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Digitalisierungs- und Umbauprojekte umgesetzt, wobei die Erö nungen des Hotels Seidenhof und des Restaurants Enja weitere Meilensteine in der strategischen Weiterentwicklung der Sorell Hotels darstellen. Wie bereits beim Umbau des Sorell Hotels St. Peter wurde beim Hotel Seidenhof das Architekturbüro Andrin Schweizer Company für den Innenausbau beauftragt, derweil im Restaurant Enja Grego Architektur für die Innenarchitektur verantwortlich zeichnete.
Die Sorell Hotels im Überblick
Die Sorell Hotels sind die grösste Schweizer Hotelgruppe in Eigen besitz mit 16 individuellen Stadt- und Ferienhotels im 3- und 4-Sterne-Bereich in Zürich, Dübendorf, Basel, Winterthur, Bern, Rapperswil, St. Gallen und Bad Ragaz. Die Sorell Hotels gehören der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, innovativer Gastgeberin in den Bereichen Verpflegung, Beherbergung und Betreuung.
sorellhotels.com
Anzeige







Ein Hotelkonzept führt in neue digitale Dimensionen.
Neuro Campus Hotel DAS MORGEN erö net
Wo Musik und Gastroboter Gästen Genuss bereiten
DAS MORGEN in Vitznau widmet sich der Neurologie, der Musik und dem Genuss. Damit gelingt dem emenhotel eine weltweit einzigartige Fokussierung. Wissenschaftliche Erkenntnis und Forschung werden im Campus Kultur Kulinarik Vitznau konkret. Personalisierte Ernährung, Musik und Gästeroboter bescheren den Gästen vielfältige Erlebnisse. Ein vielversprechendes Konzept, das Gastronomie, Kulinarik und die Neuro Music Academy miteinander vernetzt.
Text: Ronald Joho-Schumacher, Hilmar Gernet Bilder: Emanuel Ammon/AURA, DAS MORGEN

Der Campus Kultur Kulinarik Vitznau gründet auf einer Vision des Investors Peter Pühringer. Seine Pühringer-Gruppe machte sich mit Innovationen im Bereich der neurowissenschaftlichen Forschung und Anwendung einen Namen. Ein Beispiel dafür ist die international anerkannte Reha-Klinik für neurologische Erkrankungen in Weggis. DAS MORGEN wird von seinen Betreibern verstanden als Synonym für das Erleben und das Erfahren von Genuss, basierend auf Erkenntnissen der neurowissenschaftlichen Forschung.
Reale Vision
Wie wird die Vision umgesetzt? Der Campus Kultur Kulinarik Vitznau ist mit seinem Kernprojekt DAS MORGEN ein Ort, der Verbindungen scha t. Wegleitend dafür ist das Credo «Vergangenheit bewahren und die Zukunft gestalten». Wie sich im menschlichen Gehirn ständig neue neuronale Netzwerke bilden, so sollen auch im neuen Campus Verbindungen, Konzepte, Ideen und Werke entstehen. Die Bestandteile des Netzwerks wecken die Sinne. Sie heissen Hotellerie,
Das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau.
Gastronomie, Kulinarik und Musik. Für Elke Hesse, die Verantwortliche für Kunst und Kultur der Pühringer-Gruppe, wird das Neuro Campus Hotel «innovatives Denken fordern und fördern», und zwar durch «beste Infrastrukturen auf der Basis neuster Erkenntnisse der Neurowissenschaften».
Das Neuro Campus Hotel ist mit seinen 54 Zimmern und 128 Betten auch ein Denkraum für Forschung und Innovationen innerhalb des Campus Kultur Kulinarik Vitznau. Es gliedert sich in vier Gastzonen, die sich, so der verantwortliche Resident Manager Tim Moitzi, auf das Erdgeschoss und das Dach verteilen. Dort geniessen die Gäste Drinks, kleine Speisen und erholen sich unterstützt durch die eindrückliche Sicht auf den Vierwaldstättersee und die Berge.
Die konzeptionellen Gastzonen orientieren sich am Gestern, am Heute und am Morgen. Im Gestern erwartet den Besucher ein heimelig anmutendes «Stübli». Es verbindet Traditionelles mit Regionalem. Da wird die lokale zusammen mit der klassischen Küche modern interpretiert. Experimenteller sind die Zonen Heute und Morgen. «Jedem Gast sein Gusto» lautet das Prinzip im Heute. Das gilt für die Feingestaltung seiner Bestellung ebenso wie für die individuelle Nutzung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss.
Im Morgen wird permanent an der Gastronomie der Zukunft geforscht und geprobt. Hervorzuheben ist beispielsweise die personalisierte Speisenempfehlung via Smartphone und App. Die Zutaten werden von den Präzisionsköchen des Campus zum genussvollen, persönlichen Menü nalisiert.
Personalisierte Ernährung
«DAS MORGEN», so der Gastgeber des Neuro Campus, Silvan Sutter, «scha t mit seinem bemerkenswerten Konzept ein völlig neues Genre in der europäischen Hotelszene.» Hier werde eine «einzigartige Symbiose von individualisierter Gastronomie mit automatisierter Hotellerie, ergänzt durch Forschung und durch Musik» praktiziert. Das einzigartige Konzept ist vom Neuro Culinary Center (NCC), das zur PühringerGruppe gehört, entwickelt worden.
Dazu Geschäftsführer Markus Arnold: «Wir scha en Innovationen in Hotellerie und Gastronomie, indem wir Produkte, Prozesse und Präzision im Bereich der
Kulinarik weiterentwickeln.» Das NCC fokussiert dabei auf personalisierte Ernährung, welche zugleich die Möglichkeiten der Automatisierung, Digitalisierung und Robotik konsequent nutzt. Das Neuro Campus Hotel positioniert sich zudem als Kompetenzzentrum, welches ein umfassendes Angebot an Wissensvermittlung und Weiterbildung bietet. Ein besonderes Angebot sind in diesem Kontext die Dinner-Experience-Aktionen. Es sind Erlebnis- und Selbstentdeckungsabende, wo den Gästen die Neurogastronomie nähergebracht wird und sie die personalisierte Ernährung geniessen können.
Gastroboter: Vitzi und Telli In Küche und Service werden die neusten Automatisierungs- und Robotertechniken genutzt. Beispiel dafür sind eigens entwickelte Gastroboter. Zwei davon, Telli und Vitzi mit Namen, sind voll ins Konzept der Automatisierung in der Gastronomie und der Hotellerie einbezogen. Telli steht für den verlässlichen Tellerbringer vom Dienst. Vitzi ist die Abkürzung für den ersten Vitznauer Roboter. NCC-Geschäftsführer Markus Arnold: «Mit o enem und geschlossenem Warentransport oder Bildschirmen ausgestattet, unterstützen sie viele Prozesse. Bei der Begrüssung im Restaurant, bei der Litftnutzug oder beim Zimmerservice stehen sie im Einsatz für unsere Gäste.»
Das Neuro Campus Hotel setzt generell auf eine Kombination von Digitalisierung und persönlichen Servicedienstleistungen. Während des Aufenthalts kann der Gast über eine innovative Software verschiedene Leistungen – zum Beispiel Seminarequipment im Zimmer, Roomservice, Zimmerreinigung – exibel buchen. Funktionen wie das digitale Abschliessen von Türen oder das kontaktlose Bezahlen im Restaurant sind im Neuro Campus Hotel selbstverständlich Standard.
Neuro Music Academy und Musikita «Musik begleitet Menschen rund um die Welt durch ihr Leben. Musik ruft Emotionen hervor, lässt Menschen miteinander in Beziehung treten und weckt Erinnerungen an Dinge, die einem lieb sind», erklärt Martin Baumgartner, der künstlerische Leiter der Neuro Music Academy. Die Neuro Music Academy knüpft an diesen sozialen Kontext der Musik an. Sie verknüpft Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der Musik und gestaltet so ihr Angebot. Die Neurowissenschaften helfen, zu verstehen, wie Musik

Jedes Zimmer im Neuro Campus Hotel hat seine eigene Geschichte.




DAS MORGEN –die Verantwortlichen Einzigartige Projekte brauchen beste Lagen. Das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN liegt in Vitznau – dort, wo das ehemalige Hotel Flora einst Gäste aus aller Welt beherbergt hat. Die Vernetzung des Campus Kultur Kulinarik Vitznau mit der international anerkannten Reha-Klinik für neurologische Erkrankungen im nahe gelegenen Campus Hotel Hertenstein ist denn auch erklärte Strategie der Pühringer-Unternehmensgruppe. Die Pühringer-Gruppe betreibt in der Schweiz neben dem Neuro Campus Hotel DAS MORGEN auch das Park Hotel in Vitznau sowie das Campus Hotel in Hertenstein.
Die Idee zum Campus Kultur Kulinarik Vitznau hatte der österreichische Unternehmer, Investor, Visionär und Musikliebhaber Peter Pühringer. Elke Hesse, die Verantwortliche für Kunst und Kultur der PühringerGruppe, und der Hotelier Tim Moitzi sind für die Umsetzung des Campus Kultur Kulinarik Vitznau mit dem Campus Hotel DAS MORGEN verantwortlich. Elke Hesse kann bei ihrer Arbeit unter anderem auf ihre Erfahrungen als Entwicklerin und Leiterin des Konzertsaales der Wiener Sängerknaben zurückgreifen. Tim Moitzi ist innerhalb der Pühringer-Gruppe als Resident Manager im Campus Hotel Hertenstein tätig. Ihnen zur Seite stehen Marcella Tönz, Projektleiterin Musikita Vitznau, Martin Baumgartner, künstlerischer Leiter der Neuro Music Academy, Markus Arnold, Geschäftsführer der Neuro Culinary Center AG. Silvan Sutter ist als Gastgeber Gastronomie des Neuro Campus Hotels DAS MORGEN verantwortlich.

Aufgestellt: Frische und leichte Atmosphäre.


Foyer und Lobby:
ankommen.
wirkt und was sie im Gehirn der Zuhörenden wie auch der Künstlerinnen und Künstler auslöst. Die Neuro Music Academy bietet entsprechend vielseitige Angebote zur musikalischen Aus- und Weiterbildung für Laien und und Pro s an.
Grosse Bedeutung schenkt der innovative Campus auch der musikalischen Jugendförderung. Dabei ist die Kammermusik Akademie Vitznau ein zentraler Partner. Sie startet im Oktober 2022 «ein wegweisendes Stipendienprogramm für internationale Talente», wie Martin Baumgartner ausführt. Unter dem Dach der Neuro Music Academy nden zudem mehrtägige Foren und Praxisworkshops statt. Das erste Forum zum ema «Auftreten –Präsentieren–Überzeugen» fand bereits Ende März 2022 statt.
Integrierender Bestandteil der Neuro Music Academy ist die Musik-Kita Vitznau. Ihr Konzept beruht auf einer Vielzahl von Studien, welche die Vorteile einer intensiven Beschäftigung von Kindern mit Musik für deren persönliche Entwicklung belegen.
Projektleiterin Marcella Tönz versteht die Musikita «nicht als Talentschmiede, sondern als kindlichen Lebensraum in engem Kontakt zur Musik. Es soll ein Ort sein, wo Leistung, Lust und Spass ineinander iessen. Hier hat es Platz für Experimente. Hier wird Musik mit allen Sinnen gelebt.»
Die Arbeitsweise der Musikita Vitznau basiert auf der WirthMethode. Bei der vom österreichischen Musikpädagogen Gerald Wirth entwickelten Methode sollen die musikalischen Einheiten nicht einem vorgefassten Plan folgen, sondern vielmehr der momentanen Situation angepasst werden. Dabei spielen die Inputs der Kinder eine wesentliche Rolle. Alles soll geprägt sein von Freude und Spass am Musizieren, Spielen und Lernen. Die Musikita Vitznau betreut seit Januar 2020 20 Kinder aus der Region. Die Kosten für die musikpädagogische Begleitung der Kinder werden von der Pühringer Foundation übernommen.
Vorbild Berlin: Kammermusiksaal
Ein grundlegendes Element des Neuro Campus Hotels ist auch der unterirdische Kammermusik- und Multimediasaal. Er wird im Frühjahr 2023 erö net. Er bietet Platz für rund 300 Personen. Der Saal wird – selbstverständlich, ist man geneigt festzustellen –über eine Hightech-Infrastruktur verfügen, die Tonaufnahmen in bester Qualität erlaubt. Für die hochklassige Akustik zeichnet der namhafte holländische Klangarchitekt Martijn Vercammen verantwortlich. Er hat auch das Akustikkonzept für die Berliner Staatsoper entwickelt. Der Kammermusik- und Multimediasaal steht den Gästen der Hotels und Institutionen der PühringerGruppe, aber auch Touristen, angehenden Musikpädagoginnen und -pädagogen sowie Kunstscha enden zur Verfügung. Geplant sind neben Mini-Festivals und Konzerten auch Projekte in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern sowie mit weiteren Festivalveranstaltern aus der Region. Ein Highlight sind die Wiener Sängerknaben, welche während ihres zweiwöchigen Sommeraufenthalts hier üben und es sich gut gehen lassen.
Willkommen,





EDEN SPIEZ – WELLNESS UND GENUSS
AM THUNERSEE SEIT 1903
Willkommen im Paradies!
Ob als Hotelgast oder Tagesgast im Eden Spa – während Ihrem Aufenthalt geniessen Sie den Blick auf die schönste Bucht Europas und die Berge der Jungfrau-Region.
Vom Balkon jedes der 45 individuell gestalteten Zimmer blicken Sie auf das malerische Schloss Spiez, den Dorfkern von Spiez, das atemberaubende Bergpanorama des Berner Oberlandes oder den Thunersee. Zentral in Spiez gelegen, bietet das Eden Spiez auch den idealen Ausgangspunkt für Ihre Aktivitäten und Ausflüge.
Nach Erlebnis und Besichtigung von Sehenswürdigkeiten lässt es sich im 650 m² grossen Eden Spa herrlich entspannen. Geniessen Sie die Kraft der Elemente im Sole-Aussenbad (33 Grad) mit «Jungbrunnenwasser», sprudelnden Attraktionen und Unterwasserliegen. Ein Salzraum mit Himalaya-Salz steinen, eine finnische Sauna, eine Biosauna, ein Dampfbad und ein Panorama-Hallenbad laden ebenso zur Erholung und zum Entschleunigen ein.
Kulinarische Köstlichkeiten finden Sie im eleganten Restaurant Belle Epoque. Das Küchenteam um Thomas Pape ergänzt die



genussvollen Speisen mit Kräutern, Obst und Gemüse aus dem Garten Eden. «Gault Millau» zeichnete ihre Küche jüngst mit 13 Punkten aus. Für Ihr leibliches Wohl ist also gesorgt.
Das Serviceteam um Salvatore Bruno serviert diese Kreationen mit viel Hingabe und empfiehlt charmant den passenden Wein. In der ausgezeichneten Weinkarte befinden sich neben den Weinen vom Spiezer Rebberg über 250 Positionen auserlesener Schweizer Weine und aus speziell ausgesuchten Regionen Europas.
Die Bistro-Bar, wo Kaffeespezialitäten, Spiez-Wein und leichte Bistrogerichte in ruhigem Ambiente serviert werden, lädt den ganzen Tag zum Verweilen ein.
Eine Smokers Lounge für Zigarrenliebhaber und eine Seeterrasse, auf der Sie im Sommer das mediterrane Klima geniessen können, runden das genussvolle Angebot ab.
Seien Sie herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie!




Romantik Hotel

Schweizerhof, Grindelwald.
Neues Label: Pearls by Romantik
Mit dem neuen Label Pearls by Romantik ö net sich die europaweit tätige Hotelkooperation Romantik Hotels & Restaurants noch stärker für die Vermarktung von 5-Sterne-Hotels. Zum Start sind neun exklusive Häuser in fünf Ländern auf der Plattform vereint. Mit dem Romantik Hotel Schweizerhof in Grindelwald gehört auch ein Schweizer Haus zu den Perlen.
Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: zVg


Als «neue Alternative mit starker Verankerung in den Heimatmärkten in diesem Segment» beschreibt Romantik-CEO omas Edelkamp Pearls by Romantik. Das Label sei eine natürliche Weiterentwicklung der Marke. Denn im Portfolio von Romantik habe es schon immer 5-Sterne-Hotels gegeben. «Mit Pearls erhalten diese Hotels nun eine eigene Plattform für die Pro lierung und erfolgreiche Positionierung in allen relevanten Kanälen. Markendesign und Logo sind geeignet, Pearls by Romantik auch alleinstehend zu vermarkten», sagt Edelkamp.
Pearls by Romantik startet mit acht exklusiven Hotels in vier Ländern Zu den Pearls-Hotels zählen neben dem Romantik Hotel Schweizerhof in Grindelwald auch das Romantik Wellnesshotel Deimann (Schmallenberg), das Romantik Hotel Sackmann in Baiersbronn, das Romantik Hotel auf der Wartburg (Eisenach) und das Romantik


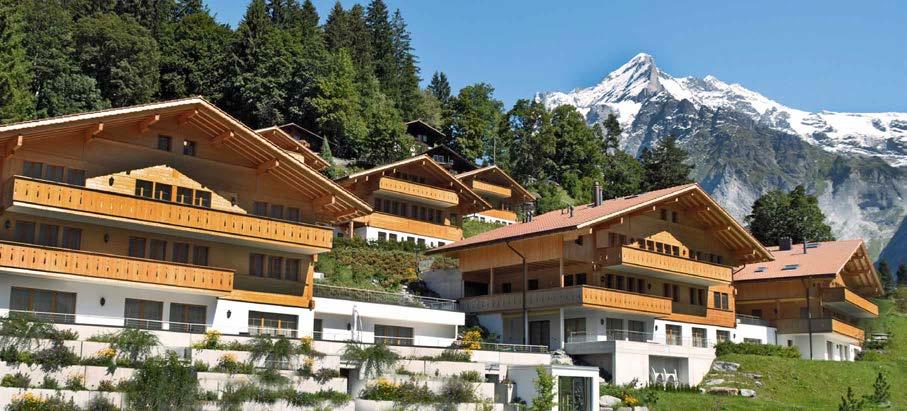
Roewers Privathotel (Rügen) in Deutschland. Hinzu kommen in Österreich das Romantik Hotel Die Krone von Lech (Lech) sowie in Italien das Romantik Hotel Turm (Völs) und das Romantik Hotel Cappella (Corvara). Die neuste Perle, seit März 2022, ist das Parkhotel de Wiemsel im Kunststädtchen Ootmarsum direkt an der niederländisch-deutschen Grenze.
Romantik – Markenaufbau seit fünf Jahrzehnten
Romantik ist seit 50 Jahren im europäischen Markt aktiv. Besonders stark sei die Marke im deutschsprachigen Raum, wo sie in den letzten Jahrzehnten viele Fans in allen Altersgruppen gewonnen habe, erläutert omas Edelkamp. Tausende loyale Gäste, zudem eine besonders anspruchsvolle Klientel, die grossen Wert auf Genuss lege, reisten jedes Jahr mit der Marke in die neun Romantik-Länder. Der weitere Aufbau des Netzwerkes soll nun selektiv und mit konsequent hohen
Qualitätsansprüchen betrieben werden. Dabei bleibt das 5-Sterne-Segment bei Romantik familiär geprägt.
«Die Romantik-Gastgeber sind einer der Grundpfeiler der Marke und garantierten genau die Leichtigkeit, die Reisende von den Häusern der Kooperation kennen und erwarten», so Edelkamp weiter.
Orte für Geniesser, Erlebnis-Sammler und Individualisten
Der Markenexperte beschreibt die meist familiengeführten Pearls-by-Romantik-Hotels als «Orte für Geniesser, Erlebnis-Sammler und Individualisten», die sich auch durch aussergewöhnliche WellnessBereiche und eine hochstehende Kulinarik auszeichnen. «Unser neues Kundenbindungsprogramm, Partnerschaften mit Miles & More und Bahn-Bonus, ein eigener digitaler Service zur Tischreservierung sowie unsere MyRomantik-CRM-Plattform, die alle Aktivitäten und Informationen europaweit verbindet und massgeschneidertes Direktmarketing erlaubt, füllen die Marke mit Leben», so omas Edelkamp.

Alexandra Hürlimann.
Alexandra Hürlimann ist die neue Direktorin im B2 Hotel Zürich
Nina Schröder verlässt das B2 Hotel im Hürlimann-Areal Zürich, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Nachfolgerin übernahm Alexandra Hürlimann per 1. April als Direktorin die Verantwortung für die Betriebsleitung.
Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: zVg
Alexandra Hürlimann übernahm per 1. April die Leitung des B2 Hotels in Zürich. Nach Abschluss der Matura und der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern konnte sie wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Gastronomie- und Hotelbetrieben sammeln. Ihre Stationen umfassen das Kempinski Grand Hotel des Bains in St. Moritz, das KKL Luzern, das Zürich Marriott Hotel sowie zuletzt während zehn Jahren die 25hours Hotels Zürich.
Martin Emch, CEO der Turicum Lifestyle Hospitality Management AG, freut sich über das Engagement von Alexandra Hürlimann. «Mit ihr konnten wir eine ausgewiesene Fachfrau gewinnen, die mit ihrer spürbaren
Leidenschaft für das Hotelfach das B2-Hotel-Konzept weiter prägen wird.»
Nina Schröder hat sich entschieden, sich eine Auszeit zu gönnen und sich anschliessend einer neuen Herausorderung zu stellen. Martin Emch meint dazu: «Wir bedauern den Weggang von Nina Schröder sehr. Während sieben Jahren hat sie den Hotelbetrieb mit grossem persönlichem Engagement und erfolgreich geführt. Sie hat mit einer ausgezeichneten Teamleistung den B2-Spirit gelebt.»
Das B2 Hotel ist eine Eigenmarke der Turicum Lifestyle Hospitality Management AG und wurde 2012 im Hürlimann-Areal in Zürich erö net.
Bellevue Interlaken
Winter für Winter für die Zukunft gebaut
IText: bearbeiteter zVg-Text Bilder: zVg
n rund 20 Jahren haben Regula und omas Dübendorfer aus dem anfangs sehr renovationsbedürftigen Gebäude des Hotels Bellevue in Interlaken ein beachtliches 4-Sterne-Haus gemacht. Heute bietet das Bellevue 38 Zimmer in verschiedenen Grössen und Kategorien, ein Appartement und das Riverhouse direkt an der Aare. Vervollständigt wird das Angebot mit der Alplodge, die 22 Zimmer für eher budgetorientierte Gäste bietet.
Zum Familienunternehmen gehört auch der Goldene Anker, das erst kürzlich erworben wurde. Ein grosser Teil dieses geschätzten Kulturlokals wurde abgebrochen und wieder aufgebaut. Mit einer völlig neuen Planung konnten elf neue Bellevue-Loft-Zimmer im 4-Sterne-Bereich mit direktem Blick auf die Jungfrau realisiert werden. Zudem wird auch die Alplodge um neun Zimmer erweitert. Es entstehen aber nicht nur neue Zimmer, der Anker bekommt ein neues, attraktives Gartenrestaurant mit rund hundert Sitzplätzen.

Die Ära «Goldener Anker» geht weiter
Dem Kult- und Kulturlokal «Goldener Anker» wird von Regula und omas Dübendorfer neues Leben eingehaucht. Sie wissen um die Bedeutung des Lokals für die einheimische Bevölkerung. Denn der «Goldene Anker» ist nicht nur ein Restaurant. Hier haben viele internationale Sänger und Bands – u. a. Shaggy, e Wailers, Jimmy Cli , Toots & the Maytals – und lokale Künstler gespielt und das Haus zum Beben gebracht.
Neue Perspektiven
Seit gut einem Jahr ziehen auch Sohn Timotheus Dübendorfer und seine Frau Nadine im Familienbetrieb Bellevue & Alplodge mit. So wurde aus dem Umbau- ein Zukunftsprojekt, eine Pespektive für die nachfolgende Generation. Das bisherige Boutique Hotel Garni wird um ein Restaurant ergänzt. So können Gäste direkt im Haus essen und bei Seminaren und anderen Anlässen ist das Restaurantangebot ein Vorteil. Bis das Projekt x fertig realisiert ist, für welches ein Budget im höheren einstelligen Millionenbereich vorgesehen ist, dauert es noch rund ein Jahr.

Alplodge Aussenansicht.
Jens Massem ist der neue Küchenchef im Deltapark Vitalresort

Jens Massem ist seit dem 1. März 2022 als Küchenchef für die Restaurants Delta, Delta Gourmet, Deltaverde ai Cuisine und das Hotelrestaurant des Deltapark Vitalresorts in Gwatt verantwortlich.
Der 35-Jährige folgt auf Stefan Prieler, der das 4-Sterne-Superior-Hotel nach knapp vier Jahren verlässt.
Text: bearbeiteter zVg-Text Bilder: Romel Janeski
Seit Anfang März werden die Gäste des Deltapark Vitalresorts unter der Leitung des neuen Küchenchefs Jens Massem verköstigt. Der gebürtige Deutsche übernimmt die Verantwortung für den gesamten Kulinarik-Bereich: das Restaurant Delta Gourmet, das Deltaverde ai Cuisine, das A-la-carte-Restaurant Delta sowie das Hotelrestaurant. Massem ist Chefkoch mit eidgenössischem Fachausweis, Berufsbildner und hat über zehn Jahre Berufserfahrung in der Schweiz und Deutschland.
Zuletzt war er in Interlaken im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa als Senior Sous-Chef des Restaurants La Terrasse (16 GaultMillau-Punkte) und anschliessend über zwei Jahre im Congress Centre Kursaal Interlaken als Chef de Cuisine tätig.
Frische und Leichtigkeit
Die Verköstigung durch seine Küche zeichnet sich durch viel Frische und Leichtigkeit aus. Dabei richtet er seinen Fokus auf regionale Produkte und frische Kräuter mit Ein üssen aus der vitalen Vollwertkost.
Jens Massem.


Dazu sagt Massem: «Mir ist ein regelmässiger Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit den Produzenten und Lieferanten wichtig – somit kann ich sowohl dem Lebensmittel als auch dem Produzenten den verdienten Respekt zollen.»
Gourmetküche weiter ausbauen Jens Massem folgt auf Stefan Prieler, der nach knapp vier Jahren das Deltapark Vitalresort verlässt, um sich einer neuen Herausforderung in seiner Heimat Österreich zu widmen. Prieler war massgebend am Erfolg des Restaurantkonzeptes des Hotels beteiligt: Im Juni 2020 wurde das Restaurant Delta Gourmet unter seiner Leitung mit 16 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet.
Das Deltapark Vitalresort setzt auch zukünftig auf Gourmetküche, wie der Hoteldirektor Mirco Plozza sagt: «Jens Massem bringt die nötige Expertise mit, um den Gourmetbereich weiterzuentwickeln, den wir mit viel Sorgfalt in den letzten Jahren aufgebaut haben.»



Stefan Prieler.
Deltapark Vitalresort Gwatt.
Anzeige
«Sonder-BAR»
Eine etwas andere Presseschau
Text: Hilmar Gernet
Schweiz: mehr Köche ins Parlament Der bekannte Wirtschaftsprofessor und Glücksforscher Bruno S. Frey hat in einem grossen «Blick»Interview (7. 3 2022) über wesentliche Zukunftsfragen gesprochen. Die Politik werde in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, so Frey. Das Problem aber sei, dass immer weniger Berufsleute und dafür immer mehr Akademiker im Parlament sitzen. «Im Parlament sitzen keine Schreinermeister und Elektroinstallateure, sondern vor allem studierte Juristen und Lobbyisten.»
Diese Entwicklung trage dazu bei, dass die Distanz zu den Stimmberechtigten wachse. Frey fordert deshalb, dass die Politik sich wieder mehr den Problemen der Durchschnittsbürger widme. Er schlägt vor, neben dem National und dem Ständerat eine neue dritte Kammer zu schaffen. Die Mitglieder dieser dritten Kammer, zusammengesetzt aus «normalen Bürgern», sollen per Los bestimmt werden.
In der dritten Kammer, die ebenfalls Gesetzgebungskompetenz hätte, sollten die Anliegen der «Tramfahrerin, des Kochs, des Coiffeurs» vertreten werden. «Das garantiert Vielfalt, es garantiert gesunden Menschenverstand, es durchbricht Seilschaften und Klüngeleien.»
Teneriffa: siebter Kreis der Hölle
Die «Göttliche Komödie» (Divina Commedia) ist das Hauptwerk des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265–1321). Sie entstand während der Jahre seines Exils und wurde wahrscheinlich um 1307 begonnen und erst kurze Zeit vor seinem Tod vollendet. Sie beschreibt Hölle, Fegefeuer und Paradies und gilt als eine der bedeutendsten Dichtungen der italienischen Literatur und eines der größten Werke der Weltliteratur. Die zeitlose Komödie inspiriert Autoren und Journalisten bis heute in allerlei Kontexten immer wieder.
Jüngst erinnerte sich ein Journalist in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (3. 3 2022) in einem Artikel über Teneriffas Tourismus – «Das Ende der Vergänglichkeit» – an die Komödie. Im wohlwollenden Artikel zu den positiven Entwicklungen, in denen sich die Kanareninsel «allmählich besinnt auf ihre wahren Schätze», wurde ein gegenwärtiger Kreis der DanteHölle auf Teneriffa beschrieben:
«In Orten wie L.C. oder P.d.l.A. bewegen sich die Herren prinzipiell oben ohne trozt schauderhaft tätowierter Plauzen und begrüssen den jungen Tag am liebsten mit einem frischen Bier. Die Damen interessieren sich schon lange nicht mehr für Äusserlichkeiten, erst recht nicht für die eigenen (…) Es ist der siebte Höllenkreis des Massentourismus aus Irish Pubs, Table Dance, Fast Food, Pizza, Pasta, Steaks und Schnapsläden, die als Supermärkte getarnt sind. Jeder scheint den Kampf gegen die Hässlichkeit aufgegeben zu haben, weil er ohnehin hoffnungslos ist – und wir fragen uns fassungslos, wie der Mensch ein solches Los für ein bisschen Sonne und Strand nur so breitwillig in Kauf nehmen kann. Doch der erste Eindruck täuscht, Teneriffa gibt sich nicht geschlagen, sondern wandelt sich zum Besseren.»
Kiew: Frühstück im Hotel im Krieg Reisekolumnisten, in friedlichen Zeiten sind die besseren anregende Philosophen des Reisens, sind im Krieg überfordert. Zeitungsspalten müssen dennoch gefüllt werden. Eine Kolumnistin versuchte in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (3. 3. 2022) den Spagat zwischen «gutem Leben und Leid» im Ukrainekrieg.
Sie blicke auf die TVBilder aus Kiew, «da haben wir Bier getrunken, dort waren wir einkaufen». Dann erinnert sie sich an das Frühstücksbuffet im Hotel Ukrajina. Von der Dachterrasse blicke man auf den MaidanPlatz und dem «goldenen Erzengel auf seiner Säule direkt in den Rücken». Im Frühstücksraum mit «steifer Staatsbankettatmosphäre» gab es «zwei Arten von Frühstück» zur Auswahl: «Mehr Richtung Heringsalat oder mehr Richtung Erdbeersahnebisquitrolle, dazwischen gibt es nichts. Das Hotel Ukrajina ist günstig, zentral und empfehlenswert, wenn nicht gerade Krieg ist.»
Die Situation ist unerträglich, so versucht sie, sich irgendwie philosophisch zu arrangieren: «Reisen gibt einem ein vollständigeres Bild von der Welt, und es ist einem auch nicht mehr so viel egal. Das mag stellenweise unbequemer sein, als Konflikte in den Nachrichten einfach durchzuwinken (…) Das gute Leben und das Leid sind kaum zu trennen. Nun stehen wieder Barrikaden rund um Kiew, und man wünscht sich nur, dass sie halten.» – Ein Kolumne aus einer anderen Welt, einer Welt, die – nicht nur in Kiew – nicht mehr zurückkehrt.
Genf / London: Oligarchen zu Hause statt im Restaurant «Ich kann nicht mal einen Restaurantbesuch bezahlen. Ich muss zu Hause essen und bin praktisch unter Hausarrest gestellt.» So beklagte sich der in London domizilierte Oligarch und ZwölffachM illiardär Michail Fridman (Forbes). Es fehle ihm das Geld für ein Taxi, um Essen zu kaufen. Er erwartet Unterstützung durch die britischen Behörden. Sie sollten ihm Geld geben, auch wenn es nur «sehr begrenzte Mittel sein werden, gemessen an den Lebenshaltungskosten in London». (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. 3. 2022).
Ähnliche Probleme hat Alexander Pumpianski, schweizerischrussischer Doppelbürger, der bei Genf lebt. Er steht auf der rund 900 Namen umfassenden Sanktionsliste des Bundesrats. In den Reichstenlisten taucht er als «Erbe» seines Vaters Dimitri auf, eines milliardenschweren, russischen Stahlmagnaten. Auch wenn die Pumpianskis ein «unauffälligeres Leben als andere Oligarchenfamilien» führen, sieht Alexander ein erstes Problem am Horizont aufsteigen: die Einkäufe. «Es besteht die Gefahr, dass man nach Alternativen suchen muss, nur um in die Migros zu gehen.» Er habe keinen Zugriff mehr auf seine Bankkonten. Als Alternative bliebe allenfalls eine teilweise Selbstversorgung auf seinem zweiten Weingut, das er vor Kurzem im französischen Jura erworben hat. Das andere liegt im Languedoc. (Der Bund, 29. 3 2022)
Wege aus dem Dschungel Arbeitsrecht
Es gehört zum guten Ton, über die vielen Vorschriften zu schimpfen. An jeder Ecke droht ein Prozess. Erfahrene, prozessierende Anwälte aber wissen: Die Kunst ist nicht, einen Prozess zu gewinnen, sondern ihn zu vermeiden. Im beruflichen Alltag wäre man auf eine klare Rechtslage angewiesen. Hier lesen Sie, weshalb das nicht so ist.
Text: Martin Schwegler Bild: zVg
Im Arbeitsrecht für Hotellerie und Gastronomie gibt es drei wesentliche Rechtsquellen: das Obligationenrecht (OR) als Basis, den LandesGesamtarbeitsvertrag (LGAV) als branchenspezifische Ergänzung dazu und das öffentlichrechtliche Arbeitsgesetz (ArG). Es herrscht allerdings keine klare Ordnung, wo sich was findet. Gewisse Themen sind an mehreren Orten geregelt – für NichtJuristen ein undurchdringlicher Dschungel.
Ein konkretes Beispiel: Im LGAV wird beispielsweise die Probezeit anders als im OR geregelt. Die Norm aber, wonach sich Krankheit in der Probezeit verlängernd auf die Kündigungsfrist auswirkt, steht nur im OR. Im LGAV wird definiert, wie viele Ruhetage zu gewähren sind und dass ein Ruhetag 24 Stunden im Anschluss an die Nachtruhe umfassen muss. Die Dauer der Nachtruhe muss man aber im Arbeitsgesetz nachschlagen. Ohne professionelle juristische Erfahrung hat man als Laie daher keine Chance, sich zurechtzufinden. Man ist auf Fachpersonen angewiesen. Aber auch die Fachpersonen, also die Juristen, kommen oft an ihre Grenzen.
Fristlos oder doch nicht fristlos?
Man stelle sich vor, eine Mitarbeiterin betritt in ihrer Freizeit betrunken und zu leicht bekleidet die hoteleigene Wellnessanlage und belästigt Gäste. Sofort stellt sich die Frage: Kann man die junge Dame fristlos entlassen? Im Kontakt mit dem Rechtsdienst des Verbandes kriegt man die Antwort, dass es eventuell nicht reicht, man müsse verwarnen. Ein bekannter Anwalt meint hingegen, dass dies seiner Ansicht nach ein Grund für eine fristlose Kündigung ist, letztlich aber müsse dies ein Gericht beurteilen. Nebenbei erwähnt, manchmal ist eine fristlose Kündigung gar nicht intelligent. Gerade wenn noch viele Überstunden und Ruhetageguthaben vorhanden sind, sucht man besser den Weg über eine Aufhebungsvereinbarung.
Unbestimmte Rechtsbegriffe sind zu interpretieren
Woher kommt es, dass auf klare Fragen häufig keine rechtlich klaren Antworten gegeben werden können?
Es gibt im Wesentlichen zwei Ursachen: Zum einen verwendet das Gesetz zahlreiche sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe. Zum anderen sind die gesetz

Martin Schwegler, lic. iur. /RA
Der Autor dieses Beitrages ist seit 1994 Dozent für Arbeitsrecht an der SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern. Hauptberuflich ist er in der von ihm gegründeten Anwaltskanzlei Schwegler & Partner Rechtsanwälte und Notare AG in Menznau (LU) tätig. 2020 hat er die correct.ch ag gegründet, welche arbeits rechtliche Dienstleistungen für die Hotel- und Gastrobranche anbietet. Ein Produkt der Firma ist correctTime, eine Zeiterfassung, welche nach L-GAV und ArG korrekt rechnet.
lichen Normen häu g nicht so vollständig und di erenziert, dass sie auf jeden Sachverhalt des Lebens ohne Weiteres anwendbar sind.
Das Obligationenrecht regelt in Art. 337 OR die fristlose Kündigung. Dort steht, dass aus «wichtigen Gründen» jederzeit fristlos das Anstellungsverhältnis aufgelöst werden kann. Als wichtiger Grund gilt «jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf». Schliesslich soll der Richter über das Vorhandensein solcher Umstände «nach seinem Ermessen» entscheiden.
Es menschelt im Gericht
Dieser Art. 337 OR strotzt nur so von unbestimmten Rechtsbegri en. Niemand kann klar sagen, wann es für eine fristlose Kündigung reicht und wann eben nicht. Weil Richterinnen und Richter auch nur Menschen sind, menschelt es am Gericht sehr. Je nach Erfahrungshintergrund oder politischer Einstellung, vielleicht auch sogar nur wegen Sympathie oder Antipathie gegenüber Parteien oder deren Rechtsvertreter, kann es so oder anders rauskommen.
Die Gesetzesordnung kann gar nicht so geschrieben sein, dass darin für jeden Fall eine eindeutige Antwort gefunden werden kann. Die Gesetze enthalten deshalb zwangsläu g nur Regeln, welche dann auf den Einzelfall angewandt werden müssen. Ihre Anwendung führt dann ebenso zwangsläu g dazu, dass ähnliche Fälle hier so und anderswo anders entschieden werden.
Gesetze sind sehr oft lückenhaft
Wie wird der Anspruch auf Ruhetage nach Art. 16 L-GAV und deren Bezug berechnet, wenn ein Mitarbeiter während dreier Monate zu 100 Prozent arbeitsunfähig war, danach zu 30 Prozent wieder einstieg, nach einem Monat auf 50 Prozent erhöhte und erst nach drei weiteren Monaten wieder voll arbeitsfähig war?
Wer den Art. 16 L-GAV liest, ndet die Antwort sicher nicht. Auch der entsprechende juristische Kommentar schweigt dazu. Weil die Ruhetage im Arbeitsgesetz erwähnt sind, ndet man dort vielleicht einen Hinweis. Aber auch da: Fehlanzeige. Der Ruhetageanspruch ist grundsätzlich klar, mindestens zwei Tage pro Woche. Aber wie viele Ruhetage werden faktisch bezogen, wenn der Mitarbeiter an fünf Halbtagen pro Woche arbeitet? Eigentlich hat er ja dann fünf Halbtage plus
Martin Schwegler.
zwei ganze Tage frei gehabt. Können diese so bezogenen Ruhetage allenfalls mit einem Saldo aus früherer Zeit oder in der Zukunft verrechnet werden? Fragen über Fragen.
Kommentare sind hilfreich, aber keine Gesetze Weil die Gesetzestexte lückenhaft sind, weil viele unbestimmte Rechtsbegri e interpretiert werden müssen, werden oft juristische Kommentare verfasst. Gerade für das Arbeitsrecht gibt es viele solche dicken Bücher, in denen man die Details nachschlagen kann.
Arbeiten mit Schutzstatus S
Sobald aber in einem GAV vom OR abweichende Normen enthalten sind, helfen die klassischen ORKommentare nicht mehr weiter. In der Hotellerie und im Gastgewerbe haben wir immerhin die relativ gute Ausgangslage, dass in der Onlineversion des L-GAV Kommentare zu den einzelnen Artikeln enthalten sind, welche Hinweise für die Praxisanwendung geben. Allerdings sind auch diese mit Vorsicht zu geniessen: Letztlich ist der Kommentar nicht mehr als eine Meinung von Fachpersonen. Die Gerichte sind daran nicht gebunden.
Die aus der Ukraine in die Schweiz fliehenden Menschen werden vorerst mit dem Schutzstatus S hier leben können. Das erlaubt ihnen, während ihres Aufenthalts zu arbeiten, obwohl sie aus einem Nicht-EU-Land stammen. Denn Art. 30 Abs. 1 Bst. l des Ausländer- und Integrations gesetzes (AIG) erlaubt dies grundsätzlich. Es sind dabei die Vorgaben der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) einzuhalten.
Mindestlöhne sind einzuhalten
Eine vorübergehende Erwerbstätigkeit wird bewilligt, wenn es die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage erlaubt, wenn keine inländischen Arbeitskräfte gefunden werden können und wenn die branchenüblichen Anstellungsbedingungen eingehalten werden. Für die Hotellerie und Gastronomie bedeutet dies auch, dass die Mindestlöhne nach Art. 10 L-GAV eingehalten werden müssen. Dieser liegt für nicht in der Branche ausgebildete Arbeitskräfte bei 3477 CHF monatlich zuzüglich Anteil 13. Monatslohn.
In einer sogenannten Einführungszeit von maximal zwölf Monaten kann dieser Lohn um acht Prozent, also 278 CHF, unterschritten werden. Der absolute Mindestlohn beträgt somit 3199 CHF monatlich. Auf den Stundenlohn umgerechnet ergibt dies 17.52 CHF Basislohn. Darauf sind je nach Umständen noch die Ferien (10,65 %) und die Feiertagsentschädigungen (2,27 %) und immer der Anteil 13. Monatslohn sowohl auf dem Basislohn wie auf den Entschädigungen geschuldet.
Bewilligung der Behörden ist zwingend Wenn nun die Person, welche man anzustellen gedenkt, über eine einschlägige berufliche Ausbildung im Heimatland verfügt, so ist der Mindestlohn der höheren Kategorie geschuldet. Die Einordnung kann im Einzelfall schwierig sein. Eine zweijährige Ausbildung im Heimatland (Ukraine) entspricht dem Berufsattest und eine dreijährige Ausbildung dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Bevor man Menschen aus der Ukraine anstellen darf, muss der Arbeitgeber um eine Bewilligung bei der zuständigen kantonalen Behörde nachsuchen, ansonsten macht er sich strafbar.
Martin Schwegler, Rechtsanwalt
Nachhaltigkeit garantiert Spitzenqualität
Sie sagen: «Nachhaltigkeit scha t Qualität. Davon sind wir überzeugt.» Warum?
Beatrice Rast: Gerade beim Anbau von Ka ee und bei dessen Verarbeitung ist Nachhaltigkeit ein entscheidender Qualitätsfaktor. Denn die gewünschte Spitzenqualität kann langfristig nur dann gewährleistet werden, wenn auf die klimatischen und sozialen Veränderungen Rücksicht genommen wird. Die Investition in eine nachhaltige Produktion und ein partnerschaftlicher Umgang mit allen Leistungspartnern sind dabei elementar. Als Ka eerösterei sind wir überzeugt: Um Spitzenqualität in der Ka eeproduktion zu erreichen und zu erhalten, gehen ökologische und soziale Verantwortung Hand in Hand.
Was bedeutet dies für Ihren Ka eeEinkauf?
Über faire Einkaufspreise muss den Ka eeproduzenten und deren Mitarbeitenden ein gutes Einkommen ermöglicht werden. Die Ka eebauern müssen überzeugt sein, dass sich eine nachhaltig ausgerichtete Produktion mit Fokus auf höchste Qualität auszahlt. Es muss sich lohnen, Ka ee sorgfältig und ökologisch anzubauen, ohne die natürlichen Ressourcen auszubeuten und dafür auf eine intensive und kurzfristig auf die Maximierung ausgerichtete Produktion zu verzichten.
Sie stehen im direkten Austausch mit Ihren Ka eeproduzenten. Warum orientieren Sie sich nicht nur an den ausgewiesenen Zerti zierungen?
Nachhaltigkeitszerti kate sind Eckwerte für die Überprüfung der Einhaltung der geforderten Standards – und sollten für alle zugänglich gemacht werden. Auch für kleine Ka eefarmen ohne grosses Budget. Viele von ihnen erfüllen alle Zerti zierungsstandards, können sich aber die Kosten für den Zerti zierungsaufwand nicht leisten. Zertizierungen ersetzen nicht die langjährigen, direkten, partnerschaftlichen Beziehungen zu den Ka eeproduzenten und vor allem nicht die lückenlose Informationskette.
Nachhaltigkeit beginnt in den Ursprungsländern des Ka ees … … endet aber nicht mit der Ernte, sondern muss bis zur Röstung und zur Ka eezubereitung ganz am Schluss die gesamte Wertschöpfungskette umfassen. Damit auch ein Hotelier und Gastronom sich mit seinem Unternehmen über eine konsequente Nachhaltigkeit und einen ebenso konsequenten Qualitätsanspruch im Ka eekonzept positionieren kann.
Wie setzt Rast Ka ee im Röstalltag auf Nachhaltigkeit?
Wir streben nach einer ganzheitlichen Nachhaltigkeit im Umgang mit den Res-
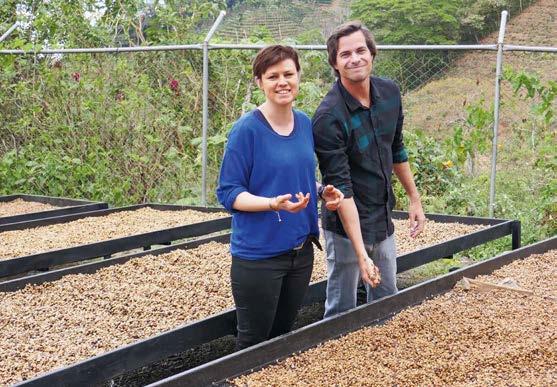
Im persönlichen Kontakt mit den Produzenten: Beatrice Rast auf der Kaffeeplantage
Sonora in Costa Rica mit Plantagenbesitzer Diego Guardia.
sourcen und achten genauso auf die Energieherkunft wie auf ihren Verbrauch, wir reduzieren das Verpackungsmaterial und lassen aus den beim Rösten anfallenden Ka eehäutchen Biogas gewinnen.
Wie sieht Ihre Vision einer nachhaltigen Gourmetrösterei aus?
Zusammen mit der Stiftung myclimate haben wir unser Unternehmen in allen Fra gen der Nachhaltigkeit entlang der gesamten Produktionskette analysiert. Zusätzlich zu unseren betriebsinternen Massnahmen unterstützen wir ganz konkrete Nachhaltigkeitsprojekte direkt vor Ort bei unseren Ka eepartnern. Ein gutes Beispiel dafür sind unsere Partner in Brasilien: Die Fazenda Samambaia will bis 2025 CO2-neutral Ka ee anbauen und engagiert sich mit grosser Kraft für dieses Ziel. Ebenso die Balehonnur-Farm in Indien. Ihr Besitzer Jacob Mammen sah sich aus Kostengründen gezwungen, die Anscha ung einer automatischen Maschine für die Ka eesortierung zu prüfen und damit 21 Mitarbeitende aus den umliegenden Dörfern einzusparen. Dank einem Preisaufschlag auf den Rohka ee kann er die Mitarbeitenden nun weiterbeschäftigen. Wir suchen verantwortungsvolle Partner, welche die ökologische und soziale Nachhaltigkeit glaubhaft leben.
Die Expertin
Beatrice Rast ist zu sam men mit ihrer Schwester Evelyne Rast Inhaberin und Mitglied der Geschäftsleitung der Gourmet Rösterei Rast Kaffee mit Sitz in Ebikon bei Luzern.
rast.ch
Das Berner Oberland erweist sich als Schlaraffenland in ungeahnter Fülle: Die nachhaltig aufgezogenen Shrimps stammen von einem Emmentaler Bauernhof.

Historische Grandezza mit modernem Twist
Das Victoria-Jungfrau in Interlaken, die «Grande Dame» der Schweizer Luxushotellerie, deckt zur Rundumerneuerung auf: mit Kindervilla und neuen Restaurants – wie dem Radius.
Und es gibt neue, lokal-radikale Speisekarten mit mehr veganen Köstlichkeiten.
Text: Daniela Dambach Bilder: Tina Sturzenegger, Zürich, zVg
Stefan Beer steht draussen vor dem imposanten Prachtbau des Victoria-Jungfrau Grand Hotels & Spa und blickt der Sonne entgegen, die sein weisses Kochhemd leuchten lässt. Die Rasen äche zu seinen Füssen wird auf die Sommersaison hin in eine Terrasse für sonnen- und genusshungrige Gäste ver wandelt: Diese erweitert das Restaurant La Terrasse Brasserie, das seit Ende 2021 Brasserie-Klassiker mit modernem Twist bietet.
«Menü vo hie»
Dies ist nur eine der zahlreichen Neuerungen, die derzeit ein Werkzeugkasten hier und eine Baumaschine da erahnen lassen, wenn man durch die noblen Hallen mit 150-jähriger Geschichte schreitet: So sind auch die Räumlichkeiten für das neue Gourmetrestaurant Radius by Stefan Beer im Entstehen. Hier wird der Executive Küchenchef die Erfolgsstory seines «Menü vo hie» ab Frühsommer 2022 fortführen, das er im ehemaligen Fine-Dining-Restaurant La Terrasse bereits etabliert hatte.

Geerntet vor den Toren des Grandhotels: Aus dem eigenen Garten des VictoriaJungfraus stammen Kräuter, Beeren und Nüsse, die Stefan Beer in seine lukullischen Genüsse verwandelt.

Was in der Region saisonal verfügbar ist, ergibt das Menü: So kreiert Stefan Beer beispielsweise Berner Oberländer Kalb nach Szegediner Art.
«Ganz verkehrt nde ich es, für vegane Menüs zu versuchen, Fleisch zu imitieren.»
Stefan Beer, Executive Küchenchef Victoria-Jungfrau

Doppelt lokal: Das köstliche, vegane Gericht Fredo, zubereitet mit Keimlingen aus Uetendorf, Stangensellerie und Apfel, ist auf in Wilderswil getöpferten Tellern angerichtet.


Wissen, wo das Wahre keimt: Stefan Beer pflegt persönliche Beziehungen zu Fischern, Käsern und Bauern, welche die erlesenen Zutaten für seine Gerichte produzieren, nicht selten extra für ihn.
«Ich möchte meinen Gästen eine emotionale Küche bieten, die berührt, indem sie Gefühle weckt.» Und das erreicht Stefan Beer mit Zutaten, deren Geschichten er erzählen kann – bald in seinem neuen Gourmetrestaurant.
«Ich fokussiere mich bei der Zutatensuche weiterhin auf das Tal zwischen den zwei Seen», sagt der Chefkoch und kneift seine Augen zusammen – wegen der grellen Kraft der Frühlingssonnenstrahlen. Kein Auge zu drückt er hingegen, wenn es um die Herkunft der Produkte geht, aus denen er seine Speisen kreiert. Er lässt seinen Blick schweifen, auf die Interlakner Flaniermeile und die wolkenkratzenden Felswände. Nein, die Zutaten stammen nicht gerade aus Sichtweite: Im Umkreis von maximal 50 Kilometern wurzeln, gedeihen, weiden, blühen und schwimmen die Rohsto e, denen jene Ra nesse entwächst, für die ihn GaultMillau jüngst mit 17 Punkten auszeichnete – einem Punkt mehr als im vorherigen Rating.
Aha-Erlebnisse
50 und keinen Kilometer mehr. Die Spielregel für sein Gourmetkonzept hat der Spitzenkoch selbst aufgestellt: «Mich so radikal im Radius einzuschränken, gibt mir Inspiration», erläutert er. «Es lässt mir folglich keine Wahl, strikt saisonal zu kochen.» Fragt ein Gast im nie enden wollenden Spätwinter nach Spargeln, scheut sich Stefan Beer nicht davor, am Tisch zu erklären, dass jene aus Belp noch nicht Saison haben.
«Solche Aha-Erlebnisse sensibilisieren die Gäste dafür, was Nachhaltigkeit tatsächlich bedeutet: Manches ist noch nicht oder nicht mehr verfügbar.» Überdies verleihe es dem Genuss Echtheit: «Es würde sich nicht stimmig anfühlen, auf einen von Bergen umrahmten See zu blicken und dazu Meerestiere aus Südafrika zu essen. Oder?»
Produkte aus der Schweiz? Das wäre dem Küchenchef eben nicht wirklich genug «vo hie». Über Jahre hinweg hat er die Gegend durchstreift und Einheimischen Insider-Adressen entlockt, um Lieferanten aufzuspüren, die seine Philosophie mittragen. Die Geschichten, die er bei ihnen erlebte, erzählt er seinen Gästen, denn mittlerweile ist er allen, die Erlesenes zu seinem Menü «vo hie» beisteuern, begegnet. So schipperte er mit Fischer Marco Gurtner über den Brienzersee, um einen Hecht wirklich an der Angel zu haben. Oder balancierte im nahgelegenen Feld von Peter Zwahlen zuoberst auf der Holzleiter, um den rotbackigsten Apfel zu p ücken. Oder spazierte mit der «Trü elfrau» Christina Mader aus Bönigen und ihrer vierbeinigen «Schnüffelnase» Camina durch die Wälder, auf der Suche nach dem schwarzen Gold.
Radikal-lokal
Eine der Partnerschaften ist jene mit Espro in Uetendorf: Gerade feilt er an einem Gericht, für das sämtliche Zutaten wie Microgreens, Sprossen, Blüten und Pilze aus dem Familienbetrieb stammen. Unter dem Motto «Was noch nicht hier wächst, wird hier angep anzt» experimentiert Frédéric Amstutz-von Arx mit dem Anbau von Ingwerknollen, die er speziell für Stefan Beer in der nährsto reichen Erde vergräbt. Diese Speise kredenzt Stefan Beer in Tellern und Schalen, die eine Künstlerin aus Wilderswil für ihn getöpfert hat. «Das macht es im eigentlichen Sinn doppelt lokal», kommentiert er mit Freude, die ihm ins Gesicht geschrieben steht.
Dass gerade Stefan Beer auf radikal-lokal setzt, ist bemerkenswert, sind seine Kochkünste doch von internationalen Ein üssen geprägt. Mit 29 Jahren zog es ihn die Ferne, wo er an Stationen wie Shanghai, Bangkok, Singapur oder Dubai Halt an den hochkarätigsten Herden machte. Nach zehn Jahren in den wummernden Weltmetropolen, in denen seine Restaurants viele Gastro -Bestenlisten anführten, kehrte er 2016 mit seiner Frau und seinen zwei Kindern zurück in die beschauliche Heimat. Zurück in ein Engagement im 5-Sterne-Superior-Haus Victoria-Jungfrau, in die Region, wo er aufgewachsen ist. Sein Vater, der aus Spiez stammt, führte einst mit seiner Mutter ein kleines Dorfrestaurant. Nicht zuletzt deshalb war für Stefan Beer das Berufsziel früh klar. Bereits kurz nach seiner Kochlehre gewann er internationale Wettbewerbe wie den Culinary World Cup.
Nahe an der Wahrheit bleiben Damals, als junger Koch, habe er gedacht: Je komplizierter, desto besser. Diese Denition von vermeintlicher Kreativität war beein usst durch seine Ausbildungsjahre. Später erlangte er die Erkenntnis, dass es nicht 30 verschiedene Zutaten braucht für einen Gaumenschmaus, ganz im Gegenteil. Das emp nde er als gesucht, gekünstelt. Einer seiner Lehrmeister ö nete ihm die Augen: «Stefan, du kannst ein Lamm rollen, drehen und schneiden – aber es einfach perfekt braten, das kannst du nicht», klingen die aufschlussreichen Worte bis heute in seinen Ohren nach.
Heute setzt er auf qualitativ hochstehendes Lamm aus der nächsten Umgebung, so perfekt gelagert und gebraten wie nur möglich und vollendet mit dem, was es ins beste Licht rückt. Es gehe ihm nicht mehr darum, das Lamm zu marinieren, zu stopfen oder zu füllen. Er will es möglichst nahe am Ursprung belassen. «Bei der Wahrheit zu bleiben», nennt er diesen eigenen Anspruch.
Kreation statt Fusion
Die Auslandsstationen haben ihn geprägt: «Doch anders, als man vielleicht denkt», sagt er schmunzelnd. In der Ferne habe er gelernt, dass Fusion für ihn nicht funktioniert: Er will freigeistig jenes kombinieren, was miteinander wächst, am selben Ort. «Wenn ich Äpfel, P aumen und Honig habe, ergibt sich daraus intuitiv, fast wie von allein, eine Kreation.»
Völlig anders gestaltet es sich bei der veganen Zubereitung: Das Kochen erfordert eine andere Denk- und Herangehensweise: «Wie mache ich es cremig?» «Wie luftig?» «Wie binde ich es – und muss ich das überhaupt?» Diese forschenden Fragen hat Stefan Beer exzessiv ergründet. Und er hat eine Antwort gefunden: Sein durchdachtes Sechs-Gänge-Menü tischt er auch als vegane Version auf.
Exzessiv experimentiert
Das Vegane ist bei Stefan Beer gewissermassen eine Lorbeere des Lockdowns. Während dieser Zeit hat sich der Spitzenkoch exzessiv mit der Kochkunst beschäftigt, die auf rein p anzliche Ingredienzen setzt. Gäste, die Veganes mögen, sind es gewohnt, im Restaurant eine – im wahrsten Sinn – abgespeckte Variante des Menüs vorgesetzt zu bekommen. Bei Stefan Beer und Küchenchef Michael Althaus handelt sich es aber um eine ausgetüftelte Speiseabfolge, die dem Fleisch- oder Fischmenü in ihrer Exzellenz in nichts nachsteht. «Ganz verkehrt nde ich es, beim veganen Menü zu versuchen, Fleisch oder Fisch zu imitieren», stellt Stefan Beer klar. Von Fleischersatz hält er nichts: «Das wäre bloss Plan B, weil man das Original verschmäht.»
Experimentieren ist wichtig im Team um Stefan Beer, so wurde zum Beispiel aus einheimischen Linsen «Peaso» anstelle von «Miso», welches aus Kichererbsen gemacht werden würde. Allein deren Fermen-
Aus dem Menü «vo hie»: eine Komposition aus Kirchdorfer Lauch, Bödeli-Birnen und Ueten dorfer Kapuzinerkresse.
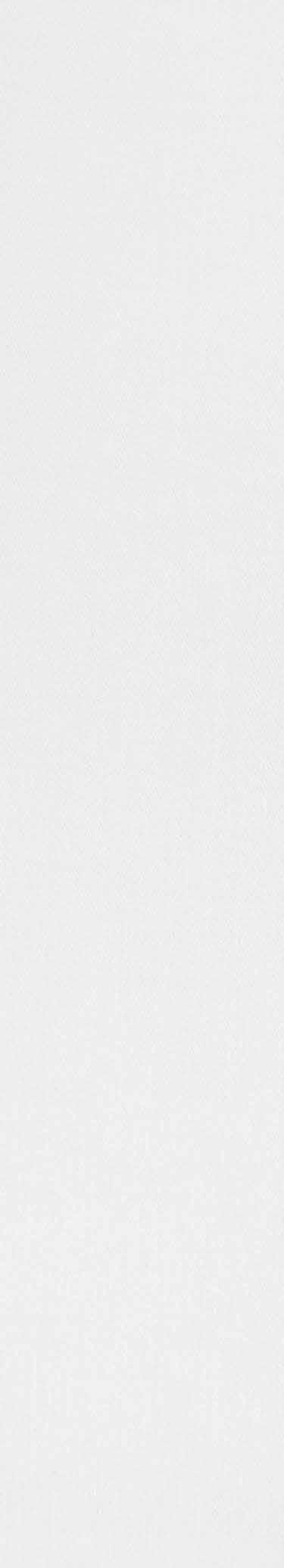



Eingespieltes Team im Dienste des Genusses: Pierre Cardona, Executive Pastry Chef, Stefan Beer, Executive Küchenchef, und Michael Althaus, Küchenchef (v. l. n. r.).
Mit 17 GaultMillau-Punkten ausgezeichnete Kochkunst mit überraschungskomponenten begleitet von den besten Tropfen aus der Region. «Ich finde es schön, lokale Winzer und Produzenten zu unterstützen», so Sommelier Torsten Noack.
«Mich für die Rohsto e radikal im Radius einzuschränken, inspiriert mich.»
Stefan Beer, Executive Küchenchef Victoria-Jungfrau
Das 5-SterneSuperior-Haus befindet sich im Wandel: Nicht nur das ehemalige La Terrasse erstrahlt in neuem Brasserie-Glanz, der die altbewährte Grandezza dennoch innehat, auch die Zimmer und Suiten sind sanft modernisiert. Weitere Infos und Reservation: victoria-jungfrau.ch.



Machen Gäste wunschlos glücklich: Gastgeber Gennaro d’Onofrio und Chef de Service
Alicja
Sosno.
Appetit auf Authentizität:

In der La Terrasse Brasserie interpretiert das Küchenteam
Schweizer Gerichte und inter nationale BrasserieKlassiker modern, wie die Militär-Käseschnitten, den Victoria’s Burger oder Zürcher «Gschnätzlets».

tation, bei der Küchenchef Michael Althaus federführend war, dauerte drei Monate. «Manchmal macht es irgendwann im Prozess klick, manchmal aber verwerfe ich eine Idee, nachdem ich sie ein Jahr lang emsig verfolgt habe.» Das Gesamtwerk müsse stimmen, sowohl Geschmäcker wie Texturen. Das regt auch Nicht-Veganer an, den einen oder anderen rein p anzlichen Gang zu verköstigen. «Wohl aus Neugierde», mutmasst der 43-Jährige.
Zeitgemässe Aura
Die neue Küche, wo der Executive Chef seine kulinarischen Ideen zu Teller bringt, steht bereit. An den innenarchitektonischen i-Tüpfelchen des neuen Gourmetrestaurants Radius by Stefan Beer feilt das Team noch. Nicht nur daran: «Wir sind dauernd daran, dies zu überdenken und das zu verändern», beschreibt HerzblutHoteldirektor und -Gastgeber Peter Kämpfer den Umbruch. «Es ist eine Gratwanderung, die Grandezza von einst zu bewahren, aber dem Interieur dennoch einen modernen Twist zu verleihen.»
Wer das Parterre verlässt, spürt statt blitzblankem Marmor federnden Teppich unter den Füssen, in den Gängen, wo sich Tür an Tür reiht, hinter denen sich Zimmer und Suiten in neuem Gewand verbergen. Man habe den Räumlichkeiten eine zeitgemässe Aura verliehen: «Aber nicht so, dass man beim Aufwachen nicht mehr weiss, wo man ist», meint Peter Kämpfer lächelnd.
Jedes gehoben-gemütliche Gästezimmer variiert im Grundriss und leicht in den Farbnuancen. Die wohnliche SuperiorSuite beispielsweise ist speziell für Familien konzipiert, die das Victoria-Jungfrau im Wandel zum Resort künftig stärker anspricht: «Das ehemalige Personalhaus verwandeln wir derzeit in eine Kindervilla, in der die Kleinen spielen können», verrät der Hoteldirektor.
Wahrscheinlich, dass auch die Träume ganz «vo hie» sind, wenn man sich in das Kingsize-Bett fallen lässt. Vielleicht wie kunstvoll angerichtete Teller, die wie Ufos über dem sternenklaren Nachthimmel des Berner Oberlands kreisen? Es dauert nur noch wenige Sonnenaufgänge, bis die «Grande Dame» in all ihrer neuen Noblesse erwacht. Gut möglich, dass man dann zwar kurz die Augen zusammenkneift, nicht weil es blendet, sondern um sich zu vergewissern, wie edel sie strahlt.
Schweizer Weinkultur mit Chandra Kurt
Neuenburger Weintradition

Château Auvernier be ndet sich am Neuenburgersee und ist seit über 400 Jahren im Familienbesitz.
Henry Grosjean repräsentiert die 15. Generation dieser traditionsbewussten Schlossfamilie, deren Weine zu den besten der Region zählen. Etwas über 60 Hektaren Reben werden verarbeitet, wobei Chasselas und Pinot Noir die önologische DNA des Gutes sind.
Text: Chandra Kurt Bilder: Christoph Kern
Château d’Auvernier wurde 1603 erbaut und be ndet sich unweit des Ufers des Neuenburgersees im gleichnamigen Ort Auvernier. Fischerei und Weinbau waren hier früher Hauptaktivitäten, inzwischen ist der Weinbau dominant. Über 400 Jahre später entdeckt man auf dem Anwesen zahlreiche Zeugnisse dieser langen Geschichte und wäre da nicht der moderne Degustationsraum, könnte man meinen, sich gerade in einer Zeitzone der Vergangenheit zu be nden.
Château Auvernier ist ein Bijou schweizerischer Weinkultur, das uns auch vor Augen führt, wie weit unsere önologische Geschichte zurückgeht und dass die wichtigsten Reben und Terroirs historisch bedingt oftmals neben Klöstern oder Schlössern angelegt worden sind. In der Weinregion Neuenburg gibt es zahlreiche Schlösser und Klöster zu entdecken, wobei der Ursprung auf das Jahr 998 zurückgeht, als die Cluniazenser Mönche der Abtei von Bevaix die Erlaubnis erhielten, den ersten Weinberg der Region anzup anzen.
Inzwischen ist Neuenburg Teil der Weinbauregion Drei-Seen und macht mit ihren rund 600 Hektaren Reb äche zwei Drittel der Gesamt äche aus. Die Weinberge erstrecken sich entlang dem See von Vaumarcus im Westen über Auvernier bis nach Neuenburg und Cressier im Osten. Hauptsorten sind Chasselas mit etwas über 160 Hektaren für Weissweine und Pinot Noir mit über 330 Hektaren für Rotweine. Die Pinot-Dominanz liegt auf der Hand, zumal Burgund und Neuenburg nur durch das Jura-Massiv getrennt sind. Die Nähe zum Burgund hat natürlich ihren Ein uss, wobei die Region eine eigenständige Interpretation von Pinot Noir vini ziert. Die Pinots Neuenburgs sind von Frische, Finesse, Parfüm, delikater Struktur und einer selbstsicheren Präsenz gezeichnet. Dass sich Pinot Noir hier wohl fühlt, hat mit den kalkhaltigen Böden des Jurasüdfusses, dem gemässigten Klima und der Höhe der Rebberge auf 430 bis 600 Meter über Meer, wie auch mit den markanten Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht zu tun. Im Unterschied zum


Burgund sind die Böden viel jünger und die Regenmenge ist auch nicht vergleichbar. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum es falsch wäre, Neuenburg als «das kleine Burgund» zu bezeichnen – und dass sind die bodenständigen Neuenburger, die wohl Französisch sprechen, aber auch Deutsch, und historisch eine A nität zu den Preussen hegten, bis sie schliesslich 1814 der Schweiz beitraten.
Henry Grosjean ist nicht nur stolzer Schweizer und Schlossherr von Château Auvernier, er ist auch ein stolzer Neuenburger, der die Arbeit seiner Winzerkollegen schätzt. Dass erlebt man bei einem Besuch des Winzerstädtchens Auvernier, wo Weinbau omnipräsent ist und sich zahlreiche jahrhundertalte Winzerhäuser unweit von oder direkt an der Grand-Rue be nden. Zu ihnen gehören unter anderem die Domaine de Montmollin, La Maison Carrée oder Domaine Bouvet-Jabloir.
Spricht man von Neuenburg, spricht man auch von zwei regionalen Signaturweinen –

Der Insider-Tipp
dem trüben Non-Filtré (100 % Chasselas) und dem pinken Œil de Perdrix (100% Pinot Noir). In Neuenburg geht letzterer auf das Jahr 1861 zurück und wird «leider» inzwischen im ganzen Land abgefüllt, da man im Gegensatz zum Non-Filtré vergessen hatte, den Namen zu schützen. Wie auch immer – das Original stammt aus Neuenburg und die Abfüllung von Château d’Auvernier ist eine der besten überhaupt. Es ist ein weiniger Rosé, den man zu Fisch wie auch zu Fleisch geniessen kann und der sogar etwas Reifezeit
Wein aus der Magnumflasche?
Eine Magnumflasche enthält 1,5 Liter Wein, was dem Inhalt von zwei «normalen» Weinflaschen entspricht. Ihre Aura ist jedoch deutlich festlicher. Ein solches Grossformat wirkt an der Bartheke besonders positiv. Auch Weissweine und Schaumweine werden in Grossformate abgefüllt. Wer den Wein nicht gerne aus der Magnum ausschenkt, kann den Inhalt vorher in zwei bis drei schöne Weinkaraffen verteilen. Wichtig ist einfach, dass man vor dem Umgiessen prüft, dass der Wein keinen Korkfehler hat. Falls es vorkommen sollte, dass der Inhalt nicht ganz ausgetrunken ist, kann man ihn beispielsweise in eine kleinere Flasche umfüllen oder einfach den Korken wieder auf die Flasche drücken und diese in die Kälte stellen – hier ist jedoch zu betonen, dass die weinbenetzte Seite des Korkens in die Flasche kommt, da von der anderen Seite her schnell Unreinheiten in den Wein gelangen können.
Bekannte Flaschengrössen:
0,75 l Normalflasche
1,5 l Magnum
3l Doppelmagnum
4,5 l Jeroboam
6l Impérial (Bordeaux) oder Methusalem (Burgund oder Champagner)
9l Salmanazar
12 l Balthasar
Bisher erschienen:
Dekantieren oder nicht?
Naturweine auf die Weinkarte? Was tun bei Korkgeschmack? Was ist die ideale Trinktemperatur?
im Keller verträgt. Er macht rund 40% des Absatzes der Kellerei aus, was für die Wichtigkeit dieser bernsteinfarbenen Spezialität spricht. Seinen Namen verdankt er nicht dem Zufall oder gar dichterischer Freiheit. Seine unverkennbare braun-rötliche Farbe entspricht vielmehr genau jener, die das sonst kastanienbraune Auge eines sterbenden Rebhuhns annimmt. Ältere Weinetiketten von Œil-de-Perdrix-Weinen zeigen oft auch den Blick des waidwunden Flügeltiers, mitunter sogar zusammen mit einem Blutstropfen. Doch diese Kenntnisse scheinen sich verloren zu haben: Auf den heutigen Flaschen ist – wenn überhaupt – meist ein springlebendiges Rebhuhn zu sehen. Die Abfüllung von Auvernier zeigt kein Rebhuhn, sondern das stolze Schloss, das auch auf dem Non-Filtré zu erkennen ist.
https://chateau-auvernier.ch


RAMSEIER
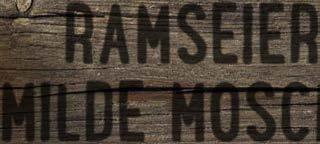


MILDE MOSCHT.
Fruchtig mild
Bester RAMSEIER Apfelwein,
verfeinert mit mildem Apfelsaft
Mit und ohne Alkohol


Anzeige

Das «gute Mahl», eine friedensfördernde Massnahme
Text: Hilmar Gernet Bild: Adobe Stock
Friede ist nicht natur- oder gottgegeben. Das erfahren wir gerade in diesen Zeiten. Friede ist eine «Aufgabe», wie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) meinte. Und er erkannte, dass die Friedensaufgabe mit der allgemeinen Gastlichkeit verbunden ist.
Die Tischgesellschaft diente ihm als Modell für die nicht-kriegerische Bewältigung von Kon ikten. Die beim Gastmahl geltenden Regeln würden einen «Schutzwall» bilden, der den «unvermeidbaren ernstlichen Streit vor dem Umschlag in die endgültige Entzweiung und tätige Auseinandersetzung» – sprich Krieg – bewahren könne.
Das Gastmahl beinhaltet für Kant «auch ohne einen besonderen dazu getro enen Vertrag, eine gewisse Heiligkeit und P icht zur Verschwiegenheit». Vom Tisch nichts hinauszutragen, diene dem «o enen Verkehr der Menschen und ihrer Gedanken».
Clemens Brentano (1778–1842), der romantische Dichter und Gründer der Berliner Tischgesellschaft, beschrieb diese schwärmerisch: «Es gibt etwas grösseres als die Liebe, ich fühle es deutlich, es ist der Verein vortre icher Menschen in Freiheit, die bewusstlos (im heutigen Verständnis gemeint ist: absichtslos) zum Kunstwerke der Geselligkeit werden.»
Auch Kant war nicht die «leibliche Befriedigung» einer guten Mahlzeit wichtig. Wichtiger war ihm die «ästhetische Vereinigung» miteinander essender und kommunizierender (zeit- und kulturbedingt nur) Männer. Diese Runde war ihm ein Vorzeichen «wahrer Humanität». Humanität, so seine Vorstellung, entstand durch die Verbindung von «geselligem Wohlleben» mit der «Tugend».
Ein «gutes Mahl» passiert dem essenden Wesen Mensch nicht einfach so. Vielmehr müsse man sich tätig – auch essend – seiner «weltbürgerlichen Bestimmung» annähern. So könne man sich der «Menschheit würdig machen». Das «gute Mahl in guter Gesellschaft» war für Kant eine friedensfördernde Massnahme.
Diese bedenkenswerten Klugheiten zur Tischgesellschaft, zum gemeinsamen Essen, nden sich im Buch «Figuren des Politischen» von Iris Därmann. Gerade in einer Gesellschaft, die in «Formen des getrennten Zusammenlebens» funktioniere, hätten Tischgesellschaften eine besondere – wenn auch nicht im engen Sinne politische, so doch gesellschaftliche – Bedeutung, schreibt Därmann. So ist es.
Fliessender Genuss für Gaumen und Auge
Jeder kennt es, das Schwellenmätteli in Bern. Bestehend aus verschiedenen Gebäuden ist es ein weit über die Stadtgrenze hinaus bekannter Tre punkt. Nach einem Facelift durch LIGNO in-Raum ist das Restaurant Terrasse neu Genuss für Gaumen und Auge.
Text: LIGNO in-Raum AG Bilder: Remimag Gastronomie AG

Das Terrasse ist ein Restaurant mitten in Bern an einmaliger Lage direkt an der Aare: Integriert in eine naturnahe Umgebung mit überraschender Perspektive auf die Stadt, sonnigen Sitzplätzen und dem wohltuenden Rauschen und Glitzern des vorbeiziehenden Wassers. Dazu ein Fischgericht mit spritziger Weinbegleitung. Kurz gesagt: Naherholung tri t auf urbane Lebenskultur, eine Oase an der Berner Riviera.
Facelifting für das Restaurant Terrasse Betrieben wird das gesamte Schwellenmätteli-Areal durch das Zentralschweizer Familienunternehmen Remimag Gastronomie AG. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Innenarchitekturbüro LIGNO inRaum aus Emmen wurde für das Restaurant Terrasse ein neues Design entwickelt. Die grösste Herausforderung bestand darin, in den Innenräumen ein Ambiente von Wärme und Behaglichkeit zu generieren, dies im Kontrast zu der kühl anmutenden Gebäudehülle aus Stahl und Glas. Zudem sollte der Kern mitsamt Bu et optisch stärker als eine zusammenhängende Zone wahrgenommen werden, um den Gast besser leiten zu können. Allgemein war ein frischer Look gefragt. Im neuen Restaurant Terrasse betonen nun verschiedene gestalterische Details die unmittelbare Umgebung: Holzpaddel schmücken die Wände, Schi staue zieren die Bartheke, Weinschränke in Boot-Optik, sich tummelnde Forellen an der Decke, an Fangkörbe erinnernde Hängeleuchten, kecke Bären auf Fischfang in den WCs. Florian Eltschinger von Remimag freut sich über den erfolgreichen Umbau: «Das Restaurant Terrasse gewann innere Strahlkraft. Eine gute Basis für die Zukunft.»
Ein frischer Wind weht in diesem Kleinod der Schweizer Hauptstadt. Einer, der schon bald einer lauen Sommerbrise weicht und die Gäste dazu einlädt, genussvolle und erlebnisreiche Stunden im Schwellenmätteli zu verbringen. Getreu dem Motto der Mundart-Band Stiller Has: «dr schöne grüene Aare naa» …
Das Restaurant Terrasse des Schwellenmätteli Bern wurde durch LIGNO in-Raum AG umgebaut.

Learnings aus Dubai
«Wir brauchen keine Superlative, aber ein Erlebnis, welches in Erinnerung bleibt und beim Gast Emotionen auslöst. »
Text: Ivo Christow
Im März 2022 durfte ich die Expo in Dubai besuchen. Ziel dieser Reise war es, neue Inspirationen für anstehende Projekte zu sammeln. Die Weltausstellung ist das Mekka aller Szenografen, doch nicht nur die Messe, sondern die ganze Stadt reizte mich mit ihren Superlativen. Ich wollte heraus nden, wie sich die Stadt entwickelt hat und gibt es «Learnings», welche ich mitnehmen kann. Ich reiste also gemeinsam mit einem meiner Kunden, ein Gastronom mit diversen Restaurants in der Schweiz, nach Dubai und wir machten eine Entdeckungsreise durch eine völlig absurde, aber durchaus spannende Welt.
Dubai ist die Stadt der In uencer, und darauf ist auch ihr ganzes Marketing Prinzip aufgebaut. Denn Dubai lebt von der Inszenierung und bedient sich dabei an allen klassischen Elementen, welche Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Grösse, Menge, Formensprache und so weiter.
Auf das ema «Grösse» muss man sicher nicht näher eingehen, dass erklärt sich in Dubai von selbst. Denn selten ist etwas so oft «das Grösste» als dort. Das grösste Gebäude, das grösste Riesenrad, die grösste Mall, das grösste Dies, das grösste Das …
Besonders aufgefallen ist mir allerdings, in welcher Menge das ema Wasser in Dubai
präsent ist. Ob mit den Wasserspielen vor dem Burj Khalifa, dem gigantischen Aquarium in der Mall of Dubai (wahrscheinlich auch wieder «das Grösste»), inszenierte Wasserfälle und -Spiele wo man auch hinschaut. Und dann noch die Unmenge an Wasser, welche in den Hotels etc. verbraucht wird. Dabei würde man ja denken, dass in der Wüstenregion Wasser eher Mangelware ist, doch die Emirate verfügen über die modernsten Entsalzungsanlagen der Welt. Und dadurch ist für sie Wasser eine Ressource, an der es ihnen nicht fehlt, und wird überall wo es nur geht als Inszenierungselement eingesetzt.
Was mir ebenfalls ins Auge gestochen ist, sind Spiegel. Ich habe selten einen so gekonnten Umgang mit Spiegeln erlebt als in Dubai. Ob an Wänden, Decken oder Böden, das «Werkzeug» Spiegel wurde geschickt eingesetzt, um neue und spannende Raumsituationen zu bilden.
Grundsätzlich ist der Umgang mit Raum ein ema, welches mich in Dubai faszinierte. Während auf der einen Seite Gebäude in einer derart unmittelbaren Nähe aufeinander gebaut wurden, dass wenn man Pech hat, die Sonne ein seltener Gast ist. Andererseits ist der Platz in manchen Gebäuden und besonders in einigen Restaurants teils exorbitant und verschwen-

Christow, Head of Design krucker-partner.ch
derisch gross. Hier war es spannend zu sehen, wie mit geschickter Raumaufteilung und Zonierung perfekt damit umgegangen wurde. Wichtig ist hier, dass jede neu gebildete Zone eine gleichwertige, einladende Bedeutung im Raum einnimmt, sodass der Gast die Qual der Wahl hat. Doch eine grosse Fläche erfordert auch ausreichend Personal. Wie sich das rechnet, ist ein anderes ema.
Auch was die Digitalisierung betri t, gibt es sicher einige «Learnings», welche man aus Dubai mitnehmen kann. Denn eine digitale Speisekarte via QR-Code einlesen, ist seit der Pandemie lediglich ein «Standard» geworden. In diesem Bereich hat es noch viel mehr Potenzial nach oben. Ob nun mit Augmented Reality Avataren oder anderweitigen Infotainment, hängt natürlich von der jeweiligen Zielgruppe ab.
Allgemein ist mir das ema «Show» und «Entertainment» in Dubai besonders aufgefallen. Während sich bei uns die Erfolgsquote eines Restaurants aus den Faktoren «Essen, Personal und Einrichtung» ergibt, reichen diese dort nicht mehr aus, es braucht den Zusatz «Experience» oder besser gesagt das Herauskitzeln der «Emotionen». Das Erlebnis muss aber meines Erachtens keine Superlative sein, aber eines, das in Erinnerung bleibt.
Ivo
Booking-Plattformen: Nationalrat verbietet Paritätsklauseln
Verbot für BookingKnebelverträge
Kooperationsverträge von Booking-Plattformen mit Hotels behindern die freie Preisgestaltung ihrer Angebote. Diese «Knebelverträge» hat der Nationalrat in der Frühjahrsession verboten. Sogenannte Paritätsklauseln in Verträgen zwischen Hotels und Booking-Plattformen sind nicht mehr gestattet. Hier die markantesten O-Töne der engagierten Parlamentsdebatte.
Text: Hilmar Gernet Bilder: Parlamentsdienste 3003 Bern
Die Ausgangslage
«Verbot von Knebelverträgen der Online-Buchungsplattformen gegen die Hotellerie.» So lautete im Jahr 2016 der Titel einer Motion von Ständerat Pirmin Bischof (Mitte, SO). In der Frühjahrssession kam das ema ins Plenum des Nationalrats. Mit Änderungen im Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb sollten Preisbindungsklauseln gegenüber Beherbergungsbetrieben in Verträgen mit Online-Buchungsplattformen verboten werden.
Florence Brenzikofer (Grüne, BL) erläutert für die nationalrätliche Kommission, die das Gesetz vorberaten hat, Vorentscheidungen und Zielsetzung der Gesetzesanpassungen: «Die Änderung hat zum Ziel, Hotels und anderen Gasthäusern eine freie Preisgestaltung zu ermöglichen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.»
«In der Kommissionsberatung wurde das Ersetzen des Wortes ‹Preisbindungsklausel› durch das Wort ‹Paritätsklausel› beschlossen. Diese Formulierung der Kommissionsmehrheit entspricht der Regelung der Nachbarländer wie Frankreich, Italien und Österreich.»


Wettbewerbsrecht ist kein Kiosk Das Eingreifen in die Vertragsfreiheit zwischen BookingPlattformen und Hotels wird kritisiert. Das Wettbewerbsrecht sei kein Kiosk. Protektionistische Eingriffe wirkten wettbewerbsverzerrend, wurde kritisiert. Zudem würden Buchungsplattformen internationale Märkte öffnen.
Judith Bellaiche (GLP, ZH): «Mit einer branchenspezifischen Änderung des UWG will das Parlament in privatrechtliche Verträge zwischen zwei Parteien eingreifen. Das ist in vielerlei Hinsicht falsch. Es ist einerseits systemfremd, ein allgemeingültiges Gesetz für eine einzelne Branche zurechtzubiegen, das öffnet Tür und Tor für weitere Begehrlichkeiten. Das Wettbewerbsrecht ist kein Kiosk.»
«Werden einzelne Branchen aus protektionistischen Motiven – ‹protéger l’hôtellerie suisse›, der Kommissionssprecher hat es genauso gesagt – gesondert behandelt oder sogar bevorzugt, wirkt sich das wettbewerbsverzerrend aus.»
«Die Vorlage ist auch materiell zu hinterfragen, denn die Hotels, die Beherbegungsbetriebe und damit der gesamte Tourismusstandort profitieren von der internationalen Reichweite der Plattformen. Erst dank diesen Plattformen und deren Netzwerkeffekten erscheinen die Schweizer Hotels überhaupt auf dem Schirm von Touristen und Gästen im In und Ausland.»
«Diese Gesetzesänderung ist ein klarer Eingriff in diese Vertragsfreiheit. Wir müssen der Versuchung widerstehen. (…) Bevor es die Digitalplattformen gab, wurden Hotels über Reiseagenturen vermittelt. Da gab es keine Transparenz über die Vermittlungsgebühr und auch kein Verbot von Paritätsklauseln. (…) Ich beantrage, die Vorlage abzulehnen.»
Verbote bringen keine Dynamik in den Wettbewerb
Pirmin Schwander (SVP, SZ): «Ich ging bis jetzt immer davon aus, dass eine Mehrheit des Parlamentes davon ausgeht, dass wir mit Verboten keine Wettbewerbsdynamik fördern können, im Gegenteil.»
«Es stellt sich grundsätzlich die Frage, warum die Beherbergungsbetriebe überhaupt auf diese Plattformen wollen. Ich gehe davon aus, wegen der Attraktivität. Von diesen Plattformen profitieren eben alle – marketingmässig, ökonomisch, unternehmerisch, (…) insbesondere auch die Beherbergungsbetriebe. Sie profitieren massiv von den Marketingmassnahmen.»
«Nun kommen die gleichen Beherbergungsbetriebe und sagen, diese Attraktivität wollen wir natürlich, selbstverständlich auch die Marketingmassnahmen und so weiter, so müssen wir weniger investieren, aber wir wollen einfach die Nachteile nicht. Vorteile ja, Nachteile nein – wir sind nicht da, um diesen Mechanismus hier zu unterstützen.»

Primin Bischof, Ständerat.
Vater des Knebelvertrag-Verbots ist sehr happy
Ständerat Pirmin Bischof (Mitte, SO) hatte 2016 die politische Debatte über Knebelverträge von Buchungs plattformen lanciert. Jetzt freut er sich über die Entscheidung des Nationalrats, solche Verträge zu verbieten. Nachdem die politischen Entscheide in beiden Kammern gefallen sind, verlangt er vom Bundesrat, das Verbot rasch umzusetzen.
Damals habe es in der Schweiz eine «skandalöse Situation» zu Lasten der Hotellerie gegeben, blickt Bischof zurück. Buchungsplattformen hatten mit ihren Verträgen sehr stark in die Preispolitik der Hotels eingegriffen. Wer Dienst leis tungen der Buchungsplattformen in Anspruch nahm, der durfte im eigenen Hotel keine tieferen Preise anbieten, als sie bei Booking.com publiziert waren. Da die Nachbarländer Knebelverträge bereits verboten hatten, ging es darum, für Schweizer Hotels gleich lange Spiesse zu schaffen und Marktverzerrungen zu verhindern.
«Meine Freude über das Verbot von Knebelverträgen ist sehr gross», erklärte Bischof gegenüber dem «Hotelier»:«Hotelière». Es gab viele Widerstände zu überwinden, wie er ausführte. So vom Unternehmen Booking.com, das starkes Lobbying betrieb. «Auch der Bundesrat und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) waren nicht begeistert von meinem Vorstoss.» Sie argumentierten mit Marktfreiheit, obwohl durch die Wettbewerbskommission (WEKO) eine weitgehend marktbeherrschende Stellung von Booking.com festgestellt worden war.
«Dank dem nun beschlossenen Verbot von Knebel verträgen von Buchungsplattformen können die Hoteliers in dieser Sache wieder ruhiger schlafen», sagte Bischof. Mit dem Krieg in der Ukraine haben sie bereits wieder neue, grosse Herausforderungen zu lösen.
Anzeige

















VIELSEITIGE ZUTRITTSLÖSUNGEN
–––
FÜR JEDEN ZUTRITTSPUNKT
Vielfältige Beschläge, Schlösser, Zylinder und Wandleser für Hoteltüren aller Art sowie Aufzüge, Zufahrten, Tore, Möbel u.v.m.
–––
FÜR MASSGESCHNEIDERTE SYSTEME
Flexible Kombination von virtueller Vernetzung, Funkvernetzung, Mobile Access, Online- und Cloud-Systemen.
FÜR EFFIZIENTEN BETRIEB
Kompatibel zu diversen PMS-Systemen, Kassenabrechnungssystemen und dem SwissPass. Nahtlose Digitalisierung mit mobilen Hotelservices und Check-inSystemen.

SWISSBAU, 3.–6.5.2022
MESSE BASEL, HALLE 1.0
Vertragsfreiheit ist heute eine Illusion Buchungsplattformen sind für die Linke kein Problem an sich. Die heute geltenden Geschäftsbedingungen hätten aber nichts mit Vertragsfreiheit zu tun.
Baptiste Hurni (SP, NE): Die Haltung von Nationalrat Schwander «ne constitue pas un casus belli pour le groupe socialiste. En effet, les offres de plateformes d’hôtellerie, comme Booking.com, ne nous dérangent pas en soi, mais elles deviennent problématiques lorsqu’elles imposent des conditions qui ne permettent plus la liberté économique des hôtels et des consommateurs.»
«Face aux conditions générales de ces plateformes, parler de liberté contractuelle est simplement, à notre sens, contraire à la réalité.»
Min Li Marti (SP, ZH): «Diese Gesetzesrevision ist eigentlich eine kleine Sache, sie berührt aber gewisse Grundsatzfragen im Umgang mit der Digitalisierung. Es geht hier aber nicht in erster Linie um eine Diskussion über Technologie, sondern um eine wettbewerbsrechtliche Frage.»
«Die SPFraktion wird dieser Vorlage zustimmen. Wir stehen einer wirtschaftlichen Übermacht von grossen OnlinePlattformen, insbesondere solchen mit monopolartigem Charakter, skeptisch gegenüber.»
Nicolas Walder (Grüne, GE): «Le groupe des Verts appelle à soutenir ce projet de modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.»
Grosser Nutzen für die Kunden Für die Kunden bringen die Buchungsplattformen mit ihren transparenten Informationen einen grossen Nutzen, zeigt sich die SVP überzeugt. Die FDP erachtet ein Verbot aus liberaler Sicht als sehr problematisch.
Barbara Steinemann (SVP, ZH): «Die hier ins Recht gefassten Plattformen verfügen über einen eher lädierten Ruf, Gaststättenbetreiber – ihre Vertragspartner – sprechen mitunter von einem Knebelvertrag. Diesen Plattformen dürfen aber mit Fug und Recht grosse Verdienste zugeschrieben werden: Konsumenten haben einen Nutzen, wenn externe Dienstleister das weltweite Beherbergungsangebot und die Preis, Leistungs und Nutzungsbedingungen übersichtlich und vergleichend darstellen.»
«Die verpönten Plattformen übernehmen ein tadelloses Marketingkonzept für alle Hotels.»
«Die Wettbewerbskommission hat den drei grossen Plattformen Booking.com, Expedia und HRS Group bereits im Herbst 2015 die Anwendung von sogenannten weiten Preisparitätsklauseln verboten. Die obersten Wettbewerbsschützer der Schweiz sind damit den Hoteliers bereits weit entgegengekommen.»
«Es ist unbestritten, dass in vielen Fällen tatsächlich ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Beherbergungsbetrieb und Buchungsplattformen besteht. Wer einen solchen Vertrag eingeht, kann nachher nicht den Staat um Hilfe rufen und ihn bitten, ihn doch vor den negativen Folgen des Vertragsabschlusses zu bewahren.»
Christa Markwalder (FDP, BE): «OnlineBuchungsplattformen für Hotels bieten sowohl den Kundinnen und Kunden als auch den Beherbergungsbetrieben viele Vorteile. Sie haben eine grosse internationale Reichweite, sodass Reisende überhaupt auf die Angebote der Hotels aufmerksam werden. Zusätzlich erlauben Buchungsplattformen Hoteliers derzeit auch die Gewährung von tieferen Preisen, zum Beispiel bei Buchungen per Telefon.»
«Die vorgeschlagene Regelung schafft aus liberaler Sicht zahlreiche neue Probleme. So schränkt sie die verfassungsmässig garantierte Wirtschafts und insbesondere Vertragsfreiheit auf unzumutbare Weise ein.»
«Sie ist auch nicht geeignet, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Hotellerie zu stärken. So werden gemäss brancheninterner Umfrage nur etwa 15 Prozent der Buchungen direkt über die Websites der Hotels gebucht, die von den Preisbindungsparitäten gemäss den allgemeinen Geschäftsbedingungen betroffen sind.»
Eringer Politikkampf
Müssen die mittelständischen Hotels vor internationaler Marktmacht geschützt werden? Für die Mitte war klar, ohne Verbot der Preisbindungsklauseln geht es nicht. Es gehe um gleich lange Spiesse für die Schweizer Hotels. Zu dieser Frage entw ickelte sich zwischen zwei WalliserPolitikern ein kleiner Eringer Politikkampf.
Philipp Bregy (Mitte, VS): «Eigentlich geht es um eine simple und einfache Frage: Wollen wir die rechtlichen Bedingungen so regeln, dass grosse internationale Plattformen profitieren, oder wollen wir die eigenen, die schweizerischen, die mittelständischen Hotels schützen? Damit sie der Marktmacht, zumindest der relativen Marktmacht dieser internationalen Plattformen, nicht ausgeliefert sind?»
«Ein kleines oder mittleres schweizerisches Hotel kann nicht wählen, ob es dort mitmacht. Daher ist es gefährlich, wenn man diese Preisbindungsklauseln und –noch idealer – die Preisparitätsklauseln nicht verbietet.»
«Wenn wir der schweizerischen Hotellerie gegenüber dieser internationalen Marktmacht den Rücken stärken wollen, dann müssen wir für ein Verbot von Paritätsklauseln eintreten. Damit passen wir uns quasi nahtlos dem direkten Umfeld unserer Nachbarstaaten an, damit bieten wir den schweizerischen Hotels die gleichen Spielregeln wie im nahen Ausland.»
«Wenn ich heute gehört habe, es gehe darum, abzuwägen, welche Vorteile es für unsere schweizerischen Unternehmen gibt. Ich schaue insbesondere die SVPFraktion an, die heute hier in der Tendenz sagt: Wir unterstützen die internationalen Konzerne statt die schweizerischen Unternehmen. Das ist für mich völlig unverständlich.
«Die MitteFraktion ist bereit, die Hotellerie und den Tourismus zu stärken, ohne dass man hier eine grosse Szene darüber veranstaltet, wie stark in den Markt eingegriffen wird.»
Philipp Nantermod (FDP, VS): «Monsieur Bregy, vous m’avez presque convaincu. Ces plateformes sont vraiment affreuses et vampirisent le marché. Estce qu’il ne serait pas plus efficace de les interdire purement et simplement?»
Philipp Bregy (Mitte, VS): «Es handelt sich nicht um ein Verbot, Herr Kollege Nantermod. Die Frage ist: Wollen wir akzeptieren, dass es eine marktbeherrschende Stellung gibt, die unsere kleinen und mittleren Betriebe schwächt? Sie selber kommen aus einem Kanton, in dem es viele Hotels gibt, die auf diese Weise unter Druck kommen. Offensichtlich sind Ihnen diese egal.»
Der Nationalrat hat sich in der Gesamtabstimmung mit 109 gegen 70 Stimmen bei 13 Enthaltungen für ein Verbot von Paritätsklausel bzw. Preisbildungsklauseln ausgesprochen. Damit ist das Gesetz unter Dach und Fach. Der Ständerat hatte der Vorlage bereits früher zugestimmt.

Nicola Paganini, Nationalrat.
Hilmar Gernet im Gespräch mit Nationalrat Nicolo Paganini, Präsident Schweizer TourismusVerband
«Es gibt eine grosse Sehnsucht nach Normalität»
Krise folgt auf Krise. Corona und der Krieg in der Ukraine schlagen direkt auf den Tourismus in der Schweiz durch. Nationalrat Nicolo Paganini äussert sich zu Konsequenzen des Krieges für die Hotels und aktuellen politischen Herausforderungen für den Tourismus.
Bild: Parlamentsdienste 3003 Bern
Wie schätzen Sie die Folgen des Krieges in der Ukraine für den Tourismus in der Schweiz ein?
Sollte der tragische Ukrainekrieg mit verheerenden Auswirkungen für die Zivilbevölkerung über längere Zeit dauern, so wird dies Auswirkungen auf den Schweizer Tourismus haben. Wir müssen zwischen direkten und indirekten Folgen unterscheiden. Das anhaltende Fehlen von internationalen Gästen trifft vor allem den Tourismus in den Städten. Besonders Zürich und Genf sind hier zu nennen. Destinationen in den Bergen können die fehlenden
Gäste hingegen besser durch einheimische Gäste kompensieren. Ein Phänomen, welches sich bereits in der Coronakrise gezeigt hat.
Das Fehlen der Gäste aus Übersee fällt bald schwer ins Gewicht? Wir stellen bei Gästen aus Übersee ein zurückhaltendes Buchungsverhalten fest. Von je weiter weg die Gäste anreisen, desto weniger werden die Regionen in Europa unterschieden. Der Krieg in der Ukraine findet in deren Wahrnehmung in Europa statt. So besteht das Risiko, dass Ferien auf unserem gesamten Kontinent als nicht sicher eingeschätzt werden.
Feriengäste aus Russland oder der Ukraine werden wegen des Krieges völlig wegfallen.
Ja, bestimmt. Aber Gäste aus diesen beiden Ländern haben bereits im vergangenen Jahr im internationalen Gästemix keine entscheidende Rolle mehr gespielt. Kritisch für den Schweizer Tourismus wird es erst dann, wenn auch andere internationale Gästegruppen in grossem Stil wegbleiben würden.
Welches sind die indirekten Kriegsfolgen, auf die sie schon hingewiesen haben?
Mir scheinen zwei Aspekte erwähnenswert. Zum einen führt der Krieg dazu, dass Ferien und Reisen in ihrer Bedeutung für viele Menschen in den Hintergrund gerückt sind. Da das Geld nur einmal ausgegeben werden kann, ist man generell zurückhaltender bei Ausgaben, die nicht absolut zwingend sind. Kommt hinzu, dass die Preise für bestimmte Güter wie Benzin, Energie oder Lebensmittel steigen werden. Und auch die Inflation ist ein Thema.
Die Kriegskrise schliesst unmittelbar an die Coronakrise an.
Es ist tatsächlich eine zermürbende Situation, mit der viele Hotel und Gastronomiebetriebe konfrontiert sind. Es herrscht das Gefühl, die nächste Krise stehe unmittelbar bevor. Auch wenn wir selbstverständlich nicht wissen, von welcher Art sie sein wird. Viele Hotel und Tourismusunternehmen haben in der Coronakrise ihr Eigenkapital angebraucht und stehen gleichzeitig vor der Herausforderung, Cov idK redite zurückbezahlen zu müssen. Eine weitere Baisse wäre für sie verheerend. Es gibt daher eine grosse Sehnsucht nach Normalität.
Normalität?
Es ist der Wunsch nach einer Welt, in der alles wieder in geordneteren Bahnen läuft. So wie es in weiten Teilen unserer Wirtschaft vor Corona der Fall war. Es ist der
Wunsch nach einer Welt, in der nicht eine Akutsituation auf die nächste folgt. Erinnern Sie sich – 2019 haben wir das Thema Overtourism in Luzern diskutiert. Nicht, dass wir explizit dahin zurückwollen. Die Krise hat auch Chancen eröffnet, den Tourismus neu zu denken. Aber ein wenig Durchschnaufen würde uns allen guttun.
Wie sehen Sie die vielen spontanen Hilfsaktionen der Hoteliers im ganzen Land? Hotels haben Tausende Betten für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung gestellt.
Die Schweizer Hoteliers und Hotelièren sind sehr solidarisch, dies hat sich auch schon während der Coronapandemie gezeigt. Diese Aktionen freuen mich sehr. Vor allem auch darum, weil viele Betriebe aufgrund der letzten zwei schwierigen Jahre weiterhin mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen haben. Das ist echte Hilfsbereitschaft und kein Profitstreben.
Sind Aktivitäten des Schweizer Tourismus-Verbands bei der Unterbringung oder bei der Gestaltung des Aufenthalts der Flüchtlinge zu erwarten?
Der STV steht bei diesen Fragen in Kontakt mit seinen Verbandspartnern. Wir würden gemeinsame Aktionen koordinieren und unterstützen. Möglicherweise bietet der erstmals angewandte Schutzstatus S für Flüchtlinge aus der Ukraine auch die Chance, dass ein Teil von ihnen in der Hotellerie und Gastronomie Arbeit findet.
Hat die Parlamentarische Gruppe Tourismus den Krieg in der Ukraine auf dem Radar?
Ja. Der Krieg war auf der Tagesordnung beim letzten Treffen unserer Parlamentarischen Gruppe für Tourismus in der Frühjahrssession. In der Sommersession werden wir uns wieder treffen und uns erneut mit der Situation in der Ukraine befassen; dann wissen wir auch mehr zu den Auswirkungen auf den Tourismus. In der Politik
und im Austausch in unserer Parlamentarischen Gruppen werden wir uns mit der sogenannten Zeitenwende befassen, in der wir mittendrin stecken und die uns noch lange beschäftigen wird. Auch die Rahmenbedingungen für den Tourismus sind zu überdenken und neu zu gestalten. Fragen der Rohsto e, der Lebensmittel, des freien Reisens, der Sicherheit und viele weitere emen werden von dieser Zeitenwende beein usst. Vorerst ho en wir aber, dass der Krieg möglichst rasch vorbei ist. Bis dahin werden wir die Kriegssituation und ihre Entwicklung aufmerksam verfolgen.
Weg
mit der KMU-Mediensteuer und dem Meldeschein-Chaos
Auf der Traktandenliste der Eidgenössischen Räte in der Frühjahrssession gab es auch einige emen, die für die Hotellerie und Gastronomie wichtig sind. Im Zentrum stand sicher der Entscheid des Nationalrats, Preisbindungsklauseln von Buchungsunternehmen zu verbieten. Der STV ist erfreut über den Entscheid des Nationalrates, nicht nur die Preisparitätsklauseln, sondern alle Paritätsklauseln zu verbieten. Die Nachbarländer und damit die wichtigsten Mitbewerber des Schweizer Tourismus haben solche Paritätsklauseln längst verboten. Damit waren die Schweizer Beherbergungsbetriebe einem klaren Wettbewerbs- und Standortnachteil ausgesetzt. Der Nationalrat hat nun gleich wie Europa und damit für die Schweizer KMU-Hotellerie entschieden.

Gerade kleinere und mittelständische Betriebe haben heute gegen die grossen Online-Plattformen faktisch keine Vertragsfreiheit, da Online-Plattformen mittels engen Paritätsklauseln eine dauerhafte Abhängigkeit scha en können. Denn solange sich Hotels auf ihrer eigenen Website nicht von den Buchungsplattformen di erenzieren dürfen, ist ihre unternehmerische Freiheit massiv eingeschränkt. Zudem pro tieren auch die Konsumentinnen und Konsumenten von einem Verbot aller Paritätsklauseln, denn verbesserte Wettbewerbsbedingungen führen zu besseren Auswahlmöglichkeiten und günstigeren Preisen.
Anzeige
RAY SOFT
brunner-group.com
Was halten Sie vom Vorstoss Ihres Ratskollegen Fabio Regazzi, des Präsidenten des Gewerbeverbandes, der verlangt, KMU von der Mediensteuer zu befreien?
Hotels und Gastrobetriebe gehören weitgehend zur KMUWelt. In meinen Augen ist es gut, wenn ungerechtfertigte Steuern abgeschafft werden. Ich muss hier allerdings darauf hinweisen, dass der Schweizer TourismusVerband zu diesem Vorstoss bisher offiziell noch keine Position bezogen hat. Der Grund dafür liegt darin, dass die parlamentarische Initiative Regazzis bisher erst in den Kommissionen behandelt worden ist.
Schluss mit dem Meldeschein-Chaos in der Beherbergungsbranche, so lautet die Forderung der Luzerner von Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger in einer Motion. Da kann man nichts dagegen haben?
Klar, der Verband begrüsst die Motion. Leider wurde der Vorstoss in der Frühjahrssession noch nicht behandelt. In der Schweiz existieren viele unterschiedliche Modelle zur Meldepflicht. Einige Kantone verfügen nicht einmal über eine digitale Lösung. Ineffizienz ist die Folge – das muss nicht sein. Auch was die Datenaufbewahrung betrifft, existieren unterschiedliche Anforderungen. Von der mehrjährigen physischen Lagerung der Meldescheine im Hotel bis hin zur Abgabe der Dokumente bei der örtlichen Polizei finden sie alles. Die Digitalisierung sollte genutzt werden, um diesen enormen bürokratischen Aufwand zu überwinden. Der Vorstoss steht im Einklang mit der neuen Tourismusstrategie 2021, in welcher Digitalisierung und gute Rahmenbedingungen als wichtige Ziele und Handlungsfelder identifiziert werden.
Gibt es neben diesen aktuellen Politikthemen ein Thema, das Sie und den STV umtreibt?
Der Fachkräftemangel ist sowohl ein dringliches als leider auch ein Dauerthema. Ein praktisches Problem ist der zu tiefe Schwellenwert bei der Meldepflicht für offene Stellen. Mit aktuell fünf Prozent ist der Schwellenwert zu niedrig angesetzt. Das führt bei Berufsgruppen mit nachgew iesenem Fachkräftemangel zu einem enormen Bürokratieaufwand. Wir sind der Meinung, dass die Erhebung der Arbeitslosenquote in einzelnen Berufen überarbeitet werden muss. Ständerat Erich Ettlin verlangt nun in seiner Motion «Stellenmeldepflicht» die Wiedereinführung eines praxistauglichen Schwellenwertes. Der STV unterstützt diesen Vorstoss. Denn die tiefe Eintrittsschwelle und die damit zusammenhängende hohe Fluktuation führt beispielsweise im Gastgewerbe zu einer zu hohen statistischen Arbeitslosenquote. Die Statistik verfälscht das reale Bild erheblich. Die Arbeitslosenquote, wie sie derzeit erhoben wird, gibt keine Auskunft darüber, ob die arbeitslosen Personen eine gastgewerbliche Ausbildung haben, wie lange die arbeitslosen Personen im Gastgewerbe gearbeitet haben oder in welchen Branchen die arbeitslosen Personen eine Stelle suchen oder besser finden könnten. Die Motion wurde nun zur genaueren Prüfung der Kommission zugewiesen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das gastronoviKassensystem im Casino Bern
Das Traditionshaus zeigte bei dessen Wiedererö nung
2019 einen tiefgreifenden Wandel – weg vom traditionellen Gasthaus, hin zu einem modernen Gastronomie-, Kultur und Eventbetrieb.
Vielfältiges gastronomisches Angebot auf hohem Niveau
Der Umbau des klassizistischen Gebäudes brachte das Casino Bern wieder näher an das prachtvolle Original von 1909 zurück. Für die Zukunft hingegen hatte die Burgergemeinde Bern andere Pläne: Das Traditionshaus sollte zum Begegnungsort im Herzen Berns werden mit einem vielfältigen gastronomischen und kulturellen Angebot. Zusammen mit Ivo Adam, dem bekannten Gourmetkoch und Direktor des Casinos Bern, wurde ein Konzept entwickelt, welches Gastronomie, Kultur und Eventbereich beinhaltet. Entstanden ist ein komplexer Betrieb mit einem vielfältigen gastronomischen Konzept, welches vom Publikum mit Begeisterung angenommen wurde.
Die unterschiedlichen Speiseangebote im Salon d’Or, an der Bistrobar, im französischen Restaurant, am japanischen Cheftisch oder am Zunfttisch sind eine Herausforderung für Küche und Service, im Sommer wird diese Komplexität mit der grossen Terrasse noch gesteigert. «Die grösste Schwierigkeit sind die verschiedenen Anforderungen, die jedes gastronomische Konzept an die internen Abläufe und an die Verfügbarkeit von Produkten hat», erläutert Florian Bettschen, Leiter Gastronomie. «Wir benötigten deshalb ein System, welches gleichermassen für Küche, Service, Empfang, Reservationsmanage-
ment oder Marketing & Verkauf genutzt werden konnte.» Während der Planungsphase wurden die Anforderungen an ein künftiges Kassensystem zusammengetragen und verschiedene Systeme analysiert. Die Wahl el schlussendlich auf gastronovi – weil es mit zahlreichen praktischen Features und Schnittstellen (z.B. zu Eguma oder Abacus) überzeugte. «Die Anforderungen an das System waren hoch, denn es musste der Komplexität unseres Betriebes in allen Dimensionen entsprechen. Das war zu Beginn eine Herausforderung, das gebe ich gerne zu. Zum Erstellen der Datenbank leisteten wir zunächst Fleissarbeit, denn sämtliche Produkte und Lieferantendaten mussten erfasst werden – und das waren unendlich viele!
Später wurden jedoch die Vorteile von gastronovi o ensichtlich. Beispielsweise beim Erstellen von detaillierten Analysen, in der Warenbewirtschaftung und Inventur, beim Erstellen von Kalkulationen oder im gesamten Bestellwesen.»
Diese Grundlagenarbeit trägt im Alltag Früchte: «Wir managen sämtliche Getränkebestellungen über gastronovi. Vor der Einführung entschieden wir uns dafür, ausschliesslich die Getränke mit deren Rezepturen zu hinterlegen. Damit wird bei jeder Bestellung direkt der Lagerbestand angepasst, und wir verfügen jederzeit über eine aktuelle Inventurliste und ein genaues Controlling. Es wäre möglich, dies auch mit dem Speiseangebot zu tun, jedoch ist
Casino Bern – Kultur, Gastro nomie und Events
Besitzerin Burgergemeinde Bern Neueröffnung 2019 nach einer umfangreichen Komplettsanierung
Gastronomiekunde von Baldegger
+ Sortec AG seit 2019
· Ivo Adam, Direktor; Florian Bettschen, Leiter Gastronomie
15 Kassen, fünf Restaurants
casinobern.ch
das bei so vielen unterschiedlichen gastronomischen Konzepten mit wechselnden Speisekarten eine Arbeit, die wir nicht leisten wollten.»
In den Erlebnisbereichen Kultur, Gastronomie und Event arbeiten rund 100 Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Kompetenzen. Ein Kriterium bei der Auswahl der Kassensoftware war deshalb deren Einfachheit im Frontend: «Wir haben festgestellt, dass neue Mitarbeitende in Service und Küche nach einer kurzen Einführung rasch mit dem System vertraut sind.» Im Backo ce hingegen ist es gemäss Florian Bettschen von Vorteil, wenn für die Bewirtschaftung eines komplexen Systems entsprechende IT-Kompetenzen vorhanden sind.
Auf die Frage, ob er die Kassensoftware empfehlen würde, meint er: «gastronovi ist ein Rundumpaket mit vielen Möglichkeiten, die dem Betrieb entsprechend ausgerichtet werden können. Die verschiedenen Features erleichtern deutlich die Arbeitsabläufe. Ich zeige gastronovi gerne meinen Berufskolleg:innen, weil es mich in allen Facetten überzeugt.» Der Support von Baldegger+Sortec AG ist ein weiterer Pluspunkt, den er hervorhebt. «Wir schätzen es, dass wir direkte Ansprechpersonen haben, die auf unsere Anliegen individuell reagieren – beispielsweise indem wir Features als Testversion prüfen können. Im Alltag ist das Supportteam eine super Unterstützung.»
Fabio Regazzi, Tessiner Mitte-Nationalrat und Präsident des Gewerbeverbandes.

Mediensteuer für KMU(-Hotels) ist nicht vom Tisch
DText: Hilmar Gernet Bild: SGV / USAM
ie KMU sind von der Mediensteuer auszunehmen. So lautete der Auftrag, den Fabio Regazzi, Tessiner MitteNationalrat und Präsident des Gewerbeverbandes, dem Parlament mit einer parlamentarischen Initiative erteilen will. Seit 2019 engagiert er sich gegen die «Doppelbesteuerung für KMU», die mehr als einer halben Million Franken Jahresumsatz ausweisen. Statt einer Besteuerung aufgrund des Umsatzes schlägt er vor, Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden (Auszubildende nicht mitgezählt) generell von der Medienabgabe zu befreien.
Nationalrat für die Abscha ung
Seine Begründung, die er in der zurückliegenden Frühjahrssession präsentierte, war einfach und für eine Mehrheit einleuchtend: «Wenn Personen in einem Haushalt Radio hören, ist eine Abgeltung gerechtfertigt. Wenn die gleichen Personen am Arbeitsplatz Radio hören oder fernsehen, ist es eine Doppelbesteuerung. Die gleiche Person kann nicht gleichzeitig am Arbeitsplatz beispielsweise in einer Werkstatt und zu Hause Radio hören.» Lehnte die zuständige Kommission des Ständerats den Vorschlag Regazzis bereits früher ab, fand er am 15. März 2020 im Nationalrat eine klare Unterstützung mit 119 Stimmen.

Zwängerei oder grundlegendes Problem
Gegen eine Befreiung der KMU von der Mediensteuer stimmten 71 Nationalrätinnen und Nationalräte. Sie folgten der Argumentation von Matthias Aebischer (SP, BE). Er sah im Vorstoss von Regazzi eine «Zwängerei». Das Volk hätte 2015 diese Abgabe beschlossen. In der Zwischenzeit habe das Parlament noch nachgebessert und die einfachen Gesellschaften von der Medienabgabe befreit.
Die vorberatende Kommission des Nationalrats hatte sich mit 14 gegen 10 Stimmen gegen die «ungerechte und unverhältnis-
mässige Doppelbesteuerung» ausgesprochen, wie ihr Sprecher Marco Romano (Mitte, TI) erläuterte. In der Kommission kritisiert worden war der Geschäftsumsatz als Grundlage für die Berechnung der Mediensteuer. Das Problem könne nicht gelöst werden, indem an den di erenzierten Steueransätzen geschraubt werde, sagte Romano. «Das Problem ist ein grundlegendes Problem. Es handelt sich um eine Doppelbesteuerung auf der Grundlage eines falschen Kriteriums.»
Aufgrund der Di erenz zum Ständerat bleibt das Geschäft auf der Agenda des Parlaments. A aire à suivre – auch für die KMU-Hotels.
Anzeige

• aktuelle Infos über Region, Wetter, Events, Fahrpläne & Vieles mehr!
•Streaming-Möglichkeit von Netflix, YouTube & Co.
• Digitalisierung der Zimmer- & Hotelinformationen
•Spracheinstellung und persönliches Ansprechen der Gäste mittels PMS-Schnittstelle
•Set-Top-Box-freie Installation
• modulare Software-as-a-Service Cloudlösung
•Monitoring/Verwaltung sämtlicher Geräte & Inhaltspflege übers CMS
•Anbindung an Licht- & Temperatursteuerung via Gebäudeautomation von Loxone und KNX

DAS INTERAKTIVE TV-SYSTEM AUS ZERMATT
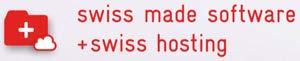


Frontex-Abstimmung: Hilmar Gernet im Gespräch mit Andreas Züllig, Präsident HotellerieSuisse
Ja zu Frontex sichert das Reisen in die Schweiz und die EU
BBild: zVg
ei der Frontex-Schengen-Abstimmung vom 15. Mai steht für die Hotellerie- und Tourismusbranche viel auf dem Spiel. Ein Nein führt zum automatischen
Ausschluss der Schweiz aus dem europäischen Visa-Raum Schengen. Für die Tourismusbranche würde eine Absage des leicht erhöhten Finanzbeitrags an die Sicherung den Schengen-Raum jährliche Ausfälle von mindestens 500 Millionen Franken bedeuten.
37 Millionen Franken mehr muss die Schweiz künftig für die Sicherung der europäischen Aussengrenzen durch die Organisation Frontex beisteuern. Damit werden jene Länder unterstützt, welche die europäische Grenz- und Küstenwache für alle SchengenStaaten, zu welchen die Schweiz auch gehört, tatsächlich durchführen. Zu den Aufgaben der Frontex gehört die Sicherung der Grenzen, aber auch ankommende Flüchtlinge zu empfangen. Dass diese beiden Aufgaben zusammenfallen können, zeigt der gegenwärtige Krieg beispielsweise in Polen, der Aussengrenze zur Ukraine, eindrücklich. Scheinbar weit weg von der Schweiz wird zugleich humanitäre und grenzschützerische Arbeit geleistet – und die hat einen Preis.
Der operative Schutz an den europäischen Aussengrenzen durch die Frontex-Organisation, so kann man argumentieren, ist tatsächlich nicht ein primäres Problem der Schweiz.
Andreas Züllig: Die operativen Aufgaben und Herausforderungen zu meistern, ist tatsächlich nicht in erster Linie eine schweizerische Aufgabe. Wir leisten unseren Beitrag mit den zusätzlichen Geldern. Das Problem aber ist, dass ein Nein zum erhöhten FrontexBeitrag automatisch den Kündigungsmechanismus nach Art. 7 des Schengen-Abkommens zwischen der Schweiz und der EU auslöst.
Bisher hat sich die Schweiz im Verhältnis zur EU darauf verlassen, dass die europäischen Mühlen sehr langsam mahlen. Warum darf man sich jetzt nicht auf dieses Vorgehen verlasssen?
Bei den gegenwärtigen Herausforderungen, die der Krieg in der Ukraine an den europäischen Aussengrenzen mit sich bringt, wäre es fahrlässig, sich darauf zu verlassen, dass die Schweiz für einen Sonderweg auf das Verständnis der EU-Staaten zählen dürfte. Um den rechtlichen Automatismus bei einem Nein noch abwenden zu können, müssten alle EU-Staaten dem Schweizer Sonderzug zustimmen. Ich meine: Das ist ein absolut unwahrscheinliches Szenario. Darauf liesse sich keine seriöse Planung aufbauen. Und zudem wäre es höchst unsolidarisch.


Andreas Züllig.
Ohne Schengen würde die Schweiz zur Visums-Insel. Die Touristen aus den wichtigen Fernmärkten ausserhalb Europas bräuchten ein separates Visum für die Schweiz. Die Folgen für die Hotellerie und die Beherbergungsbranche wären sehr klar negativ. Studien bezi ern den Verlust auf jährlich über eine halbe Milliarde Franken. Hinzu kommen die Grenzkontrollen, welche wieder eingeführt werden müssten, weil die Schweiz wieder zur Aussengrenze der EU würde. Für die Gäste bedeutet das Reisebürokratie statt Reisefreiheit. Für die Betriebe bedeutet es das latente Risiko von Lieferengpässen oder Verspätung bei verderblicher Ware.
Neben der direkten Folge, dass viele Touristen für eine Schweizreise ein Visum beantragen müssten, mit welchen weiteren Auswirkungen rechnen Sie bei einem Nein zur Frontex-Vorlage für die Hotellerie und den Tourismus in unserem Land? Mittelfristig würde ein Nein die Ausgangslage in der ohnehin schwierigen Europapolitik der Schweiz zusätzlich verschlechtern. Kommt es im Europadossier zu weiteren Blockaden, drohen Grenzkontrollen und neue Visabestimmung. Zudem gefährden wir auch den erleichterten Zugang zu unseren europäischen Kundinnen und Kunden und zu Fachkräften aus Europa, die wir unbedingt benötigen. Stabile Beziehungen zu Europa und eine konstruktive Europapolitik bleiben für die Hotellerie weiterhin äusserst wichtig.
Ein Ja zu «Frontex» ist in ihren Augen also sowohl branchenpolitisch als auch europapolitisch für die Schweiz zu begründen. Ja, unbedingt. So stehen beispielsweise der Schweizerische Gewerbeverband und viele andere Wirtschaftsorganisationen für den Frontex-Beitrag ein. Eigentlich haben wir eine ähnliche Situation wie 2019 mit der Übernahme der Wa enrichtlinie. Der Unterschied besteht darin, dass damals nicht linke Gruppierungen, sondern die Schützen das Referendum ergri en hatten. Die Konsequenzen und die Betro enheit aber sind dieselben.
Und können Sie diese nochmals auf den Punkt bringen?
Die Schweizer KMU-Wirtschaft und ganz besonders die Beherbergungsbranche brauchen den Erhalt des Schengen-Abkommens. Die Schweiz soll und will weiterhin am Schengen-Raum partizipieren. Die Reisefreiheit, der freie Visumraum, die o enen innerhalb Europas, aber auch die Sicherheit an den europäischen Aussengrenzen und nicht zuletzt das gute Verhältnis zu unseren Nachbarn hängen daran. Ein Nein würde all diese Vorteile verspielen. Deshalb sage ich am 15. Mai Ja zur Frontex-Vorlage.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Historisches
Hotels im Krieg: Schweizer Hoteliers zwischen Ho nung und Ruin
Schüsse. Kanonensalven detonieren in Städten und auf Schlachtfeldern. Die Menschen iehen. Für Flüchtlinge können Hotels – weit weg von lebensbedrohenden Angri en – ein Ort der Ho nung sein. Schweizer Hotels waren im Ersten und Zweiten Weltkrieg Hilfs- und Ho nungsorte. Vielen Hotels brachte der Krieg aber grosse Hil osigkeit oder gar den Ruin.
Text: Hilmar Gernet Bilder: ierry Ott, Palaces (Quelle)
Die Flüchtlingswelle nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist ein «Ereignis von historischer Dimension, vor allem als einzigartiger Moment für Europa». So beurteilt der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi, ein Diplomat aus Mailand, die Lage. In acht Tagen und nicht in einem Zeitraum von acht Jahren, wie im Jugoslawienkrieg vor 30 Jahren, hätten Millionen von Menschen ihr Land verlassen. Zugleich, so seine vorläu ge Bilanz in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (9. März 2022), habe Europa noch nie so viel Toleranz und Aufnahmebereitschaft gezeigt. Auch die Schweizer Bevölkerung hilft. Am nationalen Solidaritätstag, am 9. März, wurden über die Glückskette über 51,5 Millionen Franken für die Ukraine gespendet.


Grandhotel Bernerhof, 1913.


Das Hôtel Métropole, Genf, wird 1941 dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zur Verfügung gesstellt.

Grand Hôtel de la Métropole, Genf, 1855.
Die tödlichen Schüsse auf den österreichischen ronfolger Erzherzog Ferdinand am 8. Juni 1914 leerten innert weniger Tage die Grandhotels. Nach euphorischen Gästezahlen 1912 und 1913 stürzten sie im Ersten Weltkrieg (1914–1918) und wegen der russischen Oktoberrevolution (1917) ab. Der Zustrom von Gästen in Hotels aller Kategorien war plötzlich und auf Jahre hinaus unterbrochen.
*
«Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen.» Mit dieser Lüge rechtfertigte Adolf Hitler am 1. September 1939 den Angri auf Polen. Der Zweite Weltkrieg schliesst in der Schweiz viele Hotels. Die Schweizer Hotellerie mit internationaler Gästeschaft erlebt eine weitere existenzielle Krise, wie Rucki in ihrem Buch «Das Hotel in den Alpen» schreibt. Statt zahlender Gäste übernachten in vielen Grandhotels Flüchtlinge, Kranke und Verwundete, Generalstäbe oder Soldaten.
Die humanitäre Tradition der Schweiz, repräsentiert durch das Rote Kreuz, logiert politisch im Berner Bundeshaus. Konkret koordiniert und leistet das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) seine humanitäre Arbeit aber seit 1941 aus dem ehemaligen Genfer Hotel Métropole.
Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 entscheidet sich die westlich-demokratische Welt überraschend schnell für ein massives Sanktionenpaket gegen den Aggressor. Die Schweiz schliesst sich nach kurzem Zögern auch an. Statt nach der ab auenden Coronapandemie wieder vermehrt Touristen zu begrüssen, gilt es, die Vertriebenen aus der Ukraine in der Schweiz zu beherbergen. Die grosse Fluchtbewegung aus der Ukraine in den Westen ist Anlass, einen historischen Blick auf die Situation und die Herausforderungen der Hotels und der Beherbergungsbranche von damals zu werfen.
Bundesrat verlangte «objektive Darstellung»
Wie mit den Flüchtlingen in der Schweiz umzugehen sei und wie viele aufgenommen werden sollen, war im 20. Jahrhundert immer wieder ein kontroverses Politikum. Am heftigsten war die Auseinandersetzung mit der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. War das «Rettungsboot» Schweiz voll oder nicht? Der Bundesrat gab dazu 1953 eine Untersuchung in Auftrag. Carl Ludwig, der Basler Rechtsprofessor und ehemalige Regierungsrat der Liberalen Partei, sollte eine «objektive, möglichst umfassende Darstellung» der Schweizer Flüchtlingspolitik seit 1933 erarbeiten. Das Werk «Die Flüchtlingspolitik der Schweiz seit 1933 bis zur Gegenwart» erschien 1957.
War das «Rettungsboot» voll?
Während des Zweiten Weltkrieges brauchte man, wie heute, schnell Unterkünfte für die Flüchtlinge. Im Herbst 1942 waren es laut LudwigBericht 10 000 bis 12 000 Flüchtlinge, die in die Schweiz kamen. «Das Rettungsboot sei nunmehr voll besetzt und die Aufnahmefähigkeit unseres Landes erschöpft», wurde vom Bundesrat erklärt.
Der Historiker Edgar Bonjour beschrieb die Haltung des Bundesrats: «Er hat zwar die Flüchtlingsfrage nicht bloss als politisches, sondern auch als menschliches Problem verstanden und empfunden, entschied jedoch im Kampfe der widerstreitenden Pflichten zugunsten der Staatsräson.»
Diese Haltung kam in einer Äusserung des zuständigen Chefs des Eidgenössischen Justiz und Polizeidepartements, Bundesrat Eduard von Steiger (Bauern, Gewerbeund Bürgerpartei; Vorgänger der SVP), zum Ausdruck. In einer Versammlung sprach er «das unglückliche, so ganz falsche Vorstellungen über das Mass des Tragbaren erweckende Wort vom ‹stark besetzten kleinen Rettungsboot›.» (Bonjour).
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Zahl der «registrierten Aufgenommenen» bei 295 000 festgestellt. Die grösste Gruppe waren die «Militärinternierten» –rund 104 000. Sie aufzunehmen, war eine völkerrechtliche Pflicht. «Zivilflüchtlinge» sind 51 129 aufgenommen worden. Ein Einsatz, der als «humanitäre Extraleistung» qualifiziert worden ist.
Bonjour meinte zur Bewältigung der Flüchtlingsfrage im Zweiten Weltkrieg, dass der Bundesrat im Urteil der Bevölkerung das Spannungsverhältnis zwischen den «Geboten der Menschlichkeit» und der «behördlichen Staatsräson» gut gemeistert habe. «Die Zahl der Flüchtlinge war grösser, als man nachträglich, von anderen Voraussetzungen aus urteilend, wahrhaben wollte. Deshalb scheint es billig, wegen der begangenen offensichtlichen Fehler nach den Behörden jener Zeit mit Steinen zu werfen. Die ganze damalige Generation hat versagt und ist mitschuldig.»
Nach dem Weltkrieg gelang es, aufgrund der sich positiv entwickelnden Konjunktur für fast alle «arbeitsfähigen Flüchtlinge geeignete Arbeit» zu finden. Beschäftigungsmöglichkeiten ergaben sich in der Industrie, im Hotel und Gastwirtschaftsgewerbe und in der Landwirtschaft.
Schonungslose Aufarbeitung
Die historische Forschung attestiert dem Ludwig-Bericht bis heute, «bemerkenswert zeitbeständig» zu sein. «Ludwig war um eine schonungslose O enlegung der restriktiven Haltung der Behörden bemüht» ist in der «Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte» zu lesen. Die «NZZ» formulierte als Lehre aus dem Bericht: Man müsse hinnehmen, dass «die an sich richtige Maxime der weitherzigen Aufnahme» durch die «Ernährungsproblematik und die Sicherheitsbedürfnisse» der Schweiz auch künftig eingeschränkt würden.
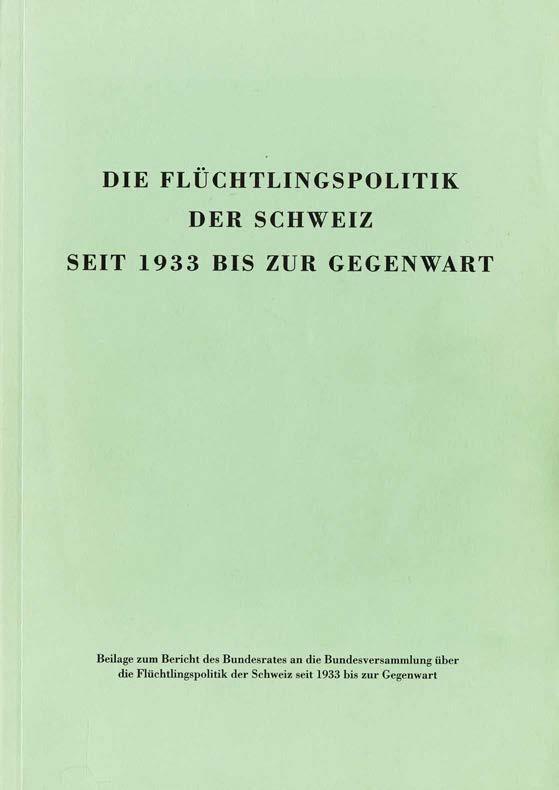
Flüchtlinge in «schönen Hotels» Um für die Flüchtlinge rasch eine Behausung zu nden, war es naheliegend, leer stehende oder wenig frequentierte Hotels zu mieten. Das war jedoch schwierig, da es im Umfeld solcher Hotels für die Flüchtlinge laut Ludwig-Bericht oft keine passenden Arbeitsgelegenheiten gab. Zudem sollten die Flüchtlinge nur in militärisch unbedenklichen Gebieten untergebracht werden.
Dennoch waren die Hotels ein unverzichtbares Element der Hilfe für die Flüchtlinge. Die Unterbringung der Flüchtlinge in Hotels war in den Augen von Bundesrat Eduard von Steiger im Ludwig-Bericht nicht angemessen dargestellt worden. In einer ausführlichen «Stellungnahme», die im Ludwig-Bericht publiziert ist, stellte er seine Sicht der Dinge dar. «Mit Freude und Genugtuung» beschrieb er rückblickend das Fazit seiner Inspektionsreisen in Hilfsunterkünfte und hielt fest: «… wie schön eigentlich die Flüchtlinge untergebracht werden konnten. (…) ich bin überzeugt, dass kein Land die Flüchtlinge so aufgehoben hat wie die Schweiz.» Er führt eine Liste von «vorzüglichen und schönen Hotels» an, die als Flüchtlingsunterkunft dienten: «Ein Grand Hotel Brissago, ein Hotel Eden in Brunnen, die Hotels Bernina und Cresta-Kulm in Celerina, der Schweizerhof auf Beatenberg, die Hotels in Champéry, Engelberg, Flims-Waldhaus, MontPélerin, Montana usw. sind Beispiele, in was für schönen Hotels die Flüchtlinge und namentlich die Flüchtlingsfrauen Unterkunft fanden, neben auch guten, aber etwas einfacheren Hotelgebäuden.»
«Bankenhotels»
Streit um Qualität der Hilfe-Hotels
Die Beherbergung von Flüchtlingen – die Internierung – zu organisieren, war die Aufgabe der Eidgenössischen Zentralleitung der Heime und Lager (ZL). Von 1940 bis 1950 haben rund 500 Mitarbeitende 95 Lager (meist Barackensiedlungen) und 135 Heime (Hotels, Bildungshäuser, Kinderheime, Krankenstationen, Schulheime, Sanatorien usw.) organisiert. Für die Miete von leer stehenden Hotels sowie den Erwerb und die Miete von Baracken gab die ZL von 1940 bis 1949 rund 10,5 Millionen Franken aus.
Die wirtschaftlichen Drucksituationen in den Weltkriegen, aber auch in der Zwischenkriegszeit, hatten dazu geführt, dass verschiedene Eigentümerfamilie ihr Hotels nicht mehr halten konnten. Als Lösung wurde nicht selten eine Aktiengesellschaft gegründet, die Geld für ein krisengeschütteltes Hotel zur Verfügung stellte. Die Bündner Banken waren gerne bereit, entsprechende Hotelaktien zu zeichnen, und nicht immer konnte die bedürftige Hotelierfamilie die Aktienmehrheit behalten. Vor allem für den Kanton Graubünden ist diese Entwicklung gut erforscht. «Ohne die Hilfe der Banken und das Engagement der Schweizerischen Hoteltreuhandgesellschaft, die vor allem in bauliche Er neuerungsmassnahmen investieren», so Rucki in ihrer Engadiner Hotelgeschichte, «hätte die Engadiner Hotellerie die Krise wohl nicht überstanden.»
In der «langen Krise» des Tourismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts traten « Aktiengesellschaftshotels» an die Stelle autonomer Familienhotels. Diese Entwicklung wurde von der Schweizerischen Hoteltreuhandgesellschaft als Problem angesehen. Ihr Präsident, der Aargauer Ständerat Gottfried Keller, kritisierte an der Generalver sammlung 1940 die «unpersönlichen Aktiengesellschaftshotels», die «Direktoren- oder Bankenhotels», hinter denen keine Hotelierfamilie mehr stehe. Er verlangte, die «Bankenhotels» wieder «in den Privatbesitz tüchtiger Hotelfachleute» (Rucki) zurückzuführen.
Der ZL-Leiter Otto Zaugg kommt in der Stellungnahme von Bundesrat von Steiger zu Wort. Zaugg schreibt, dass «von Internierung nur in Bezug auf einige Speziallager für politische Flüchtlinge gesprochen werden kann. (…) Die übrigen Lager und Heime wurden derart frei geführt, dass der Ausdruck ‹Internierung› dem tatsächlichen Sachverhalt nicht entspricht.»
Wesentlich anders schildert der Historiker Simon Erlanger in seiner Dissertation den Zustand vieler angemieteter Hotels: «altmodisch», «kein warmes Wasser», «sanitäre Anlagen rudimentär», «Waschgelegenheiten im Keller». In den Kriegsjahren bestand an «leeren und teilweise heruntergekommenen Hotels und Kurhäusern (…) kein Mangel, da der Tourismus fast völlig zum Erliegen gekommen war.» Die angemieteten Hotelunterkünfte sollten über das ganze Land verteilt sein, da man «eine Ansammlung von Flüchtlingen in einer Ortschaft oder Gegend vermeiden wollte». Zudem war das «Réduit» für Flüchtlingsunterkünfte «Sperrgebiet».
Die Aufgabe der ZL, geeignete Unterkünfte zu nden, war eine grosse Arbeit. Die Gemeinden und Kantone erhoben oft Einspruch, weil sie keine Flüchtlinge wollten. Sie fürchteten um den guten Ruf ihres Ferienortes. Aus gleichem Grund wurden abschreckende Polizeivorschriften erlassen, zum Beispiel Ausgehverbote nach 21 Uhr. Oder in Luzern das Verbot, die Bänke in den Quaianlagen zu benutzen.
Schiedsgerichte waren nötig Aus betriebswirtschaftlichen Gründen suchte die ZL mittelgrosse Häuser mit Platz für 70 bis 120 Personen. Kleinere Häuser galten als unwirtschaftlich, grössere Hotels aber als unübersichtlich. Bei den Mietverhandlungen mit den Besitzern von leer stehenden Hotels kam es des Öfteren zu Konflikten. Eigentümer wüssten es so einzurichten, «dass ihr Gebäude möglichst beschädigt wird, sodass sie es mehr oder weniger auf Kosten des Bundes wieder renovieren können», schreibt Erlanger. Dies sei eine gängige Praxis gewesen. Solchen Machenschaften wirkte die ZL entgegen und erstellte detaillierte Protokolle über den baulichen Zustand des Hauses.
Die gemieteten Hotels wurden periodisch von Inspektoren der ZL kontrolliert. Bei der Rückgabe einiger Mietobjekte musste man sich schiedsgerichtlich auseinandersetzen. Als Schiedsrichterin zwischen der ZL und den Eigentümern fungierte die Schweizerische Hoteltreuhandgesellschaft.
Gleichgewichtskünstler Hotelier
Die Hoteliers seien in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts «wahre Gleichgewichtskünstler» gewesen, hält Thierry Ott in seiner Geschichte zur Luxushotellerie in der Schweiz «Palaces» fest. «Um ihre Aufgabe zu erfüllen, brauchten sie gleich viel Geld wie vorher. Doch die Einkünfte nahmen ab, die Zahl der Gäste ebenfalls. Von den übrigen Kunden liessen immer mehr ihre Rechnung offen.» Die Kriegsumstände diktierten den Hoteliers und Hoteldirektoren das Geschäft.
Der politischen und wirtschaftlichen Schweiz gelang der Übergang vom Zweiten Weltkrieg in die Nachkriegsjahre als kontinuierlicher Prozess gut. Es gab eine kurze Phase innenpolitischer Abrechnungen mit den prodeutschen Kräften. Der weitverbreitete Eindruck nach Kriegsende war, eine historische Bewährungsprobe erfolgreich bestanden zu haben.
Illustriert werden kann dies anhand des wirtschaftlichen und politischen Personals. Es blieb, mit wenigen Ausnahmen (Rücktritt des FDPBundesrats Marcel PiletGolaz 1944), in seinen Chargen. Darunter auch die Bundesräte Philipp Etter und Eduard von Steiger: Der eine, Etter, 1940 Befürworter eines Umbaus der Eidgenossenschaft in Sinne einer «autoritären Demokratie», der andere, von Steiger, Hauptverantwortlicher für die restriktive Flüchtlingspolitik.
Die innere bzw. innenpolitische Selbsteinschätzung der Schweiz stand jedoch in «scharfem Kontrast» zu ihrem «negativen Image bei den Alliierten seit 1943», wie der BergierBericht Ende der 90erJahre festhielt. Das Ansehen der Neutralität hatte bei Kriegsende einen «Tiefpunkt» erreicht, und es gab harsche Kritik der Siegermächte.

Palace Hotel Pontresina, 1907.
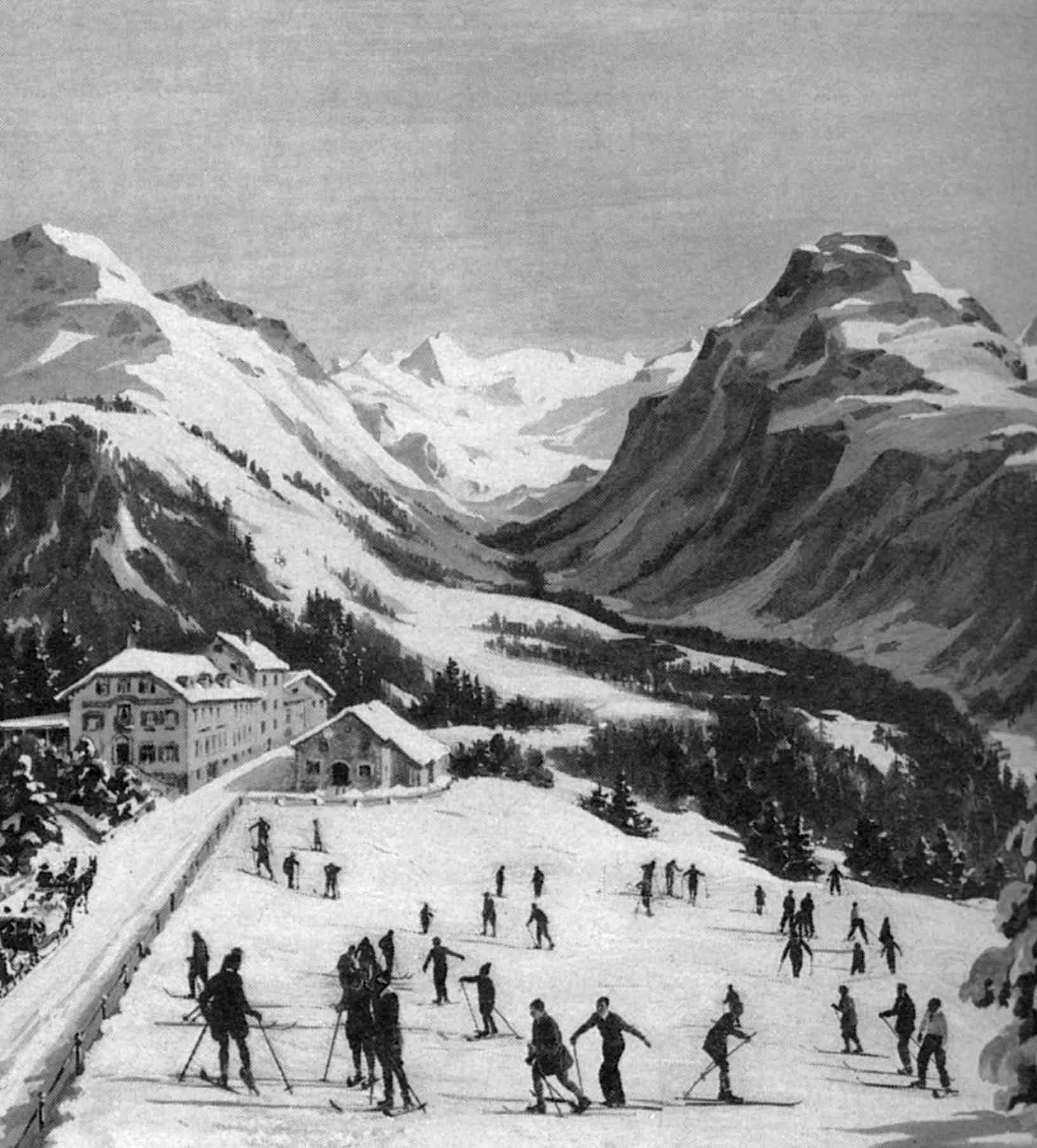
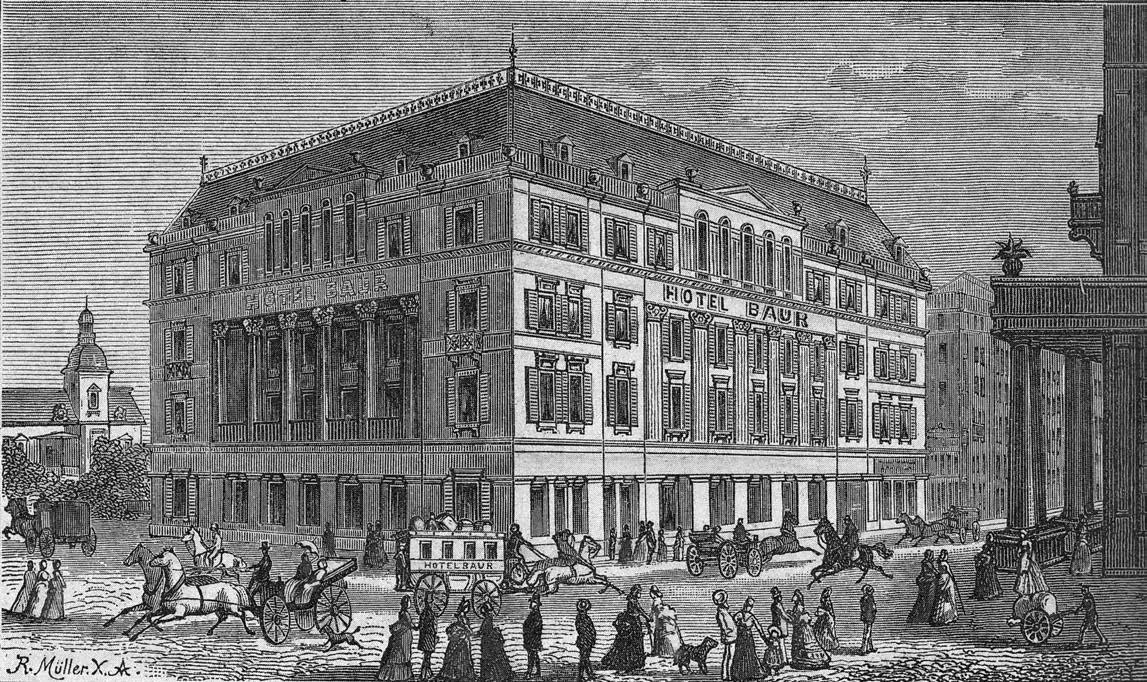
Hotel Sonnenberg: Musterheim für Russinnen
Das Hotel Sonnenberg in Kriens war vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 ein «Musterfrauenheim» für rund 180 Russinnen. Es war eines von vielen Häusern, das von der Eidgenossenschaft für Flüchtlinge gemietet worden war. «Man hatte für die Frauen und Mädchen leer stehende Hotels gemietet, prachtvolle Bauten. Der Aussenstehende, der an einem solchen Gebäude vorbei aniert, beneidet sicherlich die Insassinnen.» Der Sonnenberg war wegen seiner landschaftlichen Schönheit ein beliebtes Aus ugsziel, aber auch «wegen der Möglichkeit, mit den internierten Frauen zu sprechen. Und auf ein solches Gespräch folgte nämlich nicht selten eine Einladung zu einem gemeinsamen Essen am Sonntag», wie sich ein Luzerner noch 2002 erinnerte.
Allerdings: Der Tagesablauf der Frauen war klar strukturiert, mit Ordnung und Disziplin. Am Morgen und am Abend war Appell. Diese Musterhaftigkeit schilderte eine ehemalige «Insassin» des Sonnenbergs: «Ich denke mir manchmal wirklich, warum ich vor den Deutschen ausgerückt bin, um wieder in einer preussischen Kaserne zu landen.» In Gesprächen wurden solche Gedanken aber postwendend wieder relativiert. «Was beklage ich mich? Ich lebe!»
Gestrandete, nicht Gäste Im Flüchtlingsheim Sonnenberg war für die russischen Frauen eine «Schule» eingerichtet worden. Geleitet wurde sie von einem russischen Militärinternierten. «Sanitärischer Unterricht, Sprachen, Mathematik, Näh- und Strickkurse» waren die Unterrichtsfächer.
Hotel Baur, Zürich, 1838.
Der organisierte Tagesablauf und die kriegerischen Umstände machten den internierten Frauen deutlich, «dass sie keine ‹Gäste› sind, sondern gegen den Willen dieses Staates hier ‹Gestrandete›, die jetzt eine verordnete Fürsorge erhalten». So schätzte der Eidgenössische Kommissär für Internierung und Hospitalisierung 1942 in einem Bericht die Situation ein.
Schwierige Heimkehr
Die Frauen vom Sonnenberg ho ten, rasch heimkehren zu können. Militärisch-diplomatische Quereleien verzögerten jedoch die Rückkehr. Die Schweiz galt in den Augen russischer Militärs als Kriegsgewinnler. Zudem wollte Russland sicherstellen, dass es «keine Heimkehrverweigerer» gab. Der russische Machthaber Stalin hatte im Krieg mehrmals befohlen, dass es für Russinnen und Russen nur zwei Verhaltensmöglichkeiten gibt: für das Vaterland kämpfen oder sterben. Es durfte also keine russischen Kriegsgefangenen geben, geschweige denn Internierte in einem neutralen Land.
Woran sollten sich die russischen Frauen halten? «Konnten sie denen Glauben schenken, die erzählten, sie würden zu Hause sehnlichst erwartet? Oder jenen, die sie warnten, die sich selber standhaft weigerten und im Falle der Nötigung gar von Selbstmord sprachen. Eigentlich wollten ja alle zurück», sinnierten die Historiker Stadelmann und Lottenbach. Der Tag der Rückkehr kam, der 13. September 1945.
Vom Hotel Sonnenberg führte die Rückreise nach St. Margrethen und zurück nach Russland. Der DokFilm «In die Heimat, in den Tod» (Schweizer Fernsehen, 1995) zieht ein bedrückendes Fazit: «Heute wissen wir, dass diese Reise (…) für viele der ehemaligen Flüchtlinge und nun Heimkehrer in den sibirischen Gulag und in den Tod führen sollte.»
Hotels im Ersten Weltkrieg
Das Bellevue Palace in Bern wird ab Herbst 1914 zum Hauptquartier des Generalstabs von General Ulrich Wille. Das Kriegsende brachte noch nicht das Ende der Besetzung des Luxushotels durch die Generalität. Wille verlängerte den Aufenthalt wegen des Generalstreiks im November 1918. «Nur begnügte er und seine zwei hundert Soldaten sich nun mit dem Erdgeschoss.» Während der Kommandozeit im Bellevue liess sich der General von Ferdinand Hodler porträtieren. Hodlers Bild soll er ironisch kommentiert haben: «Mittelmässig, höchst mittelmässig … aber verdammt ähnlich.»
Im Hotel Palace Luzern ging es weniger feudal zu und her als im Berner Palace. In den Kriegsjahren 1915–1918 wurde das Erd geschoss zum Warenlager für Pneus und Kriegsmaterial.
Das Maloja Palace wurde von der Armee als Kaserne benutzt.
Das Montreux Palace ist umfunktioniert worden zum Spital und beherbergte ab 1916 Hunderte von französischen und englischen Kriegsverletzten. Die krieg führenden Staaten bezahlten für die Pflege ihrer Verletzten vier Franken pro Tag und Person.
In den Grandhotels Splendid (Lugano) und Beau-Rivage Palace (Ouchy) sanken die Umsätze gegenüber den glanzvollen Vorkriegsjahre von 280000 CHF auf 115000 CHF bzw. 2,2 Millionen CHF auf 1,3 Millionen CHF.
Der Verwaltungsrat des Beau-Rivage Palace, Ouchy, stellte 1917 fest, dass viele Hotelrechnungen offenblieben: «Die Schulden stammen fast ausschliesslich von alten, treuen Kunden, vorwiegend Russen, die sich in einer heiklen finanziellen Lage befinden, da sich ihr Kapital nicht in die Schweiz transferieren lässt.» Der Grund war die Oktoberrevolution. Weiter konstatiert die Hotelführung: «Es ist uns angesichts unserer Verpflichtungen unseren Hypothekargläubigern gegenüber nicht möglich, gegenüber unseren Kunden als Bankier aufzutreten.» Offene Rechnungen sollten jede Woche gemahnt werden.
Es gab Grandhotels in Genf, Bern, Zürich oder Lausanne, die vom Krieg profitierten. Sie wurden zum «Asyl» für Flüchtlinge, die «ein wahrhaft unerschöpfliches Vermögen besassen» und den «Sinn für Luxus nicht verloren».
(Quelle: Thierry Ott, Palaces, 1990)
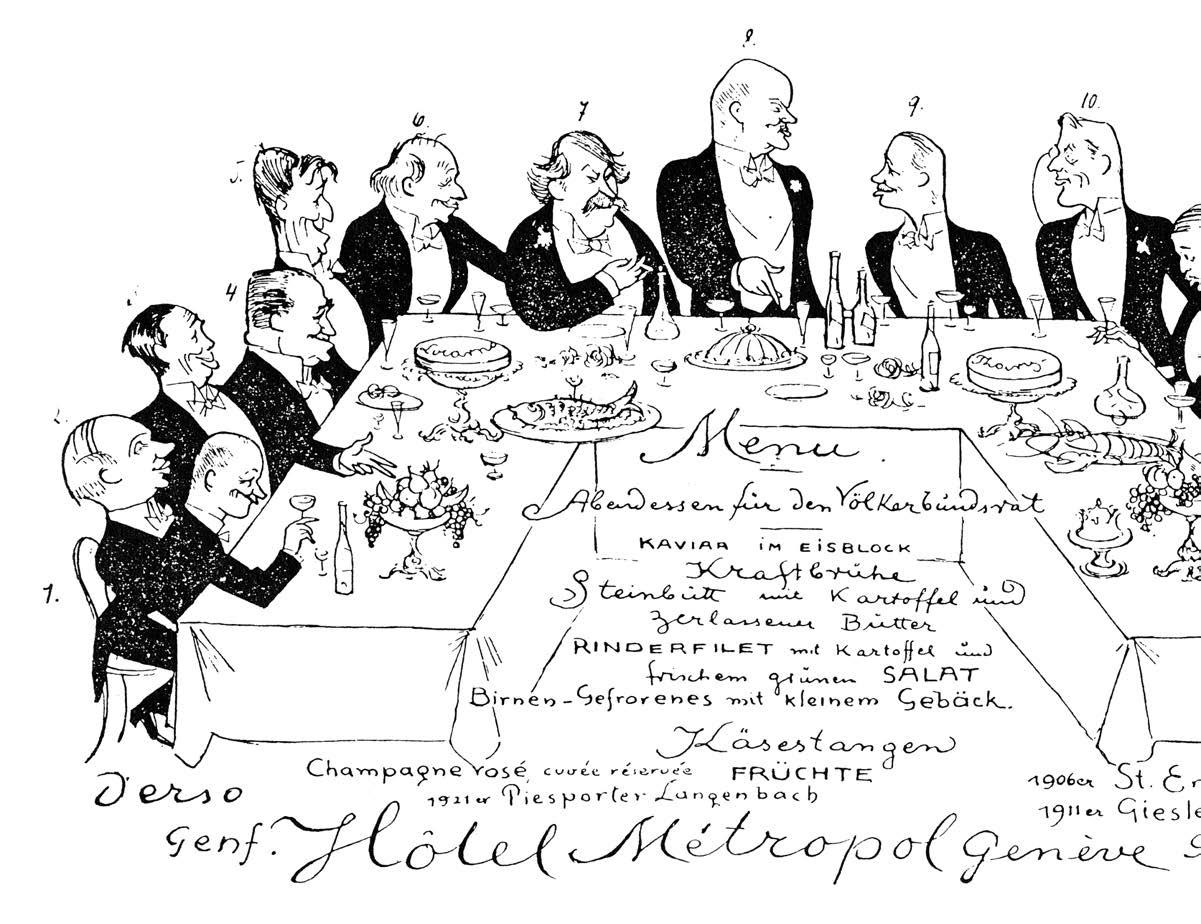
Verwendete und weiterführende Literatur
Bergier-Bericht: Schlussbericht der unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, Präsident JeanFrancois Bergier, Zürich, 2002 (zitiert: BergierBericht)
Edgar Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität, Band VI, 1939–1945 (Bonjour)
· Simon Erlanger, «Nur ein Durchgangsland». Arbeitslager und Internierungsheime für Flüchtlinge und Emigranten in der Schweiz 1940–1949, Zürich, 2006 (Erlanger)
· Carl Ludwig, Die Flüchtlingspolitik der Schweiz in den Jahren 1933 bis 1955. Bericht an den Bundesrat zuhanden der eidgenössischen Räte (Ludwig-Bericht)
ierry Ott, Palaces. Die schweizerische Luxushotellerie, Yens-sur-Morges, 1990 (Ott)
· Isabelle Rucki, Das Hotel in den Alpen. Die Geschichte der Oberengadiner Hotelarchitektur ab 1860, Baden, 2012 (Rucki)
· Die Schweiz und der Zweite Weltkrieg, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Vol. 47., 1997, Nr.4, (Zeitschrift Geschichte)
Jürg Stadelmann, Samantha Lottenbach, Gestrandet auf dem Sonnenberg. Flüchtlings- und Rückwandererheim «Hotel Sonnenberg», siehe www.geschichte-luzern.ch/spurensuche-aufdem-sonnenberg, Flüchtlingsheime in Luzerner Hotels während des Zweiten Weltkrieges (publiziert am 1. Mai 2015), besucht am 5. März 2022 (Stadelmann/Lottenbach)
Jürg Stadelmann, Umgang mit Fremden in bedrängter Zeit. Schweizerische Flüchtlingspolitik 1940–1945 und ihre Beurteilung bis heute, Zürich, 1988

Genfer Hotellerie profitierte von den Diplomaten des Völkerbunds, Karikatur 1927.
Hotels im Zweiten Weltkrieg
Das Grandhotel Tschuggen in Arosa trotzte dem Kriegswinter 1940 und wollte seine Gäste «verwöhnen». Für wärmende Kohle und genügend Lebensmittel für die Küche sei gesorgt, wurde in einem Inserat versprochen. Zudem sollte das Orchester wieder eingestellt und ein «Bridge- sowie ein Skilehrer beschäftigt werden».
Die Gäste sollten im «gesunden, sonnigen Klima von Arosa jene Kräfte tanken können, die sie so dringend benötigten» – und zwar ohne Preiserhöhung.
In St. Moritz schlossen vier der fünf grossen Häuser, offen blieb nur das Palace. Das Grand Hotel St.Moritz wurde zur Truppenunterkunft und brannte 1942 unter nicht restlos geklärten Umständen ab.
Die Seiler-Häuser in Zermatt schlossen mit dem Ende der Sommersaison 1939.
Das Waldhaus in Sils-Maria und das Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz blieben offen, auch wenn sich die Übernachtungen massiv verringerten.
Das Palace Bürgenstock wurde der Kommandoposten des Generalstabs der fünften Division. Das Palace in Luzern wurde, wie schon im Ersten Weltkrieg, zum Lager umfunktioniert. Zusätzlich wurde ein Spital eingerichtet.
14 Grandhotels an der Waadtländer Riviera wurden als Kinderheime, Auf nahmestätten für jüdische Flüchtlinge und Lager für amerikanische Kriegs internierte genutzt, darunter das Palace in Montreux und in Mont-Pèlerin oder das Grand Hôtel von Caux.
Das Beau-Rivage in Genf stellte 1940 den Betrieb ein. Das Métropole wurde Ende 1941 von der Stadt Genf dem Komitee des Internationalen Roten Kreuzes bis zum Ende des Krieges zur Verfügung gestellt. Die Stadt hatte das Hotel günstig kaufen können. Sie übergab es dem IKRK zur Erfüllung seines «humanistischen Werks» – unentgeltlich.
(Quelle: Thierry Ott, Palaces, 1990)

Andreas Züllig.
Ukrainekrieg: Gespräch von Hilmar Gernet mit Andreas Züllig, Präsident HotellerieSuisse
Logiernächte nicht gegen Leid der Flüchtlinge aufrechnen
DBilder: zVg
ie Flüchtlinge, wie sie aus der Ukraine jetzt in der Schweiz eintreffen, sind für Andreas Züllig eine Art Déjàv u. Als zehnjähriger Bub, erzählt er zu Beginn unseres Gesprächs, erlebte er im elterlichen Hotel am Bodensee, wie 1968 – nach dem Prager Frühling – Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei in die Schweiz kamen. «Im grossen Saal unseres Hotels haben wir etwa 100 Flüchtlinge aufgenommen, die auf Matratzen auf dem Boden geschlafen haben. Ich habe den Flüchtlingskindern meine Spielsachen geschenkt.» In der gegenwärtigen Flüchtlingssituation tauchten diese Erlebnisse und Erinnerungen wieder auf, machen ihn betroffen und lassen ihn mitfühlen.
«Nach dem Mauerfall 1989», so Züllig, «schien der Kalte Krieg überwunden.» Mit der politischen Entwicklung seither, mit der Globalisierung, der Digitalisierung und den neuen Medien seien wir doch davon ausgegangen, dass «ein Krieg in Europa nicht mehr passieren kann». Umso härter sei es, sich von dieser Haltung zu verabschieden. Wir müssten uns auf die neue Realität einstellen.
«Das Leid in der Ukraine ist unglaublich. Wir dürfen es nicht aufrechnen mit Logiernächten, die wir in der Schweiz verlieren, oder mit höheren Benzinpreisen. Das sind keine grossen Probleme im Vergleich mit jenen in der überfallenen Ukraine. Uns geht es noch immer sehr gut», analysiert er die Lage der Schweiz. Klar ist auch, dass die Fernmärkte USA und Asien nun nicht die eigentlich erwartete Erholung bringen. «Für Gäste aus diesen Weltregionen herrscht in Europa Krieg», sagt er weiter.
Wie schätzen Sie die direkten Kriegsfolgen für die Hotellerie in der Schweiz ein?
Für die einzelnen Betriebe werden die Kosten steigen. Energie ist ein wesentlicher Kostenfaktor in unserer Branche. Die höheren Lebensmittelpreise aufgrund der ausfallenden Ernten in der ukrainischen Kornkammer oder das wegfallende russische Gas werden den finanziellen Aufwand in den Hotelbetrieben erhöhen. Diese Kosten können aber nicht eins zu eins an die Gäste weitergegeben werden. Schliesslich ist mit einer gewissen Inflation zu rechnen und die Hypothekarzinsen dürften steigen. Das sind neue finanzielle Realitäten, die viele Unternehmen stärker belasten werden.
Dennoch haben viele Hotels sehr schnell ihre Hilfe angeboten und Flüchtlingen unbürokratisch ihre Infrastrukturen und ein Bett zur Verfügung gestellt.
Das war eine wunderbare Geste. Wir haben gezeigt, dass wir eine empathische Branche sind und uns in die Menschen einfühlen können.
Es gab aber auch negative Stimmen. Man hörte, dass Hotels aus dem Leid der Flüchtlinge ein Geschäft machten. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Das ist schon fast eine bösartige Unterstellung. Bei einem Betrag von 70 Franken für eine Übernachtung und 50 Franken für die Vollpension kann absolut nicht von einer Volldeckung der Kosten gesprochen werden. Zu bedenken ist weiter, dass auch der Bund Aufwand und Kosten hätte, wenn er Unterbringung und Verp egung der Flüchtlinge selbst in die Hand nehmen müsste. Ich sehe in vielen Hotels in der jetzigen Situation aber nicht eine kleinliche Buchhaltermentalität. Vielmehr wird spontane Hilfe geleistet, und Flüchtlinge werden teilweise kostenlos aufgenommen. Eine beachtliche Zahl von Hotels verzichtet auf einen Bundesbeitrag, weil sie etwas von der selbst erfahrenen Hilfe während der akuten Coronaphase zurückgeben möchten.
Erachten Sie es als realistisch, dass Flüchtlinge mit dem Schutzstatus S in der Hotellerie und im Gastgewerbe eine Arbeitsmöglichkeit nden? Mir scheint es, in unserer Branche gute Möglichkeiten zu geben. Viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind gut ausgebildet und sprechen Englisch. Solche Personen haben gute Chancen, in die Arbeitsprozesse einbezogen zu werden, die in einem Hotel zu leisten sind. Dass Deutschkurse mit bis zu 3000 Franken unterstützt werden, begrüsse ich. Es ist ein Beitrag, um Flüchtlinge aus- und weiterzubilden. Ihnen so auch eine Tagesstruktur zu geben, erachte ich als sehr wichtig. Nichts Schlimmeres, als wenn sie nichts tun können und immer an den Krieg, ihre Angehörigen und Freunde in der Ukraine denken müssen.
Wird HotellerieSuisse besondere Aktivitäten für die Ukraine-Flüchtlinge lancieren?
Das ist nicht vorgesehen. Aber unsere Branche ist sehr gut geeignet, durch direkte und konkrete Angebote in den Hotels vor Ort und in Zusammenarbeit mit den Behörden zu helfen. Zudem hat der Verband sehr schnell eine Website zur Ukraine geschaltet. Da nden sich alle relevanten Infos für die Hoteliers und die Zusammenarbeit mit den Ämtern. Zudem kommen jetzt die in den letzten Jahren aufgebauten guten Kontakte mit den beiden Staatssekretariaten für Migration, SEM, und für Wirtschaft, SECO, zum Tragen. Dieses Netzwerk ist bei der erneuten Krisenbewältigung sehr nützlich.
Sie liefern das Stichwort: Wir stecken seit Jahren im Krisenmodus. Die Bankenkrise 2008, dann die Eurokrise 2015, seit 2020 gefolgt von der Coronakrise und nun der Ukrainekrieg. Immer wieder muss die Hotel- und Tourismusbranche neu anfangen, wenn auch nicht ganz bei null. Stellen Sie nicht langsam eine Motivationskrise in der Branche fest?
Bei uns gibt es keine Motivationskrise. Sie haben die Krisen genannt, die sich den Stafettenstab sozusagen übergaben. Aber die Resilienz in der Branche ist enorm hoch. Zudem gab es in den letzten Jahren auch Lichtblicke. Trotz Corona konnten die auf den Binnenmarkt Schweiz ausgerichteten Hotels gute Ergebnisse erzielen. Und noch jetzt gehen wir davon aus, dass die Europäer weiterhin zu uns in die Schweiz kommen.
Das klingt schon beinahe professionell berufsoptimistisch.
Mit Krisen und ausserordentlichen Situationen umzugehen, gehört bei uns Hoteliers zur Grund-DNA. Das ist auch in unserem Berufsalltag so, wo wir immer wieder die individuellsten Wünsche unserer Gäste erfüllen. Aber ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass es derzeit darum geht, Mitgefühl zu zeigen und den Flüchtlingen zu helfen. Der Blick auf ihre traurige Situation relativiert unsere eigenen Sorgen.


Ukrainekrieg ruft bei Andreas Züllig Kindheitserinnerungen wach.
Sinnstiftende Branche
Es ist die Kinderzeit, die diese Haltung bei Andreas Züllig prägte. Diese lässt er sich auch heute nicht nehmen. So erachtet er politische Vorstösse für die Hotelbranche im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg momentan als nicht nötig. «Wir sind gut aufgestellt. Das System funktioniert. Unsere Kontakte zur Politik spielen gut.»
Der HotellerieSuisse-Präsident ist überzeugt davon, dass die Hotelbranche gerade jetzt ihre besten Trümpfe spielen kann. «Wir sind eine sinnstiftende Branche. Wir können den Menschen etwas Gutes tun.» Und man glaubt ihm, wenn er damit gleichermassen die Hotelgäste und die Flüchtlinge meint, die jetzt unsere Gastfreundschaft benötigen.

Brillantes, das berührt
Was das Uhrwerk für die Zeitmesser ist, sind sie für ihre Bijouterie und ihr Schmuckatelier: die Herzen, die es in Schwingung halten. Brigitte und Patrick Aeschbacher über Uhrenhandwerk und Schmuckunikate, die verbinden.
Text: Daniela Dambach Bilder: zvg
8.58 Uhr. Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk schliessen Brigitte und Patrick Aeschbacher ihre Bijouterie im Bälliz auf – wie sie das seit über 20 Jahren tun. 21, um genau zu sein, denn ihr Geschäft ist die Genauigkeit. Aber auch der gute Geschmack, die Haute Horlogerie und das Handwerk. Im Jahr 2000 haben sie den Laden übernommen, dessen Geschichte weiter zurückreicht. Das Rad der Zeit mit einem schwungvollen Schubs retourgedreht, landet man im Jahr 1965, als Ursula und Fred Bläuer ihr Uhrengeschäft in un gründeten.
Wer die 200 Quadratmeter der Bijouterie Bläuer betritt, vermutet, ein vielstimmiges Ticken zu vernehmen. Doch die Schönheiten folgen stumm ihrem Sinn, denn alle Zahnrädchen greifen präzise ineinander, leise, rhythmisch und reibungslos. Es versammelt sich die gesamte Virtuosität der Uhrmacherkunst in den Vitrinen. Lu xuriöse Zeitmesser von Manufakturen wie Breitling, Rado, Certina oder Chopard, zwecks fachkundigem – oder einfach fasziniertem – Blick eins zu eins nebeneinander auf die ebenhölzerne eke oder gar um die Handgelenke gelegt, zu vergleichen, ist ein Kaliber für sich. Schliesslich müssen


Uhrenvernarrte üblicherweise ein, zwei Stündlein mehr einplanen, um die markenspezi schen Stores abzuklappern. Auch die Services, bei denen die Uhrmacher das Innenleben der Zeitmesser hemmungslos o enlegen, bietet Bläuer im hauseigenen Atelier. Durch eine Glasscheibe hindurch lassen sich die Uhrmacher beobachten, wie sie mit Vergrösserungsglas, Zehntelmass und Schraubenzieherchen an reiskornkleinen Komponenten operieren.
In den Ateliers, nur wenige beschwingte Schritte entfernt von der Bijouterie, beugen sich die Meister ihres Fach in ähnlicher
«Wir sind zwei – und doch eins, für immer vereint» – das symbolisieren die Colliers Mother & Daughter, die aus zwei Anhängern bestehen, die einzeln oder kombiniert tragbar sind. In verschiedenen Gold- und Edelsteinvariationen erhältlich.

Jahrzehntelange Erfahrung bei farbigen Juwelen: Was die Gemmo logen erlesen, daraus fertigen die Goldschmiede in den Thuner Ateliers Schmuckkreationen.
Weise über die Werkbänke, doch was sie unter der Lupe formen und feilen, dient nicht der prunkvollen Pünktlichkeit, sondern der zeitlosen Zierde. Seit über 120 Jahren be ndet sich hinter den Fassaden des schmalen Altstadthauses die Schmuckmanufaktur Frieden, die Brigitte und Patrick Aeschbacher 2018 übernommen haben.
Das Frieden-Team sorgt für Strahlen und Leuchten – sowohl mit Unikaten, die es von der Skizze bis zum sprichwörtlichen «letzten Schli » individuell gestaltet, wie auch mit eigenen Schmucklinien. Was vor Jahren in Wien bei einem Hof juwelier mit ersten Schritten begann, führt Brigitte Aeschbacher heute leidenschaftlich fort: Die hochkarätigen Preziosen tragen ihre Handschrift, wie jüngst die Kollektion Mother & Daughter. «Als Hommage an die Verbindung zwischen Mutter und Tochter», beschreibt sie ihre Idee, die bei einem Spaziergang am unersee mit ihrer Tochter Alexandra entstand.





Zwei Herzen im Gleichtakt:
Brigitte und Patrick
Sorgfältig löst sie das Collier von ihrem Hals, um den Kunstgri vorzuführen: Aus einem Schmuckstück werden zwei. Die trennbaren Anhänger zieren Farbedelsteine – eine Faszination, welcher omas Frieden mehr als sein halbes Leben lang frönt. Die Suche führt den Gemmologen an entlegene Orte der Welt, wo er seltene Schätze aufspürt mit einem Sinn, den man als «siebten» bezeichnen muss, denn mit Wissen allein sind seine kostbaren Funde nicht zu erklären. Sie sind sowohl Wertanlage wie «Grundstein» für Geschmeide, für die es Brigitte Aeschbacher gewiss nicht an Inspirationen mangelt. «Kommt eine Idee bei meinem Mann gut an, kommt sie überall gut an», stellt sie lächelnd fest. Er sei der «purste Kritiker», be nden beide einstimmig. Wie eingespielte Zugfedern treibt das Unternehmerpaar ihr Tagewerk an, bis es sich dem widmet, wofür es sich immer genügend Zeit nimmt: der Familie.
Aesch bacher führen seit 2000 die Bijouterie Bläuer, vor vier Jahren übernahmen sie die Schmuckmanu faktur Frieden.
Bijouterie Bläuer
Bälliz 40, 3600 Thun www.blaeuer-uhren.ch
Schmuckmanufaktur Frieden
Obere Hauptgasse 37, 3600 Thun www.frieden.ch

Diplome für 35 neue Hotelführungskräfte, Schweizerische Hotelfachschule Luzern
Diplom und «Imagine» für Führung und gegen Fake News
Diplomfeiern sind Landung und Start zugleich. Wer ein Berufsdiplom erreicht, legt nach einer anstrengenden Bildungsreise eine Ziellandung hin. So wie es 35 dipl. Hôteliers-Restaurateurs HF und dipl. Hôtelières-Restauratrices HF an der SHL Schweizerischen Hotelfachschule Luzern gelang. Aber auch «Ehrenrunden» schaden nicht.
Text: Hilmar Gernet Bilder: Nicole Martin/SHL

Die glücklichen Diplomierten.
Gestartet waren die Studierenden der SHL des Jahres 2022 mit dem sehr interpretationsfähigen Motto «SHL Space Taxi». Diesem Motto nahm sich die SHL-Direktorin Christa Augsburger auch in ihrer Diplomansprache an. Sie verglich die verschiedenen Ausbildungsstationen mit den Sternen unseres Sonnensystems, auf denen das SHL-SpaceTaxi einen Halt machte oder manchmal bloss in Sichtweite an ihnen vorbei og.
Knotenpunkt Fronto ce
Eine wichtige Station im Space-Flug ist in ihrer Darstellung der Merkur, benannt nach dem Götterboten, dem Gott der Kommunikation. Im Hotel ist das Fronto ce der Kommunikationsknotenpunkt. Da ist der Dreh- und Angelpunkt des Systems, des Netzwerks Hotel. Hier gelte es, entstandene Knoten durch Vermittlung zu lösen. Egal, ob sie durch «schwierige Kunden, Marsmenschen oder E.T.» verursacht worden sind, meinte Augsburger augenzwinkernd. Wer im SHL-Studium eine Ehrenrunde drehen muss und eine Prüfung zu wiederholen hat, solle daran nicht verzweifeln. «Solche Umwege», so Christa Augsburger, «erhöhen die Welt-All-Kenntnisse.»
Prüfungen stören
Zu Prüfungen äusserten sich auch Sabrina Zwicky und Lars Betschart in ihrem launigen Rückblick auf das Studium: «In unserer Ausbildung sind wir Pro s der Apérokultur geworden; leider ist sie nicht geprüft worden.» Sie plädierten auch für ein Prüfungsverbot während der Luzerner Fasnacht. Die Guggenmusikklänge sollten nicht die Prüfungen stören. Gemeint war, dass Prüfungen nicht die Fasnacht stören sollen. Keine Fragen liess ihr Sprüche-Fazit o en: «Schade, dass es endlich vorbei ist.»
Wissen versus Fake News
Traditionsgemäss gehört zur Diplomfeier der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern eine Rede vom SHLStiftungsratspräsident, Urs Masshardt. Diesmal wolle und müsse er «über die Gewalt in der Welt», den Krieg in der Ukraine, reden. Trotzdem sollten die Diplomierten die Hauptdarsteller des Tages bleiben. Masshardt begann mit einer eingängigen Argumentationskette: «Viele politische Führer können lügen. Wir werden zum Spielball von Fake News. Wer permanent lernt, kann die Macht des Wissens erlangen und sich gegen Fake News wehren.» Dies sei ein wesentliches Element in einer Führungsrolle. Er folgerte weiter: «Macht ist, wenn einer macht und die andern mitmachen. Verantwortlich ist man für alles, was man macht oder nicht macht.»
«Imagine»
Als angehende Führungskräfte hätten sie als Hoteliers und Hotelièren die Aufgabe, zusammen mit ihren Mitarbeitenden «die Resilienz der Menschen im Alltag zu stärken». Konkret verwies er auf die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden sowie die Wertschätzung der Mitarbeitenden für die Gäste. Diese Haltung untermalte er mit dem Lied «Imagine» von John Lennon:
Refrain
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
Sie können sagen, ich bin ein Träumer
Aber ich bin nicht der Einzige
Ich ho e, du wirst uns eines Tages beitreten
Und die Welt wird eins sein
Schlüssel zum Erfolg
Bei der Diplomübergabe, erstmals nach zwei Jahren ohne Pandemieeinschränkungen, lobte die Direktorin das SHL-2022-Space-Team. «Sie sind als Team zusammengewachsen und haben eruiert, wo Sie alle Ihr Spezialwissen sowie Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen haben.» In Augsburgers Augen war es «eine rundum geglückte gemeinsame Reise, auf der die Ziele in hohem Masse erreicht wurden und die Moral ‹on board› vertrauensvoll und gut war». Ihre Rede schloss Christa Augsburger mit dem Wunsch an die jungen Führungspersönlichkeiten: «Mögen Sie alle Ihre Galaxy nden und auf tollen Missionen Ihre Kompetenzen und Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen können.»
Die Diplomarbeit, die den Transfer zwischen Tradition und Moderne am besten darstellte, ist mit dem Kronenhallen Heritage Preis der Hulda und Gustav Zumsteg-Stiftung gekürt worden. Zudem sind die drei Studierenden, die das Studium mit den besten Noten abschlossen, mit Blumen und Gutscheinen von Relais & Château prämiert worden: Lars Betschart (Notenschnitt: 5,65), Jimi Müller (5,36) und Sabrina Zwicky (5,33). Da schulische Noten nie die individuelle und ganzheitliche Leistung der Studierenden abbilden, erhielten alle Diplomierten für ihre beru iche Weiterreise einen versilberten Schlüssel, den symbolischen «Schlüssel zum Erfolg» – und endlich das verdiente Diplom.

Ausbildner und ihre erfolgreichsten Ausgebildeten, von links nach rechts: Christa Augsburger, Direktorin SHL, Lars Betschart, Sabrina Zwicky, Jimi Müller, Timo Albiez, Stv. Direktion.



Anzeige

Diplomfeier 2022, Schweizerische Hotelfachschule Luzern
Junge Hoteliers sehen die Zukunft nicht rosig, sondern
realistisch
Hotelier werden in Zeiten der Krisen?
Die Hotellerie hat durch die Coronapandemie und den Ukrainekrieg einen schweren Stand.
Wie sehen die drei besten jungen Hoteliers in diesen herausfordernden Zeiten ihre Zukunft?
Sie beurteilen die Situation nicht rosig, sondern realistisch: die Krise als Chance. «Hotelier»: «Hotelière» hat an ihrer Diplomfeier in Luzern mit ihnen gesprochen.
Die Antworten auf die vier «Hotelier»: «Hotelière»-Fragen zeigen, dass die Attraktivität des Berufs bei den jungen Hotelièren und Hoteliers ungebrochen ist. Die Ausbildung bietet eine breite Grundlage für viele mögliche Berufswege Von Zukunftszweifeln ist bei den jungen Führungskräften nichts zu spüren.
Lars Betschart, Brunnen
Jg. 1996
1. Rang: Note 5,65
Zu 1) Der Höhepunkt war für mich die Exkursion in die Weinhandlung Vergani nach Zürich. Die Weindegustation und die Köstlichkeiten der Tavolata, das war echtes Learnig by Doing.
Zu 2) Negative Erlebnisse sehe ich immer auch als Chancen. In unserer Branche müssen wir in dieser Hinsicht noch exibler werden. Vor allem in der Digitalisierung ist noch viel zu tun. Ein gutes Beispiel ist in meinen Augen Das Morgen in Vitznau –Roboter, die servieren, oder das SelfCheck-in. Wenn wir in diesem Bereich Fortschritte machen, dann können wir auch schneller und exibler reagieren. Das ist auch die Erwartung, die ich an mich stelle.
Zu 3) Mein Traum ist es, als Generalmanager ein 5-Sterne-Stadthotel in New York zu führen.
Zu 4) Ab Mai werde ich im Parkhotel Vitznau als Junior Front O ce Manager arbeiten. Dort habe ich bereits ein Praktikum absolviert. Im Herbst will ich in Luzern an der Fachhochschule das Bachelor-Studium beginnen.
1. Was war das Highlight der Ausbildung an der SHL?
2. Welches sind Ihre Erwartungen oder Hoffnungen trotz Pandemie und Krieg und der damit ver bundenen schwierigen Situation für die Hotel branche?
3. Wo möchten Sie beruflich in zehn Jahren sein?
4. Wo starten Sie Ihren beruf lichen Weg mit dem Hotelierdiplom im Sack?
Jimi Müller, Wädenswil
Jg. 1997
2. Rang: Note 5,36
Zu 1) Die Teamarbeiten und das vertiefte Kennenlernen von Produkten haben mich fasziniert. Vor allem die Geschichten hinter den Produkten interessieren mich.
Zu 2) Die Situation ist momentan schwierig, aber sie hilft auch und ist eine Chance. Der Wandel, der in der Branche bereits im Gang ist, wird beschleunigt. Der Weg zu nachhaltigem Tourismus hat in dieser Situation gute Chancen. Generell geht es darum, die einzelnen Personen und die einzelnen Produkte zu sehen und nicht die Masse. Und es geht um Entschleunigung.
Zu 3) Gerne möchte ich etwas Eigenes haben. Was, ist nicht so wichtig. Ich möchte selber bestimmen und gestalten können. Es soll ein nachhaltiges Unternehmen sein – nicht unbedingt ein Resti oder ein Hotel. Auch im Eventbereich kann ich mir etwas vorstellen.
Zu 4) Ich werden als Junior Food-Consultant bei Betty Bossi beginnen und im Bereich Produktentwicklung arbeiten.
Sabrina Zwicky, Meilen
Jg. 1994
3. Rang: Note 5,33
Zu 1) Die Vielfalt in der Ausbildung und die tollen Leute haben mir sehr gut gefallen. So verschieden wir alle sind, gab es gleichzeitig viel Verbindendes. Besonders viel gelernt habe ich über die Lebensmittel und die Wertschöpfungsketten.
Zu 2) Mir scheint, dass die Wertschätzung für den Beruf der Hotelière und des Hoteliers grösser wird. Die Gäste erkennen, welchen Knochenjob wir leisten, und das bei einem eher kleinen Lohn. Der Wandel passiert aber nicht einfach, wir müssen die drängenden Fragen auch angehen – die Löhne oder die 4-Tage-Woche. Die Hotellerie ist und bleibt eine tolle Branche, aber wir müssen den Gästen unsere Leistungen klar machen.
Zu 3) Etwas Eigenes aufmachen ist mein Ziel. Dazu habe ich mit Kollegen bereits ein Konzept entwickelt – Richtung Restaurant.
Zu 4) Ich starte beim GDI Gottlieb Duttweiler Institut als Managerin im Bereich Sales und Events.
Die Gespräche führte Hilmar Gernet.

Wo Hund und Herrchen sich pudelwohl fühlen
Zum dritten Mal sind 2022 die beliebtesten 50 Unterkünfte für den Urlaub mit Hund mit dem hundehotel.info Award ausgezeichnet worden. Zur Auswahl standen 645 Hotels aus zehn europäischen Ländern. Drei Auszeichnungen gehen in die Schweiz.
Text: bearbeiteter zVg-Text Bild: Adobe Stock
In den Top Ten der 50 ausgezeichneten Hundehotels ndet sich auf Platz 7 das Hotel Gravas Lodge aus Vella (GR). Platz 39 (zugleich Platz 5 der Aufsteiger-Hundehotels) belegt das Chalet-Gafri BnB in Wilderswil/Interlaken. Platz 45 erreichte das dritte klassierte Schweizer Hundehotel Valsana in Arosa.
Pluspunkt Pizzeria
Das beliebteste Hundehotel der Schweiz im Val Lumnezia wird von Beatrice und Fabio Di Blasi-Brand geführt. Auf 1250 m ü. M. warten nicht nur wunderschöne Wanderwege der Bündner Alpen, sondern auch eine grosse, eingezäunte Hundespielwiese, Hundekurswochen und komfortable Zimmer mit Fress- und Trinknäpfen. Ein Pluspunkt für die Herrchen und Frauchen ist die Pizzeria Gravas mit herrlicher Sonnenterrasse.
Unter den 50 prämierten Hotels be nden sich 28 in Österreich, 14 in Deutschland, 5 in Italien sowie 3 in der Schweiz. Das gesamte Top-50-Ranking ndet sich auf www.hundehotel.info/award. Die drei Siegerhotels 2022 sind das Landhotel Haus Waldeck (Phillippsreut, Bayern), Hotel Magdalena (Platz 2, Ried im Zillertal, Tirol) und das Naturforsthaus (Platz 3, Preitenegg, Kärnten).
Sechs Doggies
Das Team von hundehotel.info hat ein eigenes Kategorisierungssystem von einem bis sechs Doggies entwickelt. Ähnlich wie bei den Hotelsternen zeigen die Doggies an, wie hundefreundlich das Angebot in der Unterkunft ist. Ein Doggy bedeutet, dass Hunde im Hotel erlaubt sind. Sechs Doggies bedeuten, dass das Hotel auf Hunde und Hundebesitzer spezialisiert ist.
Die Bewertungskriterien und Ansprüche entwickeln sich laufend weiter, wie Christoph Reichelt, Redaktionsleiter von hundehotel.info, feststellt: «Der Service, den die Hotelbetreiber den Hunden und Hundebesitzern bieten, wird immer umfangreicher und reicht von täglich frischen Speisen bis zu hundegerechten Fitnessgeräten und spezieller Hundephysiotherapie.»
Den Trend zum Urlaub mit dem Hund erkennen auch die Hoteliers. Sie investieren in hundefreundliche Ausstattungen und bieten auch den einen oder anderen Luxus für Hunde. Zur Grundausstattung von hundefreundlichen Hotels zählt im Zimmer ein eigener Hundeschlafbereich inklusive Hundekissen. Andere Betriebe verwöhnen ihre Gäste auf vier Pfoten zudem mit exklusiven Serviceleistungen wie Hundetrainings, besonderen Nahrungsmitteln, eigenem Badeteich, professioneller Hundewaschanlage, inklusive Föhn oder Fitnessangeboten und Massagen.
VEREINIGUNG DIPLOMIERTER
Echtzeit-Projekttag versorgt VDH-Mitglieder mit konkreten Zukunftsideen
Am Echtzeit-Projekttag des Studiengangs 47 im Hotel Seaside in Spiez wurden sechs innovative und kreative Ideen und Businesspläne für Hotels und Restaurants präsentiert. Auch eine Markthalle oder ein Privat-Spa waren dabei.
Text: Roland Gasche, Präsident VDH und Lehrgangsleiter NDS HF Hotelmanagement
Der modular aufgebaute NDS HF Hotelmanagement-Lehrgang besticht durch verschiedene unternehmerische Disziplinen, die in 18 Monaten von den Teilnehmenden absolviert werden. Nebst den drei Modulen, MENSCH, MARKT, MITTEL, die jeweils mit einer Prüfung abgeschlossen werden, setzen sich die Teilnehmenden neben ihrer Diplomarbeit mit einer Echtzeit-Projektarbeit auseinander. Im vierten und letzten NDS-Modul HOSPITALITY werden dann alle Disziplinen vernetzt. Den Abschluss dieses Moduls bildet die Präsentation der Echtzeit-Projekte.
VDH-Networking am 9. Mai in Bern
Am Vorabend der alljährlichen Mitgliederversammlung, der Ver einigung diplomierter Hoteliers-Restaurateure SHV, Hotelmanager:innen NDS HF, vom 9. Mai 2022, werden die Pforten für Networking, Erfahrungsaustausch und Freundschaftspflege geöffnet. Das Lehrgangstreffen (Zyklustreffen) aller Teilnehmer:innen des Unternehmerseminares (US) oder Nachdiplomstudiums HF Hotelmanagement (NDS) sind zum Apéro und gemeinsamen Dinner am 8. Mai 2022 im Kornhauskeller in Bern herzlich eingeladen. Weitere Infos und Anmeldungen für die Mitgliederversammlung und das VDH & US/NDS-Treffen unter www.events.vdh.swiss oder bei der Geschäftsstellewelcome@vdh.swiss.
Beim letzten Studiengang wurden von den Teilnehmenden sechs Echtzeit-Projekte mit einer Kurzpräsentation vorgestellt. Danach wurden die Projektteams zusammengestellt. Im Zentrum der Projektauftraggeber stand ein Businessplan. Er sollte Auskunft über die Tragbarkeit und die Machbarkeit eines Bauprojekts aus Sicht der Mieter und der Eigentümer geben.
Während sechs Monaten arbeiteten die Teams mit Begleitung des Projektcoaches und Lehrgangleiters intensiv an den gestellten Aufgaben. Am 11. März wurden die Ergebnisse den Auftraggebern, den Kolleginnen und Kollegen und Gästen präsentiert.
Kreativ am Bodensee:
Biergarten und kleine Zimmer
Zwei Projekte wurden von den Ufern des Bodensees eingereicht. Bei der Krone in Altnau handelte es sich um ein komplettes Neubauprojekt, das aus der Sicht des Mieters bearbeitet werden musste. Neben einem Restaurant mit grosser Terrasse soll ein Biergarten mit Selbstbedienung entstehen. Es ist zu erwähnen, dass die Bewilligung der neuen Krone in Altnau, die direkt am Ufer des Bodensees zu liegen kommt, in der heutigen Zeit eine grosse Ausnahme darstellt.

Beim Hotel Drachenburg in Gottlieben geht es um eine Restrukturierung und den teilweisen Ausbau. Bei diesem Projekt galt es, die Sicht der Eigentümer zu bearbeiten. Das Hotel Drachenburg liegt am Bodenseeufer. Die Herausforderung bestand in erster Linie darin, eine elegante Lösung in die wunderschönen alten Räume zu zaubern. Zu bedenken war auch, dass die alten Zimmer nicht gerade riesig sind und trotzdem geeignete Lösungen für Neues zu nden waren. So brauchte es viel Kreativität und Vorstellungskraft, denn der einfache Weg, die Zimmer zu vergrössern, bestand nicht.
Denkmalschutz kreierte Privat-Spa
Mit dem Projekt Park Hotel Winterthur reichte ein städtischer Hotelbetrieb ein Echtzeit-Projekt ein. In einem denkmalgeschützten Haus eine Projektidee für einen Spa- und Wellnessbereich zu entwickeln, ist eine grosse Herausforderung. Sie wurde vom Projektteam mit sehr innovativen und kreativen Ideen gemeistert. Man wählte den Ansatz des Privat-Spa, der sich mit vielen tollen und unerwarteten Ideen durch das Projekt zog.
Enge Vorschriften: Holzbau als Lösung
Im Berner Oberland, im Haslital, liegt das ChaletHotel Schwarzwaldalp. Hier galt es für das Team, sich mit dem Neubau eines Hotels aus Sicht eines Mieters auseinanderzusetzen. Die Rahmenbedingungen waren anspruchsvoll: Das örtliche Baureglement verbietet den Neubau eines Chalets. Für das bestehende Chalet gibt es keine Ausbaumöglichkeit. Im erarbeiteten Businessplan wurde die Idee eines gut in die Landschaft integrierten Holzbaus aufgezeigt. Damit entsteht ein Betrieb, der den heutigen Ansprüchen genügt, der e ektiv und erfolgreich geführt werden kann.
Etappenplan führt zum Ziel
Ein gut etappierter Plan soll im Aparthotel Goldey in Unterseen bei Interlaken sicherstellen, dass die aktuelle Geschäftsführerin und künftige Inhaberin die notwendigen Umbauten tatsächlich realisieren und tragen kann. Bei diesem Projekt ging es um eine nanziell tragbare Form der Renovation von Zimmern. Zudem sollten die Bereiche Eingang, Lobby und Frühstücksraum neu gestaltet werden. Nicht betro en vom Projekt waren die bestehenden Suiten. Sie sollten so weitergeführt werden wie bisher.
Markthalle, Brauerei, Gewölbekeller
Aus Sumiswald im Emmental, wurde das sehr interessante Projekt Markthalle eingereicht. Es geht darum, in einem bestehenden Gebäude einen Markt mit Produkten von Produzenten aus der Region einzurichten. Kunden aus der Umgebung und Touristen sollen sich in der Markthalle selbst bedienen können. Nebst einer Brauerei soll auch ein Gastronomiekonzept integriert weden. Der bestehende Gewölbekeller soll für Gruppen und Events genutzt werden. Die Markthalle, so das Ziel, soll ein echter Begegnungsort werden.
Der Echtzeit-Projekttag des NDS Hotelmanagement entwickelt sich mehr und mehr zum unverzichtbaren Event für zukunftsorientierte Hoteliers. Oder wie es ein Hotelier sagte: «Wer echte Innovation und Kreativität in unserer Branche erleben will, der muss am NDS-Projekttag unbedingt dabei sein.»
Roland Gasche.
Bruno- omas Eltschinger im Gespräch mit dem Sommelier-Weltmeister
Marc Almert –Sommelierkönig aus Zürich
Mit 27 Jahren wurde Marc Almert 2019 in Antwerpen zum 16. Sommelier-Weltmeister ASI, dem renommiertesten Sommelier-Wettbewerb der Welt, gekürt. Der junge Sommelier verkörperte schon damals eine neue Generation. Sie verbindet Ehrgeiz mit Bescheidenheit, Dienstbereitschaft mit Anstand und Demut.
Text: Bruno- omas Eltschinger Bilder: zVg
Es war ein beru icher Generationenwechsel, als der Titel des «SommelierWeltmeisters» an Marc Almert vergeben wurde. Sein Sieg hatte eindrücklich gezeigt, dass ein moderner zeitgemässer Sommelier nicht mehr allein durch gelerntes Weinwissen überzeugt und punktet. Er verkörpert eine Generation, die Ehrgeiz mit Bescheidenheit, Dienstbereitschaft mit Anstand sowie Demut mit Bodenständigkeit verbindet. Almert repräsentiert eine Berufsjugend, die unaufgeregt, pragmatisch, strukturiert und zielgerichtet an eine Prüfung geht und nicht verbissen den Sieg mit angelerntem, lexikalischem Fachwissen sucht oder bei seinen Gästen arrogant auftritt.
Genussmanager ohne Stress
Dieser junge Sommelier wirkt nie gestresst, verbissen, nervös oder übermotiviert. Seine Auftritte sind stets sympathisch, humorvoll, professionell und hö ich. Die Herzlichkeit gegenüber seinen Gästen bleibt in jeder Situation nicht angelernt, sondern glaubwürdig, ruhig, empathisch und unaufgeregt. «Ein Sommelier ist nicht nur ein Weinkenner, er ist vielmehr ein Genussmanager», so Almert. Er muss in der Lage sein, den Gast während seines kompletten Restaurantbesuchs zu beraten. Hinzu kommt ein geschultes Auge für menschliche Interaktion, eine breite soziale Intel-

ligenz und das Wissen um wirtschaftliche Kriterien wie e zientes Management.
Marc Almert ist in Köln aufgewachsen. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann und Barmixer im Jahr 2011 absolvierte er ein Trainee im F&B-Management. Während seiner Ausbildung im Kölner Excelsior Hotel Ernst fand im historischen Weinkeller eine Probe mit Egon Müller sowie Dominic Symington von der gleichnamigen Portwein-Gruppe statt. Dabei wurden diverse reife Weine ausgeschenkt, die er mit verkosten durfte. Es überraschte und faszinierte ihn besonders, wie lebendig und spannend diese «alten» Weine waren – die meisten waren schliesslich mehr als doppelt so alt wie er selbst und in seinen damaligen Augen «nur vergorener Traubensaft», der ihn ob dieser Langlebigkeit völlig verblü te. Die Frage, warum ihm gewisse Rebsorten schmecken und andere nicht, sollte schliesslich seinen beru ichen Werdegang bestimmen.
Gespannt auf das nächste Glas Wein
In den darau olgenden Stationen in Luxushotels in ganz Deutschland entschied er sich endgültig für den Beruf des Sommeliers und entdeckte seine Leidenschaft als Gastgeber. Die Grundlagen erlernte er im Restaurant Ente in Wiesbaden. 2014 folgte der Wechsel ins Fair-

So sieht der Sommelier-Weltmeister Welt und Wein
Sind Sie ein Gefühls- oder Kopfmensch?
Bei Entscheidungen Kopfmensch, beim Wein eher Gefühlsmensch. Wein ist Leidenschaft.
mont Hotel Vier Jahreszeiten nach Hamburg, wo er mit 22 Jahren seine erste Festanstellung als Sommelier begann. Seit Januar 2017 ist er für das 2-Sterne-Restaurant Pavillon des Zürcher Traditionshotels Baur au Lac als Chef-Sommelier tätig und übt den Beruf mit Leidenschaft und Demut aus. Almert ist ansteckend neu gierig und stets auf das nächste Glas Wein gespannt. Genau das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein.
Erfolg folgt Erfolg
Marc Almert hat eine ausgeprägte A nität für kulturhistorische emen. Zudem ist ein hohes Mass an Disziplin ein weiteres Attribut, das zu seinem beru ichen Erfolg beiträgt. Marc Almert nahm während seiner Laufbahn an zahlreichen Wettbewerben teil. 2015 gewann er den Concours National des Jeunes Sommeliers der Chaîne des Rôtisseurs Allemagne und 2016 den Gaggenau International Sommelier Award sowie den Wines of South Africa International Sommelier Cup.
Der grösste Erfolg seiner Karriere ist der Gewinn des «ASI Best Sommelier of the World 2019» im belgischen Antwerpen. Zwei Jahre zuvor sicherte es sich bereits die Auszeichnung «Bester Sommelier Deutschlands». 2020 zeichnete der Michelin Guide Switzerland ihn mit dem «Sommelier Award» aus. Nur wenige Wochen später wurde Almert vom Schweizer Falsta zum «Sommelier des Jahres» gekürt. Im Jahr 2021 erkor ihn eine Publikumswahl auch noch zum «Sommelier des Jahres SVS 2021». Eine wahrhaft märchenhafte Karriere.
Was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Der tägliche Kontakt mit Menschen aus vielen Ländern, sowohl als Gäste als auch im Team.
Welchen Geschmack verbinden Sie mit Ihrer Kindheit? Baumkuchen und Zitroneneistee.
Was wollten Sie als Kind nie essen?
Grünes. Wenn beispielsweise die Pasta zu viele Kräuter drauf hatte, wurde ich bockig.
Welcher Wein hat ursprünglich Ihre Liebe zum Wein geweckt?
Ein gereifter Riesling von der Saar.
Welchen Wein haben Sie zu Hause immer vorrätig?
Champagner, Bordeaux Cru Bourgeois, gereiften Pinot Noir, und auch eine gekühlte Flasche feinherber Riesling fehlt nie.
Welche Weinpersönlichkeiten haben Sie am meisten beeindruckt?
Jancis Robinson MW, Gerard Basset MS MW OBE, Serge Dubs, Markus del Monego MW.
Wie wichtig sind Köche für die Arbeit der Sommeliers?
Essenziell. Ohne ein spannendes Speiseangebot hätten wir keine Gäste, denen ich Wein einschenken könnte. Die gesamte Gastronomie lebt vom Teamwork und vom Austausch untereinander.
Was erwarten Sie von einem guten Sommelier?
Ein gutes Gespür für Gäste, Demut, Leidenschaft und Neugier.
Marc Almert.
Welches Erlebnis mit einem Winzer vergessen Sie nie?
Auf Kloster Eberbach Riesling aus dem Jahr 1945 zu kosten. Dabei noch vorgelesen zu bekommen, was die Kellermeister in diesem Jahr, als der Zweite Weltkrieg endete, in ihre Annalen schrieben, bleibt mir immer in Erinnerung.
Was ist Ihre letzte Weinentdeckung?
Cinsault aus Südafrika – ein Muss nicht nur für Beaujolais-Fans.
Welches war der beste Wein Ihres Lebens und wo haben Sie ihn getrunken?
Ich bin kein Freund von Superlativen. Es gibt viele besondere Momente mit spannenden Weinen, inspirierenden Menschen, genussvollen Speisen und tollen Orten.
Welches Erlebnis mit einem anderen Sommelier vergessen Sie nie?
Bei Sonnenaufgang am östlichsten Teil der Weinwelt Gisborne in Neuseeland im Pazi k schwimmen zu gehen und dabei mit diversen Kolleginnen und Kollegen einen leichten lokalen Muscat zu geniessen.
Bei was unterscheiden sich Küchenchef und Sommelier?
Wir suchen Produkte eher anhand des Gastes aus. Ein Küchenchef sucht Produkte eher auf Grund der eigenen Handschrift und Stilistik aus.
Was fällt Ihnen an anderen Menschen als Erstes auf?
Die Augen und die Körperspannung.
Wie lautet Ihr Lebensmotto? ink positive.
Was war die mutigste Entscheidung in Ihrem Leben?
Mit 22 Jahren die Stelle als alleiniger Sommelier im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg anzunehmen.
Wer sind Ihre Vorbilder?
Aurélien Blanc, Gerard Basset, Serge Dubs, Markus del Monego und meine Eltern.
Was ist der beste Rat, den Sie je erhalten haben?
Kants kategorischer Imperativ: «Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.»
Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen?
Hartkäse, Dauerwurst, frische Früchte und je eine Flasche Champagner und eben feinherber Riesling.
Welche Haushaltsarbeit machen Sie am liebsten?
Den Weinkeller aufräumen.
Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?
Immer wieder mit einem Glas Wein in der Hand in malerischen Weinregionen zu sein.
Auf welcher Website verbringen Sie online am meisten Zeit?
Bei GuildSomm, auf dem Wine-Blog Terroirist und der NZZ.
Welches ist das beste Buch, das Sie gelesen haben?
Zum Entspannen lese ich meist historische oder politische riller.
Wie verbringen Sie am liebsten Ihre Freizeit?
Im Gespräch mit inspirierenden Menschen, am liebsten am Tisch mit spannenden Speisen und vielschichtigen Weinen.
Was bedeutet Ihnen Zürich und die Schweiz?
Es ist nun seit fünf Jahren meine geliebte Wahlheimat. Ich ho e, es werden noch viele weitere Jahre.
Was hat Sie in letzter Zeit emotional sehr berührt?
Das Wiedersehen mit unseren Stammgästen nach den Lockdowns. Wir haben uns gegenseitig sehr vermisst.
Gibt es etwas, was Sie unbedingt noch erleben wollen?
Mein Ziel ist es, alle Weinregionen dieser Welt zu bereisen. Da fehlen noch etliche, so war ich noch nie in Südamerika.

Zie ekoch
CONCORDE Hotel am Flugplatz –elegante Kontraste
Im Rahmen eines kompletten Faceliftings wurden Räume und ö entliche Bereiche im CONCORDE Hotel am Flugplatz in Donaueschingen neu aufgeteilt und abwechslungsreich eingerichtet. Es sind persönliche Nischen und grosszügig lichtdurch utete Tre punkte, die hier entstanden. Alles im Einklang mit ausgesuchten Einrichtungskomponenten in Rezeption, Lobby und Restaurant – kontrastreich, chic und modern. Gross ächige, beleuchtete Bildmotive aus der Luftfahrtgeschichte be ügeln die Räume mit einem charmanten Hauch von grosser, weiter Welt und Nostalgie in der Lobby und den Hotelzimmern. Ein Highlight ist der gross ächige Aufdruck einer Concorde entlang der Rezeptionstheke.
concorde-donau.de zieflekoch.de
Duscholux
Moderne InteriorTrends. En-SuiteHotelzimmer.
Raum-in-Raum-Lösungen, wie DUSCHOLUX System 210, helfen Architekturbüros bei der Entwicklung exibler Raumkonzepte. System 210 passt sich dabei ohne grossen Aufwand den wandelnden ästhetischen Bedürfnissen der Raumeigner an. Dabei erfüllt es höchste Designansprüche und ermöglicht die individuelle Ober ächengestaltung – ohne traditionelle Trockenbaulösungen oder Sonderprodukte vom Glasereibetrieb. Das heisst nahezu ohne bleibende Eingri e in die Bauphysik.
Mehr dazu auf duscholux.com/system210

Hotelier
Hotelier
28. Jahrgang hotelier.ch
Herausgeberin
Weber Verlag AG Gwattstrasse 144 CH-3645 Gwatt/Thun 033 336 55 55 weberverlag.ch
Verlegerin
Annette Weber-Hadorn a.weber@weberverlag.ch
Verlagsleiter Zeitschriften
Dyami Haefliger d.haefliger@weberverlag.ch
Chefredaktor Dr. phil. Hilmar Gernet h.gernet@hotelier.ch
Redaktion
Karl Wild k.wild@hotelier.ch
Anzeigenverkauf Maja Giger m.giger@hotelier.ch
Aboverwaltung Anja Rüdin a.ruedin@weberverlag.ch
Layout Nina Ruosch Cornelia Wyssen
Bildbearbeitung Adrian Aellig
Korrektorat David Heinen
Druck AVD Goldach AG Sulzstrasse 10 – 12 9403 Goldach
Preise Abonnement
1 Jahr (6 Ausgaben + 2 Sonderausgaben): CHF 120.–2 Jahre (12 Ausgaben + 4 Sonderausgaben): CHF 240.–Einzelausgabe: CHF 16.–, Ausland zuzüglich Porto ISSN 1664-7548
WEMF/SWBeglaubigung 2021 Total gedruckte Auflage: 8000 Exemplare Total verbreitete Auflage: 7160 Exemplare Davon verkauft: 2676 Exemplare
Verband Schweizer Medien Die Weber Verlag AG ist Mitglied im Verband Schweizer Medien
Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck von Artikeln ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion und genauer Quellenangabe gestattet. Mit Verfassernamen beziehungsweise Kürzel gezeichnete Veröffentlichungen geben die Auffassung der Autoren und nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Publiziertes Bildmaterial, sofern nicht angeführt, wurde dem Verlag zum Abdruck zur Verfügung gestellt. Für unaufgefordert eingereichte Manuskripte und Bilder kann keine Haftung übernommen werden.
Offizielles Publikationsorgan «Hotelier» ist das offizielle Publikationsorgan des Schweizer Sommelierverbandes ASSP-SVS und der Swiss Hospitality & Marketing Association SHMA sowie der Vereinigung dipl. Hoteliers VDH.



Margot Faucherre: «Ich habe alles, was ich brauche.»

Margot Faucherre wuchs im elterlichen Hotelbetrieb im Walliser Bergdorf Grächen auf. Vor über 20 Jahren zog sie mit ihrem Ehemann ins Tessin. Seit elf Jahren ist sie
Direktorin im 4 -Stern-Hotel Ascovilla in Ascona. Das reizvolle Hideaway an bester Lage in der Nähe des Sees und der Piazza entwickelte sich unter ihrer Führung rasch zu einem der beliebtesten und besten Ferienhotels der Schweiz.
Womit langweilt man Sie am meisten?
Mit Jammern über Gott und die Welt.
Was weckt Ihre Begeisterung?
Begeisterungsfähige Menschen.
Was macht Sie glücklich?
Unbeschwerte Stunden mit meinem Mann, meinem Sohn und seiner Frau.
Was macht Sie traurig? Ungerechtigkeit und Machtlosigkeit.
Ihr bisher grösster Erfolg?
Eidgenössische Matura im Fernstudium neben einem Fulltime-Job.
Der grösste Flop?
In jedem Flop sehe ich in erster Linie, was ich daraus lernen und wie ich das Vermasselte lösen kann.
Ihre Lieblingsbeschäftigungen?
Musik hören, lesen, walken.
Was möchten Sie gerne können?
So zeichnen, dass man nachher erkennt, was es darstellen soll.
Welchen Traum würden
Sie sich gern erfüllen? Ich habe alles, was ich brauche.
Ihr grösster Wunsch?
Ausgewogene Work-LifeBalance und Gelassenheit.
Ein Jahr lang Ferien – was würden Sie tun?
Freundschaften p egen, den Alltag gemütlicher nehmen und viel lesen.
Welche Persönlichkeiten bewundern Sie am meisten?
All jene bescheidenen Menschen, die es scha en, mit wenig zufrieden und glücklich zu sein.
Wer wird Ihrer Meinung nach völlig unterschätzt?
Da gibt es wahrscheinlich sehr viele, mehr als man denkt.
Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gern einen Abend verbringen?
Mit Bundesrat Alain Berset.
Was wäre das ema?
Wie er persönlich die schwierige Coronazeit erlebt hat.
Ist Ihr Leben heute spannender als vor zehn Jahren?
Ja, heute erlebe ich vieles intensiver und bewusster.
Wo leben Sie am liebsten?
In der Schweiz und jeweils dort, wo meine Familie und ich gerade wohnen.
Was haben Sie im Leben verpasst? Nichts.
Als was würden Sie am liebsten wiedergeboren werden?
Als Margot Faucherre.
Ihr Lebensmotto?
Leben und leben lassen.
Ihr Lieblingshotel – und warum?
Kein Spezielles. Ich liebe es, neue Hotels kennenzulernen und zu erkunden.
Ihr Lieblingsrestaurant –und warum?
Alle Restaurants, wo man freundlich empfangen und mit Begeisterung verwöhnt wird.
Was soll man später einmal von Ihnen sagen?
Schön, dass es sie gab.
Margot Faucherre. Bild: Moritz Hager
Kontaktlose Bestell- & Bezahlmöglichkeiten | reduzierte Laufwege | verbesserte Gästeberatung | zusätzliche Umsatzchancen


SIND SIE BEREIT FÜR EINE LAUFBAHN IN EINEM VON 39 SWISS DELUXE HOTELS?
Ergreifen Sie Ihre Chance – bewerben Sie sich bei den «Founders of Exceptional Service». WWW.SWISSDELUXEHOTELS.COM/DE/CORPORATE/KARRIEREN



