Hotelier
Das Schweizer Fachmagazin für Hotellerie & Gastronomie

Gespräch mit Murat Baki und Claudia Vogl Baki (Hotel «La Couronne», Solothurn)
Sie sind das Hotelier-Traumpaar

Das Schweizer Fachmagazin für Hotellerie & Gastronomie

Gespräch mit Murat Baki und Claudia Vogl Baki (Hotel «La Couronne», Solothurn)
Sie sind das Hotelier-Traumpaar
Hotelprojekt-Experte Damien Rottet über das Hotel nach der Pandemie. | Tourismusprofi Jürg Schmid über die Zukunft der Stadthotellerie. | EHL-Vorsitzende Dr. Carole Ackermann über Diversity und Inclusion. | NEU: Hotelbetten-Check. Kostenloses Analyse-Tool

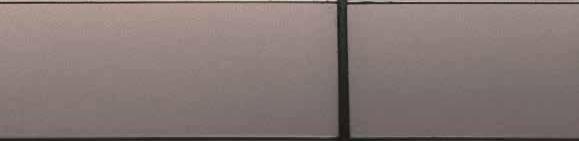


Unser Handwerk hat 47 Jahre Tradition – Sie scha en das in wenigen Minuten! Denn mit unseren in der Schweiz hergestellten Backwaren und Konditoreiprodukten servieren Sie Ihren Gästen zu jeder Zeit hochwertige süsse und salzige Köstlichkeiten. Nebst Luxushotels bedienen wir weitere Unternehmen, denen nur das Beste gut genug ist.
Bestellen Sie jetzt unsere feinen Produkte direkt auf www.romers.ch oder rufen Sie uns an unter 055 293 36 36.
















4 Editorial
6 . Szene
14 Zu Gast
«Hotelier»-Talk
16 Murat Baki und Claudia Vogl Baki: «Hotellerie ist für uns ein HerzblutBusiness»
Report Schweiz
26 Welches Hotelmodell wird nach Corona Erfolg haben?
30. Wie geht es Ihnen im Tessin, Herr Caratsch?
33 Wo sind sie denn, die Hoteldirektorinnen?
34. Stadthotels sollten vermehrt Freizeitangebote haben
36 . «Ein Hotelier und Gastwirt muss vom Virus infiziert sein»
Report Ausland
42. «Hyatt setzt vermehrt auf die Ferienhotellerie»
46. «Die Resort-Hotellerie bleibt der grosse Gewinner»
48. Wird sich der Tourismus wirklich verändern?


Food & Beverage
52. Vegetarisches Fine Dining by Andreas Caminada
60. Was steckt hinter der Traubensorte Amigne?
Sommelier
64 Was erwarten Sie von einem Sommelier?
66 . Das grosse Finale im «Splendide Royal» in Lugano
Digital
68 . Fast alles im Hotel läuft über die App
70. Warum Hoteliers flexible, digitale Systeme brauchen
Schlafkomfort
72 Swissness ist ab sofort grün!
75. Betten-Check: Kostenloses Analyse-Tool für Hotels im Internet
Events
76 . Jürg Schmid, was sind die Highlights am SID 21?
77 The Return of Travel?
10 Fragen
78. Wie lautet Ihre Perspektive für die Luxushotellerie?
VDH-News
80 Präsident als Nicht-VDH-Mitglied. Wie kommt das?
82 Am Markt
R. AMREIN
Ja, es gibt sie. Hoteliers und Hotelier-Paare, die nicht nur und ständig über Leidenschaft und Herzblut reden, sondern dies auch im Alltag leben. Ich könnte an dieser Stelle viele Namen nennen, aber ich konzentriere mich auf ein junges Paar, das seit zwei Jahren eines der schönsten und ältesten Stadthotels der Schweiz führt, nämlich das aus dem 17. Jahrhundert stammende «La Couronne» in Solothurn, ein Barockbau direkt neben der St. Ursen-Kathedrale. Ein wunderbares kleines Vier-Sterne-Boutique-Hotel mit hervorragender (klassischer) Gastronomie und wunderschön sanierten Zimmern und Suiten. Der Inhaber der Liegenschaft, die Zürcher Immobilienfirma «Swiss Prime Site», hat rund 20 Millionen Franken in die Sanierung der ehemaligen «Krone» investiert. Seit Mai 2017 erstrahlt das Haus in neuem Glanz, wie man so schön sagt. Und hat glänzende Gastgeber, die als Musterbeispiel in einem Fachbuch über «Service Excellence» Erwähnung finden könnten. Motto: «So führt man mit Leidenschaft, Herzblut, Engagement und hoher Professionalität einen Hotelbetrieb.» Sie heisen Murat Baki und Claudia Vogl Baki. Seine Grosseltern sind türkisch-syrischer Abstammung, sie stammt aus Deutschland und Österreich. Murat und Claudia haben sich 2009 kennen- und lieben gelernt. Sie sind für mich das aktuelle «Hotelier-Traumpaar der Schweiz». Leider gibt es diese Kategorie in den Hotelratings (noch) nicht.
Murat und Claudia bringen (fast) alles mit, was erfolgreiche und engagierte Gastgeber auszeichnet. Sie sind so etwas wie «Bilderbuch-Gastgeber». Ja, ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe sie «live» in ihrer Hotelwelt erlebt. Wie Murat seine Gäste empfängt, wie er auf sie eingeht, wie er mit ihnen kommuniziert – vorbildlich. Seine Frau Claudia, gelernte Restaurant- und Weinfachfrau (Sommelier), serviert den Gästen im stilvoll eingerichteten Restaurant nicht einfach schön zubereitete «Klassiker», nein, sie zelebriert die Speisen und Weine mit einem «inneren Feuer» und einer Ausstrahlung, wie ich das selten erlebe in Hotels. Und erst ihr junges, hoch motiviertes Team. Eine TopCrew. Sie haben längst begriffen, um was es in dieser Branche eigentlich geht: Der Gast will als Individuum wahrgenommen werden, er erwartet Aufmerksamkeit, authentischen, engagierten Service – er will etwas ganz Besonderes erleben. Und all das neben hoher Qualität, passendem Design, perfekt funktionierender Infrastruktur und einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie.
Kein Wunder, denken Murat und Claudia bereits an neue, spannende Herausforderungen. Zwar hätten sie «derzeit überhaupt nicht die Absicht», das wunderbare Haus in Solothurn zu verlassen, wie Claudia Vogl Baki im «Hotelier»-Talk erklärt, aber irgendwann in den nächsten Jahren wollen sie sich als Hotelier-Paar und Gastgeber verändern. Ihr Traum: ein schönes Boutique-Hotel am Wasser. Zürich. Ja, das wäre ihre Traumdestination, wie sie sagen. In die Stadt Zürich hätten sie sich verliebt, sagt Murat, dort sei auch ihr Sohn auf die Welt gekommen.
«Murat
und Claudia, die wunderbaren Gastgeber im historischen Barockstädtchen Solothurn, ersetzen
jedes Lehrbuch zum Thema «guest relations»
HANS R. AMREIN
Claudia und Murat sind nicht nur ein Paar. Hoteliers, die sechzehn Stunden am Tag durch ihr Hotel eilen und sich nur für ihr Haus aufopfern. Sie sind eine Familie, haben zwei kleine Kinder. Wie sie es schaffen, Familie, Kinder und Job unter einen Hut zu bringen, lesen Sie im erwähnten «Hotelier»-Talk. Das Beispiel Murat & Claudia zeigt eindrücklich, dass es absolut möglich ist, mit hundertprozentigem Engagement Beruf (sprich Hotel) und Familie in Harmonie zu leben. Und noch etwas: Murat und Claudia sind jung – aber bereits sehr erfolgreich, auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Murat Baki ist ein ausgewiesener Revenue-Management-Experte – er schafft es, dank cleveren Tools im Hintergrund, den Betrieb mit nur 37 Zimmern und Suiten sowie hohem Food-&-Beverage-Anteil (60%) mit Gewinn zu führen. Sein «Chef», der renommierte Gastronomieexperte Martin Volkart von der «Genossenschaft Baseltor», darf stolz sein auf sein «Traumpaar».
Was können wir von Murat Baki und Claudia Vogl Baki lernen? Leidenschaft und Herzblut sind, wie gesagt, nicht einfach schöne Worthülsen, sondern können im Alltag authentisch und professionell gelebt werden. Kann man Leidenschaft und Herzblut lernen? Kann man vielleicht sogar ein Diplom oder einen «Master in Herzblut» erwerben? Nein. Eine gewisse Begabung (DNA) muss vorhanden sein. Man muss infiziert sein vom «Service-Virus» (nicht zu verwechseln mit dem Corona-Virus). Man muss dieses Virus tief in seinem Herzen tragen. Ja, Hospitality ist eine ganz besondere und deshalb faszinierende Branche. Warum? Weil es fast immer um Menschen, Kommunikation, Erlebnisse und Geschichten geht. Es ist, wie wir alle wissen, ein «People-Business» (tönt schrecklich).
Und wo Menschen sind, spielen Leidenschaft, Achtsamkeit und Herzblut die zentrale Rolle. Zimmer über Booking.com vermarkten, ja, muss oder kann man. Essen und Trinken an den Gast bringen, ja, ergibt Sinn. Design und Hotelarchitektur, ja, kann ein Positionierungsmerkmal sein. Die Lage des Hauses, ja, kann relevant sein. Aber es geht nichts über Menschen und Geschichten. Murat und Claudia, die wunderbaren Gastgeber im historischen Barockstädtchen mit dem Namen Solothurn, ersetzen jedes Lehrbuch und jedes Weiterbildungseminar zum Thema «guest relations».
Hans R. Amrein
Hans R. Amrein, Publizist, Hoteltester, Buchautor und Dozent, ist seit 2010 Chefredaktor der Fachzeitschrift «Hotelier». Er ist auch Mitglied mehrerer Fachjurys.


DUNCAN
O’ROURKE, CEO ACCOR NORTHERN EUROPE, ÜBER DAS NEUE MÖVENPICK HOTEL BASEL:
Dort, wo früher das «Hilton Basel» stand, wird am 16. September das neue Mövenpick Hotel Basel eröffnet. 234 Zimmer und 30 Suiten bietet das neue Vorzeigehotel. General Manager ist der gebürtige Berner und Ex-Les-Trois-Rois-Direktor Reto Kocher. Was erhoffen sich die Betreiber (Accor) vom neuen Businesshotel beim Bahnhof SBB?
Das Mövenpick Hotel Basel gilt als «jüngstes Vorzeige-Projekt» der Marke. Es ist das sechste Mövenpick-Haus in der Schweiz und positioniert sich als Stateof-the-Art-Businesshotel im PremiumSegment. Es befindet sich direkt am Basler Bahnhof SBB als Teil des neuen Baloise Parks. Für den Bau des Hotels zeichnen die Architekten Miller & Maranta verantwortlich. Das Interior Design stammt aus der Feder des international bekannten Designers Matteo Thun.
Von der Baloise Group als einem der grössten Versicherungsdienstleister des
Landes entwickelt, wird das Hotel künftig von der Berliner «HR Group» als Franchisenehmerin unter der MövenpickFlagge geführt. General Manager ist Reto Kocher, der auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Luxushotellerie (Bellevue Gstaad, Les Trois Rois Basel) blickt.
«Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des Mövenpick Basel», so Duncan O’Rourke, CEO Accor Northern Europe. «Der Standort hat für uns nicht nur


eine strategische Bedeutung – für Accor ist es wichtig, das Wachstum der Marke Mövenpick in der Schweiz weiter zu fördern und die starke Position am Hotelmarkt zu sichern. Zudem sind wir stolz darauf, dass auch unsere Partnerschaft mit der HR Group weiter wachsen kann –damit zählt das Mövenpick Basel zu einem unserer wichtigsten Projekte innerhalb der Region Northern Europe».
Für den Gebäudeentwurf hat die Baloise Group mit Miller & Maranta einen renommierten Partner an Bord geholt. Das Basler Architekturbüro verantwortete den Bau des gesamten Hotels, das über 234 Zimmer und 30 Suiten (darunter 20 Junior Suiten, neun Suiten und eine Präsidenten Suite) verfügen wird. Das atmosphärische Interieur trägt dagegen ganz die Handschrift des weltbekannten Designers Matteo Thun, der für die stimmige Gestaltung des insgesamt 19 Stockwerke umfassenden Hotels in engem Austausch mit Miller & Maranta stand. Getreu dem Motto «Timeless Modern» unterstreichen warme Farben und natürliche Materialien den bewussten Stilmix aus eleganter Schweizer Schlichtheit und zeitlosem Komfort.


Aktuell betreibt Mövenpick Hotels & Resorts fünf Hotels mit insgesamt 1306 Zimmern in der Schweiz:
Das Mövenpick Hotel & Casino Genf, das Mövenpick Hotel Egerkingen, das Mövenpick Hotel Lausanne, das Mövenpick Hotel Zürich Airport und das Mövenpick Hotel ZürichRegensdorf. Das Mövenpick Resort Savognin wird das Portfolio als siebtes Hotel der Marke ergänzen.
In der Region Nordeuropa, wozu Accor aktuell 31 Länder zählt (darunter neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch die Benelux-Staaten, das Vereinigte Königreich, Osteuropa und Russland) sind aktuell insgesamt zwölf Mövenpick-Projekte in der Entwicklungs-Pipeline. Ein besonders starkes Potential sieht die Marke in Deutschland, den Nenelux-Ländern und Osteuropa. Für letzteres hat sie jüngst Verträge für vier neue Hotels unterzeichnet, wobei der Fokus auf dem Resort-Ausbau liegen wird.


Die Gastronomie
Herzstück der Marke Mövenpick ist seit jeher das Gastronomie-Konzept hinter jedem Hotel. «Das Restaurant PURO mit Showküche verbindet in ungezwungenem Ambiente lateinamerikanische Spezialitäten mit den traditionellen Aromen Asiens und den besten regionalen Produkten», schreibt Mövenpick in einer Medienmitteilung. Als Executive Chef setze der Argentinier Pablo Löhle «neue überraschende Akzente». Löhle habe zuvor auch schon die Speisekarte im Basler Grand Hotel Les Trois Rois massgeblich prägte. Zu seinen weiteren Stationen zählen die namhaften Hotels Kempinski Hotel Bristol, Grand Hyatt und Hotel Adlon Kempinski in Berlin.
Im Erdgeschoss des Hotels bietet sich das MP’s Bistro & Bar mit Aussenterrasse als Treffpunkt für Einheimische und Hotelgäste an. In modern-lässigem Ambiente werde hier «vom Frühstück über saisonal und regional inspirierte Gerichte bis hin zu raffinierten Cocktails und erlesenen Weinen alles serviert», so Mövenpick.
Als wichtiger Wirtschafts- und Veranstaltungsort international bedeutender Messen wie der Art Basel verfügt das Hotel auch über ein umfassendes Business- und MICE-Angebot. So fasst das hochmoderne Konferenzzentrum eine Gesamtfläche von 2000 Quadratmetern. Der unterteilbare Ballsaal mit einer Raumhöhe von fünf Metern gestattet Festlichkeiten mit bis zu 600 Gästen.
Ausserdem verfügt das Mövenpick Hotel Basel über einen luxuriösen Spa- und Fitnessbereich auf 240 Quadratmetern.
[01] Lobby und Eingangshalle.
[02] Doppelzimmer.
[03] Konferenzraum.
[04] Das neue Mövenpick Hotel Basel im Baloise Park.
[05] Duncan O’Rourke, CEO Accor Northern Europe.
[06] Reto Kocher, General Manager im neuen Mövenpick Hotel Basel.
PERSONELLE NACHRICHTEN JUNI UND JULI 2021

Nadja Lang, die amtierende Verwaltungsratspräsidentin der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, hat Ende Juni 2021 die operative Verantwortung übernommen und folgt somit auf Andreas Hunziker, der seinen Rücktritt als CEO im April bekanntgegeben hatte. «Nadja Lang bringt dank ihren Tätigkeiten bei Coca-Cola, General Mills und Fairtrade Max Havelaar sowie dank verschiedenen Verwaltungsratsmandaten breite strategische und operative Erfahrungen mit», so der ZFV.

Das Finale des grössten Schweizer Kochwettbewerbs, «Der Goldene Koch 2021», im Kursaal Bern hat Paul Cabayé (28), Chef de Partie Fleisch im Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier für sich entschieden. Unter den Augen einer hochkarätigen Jury hat sich Paul Cabayé nach fünfeinhalb Stunden, in denen er ein Fisch- und ein Fleischgericht zubereiten musste, gegen drei weitere Kandidaten durchgesetzt.

Mark Urech übernimmt am 1. September 2021 die Position «Leiter Ausbildung» an der Belvoirpark Hotelfachschule HF in Zürich. Sein Vorgänger, Anton Pfefferle, verabschiedet sich nach vielen erfolgreichen Jahren per Ende August 2021 in die Pension. Mark Urech ist aktuell an der Swiss Hotel Management School (SHMS) in Leysin (VD) tätig.

Nach über acht Jahren hat sich Hotelier Kurt Wodicka entschieden, beruflich neue Wege zu beschreiten und die Fred Tschanz Gastronomie-Gruppe in Zürich zu verlassen. Er führte die Hotels der Gruppe, so z. B. das Walhalla Hotel Zürich, seit 2012. Seine Nachfolgerinnen im «Walhalla» sind Claudia Jenni und Sabrina Schreiber. Wodicka wird Manager bei der Senevita Gruppe.

Mit dem Direktionsehepaar Stephanie und Michael Lehnort bekommt das Carlton Hotel St. Moritz gleich zwei neue, erfahrene Gastgeber. Nach mehreren Stationen in Deutschland und der Schweiz, u. a. Brenner’s Park-Hotel & Spa, Gstaad Palace und Park-Hotel Vitznau, konnten die beiden in den letzten Jahren im neu eröffneten Valsana Hotel Arosa als Pioniere das Thema Nachhaltigkeit in der Schweizer Hotellerie neu definieren setzten. Das Valsana Hotel Arosa wird neu vom Bündner Claudio Laager geführt. Als aktueller Viezedirektor des zur gleichen Gruppe gehörenden Tschuggen Grand Hotel Arosa ist der Weg ins Valsana nicht weit.

Im Flughafen Zürich im Herzen des Circle hat anfangs April das Hyatt Regency Zurich Airport The Circle seine Türen geöffnet. Verantwortlich ist Benno Geruschkat (50), General Manager für das Hyatt Regency und das Hyatt Place Zurich Airport The Circle sowie das The Circle Convention Center. Er übernahm vor zwei Jahren seine jetzige Position.

Tatkräftig unterstützt wird Benno Geruschkat seit Ende 2018 von Paul Dirksen (37), Cluster Director of Sales & Marketing. Der gebürtige Holländer wirkte rund drei Jahre im Hyatt Place Amsterdam als Director of Sales & Marketing.

Das traditionsreiche Sorell Hotel Rüden in Schaffhausen mit Frühstücksrestaurant, Seminarräumen und Veranstaltungsbereich hat seit Anfang 2021 eine neue Gastgeberin: Samantha Schnewlin verfügt über fundierte Erfahrung in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie und ist in der Sorell Hotelgruppe keine Unbekannte: sie war bereits von November 2016 bis Dezember 2019 im Sorell Hotel Rüden als Betriebsassistentin tätig. Die 36-jährige Schweizerin schloss 2014 an der Höheren Gastronomie- und Hotelfachschule in Thun die Ausbildung zur Dipl. Restauratrice-Hôtelière HF ab.

Thomas Ulrich (44) hat am 1. Juni die Nachfolge von Roland Barmet-Garcia (60) als Direktor des Cascada Boutique Hotels mit dem spanischen Restaurant Bolero angetreten. Barmet-Garcia, seit 1988 für das Haus am Bundesplatz in Luzern tätig, übernahm die Direktion im Jahr 1990 und prägte dabei die erfolgreiche Entwicklung des Cascada Boutique Hotels massgeblich. Er wird dem Unternehmen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und lanciert gleichzeitig ein eigenes Beherbergungsprojekt in seiner Finca in Spanien.

Im Rahmen der unternehmensweiten Umstrukturierung von Accor wurde Pascal Rüegg zum Accor Invest Vice President Operations Switzerland and Germany ernannt. Er verantwortet damit den Bereich Operations von insgesamt 35 Accor Invest Hotels in der Schweiz sowie dem benachbarten Deutschland. Zuletzt war Rüegg, der bereits seit 1992 in der Hospitality-Branche tätig ist, als Regional Vice President Mövenpick Switzerland sowie Cluster General Manager Mövenpick Zürich-Airport & Egerkingen für die Gruppe tätig.

Bei der diesjährigen Ruinart Sommelier Challenge hat die Jury von Maison Ruinart Angelika Grundler vom Hotel Baur au Lac Zürich zur Sommelière des Jahres gekürt. Die Maison Ruinart veranstaltete die vierte Ausgabe der Sommelier Challenge und lud die vielversprechendsten Sommeliers der Schweiz ein. Unter den 20 Teilnehmenden an der Ruinart Sommelier Challenge fiel die Wahl der Jury jetzt auf Angelika Grundler. Die 29-Jährige wuchs im elterlichen Hotel- und Gastronomiebetrieb am Bodensee auf und schloss ihre Restaurantfachausbildung im Brenner’s Park-Hotel & Spa, Baden-Baden ab.

Neu betreut Michael Böhlers SUM Hospitality das Arosa Vetter Hotel. Dank zugewonnenem Know-how soll das Aroser Haus für die Zukunft gerüstet werden. Der zweite Zuwachs kommt durch Raphael Simcic, der neu bei SUM Hospitality als Business-Partner tätig ist. Neben dem Arosa Vetter Hotel wird das Know how der Swiss Urban & Mountain Hospitality bereits seit Herbst 2020 im Hotel Alpina Parpan eingesetzt. Die Nachfolge für das Traditionshaus in der Lenzerheide ist damit gesichert. Das junge Direktionspaar Stephan Bittel und Alexandra Neuberger konnte diesen Winter ihre erste Saison mitgestalten.

Der Vorstand der «Zürich City Hotels» wählte Michael Böhler in den Vorstand. Böhler tritt die Nachfolge von John Rusterholz an. «Mit Böhler kommt ein neugieriger, kreativer und äusserst erfahrener Direktor in den Vorstand. Der ursprünglich aus dem Zürcher Unterland stammende Vollbluthotelier ist Group General Manager der Meili Hotels und verantwortet unter anderem die Geschäftsgänge der beiden Innenstadtbetriebe Hotel Opera und Hotel Felix», so der Vorstand. Die Vereinigung der «Zürich City Hotels» wurde 1997 gegründet und umfasst heute rund 20 Mitglieder (total 1200 Zimmer).

York Scheunemann wird Mitglied des Verwaltungsrats der EHL Holding SA und der EHL Next SA, der neuen Einheit der EHL Gruppe, die für Innovationsprojekte zuständig ist. Als Führungskraft aus der Technologiebranche werde er die Fähigkeit der EHL Gruppe, die Bildungslandschaft von morgen neu zu gestalten, zusätzlich stärken, so die EHL Group. In seiner aktuellen Rolle ist Scheunemann bei Google für Kundenprogramme im EMEA-Raum tätig.

Der gebürtige Italiener Marco Valmici ist seit rund 20 Jahren mehrheitlich in der Schweizer Tourismusbranche tätig und leitet seit Anfang Juni das Hotel La Palma au Lac in Locarno. Zuletzt war er Hoteldirektor des Sorell Hotel Rüden in Schaffhausen. Bevor Marco Valmici seine Passion in der Hotellerie fand, gab der diplomierte Saxophonist Musik- und Saxophonunterricht in Bologna und Basel. Im Jahr 2007 entschloss sich Valmici für ein Hotel-Management-Studium in Bellinzona, das er 2010 beendete.

Dream & Chill lautet das Motto des Lifestyle-Hotels Moxy (90 Zimmer), das von der RIMC Hotels & Resorts-Gruppe in Rapperswil eröffnet wurde. Geführt wird das Haus von Bernard Krabbenhöft.

In der prestigeträchtigen «Diageo World Class Competition» für Cocktails geht der 1. Platz an das Fünf-Sterne-Boutique Hotel Widder in Zürich. Ein eleganter Italiener mixte die Zürcher Institution an die Spitze. Dass er sein Handwerk versteht, hat er in Italien, London und nun in der Widder Bar unter Beweis gestellt. Doch jetzt ist es amtlich: Matteo Moscatelli ist 2021 der beste Bartender der Schweiz.

Sebastian Rabe wird Küchenchef im «Caspar» in Muri (Aargau). Seit 15 Jahren bereichert der deutsche Spitzenkoch die Schweizer Restaurantszene und sorgte zuletzt in der «Wart» in Hünenberg für eine kreative, frische und regionale Küche. Dass sich ein Küchenchef vom Format Sebastian Rabes für das «Caspar» habe begeistern lassen, sei ein Glücksfall, sagt Hoteldirektor John M. Rusterholz.
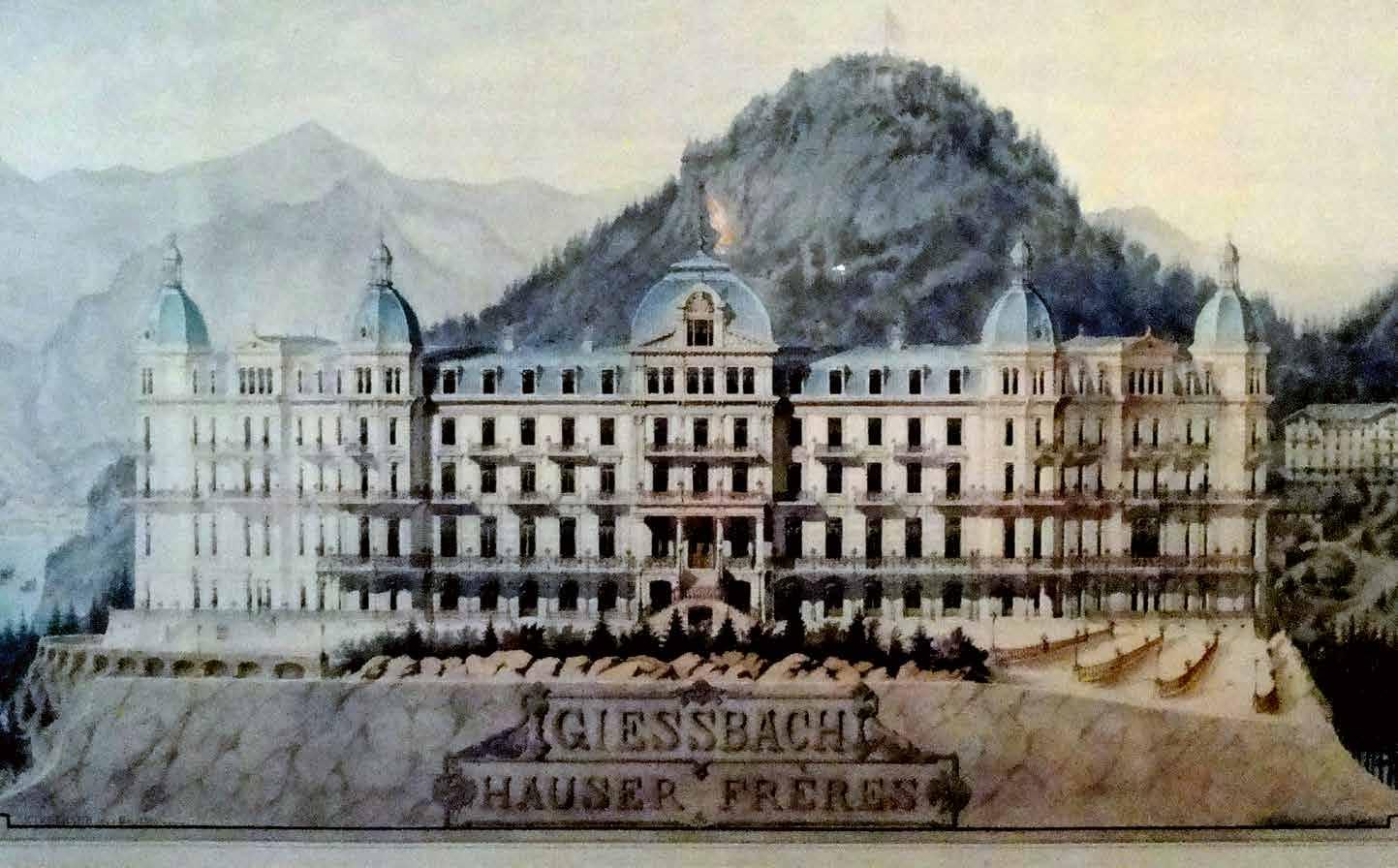
NEUES BUCH ÜBER ARCHITEKT
HORACE EDOUARD DAVINET (1839 BIS 1922)
Horace Edouard Davinet gilt als einer der wichtigsten Architekten zur Zeit der Grand Hotels in den Alpen. Zusammen mit seinem Schwager, dem Baumeister Friedrich Studer, führte er ein erfolgreiches Architekturbüro in Interlaken, in welchem er bald einmal die alleinige Führung übernahm. Bauten wie das Hotel Schreiber auf Rigi Kulm (1875), das Hotel Giessbach (1875, 1884), der Kursaal Heiden (1874), das Grand Hotel Seelisberg (1874/75) oder das Hotel Beau-Rivage in Interlaken (1873) sind oder waren Zeugen seines Schaffens.
Auch mit Projekten in Deutschland, Frankreich, Korsika und Spanien wurde er beauftragt. Weniger bekannt ist Davinets Schaffen in der Stadt Bern selbst, wo er unter anderem zahlreiche Villenbauten realisierte und sich in der Planung des Kirchenfeldquartiers engagierte. 1891 wurde er zum Direktor des Kunstmuseums berufen und wirkte als Ratgeber und Experte in der ganzen Schweiz.
Davinet erweist sich als eine Schlüsselfigur in der Berner und Schweizer Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Sein Werk und seine Leistungen
als Architekt, Siedlungs- und Städteplaner sind von gesamtschweizerischem Interesse.
Im «Hier und Jetzt Verlag» ist soeben das erste umfassende Buch über Davinet erschienen. Verfasst hat es die in Bern aufgewachsene Architekturhistorikerin Alexandra Ecclesia. Das Buch ist eine Überarbeitung ihrer Abschlussarbeit an der Universität Lausanne.
Seit 2018 arbeitet sie bei der Denkmalpflege der Stadt Lausanne.
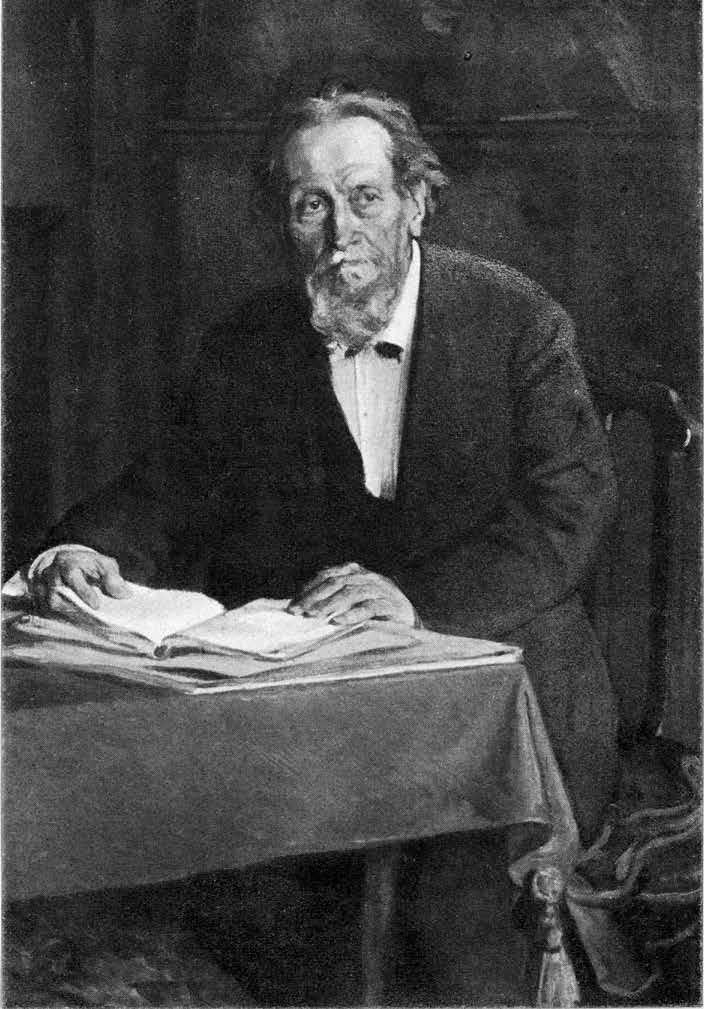
[01] Im Stil eines französischen Barockpalastes: Das alte, ursprüngliche Giessbach Hotel im Jahr 1875.
[02] Hotelarchitekt Horace Edouard Davinet (1839 bis 1922).
Autorin: Alexandra Ecclesia 248 Seiten, 240 schwarz-weisse und farbige Abbildungen, gebunden CHF 49.–, Verlag Hier und Jetzt Mai 2021, 978-3-03919-525-1
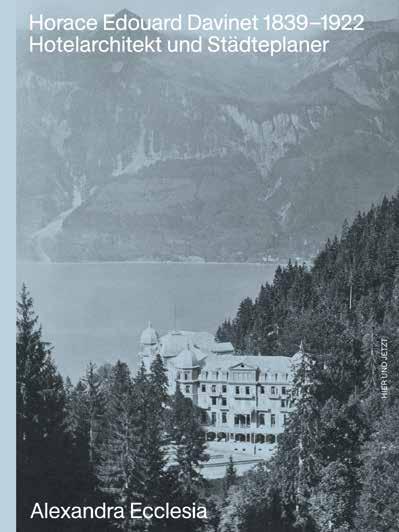
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (IHG)
Willemijn Geels, Vice President Development Europe bei der Intercontinental Hotels Group (IHG), kündigt starkes Wachstum mit neuen Marken an – auch im deutschsprachigen Raum (DACH). «Wir haben während der gesamten Pandemie ein erhöhtes Interesse an Kurzstrecken-, Freizeit- und Inlandsreisen festgestellt, und die Holiday-Inn-Markenfamilie hat sich in dieser Zeit als äusserst widerstandsfähig erwiesen. Wir haben ein spezielles Resort-Team und bieten Eigentümern eine Reihe von Entwicklungsmodellen, wenn sie ein Resort-Produkt in Erwägung ziehen. Für die Zukunft sehen wir in der DACH-Region starke Wachstumschancen für unsere Premiummarke Voco sowie für die Marken Intercontinental und Kimpton im Luxussegment. Aktuell haben vier Resorts in Europa eröffnet und 14 befinden sich in unserer Entwicklungspipeline», so Willemijn Geels gegenüber der deutschen Fachzeitung AHGZ.

Und welche Standorte sucht IHG und ab welcher Grösse? «Je nach Standort suchen wir typischerweise nach Immobilien, die eine Zimmerzahl von 70 und mehr haben. Es sei denn, es handelt sich um ein Produkt der gehobenen Luxusklasse, bei dem eine kleinere Zimmerzahl in Betracht gezogen wird, da die Gäste einen intimeren Aufenthalt erwarten. Wir schauen uns aktiv auch schweizerische Alpen-Destinationen an, von denen wir gesehen haben, dass sie jetzt eher ganzjährig als saisonal betrieben werden.»
Und: «Wir glauben, dass Marken innerhalb der Resort-Kategorie zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.»

Willemijn Geels, Vice President of Development Europe der Intercontinental Hotels Group.
«Alpen Gold Hotel»
Michel Reybier Hospitality hat Anfang Juni das Management des Intercontinental Davos übernommen und führt das Haus unter dem neuen Namen «Alpen Gold Hotel». Bereits Ende 2019 erwarb AEVIS VICTORIA die Immobilie des Intercontinental Davos sowie dessen Betreibergesellschaft Weriwald AG. Nach der Beendigung des Vertrages mit Intercontinental, sei es daher nur selbstverständlich, dass AEVIS VICTORIA das Management dieses Flagship-Hotels in die bekannten Hände von Michel Reybier Hospitality lege, betont die Hotelgruppe.
«Das Hotel hat eine Menge zu bieten und ich freue mich sehr, ihm eine neue Dynamik geben zu können. Insbesondere hoffe ich, dass nach der Übernahme die Davoser Bevölkerung das Hotel als einen integralen Bestandteil des Ortes sieht und annimmt. Es soll, auch gerade aufgrund seiner Lage inmitten der Natur, ein Treffpunkt für alle sein. Grundsätzlich wird sich das Alpen Gold wieder in der Schweiz etablieren müssen», erklärt Michel Reybier.
Das Universum fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden. Nun soll 2027 ein Hotel in der Erdumlaufbahn mit faszinierenden Möglichkeiten für 280 Gäste eröffnen. Eine Sporthalle, in der die Spieler sechsmal höher springen können als auf der Erde, eine Hotelsuite mit Ausblick auf den blauen Planeten und Übernachtungspreise ab 5 Mio. US-Dollar. Das soll ein Weltraumhotel bieten, dessen Eröffnung nach ehrgeizigen Zeitplänen für das Jahr 2027 geplant ist.
Das Projekt verwirklichen will die amerikanische Firma Orbital Assembley Corporation. Das Unternehmen hat sich auf das Bauen im Weltraum spezialisiert und will unter anderem auch ein Solarkraftwerk im Weltall erstellen. Geplant ist eine riesige Voyager Station im All mit 11 600 Quadratmeter Wohnfläche in Modulen und Röhren zum Leben, Arbeiten, Spielen und Essen. Die Menschen werden von einer Leichtigkeit des Lebens fasziniert sein, denn die Schwerkraft soll nur ein Sechstel der Erdanziehungskraft betragen.
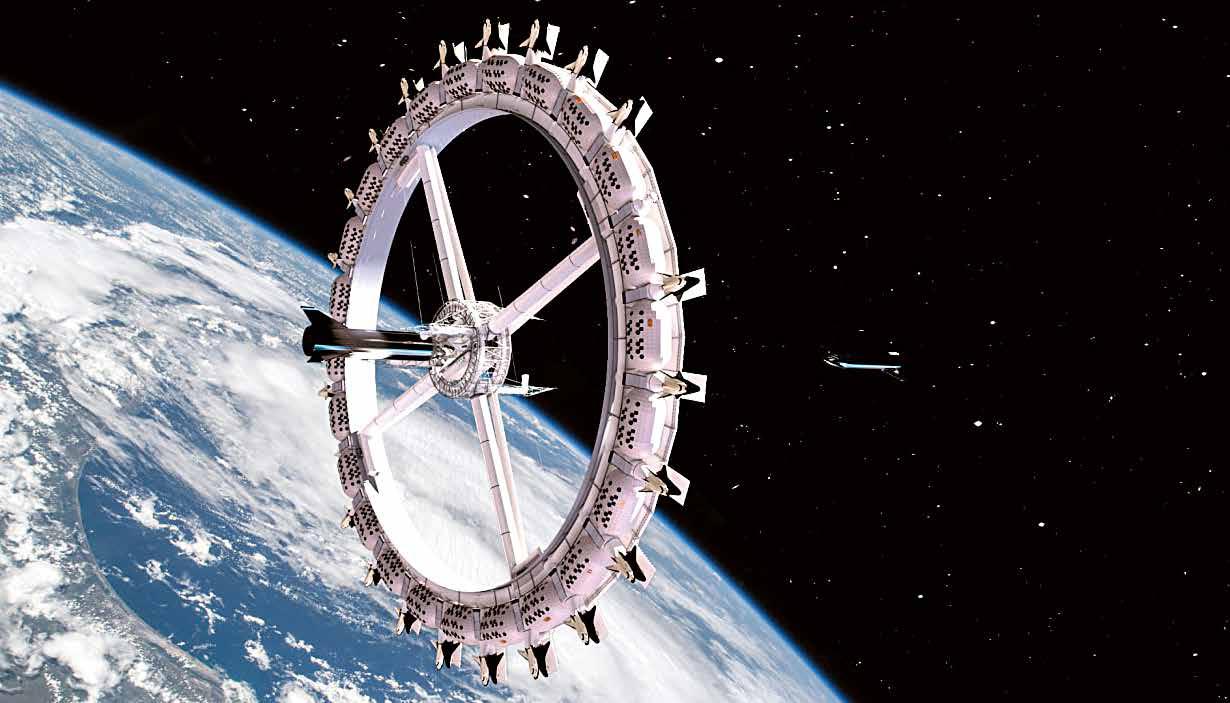
So könnte das Weltraumhotel aussehen.
Das Vorhaben ist allerdings nicht die erste Ankündigung dieser Art. Schon 2001 wurde publik gemacht, dass vielleicht 2004 das Weltraumhotel «Mini Station 1» gebucht werden könne. «Die private Weltraumstation kostet umgerechnet 218 Millionen Mark, finan-
HOTELIMMOBILIENMARKT 2021 IM DACH-RAUM
lauten die

Das erste Halbjahr 2021 war in Bezug auf Transaktionen im Hotelbereich ein äusserst ruhiges: Gerade zwei nennenswerte Verkäufe im DACH-Raum konnten verzeichnet werden. In Stuttgart wurde das Projekt «Turm am Mailänder Platz», welches von den beiden Betreibern Adina Hotels und Premier Inn betrieben wird, für rund 137 Mio. Euro verkauft, in Frankfurt die Villa Kennedy (Betreiber: Rocco Forte).
Martin Schaffer, Geschäftsführer und Partner von mrp hotels, sieht dies symptomatisch für das Jahr 2021: «Im Gegensatz zu vielen internationalen Experten sehen wir die Lage differen-
ziert vom russischen Raketenbauer Energiya und zwei amerikanischen Geschäftsleuten», hiess es damals.
zierter. Unserer Ansicht nach wird es auch im zweiten Halbjahr zu keinem rasanten Anstieg der Transaktionen oder Portfoliobereinigungen kommen.»
Die Ursache für den zurzeit schwachen Transaktionsmarkt sieht mrp hotels unter anderem in den Staatshilfen, die fortdauernd ausgezahlt, aber noch nicht fällig gestellt wurden. Genauso wie in der schwierigen Beurteilbarkeit in der Qualität bzw. finanziellen Leistungsfähigkeit der Betreiber. «Für Investoren sind aufgrund der fehlenden Einsichtsmöglichkeiten und aussagekräftiger Kennzahlen viele Betreiber weiterhin eine absolute ‹Black Box›», so Martin Schaffer.
Was bringt der Ruf nach «Diversity» und «Inklusion», der zurzeit durch alle Branchen hallt? Was versprechen wir uns für die Hospitality-Industrie von Diversity in allen Dimensionen – und was soll sich dadurch nicht nur verändern, sondern sich vielmehr verbessern? Dr. Carole Ackermann, Verwaltungsratspräsidentin der EHL Holding AG und Vorsitzende der EHL-Stiftung, zeigt im folgenden «Hotelier»-Gastbeitrag Mittel und Wege auf.
Viele Produkte des täglichen Gebrauchs wie Kleider, Möbel, Nahrungsmittel, Autos, Elektronik und ähnliches richten sich an eine immer breiter werdende Kundschaft mit unterschiedlichen Vorstellungen und diverser Herkunft, was sich in vielen spezifischen Varianten bezüglich Gestaltung, Farbe und Funktionsweise niederschlägt. Man schätzt, dass zirka 80 Prozent der Konsumentscheide von Frauen getroffen werden und dass sogar in der mutmasslichen Männerdomäne, dem Autokauf, in 60 Prozent der Fälle Frauen die finale Entscheidung über Modell, Farbe und Innenraumgestaltung treffen – während sich Männer noch auf PS und Fahreigenschaften fokussieren. Die Autoindustrie hat daher vermehrt die Frauen im Fokus, wenn es um die Gestaltung der Fahrzeuge geht.
Noch extremer ist es bei der Wahl der Feriendestination und der Auswahl von Hospitality-Anbietern oder auch der Buchung von Geschäftshotels, wo Assistentinnen entscheiden und zunehmend Frauen selbst auf Geschäftsreise sind. Wir können also der Frage nicht ausweichen, auf welche Gäste wir unsere Angebote ausrichten – dies in Bezug auf Gender, Altersgruppe, Interessen etc. – und wie die verschiedenen Führungsrollen in unseren Unternehmen besetzt sind, um diese Kundinnen und Kunden gezielt zu bedienen.
Frauen in der Mehrheit an der EHL
Wenn wir die Zusammensetzung der Studierenden an der EHL – Ecole hôtelière de Lausanne – auf den verschiedenen Graduierungsstufen näher anschauen, fällt auf, dass seit über zehn Jahren rund 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer an diesen Kursen teilnehmen. Demgegenüber liegt der Frauenanteil in den oberen Führungsebenen in der Hospitality-Industrie bei unter 25 Prozent.
Es stellt sich die Frage, wo und wieso dieser grosse Anteil an Frauen bei fortschreitenden Karrieren verloren geht. Zugleich fragt es sich, welche Chancen zur Differenzierung damit vergeben und wie viel Fokussierung auf die wichtigste EntscheiderGruppe, die Frauen eben, damit verspielt wird. Oder anders formuliert: Sind Männer die besseren Frauenversteher, wenn es um Einrichtung, Ausstattung und Bedienung der weiblichen Kundschaft geht?
Wenn dies die nackten Zahlen der Hospitality-Industrie sind, wie attraktiv oder abschreckend sind wir dann für FrauenKarrieren? Was bringt der Ruf nach «Diversity» und «Inclusion», der zurzeit durch alle Industrien hallt? Und was versprechen wir uns für die Hospitality-Branche von Diversity in allen Dimensionen? Sprich: Was soll sich dadurch nicht nur verändern, sondern sich vielmehr verbessern?
Diversity ja – kombiniert mit Inklusion
Branchenübergreifend wurde darüber schon viel geforscht und noch mehr darüber geschrieben. Es lohnt sich deshalb darüber nachzudenken, was für uns in der Hotellerie an Schritten zur Veränderung möglich ist. Die ganz allgemeine und nachvollziehbare Erfahrung ist, dass Asiatinnen und Asiaten Asien besser verstehen, Frauen Frauen besser verstehen, «divers» aufgestellte Teams die Probleme breiter analysieren und kreativere Lösungen entwickeln. Aber – und es gibt hier ein grosses Aber: Diversity bringt nur dann bessere Ergebnisse und engagiertere Teams mit mehr Energie, wenn Diversity von Inklusion begleitet ist. Und diese Inklusion setzt neue Fähigkeiten bei den Team-Leadern und Führungskräften auf allen Stufen voraus. Dies beginnt mit einer gemeinsamen Sprache, die alle verstehen. Mit Rollenverständnissen und Regeln, die klar und akzeptiert sind. Mit einer Kultur, die auf Teamwork und Einbezug des Teams setzt, sowie neue Wege wie Top-Sharing, Teilzeitarbeit, Portfolio-Working oder Homeoffice ausprobiert.
Die heutige Nachwuchsgeneration – die Generation Z – hat andere Erwartungen an die Unternehmenskultur, das heisst: wie wir miteinander umgehen. Sie hat grössere Führungsansprüche und sucht nach Ge-
staltungsspielraum. Sie will mehr als Befehlsempfängerin sein. Dafür ist sie aber auch bereit, sich mit allem, was sie hat, einzubringen.
Selbstbestimmung schafft Selbstvertrauen und Vertrauen in andere
Diese Entwicklung erfolgt entlang der Formel: Selbstbestimmung führt zu Selbstvertrauen und Selbstvertrauen zu Vertrauen in andere. Dieses Vertrauen wiederum ist der wichtigste Faktor zur Reduktion von sozialer Komplexität – und erst dieses Vertrauen macht ein Unternehmen handlungsfähig. Fehlt es, muss alles, was geschehen könnte, im Vornherein geregelt werden.
An der EHL haben wir dazu zusammen mit der IMD Business School in Lausanne eine Initiative gestartet, mit der wir im ersten Schritt die Kultur, wie wir die Schule führen, weiterentwickeln wollen. Im zweiten Schritt dann wollen wir auch die Führungsausbildung unserer Studierenden auf einen neuen Stand bringen und diese mit gutem Beispiel vorleben. Dabei gilt das Prinzip: «Panta rhei» – alles fliesst. Und so müssen wir alle jeden Tag einen kleinen Schritt in punkto Entwicklung machen.
Kulturwandel schlägt sich im Lehrplan nieder
Was kann die Hospitality-Industrie von der EHL auf diesem Weg nun erwarten? Neben den bisherigen, zentralen Themen
der Fach- und Hospitality-ManagementAusbildung wollen wir diesen Kulturwandel, den die Millennials und die Generation Z einfordern, ernst nehmen. Unser Lehrplan integriert transversale Themen, sodass unsere Studierenden diese auch in ihrer künftigen beruflichen Tätigkeit pflegen werden. Teamarbeit wird noch wichtiger. Zudem befähigen wir unsere Studierenden noch stärker, Neues auszuprobieren. Ebenso fordern wir bewusst den Diskurs zu gleichermassen diverser wie inklusiver Perspektive und entsprechendem Verhalten. Ein erstes kleines Resultat dieser ernsthaften Auseinandersetzung ist der neue Dresscode an der EHL, der für alle auf dem Campus ab September 2021 gilt und mehr Inklusion zu leben versucht. Denn wir sind überzeugt, dass Kundinnen und Kunden lieber ein Hotel buchen, dem es gelingt, Diversity und Inklusion zu verinnerlichen, den Unterschied zu fördern und so diese Werte täglich erlebbar macht.
Corporate Social Responsibility (CSR) wird ein zunehmend wichtigerer Bestandteil unserer Strategie und wir wenden ESGKriterien (environmental, social und governance) bei der Leistungsbeurteilung ebenso an, wie wir Studierenden auch aufzeigen, welchen Stellenwert ein Engagement hinsichtlich CSR für Investoren bei der Finanzierung neuer Hospitality-Projekte hat. Institutionelle Investoren, aber auch Rating-Agenturen und Fonds, geben neu dem Aspekt «social» eine noch grössere Gewichtung und strafen Unternehmen ohne Diversity in Führungsfunktionen ab.
Carole Ackermann ist Verwaltungsratspräsidentin der EHL Holding AG, der weltweit führenden Ausbildungsgruppe für Hospitality, und Präsidentin der EHL-Stiftung. Ackermann verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten. Als Mitgründerin und CEO der privaten Investmentgesellschaft Diamondscull AG investiert sie in junge Unter nehmen in den Bereichen ICT und Technologie. Carole Ackermann ist zugleich Mitglied des Verwaltungsrats von Allianz Schweiz, der BKW, von BNP Paribas Schweiz und der BVZ Holding, unterstützt als Vorstand die Berner Innovationsagentur «be-advanced» und ist Fakultätsmitglied der Universität St. Gallen (HSG).
Wegweisend: Initiative «Women in Leadership»
Mit unserer «Women in Leadership Initiative» (WIL) untersuchen wir an der EHL seit 2018, unter der Leitung von Prof. Sowon Kim, die unterschiedlichen Dimensionen weiblicher Karrieren im Hospitality-Bereich. Ein erstes konkretes Resultat daraus ist die konsequente und obligatorische Ausbildung aller Studierenden und Mitarbeitenden zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ebenso verfügen wir über eine Gruppe von «Leading Hôtelières», der Prof. Kim als Mentorin angehört, wo Fragen wie Lohngleichheit, Karrierechancen für alle und flexible Arbeitsmodelle diskutiert werden. Und «Lifelong learning – lifelong consulting» heisst unser ambitiöses Programm, wo wir die Inklusion über Generationen hinaus adressieren.
Der Diversity-Shift in der Tourismus- und Hospitality-Industrie ist also mehr als «nur» ein neues Frauenförderungsprogramm. Ein inklusiver Umgang mit vielfältigen Lebensformen und diversen Meinungen fordert ein Umdenken von uns allen, um für künftige Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende attraktiv zu bleiben. Wir sind stolz, dass Diversity und Inklusion beim Lehrkörper wie auch bei den Studierenden der EHL einen hohen Stellenwert genies-

«Hotelier»-Gespräch mit Murat Baki und Claudia Vogl Baki
Sie sind ein Hotelier-Traumpaar. Er, ein Ausnahmetalent und Vollblutgastgeber. Sie, eine charmante, höchst professionelle Restaurateurin und Weinkennerin. Zusammen sind sie ein Power- Direktionspaar: Murat Baki und Claudia Vogl Baki. Seit zwei Jahren führen sie gemeinsam das historische Hotel «La Couronne» in Solothurn. Was steckt hinter dem Erfolg der beiden Hoteltalente?
Hans R. Amrein



Murat Baki, Sie gelten in der Branche als Ausnahmetalent. Sie tragen das sogenannte «Service-Gen» in Ihrer Brust. Mit anderen Worten: Sie sind der perfekte Gastgeber und Hotelier …
Murat Baki (lacht und fühlt sich geehrt): Nun, ich wusste bereits als 14-jähriger Bub, dass ich später mal Hoteldirektor werden wollte. Damals konnte ich gut zeichnen, hatte da sogar ein gewisses Talent. Doch ich interessierte mich für Kulturen und Sprachen, deshalb stellte sich die Frage: Wo kann ich das ausleben?
Natürlich in der Hotellerie!
Sie sind in Bad Säckingen im Schwarzwald aufgewachsen.
Ja, da habe ich mich als Schüler dann auch für diverse Praktika in Hotel- und Gastronomiebetrieben beworben.
Murat Baki tönt nicht unbedingt nach Schwarzwald und Titisee … … so ist es. Das ist ursprünglich ein arabischer Name und stammt aus dem Syrischen. Murat heisst «Wunsch», Baki «Ewigkeit».
Der «ewige Wunschhotelier». (lacht). Mein Vater ist Türke, meine Mutter ist türkisch-syrischer Abstammung. Durch meinen Grossvater kamen sie 1964 nach Deutschland. Meine Mutter kam als 5-jähriges Mädchen nach Deutschland und absolvierte eine Ausbildung als Dolmetscherin, mein Vater war Textilmeister in einer grossen Firma.
Ihre Eltern hatte also mit dem Gastgewerbe nichts zu tun. Wie erklären Sie sich Ihre Begabung?
Man spricht ja von der türkischen oder orientalischen Gastfreundschaft. Vielleicht habe ich diese Gene in mir.
Claudia Vogl Baki, Sie stammen aus Österreich und Deutschland.
Ich wurde in Augsburg (Deutschland) geboren, doch mein Vater kommt aus Österreich. Meine Eltern sind Gastronomen durch und durch. Sie führten in Augsburg dreissig Jahre lang ein Restaurant.
Mir wurde das Gastgewerbe in die Wiege gelegt. Mein Vater ist ein grosser Weinkenner- und Liebhaber und meine Mutter eine tolle Köchin.
Claudia, Sie sind Restaurantfachfrau, wie man dem in Deutschland sagt.
Richtig. Ich machte eine klassische Ausbildung in Augsburg. Im «Palais Goburg» in Wien, wo eine der grössten Weinsammlungen der Welt existiert, hatte ich meine Ausbildung zum Sommelier.
Murat, was haben Sie gelernt?
Ich bin gelernter Hotelfachmann. Diese Ausbildung oder Lehre dauert drei Jahre. Da erhält man eine solide Grundlage. Und nebst weiteren Weiterbildungen, habe ich 2017 den Eidg. Dipl. Hotelmanager NDS/HF in der Schweiz abgeschlossen.
Und dann?
Ging es hinaus in die weite Welt.
Also, jetzt haben wir hier eine Restaurantfachfrau und einen Hotelfachmann. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Murat Baki: Ich war auf dem Luxusschiff MS Europa im Service tätig und suchte dann einen Job an einer Rezeption. Ich fand diesen Job im «Steigenberger Graf Zeppelin» in Stuttgart, wo ich dann Claudia kennenlernte.
Sie waren am Anfang so etwas wie NachtRezeptionist. Richtig.
Claudia, wie haben Sie dann Murat kennenund lieben gelernt?
Ich war im Restaurant des Steigenberger Hotels stellvertretende Restaurantleiterin und Sommelier. Nach Feierabend musste ich Murat, dem Nachtportier, jeweils unsere Abrechnungen übergeben.
Und so entstand spät in der Nacht eine Liebesgeschichte. Wann haben Sie geheiratet? Vier Jahre später.
Murat Baki: 2007 haben wir uns kennengelernt.
Claudia Vogl Baki: Murat wollte dann in die Schweiz. Am Anfang war ich unsicher, er sagte dann: Entweder gehen wir zusammen in die Schweiz – oder wir trennen uns wieder. Wir gingen dann nach Zürich, arbeiteten aber in verschiedenen Häusern. Erst in Langenthal führten wir gemeinsam das Boutiquehotel «L’Auberge», eine kleine Villa mit 17 Zimmern und 15-Punkte-Restaurant.
Was fasziniert Sie an der Hotellerie?
Murat Baki: Es ist ein Herzblut-Business. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Es gibt keine andere Branche, in der man so viele unterschiedliche Menschen und Kulturen trifft.
Claudia Vogl Baki: Für mich ist es ebenfalls der Fokus Mensch. Ich kommuniziere gerne mit Leuten. Den ganzen Tag an einem Schreibtisch sitzen? Könnte ich nicht.
Ihr habt zwei kleine Kinder, 4- und 8-jährig. Wie bringt man Hotel und Familie unter einen Hut? Ist das nicht besonders herausfordernd …
Claudia Vogl Baki: Viele fragen sich, wie man das schafft. Nun, wir haben für uns ein modernes Arbeitsmodell gewählt. Wir haben ja die Kinder zusammen auf die Welt gebracht, deswegen teilen wir uns auch die Betreuung der Kleinen nach der Formel 50:50. Am Vormittag und über die Mittagszeit sind wir zusammen im Hotel, die Kinder sind dann in der Kita oder in der Schule, nachmittags gehe ich nach Hause und schaue zu den Kids. Murat arbeitet bis 17 Uhr, geht dann nach Hause – und ich übernehme das Abendgeschäft.
Und das funktioniert?
Ja, sehr gut. Wir haben viel Zeit für unsere Kinder.
Sie sind Geschäftsführer des Hotels. Ihr Arbeitgeber ist die Genossenschaft Baseltor. Wie frei ist man da im Hotelalltag?
Murat Baki: Natürlich gibt es einen Rahmen der Genossenschaft – darin müssen wir uns bewegen. Aber dieser Rahmen ist sehr weit gesteckt. Wir dürfen dieses Haus so führen, wie wenn es unser eigenes Hotel wäre.
Claudia Vogl Baki: Das war ja der springende Punkt, denn wir können dieses wunderschöne Haus nur erfolgreich und nachhaltig führen, wenn man uns den Freiraum dazu gibt. Ab und zu gehen wir auch unkonventionelle Wege, aber wichtig ist das Vertrauen.
Sie führen »La Couronne» seit etwa zwei Jahren. Ihre Zwischenbilanz?
Murat Baki: Super! Es ist uns schon nach drei Monaten gelungen, den Betrieb und das Team in eine Richtung zu lenken, sodass wir erfolgreich arbeiten konnten. ➤



La Couronne
Das 4-Sterne-Boutiquehotel
La Couronne liegt im Zentrum der barocken Altstadt von Solothurn und wurde im Mai 2017 – nach einer umfassenden Sanierung – neu eröffnet. Den heutigen Betreibern geht es darum, die illustre und geschichtsträchtige Vergangenheit des Hauses mit den feinen Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hauses mit privatem Flair in die heutige Zeit zu überführen. Das Haus umfasst heute 37 Zimmer und Suiten, ein Stadtrestaurant mit modern interpretierten französischen Klassikern, eine Bar à vin und einen grossen Festsaal mit Blick auf die Kathedrale.
Rund um «La Couronne» und die Krone ist in den vergangenen 500 Jahren ein grosser Strauss von Geschichten zusammengekommen. «Es gilt urkundlich als zweitältestes Gasthaus der Schweiz und ist untrennbar mit der Geschichte der Ambassadoren stadt Solothurn verbunden», erklären die Hotelbetreiber auf ihrer Webseite. «Als gesellschaftliches und politisches Zentrum spielte das Hotel oft eine entscheidende Rolle», so die Solothurner Zeitung in einer zwei teiligen Serie über das ehemalige Hotel Krone. Zur Geschichte des Hauses gehören auch zahlreiche illustre und prominente Gäste wie Casanova, Napoleon, Jane Fonda oder Sophia Loren.
Was heisst «in eine Richtung zu lenken»?
Wir alle sind jetzt Gastgeber! Heute dürfen wir sagen, dass das Haus und unser Team sehr erfolgreich aufgestellt sind.
Und die Pandemie, die uns seit März 2020 beschäftigt und im Gastgewerbe zu einer Krise führte?
Claudia Vogl Baki: Wir haben diese Krise für uns genutzt und – zum Beispiel – das Restaurant in eine komplett andere, erfolgreiche Richtung gelenkt. Wir waren und sind immer gut gebucht – und wir erreichen unsere Zahlen, darauf bin ich schon etwas stolz. Die Verluste aus dem Bankettgeschäft konnten wir mit der Gastronomie weitgehend wieder kompensieren.
Wie hoch ist denn eigentlich der Anteil Food & Beverage am Gesamtumsatz?
Murat Baki: Fünfundsechzig Prozent.
Ist das Haus mit 37 Zimmern und hohem Gastronomie-Anteil rentabel, das heisst: Verdienen Sie damit gutes Geld?
Ja, der Betrieb ist selbsttragend. Wir er wirtschaften sogar einen kleinen Gewinn. Wir verdienen so viel Geld, dass wir immer wieder investieren können. Im Corona-Jahr 2020 war das natürlich völlig anders, da lagen keine Gewinne drin.
Nochmals: Wie schaffen Sie es, mit nur 37 Zimmern und 65 Prozent Food & Beverage einen Gewinn zu erzielen?
Wir schaffen es mit einem professionellen uns strikten Revenue- und Ertragsmanagement. Wir achten darauf, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Raten haben. Die Airlines machen es uns ja seit vielen Jahren vor!
Dank Ihrem klugen Revenue-ManagementSystem haben Sie mehr Zeit für die Gäste. So ist es.
Wie haben Sie das Krisenjahr 2020 überlebt?
Nachdem Ende März fast alles zusammenbrach, war der Sommer 2020 hervorragend, ab Mai hatten wir eine Auslastung von über 80 Prozent. Auch der Herbst war sehr gut, bis Mitte Dezember, als die Restaurants erneut schliessen mussten.
Claudia Vogl Baki: Wir sind stolz, dass wir keine Mitarbeitenden entlassen mussten.
Kommen wir zum Werbespot für Ihr Hotel. Warum soll ich in Solothurn ausgerechnet im Hotel «La Couronne» absteigen?
Claudia Vogl Baki: Wir reden nicht nur von Gastfreundschaft und Herzlichkeit, wir leben sie.
Murat Baki: Auf allen Bewertungsportalen sind wir top. Auf Tripadvisor sind wir schon lange die Nummer eins in Solothurn. Ein Indiz dafür, dass die Gäste unser
Haus mögen. Der Gast steht bei uns immer im Mittelpunkt. Unsere ganzen Prozesse im Hintergrund sind darauf ausgerichtet.
«La Couronne» ist einer der ältesten Gasthöfe der Schweiz. Welche Rolle spielt die Geschichte des Hauses im Jahr 2021?
Murat Baki: Wir bieten hier 500 Jahre Geschichte! Laut Urkunden ist unser Haus das zweitälteste Hotel der Schweiz. Die Anfänge gehen bis ins Jahr 1418 zurück, die heutige Barockfassade sowie die Grundstruktur des Hauses stammen aus dem Jahr 1772. So eine Geschichte hat nicht jeder Hotelier.
Das Hotel wurde nach einer zweijährigen Sanierung im Mai 2017 neu eröffnet. Wie viel Geld haben die Investoren, die Immobiliengruppe «Swiss Prime Site», in das Haus gesteckt?
Murat Baki: Ins Haupthaus wurden unter Denkmalschutz rund 18 Millionen investiert, weitere zwei Millionen in unsere Dependance «Atelier».
Geschichte, Gastfreundschaft, Herzlichkeit, Design, gutes Restaurant: Wie würden Sie die aktuelle Positionierung des Hauses umschreiben?
Murat Baki: Es gibt hier mehrere Positionierungsmerkmale. Einige haben Sie bereits angesprochen, so zum Beispiel die Geschichte. Wir sind auch Mitglied bei «Swiss Historic Hotels». Das historische Flair spürt man nach wie vor im ganzen Haus. Wir sind ein Boutique-Hotel mit Anlehnung an die französische Lebens- und Gastronomiekultur. Deshalb auch der Name «La Couronne». Das Haus ist seit vielen Jahren ein gesellschaftlicher Mittelpunkt. Hier trifft sich die Stadt. Fast jeder Solothurner hat hier etwas erlebt –ein Fest, einen Ball, eine Geburtstagsfeier, eine Hochzeit …
Claudia, warum ist Ihr Restaurant so einzigartig?
Auch in der Gastronomie lassen wir Traditionen wieder aufleben: Wir bieten Grossstücke an, flambieren, filetieren und tranchieren am Tisch. Wir bieten dem Gast bewusst eine klassische, eher französisch geprägte Küche, die dort ansetzt, wo sie in den Siebzigerjahren mal war.
Und Ihre Weinkarte? Die wirkt im ersten Moment nicht sehr umfangreich …
Claudia Vogl Baki: Auf die Menge kommt es ja nicht an. Wir haben die Karte erst vor zwei Jahren neu arrangiert. Einer der Schwerpunkte ist immer noch Frankreich, dazu kommen eher unbekannte, kleinere Winzer. Was mir wichtig ist: Die Weine werden bei uns am Tisch im Restaurant zelebriert – und nicht einfach serviert. ➤

«Wir reden nicht nur von Gastfreundschaft und Herzlichkeit, wir leben sie»

Die Geschichte der heutigen Genossenschaft Baseltor in Solothurn beginnt 1978 im selbstverwalteten, basisdemokratischen Löwen mit dem Künstler Schang Hutter als erstem Präsidenten. Die Utopie der Pionierzeit – kollektiv zusammenleben und -arbeiten, die Gesellschaft durch Gastronomie und Kultur verändern, stellt die Aktivistinnen und Aktivisten der ersten Stunde auf eine harte Probe. Neben den langen Arbeitstagen im gut besuchten Löwen werden zusätzlich am Sonntag Entscheidungen in Vollversammlungen gesucht. Es wird diskutiert, argumentiert und gestritten, und dennoch: Die Beiz versinkt weder im Chaos, noch leidet die Motivation. Was zählt, sind der Idealismus und die Begeisterung fürs Kollektiv bei gleichem Lohn für alle. Der Löwen ist schon dannzumal der «Place to go» in Solothurn.
1992 erfolgt der Umzug ins ehemalige Chez Derron im Domherrenhaus bei der St.-Ursen-Kathedrale. Die Liegenschaft wird gekauft, renoviert und mit 6 (heute 17) Hotelzimmern ausgestattet. Beim Umbau wird die alte Bausubstanz geschickt mit neuen Elementen kombiniert, wofür die Genossenschaft Baseltor auch einen Architekturpreis gewinnt.
Die Genossenschaft entwickelte sich langsam und stetig weiter. Der Betrieb wurde professioneller, ohne dabei genossenschaftliche Werte aufzugeben, und im Zehn-Jahres-Rhythmus kamen neue Betriebe in der Stadt dazu. Auch in diesen neuen Lokalen gelang das Zusammenspiel von attraktiver Gastronomie, zeitgemässem Design und historischer Bausubstanz.
Heute führt die Genossenschaft Baseltor die vier Betriebe Baseltor, Solheure, Salzhaus und HOCH3 Catering, die zusammen einen wesentlichen Beitrag zu einer lebendigen Stadt mit kultureller Ausstrahlung leisten. Im Mai 2017 übernahm die Genossenschaft die damalige Krone, das erste Haus am Platz. Es wurde nach einer umfassenden Sanierung neu als La Couronne Hotel & Restaurant eröffnet.
Die Genossenschaft Baseltor ist heute ein Unternehmen mit 300 Genossenschaftern. Sie beschäftigt rund 110 Mitarbeitende und erwirt schaftet einen Gesamtumsatz von rund 12 Mio. Franken. Sie wirtschaftet nachhaltig, die Gewinne kommen den Mitarbeitenden zugute und werden in die Entwicklung der Betriebe reinvestiert.
Delegierter im Vorstand ist der Gastronomie-Berater Martin Volkart.
Mir fällt auf, dass Sie überdurchschnittlich motivierte und junge Mitarbeitende beschäftigen. Wie schaffen Sie es, das Team täglich zu motivieren?
Murat Baki: Wir geben unseren Mitarbeitenden Freiraum und schenken ihnen Vertrauen. Wir nehmen unsere Leute so, wie sie sind. Wir betonen ihre Stärken. Läuft an einem Tisch mal was schief, kann die Service-Mitarbeitende direkt entscheiden und dem Gast was Gutes tun. Unser Ziel: Wir wollen einen zuvorkommenden, authentischen, professionellen und herzlichen Service bieten. Übrigens auch ein Positionierungsmerkmal.
Ich sehe vor mir ein junges Direktionspaar. Früher waren solche Paare in Hotels stark verbreitet, denken wir an Emanuel und Rosmarie Berger (Victoria-Jungfrau) oder Helen und Vic Jacob (Suvretta House), jetzt haben in vielen Hotels die Manager das Zepter übernommen. Drängt es sich nicht bald auf, ein eigenes Haus zu besitzen und zu führen?
Claudia Vogl Baki (lacht): Ein eigenes Hotel? Das können wir uns gar nicht leisten.
Sie könnten als Pächter ein Hotel übernehmen, damit sind Sie auch Unternehmer.
Claudia Vogl Baki: Wenn das richtige Angebot auf uns zu kommt, würden wir uns das sicher überlegen.
Das richtige Angebot?
Murat Baki: Es ist, ähnlich wie «La Couronne», ein kleines, feines Boutique-Hotel. 50 bis 80 Zimmer, dazu eine schöne Gastronomie …
Sie haben eine besondere Beziehung zu Zürich. Müsste dieses Hotel an der Limmat angesiedelt sein – und warum eigentlich Zürich?
Murat Baki: Wir sind beide 2009 in Zürich gestartet, Claudia in den Kunststuben bei Horst Petermann, ich im damaligen «Sheraton Neues Schloss Hotel», zuletzt als Front Office Manager.
Claudia Vogl Baki: Ich war von 2009 bis 2013 bei Petermanns – als Restaurantleiterin und Sommelier. Iris Petermann war mein grosses Vorbild, eine wunderbare Gastgeberin!
Sie haben also in Zürich gearbeitet, aber warum sollte Ihr künftiges Hotel dort stehen?
Murat Baki: Wir haben uns in die Region Zürichsee verliebt – ja, und wir mögen den See.
Claudia Vogl Baki: Kommt hinzu, dass unser Sohn in Zürich geboren wurde.
Murat Baki: Es spielt uns eigentlich keine Rolle, ob wir als Direktionspaar oder Pächter ein Haus führen. Wir sehen uns in jedem Falle als Gastgeber.
Wenn ich Sie so höre, werden Sie Solothurn bald einmal verlassen und vielleicht eben in Zürich ein Hotel übernehmen. Oder liege ich falsch?
Claudia Vogl Baki: «La Couronne» verlassen? Nein, im Moment ist das kein Thema für uns, aber später werden wir vielleicht weiterziehen und eine neue Herausforderung annehmen. Wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man sagen müsste: Wir haben hier in Solothurn alles erreicht.
Viele jüngere Hoteliers träumen vom grossen Luxushaus. Eine Option?
Murat Baki: Definitiv.
Claudia Vogl Baki: Wichtig ist uns, dass wir gemeinsam vorne beim Gast präsent sein können. Und noch etwas: Wir arbeiten und engagieren uns als Direktionspaar, das macht uns aus.
Wer hat den Lead?
Murat Baki: Wir beide, auch grundsätzlich Dinge besprechen und entscheiden wir immer gemeinsam.
Zurück nach Deutschland?
Wir bleiben in der Schweiz.
Ein Haus in der Türkei oder in Syrien ist also keine Option.
Murat Baki (lacht): Nein, definitiv nicht. Ich hatte tatsächlich auch schon Angebote aus Istanbul oder Izmir.
Welche Hotels oder auch Restaurants sind für Sie so etwas wie «Traumbetriebe»?
Claudia Vogl Baki: Ich denke dabei wieder an Zürich – zum Beispiel an das Hotel Storchen und das «Widder Hotel». Faszinierende Häuser. Lage, Gastronomie, Geschichte – da stimmt alles.
Murat Baki: Mich haben viele Häuser, auch im Ausland, fasziniert. Das Althoff Seehotel Überfahrt am Tegernsee gehört dazu. Ich liebe Hotels am Wasser. Auch das Hotel Alex in Thalwil, direkt am See gelegen, finde ich grossartig. Es gibt viele tolle Hotels, in New York, Hamburg … oder eben in Zürich.
Claudia und Murat Baki, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!


Seit zwei Jahren sind die Eltern zweier Kinder (Florin und Ilara) als Gastgeber im historischen Hotel «La Couronne» in Solothurn tätig. Während sich Murat Baki als Direktor in erster Linie um das Hotel, Management und Marketing kümmert, zeichnet sich Claudia Vogl Baki als Directrice für das Restaurant sowie Personal verantwortlich. Die beiden sind ein eingespieltes Team, denn bereits von 2015 bis 2019 waren sie gemeinsam tätig: Sie führten das familiäre Boutique-Hotel «L’Auberge» im bernischen Langenthal mit Erfolg.
«Ich wusste schon als 14-jähriger Bub, dass ich später einmal Hoteldirektor werden wollte»
[01] Hotelier-Traumpaar Murat Baki und Claudia Vogl Baki (vor dem historischen Hotel La Couronne).
[02] Historisches Haus mit Barockfassade aus dem 18. Jahrhundert: La Couronne Solothurn.
[03] Junior Suite.
[04] Badezimmer.
[05] Konferenz- und Tagungssaal im La Couronne.
[06] Das klassisch-französische Restaurant.
Bis der Traum der gemeinsamen Arbeit als Hotelierpaar in Erfüllung gehen konnte, durchliefen Claudia wie auch Murat intensive Ausbildungs- und Wanderjahre in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Geboren in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre, absolvierten Claudia und Murat klassische Ausbildungen. Während Murat den Weg zum Hotelfachmann einschlug, meisterte Claudia – als Tochter einer Gastronomiefamilie nicht weiter verwunderlich – die Ausbildung zur Restaurationsfachfrau. Ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammelte sie in Wien im Restaurant Steirereck und im Palais Coburg, wo sie auch die Leidenschaft zum Wein entdeckte und sich zur diplomierten Sommelière weiterbildete. Murat seinerseits verdiente sich seine ersten Sporen am Tegernsee, im Seehotel Überfahrt und auf hoher See, auf der MS Europa.
Ihre Wege kreuzten sich schlussendlich in Stuttgart, wo beide im Hotel Steigenberger Graf Zeppelin tätig waren. Nach weiteren, getrennten Stationen in Deutschland, zogen die beiden 2009 nach Zürich, wo Murat unter anderem als Front Office Manager im Sheraton Neues Schloss Hotel arbeitete. Claudia ihrerseits war unter Iris und Horst Petermann in Petermann’s Kunststuben (19 Punkte, 2 Sterne) als Chef de Service und Chef-Sommelière tätig. Nach operativen Leitungsstellen in Oerlikon und Zürich folgte ein Abstecher in die Bündner Herrschaft, wo Claudia gemeinsam mit Iris Petermann das Hotel und Restaurant Weiss Kreuz in Malans übernahm und erfolgreich aufbaute. Murat arbeitete während dieser Zeit in Davos für die drei Hotels der Seehof Selection Gruppe als Rooms Division Manager.
Murat und Claudia sind Gastgeber, Hoteliers, Gastronomen, aber auch Eltern und Eheleute mit grosser Leidenschaft. Geschickt vereinbaren sie Berufung und Familie und lassen es an keinem der beiden Orte an Herzlichkeit fehlen.

Als Experte für Hospitality und Bau entwickelt und setzt Damien Rottet seit sieben Jahren bei D&D Hospitality Projects GmbH Projekte um. Als unabhängiger Experte führt er mit seinem fünfköpfigen Team Projekte mit ganzheitlichem Blick zum Erfolg und agiert im Interesse der Bauherrschaft. Konzeption, Realisierung und Beschaffung von FF&E, OS&E und IT gehören zu den Kernleistungen des Unternehmens. Rottet ist weiter an der Firma COM. Cierge beteiligt, welche die ganzheit liche Digitalisierung der Branche vorantreibt. Um ganzheitliche Konzepte aus einer Hand umzusetzen, hat er 2020 die Firma Gastruum GmbH gegründet, die Umbauten und Ausstattungen aus einer Hand und unter einer Verantwortung ausführt. Vor seiner Zeit als Unternehmer war Damien Rottet über fünf Jahre bei «Katara Hospitality Switzerland» aktiv und prägte damals die Projekte Hotel Schweizerhof Bern, Hotel Royal Savoy Lausanne und das Bürgenstock Resort mit. hospitalityprojects.ch
Hotelprojekt-Experte Damien Rottet über das Hotel nach der Pandemie
Die Coronakrise hat uns aufgezeigt, wie schnell und unverhofft unser Alltag aus den Fugen geraten kann.
Die Krise erfordert(e) ein hohes Mass an Flexibilität, Innovation und Energie seitens unserer Branche und ein sich «neu-erfinden» der touristischen Akteure insgesamt, schreibt der Hotelbau- und Projektexperte
Damien Rottet. Er stellt die Frage: Welche Hospitality-Modelle werden nach Corona Erfolg haben?
TEXT Damien Rottet
Nach über 18 Monaten Covid-19 stellt sich die Frage: Was folgt nach der eigentlichen Pandemie? In der Entwicklung von neuen Hotels, die binnen zwei bis fünf Jahren entstehen, stellen sich heute mehr denn je Fragen wie: Werden Hotels weiterhin so sein wie zuvor? Oder wird sich die Branche fragmentieren und lauter «Spezialisten» generieren? Wird der aktuelle Fachkräftemangel überwunden oder übernimmt die Digitalisierung grosse Teile des Personaleinsatzes? Und welche neuen Produkte entstehen aus ehemaligen Hotels?
Ich wage eine Prognose mit 10 Schlagwörtern und Thesen:
1. Spezialisierung: Unsere Akteure fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft: Hoteliers auf das Schlafen, Gastronomen auf die Verpflegung, Seminar-, Event- und Livestream-Organisatoren auf die Erlebnisse und das Rahmenprogramm. Dies hat zur Folge, dass der «klassische» Hotelier, der sich bis anhin in allen Belangen autonom um das Wohl der Gäste kümmerte, sich langsam aber sicher einem Netz von Spezialisten anschliesst, um eben diesen verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden. Neue Marken und Anbieter ent-
stehen mit dem Ziel, Hotels in neuer Form zu bespielen. Was heute teilweise in Städten schon umgesetzt wird, wird sich in Zukunft in allen Regionen (auch im Berggebiet und in der Resort-Hotellerie) etablieren: Ein Hotelbetrieb ist ein Zusammenschluss mehrerer Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich einem Ziel widmen – dem Gästeerlebnis.
2. Instagrammability: Hotels und letztendlich Marken werden so konzipiert, dass gewisse Bereiche oder Anlagen WowEffekte generieren, die gezielt auf #instagrammability ausgelegt sind. Es ist das Ziel, eine schnelle und effiziente Vermarktung über die sozialen Netzwerke zu schaffen. Was heute teilweise subtil in Projekte einfliesst, wird in Zukunft Teil des Raumprogramms sein und bei der Planung von Neu- oder Umbauten gezielt inszeniert werden.
3. Social Social Social: Die Bedürfnisse der Gäste waren bereits vor der Krise volatil und kaum mehr einem klaren Profil zuzuordnen. Durch Corona wurde diese Entwicklung weiter beschleunigt: Heute als Businessgast im Stadthotel, morgen als Nomade mit gleichgesinnten Freunden im Baumhaus am Lagerfeuer. Die soziale Ent-
fernung in über 18 Monaten Covid-19 generiert eine Rückwärtsbewegung. Motto: Wo kann man sich vermehrt an öffentlichen, sicheren Orten mit viel Platz in den unterschiedlichsten Formen und Formaten treffen? Öffentliche Räume sowie Aussenräume und Dachflächen werden heiss begehrt und aktiv bespielt, um den sozialen Austausch bewusst zu fördern. Wo früher eine Hemmschwelle für externe Gäste galt, wird das moderne Hotel zum Ort der Zusammenkunft im sicheren Rahmen.
4. Klassifikationsform: Die heutige Klassifikation in Sterne-Kategorien, die gewissermassen auch Anforderungen an die Entwicklung neuer Produkte stellt, wird sich wohl oder übel verändern müssen. Neue Marken und Konzepte wie z. B. CitizenM, Revier-Hotels oder hybride Beherbergungsformen wie StayKooook erfordern ein höheres Mass an Flexibilität in der entsprechenden Kategorienordnung. In Zukunft werden Hotels über deren Fokus identifiziert: Lifestyle, Boutique, Nomade, Retreat, Regenerate.
5. Make or Buy: Durch die fragmentierten Betriebsstrukturen wird sich in Zukunft vermehrt die Frage stellen: Soll ich die Leistung selbst erbringen (make) oder ➤

zukaufen (buy)? Outsourcing und/oder Kooperationen sind bereits zum heutigen Zeitpunkt in der Stadt gängig und werden auch in ein paar Jahren verstärkt in ländlichen Gebieten anzutreffen sein. B-Smart, zum Beispiel, hat die Krise genutzt, um die B-Smart-Services aktiv am Markt zu platzieren und kleinen/mittleren Hotels ein Outsourcing der Rezeption zu ermöglichen. Ein Trend, der sich in Zukunft weiter etablieren wird.
6. Immobilie als Plattform: Die städtische Hotelentwicklung der letzten Jahre erfuhr aufgrund eines eher schwachen Büromarktes einen Aufschwung. In Zukunft dürften sich Investoren und Besitzer von Hotels in allen Regionen über die Spezialisierung von Unternehmen erfreuen, die aufgrund ihrer Synergien und ihrer Expansion noch effizienter werden. Der fragmentierte Hotelbetrieb, geführt von einzelnen Spezialisten unter einem Dach und mit einem Ziel, wird sich als Standard durchsetzen. Die Immobilie des Investors oder Besitzers bietet dazu die notwendige Plattform. Durch die höhere Effizienz der Parteien ist es dem Investor oder Besitzer auch möglich, einen stabilen Miet- oder Pachtertrag zu generieren, was ihm wiederum die Möglichkeit bietet, in die Infrastruktur zu investieren. Insgesamt ein Win-Win-Win-Modell für Eigentümer, Betreiber und Gast.


7. Experience Economy: Aufgrund der sozialen Entfernung erachte ich es als realistisch, dass Gäste zunehmend Erlebnisse buchen werden, bei denen Sie im sicheren Ambiente soziale Kontakte haben und zugleich für sich und ihre ganz persönliche Lernmotivation etwas Neues erleben. Entsprechend werden sich Hotels im Rahmen der unterschiedlichen Konzepte auch zu erlebnisorientierten Zentren entwickeln, durch welche Gäste erfahrungsreicher werden.
8. E-Hotel: Von grösserer Bedeutung wird demnach auch die Digitalisierung sein. Die Service-Prozesse können durch individuell abgestimmte Technologien verkürzt werden, was wiederum dem Hotelier die Chance gibt, mehr Zeit dem Gast zu widmen, aber auch einen ökonomisch effizienteren Prozess ermöglicht. Dank digitalen Prozessen wird der administrative, aber auch der personelle Aufwand markant reduziert. Dies hat zur Folge, dass dem Gast mehr Zeit gewidmet wird.
9. Co-Everything: Bereits vor Covid waren Konzepte im Rahmen der «Sharing Economy» gefragte Betriebsformen. Nun werden diese Konzepte im Rahmen von neuen Marken und Betreibern mehr denn je aktiviert: Co-Living wird genauso wie CoWorking, Co-Dining und Co-Socializing in Hotels Einzug halten. Konzepte wie zum Beispiel «Tomo Domo» haben bereits begon-
nen, Hotels zu Co-Living-Liegenschaften umzunutzen. Co-Everything beschreibt auch die Co-Existenz mehrerer Betriebsformen unter einem Dach – sogenannte hybride Formen. Wir sehen Hotelprodukte als Matrix von Möglichkeiten, in welchen Co-Konzepte mit Lifestyles der Hotelbranche komplett frei und flexibel zu einem neuen Produkt verpackt werden.
10. Architectural Design: Und wo liegt die Zukunft im Design? Ich erachte es als zunehmend realistisch, dass der Fokus in Zukunft auf schlichte, geradlinige Formen und helle, klare, hygienische Farben gesetzt wird. Etwas femininer wird das Design wirken, hübsch und mit viel ausgewähltem Make-Up oder Dekorationen. Der Fokus in den neuen Designs: warme, helle, grosszügige Räumlichkeiten schaffen mit hygienisch unbedenklichen, nachhaltigen Materialien.
FAZIT: Hotels der Zukunft werden als fragmentierte, digitalisierte «Orte» gelten, wo sich unterschiedliche Aufenthalts- und Beherbergungskonzepte unter einer «Marke» – dem Hotelnamen – vereinen. Diese Hotels bieten den Gästen einen sicheren Ort für sozialen Austausch – und das in modernem, femininem Design. Der Ort entspricht den hygienischen Anforderungen und bietet zugleich ein überdurchschnittliches Mass an Erlebnissen und #instragammability.
In Hotellerie und Gastronomie spielen Emotionen und die Steuerung dieser eine bedeutsame Rolle. Das Schaffen von Identität mit emotional aufgeladenen gestalterischen Mitteln, trägt zu einer nachhaltigen Bindung und Identifikation mit den Gästen bei. Die Konsumenten, kulturelle Trends und demographische Entwicklung sind im stetigen Wandel. Zudem haben sich auch die Interessen verschoben. Dies schlägt sich auch im Marketing nieder. Instagrammability, das sogenannte Influencer Marketing, ist wichtiger denn je, gerade wenn man als Hotel oder Restaurant heutzutage bei der Entscheidungsfindung der Konsumenten eine Rolle spielen möchte. Heutzutage sind fotogene Orte und aussergewöhnliche Interieurs für ein erfolgreiches Social-Media Marketing massgebend. Like-hungrige Followers suchen nach der perfekten Kulisse, nach der idealen Szenerie für ein perfektes Instagram-Bild. Wer es also schafft seine Lokalität zu einem attraktiven Foto Spot zu etablieren, braucht sich eigentlich um das Marketing kaum noch Sorgen zu machen.
Der Drang etwas zu erleben und dies mit anderen zu teilen, ist ein immer grösseres Bedürfnis geworden und ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Planung in Hotellerie und Gastronomie. Heute suchen Gäste nach einem emotionalen Mehrwehrt, nach einzigartigen und aussergewöhnlichen Erlebnissen. Nur was jemanden berührt, kann ihn auch begeistern. Die Erlebnisinszenierung in Hotellerie und Gastronomie ist heutzutage genauso wichtig, wie ein gutes Essen und komfortables Schlafen. Das Ambiente muss entsprechend gestaltet sein. Das Ziel der Inszenierung ist eine Atmosphäre zu schaffen, welche bei dem Gast positive Gefühle auslöst, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Umso multisensorischer dabei eine Inszenierung ist, umso effektiver, spannender und nachhaltiger das Erlebnis. Visuelle Reize haben dabei natürlich den grössten Effekt, diese erreichen den Gast sofort und schaffen es, ihn gezielt in eine gewollte Stimmung zu versetzen.
In der Innenarchitektur sind die Bausteine der Inszenierung ähnlich wichtig, wie auf einer Bühne. Um eine aussergewöhnliche Welt zu kreieren, greift die Erlebnisinszenierung in Hotellerie und Gastronomie auf die Instrumente des klassischen Theaters zurück. Betrachtet man ein Restaurant oder ein Hotel wie ein Theater, so finden wir auch dort alle dazugehörigen Komponenten: Der Raum als solches wird zur Bühne, wir haben die Kulissen, die Requisiten, den Ton, das Licht und die Schauspieler. Im Folgeschluss ist jeder Raum eine Bühne und unsere Aufgabe ist es ihn zu bespielen.
Um ein erfolgreiches «Theater» zu kreieren, kann man sich an den vier Bausteinen der Inszenierung orientieren. Als erstes gilt es ein übergeordnetes Thema zu finden. Danach beginnt man mit der Gestaltung des Umfeldes, dem sogenannten «Setting». Hier liegt der Schwerpunkt besonders in der Materialisierung, der Farbgebung und der Formensprache. Doch am wichtigsten sind Storytelling und Dramaturgie, also der Einsatz der gestalterischen Mittel, welche das Stück zum Leben erwecken.
Das Ziel ist erreicht, wenn der Raum beginnt zu erzählen.

Ivo Christow ist Dipl.-Des. Scenography (FH) und Interior Designer.
Krucker Partner AG Sonnmatthof 1 6023 Rothenburg krucker-partner.ch
Seit 2018 fungiert er bei der Krucker Partner AG als Head of Design und ist in der Geschäftsleitung. In dem Innenarchitekturbüro, welches sich vorwiegend auf Hotel- und Gastronomiegestaltung spezialisiert hat, führt er sein Team mit starkem Fokus auf Storytelling und Inszenierung. Einzigartige und aussergewöhnliche Konzepte schaffen ist seine Leidenschaft.
«Ich bin überzeugt, dass der Erfolg in Hotellerie und Gastronomie nicht mehr nur über den Verkauf von Übernachtungen und gutem Essen erreicht wird. Heute suchen Gäste nach einem emotionalen Mehrwert, einem einzigartigen Erlebnis»
«Hotelier»-Gespräch mit Bruno Caratsch, General Manager im Hotel Casa Berno, Ascona
Eine Terrasse mit grossem Pool und Sicht über den Lago Maggiore. Einzigartig.
Das Hotel Casa Berno in Ascona ist ein spezielles Haus – nicht nur wegen der tollen Lage hoch über dem See. Das Hotel gehört einer Stiftung der katholischen Kirche. «Hotelier» wollte von Gastgeber und Direktor Bruno Caratsch wissen: Wie geht es Ihnen unmittelbar nach der eigentlichen Coronakrise?
INTERVIEW Hans R. Amrein
Bruno Caratsch, wenn Sie auf die letzten 19 Monate Corona und Pandemie zurückschauen und für Ihr Hotel Casa Berno in Ascona eine Art Bilanz ziehen müssten, wie würde diese lauten?
Ein Wechselbad der Gefühle. Als wir kurz vor der Saisoneröffnung im März 2020 den kompletten Lockdown hinnehmen mussten, war die Situation äusserst anspruchsvoll. Nach einem Winter mit Investitionen und Vorbereitungen, standen wir plötzlich vor einer nicht vorhersehbaren Situation. Als wir endlich öffnen durften, waren wir über die enorme Nachfrage überrascht, die zum Glück bis heute anhält. Wir konnten schlussendlich trotz zwei Monaten weniger Öffnungszeit die Saison sehr erfolgreich abschliessen. Vorsichtig, jedoch sehr optimistisch sind wir dann in die Saison 2021 gestartet, bis jetzt mit grossem Erfolg.
Es ist jetzt Anfang August 2021. Wie werden die nächsten Monate sein? Wird die grosse «Schweizer Nachfrage» bei Ihnen und im Tessin bis Ende Herbst 2021 anhalten?
Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage geringfügig nachlassen wird, wir jedoch weiterhin mit hoher Auslastung arbeiten werden. Der Herbst war bei uns bereits vor der Pandemie immer stark.
Das Tessin hat im in den letzten 19 Monaten einen wahren Deutschschweizer Gäste-Boom erlebt. Wird dieser Boom nachhaltig sein? Oder war das nur ein krisenbedingter Aufschwung?
Dieser Boom wird nicht mehr die Dimensionen der letzten zwei Saisons haben, trotzdem bin ich aufgrund der Feedbacks unserer «neuen» Gäste überzeugt, dass einige wieder kommen werden. Seit 2016 ging es nach schwierigen Jahren im Grossen und Ganzen stetig aufwärts. Wenn wir weiter an unseren Angeboten arbeiten und in unsere Betriebe investieren, werden wir auch in Zukunft eine gute Chance haben.
Was haben Sie als Tessiner Hotelier von der Krise oder dieser Pandemie gelernt? Die neuen Gegebenheiten erforderten viel Flexibilität, die Bedürfnisse der Gäste ha-

ben sich zum Teil verändert. Die Kurzfristigkeit und Schnelllebigkeit des Geschäfts ist und bleibt eine Herausforderung. Es gilt, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Digitalisierung muss verstärkt vorangetrieben werden, auch in der klassischen Ferienhotellerie.
Haben sich bei Ihren Gästen Buchungsverhalten, Bedürfnisse vor Ort (Hotel) und Konsum in den vergangenen Pandemie-Monaten markant verändert?
Das Buchungsverhalten hat während dieser Zeit den Trend zu kurzfristigen Buchungen verstärkt. Die Bedürfnisse nach Sicherheit, gesundem Leben und ökologischem Handeln sind spürbar. Als Beispiel haben wir in den letzten zwei Jahren eine deutliche Zunahme an Gästen, die mit Elektrofahrzeugen anreisen, aufgrund dessen wir nun sechs Ladestationen installiert haben.
Das Tessin gilt nach wie vor als «Sonnenstube der Schweiz». Ist dieses Image noch aktuell und für Tourismus und Hotellerie sinnvoll?

Ich denke, dass wir nach wie vor als Sonnenstube der Schweiz wahrgenommen werden. Gerade für kurzfristige Kuraufenthalte spielt unser mediterranes Klima eine grosse Rolle. Das Tessin hat sich jedoch weiterentwickelt und bietet heute viel Abwechslung – von der Kunst über Sportangebote bis hin zu grossen Events.
Sagen Sie mir drei bis fünf Gründe, warum ein Gast aus Zürich oder Basel Ferien oder ein Wochenende bei Ihnen im Tessin verbringen sollte?
Das Tessin ist nicht zuletzt durch den Gotthard-Basistunnel und den neuen CeneriTunnel näher an die Deutschschweiz gerückt, was es für kurzfristige Aufenthalte sehr interessant macht.
Die Angebote sind heute sehr vielfältig und gerade das Neu-Entdecken der Swissness ist im Tessin sehr ausgeprägt. Einfach mal abschalten, das «Dolce far niente» geniessen, dafür eignet sich das Tessin nach wie vor hervorragend.
Immer mehr Ferien- und Wochenendgäste setzen auf Spa- und

Wellness-Angebote. Sie bieten den Gästen heute einen Pool mit Seesicht. Haben Sie die Absicht, den Spa-Bereich auszubauen?
Ja, bereits nächsten Winter werden wir unser Spa-Angebot durch neue Saunen, Fitness und andere Dinge erweitern.
Die Lage Ihres Hotels hoch über dem Lago Maggiore mit wunderbarer Sicht auf den See sowie die Nähe zur Natur sind einzigartig. Doch einige Bereiche des Hauses sind eher austauschbar, Beispiel Gastronomie, öffentliche Räume (Lobby) … Wie wollen Sie Ihre Positionierung schärfen und das Haus noch einzigartiger machen?
Seit nun fünf Jahren investieren wir in die Modernisierung unseres Hotels. Auch der Restaurationsbereich wird in den nächsten zwei Jahren komplett neu gestaltet. Momentan erarbeiten wir Konzepte und Ideen für die Neuausrichtung unserer Gastronomie, die wir nächstens unserem Stiftungsrat zur Entscheidung vorlegen werden.
Bis Ende 2023 will die Stiftung 4,5 bis 5 Millionen Franken ins «Casa Berno» investieren. Das ist richtig. Wie bereits erwähnt, werden wir nächsten Winter (2021/22) den Eingangsbereich umbauen und einen neuen, multifunktionellen Raum für kleinere Veranstaltungen errichten. Hinzu kommen zwei neue Juniorsuiten sowie die erwähnte Erweiterung des Spa-Bereiches. Und im folgenden Winter ist der komplette Umbau der Restauration geplant. Schlussendlich wäre dann noch die Renovierung der letzten Zimmer zu erledigen.
Die Folgen von Corona werden den Strukturwandel in der Schweizer Hotellerie beschleunigen. Leider existieren im Tessin im Drei- und Vier-Sterne-Segment viele Hotels, die eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Kommt es nächstens zum grossen «Hotel sterben» in der «Sonnenstube»?
Aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre werden nicht mehr wettbewerbsfähige Hotels irgendwann durch Investoren ➤
erworben, dann wird investiert – und später werden die Häuser wieder als Hotel betrieben. Ein grosses Hotelsterben erwarte ich nicht.
Sie haben zusammen mit zwei anderen Hoteliers eine kleine Hotelkooperation («Benvenuti Hotels») gegründet. Was bringt dieser «Zusammenschluss» den einzelnen Betrieben?
Entstanden ist unsere Kooperation ursprünglich im Rahmen einer MarketingZusammenarbeit. In den Jahren haben wir uns weiterentwickelt, und heute ist die Zusammenarbeit vielfältiger – Marketing ist weiterhin der wichtigste Bestandteil der Zusammenarbeit, wir nützen Synergien, vom Benchmark bis zum Mitarbeiteraustausch, wir unterstützen uns bei Grossanlässen, kaufen gemeinsam ein …
Das Hotel Casa Berno ist im Besitz der Stiftung «Fondazione Beato Pietro Berno, Ascona». Hinter der gemeinnützigen Stiftung steht die katholische Kirche. Gemeinnützigkeit, soziale Zwecke und Geld verdienen bzw. gute Renditen erzielen – wie schaffen Sie diesen Spagat? Eigentlich ist es kein Spagat – das eine braucht das andere. Um gemeinnützige Projekte unterstützen zu können, sind wir auf eine gute Rendite angewiesen. Um auch in Zukunft eine gute Rendite erarbeiten zu können, muss ein Teil in unser Haus investiert werden, damit wir das Hotel stetig verbessern können und somit auch in Zukunft die nötigen Mittel für die Unterstützung von sozialen Werken gewährleisten können.
Sie führen das Hotel – zusammen mit Ihrer Frau Manuela – seit rund 14 Jahren. Wie lange bleiben Sie
dem Hotel noch treu? Oder anders gefragt: Reizt es Sie nicht, wieder mal ein anderes Haus oder gar ein eigenes Hotel zu führen?
Wir fühlen uns sehr wohl im Casa Berno! Der Reiz nach Neuem ist immer präsent, jedoch sehen wir nach wie vor sehr viel Entwicklungspotenzial für unser Haus, was die Aufgabe spannend macht. Die nächsten drei bis vier Jahre sind für die Ausrichtung des «Casa Berno» sehr wichtig und wir freuen uns, Teil dieser Aufgabe zu sein.
Schlussfrage: Welche Hotels oder Mitbewerber bewundern Sie?
Ich bewundere einerseits Hotels, die betreffend Architektur und Infrastruktur aussergewöhnlich sind, jedoch auch HotelierKollegen, die mit guten Ideen und mit konsequenter Positionierung ihre Betriebe führen. Da gibt es einige im In- und im Ausland.
Hotelgeschichte
Beeindruckend und zahllosen Ascona-Besuchern von der Seeseite her ansichtig ragt die Pfarrkirche S. Pietro e Paolo mit ihrem schlanken Glockenturm zwischen der Casa Serodine und dem Municipio aus dem Bild des Ortes. Das über Jahrhunderte gewachsene kirchliche Wahrzeichen birgt nicht nur einige der schönsten religiösen Werke des berühmten, im fernen Rom verstorbenen Ortsmaler Giovanni Serodine. Als geweihte Reliquie wird in einem gläsernen Schrein auch das Haupt eines Mannes bewahrt, den die Chiesa Madre heute als einen ihrer Heiligen verehrt.
Beato Pietro Berno wurde im Jahre 1553 (mutmasslich) im damals noch kaum bekannten Ort Ascona als Sohn kleiner Handwerker geboren. Bereits damals hatte sich in Rom eine nicht unbedeutende Kolonie ausgewanderter Asconeser angesiedelt. Als angehender Missionar schiffte sich Beato Berno am 4. April 1579 in Lissabon ein und landete am 8. Oktober des gleichen Jahres, zusammen mit Glaubensbrüdern, in Goa, der damaligen Hauptstadt von portugiesisch Indien.
Berno trat nach seiner Ankunft umgehend der von Jesuiten und Dominikanern geleiteten Mission bei. Nur Tage später wurden Berno und seine Mitbrüder am 13. Juli 1583 Opfer einer fanatisierten Menge.
Bereits kurz nach dem Eintreffen der Todesbotschaft in Ascona wurde der inzwischen legendäre geistliche Auswanderer in seinem Heimatort als eine Art lokaler Heiliger verehrt. Erst dreihundert Jahre später allerdings unterzeichnete Papst Leo am 13. November 1892 die entscheidenden kirchlichen Dokumente, die den Sohn Asconas unter die höchsten Märtyrer des Glaubens erhoben.
Die religiöse Geschichte Asconas wäre, wie auch immer, ohne die Namen Papio und Berno undenkbar und um viele Aspekte einer gelebten Volksfrömmigkeit ärmer.
Zur Entstehung des Hotel Casa Berno: Im Jahre 1961 bis 1962 wurde das heutige Hotel erbaut und als Altersheim eröffnet. Nach einem Jahr wurde es dann zum Hotel umfunktioniert. Nach mehreren Erweiterungen und Renovationen wird es seitdem als Hotel Casa Berno betrieben.
Das Casa Berno ist im Besitz der Stiftung «Fondazione Beato Pietro Berno, Ascona» und wird seit 10 Jahren durch Manuela und Bruno Caratsch geleitet. Das Hotel ist ein wirtschaftlich ausgerichteter und profitorientierter Betrieb. Mit den erwirtschafteten Erträgen werden vor allem soziale Projekte der Stiftung unterstützt.
Der Monat Juni ist eigentlich der Frauenmonat. Die Frauen kämpfen am 14. Juni schweizweit für gleiche Rechte und Gleichberechtigung. Zudem ist der Monat Juni offizieller «Pride Monat» und auch hier geht es um gleiche Rechte für alle. Und alle schliesst eben alle ein und wir kämpfen notabene für Gleichberechtigung in einem Zeitalter, in dem dies selbstverständlich sein sollte. Ist es aber (noch) nicht.
In den Chefetagen ist die Luft dünn, das wissen wir alle. Für Frauen soll die Luft noch dünner sein, eigentlich paradox, müssen sie sich immer noch der Welt beweisen, wozu sie mehr Luft denn je bräuchten. Schon lange frage ich mich, wo die weiblichen Hotelmanagerinnen sind. Zu meinen Anfangszeiten in der Hotellerie wurde die Hoteldirektorin vor allem wahrgenommen als die Frau, die zuständig ist für Dekoration und Blumenschmuck. Und wahrscheinlich wurde sie von Gästen und Mitarbeitenden auch als Dekoration wahrgenommen, und zwar die des sogenannten Hoteldirektors. Die Frau eben, die Frau des Hoteldirektors. Ich für meinen Teil hatte während meiner Ausbildung das grosse Glück, die Hoteldirektorin anders kennenzulernen. Die damalige Hoteldirektorin war unter anderem tatsächlich für die Blumen zuständig. Sie war eine eher introvertierte Persönlichkeit, eine zurückhaltende Frau, die sich zeitweilen auch in ihrem Büro versteckte. Sie versteckte sich hinter den Zahlen und sie wusste über jeden Franken Bescheid. Ehrfürchtig brachten wir ihr jeden Tag um die gleiche Zeit den grossen Umschlag mit dem Tagesabschluss ins Büro, alles stimmte auf 5 Rappen genau. Ich wiederhole – ehrfürchtig.
Also, wo sind sie, die Hoteldirektorinnen? Im mittleren Kader treffen wir auf viele
Frauen, die Chefs der Rezeption, die Service-Chefinnen, die Hausdamen, die SpaChefinnen … Sie sind top ausgebildet, verfügen wie all ihre männlichen Kollegen über die gleiche Ausbildung und den gleichen Weg bis zur letzten Sprosse dieser Leiter. Ich kenne viele weibliche «Chefs de» – und wenn ich sie frage, warum nicht Managerin, dann sagen sie, es sei so okay für sie.
Wir können Statistiken konsultieren, Diskussionsrunden einberufen und in all den Betrieben immer wieder wiederholen, wie wichtig wir die Frauenfrage nehmen und die damit verbundene Gleichberechtigung. Und wir Frauen dürfen den Männern nicht die Schuld dafür geben, wenn sie die letzte Sprosse der Karriereleiter nehmen und dies halt in einer gewissen Selbstverständlichkeit. So will und wollte es bis anhin die Geschichte. Seit Jahren sprechen wir ausschliesslich von den so genannten Hotelpionieren Rytz, Badrutt, Scherz, Berger & Co. Ich zähle jetzt bewusst die etwas ältere Generation auf.
Hotelpionierinnen? Fehlanzeige. Also Mut zur Lücke und Mut zur Sichtbarkeit. Die Voraussetzungen sind gleich, die Ausbildung ist gleich und nicht die Quote soll die Gleichberechtigung ausmachen, sondern die wirklichen Stärken der weiblichen Managerinnen. Frauen sollen nicht wie Männer führen, Frauen sollen wie Frauen führen – anders und vielleicht auch besser. Wir Frauen sollten jetzt die letzte Sprosse ebenso selbstverständlich nehmen, wir brauchen keine Tipps und Tricks, wir müssen es einfach tun! Sichtbarkeit heisst auch Aufmerksamkeit. Und es braucht nicht nur mehr Weiblichkeit im Management, sondern eben auch mehr Weiblichkeit in den Verbänden, Gremien, Verwaltungsräten.
Denn nur so schaffen wir das, wofür Frauen und Männer auch wirklich einstehen – für die Gleichberechtigung. Erst dann lernen unsere Töchter, Söhne, Nichten, Neffen & Co., dass es kein Nachteil sein muss, eine Frau zu sein.
Sehr geehrte «Hotelier»-Leserinnen und Leser, es ist der Zeitpunkt gekommen für Pionierinnen. Öffnet endlich in den Gremien die Türen für die Gleichberechtigung und die Diversität, denn es hat Platz – und zwar für alle! Und vergessen wir nicht: ganz oben wird man gesehen und ganz oben wird man gemessen. Es braucht Mut, Ausdauer und viel Energie da oben, aber oben ist man auch Vor bild und kann durchaus zur Pionierin werden.

Tina Müller (51) ist im Berner Oberland geboren und aufgewachsen. Die Hotellerie war und ist ihre Leidenschaft, ihr Herzblut. Seit über 25 Jahren ist sie als Beraterin in der Hotellerie & Gastronomie tätig (www.milleprive.ch).
Tina Müller, Bloggerin & Podcasterin: tinasprive.ch
KOLUMNE JÜRG SCHMID
Jürg Schmid, Präsident des Verwaltungsrates «The
Das 2020 ist ein Jahr zum Vergessen – und das 2021 auch – aus Sicht der Stadthotellerie. Während die Schweizer und Schweizerinnen in die Berge, an die Seen und ins Tessin strömen, darbt die Stadthotellerie, geplagt von fehlenden internationalen Gästeströmen, von auferlegtem Homeoffice und durch Auflagen ausgebremste Kongresse und Events. Wo liegt da die Zukunft für die Stadthotellerie? Welche Positionierung bringt den Stadthotels Perspektiven zurück? Diese Fragen diskutiert wohl so ziemlich jeder Stadthotel-Verwaltungsrat. Sollte man zumindest. Denn Hoffnung, zu hoffen, dass es schon irgendwie wieder gut kommt, ist kein tauglicher Strategieersatz.
«The Living Circle» ist eine kleine Boutique-Hotel-Gruppe mit den Hotels Alex, Storchen und Widder in Zürich und am Zürichsee. Während unser Castello del Sole in Ascona im Nachfragehoch jubelt, kämpfen die Zürcher Hotels um jeden Gast. Wir haben uns den Zukunftsfragen
Die einen Experten prophezeien die Rückkehr zur Normalität. Nicht nur die bezweifelte Lernfähigkeit unserer Spezies, vor allem auch der ökonomische Druck sprechen für eine Rückkehr zum bisherigen Reiseverhalten der Menschheit. Die
Jürg Schmid’s Passion gilt dem Tourismus – und zwar in all seinen Facetten. Als Direktor von Schweiz Tourismus positionierte er die Schweiz rund um den Globus als Ferien-, Reise- und Kongressland und erschloss als «oberster Verkäufer der Schweiz» von 2000 bis 2017 neue Märkte. Zuvor war Schmid bei Oracle Corporation als Sales & Marketing-Manager für die Märkte Nord-, Zentral- und Osteuropa, die CISStaaten, den Mittleren und Nahen Osten sowie Afrika verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Oracle erwarb Schmid wichtige Berufserfahrungen bei der Bank Vontobel sowie bei Hewlett Packard. Heute ist er Mitinhaber der Marketing- und Kommunika tions-Agentur Schmid Pelli & Partner AG und sitzt in diversen Verwaltungsräten. Jürg Schmid ist verheiratet und lebt mit seinen drei erwachsenen Kindern in Zürich.

«Wir wandeln zu Freizeit- und Ferienhotels. Dazu haben wir unsere drei
Hotels in Zürich zu einem «City & Lake Resort» unter einer Gesamtleitung geformt»
JÜRG SCHMID

getätigten und laufenden Investitionen in touristische Infrastrukturen, von Flughäfen über Flugzeugflotten bis Beherbergungsinfrastrukturen, sind derart gross, dass der gesellschaftliche und politische Sachzwang Fundamentaländerungen verunmöglicht. Die Anbieter werden mit Dumpingpreisen die Konsumenten-Zurückhaltung bekämpfen.
Es gibt Momente, wo die Welt einen Richtungswechsel vollzieht. Das ist so einer, sagen die anderen Experten. Die Verzichte haben uns massgeblich geprägt und den Blick auf die echten Werte freigegeben. Der Wandel erfasst den Tourismus, der seinen Peak eigentlich schon vor der Pandemie erlebt hat. Die Debatte über Klimawandel und Overtourism hat angefangen, das Reiseverhalten gewichtig zu verändern. Nach einer kurzen Phase einer PostShutdown-Reise-Euphorie wird der Massentourismus eine Verschlankung erfahren und zu einer neuen, nachhaltigeren Form finden.
Nun, die Zukunft zu prophezeien ist bekanntlich unmöglich. Interessant ist jedoch, dass beide Denkgruppen gewisse Veränderungen identisch erwarten. Beide gehen sie von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass nachhaltige, verantwortungsvolle Reisen zunehmen, Gruppenreisen an Popularität verlieren, der Trend zu Individual- und Kleingruppenreisen verstärkt wird, die Qualitätsansprüche von Reisen grundlegend steigen, gerade an die Schweiz. Ein ansehnlicher Anteil von Geschäftsreisen und Meetings werden sich dauerhaft auf Videokonferenzen verlagern. Wir haben einen Digitalisierungsschub erfahren. Die Befragung von 500 Firmen und Business Travellers durch das «Center for Aviation Competence» der Universität St.Gallen bestätigt diese Einschätzung: 31 Prozent weniger Kurzstreckenflüge und 20 Prozent weniger Langstreckenflüge, ist die erwartete Realität.
Wir stellen unsere Stadthotels darauf ein und haben uns einen Strategiewechsel verordnet. Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft möglichst viele Geschäftsreisende beherbergen. Die Zahlen aus dem Jahr 2019 werden wir jedoch lange, sehr lange, nicht mehr sehen. Kompensieren soll der Leisure-Gast. Wir wandeln zu
Freizeit- und Ferienhotels. Deshalb haben wir unsere drei Hotels in Zürich zu einem «City & Lake Resort» unter einer Gesamtleitung geformt. Der Gast soll die Betriebe als ein Gesamterlebnis wahrnehmen. Was sich so einfach sagt, hat aber weitreichende Folgen. Damit der Widder-Gast seinen Lunch im Alex auf die Rechnung setzen kann, galt es die Informatiksysteme auf Multi-Property-Fähigkeit aufzurüsten. Serviceketten, Prozesse, Schulungen, Marketing – der Wandel erfasste so ziemlich alles. Und Angebote, die das Resort erlebbar machen, mussten hin. Stündlich bringt nun unser Boot-Shuttle unsere Gäste zum und vom Alex Lake Zürich an den Storchen-Steg an der Limmat. Ein bisschen wie Venedig, nur «Swiss made». Die Eiscreme stammt vom eigenen Bauernhof Schlattgut am Zürichsee, den unsere Gäste auch besuchen und sich ihr Frühstücksei gleich aussuchen können.
Unsere Investitionen haben wir konsequent auf die Steigerung des Freizeitwerts ausgerichtet. Auf dem StorchenDach ist die Rooftop Bar entstanden, der Widder-Innenhof wurde neugestaltet und das Gastronomieerlebnis auf ReisemotivNiveau gehievt.
Die Entwicklung der Gästeanfragen bestätigt uns in unserem neuen Weg. Die Zukunft des Schweizer Städtetourismus liegt vermehrt im Freizeittourismus, davon sind wir überzeugt. Zur erfolgreichen Umsetzung braucht’s aber auch viel Hilfe von aussen. Stadtbehörden müssen gastfreundlich bleiben. Die Nutzungserweiterung der Aussenflächen muss dauerhaft werden und unsere Gäste erwarten offene Läden in städtischen Tourismuszonen auch an Sonntagen. Städtische Tourismusorganisationen müssen Leisure-Marketing zelebrieren – das braucht (mehr) finanzielle Mittel – und sie sollen neue Kooperationswege einschlagen, gerade auch mit Kunst & Kultur-Anbietern.
Kein Marketing der Welt kann die Auswirkungen einer solch epochalen Krise ungeschehen machen. Es führt kein Weg an der Auseinandersetzung mit der eigenen Positionierung vorbei. Dann kommt’s gut.
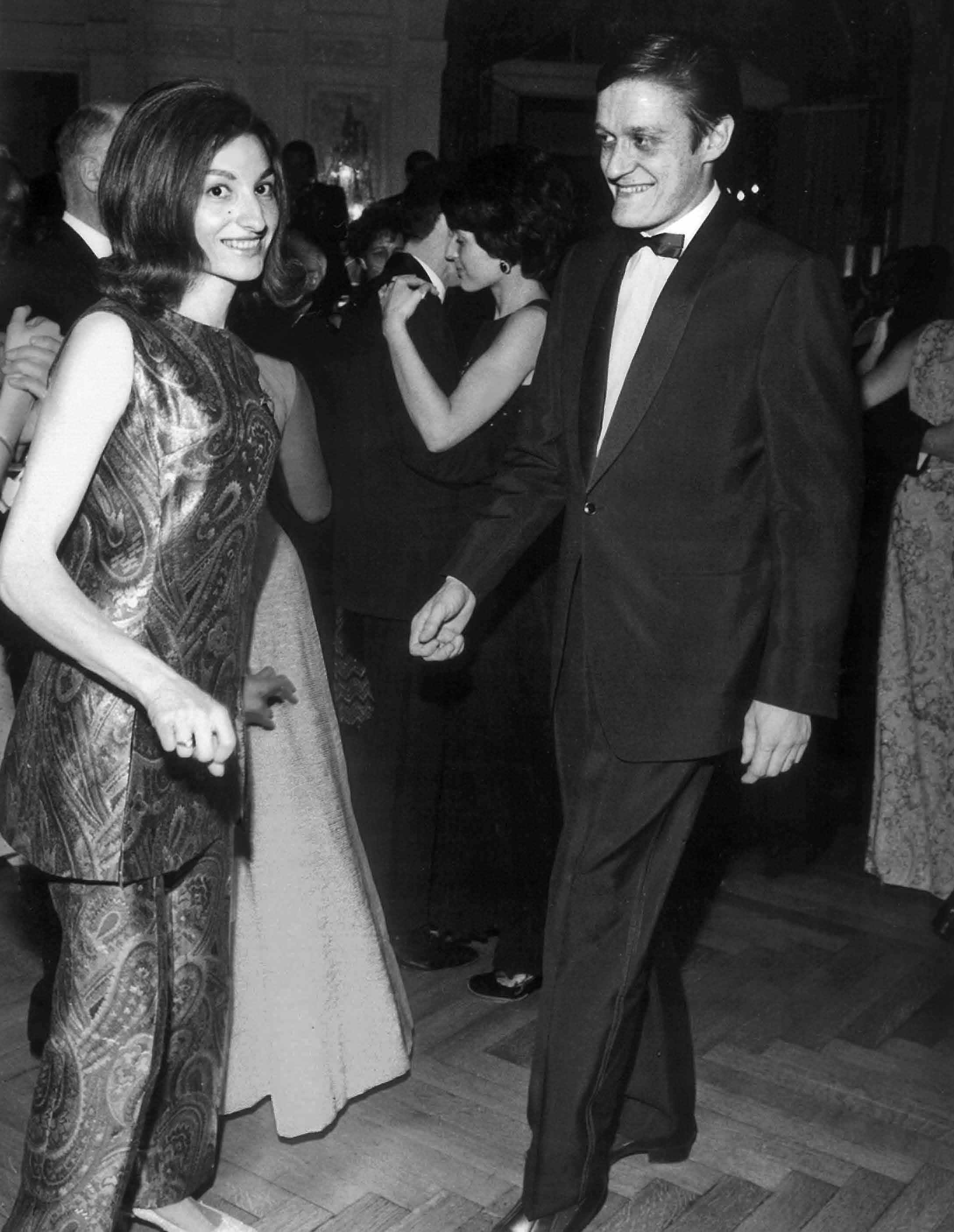
Herbert Huber (geboren 1941) ist seit 1957 in der Gastronomie tätig. Als gelernter Koch und Absolvent der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern führte er unter anderem mit seiner Frau das Goldene Kreuz in Gerzensee, den Giessenhof in Dallenwil und die Stanser Linde. Huber bekochte Elizabeth Taylor, Fürst Rainier von Monaco und diverse Bundesräte. Seit 1992 ist er Gastronomieberater, Buchautor und Jurymitglied des Guide Bleu.
«Hotelier»-Gespräch mit Herbert Huber, Hotelier, Gastwirt, Gastrotester und Buchautor
Herbert Huber. In der Zentralschweiz kennt man ihn als Gastro-Kritiker, Kolumnist und Buchautor. Jahrzehntelang führte er zusammen mit seiner Frau eigene Betriebe im Kanton Bern und in Nidwalden. Als Buchautor wurde er schweizweit bekannt – und jetzt feiert der Absolvent der Hotelfachschule Luzern seinen 80. Geburtstag.
INTERVIEW Hans R. Amrein
Herbert Huber, Sie haben 1957 eine Kochlehre begonnen, nachdem es Ihnen an am Gymnasium verleidet ist … Ihr Vater wollte ja, dass Sie eine Karriere als Architekt machen … (lacht) Ja, ich hatte alles andere im Kopf, als nur die Schulbank drücken. In der Geometrie war ich eine Niete, Algebra gurkte mich an. Latein ging noch irgendwie. Man schickte mich von Berufsberater zu Berufsberater. Die Eltern waren buchstäblich am Verzweifeln und fragten sich: Was, um Gottes willen, wird später einmal aus unserem Herbertli?
Dann half Ihnen ein Franziskanermönch weiter… Richtig, der Franziskaner Pater Professor Gügler aus Luzern half mir beratend auf die Sprünge und meinte, mit meiner vielseitigen Begabung solle ich den Sprung in die Gastronomie wagen – das war die Initialzündung. Ich begann eine Lehre als Koch.
Wie fühlten Sie sich damals als junger Lehrling in der Küche?
Zuerst kam die Kochuniform, respektive der elterliche Vorschuss, diese zu kaufen. So stand ich «uniformiert» vor dem Spiegel und übte mich in Selbstbetrachtung. «Ein flotter Kerl bist du», redete ich mir zu. «Die Gäste werden sich eines Tages vor dir verneigen und applaudieren, wenn Du auf die Gastronomiebühne trittst» …
Und?
Der Start war ernüchternd, ja, eine Katastrophe! Die Begrüssung des Küchenchefs alles andere als aufmunternd: «Aus einem Halb-Intellektuellen ist noch nie ein Koch geworden, alle diese Studierten haben zwei linke Hände. Und nur weil dein Vater den Patron kennt, ist das noch keine Garantie, dass Du erfolgreich sein wirst», sagte er und liess mich einen Berg Rüebli schneiden. Auch die Atmosphäre dieser «unterirdischen» Küche, der Geruch nach Fett
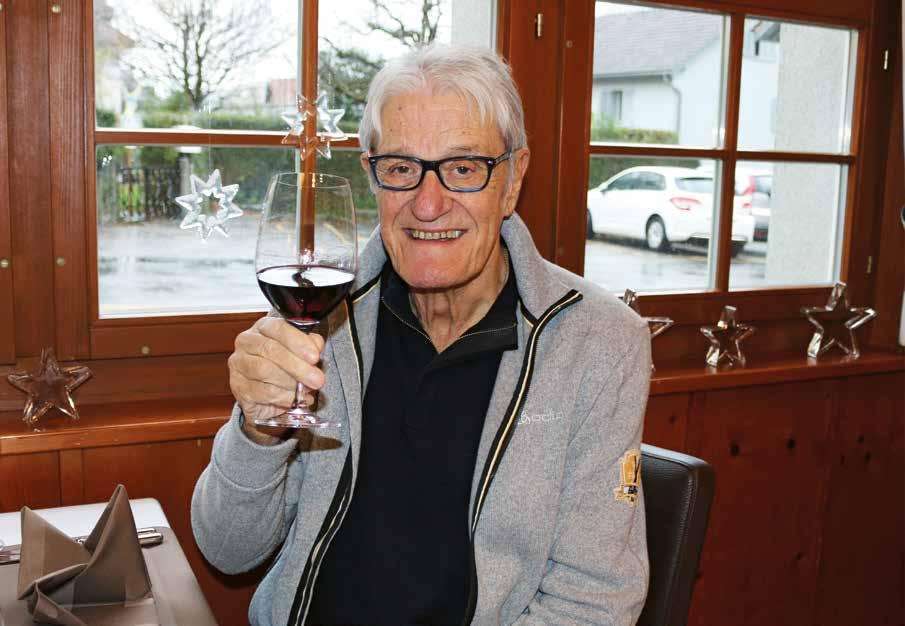
und Schweiss, Fisch und Braten, war echt gewöhnungsbedürftig. Bald aber merkte ich, dass der Lehrmeister ein guter Koch sein musste, denn das alte Continental an der Morgartenstrasse in Luzern war die Ausgehadresse schlechthin.
Flogen damals auch Pfannen durch die Küche?
Ja, manchmal flogen Pfännchen oder was gerade zum Fliegen da war, durch die Küche. Hinzu kam der derbe Ton, das Gebrüll des Chefs während des Service. Als ich mich einmal zu Hause beschwerte, meinte Vater Huber: «Du hast es so gewollt – jetzt wird durchgebissen. Punkt.»
Und wie endete dieses KüchenAbenteuer in jungen Jahren? Übrigens: Ich bezahlte am Anfang noch Lehrgeld. Das waren 50 Franken pro Monat. Lohn gab es erst ab dem 2. Lehrjahr. Ich beendete dann die Lehre mit ➤
Bestnote 1,2 – da sagte der Chef: «Ich habe es ja immer gewusst, dass aus dir ein guter Koch wird …»
Waren Sie dann als Koch in verschiedenen Betrieben aktiv oder wurden
Sie direkt Restaurateur?
Dank der Beziehung meiner Mutter zu Otto Schlegel durfte ich meine erste Saisonstelle im Gstaad Palace antreten. Das war im Winter 1961. Schlegel wurde sozusagen mein Mentor, er förderte und forderte mich – und zwar schonungslos. Bald wurde ich Chef Ròtisseur im weltberühmten Palace Hotel in Gstaad.
Und wie war das Leben in der «Welt der Schönen und Reichen»?
Das war meine Welt. Später beförderte mich Otto Schlegel im Palace Luzern. Ich wurde Chef-Saucier. In den Zwischensaisons schnupperte ich Küchenluft bei Bruder Ernesto Schlegel im Berner Schweizerhof. Ich arbeitete im «Raisin Cully» und am Automobilsalon in Genf.
Buch-Tipp
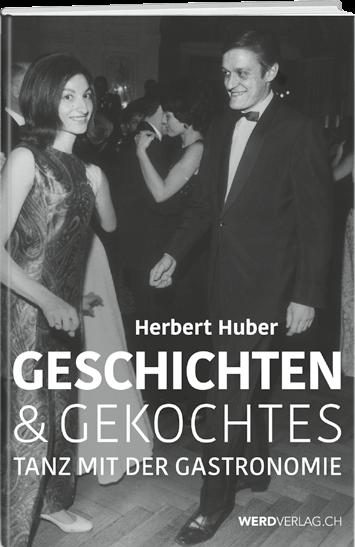
In 60 Jahren «Tanz mit der Gastronomie» ist wohl das eine oder andere Küchengeflüster herumgegangen und es ist die eine oder andere Suppe gekocht worden, die dann auch ausgelöffelt werden musste: «Geschichten und Gekochtes» ist ein Buch für Menschen vom Fach und für solche, die ein bisschen etwas von Lust und Frust des Gastgewerbes verstehen. In seinen «Geschichten» nimmt Herbert Huber den Leser mit in die aufregende Welt der Gastronomie von damals und heute.
Autor: Herbert Huber
1. Auflage 2018
232 Seiten, 16,4 × 23,5 cm, gebunden, Hardcover, mit 68 Abbildungen
ISBN 978-3-85932-911-9, CHF 39.–
Sich kochten aber auch für weltberühmte Filmstars … … ja, Elisabeth Taylor und Richard Burton engagierten mich direkt vom Palace weg als Privatkoch in ihr Chalet «Ariel» in Gstaad – für vier Monate. Der Lohn war ein Vielfaches von dem, was ich im Palace verdiente. Ein willkommener Zustupf für die Hotelfachschule Luzern, die schon bald in meinem Kopf herumgeisterte …
Dort lernten Sie Ihre Frau Gertrude kennen.
Ja, und weil diese Gertrude auch meinen Eltern «passte», zogen wir klammheimlich nach Paris, wo wir uns 1966 verlobten. Nach gut vier Monaten kehrten wir mit abgeschlossenem Französischstudium nach Hause zurück.
Und dann begann Ihre Karriere als Restaurateur.
Richtig, die Schlegel Brüder hatten einen Betrieb für uns. Das «Goldene Kreuz» in Gerzensee im Kanton Bern. Als Bewerber Nummer 36, die den Mut hatten, den Vertrag als Direktionsehepaar zu unterschreiben, wurden wir mit 27 Jahren engagiert. Dieses unglaublich erfüllende Engagement dauerte zwölf Jahre. Wir hatten 24 festangestellte Mitarbeitende, denn wir wurden von den Gästen buchstäblich überrannt. Das «Goldene Kreuz» wurde zum Vorzeigebetrieb des Kantons. Unsere Gäste waren Bauern und Bundesräte, auch das thailändische Königshaus war zu Gast … Und Fürst Rainier von Monaco verbrachte seine «Diät-Ferientage» bei uns in Gerzensee.
Sie haben – zusammen mit Ihrer Frau – total drei Gastronomiebetriebe geführt. Was waren so die Highlights in diesen 25 Jahren? Nach zwölf Jahren Gerzensee zog es uns in die Innerschweiz zurück. Nach Dallenwil, in den Giessenhof. Wir wollten selbständig sein – und ich wollte wieder an den Herd. Und bald wurde meine Kochmontur, mit der ich die Gäste begrüsste und beriet, zum

Perfekte Gastgeber: Herbert und Gertrude Huber in der «Linde» in Stans (1987 bis 1992).
Markenzeichen Huber. Hatte der Spiegel im Continental doch recht?
Ihre Konkurrenten sprachen damals vom «Gastro Clown Huber» … … dieser Clown verkaufte sich! Und noch etwas: Ohne Gertrude an meiner Seite hätte ich es nie geschafft. Wir waren ein Super-Team! Und wir arbeiteten als gleichberechtigtes Team, auch Punkto Lohn. Das war damals eine Seltenheit in der Gastronomie.
Was folgte nach dem Giessenhof in Dallenwil?
Nach acht Jahren wurde uns die «Linde» in Stans zur Miete angeboten. Einer der wohl schönsten, denkmalgeschützten Bauten an bester Lage im Kantonshauptort. Wir engagierten Beat Müller als Küchenchef und ich zelebrierte wieder mit voller Kochmontur das gastgewerbliche Schauspiel. Wir wurden dafür mit 15 GaultMillauPunkten belohnt. Ja, und wir waren immer auf der Liste der 100 besten Restaurants der Schweiz aufgeführt. Nach fünf Jahren hatten übergaben wir die «Linde» dem Ehepaar Regine und Beat Müller. Ein Glücksfall.
Sie waren 25 Jahre aktiv in der Gastronomie und wollten dann Präsident des schweizerischen Wirte-Verbandes (heute Gastrosuisse) werden … … Ich scheiterte bei der Wahl knapp, denn es fehlten nur sieben Stimmen.
Was dann?
Ich hatte mir in den 25 Jahren ein sehr grosses Beziehungsnetz aufgebaut und gründete die Beratungsfirma «Profit Gas-
tronomie». Zu meinen Kunden gehörten zum Beispiel die «Feldschlösschen Immobilien». Ich war zudem sechs Jahre Auditor der Firma «Pro Cert» und betreute das spannende Projekt «Culinarium Ostschweiz».
Sie wurden dann auch Buchautor und Kolumnist.
Daniel E. Eggli, der damalige Herausgeber des Magazins «Salz & Pfeffer», beförderte mich zum «Wirt für alle Fälle». Ich verfasste daneben auch Kolumnen und Berichte für die «Luzerner Woche, die «Schweizer Familie», die «Luzerner Zeitung», wo ich acht Jahre lang eine eigene Kolumne hatte.
Sie haben auch mehrere Bücher verfasst, im letzten Werk, «Geschichten & Gekochtes», geht es um Ihr Leben und Ihre Karriere … … Es ist, im ersten Teil, eine Biographie. Im zweiten Teil folgen Beiträge aus der «Neuen Luzerner Zeitung», und im dritten Teil werden persönliche Rezepte und solche
von Freunden und Wegbegleitern publiziert. Anton Mosimann hat das Vorwort geschrieben. Für den Werd & Weber Verlag habe ich in rund fünfzehn Jahren mehrere gastronomische Bücher initiiert und verfasst.
Auch das Buch «Virus Gastgewerbe»?
Nein. Das war mein erstes Buch, es ist im Brunner Verlag Kriens erschienen. Es hat sich wie frische Weggli verkauft, ist jetzt aber vergriffen.
Apropos Virus. Heute sprechen alle vom Corona-Virus, erklären Sie mir bitte das Gastronomie-Virus. Ein erfolgreicher Unternehmer (nicht nur in der Gastronomie) muss vom Virus für seinen Beruf infiziert sein. Mit Haut und Haar. Mit Kopf und Seele. Nur dann ist man erfolgreich. Gut, man könnte dem auch «Feuer der Begeisterung» sagen.
herberthuber.ch

Kommentar
Vollblut-Gastwirt
Ich kenne Herbert Huber schon seit vielen Jahren. Er verkörpert für mich den «Gastwirt klassischer Schule» schlechthin. Eine erstaunliche Karriere hat der heute 80-Jährige hinter sich, nicht weniger als 25 Jahre standen er und seine Gertrude in ihren Restaurants im Dauereinsatz. Gastwirt sein – das hiess damals 16-Stunden-Einsatz, Verzicht auf Privates, Familie und Hobbys.
Ich fragte Herbert Huber nach seinem Credo. In der Branche redet man ja vom so genannten «Service-Virus» oder «Service-Gen», das man in sich tragen müsse. Seine Antwort: «Ein erfolgreicher Unternehmer (nicht nur in der Gastronomie) muss vom Virus für seinen Beruf infiziert sein. Mit Haut und Haar. Mit Kopf und Seele. Nur dann ist man erfolgreich. Gut, man könnte dem auch «Feuer der Begeisterung» sagen.
Fest steht: Herbert Huber trägt dieses «Gastro-Virus» (nicht zu verwechseln mit dem Corona-Virus) noch heute in seiner Brust. Sein Leben war und ist das Gastgewerbe. Er schreibt, kocht und gibt den exzellenten Gastgeber –heute eher privat. Seine Bücher sind lebendig, spannend, kompetent, leidenschaftlich und am Ende auch sehr erfolgreich, sein Name wird beachtet und geachtet. Und: Huber ist ein exzellenter Verkäufer und Netzwerker. Er weiss, wie man Ideen oder Produkte an den Mann bzw. an die Frau bringt. Ich kenne aktuell keinen Ex-Gastronomen im Land, der sich annähernd so aktiv und mit Herzblut für die Branche engagiert.
Lieber Herbert, nur das BESTE für die Zukunft, weiterhin viel Erfolg, Spass und beste Gesundheit wünsche ich dir!
Hans R. Amrein
Das Team von b_smart services bietet Hoteliers einzigartige Leistungen und Services an

Corona macht Pause – könnte man denken, wenn man sieht, wie sich das Reiseverhalten derzeit wieder verändert. Griechenland und Spanien sind hoch im Kurs. Und die hiesigen Hotels? Diese stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Aktuellen Studien zufolge sind bis zu 50% der Branchenmitarbeiter international in andere Branchen gewechselt. Auch in der Schweiz hören wir derzeit oft, dass nicht mehr genügend Mitarbeiter gefunden werden können. Gleichzeitig müssen die Betriebskosten möglichst effizient eingesetzt werden – eine Mammutaufgabe.
Das Team der b_smart services rund um Peter Ritsch wurde deswegen in den vergangenen Monaten besonders häufig kontaktiert. Viele Betriebe stehen vor ähnlichen Herausforderungen, welche die b_smart services mit ihren eigenen Betrieben der b_smart selection bereits weit vor der Coronakrise gelöst hatten. Ungeplant ist dieses Know-how für viele Betriebe nun genau das, was sie suchen.
Kontakt & Infos b_smart services Industriestrasse 2 9487 Gamprin-Bendern Fürstentum Liechtenstein Mobile: +41 78 627 02 00 Mail: pr@b-smarts.net b-smart-services.net
Der Kostendruck hat sich in den letzten Monaten erhöht. Gleichzeitig wurden Härtefallhilfen und Kurzarbeit eingeführt – dennoch bewegen sich viele Hotels in den tiefroten Zahlen. Zahlreiche Hotels haben in den vergangenen Jahren digitale Experimente durchgeführt und hingen nun, mitten in der Krise, an teuren, komplexen und teilweise ungeeigneten IT-Systemen.
Diese Probleme hat die b_smart selection umgangen. Mit Ihrem Self-Check-in Konzept, einer hohen Digitalisierung der Betriebsabläufe konnte die Hotelgruppe mitten in der Krise wachsen. Auch die b_smart services haben in den KrisenMonaten zahlreiche Hotelbetriebe gewinnen können. Mittlerweile führt die Gruppe 16 eigene Betriebe und betreut 12 Service-Kunden. Diese sind absolut überzeugt von dieser Zusammenarbeit –daher haben wir mal hinter die Kulissen geschaut und uns mit Peter Ritsch zum Gespräch getroffen.
• 24/7 Reception (Diese kann auch nur zu Randzeiten gebucht werden)
• Übernahme des Reservationsmanagements
• Optimierung der Betriebsprozesse, so dass der Hotelier Zeit für seine Gäste hat.
• Konzeptionierung, Einführung und Unterhalt eines Self-Check-in Systems.
• Nachfolgelösung für Unternehmer und Hoteliers, welche den Betrieb aufgeben möchten.
• Über unser Partnerunternehmen CONERUM AG* helfen wir Investoren, die einen Betrieb kaufen möchten
* Die Conerum AG ist ein Partnerunternehmen der b_smart selection, welches exklusiv für die Standortsuche und –entwicklung der b_smart selection verantwortlich zeichnet. Das Unternehmen bietet Ihre Dienstleistungen wie Standortanalysen, Machbarkeitsstudien, Wirtschaftlichkeits- und Bauberatungen auch für Hoteliers und Investoren an.
1 2
5 Fragen an Peter Ritsch
Was und wer steckt hinter der b_smart selection?
b_smart ist ein privat gehaltenes Unternehmen im Eigentum mehrerer Unternehmer, die durch ihren Einsitz im Verwaltungsrat auch aktiv an der Entwicklung der noch jungen Unternehmensgruppe mitwirken. Ziel der b_smart selection ist es, dem Betriebssterben in der Klein- und Privathotellerie durch innovative und moderne Lösungen zu begegnen und sie zukunftsfähig aufzustellen. Sei es durch die Übernahme der Betriebe oder das Konzept von «b_smart services», welches Hoteliers hilft, ihre Kosten wesentlich zu senken und mehr Freiräume zu erhalten.

3 4 5
Was bietet b_smart services den Hoteliers?
b_smart services hilft dem Hotelier, seinen Betrieb zukunftsfähig aufzustellen und die mittlerweile verfügbaren Technologien zu seinen Gunsten zu nutzen. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass die Zukunft vieler kleiner Hotels in sogenannt «hybriden» Betriebsmodellen liegt. Das heisst, dass der Hotelier respektive seine Familie den Betrieb zu Kernzeiten persönlich und mit familiärem Servicestandard führt. In den Randzeiten werden die Synergien mit «b_smart services» genutzt. Dies führt dazu, dass die Verfügbarkeit für den Gast auf 24/7 ausgebaut werden kann und der Hotelier gleichzeitig viele Kosten sparen und selbst mehr Freiheiten und Lebensqualität gewinnen kann. Die Rund-umdie-Uhr-Erreichbarkeit wird durch das b_smart services-Team übernommen.
Worin liegt der Mehrwert, wenn Hoteliers mit b_ smart services zusammenarbeiten?
Konkret lassen sich die Vorteile wie folgt zusammenfassen:
– Die Rentabilität des Hotelbetriebs wird durch das Teilen von Kosten für die 24/7-Betreuung der Rezeption massiv verbessert und gleichzeitig steigern viele Hotels dadurch ihre Erreichbarkeit.
– Der Hotelier, respektive seine Familie gewinnt an Freiräumen und Lebensqualität, indem b_smart services die Betreuung der nicht rentablen Randzeiten übernimmt.
– Mit dem Digitalisieren von Betriebsabläufen kennen wir uns bestens aus und können so unseren Kunden optimale Prozesse empfehlen und helfen bei deren Einführung.
Hilft b_smart services den Hotels, den aktuellen Fachkräftemangel zu entschärfen?
Auf jeden Fall! Durch die Zusammenarbeit mit b_smart services können Personalressourcen an der Rezeption, in der Reservation und in der allgemeinen Administration deutlich reduziert werden.
Wie hilft b_smart services den Hotels konkret?
Die Leistungen von b_smart lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen:
– Aktive Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung der Automatisierung der Betriebsprozesse
– Übernahme sämtlicher Rezeptions- und Reservationsaufgaben während 24 Stunden an allen Tagen des Jahres
– Nutzung des umfassenden Netzwerks von b_smart services und der damit verbundenen Vorteile, so auch attraktivere Einkaufskonditionen.
Hanni Sele & Lara Beck, Landhaus am Giessen in Vaduz «Durch die Modernisierung und dem guten Service von b_smart services sind wir nun 24h/7 Tage erreichbar und können trotzdem für unsere Gäste persönlich da sein und so ein familiäres Ambiente bieten. So haben wir das Beste der zwei Welten kombiniert. Durch die Zusammenarbeit mit b_smart sevices wird unsere alltägliche Arbeit enorm erleichtert und wir haben mehr Zeit für unsere Gäste vor Ort.»

Philipp Schneider Krone Mosnang in Mosnang «Die Krone-LODGE ergänzt mit den zehn ZweibettZimmern unser gastronomisches Angebot ideal. So können wir unseren Gästen ein Rundum Erlebnis ermöglichen. Mit b_smart services haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der die gesamte «Rezeption» übernimmt – und uns somit im Arbeitsalltag sehr stark unterstützt und wir uns auf unsere Kernkompetenz, die Gastronomie, kümmern können.»

Roberto Maier, Business Hotel Maier in Götzis AT «Durch die Übernahme der operativen Verwaltung durch die b_smart services konnte unser MitarbeiterStock deutlich optimiert und dadurch Kosten gespart werden. Gleichzeitig erhalten wir ausserordentlich positives Feedback unserer Gäste. Aufgrund der professionellen Arbeit wird uns auch sehr viel «lästiger Aufwand» abgenommen –was ein persönlicher Mehrwert für die Geschäftsführung bedeutet.»

«Hotelier»-Gespräch mit Hyatt-Europachef
Peter Fulton über die Folgen der Covid-Krise
Peter Fulton (64) ist der Chef im Europa-Hauptquartier von Hyatt in Zürich-Kloten. Er ist für mehr als 130 Hyatt-Hotels in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Südwestasien verantwortlich. Im Interview mit Rolf Westermann, Chefredaktor der deutschen AHGZ, spricht er über den Veränderungsdruck und die Erholung der Märkte.
INTERVIEW Rolf Westermann*
Peter Fulton, die Hotellerie in Europa erwacht langsam wieder. Wie wird sich das Geschäft von der Zeit vor Corona unterscheiden? Es gibt für mich keinen Zweifel, dass unser Business wieder durchstarten wird, auch wenn es noch das eine oder andere Hindernis gibt. Menschen brauchen Menschen. 19 Monate nach dem Beginn der CoronaPandemie sind die Erwartungen der Gäste hoch. Sie suchen Komfort mit Behaglichkeit, bei dem ihre Sicherheit und Gesundheit gewährleistet ist. Und unsere Aufgabe ist es, darauf einzugehen. So haben wir hart gearbeitet, unter anderem an unseren Hygienestandards.
Haben sich die Gäste verändert? Wer monatelang im Lockdown war (siehe Deutschland), möchte etwas Besonderes erleben. Das macht die Hotels kreativer und innovativer. Die Gäste wollen den Aufenthalt auf ihre eigene Weise umsetzen. Da spielt auch Technologie eine grosse Rolle. Viele nutzen digitale Apps zum Check-In, weil sie nicht an die Rezeption kommen möchten.
Manche sagen, die Menschen vergessen schnell.
In zahlreichen Ländern sehen wir, dass die Menschen wieder in ihre Gewohnheiten zurückkehren, wenn
sich die Möglichkeit ergibt. Das ist ja auch das Ziel, für das wir alle arbeiten. Die jetzige Situation wird noch einige Zeit andauern, aber die menschlichen Verbindungen sind nicht zu ersetzen.
Wie wandelt sich die Bedeutung von Luxus?
Geht es um mehr Raum, Zeit und Individualität?
Individuen definieren Luxus für sich selbst. Luxus betrifft ganz unterschiedliche Hotels, kleine und grosse Häuser oder auch Hotels mit einer sorgfältig über Jahre herausgearbeiteten Story. Die Menschen suchen personalisierte Aufenthalte und Luxus ausserhalb ausgetretener Pfade sowie Erlebnisse, die den Unterschied machen. Es sind unsere Mitarbeitenden, die diese Angebote entwickeln und anpassen.
Wo läuft es in ihrer Region schon besonders gut, wo geht es erst langsam los?
Das ist wirklich interessant. Wir hatten lange in Indien ein gutes Geschäft, bis die zweite Corona-Welle kam und dafür sorgte, dass kaum eine Familie nicht davon betroffen war. Derzeit läuft es im Nahen Osten gut, etwa in Dubai. Die Resorts, etwa das Hyatt Regency in Sotschi am Schwarzen Meer, laufen unglaublich und endlich können wir in Westeuropa wieder starten. Hier geht es etwas langsamer voran. ➤

Heutige Position von Peter Fulton: Group President EMEA South West Asia Hyatt Hotels Corporation (seit 2011).
Stationen: Seit 1985 bei Hyatt in unterschiedlichen Funktionen (u. a. General Manager Grand Hyatt Dubai, Hyatt Regency Delhi, Hyatt Regency Acapulco).
Ausbildung: Kellogg Executive Education, Hotelmanagement (Napier College).
Geboren: 1957 in Neuseeland.

Wie ist Hyatt bisher durch die Krise gekommen und bis wann rechnen Sie mit einem Niveau wie vor der Krise?
Hyatt und die ganze Hospitality-Branche hatte 2019 ein grosses Jahr. Daran wollen wir wieder anknüpfen. 2021 wird zwar ein weiteres schwieriges Jahr, aber wir sind optimistisch, dass wir 2023 oder 2024 wieder positiv dastehen werden. Die Hotellerie ist die am schwersten betroffene Branche, der Effekt wird einige Jahre andauern.
Hyatt hat eine starke Expansion in Europa angekündigt. Wo liegen die Schwerpunkte und wie viele Hotels sind geplant?
Wir planen mehr als 20 Hotels bis Ende 2023 in Europa. Das Wachstum liegt in den kommenden Jahren bei mehr als 30 Prozent und die Pipeline ist stark besetzt, mit Neueröffnungen etwa in Tschechien, Zypern, Island, Georgien, Polen, Albanien, Estland oder Finnland.
Welche Pläne gibt es für Deutschland, Österreich und die Schweiz?
Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt und es gibt viele Aktivitäten. Wir sind überzeugt, dass wir in den nächsten sechs Monaten ein Wachstum ankündigen können, derzeit kann ich noch keine Details nennen.
Wird Hyatt mehr auf Leisure Resorts setzen?
Derzeit haben wir noch einen geringen Anteil an Resorts – etwa 16 Prozent vom gesamten Portfolio. Wir wollen mehr Resorts entwickeln und fokussieren uns auf wärmere Länder mit Standorten an Seen, am Meer, in den Bergen. Da gibt es enorme Möglichkeiten und der Mix zwischen Business und Leisure ist im Kommen. Wir gehen dorthin, wo die Gäste es wollen.
Welche Erwartungen verbinden
Sie mit dem neuen Hyatt Regency in Zürich, das vor kurzem im neuen The Circle am Flughafen eröffnet wurde – angesichts der Probleme im Flugverkehr und bei Veranstaltungen?
Das ist ein grossartiges Hotel mit Kongresszentrum an einem tollen Ort. Dort haben wir viele Möglichkeiten für grosse Hybrid-Events geschaffen. Das wird ein starker Performer. Die Luftfahrt ist resilient und wir werden darüber hinwegkommen.
Zu den Höhepunkten 2021 gehört die Einführung der Marke «Destination by Hyatt» in Europa. Die Marke umfasst bisher weltweit 17 Hotels und Resorts. Wie kamen Sie auf das erste Objekt auf Ibiza und welche Pläne haben Sie damit?
Das ist eine wichtige Marke im LeisureBereich, mit der wir die Möglichkeit haben, bei den Resorts zu expandieren. Es geht um Entdeckungen, Familie, Authentizität, exzellente Lage, echten Service und zurückgenommenen Luxus. Es ist eine tolle Gelegenheit und wir sind glücklich, dass wir zum Zug gekommen sind. Leider war ich noch nicht persönlich dort (lacht).
Die meisten Hotels der Marke liegen in den USA. Kommt auch die DACH-Region als Standort in Frage? Natürlich. In den kommenden Monaten werden wir einige neue Projekte bekanntgeben, eines davon liegt in der Schweiz.
Warum ist es so wichtig für eine globale Hotelkette, eine Marke mit unabhängigen Individualhotels zu haben?
Markenhotels sind weltweit in der Minderheit und es gibt sehr viele extrem erfolgreiche Hotels, die unabhängig sind. Wir möchten den Eigentümern dieser Häuser die Möglichkeit geben, das zu behalten,



wofür sie so hart gearbeitet haben, aber gleichzeitig von der weltweiten Distribution einer grossen Marke zu profitieren. Dadurch wird auch unsere Marke aufgewertet.
Wie beurteilen Sie die Zukunft der Kettenhotellerie?
Wir sind sehr resilient, gehen in die Krise und kommen wieder heraus. Die Hospitality ist die älteste Industrie, Innovation gehört zu unserer DNA. Wir werden zu unserer Stärke zurückfinden, auch wenn es noch nicht gleich morgen ist.
Wie lautet die Vision von Hyatt?
Wir möchten nicht die Grössten sein, aber die Besten im Umgang mit Eigentümern,
Mitarbeitern, Gästen, Lieferanten. Und wir expandieren in allen wichtigen Regionen. «To care for people so they can be their best», lautet der Leitspruch von Hyatt. Denn es sind die Gäste, die uns zu dem machen, was wir sind.
* Quelle & Copyright: Bearbeitete Kurzfassung eines Gesprächs, das AHGZ-Chefredaktor Rolf Westermann im Juni 2021 mit Peter Fulton führte. Copyright: AHGZ, 2021
Gründung: 1957, börsennotiert.
Firmensitz: Chicago / USA.
Zahl der Hotels weltweit: 1000 Hotels in 68 Ländern (erstes Quartal 2021).
Zahl der Hotels in Europa: über 70 Hotels von 9 Marken in 23 Ländern.
Pipeline: 500 Hotels mit rund 100 000 Zimmern (Ende 2020).
Marken: 20 (u. a. Park Hyatt, Grand Hyatt, Andaz).
CEO & President: Mark S. Hoplamazian.
Geschäftsjahr 2021, Q1: 304 Mio. US-Dollar Verlust.
[01] Hyatt-Manager Peter Fulton. Der 65-Jährige führt seine Hyatt-Hotels von Zürich-Kloten aus.
[02] The Circle Zürich-Airport (Rendering). Hier wurden zwei Hyatt-Hotels mit 550 Zimmern eröffnet.
[03] Derzeit das einzige Hyatt-Hotel in der Schweiz: Park Hyatt Zürich.
[04] Schlafbereich einer Suite im Park Hyatt Zürich.
Marriott-Vizepräsidentin Gitta Brückmann:
Sie ist als Vice President Austria, Germany, Switzerland zuständig für die Marriott-Hotels im DACH-Raum, so auch für die Marriott-Hotels in der Schweiz. Ein Interview mit Gitta Brückmann über die Themen Resort-Hotellerie und Hotel-Positionierungen.

[01] Gitta Brückmann: «Mit Blick in die Zukunft haben wir Verträge für einige fantastische Häuser unterzeichnet, darunter The Ritz-Carlton Zermatt.»
[02] Neu Mitglied der Autograph Collection von Marriott: Waldhaus Flims Grand Hotel & Spa.
[03] «Unser ikonisches Berghotel in den Alpen»: W Hotel in Verbier.
Wie viele Resorts betreibt Marriott aktuell in Europa?
Marriott International betreibt über 70 Resorts in Europa. Diese befinden sich hauptsächlich in unseren südeuropäischen Märkten wie Portugal, Spanien, Italien und Griechenland. Unsere Resorts laufen unter den Marken Sheraton, Westin, Marriott und Le Méridien in Destinationen wie Mallorca, Teneriffa, Malta und Rhodos. An der Algarve, auf Sardinien, Teneriffa, Zypern, Santorin, Kreta, Mallorca und Bodrum (und auch noch in weiteren Destinationen) haben wir auch einige Resorts unter unseren Marken Autograph Collection, Luxury Collection, Edition, St. Regis und The RitzCarlton. Im Dezember 2020 wurde das Waldhaus Flims Mitglied der Autograph Collection. Es ergänzt unser ikonisches Bergresort W Verbier.
Sie setzen derzeit vermehrt auf die Resorts und Ferienhotels?
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Resort-Hotellerie, ähnlich wie schon im Sommer 2020, auch in diesem Jahr der grosse Gewinner sein wird. Dies wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen und potenziell ausweiten. Einen ersten Beweis dafür haben wir im vergangenen Sommer gesehen, als die Beschränkungen in Europa kurzzeitig auf-
gehoben wurden und viele unserer Resorts in diesen wichtigen Sommerwochen eine hohe Auslastung erzielen konnten.
Verfolgt Marriott derzeit Pläne, im Bereich Resort- oder Ferienhotellerie stärker zu expandieren als zuvor?
Als Unternehmen eruieren wir kontinuierlich Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten, um unser Portfolio zu erweitern und unseren Mitgliedern und Gästen noch mehr Unterkunftsmöglichkeiten zu bieten. Trotz der Herausforderungen im vergangenen Jahr stand das Wachstum bei uns im Fokus. Selbst während der globalen Pandemie haben wir in Europa /Afrika / Middle East 2020 neue Verträge für über 13 500 Zimmer unterzeichnet und über 50 neue Hotels eröffnet. Nur ein Beispiel: Im Herbst dieses Jahres wird die Marke W ihr Debüt am Strand der Algarve geben. Ebenfalls noch in diesem Jahr wird das Marriott Resort Palm Jumeirah eröffnet, unser erstes Resort von Marriott Hotels in Dubai. Das Resort wird über mehr als 600 Gästezimmer, acht Restaurants, einen Kinderclub und einen privaten Sandstrand verfügen und ist damit ein perfektes Resort für Familienurlaube.
Mit Blick in die Zukunft haben wir Verträge für einige fantastische Häuser unterzeichnet, darunter The Ritz-Carlton Zer-

matt, das als erstes Ritz-Carlton-Skiresort in Europa voraussichtlich 2026 öffnet und mit grosser Spannung erwartet wird.
Werden Marken in der europäischen Resort-Hotellerie an Bedeutung zunehmen?
Aus Sicht von Marriott war Markenvertrauen im dynamischen Reisemarkt schon immer von grosser Bedeutung – heutzutage ist es aber so wichtig wie nie zuvor. Im Laufe der Jahre hat Marriott immer wieder neue Marken in sein Portfolio aufgenommen, um auf Veränderungen in der Reisebranche, auf neue und aufstrebende Destinationen und auf die Bedürfnisse der Kunden, einschliesslich neuer Segmente zu reagieren.
Jede der 30 Marken im Portfolio von Marriott verfügt über eine Reihe von Markenstandards, die jedes Hotel unter der Flagge der jeweiligen Marke erfüllen muss. Diese

Markenstandards gewährleisten weltweit ein einheitliches Qualitäts- und Serviceniveau und werden regelmässig überprüft, um sicherzustellen, dass unsere Hotels ihr Markenversprechen einhalten. Wenn wir potenzielle neue Hotels oder Resorts in unser Portfolio aufnehmen, arbeiten wir eng mit den Hoteleigentümern zusammen, um sorgfältig zu prüfen, ob die Marke zu
dem jeweiligen Haus passt. Dies ist ein gemeinschaftlicher Prozess, bei dem viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, von der Zimmergrösse über das Freizeitangebot und die Lage bis hin zur demografischen Zielgruppe.

«Reisen ist und bleibt ein elementares menschliches Bedürfnis, daran wird auch die Coronakrise nichts ändern. Doch das Virus markiert eine ‹Stunde null› für die Tourismusbranche»
ANJA KIRIG, TRENDFORSCHERIN

Neue Trendstudie des Zukunftsinstituts: «Die Welt des Tourismus nach Corona»
Die Tourismusindustrie zählt zu den Branchen, die weltweit am stärksten von der Coronakrise getroffen wurden. Nach der eigentlichen Coronakrise fragen sich die Experten: Wird sich der Tourismus weltweit fundamental verändern – oder bleibt alles beim Alten? Die Trendforscherin Anja Kirig (44) publizierte eine neue Trendstudie mit dem Titel «Die Welt nach Corona». Hier ihre Thesen:
TEXT Anja Kirig
Die Herausforderungen, vor denen der Tourismus steht, waren bereits im Vorfeld der Coronakrise enorm. Die Reisebranche litt unter einem Vertrauens- und Imageverlust, der mit Insolvenzen begann und durch geopolitische Unsicherheiten zusätzlich genährt wurde. Zudem hatte die Debatte über Klimafolgen und Overtourism das individuelle Reiseverhalten signifikant verändert. Durch die zunehmende Verschmelzung von «Work» und «Life» und Trendphänomene wie «Workation» befand sich auch das Geschäftsreiseaufkommen stark im Wandel. So schwankte die Tourismusbranche schon seit geraumer Zeit zwischen scheinbar ungebremstem Wachstum und einer Fülle fundamentaler
Herausforderungen, die ein tiefgreifendes Umdenken und Umlenken langfristig unverzichtbar machen.
Der Reset, den die Coronakrise bewirkte, erzwang dieses Neudenken mit einem Schlag – und ebnete zugleich den Boden für eine neue Rezeption des Tourismus. So schmerzlich die Pandemie wirtschaftlich für die Branche war und noch ist: Sie kann – und muss – auch als Anbeginn einer neuen, nachhaltigeren Ära für den Tourismus verstanden werden, global wie lokal. ➤
Das Ziel wird wieder wichtiger – und die Kommunikation
Vor der Pandemie boten die Unterwegsmärkte einen immensen Überfluss an Angeboten und Optionen. Die schier unendlichen Möglichkeiten liessen die Reisenden oft im Nirwana der Unentschlossenheit zurück. Die Wahl des Reiseortes wurde vielfach spontan, kurzfristig und wenig voraussehbar entschieden. Die kollektive Erfahrung der Coronakrise wird künftig für eine neue, bewusstere Selektierung sorgen – allein schon, weil Reiseoptionen in der Post-Corona-Welt zunächst noch reduziert sein werden.
Vertrauen, Garantien und Sicherheit
Für die Tourismusbranche besteht hier die Chance und zugleich die Herausforderung, das Vertrauensverhältnis zu den Reisenden wiederherzustellen. Denn in Zukunft wird die Auswahl von Reisezielen und Verkehrsmitteln zunehmend auch davon abhängen, welche Garantien und Sicherheiten Tourismusanbieter gewährleisten können. Einkasernierte Gäste in Hotels, Todesfälle auf Kreuzfahrtschiffen und im Ausland gestrandete Gäste haben nicht nur bei den direkt Betroffenen Spuren hinterlassen. Vor diesem Hintergrund wird zunächst der regionale Tourismus an

Anja Kirig (Jahrgang 1977) ist seit 2004 für das Zukunftsinstitut als Trendforscherin tätig, seit 2014 für die Redaktion in München. Im Fokus ihrer Vorträge stehen die neuen Lebensstile mit ihren jeweiligen Bedürfnisstrukturen. Illustrativ und lebensnah erklärt und belegt sie die Trends und Entwicklungen. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Tourismusund Freizeitkultur, Neo-Ökologie und Gender, sowie die Food- und Gastronomiemärkte.
Attraktivität gewinnen: Kurze Wege und Naherholung vermitteln ein Gefühl der Sicherheit – ebenso wie vertraute Kulturkreise emotionale Sicherheit versprechen. Doch auch überregionale Destinationen können profitieren, wenn sie hohe Standards garantieren können, etwa zuverlässige Bedingungen in puncto Gesundheitsversorgung und Transport.
Ein Gebot der Stunde lautet: Transparenz
Dass die Qualität der Interaktion mit den Reisenden künftig noch ausschlaggebender sein wird, wurde bereits während der Krise deutlich. Was nach der Krise zählt, ist die Kunst, persönlich, emotional, authentisch, vielleicht auch humorvoll zu kommunizieren. Statt auswechselbare Videoclips abzuspielen, wird es darum gehen, das Lebensgefühl eines Landes, eines Ortes oder einer Unterkunft greifbar zu vermitteln. Alle touristischen Akteure, von Gastgeberinnen bis zum CEO, müssen dafür kommunikative Kompetenzen trainieren.
Abkehr vom Massentourismus?
Die neue Reisekultur nach Corona wird insbesondere den Massentourismus verändern, in Teilen sogar vernichten. Nach einer kurzen Phase der Post-Shutdown-Euphorie, in der Spass und Erlebnis gefeiert werden, wird eine Ernüchterung eintreten. Ziele werden bewusster und achtsamer gewählt. Vor allem Anbieter, deren Zielgruppe massentouristische Märkte waren, werden wirtschaftliche Folgen zu spüren bekommen. Ehemalige Erfolgsmodelle, auf die sich beispielsweise die Kreuzschifffahrtsindustrie gestützt hatte, werden sich in verschlankter Version neu aufstellen müssen, um das beschädigte Image zu reparieren.
[01] Swiss-Flugzeuge am Terminal im Flughafen Zürich-Kloten.
[02] Kreuzfahrtschiff neben dem Markusplatz in Venedig. Die Behörden von Venedig haben soeben entschieden, dass solche Schiffe nicht mehr ins Zentrum von Venedig fahren dürfen.
[03] Touristen in einer Strasse in Barcelona.
Haben 08/15-Pauschalferien eine Zukunft?
Natürlich wird es auch in Zukunft Menschen geben, die sich für das Konzept des 08/15-Pauschalurlaubs entscheiden, weil sie darin eine altbewährte Form von Sicherheit und Komfort finden. Doch sie werden weniger, denn um Resonanz- und Transformationserfahrungen zu machen, werden künftig andere Orte auf andere Weise aufgesucht werden: Destinationen, die neue Erfahrungen, menschliche Begegnungen und positive Emotionen versprechen. Das kann der Massentourismus nicht leisten. Weil sich die Bedürfnisse und Erwartungen der Reisenden während der Krise veränderten, wird ihnen der Massentourismus zunehmend als leere Hülse erscheinen. Statt schnellem und schnell vergessenem Kick, dekadentem und kurz betäubendem Luxus oder stumpfen Wiederholungen von Strand und Büffet werden nun andere Qualitäten gesucht, die nachhaltige Eindrücke hinterlassen.


Die Thesen zum Resonanz- und Transformationstourismus, die das Zukunftsinstitut in seiner Ende 2019 erschienenen Trendstudie «Resonanz-Tourismus» aufstellte, werden nach der Krise zu einer breitenwirksamen Realität, die die touristischen Märkte verändert. Das grundlegende Prinzip der Resonanz, der Wunsch nach nachhaltigen Beziehungserfahrungen, wird durch die Erfahrungen, die jede und jeder Einzelne im Kontext der Krise machte, enormen Aufschwung und Kraft erhalten. Der Post-Corona-Tourismus wird ein Beziehungs- und Entwicklungstourismus sein.
Die Grundsteine dafür konnten schon während der Krise gelegt werden. Die Art und Weise, wie Tourismusanbieter mit den Reisenden in der Krisenzeit interagierten, wird auch für spätere Resonanzerfah-
rungen ausschlaggebend sein. Dafür benötigt der Tourismus konkrete Inhalte, die Reisenden langfristig erkennbare und spürbare Mehrwerte vermitteln.
Lokale und globale Perspektiven verschmelzen
Eine besonders wichtige Rolle für die Erwartungen der Reisenden spielen dabei neo-ökologische Konzepte, ein holistisches Gesundheitsverständnis und die Idee der Glokalisierung als Verschmelzung lokaler und globaler Perspektiven. In Erinnerung bleiben werden vor allem jene Akteurinnen und Akteure, die bereits während der Krise nachhaltig, solidarisch und sozial agierten: Unternehmen, die Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte und Geschäftspartner fair behandelten oder sich für globale Themen einsetzten, die während der Pandemie in Vergessenheit gerieten. Die Resonanzmanager der Zukunft sind deshalb nicht selten Social Entrepreneure oder B-Corps – Benefit Corporations, die privatwirtschaftliche Interessen und gemeinwohlorientierten Nutzen verbinden.
Die grossen Tourismus-Treiber: Vertrauen und Beziehung
Reisen ist und bleibt ein elementares menschliches Bedürfnis, daran wird auch die Coronakrise nichts ändern. Doch das Virus markiert eine «Stunde null» für die Tourismusbranche. Dieses vorübergehende Vakuum kann nicht gefüllt werden mit einem Konzept, das bereits vor der Krise am Bröckeln war. In der Unterwegskultur nach Corona werden andere Spielregeln gelten. Regeln, die nicht nur stärker von lokalen, globalen und sozialen Faktoren abhängig sind, sondern zunehmend von den Reisenden selbst gestaltet werden. Leitend wird dabei das Grundbedürfnis nach Beziehung sein.
Anders als nach Kriegen oder Naturkatastrophen wird die Tourismusbranche nach der Aufhebung der Restriktionen schnell wieder zu operieren beginnen. Doch die künftigen Herausforderungen umfassen mehr als nur eine ökonomische Re-Stabilisierung: In der Zeit nach der Krise geht es darum, Reisenden Angebote zu unterbreiten, die ihnen sowohl Sicherheit als auch –und vor allem – Resonanz- und Transformationserlebnisse ermöglichen, orientiert an neo-ökologischen und gemeinschaftlichen Werten.
Der hier publizierte Artikel ist ein Auszug aus der Trendstudie «Die Welt nach Corona. Business, Märkte, Lebenswelten – was sich ändern wird». Die Studie dient als Leitfaden für die Post-Corona-Realität, auf die Unternehmen hinarbeiten können.
Top-Koch Caminada hat in Fürstenau erstmals ein vegetarisches Restaurant eröffnet
Nicht nur Daniel Humm in New York setzt jetzt auf vegane und vegetarische Küche, auch sein Kollege Andreas Caminada (44) bietet nun in seinem Restaurant «Oz» in Fürstenau nur vegetarische Gerichte. Warum tut er das?

Ein Schloss, ein Gasthaus, eine Bäckerei, ein Garten: Im bündnerischen Fürstenau verwirklicht Andreas Caminada seine Idee von hervorragender Küche und gelebter Gastlichkeit. Zur mit 3 Michelin-Sternen und 19 GaultMillau-Punkten prämierten Gourmetadresse «Schloss Schauenstein» und dem Bündner Gasthaus «Casa Caminada» gesellt sich nun ein neuer Genussort. Im «Oz» gibt der schlosseigene Garten künftig den Takt vor, denn auf der stetig wechselnden Karte stehen ausschliesslich vegetarische Gerichte. «Wir kochen ohne Fisch und Fleisch, aber mit demselben Herzblut und Anspruch wie in unserer Schlossküche. Das Menü ist hundertprozentig vegetarisch, aber auch hundertprozentig Caminada», begründet der Spitzenkoch seine Intention für das neue Restaurant.
Typisch Caminada ist auch der Name: «Oz» bedeutet «heute» in seiner Muttersprache Rätoromanisch. «Auf den Tisch kommt, was wir tagsüber in unserem Garten und Gewächshaus ernten», erklärt der gebürtige Bündner. Das richtige Zuhause für sein Gemüserestaurant hatte er schon länger im Kopf. «Die historische Remise gegenüber vom Schloss haben wir bereits einige Jahre als Separee für kleine Gesellschaften genutzt und hier auch unser Schlossmenü serviert. Das war schön für Gäste, aber für mich fühlte es sich irgendwie nicht richtig an», so der Gastgeber. «Für das perfekte Erlebnis im Schloss Schauenstein greifen so viele Details ineinander, das lässt sich nicht einfach an einem anderen Ort abspielen.» Im Frühjahr wurde die ehemalige Kutscherwerkstatt deshalb umgebaut, um neuer Schauplatz für vegetarisches Fine Dining in Fürstenaus kulinarischem Mikrokosmos zu werden.

Caminada setzt auf bewährtes Team
Der Raum selbst ist wie ein edles Wohnzimmer mit offener Küche konzipiert. Zentrales Element ist der massive Tresen aus Bergahorn, um den zehn ausladende Armlehnstühle aus hellem Leder zum Verweilen gruppiert wurden. Jeder Platz erlaubt dem Gast einen uneingeschränkten Blick auf das Geschehen am Küchenblock – und die Handgriffe von Küchenchef Timo Fritsche. Für einen besonders persönlichen





Service betraute Caminada mit Giuseppe Lo Vasco einen geübten Restaurantleiter und Sommelier: Der 29-Jährige mit Wurzeln in Sizilien und Apulien gehört seit Jahren zum Team und hat sein Gespür für Gäste zuvor im «Schloss Schauenstein» sowie im St. Moritzer «IGNIV»-Ableger seines Chefs unter Beweis gestellt.
Caminadas Statthalter am Herd ist ebenfalls kein Neuling in seiner Brigade. «Timo war lange bei mir im Schloss, zuletzt als mein Stellvertreter. ➤












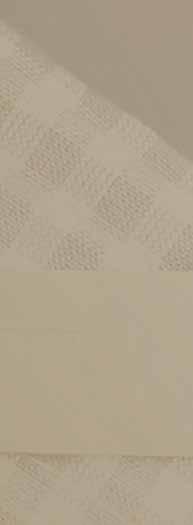































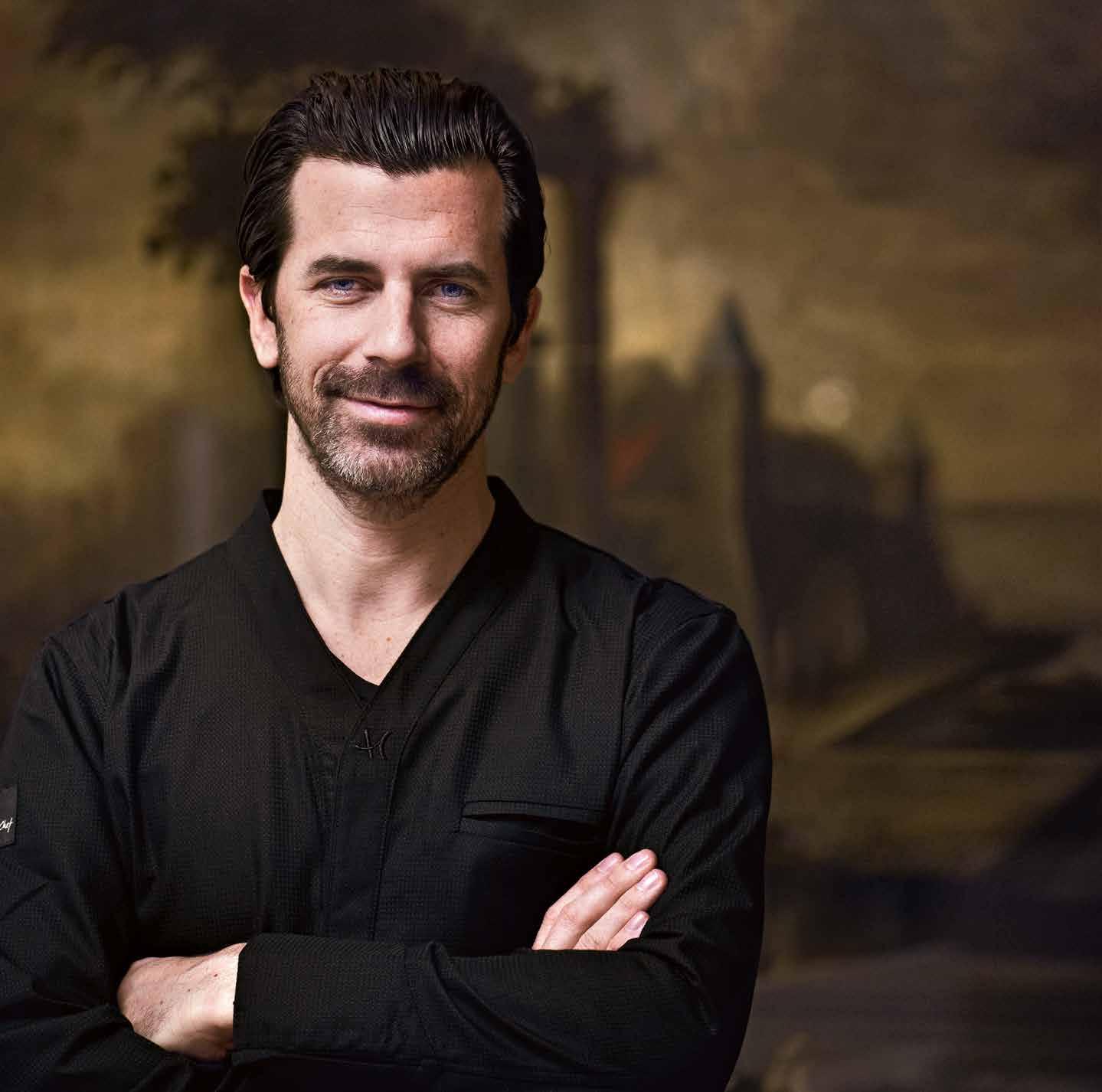
[01] Gegrillte Erbse und Brunnenkresse.
[02] Rhabarber-Kopfsalat mit Joghurt.
[03] Küchenchef im neuen «Oz»: Timo Fritsche.
[04] Andreas Caminada, mit 3 Sternen und 19 Punkten einer der besten Köche der Schweiz.
Mit seinen unterschiedlichen kulinarischen Konzepten hat Andreas Caminada Stück um Stück das Leben in die offiziell kleinste Stadt der Welt zurückgeholt. Vis-à-vis vom «Schloss Schauenstein», das sich seit 2003 vom einstigen Geheimtipp in den Bündner Bergen zur Pilgerstätte für Feinschmecker weltweit entwickelt hat und direkt neben dem 2018 eröffneten Bündner Gasthaus «Casa Caminada» mit seiner ursprünglichen Beiz und Holzofenbäckerei, hat nun das «Oz» seinen Platz bekommen. Für Caminada ist jede Lokalität ein Puzzleteil des gewünschten Gesamterlebnisses: «Wir lieben Fürstenau. Es ist unser Lebensmittelpunkt und wir wollen das Potenzial des Städtchens zeigen, ohne dass es an Charme oder Identität verliert. Der historische Ort war während vieler Jahre tot, auch die Einheimischen kamen nicht hierher, weil es einfach nichts gab. Heute kommen wieder Gäste – nicht nur von weither, sondern auch unsere Nachbarn und solche aus der Region. Das freut uns und ihnen wollen wir eine schöne Vielfalt bieten.»
Er kennt meinen Perfektionismus ziemlich gut, so dass ich ihm beim täglichen Kochen viel freie Hand lassen kann», so der 44-Jährige. «Die neun bis zwölf Gänge des vegetarischen Menüs werden sich je nach Reife und Verfügbarkeit der Zutaten oft ändern und Timo soll sich beim Gang durch die Beete inspirieren lassen. Im Oz deckt unser Garten den Tisch.»
Köche im Gartendienst
Der besagte Garten ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gewachsen. «Für das Schloss und unser Casa Caminada bauen wir schon viel länger einzelne Ge-
müse und Kräuter an, aber beziehen auch viele schöne Zutaten von unseren Biobauern aus der Region, weil unser täglicher Bedarf für 50 Gäste plus Gasthausküche hoch ist.»
Für das Oz kam diese Strategie allerdings nicht infrage: «Was wir machen, soll authentisch und nachhaltig sein. Für ein eigenes vegetarisches Restaurant einfach das Gemüse einzukaufen – das wäre nicht mein Ding.» Deshalb mussten die sorgsam bestückten Gemüse- und Kräuterbeete, Permakultur-Gewächshäuser und Obstwiesen zunächst einmal eine gewisse Grösse und Vielfalt entwickeln. «Und wir mussten lernen, richtig zu gärtnern. Was wächst wie am besten
und wann können wir wieviel ernten? Welche Fruchtfolge tut dem Boden gut? Jeder meiner Köche hat einmal die Woche Gartendienst», erklärt der Spitzenkoch. Damit das Angepflanzte gedeiht, nutzt Caminada auch sein Netzwerk: Rat und Erfahrung kommen von langjährigen Partnern wie Gemüseexperte Marcel Foffa oder dem Biohof Dusch sowie von Gärtner und Naturheilpraktiker Thomas Mann.
Der Garten: Inspirationsquelle und Labor
«Es ist kein Garten wie jeder andere», verspricht Caminada. «Für uns ist es gleichzeitig Inspirationsquelle und Labor. Wir wollen eine hohe Sortenvielfalt pflegen, bei Gurken etwa viele unterschiedliche Sorten anpflanzen. Zudem lassen wir bewusst auch Pflanzen wuchern, weil so manchmal Spannendes entsteht, das man sonst selten bekommt: Knospen, Blüten, Wurzeln.» Heute wachsen rund um das Schloss Schauenstein über 700 unterschiedliche Gemüse, Kräuter und Obstsorten.
Kartoffeln, Paprika, Erbsen, grüne Erdbeeren …
Besonders engagiert bei der Ernte ist Oz-Küchenchef Timo Fritsche. Andreas Caminada weiss um die Qualitäten seines Küchenchefs: Der 37-jährige Norddeutsche kennt nicht nur den Garten genau, sondern beherrscht auch jene nützlichen Techniken, um das faszinierende Potenzial der vegetarischen Küche auszuschöpfen. Frisch und roh, gekocht oder gegrillt, getrocknet oder gedörrt, eingelegt und fermentiert: Für sein erstes Menü verarbeitet Fritsche aktuell Karotten, Auberginen, Staudensellerie, Zwiebeln, Kohl-
rabi, Kartoffeln, Paprika, Erbsen, grüne Erdbeeren, Pfirsich, Safran, Rhabarber, Kopfsalat, Fichtennadeln sowie eigenen Blütenhonig von den Bienenvölkern auf dem Schlossgelände.
Nur zehn Plätze, dafür alles aus dem eigenen Garten
«Das Oz hat nur zehn Plätze. Dafür können wir jetzt fast alles selbst anbauen und müssen nur wenig von ausserhalb beziehen. Einige Gemüse aber auch Milchprodukte etwa, auf die ich aufgrund ihrer tiefen Verwurzelung in unserer Bündner Esskultur nicht verzichten mag, kommen wie im Schloss von Martin und Maria Bienerth aus der Sennerei Andeer.»
«Was wir machen, soll authentisch und nachhaltig sein. Für ein eigenes vegetarisches Restaurant einfach das Gemüse einzukaufen – nein, das wäre nicht mein Ding»
CAMINADA
Anzeige































Zeitversetzte Produktion und neue Küche im Hotel Alpenland, Lauenen bei Gstaad
Michael Ming, Sie sind Gastgeber im Hotel Alpenland in Lauenen bei Gstaad und besitzen jetzt eine neue, moderne Hugentobler-Küche. Was sind die Besonderheiten dieser Küche bzw. was sind die Vorteile der zeitversetzten Produktion? Es sind aus meiner Optik vor allem zwei Dinge:
a. Wir haben einen Weg gefunden zwischen viel Selbstgemachtem (beispielsweise mit Kirschen oder Äpfeln direkt vom Bauer, mit Kartoffeln aus der Region) und der Zubereitung unter bestmöglichen Qualitätsstandards.
b. Unsere Frequenz schwankt enorm aufgrund der Wetterabhängigkeit des Terrassen-Geschäfts mittags und einem Abend-à-la carte-Geschäft mit frischer, regionaler Küche mit internationalen Noten. Da kommt uns die zeitversetzte
Produktion auf der Grundlage der neuen Küchentechnologie enorm entgegen.
Warum drängte sich im Hotel
Alpenland eine komplett neue Küche auf?
Sämtliche Geräte und Einrichtungen waren veraltet. Die alte Küche stammte aus dem Jahr 1990. Die gesamte Infrastruktur war nicht mehr auf die aktuellen Bedürfnisse abgestimmt.
Ist die neue Küche vor allem für das Mittagsgeschäft von Bedeutung, weil hier hohe Gästefrequenzen herrschen?
Ja, wir arbeiten vor allem am Mittag mit dem hausgemachten «Inhouse Convenience», um die Nachfrage abfangen zu können. Die zeitversetzte Produktion findet morgens und nachmittags statt oder an

schwach frequentierten Tagen. Abends hingegen setzen wir auf eine frische, regionale À-la-carte-Küche mit einer internationalen Note.
Was sind denn aus Ihrer Optik die entscheidenden Vorteile der Hugentobler-Methode (Schockgefrieren, zeitversetzte Produktion)?
Es sind mehrere Aspekte: Die Produkte bleiben frisch und behalten ihre Aromen. Wir erreichen in der Küche eine hohe Konstanz, was Qualität und Produktion betrifft. Die Küche kommt nicht mehr ans Limit, wenn draussen Hochbetrieb herrscht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hauseigene Convenience anzubieten. Zudem sind wir in der Lage, unsere Köche optimal und nach Bedarf einzusetzen.

Das heisst: Sie sparen dank der neuen Küche und der zeit versetzten Produktion Kosten?
Ja, weil wir an Spitzentagen keine Aushilfen mehr brauchen. Total sparen wir allein im Personalbereich etwa 20 Prozent.
Apropos Personal: Wie finden Ihre Mitarbeitenden die zeitversetzte Produktion und ganz allgemein die neue Küche?
Genial! Sie haben weniger Stress und eine bessere Arbeitsauslastung unter dem Tag mit mehr Struktur.
Sparen Sie dank der neuen Küche und der zeitversetzten Produktion auch Energie?
Ja, klar! Die neuen Hugentobler-Geräte benötigen 25 bis 30 Prozent weniger Energie.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem Hugentobler-Team erlebt? Es war eine intensive, sehr gute, angenehme und effiziente Zusammenarbeit. Die Küche wurde, auch mit lokalen Partnern, fristgerecht umgebaut. Wir haben vom Fachwissen des Hugentobler-Teams stark profitiert.
Wie würden Sie die Positionierung Ihres Hotel Alpenland in wenigen Worten umschreiben? Was sind die Besonderheiten?
Unser charmantes Chalet-Hotel liegt unweit des Kurortes Gstaad und vereint echte Schweizer Tradition mit kulinarischen Höhenflügen unter einem gemütlichen Dach. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturparadies Rohr begrüssen wir mit 20 Hotelzimmern und zwei Appartements Gäste aus aller Welt. Für kulinari-
sche Highlights sorgt unser Restaurant. Hier stehen Schweizer Traditionsgerichte, raffiniert interpretiert mit Produkten aus der Region, auf der Speisekarte. Durch die naturnahe Lage und unweit des bekannten und besungenen Lauenensees begrüssen wir ganzjährig sowohl Sportinteressierte wie auch Geniesser und Familien. ➤
[01] Alpenland-Gastgeber Michael Ming mit Küchenchef Silvio Wieland. «Unsere Köche haben jetzt weniger Stress und eine bessere Arbeitsauslastung unter dem Tag».
[02] Die neue Hugentobler- Küche im Hotel Alpenland in Lauenen bei Gstaad. «Wir erreichen in der neuen Küche eine hohe Konstanz, was Qualität und Produktion betrifft» (Michael Ming).
Was sagen die Hugentobler-Experten zur neuen Küche im Hotel Alpenland?
Die Hugentobler-Küchenprofis Beat Reist (Beratung Apparate und Kochsystemtechnik) und Matthias Kyburz (Leitung Konzept und Objekt planung) über die neue Küche im Hotel Alpenland in Lauenen bei Gstaad.
Sie haben im Hotel Alpenland in Lauenen bei Gstaad die neue Küche eingerichtet. Was sind die Highlights dieser Küche?
Matthias Kyburz: Die Effizienz ist sowohl in der Fertigung als auch in der Produktion gewährleistet. Die Küche gibt den Köchen die Möglichkeit, mit einer zeitunabhängigen Produktion zu arbeiten.
Welche Küchengeräte kommen heute im Hotel Alpenland zum Einsatz?
Beat Reist: Zwei Kombisteamer Vision Plus für zwei Klimas, ein Frigo-Jet-Schockfroster, neuste Induktionstechnik im Herd, ein Elro-Kipper, die Hugifrit – das sind in etwa die wichtigsten Geräte, die täglich im Einsatz sind.
Wie war denn die Ausgangslage im Hotel Alpenland? Mit welchen Rahmenbedingungen wurden Sie am Anfang der Projektphase konfrontiert?
Matthias Kyburz: Die alte Küche funktionierte nur mit mindestens fünf Köchen und war ein Stromkiller. Hier wollte Michael Ming flexibler und energieeffizienter werden. In der neuen Küche kann die Anzahl der Köche flexibel angepasst werden – ohne längere Laufwege in Kauf nehmen zu müssen.
Wie nachhaltig ist die Küche im Hotel Alpenland?
Beat Reist: Hier wurde modernste Küchentechnik verbaut, was sich bereits ab dem ersten Tag in den Stromkosten niederschlug. Das hat in erster Linie mit dem Induktionsherd und den Kombisteamern zu tun. Die beiden Kombisteamer sparen nebst Energie auch Wasser und Reinigungschemikalien. Und mit der Hugifrit spart das Hotel Alpenland eine Menge Öl.
Wurde die neue Küche primär im Hinblick auf das Hochfrequenzgeschäft am Mittag konzipiert?
Matthias Kyburz: Genau hier liegt der Vorteil der neuen Küche: Sie ist für Hochfrequenztage wie auch für weniger hoch frequentierte Tage konzipiert. Die Anordnung der Geräte und die Kühlmöglichkeiten sind so gesetzt, dass sie entsprechend flexibel eingesetzt werden können.
Wie lange dauerte das gesamte Projekt im Hotel Alpenland – von der Idee bis zur fertigen Küche?
Matthias Kyburz: Etwa sechs Monate –das war sehr sportlich!
Hatten Sie besondere Herausforderungen zu bewältigen?
Matthias Kyburz: Zum einen war das Zeitfenster für den Küchenumbau sehr

Beat Reist (Beratung Kochsystemtechnik und Apparate).

Matthias Kyburz (Leitung Konzept und Objektplanung).
eng. Zum andern mussten wir Mittagsservice (Hochfrequenz) und Abendservice (hochstehende Kreativküche) unter einen Hut bringen, ohne die bestehende kalte Küche, die Abwäscherei und die Lüftung anzutasten.
Die Mitarbeitenden im Hotel Alpenland wurden speziell geschult und mit der zeitversetzten Produktion vertraut gemacht. Wie lief diese Schulung vor Ort ab?
Beat Reist: Ein Coach der «Gastro-Perspektiv» war zwei Tage in Lauenen und schulte die neuen Prozesse mit der Küchencrew ein. Nach einem ersten AnalyseTag waren die Ziele, die Karte und die Massnahmen gemeinsam definiert worden. Jetzt galt es, die Crew mit den neuen Kochtechniken vertraut zu machen, erste Vor-Produktionen zu kochen und gemeinsam zu staunen, wie leicht der Service vor sich geht.
Fazit: Wie würden Sie die neue Küche inkl. Küchensystem (Produktion) im Hotel Alpenland zusammenfassend umschreiben?
Beat Reist: Im Vordergrund stehen sicher die neuen Möglichkeiten, die sich den kreativen Köchen bieten. Mit den neuen Optionen sind diese glücklicher in ihrem Arbeitsalltag. Eine tiefere Fluktuation schlägt sich in den Kosten nieder.
Matthias Kyburz: Auch sind die Stromkosten massiv gesunken, weil die Geräte effizienter sind und nicht mehr den ganzen Tag laufen.
Entschleunigen – entspannen – zur Ruhe kommen
Reisen sind nun wirklich kein Leichtes mehr zu Zeiten von Corona. Doch weit muss Frau oder Mann glücklicherweise nicht fahren, um echte Regeneration und ein Timeout vom Alltag zu erfahren.
Im 4* Superior Deltapark Vitalresort am Thunersee tickt die Zeit etwas gemächlicher; «bernerischer» halt. Das Selfness Hotel – zwischen Thun und Spiez gelegen –macht bei der Ankunft zudem angenehm unkompliziert auf «understatement»: Ein unscheinbarer Abzweiger von der Hauptstrasse im Gwatt führt an einem Boottrockenplatz vorbei direkt auf das 70 000 m2 grosse Gelände am Thunersee. Hier öffnen sich Raum und Natur und damit auch die Sinne und das Erleben des ankommenden Gastes. Ein unerwartet grosszügiges Hotelhauptgebäude, eingebettet zwischen zwei Naturschutzgebieten und direkt am See. Wie auf der Webseite des Hotels beschrieben: Ankommen, ausatmen und abschalten.
Gleich angrenzend ans Hotel findet sich eine ganz spezielle Häusergruppe: 7 Seevillen im Yachtstil, direkt an eine private Lagune gebaut und mit eigener Auto- und Bootsgarage. Eine «Gated Community», die seinesgleichen in der Schweiz sucht. Ideal für Alltagsmüde; bei maximaler «privacy» stehen den Gästen trotzdem alle Hoteldienstleistungen zur Verfügung, inklusive Zugang zum über 2000 m2 grossen Wellness- und Fitnessbereich und vier Restaurants mit insgesamt 29 GaultMillauPunkten.
Die Seevillen des «Deltaprivé»-Quartiers verfügen alle über einheitliche Ausbaustandards: drei Schlafzimmer, möbliert mit ergonomischen Flowsleep-Betten von Leibundgut, mit eigenem Bad, grosse

Wohn küche, offenes Wohnzimmer mit Rundumsicht. Während der milderen Jahreszeit laden die grosszügigen Balkone – eigentlich mehr Schiffsdecks als reine Balkone – zum draussen Verweilen ein. Kann Nichtstun verlockender sein? Im Deltapark wird das persönliche Geniessen und Herunterfahren so angenehm und professionell verpackt, dass niemand ein schlechtes Gewissen haben muss. Und wer trotzdem nicht tatenlos sein kann, nimmt teil an attraktiven Gruppenkursen oder einem allumfassenden Personal Training (inklusive Bodyscan-Analyse). Problematisch in Zeiten von Contact Tracing und Maskenpflicht? Überhaupt nicht. Das Sicherheitskonzept des Deltapark findet den Spagat zwischen maximaler Sicherheit und höchster Bewegungsfreiheit. Einfach erholsam – trotz, oder gerade wegen, Corona.
deltaparkseevillen.ch



«Hotelier»-Weinexpertin Chandra Kurt über die Weissweinsorte Amigne von Vétroz
Manche Traubensorten sind praktisch ausgestorben – wie etwa die Weissweinsorte Amigne. Im Wallis werden davon noch gerade mal knapp 50 Hektaren kultiviert – vor allem in der Gemeinde Vétroz. Was ist das Besondere der Amigne?
TEXT Chandra Kurt
Der Amigne ist eine sehr seltene autochthone Traubensorte, die einzig im Wallis angebaut wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sie römischen Ursprung, zumal sie vom römischen Schriftsteller Columella in seinem Werk «De re rustica» unter dem Namen Vitis Aminea erwähnt wird. Im Jahr 1686 wird sie bereits unter ihrem aktuellen Namen im Walliser Werk «Livre pour le travail des vignes» von Riedmatten erwähnt. Darin ist zu lesen, dass am 18. September 1686 ein halber Lesewagen Amigne von Reben zwischen Granges und Noës geerntet worden ist.
Die Amigne-Traube gehört in die Kategorie der aromatischen Traubensorten. Aus ihr gekelterte Weissweine können mehr oder weniger lieblich sein, je nach Jahrgang und Auswahl des Kellermeisters. Trocken ausgebaute Weine ergeben eine feine, aber relativ diskrete Aromatik. Als leichter Süssoder Likörwein entwickelt die Amigne sehr eigenständige Aromen, die an Mandarinenschalen, Zitrusfrüchte, Trockenfrüchte und Honig denken lassen. ➤
Jüngste DNA-Analysen des Walliser RebForschers José Vouillamoz haben gezeigt, dass die Amigne mit keiner bekannten Sorte verwandt und somit einzigartig ist. Um sich mit der Amigne-Traube vertraut zu machen, lohnt sich ein Besuch in Vétroz und bei den dortigen Winzern, da diese Region inzwischen die Amigne-Hochburg ist. Rund 50 Hektaren sind mit ihr bepflanzt. Am besten plant man auch eine Wanderung durch den knapp drei Kilometer langen Amigne-Lehrpfad. Die Weinberge von Vétroz erstrecken sich über die unteren Hänge des rechten Rhône-Ufers und den Kegel aus Flussablagerungen der Lizerne zwischen Sion und Martigny im Zentralwallis. Dieser terrassierte Weinberg besteht aus Gletschermoränen und schwarzem Schiefergestein.
«Hotelier»-Insider-Tipp
Korkfehler gehören zum Weinalltag und sie kommen nur in Weinen vor, die mit einem Naturkorken verschlossen sind. Erkennen kann man den Fehler erst, wenn der erste Schluck durch den Gaumen fliesst. Denn im Gegensatz zu anderen Getränken, können Weine auch Fehler haben. Aromatisch erkennt man das, wenn es im Gaumen plötzlich nach Korken schmeckt. Die einen riechen den Korken bereits mit der Nase, andere erkennen den Fehler erst im Gaumen –auch kann er unterschiedlich intensiv daherkommen. Hat ein Wein diesen Fehler, ist seine Frucht überdeckt und er schmeckt eher müffelig und unsauber.
Doch was ist Korken überhaupt? Naturkorken braucht man seit je her, um Weinflaschen zu verschliessen. Sie sind von feinen Poren durchdrungen. In ihnen können sich Pilze festsetzten, die den Korkgeschmack hervorrufen können. Bis heute wurde noch kein Mittel gefunden, um ausschliesslich fehlerfreie Korken zu produzieren. Ausser, dass Weine mit anderen, synthetischen Verschlüssen verschlossen werden – was aber andere Probleme mit sich bringen kann.
Ist man unsicher, ob der Wein Korken hat oder nicht, lohnt es sich, den Wein zu dekantieren. Die kräftige Luftzufuhr wird den Wein entweder «reinigen» oder den Korkgeschmack ganz unbarmherzig zum Vorschein treten lassen. Es gibt auch «schleichende Korkfehler». Sie sind nicht einfach zu erkennen. Auch für Kenner nicht. Im Zweifelsfalle eine neue Flasche öffnen und vergleichen. Sobald man einen reinen und einen fehlerhaften Wein nebeneinander degustiert, wird man schnell lernen, was ein Korkgeschmack ist. Ein Korken schmeckt in jedem Wein schlecht, bei einem teuren ist es einfach ärgerlicher.
Bisher im «Hotelier» erschienen:
• Dekantieren oder nicht? (Ausgabe 03)
• Naturweine auf die Weinkarte? (Ausgabe 04/05)


Diese eher gehaltvollen Weine sind lange lagerbar, da sie einen hohen Zuckergehalt und einen relativ hohen Säuregrad haben. Generell ist es spannend zu beobachten, wie sich die Aromen der Amigne-Weine im Alter entwickeln. Grosse Jahrgänge haben das Potenzial für mehrere Jahrzehnte.
Bienen als Erkennungsmerkmal
Da ein Amigne-Wein, wie gesagt, aromatisch eine grosse Bandbreite abdeckt, hat dies beim Weinkonsumenten lange für Verwirrung gesorgt. Schmeckt der gekaufte Wein nun spartanisch knochentrocken oder bunt wie ein Regenbogen? Als Anhaltspunkt wurde ab dem Jahr 2005 ein Erkennungsmerkmal auf dem Etikett der Amigne-Weine eingeführt: die Bienen. Sie sind ein Indiz für den Zuckergehalt der Weine. Eine Biene entspricht einem trockenen Wein mit 0 bis 8 Gramm Restzucker; zwei Bienen ist ein mittelsüsser Wein mit 9 bis 25 Gramm Restzucker und drei Bienen entspricht einem Süsswein mit über 25 Gramm Restzucker.
Dank Pilz grossartige Süssweine
Nur wenige bevorzugte Mikro-Terroirs in Europa vereinen die nötigen klimatischen Bedingungen, die es braucht, um süsse und edelsüsse Weine zu produzieren. Das Wallis ist eines davon. Im Spätherbst bildet ein
Pilz – der «Botrytis cinerea»– im Innern der Beere eine Edelfäule. Während der Zucker konzentriert wird, verzehrt der Pilz praktisch die gesamte Weinsäure der Traube, was zur Folge hat, dass aus diesen edelfaulen Trauben grossartige Süssweine mit üppigem Körper und einer aussergewöhnlichen Komplexität vinifiziert werden können. Die aus Amigne produzierten Süssweine gehören zu den Besten überhaupt – zum Beispiel der Mitis von JeanRené Germanier, der zu den besten Süssweinen der Schweiz zählt. Vinifiziert wird er vom talentierten Winzerpaar Delphine Riand-Dubuis und Richard Riand, die eine ganze Palette an Amigne-Weinen für die Kellerei produzieren – vom einfachen Apéro-Amigne über den komplexen Grand Cru bis zum süssen Elixier Mitis.
Was sagt Madeleine Gay zur Amigne-Traube?
Auch für Madeleine Gay, die Grande Dame des Schweizer Weins, ist die Kellerei von Germanier zentral für den Erfolg der Amigne-Traube. So meint sie: «Beim Namen Amigne muss ich an Jean-René Germanier denken. Wir haben uns 1981 im Technikum in Changins kennengelernt. Jean-René sprach damals schon wie vom achten Weltwunder, wenn er von dieser aus seinem Heimatdorf Vétroz stammenden Rebsorte erzählte. Ich war damals noch unerfahren und hörte seinen Begrün-

dungen zu. Oftmals war ich seiner Meinung, wobei ich meine Zweifel hatte, zumal die Sorte aromatisch eher neutral ist und gerne ihre süsse Seite zeigt. Das stimmte mich kritisch. Ein Wein muss entweder trocken oder süss sein. Ich bin eine Anhängerin von trockenen Weissweinen, doch diese Traubensorte ist wie die Ausnahme der Regel. Ihre leichte Süssnote steht ihr gut und entwickelt sich prächtig mit dem Alter. Als Pflanze hinterlässt sie einen ganz anderen Eindruck: Sie produziert eine Unmenge an Trauben und noch mehr Blätter, aber bei der Ernte bleiben nur wenige Beeren zurück, denn auch wenn die Traube im ersten Moment gross wirkt, so sind die Beeren daran ganz klein und sehr, sehr süss. Spricht man von Amigne, spricht man von Sanftmut, Zartheit und Milde. Man spricht auch meist von einem Süsswein, obschon ein trocken ausgebauter Amigne eine ganz spezielle Grösse hat. Einer der Weine, die mich am meisten beeindruckt haben, war ein Amigne aus dem Jahr 1949 – der Wein war ölig, ohne schwer zu sein, und energetisch, ohne aggressiv zu sein.»
jrgermanier.ch
Prominente aus der Sommelierwelt: «VINUM»-Chefredaktor Thomas Vaterlaus
Thomas Vaterlaus (61) kam erst mit 35 Jahren zu seinem heutigen
Fachgebiet Wein. Zum ersten Mal spürte er den Zauber von Wein schon im Elternhaus in Ermatingen am Bodensee. Am Sonntagabend gab es zu Hause immer Wein aus Bordeaux, der besonders achtsam genossen wurde. Das brachte Thomas zur Überzeugung, dass es sich um ein wertvolles Getränk handeln muss. Dieser Funke ist wohl später auf ihn übergesprungen.
INTERVIEW UND TEXT: Bruno-Thomas Eltschinger und Nadja Öhrlein
BILDER: Andreas Hegner, SVS/ASSP
Seine journalistische Ausbildung absolvierte Thomas Vaterlaus am renommierten Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern. Nach Anstellungen bei grossen Tageszeitungen arbeitete er ab 1990 als Freelancer, spezialisiert auf Themen wie Lifestyle, Kultur und Kommunikation, für Titel wie Weltwoche, Annabelle, SonntagsZeitung und andere Medien. Seit 1995 ist er in verschiedenen Funktionen für «VINUM», seit 2012 wieder als Chefredaktor des Magazins für Weinkultur, tätig. Zudem ist er Mitinhaber der Agentur «mettler vaterlaus gmbh, Kommunikation für Wein & Kulinarik».
Er lässt immer dem Wein den Vortritt …
Thomas Vaterlaus stellt heute in der Weinszene und bei Weinfreunden geradezu den Nimbus eines Weingurus dar. Er ist ein Tausendsassa für Degustationen, von Südengland bis Zypern und von Russland bis
Portugal oder Übersee von Kalifornien bis Neuseeland und Australien. Was jedem auffällt, der mit ihm über Wein ins Fachsimpeln kommt, ist seine ausgesprochene Bescheidenheit – trotz hoher Weinkompetenz. Er kann sich zurücknehmen und lässt immer dem Wein den Vortritt. Diese Zurückhaltung im Verhalten zeichnet seinen Charakter aus. Er ist kein Selbstdarsteller und Besserwisser mit Starallüren wie manche Zeitgenossen, die sich ständig und vor allem ungefragt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit drängen.
Hohe Glaubwürdigkeit als Chef redaktor
Deshalb nehmen ihn die Teilnehmer seiner Weinseminare allgemein als ausgesprochen sympathisch, rücksichtsvoll und sehr umgänglich wahr. Da redet einer, der seinen Jüngern und Weingeniesserinnen auf gleicher Augenhöhe begegnet und sich mit ihnen über die gemeinsame Leidenschaft
Wein austauscht. Seine Weinreportagen sind immer selbst recherchiert und deshalb authentisch und informativ, was auch seine hohe Glaubwürdigkeit als Chefredaktor erklärt. Auf der anderen Seite kennt man Thomas Vaterlaus vor allem als Fachexperten, der seine private Seite gekonnt versteckt. Diese persönliche Zurückhaltung macht ihn manchmal, ob gewollt oder zufällig, auch unnahbar und geheimnisvoll. Trotzdem interessieren uns seine persönlichen Präferenzen und Leidenschaften. Dazu gehören neben Wein seine Hobbys Segeln, Musik hören und maritime Antiquitäten.
Burgunder, Rieslinge und Champagner
Privat gehört seine Liebe den weissen und roten Burgunderweinen sowie Riesling und Champagner. «Für mich kommen die mit Abstand spannendsten Weine aus dem Burgund – doch viele Geniesser dürften da anderer Meinung sein. Letztendlich bleibt es eine Geschmacksfrage», sagt er dazu. Sein Beruf als Weinjournalist bringt es aber mit sich, dass er natürlich alle Weine verkostet und sich oft an die Vorlieben des Publikums hält. Seine Zielsetzung ist dabei, die Geschmackspräferenzen seiner Leser abzubilden und auch Themen abzudecken, die am Markt berücksichtigt werden müssen.
«VINUM» gehört heute zu den einflussreichsten und renommiertesten traditionellen Weinmedien im deutschen Sprachraum und ist das grösste Weinmagazin Europas mit einer hohen Akzeptanz, sowohl beim grossen, am Wein interessierten Publikum als auch bei Produzenten, im Handel und in der gehobenen Gastronomie.

Welcher Wein hat ursprünglich Ihre Liebe zum Wein geweckt?
Ein Beaujolais aus Fleury, mit 22 Jahren war’s für mich der beste Wein der Welt.
Welchen Wein haben Sie immer vorrätig?
Champagner, denn ich trinke jeden Tag mindestens ein Glas davon …
Welche/r junge Winzer/in beeindruckt Sie und warum?
Beispielsweise Ilona Thétaz aus Saxon, weil sie den Mut hat, ihr ganz eigenes Ding durchzuziehen.
Welche Weinpersönlichkeit hat Sie am meisten beeindruckt?
Hugh Johnson, weil er seine Leser nie mit Ratings belehrt, sondern Wissen vermittelt, damit die Weinliebhaber selbst urteilen können.
Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach Sommeliers für die Arbeit der Winzer?
Sie sind sehr wichtig, denn die Sommeliers beurteilen Weine meist weniger aufgrund ihrer eigenen Vorlieben als beispielsweise
Journalisten, sie erkennen pragmatisch die Einsatzmöglichkeiten eines Weines.
Was erwarten Sie von einem guten Sommelier?
Dass er meine bevorzugte Weinstilistik erkennt, aber dann doch nicht das empfiehlt, was ich vermute.
Welches Erlebnis mit einem Sommelier vergessen Sie nie?
Das war im Bocuse-Restaurant L’Auberge du Pont de Collonges, der ganze Service war Weltklasse – im Gegensatz zum Essen. Wir hatten über vier Stunden hinweg immer Wein im Glas und waren doch kein bisschen angetrunken.
Was ist Ihre letzte Weinentdeckung? Generell Weissweine aus Spanien, zum Beispiel Pedra de Guix von Terroir Al Limit im Priorat, knackig, vielschichtig, genial.
Was war der schlimmste Wein, den Sie je getrunken haben und warum?
Vielleicht ein Amarone oder ein Zinfandel? Ich versuche Negatives schnell zu vergessen.
Das vollständige Interview ist nachzulesen unter: svs-sommeliers.ch
Sommelier-Get-2-Gether Bern: Montag, 16. August 2021, «Die PIWI-Pioniere aus dem Oberwallis», 18–20 Uhr
Studienweinreise für Sommeliers: Sonntag–Dienstag, 22.–24. August 2021, 3-Tages-Weinreise «Neuenburgersee» im Dreiseenland
Women&Wine Society: Donnerstag, 26. August 2021, «Weine von Frauenhand gemacht» bei Martell in Zürich
«Master-Class» Workshop Zürich: Montag, 6. September 2021, «Intensiv-Seminar», ConcoursKandidaten Deutschschweiz
«Vorausscheidung» Zürich: Montag, 27. September 2021, «Test» Concours Meilleur Sommelier Suisse Deutschschweiz
Gourmet-Lunch in Wigoltingen: Donnerstag, 30. September 2021, Restaurant «TAVERNE ZUM SCHÄFLI» bei Christian Kuchler
Generalversammlung 2021: Montag, 4. Oktober 2021, «GV 2021 in Zürich», Vorabendprogramm PIWI-Workshop
Europameisterschaft Sommeliers: 14.–19. November 2021 in Limassol, Zypern (Reiseprogramm folgt)
Gourmet-Lunch in Bad Ragaz: Mittwoch, 8. Dezember 2021, Restaurant «Memories» bei Sven Wassmer, Grand Resort Bad Ragaz
Trophée Swiss Wine

Melden Sie sich jetzt an, als Zuschauer zum Finale «Bester Sommelier ASSP der Schweiz 2021» für exzellente Professionalität, die Kultur, Geschmack und Leidenschaft vereint. Drei Finalisten werden auf der Bühne stehen und Ihnen am Sonntag, 10. Oktober 2021, im Grand Hotel Splendide Royal in Lugano in einem spannenden und fairen Wettkampf zeigen, was professionelle Sommellerie ausmacht und zu was Sommeliers fähig sind.
Der renommierte Wettbewerb zur Auszeichnung des «BESTEN SOMMELIERS DER SCHWEIZ 2021» ist ein mit Spannung erwarteter Anlass in der Welt der helvetischen Önologie und Sommellerie. Die 22. Ausgabe findet am 10. Oktober 2021 im Hotel Splendide Royal in Lugano statt. Dieser nationale Concours wird alle zwei Jahre in einer der drei Schweizer Sprachregionen durchgeführt. Rund 20 Kandidatinnen und Kandidaten aus der ganzen Schweiz kämpfen im Halbfinale am Samstag um den Finaleinzug, die durch eine nationale und internationale Jury bewertet werden. Am Sonntagnachmitttag findet der Final unter den drei Besten auf der grossen Bühne statt.
Anmeldung & Auskunft: sekretariat@svs-sommeliers.ch, svs-sommeliers.ch
«FRAUEN DER WEINWELT» … wir degustieren Weine von Frauenhand gemacht. Anforderungen: Du bist eine Frau, neugierig, flexibel und gesellig. Thema: ein typischer Frauenwein. Das haben wir sicher alle schon einmal gehört. Aber was ist damit gemeint? Gibt es Frauenweine?
Datum: Donnerstag, 26. August 2021. Ort: Martel am Bellevue, Rämistrasse 14, Zürich. Preis: 25 Franken pro Frau (Mitglied SVS) 35 Franken pro Frau (Nichtmitglied SVS). Anmeldung: bis 15. August 2021 – per E-Mail an Andrea Vogt: andrea.vogt@bluewin.ch, für Notfälle Tel. 079 740 24 36.
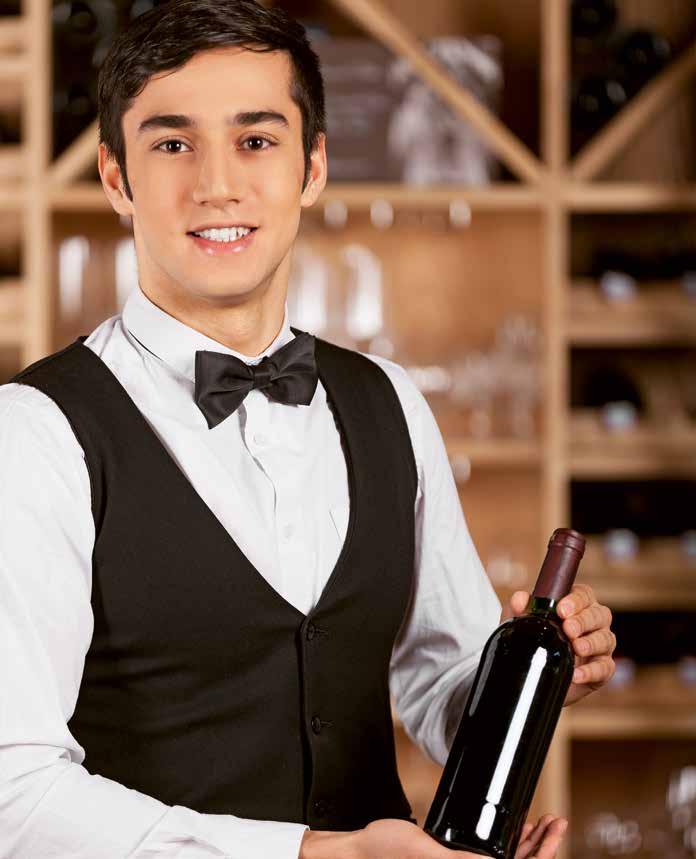
Gesucht: bester
Der «marmite youngster» ist der renommierteste Nachwuchswettbewerb der Schweizer Gastronomie und zeichnet seit über zehn Jahren die besten Nachwuchskräfte in den Kategorien Küche, Pâtisserie und Service aus (www. marmite-youngster.ch). In diesem Jahr erweitern die Projektverantwortlichen nun ihren Wett bewerb um die Kategorie Sommelier. Gesucht wird beim «marmite youngster» also neu auch das grösste Sommelier-Talent unseres Landes, das bereits am 30. November 2021 auf der grossen Bühne zum ersten «marmite youngster 2022» in der Kategorie Sommelier ausgerufen werden kann.
Über den untenstehenden QRCode gelangst Du automatisch auf die Website des marmite youngster und dort direkt zur Anmeldung zum neuen Wettbewerb. Dort kannst Du Dich auch direkt anmelden.
Fragen und weitere Infos: l.gruetter@marmite.ch oder 044 450 29 46


TEXT Evelyne Rast
Kaffee ist ein Frischprodukt. Punkt. Darum muss Kaffee auch immer frisch gemahlen und dann sofort zubereitet werden. Kein Vormahlen! Denn durch das Mahlen werden die Aromen der Kaffeebohnen freigesetzt. Das riecht zwar verführerisch – doch entfliehen diese Aromen damit auch dem Kaffeemehl. Sie verflüchtigen sich in der Luft, anstatt sich durch die Extraktion in der Tasse zu entfalten. Gemahlen bietet Kaffee eine erhöhte Angriffsfläche für Sauerstoff, Licht und Wärme. Das bedeutet: Der Mahlvorgang vor der Zubereitung muss möglichst kurz gehalten werden, die Mühle möglichst schnell mahlen. «Grind on Demand», also mahlen bei Bedarf, heisst die Losung.
Doch was macht eine gute Kaffeemühle aus? Zwei Faktoren sind qualitätsentscheidend: eine homogene Zerkleinerung und keine Hitzeentwicklung beim Mahlen. Wichtig ist, dass beim Mahlvorgang die Kaffeebohnen in der Mühle geschnitten und nicht gequetscht werden. Die Kaffeebohnen müssen gleichmässig zerkleinert werden. Je einheitlicher Kaffee gemahlen wird, umso gleichmässiger kann die Extraktion erfolgen. Und weil die Mahlscheiben sich abnützen, müssen diese regelmässig nachgeschliffen werden. Der Motor und das Mahlwerk dürfen nicht zu viel Wärme entwickeln. Denn werden Kaffeebohnen beim Mahlen zu stark erhitzt, beeinflusst das die Aromen im Kaffeepulver. Die Folge ist ein bitter bis verbrannt schmeckender Kaffee.
An der Mühle gilt es, den Mahlgrad und die Dosierung einzustellen. Mit dem Mahlgrad wird die Auslaufzeit definiert und mit der Dosierung die Pulvermenge. Bei einem Kaffeevollautomaten, bei dem die Mühle integriert ist, übernimmt Ihr Techniker diese Einstellungen. Und er wird die Einstellungen mindestens einmal
jährlich im Rahmen des Service überprüfen und justieren. Bereiten Sie den Kaffee auf einem Siebträger auf, steht die Kaffeemühle separat daneben. Und Sie können die Einstellungen des Mahlgrades und der Dosierung selber vornehmen.
Dabei spielen Ihre persönlichen Vorlieben genauso eine Rolle wie die Vorgaben durch die verschiedenen Grössen der Siebeinsätze. Ihre persönlichen Vorlieben entdecken Sie durch das Aus- und Durchprobieren. Beachten Sie, dass Sie die Körnigkeit des Mahlgrades jeweils anhand des Auslaufes von zwei Tassen definieren. Die Dosierung hingegen können Sie für eine und für zwei Tassen individuell festlegen.
Den gemahlenen Kaffee verteilen Sie dann gleichmässig im Siebeinsatz, was im Fachjargon «Levelling» heisst. Und drücken, also «tampen», diesen mit dem Tamper eben fest. Denn das Wasser sucht den Weg des geringsten Widerstandes («Channeling»). Ist das Kaffeepulver im Sieb nicht gleichmässig gelevelt und getampt, erfolgt die Extraktion nicht optimal.
Beim Kauf einer Kaffeemühle empfehle ich Ihnen, sich nicht nur an Marken oder gar am Preis zu orientieren, sondern an den eigenen Ansprüchen und an den Ansprüchen Ihrer Gäste. Lassen Sie sich vom Verkäufer Ihrer Kaffeemaschine beraten. Denn das Ziel muss es sein, Maschine und Mühle, und gemeinsam mit Ihrer Rösterei Kaffeesorte und Röstung, zusammen mit Ihren Ambitionen in Einklang zu bringen. Nur so holen Sie das Beste aus dem Kaffee heraus. Wichtig: Befüllen Sie dann den Bohnenbehälter immer nur mit höchstens einer Tagesmenge. Denn Sie wissen schon: Kaffee ist ein Frischprodukt. Punkt.
Evelyne Rast ist zusammen mit ihrer Schwester Beatrice Rast Inhaberin der Gourmetrösterei Rast Kaffee mit Sitz in Ebikon bei Luzern.
rast.ch

Die Schweizer SV Hotel Group vereint sämtliche Touchpoints in der App

«Damit sich die Mitarbeitenden des Stay KooooK voll und ganz den Gästen widmen können, sind die typischen Hotelprozesse und sämtliche Touchpoints vollständig digitalisiert.»
Was wäre, wenn man sich selbst per digitalem Schlüssel ins Hotel einchecken könnte? Wenn sich alle Buchungsdetails in einer Web-App zentral verwalten und jederzeit anpassen liessen?
Wenn Angebote tatsächlich auf die individuellen Präferenzen der Gäste massgeschneidert würden?
«Stay KooooK bringt unser Know-how und die Erfahrung, die wir jahrelang mit unterschiedlichen Marken und Konzepten gesammelt haben, auf den Punkt. Wir wollen, dass unsere Gäste ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Deshalb sorgen wir dafür, dass sie möglichst wenig Zeit mit der Bewältigung administrativer Prozesse verbringen müssen», erklärt Managing Director Beat Kuhn. «Wir lassen ihnen dabei volle Entscheidungsmacht. Unsere Gäste haben jederzeit volle Kontrolle darüber, wann sie auf ihrer Reise etwas tun und erleben möchten. Wir unterstützen sie dabei effizient, digital und persönlich.»
Die SV Group hat für Stay KooooK sämtliche Touchpoints digitalisiert und in einer praktischen App vereint. Die digitale Guest Journey ist die Online-Entsprechung des Lebensgefühls von Stay KooooK und ist damit wie massgeschneidert für die veränderten und sich weiter verändernden Bedürfnisse und Ansprüche von Reisenden.
Damit sich die Mitarbeitenden des Stay KooooK, die Hosts, voll und ganz der Begegnung mit den Gästen widmen können, sind die typischen Hotelprozesse und sämtliche Touchpoints vollständig digitalisiert. Der Gast wickelt Reservation, Check-in, Check-out und Rechnungsstellung in einer Web-App ab. Dieses durchgängige Online-Erlebnis ist einzigartig und nimmt vorweg, was sich künftig als Standard etablieren dürfte. Lieber per WhatsApp als per Mail benachrichtigt werden? Kein Problem, die Gäste entscheiden selbst, welchen Kommunikationskanal sie bevorzugen. Die Lösung ist immer nur einen Klick oder Wisch entfernt. Die eigens entwickelte Web-App liefert personalisierte Inhalte und macht es spielend leicht, den Aufenthalt nach eigenen Vorstellungen individuell zu gestalten.
Design-Thinking bestimmt die Lösung
Sämtliche Elemente der Digital Guest Journey sowie die Digital Guest Platform MAGIC sind in einem weitreichenden Design-Thinking-Prozess innerhalb der SV Group entstanden. Dabei wurden Buchungsprozesse und Abläufe Schritt für Schritt beleuchtet und geprüft, inwieweit sich diese digital vereinfachen und verbessern lassen, um das individuelle Gasterlebnis auf ein neues Level zu heben. Bei der Entwicklung waren verschiedene Startups- und Technologie-Entwickler wie beispielsweise apaleo, 3ap, EVUX oder 4SUITES beteiligt.
Wegweisende Personalisierung
Die eigens für Stay KooooK entwickelte Web-App macht es spielend leicht, den Aufenthalt nach eigenen Vorstellungen individuell zu gestalten und so die Guest Journey nicht nur zu durchlaufen, sondern aktiv mitzugestalten. Hier können Informationen über das Konzept des Hotels und die Hosts abgerufen, aus verschiedenen Studios und Zimmern gewählt oder der Check- in einfach erledigt werden. Via IoT basierten digitalen Schlüsseln lässt sich mit der Stay KooooK Web-App auch das Hotelzimmer schlüssellos öffnen.
Gäste können ausserdem einen eigenen Account anlegen, Inhalte bewerten oder Empfehlungen teilen und Angaben zu persönlichen Vorlieben machen, um Abläufe sowie die Ausstattung des Zimmers oder Studios so persönlich wie möglich zu gestalten. Sämtliche Daten können hier ausserdem für einen nächsten Aufenthalt gespeichert werden. Durch eine sogenannte Event-Driven-Architektur werden sämtliche «Events» (zum Beispiel eine Buchung oder eine Buchungsänderung) zentral in der eigens entwickelten Digital Guest Platform (MAGIC) gespeichert und

verwaltet. Die Plattform bietet eine unabhängige digitale Infrastruktur, die sämtliche operative und administrative Prozesse integriert. Services können somit auf Basis persönlicher Vorlieben angeboten und mittels smarter Technologie einfach zugänglich gemacht werden.
Gäste profitieren dabei auch von exklusiven Kooperationsangeboten und Tipps, wie z. B. Pop-Up- Geschäften, Event- oder Restaurantempfehlungen, die zu ihnen passen. Person Record Matching ermöglicht es, wiederkehrende Gastprofile zu erkennen. Gästen wird somit eine ganzheitliche, personalisierte, unkomplizierte Guest Journey ermöglicht, die ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.
staykooook.com
[01] Die eigens für Stay KooooK entwickelte Web-App macht es spielend leicht, den Aufenthalt nach eigenen Vorstellungen individuell zu gestalten und so die Guest Journey nicht nur zu durchlaufen, sondern aktiv mitzugestalten.
[02] «Wohnzimmer» im neuen Stay Kooook in Bern-Wankdorf. Gäste können einen eigenen Account anlegen, Inhalte bewerten oder Empfehlungen teilen und Angaben zu persönlichen Vorlieben machen, um Abläufe sowie die Ausstattung des Zimmers oder Studios so persönlich wie möglich zu gestalten.
Im vergangenen Jahr haben die Pandemie und das daraus resultierende Reiseverbot die Hospitality-Branche drastisch verändert. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die europäische Hotelbranche, da der Umsatz (pro verfügbares Zimmer) zu Beginn der Pandemie um über 66 Prozent sank und bis April 2020 auf einen Tiefststand von 95 Prozent fiel. Während eine Erholung nicht vor 2023 erwartet wird, haben diese Herausforderungen neue Prioritäten und Trends hervorgebracht, die wahrscheinlich relevant sein werden, wenn die neue Normalität ein Dauerzustand ist in der Hotellerie.
Mehr mit weniger tun
Die Automatisierung von Aufgaben und die Möglichkeit, mit weniger mehr zu erreichen, sind die treibenden Kräfte hinter den Innovationen in der Branche. Wir haben während der eigentlichen Krise gesehen, dass der Personalbestand an breiter Front reduziert wurde, was dazu führte, dass die Mitarbeitenden mehr Bereiche des Hotelbetriebs abdecken mussten als zuvor. Die Reduktion manueller Aufgaben durch Automatisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) hat den Hoteliers geholfen, auch mit weniger Personal ein hohes Serviceniveau zu halten. Wir erwarten, dass KI auch in Zukunft einen grossen Einfluss auf die Branche haben wird. Tatsächlich hat Oracle Hospitality die OPERA Cloud Property Management um künstliche Intelligenz erweitert, die es
Hotels ermöglicht, die Zimmerbelegung und die Reinigung zu verwalten und das Personal darüber zu informieren, wenn ein Gästezimmer reserviert oder für das Housekeeping zur Reinigung bereit ist.
Die Pandemie unterstrich die Notwendigkeit für Hoteliers, flexible Systeme zu haben, die schnell angepasst werden können, um die sich ändernden Gästeerwartungen abzubilden. Wir haben zahlreiche Vorteile von Hotels gesehen, die bereits Cloud-Technologie nutzen oder während der Pandemie auf die Cloud umgestiegen sind, um diesen Bedarf zu decken. Der Betrieb in der Cloud beseitigt die IT-Komplexität, sodass sich das begrenzte Personal besser auf die Gäste konzentrieren kann. Selbst Mitarbeitende, die aus dem Homeoffice arbeiten, haben vollen Einblick in die Abläufe, egal wo sie sich örtlich befinden, was ihre Effizienz erhöht. Darüber hinaus waren diese Hotels in der Lage, sich schnell an veränderte Marktbedingungen und Gästebedürfnisse anzupassen.
Das Starling Hotel Residence Geneva, ein Haus mit 93 Zimmern, wechselte während der Pandemie zu OPERA Cloud, nachdem es gezwungen war, sein altes Property Management System zu ersetzen, bevor es ausfiel.

Richard Oram ist Senior Director of Product Enablement für Oracle Hospitality. Oracle Hospitality verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Technologielösungen für unabhängige Hoteliers, globale und regionale Hotelketten, Glücksspiel und Kreuzfahrtgesellschaften. Das Unternehmen bietet Hardware, Software und Dienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, Daten zu nutzen, um personalisierte Gästeerlebnisse zu fördern, die Rentabilität zu maximieren und die langfristige Loyalität zu stärken. OPERA ist weltweit als führende Property-Management-Plattform anerkannt und bietet offene APIs, die als Plattform für Brancheninnovationen dienen.

Besserer Service, mehr Sicherheit …
Thomas Lambert, Direktor des Starling Hotels, meint dazu: «Erst nachdem ich mich für die Cloud entschieden hatte, wurde mir klar, dass mir dieses System so viel mehr bieten kann. Die Vorteile sind, besonders im heutigen volatilen Geschäftsklima, von unschätzbarem Wert: die Chance, mobil und von überall her zu arbeiten, bis hin zur Integration von zusätzlichen Tools für den Self-ServiceCheck-in. Diese Erweiterungen verbessern nicht nur den Service, sondern erhöhen auch die Sicherheit für unsere Gäste und Mitarbeiter. Die Fähigkeit der Cloud, dass die Mitarbeitenden aus dem Homeoffice arbeiten können – und Probleme jederzeit lösen können –, hat das Leben verändert. Mit einem mobilen Gerät ihrer Wahl können mein Team und ich uns genauso einfach von zu Hause oder einem anderen Ort aus verbinden.»
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vernetzung des Technologie-Ökosystems, um innovative Integrationen durch die Verwendung offener APIs zu ermöglichen. In dem Bestreben, die Wiederherstellung zu beschleunigen und den Partnern die Anpassung und Innovation zu erleichtern, haben wir die Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP) eingeführt. OHIP zentralisiert, konsolidiert und rationalisiert alle unsere Schnittstellenfunktionen und die damit verbundenen Prozesse in einer einzigen und einheitlichen Plattform. Sie ermöglicht den Anwendern eine beispiellose Self-Service-Erfahrung, von der
Entdeckung unserer reichhaltigen Palette an Hospitality REST APIs (derzeit mehr als 3000) bis hin zu deren Übernahme in Kunden- oder Partneranwendungen.
Berührungslose / kontaktlose Erlebnisse
Die Welt verändert sich schnell, und bei all dem hilft uns die Technologie, in unserem persönlichen und beruflichen Leben in Verbindung zu bleiben, während sie uns auch dabei hilft, getrennt und sicher zu bleiben. Technologie wird uns auch unterstützen und schützen, wenn wir wieder «normal» mit Freunden und Familie unterwegs sind.
Aber während wir das tun, werden diese vertrauten Aktivitäten wie der Aufenthalt in einem Hotel eine andere Experience bieten, da Hoteliers sich den Gegebenheiten anpassen müssen, um die Vorschriften und vor allem die Erwartungen der Gäste zu erfüllen. Hotels müssen nach Technologielösungen suchen, die nicht nur das Vertrauen der Gäste während des Aufenthalts rechtfertigen, sondern auch die Sicherheit des Personals berücksichtigen.
Aus diesem Grund sind Selbstbedienungstechnologien wie mobile Schlüssel, Checkin über einen Kiosk und digitale Nachrichtendienste zur Abwicklung von Anfragen wie Essens- und Getränkebestellungen und Concierge-Services zu einer Priorität in der Hotelbranche geworden und werden dies auch weiterhin bleiben.
Anpassen, um den neuen Kunden zu begeistern
Hotels werden auch weiterhin die Customer Journey anpassen, um Gäste in neuen Märkten zu gewinnen. Die Hotellandschaft entwickelt sich mit den sich ändernden Reisemustern ebenfalls. So haben sich zum Beispiel Hotels mit verlängerten Aufenthaltsmöglichkeiten besser entwickelt als traditionelle Hotels, da sie andere Bedürfnisse befriedigen. Traditionell geführte Hotels haben diese Veränderungen zur Kenntnis genommen und haben die nötigen Schritte unternommen, um ihre Einrichtungen so anzupassen, dass sie auch Extended-Stay-Angebote anbieten, um ein breiteres Publikum anzusprechen.
Fernarbeit und Fernlernen haben auch die Flexibilität der Zeitpläne der Gäste revolutioniert. Hoteliers auf der ganzen Welt –darunter eine Reihe prominenter Marken wie Accor, Marriott, Hilton und Scandic –nutzen die Chance, zusätzliche Einnahmen zu generieren, und bieten diesen Service an, während sie sich teilweise neu erfinden, um Umsatzverluste aufgrund niedriger Belegungszahlen auszugleichen. Das Angebot von Arbeitsplätzen ist jedoch mehr als eine vorübergehende Lösung und spiegelt die sich verändernde Art und Weise wider, wie Menschen heute und in Zukunft arbeiten wollen.
Wir alle hoffen, dass die Hotels durch geimpfte Gäste auf einen Wiederanstieg der Buchungen hoffen können. Aber egal, was die Zukunft bringt, es wird weiterhin ein grösserer Fokus auf der persönlichen Sicherheit und Sauberkeit liegen. Es ist nicht so, dass die Hotels vorher nicht sauber und sicher waren; es ist nur so, dass die Hotels nun verpflichtet sein werden, ihre Bemühungen in der Öffentlichkeit stärker darzustellen. Dies wird der Schlüssel sein, um das Geschäftsvolumen zurückzugewinnen und dafür zu sorgen, dass sich die Gäste in unserer neuen Normalität sicher fühlen.
So einfach ist das wohl nun doch nicht. Da verordnet sich gerade «Schweiz Tourismus» auf der Jahresmedienkonferenz ein neues Nachhaltigkeitsprogramm mit dem wohlklingenden Namen «Swisstainable». Erklärtes Ziel: «Die Schweiz zu einem der nachhaltigsten Reiseländer der Welt zu machen», so Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger. Und was machen die Schweizer? Sie lehnen kurz darauf per Volksabstimmung ein CO2-Gesetz ab, das ja geholfen hätte, mit einer Reduzierung der CO2-Emissionen diesem Ziel zumindest näher zu kommen. Wenn aber schon die eigene Bevölkerung nicht zu 100 Prozent hinter solch einem Ziel steht, wie sieht dann der Rest der Welt das Thema Sustainability, wie sehen es die Gäste tatsächlich? Vor allem, was ist es ihnen wert und wo sind die Grenzen?
Diese Fragen sind wichtig, denn schnell ist eine Richtung eingeschlagen, die letztlich ebenso schnell am Ziel vorbeiführen kann. Und jeder spätere Richtungswechsel kostet Zeit, Kraft und Glaubwürdigkeit. Ist Nachhaltigkeit also tatsächlich der ultimative wie unerlässliche, pauschale Werbe-Booster – oder kommt es auf die Details an? Was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Und ist Nachhaltigkeit alles, getreu dem ersten Gebot «Du sollst keine anderen Götter haben neben mir»?
Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck!
Versuchen wir es mit Antworten und beginnen wir zunächst mit der Nachhaltigkeit, ohne ein Plagiat von Wikipedia zu produzieren, und einer These. Denn der gute Johann Hanns Carl von Carlowitz, der uns allen mit seiner «sylvicultura oeconomica» 1713 den forstlichen Nachhaltigkeitsbegriff vererbt hat, hatte als Oberberghauptmann des Erzgebirges vielleicht gar nicht so sehr die Natur als solche im Mittelpunkt seiner Betrachtung. Nachhaltigkeit nicht zum Selbstzweck, sondern, aus seinem damaligen Blickwinkel, um damit das wirtschaftliche wie technische Bedürfnis dauerhaft befriedigen zu können, Stollen im Bergwerk mit Holz ab-
stützen zu können. Denn wenn man immer nur Bäume gefällt hätte, anstatt auch mal welche anzupflanzen, respektive nachwachsen zu lassen, wäre irgendwann das Erzgebirge kahl gewesen – und da Holzimporte anno 1700 noch etwas kompliziert waren, hätte der Bergbau irgend wann stillgestanden. Das galt es zu vermei den. Und er hat es vermieden, indem er sei nen Zeitgenossen und allen nachfolgenden Generationen den Vorteil einer Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit für eine fortsetzbare Ressourcen-Nutzung mit auf den Weg gegeben hat.
Nachhaltigkeit sah er, so die These, als Mit tel zum Zweck! Und daran schliesst sich folgerichtig die Frage nach der Formel für eine taugliche Nachhaltigkeitswerbung an.
Jens Rosenbaum hat Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Univer sität Münster studiert und einen Abschluss als Diplom-Kaufmann. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt er sich mit Themen der Gesundheit und ist spezialisiert auf das Fachgebiet Schlaf. Er ist diplomierter Schlafberater der Akademie LDT Nagold, Journalist, Herausgeber des Journals «Schlafen Spezial» und beratend tätig für Handel und Industrie. Seit vielen Jahren ist er Autor von Fachartikeln zum Thema Hotel-Bett, so auch im Fach magazin «Hotelier». Rosenbaum ist auch Herausgeber des neuen Buches «Das Hotel-Bett», Begründer von Hotel-Betten-Check sowie Hotel-Betten-Test und verleiht zusammen mit anderen Fachmedien jährlich den Clean- und Green-Sleeping-Award für die Hotellerie.

Nicht, ob Nachhaltigkeit wichtig oder unwichtig ist. Diese Frage ist längst geklärt. Sondern, welche Kompromisse einzugehen sind, um Nachhaltigkeit sowohl alltags- und damit auch gästetauglich, aber vor allem zielführend zu machen. Denn so viel ist sicher, den grössten Effekt in Sachen Nachhaltigkeit und der damit verbundenen Ressourcen-Schonung würde man erzielen, wenn der Tourismus scharf begrenzt, wenn nicht gar komplett unterbunden werden würde. Das kann aber kaum das Ziel sein. Wer hier also zu ambitioniert agiert und ausblendet, dass alle Massnahmen letztlich nur von und mit Menschen umzusetzen sind, um deren Ziele zu befördern, landet schnell in der Sackgasse. Der Gast soll ja kommen, um unbeschwert und mit gutem Gewissen seinen Urlaub zu verbringen, aber er ist mittlerweile auch erfahren genug, um Greenwashing entlarven zu können.
Wenn die Schweiz sich grün macht, sollte sie das Rot nicht vergessen
Und letztlich hat alles auch seinen Preis, auch seinen maximalen, wie wir es am Bio-Regal im Supermarkt sehen können. Der Verbraucher ist sehr wohl bereit, einen höheren Preis für seine Bio-Zitronen zu zahlen, aber eben nicht jeden. Er definiert hier über den Preis seine Kompromissfähigkeit, in Abwägung zu parallelen Zielen und was er letztlich dafür bekommt. Nur eine Bio-Zitrone – oder gibt es da noch einen weiteren Mehrwert? Denn der Wunsch nach Nachhaltigkeit ist eben nur einer neben vielen – und der Begriff beginnt auch sich abzunutzen. So dürfen andere, für einen Kompromiss wichtige Entwicklungen nicht unberücksichtigt bleiben, und damit kommen wir zur zweiten Frage, ob Nachhaltigkeit heute alles ist.

Was gibt es neben Nachhaltigkeit und den unendlichen, einer florierenden und sehr perfekt bis perfide funktionierenden Werbewirtschaft entstammenden Wünschen noch – und was davon ist dem Gast wichtig? Hier hat die Pandemie, die übrigens noch nicht abgeschlossen ist, wohlmöglich zu einer Verschiebung im Wertesystem beim Konsumenten geführt, die besondere Aufmerksamkeit verdient und Teil der Antwort sein könnte. So wurden aktuell in der Schweiz, an der Kalaidos University of Applied Sciences, Veränderungen im Konsumentenverhalten in Korrelation mit der Corona-Pandemie untersucht, Fokus Tourismus. Und dort wird eine Transformation des nachhaltigen Tourismus gesehen, der nicht nur grüner, sondern, jetzt bitte aufpassen, auch sozialer wird! Der Mensch hat offensichtlich gelernt, nicht nur die Natur respektvoller wahrzunehmen, sondern auch seinesgleichen. «Da im Kontext des Reisens neben der die Achtsamkeit gegenüber allen beteiligten Protagonisten im Rahmen einer Reise ebenfalls mehr in den Mittelpunkt des Interesses rückt, entwickelt sich daraus eine nachhaltigere Form des Tourismus, die auf Resonanz basiert», so Wolf-Thomas Karl, der auch Dozent für nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Fresenius und Partner von
Es kommen also neue Komponenten in das Spiel, die einen Ausblick darauf geben, was die Gäste erwarten und zu welchen Kompromissen sie willens und fähig sind. WolfThomas Karl hat in seiner Studie auch herausgefunden, dass durch die Pandemie bereits Änderungen in den Verhaltensweisen herbeigeführt respektive beschleunigt wurden. So zum Beispiel hat das Inland, samt seiner Nahziele, wieder Hochkonjunktur und Kreuzfahrten werden auch in Zukunft schwächeln, womit die Gäste bereits nachhaltiges Handeln adaptiert haben, notgedrungen, aber wissentlich. Auffallend ist eben, dass nachhaltiges Handeln bereits weit über den Schutz der Natur hinausgesehen wird als eine zukunftsfähige Konzeption für eine gesamtgesellschaftliche, soziale
«Mit Swisstainable hat man nur eine neue Worthülse geschaffen, bei der hinterfragt werden darf, was diese an Neuem enthält und ob es diese auch überhaupt braucht»
Wertschätzung für die Menschen vor Ort – von Gästen und Gastgebern auch in Richtung der Leistungserbringer. Nachhaltigkeitskonzepte verlangen demzufolge künftig auch sozioökonomische Inhalte, Natur alleine reicht also nicht mehr.
In Swissness liegt der Schlüssel für Sustainability
Mit Swisstainable, und so kommen wir zum Ausgangspunkt zurück, ist nur eine neue Worthülse geschaffen, bei der hinterfragt werden darf, was diese an Neuem enthält und ob es diese auch überhaupt braucht. Zumal die Gäste selbige auch erst verstehen müssen, um die hier gebotene Nachhaltigkeit gegenüber jener in anderen Ländern hinreichend differenzieren zu können. Dabei hat die Schweiz ja bereits seit den 90er-Jahren eigentlich einen Begriff, quasi eine Allzweckwaffe, den es nicht mehr zu erklären braucht: «Swissness». Hier bemühe ich nun mal Wikipedia: «Die positiv konnotierten Attribute Fairness, Präzision, Zuverlässigkeit, politische Stabilität, Natürlichkeit und Sauberkeit sollen in einem Begriff zusammengefasst und als typisch schweizerisch insbesondere auch im Ausland vermarktet werden».
Diese Vermarktung hat sich, und da wird niemand widersprechen, bereits mehr als erfolgreich verankert. Und mit den Attributen Natürlichkeit und Fairness ist dieser Begriff bereits auch inhaltlich für einen nachhaltigen Resonanz-Tourismus aufgeladen – und das seit 30 Jahren. Viel wichtiger wäre es also, diese Aspekte vor und mit dem Gast konsequent zu leben. Das verlangt, wie sich erahnen lässt, Kompromisse und kostet auch Geld, aber dafür erhält man dann auch Glaubwürdigkeit, die wichtigste Währung in der Werbung, und das Vertrauen der Gäste, das zu bekommen, was sie erwarten, wenn sie mehr erwarten sollen, als andere Länder zu bieten haben.
Aber was sollen sie von der Schweiz konkret erwarten? Das ist doch die entscheidende Frage. Wie würde sich Swissness in dem hier besprochenen Kontext in die Tat umsetzen lassen? Und wie weit ist der Tourismus hier bereit zu gehen? Wo hört
reine Werbung auf, wo beginnt ernsthaftes Handeln? Zum Beispiel primär auf regionale wie saisonale Produkte zu setzen. Im Winter also mal keine Erdbeeren, die sonst eingeflogen werden müssten oder aus Gewächshäusern stammen, die ganze Landstriche überdachen. Oder ohne Blumenarrangements, von denen bisweilen keine einzige in der Schweiz wächst. Oder nur Fair-Trade-Kaffee aus zertifiziert nachhaltigem Anbau. Das geht weiter mit dem Beheizen der Pools und das Präparieren der Ski-Pisten. Was davon ist vertretbar, wo wäre die Nachhaltigkeitsschwelle und wo liegt die Kompromissgrenze? Und ein ganz grosser Teil findet sicherlich im nicht sichtbaren Bereich statt. Auf Produktqualität setzen und Matratzen lieber mal öfters waschen und dafür lange nutzen, anstatt sie aus hygienischen Gründen alle fünf Jahre zu entsorgen. Die Wäsche jenseits der Grenze waschen, weil es da einige Rappen billiger ist, ist das nachhaltig und sozial? Wo kommen die Stoffe für die Wäsche her, wie wird produziert, wie entlohnt und wie wird man seiner sozialen Verantwortung vor Ort sichtbar gerecht? Swissness würde auf viele dieser Fragen bereits eine Antwort geben.
Die Schweiz geniesst einen exzellenten Ruf. Sich auf diesem hohen Niveau das Ziel zu setzten, auch zu einem der nachhaltigsten Reiseländer der Welt zu werden, braucht weniger einen neuen Werbeslogan, sondern mehr einen erkennbar grün-roten Faden, der sich durch das gesamte Angebot zieht. Durch den sichtbaren wie den für den Gast unsichtbaren Teil. Herausforderung wird sein, über die vielen Anbieter und Tourismus-Produkte eine einheitliche wie verbindliche Aussage zu formen, damit Erwartung und erlebte Realität keinen Widerspruch erfahren. Das wird auch gelingen, sofern Nachhaltigkeit nicht als starrer Begriff verstanden und kein Greenwashing betrieben wird, sondern die Qualität der Umsetzung zeigt, dass hier die Schweiz am Werk ist.

hotel-betten-check.de
Wer diesen Check besteht, der hat als Hotel nicht nur seine Betten im Griff, sondern darf sich zu den Top-Hotels in Sachen Bettenangebot zählen. Das Fachmagazin «Hotelier» unterstützt als Projektpartner dieses Angebot, bei dem vier Fragebögen mit zusammen über 100 Fragen, sowie einem gesonderten zum Thema Nachhaltigkeit, alle Aspekte erfassen, um Ausstattung, Organisation und Pflege eines Bettenangebotes kritisch überprüfen zu können.
Nach dem Ausfüllen der Fragebögen stehen den Hotels neben einem Schnell-Check auch ein Komfort- und ein Analyse-Check zur Verfügung, bei dem Schulnoten verteilt werden. Damit lassen sich Vergleiche innerhalb gewisser Kriterien anstellen, wie zum Beispiel Klassifizierung, Zimmerzahl oder Gruppen- und Verbandszugehörigkeit. Dafür wurden eigens alle Kantone der Schweiz gelistet, um diese regionalen Vergleiche zu ermöglichen. Der Check selbst samt Ergebnis ist anonym, die eigenen Daten sind für Dritte nicht einsehbar.
Für die Mühe der Beantwortung des umfangreichen Fragenkataloges winken zur Belohnung, neben der Erkenntnis über die eigenen Hotel-Betten, Zertifikate sowie die Möglichkeit, ebenfalls kostenlos, sich im künftigen Hotel-Betten-Report listen zu lassen. Diese an die Gäste gerichtete Betten-Suchmaschine bündelt dann alle Informationen aus dem Check betreffend
Bettenlänge, Kissenmenü oder ZudeckenAuswahl, um Beispiele zu nennen, aber auch Allergikereignung und Nachhaltigkeit. So soll erstmals ein Nachschlagewerk über das konkrete Bettenangebot der Hotellerie geschaffen werden. Die Finanzierung soll über klassische Werbung im Hotel-Betten-Report erfolgen.
In einer Partnerschaft zwischen einem Hotelverband, Fachverlagen und Sponsoren wurde der www.hotel-betten-check.de jetzt im Internet live geschaltet, der sich an die gesamte DACH-Region richtet. Ausgehend von dem Buch «Das Hotel-Bett», erschienen 2019 im Fachbuchverlag Erich Schmid/Berlin, fanden sich die Projektpartner zusammen, um eine Informationslücke für jene Gäste zu schliessen, die nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach der Qualität des Bettenangebotes suchen.
hotel-betten-check.de


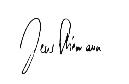




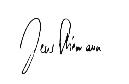


5 Fragen zum Swiss Innovation Day 2021

Tourismusexperte Jürg Schmid: «Der Städteund der Kongresstourismus werden eine längere Erholungsphase durchleben müssen.»
Der Swiss Innovation Day 2021 (SID 21) inspiriert die Hotelbranche und die Tourismus-Schaffenden zu Vorwärtsstrategien in die neue Normalität nach Corona. Namhafte nationale und internationale
Experten diskutieren über Erfolgswege nach der Krise, beleuchten «Musts» von morgen und Trends von übermorgen. 5 Fragen an Jürg Schmid, Tourismusexperte und Mitinitiant des SID 21.
Welches sind die Highlights des Swiss Innovation Day 2021?
Die profunde Lage-Einschätzung des UBS-Chefökonomen Daniel Kalt und des Flughafenchefs Stephan Widrig wird den Hoteliers und Tourismusschaffenden relevante Planungserkenntnisse liefern. Gibt’s bald einen GaultMillau-Takeaway? Urs Heller und Andreas Caminada zeigen Trends der Gastronomie in der PostCorona-Zeit auf. Der Gründer und CEO von 25hours Hotels, Christoph Hoffmann, und Markus Lehnert, Marriott VP International Hotel Development, diskutieren über Perspektiven und Strategien von Stadtund Berghotellerie und die Interessen der Hotelketten im Schweizer Markt. Werber und NZZ-Verwaltungsrat Dominique von Matt diskutiert zur Kommunikation von Hotels in einer Ära des neuen Bewusstseins und Andreas Steibl, Tourismusdirektor von Ischgl, präsentiert die Erkenntnisse eines Tornado-Erlebnisses.
Warum sollte ein Hotelier diesen Tag unbedingt besuchen?
Der Swiss Innovation Day 2021 bietet Lösungen. Das Programm ist praxisnah, keine Politiker- und Verbandsansprachen. Vorwärtsstrategien und Zukunfts-
wege in die neue Normalität der Hotellerie nach und mit Corona stehen im Zentrum der Präsentationen und Diskussionen dieses ersten grossen Hotellerieund Tourismusanlasses nach der dunklen Periode. In diesem Jahr findet der Swiss Innovation Day zudem im neueröffneten Circle am Flughafen Zürich statt. 250 Entscheidungsträger aus Hotellerie und Tourismus treffen sich zum Input und Austausch über Reise- und Hotel-Innovationsthemen.
Welche Rolle spielen Sie persönlich am SID 21?
Ich bin Teil des vierköpfigen Organisationsteams, zusammengesetzt aus Swiss Hospitality Solutions und Schmid Pelli & Partner. Ich freue mich zudem, anlässlich einer Key Note transparent und unabhängig meine Lageeinschätzung zur Schweizer Hotellerie, urban und alpin, und zum Schweizer Tourismus zu präsentieren. Ich werde Podiumsgespräche moderieren und beispielsweise mit Andreas Caminada bei einem Espresso-Talk offen über Trends, No-Trends und die Zukunft der Gastronomie philosophieren.
4
Befassen sich die Referenten und befasst sich generell das Programm des SID 21 nur mit den Folgen der Pandemie auf die HospitalityIndustrie?
Darum geht’s ganz klar auch. Vor allem aber blicken wir nach vorne, entdecken die Chancen und sprechen über notwendige Neuausrichtungen und Neupositionierungen. Namhafte nationale und internationale Experten diskutieren über Erfolgswege nach der Krise, beleuchten Musts von morgen und Trends von übermorgen.
Wir lauten Ihre Prognosen oder Visionen für die nahe und längerfristige Zukunft der Hotellerie und Gastronomie in der Schweiz? Der Schweizer Tourismus hat intakte Chancen. Der Städte- und der Kongresstourismus werden aber wohl eine längere Erholungsphase durchleben müssen. Und ja, Greta kommt wieder, gemeint ist der unaufhaltsame Trend zu mehr Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Reisen. Mehr darüber aber am Swiss Innovation Day am 26. August. Bis bald!
6. Swiss Innovation Day (26. August 2021)

Gibt es nach Corona ein Zurück zu den gewohnten Reiseströmen? Welches sind die Prognosen und Strategien der Akteure des internationalen Reisegeschäfts? Was sind die Voraussetzungen für ein rasches Zurückfinden auf die Erfolgsspur? Genau darum geht’s am ersten Grossanlass des Schweizer Tourismus und der Hotellerie nach Corona, dem 6. Swiss Innovation Day vom 26. August 2021.
In diesem Jahr findet der Swiss Innovation Day im neueröffneten Circle am Flughafen Zürich statt. 300 Entscheidungsträger aus Hotellerie und Tourismus treffen sich zum Input und Austausch über Reiseund Hotel-Innovationsthemen. Die Zusammenarbeit zwischen SHS Academy und Schmid Pelli & Partner wurde intensiviert, was die gemeinsame Bespielung des Swiss Innovation Days auszeichnet.
Die Teilnahme richtet sich exklusiv an Entscheidungsträger (Direktoren, Verwaltungsräte, Top-Kader). Für
Fachbesucher (Berater) besteht ein sehr kleines Kontingent an Karten, die direkt über die SHS Academy erhältlich sind.



Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket mit CHF 100 Preisreduktion auf den SHS Family Preis (CHF 390 statt CHF 490) mit dem Promocode «Hotelier_SID21» auf swissinnovationday.ch
Frage an Michael Smithuis (Präsident) und Jan E. Brucker (Managing Director) von Swiss Deluxe Hotels:
39 Schweizer Luxushäuser haben sich in der Vereinigung «Swiss Deluxe Hotels» (SDH) zusammengeschlossen. Wie haben die 5-Sterne-Hotels die bisherige Krise überstanden?
Wir sehen der Präsident und der Managing Director die Post-Corona-Zukunft?
1 2 3
Wenn Sie auf die letzten rund 20 Monate «Coronakrise» zurückschauen, wie lautet Ihr Fazit für die Swiss Deluxe Hotels?
Es war eine sehr schwierige Zeit, in der vor allem unsere Anpassungsfähigkeit und Flexibilität gefragt waren. Man sah sich plötzlich mit einer neuen sozialen Distanzierung konfrontiert und musste schnell lernen, sich entsprechend anzupassen, nicht zuletzt, um auch den neuen Sicherheitsmassnahmen zu entsprechen. Wenn der persönliche Kontakt zu den Gästen eigentlich im Vordergrund steht, ist solch eine Umstellung alles andere als einfach. Die Einführung von Kurzarbeit hat vorübergehende Beschäftigungseinbrüche ausgeglichen und Arbeitsplätze erhalten. Es ist für die Swiss Deluxe Hotels unerlässlich geworden, sich aufgrund der neuen Gegebenheiten ständig zu erneuern und sich innovativ und modern zu zeigen.
Was erwartet die Schweizer «Luxushoteliers» in den kommenden Monaten?
Der Fokus wird weiterhin auf dem Schweizer Markt liegen, bevor wir wieder internationale Gäste empfangen werden. In den Sommermonaten fokussieren wir uns auf den Individualreisenden und hoffen, dass das «Gruppengeschäft» ab September wieder anzieht.
Den Stadthotels ging es während der Krise schlecht, den Resorthotels mit Schweizer Gästen dagegen hervorragend (Beispiel: The Chedi Andermatt).
Wie erklären Sie sich diesen markanten Unterschied?
Stadthotels leben hauptsächlich von internationalen Gästen, sei es für Privat- oder Geschäftsreisen. Gerade in einer Zeit, in der es unmöglich war, zu verreisen und man weder shoppen noch auswärts essen gehen konnte, waren Hotels wie das Chedi Andermatt mit ihrem umfangreichen Angebot sehr interessant. Hier standen Wellness, Gourmetküche und Aktivitäten im Freien dann sehr hoch im Kurs.

Wie lauten Ihre Perspektiven für die FünfsterneHotellerie in den nächsten Jahren – national und international?
Man wird sich geduldig zeigen müssen. Es kann durchaus bis 2023 dauern, bis wir das Niveau von 2019 wieder erreichen können. Wichtig ist im Moment vor allem, umzudenken und das Angebot den aktuellen Begebenheiten anzupassen. Digitale Lösungen wie Hybrid-Meetings sind heute beispielsweise sehr gefragt. Für uns gilt es, sich den Kundenbedürfnissen anzupassen und den Gästen zum Beispiel mit flexibleren Stornierungsfristen entgegenzukommen.
Was haben Sie als Vereinigung Swiss Deluxe Hotels Ihren Mitgliedern während der eigentlichen Krise (März 2020 bis Mai 2021) geboten?
Wir haben unseren Mitgliedern für beide Jahre einen Teil des Jahresbeitrags erlassen. Ausserdem haben wir gemeinsam mit unserem Partner Schweiz Tourismus die «Grand Tour Deluxe» als neues Reiseformat lanciert, mit dem explizit der Fokus auf den Heimmarkt Schweiz und das nahe europäische Ausland gelegt wird. Dazu läuft seit letzten Sommer eine grossangelegte Kampagne und wir streuen das sehr prominent in den relevanten Medien. Als Geschäftsstelle haben wir uns gleich zu Beginn der Krise proaktiv als Anlaufstelle angeboten und haben allen Mitgliedern unsere Unterstützung und Dienstleistung im Falle von personellen Engpässen oder finanziellen Schwierigkeiten angeboten. Mit der Lancierung unserer eigenen Buchungsplattform «Private Deal» im letzten Sommer bieten wir direkt über unsere Website die Möglichkeit der Direktbuchung in den Swiss Deluxe Hotels, was ein grosser Befreiungsschlag bezüglich der aktuellen Kommissionen bedeutet.

Michael Smithuis ist Niederländer. Er studierte an der Steigenberger Hotelfachschule Bad Reichenhall sowie an der IHTTI School of Hotel Management in Neuenburg, bevor er 1996 seine berufliche Laufbahn als Executive Assistant Manager im Mandarin Oriental Hotel in Jakarta begann. Später arbeitete er als Resident Manager im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg und sammelte anschliessend Erfahrungen bei der Raffles-Gruppe in Singapur. Nach einer spannenden Zeit in Asien kehrte er in die Niederlande zurück, wo er das Swissôtel in Amsterdam leitete. Im Jahr 2003 übernahm er die Rolle des General Managers des Fairmont Le Montreux Palace Hotels. Seit 2018 ist er ebenfalls als Regional Vice President Accor tätig.

6 7 8
Der Schweizer Heimmarkt hat 2020/21 zugelegt – mit einem aktuellen Marktanteil von 52 Prozent. Werden in Zukunft mehr Schweizer Ferien oder Wochenenden in Schweizer Luxushäusern verbringen?
Bis Ende Jahr wird sich an dieser Situation wohl kaum etwas ändern. Auslandreisen werden aber sicherlich zu Beginn des kommenden Jahres wieder stark zunehmen, was den Marktanteil des Schweizer Heimmarktes wieder senken wird.
Sie haben jetzt eine eigene Kreditkarte lanciert («Swiss Deluxe Hotels Visa Prestige»). Was bringt das dem Hotelier und (vor allem) dem Gast?
Die Lancierung unserer eigenen Kreditkarte in Kooperation mit VISA Bonus Card ist ein weiterer Meilenstein bei unserem Bestreben um Stärkung und Wahrnehmung unserer Marke. Zudem bildet die Zahlkarte das Fundament für ein gruppeneigenes Loyalitätsprogramm.
Derzeit sind 39 Hotels bei Swiss Deluxe Hotels dabei. Wollen Sie weitere Hotels aufnehmen? In der Schweiz gibt es rund 100 Fünfsterne-Häuser … Grundsätzlich sind wir natürlich an neuen Mitgliedern und einer Erweiterung unseres Kreises interessiert. Da für den Bewerbungsprozess und die Aufnahme einige Hürden zu meistern sind, ist der Kreis an potenziellen Anwärtern überschaubar und eine gewisse Exklusivität sollte auf jeden Fall immer erhalten bleiben. Eine konkrete Zielsetzung betreffend die Mitgliederzahl gibt es nicht. Ein Hotel, das beitritt, muss einfach zu uns passen.
Jan E. Brucker, Absolvent der Ecole Hôtelière de Lausanne, hat nach reicher Berufserfahrung in der internationalen Spitzenhotellerie, wie in Häusern der Peninsula Group of Hotels in Hong Kong und Beijing, verschiedene Direktionen in der Schweizer Erstklass- und Luxushotellerie innegehabt, so im Hotel Beatus in Merligen am Thunersee, im Seiler Hotel Schweizerhof in Zermatt und im Grand Park Gstaad. Nach einem Abstecher nach Berlin, wo er als General Manager für die Neueröffnung des Swissôtels Berlin am Kurfürstendamm zuständig war, übernahm er zusammen mit seiner Frau Regula die Direktion des Widder Hotels in Zürich. Diesem Hoteljuwel in der Zürcher Altstadt stand das Ehepaar Brucker fast 20 Jahre vor. Als aktiver Hotelier war Brucker von 2011 bis 2019 Präsident der Swiss Deluxe Hotels. Seit der Gründung seiner eigenen Firma Brucker Hospitality Consulting GmbH im Jahre 2020 führt er die Swiss Deluxe Hotels als Managing Director im Mandat.
Wie lauten eigentlich die aktuellen Aufnahmekriterien?
Und: Muss man zwangsläufig Mitglied von «The Leading Hotels of the World» sein?
Für eine Aufnahme muss das Hotel mindestens ein Jahr in Betrieb sein und einen «Five Star superior»-Status vorweisen können. Neben einem ordentlichen Antragsschreiben braucht es zwei Mitgliederhotels in nächster geografischer Nähe, die als Paten auftreten. Die LQA-Softwarekontrolle muss mit mindestens 80 Prozent erfüllt und die Hardwarekontrolle erfolgreich abgeschlossen werden, hierbei wird nach insgesamt 800 Kriterien bewertet. Im Anschluss kommt der Antrag vor die Generalversammlung, bei der mindestens drei Viertel aller Mitglieder der Aufnahme zustimmen müssen.
Michael Smithuis, wie geht es eigentlich Ihrem Hotel am Genfersee, dem Fairmont Montreux Palace?
Das Montreux Palace musste zweimal seine Türen schliessen, gleich zu Beginn der Pandemie für drei Monate und Ende des Jahres für weitere sechs Monate. Alle Mitarbeiter waren in Kurzarbeit und viele arbeiteten vom Homeoffice aus. Wir haben die Zeit genutzt, um wichtige Renovationsarbeiten durchzuführen. So wurde mittlerweile unsere Penthouse-Suite eröffnet. Ausserdem freuen sich unsere Gäste und Mitglieder, dass seit Anfang Mai unser neuer Wellnessbereich unter dem Namen «Fairmont Spa» wieder zugänglich gemacht wurde.
8 Fragen an Roland Gasche, neuer Präsident der Vereinigung dipl. Hoteliers (VDH)
1 2 3
Roland, du bist NDS-Leiter und hast das NDS selbst nicht abgeschlossen. Wie kann es sein, dass du nun als Nicht-VDH-Mitglied das Präsidium übernimmst?
Grundsätzlich ist die Normalität die, dass in vielen Alumni-Vereinigungen der Lehrgangsleiter auch die Leitung der Vereinigung innehat. Das hat den Vorteil, dass er die Absolventinnen und Absolventen sehr gut kennt, begleitet er sie doch währen rund 1½ Jahren sehr intensiv. Es stellt sich ja dann auch die Frage, was man sich davon verspricht, dass ein Präsident zwingend Mitglied sein und den Lehrgang selber abgeschlossen haben muss.
Gewisse VDH-Mitglieder haben «Angst», dass die VDH von der HotellerieSuisse übernommen wird. Kannst du Ihnen diese Ängste nehmen?
Ich verstehe diese Ängste sehr gut, das hat aber vermutlich eher mit der Vergangenheit zu tun. Eine Übernahme macht ja nur dann Sinn, wenn man damit erheblichen Nutzen, wie Mitgliedergewinnung, generiert, das ist hier nicht der Fall. Viele Absolventinnen und Absolventen sind ja bereits Mitglied bei HotellerieSuisse.
Hat der Vorstand seine Arbeit «nicht gemacht», weil er keinen Präsidenten gesucht hat?
Mit Fug und Recht darf gesagt werden: Doch, das hat er. Bereits 2019 hat der Vorstand, in dem ich seit fünf Jahren Mitglied bin, kommuniziert, dass wir auf der Suche nach einem Präsidenten sind, auch das Datum von Michaels Demission war klar. Trotz mehrmaliger Aufrufe und persönlichen Gesprächen hat sich niemand zur Verfügung gestellt. Von den sehr spärlich eingegangenen Vorschlägen wollte niemand das Amt übernehmen.
Einige Mitglieder haben im Vorfeld «Alarm» geschlagen und es wurden von früheren Zyklen Rund-Mails verschickt, mit denen man versuchte, deine Kandidatur zu boykottieren. Manche Mitglieder waren beleidigt und drohten bei der MV nicht zu erscheinen. Hast du davon etwas gespürt? Es fällt mir schwer, das alles nachvollziehen zu können. Dass man beleidigt sein kann, wenn man sich selbst nicht zur Verfügung stellt … Tatsache ist, ich hätte die Wahl nicht angenommen, wenn ich an der Mitgliederversammlung nur mit Ach und Krach gewählt worden wäre. Da sowohl das Rahmenprogramm am Sonntag innerhalb kurzer Zeit ausgebucht war und meine Wahl einstimmig ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen bestätigt wurde, kann ich mir Boykott-Gedanken gar nicht vorstellen.
Es heisst sehr häufig: «Die VDH ist völlig veraltet». Stimmt das?
Natürlich nimmt das Durchschnittalter eines Vereins zu, wenn nur wenige junge Absolventinnen und Absolventen Mitglieder werden. Tatsache aber ist, von den rund 440 Mitgliedern sind über drei Viertel der Mitglieder berufstätig, also am Puls des Geschehens. Dass es pensionierte Mitglieder einfacher haben, an Veranstaltungen teilzunehmen, ist offensichtlich, darum ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie eine Veranstaltung ausgestattet wird, um unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Es darf dabei aber nie um «Jung» gegen «Alt» gehen, der Fokus muss immer auf «Jung» gemeinsam mit «Alt» gerichtet sein.
Wie lautet die Strategie, um junge Mitglieder zu motivieren, bei der Alumni-Vereinigung zu bleiben und nicht nach dem Gratisjahr auszutreten? Es hat etwas mit meiner Antwort bei der Frage 5 zu tun. NDS-Absolventinnen und -Absolventen stehen mitten im Ausbau ihrer Karriere. Das bedeutet, ihre Zeit ist voll auf ihre Topposition und den damit verbundenen Aufgaben und Verantwortungen im Betrieb ausgerichtet. Wenn sie dann Zeit für ihr Netzwerk investieren, dann reicht es ihnen nicht aus, zwei Tage nach Zürich zu reisen, um an Ausflügen, Besichtigungen und einer Mitgliederversammlung teilzunehmen. Wir tun also gut daran, zuerst einmal darüber nachzudenken, wo sich und wie sich die VDH in Zukunft positionieren will, um für Berufstätige, wie auch Mitglieder, die im wohlverdienten 4 5 6

Der neue VDH-Präsident, Roland Gasche, nach seiner Wahl im The Dolder Grand in Zürich.
Ruhestand sind, attraktiv zu sein. Von diesem Entscheid kann dann abgeleitet werden, welche Bedeutung das für die Planung, Organisation, Gestaltung und für die Durchführung von Anlässen haben wird.
Kann man also den sogenannten «Generationenkonflikt» auch in der VDH erkennen?
Ich erkenne und anerkenne, dass die Interessen aus bereits erwähnten Gründen unterschiedlich sind, dabei von Generationenkonflikt zu sprechen, halte ich als übertrieben. Zudem gefällt mir das Wort Konflikt überhaupt nicht, es ist sehr negativ behaftet und suggeriert, dass man sich feindlich gegenübersteht, das spüre ich nicht. Meinungsverschiedenheiten sind Teil jeder Organisation und gehören ausgesprochen, mit dem Betroffenen persönlich besprochen und geklärt. Es ist kein Erfolgsmodell, über andere zu sprechen, mit ihnen zu sprechen dagegen wohl.
Was würdest du dir von den VDHMitgliedern wünschen?
Dass wir gemeinsam am Erfolg unserer Vereinigung arbeiten. Es gibt nicht den Vorstand und die Mitglieder! Wir alle sind Mitglieder, haben teilweise bloss eine etwas andere Rolle. Das ändert aber nichts daran, dass jedes Mitglied einen Beitrag zur Entwicklung und zum Erfolg der Vereinigung leistet, über den Mitgliederbeitrag hinaus. Wenn sich über 400 Mitglieder einsetzen, mit Begeisterung über die VDH zu sprechen und damit deren Attraktivität greifbar zu machen, dann haben wir einen ersten wichtigen gemeinsamen Schritt getan.
Reben und Wein
Ich besitze einen kleinen Rebberg im Piemont, aus dessen Reben wir in sehr guten Jahren an die 300 Magnumflaschen Rotwein keltern. Es ist eine Assemblage von Nebbiolo, Barbera und Merlot und heisst «Goccia Nera».
Lehrjahre und Studium
Nach der Kochlehre im Old Swiss House und dem Studium an der Hotelfachschule in Luzern wollte ich die Welt und die Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten kennenlernen. Der Kreis schloss sich, als ich mit einem Rucksack voller Erfahrungen und Einsicht in die vielfältigsten Aufgaben die Leitung der Unternehmerbildung und damit auch die Leitung des NDS HF Hotelmanagement-Lehrgangs übernommen habe.
Seine Zeit in Afrika
Ich habe in Afrika in verschiedenen Hotels und Bereichen gearbeitet. Mein Abstecher nach Afrika endete in Durban, wo es darum ging, auf einer Krokodilfarm mit über 2500 Krokodilen ein Tourismusangebot zu schnüren, was auch gelang.
Sein Lieblingshotel
Ich hoffe, ich mache jetzt niemanden traurig oder gar böse, aber «La Couronne» in Solothurn ist mein Lieblingshotel. Die «Couronne» vereint das, war mir als Hotelgast wichtig ist. Ausnahmslos alle Mitarbeitenden aller Stufen machen mir meinen Aufenthalt, egal wie kurz oder lang, jedes Mal zu einem tollen Erlebnis.
Die diesjährige Mitgliederversammlung 2021 stand ganz im Zeichen des Präsidentenwechsels. Die üblichen Traktanden, so z. B. Protokoll der Mitgliederversammlung des Vorjahres, Geschäftsbericht 2020 und Jahresrechnung 2020 wurden per Akklamation genehmigt. Auch dem Solidaritätsbeitrag wurde zugestimmt. Aufgrund der aktuellen Situation soll gebeutelten VDH-Mitgliedern und in Not geratenen Kompetenzpartnern die Möglichkeit gegeben werden, einen Teil des Mitgliederbeitrages zu erlassen.
Die Wiederwahl von Vorstandsmitglied Nicoletta Müller und Vizepräsidentin Verena Kern Nyberg wurde ebenfalls angenommen.
Die Vizepräsidentin ist bereit, das Amt ein weiteres Jahr auszuüben, um dem neuen Präsidenten zur Seite zu stehen und ihm den Einstieg zu erleichtern.
Auch die beiden Revisoren Patrick Leu und Stefan Boller werden für ein weiteres Jahr gewählt. Spannend war die Wahl des neuen
Präsidenten. Michael Müller konnte – nach zwei Jahren Suche – Roland Gasche, Leiter des NDS, als den richtigen Mann gewinnen. Der mit Akklamation neu gewählte Präsident überzeugte in seiner Antrittsrede.
Hotel2invest, eine Marke von Hotel & Gastro Consulting, verkaufte schon von 2017 bis 2019 erfolgreich Hotels. Zwischenzeitlich wurde sie offline weiterentwickelt und mit neuen Highlights, wie automatisiertem Bieterverfahren, Chat, Grundstückidentifikation, kostenloser Aufschaltgebühr und nur 0,3 % erfolgsabhängiger Transaktionsgebühr, erweitert. Ende März 2021 wurde sie wieder lanciert. «Wir freuen uns, mit dem neuen Tinder für Hotelimmobilien online zu gehen», schmunzelt Inhaber André Gribi. «Was sich nicht ändern wird, ist das persönliche Know-how, unsere 1:1-Kundenbegleitung und das Herzblut zur Hotellerie.»
hotel2invest.com


Sie möchten eine Hotelimmobilie im Fürstentum Liechtenstein oder in der Schweiz kaufen, verpachten, vermieten oder verkaufen? Wir unterstützen Sie dabei umfassend: von der Standortanalyse und Machbarkeitsstudie über die Betreiber- und Investorensuche bis hin zur Bauberatung und Übergabe der Immobilie.
Warum CONERUM? Weil wir ausgewiesene Experten für Hotelinvestments, Betriebsübernahmen und Nachfolgelösungen sind.
CONERUM ist ein Beratungsunternehmen für Betriebsinhaber, Betreiber und Investoren von Hotelimmobilien im Fürstentum Liechtenstein und in der Schweiz. Wir sind eine Schwesterfirma der Hotelkette b_smart selection und ihr exklusiver Development-Partner. CONERUM hält zudem selbst Hotelimmobilien und vertritt verschiedene Family Offices sowie weitere Investoren bei Hotelprojekten.
conerum.com
Hotelier
27. Jahrgang hotelier.ch
Herausgeberin
Werd & Weber Verlag AG
Gwattstrasse 144
CH-3645 Gwatt/Thun 033 336 55 55 weberverlag.ch
Verlegerin
Annette Weber
Chefredaktion
Hans R. Amrein (hra) h.amrein@hotelier.ch
Anzeigenverkauf Maja Giger m.giger@hotelier.ch
Aboverwaltung Anja Rüdin a.ruedin@hotelier.ch
Layout
Cornelia Wyssen
Bildbearbeitung
Adrian Aellig
Korrektorat Rosemarie Schenk David Heinen
Druck
AVD Goldach AG Sulzstrasse 10 – 12 9403 Goldach
Preise Abonnement
1 Jahr (10 Ausgaben + 2 Sonderausgaben): CHF 120.–
2 Jahre (20 Ausgaben + 4 Sonderausgaben): CHF 240.–
Einzelausgabe: CHF 14.–, Ausland zuzüglich Porto
ISSN
1664-7548
Notarielle Auflagebeglaubigung
Total gedruckte Auflage: 8000 Exemplare
Total verbreitete Auflage: 7484 Exemplare
Total verkaufte Exemplare: 3204 Exemplare
Verband Schweizer Medien
Der Werd & Weber Verlag ist Mitglied im Verband
Schweizer Medien
Mit Verfassernamen beziehungsweise Kürzel gezeichnete Veröffentlichungen geben die Auffassung der Autoren und nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Publiziertes Bildmaterial, sofern nicht angeführt, wurde dem Verlag zum Abdruck zur Verfügung gestellt. Für unaufgefordert eingereichte Manuskripte und Bilder kann keine Haftung übernommen werden. «Hotelier» ist das offizielle Publikationsorgan des Schweizer Sommelierverbandes ASSP-SVS und der Swiss Hospitality & Marketing Association SHMA sowie der Vereinigung dipl. Hoteliers VDH.



Keynotes:
Corona-Pandemie:
Grosse Herausforderung für Wirtschaft und Politik


Prof. Dr. Thomas J. Jordan
Präsident Nationalbank-Direktorium
Hospitality nach Corona
Dr. Stephan Sigrist
Gründer und Leiter W.I.R.E.
Erfolgreiche Strategien für die Zukunft
Maud Bailly
CEO ACCOR Southern Europe
Die Chefs von morgen
Prof. Dr. Ursula Renold
Chair of Education Systems, ETH Zürich
Die Zukunft gewinnen
Dr. Mathis Wackernagel
Präsident Global Footprint Network
Back to the Future
Matthias Horx
Gründer Zukunftsinstitut
Expertinnen und Experten diskutieren:

Moderation:
Aileen Zumstein und Urs Gredig
7. & 8. September 2021
Halle 550 Zürich Oerlikon
Entdecken Sie jetzt das gesamte Programm und sichern Sie sich Ihren 2-Tagespass auf hospitality-summit.ch
Die Rückkehr der internationalen Märkte: Prognosen zum Reiseverhalten der Zukunft. Fokusthemen für Tourismus und Beherbergung: Auswirkungen von Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität und Innovation. Automatisierung der Tagungsindustrie: Radikales Umdenken bei der Vermarktung von MICE-Aktivitäten. Wie Innovation gelingt! Wie kriegen wir Innovation und Agilität in unseren Alltag?
Future Hospitality: Wie bleiben die Fachkräfte der Branche erhalten?
NextGen. Hospitality Camp: 30 junge Hospitality-Fachkräfte präsentieren ihre lösungsorientierten Business Cases.
Presenting Partner: Patronat: