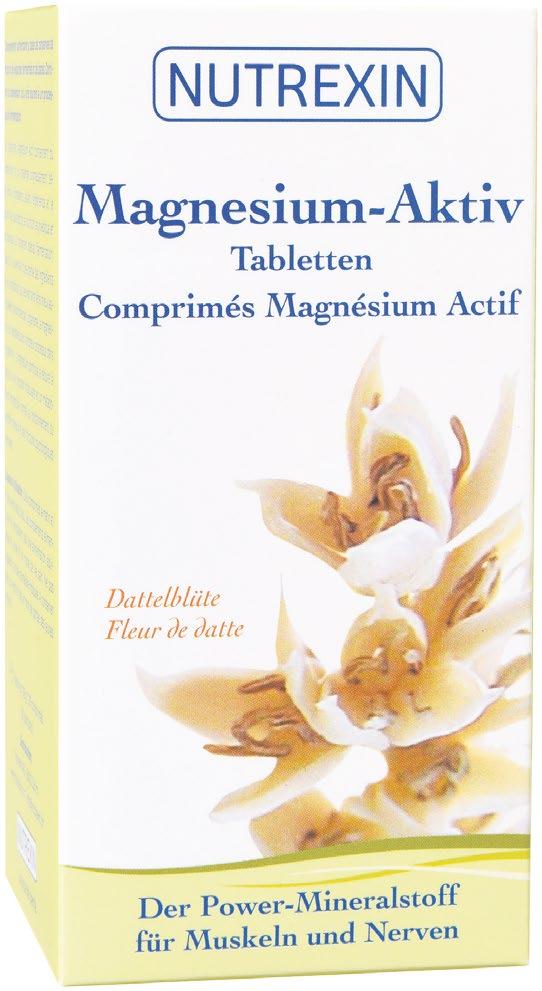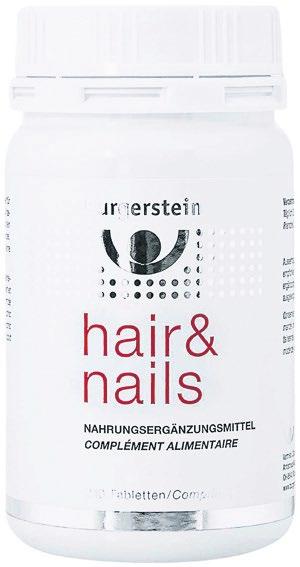natürlich

Periodenprodukte
Weg von Wegwerfprodukten
Endometriose
Wenn der Schmerz zur Qual wird
Das verborgene Tabu Falsche Scham in vielen Kulturen
Kinesio-Tapes
Kleine Bänder, grosse Wirkung
Sport
Zyklus für bessere Leistungen nutzen


Periodenprodukte
Weg von Wegwerfprodukten
Endometriose
Wenn der Schmerz zur Qual wird
Das verborgene Tabu Falsche Scham in vielen Kulturen
Kinesio-Tapes
Kleine Bänder, grosse Wirkung
Sport
Zyklus für bessere Leistungen nutzen
mit der Excellence Empress

Excellence Empress
Luxus und Gastlichkeit für das Hier und Jetzt. Als erstes Fluss- Passagierschiff der Welt setzt die Excellence Empress einen Meilenstein für umweltgerechtes Flussreisen – mit dem Clean Air Technology System. An Bord erwartet Sie Kulinarik vom Feinsten.
Route 1 Strassburg – Colmar
Tag 1 Schweiz > Strassburg
Busanreise zum Strassburger Weihnachtsmarkt. Nachmittags Busfahrt zum Hafen in Kehl. Um 17 Uhr legt die Excellence Empress ab. Romantische Lichterfahrt nach Breisach.
Tag 2 Colmar > Schweiz
Nach dem Frühstück Bustransfer von Breisach zum Weihnachtsmarkt in Colmar – das Schmuckkästchen unter den elsässischen Städten. Nachmittags erfolgt die Busrückreise in die Schweiz zu Ihrem Abreiseort.
Route 2 Colmar – Strassburg
Reise in umgekehrter Richtung. Detailprogramm auf Anfrage.
Reisedaten 2022
Route 1, 02.12.–03.12., 04.12.–05.12., 06.12.–07.12., 08.12.–09.12. Route 2, 05.12.–06.12., 07.12.–08.12., 11.12.–12.12.
Preise pro Person Fr. Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis 2-Bett, Hauptdeck 275 195 2-Bett, frz. Balkon, Mitteldeck 335 255 2-Bett, frz. Balkon, Oberdeck 375 295
Das Excellence-Inklusivpaket Excellence Flussreise in eleganter Flussblick-Kabine • Excellence Fluss-Plus: Komfort-Reisebus während ganzer Reise • Gepäckservice • WiFi an Bord • Excellence-Kreuzfahrtleitung Zuschläge Wochenende Fr–Sa / Sa–So 35 • Alleinbenützung Kabine HD 45 • Alleinbenützung Kabine MD/OD 125 • Königsklasse-Luxusbus 30
Reise & Buchung

Route 1 Paris – Rouen – Vernon
Tag 1 Schweiz > Paris Busanreise (alternativ Anreise mit TGV) nach Paris.
Tag 2 Paris Stadtrundfahrt Paris (Fr. 35). Transfer zum Weihnachtsmarkt La Défense.
Tag 3 Paris > Conflans
Ausflug Schloss Chantilly (Fr. 54).
Tag 4 Rouen
Die Excellence Royal bietet Platz für 144 Gäste. Die Kabinen befinden sich aussen, sind erstklassig-exquisit ausgestattet: Dusche/WC, Sat.-TV, Minibar, Safe, Föhn, Haustelefon, individuell regulierbare Klimaanlage und Heizung.
Weihnachtsmarkt in Rouen.
Tag 5 Vernon > Schweiz Busrückreise zu Ihrem Abreiseort.
Route 2 Vernon – Rouen – Paris
Reisedaten 2022
Route 1, Paris–Rouen–Vernon, 24.11.–28.11. Do–Mo,
Preise pro Person Fr. Kabinentyp
Das Excellence-Inklusivpaket Excellence Flussreise mit Genuss-Vollpension an Bord • Excellence Fluss-Plus: Komfort-Reisebus während der ganzen Reise • Excellence-Kreuzfahrtleitung
Zuschläge Alleinbenützung HD 195, MD/OD 255 • Königsklasse-Luxusbus 195 • TGV An-/Rückr. Schweiz - Paris v.v. (one way) ab 90
Reise in umgekehrter Richtung. Reise & Buchung

Die Excellence Queen zählt zu den luxuriösesten Schiffen Europas. Die Kabinen auf dem Mittelund Oberdeck sind 16 m² gross mit französischem Balkon, ausgestattet mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, SAT/TV, Minibar, Safe, Telefon. Lift von Mittel- zu Oberdeck mit Whirlpool.
Route 1 Koblenz – Trier
Tag 1 Schweiz > Koblenz. Busanreise. Zur Adventszeit verwandelt sich die Stadt in ein stimmungsvolles Vor-Weihnachtsparadies.
Tag 2 Koblenz > Cochem. Winterliche Flussreise auf der Mosel. Gerade in der Adventszeit erstrahlt Cochem in besonderem Glanz.
Tag 3 Traben-Trarbach > Bernkastel. Wenn die «Queen» in Bernkastel anlegt, tut sich schon am Hafen die romantische Atmosphäre im idyllischen Moselstädtchen auf.
Tag 4 Trier > Schweiz. Am Hauptmarkt der Römerstadt, vor der Kulisse des Doms, erwartet Sie eine stimmungsvolle Winterwelt. Busrückreise.
Route 2 Trier – Koblenz Reise in umgekehrter Richtung.
Reisedaten 2022
Route 1, Koblenz – Trier, 03.12.–06.12., 09.12.–12.12., 15.12.–18.12.
Route 2, Trier – Koblenz, 06.12.–09.12., 12.12.–15.12.
Preise pro Person Fr. Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis 2-Bett, Hauptdeck
499 2-Bett, frz. Balkon, Mitteldeck
2-Bett, frz. Balkon, Oberdeck
Das Excellence-Inklusivpaket Excellence Flussreise mit Genuss-Vollpension • Excellence Fluss-Plus: Komfort-Reisebus während der ganzen Reise • Excellence-Kreuzfahrtleitung Zuschläge Alleinbenützung HD 155 • Alleinbenützung MD/OD 195 • Königsklasse-Luxusbus 95 • Treibstoffzuschlag 20
Reise & Buchung
Sofortpreis mit beschränkter Verfügbarkeit! Nicht eingeschlossen Auftragspauschale pro Person Fr. 30 • Persönliche Auslagen und Getränke • Trinkgeld • Ausflüge • Versicherung Abfahrtsorte Wil •, Burgdorf •, Winterthur–Wiesendangen SBB, Zürich-Flughafen •, Aarau SBB, Baden-Rütihof •, Arlesheim •, Basel SBB. Abfahrtszeiten auf Anfrage

Liebe Leserin, lieber Leser
Eigentlich ist der monatliche Menstruationszyklus die natürlichste Sache der Welt. Unsere biologische Existenz hängt schliesslich mit der Periode, beziehungsweise deren Ausbleiben, zusammen. Das beantwortet vielleicht auch die Frage, warum ich mich als Mann überhaupt wage, ein Editorial dazu zu schreiben. Menstruation betrifft uns alle. Punkt. Doch nicht immer und überall auf der Welt sah man und sieht man das so. In vielen Kulturen war und ist heute noch die Periode mit Scham, ja mit Tabus behaftet. Warum dem so ist und wie sich die Einstellung der Menschen zur Menstruation entwickelt hat, dem geht der Artikel «Menstruation – das verborgene Tabu» nach.
Fast ebenso alt wie die Menstruation an sich sind die sogenannten Periodenprodukte. Während lange Zeit einfache, natürliche Produkte zum Auffangen des Menstruationsblutes verwendet wurden, kamen im 20. Jahrhundert zahlreiche Einwegprodukte auf den Markt. Wir gehen im Beitrag «Für eine nachhaltige Periode» der Frage nach Alternativen nach. Unter dem Titel «Periode – die weibliche Kraft» geht unsere Kolumnistin Sabine Hurni den positiven Aspekten des Monatszykluses nach. Sie empfiehlt, die natürlichen Schwankungen als Antriebskraft zu nutzen, anstatt sie zu unterdrücken.
Zum Schluss noch ein ganz anderes Thema: Farbige Tapes werden immer häufiger zur sanften Therapie von Muskeln und Gelenken eingesetzt. Die sogenannten Kinesio-Tapes können – wenn sie richtig angebracht werden – Gelenke stabiliseren, Lymphflüssigkeit zum Abfliessen bringen oder Muskeln entspannen.
Dies und noch einige andere spannende Beiträge können Sie im Heft lesen, das Sie in den Händen halten. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei!

Samuel Krähenbühl, Chefredaktor










Einzigartig frisches und qualitativ hochwertiges Kurkumapulver

Durch die schonende Verarbeitung von frischem Bio-Kurkuma in der Schweiz bleibt das charakteristische Aroma und alle Inhaltsstoffe der Kurkumawurzel vollständig erhalten!
Zellavie Bio Kurkuma eignet sich hervorragend für alle Diäten und Therapien mit Kurkuma, da der Curcumin-Gehalt doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Pulvern ist.
Es entfaltet sich auch goldig froh in Ihren Getränken und Gerichten.

Jetzt bestellen auf zellavie.ch



GESUND SEIN
8 Das verborgene Tabu
Woher kommt die Stigmatisierung der Menstruation?
12 Periodenprodukte
Es müssen nicht immer
Wegwerfprodukte sein.
18 Sabine Hurni über … … die weibliche Kraft.
GESUND WERDEN
24 Endometriose
Der Spezialist sagt, was Abhilfe schaffen kann.


28 Kinesio-Tapes
Wie bunte Klebstreifen heilen können.
32 Winterblues Ade
Wie Sie Licht in den Herbst bringen können.
DRAUSSEN SEIN
46 Gesunder Rasen
Die richtige Rasenpflege beginnt im Herbst.
52 Periode und Sport
Nutzen Sie den Schwung Ihres Zyklus für den Sport.
56 Erfahrungsmedizin
Was versteckt sich hinter der Erfahrungsmedizin?
03 Editorial / 06 Leben und Heilen / 16 Rezepte / 23 Liebesschule
42 Staunen und Wissen / 61 Hin und weg / 63 Neu und gut / 64 Rätsel / 65 Vorschau / 66 Eva unterwegs

Jentschuras BasenKur


Fasten erleichtert den Körper und beflügelt Geist und Seele nach der bewährten P. Jentschura Methode
7x7® KräuterTee – der geniale Basentee mit 49 Kräutern WurzelKraft® – das Naturlebensmittel aus mehr als 100 pflanzlichen Zutaten
MeineBase® – das Original unter den Basenbädern mit pH 8,5
Jetzt einkaufen und erleben: www.jentschura-shop.ch Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ
FORSCHUNG
Meer macht noch glücklicher als Wald
Neue Forschungsarbeiten zeigen, dass uns ein Aufenthalt am Wasser noch mehr entspannt als das Grün des Waldes. Das schreibt spektrum.de. Vor etwa zehn Jahren kam erstmals die Idee auf, dass blaue Räume noch besser sein könnten als grüne. Susana Mourato von der London School of Economics und George Mackerron von der University of Sussex beschlossen, dem auf den Grund zu gehen. Sie forderten mehr als 20 000 Menschen im Vereinigten Königreich dazu auf, eine Smartphone-App zu nutzen, die ihnen zu zufälligen Zeitpunkten einen Fragebogen zusandte. Wie fühlen Sie sich? Fragen wie diese mussten sie an Ort und Stelle beantworten. Die Forschungsgruppe sammelte mehr als eine Million Antworten. Anhand der Standortdaten der Telefone ermittelte sie, dass die Menschen in der Natur wesentlich glücklicher waren als jene in der Stadt. Selbst wenn sie Faktoren wie den Wochentag oder das Wetter berücksichtigte, blieb der Zusammenhang bestehen. Aber: An Meeres- und Küstengebieten seien die Menschen mit Abstand am glücklichsten, schreiben die Forschenden. Küstengebiete schnitten auf einer 100-Punkte-Glücksskala etwa sechs Punkte besser ab als städtische Bezirke. ska

GESUNDHEITSPREIS
Erfolgreiche Amputation
Anthropolog*innen sind auf der Insel Borneo auf einen erstaunlich frü hen Fall einer chirurgischen Behandlung gestossen: Einem jungen Pa tienten wurde vor etwa 31 000 Jahren der linke Fuss samt eines Teils des Unterschenkels entfernt, geht aus der Untersuchung eines Skelettfundes hervor, schreibt wissenschaft.de. Die Amputation wurde offenbar er staunlich professionell durchgeführt und war mit anschliessender Für sorge verbunden: Das Individuum lebte noch jahrelang weiter. Den Forschenden zufolge legen die Befunde somit nahe, dass bereits einige Jäger*innen und Sammler*innen der Altsteinzeit komplexes medizini sches Wissen besassen. ska



BRITISCHER KÖNIG
Neuer König Charles III. ist Schirmherr der Fakul tät für Homöopathie
Der neue britische König Charles III., der sein Amt am Tag des Todes seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September an trat, ist seit längerem als Anhänger von naturheilkundlichen Methoden bekannt. In den letzten beiden Jahrzehnten hatte sich der frühere «Prince of Wales» klar für die Komplementärmedizin und insbeson dere für die Homöopathie ausgesprochen, schreibt «dasgoetheanum.com».
Im Jahr 2019 gab die alte ‹Londoner Fakul tät für Homöopathie› beispielsweise den Namen ihres neuen Schirmherrn bekannt: Prinz Charles. Doch als wäre das alles noch nicht genug, hat sich der König nicht nur für den ökologischen Landbau und die Homöopathie ausgesprochen – er äusserte sich auch öffentlich zu seiner Bewunderung für Rudolf Steiner und die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Dies geschah 2017 in einer Rede, die er per Videokonferenz bei der Eröffnung des Kongresses der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum hielt. ska


Die Menstruation ist ein natürlicher Vorgang. Und dennoch gibt es kaum Kulturen oder Religionen, in der die zyklische Blutung nicht schambehaftet ist. Woher rühren Scham und Stigmatisierung?
Täglich menstruieren weltweit zwischen 300 und 800 Millionen Frauen, Mädchen sowie Menschen, die sich ihrem biologischen, weiblichen Geschlecht nicht zugehörig fühlen. Das Frauen menstruieren, sollte längst kein Tabu mehr sein. Und dennoch ranken sich Mythen um die Tage und halten sich hartnäckig, auch in unseren mitteleuropäischen Breiten.
Blut gilt vielen Religionen als Träger des Lebens. Beim Thema Menstruationsblut zeigt sich hingegen ein ambivalentes Verhalten, denn in vielen Glaubenssystemen gelten menstruierende Frauen als unrein. Mary Douglas, britische Kulturanthropologin, stellte Mitte der 1960er-Jahre in ihrem Buch «Reinheit und Gefährdung» folgende These auf: Viele Glaubenssysteme nehmen das Menstruationsblut als Überschreitung war und somit als Bedrohung der Ordnung, denn «Schmutz verstösst gegen Ordnung», er ist Materie am falschen Ort. Diese «Unordnung» gilt es zu beseitigen mit einer Reihe von Konsequenzen, die je nach Religion unterschiedlich formuliert sein können, sich aber im Kern ähneln: Ausgrenzung der menstruierenden Frau von ihrem sozialen Umfeld, Distanz zum Partner und in alltäglichen Handlungen, zudem vom jeweiligen Heiligen.
Menstruation als Unreinheit
Im Alten Testament spielen in seinen normativen Texten «Reinheit» und «Unreinheit» eine zentrale Rolle, das Buch Levitikus erklärt im 15. Kapitel die aus der Menstruation entstehende Unreinheit und ihren Geltungsbereich und laut Levitikus 15,24 gilt auch ein Mann, der mit einer menstruierenden Frau Sex hatte, ebenfalls sieben Tage als (rituell) unrein. Zur Wiederherstellung der «Reinheit» lesen wir in Levitikus 15,30 folgendes: Zwei Tauben werden durch den Priester geopfert, um «für sie so vor dem HERRN wegen ihres verunreinigenden Ausflusses Versöhnung (zu) erwirken».
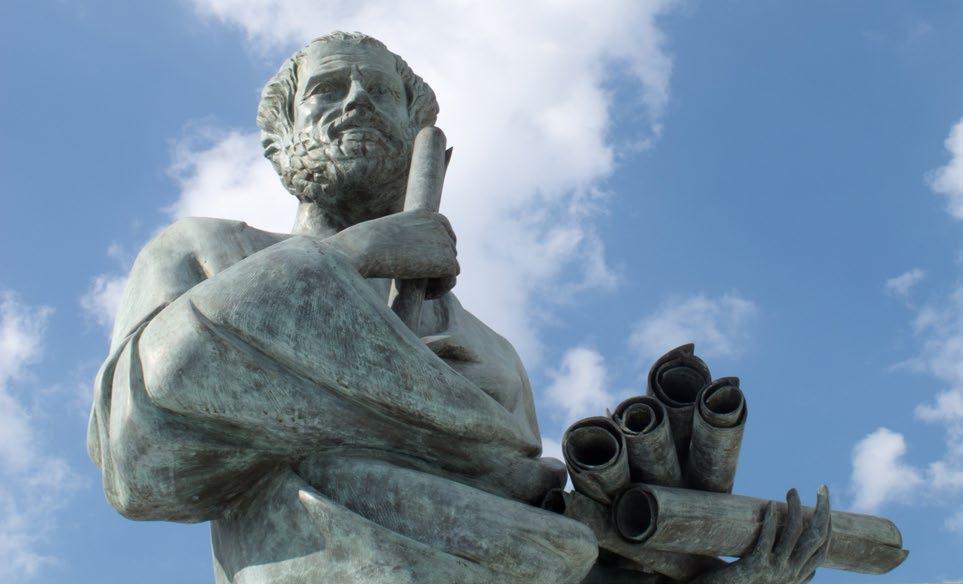
Religionsführer sind häufig männlich. Ob es auch daran liegt, dass menstruierende Frauen in vielen Religionen als unrein gelten?
Der griechische Philosoph und Wissenschaftler Aristoteles (384 v. Chr.–322 v. Chr) sah in der Menstruation den Beweis für die weibliche Minderwertigkeit und der Römer Plinius der Ältere (ca. 23 n. Chr–79 n. Chr) beschrieb, dass in der Nähe menstruierender Frauen der Wein verderbe, Bienen stürben und Saatgut unfruchtbar würde. Der Schweizer Theologe und Philosoph Paracelsus (1493–1541) setzte noch einen drauf, indem er die Menstruationsblutung zur Bedrohung der Menschheit stilisierte.
Das Christentum erlang seine Identität durch Abgrenzung vom Judentum auch durch bewusste Übertretung jüdischer Reinheitsvorschriften. Es findet sich keine offizielle Lehre des Menstruationstabus. Beim Evangelisten Markus lesen wir von folgender Begegnung: Eine Frau, die «den Blutfluss seit 12 Jahren hat und somit als unrein und als Unberührbare gilt, berührt das Gewand Jesus, das eines Juden. Sie begeht damit – nach jüdischer Reinheitsauffassung – eine Gesetzesüberschreitung. Jesus lässt sie gewähren und entlässt die menstruierende Frau mit den Worten, «meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage!», Markus 5,25–34.

In ärmeren Ländern haben nicht alle Mädchen und Frauen Zugang zu Monats-Hygieneprodukten.
Christentum:
Unreinheit verliert an Bedeutung
Das Christentum verortet die Kategorien «rein» und «unrein» theologisch in das Innere des Menschen. Die körperliche Reinheit verliert ihre zentrale Bedeutung, allerdings auch im Sinne der Hygieneverweigerung. Die alttestamentarischen Menstruationsvorschriften gelten im Christentum nicht mehr. Soweit die Theorie, denn die Praxis sieht anders aus: Auch menstruierende Christinnen gelten in einigen Regionen der Welt als unrein und folglich wird auch ihnen während ihrer Periode der Kontakt mit dem Heiligen in ihrem Religionssystem verwehrt.
Der Islam, die jüngste der drei grossen monotheistischen Weltreligionen, unterscheidet ebenfalls strikt zwischen dem Zustand der Reinheit und der Unreinheit. Dazu Sure 2:222: Und sie werden dich über die Menstruation befragen. Sprich: «Sie ist ein Leiden». Enthaltet euch daher eurer Frauen während der Menstruation und naht ihnen erst wieder, wenn sie sich gereinigt haben. Sind sie jedoch rein, dann verkehrt mit ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Siehe, Allah liebt die Bekehrenden und liebt die sich Reinigenden. Je nach Auslegung, gilt das Verbot für menstruierende Frauen zu beten und zu fasten, die Berührung des Koran sowie das Betreten einer Moschee.
Auch im Hinduismus und Buddhismus herrscht die Vorstellung Menstruationsblut sei verunreinigend. In Nepal müssen Mädchen und Frauen die Zeit ihrer Tage abgesondert von der Gemeinschaft in einer sogenannten «Menstruationshütte» verbringen. Viele haben Angst vor der monatlichen Isolierung, die einige Gefahren mit sich bringt, wie etwa eisige winterliche Kälte, Verletzungen durch wilde Tiere und Bedrohung durch übergriffige Männer. In Indien hat das Mens-
truations-Stigma mitunter verheerende BildungsNachteile für Mädchen, denn in vielen staatlichen Schulen fehlen Toiletten. Schätzungsweise jedes vierte indische Mädchen verpasst während seiner Periode den Unterricht.
Berichten der Weltgesundheitsbehörde, der WHO, zufolge, haben vielerorts mittellose Mädchen und Frauen keinen Zugang zu Monats-Hygieneprodukten und prostituieren sich für Binden und Tampons. Laut WHO und der Hilfsorganisation CARE steigt die Zahl stetig. CARE versucht diesem alarmierenden Trend durch mehr Bewusstsein für die hygienische Notlage der Frauen entgegenzuwirken.
Menstruationsblut in zentraler Rolle In einigen tantrischen Praktiken und indigenen Kulturen hingegen spielt Menstruationsblut in religiösen Zeremonien eine zentrale Rolle. Die Anthropolog*innen Thomas Buckley und Alma Gottlieb deuten die Verwendung von Menstruationsblut als Akt extremer Transgression von Reinheitsvorstellungen und Reinheitsgeboten, deren bewusste und gewollte Überschreitung als heroischer Akt hochstilisiert werde aber keineswegs die Trennung von rein und unrein aufhebe.
«Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse.» Dieser Werbesatz sollte einst das Tabu aufbrechen, ist aber prototypisch für das, was Werbung für Menstruationsprodukte ausmacht: Das Tabu der Menstruation wird reproduziert und verstärkt. «In Würde bluten» fordern Frauen weltweit am 28. Mai, dem Internationalen Tag der Menstruation. Die monatliche Blutung ist der natürlichste Vorgang der Welt, höchste Zeit für einen natürlichen gesellschaftlichen Umgang mit ihr.

«Menstruationsblut ist nicht kontrollierbar»
Interview: Gundula Maria Tegtmeyer
Fast alle grossen Religionen betrachten die Menstruation als etwas Unreines, ja, gar Bedrohliches. Professorin Dr. Theresia Heimerl, römisch-katholische Theologin vom Institut für Religionswissenschaft, Graz, sagt, wie es dazu gekommen ist.
«natürlich»: Frau Professorin Heimerl, einer Ihrer theologischen Forschungsschwerpunkte ist «Körper – Geschlecht – Religion». Bitte erläutern Sie unseren Lesenden die Kategorisierung von Menstruationsblut als unreine Ausscheidung.
Theresia Heimerl: Blut generell hat in vielen Religionen einen ganz besonderen Status. Es spielt für Opfer ebenso eine Rolle wie für magische Praktiken, der Kontakt von Blut mit «dem Heiligen», also sprich wann und wie Blut in die Sphäre der Transzendenz, konkret in Tempel, Opferstätten usw. gelangen darf, ist strengen Regeln unterworfen. Menstruationsblut ist ein besonderer Fall innerhalb dieser komplexen Rolle von Blut: Es ist nicht kontrollierbar, wie etwa bewusst herbeigeführte Verletzungen bei religiösen Praktiken. Es ist einem Geschlecht vorbehalten und konstituiert so die Geschlechterbinarität wesentlich mit. Es fällt «örtlich» im Körper mit den anderen Ausscheidungen zusammen und gehört dadurch zum Bereich des «Verborgenen» und «Unreinen».
Finden wir die Kategorisierung in rein und unrein auch heute noch im Christentum?
Das Christentum positioniert sich in seinen Anfängen bewusst gegen das traditionelle jüdische Reinheitsverständnis. Allerdings finden wir bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sowohl im katholischen als auch orthodoxen Christentum als eine der Begründungen für den Ausschluss für die Weihe von Frauen, dass diese während der Menstruation das Allerheiligste beflecken
würden. Auch sind in Osttirol oder der Schweiz bis vor wenigen Jahrzehnten sogenannte «Aussegnungen» von Frauen 40 Tage nach der Geburt überliefert, bis dahin durften sie aufgrund der nachgeburtlichen Blutung keine Kirche betreten.
Menstruierende Frauen werden in vielen Glaubenssystemen und Gesellschaften als Überschreitung, gar als Bedrohung der Ordnung wahrgenommen. Warum ist das so?
Alle grossen Religionssysteme sind in patriarchal geprägten Gesellschaften entstanden. Die Ordnungskategorie «rein – unrein» ist aus männlicher Perspektive konzipiert und trug zum Ausschluss von Frauen aus verschiedenen Bereichen der Öffentlichkeit bei. Ob Frauen an dieser Kategorisierung aktiv beteiligt waren, lässt sich religionshistorisch nicht mehr rekonstruieren. Wenn heute von manchen Vertreterinnen eines spirituellen Feminismus Absonderungsriten rund um die Menstruation bei indigenen Kulturen als Form einer speziellen weiblichen Religiosität oder geheimen Machtstruktur propagiert werden, so ist dies eine sehr junge Entwicklung und postmoderne Umdeutung.
Beobachten Sie das Aufbrechen des Tabus Menstruationsblut?
Aktionen wie die «Erdbeerwoche» oder die Forderung, Menstruationsartikel gratis zur Verfügung zu stellen oder Menstruationsbeschwerden auch arbeitsrechtlich als Krankheit anzuerkennen, zeigen deutlich, dass das Thema in der Gesellschaft immer mehr enttabuisiert wird. Allerdings gibt es dazu seitens der katholischen und protestantischen Kirche keine Stellungnahmen, dem Thema «rein – unrein» wird kaum mehr Bedeutung beigemessen. Die gegenwärtigen Diskurse über Menstruation sind rein säkular.


Herkömmliche Periodenprodukte sorgen nicht nur für riesige Müllberge, sie sind oft auch schädlich für die Gesundheit. Doch in den letzten Jahren haben nachhaltige Alternativen an Beliebtheit und Bekanntheit gewonnen.
Blanca Bürgisser
Eine menstruierende Person hat während rund 35 Jahren ihres Lebens ihre Periode, was sich auf über 400 Zyklen beläuft. Wer reguläre Einwegprodukte wie Binden oder Tampons verwendet, benutzt somit 10 000 bis 15 000 Hygieneartikel. Jährlich werden so weltweit um die 45 Milliarden Tampons und Binden verbraucht. Dies ist problematisch, da viele dieser Produkte aus synthetischen Materialien bestehen und weder biologisch abbaubar noch recyclebar sind. Und wenn sie erstmal in der Umwelt landen – was leider viel zu oft der Fall ist –, brauchen diese Produkte Hunderte von Jahren, bis sie sich zersetzen.
Eine weitere Problematik besteht darin, dass viele der herkömmlichen Periodenprodukte Schadstoffe enthalten. Dies ist besonders schlimm, wenn man bedenkt, dass die vaginale Schleimhaut eine der empfindlichsten und aufnahmefähigsten Körperstellen ist und Schadstoffe darüber rasch ins Blut gelangen. Dazu gehören Rückstände von Pestiziden, Bleichmitteln und Weichmachern, die für die Verarbeitung von Baumwolle und Zellulose genutzt werden. Aber auch Duftstoffe und Mikroplastik sind in vielen Binden enthalten. Trotz dieser Tatsache sind Firmen nicht verpflichtet, die Inhaltsstoffe auf der Packung aufzulisten. Neben gesundheitlichen und ökologischen
Vorteilen sind viele nachhaltige Periodenprodukte auch besser für das Portemonnaie. Studien gehen davon aus, dass Menstruierende in ihrem Leben zwischen 2000 und 6000 Franken für Einwegperiodenprodukte ausgeben. Glücklicherweise gibt es zahlreiche nachhaltige Alternativen, die den Müllberg senken und zudem besser für Umwelt und Gesundheit sind. Anbei stellen wir Ihnen sieben Alternativen vor, die Ihnen helfen, die Periode nachhaltiger zu gestalten.
Die Menstruationstasse
Die Tasse aus medizinischem Silikon, die wie ein Tampon eingeführt wird, hat zahlreiche Vorteile. Sie kann bis zu 35 Milliliter Blut auffangen und acht Stunden am Stück getragen werden. Nach dem Einsetzen bildet sich ein Vakuum, wodurch im Normalfall kein Blut ausläuft und unangenehme Gerüche verhindert werden. Die Tasse kann nach dem Leeren mit Wasser ausgespült und gleich wieder eingesetzt werden. Nach jedem Zyklus sollte die Tasse abgekocht werden, wodurch sie bis zu zehn Jahren haltbar ist. Anders als beim Tampon werden die Schleimhäute weniger ausgetrocknet. Das Einsetzen kann zu Beginn etwas herausfordernd sein, ebenso wie das eigene Blut zu sehen. Beim Kauf sollte auf hochwertiges Material geachtet werden, doch auch solche Exemplare gibt es bereits ab 30 Franken.
Stoffbinden
Bis zur Erfindung und Vermarktung der modernen Wegwerfbinden waren Stoffbinden das wohl am meisten verwendete Periodenprodukt in der westlichen Welt (siehe Kasten). In ihrer Form unterscheiden sie sich kaum von den gängigen Binden. Dank natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Hanf sind sie sehr langlebig und besser für die empfindliche Vulvahaut.
Weil sie mit Druckknöpfen an der Unterhose angebracht werden, haben sie keine Klebefolie mit potenziellen Schadstoffen. Sie sind atmungsaktiver, wodurch man weniger schwitzt und das Risiko für eine Pilzinfektion sinkt. Anders als bei der Menstruationstasse muss man sich jedoch gleich einige Exemplare kaufen, wodurch die Kosten höher sind. Wer möchte, kann sie sich auch selbst nähen. Das Wechseln unterwegs kann eine Herausforderung darstellen. Es empfiehlt sich, dafür einen beschichteten und gut verschliessbaren Beutel dabeizuhaben.
Stofftampons
Stofftampons bestehen aus einem rechteckigen Stoffstück, das aufgerollt und mit einer Baumwollschnur zusammengebunden wird. Sie sind einfach selbst herzustellen und können alles, was ein regulärer Tampon kann. Sie sind jedoch schwieriger einzuführen und können die Schleimhaut austrocknen. Um Infektionen zu vermeiden, müssen sie zudem öfters gewechselt werden. Wie bei der Stoffbinde spült man den Stofftampon nach der Entnahme kalt aus und wäscht ihn dann bei mindestens 60 Grad.
Die Schwämmchen werden wie ein Tampon verwendet. Man muss sie vor dem Einführen nur kurz befeuchten und auswringen. Sie können gut mit den Fingern entfernt werden. Da Schwämme essenziell für die Meeresfauna sind, sollte man sie nur von Firmen kaufen, die den Artenschutz berücksichtigen.
Schwämme sind Lebewesen, ihre Verwendung ist also nicht vegan. Trotzdem haben sie einige Vorteile: Sie passen sich an den Körper an und sind komfortabel zu tragen. Ihre Grösse lässt sich zuschneiden, und sie können auch während des Sex getragen werden. Sie trocknen die Schleimhäute nicht aus und sind leicht zu reinigen. Man muss sie nur mit kaltem Wasser ausspülen und kann sie wieder einsetzen. Zwischendurch kann das Schwämmchen zur gründlichen Reinigung über Nacht in Essigwasser eingelegt werden.
Freebleeding
Beim Freebleeding verzichten Menstruierende auf Periodenprodukte. Mit der Beckenbodenmuskulatur kontrolliert man die Blutung, sodass man nur blutet, wenn man auf der Toilette ist, oder man sucht die Toilette auf, sobald sich ein Blutschwall ankündigt.
Da man dabei komplett auf Periodenprodukte verzichtet, spart man Geld und erzeugt keinen Abfall. Freebleeding kann jedoch einschränkend sein: Man ist stets auf den Zugang zu einer Toilette angewiesen und muss auch in der Nacht öfters aufs WC.
Stoffbinden haben Druckknöpfe, mit denen sie an der Unterhose festgemacht werden können.

Einwegprodukte aus Biobaumwolle
In manchen Situationen sind herkömmliche Binden und Tampons am praktischsten. Biobaumwollprodukte sind auch eine gute Zwischenlösung für alle, die langsam auf nachhaltige Periodenprodukte umstellen möchten. Der Verzicht auf Pestizide schützt nicht nur die Umwelt und die Menschen in den Produktionsländern, sondern ist auch besser für die eigene Gesundheit, da keine Schadstoffe in den Körper gelangen. Durch ihre Plastikfreiheit sind sie zwar zersetzbar, es handelt sich jedoch immer noch um ein Einwegprodukt. Zusätzlich hat der Baumwollanbau einen hohen Wasserverbrauch, und die Weiterverarbeitung benötigt viel Energie.
Periodenunterwäsche
Auf den ersten Blick hat Periodenunterwäsche viele Vorteile. Sie kann wie normale Unterwäsche getragen werden. Sie absorbiert so viel Blut wie bis zu drei Tampons, ohne sich feucht anzufühlen. Viele Modelle enthalten jedoch Mikroplastik, der beim Waschen ins Wasser gelangt. Während die antibakterielle Schicht unangenehme Gerüche verhindert, wirkt diese meist nur wenige Jahre und enthält oft bedenkliche Biozide, die unter Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein. Biozide werden eingesetzt zum Abtöten von Bakterien und Pilzen. Denn wenn unser Blut über längere Zeit in der Menstruationsunterhose eingeschlossen ist, bilden sich in der Feuchtigkeit Bakterien und Mikroorganismen. Um diese abzutöten, müsste man die Periodenunterwäsche bei 70 bis 80 Grad waschen, was aufgrund der darin enthaltenen Materialien nicht möglich ist.

Die Vielfalt an Periodenprodukten ist gross.
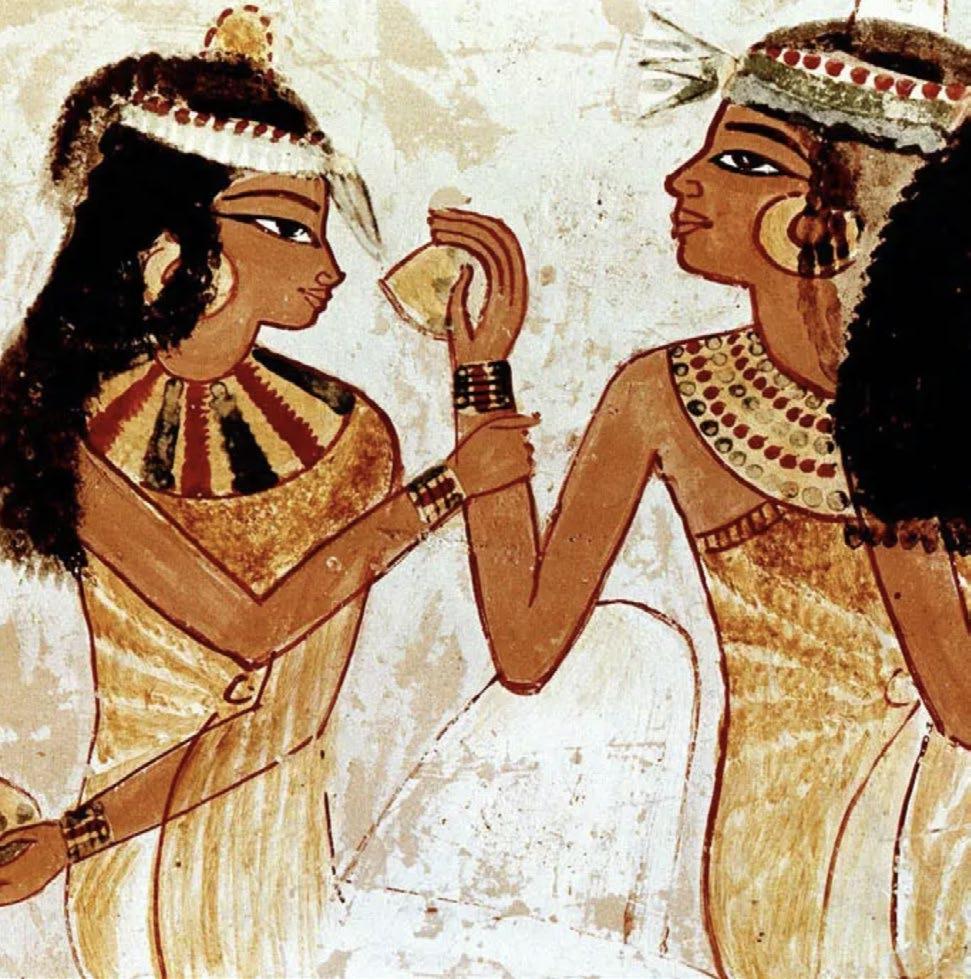
Die Auswahl an Menstruationshygieneartikeln ist erst seit Kurzem so umfassend. Industriell hergestellt werden sie erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Namentlich die industriell hergestellten Einwegprodukte gibt es erst seit wenigen Jahrzehnten auf dem Markt. Doch schon viel früher gab es erste Periodenprodukte. Im alten China hatten sie eine vergleichsweise breite Auswahl. Frauen fertigten Binden per Hand an und fixierten sie mit Bändern am Gürtel. Diese waren mit Strohpapier, Baumwolle oder Altkleidern gefüllt. Je nach Material waren sie waschbar oder Einwegartikel. Die Frauen des Alten Ägyptens halfen sich mit Holzstäbchen, die sie mit Papyrus umwickelten. Vermutlich trugen sie während ihrer Menstruation ausserdem spezielle Unterwäsche, die sie anschliessend wuschen. Dort hineingestecktes Gras und Papyrus diente zum Aufsaugen des Blutes.
Im europäischen Mittelalter galt die verbreitete Meinung, Menstruationsblut solle ungehindert abfliessen. Teilweise war es Frauen sogar verboten, Unterwäsche zu tragen oder ihre Periode anderweitig aufzufangen. Die durchschnittliche Frau war zu dieser Zeit sehr häufig schwanger oder stillte. Daher bekamen viele Frauen im gebärfähigen Alter nicht so oft ihre Menstruation. Später, zu Beginn der Neuzeit, halfen Frauen sich mit Binden aus Leinen, Altkleidern oder Wolle. In Amerika war in Mulltuch eingeschlagene Baumwolle üblich. Die ersten industriell hergestellten Artikel für die Monatshygiene kamen Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt. Sie bestanden aus Holzwolle, Torfmoos und später auch aus Frottierstoff oder Watte. In Deutschland entwickelten im Jahre 1926 die Vereinigten Papierwerke Nürnberg, die später auch Tempo-Taschentücher vermarkteten, eine Zellstoffbinde im Netzschlauch für den Einmalgebrauch; das Produkt trug den Namen «Camelia». Heute enthalten Damenbinden Zellstoff, Baumwolle und/oder Kunststoff. Sie sind ausserdem mit einer Klebeseite versehen, damit die Binde nicht verrutscht. ska


Das Geheimnis sei sofort verraten: Dem hohen Beta-Carotin-Gehalt der Goldhirse ist es zu verdanken, dass diese Bratlinge so sonnig-knusprig sind. So wie sie aussehen, so schmecken sie. Fabelhaft! Kein Wunder, sind die glutenfreien Körnchen ihr Gold wert –bei all den gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen, die sie zu bieten haben.
Zutaten
für 4 Personen
250 g Biofarm Goldhirse
1 EL Biofarm Olivenöl
6 dl Bouillon
150 g Rüebli
100 g Greyerzer gerieben
150 g Vollmilch Quark
2 Eier
100 g Biofarm Hirseflocken
1 Knoblauchzehe
50 g Frischer Schnittlauch
Nach Bedarf Salz und Pfeffer
Nach Bedarf Basilikum, Majoran, Paprika, Pfeffer, Chili
Nach Bedarf Biofarm Weissmehl
Zum Anbraten Biofarm Sonnenblumen-Bratöl
Hirsenbratlinge
1. Die Goldhirse unter fliessendem Wasser abspülen und abtropfen lassen.
Die Hirse in einer Pfanne mit Olivenöl bei schwacher Hitze kurz anrösten. Mit der Bouillon ablöschen, aufkochen und bei schwacher Hitze 5 bis 8 Minuten weichkochen. Die Pfanne von der Platte nehmen, die Hirse etwa 10 Minuten quellen und anschliessend auskühlen lassen.
2. In der Zwischenzeit die Rüebli fein raffeln und mit Käse, Quark, Eiern, Hirseflocken und Schnittlauch in eine Schüssel geben. Den Knoblauch dazu pressen. Die Goldhirse mit den andren Zutaten mischen und mit Salz, Pfeffer und weiteren Gewürzen abschmecken.
3. Aus der fertigen Masse Bratlinge formen. Sollte die Masse zu feucht sein, etwas Mehl dazugeben, bis eine schöne kompakte Masse entsteht. Die Bratlinge in eine Bratpfanne mit Öl geben und auf beiden Seiten gold-braun anbraten.

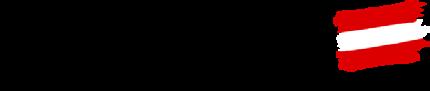
Süsse Hauptspeise oder zum Dessert: Topfenknödel sind immer eine gute Wahl. Typisch österreichisch, saftig und locker. Topfen ist übrigens das österreichische Wort für Quark und verleiht dem Knödel seine Luftigkeit und Frische. Die Zubereitung geht blitzschnell und macht damit auch spontane Gäste satt und glücklich.
Für die Topfenknödel:
500 g Topfen
2 Eier, Gr. M
8 EL Dinkel Griess
4 EL Dinkel-Semmelbrösel
Prise Salz
1 Pkg. Vanillezucker (optional)
Für die Butterbrösel:
50 g Butter
150 g Dinkel-Semmelbrösel
Für das Apfelmus:
3 – 4 süss-saure Äpfel
50 ml Wasser
Spritzer Zitronensaft
Prise Zimt
Opfenknödel mit Apfelmus
1. Für die Dinkel Topfenknödel alle Zutaten rasch miteinander verrühren und für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen.
2. Äpfel schälen, in kleine Stücke schneiden und in einen kleinen Topf geben. Mit Wasser aufgiessen, Zitronensaft sowie Zimt zugeben und auf kleiner Flamme köcheln lassen bis die Äpfel zerfallen. Alternativ können die weichgedünsteten Äpfel auch mit einem Mixstab fein püriert werden.
3. Einen Topf mit reichlich Wasser aufsetzen und zum Sieden bringen. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und mit feuchten Händen oder einem Eisportionierer Knödel formen.
4. Die Knödel ins siedende Wasser legen und für ca. 10–12 Minuten ziehen – nicht kochen lassen. Je nach Größe der Knödel kann sich die Garzeit etwas verkürzen oder verlängern.
5. In der Zwischenzeit die Butter schmelzen und die Dinkel-Brösel darin goldbraun rösten.
6 Knödel aus dem Wasser nehmen, in den Bröseln schwenken und mit Apfelmus servieren.

Ist unsere monatliche Blutung ein Defizit oder ein Geschenk der Natur? Ich stelle fest, dass die Periode in der Öffentlichkeit immer als Problemfall betrachtet wird. Wir lesen von prämenstruellen Beschwerden, Endometriose, Myome bis hin zu Wechseljahrbeschwerden. Die Thematisierung ist oft auch berechtigt. Die meisten Frauen fühlen sich in diesen Tagen sensibler und dünnhäutiger als sonst. Haben Schmerzen, sind müde und unkonzentriert – und müssen trotzdem so tun, als wäre alles wie immer in bester Ordnung. Nicht wenige Frauen gehen Monat für Monat durch die Hölle und schlucken während zwei Tagen Schmerzmittel, um einigermassen über die Runden zu kommen. Aber Hand aufs Herz. Ist es das, was die Schöpfung für uns Frauen vorgesehen hat?
Einen Körper, der sich rund vierzig Jahre lang monatlich auf die Möglichkeit einstellt, Kinder zu gebären und uns schmerzhaft in Erinnerung ruft, dass wir mit durchschnittlich zwei Kindsgeburten pro Frauenleben den Daseinszweck mehrheitlich nicht erfüllen? Was, wenn wir die Geschichte umdrehen? Wenn wir mit Hilfe unseres Zyklus unseren Körper, unsere Spiritualität, unsere tiefe Kreativität, unsere Weiblichkeit und unsere Kraft besser kennenlernen. Hören wir doch auf, unsere ureigenste Weiblichkeit als ein störendes Defizit zu betrachten, nur weil wir in einem, mehrheitlich von männlichem Gedankengut geprägten Umfeld mithalten wollen, müssen oder meinen zu müssen. Durch das Nichtannehmen von dem, was ist, erhöhen wir die Beschwerden, welche die Menstruation begleiten können. Und umgekehrt. Je tiefer wir uns auf den natürlichen Prozess der Blutung einlassen können, desto entspannter kann sich die Mischung aus Blut, Wasser und Schleimhaut von der Gebärmutter lösen und ausgestossen werden. So zumindest berichten viele Frauen, die sich von PMS und Erschöpfung befreit haben, indem sie einen achtsameren Umgang mit sich und ihrem Zyklus gefunden hatten.
Liebe Frauen, unser Zyklus ist unsere Natur, unser Nährboden und unser Taktgeber. Nicht ich – mein Ego – gebe den Rhythmus vor, sondern die Natur meines Körpers, die verbunden ist mit der Zeitrechnung des Mondes. Wir dürfen mit Hilfe von unserem Zyklus lernen, dass wir einem Zeitgeschehen unterstellt sind, das wir nicht kontrollieren oder beherrschen können. Wir können uns diesem Rhythmus lediglich hingeben, genauso wie wir uns beim Tanzen der Musik hingeben und uns von ihr durch den Raum tragen lassen. Betrachten Sie sich als fliessendes Gleichgewicht. Wie das Meer bei Ebbe und Flut zieht sich Ihre Energie in der Zeit der Mensturation zurück in Ihr Innerstes. In der Zeit gegen den Eisprung hin, überfluten Sie Ihr Umfeld mit Ihrer Energie. Die Energie wird, genauso wie das Meerwasser, nicht weniger – sie zieht sich nur zurück, um später umso kraftvoller zurückzukommen.
Eine Möglichkeit, die Natur des Menstruationszyklus wieder ins Bewusstsein zu rufen, und mehr in Fluss zu kommen, ist die Auseinandersetzung mit dem Mond und die Symbolik der Jahreszeiten, welche die verschiedenen Phasen des Zyklus repräsentieren. Mit dem ersten Tag der Blutung beginnt der innere Winter (ca. Tag 27 bis 5). Danach bewegt sich der Körper mit einer Aufbruchstimmung in den Frühling (ca. Tag 6 bis 11), erreicht im Sommer (ca. Tag 12 bis 19) in der Zeit des Eisprungs seinen energetischen Höhepunkt und zieht seine Energie dann langsam mit der Herbstphase (ca. Tag 20 bis 26) zurück, bis mit dem Einsetzen der nächsten Blutung erneut der Winter Einzug erhält. Frauen die nicht, oder nicht mehr bluten nehmen den Mond als Orientierungshilfe. Mit dem Neumond beginnt der Winter, im Vollmond ist die Spitze der Energie und dazwischen baut sich die Energie entweder auf, zum Vollmond hin, oder ab, zum Leermond hin. Frühling und Sommer stehen für Offenheit. Wir sind nach aussen orientiert, voller Energie, voller Kraft, gesellig und sprühend. Im Herbst beginnt sich das Licht im Aussen zu dimmen. Es
geht darum, dass wir nun langsam bei uns selbst ankommen, vermehrt nein sagen und im Winter, beim Einsetzen der Blutung dann die Qualität des inneren Raumes geniessen. Überlegen Sie sich mal, wo sie gerade stehen in Ihrem Zyklus oder im Mond. Überlegen Sie sich auch, wie Sie sich fühlen und worauf sie, jetzt am meisten Lust hätten. Raus ins Geschehen oder rein in die warme Höhle?
Die Zeit des inneren Winters ist eine magische Zeit. Es geht um Rückzug, Neinsagen zur Welt, Loslassen, Ruhe und Stille. Die Lichter der Aussenwelt gehen aus, dafür wird das innere Licht umso stärker. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie sie sich in ihrer momentanen Lebenssituation rausnehmen können. Für die eine Frau ist das ein freier Tag, für die andere sind es fünf Minuten bewusste Ruhe. Je regelmässiger Ihr Zyklus ist, je besser lässt sich ihr Leben um den Zyklus planen. Ich bitte Sie, lassen Sie sich nicht mehr von ihren Schmerzen zur Ruhe zwingen, sondern planen Sie die Zeit für sich selbst bereits jetzt, proaktiv, in ihrem Kalender ein. Führen Sie ein einfaches Zyklustagebuch, in das Sie ab dem ersten Tag der Menstruation schreiben, wie sie sich fühlen und was Ihnen jetzt guttut. Nach ein paar Monaten erkennen Sie ein Muster, das Ihnen Einblick gibt in Ihr Energielevel. Das eine Prozent mehr Ruhe, das Sie sich in der Zeit des inneren Winters schenken, werden Sie in der Zeit des Frühlings wieder zur Verfügung haben.
Während der Menstruation sind wir empfänglicher für spirituelle Aspekte im Leben. Empfangen Visionen und kreieren Ideen, lassen gehen, was nicht mehr wichtig ist und finden einfacher einen Zugang zur inneren Tiefe. Diese Tiefe ist wichtig. Aus ihr schöpfen wir Frauen Kraft. Es braucht Mut, dort hinunterzusteigen. Die Welt will uns strahlend, lachend und nickend. Doch auch die Melancholie, die Vergänglichkeit und das Abtauchen brauchen Platz in unserem weiblichen Lebensrhythmus. Und nicht vergessen: Die Zeit der inneren Einkehr ist auf einige Tage begrenzt. Am Tag 5 kommt erneut der Frühling. Sie reissen sich aus der Höhle, hüpfen über das Feld und vergnügen sich. Im Sommer setzen Sie voller Energie alle Projekte mit Links um, im Herbst beginnen Sie sich langsam vom Aussen zu verabschieden und dürfen sich bereits freuen, dass um die Zeit des inneren Winters ein paar ruhige Tage anstehen, die Ihnen erlauben, einfach mal nichts zu machen.
Männliche Energie hat etwas Strukturiertes. Da wird gut eingeteilt und kontinuierlich einen Schritt vor den anderen gesetzt. Weibliche Energie ist Bewegung. Das sind energetische Wellenberge und Wellentäler. Ich wünsche mir so sehr, dass immer mehr Frauen in diese Kraft kommen und zu ihrer bewegten Weiblichkeit stehen. Die Welt muss lernen, damit umzugehen – und das wird sie auch. Und wir Frauen müssen lernen, auch unser eigenwilliges, borstiges, zutiefst weibliches Herbst-Winter-Gesicht anzunehmen, das vermeintlich weniger attraktiv und verführerisch ist als unsere, von der Gesellschaft als weiblich empfundene Frühling-Sommer-Seite.
Der Text ist inspiriert vom Buch: «Wild Power – discover the magic of your menstrual cycle and awaken the feminine path to power» von Alexandra Pope und Sjanie Hugo Wurlitzer.

Sabine Hurni arbeitet als Naturheilpraktikerin und Lebensberaterin in Baden, wo sie auch Ayurveda Kochkurse, Lu Jong- und Meditationskurse anbietet.
KNIESCHMERZEN
Ich leide seit 6 Monaten an einer Pseudogicht mit Kalziumpyrophosphatkristallen. Ein Teil davon wurde schon abgesogen und einmal wurde Cortison gespritzt. Ich habe Quarkwickel gemacht, gekühlt, Cartilago/Mandragora comp. und Bryona/Stanum injziert, Arnikaglobuli geschluckt und Arnikaöl eingerieben. Leider ohne Erfolg. Ich habe auch eine schwere Osteoporose, deshalb sind wir zurückhaltend mit Cortisonspritzen. Ich weiss nicht mehr wie weiter. Anscheinend weiss man die Ursache nicht, könnte es eine Stoffwechselstörung sein? Haben Sie einen guten Rat?
U. B., Zürich
Ich würde im Moment den Körper vorwiegend innerlich stärken und strikt auf alles verzichten, was die Entzündung vorantreibt und die Säure im Köper erhöht. Versuchen Sie in den nächsten Wochen das Gemüse zu Ihrer Nahrungsgrundlage zu machen. Verzichten Sie auf Schweinefleisch und Eier. Sie dürfen ab und zu, das heisst maximal zweimal die Woche, Fleisch essen, aber nur in Kombination mit viel Gemüse.
Beim Käse geben sie den Schaf- und Ziegen milchprodukten den Vorrang, weil diese Milch eher wärmend ist für den Körper und weniger häufig zu Stress führt im Immunsystem. Und sorgen Sie beim Getreide ebenfalls für Abwechslung. Essen Sie höchstens einmal täglich ein Weizen- oder Dinkelprodukt und weichen Sie vermehrt auf Reis und Hirse aus.

Auf diese Weise reduzieren Sie die stärksten Entzündungsförderer aus der Nahrung und sorgen Sie für ein ausgewogenes Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper. Das scheint mir im Moment sehr wichtig zu sein. Oder anders gesagt: Bis die Entzündung weg ist, würde ich Ihnen sehr ans Herz legen, sich an das sogenannte Schimpansenfutter ;-) zu halten:
Gemüse und Früchte als Nahrungsgrundlage. Essen Sie Gemüse mit Reis, Gemüse mit Käse, Gemüse mit Fisch (Lachs), Gemüse mit Nüssen/Kernen.
Hier noch ein paar Inputs zum Reinspüren, ob das etwas wäre für Sie: Sie können sich in der Drogerie auch eine Packung Basen-Badesalz kaufen und damit die Füsse baden und das Knie einreiben. Oder Vollbäder machen. Als Alternative ginge auch Heilerde. Es gibt zudem Basensalze, die man einnehmen kann, um das gesunde Gleichgewicht wieder herzustellen. Und kennen Sie MSM? Sie erhalten in Drogerien und Apotheken Kurkumapräparate, die mit MSM angereichert sind. Das MSM ist eine Schwefelverbindung, die stark entzündungshemmend wirkt. Ich wünsche Ihnen von Herzen gute Besserung!
Sie dürfen die beiden Produkte aufbrauchen. Die Salbe über Nacht anwenden, die Tropfen am Tag bei Bedarf. Wenn die Salbe mal offen ist, sollte man sie innert rund sechs Monaten aufbrauchen. Ansonsten müssen sie sich keine Sorgen machen wegen einer Überdosierung. Befeuchtende Augenpräparate werden Sie vermutlich in der Zukunft immer mehr oder weniger intensiv begleiten. Wenn Sie Ihre Produkte aufgebraucht haben, können Sie auch mal die Augentropfen von Wala probieren. Es ist, wie auch Weleda, ein anthroposophisches Präparat und enthält eine sehr interessante Wirkstoffkombination. Sie finden die Tropfen in Drogerien und Apotheken unter dem Namen: Wala Chelidonium/Terebinthina laricina comp.
VERSPANNUNGEN
Ich habe seit geraumer Zeit Schmerzen und Verspannungen im unteren Rücken/ Po/Hüfte/Leiste. Die Physiotherapie hat anfänglich geholfen, dann hat es stagniert und jetzt ist die Situation eher wieder schlechter. Wie kann ich – allenfalls durch entsprechende Ernährung – die Muskeln geschmeidiger machen?
D. R., Winterthur
Haben Sie in Ihrer Nähe die Möglichkeit, sich Ayurveda Massagen zu gönnen? Oder Shiatsu, Lomilomi, Esalem – etwas, das ihren ganzen Körper rundherum behandelt. Besonders die Ayurveda-Behandlungen mit warmem Öl sind Balsam für harte Muskeln und machen Sie tatsächlich geschmeidig. Allenfalls können Sie sich sogar mal eine oder zwei Wochen Ayurveda-WellnessFerien gönnen. Das tut ungemein gut, nicht zuletzt auch deshalb, weil man gehegt und gepflegt wird wie ein Baby. Was die Ernährung betrifft so gilt im Ayurveda zur Beruhigung der harten Muskeln: Warm, regelmässig, gekocht, süss im Geschmack. Das heisst, drei warme Mahlzeiten pro Tag, auch als Kleinstmahlzeit möglich als heisse Bouillon oder gedämpfter Apfel. Aber warm und gekocht muss es sein. Trinken Sie über den Morgen verteilt heisses Ingwerwasser, essen Sie Rohkost nur über Mittag und als Zwischenverpflegung, trinken Sie allgemein warmes Wasser und essen Sie am Abend eine Suppe. Sehr wohltunend ist auch die Selbstmassage: Ölen Sie sich selbst zweimal die Woche von Kopf bis Fuss mit warmem Sesamöl ein.
Achten Sie auch auf Ihre Haltung sich selbst gegenüber. Oft deuten Anspannungen im Gesässbereich auf eine unendlich hohe Messlatte hin, die man sich auferlegt. Das Gefühl, nicht zu genügen prägt den Alltag und führt dazu, dass man sich selbst an den Rand der Belastbarkeit puscht. Es können auch alte Erwartungshaltungen von Seiten der Eltern sein, denen man niemals entsprechen kann. Als Extrembeispiel: Es kommt ein Mädchen zur Welt, obwohl sich die Eltern einen Jungen gewünscht hätten. Solche Themen können zu massiven inneren Anspannungen führen, die sich oft im Gesässbereich zeigen. Versuchen Sie allgemein sehr liebevoll im Umgang mit sich selbst zu sein. Muten Sie sich nur Dinge zu, die sie auch von anderen erwarten. Und reden Sie innerlich nur so mit sich selbst, wie sie auch mit anderen Menschen sprechen. Es ist extrem, wie brutal hart wir Menschen im inneren Dialog mit uns selbst ins Gericht gehen.

Sie stinkt gehörig, doch die heilsame Wirkung einer Zwiebel über dem Kinderbett oder eines Zwiebelwickels bei Ohrenschmerzen ist unbestritten.
So hilft die Zwiebel: Zwiebeln enthalten stark riechende Schwefelverbindungen, Kalium, Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin C. Diese Wirkstoffe vermögen zähen Schleim zu lösen und Schmerzen zu stillen. Die Zwiebel kann deshalb bei Mittelohrenentzündungen helfen.
Anwendung: Es braucht eine Zwiebel, ein dünnes Baumwolltuch, ein Stück Rohwolle oder Watte und ein Stirnband oder eine Mütze zur Befestigung.
1. Die Mütze oder das Stirnband leicht vorwärmen,
2. In einer Pfanne etwas Wasser aufkochen.
3. Eine Zwiebel schälen und die äusserste, dickste Zwiebelhülle ablösen.
4. Die beiden Hälften auf das Tuch legen und auf dem Pfannendeckel wärmen.
5. Dem Kind kann schon mal die warme Mütze aufsetzen.
6. Wenn die Zwiebeln warm sind, im Tuch zerquetschen, damit der Saft austritt.
7. Ein Päckchen formen und dieses unter die Mütze auf das schmerzende Ohr schieben und mit Rohwolle abdecken.
Beachten Sie: Zwischen Zwiebel und Ohr sollte nur eine Lage Stoff sein. Zudem soll er das Ohr und den Bereich hinter dem Ohr bedecken. Zwei Stunden oder über Nacht einwirken lassen.
Soforthilfe bei Ohrenentzündungen:
• Zwiebelwickel sollten bei ersten Anzeichen einer Ohrenentzündung angewendet werden. Verbessert sich der Zustand des Kindes nach der Anwendung nicht, sollte der Kinderarzt aufgesucht werden.
• Auch ein Tropfen naturreines, ätherisches Lavendelöl kann helfen. Auf ein Stück Watte tröpfeln und ins Ohr schieben.
• Bei wiederkehrenden Ohrenschmerzen und Mittelohrenentzündungen könnte eine Kuhmilchallergie vorliegen.

Heute ist in der Medizin sehr vieles möglich und oft herrscht die Meinung vor, dass alles gemacht werden muss, was irgendwie möglich ist. Dabei wird verkannt, dass nicht alles, was möglich wäre, im konkreten Fall auch sinnvoll sein muss. In vielen Fällen ist sogar das Gegenteil der Fall. Es ist allgemein bekannt, dass sowohl unterlassene oder verspätete Leistungen als auch unnötige Mehrbehandlungen oder Fehlbehandlungen zu enormen Schäden führen. All dies kann grosse Probleme für Patient*innen darstellen, führt Fehlversorgung doch nicht selten zu Verunsicherung, Komplikationen oder sogar Folgeeingriffen.
In der Beratungspraxis begegnen uns Fälle aus allen Ausprägungen der schädlichen Versorgung, überwiegend jedoch aus dem Bereich der Fehlversorgung. Ungefähr die Hälfte aller Personen, welche sich an die SPO wenden, haben Fragen zu Behandlungen bzw. Behandlungsfehlern. Immer wieder zeigt sich: Es braucht ein Umdenken weg von der Standardisierung hin zur patientenorientierten Medizin. Das ständig wachsende medizinische Wissen muss der konkreten Situation dem einzelnen Patient*innen gegenübergestellt werden. Dazu muss ein bestimmter Prozess entwickelt werden, wonach das medizinische Fachwissen eingebracht, dann aber die Situation der Patient*innen ins Zentrum gerückt wird. Das heisst: Patient*innen müssen dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Und das geht nur, indem man sie fragt.
Susanne Gedamke, Geschäftsführerin SPO
Mehr zum Thema Patient*innenrecht:
Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch
Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min.
Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).
NÜSSE RÖSTEN ODER NICHT?
Immer wieder wird berichtet, man sollte Nüsse vor dem Verzehr rösten in der Pfanne oder im Backofen. Ist das unbedingt notwendig? Wir essen so viele Nüsse jeden Tag, dass ich unmöglich alle rösten kann.
E. S., Zürich
In unzähligen Blogs und Beratungsseiten heisst es, man müsse die Nüsse einweichen oder rösten. So werden sie bekömmlicher und die Nährstoffe seien besser verfügbar. Ich würde diese Aussage eher mit Vorsicht geniessen. Es stimmt, dass Nüsse, genauso wie Hülsenfrüchte und Getreide, Phytinsäure enthalten. Diese binden die Mineralstoffe und verhindern, dass diese von unserem Körper aufgenommen werden kann. Nun ist es aber so, dass der Phytingehalt in den Nüssen sehr variabel ist. Die einen Mandeln enthalten viel, die anderen wenig. Unter dem Strich heisst das, dass Sie vielleicht nicht ALLE Mineralstoffe aus der Mandel aufnehmen, aber immer noch genügend viele, auch wenn Sie die Mandeln weder rösten noch einweichen. Das Rösten macht die Nüsse und Mandeln knackiger und aromatischer. Und ja, sie werden dadurch auch bekömmlicher, weil sie aufgrund der Erhitzung die Verdauungsleistung unterstützen, auch wenn sie später kalt gegessen werden. Ein Lebensmittel, das einmal erhitzt war, hat eine andere thermische Qualität als ein rohes. Wenn jemand empfindlich auf Nüsse reagiert, kann das Rösten helfen. Walnüsse lösen roh bei vielen Leuten Aphten aus. Geröstet hingegen nicht.
Wenn Sie die Nüsse bisher gut vertragen haben, und davon gehe ich aus, wenn Sie derart viele davon essen, dann essen Sie diese auch in Zukunft roh. Für die vielen ungesättigten Fettsäuren ist das ohnehin viel besser. Wenn Sie trotzdem Lust haben, die Nüsse ab und zu zu rösten, dann einfach sehr schonend! Ich persönlich röste sie für 8 Minuten bei 180 Grad Umluft im Backofen. Meist, wenn ich ihn ohnehin grad brauche. Dann lasse ich die Mandeln abkühlen und fülle sie ins Einmachglas. Ich mag dieses Aroma und liebe auch das Knacken, wenn man sie verbeisst. Für den Salat röste ich die Kerne jeweils frisch in einer kleinen Pfanne. Ebenfalls so schonend wie möglich. Sie schmecken einfach besser.
Haben Sie Fragen?
Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und AyurvedaExpertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich: s.hurni@weberverlag.ch

Kann ein Mensch lieben und gleichzeitig Krieg führen? Die meisten Menschen scheinen davon auszugehen. Sonst gäbe es kaum so viele Kriege und gleichzeitig so viele Menschen, die von der Liebe träumen. Ich wette, dass auch ein General, der gerade einen Vergeltungsschlag befohlen hat, sich nach Zärtlichkeit sehnt. Dasselbe gilt für Söldner, Waffenhändler und sämtliche Rädchen im Kriegsgetriebe. Manche behaupten sogar, aus Liebe Krieg zu führen: Aus Liebe zur Heimat, zu Gott, ihrem Volk – oder ihren Eltern, Lehrern und anderen Autoritäten zu-«liebe». Ganz zu schweigen von den vielen Liebesbeziehungen, in denen Krieg herrscht: Krieg aus Eifersucht; Krieg darum, wer recht hat; Krieg um die Farbe des neuen Sofas usw. – es gibt nichts, um das Beziehungspartner nicht kämpfen könnten.
Gehören also Liebe und Krieg zusammen? Nein. Angesichts der Weltsituation sage ich aus vollem Herzen: Krieg ist das Gegenteil von Liebe. An alle, die vorgeben, trotz ihrer Liebe oder gar aus Liebe Krieg zu führen: Ihr irrt euch. Ihr nennt etwas Liebe, was keine Liebe ist. Wer liebt, findet immer eine andere Lösung als Kampf. Wer etwas wirklich liebt – sei es die Heimat, einen Gott, bestimmte Wertvorstellungen oder die eigenen Kinder – den macht diese Liebe weit und offen. So weit, dass auch die Heimat, der Gott, die Wertvorstellungen oder die Kinder des jeweils anderen darin Platz haben. So offen, dass wir uns in die anderen hineinversetzen können. Und dann fühlen wir: So innig, wie wir lieben, so innig lieben auch die die anderen. Bei allen Unterschieden: Unsere Liebe ist dieselbe. Und in Liebe wollen wir das Beste für den oder die Geliebten.
Geht ein liebender Mensch also allen Konflikten aus dem Weg? Nicht unbedingt. Konflikte sind noch kein Krieg. Konflikte in Liebe auszutragen, kann etwas Wunderbares sein. Es bedeutet, gemeinsam um die beste Lösung zu ringen. Dabei muss es nicht immer sanft
zugehen, es kann auch einmal laut und leidenschaftlich werden. Doch aufgepasst, es gibt einige Dinge, die wir beherzigen sollten. Mein Rat: Handeln wir nicht aus dem Affekt! Nehmen wir uns lieber Zeit, dem Gegenüber wirklich zuzuhören. Können wir probehalber seine Position einnehmen? Wie fühlt es sich an, «in ihren Mokassins zu gehen», wie die amerikanischen Ureinwohner sagen? Könnte an seiner Kritik etwas Wahres sein, selbst wenn sie weh tut? Können wir nachgeben? Oder wer oder was in uns will, unbedingt Recht behalten – ist das wirklich die Liebe?
Liebe können wir nicht aufteilen in Gut und Böse. Sie kommt aus dem Ganzen und meint immer das Ganze. Wir können auf Dauer nicht unseren kriegerischen und unseren sanften Teil voneinander trennen – sie werden einander durchdringen. Wenn wir uns für Krieg entscheiden, dann wird etwas in uns hart werden. Dann werden wir zu einem Kriegerin oder Krieger, die die Zärtlichkeit, nach der sie sich sehnen, nicht mehr annehmen können. Wenn wir uns aber für die Liebe entscheiden, dann wird sie unseren inneren Krieg überwinden. Stück für Stück. Durch Hingabe, Aussprechen, Nachgeben und Neuanfang. Das ist nicht immer einfach – schliesslich haben wir zeitlebens etwas anderes gelernt. Aber es lohnt sich. Denn in Beziehungen gilt dasselbe wie auf den Schlachtfeldern: Kriege kann man nicht gewinnen. Gewinnen kann nur, wer Frieden schafft.
Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin. Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen, lebte u. a. über 18 Jahre in Tamera, Portugal, sowie in anderen Gemeinschaften. Am meisten liebt sie das Thema Heilung von Liebe und Sexualität sowie neue Wege für das Mann- und Frau-Sein.

Fast jede zehnte Frau ist von Endometriose betroffen. PD Dr. Patrick Imesch ist Gynäkologe und Spezialist für dieses häufige Krankheitsbild, welches oft mit starken Schmerzen verbunden ist. Die Beschwerden können auch mit konservativen und naturheilkundlichen Ansätzen angegangen werden, erklärt er im Interview.
Interview: Samuel Krähenbühl
«natürlich»: Es gibt verschiedene Formen und Stärkegrade von Monatsbeschwerden. An was kann Frau erkennen, dass sie möglicherweise an Endometriose leidet?
Patrick Imesch: Die Wahrnehmung von Schmerzen ist individuell sehr unterschiedlich und lässt sich demnach nicht in eine allgemein gültige Formel verpacken. Suspekt ist sicherlich, wenn man regelmässig Schmerzmittel während den Menstruationen einnehmen muss und wenn die Menstruationen von der betroffenen Frau jeweils regelrecht ersorgt wird. Wenn zudem regelmässig Ausfälle in der Schule oder am Arbeitsplatz dazu kommen, ist eine weiterführende Abklärung sicherlich sinnvoll.
Was genau ist eigentlich Endometriose? Endometriose definiert sich durch das Vorhandensein von gebärmutterartiger Schleimhaut ausserhalb der Gebärmutter. Sehr häufig wachsen diese Schleimhautinseln im Bereich des Bauchfells, an den Eierstöcken. Manchmal wachsen diese Herde auch in benachbarte Organe und Strukturen ein, beispielsweise den Darm, die Blase und so weiter.
Was für Symptome kann Endometriose auslösen?
Die Symptome können sehr unterschiedlich sein, was mitunter auch die langen Latenzzeiten zwischen den Erstsymptomen und der Diagnosestellung erklären kann. Zu den typischen Symptomen gehören aber starke Menstruationsbeschwerden, chronische Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Wasserlösen und Stuhlgang, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Endometriose ist einerseits eine Schmerzerkrankung, sie kann aber andererseits aber auch eine Ursache für eine ungewollte Kinderlosigkeit sein.
Der
Diagnose geht oft eine lange Leidenszeit voraus.
Wie viele Frauen sind prozentual etwa von Endometriose betroffen?
Man geht davon aus, dass immerhin sechs bis zehn Prozent der Frauen in der reproduktiven Phase ihres Lebens von Endometriose betroffen sind. Für die Schweiz bedeutet das, dass derzeit mindestens 190 000 Frauen davon betroffen sind.
Gibt es einen Zusammenhang mit dem Alter?
Die Erkrankung manifestiert sich vor allem in der reproduktiven Phase des Lebens, das heisst in der Phase, in der die Frauen menstruieren. Die Diagnose erfolgt meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, wobei dann häufig schon eine mehrjährige Leidensgeschichte vorangegangen ist.
Inwiefern wirkt sich Endometriose auf die Empfängnis und Schwangerschaft aus?
Endometriose kann mit erschwerter Schwangerschaftsentstehung assoziiert sein, muss aber nicht, was ganz wichtig ist. In spezialisierten Kinderwunschsprechstunden sind Endometriosepatientinnen aber überdurchschnittlich häufig vertreten. Ungefähr 30 bis

Ein operativer Eingriff ist bei Endometriose nicht zwingend.
50 der Frauen mit Endometriose zeigen Veränderungen in der Fruchtbarkeit. Man darf allerdings festhalten, dass schlussendlich gleichwohl 60–70 % der betroffenen Frauen spontan schwanger werden können.
Gibt es auch Fälle von Endometriose, welche weitgehend symptomlos sind?
Das ist auch möglich. Es kommt gelegentlich vor, dass man zufälligerweise eine Endometriose entdeckt, beispielsweise im Rahmen einer anderen Operation. Bei einer asymptomatischen Endometriose ist keine Therapie notwendig, die Endometriose hat dann keinen Krankheitswert. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine milde, asymptomatische Endometriose später Probleme macht, wird insgesamt als klein angesehen.
In welchen Fällen empfiehlt sich eine Behandlung oder gar ein operativer Eingriff?
Eine Behandlung empfiehlt sich in allen symptomatischen Fällen. Endometriose ist eine chronische, entzündliche und hormonabhängige Erkrankung. Wegen dem chronischen Charakter braucht es einen langfristigen Plan, die Hormonabhängigkeit bietet eine therapeutische Option. Heutzutage wird in den meisten Fällen primär eine medikamentöse Therapie, beispielsweise mit Gelbkörperhormonen empfohlen. Eine Operation ist dann nötig, wenn die Schmerzen medikamentös nicht beherrschbar sind, wenn die Medikamente nicht toleriert werden, wenn Organe darunter leiden, beispielsweise eine Einengung des Darmtraktes oder der Harnleiter. Eine Operation wird zudem häufig auch bei unerfülltem Kinderwunsch geplant.
Wie wird bei einer Operation vorgegangen?
Ziel ist die vollständige Entfernung aller sichtbaren Endometrioseherde und die Wiederherstellung der Anatomie. Dies sind häufig sehr aufwendige und schwierige Operationen. Idealerweise werden solche Operationen deshalb durch Spezialist*innen durchgeführt, welche auch interdisziplinär arbeiten.
Gibt es auch Möglichkeiten zu einer naturheilkundlichen Behandlung?
Diese Möglichkeit gibt es und ist auch sinnvoll. Aus meiner Erfahrung erzielt man die besten Resultate, wenn man die Frauen in einem multimodalen Therapiekonzept betreut. Innerhalb dieses Konzepts gehören durchaus auch naturheilkundliche Behandlungsoptionen.
Welche pflanzlichen Wirkstoffe können Beschwerden lindern?
Es gibt zahlreiche bioaktive Verbindungen aus Pflanzen, die nachweislich hemmende Wirkung auf die Endometriose haben. Die wissenschaftliche Datenlage ist derzeit aber leider noch sehr beschränkt. Man weiss aber beispielsweise das Granatapfel antiproliferative und antiaromatase Eigenschaften haben, welche in der Entstehung der Endometriose bedeutsam sind. Vom Mönchspfeffer sind dopaminerge und prolaktinsenkende Eigenschaften, und eventuell Aktivität an Östrogen-, Endorphin- und Opioidrezeptoren beschrieben.

Nach dem Studium in Bern hat sich PD Dr. Patrick Imesch in grossen gynäkologischen Zentren breit aus- und weiterbilden können. Als langjähriger Kaderarzt im Universitätsspital Zürich konnte er im gesamten Spektrum der Gynäkologie sowohl im konservativen wie auch operativen Gebiet grosse Erfahrung sammeln. Wichtige Schwerpunkte seiner klinischen Tätigkeit stellen dabei die Diagnose und Therapie bei Endometriose und unklaren, chronischen Unterbauchschmerzen dar. Seit 2021 betriebt er eine eigene Praxis mit Schwerpunkt Endometriose in der Klinik Bethanien in Zürich.

prefemin® – gegen PMS-Symptome wie Brustspannen, Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen. prefemin®
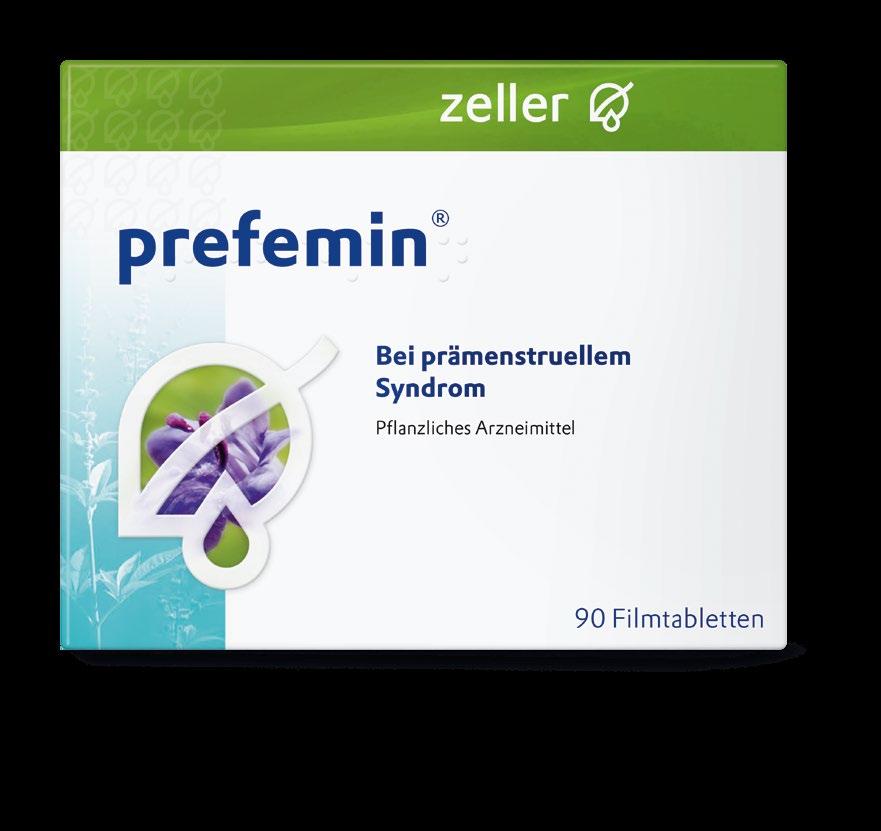
Auch bei Zyklusstörungen

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn, www.zellerag.ch
PFLANZLICH.
MIT MÖNCHSPFEFFER.
1 TABLETTE TÄGLICH.

Wenn Menschen mit farbigen Tapes auf der Haut unterwegs sind, handelt es sich dabei mit grosser Wahrscheinlichkeit um sogenannte Kinesio-Tapes. Sie werden bei verschiedensten Symptomen rund um Muskeln und Gelenke mit Erfolg eingesetzt.
Fabrice Müller

Ein Autofahrer fuhr mit über hundert Kilometer pro Stunde in eine stehende Autokolonne. Neben leichteren Verletzungen trug der Mann ein schweres Schleudertrauma davon. «Zu Beginn konnte er den Kopf kaum noch bewegen», erzählt sein Sporttherapeut Beat Wegmüller, der gleichzeitig als Leiter und Dozent der SWISS Sporttherapieschule in Langenthal Weiterbildungen anbietet. Beat Wegmüller und seine Schule gehörten zu den ersten in der Schweiz, die vor zwölf Jahren Weiterbildungen für Kinesio-Taping anboten. Die Kombination aus Sporttherapie und Taping war es denn auch, die dem Patienten mit dem Schleudertrauma wieder so weit brachte, dass er heute seinen Kopf sogar besser bewegen kann als vor dem Unfall. «Dank dem Taping haben wir in der Therapie sehr schnell Fortschritte erzielt. Zudem haben die Tapes dem Patienten auf der psychologischen Ebene als zusätzliche Stütze mehr Sicherheit gegeben», berichtet Beat Wegmüller, der früher als Leistungssportler im Berglauf aktiv war und seit 17 Jahren in der Sporttherapie und Weiterbildung tätig ist.
Kinesio-Taping wurde bereits anfangs der 70er-Jahre durch den japanischen Arzt und Chirotherapeuten Dr. Kenzo Kase entwickelt (siehe auch Info-Box). Der Begriff Kinesio-Taping setzt sich zusammen aus «Kinesis», was auf griechisch Bewegung bedeutet, und «Taping», ein englischer Ausdruck für das Befestigen mit einem Band. Beat Wegmüller hatte selbst das Glück, Kenzo Kase persönlich kennen zu lernen und sich bei ihm in der Anwendung der Tapes weiterbilden zu lassen. Nun gibt er sein Wissen an Therapeutinnen und Therapeuten, darunter auch medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten, weiter. «Taping ist gerade in der Physiotherapie mittlerweile ein Muss», sagt Beat Wegmüller. Weiter arbeitet er mit Hochschulen zusammen, um noch mehr über die Wirkung der Tapes zu forschen. Dadurch
entstanden Forschungsarbeiten zum Beispiel zur Reizübertragung dank dem Kinesio-Tape auf das stimulierende Gewebe oder zur Optimierung von Leistungen im Spitzensport.
Das Einsatzgebiet der Kinesio-Tapes, die nur längs- und nicht querdehnbar sind, ist vielfältig. Sie werden über vorgedehnte Muskeln- oder Gelenkzonen geklebt. Je nach Körperstelle und Beschwerden legen die Therapeutinnen und Therapeuten die Tapes in gerader Form oder zum Beispiel als Ypsilon auf die Haut, um die Muskeln zu entlasten; dies ist unter anderem bei Knie- und Schultergelenkbeschwerden der Fall. Sogenannte Fächertapes eigenen sich bei Lymphanlagen, um den Abflussprozess zu beschleunigen. Beat Wegmüller empfiehlt, das Tape mindestens drei Tage auf der Haut zu lassen. Wird der Muskel oder das Gelenk bewegt, bleiben die Tapes auf der Haut haften, wodurch es zu einer permanenten Verschiebung der Haut gegen die Unterhaut kommt. Dies führt zu einer Reizung der darunter liegenden Muskel-, Bänder- oder Gelenkareale wie auch der Lymphe. Diese ganzheitliche Anregung der erkrankten
«
Die Einsatzmöglichkeiten von Kinesio-Tape sind vielfältig. »
Buchtipp

Kinesiologische Tapes
Verspannungen lockern, Schmerzen lindern, Gelenke unterstützen
9. Mai 2017, Garant Verlag GmbH, 128 Seiten, ISBN 978-3-7359-1290-9, CHF 12.90
Die Kinesio-Tapes wurden durch den japanischen Arzt und Chirotherapeuten Dr. Kenzo Kase 1973 entwickelt. «Ursprünglich experimentierte Kenzo Kase mit den Nasenpflastern der Firma Niko Denko», berichtet der Schweizer Sporttherapeut Beat Wegmüller. Dabei habe Kenzo Kase zum Beispiel eingerenkte Schultern mit Tapes fixiert – anstelle eines Schlingenverbandes, der – so Beat Wegmüller – zu Fehlhaltungen und Verkürzungen an den Muskeln führen könne. Kenzo Kase entwickelte die ursprünglichen Nasenpflaster zu Tapes für die Muskulatur weiter. Sein Ziel war es, die bis anhin vorhandenen Stabilitätstapes so zu verändern, dass sie nicht nur stabilisieren, sondern auch den Heilungsprozess beschleunigen und Rückfälle verhindern
Aus dieser Forschungsarbeit heraus entstand ein Material aus einer Art Baumwollgewebe, das in der Lage ist, Wasser und Schweiss abzutransportieren. Eine spezielle Acrylbeschichtung ist für die Elastizität verantwortlich. Der Kleber muss zum einen eine hohe Stabilität gewährleisten, zum andern jedoch sich auch wieder von der Haut entfernen lassen. Ausserdem sind die Tapes ausserordentlich dehnfähig und müssen hohen hygienischen Anforderungen entsprechen, wie Beat Wegmüller erklärt. Nicht alle Produkte erfüllen offenbar diese Qualitätsanforderungen, sei es auf der Ebene des Baumwollgewebes wie auch beim Kleber. «Ein Produkt für unter zehn Franken kann diese Qualität nicht erfüllen», sagt Beat Wegmüller
Region unterstützt den Rückgang von Schwellungen und Entzündungen, durch die Förderung des Lymphflusses. Darin liegt auch der therapeutische Unterschied zum starren Verband der Schulmedizin, der nur über die Ruhigstellung wirkt. Die Wirkprinzipien lassen sich physiologisch gut erklären, zudem belegen einige wissenschaftliche Studien sowie positive Erfahrungen etwa im Hochleistungssport den Erfolg des Kinesio-Taping.
Das Tape gibt dem Muskel seine Hautfunktion zurück Die Tapes werden zum Beispiel eingesetzt bei der Unterstützung von geschwächten Muskeln etwa nach einem Unfall, einer Krankheit oder bei neurologischen Problemen. Soll das Kinesio-Tape einen bestimmten Muskel oder ein bestimmtes Gelenk entlasten, wird es mit Zug aufgebracht. Hierbei wird es gedehnt entlang des Muskelverlaufs auf die Haut geklebt. Die gespannte Haut leitet einen Reiz an den Muskel weiter, der sich hierdurch besser entspannt. Die Mobilität wird gesteigert und Schmerzen reduziert. «Das Tape gibt dem Muskel seine Hauptfunktion vor. Dabei wird der Muskel geführt und verhindert, dass er falsche Bewegungen ausübt», erklärt Beat Wegmüller. Das Imitieren von Bewegungen trage zum einen zur Heilung, zum andern zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Beweglichkeit des Muskels bei. Bei Tennis- und Golferarm kommt das Tape häufig zum Einsatz und leistet gute Dienste bei der Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen und Prellungen. Das Kinesio-Tape kann zudem bei Kopfschmerzen, Neuropathien, Multiple Sklerose und Aszites angewendet werden. Bei Lymphödemen beispielsweise fördert es den Abtransport von Lymphflüssigkeit.
Haltungskorrekturen
Weiter werden die Tapes etwa bei Korrekturanlagen für Haltungskorrekturen eingesetzt – zum Beispiel am Knieoder Sprunggelenk sowie für die Schulterhaltung. «In solchen Fällen schränkt das Tape einerseits gewisse Fehlfunktionen ein, andererseits unterstützt es die Muskeln bei der Ausführung der korrekten Haltung», sagt Beat Wegmüller und nennt das Hohlkreuz als Beispiel einer solchen Anwendung. Mit den Kinesio-Tapes lassen sich zudem alte, schädigende Muster, die sich in der Haltung oder bei Muskelbewegungen eingeschlichen haben, auszumerzen. «Es braucht zwischen 500 und 700 Bewegungen, bis das Gehirn diese neuen Abläufe als Synapse gespeichert hat. Mit dem Tape unterstützen wir den Körper in diesem Prozess.»

Hier werden die Tapes zur Unterstützung des Kniegelenks angebracht.
Wirkung auf der neurologischen Ebene
Wird das Tape für sogenannte Stabilisationsanlagen verwendet, lässt sich die Stabilität eines Muskels oder von Bändern laut Beat Wegmüller um bis zu 98 Prozent erhöhen. Dies sei zum Beispiel bei wieder eingerenkten Gelenken wertvoll, weil das Tape die Muskeln gezielt unterstütze und Belastungen abfedere. «Dass man mit den Tapes auch am Bandapparat arbeiten kann, wissen viele nicht», stellt Beat Wegmüller immer wieder fest. Ebenfalls vermutlich wenig bekannt ist, dass die Kinesio-Tapes auch auf der neurologischen Ebene wirken, indem durch das bewusste Führen, Stärken oder Entlasten von Muskeln und Bändern dem Nervensystem entsprechende Signale übermittelt werden.
Dies verhindert zum Beispiel, dass der Körper sich dauernd überfordert und zu stark belastet. «Wir schaffen mit den Tapes ein neues Umfeld und können gezielt die Leistung des Körpers fördern», ergänzt Beat Wegmüller. Dies sei auch ein Plus für die Psyche, ist der Sporttherapeut überzeugt: «Der Körper reagiert anders, wenn es der Psyche gut geht. Der Heilungsprozess wird dadurch zusätzlich beschleunigt.»
Jeder Mensch reagiere anders auf Tapes, stellt der Therapeut immer wieder fest. Neben der körperlichen Konstitution spielen hier auch die mentale Einstellung und die persönliche Lebenserfahrung eine gewisse Rolle. «Manchmal bin ich überrascht, wie schnell ein Tape wirkt. Während ich die Wirkung auf

Kinesio-Tape zur Stärkung der Handgelenke.
Anhieb erkenne, ist sie den Patientinnen und Patienten oft nicht sofort bewusst.» Andere Personen reagieren abstossend auf die Tapes, weil sie sich zum Beispiel am Hautkontakt stören.
Vorsicht bei Narben und Hautkrankheiten
Trotz der vielen positiven Effekte, die von den Kinesio-Tapes ausgehen, hat diese Technik auch ihre Grenzen. «Die Tapes ersetzen keine Therapie, sie ergänzen sie oder sorgen für ein effizienteres Training», betont Beat Wegmüller. Kein Tape verwenden würde der Sporttherapeut beispielsweise nach einer Operation, solange noch keine andere Therapie möglich ist. Man könne zwar Körperstellen mit Narben tapen, allerdings nur unter ärztlicher Aufsicht. Auch vor einer Lymphanlage mit Tapes im Rahmen einer Chemotherapie rät Beat Wegmüller ab. «Erst, wenn der Patient oder die Patientin therapiert werden kann, dürfen die Tapes zur Anwendung kommen.» Auch bei Neurodermitis, Ekzemen und Psoriasis ist von der Anwendung dringend abzusehen, weil die Tapes bzw. der darin enthaltene Klebstoff die Haut zu stark irritieren könnte. Bei einer unsachgemässen Fixierung des Tapes kann es zu Bewegungseinschränkungen, Schwellungen oder Beeinträchtigung des Blutflusses kommen. Doch: «Die Gefahr, mit den Tapes etwas falsch zu machen, ist gering. Viel grösser ist die Chance, einen positiven Effekt zu erzielen», betont Beat Wegmüller.
www.swisssporttherapie.ch

Weniger Licht im Winter schlägt auf unser Gemüt. Vieles kann helfen: Ob Lichttherapie, Johanniskrauttee, Sport oder gemütliches Kuscheln. Probieren geht über Studieren.
Lioba Schneemann
Diese Zeit des Jahres liegt mir wie ein Mühlstein auf der Seele. Meine Nerven versagen, meine Zähne schmerzen und mein Mut fällt in die bodenlose Tiefe der Unendlichkeit.»
Der US-Amerikanische Chronist Henry Adams schrieb dies im Jahr 1869. War er Opfer einer Winterdepression? Dass unsere Stimmung und unsere Energie von der Jahreszeit, je nach Individuum sicher unterschiedlich stark, beeinflusst wird, weiss jedes Kind. Man redet von der Frühjahrsmüdigkeit, dem euphorischen Sommerhoch, und dem Winterblues. Hierbei klagen die Betroffenen über eine ausgeprägte Verstimmung mit Antriebslosigkeit und vermehrter Müdigkeit.
Zwei Seelen in der Brust
Rund 10 Prozent der Menschen in unserem Kulturkreis sind vom Winterblues betroffen. Eine regelrechte Depression – als «saisonal abhängige Depression» (SAD) bezeichnet – tritt, je nach Studie, bei 2,5 bis 6 Prozent der Bevölkerung auf. Eine SAD wird diagnostiziert, wenn typische Symptome regelmässig im Winter und mindestens zwei Jahre hintereinander auftreten. Von einer SAD Betroffene berichten von einer bedrückten Stimmung, Antriebs- und Lustlosigkeit, Desinteresse, Verminderung der kognitiven Leistungsfähigkeit, Zu-
kunftsängsten, Minderwertigkeitsgefühlen oder gar einer sozialen Dissoziation. Dazu können Schlafstörungen, ein gesteigertes Schlafbedürfnis oder Schwindel sowie Kopf- und Rückenschmerzen auftreten. Da oft der Appetit auf kohlenhydratreiche Lebensmittel zunimmt, nehmen viele auch an Gewicht zu. Im Frühling ist der Spuk dann meist vorbei. Eine Betroffene berichtet, sie habe das Gefühl, buchstäblich «zwei Seelen in ihrer Brust» zu haben – im Sommer eine fröhliche, im Winter eine traurige. Oft wir diese Winterdepression nicht erkannt, obwohl es eine ernst zu nehmende Erkrankung ist. Auch Kinder und Jugendliche können betroffen sein. Offenbar werden die auftretenden Symptome von unserer Gesellschaft in gewisser Weise als normale Begleiterscheinung der dunklen Jahreszeit bewertet.
Allerdings sollte man grundsätzlich Diagnosen kritisch betrachten. Bei einem Verdacht auf SAD kann nämlich auch eine andere Erkrankung vorliegen. Eine gründliche ärztliche Untersuchung, etwa der Schilddrüse, auf Unterzuckerung oder auf eine Vireninfektion ist ratsam. Allerdings spricht ein wiederholtes Auftreten vieler Symptome im Winter mit einem Abklingen im Frühjahr stark für eine saisonal abhängige Depression

Schlafstöruungen oder ein gesteigertes Schlafbedürfnis gehören zu den Symptomen der Winterdepression.
Schokolade hat nicht umsonst einen Ruf als Glücksbringer.
Mehr Licht!

Nach der Ursache für eine Feinfühligkeit muss man nicht lange suchen: Es ist das fehlende Licht im Winter. Das wusste übrigens schon Hippokrates, der einst schrieb, dass man als erstes die Jahreszeiten erforschen müsse. Die dunkle Jahreszeit mit den kurzen Tagen –im Dezember sind die Tage gegenüber dem Juni um rund 8 Stunden kürzer – sorgt dafür, dass unser Körper auch am Tag mehr Melatonin ausschüttet. Melatonin ist ein Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers beeinflusst. Und es steht im Zusammenhang mit dem Botenstoff Serotonin, der bei der Entstehung einer Depression eine zentrale Rolle spielt.
Warum jedoch manche Menschen im Winter an einer Depression erkranken, andere «nur» einen milderen Blues spüren, hat noch andere Gründe. Man nimmt an, dass Anomalien in der Ausschüttung bestimmter Hormone oder eines Systems chemischer Botenstoffe an der Entstehung einer SAD beteiligt sind. Möglich ist zudem, dass die Augen von SAD-Patient*innen auf Licht anders reagieren als bei Nichtbetroffenen.
Licht erhellt das Gemüt
Lichttherapie wird heute oft bei Winterdepression oder Winterblues angewendet. Diverse Studien zeigen, dass Lichttherapie bereits nach zwei bis acht Wochen die Symptomatik einer Depression stärker verbesserte als Placebo. Zwischen 60 bis 80 Prozent aller SAD-Patient*innen profitierten von der Lichttherapie. Zudem traten bei der Lichttherapie im Vergleich zum Antidepressivum Fluoxetin weniger Nebenwirkungen auf. Licht wird auch bei der Behandlung von anderen Formen der Depression und von Schlafstörungen oder anderer Erkrankungen wie etwa Alzheimer, eingesetzt. Lichtlampen können auch einfach und zeitlich flexibel
zu Hause angewendet werden. Bei der Behandlung wird das Licht durch die Augen aufgenommen. Die Therapielampen sind ohne UV-Licht konstruiert, um Augenschäden zu verhindern. Neben Antidepressiva und Lichttherapie wird oft auch eine kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Dass übrigens eine Vitamin-D-Kur nützt, ist unter Medizinern umstritten, da Studien dazu bei einer Winterdepression fehlen.
Glücksbringer Essen
Eine ausgewogene Ernährung hat ebenso einen grossen Einfluss auf unser Gemüt. Essen macht glücklich, man denke nur an Kakao! Die Qualität der Nahrungsmittel und ein wirkliches Genusserleben spielen jedoch ebenso eine Rolle.
Natürlich wäre es praktisch, wir könnten den Glücksstoff Serotonin einfach essen. Diskutiert wird, die Vorstufe davon, die Aminosäure Tryptophan, mit der Nahrung aufzunehmen. Für dessen Transport und Aufnahme im Gehirn sind auch Kohlenhydrate wichtig. Geraten wird darum, Fisch, Milch- und Sojaprodukte sowie Nüsse, Samen, Trockenfrüchte, dunkle Schokolade und Vollkornprodukte zu essen. Nüsse wie Cashewkerne, Mandeln, Para- und Erdnüsse beispielsweise, enthalten zudem viel Magnesium, das als «Mineral der inneren Ruhe» bezeichnet wird. Auch scharfe Gewürze wie Chili sollen die Stimmung heben, denn die Schärfe wird von unserem Gehirn als Schmerz wahrgenommen, wir schütten Endorphine aus, was uns euphorischer macht.
Sein Leben unter die Lupe nehmen Jedoch, wie so oft, sind die Zusammenhänge auch hier komplexer. «Die Rolle der Ernährung spielt eine Rolle beim Winterblues und auch bei einer Depression. Heil-
mittel aus der Natur sowie die Lichttherapie können Linderung verschaffen. Jedoch rate ich, sich auch mit seinem Leben als Ganzes auseinanderzusetzen», sagt Patrizia Aeberhard, Naturheilpraktikerin mit Eidg. Diplom in TEN in Bad Zurzach. «Ich schaue mit den Betroffenen alle Bausteine an: Wie steht es mit der Bewegung, der Entspannung? Wie ernährt sich die Person, kocht sie zum Beispiel stets selbst? Wie wertschätzt sie sich und ihren Körper? Wieviel Eigenverantwortung und Initiative ist da?» Wer wiederholt einen Winterblues erlebe oder seine Neigung zu einer saisonalen Depression kenne, solle bereits im Herbst anfangen Dinge umzusetzen, so Aeberhard.
Sie empfiehlt eine ausgewogene Ernährung, die in Form einer gesunden Mischkost viel regionales Gemüse, jedoch weniger Früchte (wegen des Fruchtzuckers) und vor allem, täglich genug pflanzlich oder tierisches Eiweiss enthält. Ratsam sind drei Mahlzeiten am Tag, die man selbst kocht. Ausserdem sollte man auf Zwischenmahlzeiten verzichten, da diese das Verdauungssystem ständig fordern. «Alle Massnahmen sollten zum eigenen Lebensstil passen, sonst funktioniert es nicht. Viele kleine Schritte führen zum Erfolg. Dazu gehört auch: regelmässig raus in die Natur mit ausreichend moderater Bewegung oder Sport. Sich selbst wertschätzen. Für sich gut sorgen. Schliesslich kann die eigene Einstellung zum Winter viel bewirken.» Eine Fachperson kann sehr unterstützen, jedoch ist gemäss Aeberhard die Eigenverantwortung ein Schlüssel. «Keine Ärztin, kein Therapeut, kein Medikament kann mir meine eigene Verantwortung abnehmen. Wenn ich es schaffe, auch in der lichtarmen Zeit die Schönheiten zu erkennen, so fällt mir das Leben leichter.»
Stoffe
Bei depressiven Verstimmungen ist Johanniskraut ein Klassiker. Man kann sich einen Johanniskrauttee selbst ansetzen und einige Tassen davon täglich trinken. Da die Wirkung erst nach etwa drei Wochen eintritt, sollte man die Teekur bereits im Oktober beginnen. Tabletten oder Frischsaft ist ebenso ideal, jedoch kann der heisse Tee als entspannendes Ritual schon für gute Stimmung sorgen. Auch die Auswahl an Naturheilmitteln gegen die trübe Stimmung ist gross. Hier ist der Rat einer Fachperson angebracht – und dann heisst es, selbst ausprobieren, was hilft. Präparate wie Orthomolekulare Vitalstoffmischungen mit Safran und Melisse bis zur Homöopathie sind empfehlenswert. Heilpraktiker*innen geben gerne auch individuell abgestimmte Mischungen mit Spagyrik, Bachblüten, Tinkturen und Tees. Aromatherapie mit feinen Ölen sowie der Einsatz von hellen Farben im Wohnraum sind weitere Tipps, die helfen, dass wir uns wohler im Alltag fühlen.

Sportliche Aktivität ist ebenso hilfreich, sei es beim Winterblues oder bei einer SAD. Bewegung in der Natur bewirkt, dass unser Körper wichtige Botenstoffe und Hormone ausschüttet wie Serotonin, Dopamin und Adrenalin. Die Waldluft (Terpene) hält uns gesund wie Studien zeigen. Ebenso sind Freunde und Familie wichtig, dazu Freude und Spass erleben, sind wahre Gesundbrunnen.
Das Gefühl von Verbundenheit fördert unser Wohlbefinden, wir fühlen uns glücklich. Dazu gehört auch Körperkontakt, den wir beim Kuscheln, beim Sex oder auch einer wohltuenden Massage erfahren. Liebevolle Berührungen sind Balsam für Körper, Geist und Seele: Sanftes Streicheln, Umarmen und die Wärme des anderen entspannt, reguliert Emotionen und stärkt das Immunsystem. Das Bindungshormon Oxytocin sorgt für Wohlbefinden: es wirkt antidepressiv, verringert Angst und Schmerzempfinden, fördert Vertrauen, dazu gesunden wir schneller. Das sind doch gute Neuigkeiten. Also – ran ans Kuscheln!

«natürlich» und der Dachverband Komplementärmedizin Dakomed arbeiten künftig enger zusammen. Ziel ist, die Bevölkerung besser zu informieren –und politisch den Anliegen der Naturheilkunde mehr Gewicht zu verleihen, wie Dakomed-Präsidentin Edith Graf-Litscher im Interview betont.
Interview: Markus Kellenberger
Schweizerinnen und Schweizer vertrauen der Naturheilkunde. Trotzdem ist in den letzten Jahren die Heilmittelvielfalt im komplementärmedizinischen Bereich zurück gegangen. Was läuft hier falsch?
Edith Graf-Litscher: Im Bereich der pflanzlichen, also der phytotherapeutischen Heilmittel ist die Zahl der Zulassungen in den letzten zehn Jahren um rund 40 Prozent gesunken. Das liegt vor allem an den stetig sinkenden Preisen in der Spezialitätenliste und an erhöhten Anforderungen der Inverkehrbringung. Vielen Politikerinnen und Politikern ist leider immer noch nicht bewusst, welche Chancen sich durch eine engere Zusammenarbeit zwischen Schul- und Komplementärmedizin bei den Heilerfolgen und der Kostendämpfung ergeben können. Widerstand kommt aber auch aus der Bundesverwaltung, obschon das Volk 2009 mit der Abstimmung über die Komplementärmedizin Bund und Kantonen den Auftrag gegeben hat, diese in der Grundversicherung zu verankern und sich für die Arzneimittelvielfalt einzusetzen.
Politisch sind sogar Bestrebungen im Gang, die Komplementärmedizin wieder aus der Grundversicherung herauszunehmen.
Wer sind die Treiber?
Seit Teile der Komplementärmedizin in die Grundversicherung aufgenommen wurden, wird medial und politisch versucht, das wieder rückgängig zu machen. So hat zum Beispiel FDP-Nationalrat Philippe Nantermod vor einem Jahr im Parlament einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. Wir vom Dakomed haben sofort mit einer Stellungnahme zu Gunsten der Komplementärmedizin darauf reagiert – und dürfen erfreut feststellen, dass der Bundesrat dahinter steht, dass ärztliche Komplementärmedizin von der Grundversicherung vergütet wird.
Dakomed ist die politische Speerspitze der Komplementärmedizin. Was setzt der Dachverband im Bundeshaus diesen Bemühungen entgegen, wo liegen seine Schwerpunkte?
Wir vertreten beispielsweise die Interessen aller Therapeutinnen und Therapeuten im naturheilkundlichen Bereich oder die Anliegen der Hersteller komplementärme-
SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher ist Präsidentin des Dakomed und vertritt die Anliegen der Komplementärmedizin im Bundeshaus.

dizinischer Produkte. Konkret: Wir wollen, dass es genügend qualifizierte Ärztinnen und Ärzte und Therapeutinnen und Therapeuten gibt und dass die Arzneimittelvielfalt erhöht wird. Sie ist die Voraussetzung für Therapievielfalt und individuelle Behandlungsmöglichkeiten.
Kritikerinnen und Kritiker werfen der Naturheilkunde oft Nähe zur Esoterik und mangelnde Nachweisbarkeit der Wirkung vor. Was halten Sie dagegen?
Der Dakomed setzt sich politisch nicht nur für die Anerkennung der Komplementärmedizin ein, sondern auch für seriöse Expertisen und Studien. In der Naturheilkunde geht es oft um «Erfahrungsmedizin», und die lässt sich nur bedingt mit den Prüfmethoden der Schulmedizin messen. Es gibt adäquate Forschungsmethoden, die zu wenig eingesetzt werden. Es braucht also mehr praxisgerechte Forschung in der Komplementärmedizin und der Bundesrat sollte diese fördern.
Der Branche selbst fehlen die notwendigen Mittel dazu. Hinzu kommt, dass sich die vielen kleinen und teilweise familiär geführten Firmen die heute geltenden und auf Pharmastandards ausgerichteten Prüfverfahren für Heilmittel nicht mehr leisten können. Das ist einer der Hauptgründe für den Rückgang der zugelassenen Naturheilmittel. Wir wollen, dass hier auch erfahrungsmedizinische Studien zugelassen werden. Die in der Regel auf einen einzigen Wirkstoff ausgerichteten Prüfmethoden werden vielen naturheilkundlichen Produkten, bei denen oft die Wechselwirkung verschiedener Inhaltsstoffe eine wichtige Rolle spielt, nicht gerecht.
Je mehr Pharma, desto höher die KrankenkassenPrämien – je mehr Naturheilkunde, desto weniger steil steigen die Prämien an. Stimmt diese Kurzformel?
Man kann und soll das nicht gegeneinander ausspielen. Wir sind aber davon überzeugt, dass ein «Miteinander» der verschiedenen Leistungserbringer aus Schul- und Komplementärmedizin die Kosten für viele Behandlungen senkt, weil das Resultat besser ist. Das Stichwort dazu heisst integrative Medizin. Mit dem «Millefolia»Bulletin informiert der Dakomed Schweizerinnen und Schweizer regelmässig über seine Arbeit.
Was verspricht sich der Dakomed von einer engeren Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Magazin «natürlich»?
Gemeinsam können wir die Selbstkompetenz der Menschen für ihre Gesundheit besser fördern. Und gemeinsam bilden wir eine starke Stimme für die Naturheilkunde, die in der Politik gehört und ernst genommen wird. Deshalb freue ich mich auf diese Zusammenarbeit.
Dieser Ausgabe von «natürlich» liegt das aktuelle «Millefolia-Bulletin» bei. Damit informiert der Dakomed Leserinnen und Leser über die politische Arbeit des Verbandes. Auf der Website «Millefolia.ch» stellt er eine breite Palette von Artikeln über Komplementärmedizin und Naturheilkunde zur Verfügung. Für seine politische Arbeit ist der Dakomed auf Unterstützung angewiesen.
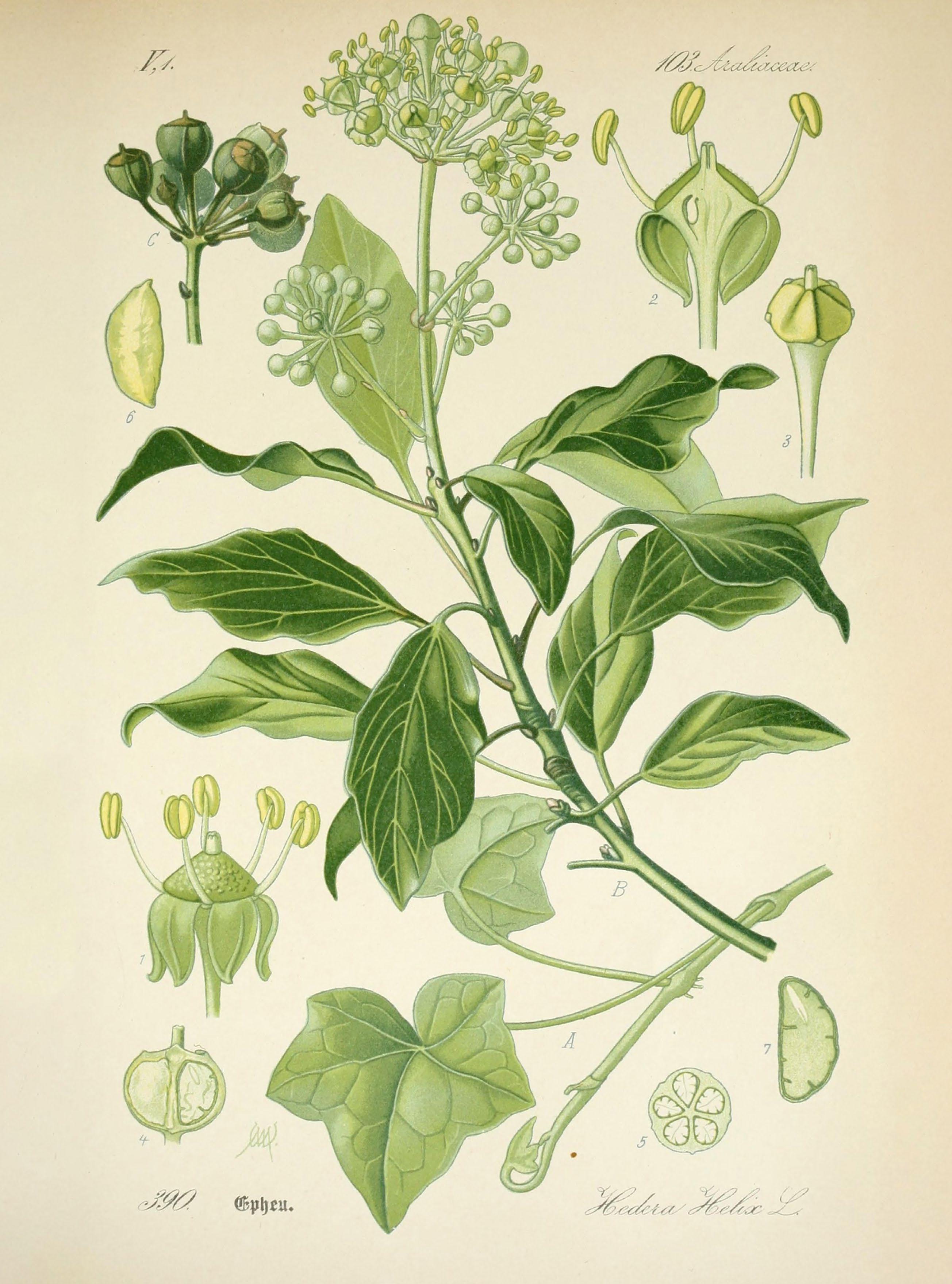
Der Efeu ist ein immergrüner Meisterkletterer. Er steht für Halt und Kraft. Besonders hilfreich ist seine Heilkraft bei bronchialen Infekten und Schilddrüsenerkrankungen.
Steven Wolf
Das Wesen des Efeus ist die Verbindung von Dunkelheit und Licht – die Wurzeln wuchern unbändig in der Dunkelheit, die immergrünen Blätter vermehren sich durch Ausläufer, die über dem Boden ein dichtes Netz bilden und so dem Licht entgegenwachsen. Diese Verbindung von Dunkelheit und Licht verkörpert eine immense, lebensfördernde Kraft. Der starke Bezug zur Wurzelenergie stärkt unsere innere Verbindung zum Boden und stellt das tiefe Vertrauen in die Verbindung zur grossen Mutter Erde wieder her. Deshalb ist der Efeu eine kraftvolle Heilpflanze bei Mangelzuständen, Ängsten und vermindertem Selbstwertgefühl. Der Efeu verfügt zwar über einen starken Halt, ist jedoch nicht an einen festen Standort gebunden. Er hat diesen überwunden. Das rankende Wesen des Efeus verkörpert die Planetenenergie des Merkurs. Sein vibrierendes Vorwärtsschreiten steht für Bewegung und Vitalität. Er sucht sich kriechend, verwurzelnd und vernetzend seinen Weg entlang des dunklen Waldbodens in Richtung des Lichtes. Dies ist eine Einladung für uns, unseren Weg konsequent zu gehen, und uns nicht in Details zu verstricken. Sollte dies passieren, führt uns die Efeuenergie durch ihre hohe Standortflexibilität aus den verfahrensten Situationen heraus, wieder auf neue Pfade.
Gibt Halt und Verwurzelung
Efeu ist ein Tonikum zur Anregung der Geisteskräfte. Er wirkt gegen auszehrende und abbauende Zustände, die unsere Lebenskraft bedrohen. Als immergrüne Pflanze verwende ich das Efeuöl bei Vitalitätsverlust. Bei Muskel- und Gelenksrheumatismus, Gicht und Ischiasschmerzen. Die alles verbindende Kraft des Efeus wirkt aber auch auf den Stoffwechsel und das Hormonsystem. Efeu stimuliert die Ausschüttung von Nebennierenrin-
den-Hormonen. Diese hemmen Entzündungen und beseitigen Ablagerungen in den Gelenken, damit man weiterhin frei und beweglich bleiben kann. Efeu eignet sich auch zur Hormon-Menstruationsregulierung. Er kann als Tinktur bei zu schwacher Menstruation mit einem zuvor scharfen, wundmachenden Ausfluss helfen. Ebenso bei Schilddrüsenunterfunktionen.
Der Efeu ist der einzige einheimische Wurzelkletterer Mitteleuropas. Trifft er auf ein Kletterhindernis, zum Beispiel einen Baum, schmiegt er sich an dessen Stamm und beginnt, sich windend, über seine Schattenseite an ihm hochzuwachsen. Diese, teilweise über hundert Jahre andauernde Partnerschaft zwischen Efeu und Baum ist ein Zeugnis der Verbundenheit und der Treue. Die Jungtriebe übernehmen mit ihren Haftwurzeln eine statische Wuchssicherung. Nicht nur auf groben Baumrinden, sondern auch auf glatten Oberflächen wie Fensterscheiben oder Hauswänden. Auch hier widerspiegeln sich die Themen Halt und Verwurzelung. Der Efeu erinnert uns daran, dass wir in Zeiten der Veränderung nicht an äusseren Sicherheiten wie ein Zuhause, Geld, Versicherun-
«
Der Efeu ist der einzige einheimische Wurzelkletterer.

gen oder einer Partnerschaft festhalten sollten. Nicht klammern, zetern oder jammern. Sondern loslassen, sich mit den Ängsten konfrontieren und mutig vorwärtsschreiten.
Der aufwärts schlängelnde Stamm von alten Efeuranken erinnert an Blutbahnen, Adern, Venen und den Darm. Das zeigt, dass Efeu stabilisiert, entschlackt und den Sauerstofftransport im Blut steigert. Allgemein fördert er die Durchblutung und die Durchlässigkeit der Blutgefässe. Er ist ein hervorragendes Venentonikum bei Krampfadern, fördert die Durchblutung der Arterien bei Arteriosklerose und stärkt das Altersherz. Desweiteren kann bei Magen-Darmentzündungen, ständigem Heisshunger, Appetitlosigkeit oder aufgeblähtem Magen an Efeutinktur gedacht werden.
Im stillen Dialog mit dem Efeu
Die Botschaft, die mir der Efeu während meiner Meditation gibt, ist das Geben und Nehmen. Es geht um den Ausgleich, um das Naturgesetz des Schenkens und Empfangens. In der Regel wird bei uns Menschen das Geben und Schenken höher bewertet als das Empfangen. Beschenkt zu werden ist uns unangenehm: «Ich bin ein Wanderer und gebe an allen Orten, wo ich vorbeikomme, etwas ab von meiner Substanz. Gleichzeitig nehme ich etwas von der Substanz der jeweiligen Orte in mich auf. Ich beherberge das winterliche Licht der Gastfreundschaft, die Grosszügigkeit und den Schutz vor dem Geiz. Ich bin das Geschenk, die Einheit der Schenkenden und das Schenken um des Schenken Willens. Ein Geschenk ist keine Belohnung. Man kann es sich weder verdienen noch erarbeiten. Um dies zu verstehen, reicht die Fähigkeit deines Verstandes nicht aus. Als Mensch musst du dies erfahren, erst dann wird der Weg zum Gesetz. Ent-
fessle die wandernde Seite in dir und befreie dich von den unnötigen Fesseln der belastenden materiellen Lebenseinstellung. Beginne mit dem freien Aufstieg nach den Geistesgesetzen. Das bedeutet nicht, in Armut zu Leben. Wenn du auf deinem Herzensweg bleibst, oder anfängst ihn zu beschreiten, werden sich die materiellen Bedienungen für das tägliche Leben von selbst einstellen. Es kommt auf dich zu. So öffne ich deinen Geist, damit du wachsamer deinen Weg beschreitest und erkennst, was du zu empfangen und was du zu geben hast». Vielleicht hast du Lust, das Märchen vom Hans im Glück mal wieder zu lesen. Auch diese Geschichte weiht uns ein in die Gesetze des Gebens und Nehmens.
Das wohl bekannteste Einsatzgebiet des Efeus ist die Heilwirkung auf die oberen Atemwege. Dies aufgrund seiner entzündungshemmenden, antibakteriellen, antiviralen Eigenschaften. Efeu zeigt sich in der äusseren Betrachtung als ein starkes Blattwesen. Dies weist auf ein kraftvolles Wirken im mittleren Pol des Menschen hin, der sich im Brustraum und der Herzgegend befindet. Efeu hat somit einen Bezug zur Atmung und Blutkreislauf. In alten Zeiten wurde das Efeublatt für psychsomatische Herzbeschwerden eingesetzt, um verkrampfte Atemwege und die Bronchialmuskulatur zu erweitern. Es erleichtert die Sauerstoffzufuhr zur Lunge und kann die Atemwege von Entzündungen und Verschleimung befreien. Die Tinktur eignet sich deshalb zur Behandlung von grippalen Infekten mit starker Verschleimung. Sämtliche Bronchialerkrankungen, Asthma, krampfartiger Reizhusten und Rachenentzündungen können gelindert werden. Der säuerliche, bittersüsse Geschmack des Blattes verweist auf die Bereiche Leber, Verdauung, Herz und Milz. Die drei bis fünf dreikantigen, nieren-

Die aufwärts schlängelnden Efeuranken erinnern an Blutbahnen.

Efeu wirkt heilend auf die oberen Atemwege.
förmigen Samen machen eine Verbindung zur Niere und Gallenblase. Der Efeu kann somit auch die Verdauung unterstützen und den Gallenfluss fördern.
Nach acht bis zehn Jahren des Erklimmens und der Ausprägung der Altersform. Erscheinen zwischen September und November die, in Dolden angeordneten unscheinbaren gelbgrünen Blüten. Sie verströmen einen süsslichen Fäulnisduft, der viele Insekten anlockt, um noch die letzte Blütennahrung vor dem Winter zu verschenken. Die erbsengrossen Früchte reifen über den Winter. Gegen Februar/März hin werden die zuerst grünen Beeren dunkelbraun-blau, später fast schwarz und giftig. Schwarze Beeren symbolisieren unter anderem die Augen, den Blick. Ich verwende Efeublätterwaschungen, sprich Kompressen bei Augenentzündungenreizungen. Die in Dolden angeordneten Beeren erinnern mich an ein Insektenauge. Eine Menge an Augen die eins ergeben. Es ist ein klares Zeichen für den Kugelblick, das heisst, die Fähigkeit zu entwickeln, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das hilft, neue Haltungen einnehmen zu können und Lösungen zu finden.

Steven Wolf hat schon als Kind von seiner Grossmutter altes Pflanzenwissen gelernt und weiss um die Kraft der Natur mit all ihren sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Er lebt in Escholzmatt, wo er zusammen mit seiner Partnerin ganzheitliche Pflanzenkurse für interessierte Menschen durchführt. Im Lochweidli steht dafür eine eigens gebaute Schuljurte. www.pflanzechreis.ch
In hoher Dosierung sind alle Teile des Efeus giftig und dürfen nicht eingenommen werden. Deshalb wird Efeu nicht als Tee, sondern fast nur in Form von fertigen Arzneien angeboten. Unbedenklich ist hingegen die äussere Anwendung als Kompressen oder Öl. Die Herstellung des Efeu-Kreislauföles geht so:
Man benötigt eine gute Handvoll frische oder getrocknete Efeublätter. Die Blätter in kleinere Stücke zupfen, in ein Schraubglas geben und mit kaltgepresstem Olivenöl übergiesen. Das Olivenöl wird bis 5 Millimeter unter den Rand des Schraubglases gefüllt und verschlossen. Den Ölauszug für mindestens drei Wochen an einem warmen Ort ziehen lassen und täglich schwenken. Am Schluss absieben und in dunkle Flaschen füllen. Der Ölauszug ist für die äusserliche Anwendung, zur Massage und für Einreibungen bestimmt. Das Öl kann mit passenden, ätherischen Ölen ergänzt werden werden.
BITTERSTOFFE
Gemüse: Wegzüchten der Bitterstoffe hat seinen Preis
Steckt man einem Baby einen Löffel mit bitterem Gemüse in den Mund, folgt die Reaktion meist prompt: Der Brei wird ausgespuckt. Die Aversion gegen Bitteres hat zum Wegzüchten solcher Stoffe aus Pflanzen geführt. Das hat allerdings Folgen, schreibt geo.de. Doch dieses Wegzüchten hat das Gemüse wehrloser gemacht – nun schmeckt es auch Fressfeinden wie Nacktschnecken oder Pilzen besser. «Mit manchen alten Sorten hätten Kleingärtner womöglich weniger Sorgen», sagt Nicole van Dam vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig. Beim Weißkohl zum Beispiel gebe es eine Sorte, die zwar weniger bitter schmeckende Senfölglykoside enthalte, aber empfindlicher für den Befall mit Fadenwürmern (Nematoden) sei. Auch anderen Pflanzen wie Chicoree und Rosenkohl seien Bitterstoffe weggezüchtet worden. Generell seien Abwehrmechanismen bei vielen Sorten verloren gegangen, weil bei der Zucht lange vor allem auf die Optik geachtet wurde. «Wenn man den Pflanzen die Zähne zieht, muss man sie anders schützen», erklärt van Dam. «Man braucht mehr Pestizide.» Eine Ausnahme seien Bio-Sorten, bei deren Züchtung auch Wert darauf gelegt werde, dass sie mit wenig Pestiziden und Kunstdünger auskommen. ska

TIERVERSUCHE

575 000 Tiere für Versuche eingesetzt
In der Schweiz sind im vergangenen Jahr rund 575 000 Tiere für Versuche eingesetzt worden. Das entspricht einer Zunahme von drei Prozent. Doch nicht nur die Anzahl der Versuche war zunehmend, sondern auch die durchschnittliche Belastung der involvierten Tiere, zitiert die Schweizerische Depeschenagentur das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). So stieg gemäss neuer Tierversuchsstatistik die Anzahl Tierversuche mit dem Schweregrad 3, welche für die betroffenen Tiere mit der höchsten Belastung einhergehen, um 31 Prozent an. Gegenüber dem Vorjahr sank hingegen die Anzahl Versuche mit dem Schweregrad 0 um neun Prozent. Wie das BLV betonte, standen 93 Prozent der Tierversuche im Schweregrad 3 im Zusammenhang mit der Erforschung von Krankheiten beim Menschen. Bei etwa der Hälfte der Versuche sei es um die Erforschung von Krebs und neurologischen Krankheiten wie Demenz oder Multiple Sklerose gegangen. ska

AMEISENARTEN
20 Billiarden Ameisen weltweit –mindestens
Weltweit sind rund 15 700 Ameisenarten bekannt und beschrieben, ihre wahre Vielfalt könnte jedoch noch weit grösser sein: Biologen schätzen, dass noch einmal so viele Ameisenarten bisher unentdeckt geblieben sind. «Während die Ameisenvielfalt eindeutig entscheidend für das Funktionieren und die Erhaltung vieler Ökosysteme ist, wird das Ausmass ihres Einflusses auch durch die schiere Menge und Aktivität der Ameisen geprägt», zitiert wissenschaft.de
Patrick Schultheiss von der Universität Hongkong und der Universität Würzburg.Wie viele Ameisen es jedoch weltweit insgesamt gibt, konnte bisher nur grob geschätzt werden. Schultheiss und sein Team haben nun Daten von 465 Studien weltweit zusammengetragen, in denen Ameisen entweder mithilfe von Bodenstreuproben gezählt oder durch Bodenfallen gefangen wurden. Da letzteres jedoch eher die Aktivität von Ameisen in einem Gebiet widerspiegelt als ihre absolute Zahl, werteten die Forschenden die Daten beider Methoden getrennt aus. Zusätzlich bezogen sie noch Daten von 24 Studien zur Ameisenzahl auf Bäumen mit ein, die mithilfe von Insektizid-Einnebelungen von ganzen Baumkronen gewonnen worden waren. Aus ihren Auswertungen dieser Daten schliessen Schultheiss und sein Team, dass es weltweit allein in der Bodenstreu rund drei Billiarden Ameisen geben muss. Rechne man auch die in anderen Habitaten lebenden Ameisen hinzu, ergebe sich eine Gesamtzahl von rund 19,8 Billiarden Ameisen weltweit. ska


Babys reagieren schon im Mutterleib auf Geschmack
Schon im Mutterleib bekommen Ungeborene einiges von ihrer Aussenwelt mit: Sie hören Geräusche aus der Umgebung, nehmen durch die Bauchdecke hindurch Lichtreize wahr und ertasten, was sie umgibt. Auch der Geruchs- und Geschmackssinn entwickelt sich bereits früh: Durch im Fruchtwasser gelöste Aromastoffe probieren die Föten indirekt die Nahrung ihrer Mutter. Ein Team der Durham University in England hat nun erstmals direkt per Ultraschall beobachtet, wie Föten auf verschiedene Aromen aus der mütterlichen Nahrung reagieren. Das schreibt wissenschaft.de. Dazu liessen die Forschenden 97 Frauen in der 32. Schwangerschaftswoche entweder eine Kapsel mit Karottenpulver oder eine Kapsel mit Grünkohlpulver schlucken und beobachteten 20 Minuten danach im 4D-Ultraschall den Gesichtsausdruck des ungeborenen Babys. Bei 81 Frauen wiederholte das Team die Untersuchung zudem in der 36. Schwangerschaftswoche. Das Ergebnis: Föten, die dem Karottengeschmack ausgesetzt waren, zeigten häufiger ein Lachgesicht, während Föten, die dem Grünkohlgeschmack ausgesetzt waren, häufiger ein Weingesicht zeigten. Als Vergleichsgruppe dienten 30 Ungeborene, die zum Zeitpunkt der Beobachtung keinem Aroma ausgesetzt waren. Die Gesichtsausdrücke waren dabei in der 32. und 36. Schwangerschaftswoche ähnlich, wobei die älteren Föten in Reaktion auf den bitteren Grünkohlgeschmack noch ausgeprägter das Gesicht verzogen. ska

In der ersten November-Dekade kann das Wetter manchmal ungewöhnlich schön und warm sein. Diese Schönwetterperiode heisst «Martini-Sommer» und wird jeweils durch eine stabile Hochdrucklage verursacht, die in entsprechenden Jahren in den Weinbaugebieten eine Novemberlese möglich macht.
Der Begriff «Martini-Sommer» kann aus meteorologischer Sicht jedoch nicht wörtlich genommen werden, denn definitionsgemäss müssten für einen Sommertag Tageshöchsttemperaturen von mehr als 25 Grad gemessen werden, was im November kaum möglich ist. Da jedoch im November bereits Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auftreten können, werden Temperaturen von 20 Grad bereits als sommerlich empfunden. Solche ungewöhnliche Wärmeeinbrüche werden durch Südwestlagen oder Föhnlagen verursacht. Der Name «Martini-Sommer» stammt aus dem Mittelalter des christlichen Abendlandes und geht der Legende nach auf den heiligen Martin im französischen Tours zurück. Nach dem Besuch eines neu gegründeten Klosters soll der damalige Bischof unerwartet gestorben sein. Als sein Leichnam auf der Loire in die Stadt transportiert wurde, erfolgte ein starker Wärmeeinbruch. Die Wiesen wurden wieder grün wie im Frühling und viele Pflanzen begannen neu zu blühen. Dieses «Wunder» wurde dem heiligen Martin zugeschrieben, dessen Namenstag die katholische Kirche am 11. November feiert. Der «Martini-Sommer» gehört zu den meteorologischen Singularitäten. Dies sind Wetterlagen, die zu bestimmten Zeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten –wie z. B. die «Schafskälte» oder das «Weihnachtstauwetter» – und damit vom scheinbar normalen Witterungsverlauf eine grosse Abweichung bewirken.
Andreas Walker

BUCHTIPP
Der Badener Autor Thomas Gröbly ist Theologe und Ethiker – und er wird nicht mehr lange leben. Die Amyotrophe Lateralsklerose ALS, die bei ihm vor sechs Jahren diagnostiziert wurde und tödlich endet, schreitet unaufhaltsam voran. Dagegen lehnt sich Gröbly nicht mehr auf, aber gegen die Hoffnungslosigkeit. Und so schreibt er in seinem Poesieband «Einen Augenblick staunen» weiterhin kraftvoll gegen die Zerstörung der Umwelt durch uns Menschen an. Mit kurzen Texten und Gedichten macht er das, mit Sanftmut und der Einsicht eines Mannes, der sich mit dem Ende aller Dinge befassen muss. Im Zentrum seines Buches steht nicht sein Leiden, sondern die Zukunft seines zweijährigen Enkelkindes – und somit aller Kinder dieser Welt. Das ist es, was ihn antreibt, wenn er schreibend über neue Nachhaltigkeit nachdenkt und Ideen entwickelt, wie die Erde ein besserer Ort werden könnte, und was die Würde des Menschen und aller Wesen damit zu tun hat. «Einen Apfelbaum setz ich heute / und werde nie in seinem Schatten einen Apfel beissen», lautet eines seiner kurzen Gedichte und strömt aus, was Thomas Gröbly, seinen Enkel vor Augen, auch in der Erwartung des eigenen Sterbens antreibt: Hoffnung. kel
Thomas Gröbly: «Einen Augenblick staunen – Variationen über Sterben, Nachhaltigkeit und friedfertiges Leben», Verlag volleshaus.ch, 176 Seiten, Fr. 28.–.
Jupiter ist der grösste Planet in unserem Sonnensystem. Er kann im November von der Abenddämmerung bis nach Mitternacht (Mitte November um 22 Uhr im Süden) beobachtet werden. Der Planet wurde bereits vom italienischen Universalgelehrten Galileo Galilei (1564 – 1642) mit einem von ihm selbst konstruierten Fernrohr beobachtet. Dabei entdeckte er die vier grössten Jupitermonde, die noch heute als die Galileischen Monde bezeichnet werden. Es sind Ganymed, Kallisto, Io und Europa, die einen Durchmesser zwischen 5262 und 3122 km haben und bereits 1610 entdeckt wurden. Bis 1980 waren 16 Jupitermonde bekannt, darunter 6 mit nur etwa 20 Kilometern Durchmesser. Die Voyager-Raumsonden der 1980er-Jahre entdeckten über 40 weitere Satelliten und seit 2019 sind 79 Jupitermonde bekannt. Der Umlauf der Jupitermonde inspirierte Galileo Galilei zu einem neuen Weltbild. Damals glaubte man, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei und sich die anderen Himmelskörper um die Erde drehten. Galileo Galilei zog aus seinen Beobachtungen die richtigen Schlussfolgerungen.
Wenn Jupiter mit seinen Monden ein «MiniWeltensystem» bildete, so gehörte die Erde zu einem Verband eines grösseren Systems, indem die Sonne im Mittelpunkt stand und die Planeten, also auch die Erde, um die Sonne kreisten. Da diese Weltsicht nach Ansicht der katholischen Kirche der Bibel widersprach, wurde er verurteilt und musste 1633 der Inquisition versichern, dass er seiner Lehre von der Erdbewegung um die Sonne abschwor.
Galileo Galilei wurde erst am 31. Oktober 1992 von Papst Johannes Paul II. rehabilitiert. Die Galileischen Monde können mit wenig Aufwand beobachtet werden. Mit einem kleinen Teleskop oder Feldstecher können sie bereits beobachtet werden und man kann sehen, wie sie ihre Positionen bereits nach einigen Stunden verändert haben. In den drei Bildern sind jeweils verschiedene Konstellationen dieser vier Monde fotografiert, in der Bildmitte ist der Planet Jupiter zu sehen.
Andreas Walker
1-Jahresabo: 10 Ausgaben für CHF 89.–
2-Jahresabo: 20 Ausgaben für CHF 159.–
Name
Adresse
PLZ | Ort
Telefon
Datum
Unterschrift
Geschenkabo Lieferadresse
Name
Adresse
PLZ | Ort
natuerlich-online.ch

Online via QR-Code (www.natuerlich-online.ch/abo) oder per Mail an abo@weberverlag.ch
Talon einsenden an: Weber Verlag AG, Gwattstrasse 144, 3645 Thun / Gwatt,






Es ist Herbst. Doch wer nächsten Frühling einen naturnahen und doch gepflegten Rasen möchte, tut gut daran, sich jetzt darauf vorzubereiten. Denn wichtige Arbeiten erfolgen im Herbst und im Winter.
Walter Bühler
Ei n schöner, grüner Rasen ist auch auf natürliche, biologische Weise möglich. Das beweisen viele Gartenbaubetriebe seit längerem. Die Stadt Basel zum Beispiel pflegt ihre Rasen- und Sportplatzflächen – wenn wir den Rasen im Fussballstadion Joggeli mal ausnehmen – im öffentlichen Grün seit Jahrzenten rein biologisch. Obschon der Anspruch an einen perfekten Golfrasen im Hausgarten rückläufig ist, bleiben dennoch viele Erwartungen an ein repräsentatives «Grün», welche selbst in uns Gärtner*innen tief verankert bleibt.
Drei häufig geglaubte Irrtümer
Mit drei solchen typischerweise an den heimischen Garten gerichteten Irrtümern möchte ich gleich aufräumen. Wichtig ist: Ich grenze mich hier von normierten Sportplätzen nach DIN-Norm ab. Nein, es geht um einen schönen Rasen bei Ihnen zu Hause. Wem ein Blumenrasen mit Gänseblümchen, Günsel und Duftveilchen mehr zusagt ein monotones Grün im Garten möchte, umso besser.
Irrtum Nummer 1: «Rasenbeikräuter müssen zwingend mit Herbiziden behandelt werden, um einen schönen Rasen zu bekommen.» Dem ist aber nicht so. Zugegeben: Wer ein Haus im Grünen, nahe von Blumenwiesen oder Kulturland hat, hat sicher mit einem höheren Eintrag von Samen der genannten Rasenbeikräuter zu kämpfen als bei einer Parzelle mitten im Dorfkern. Doch es gibt noch wichtigere Faktoren. So geht das Aufkommen von Beikräutern immer mit einer mangelnden Konkurrenzfähigkeit der Rasenkräuter einher. Auf den Punkt gebracht: Ist der Rasen nicht gut mit Nährstoffen versorgt, so sind Beikräuter klar im Vorteil. Allen voran ist hier vor allem der Klee zu nennen, welcher als Leguminose Stickstoff aus der Luft binden kann. Deshalb braucht ein Rasen eine gezielte Düngung.
Irrtum Nummer 2: «Organischen Dünger kann ich nicht verwenden, er nützt sowieso nichts und stinkt.» Auch das stimmt so nicht. Korrekt ist, dass bei der organischen Düngung wie bei allen biologischen Hilfsstoffen der Zeitpunkt entscheidend ist. Sprich: Ich muss die Natur beobachten, um die bestmögliche Effizienz zu erreichen. Ein Bio-Dünger muss im Boden durch die Lebewesen zuerst mineralisiert werden, um für die Pflanzen verfügbar zu werden. Eine Faustregel lautet, den Dünger drei bis vier Wochen vor dem Zeitpunkt auszubringen, wenn der Rasen ihn braucht. Das bedeutet also nichts anderes, als dass eine Frühjahresdüngung mit organischem Dünger bereits Ende Februar erfolgen sollte. Eine weitere Kritik am organischen Dünger sind die Geruchsemissionen. In der Tat stinkt organischer Dünger etwas. Positiv ist aber, dass man aber im Vergleich zu mineralischem Dünger einen Haufen Geld einsparen und man gleichzeitig der Natur etwas Gutes tun kann.
Irrtum Nummer 3: «Frühling ist die beste Zeit, um den Rasen zu Vertikutieren.» Ja, das Frühjahr ist wirklich prädestiniert, um den Rasen zu pflegen. Persönlich würde ich jedoch das Aerfizieren dem Vertikutieren vorziehen. Was bedeutet Aerfizieren? Man stanzt kleine Zylinder aus dem Boden. Dabei werden Verdichtungen, welche durch die letztjährige Benutzung entstanden sind, wieder gelöst. In der Folge gelangt Luft in den Boden. Dies führt zu einer höheren Aktivität der Bodenlebenwesen, was wiederum eine bessere Nährstoffverfügbarkeit mit sich bringt. In sehr schweren Böden kann ich die ausgestanzten Löcher der Zylinder mit kalkarmen Sand verfüllen. Als zusätzliche, weniger stressige Option zum Vertikutieren empfiehlt sich das Striegeln im Frühling. Striegeln hat etwa die gleiche Wirkung als würde ich einen Grasrechen über die Fläche ziehen. Damit


kann man alte Grashalme und teilweise auch den Rasenfilz entfernen. Gleichzeitig wird damit das zu bekämpfende Beikraut aufgerichtet. Wenn ich anschliessend tief mähe, kappe ich die aufgerichteten Beikräuter tief am Vegetationspunkt und schwäche diese.
Lieber im Herbst als im Frühling vertikutieren
Ich komme noch mal auf das Vertikutieren zurück. Hier die Erklärung, warum das im Frühling suboptimal ist und auf was es bei der richtigen Pflegearbeit ankommt: Vertikutieren bedeutet für den Rasen enormen Stress. Da auch in Mitteleuropa der Frühling tendenziell eher trockener und der Sommer manchmal gar wüstenähnlich wird, ist Stress im Frühling, wenn doch der Rasen schnell saftig grün werden sollte, alles andere als gut. Beim Vertikutieren kann man zwar die Filzschicht im Rasen entfernen, nicht aber das Moos. Gegen Moos hilft nur eine Kombination aus einer guten Durchlässigkeit des Bodens (Sand und Splitt bei der Neusaat einarbeiten) auf der einen und einem nicht zu tiefen Schnitt (nicht unter sieben Zentimeter) auf der anderen Seite. Noch ein Wort zum Rasenfilz. Dieser entsteht durch liegengelassenen Rasenschnitt. Dieser wächst knapp über dem Boden in die Gräser ein und hemmt Wasser und Nährstoffe, welche dadurch schlechter zu den Wurzeln gelangen. Rasenfilz zu haben bedeutet nicht, dass man den Rasen schlecht pflegen würde. Denn es bleibt immer etwas Rasenschnitt zurück, auch wenn ich den Rasenschnitt aufnehme oder einen Mulchmäher verwende. In Böden mit schlechter Tätigkeit der Bodenlebenwesen bildet

er sich zudem mehr als in anderen. Ein Grund mehr, warum nicht am Anfang sondern am Ende der Rasensaison vertikutiert werden sollte, sind Hitzeschäden aufgrund der Sommertrockenheit. Ich kann vertrocknete Stellen gleich im Anschluss renovieren und nütze dabei die noch vorhandene Bodenwärme inklusive der Feuchtigkeit, welche im Herbst eher vorhanden ist, zum Keimen der Rasensamen.
Anhand der folgenden Schritte und Bilder möchte ich Ihnen nun zeigen, wie bei uns an der Gartenbauschule Oeschberg eine Rasenrenovierung im Herbst abläuft. Zu beachten ist, dass eine Renovierung nur dann sinnvoll ist, wenn nicht mehr als die Hälfte der Fläche in desolatem Zustand ist. Sind mehr als die Hälfte des Rasens von Beikraut durchsetzt, lückig und vertrocknet, empfehle ich die Flächen abzuhacken und neu anzusäen (Bild 1). Nun aber zum Vertikutieren. Zunächst einmal ist die Wettervorhersage zu beachten. Ideal ist, wenn eine Regenphase oder wechselhaftes Wetter nach dem Vertikutieren in Aussicht ist. Denn so erspare ich mir das Wässern. Als erstes gilt es den Rasen tief auf drei bis vier Zentimeter Höhe runterzumähen (Bild 2). Nicht erschrecken, wenn es etwas hellgrün bis bräunlich wird. Im Gegensatz zum Frühling steckt der Rasen das im Herbst besser weg. Nun geht es an das Vertikutieren mit der Maschine. Achten Sie darauf, dass die drehenden Messer den Boden nur anritzen. Die Messer sollten nicht tiefer als drei Milimeter in den Boden gehen, denn die Filzschicht liegt ja über dem Boden (Bild 3). Beim Vertikutieren befahre


ich die Fläche zuerst in einer Richtung und dann in der anderen quer dazu (Bild 4). Wichtig ist, dass ich den herausgerissenen Rasenfilz nach jedem Vertikutierdurchgang sauber zusammenreche (Bild 5). Jetzt mähe ich die Fläche nochmals mit dem Rasenmäher. Dabei entferne ich letzte liegengebliebene Halme und die zerzauste Fläche sieht wieder sauber aus. Bei beiden Mähdurchgängen (vor und nach dem Vertikutieren) verwende ich einen Auffangsack (Bild 6).
Jetzt wird der Rasen gedüngt. Dabei gehe ich ähnlich vor wie beim Vertikutieren und verteile zuerst die eine Hälfte des Düngers in Längs- und dann die andere in Querrichtung (Bild 7). So ergibt sich auch für die ungeübte Hand eine bessere Verteilung. Bitte beachten Sie, dass Dünger und Nährsalze die Haut angreifen können. Zu Ihrem eigenen Schutz empfiehlt es sich, Handschuhe zu tragen. Als nächster Schritt werden allfällige lückige Stellen im Rasen mit Kräuel oder Rechen leicht aufgekratzt, frisch angesät und mit einer Schneeschaufel festgeklopft. Dazu sind spezielle, regenerative Samenmischungen zu empfehlen. Diese verfügen über eine andere Zusammenstellung der Gräsersorten als jene bei Neusaaten. Das hat den Vorteil, dass sich die Lücken rasch und zu einer dichten Grasnarbe schliessen. Zum Schluss sollte die renovierte Fläche abgesperrt werden. Gerade wenn grössere Flächen neu angesät wurden, ist es von Vorteil diese gegen ein Betreten zu sichern. Falls der erhoffte Regen ausbleibt, sollte die Fläche begossen werden, damit die frischen Samen keimen und der Rasen wachsen kann.

Analog zu den drei häufig geglaubten Irrtümern gibt es aber auch drei wichtige Ratschläge, welche es bei der Rasenpflege zu beachten gibt. Hier also das «A und O» für jeden Rasen:
Ratschlag Nummer 1: «Ein gesunder Rasen sollte optimal gedüngt werden.» Zu empfehlen sind drei bis vier Gaben im Jahr (Februar, April, Juni und September).
Ratschlag Nummer 2: «Mähen, mähen und nochmals mähen!» Mindestens einmal pro Woche mähen, bis das Wachstum aufhört. Im Schweizer Mittelland wächst der Rasen in milden Wintern gut und gerne bis Mitte November.
Ratschlag Nummer 3: «Wasser ist Leben!» Rasen braucht Wasser. Bei Temperaturen über 25 Grad und ab einer Woche ohne Niederschlag ist Rasen auf Wasser angewiesen. Als Faustregel gilt, dass der Rasen 25 Liter pro Quadratmeter und Woche braucht. Es lohnt sich deshalb, einen Regenmesser aufzustellen.

Walter Bühler ist gelernter Landschaftsgärtner und Landwirt. Er arbeitet als Berufsbildner an der Gartenbauschule Oeschberg in Koppigen (BE). In seiner Freizeit interessiert er sich für Pflanzen, Permakultur und produziert unter dem Namen «Pommebastisch» leidenschaftlich gerne Cidre aus dem eigenen Obstgarten.


Der Winter ist der Samen, aus dem das Leben erwacht. Aus diesem Zauber heraus malen wir im märchenhaften Schwarzwald den Frühling, das Erwachen und das Spriessen. Unsere Malbegleiter sind Acrylfarbe und allerlei Überraschendes aus der Natur. Schicht um Schicht entsteht so ein kleiner Anfang voller Leichtigkeit und Magie.
Spaziergänge im Biosphärengebiet Südschwarzwald direkt vor unserer Hoteltür sind unsere Inspiration, der Blick weit in die Vogesen und den Feldberg unser Seelenflug. Nach erfrischenden Naturspaziergängen, einer wärmenden Sauna oder einem Glas Wein geniessen wir im Einklang mit der Natur die Ruhe des Südschwarzwaldes. Mit gleichgesinnten Menschen sind wir unterwegs und gehen in dieser Woche immer wieder neue Wege und leben dabei unsere Kreativität lebendig aus.
«Die Hände sind die Werkzeuge deiner Seele»
Reiseprogramm
1.Tag individuelle Anreise
Ihre Anreise per Bahn und Bus oder mit dem Auto. Gemeinsamer farbenfroher Willkommensdrink.
2., 3. und 4. Tag Malzauber & Natur Frühstück, danach gemütliche Spaziergänge mit oder ohne Schneeschuhe. Besuch des Museum Schniederli aus dem Jahr 1593. Nach den erfrischenden Naturspaziergängen beziehen wir am Nachmittag den hellen Frühstücksraum, unser Atelier. Genügend Zeit haben wir, um dem Zauber der Farben Platz zu geben. Kursleiterin Doris Horvath zeigt uns Tipps & Tricks und begleitet unser herzeigenes Malprojekt. Eine wärmende Sauna oder ein Glas Wein geniessen wir abends, ganz im Einklang und in der Ruhe des Südschwarzwaldes. Genussvolles Abendessen im Restaurant Bergwiese, mit allerlei Spezialitäten aus dem Schwarzwald.
5. Tag individuelle Rückreise
Gemeinsames Frühstück und individuelle Rückreise.

Kursleiterin
Doris Horvath
Kursinhalt
Malerei heisst die innere Schönheit nach aussen bringen. In diesem Sinne malen wir mitten im traumhaften Schwarzwaldwinter mit Acryl den Frühling und das Erwachen der Natur.
Kursleiterin Doris Horvath ist in Winterthur geboren, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Rheinfelden als freischaffende Malerin. An der Assenzaschule Basel (heute Visual Art Schule) hat sie ein vierjähriges Malstudium absolviert und seit fünfzehn Jahren stellt sie im In- und Ausland aus. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Kursleiterin in Rheinfelden und leitet seit mehreren Jahren Malreisen für Baumeler Reisen. So zum Beispiel in Andalusien, La Gomera, Amrum, Marokko und im Binntal im wilden Wallis. Nebenbei leitet sie die Kunstabteilung in der Privatklinik Schützen in Rheinfelden. «Die Hände sind sie Werkzeuge deiner Seele.» In diesem Sinne malt und erlebt Doris Horvath die Farben auf dem Bild. Pigmente aus der Natur sind ihr dabei die liebsten Begleiter. Der spielerische Prozess und die Freude am Ausprobieren der unterschiedlichsten Materialien begleiten sie dabei.
Weitere Informationen: www.doris-horvath.ch
Auf einen Blick:
Die Unterkunft: Berghaus Freiburg auf dem Schauinsland. Das Haus liegt auf rund 1200 Metern Höhe. Ein Ort zum Durchatmen, Ruhe geniessen und kreativ sein. Es stehen alles komfortable Doppelzimmer mit Dusche/WC zur Verfügung.
Reisetermin: 26. Februar bis 2. März 2023
Reisedauer: 5 Tage
Teilnehmer: maximal 14 Webcode: 574
Preis:
Doppelzimmer: Fr. 1460.–Zuschlag Einzelzimmer: Fr. 220.–
Im Preis inbegriffen:
• Unterkunft inkl. Halbpension
• Trinkgelder im Hotel
• Ausflüge gem. Programm
• Baumeler-Kursleiterin/Reiseleitung
• Reisedokumentation
Beratung und Buchung Markus Kellenberger Tel. 033 334 50 11 (Mo, Di, Mi) reisen@natuerlich-online.ch


Ein Angebot von «natürlich» in Zusammenarbeit mit Baumeler Reisen AG
Baumeler Reisen und «natürlich» – zwei starke Partner arbeiten zusammen und bieten «natürlich»-Leserinnen und -Lesern neu spannende Reisen zu vorteilhaften Preisen an.

Frauen können ihren Monatszyklus im Sport nutzen. So lässt sich das Training individuell gestalten. Oft mit Erfolg, wie sich in der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen zeigte.
Aurora Wildi Illustration: Sonja Berger
Wir Frauen sitzen alle im gleichen Boot – wir haben einen Menstruationszyklus, der unseren Alltag prägt. Die Menstruation galt bis vor wenigen Jahren noch als Tabu. Konnte man aufgrund von Periodenschmerzen kein Sport betreiben, wurde es oft nicht akzeptiert. Insbesondere Spitzensportlerinnen hatten keine Möglichkeit, im Training auf ihre körperlichen Bedürfnisse einzugehen. Sie trainierten im gleichen Schema wie ihre männlichen Kollegen. Die Hormone galten als störend und es gab nur wenige sportwissenschaftliche Studien, die sich mit den hormonellen Schwankungen einer Athletin auseinandersetzten. Doch das ändert sich heute.
Frauen trainieren bisher wie Männer
Die Forschung hat Frauen bis vor wenigen Jahren systematisch ignoriert, weil sie als Studiengruppe viel zu heterogen sind. Während Männer eine relativ einheitliche Gruppe bilden, müssen bei weiblichen Teilnehmerinnen mehrere Faktoren, wie zum Beispiel die Menstruation oder hormonelle Schwankungen während des Zyklus, beachtet werden. Das gilt auch im Sport. Obwohl sich der «Gender Data Gap» langsam zu schliessen beginnt, trainieren Frauen im Breiten- und Spitzensport meistens wie ein Mann. Stacy Sims, ehemalige Ausdauersportlerin und bekannte Wissenschaftlerin in der Gesundheits- und Fitnessbranche, traf den Nagel auf den Kopf als sie sagte: «Women are not small men – stop eating and training like one.»
In der Tat. Frauen sind keine klein gewachsenen Männer und entsprechend können Trainings- und Ernährungspläne von Männern nicht analog auf Frauen übertragen werden. Immer mehr Spitzensportlerinnen setzen sich für eine Enttabuisierung dieses Themas ein. Vermehrt wird nun auch aktiv in der Trainingsplanung auf den hormonellen Zyklus eingegangen und darüber gesprochen. Projekte wie «Frau und Spitzensport» von Swiss Olympics, möchten die Möglichkeit
«
Hinter dem Zyklusgesteuerten Training verbirgt sich ein enormes Potential. »
schaffen, dass Athletinnen optimal gefördert werden. Es ist also ein Thema, welches jede Frau betrifft. Um Athletinnen aber optimal sportlich zu betreuen, braucht es dementsprechend neue Methoden.
Training nach Zyklus
Das Trainieren nach Zyklus war bis vor wenigen Jahren noch komplettes Neuland. Für Frauen, und auch für Männer. Das ist schade, denn hinter dem Zyklusgesteuerten Training verbirgt sich ein enormes Potential, das Sportlerinnen gezielt ausschöpfen können. Denn, im Laufe eines Monatszyklus verändert sich der Hormonspiegel. Nutzen Frauen dieses Wissen, können sie ihr Trainingsverhalten individuell abstimmen – vorausgesetzt sie verwenden keine hormonellen Verhütungsmittel. Diese unterbinden das natürliche auf und ab der Hormone und verhindern das Heranreifen der Eizelle wie auch den Eisprung. Ob mit oder ohne Verhütungsmittel – das körperliche Wohlbefinden steht im Zentrum. Es wird nur so trainiert, wie der Körper es zulässt.
Wenn man nun den Zyklus betrachtet, der durchschnittlich 28 Tage dauert, wird erkenntlich, dass der Eisprung, auch Ovulation genannt, denn Zyklus in zwei Hälften teilt. In der ersten Zyklushälfte, der Follikelphase, produziert der Körper, unter Einfluss von reichlich Östrogen, follikelstimulierende Hormone (FSH), welche Eizellen heranreifen lassen und später den Eisprung auslösen. Das heisst also, dass im Körper direkt nach der Menstruation die Östrogenproduktion angekurbelt wird. Progesteron ist in dieser Zeit eher niedrig und somit ist auch die Körpertemperatur tiefer. Man kann besser mit der Hitze umgehen, kommt weniger ins Schwitzen und die Fettverbrennung ist erhöht.
Sobald Frau anfängt zu trainieren, wird eine Reaktion im Körper ausgelöst. Die Synapsen senden Signale an das Gehirn und dieses führt die Bewegungen aus. Befindet man sich gerade in der ersten Zyklushälfte, so ist das Hormon Östrogen vorhanden und kann genutzt werden, um mehr Energie zum Beispiel in das Krafttraining zu setzen.

Krafttraining bis zum Eisprung
In der Zeit vor dem Eisprung ist Krafttraining oder intensives Intervalltraining (HIIT) sehr effektiv. Das heisst, anstrengende Trainingseinheiten wechseln sich mit der Erholungsphase in schneller Folge ab. Dabei wird besonders der Herz-Lungen-Kreislauf angeregt sowie die Fettverbrennung. Insbesondere das Maximalkrafttraining (grösste Kraft, die ein Muskel oder eine Muskelgruppe gegen einen Widerstand ausübt) kann aufgrund des erhöhten Östrogenlevels noch effektiver sein. Aber auch Übungen wie Planks, bei denen mit dem Eigengewicht die Körpermitte, wie auch der ganze Körper trainiert wird, Rumpfbeugen (Crunches) oder Liegestützen sind zu empfehlen. Bis zum Eisprung, also am 14. Tag des Zyklus, können die Intensität der Übungen und auch die Trainingseinheiten immer weiter gesteigert werden. Durch das erhöhte Östrogenlevel steigt auch die Energie, viele Frauen fühlen sich in dieser Zeit so, als könnten sie Bäume ausreissen. Dazu kommt, dass Sehnen und Bändern dehnbarer sind.


Neben dem Krafttraining ist die Zeit vor dem Eisprung auch ideal für Dehnübungen. Mobilisieren, Dehnen oder Yoga fördern das Körpergefühl und wirken Verspannungen entgegen. Kombiniert mit den Kraftübungen wird mit Hilfe der Dehnungsübungen die Gelenksstabilität aufrechterhalten. Natürlich immer mit der nötigen Vorsicht, denn aufgrund des weicheren Bindegewebes und der erhöhten Beweglichkeit sollte sie nicht forciert, sondern kontrolliert ausgeführt werden. Wenn Frauen in dieser Zeitspanne Ausdauersport betreiben, zum Beispiel Joggen oder Radfahren, haben sie eine höhere Fettverbrennungsrate und einen geringeren Eiweissabbau. Besonders ausgeprägt ist dieser Nutzen in der frühen und späten Follikelphase. Das heisst, Ausdauertraining ist kurz nach der Menstruation und kurz vor dem Eisprung am effizientesten. Die Intensität des Trainings kann noch bis kurz nach dem Eisprung hochgehalten werden.
In der zweiten Zyklushälfte geht es gemächlicher zu und her. Das Hormon Progesteron beginnt zu steigen, während die Konzentration von Östrogen allmählich sinkt. Progesteron wirkt als Gegenspieler zu Östrogen und betrifft eher den Abbaustoffwechsel. Das heisst, dass die Körpertemperatur steigt und zugleich der Eiweissabbau erhöht ist. Die Krafterhaltung spielt in dieser Phase deshalb eine wichtige Rolle. Für Sportlerinnen heisst das, dass der ganze Trainingsumfang eher reduziert werden sollte und der Fokus auf Koordination und Prävention liegt. Das Sprichwort «Weniger ist mehr» trifft hier bestens zu. Ein leichtes Krafttraining mit weniger Gewichten aber mehreren Wiederholungen, Schwimmen oder Pilates tun dem Körper in dieser Zeit sehr gut. Nun ist auch Ruhe und Regeneration angesagt. Entspannungsmethoden oder Massagen regen die Durchblutung von Haut und Muskeln an. Nach dem intensiven Training während der Follikelphase ist diese Erholung und Stabilisierung wichtig, um im nächsten Zyklus optimal wieder zu starten.
Während der Menstruation gibt es kein richtig oder falsch. Es gilt das Motto: «go with the flow.» Man soll nur das tun, was sich gerade gut für den Körper anfühlt. Natürlich ist es je nach Frau unterschiedlich – für manche ist Krafttraining optimal, andere nehmen sich eine Auszeit vom Sport und die nächsten geniessen eine leichte Yoga-Session. Nicht zuletzt auch, um allfällige Menstruationskrämpfe zu lindern.
Jeder weibliche Körper ist verschieden. Das heisst, in den meisten Fällen können keine vorgefertigten Trainingspläne einfach so übernommen werden. Ein zyklusorientierter Trainingsplan, der auf Frau X abgestimmt ist, kann nicht auf Frau Y übertragen werden. Hier muss im Hinterkopf behalten werden, dass die individuellen Bedürfnisse und Empfindungen der Frauen angepasst sein. Oft braucht es etwas Zeit, bis man den perfekten Rhythmus für sich selbst gefunden hat.
Auch wenn die meisten Untersuchungen und Interviews mit Spitzensportlerinnen durchgeführt werden, die auf höchstem Niveau trainieren, können auch wir Ottonormalverbraucherinnen von diesem Konzept profitieren. Dabei ist es in erster Linie wichtig, sich mit dem eigenen Zyklus zu befassen. Führen Sie ein Periodentagebuch, schriftlich oder als App (Flo). In diesem können Sie protokollieren, in welcher Phase Sie welche Beschwerden haben oder was sich besonders gut anfühlt. Solch eine Auseinandersetzung ist auch deshalb positiv, weil man den eigenen Körper auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Offene Gespräche mit anderen Frauen geben Einsichten darüber, was andere Frauen gegen Periodenschmerzen tun oder welche Sportarten sie gerne machen.
Auch die Schweizer Fussball Nationalmannschaft der Frauen trainiert zyklusgesteuert. Die Fussballerinnen tracken den Zyklus über eine App auf dem Smartphone, in der sie ihre Beschwerden und Empfindlichkeit eintragen können. Mit Erfolg. Sie fühlen sich leistungsfähiger, können effizienter trainieren und verhindern auch Verletzungen, wie der Beitrag von SRF Impact «Menstruation und Leistungssport» vom 22.6.2022, berichtet. Das Zyklusgesteuerte Training befindet sich zwar noch in der Anfangsphase, es ist jedoch anzunehmen, dass es sich grundsätzlich für alle Sportarten im Spitzen- und Breitensport eignet. Noch fehlen Langzeiterfahrungen, doch eines ist klar: Trainiert man mit den Zyklusphasen, entsteht eine Harmonie im Körper. Wir gehen liebevoller und achtsamer mit ihm um und beherzigen, dass jede Frau ihren Körper am besten kennt und weiss, was sich gut anfühlt.

Jedes Mal, wenn ich Freunden und Bekannten schildere, dass ich seit geraumer Zeit beim ErfahrungsMedizinischen Register arbeite, muss ich zunächst sekundenlang in fragende Gesichter schauen – und mir danach die eine, immer gleiche Nachfrage anhören: «Erfahrungsmedizin? Was ist das?» Automatisch leite ich dann auf Komplementär- und Alternativmedizin über. Aber ist das auch tatsächlich korrekt? – Entscheiden Sie selbst.
Maurizio Schianchi
Die Rede ist von Bezeichnungen, die als Überbegriff für eine Vielzahl diagnostischer und therapeutischer Verfahren benutzt werden, die ausserhalb der konventionellen Medizin bzw. der Schulmedizin stehen. Davon gibt es zahlreiche: von Naturmedizin, Volksmedizin, Ganzheitsmedizin, Sanfter Medizin bis hin zu Komplementärmedizin, Alternativmedizin, Integrativer Medizin, Erfahrungsmedizin. Welche Begriffe jeweils vorherrschen, hängt nicht zuletzt von Faktoren nationaler, sprachlicher, historischer, kultureller und sozialer Natur ab. Und, wie nicht anders zu erwarten, stehen hinter so vielen Begriffen mindestens so viele Definitionen. Folglich kann es sie nicht geben – die orts- und zeitunabhängige, allgemeingültige Definition.
Komplementär- und Alternativmedizin sind bekannter
Weit verbreitet sind hierzulande heute die Bezeichnungen «Komplementärmedizin» und «Alternativmedizin» – wobei sie mitunter synonymisch verwendet werden, obwohl «komplementär» genau genommen «ergänzend» zur Schulmedizin und «alternativ» vielmehr «anstelle» der Schulmedizin meint.
Warum dann Erfahrungsmedizin?
Warum hält also das ErfahrungsMedizinische Register EMR, das nicht nur Pionierarbeit in der Qualifikationsdefinition und Qualitätssicherung von Therapeut:innen in dem Bereich geleistet hat, sondern auch heute quantitativ und qualitativ die Nummer 1 auf diesem Markt ist, nach wie vor an der weniger gängigen Bezeichnung «Erfahrungsmedizin» fest?
Die Erfahrung in den Mittelpunkt zu stellen, hat mehrere Gründe. Die EMR-Methodenliste umfasst heute rund 200 Behandlungsmethoden zur Feststellung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten und Störungen sowie zur Gesundheitsförderung: Zahlreiche Methoden, die sich den Komplementärtherapien zuordnen lassen, andere, die eher zur Alternativmedizin zu zählen sind, aber auch weitere Methoden wie Musiktherapie oder Psychomotorik. Darum der Überbegriff Erfahrungsmedizin, der sowohl mündlich und schriftlich überlieferte traditionelle Medizinsysteme aus aller Welt als auch neu entwickelte unkonventionelle medizinische Verfahren umfasst. Viele dieser Methoden basieren auf jahrhundertelanger Tradition. Man denke
nur an Grossmütter, Dorfälteste oder Kräuterfrauen und Chrüütermannli mit ihren Hausmittelchen und Verfahren, die über Jahrhunderte positive Effekte gezeigt haben: Sie alle haben aus direkter oder überlieferter Erfahrung praktiziert. Jedoch wurden sie von der Schulmedizin mehr und mehr in die Ecke gedrängt.
Die Erfahrungsmedizin zieht ihren Erkenntnisgewinn im Gegensatz zur Schulmedizin nicht aus klinischen Studien, sondern aus langjähriger Beobachtung von Patient:innen und ihren Krankheitsverläufen – mit Untersuchungsverfahren und Heilmethoden, die aus solchen individuellen Verlaufs- und Therapiebeobachtungen entstanden sind.
Zunehmend mehr Forschung, Studien, eidgenössische Abschlüsse
Dass viele erfahrungsmedizinische Behandlungsverfahren kaum mit naturwissenschaftlichen Methoden erforscht wurden und individuelle Therapiebeobachtungen im Vergleich zur Schulmedizin eine geringere wissenschaftliche Evidenz haben, ist unbestritten. Das soll aber kein falsches Bild der aktuellen Erfahrungsmedizin abgeben. Auch dieser Bereich des Gesundheitswesens gründet zunehmend auf Studien und Forschung – immer weniger nur auf Beobachtungen. Die Anzahl Ausbildungen mit eidgenössischen Abschlüssen steigt ebenfalls stetig.
Vorbei sind auch die Zeiten, als sich jede und jeder Therapeutin oder Therapeut nennen konnte und Krankenkassen und Patient:innen keinen Überblick hatten – spätestens seit Entstehung des EMR und des EMR-Qualitätslabels. Geblieben ist der zentrale Aspekt, wonach Erfahrungen, Gedanken und Emotionen der Patienten:innen nicht zuletzt den Ansatzpunkt vieler Methoden darstellen und Anwendungen und Anwender:innen sich auch auf Werte des Erfahrungswissens berufen.
Die Anstrengungen des EMR zur Stärkung der erfahrungsmedizinischen Branche und zu deren Anerkennung und Akzeptanz als sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin haben gewiss mit dazu beigetragen, dass heute beinah zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung entsprechende Methoden nutzen und 9 von 10 Befragten sie als sinnvoll und wirksam erachten. So lautet das Ergebnis der 2021 vom EMR initiierten bevölkerungsrepräsentativen Erhebung zu Verbreitung, Nutzung und Behandlungserfolg der Erfahrungsmedizin in der Schweiz: das KAM-Barometer.1)
Die Ergebnisse der Meinungsumfrage 2021 basieren auf einer repräsentativen Online-Panelerhebung. Wie die Studienüberschrift «KAM-Barometer» bereits andeutet, soll es jedoch nicht bei einer Momentaufnahme belassen werden: Das EMR will auch künftig den jeweiligen Puls der Zeit fühlen, Veränderungen frühzeitig wahrnehmen und Trends erkennen. Aber auch Datenvolumen und Befragungsmodi sollen eweitert werden. Eine analoge Umfrage wurde deshalb auch in sozialen Medien lanciert.
Ihre Meinungen und Erfahrungen sind uns wichtig.
www.polyquestonline.ch/goto/kam-barometer
ErfahrungsMedizinisches Register EMR 1999 entstand das EMR, weil der Bedarf nach einem Label zur Qualitätssicherung in der Komplementär- und Alternativmedizin (KAM) aufgekommen war. Auslöser war die 1994 erfolgte Revision des Krankenversicherungsgesetzes, die der Rückvergütung komplementär- und alternativmedizinischer Leistungen über die obligatorische Grundversicherung endgültig den Riegel vorschob. Fortan sollten sich diese Leistungen über die private Zusatzversicherung finanzieren. Für Versicherer wie auch Therapeut:innen stellte sich so die Frage nach einem neuen Leistungsanerkennungs-Modell. Die Lösung fand man in der Entwicklung des EMR-Qualitätslabels. Seit 1999 prüft das EMR Erfahrung, Kompetenzen, jährliche Fortbildungen und den Umgang mit Patient:innen von Therapeut:innen im KAM-Bereich und zeichnet sie mit dem EMR-Qualitätslabel aus, das für die meisten Versicherer die Grundvoraussetzung darstellt, um entsprechende Leistungen über private Zusatzversicherungen zu vergüten.
Wie finde ich qualifizierte Therapeut:innen? Und werden ihre Leistungen von meiner Versicherung rückerstattet? Das sind Fragen, die sich die meisten von Ihnen wohl immer wieder stellen.
Qualifizierte Therapeut:innen erkennen Sie am EMR-Qualitätslabel: Aktuell sind rund 24 500 Therapeut:innen für rund 200 Behandlungsmethoden und Berufsabschlüsse EMR-zertifiziert und von den meisten Versicherern anerkannt. Und Sie finden sie am einfachsten und schnellsten auf www.emr.ch
1) Die Umfrage führte das auf dem Gebiet spezialisierte Institut Polyquest AG mit methodischer Unterstützung der Büro Vatter AG durch. Quelle: Christian Bolliger, Markus Simon (2021). KAM-Barometer – Studie zu den Erfahrungen der Schweizer Bevölkerung mit der Komplementär- und Alternativmedizin. Initiiert und herausgegeben vom ErfahrungsMedizinischen Register EMR. Basel

Vom Einkauf bis zu der Kommunikation: Vieles tun wir im Alltag nur noch digital. Das kann effizient und bequem sein, aber auch zur echten Belastung werden. Umso befreiender ist eine «Offline-Zeit» – insbesondere der Kanton Bern bietet hierzu ideale Voraussetzungen.
Elisha Nicolas Schuetz
Wir sind «always on»: Das Smartphone vibriert, die Hintergrundmusik plätschert vor sich hin und der Laptop ist allzeit griffbereit. Die Angst, etwas zu verpassen, belastet nicht nur viele Nutzer von Social Media & Co., denn die Hektik der digitalen Revolution kann ganz generell überfordern. Teil dieser digitalen Gesellschaft zu sein, bereitet zunehmend Stress sowie Konzentrations- und Schlafstörungen. Infolgedessen mutiert das Handy plötzlich zum anstrengenden und lästigen Begleiter. So wird in einer Zeit ständiger Erreichbarkeit und extensiver Nutzung digitaler Gadgets immer häufiger eine sogenannte «Offline-Zeit» empfohlen, um den «digitalen Stress» im Alltag auszugleichen. Digital Detox kann durchaus sinnvoll sein, um den eigenen digitalen Konsum sowie sein Verhalten zu reflektieren und allenfalls gar zu verändern.
Rein in die «Offline-Welt»
Digital Detox könnte man als Gegenbewegung zum digitalen Rausch bezeichnen – statt permanent auf den Bildschirm zu starren, wird der Reichtum der realen Welt erlebt, bewusster wahrgenommen und dadurch gespürt, was wirklich wichtig ist. Dies führt auch zu mehr Raum
für neue Ideen und Inspirationen. Dennoch: Ein kalter Entzug ist für extreme Digital-Junkies eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Stattdessen sollten sie wohl eher langsam vorgehen und sich behutsam auf die «Offline-Welt» einstellen. Nichts eignet sich dafür besser, als sich einige Tage in die Natur zurückzuziehen, den «Always-on-Modus» vorübergehend auszusetzen – und in Hotels zu übernachten, welche sich der ganzheitlichen Entschleunigung verschrieben haben. Quasi als Geschwindigkeitsbegrenzung bei unserem digitalen Rausch.
Insbesondere der Kanton Bern verfügt über zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten, die sich hervorragend zur Entschleunigung eignen; der Kanton ist sozusagen die Detox-Hochburg der Schweiz. Denn die ursprüngliche, unberührte Natur der Region ist der ideale Ort, um aus dem Alltagstrott zu entfliehen. Viele Betriebe haben weder Fernseher noch Wifi – und meistens wird auch ganz bewusst auf die ständige Musikberieselung im Hintergrund verzichtet. Wie im geschichtsträchtigen Hotel Rosenlaui im Berner Oberland, wo weder Fernsehen, Radio noch Internet vorhanden sind. Stattdessen: Ruhe
geniessen, die Augen über die prachtvolle Bergwelt und saftig grünen Wiesen schweifen lassen und den nervenaufreibenden Alltag vergessen. Der Gebrauch von digitalen Geräten sowie Fotografieren ist in den öffentlich zugänglichen Räumen nicht erlaubt. Zwitschernde Vögel und plätschernde Bäche statt klingelnder Handys, echtes Naturidyll statt leuchtender Bildschirme.
An wunderbarer Lage und in familiärer Atmosphäre entschleunigen und mal wieder richtig durchatmen, während kein Handygeklingel die Ruhe stört – dies ist auch im 1910 erbauten Hotel Waldrand-Pochtenalp bei Kiental im Berner Oberland möglich. Das im typischen Chaletstil erbaute Nostalgiehotel hat nicht einmal Handy-Empfang. Zurück in die Vergangenheit, wie zu Grossmutters Zeiten. Den Ausstieg aus der digitalen Welt schafft der gestresste Zeitgenosse bestimmt auch im Hotel Simmenfälle an der Lenk. Das Hotel hat sich ganz bewusst der digitalen Enthaltsamkeit verschrieben: extra elektromagnetisch abgeschirmte Zimmer, keinerlei Wifi, eine 24/7-handyfreie Zone. Man wolle keine Handystrahlung, heisst es lakonisch auf der Hotel-Webseite. Doch nicht nur digitales Detox wird hier betrieben, sondern auch Rauchen ist nicht gestattet. Dafür können die Gäste die entspannte Ruhe, herzliche Gastfreundschaft und die herrliche Naturidylle um die malerischen Simmenfällen an der Lenk direkt vor der Haustüre geniessen. Eine gemütliche Wanderung zur nah gelegenen Barbarabrücke oder zur Quelle der Simme, den «Siebe Brünne», lohnt sich jederzeit.
Reizüberflutung ade
Das sympathische Berghaus Niesen bietet derweil auf 2340 Metern acht gemütlich-rustikale Zimmer, ein atemberaubendes Panorama – und null Ablenkung. Auf dem markanten Niesengipfel, der sich wie eine Pyramide am Thunersee erhebt, können sich die Gäste wunderbar vom Alltagsstress erholen. Wer Ruhe pur geniessen möchte, ist hier exakt richtig. Glücklich schätzen können sich jene Gäste, welche sich während einer klaren Nacht auf dem Niesen aufhalten – die unzähligen Sterne am Himmelszelt funkeln wie in einem kitschigen Film. «Digital Detox» wird auch im traditionellen Hotel Engstlenalp aus dem Jahr 1892 in der Region Meiringen-Hasliberg zelebriert: keine Berieselung mit Hintergrundmusik, kein Internet, weder Telefon noch Radio oder Fernseher stören hier die Ruhe der Gäste. Stattdessen bieten die Nostalgiezimmer von anno dazumal wie auch die modern eingerichteten Zimmer eine unvergleichliche Sicht auf die spektakuläre Berglandschaft. Das Hotel legt zudem grossen Wert auf Nachhaltigkeit. So wird das Warmwasser mittels der eigenen Sonnenkollektoren erhitzt, im Winter mit Holz geheizt und Strom aus der eignen Wasserkraft erzeugt. In dieser einmaligen Landschaft lassen sich in der Tat wunderbar die Batterien wieder aufladen – weit weg von Zivilisation, Reizüberflutung und Lärm. Digital Detox eben.

Das Hotel Simmenfälle an der Lenk hat sich ganz bewusst der digitalen Enthaltsamkeit verschrieben.

Wer sich einer kompletten Detox-Kur unterziehen möchte, dem sei das Alpina Gstaad empfohlen; im Six Senses Spa werden gleich mehrere Angebote präsentiert, die das Thema Detox integrieren – von Yoga-Detox bis hin zum Anti-Aging-Programm. Im Fokus steht dabei nicht nur die Reinigung des Körpers, sondern gleichwohl auch die Stärkung des Immunsystems. Derweil ist das 2000 Quadratmeter grosse Six Senses Spa ein luxuriöser Ort des Wohlbefindens. Ein hochmodernes Fitnesscenter mit privaten Trainern, ein Yogastudio, eine Salzgrotte und diverse Poolanlagen runden das Angebot ab. www.thealpinagstaad.ch
Das Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken steht seit jeher für einen gehobenen Genuss. Im exklusiven Spa Nescens hat die Hektik definitiv keinen Zutritt. Zum ganzheitlichen Angebot gehören auch Better-Aging-Programme wie Ostheound Physiotherapie, Ernährungsberatung, kosmezeutische Behandlungen sowie Sport-Coaching. Die Better-Aging-Programme von Nescens helfen Risikofaktoren zu erkennen und falsche Lebensgewohnheiten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das Forschungsteam von Nescens hat das Angebot entwickelt, medizinische Spezialisten betreuen die Gäste vor Ort. www.victoria-jungfrau.ch



Faszien in Bewegung


Info-Abend: 11. Jan.
3 Jahre, ASCA u. SGfB-anerk

Info-Abend: 16. Jan.
3 Jahre, SGfB-anerk.

Faszientraining Beckenboden
«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt.»
Neu: Finanzierung Ihrer Ausbildung durch Bundesbeiträge Mit Option zum eidg. Diplom
Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP
Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung.
Dipl. Paar- und Familienberater/in IKP
Ganzheitliche systemische und psychosoziale Beratung sowie Coaching-Tools rund um Beziehungen.
Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden. IKP Institut, Zürich und Bern
Seit 40 Jahren anerkannt

Neuroathletik Basic –Training des Nervensystems

Nahrung fürs Blut –Eisen, Vitamin B12, Folsäure und Co.

Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Antoinette Bärtsch, Pete Kaupp, Renate von Ballmoos, Marcel Briand, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Kokopelli Guadarrama, u. a.
Nächster Ausbildungsbeginn: Samstag/Sonntag 25./26. März 2023
«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»
Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen
Tel. 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch
Mehr als 500 Kurse, durchgeführt von erfahrenen Fachdozenten.

Shaolin Power Qi Gong

Manualmedizinische Manipulations- und Mobilisationstechniken





Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.
Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit
Kurhaus St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch

BEA-Verlag, 5200 Brugg 056 444 22 22, bea-verlag.ch

AUSBILDUNG
Die naturheilkundliche osteopathische Therapieform 4 mal 3 Tage, manuelle Arbeit, effektiv und ganzheitlich umgesetzt. 24. März bis 22. Oktober 2023 mit Tobias Hauser, Inhaber des Deutschen Zentrums für BowenTherapie und Heilpraktiker. Die Anwendung erfolgt hauptsächlich über die oberflächlichen Faszien des Körpers und entfaltet so ihre Wirkung auf den Menschen. Bestimmte Schlüsselstellen im Körper werden mit den Händen sanft stimuliert. Darüber hinaus ist sie eine wertvolle Ergänzung für Berufsbilder, die im Rehabilitations-, Präventions-, Coachingoder Wellness-Bereich angesiedelt sind. LIKA GmbH, Stilli b. Brugg, 056 441 87 38, www.lika.ch/bowen-therapie
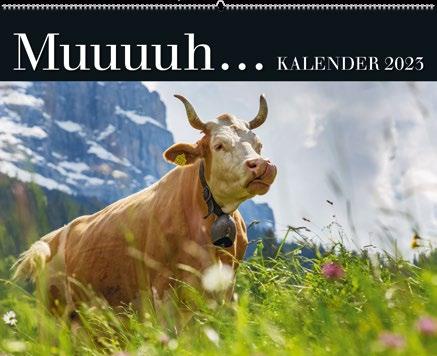
Muuuuh… Kalender 2023

KOMPLEMENTÄRTHERAPIE
Die Craniosacral Therapie ist eine sanfte, ganzheitliche Körpertherapie, die sich bei Beschwerden, Schmerzen und Krankheiten bewährt hat. Sie dient der Linderung von Ängsten und Erschöpfungszuständen und stärkt das Immunsystem. Mit ruhenden Berührungen unterstützen Craniosacral Therapeut*innen den Prozess der Selbstregulation. Zusatzversicherungen übernehmen in der Regel mindestens einen Teil der Behandlungskosten.
Auf www.craniosuisse.ch finden Sie weitere Informationen und eine Liste qualifizierter Therapeutinnen und Therapeuten.
Marcus Gyger, 14 Blätter, 43 × 34,5 cm, Spiralbindung
ISBN 978-3-03818-392-1 , CHF 25.– | EUR 20.–Jetzt bestellen.
Kühe prägen das Bild der Schweizer Alpen bis heute. Und so vielfältig wie die Schweizer Alpwirtschaft sind auch deren Kühe. Ob rotbuntes Simmentaler Fleckvieh, Glarner Braunvieh oder das doch eher exotische Schottische Hochlandrind – der wunderschöne Kalender des Fotografen Marcus Gyger zeigt in bestechenden Bildern die Vielfalt der vierbeinigen Alpenbewohner der Schweiz. Und das alles vor dem Hintergrund einer herrlichen Berglandschaft, wie sie nur in den Alpen zu finden ist.
bestellen Sie online oder per Mail: www.weberverlag.ch, mail@weberverlag.ch
Seit 30 Jahren setzen sich Solarspar-Mitglieder für die Zukunft ein: 100 Solar-Anlagen sparen in der Schweiz jährlich über 2000 Tonnen CO2 ein. Mit Ihrer Unterstützung bauen wir weiter.
www.solarspar.ch/mitmachen



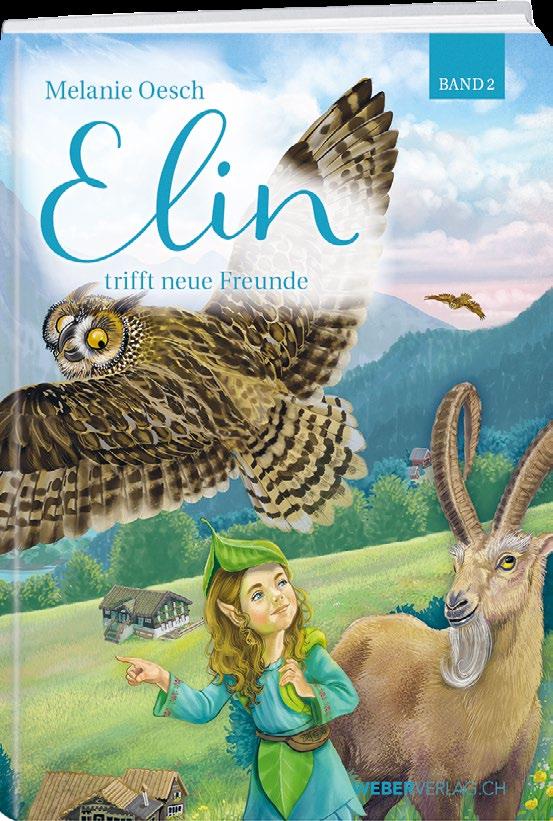

Das kleine Baumzwergenmädchen Elin geniesst zusammen mit ihrer Familie ein glückliches Leben in den Wäldern des Eriztals.
AUCH IM BUCHHANDEL ERHÄLTLICH

SCHREIBSET ELIN
Jeden Tag nach der Schule tollt sie mit ihren Brüdern durch das Gehölz und fordert die Spaziergänger zum gemeinsamen Spiel auf. Doch auf einmal ist alles anders: Die Passanten scheinen weder Zeit noch Lust zu haben, mit Elin zu spielen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin, der weisen Waldohreule Berta, schmiedet Elin den Plan, den Menschen wieder Freude ins Herz zu bringen …
Das kleine Baumzwergenmädchen Elin geniesst mit ihrer Familie ein glückliches Leben in den Wäldern des Eriztals. Jeden Tag tollt sie mit ihren Brüdern herum und fordert die Spaziergänger zum Spiel auf. Doch auf einmal haben diese weder Zeit noch Lust dazu. Da schmiedet Elin mit der Waldohreule Berta den Plan, den Menschen wieder Freude zu bringen
SCHREIBSET ELIN
Elins Abenteuer geht weiter! Bertas alter Schulfreund Harry der Waldkauz lädt Elin und Berta zu sich nach Hause in Habkern ein. Der beschwerliche Weg nach Habkern führt über den steilen und unwegsamen Grünenbergpass, wo sie auf einen alten Bekannten treffen – den Steinbock Alex. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Habkern, wo der grosse Alpabzug bevorsteht. Elin und Berta mischen sich unter die Zuschauenden, als Berta plötzlich jäh zu Boden gerissen wird
Elins Abenteuer geht weiter! Bertas alter Schulfreund Harry der Waldkauz lädt Elin und Berta zu sich nach Habkern ein. Der beschwerliche Weg führt über den steilen Grünenbergpass, wo sie auf den Steinbock Alex treffen. Als sie dem Alpabzug zuschauen, wird Berta plötzlich jäh zu Boden gerissen
Autorin: Melanie Oesch, Illustratorin: Christina Wald
Autorin: Melanie Oesch
Illustratorin: Christina Wald
60 Seiten, 21,5 × 28,7 cm, gebunden, Hardcover Inkl. Hörbuch mit Bonus-Song, mit 25 Illustrationen
Autorin: Melanie Oesch, Illustratorin: Christina Wald
Das kleine Baumzwergenmädchen Elin geniesst mit ihrer Familie ein glückliches Leben in den Wäldern des Eriztals. Jeden Tag tollt sie mit ihren Brüdern herum und fordert die Spaziergänger zum Spiel auf. Doch auf einmal haben diese weder Zeit noch Lust dazu. Da schmiedet Elin mit der Waldohreule Berta den Plan, den Menschen wieder Freude zu bringen … Bringen auch Sie Ihren Mitmenschen Freude ins Herz, zum Beispiel mit einem handgeschriebenen Brief auf unserem wunderschön illustrierten ElinBriefpapier!
Das kleine Baumzwergenmädchen Elin geniesst mit ihrer Familie ein glückliches Leben in den Wäldern des Eriztals. Jeden Tag tollt sie mit ihren Brüdern herum und fordert die Spaziergänger zum Spiel auf. Doch auf einmal haben diese weder Zeit noch Lust dazu. Da schmiedet Elin mit der Waldohreule Berta den Plan, den Menschen wieder Freude zu bringen … Bringen auch Sie Ihren Mitmenschen Freude ins Herz, zum Beispiel mit einem handgeschriebenen Brief auf unserem wunderschön illustrierten Elin-Briefpapier!
Illustratorin: Christina Wald
48 Seiten, 21,5 × 28,7 cm, gebunden, Hardcover Inkl. Hörbuch, mit 25 Illustrationen
60 Seiten, 21,5 × 28,7 cm, gebunden, Hardcover, inkl. Hörbuch.
ISBN 978-3-03818-177-4 CHF 29.–
60 Seiten, 21,5 × 28,7 cm, gebunden, Hardcover, inkl. Hörbuch mit Bonus-Song.
23,5 × 16,5 × 1,5 cm Schreibset mit Schreibblock (25 Blätter A5), 25 Couverts C6 und Elin-Bleistift
ISBN 978-3-03818-117-0 CHF 29.–
ISBN 978-3-03818-176-7, CHF 29.–

Bestellung
Bestellung
ISBN 978-3-03818-177-4, CHF 29.–
23,5 × 16,5 × 1,5 cm Schreibset mit Schreibblock (25 Blätter A5), 25 Couverts C6 und Elin-Bleistift
ISBN 978-3-03818-302-0 CHF 15.–
Melanie Oesch wurde 1987 geboren und wuchs in der Nähe von Thun im Kanton Bern auf. Bereits mit fünf Jahren stand das Gesangstalent zum ersten Mal auf der Bühne. Mittlerweile ist sie schweizweit bekannt als Frontfrau der erfolgreichen Schweizer Volksmusikformation Oesch’s die Dritten. Mit «Elin – Das Baumzwergenmädchen» erscheint im Weber Verlag ihr erstes Kinderbuch.
ISBN 978-3-03818-302-0, CHF 15.–
Melanie Oesch wurde 1987 geboren und wuchs in der Nähe von Thun im Kanton Bern auf. Bereits mit fünf Jahren stand das Gesangstalent zum ersten Mal auf der Bühne. Mittlerweile ist sie schweizweit bekannt als Frontfrau der erfolgreichen Schweizer Volksmusikformation Oesch’s die Dritten. Mit «Elin – Das Baumzwergenmädchen» erscheint im Weber Verlag ihr erstes Kinderbuch.
Bitte senden Sie mir ___ Ex. «ELIN DAS BAUMZWERGENMÄDCHEN»
Bitte senden Sie mir ___ Ex. «ELIN TRIFFT NEUE FREUNDE» zum Preis von je CHF 29.– (inkl. Versandkosten).
Name/Vorname
Bitte senden Sie mir ____ Ex. «Elin – das Baum zwergenmädchen»
Adresse
Bitte senden Sie mir ____ Ex. «Elin Trifft neue Freunde» zum Preis von je CHF 29.– (inkl. Versandkosten).
Bitte senden Sie mir ___ Ex. «SCHREIBSET ELIN» zum Preis von je CHF 15.– (inkl. Versandkosten).
PLZ
Bitte senden Sie mir ____ Ex. «Schreibset Elin» zum Preis von je CHF 15.– (inkl. Versandkosten).
Talon einsenden / faxen an: Werd & Weber Verlag AG, Gwattstrasse 144, 3645 Thun / Gwatt, Fax 033 336 55 56 oder bestellen Sie online oder per Mail: www.weberverlag.ch, mail@weberag.ch
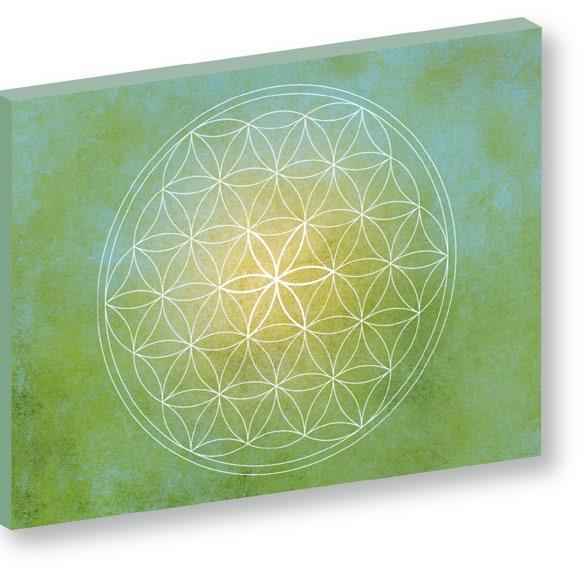
FENG-SHUI
Wandbilder für ein harmonisches Fliessen der
Die Wandbild-Gestaltungen von Anima Pura beruhen auf Feng-Shui-Grundsätzen. Sie bringen die Atmosphäre eines Raumes in ein gutes Gleichgewicht und erleichtern ein harmonisches Fliessen des Qi. Mit ihren klaren Formen und Farben wirken sie unaufdringlich und fein. Anima PuraWandbilder eignen sich für Räume für Therapie, Erholung, Meditation und zum Wohnen.
Lassen Sie sich inspirieren auf: www.anima-pura.ch

U MAMI!
Zellavie® Bio-Wietofu ist eine tofuartige Zubereitung aus hochwertigen, regionalen Bio-Hanfsamen und Wasser. Probieren Sie es aus, verwenden Sie Wietofu in Ihren Lieblingsrezepten, anstelle von Fleisch und Tofu.
Jetzt bestellbar auf zellavie.ch

MASSIVHOLZ
Genuss pur!
Verwöhnen Sie Ihre Familie und Freunde gerne mit Speis und Trank? Der geölte Holztisch mit seiner samtig anfühlenden Oberfläche lädt zum Verweilen ein. Wir schreinern Ihren Wunschtisch nach Mass, aus erlesenem heimischem Massivholz, langlebig und renovierbar. Für gemütliche und genussvolle Stunden am edlen Esstisch – kontaktieren Sie uns www.holzx-schreiner.ch

ERKÄLTUNGSZEIT
Mit der Kraft ätherischer Öle: Der Duft der Kneipp ® Badekristalle Erkältungszeit Nacht wirkt in Verbindung mit der wohltuenden Wirkung des warmen Wassers entspannend. Der Körper wird angenehm durchwärmt und in der Erkältungszeit auf das Einschlafen vorbereitet. Mit natürlich pflegenden Ölen.
Erhältlich auf kneipp.swiss
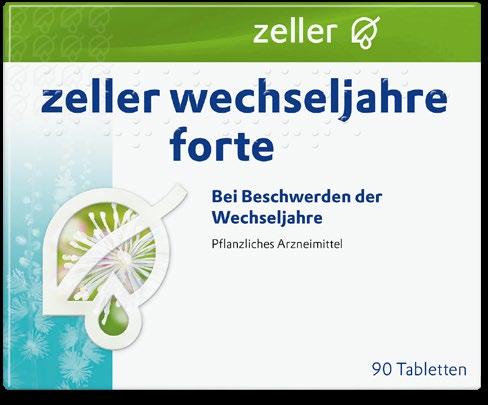
WECHSELJAHRE
Cool durch heisse Zeiten.
Zeller wechseljahre/forte ist ein pflanzliches Arzneimittel mit einem Extrakt aus Traubensilberkerze. Es wird eingesetzt gegen Wechseljahrbeschwerden wie: Hitzewallungen, Schweissausbrüchen, Schlafstörungen, Nervosität und Verstimmungszuständen.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn

Aqua Dynamic-Wasserbett mit 100 % stabilisierter Wassermatratze, inkl. Wärmesystem, inkl. Lieferung und Montage im Wert von Fr. 2 030.–. Mehr Infos auf www.wasserbett.ch.

Lösung des Rätsels aus dem Heft 10/2022 Gesucht war: Akupressur
Vorname Name
Strasse PLZ / Ort
Lösung

Und so spielen Sie mit: Senden Sie den Talon mit der Lösung und Ihrer Adresse an: Weber Verlag, «natürlich», Gwattstrasse 144, 3645 Gwatt Schneller gehts via Internet: www.natuerlich-online.ch/raetsel
Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist der 23. November 2022. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinnen Sie 1 Aqua Dynamic-Wasserbett im Wert von Fr. 2 030.–.

IMPRESSUM
41. Jahrgang 2022, ISSN 2234-9103 Erscheint 10-mal jährlich Druckauflage: 22 000 Exemplare Verbreitete Auflage: 20 182 Exemplare (WEMF/KS beglaubigt 2022)
Kontakt
mail@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch
Redaktion, Herausgeber und Verlag
Weber Verlag AG , Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun Tel. +41 33 336 55 55, leserbrief@natuerlich-online.ch www.weberverlag.ch
Verlegerin
Annette Weber-Hadorn a.weber@weberverlag.ch
Verlagsleiter Zeitschriften Dyami Häfliger d.haefliger@weberverlag.ch
Chefredaktor
Samuel Krähenbühl, s.kraehenbuehl@weberverlag.ch
Leser*innenberatung
Sabine Hurni, s.hurni@weberverlag.ch
Weitere Autor*innen
Samuel Krähenbühl, Gundula Madeleine Tegtmeyer, Blanca Bürgisser, Sabine Hurni, Leila Dregger, Fabrice Müller, Lioba Schneemann, Markus Kellenberger, Steven Wolf, Walter Bühler, Aurora Wildi, Maurizio Schianchi, Elisha Nicolas Schuetz, Susanne Gedamke
Grafik/Layout: Shana Hirschi, Nina Ruosch
Copyright Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung durch den Verlag. Für unverlangte Einsendungen wird jegliche Haftung abgelehnt.
Anzeigenleitung
Dino Coluccia, Tel. +41 76 324 64 45 d.coluccia@weberverlag.ch
Anzeigenadministration/Marketing Blanca Bürgisser, Tel. +41 33 334 50 14 b.buergisser@weberverlag.ch
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Aboverwaltung abo@weberverlag.ch, Tel. 033 334 50 44
Druck
Vogt-Schild Druck AG, CH-4552 Derendingen
Bildnachweise
Andrea Abegglen: Seiten: 3, 24
Sonja Berger: Seiten: 34-37
Andreas Walker: Seiten: 46-47
Walter Bühler: Seiten: 48-49
Angela Bernetta: Seite:19
ABONNIEREN
Einzelverkaufspreis Fr. 9.80
Abonnement 1 Jahr Fr. 89.–Abonnement 2 Jahre Fr. 159.–Preise inkl. MwSt. www.natuerlich-online.ch/abo

Auf die richtige Haltung am Arbeitsplatz kommt es an Dombreuss-Therapie.
Wirbel und ihre Verbindung zu den Organen. Pohltherapie. Wie können Schmerzen ohne Medikamente bekämpft werden? Urintherapie. Körpersaft mit heilender Kraft.
Weihnachten. Güetzi mit Kindern backen.
«natürlich» 12/22 erscheint am 24. November 2022
Kontakt /Aboservice: Telefon 033 334 50 44 oder abo@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch
Eva Rosenfelder
Kälte kriecht in die Knochen. Trotzdem stapfe ich durch die Nebellandschaft und geniesse den würzigen Duft des Waldes. In einer Lichtung stosse ich auf wackere, grüne «Jungspunte»: stramme Tännchen spriessen hier eins neben dem anderen, züchtig wie kleine Befehlsempfänger. Doch was bewegt sich denn dort hinten? Ich zwänge mich der Einzäunung entlang, um besser zu sehen. Ein Greifvogel sitzt zusammengeduckt am Boden, flattert, strauchelt… Ich finde ein Schlupfloch, pirsche vorsichtig näher. Der Zeichnung nach muss es ein Mäusebussard sein. Verborgen im Gestrüpp, beobachte ich ihn: Nach ein paar vergeblichen Flügelschlägen kippt der Vogel ermattet auf die Seite. Offensichtlich hat er ein gröberes Problem und ich bin drauf und dran, die Wildvogelhilfe zu informieren.
Über uns kreist ein weiterer Vogel, ruft: «Wiii, wiiii!», warnt … So will ich noch etwas zuwarten und schauen. Ob es sich um den oder die Lebensgefährt*in handelt? Ähnlich wie die Rabenvögel bleiben auch Bussardpaare meist lebenslang zusammen. Sie verteidigen ihren auserwählten Horstbaum gegen Konkurrenz und im April legt das Bussardweibchen zwei bis drei Eier ins Nest hoch oben in einer Laubbaumkrone. Über einen Monat brütet sie diese aus, danach versorgen die Eltern gut sechs Wochen lang die Kleinen im Nest. Ein anstrengendes Unternehmen, denn ein erwachsener Mäusebussard frisst selbst pro Tag drei bis vier Mäuse, hat er im Frühling seine ganze Familie samt Küken zu versorgen, gilt es täglich 40 –5 0 Mäuse, Amphibien oder Aas zu erbeuten. Auch die Winter sind hart, vor allem, wenn bei Schnee und Kälte keine Mäuse mehr hervorkommen. Oft findet man deshalb am Rand von Autobahnen Bussarde, die auf Kadaver lauern.
Wie die Rabenvögel sind auch Mäusebussarde extrem liebevolle Eltern. Selbst wenn die Jungen bereits fliegen können, begleiten sie ihre Kinder und führen sie bis zu zehn Wochen ins Bussardleben ein. Gut ein halbes Jahr sind diese intelligenten Greifvögel mit ihrer Brut be-

schäftigt, was die Lebenserwartung extrem verbessert – fast die Hälfte der Jungvögel überleben.
Habe ich es nun hier in der Baumschule mit einem kranken Altvogel oder einem Jungspunt zu tun? Schwer zu sagen. Auch Männchen und Weibchen lassen sich farblich nicht unterscheiden, nur anhand der Grösse: Eine Bussardin bringt etwa ein Kilogramm auf die Waage, während die Männchen nur knapp 800 Gramm wiegen. Doch aus Distanz ist das kaum zu beurteilen.
Gerade bewegt sich der Vogel wieder, versucht nochmals aufzustehen, strauchelt. Sichtlich erschöpft sitzt er jetzt da, um unverhofft und ganz langsam zur Seite zu sinken. Er schlägt nochmals kurz mit den Flügeln, dann übergibt er seinen Kopf der Erde, als würde er sich zur Ruhe legen. Ein Zucken, er kippt um, streckt seine Beine …, und es wird still. Was ist geschehen mit ihm? Hat er sich an Pestiziden vergiftet? Mäusegift? Ist er verletzt? Alt? Unerfahren? Fragen tosen in mir, Empörung, Trauer, Hilflosigkeit, um dann mehr und mehr abzuebben … Kein Vogel, kein Geräusch ist mehr zu hören hier, nur Stille breitet sich aus. Alle Wesen schweigen. Als hätte sich Zeit und Kälte in Nichts aufgelöst, sitze ich da und spüre mitten in diesem Wald Andacht, Frieden. Die Hingabe dieses «Himmeladlers» – Bussarde sind dem Adler in Bewegung und Körperform sehr ähnlich – an die Erde und an das Unausweichliche seines Schicksals berührt mich tief. Während ich langsam in unsere tosende Welt zurückkehre, fühle ich etwas von diesem stillen Leuchten in mir, das ich hoffe, noch lange bewahren zu können.
Eva Rosenfelder ist Autorin/Journalistin BR. In ihrer Serie schreibt sie über kleine und grosse Glücksmomente des Alltags. Mehr über die Autorin und ihre Angebote erfahren Sie unter www.natur-und-geist.ch

Seit über 20 Jahren zeichnet das ErfahrungsMedizinische Register EMR qualifizierte, erfahrene Therapeut:innen der Komplementär- und Alternativmedizin mit dem EMR-Qualitätslabel aus – für fast alle Krankenversicherer auch die Grundvoraussetzung, um deren Leistungen zu vergüten.
Finden auch Sie Therapeut:innen mit EMR-Qualitätslabel ganz einfach mit der Suchfunktion auf emr.ch
Mehr zum EMR erfahren Sie aus der Publireportage in diesem Heft