Psoriasis
Der Ursache auf den Grund gehen
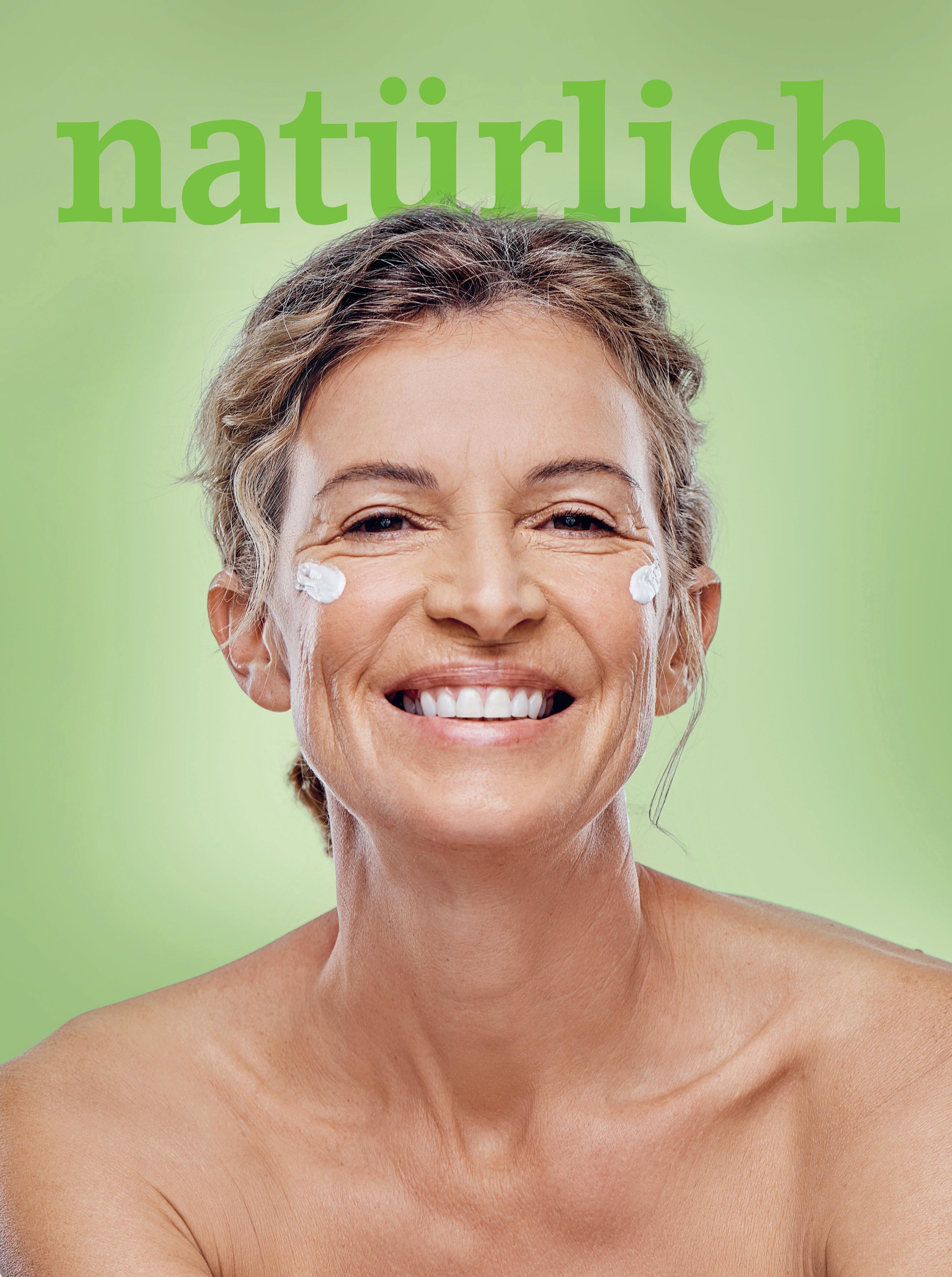
Tattoos
Viele Stiche, eine Aussage
Hautpflege
Gesichtsmasken selber herstellen
Tierwelt
So viele Tiere, so viele Häute
Haut
Mehr als nur ein vielseitiges Organ
Berühren Nahrung für die Seele

Psoriasis
Der Ursache auf den Grund gehen
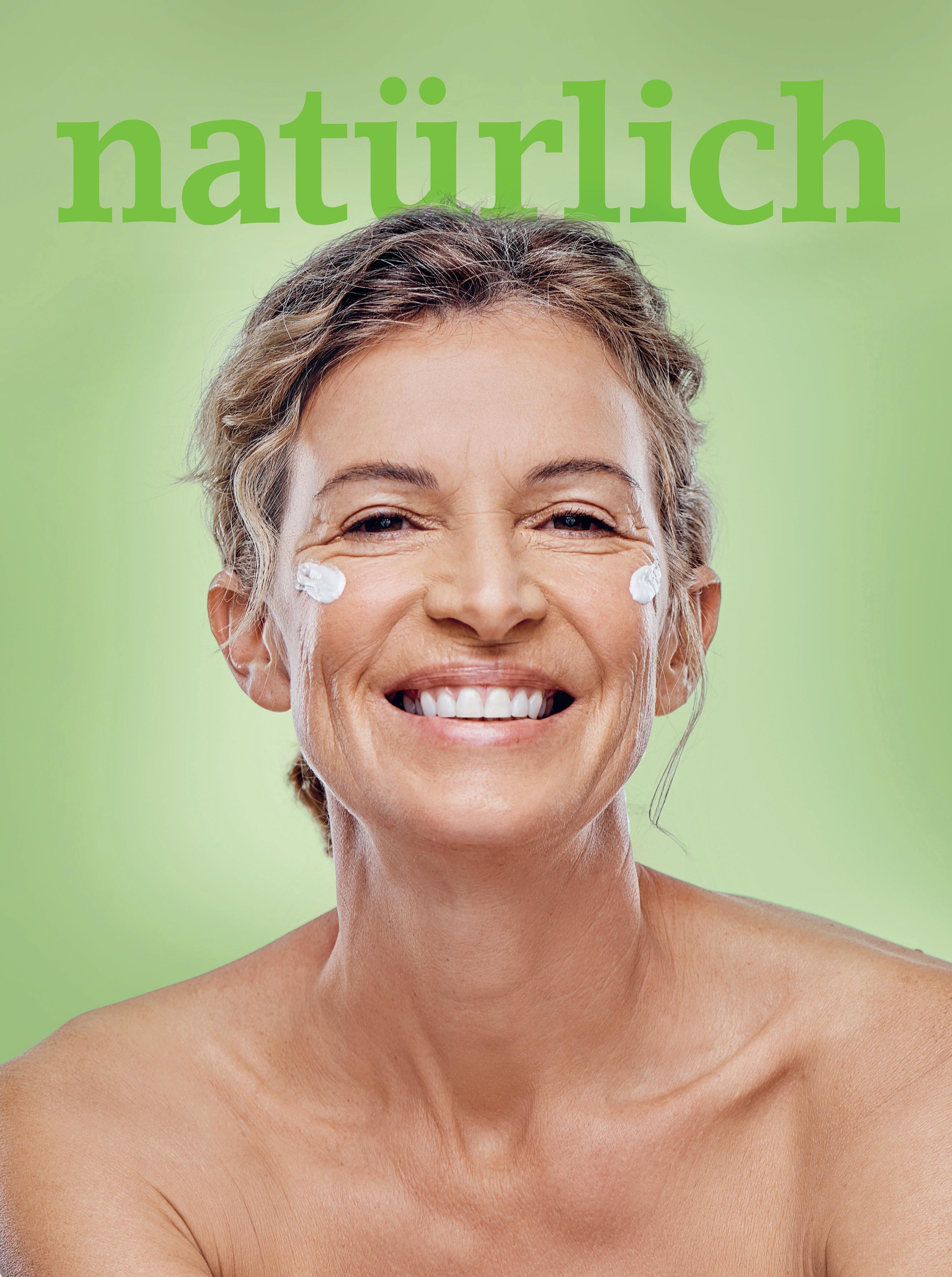
Tattoos
Viele Stiche, eine Aussage
Hautpflege
Gesichtsmasken selber herstellen
Tierwelt
So viele Tiere, so viele Häute
Haut
Mehr als nur ein vielseitiges Organ
Berühren Nahrung für die Seele
Dank nachhaltiger Zusammenarbeit mit Bio Suisse seit 1993.


1 von über 3700 Produkten










Liebe Leserin, lieber Leser






Durch die schonende Verarbeitung von frischem Bio-Kurkuma in der Schweiz bleibt das charakteristische Aroma und alle Inhaltsstoffe der Kurkumawurzel vollständig erhalten!

In der deutschen Sprache gibt es viele Redensarten, die mit der Haut zu tun haben. Spannend daran ist, dass es in einigen buchstäblich ums nackte Überleben geht: «Die eigene Haut retten», «Mit heiler Haut davonkommen», «Jemandem die nackte Haut retten». Dann gibt es einige Sprichwörter, welche das Wohlbefinden zum Thema haben: «Da möchte man aus der Haut fahren», «Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken», «Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut», «Es geht mir unter die Haut». Sogar der Charakter wird mit der Haut in Verbindung gebracht: «Eine ehrliche Haut», «dünnhäutig sein». Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Themenkreis des Aussehens: «Er ist nur noch Haut und Knochen.»



Es kann kein Zufall sein, dass der Volksmund derart vielfältige Ausdrucksweisen zum Organ Haut geprägt hat. In Wikipedia lesen wir beim Artikel zum Thema Haut folgendes: «Die Haut ist funktionell das vielseitigste Organ eines menschlichen oder tierischen Organismus.» Ja, man kann die Haut mit Fug und Recht als eierlegende Wollmilchsau unter den Organen bezeichnen.
Es würde zu weit führen, hier alle Funktionen der Haut im Detail aufzulisten. Denn die Haut ist äusserst komplex. Zum einen gibt es nicht nur «eine» Haut. So sind etwa die Schleimhäute ganz anders aufgebaut als etwa die Lederhaut an den Extremitäten. Denn die Haut ist kein homogenes Konstrukt. Sie besteht aus mehreren Schichten und enthält ihrerseits ganz viele Gefässe, Rezeptoren oder etwa auch Haarfolikel.
Wir können deshalb in dieser Ausgabe auch nur Streiflichter zum sehr breit gefassten Thema bringen. Das tun wir aber sehr vielfältig. Von Hautkrankheiten wie der Schuppenflechte über selber gemachte Hautpflegeprodukte bis hin zu den verschiedenen Häuten in der Tierwelt und vieles mehr versuchen wir, Ihnen ein richtiges Kaleidoskop zur Thematik Haut zu zeigen.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Mix in der neusten Ausgabe von «natürlich» gefällt. Und wenn Sie das nächste Mal ein Sprichwort aus dem Themenkreis der Haut verwenden, denken Sie daran, wie wichtig dieses oft genannte, aber trotzdem wenig beachtete Organ für uns ist!
Samuel Krähenbühl

Chefredaktor
Zellavie Bio Kurkuma eignet sich hervorragend für alle Diäten und Therapien mit Kurkuma, da der Curcumin-Gehalt doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Pulvern ist.


Es entfaltet sich auch goldig froh in Ihren Getränken und Gerichten.
Herzensbilder schenkt professionelle Familienfotografien.
Dort, wo ein Kind oder Elternteil schwer krank ist oder wo ein Kind viel zu früh oder still geboren wird. In aufwühlenden Zeiten übermittelt Herzensbilder Botschaften, die von Verbundenheit, Tapferkeit und Liebe sprechen.
Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung !

Verein Herzensbilder
Postfach, 8157 Dielsdorf
mail@herzensbilder.ch
Spenden
IBAN CH42 0900 0000 8529 5327 3
Postfinance Bern herzensbilder.ch/unterstuetzung



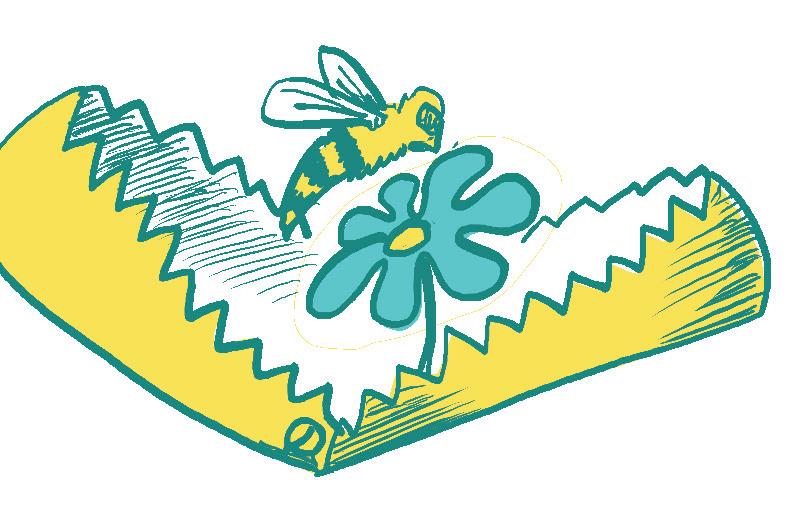
GESUND SEIN
8 Hautsache gesund
Das Gesicht einfach und doch gut pflegen.
12 Unter die Haut
Tätowieren ist in. Wir sagen, auf was dabei zu achten ist.
16 Haut zum Essen gern
Tierische Häute stecken in überraschend vielen Lebensmitteln.
18 Sabine Hurni über … … Getreidegras.
22 Leserberatung
Starke Menstruationsbeschwerden: Was hilft wirklich?
GESUND WERDEN
26 Schuppenflechte
Viele Ursachen, viele Wege zur Heilung.
30 Berühren
Über die Haut berühren wir die Seele.
34 Allergien
Allergien sind lästig. Doch es gibt Wege zur Besserung.
38 Krebs
Der sanfte Weg gegen den aggressiven Parasiten
44 Heilpflanzen
Nachtviole –Das scharfe Energiebündel
DRAUSSEN SEIN
48 Jedem Tier seine Haut
Die Häute in der Tierwelt sind extrem unterschiedlich.
56 Permakultur
Mit und nicht gegen die Natur arbeiten.
60 Bewusst in die Zukunft
Immer mehr Projekte beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit.
62 Wellness
Spezielle Behandlungen für schöne Haut


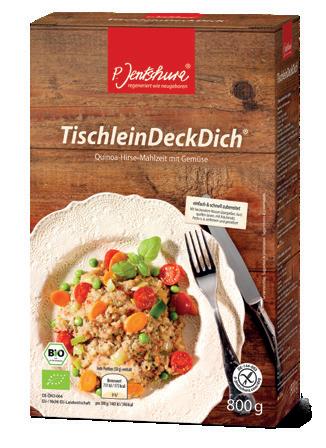
Sag Hallo zu 100 % Natürlichkeit & abwechslungsreichem, basischem Genuss
Das leckere Familienfrühstück für den perfekten Start in einen erfolgreichen Tag!
Mit mehr als 100 pflanzlichen Zutaten für eine omnimolekulare Vital- und Nährstoffversorgung!
Zaubert im Handumdrehen himmlisch gesunde Leckereien für Gross und Klein!
04 Editorial / 06 Leben und heilen / 18 Rezepte / 25 Liebesschule / 43 Alice im Wunderland / 52 Staunen und wissen / 55 Neu und gut / 55 Hin und weg / 64 Rätsel / 66 Eva unterwegs / 67 Vorschau

Kostenlos Proben bestellen
p-jentschura.com/nch18
Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ www.jentschura-shop.ch

Fussball Ärzt*innen fordern Kopfball-Verbot für Kinder
Das ärztliche Fachpersonal der Hamburger Asklepios Klinik Nord haben gemäss rp-online.de ein Verbot von Kopfbällen im Fussball mit Kindern unter zwölf Jahren gefordert. Die medizinischen Fachpersonen – darunter Neurolog*innen, Hals-Nasen-Ohren-Spezialist*innen und Kinderchirurg*innen –kritisierten zugleich die Haltung des Deutschen Fussball-Bundes, der auf altersgemässe Regelungen setzt. Die Ärzte der Hamburger Asklepios Klinik riefen den DFB auf, sofort Position gegen das frühe Kopfballspiel zu beziehen und das Kopfball-Training für Kinder unter zwölf Jahren auszusetzen. Eine schottische Studie hatte 2019 bei Fussballer*innen ein erhöhtes Risiko dafür gefunden, an Demenz oder Alzheimer zu sterben. Eine Antwort auf die Frage, ob Kopfbälle schwere Gehirnerkrankungen auslösen könnten, gibt es bisher nicht. ska

Blutdruck senken ohne Medikamente
Bluthochdruck steigert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Um den Blutdruck zu senken, sind nicht immer Medikamente nötig. Wie der ganzheitliche Ansatz der Naturheilkunde helfen kann, zeigen die NDR Natur-Docs. Behandelt wird gemäss ndr.de mit verschiedenen Verfahren, deren Wirksamkeit in Studien belegt ist. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Bei Rheuma, Polyneuropathie oder Arthrose ebenso wie bei Krebs, Burnout oder Hauterkrankungen kann die Naturheilkunde helfen. Statt Tabletten gegen schlechte Blutwerte einzunehmen, kann Fasten viel bewirken. In der Naturheilkunde gibt es eine Reihe von Tiefenentspannungsverfahren, die gegen Bluthochdruck und Stress wirken. Wichtig ist es, den Körper einmal am Tag so richtig runterzufahren. Auch extreme Kälte kann gegen Bluthochdruck helfen. Ähnlich wie die Kältekammer wirken auch Wassergüsse nach Kneipp, die man auch zuhause machen kann. Auch Bewegung hilft, den Blutdruck auf natürliche Weise zu regulieren. Wer sich ohne Leistungsdruck auspowern möchte, kann zum Beispiel Wassergymnastik machen. ska
Körpergrösse
Proteinüberschuss lässt Mädchen grösser werden
Wie gross Kinder später einmal werden, hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist die Ernährung. Welche Rolle die Eiweisszufuhr im Kinder- und Jugendalter für die spätere Grösse von Mädchen und Jungen hat, haben Forschende in einer Langzeitstudie untersucht. Gemäss einer Meldung von «wissenschaft.de» können zu viele Proteine bei Mädchen zu einer grösseren Statur führen. So ist ein durchschnittliches Plus von täglich sieben Gramm Eiweiss mehr als empfohlen mit einer Erhöhung der Erwachsenenkörpergrösse um einen Zentimeter verbunden. Bei Jungen dagegen zeigte sich keine Verbindung zwischen Proteinkonsum und Körpergrösse. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Mädchen 0,8 bis 0,9 Gramm Eiweiss pro Kilogramm Körpergewicht, also beispielsweise 48 Gramm Proteine für eine 60 Kilogramm schwere Jugendliche. Schon eine zusätzliche Aufnahme von sieben Gramm Eiweiss mehr am Tag ist der Studie zufolge bei Mädchen mit einer Erwachsenengrösse von einem Zentimeter mehr assoziiert. ska




Die Haut, im Volksmund oft als «Körper der Seele» bezeichnet, will sorgsam gepflegt sein. Dafür braucht es keine teuren Cremes in schicken Tiegeln. Denn was der Haut guttut, findet man auch in der Küche und im Garten.
Text:
Andreas Krebs
Die Haut ist das grösste Organ des Menschen. Sie wird im Volksmund oft als «Spiegel der Seele» bezeichnet. Auch Redewendungen weisen auf die enge Verbindung von Haut und Psyche hin, etwa «das geht einem unter die Haut», «das juckt mich nicht» oder «das ist zum aus der Haut fahren». Und tatsächlich haben Hauterkrankungen wie Nesselsucht (unterdrückte Wut) oder Neurodermitis (Stress) oft psychischseelische Ursachen. So überrascht es nicht, dass gemäss einer neuen europäischen Studie fast jede*r dritte Hautkranke auch unter psychischen Problemen leidet. Die Psychohygiene ist also elementar für die Haut. Dazu zählt die Selbstliebe ebenso wie regelmässige Entspannung und gute soziale Kontakte.
Die Haut verwöhnen
Darüber hinaus freut sich die Haut über liebevolle Zuwendung. Regelmässige Trockenbürstenmassagen sorgen nicht nur für eine gute Durchblutung, was den Kreislauf anregt und das Immunsystem stärkt, sondern auch für ein gesundes Hautbild. Peelings, Masken und Cremes sind weitere Verwöhnmöglichkeiten für die Haut. Auf teure und abfallintensive Produkte kann man dabei in aller Regel verzichten. Produkte mit langen Zutatenlisten, darunter Mineralöle, Mikroplastik, Konservierungsstoffe und so weiter, kommen für Purist*innen ohnehin nicht in Frage. Auf ihre Haut kommt nur, was sie auch essen oder trinken würden. Vitamin C zum Beispiel, Olivenöl, Kamille, Lavendel, Löwenzahn, Quark oder Honig (Rezepte siehe Seite 11). Das wollen wir uns genauer ansehen.
Zutaten für die Hautpflege
Vitamin C wirkt entzündungshemmend und antioxidativ: Es macht freie Radikale unschädlich und schützt so unsere Zellen. Zudem fördert es – regelmässig und langfristig angewendet – ein ebenmässiges Hautbild und ist für die Produktion von Kollagen unverzichtbar. Grosse Teile des Bindegewebes bestehen aus diesem Protein, das für die Elastizität von Blutgefässen, Sehnen, Bändern und Haut sorgt. Eine gute Vitamin-C-Versorgung (innerlich wie äusserlich) geht mit einer erhöhten Kollagenproduktion einher. Die Haut bleibt so länger elastisch, hat eine höhere Spannkraft und neigt nicht so stark zur Faltenbildung. Ein einfaches Vitamin-C-Gesichtswasser besteht aus destilliertem Wasser, in dem man Vitamin-C-Pulver aus der Drogerie oder Apotheke («Ascorbinsäure») auflöst. Wichtig ist die

Konzentration: Am besten fängt man mit einer fünfpro zentigen Lösung an, um die Haut daran zu gewöhnen. Im Laufe der Zeit kann man die Konzentration auf bis zu maximal zwanzig Prozent erhöhen. Am besten in einer Braunglasflasche im Kühlschrank aufbewahren und innert drei Monaten aufbrauchen. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen; Augenpartie aussparen.
Lindenblüten pflegen die Haut nicht nur, sie wirken an heissen Tagen auch wunderbar erfrischend. Dazu einen Tee zubereitet, abkühlen lassen, in eine Sprühflasche abfüllen und bei Bedarf auf Gesicht und Hals sprühen. Man kann auch Wattepads in kaltem Lindenblütentee tränken und zehn Minuten auf die strapazierten Augen legen. Das wunderbar erholsam und pflegt zugleich die zarte Haut um die Augen.
Lavendelblüten fördern, als Gesichtswasser angewandt, die Durchblutung der Haut, erneuern die Zellen und lassen die Haut frisch glänzen. Dazu einfach morgens einige Blütenstängel in 0,1 Liter warmes Wasser eintauchen und tagsüber stehen lassen. Abends ist das wohlriechende, milde Gesichtswasser fertig. Im Kühlschrank hält es eine Woche.
Löwenzahnblüten kann man als Pads verwenden. Damit wird die Haut zart und weich. Dazu zwei Handvoll Blüten mit einer Tasse heissem Wasser übergiessen, ziehen und auf Körpertemperatur abkühlen lassen. Dann die Blüten leicht ausdrücken und als natürliche Packung für mindestens zehn Minuten auf das Gesicht legen. Anschliessend die Haut mit dem Löwenzahntee abwaschen.

Kamillenblüten unterstützen die Wundheilung, beugen Infektionen vor und beruhigen die Haut. Dazu einfach einen Tee aufbrühen, abkühlen lassen und dann damit die Wunde betupfen oder mit einer Kompresse einen Umschlag machen. Letztere höchstens zehn Minuten auf der Wunde belassen.
Ackerschachtelhalm enthält reichlich Kieselsäure und Mineralstoffe. Eine Salbe daraus ist besonders wertvoll für Menschen mit trockener, rauer und/oder juckender Haut. Auch zur regelmässigen Hautpflege bei Psoriasis und Neurodermitis ist sie wunderbar geeignet, da sie die Haut effektiv beruhigt und auch aufbaut.
Olivenöl enthält mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die Vitamine A und E sowie Antioxidantien. Es wirkt der Faltenbildung entgegen und spendet Feuchtigkeit. Man kann Cremes ein paar Tropfen beigeben oder das Olivenöl gleich pur anwenden, etwa bei trockener Haut und spröden Lippen.
Naturjoghurt respektive die darin enthaltenen Milchsäurekulturen gleichen den pH-Wert der Haut aus und unterstützen so die natürliche Hautbarriere; das Milchfett und die Feuchtigkeit lassen die Haut praller und gepflegter aussehen.
Quark spendet nicht nur Feuchtigkeit, er enthält auch Kalzium und andere wertvolle Mineralstoffe. Als Bestandteil von Gesichtsmasken wirkt er entspannend und feuchtigkeitsspendend. Ausserdem eignet er sich dank seiner Konsistenz prima dazu, andere Zutaten zu binden, damit sie sich leicht auftragen lassen.
Honig fördert die Wundheilung, etwa bei spröden Lippen. Ausserdem wirkt er antiseptisch. Gesichtsmasken beigemischt versorgt er die Haut mit Vitaminen und Mineralstoffen.
Zitrusfrüchte enthalten viel Vitamin C, das der Hautalterung vorbeugen kann (siehe oben). Die enthaltenen Fruchtsäuren haben einen leicht peelenden Effekt und beeinflussen den pH-Wert der Haut positiv.
Zucker, Salz oder Kaffeesatz eignen sich als Zutaten für Peelings.


Rezepte für Peelings, Gesichtsmasken und -wässer
Peelings wirken tiefenreinigend und bereiten die Haut für die nachfolgende Pflege vor. Gesichtsmasken immer auf gereinigte Haut auftragen; empfindliche Augenpartie aussparen. Nach der Einwirkzeit mit warmem Wasser gründlich abwaschen. Die aufgeführten Mengen reichen für eine Anwendung an Gesicht und Dekolleté.
1. Olivenöl-Zucker-Peeling
Ideal für raue Hautpartien wie Füsse, Ellbogen und Knie. Dort entfernen die groben Zuckerpartikel, unterstützt vom Zitronensaft, Hornhaut; das Olivenöl macht die Haut zusätzlich zart und geschmeidig.
• 2 EL Kristallzucker
• 2 EL Olivenöl
• 1 TL Zitronensaft
Zutaten gut vermischen und das Peeling am besten unter der Dusche anwenden. Nicht zu stark schrubben und nicht bei empfindlichen Hautpartien anwenden.
2. Kokos-Kaffee-Peeling
Mit dieser weniger groben Mischung kann auch die Gesichtshaut gepeelt werden.
• 2 TL Kaffeesatz
• 1 EL Kokosöl
Zutaten gut mischen. Gesichtshaut damit drei Minuten peelen, dann Gesicht mit Wasser abspülen und, bei Bedarf, eine Gesichtsmaske auftragen.
Es gibt viele weitere natürliche Produkte, die der Haut schmeicheln, Entzündungen hemmen und die Regeneration oder Wundheilung unterstützen. Dazu zählen z. B. Holunderblüten, Ringelblumen, Schafgarbe, Gurken und Heilerde, aber auch Mandel- oder Jojobaöl. Wer mag kann damit experimentieren und auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Rezepte kreieren. Als Inspiration stellen wir nachfolgend einige einfache Rezepte vor, die Sie 1:1 oder individuell ab -



3. Honig-Quark-Maske
Beruhigt, spendet Feuchtigkeit und wirkt wundheilend bei strapazierter und aufgerauter Haut.
• 2 EL Quark
• 2 TL Honig
• 1 TL Kurkuma (optional)
• 1 TL Olivenöl
Alle Zutaten gut miteinander verrühren. Die Maske 10 bis 30 Minuten einwirken lassen, danach mit Wasser abspülen.
4. Maske für trockene Haut
Spendet besonders viel Feuchtigkeit und beruhigt trockene und gereizte Haut. Die Milch lindert Rötungen, die Haferflocken lösen trockene Hautschüppchen und haben eine glättende Wirkung.
• 1 TL Honig
• 3 EL Milch
• 3 EL gemahlene Haferflocken
Zutaten gut mischen und auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen. 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser abnehmen und allenfalls Tages- oder Nachtcreme auftragen.
5. Maske für reife Haut
Macht die Haut weicher und nährt sie.
• ½ Glas pürierte Bananen
• 1 TL Mandelöl
Gut mischen und die Masse für 15 Minuten auf dem Gesicht belassen. Danach gut mit lauwarmem Wasser abspülen.
6. Maske für fettende Haut
• ½ Glas pürierte Gurken
• 2 TL Zitronensaft
Gut mischen, die Masse auftragen und für 10 bis 15 Minuten auf dem Gesicht belassen. Danach gut mit lauwarmem Wasser abspülen. Man kann auch einfach dünne Gurkenscheiben auf fettiger Haut einwirken lassen.

7. Maske für straffe Haut
Diese Maske sollte man nicht öfters als einmal pro Woche anwenden.
• ½ TL Kokosöl
• 1 Eiweiss
• ½ TL Zitronensaft
Alles gut verrühren und auf das Gesicht auftragen. 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, dann gründlich mit lauwarmem Wasser und einem weichen Lappen abwaschen, und zwar mit kleinen, kreisenden Bewegungen. So werden lose Hautschüppchen abgetragen.
8. Maske bei Akne
Diese Maske hilft, regelmässig angewendet, bei Unreinheiten und Akne. Teebaumöl wirkt entzündungshemmend und antibakteriell; Joghurt unterstützt die Hautflora, Magerquark entzieht der Haut überschüssiges Fett, Honig wirkt beruhigend und antiseptisch und Zitronensaft löst abgestorbene Hautschüppchen und nährt die Haut mit Vitamin C.
• 1 EL Vollmilchjoghurt
• 1 EL Magerquark
• 2 TL Honig
• 1 TL Zimt (optional)
• 1 Spritzer Zitronensaft
• 2 bis 4 Tropfen Teebaumöl
Zutaten gut verrühren, auftragen und Maske 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Augen, Mund und Nasenlöcher aussparen, da das Teebaumöl Augen und Schleimhäute reizen kann.
9. Schonendes Rasierwasser
Auch geeignet für besonders empfindliche Haut.
• 50 ml Ringelblumentinktur
• 75 ml Holunderblütenwasser
• 75 ml Kamillenblütentee
• 5 Tropfen ätherisches Lavendelblütenöl (optional)
Alles gut mischen und in einen Zerstäuber abfüllen.
Natürliche Sonnenpflege von Dr. Hauschka. Fünffacher Heilpflanzenkomplex und mineralischer Sonnenschutz
Tattoo-Träger*innen finden sich heutzutage quer durch alle Gesellschaftsschichten. Wer sich unter die Nadel legt, sollte einige gesundheitliche Aspekte beachten.
Text: Gundula Madeleine Tegtmeyer

«
Mein Körper ist mein Tagebuch und meine Tattoos sind meine Geschichte. »
Johnny Depp, Sc hauspieler
Die Kunst des Tätowierens reicht in der Menschheitsgeschichte weit zurück. 2018 berichtete die Fachzeitschrift «Journal of Archeological Science «von zwei schätzungsweise 5350 Jahre alten Mumien mit deutlich erkennbaren Tätowierungen, Fundort: ein kleiner Ort in Oberägypten. Noch rätselt die Wissenschaft über die Bedeutung der eingestochenen Motive. Bestaunen kann man sie im Britischen Museum in London. Im antiken Griechenland sollen in die Haut gestochene Zeichen Spion*innen als Geheimcode untereinander gedient haben. Muster und Zeichen können zudem die ethnische Herkunft kodieren, Tattoos als Zeichen der kulturellen Identität. Kopten, eine ethnisch-religiöse Gruppe mit Ursprung im heutigen Ägypten, tragen bis heute als gegenseitiges Erkennungsmerkmal als Christ*in in einem islamisch geprägten Umfeld, ein kleines Tattoo-Kreuz am rechten inneren Handgelenk.
Von Ägypten ausgehend breitete sich diese christliche Tradition des Tätowierens auch im Heiligen Land aus und von dort weiter zu den Ostchrist*innen des Nahen und Mittleren Ostens. 1099 eroberten die Kreuzritter auf ihrem ersten Kreuzzug Jerusalem von den Muslim*innen zurück und verbreiteten in der Folge die Tattoo- Tradition auch unter europäischen Christ*innen. Bis heute lassen sich Menschen aus aller Welt zum Abschluss ihrer Pilgerreise im in der Jerusalemer Altstadt bei «Razzouk Ink», tätowieren, meist ein Kreuz. Die christlich-arabische Familie Razzouk ist seit gut 500 Jahren in Jerusalem ansässig und hält diese alte christliche Tradition seit vielen Generationen am Leben.
In einigen Weltregionen gelten Tätowierungen als Kulturgut, wie etwa in Französisch-Polynesien, gelegen im Südpazifik. Die Körperkunst hatte wahrscheinlich ihren Ursprung vor etwa 1500 Jahren auf den nahen Marquesas-Inseln, von wo sie auf den Rest Polynesien überschwappte. Die Einheimischen verewigen Familienchroniken auf ihrer Haut. Viele Tätowierungen, wissenschaftlich Tatauierung, haben zudem eine spirituelle Bedeutung und dienen als Talisman.
James Cook, britischer Kapitän und Entdeckungsreisender im Namen der englischen Krone, und der ihn begleitende Forscher Joseph Banks fanden auf ihren Pazifikreisen im 18. Jahrhundert Gefallen an den traditionellen Körperbemalungen und liessen sich noch vor Ort selbst tätowieren. Es war Cook, der den Begriff Tattoo in den Westen brachte. Aus dem tahitischen Begriff «te tatau», sinngemäss etwa «ein Zeichen, ein Muster schlagen» wurde über die Jahre das englische Wort Tattoo.
Elektrische Nadel erfunden
Dem irisch-stämmigen US-Amerikaner Samuel O’Reilly gelang eine wegweisende Innovation. Im Jahr 1875 hatte Thomas Edison (1847–1931) einen «Stencil Pen» erfunden. Die elektrisch bewegte Nadel im Stift perforiert beim Schreiben oder Zeichnen eine Vorlage, die als Schablone für Vervielfältigungen benutz werden kann. O’Reilly hatte eine geniale Idee: Durch die von ihm an der Stencil Pen vorgenommen Umbauten, konnte nun Farbe unter die Haut gestochen werden. 1891 liess er sich seine elektrische Tätowiermaschine, die «Tattoo-Gun» patentieren und eröffnete in New York City am Chatam Square sein eigenes Tattoo-Studio.


Eine gründliche Vorbereitung der Haut zum Stechen, Nachsorge sowie Hautpflege kann vor bösen Überraschungen schützen und helfen, dass die Farbe unter der Haut dauerhaft schön aussieht. Tätowierer*in ist kein anerkannter Ausbildungsberuf, daher ist Sorgfalt bei der Auswahl des Tattoo-Studios geboten. Auch wenn die Ausrüstung der Studios in der Bundesgesetzgebung nicht geregelt ist, hat das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eine Richtlinie für eine «Gute Arbeitspraxis» herausgegeben, welche von einer Expertengruppe erarbeitet wurde. Am Tag vor dem Tattoo-Stechen sollten Sie alkoholische Getränke, blutverdünnende Schmerzmittel und Sonnenbäder vermeiden. Die Rasur der ausgewählten Körperpartie überlassen Sie besser dem Profi. Die Tätowierungsprozedur kann für den Kreislauf belastend sein. Trinken, essen und schlafen Sie ausreichend.
Jede Tätowierung verursacht mikrofeine Hautverletzungen. Mit bis zu 120 Stichen pro Sekunde jagt die Nadel Farbpigmente in die Lederhaut und dies ein bis drei Millimeter tief, was an einigen sensiblen Körperstellen, wie etwa dem Gesicht, äusserst schmerzhaft sein kann. Die Farbe Rot tut besonders weh. Tattoos müssen nach einer Weile nachgestochen werden, denn die Konturen werden mit der Zeit unscharf, die Farben verblassen. Dieser Umstand sollte bei der Motivwahl und gewählten Körperstelle berücksichtigt werden. Professionelle Tattoo-Studios desinfizieren die frische Wunde, cremen sie ein und wickeln die frisch tätowierte Hautpartie in eine Folie ein.
Farbpigmente oder deren Abbauprodukte können wandern und sich in andere Körperstellen, wie etwa den Lymphknoten, ablagern. In der Schweiz gelten gesetzliche Anforderungen an Tätowier- und Permanent-Makeup-Farben. Festgelegt sind sie in der «Verordnung über Gegenstände für den Humankontakt». Besonders bedenkliche Substanzen, wie etwa solche mit nachweislich krebserregenden Eigenschaften, sind bereits verboten. In der EU wurde mit der aktuellen Verordnung (EU) 2020/2081 eine Regulierung über das Chemikalienrecht neu eingeführt.
Die Schweiz prüft derzeit diese Regelungen und passt im laufenden Revisionsverfahren gegebenenfalls die Verordnung entsprechend an, welche voraussichtlich Mitte März 2023 in Kraft treten wird. Entsprechende Übergangsfristen sind vorgesehen.
Seit 2015 feiern weltweit Tattoo-Liebhaber*innen am 21. März, dem Datum der Sonnenwende und somit dem astronomischen Frühlingsanfang, den «World Tattoo Day». Das Logo der internationalen Tattoo-Organisation schmücken vier Symbole: der Anker steht für Hoffnung, Vertrauen und ewige Liebe, die Krone verkörpert die Loyalität zu Tattoos und Körperbemalung, ihre fünf Zacken stehen für die fünf Kontinente. Die Erdkugel symbolisiert Grenzenlosigkeit, das Seil als ein Appell sich zu verbinden um Ziele und allgemeingültige Werte zu erreichen.
Tattoo–Pflegetipps:
Frisch gestochene Tattoos sind Hautverletzungen. Generell gilt: Während der Abheilungsphase darf das Tattoo weder durch Kontakt mit zu viel Wasser aufweichen noch durch zu wenig Feuchtigkeit austrocknen. Die tätowierte Haut schält sich in den ersten Wochen, was meist mit einem starken Juckreiz einhergeht. Vermeiden Sie zu kratzen! Zudem tritt während des Abheilungsprozesses von 3 bis 4 Wochen Farbe aus, da nur die unteren Hautschichten Farbe dauerhaft speichern kann. Um Entzündungen oder gar Schlimmeres zu vermeiden, sollten folgende Pflegetipps beherzigt werden: Waschen Sie sich vor jedem Eincremen ihre Hände. Benutzen Sie regelmässig eine spezielle Tattoo-Pflege. Vermeiden Sie starkes Schwitzen sowie in den ersten Wochen chlorhaltiges Wasser, Badewannen sowie baden im Meer sowie Sonnenbäder und Solarien. Schützen Sie das frisch gestochene Tattoo vor Schmutz und Staub. Vermeiden Sie das Tragen fusseliger Kleidung, die Fasern könnten sich in der frischen Wunde verfangen und Farbe herausziehen. Sollte sich ein frisches Tattoo dennoch entzünden, kann als Erste-Hilfe-Massnahme Wundalkohol die Beschwerden lindern. Tätowierte Hautpartien benötigen einen hohen Lichtschutzfaktor von mindestens 50. •

«Tattoos sind auch eine Ausdrucksform für Gefühle»
Kevin Gubser ist Tattoo-Artist und Inhaber von Swiss Ink Tattoo, Weesen SG. Er rät, sich nur von gut ausgebildeten und seriösen Tätowierer*innen stechen zu lassen.
Interview: Gundula Madeleine Tegtmeyer natürlich: Herr Gubser, seit nunmehr 10 Jahren arbeiten Sie als selbstständiger Tattoo-Artist in Ihrem eigenen Studio in Weesen. Ihre Stilrichtung bezeichnen Sie als fotorealistisch. Tätowierer*in ist keine geschützte Berufsbezeichnung, kein anerkannter Ausbildungsberuf. Was zeichnet eine*n handwerklich gute*n und gewissenhafte*n Tätowierer*in aus?
Kevin Gubser: Ich empfehle im Vorfeld eine Ausbildung zu absolvieren, die Kenntnisse verlangt, die auch beim Tätowieren zentral sind. Dabei denke ich beispielsweise an ein Kunststudium und eine medizinische Ausbildung. Letztere ist hilfreich rund um das Thema Wundheilung und Hygienevorschriften. Grössere Tattoo-Studios bieten Praktikumsplätze an. Für den Entwurf von Tattoos und ihre Umsetzung sowie das Arbeiten nach Vorlagen bringen Interessierte idealerweise eine zeichnerische Begabung mit. Seriöse Tätowierer*innen gehen geduldig auf die Fragen ihrer Kundinnen und Kunden ein, versuchen die Wünsche und das, was tatsächlich möglich ist, in Einklang zu bringen. Zudem befolgen sie die strengen Hygienerichtlinien und zeigen grosse Sorgfalt bei der Auswahl der Farben und Nadeln. Last but not least: Setzen sie nur Motivwünsche um, hinter denen sie stehen können.
Gibt es in der Schweiz ein gesetzliches Mindestalter für Tattoos?
Ein gesetzliches Mindestalter ist 16 Jahre, allerdings mit Einverständnis der Eltern. Ab dem Alter von 18 Jahre können alle selbst für sich entscheiden.
Eine Tätowierung wurde mangelhaft ausgeführt. Was ist zu tun? Was raten Sie unseren Leserinnen und Lesern?
Betroffene sollten zuerst den Tattoo-Artist aufsuchen, der das Tattoo gestochen hat. Sollte das Problem nicht behoben werden können rate ich zwei bis drei weitere Studios zu konsultieren, um sich weitere Meinungen über die bestehenden Möglichkeiten einzuholen. Ist es ein medizinisches Problem, rate ich umgehend ein*e Ärzt*in zu konsultieren.
Was Tätowierfarbe langfristig im Körper verursacht, darüber kann aufgrund dünner Studienlage nur spekuliert werden. Können Tätowierungen ein gesundheitliches Risiko sein?
Jede Tätowierung ist ein Eingriff in den Körper und kann entsprechende Risiken bergen. Allerdings zeigt meine Erfahrung, dass eher selten Probleme auftreten.
Tätowierungen wurden lange ausschliesslich unteren Gesellschaftsschichten zugeschrieben. Das hat sich geändert. Inzwischen finden sich Tattoo-Trägerinnen und -Träger quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Was hat Tattoos salonfähig gemacht?
Den Medien kommt dabei eine wichtige Rolle zu, denn sie promoten prominente Tattoo-Träger*innen, wie beispielsweise Fussball- und Filmstars. Im täglichen Miteinander erkennen viele Menschen zunehmend, dass nicht nur Rocker*innen oder Seeleute Tattoos tragen, sondern auch Ärzt*innen, Polizeikräfte und Anwält*innen, um nur einige zu nennen.
In einigen Regionen der Welt gehören Tätowierungen zum Kulturgut. Muster und Zeichen werden seit Generationen überliefert, sind von hoher Symbolkraft und drücken die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Ethnie aus. Wir hingegen streben Individualität an. Warum lassen sich Schweizer*innen tätowieren?
Zum einen gefallen Tattoos den Leuten ganz einfach. Für viele Menschen bieten Tattoos darüber hinaus eine Form der Verarbeitung von einschneidenden Ereignissen und Erinnerungen, ein Tattoo als eine Ausdrucks- und Präsentationform ihrer Gefühle.

Wer Fleisch isst, isst oft auch mehr oder weniger bewusst Haut mit. Manchmal essen wir aber auch Haut, wenn wir es gar nicht merken. Etwa bei Gummibärchen.
Text: Samuel Krähenbühl
Gleich vornweg: Wer sich ausschliesslich vegetarisch ernährt, wird jetzt vielleicht denken, dass ihn oder sie dieser Beitrag kaum zu interessieren habe. Irrtum. Denn tierische Häute stecken in mehr Lebensmitteln, als sich der Durchschnittsverbrauchende vorstellen können. Schon nur daher ist es auch für sie spannend, dabei zu bleiben. Aber bleiben wir zunächst beim Offensichtlichen. Wer Fleisch mag, der mag ziemlich sicher den Geruch von frisch grilliertem Poulet. Und gar der Biss in die noch warme, würzige Haut kann gar ganze Geschmacksorgien entfachen. Ja, gegrilltes Poulet lebt, bzw. hat für den feinen Geschmack gelebt, den es unserem Gaumen nach seinem Ableben in Form seiner knusprig braunen Haut schenkt. Vielleicht schon etwas gewöhnungsbedürftiger ist das Eisbein, in Schweizer Dialekt auch als «Haxe» bezeichnet. Dieses wird in einigen Regionen gekocht gerne zu Sauerkraut gegessen. Oder auch im Erbsmus als Fleischeinlage geschätzt. Damit die Haut und das Bindegewebe mitgegessen werden können, muss die ganze Haxe richtig gar sein. Denn sonst wird es zäh.
Schwarte – Beliebter Wurstbestandteil Fleischesserinnen und -esser essen aber auch unbewusst oft Haut mit. Etwa in der Schweizer Nationalwurst, der Cervelat. «Ein Cervelat besteht aus Rindfleisch, eventuell Schweinefleisch, Wurstspeck, Schwartenblock und Eiswasser. Als Gewürze nimmt man Frischzwiebeln, Pfeffer, Koriander, Muskatnuss, Knoblauch und Nelken.» Das können wir auf der Website des Kulinarischen Erbes der Schweiz lesen. Schwarte ist in dem Fall nichts anderes als Schweinehaut. Auch in anderen Wurstwaren ist häufig «Schwarte» zu finden. Sogar im Namen trägt den Begriff die «Schwartenwurst».
Doch damit noch nicht genug. Wir haben deshalb nachgefragt bei der Centravo AG in Lyss, welche sogenannte Schlachtabfälle verwertet. Es handelt sich hierbei um beträchtliche Mengen, welche jedoch mehrheitlich zu Leder verarbeitet werden (siehe Kasten). Gemäss Eric Rava, Leiter Unternehmenskommunikation, können aber Tierhäute –selbstverständlich unter der Einhaltung aller dafür notwendigen Hygiene- und Lebensmittelvorschriften – auch in stärker verarbeiteten Lebensmitteln landen: «Der Spalt des Leders (der untere Teil der Haut) kann auch in der der Gelatine-Produktion verwertet und so beispielsweise letztendlich in Gummibärchen verwendet werden.» Wobei: Nicht in allen Gummibärchen und CO. steckt heute mehr tierische Gelatine. Der bekannte Hersteller «Haribo» schreibt dazu auf seiner Website: «HARIBO bietet schon seit vielen Jahren Produkte an, die ohne tierische Gelatine erzeugt werden. Da das Interesse insbesondere an vegetarischen Produkten immer grösser wird, haben wir uns entschlossen, eine Zertifizierung der in Frage kommenden Produkte durch eine unabhängige Organisation durchzuführen.»
Rezepttipp

Die meisten Häute werden Leder
Die Centravo AG verarbeitet beträchtliche Mengen an Häuten und Fellen. Grossvieh, Pferde und sogenannte Exoten machen gemäss Sprecher Eric Rava ungefähr 393 000 Stück aus. Kalbfelle und sogenannte «Fresser» ungefähr 190 000. Und schliesslich Schaf- und Lammfelle ungefähr 233 000 Stück. «Die Tierhäute werden zu Leder verarbeitet und daraus dann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Nach unserer Verarbeitung werden diese der Kürschnerei zugeführt», erläutert Rava.
«
Tierische Häute stecken in mehr Lebensmitteln, als sich der Durchschnittsverbraucher vorstellen kann. »
Mit Mass genossen schadet es nicht
Doch zurück zu den Häuten, welche verspiesen werden. Das eingangs beschriebene grillierte Poulet schmeckt sicher auch dank seiner würzigen Haut besonders gut. Das hat auch einen logischen Grund: Poulethaut besteht vorwiegend aus Fett. Und Fett ist ein Geschmacksträger. Stéphanie Bieler, Fachexpertin Ernährung bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) nennt Zahlen: «100 Gramm Pouletbrust ohne Haut enthält nur ein Gramm Fett, während 100 Gramm Pouletbrust mit Haut 6,5 Gramm Fett enthält. Die Haut enthält auch bedeutende Mengen an Cholesterin.» Weitere Beispiele können unter www.naehrwertdaten.ch nachgeschlagen werden. Doch sie gibt auch Entwarnung: «Ob man die Haut essen möchte oder nicht ist vor allem eine Frage der Vorliebe. Wer Fleisch – wie im Rahmen der Lebensmittelpyramide empfohlen – massvoll konsumiert, braucht sich wegen des erhöhten Fettgehalts keine Sorgen zu machen und kann die Haut gerne mitverzehren.»
Eine andere Frage, die sich weiter stellt, ist die nach der besseren Verwertung der Lebensmittel, respektive von «Food Waste». Könnte eventuell hier der vermehrte Verzehr von Tierhäuten einen Mehrwert bringen. Bieler winkt ab, zumindest teilweise: «Natürlich würde dies auch einen Beitrag zur Reduktion von Foodwaste leisten – allerdings sehe ich da grundsätzlich eher wenig Potential im Vergleich zu anderen Massnahmen, die zur Reduktion von Food Waste getroffen werden könnten.» •

Sie überzeugen farblich auf den ersten Blick, geschmacklich auf den ersten Happen. Verbindet sich die tolle Knolle mit den lustigen Erbsen vom Schweizer Nachbaracker, beginnt ein Märchen aus dem Orient. Denn mit dieser Traumkombination wirkt auf dem Teller ihr Zauber garantiert: Der graue Alltag schmeckt plötzlich rosig.
Zubereitung
1. Die Kichererbsen über Nacht einweichen.
2. Anschliessend mit frischem Wasser eine Stunde weichkochen.
3. Die vorgekochte Rande schälen und in Stücke schneiden.
4. Kichererbsen und Rande zusammen mit Olivenöl, Knoblauch und Petersilie in den Mixer geben und solange pürieren, bis die Masse schön cremig ist.
5. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen und anrichten.
Passt hervorragend zu Biofarm Maischips aus Schweizer Bio-Knospe-Anbau.
Offeriert von biofarm.ch

HUMMUS MIT RANDEN für 4 Personen
Zutaten
250 g Biofarm Kichererbsen
1 Rande gekocht
3 EL Biofarm Olivenöl
1 Knoblauchzehe
1 Bund Petersilie nach Bedarf Salz und Pfeffer
1-2 EL Zitronensaft


Zubereitung
1. Warmes Wasser, Salz und Hefe in die Mulde geben und nach und nach zu Teig kneten, Honig, Olivenöl und Zitronensaft mitverarbeiten, 30 Minuten gehen lassen.
2. Nüsse in den Teig kneten. In drei gleiche Teile und Stangen formen. Bei warmer Zimmertemperatur überdeckt, verdoppeln lassen.
3. Im vorgeheizten Ofen 200°C, ca. 35 Minuten backen. Auf einem Rost auskühlen lassen.
HASELNUSS- PISTAZIEN-BROT
Ergibt 3 Brote à 600 g
Zutaten
300 g Weissmehl, gesiebt
700 g Fünfkornmehl, gesiebt
2 TL Salz
6 TL Trockenhefe
6 dl warmes Wasser
3 TL Honig
½ dl Olivenöl
2 TL Zitronensaft
Je 50 g Haselnüsse und Pistazien, sauber geschält

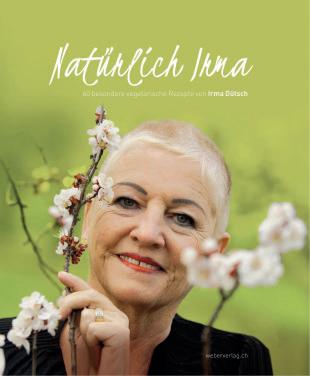

Beim Stichwort Getreide denken die meisten Leute wohl an Teigwaren und Brote. Ich möchte Ihnen heute ein anderes Bild der herkömmlichen Getreidearten präsentieren. Jenes des Superfoods, der Vitalstoffbombe und Nahrungsergänzung. Wir reden nicht vom Getreidekorn, sondern von den zartgrünen, frisch gekeimten Pflänzchen. Aus diesen Jungpflanzen wird Getreidegraspulver hergestellt, das Ihnen vielleicht im Regal der Reformabteilung von Bioläden oder Drogerien bereits begegnet ist. Wer zum ersten Mal einen Teelöffel voll Gersten-, Weizen-, oder Dinkelgraspulver in ein Glas Wasser gibt und kräftig rührt, damit es sich auflöst, blickt wohl etwas skeptisch auf das Gebräu. Knallgrün die Farbe, grasig der Geruch und entsprechend herb schmeckt die erste Verkostung. Die etwas ungewohnte Nahrungsergänzung hat es jedoch in sich: Kein anderes Blattgemüse enthält so viele Nährstoffe, wie die getrockneten und pulverisierten Getreidesprösslinge.
Als Entdecker des Getreidegrases gilt der Japaner Dr. Yoshihide Hagiwara. Er untersuchte in den 1960er-Jahren verschiedene Blattgemüsearten auf ihre Nährstoffdichte. Dabei entdeckte er die beeindruckende Nährstoffvielfalt von frisch gekeimten Süssgräsern, zu denen auch der Weizen und der Dinkel gehören. Gersten-, Weizen-, wie auch Dinkelgras enthalten beachtliche Mengen an Ballaststoffen, am Pflanzenfarbstoff Chlorophyll, Enzymen, sekundären Pflanzenstoffen, Eiweissen, Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Die Nährstoffe kommen in einem ausgewogenen Verhältnis vor und können vom Körper sehr gut aufgenommen werden. Man gewinnt das Süssgraspulver aus jungen Getreidepflanzen, die gerade mal 10 Tage alt und rund 15

über Getreidegras
Zentimeter hoch sind. In diesem Stadium steht die Pflanze in ihrem vollen Saft, die Zellteilung ist extrem aktiv und die Nährstoffdichte ist so hoch wie nie.
Die Gräserpulver unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander. Ganz grob kann man aber sagen, dass Gerstengras durch seine starke Basenwirkung und den leicht bitteren Geschmack als ideale Begleitung für die Frühlingsmonate überzeugt. Weizengras gilt als wertvoller Eisen- und Vitamin-C-Lieferant, das im Winter das Immunsystem unterstützen kann und Dinkelgras kommt oft als Sportgetränk zum Einsatz, weil es neben den vielen Mineralstoffen den höchsten Proteingehalt hat. Bei der Internetrecherche über die Getreidegräser, bekommt man den Eindruck, die Gräserpulver wären Alleskönner, die jede Krankheit besiegen. Das ist sicher zu hoch gegriffen. Die Getreidegräsern liefern uns jedoch viele Nährstoffe, die uns im Alltag tendenziell fehlen. Allen voran die Ballaststoffe. Führen wir sie über die Einnahme der Getreidegräser zu, machen wir einen grossen Schritt in die richtige Richtung.
Bei vielen Beschwerdebildern können die in Wasser gelösten Getreidepulver eine äusserst effektvolle und harmonisierende Wirkung zeigen. Sehr gute Erfahrungen werden zum Beispiel beim Ausgleich des Säure-Basenhaushalts gemacht. Aufgrund der hohen Mineralstoffdichte in den Süssgräsern liefern die Süssgräser dem Körper eine Möglichkeit, überschüssige Säuren aus der Ernährung zu binden. Das entlastet den Stoffwechsel, kann bei allen Beschwerden des rheumatischen Formenkreises Linderung bringen und auch den Hautstoffwechsel positiv beeinflussen. Getreidegras, insbesondere das Gerstengras, sorgt für

Harmonie bei Stoffwechselstörungen wie Diabetes oder erhöhten Blutfettwerten. Es wirkt mit seinen sekundären Pflanzenstoffen als Radikalfänger und somit als Zellschutz bei Entzündungen, Hauterkrankungen oder Darmbeschwerden. Weil Süssgräser aufgrund der hohen Ballaststoffdichte für ein darmbakterienfreundliches Darmklima sorgen, vermag das Pulver durchaus auch Entzündungen zu lindern und viele Darmerkrankungen sehr günstig zu beeinflussen.
Getreidegräser sind im Fachhandel erhältlich. Man kann sie aber auch mit rudimentären Gartenkenntnissen und in bester Bio-Qualität selbst grossziehen. Wer Erfahrung hat mit der Zucht von Kresse oder dem Anbau von Sprossenmischungen, wird vertraut sein mit den einzelnen Arbeitsschritten:
• Kaufen sie keimfähiges Saatgut für Gerste-, Dinkeloder Weizen in Bio-Qualität.
• Legen Sie das Saatgut während acht Stunden in zimmerwarmes Leitungswasser ein.
• Geben Sie eine rund zwei Zentimeter dicke ErdSubstrat-Schicht in ein flaches Gefäss und befeuchten Sie die Erde sehr gut.
• Verteilen Sie die eingeweichten Getreidekörner auf der feuchten Erde. Die Körner sollen nahe beieinander aber nicht übereinander liegen. Leicht andrücken.
• Stellen Sie das Gefäss an einen hellen, sonnigen Platz und halten Sie die Erde feucht. Am besten geht es mit einem Zerstäuber.
• Schon nach zwei bis drei Tagen beginnen die Körner zu keimen. Die gekeimten Getreidekörner sind kleine Kraftpakete und eignen sich als Salatbeigabe.
• Nach 10 Tagen haben die Getreidegräser eine Höhe von rund 10 Zentimeter erreicht. Sie sind bereit zur Ernte. Das Gras wird oberhalb der Wurzel abgeschnitten. Die verbleibenden Getreidekörner treiben wieder aus, der Nährstoffgehalt nimmt bei der Zweiternte jedoch ab.
• Man kann das frische Getreidegras für Smoothies verwenden oder in einem dunklen, trockenen, gut durchlüfteten Raum schonend trocknen.
• Das getrocknete Gras im Mörser zerreiben und in dunklen Gläsern lagern.
Gersten-, Weizen-, und Dinkelgras nimmt man als Nahrungsergänzung zwei- bis dreimal täglich aufgelöst in einem grossen Glas Wasser ein. Am besten am Morgen auf nüchternen Magen, zwischen den Mahlzeiten und abends vor dem Zubettgehen. So wird verhindert, dass die Aufnahme der Inhaltstoffe durch andere Lebensmittel oder Genussmittel gestört ist. Die deftigen Getreidespeisen, die uns im Winter so wohlig genährt haben, dürfen im Frühling ruhig auf der Seite gelassen werden. Die knallgrünen Säfte aus Getreidegräsern hingegen liefern genau das, was der Körper jetzt braucht: geballte Lebenskraft.
Sabine Hurni arbeitet als Naturheilpraktikerin und Lebensberaterin in Baden, wo sie auch Ayurveda Koch kurse, Lu Jong – und Meditationskurse anbietet. Sie befasst sich intensiv mit allen Richtungen der Natur heilkunde, Ernährung und spirituellen Lebensthemen.


Meine Tochter (30) hat seit Jahren starke Menstruationsbeschwerden.
Könnte sie an Endometriose leiden? Im Netz gibt es ja Vieles zu finden. Doch wie/wo beginnen …?
M. D., Berlin
Eine schmerzhafte Menstruation kann viele Ursachen haben. Vom Beckenschiefstand über zu kalte Nahrung bis hin zu Stress ist alles möglich. Oft ist es wichtig, einfach mal irgendwo anzufangen und im Dschungel der Behandlungsmethoden auf die Intuition zu vertrauen. Vielleicht fühlt sich ihre Tochter eher zu einer Körpertherapie hingezogen, vielleicht mehr zur Ernährung als Medizin oder zur Homöopathie. Schlussendlich führt jeder Weg einen Schritt näher zu sich selbst und zu einem bewussteren Umgang mit sich und der Aussenwelt. Im Ayurveda wird bei schmerzhafter Menstruation zum Beispiel empfohlen, warm zu essen. Wenig Rohkost, keine kalten Produkte aus dem Kühlschrank, keine Sandwichs und keine kalten Getränke. Das heisst, von früh bis spät alles kochen, wärmen und gut würzen. Auch die Chinesische Medizin mit Akupunktur oder APM kann sehr viel bewirken, weil es den Energiehaushalt ausgleicht. Zudem helfen Kräuter wie die Schafgarbe, der Frauenmantel oder
die Himbeerblätter, die Schmerzen etwas auszugleichen. Ideal in Kombination mit einer Wärmeflasche und viel Ruhe. Ihre Tochter soll sich einige Monate Zeit nehmen, um sich diesem Thema naturheilkundlich zu nähern. Wichtig dabei ist, dass sie ihren eigenen Weg geht und ihrer Intuition vertraut. Das Buch von Dr. Sylvia Mechsner kann ihr sicherlich Antworten liefern. Zudem gibt es in Berlin bestimmt viele Frauenärzt*innen, die ganzheitlich arbeiten. Oder auf Frauenheilkunde spezialisierte Naturheilpraktiker*innen.
Falls die oben erwähnten Massnahmen keine Veränderung bringen, ist eine Abklärung sicher sinnvoll, um eine mögliche Endometriose auszuschliessen. Das geht nur über den schulmedizinischen Weg und deren Diagnosemethoden. Die Behandlung danach, kann, je nach Befund, durchaus naturheilkundlich erfolgen oder als Kombination zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde.

Fersenrisse
Ich habe seit jeher viel Hornhaut an den Füssen und immer wieder Fersenrisse. Eine Zeit lang hat Hirschtalgcreme gut geholfen, dann bekam ich den Schüsslerstick empfohlen, der die Haut weich macht. Seit anfangs Jahr habe ich aber trotzdem wieder Fersenrisse. Haben Sie mir einen Rat, was noch weiter helfen könnte?
Ein super Heilmittel für die Füsse ist Rizinusöl. Sie können das Öl jeweils nach einem Fussbad einreiben, oder abends anstelle einer Salbe die Fersen damit einölen. Danach einfach Socken über die Füsse ziehen, weil sie sehr ölig werden. Rizinusöl ist nicht nur fettig, sondern auch sehr befeuchtend und wundheilend. Sie sollten es so oft wie möglich auf die schmerzende Wunde auftragen. Als Fussbad eignet sich ein Cremebad, Ölbad oder Salzbad. Geben Sie jeweils einen Schuss Apfelessig ins Wasser. Die Feilen und Raspel sind oft zu aggressiv. Besonders die Raspel sollte man nur auf der trockenen Haut anwenden, weil sonst die Haut zu stark verletzt wird, und sich erst recht wieder Hornhaut bildet. Also lieber die Füsse im Fussbad zuerst einweichen, dann mit dem Frottiertuch die Hornhaut abrubbeln und mit Rizinusöl befeuchten.
Für die normale abendliche Anwendung und generell zur Pflege der Füsse sollten Sie Produkte anwenden, die einen hohen Fettanteil haben. Insbesondere tierische und pflanzliche Fette sind ideal. Verzichten Sie auf Produkte mit Mineralöl. Vielleicht kennen Sie den Kartoffelbalsam für die Füsse? Er ist in Reformhäusern und Drogerien erhältlich.
Achten Sie darauf, das Sie genug trinken und dass Sie mit genügend gesunden, pflanzlichen Fetten versorgt sind. Also gerne etwas Olivenöl über das Gemüse träufeln und Nüsse essen. Ideal sind auch Produkte mit ungesättigten Omega3-Fettsäuren, wie Lachs, Thunfisch, Leinsamen oder Baumnüsse.

Muskeln entspannen
Ich habe etliche Operationen hinter mir. Karpaltunnel, Knieprothese, Hüftimplantat. Im Moment habe ich das Gefühl, mein ganzer Körper sei verspannt. Sogar der Kiefer schmerzt. Gerne möchte ich das ganzheitlich angehen, aber ich weiss nicht wo anfangen.
D. R., Aarau
Die Arthrose ist mit den künstlichen Gelenken zwar beseitigt, doch die Muskeln, die über Jahre verkürzt, überdehnt oder versteift waren, um die Fehlhaltung auszugleichen, müssen in ihre natürliche Position zurückfinden. Es ist deshalb wichtig, dass Sie gezielt mit den Muskeln arbeiten. Zum Beispiel mit Massagen, Sauna oder Thermalbad. Das sorgt für Entspannung für Geist und Körper. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie für die Massagen eine ganzheitliche Therapie wählen. Shiatsu, Akupunkturmassage oder klassische Ganzkörpermassagen, damit der Energiefluss im ganzen Körper wieder ins Fliessen kommt.
Eigentlich wäre eine Ayurveda-Kur ideal für Sie. Körpermassagen mit warmem Öl sorgen für Entspannung der Muskulatur, auf Sie abgestimmte Ernährung stärkt den Körper und zudem wird der Lymphfluss durch die Massagen angeregt, was die Entgiftung fördert. Falls diese Art von Massagen und Therapien Sie anspricht, finden Sie gute Adressen in der Schweiz oder im nahen Ausland. Sie dürfen sich auch gerne nochmals melden, wenn Sie einen Tipp brauchen.

Haare sind einem ständigen Prozess des Werdens und Vergehens unterworfen. Nach etwa acht Jahren erreichen jeden Tag ungefähr 100 Haare ihre maximale Lebensdauer und fällen aus. Im Frühling und Herbst etwas mehr. Für ein gesundes Wachstum sind die Haare auf Nährstoffe angewiesen, die ihnen über den Blutkreislauf zugeführt werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Kopfboden gut durchblutet ist.
So hilft die Klettenwurzel: Die Wurzeln der grossen Klette enthalten ätherische Öle und schwefelhaltige Ayetylenverbindungen. Diese Wirkstoffe regen die Durchblutung des Haarbodens an und wirken leicht antiseptisch. Der Extrakt der Klettenwurzel ist Bestandteil vieler Haarpflegeprodukte. Zum Beispiel in Haarölen oder Haarwasser.
Wie anwenden: Wichtig ist, dass der Extrakt direkt mit dem Haarboden in Berührung kommt. Ein Klettenwurzelöl kann man nach dem Haarwaschen mit den Fingerspitzen auf den feuchten Haarboden auftragen und sanft einmassieren. Für eine intensivere Wirkung kann man mit dem Öl auch eine Haarpackung machen, ein Handtuch um den Kopf und mehrere Stunden einwirken lassen. Achten Sie beim Kauf auf ein natürliches Basisöl.
Das hilft ebenfalls gegen Haarausfall:
• Es ist normal, dass im Frühjahr der Haarausfall stärker wird. Trinken Sie viel Brennnesseltee. Die Brennnessel enthält Kieselsäure und stärkt das Haar. Auch als Haarwasser geeignet.
Haben Sie Fragen?
Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. s.hurni@weberverlag.ch
• Bürsten Sie Ihr Haar mit einer Naturbürste sanft in alle Richtungen. Das regt die Durchblutung und den Lymphfluss an.
• Bei starkem Haarausfall hilft die Stärkung von innen. Haaraufbaupräparate liefern dem Haar alles, was es braucht. Sie sollten kurmässig für drei bis sechs Monate angewendet werden.

Per Arthroskopie wurde vor 3 Monaten der Meniskus teilweise entfernt. Jetzt habe ich immer noch Beschwerden, wenn ich Sport betreibe. Der Arzt sagt, ich hätte eine Arthrose. Ich möchte mich bei Ihnen erkundigen was ich dagegen tun kann.
E. B., Chur
I ch habe die Erfahrung gemacht, dass die Arthroskopie-WundNarben oft Störfelder hervorrufen. Das erstaunt zwar, weil die Narben viel kleiner sind als lange Schnittwunden, aber offenbar fühlt sich das Gewebe gestresst durch die Einstiche. Man sollte deshalb auch eine minimal-invasive Narbe immer entstören und sie nach der Operation gut pflegen. Wenn die Narbe als weisser Punkt sichtbar ist, heisst, das, dass sie schlecht durchblutet ist und vermutlich die Energie blockiert. Eine Behandlungsmöglichkeit ist Johanniskrautöl. Es hilft, Entzündungen zu mildern, die Narben zu pflegen und dringt zudem tief ein, damit auch der Knorpel gut geschmiert wird. Auf diese Weise erhöhen Sie die Durchblutung im Knie, verbesssern die Versorgung des Knorpels mit Nährstoffen und lockern die Muskeln und Sehnen um das Gelenk.
Kaufen Sie sich eine Flasche Johanniskrautöl und massieren Sie die OP-Einstichwunden wie auch das Knie sehr intensiv ein, am besten jeden Abend vor dem Zubettgehen.

Ambulant vor stationär – sinnvoller Grundsatz für Patient*innen?
Der medizinische Fortschritt ermöglicht es, dass Patientinnen und Patienten bei immer mehr Eingriffen noch am gleichen Tag nach Hause gehen können. Immer mehr Operationen erfordern daher keinen Spitalaufenthalt mehr. Diese Verlagerung von medizinischen Eingriffen vom stationären in den ambulanten Bereich ist ein grosses gesundheitspolitisches Thema. Seit dem 1. Januar 2019 gilt eine schweizweit verbindliche Liste ambulant durchzuführender Eingriffe. Mit der neuen Regelung verfolgt der Bund das Ziel, Verlagerungen in den ambulanten Sektor zu fördern und die Kostenentwicklung zu dämpfen. Doch was nützt die Regelung den Patientinnen und Patienten?
Patientinnen und Patienten sollen dort behandelt und betreut werden, wo sie mit ihrem Gesundheitsproblem am besten aufgehoben sind – und dies möglichst ohne Unterbrüche. Je nach Behandlungsund Betreuungssituation kann ein ambulantes oder stationäres Setting für die Patient*innen passender sein. Es greift daher zu kurz, ambulanten Leistungen pauschal den Vorzug vor stationären Leistungen zu geben. Für die einen Patient*innen ist es wichtig, möglichst früh ins gewohnte soziale Umfeld zurückzukehren. Bei anderen Patient*innen macht eine längere Überwachung im Spital mehr Sinn. Der Grundsatz «ambulant vor stationär» ist deshalb zu undifferenziert. Anstatt einen Sektor zu bevorzugen, wäre es wichtig, den gesamten Behandlungsund Betreuungsprozess in den Fokus zu nehmen. Dies wäre ein echter Fortschritt für Patientinnen und Patienten.
Susanne Gedamke, Geschäftsführerin SPO.
Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch
Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min.
Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).
Mal ehrlich – was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie ein Paar mit einem grossen Altersunterschied sehen? Zum Beispiel der reife Mann und die junge Frau, die da Hand in Hand über die Strasse schlendern. Denken Sie: Er muss wohl Geld oder Macht haben, wie sonst könnte sie sich für ihn interessieren?
Oder wenn ein junger Mann zärtlich eine Frau küsst, deren Haar sich bereits grau färbt. Ist er vielleicht ihr gut bezahlter Loverboy? Oder warum sonst liebt er eine Frau, die offensichtlich so gar nicht zu ihm passt? Bei gleichgeschlechtlichen Paaren reagieren wir ähnlich.
Wir können an unserer eigenen Reaktion ablesen, wie sehr wir in äusserlichen Bildern von Liebe und sexueller Attraktion festhängen. Lust und Liebe selbst sprechen meist viel direkter. So manche reife Frau oder ältere Mann wäre überrascht, wenn sie sehen könnten, wie häufig sie trotz Altersspuren, Fältchen oder Bauch auf dem erotischen Radar jüngerer Menschen auftauchen. Sowohl die Anziehung zwischen Menschen mit grossem Altersunterschied als auch das Befremden darüber haben eine eindeutige Ursache: Die Verbindung zwischen Mutter und Sohn bzw. Vater und Tochter gelten als das Tabu aller Tabus.
Dabei ist die Anziehung normal: Mama und Papa waren unsere ersten Geliebten. Ihr Bild tragen wir zeitlebens in uns, manchmal tief vergraben, beeinflusst es unser Bild vom perfekten Partner. Das gilt seelisch, aber auch sinnlich: Wir sind als winzige Wesen zwischen den riesigen Schenkeln einer Frau geboren worden. Sie war unsere leibliche Heimat! Und Papa war für die meisten Mädchen der erste Mann, den sie beeindrucken wollten. Wenn wir dann als Erwachsene dieses Seelenbild in einer Frau, einem Mann wiedererkennen – egal welchen Alters – dann kann uns das magisch anziehen – oder auch abstossen.
Bis vor kurzem hätte ich jeden Geliebten, der in mir eine Mutterfigur sieht, von der Bettkante geschubst. Die Mutter! So langweilig und alt bin ich für ihn? So ein Muttersohn ist er, dass er das attraktiv findet? Doch
inzwischen kenne ich die erotische Ausstrahlung von Mütterlichkeit. Wenn ich beim Sex nicht nur heiss, sondern voll überschäumender Zärtlichkeit bin, wenn ich den oder die Geliebte innig halten und streicheln will, wenn ich vor allem will, dass es ihm oder ihr gut geht – dann ist da auch immer ein Stück Mutter mit im Spiel. Mutter und sexy – das ist nur ein Tabu, solange wir in einer Welt voller patriarchaler Vorstellungen leben. Denn nur in dieser Welt sind Mütter asexuell, kontrollierend, über-emotional und furchteinflössend. In anderen Kulturen gibt es andere Mutter-Ikonen –voller Erotik, Verlockung und Fülle.
Nicht dass ich darauf beschränkt werden will. Als erotische Frau kann ich vieles sein. Wenn ich für einen Mann die Mutter verkörpere und wir darin unsere Lust entdecken, dann beginnt eine neue Vertiefung unserer Liebe. Sie wird inniger, direkter, saftiger. Wir treten aus einem einengenden Bild der Sexualität aus und lassen uns in einen neuen Kosmos der Lust führen. Diesem Weg zu folgen, bedeutet, immer mehr Klischees und Erwartungen hinter uns zu lassen. Wir werden uns jenseits aller Bilder treffen und erkennen, dort wo wir zutiefst wir selbst sind. Da können wir einander Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Schwester, Bruder, Geliebte und bester Freund sein – unabhängig jeden Alters. Das ist das Ziel der Liebe. •

Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin. Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen, lebte u. a. über 18 Jahren in Tamera, Portugal, sowie anderen Gemeinschaften auch in anderen Kontinenten. Am meisten liebt sie das Thema Heilung von Liebe und Sexualität sowie neue Wege für das Mann- und Frau-Sein.

Schuppenflechte | gesund werden
Etwa zwei Prozent der Bevölkerung sind von Schuppenflechte betroffen. Die Hautkrankheit hat genetische, physische und psychische Ursachen. Oft ist die sogenannte Psoriasis ein Signal für weitere Krankheiten.
Text: Fabrice Müller
Die rötlichen Krankheitsherde auf der Haut sind von mehr oder weniger dichten, silbrig-weissen Schuppen bedeckt. Die Herde können bis zu einigen Zentimetern gross sein. Bei allen Betroffenen kann die Schuppenflechte, auch Psoriasis genannt, anders ausgeprägt sein. Das Erscheinungsbild reicht von wenigen kleinen Herden, insbesondere an den Ellbogen, den Knien, in der Steissbeinregion und am Kopf bis zum Befall der gesamten Hautoberfläche. Auch die Nägel können betroffen sein. Etwa 60 Prozent aller Psoriasis-Patientinnen und -Patienten sind von Schuppenherden auf der Kopfhaut betroffen. Dehnen sich die Herde stark aus, ist oft die gesamte Kopfhaut mit dichten, panzerartigen Schuppenfeldern bedeckt. Wird die dicke Schuppenschicht über längere Zeit nicht abgelöst, fallen die Haare aus oder brechen ab. Bis zu einem Drittel aller Menschen, die mit Schuppenflechten zu kämpfen haben, leiden zusätzlich an einer schmerzhaften und bewegungseinschränkenden Entzündung der Gelenke. Die Psoriasis-Arthritis beginnt meist zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. Im Gegensatz zum Gelenkrheuma betrifft es vielfach nur wenige Fingermitteloder Fingerendgelenke.
Schon die Pharaonin Hatschepsut litt darunter
In der Schweiz gibt es schätzungsweise über 200 000 Betroffene, weltweit sind es mehr als hundert Millionen. Neu ist diese Krankheit, die als Zivilisationskrankheit gilt, allerdings nicht. 2011 fanden deutsche Forschende bei der Analyse eines Flakons aus dem ägyptischen Museum in Bonn heraus, dass das Gefäss der alt-ägyptischen Pharaonin Hatschepsut (1479–1458 vor Christus) eine teerhaltige Lotion enthielt. Diese wurde damals zur Behandlung von Hautkrankheiten eingesetzt. Offenbar ist es bekannt, dass in der Familie von Hatschepsut Fälle von Hauterkrankungen vorkamen. Erste schriftliche Überlieferungen zu Schuppenflechte stammen aus dem antiken Griechenland. So berichtete der Arzt Hippokrates (460–370 vor Chrisus) von einer schuppenden Hautkrankheit, bei der es sich vermutlich um Psoriasis handelte. Allerdings benutzte er dabei den Ausdruck Impetigo, worunter man heute die sogenannte Borkenflechte versteht.
Heute weiss man: Die Schuppenflechte ist eine nicht ansteckende Hauterkrankung, die in jedem Lebensalter auftreten kann. Die Schulmedizin spricht von einer Systemerkrankung, bei der der Körper und die Psyche überfordert sind und das Immunsystem in eine Dysfunktion geratet. Die Ursachen für dieses Phänomen sind nicht gänzlich geklärt. PD Dr. Matthias Möhrenschlager, Chefarzt Dermatologie an der Hochgebirgsklinik in Davos, nennt die genetische Veranlagung als möglichen Faktor, der diese Krankheit begünstigt. «Oftmals sind jedoch weitere Einflüsse mit im Spiel, die eine Schuppenflechte auslösen», gibt der Mediziner zu bedenken. Weitere Einflussfaktoren seien zum Beispiel seelische Belastungen, Infektionen durch Keime, bestimmte Medikamente wie Psychopharmaka, Betablocker oder Verhütungsmittel, Nikotin, Alkohol oder Übergewicht. Laut Matthias Möhrenschlager tritt die Schuppenflechte häufig in Kombination mit anderen Erkrankungen wie Bluthochdruck, zu hoher Harnsäure oder Fetten im Blut auf. «Die Schuppenflechte deutet oft auf ein erhöhtes Schlaganfallrisiko hin und ist sozusagen ein äusseres Signal für weitere Krankheiten», sagt der Dermatologe. Je nach Ausmass der Schuppenflechte bedeutet die Krankheit eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. Betroffene meiden aus Scham den Besuch von öffentlichen Bädern. Beim Schwitzen verstärken sich die Rötungen und der Juckreiz der Haut zusätzlich. Aus der unbegründeten Angst, angesteckt zu werden, werden Menschen mit Psoriasis nicht selten ausgegrenzt und zurückgewiesen – etwa im Freundeskreis oder in der Partnerschaft.

Die Abteilung für Dermatologie und Allergologie der Hochgebirgsklinik Davos ist auf die Behandlung von Psoriasis spezialisiert. Das Sonnenlicht mit seinen UVB- und UVAStrahlen spielt dabei eine zentrale Rolle, wie Chefarzt Matthias Möhrenschlager erklärt. «Bestimmte Wellenlängen des natürlichen Lichts drängen die Schuppenflechte zurück.» Hinzu kommt eine äussere Behandlung etwa mit salicylsäurehaltigen Salben, die zuerst die Schuppen von der Haut lösen. Die Schuppen verhindern das Eindringen von Sonnenlicht und weiteren Wirkstoffen. Danach kommen Cremes mit Schieferöl oder auch Cortison in Kombination mit Vitamin-D-Analoga zum Einsatz. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit ist laut Matthias Möhrenschlager ein Bad mit Lichtsensibilisatoren und einer Bestrahlung mit UVA-Wellen. Zudem gibt es medikamentöse Therapien mit sogenannten «Biologicals» in Tablettenform, als Injektionen oder Infusionen, um die Entzündungen zu blockieren. «Bei allen Behandlungen geht es um eine möglichst langanhaltende Milderung des Erscheinungsbildes. Aber heilbar ist die Schuppenflechte nicht», betont Matthias Möhrenschlager und verweist auf die genetische Veranlagung dieser Krankheit.
Gift- und Zusatzstoffe
Wie beurteilt die Naturheilmedizin das Phänomen der Schuppenflechte? Für Urs Schäffler, der in Winterthur eine manuell-energetische Praxis führt und auch Patientinnen und Patienten mit Psoriasis behandelt, spielen die Gift- und Zusatzstoffe in Lebensmitteln eine zentrale Rolle. «Die heu tige Ernährung hat einen wesentlichen Einfluss, indem sie zum Beispiel die Darmflora angreift und Autoimmunkrank heiten auslöst. Dabei richtet sich das Immunsystem gegen die Zellen des eigenen Körpers.» Aus naturheilkundlicher Sicht kann die Schuppenflechte auch durch Allergene, Medika mente, Hormonschwankungen, Infektionen, Stoffwechsel störungen oder Übergewicht ausgelöst werden.
Schlackenstoffe und Hitze
Auf der psychischen Ebene begünstigen seelische Belastungen, beruflicher Stress und eine unregelmässige Lebensführung die Bildung von Schuppenflechten. In diesem Sinne gilt diese chronische Hautkrankheit stets als ein Hinweis auf den gesundheitlichen Zustand eines Menschen. Ähnlich wird die Schuppenflechte in der ayurvedischen Medizin beurteilt: Dort spricht man von Schlackenstoffen sowie einem Übermass an Hitze. Dies schwächt das Immunsystem, so dass die Schadstoffe tiefer ins Gewebe vordringen und Haut-, Muskelgewebe sowie das lymphatische System betreffen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt Blut-Hitze als Hauptgrund für Schuppenflechte. Je mehr Hitze im Blut vorhanden ist, desto röter sind die schuppigen Hautstellen und desto aktiver ist die Krankheit.
Ausscheidungsorgane anregen
Die Naturheilmedizin behandelt die Psoriasis auf mehreren Ebenen, da man häufig von einem Wechselspiel zwischen physischen und psychischen Faktoren ausgeht. Wie Urs Schäffler informiert, werden in den natur- und volksheilkundlichen Behandlungsmethoden als erster Schritt die Ausscheidungsorgane angeregt – zum Beispiel mit harntreibenden Tees wie Brennnessel, Goldrute oder Zinnkraut. Für die Darmreinigung empfiehlt der Therapeut Flohsamen oder Leinsamen. «Sie erhöhen das Darmvolumen und fördern so


Psoriasis-Fluid:
6 Teile Wasser, 2 Teile Storchenschnabeltinktur, 1 Teil Lavendeltinktur, 1 Teil Kamillentinktur. Zweimal täglich einreiben.
Eigenurin-Anwendungen:
Zuerst einen Kamillendampf anwenden, damit sich die Poren öffnen. Dann frischen Morgenurin in Form einer fünf- bis zehnminütigen Auflage oder einer Einreibung aufbringen. Nachher in der Luft trocknen lassen und nicht abwaschen.
Vollbad mit Schöllkraut:
1 Handvoll Schöllkraut in 1 Liter Wasser aufkochen, 5 Minuten ziehen lassen, abfiltrieren und dem Badewasser beigeben.
15 bis 20 Minuten baden.
Quelle: Urs Schäffler, Irchelpraxis, Winterthur, www.irchelpraxis.ch
Schuppenflechte | gesund werden
die Ausscheidung», ergänzt Urs Schäffler. Zur Unterstützung der Leberfunktion wird eine Mariendistel-Tinktur empfohlen. Eine basenreiche Ernährung unterstützt den Heilungsprozess. Dabei sollte – so Urs Schäffler – auf die genügende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren geachtet werden, beispielsweise mit Lein-, Nuss- oder Fischöl. Ebenso ist es wichtig, den Mineralstoffwechsel mit Kieselsäure, Zink, Kalzium und Schwefelverbindungen zu optimieren.
Nur pflanzliche Produkte für die Hautpflege
Für die tägliche Pflege der Haut rät Urs Schäffler, ausschliesslich auf pflanzliche Produkte zu setzen. Nach dem Duschen kann die Haut mit Rizinus-, Jojobaöl oder Sheabutter eingerieben werden. «Echte Naturkosmetika sollten nur essbare Inhaltsstoffe enthalten», empfiehlt Urs Schäffler. Weiter schlägt der Therapeut verschiedene Tinkturen mit Storchenschnabel, Lavendel oder Kamillen vor (siehe Info-Box). Gewöhnungsbedürftig, aber wirkungsvoll seien auch Anwendungen mit Eigenurin. «Bei vielen Hauterkrankungen ist der Harnstoffgehalt in der Haut stark reduziert. Urinanwendungen führen den fehlenden Harnstoff zurück, sie verhindern eine Austrocknung, Alterung und Erkrankung der Haut.» Wer keinen Urin anwenden möchte, kann Harnstoff in Form einer Crème mit mindestens drei Prozent Urea bzw. Urin auftragen. Weitere Behandlungsmöglich-
keiten sind laut Urs Schäffler zum Beispiel feuchtwarme Wickel mit Lehm bzw. Heilerde, das Betupfen der befallenen Stellen mit reinem Eiweiss oder Waschungen mit drei- bis vierprozentiger, körperwarmer Salzlösung.
Schutz vor Verletzlichkeit
Die Haut gilt als Spiegel der Seele. Die Naturheilkunde behandelt die Schuppenflechte je nach Patientin bzw. Patient deshalb oft auch auf der psychologischen Ebene. Dabei werden alltägliche Gewohnheiten hinterfragt, um Auslöser und (Mit-)Ursachen der Schuppenflechte zu identifizieren und auszuschliessen. Auf seelischer Ebene steht die Schuppenflechte für den Schutz vor einer Verletzlichkeit, indem sich die Betroffenen verpanzern oder abgrenzen. Gleichzeitig kann diese Hautkrankheit aber auch ein Ausdruck für eine grosse Sehnsucht nach Liebe und Zuwendung sein. «Das Wichtigste im Umgang mit Schuppenflechte ist, sie nicht zu ignorieren und nichts zu unternehmen», betont Urs Schäffler, «ansonsten dehnt sie sich im Körper weiter aus.» •
Linktipps:
www.hochgebirgsklinik.ch www.irchelpraxis.ch

Hametum® LipoLotion
Nährende Intensivpflege
Pflanzlich mit Hamamelis
Reichhaltig mit Arganöl und Shea Butter
Ohne Paraffine
Ohne Parabene
Klebt nicht
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Unser Tastsinn gilt als Mutter der Sinnesorgane. Vor allem achtsame und sanfte Berührungen geben uns das Gefühl von bedingungloser Liebe.
Text: Lioba Schneemann
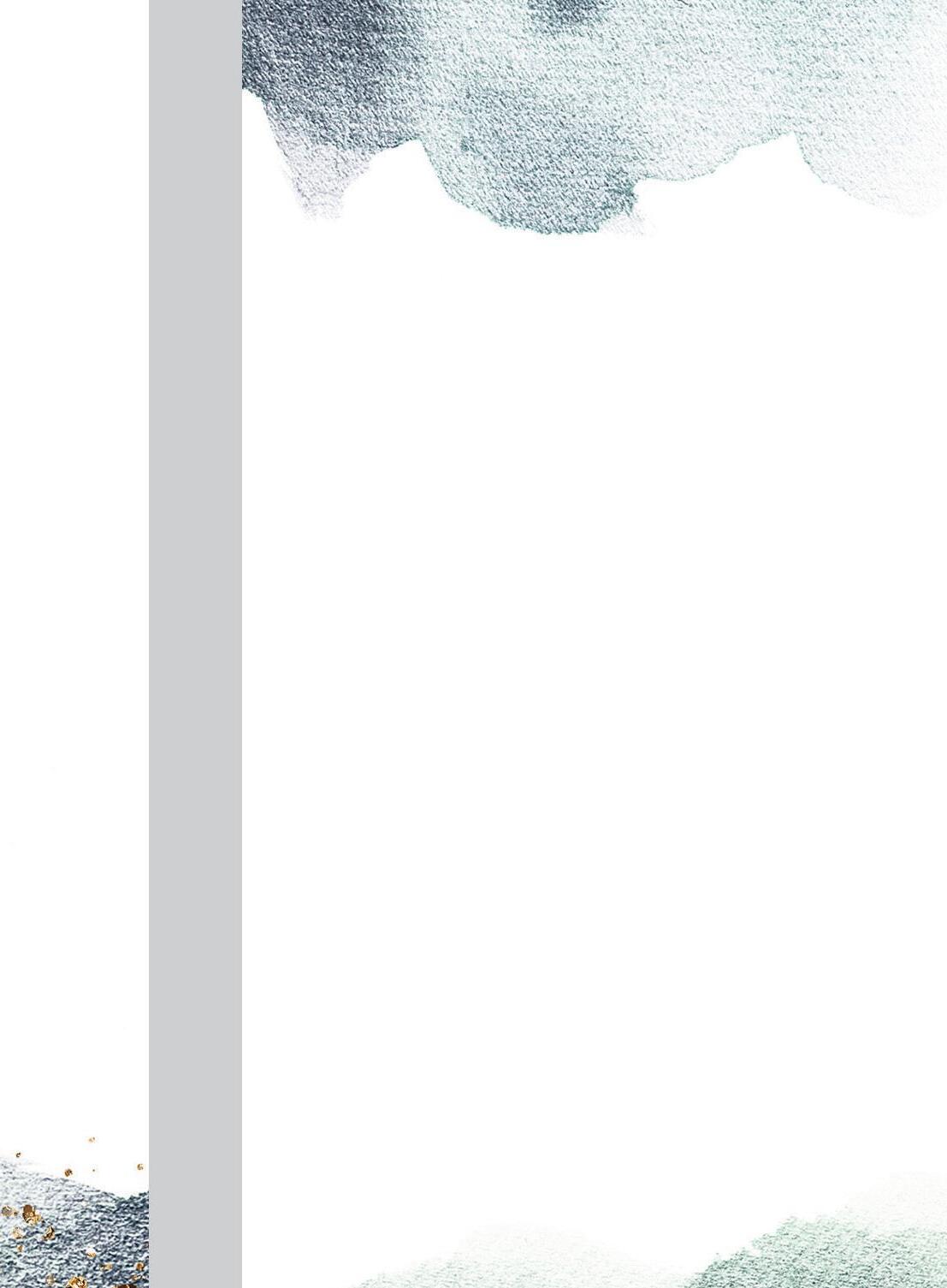


Berührung prägt uns

Die Haut ist unser grösstes Organ. Über 2 m 2 Hautoberfläche bedecken den menschlichen Körper mit Millionen von Zellen, die auf Berührung reagieren. Wir nehmen vor allem damit Kontakt zu anderen auf. In der embryonalen Entwicklung gehen Haut und Nervensystem aus demselben Keimblatt hervor (Ektoderm). Somit stellt die Haut das externe Nervensystem dar. Bereits nach wenigen Wochen kann der Embryo Reize erkennen und darauf reagieren. Das sensorische und motorische System sind miteinander verbunden. Der Tastsinn ermöglicht dem Baby, eine der wichtigsten Erfahrungen zu machen: den eigenen Körper und sich selbst wahrnehmen und erkunden. Auch später ist die Qualität der Berührung, die das Kind durch die Eltern und andere Bezugspersonen erfährt, von prägender Bedeutung für die Mutter-Kind-Beziehung wie auch für das ganze Leben. Wie wir berührt wurden, prägt unsere Sicht auf uns und auf die Welt; es bestimmt, wie wir lieben und Liebe weitergeben. Liebevolles Berühren nährt uns jedoch in jedem Alter. Es sorgt dafür, dass wir Hormone ausschütten, die wiederum Prozesse für ein gesundes Leben steuern. Dabei spielen Oxytocin, Endorphine und Neurotransmitter eine grosse Rolle. Interessant sind aktuelle Forschungen über Nervenfasern. So entdeckte man «Streichel-Sensoren» (C-taktile Fasern), die Informationen von sehr langsamen Berührungen an bestimmte Areale im Gehirn weiterleiten. Das Aktivieren der CT-Fasern erzeugt ein Gefühl von Wohlsein. Sie sind, so stellte man fest, nur auf behaarten Oberflächen zu finden und sind offenbar
dazu da, aus der Flut von Berührungen diejenigen herauszufiltern, die für das emotionale und soziale Leben wichtig sind. Diese Fasern werden angeregt, wenn wir bewusst ausgeführte, liebevolle und weiche Streichelberührungen mit einer Geschwindigkeit von drei bis zehn Zentimetern pro Sekunde erleben. Langsam ausgeführte Berührungen berühren uns demnach tiefer als schnelle.

Sinnlichkeit als Tabu
Heute weiss man, dass Berührungen sehr heilsam sind. Sie helfen beispielsweise, unseren Stress abzubauen, sich emotional zu stabilisieren, sie regulieren den Blutdruck und harmonisieren den Schlaf-Wach-Rhythmus. Louka Leppard, der Begründer der Tula-Massage spricht der Berührung eine überragende Bedeutung zu: «Wir müssen durch Berührung kommunizieren, es ist unsere ursprünglichste Sprache, in seiner höchsten Form nichts anderes als Poesie. Genauso wie wir darüber sprechen müssen, wie wir uns fühlen und was wir denken, müssen wir auch durch unseren Körper und unsere Hände sprechen. Ebenso wie wir intellektuell verstanden werden wollen, sehnen wir uns danach, physisch verstanden zu werden.»
In unserer Kultur ist das Berühren zumindest teilweise in «Misskredit» geraten. Zunehmende Digitalisierung, Entfremdung und zuletzt die unnatürliche Distanzierung in der Pandemie haben diesen Trend und eine diffuse Angst vor Nähe sicher verstärkt. «Ich beobachte derzeit zwei Strömungen», sagt der Berührungs- und Prozesscoach Markus Mühlbacher, Gründer von «Berührungswelten» in Luzern. «Auf der einen Seite eine Pseudo-Prüderie, die jede Art von Sinnlichkeit als ‹unmoralisch›, ‹sexistisch› oder als ‹Macho-Getue› ablehnt. Andererseits stelle ich ein zunehmendes Bedürfnis nach achtsamen Berührungen fest. Gerade auch Frauen trauen sich, offener ihre Bedürfnisse auszusprechen, und sich diese auch zuzugestehen.»
Seinen Klient*innen geht es vor allem um wahre Begegnung und Heilung. Die Gründe für eine Kuschelstunde oder eine Tantra-Massage sind vielfältig. «Einige sind einfach einsam, andere suchen nährenden Körperkontakt oder auch Geborgenheit, Nähe und die Erfahrung von bedingungsloser Liebe. Andere wollen sich persönlich und intim austauschen», sagt Mühlbacher.
Dieses ganzheitliche Wahrnehmen des ganzen Körpers hätten viele Klient*innen so noch nie erlebt. «Es geht um die Verbindung der Energiezentren (Chakren), aber es geht auch darum, sich geborgen, aufgehoben und geliebt zu fühlen. Sich fallen zu lassen, ganz bei sich sein.» Er höre immer wieder, dass sie dies in ihren Beziehungen nicht könnten, sich nicht getrauten oder dafür einfach die Zeit fehle. «Wahre Intimität und Nähe ergeben sich nur, wenn beide sich genügend Zeit nehmen, bei sich und beim anderen anzukommen. Und Hineinspüren, was jetzt gerade da ist.» Es erstaune nicht, dass Studien zeigten, dass Paare, die viel kuschelten wesentlich länger zusammen blieben als Paare mit viel Sex, aber weniger Kuschelmomenten. Viele Klient*innen bringen auch einen «schwer gefüllten Rucksack» mit in die Berührungssitzungen: Trauma, Verletzungen, körperlicher und seelischer Missbrauch, Depressionen oder Burnout. «Sie möchten in erster Linie einen geschützten Raum, wo sie einfach sie selbst sein können. Dieses ‹alle Emotionen sind willkommen› öffnet einen heilsamen Raum, den viele bisher in dieser Form noch nie erlebt haben», ergänzt der Therapeut.
Wertfrei und wohlwollend Berührung, egal in welcher Form, stellt eine in allen Kulturen praktizierte und ursprünglichste Heilmethode dar, unabhängig von Kultur und Epoche. Im ayurvedischen Heilsystem etwa ist die Wichtigkeit von Massagen bis heute überliefert. Jede Massage oder Therapie – sei es Kuscheltherapie, Tula-Massage, Lomi-Lomi-Massage bis hin zur Tantra-Massage – wirkt heilend. Das zunehmende Gewahrsein der Wichtigkeit von Berührungen spiegelt sich sowohl in der Wissenschaft, den Medien als auch in der steigenden Nachfrage an körperbetonten Therapien wider. Auch der Boom an achtsamkeitsbasierten Methoden zeigt, dass ein grosses Bedürfnis nach Körperlichkeit, Selbstbewusstsein und Sinnhaftigkeit vorherrscht, und ganz im ursprünglichen Sinne: Wollen wir andere mit allen Sinnen und wahrhaftig berühren und dies erlernen, egal, ob


Markus Mühlbacher, Berührungs- und Prozesscoach in Luzern



nun mit oder ohne Sex, ist ein stabile Basis wichtig. Dazu gehören die Fähigkeit, sich zentrieren zu können und im eigenen Körper anwesend zu sein sowie eine wertfreie und wohlwollende Wahrnehmung als innere Haltung. Schliesslich der Wille, die eigene «sinnliche Insel» zu entdecken und sie zu bewohnen. Präsenz sei entscheidend, betont der Berührungscoach. «Ich bin mit meinem Fühlen 100 % im Hier und Jetzt, örtlich genau bei der Berührung, die ich gerade gebe. Dies führt zu einem genussvollen, entspannten Zustand, weit weg von äusseren Bildern. Bringen wir Achtsamkeit in die Berührungen, erzeugen wir automatisch Liebe, Wachheit und Verbindung.» •
Spüren ohne Worte
Probieren Sie für zwei Minuten, körperliche Empfindungen oder Gefühle wahrzunehmen, ohne sie zu benennen. Erleben Sie einfach, wie sie kommen und gehen. Nur spüren. Wärme, Müdigkeit, Leichtigkeit
Wie ist es gelungen? Konnten Sie die Wahrnehmungen so lassen ohne Kommentar, ohne Gedanken darüber? Wenn das passiert ist, ist es kein Problem, sondern heisst: wiederholen!
Das nächste Mal, wenn Sie Ihre*n Partner*in umarmen, tun sie dies drei Minuten lang. Achten Sie beide auf einen guten Stand. Bleiben Sie in der Umarmung, ohne Reden oder Tun. Entspannen Sie dabei, so gut es geht und spüren Sie den Kontakt der Körper miteinander. Spüren Sie Ihren Atem und den Atem des anderen. Am Ende lassen Sie das Erlebte nachklingen: Was war anders als sonst? Wie hat es sich angefühlt? Wie war es für den anderen?
Wiederholen Sie diese Übung die nächsten drei Wochen täglich. Dabei sollten abwechselnd beide den*die andere dazu einladen.
Mehr unter: www.beruehrungswelten.ch

Mit EGK freier Zugang zu Natur- und Komplementärmedizin.
Grundsätzlich handelt es sich bei einer Allergie um eine Überreaktion des Immunsystems gegen an sich unbedenkliche Stoffe. Bei einer Autoallergie sogar gegen sich selbst. Man spricht dann von einer Autoimmunerkrankung. Rund ein Viertel der Menschen sind in ihrem Leben von Allergien betroffen. Tendenz steigend. Doch es gibt auch Wege aus der Allergie.
Text: Rolf Wenger Illustration: Sonja Berger
Die Symptome können sehr unterschiedlich sein.
Beim Heuschnupfen, der Pollenallergie, kennen wir die laufende, verstopfte Nase und tränende, oft juckende Augen. Je nach Allergieart reicht das Spektrum aber noch viel weiter. Es geht von Schleimhautschwellungen über Ekzeme, Nesselsucht (Bläschenbildung), Asthma, Magen-Darm-Beschwerden mit Durchfällen bis hin Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen. Alles eine Folge der Freisetzung des körpereigenen Hormons Histamin, ein lebenswichtiger Mediator bei Entzündungsreaktionen.
Bei der Allergie kennt die Medizin zwischenzeitlich sechs verschiedene immunologische Wege, die zu unterschiedlichen Reaktionszeiten führen. Bei einer Typ-1-Allergie spürt man die Reaktionen unmittelbar nach dem Kontakt. Das kann im schlimmsten Fall zum Tod führen, indem das Anschwellen der Schleimhäute die Atmung blockiert. Bei anderen Reaktionswegen können die Symptome erst Stunden oder gar Tage nach dem Kontakt auftreten. Das macht es für die Betroffenen nicht einfach, die auslösenden Substanzen herauszufinden.
Ähnliche Beschwerden können aber auch durch sogenannte Intoleranzen verursacht werden. Dabei handelt sich nicht um eine Allergie, sondern meist um einen Mangel an gewissen Stoffen wie zum Beispiel Enzymen. Dadurch können Lebensmittelbestandteile wie Lactose (Milchzucker), pharmakologische Substanzen wie Glutamat (Geschmacksverstärker), Lebensmittelzusätze oder an sich schon histaminhaltige Lebensmittel nicht richtig abgebaut werden.
Wir können auf fast alles eine Allergie entwickeln. Zu den klassischen Auslösern gehören Pollen und Sporen, Tier haare, -epithelien, Hausstaubmilben, Insektengifte, Kos metika (auch Bio, wenn man auf bestimmte Pflanzenstoffe reagiert), Medikamente wie z. wie z. B. Nüsse, Nahrungsmittelzusatzstoffe, Chemikalien wie etwa Waschmittel oder Metalle wie Nickel.
Kreuzallergie auf ähnliche Stoffe
Vielleicht haben Sie auch schon von der Kreuzallergie ge hört. Das heisst, dass das Immunsystem auch auf ähnliche Stoffe reagiert, wie sie im Primärallergen vorhanden sind. So kann es bei einer Allergie auf Baumpollen eine Kreuz reaktion auf einige Stein- und Kernobstsorten, Nüsse, Kiwi, Sellerie, diverse Gewürze wie Curry, Anis, Knoblauch, Hopfen, Soja, Petersilie, Basilikum und/oder Zwiebeln kommen. Bei einer Allergie auf Kräuter- und Blumenpollen sind es teilweise wieder andere Substanzen. Für Betroffene ist es wichtig, dies zu wissen.


Es ist bekannt, dass Kinder von Eltern mit Allergien eine deutlich grössere Allergieneigung aufweisen, zum Teil bis um das Vierfache. Die Ursachen für die Überreaktionen sind medizinisch weitgehend unbekannt. Es werden viele mögliche Ursachen diskutiert, wobei vermutlich eine Kombination derselben ausschlaggebend ist. Wenn wir uns damit beschäftigen, kennen wir auch schon die ersten Therapieansätze.
Umweltfaktoren: Dazu gehören nebst den natürlichen Stoffen wie Pollenflug oder Ozon auch die menschgemachte Luftverschmutzung durch Abgase, Feinstaub von Kerzen oder toxische Stoffe, wie z. B. Quecksilber aus Amalgamfüllungen, welche ein Kind bereits im Mutterleib über die Plazenta oder später als Neugeborenes über die Kleider von Raucher*innen aufnimmt.
Medikamente: Antibiotika vernichten oft auch lebensnotwendige Bakterien in unserem Darm, dem Fundament für die Schleimhautimmunität. Je geringer die mikrobielle Vielfalt, desto höher das Risiko für allergische Erkrankungen. Auch Mehrfachimpfungen im Kindesalter stehen im Verdacht, das Terrain für Allergien zu ebnen. Kennen Sie ein Kind, das zwölf Infektionskrankheiten gleichzeitig hat? Doch das wird unseren Kleinsten, deren Immunsystem noch gar nicht richtig ausgeprägt ist, zugemutet. So kann es sein, dass der Körper derart überfordert ist, dass er sich als Schutzmassnahme grundsätzlich einmal gegen alles wehrt – auch gegen sich selbst. Und damit sind wir wieder bei den Autoimmunerkrankungen.
Ernährung und Lebensstil: Ein zu frühes Abstillen und Zufüttern von artfremden Proteinen kann die Allergieneigung ebenso erhöhen wie eine Unterforderung des Immunsystems. Eine übertriebene Hygiene und der fehlende Kontakt zu anderen Menschen, Tieren und der Natur im frühen Kindheitsalter ist bei der Ausbildung des Immunsystems hinderlich.
Psychische und soziale Faktoren: Es ist längst erwiesen, dass Stress auch das Immunsystem beeinflusst. Spannungen in der Familie oder im Beruf, chronische Unzufriedenheit durch das Gefühl nicht geliebt zu sein, stetige Überforderung durch das Gefühl nicht gut genug zu sein, gelten als gewichtige Faktoren bei jungen Allergiker*innen.
Bei der Selbstdiagnose hat ein genau geführtes Esstagebuch schon vielen geholfen, mögliche Auslöser aufzudecken. Für die wichtigsten Intoleranzen gibt es einfache Selbsttests (siehe Kasten 1). Auch in der naturheilkundlichen Praxis steht vor einer Behandlung eine seriöse Diagnostik. Über das Blut kann zwischen Allergien und Unverträglichkeiten differenziert werden. Es gibt Stoffe, die keine Allergie, sondern eine stille Entzündung auslösen. Nicht selten kommt es vor, dass sogar entzündungshemmende Heilmittel wie Kurkuma oder Weihrauch selbst eine Entzündung verursachen. Beim Verdacht auf eine Lebensmittel-Intoleranz wird ein Atemgastest durchgeführt und ein Mangel an Mikronährstoffen ermittelt, die für den Abbau von Histamin relevant sind. Zudem spielt die Stuhldiagnostik eine wichtige Rolle. Die Regulationsdiagnostik mit dem Armlängenreflextest stellt eine weitere Säule dar. Wenn etwas im Körper Stress auslöst, beeinträchtigt dies massgebend das vegetative, bzw. autonome Nervensystem. Das ist der Bereich im Körper, der alle unbewussten Prozesse steuert. Der Körper verspannt sich unter Stress asynchron (einseitig). Mit einem speziellen Armlängentest kann diese Verspannung festgestellt werden. Dies gibt wertvolle Hinweise, worauf der Körper reagiert, ob er regulationsfähig bleibt oder eine energetische Blockade vorliegt.
In der Therapie setzt die Akutmedizin auf Anti-Histaminika und Kortison. Das kann in Notfällen lebensrettend sein. Doch wirkt es bloss symptomatisch. Solange die Ursachen nicht behoben werden, sind die Erfolge oft dürftig. Was können wir also noch tun?
In erster Linie gilt es, den Körper zu entlasten – und das nicht nur von den allergieauslösenden Substanzen. Auch die allgemeine Schadstoffbelastung ist zu minimieren, sei dies aus Nahrung, Kleidung, Abwaschmitteln, Wohnungseinrichtung (Möbel, Teppichböden), Kosmetika, Raumsprays, WC-Steine usw. Eine gezielte Ausleitung von nachgewiesenen Schwermetallen und anderen Umweltgiften schafft weitere Reserven. Dazu unterstützen wir unsere Ausscheidungsorgane mit allen Varianten des grünen Gemüses, aber auch Algen. Kräuter wie Löwenzahn oder Mariendistel (Leber/Galle), Goldrute (Niere), Linden- oder Holunderblüten (Haut), Steinklee (Lymphe) und aus reichend Ballaststoffe (Darm) helfen bei der Entgiftung. Schwefelhaltige Lebensmittel mobilisieren die toxischen Stoffe. Dazu gehören Zwiebeln, Knoblauch, Eier, Kohl-

Selbsttest auf Lebensmittelinteloranz
Bei Verdacht auf Laktose: Milch und deren Produkte für eine Woche reduzieren, danach morgens 0,5 Liter Vollmilch trinken. Bei Verdacht auf Fruktose: Früchte und fruchtzuckerhaltige Lebensmittel für eine Woche reduzieren und danach morgens 10-15 getrocknete Pflaumen essen. Treten unter der Provokation abdominelle (Blähungen, Durchfall, schmerzhafter Stuhldrang usw) oder extraintestinale (Migräne, Depression usw.) Beschwerden auf, ist das ein Hinweis auf eine entsprechende Kohlenhydratunverträglichkeit.
gemüse wie Brokkoli, Walnüsse, Leinsamen und mehr. Aus der ayurvedischen Medizin hat sich die Entgiftung über die Mundschleimhaut mittels der Ölzieh-Kur bewährt (siehe Kasten).
Eine gezielte Darmsanierung mit dem Ausleiten krankmachender Keime, dem Aufbau lebensnotwendiger Bakterien und schleimhautstärkenden Substanzen gehört zum Fundament einer ursächlichen Allergiebehandlung. Denn gibt es im Darm ein Übermass an histaminbildenden Bakterien, ist das Fass schneller voll, bevor es überläuft. Zudem vermehren sich die Unverträglichkeiten mit einem zunehmenden Leaky-Gut-Syndrom (Darmpermeabilität). Das kann so weit gehen, dass jemand kaum mehr etwas verträgt, das er zu sich nimmt. Bestimmte Bakterien regulieren auch gezielt die Schleimhäute der Atemwege.
Die richtigen Heilpflanzen auswählen Ein Pestwurzextrakt kann genauso wirksam sein wie klassische Antihistaminika, allerdings ohne deren Nebenwirkungen. Aufgrund der leberschädigenden Alkaloide ist ein Fertigpräparat aus der Apotheke oder Drogerie von Vorteil. Gemäss Kneipp haben sich im Akutfall auch das reizlindernde warme Bad oder Fussbad mit Zusatz von Kleie, Molke oder Ackerschachtelhalm sowie die warme Auflage mit Tee von Stiefmütterchen, Schafgarbe, Salbei oder Lindenblüten bewährt. Ysop-Kraut kann auch als Tee gegen Heuschnupfen wirken (jedoch nicht in der Schwangerschaft anwenden). Vielen ist sicher der Augentrost bekannt, der die allergische Bindehautentzündung mildert. Holunder, Spitzwegerich und schwarze Johannisbeere zeigen nebst der wichtigen Brennnessel ebenfalls mildernde Wirkung. Immer mehr ins Licht der Allergiebehandlung rücken auch die Heilpilze. So kann der Reishi die Histaminausschüttung reduzieren und antientzündlich auf Haut und Schleimhäute wirken. Hericium wirkt auf Magen- und Darmschleimhaut regenerierend. Pleurotus hilft das Darmmikrobiom aufzubauen und stärkt das darmassoziierte Immunsystem. Und selbst der Maitake enthält antiallergisch wirkende Stoffe.
Die Seele in die Balance bringen Oft repräsentieren Allergien einen Toleranzverlust auf der emotionalen Ebene. So können wir uns fragen, wo wir uns und anderen gegenüber zu wenig tolerant sind. Wo herrscht Intoleranz vor Liebe? Bei der Psoriasis kann häufig das Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Nähe bei

Sie nehmen dazu morgens nach dem Aufstehen einen Esslöffel kaltgepresstes Bio-Öl (zum Beispiel Sesam, Sonnenblumen, Leinöl) in den Mund und ziehen es rund 10 min zwischen den Zähnen hin und her. Das Öl wird mit der Zeit dünnflüssig und schaumig. Spucken Sie es aus und spülen Sie den Mund mehrmals mit Wasser. Bitte aber nicht ins Lavabo, da dieses verstopfen könnte. Danach putzen Sie sich gründlich die Zähne. Wenn Sie Lust dazu haben, können Sie es gerne abends vor dem Zubettgehen wiederholen.
gleichzeitigem Schutz davor beobachtet werden. Eine AutoAggression, also wenn die Aggression in sich hineingefressen wird, können wir über das Spiegelbild sichtbar machen. Dann führt das Betrachten von sich selbst in einem Spiegel zu einer messbaren Reaktion im autonomen Nervensystem. Wer mit der Selbstbehandlung an seine Grenzen kommt, dem dienen die Neurobiologie nach Dr. Klinghardt, die Klopf-Akupressur oder andere bewährte Therapieverfahren. Und daran denken: Ein mehrstündiger Waldspaziergang reguliert den Stress, schont die Atemwege (ausser bei spezifischen Allergien) und moduliert das Immunsystem noch über mehrere Tage.
Nahrungsmittel als Heilmittel nutzen
Grundsätzlich empfiehlt sich eine basische Ernährung. Der vorübergehende Verzicht auf Milch- und Weizenprodukte sowie Süssigkeiten unterstützt eine schnellere Ausheilung. Enzyme spielen eine Schlüsselrolle, da sie jegliche Art von Entzündungen modulieren. Ideal wären Ananas und Papaya. Doch finden wir in unserer Gegend keine am Baum gereiften Früchte. So kann sich der Griff nach speziellen Nahrungsergänzungen für die innere als auch äussere Anwendung lohnen. Vitamin C, das ähnlich wie ein Antihistaminikum wirkt, bieten auch Früchte in unserer Umgebung. Dazu gehören Hagebutte, Sanddorn und die Acerloakirsche. Es findet sich aber auch in vielen Gemüsen, z. B. Brokkoli und Paprika. Im Winter profitieren wir vom Sauerkraut und seinem Saft, sofern nicht pasteurisiert. Denn Vitamin C wird ab 40 Grad zerstört. Auch die Petersilie soll eine Histaminausschüttung hemmen. Die Allergiesymptome können aber auch durch Stangensellerie gemildert werden, sofern keine Unverträglichkeit darauf besteht. Kürbis und Karotten können durch den hohen Carotinanteil helfen.
Die Natur bietet uns in der Behandlung von Allergien ein riesiges Arsenal heilender Wirkstoffe. Es gilt einfach, sich vom Gedanken zu verabschieden, dass keine Heilung möglich ist.
Die Natur bietet uns in der Behandlung von Allergien ein riesiges Arsenal heilender Wirkstoffe. Es gilt einfach, sich vom Gedanken zu verabschieden, dass keine Heilung möglich ist. Dabei kann uns eine Urtinktur der Gundelrebe helfen. Wecken wir das Vertrauen in unseren inneren Arzt, unsere Selbstheilungskräfte. Gemäss Dr. Roger Kalbermatten «öffnet sie die Augen für die Einsicht, dass wir nicht alles selbst tun müssen, dass – wenn wir uns dafür öffnen –die Hilfe schon da ist.» •

Krebsbehandlung | gesund werden
Der Krebs gilt als Seuche der modernen Zivilisation. In der Komplementärmedizin wird bei der Krebsbehandlung der Mensch als Ganzes berücksichtigt, sei es bei der Prävention, Behandlung wie auch Nachsorge.
Text: Fabrice Müller
Die Komplementär- bzw. Naturheilmedizin betrachtet den Krebs umfassender als die Schulmedizin», sagt Dr. Marion Debus, Chefärztin Onkologie der Klinik Arlesheim BL, die sich auf eine ganzheitliche Krebsbehandlung spezialisiert hat und 2021 ihr Hundert-Jahr-Jubiläum feierte. Es gehe nicht nur darum, die bösartigen Krebszellen zu beseitigen, sondern die Kräfte im gesamten Organismus zu stärken, sodass sich die formgebenden Kräfte auf der Zellebene wieder entfalten können. «Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit der Frage, was für Einflüsse dem Organismus die Form geben und welche Kräfte das von Krebs befallene Organ schwächen», erklärt Dr. Marion Debus. Die Suche nach den medizinischen Ursachen sollte einher gehen mit der Frage nach dem Warum auf der seelisch-geistigen Ebene.
Wie lässt sich Krebs verhindern?
Welche Lebensweise und Geisteshaltung begünstigen die Entstehung von Krebs? Oder anders gefragt: Wie lässt sich der Krebs verhindern? Für den Komplementärmediziner Dr. Simon Feldhaus vom Paramed-Ambulatorium in Baar ZG steht der Krebs in einem engen Zusammenhang mit der Lebensart, der geprägt ist von der Ernährung, der Arbeit, der Familie wie auch vom Umfeld, wo man wohnt und arbeitet. «In der Komplementärmedizin betrachten wir die Patientin oder den Patienten als Ganzes, indem wir auch die Persönlichkeit und Lebensweise miteinbeziehen», sagt Dr. Simon Feldhaus. Freien Radikalen werde dabei ebenso Beachtung geschenkt wie dem oxydativen Stress, Vitamin-DMangel oder der Schwermetallbelastung im Körper. Genetische Faktoren indes finden offenbar im Krebs eher selten ihren Ausdruck. Als wesentliche Einflussfaktoren, die mit der Lebensweise in Zusammenhang stehen, gelten die Ernährung, Bewegung und der Umgang mit Stress.
Ernährung und Bewegung
Einzelnen Lebensmitteln wird laut der Krebsliga eine krebsvorbeugende Wirkung nachgesagt, beispielsweise Knoblauch, Kohl, Grüntee, Kaffee, Ingwer, Milch und andere Lebensmittel. Als wertvoll werden Inhaltsstoffe wie Allicin in Knoblauch, Curcumin in Kurkuma, Chlorogensäure in
Kaffee oder Glucosinolate in Kohlgemüse genannt. Allgemein wird eine vielseitige und abwechslungsreiche Ernährung mit einem hohen Anteil an Gemüse, Früchten und Vollkornprodukten empfohlen. Rotes Fleisch gilt hingegen als krebserregend, wie die Internationale Agentur für Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer –IARC) der Weltgesundheitsorganisation 2015 in einer MetaStudie zum Schluss kam. Laut Dr. Marion Debus von der Klinik Arlesheim führt der allzu häufige Verzehr von Fleisch zu einer ungünstigen Zusammensetzung der Darmflora. «Die Darmflora ist das Trainingslager für unser Immunsystem und somit entscheidend für die Krebsprävention.» Raffinierter Zucker soll die Krebsbildung ebenfalls begünstigen. Der Medizin-Nobelpreisträger Otto Heinrich Warburg erkannte bereits 1924, dass die meisten Krebszellen ihren Energiebedarf durch eine hohe Glycolyse- bzw. Zuckerrate, gefolgt von Laktosefermentation, also dem Abbau der Zuckerlaktose in eine Säure, decken. Die IARC schätzt, dass jede vierte Krebserkrankung weltweit auf das Konto von Übergewicht, Fettleibigkeit und mangelnde Bewegung geht. Letztere ist in der Krebsprävention so wertvoll, weil sie Stoffe wie Myokine in den Muskeln freisetzt. In letzter Konsequenz führt dieser Prozess dazu, dass die Bildung von Polypen, aus denen Krebskarzinome werden können, im Darm gehemmt wird und dadurch auch die Entstehung von Krebs.
«
In der Komplementärmedizin betrachten wir die Patientin oder den Patienten als Ganzes, indem wir auch die Persönlichkeit und Lebensweise miteinbeziehen. »

Lebensrhythmus und Familie
Aus anthroposophischer Sicht ist der Lebensrhythmus ein wichtiger vorbeugender Faktor gegen Krebs. «Wir leben heute immer mehr abgekoppelt vom Rhythmus der Natur, sei es beim Essen, Schlafen oder Arbeiten», erklärt Dr. Marion Debus und verweist auf die Entdeckung der inneren Uhr in allen Organen durch Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young; sie wurden dafür 2017 mit dem Medizin-Nobelpreis geehrt. Der Lebensrhythmus ist laut Dr. Marion Debus ein entscheidender Faktor bei der Entstehung bzw. Vorbeugung von Brustkrebs. Der Wärmeorganismus des Menschen, der für eine mehr oder weniger konstante Eigenwärme von ca. 37 Grad Celsius im Körper sorgt, steuert alle anderen Rhythmen und hat dabei einen grossen Einfluss auf das Immunsystem. «Wer etwa als Kind häufig an fieberhaften Krankheiten litt, ohne dass das Fieber unterdrückt wurde, erkrankt im Erwachsenenalter weniger an Hautkrebs», wie epidemiologische Untersuchungen gemäss Dr. Marion Debus zeigen. Auf der sozialen und psychologischen Ebene sollen, so haben Forschende des Instituts für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich und der Adelaide Medical School 2018 herausgefunden, die Grösse der Familie und der Zusammenhalt untereinander mit dem Krebsrisiko in Verbindung stehen. Das heisst: Je grösser die Familie ist, desto weniger häufig treten bestimmte Krebsarten auf wie Hirntumor, Blasen-, Lungen-, Magen-, Haut-, Brust-, Dickdarm-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs. Auch eine positive Lebenseinstellung, frei von Ängsten, wirke krebspräventiv, ergänzt Dr. Marion Debus, denn Angst bedeute Kälte und schwäche das Immunsystem.
Komplementärmedizinische Behandlungen
Welche Methoden kommen in der Komplementärmedizin bei der Krebsbehandlung zum Einsatz? Nach Dr. Simon Feldhaus setzt die Komplementärmedizin auf eine möglichst individualisierte Behandlung frei von Schemata und angepasst an die schulmedizinische Therapie. In über 90 Prozent der Krebsfälle greife die Komplementärmedizin auf die Misteltherapie zurück.

• Die Mistel, ein Parasit auf Bäumen, gilt als das am besten erforschte komplementärmedizinische Arzneimittel. Es zerstört die parasitären Krebszellen und regt das Immunsystem an. Auch die Klinik Arlesheim arbeitet häufig mit Mistelpräparaten. «Die Misteltherapie steigert die Vitalität und hilft, die Chemotherapie besser zu vertragen», sagt Dr. Marion Debus. Bei Bauchspeicheldrüsen- und Lungenkrebs etwa wirke die Mistel lebensverlängernd, wie Studien zeigten.
• In der individuellen orthomolekularen Medizin, wie sie zum Beispiel von Dr. Simon Feldhaus am Paramed-Ambulatorium in Baar angewandt wird, kommen Mikronährstoffe wie Zink, Selen oder Vitamin D zum Einsatz, um die Gesundheit zu erhalten oder einen therapeutischen Effekt zu erzielen.
• In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) gilt, dass jegliches Ungleichgewicht der Organe eine Disharmonie hervorbringt, die mit Heilmitteln, Akupunktur, Qi Gong und spezieller Ernährung zu beheben ist. Artemisia annua beispielsweise ist ein seit Jahrhunderten aus der Traditionellen Chinesischen Medizin bekanntes Heilmittel gegen Krebs. Weiter verschreibt die TCM unter anderem Heilpilze, deren Wirkung auf ihren entgiftenden und anti-oxidativen Wirkstoffen beruht. Beta Glucan bewährt sich als Hauptwirkstoff, indem es wie kein anderes Naturheilmittel die Abwehrzellen, speziell die NK-Killerzellen stärkt. Diese Abwehrzellen greifen den Tumor direkt an. Mehrere Studien bestätigten die im Laborversuch beobachteten Effekte einer Anti-Tumorwirkung und Immunstärkung.
• In der klassischen Homöopathie geht man davon aus, dass bestimmte Menschen aufgrund ihrer charakterlichen Eigenschaften eher und schneller an Krebs erkranken als andere. Diese Theorie ist jedoch umstritten. Der homöopathische Arzt Dario Spinedi, Gründer der gleichnamigen Klinik in Orselina TI, nahm gemeinsam mit seinem Team in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle der homöopathischen Krebstherapie in Europa ein.


• In Indien werden Krebspatienten mit Ayurveda, Chemotherapie und Homöopathie behandelt. Ayurveda eignet sich als Erfahrungsmedizin gut für die Heilung von chronischen Krankheiten wie etwas Krebs. Ein wichtiger Bestandteil der Therapie sind Yoga-Übungen und Meditationen. Vor der Chemotherapie kann der Körper durch ayurvedische Heilmittel vorbereitet werden.
• In der Behandlung mit Hyperthermie werden der Körper oder einzelne Körperpartien gezielt erwärmt. Dies löst einen «Hitzestress» aus und lässt die Krebszellen empfindlicher werden gegenüber körpereigenen Abbauprozessen, einer begleitenden Strahlenbehandlung oder Chemotherapie, regt aber auch das Immunsystem als Ganzes an.
• Die sogenannte therapeutische Sprachgestaltung, eine wichtige Säule der anthroposophischen Onkologie, kann von Sprech-, Stimm- und Atemstörungen über ein weites Spektrum von Erkrankungen bis hin zur Verbesserung der Wärmebildung, der körpereigenen Abwehrkräfte sowie der bewussten Lebensführung und menschlichen Autonomie eingesetzt werden.
Viele Krebsbehandlungen zielen auf eine Stärkung des Immunsystems ab. Bei Lymph- oder Blutkrebs etwa sei dies, so Dr. Simon Feldhaus, kein guter Weg, weil dadurch gleichzeitig auch die Krebszellen gestärkt würden. Besonders beim Einsatz von «sanften» Methoden gegen Krebs sei die strikte Einhaltung des Ablaufs wichtig. Damit eine komplementärmedizinische Krebstherapie wirke, brauche es aber auch die aktive Mitarbeit durch die Patientin bzw. den Patienten, wie Dr. Simon Feldhaus betont. Dazu gehöre ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient*innen und Ärzt*in, aber ebenso die Bereitschaft, an sich zu arbeiten und gewisse Lebensmuster zu ändern. «Wir bieten unseren Patient*innen die nötige seelisch-geistige Unterstützung, damit sie ihre Ressourcen im Hier und Jetzt einsetzen können.»
Jede Epoche hat ihre typische Seuche, sagt Dr. Rosina Sonnenschmidt, Naturheilpraktikerin und Autorin des Buchs «Miasmatische Krebstherapie. Prozessorientierte Behandlung mit Homöopathie und Naturheilkunde» (siehe Buchtipps). Die Seuche repräsentiere ihren Zeitgeist und stelle die Menschen vor zentrale Fragen: Welches Bewusstsein manifestiert sich in der Seuche? Welche Themen des Menschseins drückt sie aus? Wie kann sie erfolgreich behandelt werden? Die «Seuche» unserer Epoche sei der Krebs. Ursprünglich stammt der Begriff «Krebs» vom griechischen Arzt Hippokates (karkinos (griech.) = Krebs). Er verglich das «nicht heilende Geschwür» wegen seines Wachstums mit den Zangen eines Krebses. Im Zeitgeist des Krebses spielt sich laut Dr. Rosina Sonnenschmidt die moderne Lebensweise, die sich bekanntlich auszeichnet durch eine Abtrennung von der Natur, von Gefühlskälte, Leistungsstress usw. Die aktuelle Zeit lasse hingegen wenig Raum für die individuellen Potenziale und Bedürfnisse. Das Krebsgeschehen selbst sei ein Inbegriff autonomer Produktivität und Kreativität – jedoch mit negativem Vorzeichen. «Der grösste Irrtum der Ärzte besteht darin, den Körper heilen zu wollen, ohne an den Geist zu denken. Doch Körper und Geist sind eins und sollen nicht getrennt behandelt werden», klagte bereits der griechische Philosoph Plato (427–347 v. Chr.). Seine Kritik scheint an Aktualität nicht verloren zu haben – besonders auch in der Krebsbehandlung. (fm)
gefragt: Claudia Witt

Claudia Witt, Professorin und Direktorin des Instituts für komplementäre und integrative Medizin am Universitätsspital Zürich, über das Miteinander von Onkologie und Komplementärmedizin bei der Behandlung von Krebspatienten.
Interview: Fabrice Mülller
natürlich: Was braucht es, damit Onkologie und Komplementärmedizin in der Behandlung von Krebspatienten erfolgreich zusammenarbeiten?
Claudia Witt: Das gesamte Behandlungsteam – auch komplementärmedizinische Therapeut*innen – muss sich mit Krebserkrankungen auskennen und die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellen. Eine einheitliche Sprache, gegenseitige Informationen und die Berücksichtigung von wissenschaftlichen Erkenntnissen bei den komplementärmedizinischen Empfehlungen sind eine wichtige Basis für eine gute Zusammenarbeit. Nur so ist eine sichere Behandlung möglich, denn die Komplementärmedizin soll ja unterstützend wirken und nicht die Krebstherapie stören.
Wie profitieren die Patientinnen und Patienten von einer engeren Zusammenarbeit zwischen Onkologie und Komplementärmedizin?
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Verfahren wie zum Beispiel die Akupunktur Symptome der Krebserkrankung und Nebenwirkungen der Krebstherapie reduzieren können. Akupressur, Entspannungsübungen und Yoga ermöglichen es Patientinnen und Patienten, sich aktiv in die Krebsbehandlung einzubringen und selber etwas für das Wohlbefindens zu tun. Dies lässt sich jedoch nicht so einfach in der breiten Krebsbehandlung umsetzen, da es bisher nicht genug Angebote im Rahmen der Grundversicherung gibt und Anbietende in der Zusatzversicherung oft noch nicht die entsprechenden onkologischen Kenntnisse haben.
Was muss sich im Miteinander von Onkologie und Komplementärmedizin in der Krebsbehandlung künftig verbessern?
Es braucht spezifische Fortbildung. Dort plädiere ich dafür, dass sich nichtärztliche Therapeutinnen und Therapeuten aus der Komplementärmedizin mehr Fachwissen aus der Onkologie aneignen. Im Gegenzug braucht es bei den Onkologinnen und Onkologen ein Grundwissen über komplementärmedizinische Verfahren und Kenntnis der Studienlage, damit sie die Patientinnen und Patienten darüber informieren können. Im Medizinstudium wird dieses Wissen zunehmend vermittelt. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer ganzheitlicheren Versorgung von Krebspatienten und -patientinnen.
Zur Person
Claudia Witt, Professorin und Direktorin des Instituts für komplementäre und integrative Medizin am Universitätsspital Zürich.
Foto: Frank Brüderli
Nach der Behandlung: Lebensweise ändern
Um einen erneuten Krebsausbruch nach der Behandlung zu verhindern, arbeitet man in der Komplementärmedizin laut Dr. Simon Feldhaus aktiv am Aufbau des Immunsystems. Dazu gehört zum Beispiel die Weiterführung der Misteltherapie. Weiter sollen Risikofaktoren rund um Ernährung, Lebensweise, Stress usw. bewusst reduziert werden. «Manchmal braucht es radikale Veränderungen im Beruf oder in der Ernährung, um den Krebs zu verhindern», betont der Komplementärmediziner. Jene Empfehlungen, die in der Krebsprävention ihre Gültigkeit haben, sollten auch nach der Krebsbehandlung beachtet werden, sagt Dr. Marion Debus.
Anita Herrmann (Name geändert) blickt auf eine kräftezerrende Chemotherapie zurück. Nun freut sie sich. «Ich habe wieder Singen gelernt. Und mit dem Singen und der Musik etwas auszudrücken, was ich vorher nicht sagen konnte. Und mit dem Trommeln, ja überhaupt mit der Freiheit der Musik habe ich den inneren Zugang zu mir selbst wieder gefunden», freut sich die 42-Jährige, die nach der Brustkrebs-Behandlung eine ambulante Rehabilitation am Sokrates Gesundheitszentrum Bodensee in Güttingen TG absolviert und über die verschiedenen alternativen Therapien wieder neuen Mut zum Leben geschöpft hat. Vieles dieser ambulanten Rehabilitation hat bei ihr offenbar tiefe Spuren hinterlassen. Ganz besonders die Musiktherapie: «Mir war schon bewusst, wie wohltuend die Arbeit mit Musik ist. Aber diese Erfahrung, was es in einem bewegt und hilft, zu sich selbst zu kommen und mich wahrzunehmen, das hat meine Vorstellung weit übertroffen.» Die Musiktherapie gab Anita Herrmann ein Werkzeug, diese Kraft und Lebendigkeit aus der Kindheit wieder aufleben zu lassen. Am Gesundheitszentrum Bodensee arbeiten Schulmedizin- und Komplementärmedizin Hand in Hand. •
www.klinik-arlesheim.ch
www.paramed.ch www.klinik-sokrates.ch
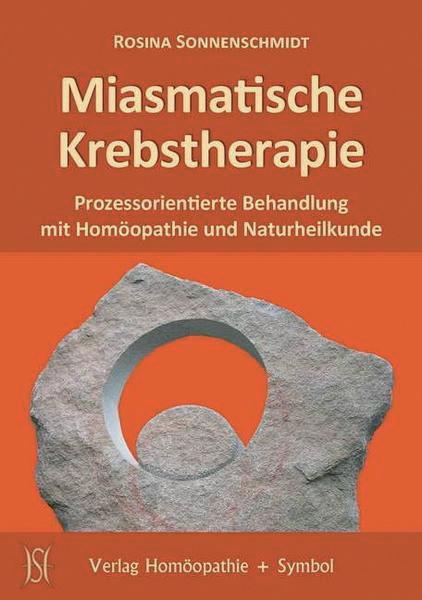
Buchtipp
Rosina Sonnenschmidt
Miasmatische Krebstherapie
Prozessorientierte Behandlung mit Homöopathie und Naturheilkunde
Verlag Homöopathie + Symbol, 2008, 487 Seiten, ISBN 978-3-937095-15-8, CHF 52.–
Text: Alice Hofer
B ekanntlich ist es uns Menschen möglich, kraft der Liebe die grössten Wunder zu vollbringen, den tiefsten Schmerz zu bewältigen und die höchsten Hürden zu überwinden. Eine Fähigkeit also, die wir niemals unterschätzen sollten. Wenn man bedenkt, dass alles aus Liebe entstand und nach Liebe strebt, wird ersichtlich, dass mit liebevoller Betrachtung alles seine goldene Entfaltung findet. Was uns daran hindert, dies zu sehen, sind «lediglich» unsere Beurteilungen. Wenn es uns gelingt, in allen Erscheinungsformen eine Weisheit zu erkennen oder doch zu vermuten, können wir Vertrauen haben in einen Sinn, egal, ob dieser sich nun zeigt oder nicht. Die grossen Meister nennen es «Nicht-Einmischen, nur Betrachten». Es hat eine Weile gedauert, bis ich dies begriff, und nun fühlt es sich immer besser an, vor allem in Situationen, die unverständlich scheinen. Es bringt Geduld, Gelassenheit und Eigensinn, wovon Letzterer grossen Spass macht (wie bereits Hermann Hesse zu berichten wusste).
«Nicht-Einmischen» bedeutet, den höchsten Respekt zu bekunden. Gegenüber der Natur heisst das etwa: «Ich anerkenne deine Zyklen und füge mich diesen.» Gegenüber Menschen heisst es im Klartext: «Ich anerkenne dein Potential und traue dir zu, es zu meistern.»
Indem wir andern mit dieser Haltung begegnen, erlösen wir sie automatisch aus ihrer Unsicherheit und erheben sie auf Augenhöhe. Wir ermutigen einander damit gegenseitig zur eigenen Schöpferkraft und Verantwortung für unseren Anteil am Geschehen. Ob wir dann maximal reüssieren oder halt nur teilweise, bleibt letztlich ein gradueller Unterschied (und am Ende des Tages vielleicht auch egal), denn wichtig ist, ob wir selbst uns zutrauen, unser Leben zu leben. Dabei meine ich, dass «Versagen» und «Scheitern» ebenfalls Produkte der menschlichen Beurteilung sind, denn aus der Sicht des Universums gibt es sowas nicht, und ich unterstelle jetzt mal unserem Schöpfer sowieso absolute Urteilslosigkeit und bedingungslose Liebe.
Wenn wir jemandem sagen «ich liebe Dich», kann dies sowohl heissen: «bitte liebe mich auch!» wie «ich brauche Dich!» Manche finden, die Liebe sei schmerzhaft. Ich sage: Nicht die Liebe schmerzt, sondern die Angst davor, nicht zurückgeliebt zu werden, nicht gebraucht zu werden, nicht bedeutend zu sein. Diese Angst verschwindet im Moment, wo wir uns selbst lieben (und danach den Nächsten). Wir wählen ständig, bewusst oder unbewusst, ob wir an uns selbst glauben und bereit sind, uns selbst zu sein.
Neulich beobachte ich vermehrt ein bemerkenswertes Verhalten von Leuten, die sich berufen fühlen, andere unbedingt zu belehren: Ungefragt, unverlangt, und vor allem unentgeltlich dreschen sie Ratschläge (mehr Schläge als Rat). Die Besserwisser*, Missionare* und Wach-Apostel* spriessen wie Pilze aus dem Boden. Mir wird schwindlig, wenn ich höre, was ich alles tun solle, um mein Dasein zu verändern, verbessern, bereichern, flicken, retten oder mindestens zu geniessen. Es fragt sich, ob sie sich damit selber aufpolieren könnten, als Botschafter und Helden? Haben sie ein Mandat? Könnten die Diagnosen, die sie anderen stellen, einen blinden Fleck in der Pupille des Absenders offenbaren? Wohl sieht man den Dorn in Bruders Auge besser als den Balken im eigenen. Die meisten Absichten sind gut gemeint, allerdings nicht gut durchdacht.
Ich glaube, dass wir von Natur aus vollkommen sind und uns gleichzeitig stets wandeln dürfen. Was sich als «Mangel» oder «Makel» darstellt, ist nichts anderes als ein unerlöstes Potential im unerforschten Dickicht unseres eigenen inneren Dschungels. Jemandem um jeden Preis «helfen» zu wollen, bedeutet oft, insgeheim dessen Selbst-Wert zu bezweifeln. Auch kann es wunderbar davon ablenken, ob und wie man selbst seinen eigenen Weg geht. Jedoch – niemand kann den Reifeprozess forcieren, Kirschen im April ernten oder Zwetschgen im Mai; alles entwickelt sich im richtigen Tempo, wenn man es nur zulässt. Es gibt viel Luft, wenn man ruhig atmet, ganz abgesehen von der Liebe, die alles trägt. •

Alice Hofer, Inhaberin der «Praxis für angewandte Vergänglichkeit», sieht den Tod nicht als Ende, sondern als Vollendung des irdischen Lebens. Sie ermutigt Menschen zum ganzheitlichen, selbstbewussten Abschiednehmen. www.alicehofer.ch
werden | heilpflanze

Die Gemeine Nachtviole strotzt vor Lebenskraft. Sie wächst schnell und duftet nachts betörend süss. Als Scharfmacherin sorgt sie im Körper für Wärme, löst Schleim und stärkt das Immunsystem.
Text: Steven Wolf
In der Nacht auf den 1. Mai feiern wir die Walpurgisnacht. Es ist die Hochzeit des jungen Götterpaares, der Sonne und der Erde. Von jetzt an wird die Entwicklung der Natur Fahrt aufnehmen. Der Mai steht im Zeichen der pubertären Gefühle, der Jugend, der Liebe, der Lust und des Genusses. Lasst uns feiern, tanzen, lieben und weinen! Wir dürfen uns hingeben, aus uns herauskommen und alle unterdrückten Gefühle aus dem Unterbewusstsein ans Licht bringen.
Die bezaubernde Gemeine Nachtviole (Hesperis matronalis) ist eine liebliche Begleiterin für diese wilden Zeiten. Sie ist im gesamten europäischen Raum zu finden und bevorzugt schattige Auwälder, Gebüsche und Böschungen von Bach- und Flussläufen. Ihr zweiter Name lautet Mondscheindufter, weil sie erst in der Dämmerung und in der Nacht ihre wahre Magie offenbart. Die Blütenstände verströmen nachts einen betörend sinnlichen, schweren, lieblichen Veilchenduft, der mich an Duftnuancen von Marzipan und Puderzucker erinnert. Das Leben der Nachtviole ist voller Energie, schnell und hitzig. Die Einzelblüte blüht nur für kurze Zeit und während sie ins Fruchtstadium übergeht, bilden sich bereits wieder neue Blüten. So wächst der Blütenstand stetig 40 bis 100 Zentimeter in die Höhe. Die lieblichen Blüten bestehen aus vier, übers Kreuz stehenden Blütenblätter. Der Geschmack der Wurzel, der Blätter und der Samen hat es in sich. Je nach Standort ist er scharf bis brennend, leicht bitter bis kohlartig. All dies weist darauf hin, dass die Nachtviole der Familie der Kreuzblütler angehört. Verantwortlich für den scharfen Geschmack sind die, in der Pflanze enthaltenen Senfölglykoside und Schwefelstoffe.
Die Nachtviole als Heilpflanze
Der Rest der Pflanze ist nicht allzu bitter und scharf im Geschmack. Das deutet darauf hin, dass die Nachtviole viel Feuchtigkeit enthält und eine wärmende, zerteilende und zugleich kühlend wassertreibende Wirkung zu erwarten ist. Als Heilpflanze ist die robuste, zwei- bis mehrjährige Pflanze leider in Vergessenheit geraten. Doch das dunkle
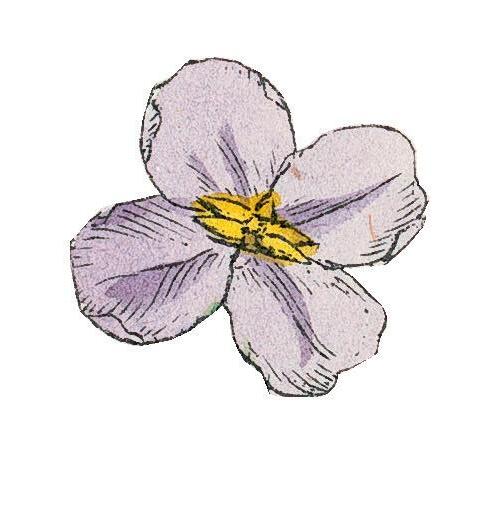
Der feurige Geschmack wirkt kräftigend, appetit- und verdauungsfördernd. Er belebt die Bauchspeicheldrüse und fördert die Verdauung nach Genuss von fettigen Speisen.
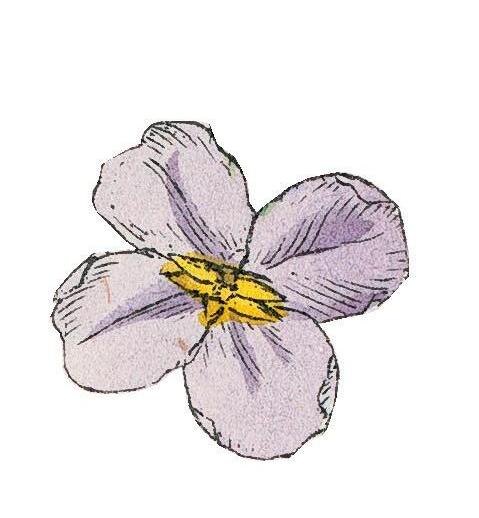
Grün und die Schärfe der Blätter weisen auf eine wundheilende, antibakterielle, antivirale, fungizide und immunsystemstärkende Wirkung hin. Die Schwefelstoffe wirken antibiotisch gegen multiresistente Keime. Sie zerstören mutierte Zellen und aktivieren die natürlichen Entgiftungsund Antioxidationsenzyme unseres Körpers. Als Scharfmacherin fördert die Heilpflanze die Brustgesundheit und hilft bei infektiösen Erkrankungen der unteren und oberen Atemwege. Sie lindert Schnupfen, Husten, Erkältungen, Halsentzündungen und Fieber. Dank ihrer auswurffördernden Wirkung kann sie die Bronchien von Schleim befreien und das Durchatmen erleichtern. Zudem senkt sie das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, indem sie das Herz stärkt und den Kreislauf erwärmt. Der feurige Geschmack wirkt kräftigend, appetit- und verdauungsfördernd. Er belebt die Bauchspeicheldrüse und fördert die Verdauung

nach dem Genuss von fettigen Speisen. Auch auf die Galle und die Blase wirkt die Heilpflanze stimulierend. Sie wirkt ausgleichend bei der Melancholie, Traurigkeit und Gefühlskälte. Bei Schwermütigkeit nach zu viel Alkoholgenuss empfiehlt es sich, einen, aus Nachtviolen geflochtenen Blütenkranz auf dem Kopf zu tragen.
Im Dialog mit der Pflanze
Wenn ich mich hinsetze und die Energie der Gemeinen Nachtviole auf mich wirken lasse, fühle ich folgende Informationen über die duftende Schönheit: «Ich bilde den Übergang zwischen dem Seelischen und dem Materiellen. Mein Ziel ist es, diese beiden gegensätzlichen Pole zu harmonisieren. Ich bringe die Hände des Gebens und Nehmens ins Gleichgewicht. Ich spanne den Bogen zwischen Materialismus und Selbstachtung. Ich lenke deine Aufmerksamkeit auf dein Verhalten, wenn du zu stark auf Materielles ausgerichtet bist und zum Beispiel von Geldsorgen geplagt wirst. Meine Blütenmedizin wirkt harmonisierend auf Menschen, die einzig auf ihren Vorteil bedacht, besitzergreifend und habgierig sind. Bei solchen Ausprägungen bleibt die Energie für eine spirituelle Entwicklung auf der Strecke. Es geht im Leben nicht darum, sich nur äusserlich zu bereichern. Verlasse mit mir den Raum des Mangels und des Armutsbewusstseins. Erfahre durch mich, dass eine spirituelle Stärkung dem materiellen Körper Heilung bringen kann. Lerne für die Entwicklung deines inneren Reichtums, materielle Einbussen in Kauf zu nehmen. Der Wandel
der Achtung für das Leben aller Geschöpfe beginnt im eigenen Innern. Entzünde im Innen wie im Aussen das Feuer der eigenen Wertschätzung sowie der Selbstachtung und feiere dich.»
Wärmende Anwendungen
Die Samen der Gemeinen Nachtviole enthalten Senföl, das aus ungesättigten, sehr aktiven Fettsäuren besteht. Nach einer Massage mit Violen-Senföl sieht die Haut frisch und rosig aus. Es wirkt belebend, lindert Verspannungen und sorgt für eine Mehrdurchblutung der Haut und der Muskulatur. Man kann das Senföl bei Erkältungen, Muskelschmerzen und einem schwachen Kreislauf einsetzen – zum Einreiben oder als Körper- oder Fussbad. Für ein Vollbad mischt man 1 bis 2 kleine Tassen Senföl mit ein wenig Milch
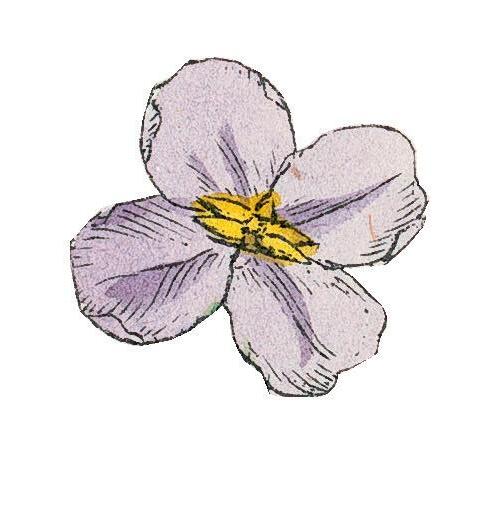
Lerne für die Entwicklung deines inneren Reichtums, materielle Einbussen in Kauf zu nehmen.
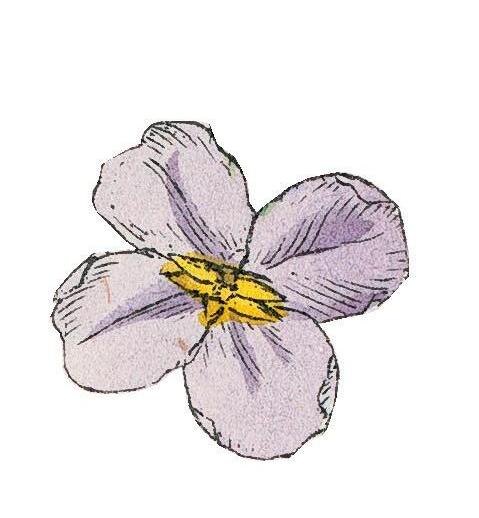

oder Rahm und giesst die Mischung ins Badewasser. Für ein Fussbad reicht eine halbe Tasse Senföl mit etwas Milch oder Rahm vermischt. Wenn Sie das Öl äusserlich anwenden, sollten Sie vorsichtig daran heran gehen. Am besten tragen Sie das Öl zuerst dünn auf einer kleinen Stelle auf und beobachten Sie, wie die Haut reagiert. Sie sollte warm werden, jedoch nicht brennen. Brennt das Öl zu stark, kann man es mit Wasser und Seife abwaschen.
Auch ein Taillenwickel wirkt wärmend und ausgleichend. Die trichterförmig eingestülpten Blüten sind ein Fruchtbarkeitssymbol. Hier wirkt sie menstrationsfördernd bei verhaltener, stockender Menstruation und entspannend bei stechenden Schmerzen bis ins Kreuz vor- oder während der Periode. Hierzu eignet sich ein Taillenwickel mit dem ViolenSenföl oder eine, mit Tee getränkte Kompresse. Am allerbesten wirkt jedoch ein, aus frisch gestampften Blättern und Blüten gemachter Umschlag, den man im Abstand von vier Stunden erneuert.
Die jungen Blätter kann man von April bis Mai sammeln, die Samen von April bis Oktober und die Blüten von April bis Juli. Bitte wartet mit dem Sammeln der Blüten, bis die Abendstunden eingebrochen sind. Erst dann entfaltet sich der Duft und die wahre Magie dieses kraftvollen Pflanzen wesens. •
Teezubereitung:
Die, in der Nachtviole enthaltenen ätherischen Schwefelstoffe reagieren empfindlich auf Erwärmung und Verbrennung. Für die Teezubereitung eignet sich ein Kaltwasserauszug der frischen Blüten oder Blätter. Man setzt ein Teelöffel der Blüten über Nacht in kaltem Wasser an. Vor dem Trinken kann der Kaltwasserauszug mit heissem Milchwasser überbrüht werden, damit auch die fettlöslichen Inhaltstoffe besser aufgenommen werden können. Auch ein Auszug in einem guten Rotwein ist zu empfehlen.
Der Viola-Damascena-Zucker
250 Gramm frische Blüten und 500 Gramm Zucker zusammen vermörsern. In einem Einmachglas gut verschlossen und lichtgeschützt an einen warmen Ort stellen. Nach zwei Wochen ist der Zucker fertig zur Einnahme. Er eignet sich für die oben erwähnten Themen der Brust, des Herzens, des Unterleibs und der Melancholie. Den Zucker soll man kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. Erwachsene nehmen täglich 15 bis 30 Gramm Blütenzucker ein, Kinder die Hälfte. Ein Löffel Blütenzucker im Mund zergehen lassen. Gut Einspeicheln und runterschlucken.

Steven Wolf seiner wissen gelernt und weiss um die Kraft der Natur mit all ihren sicht baren und unsichtbaren Wesen. Er lebt in Escholzmatt, wo er zusam men mit seiner liche Pflanzenkurse für Menschen durchführt. Im Loch weidli steht dafür eine eigens gebaute Schuljurte. www.pflanzechreis.ch

Sämtliche Pflanzenteile der gemeinen Nachtviole enthalten das giftige Cardenolid-Glykosid. In den Samen ist die Konzentration am höchsten. Die Gefährlichkeit wird allerdings als sehr gering eingestuft. Kinder und Schwangere sollten die Hände ganz davon lassen, Erwachsene dürfen einige Teile der Pflanze sparsam verwenden und nur über kurze Zeit. Äusserlich ist es kein


Tierhäute sind so vielfältig wie die Welt der Tiere an sich. Sie passen sich optimal dem Lebensraum und der Lebensweise eines Tieres an. Und manchmal gibt die Haut auch einen spannenden Einblick in das Leben eines Tieres.
Text: Fabrice Müller
Der australische Nackthund entpuppte sich im Nachhinein als grosse Herausforderung. Bei der Präparation im Naturhistorischen Museum Bern galt es, die Haut mit Farbe zu behandeln, weil sie nicht behaart war. Doch mit der gewohnten Methode fehlte die nötige Tiefenwirkung, also wich die Präparatorin auf ein Gemisch aus Wachs und Farbe aus. Jetzt wirkt der Hund mit seiner dunkelrötlichen Haut wie echt. Er wartet im Archiv des Museums – neben hunderten anderen präparierten Tieren vom Wiesel bis zum Wasserbüffel – darauf, entdeckt und bewundert zu werden. Auch die Haut einer Elefantendame namens Ota, die einst im Zoo Basel lebte, lagert hier unten. Einer, der sich täglich mit der Haut und den Haaren von Tieren beschäftigt, ist Martin Troxler, naturwissenschaftlicher Präparator im Naturhistorischen Museum Bern. «Unter dem Mikroskop betrachtet, präsentiert sich die Haut eines Tieres wie ein grosses Gebilde aus nebeneinander liegenden und verschlungenen Fasern – ohne Anfang und Ende.»

Was die Haut verrät
Martin Troxler arbeitet mit Tierhäuten, -fellen und -knochen von Säugetieren über Vögel und Fische bis zu Reptilien und Amphibien. Dabei fasziniere ihn zum einen die Konservierung und der Erhalt von Tierhäuten verschiedenster Art, zum anderen aber auch die Auseinandersetzung mit dem Tier und seiner Lebensgeschichte. «Die Haut und das Fell eines Tieres sind geprägt von seinem Lebenszyklus, von den Jahreszeiten und dem Lebenswandel.» So sei zum Beispiel bei Tieren, die im Sommer in den Bergen unterwegs sind, die Haut ausgebleicht und deutlich heller. Oder es gebe Spuren von Verletzungen oder Schürfungen. Zudem verrate das Fell wie auch die Haut, ob das Tier gesund war oder nicht. «Die Haare sind das Produkt der Haut. Beide reagieren empfindlich auf äussere Einflüsse wie auch auf Krankheiten», erklärt Martin Troxler. Leidet das Tier unter einer Krankheit, ziehe sein Körper Energie von der
fallen zum Teil aus; die Haut selbst verliert an Spannung und Kraft. Beide Faktoren seien jedoch bei seiner Arbeit als Präparator wichtig. «Die Tierhaut muss dehnbar und weich sein, damit ich sie auf dem präparierten Gesicht und Körper verteilen kann», sagt Martin Troxler.
Unterschiedliche Aufgaben
Grundsätzlich gilt die Haut als die äussere Hülle und Schutzschicht von Menschen und Tieren. Die Haut eines Tieres erfüllt unterschiedliche Aufgaben – abhängig vom Tier und seiner Umgebung. Sie beeinflusst die Körpertemperatur, ist ein Sinnesorgan für Hitze, Kälte, Berührung und Schmerz, sie schützt zudem vor Verletzungen, Bakterien und der Sonne. Säugetiere verfügen über eine besonders trockene Haut mit Haaren. Sie können dank ihrem Fell fast überall leben. Keine Haut gleicht der anderen. Die Haut ist je nach Säugetier und Rasse unterschiedlich. Bei Rindern beispielsweise besteht die Haut zu 33 Prozent aus Eiweissstoffen (Proteine), zu zwei bis sechs Prozent aus Fetten, zu 65 Prozent aus Wasser und zu 0,5 Prozent aus Mineralstoffen. Sie gliedert sich in drei Schichten: Oberhaut (ca. ein Prozent der Dicke), Lederhaut (ca. 85 Prozent) und Unterhaut (ca. 15 Prozent). In der Lederherstellung wird ausschliesslich die Lederhaut verwendet. Auf einem Hautstückchen vom Wildschwein wachsen sogenannte Grannenhaare, die als Nässe- und mechanischer Schutz dienen, sowie die gekräuselten Wollhaare, die im Winter für die nötige Wärme sorgen. Beim Seehund indes, der über eine kurze, anliegende Behaarung verfügt, schützt eine dicke Speckschicht unter der Haut den Körper vor Wärmeverlust.
Haut | Im Archiv des Naturhistorischen Museum Bern lagert auch die Haut eines Elefanten.



Leder gehört zu den ältesten natürlichen Materialien. Es wird schon seit Jahrhunderten als Rohstoff für unterschiedlichste Produkte verwendet. Aufgrund der schnellen Verderblichkeit roher Tierhäute begannen Menschen bereits früh, damit eine geeignete Methode zur Stabilisierung und Haltbarkeit der Tierhäute zu entwickeln. Dieser Prozess wird als Gerbung bezeichnet. Die Kleidung der Steinzeit bestand in den ersten Epochen grösstenteils aus Fellen oder Tierhäuten. Leder wurde im altorientalischen Kulturraum zur Aufbewahrung und zum Transport von Lebensmitteln genutzt. Trommeln, die mit Tierhaut überzogen sind, gehören zu den ältesten Trommeln überhaupt. Viele der heute verwendeten Trommeln entspringen den traditionellen afrikanischen Trommeln, deren Membranen aus Tierhäuten gefertigt wurden. Auch Pergament wurde aus Tierhäuten hergestellt, vor allem aus Schafs- oder Ziegenhaut, aber auch aus Kalbs- und Rinderhaut. Im Gegensatz zum Leder wurden diese Häute nicht gegerbt.
Die Tierhaut und das Fell stehen immer wieder im Interesse der Forschung. Ein internationales Konsortium von Forschenden mit Beteiligung des Instituts für Genetik der Universität Bern etwa konnte zeigen, wie Fellfarben bei Hunden vererbt werden. Ausserdem wiesen die Forschenden nach, dass eine Genvariante für helles Fell bei Hunden und Wölfen von einem inzwischen ausgestorbenen Verwandten des Wolfs stammt und mehr als zwei Millionen Jahre alt ist. Die Haut ist das grösste Organ des Hundes und nimmt zwischen 12 bis 24 Prozent der gesamten Körpermasse ein. Mit einer mindestens 0,5 Millimeter dicken Schicht bedeckt sie die Muskeln, das Skelett und die Organe des Hundes. Bei Welpen und Kleinhunderassen wie Chihuahua und Zwergpinscher ist der Schutzmantel der Haut häufig durchlässiger als bei erwachsenen Tieren und Exemplaren grösserer Rassen. Insgesamt besteht die Hundehaut aus der Oberhaut mit pigmentbildenden Zellen, der Lederhaut mit vielen Blutgefässen und einem dichten, aber gleichzeitig sehr beweglichen Gewebe, und der Unterhaut, wo mehrere Drüsen verankert sind. Die sogenannten apokrinen Drüsen, die über den ganzen Hundekörper verteilt sind, haben unter anderem eine kommunikative Funktion. Das Absondern und Aufnehmen von Gerüchen über diese Drüsen informieren Artgenossen über das Geschlecht und den Fortpflanzungsstatus des anderen Hundes. •
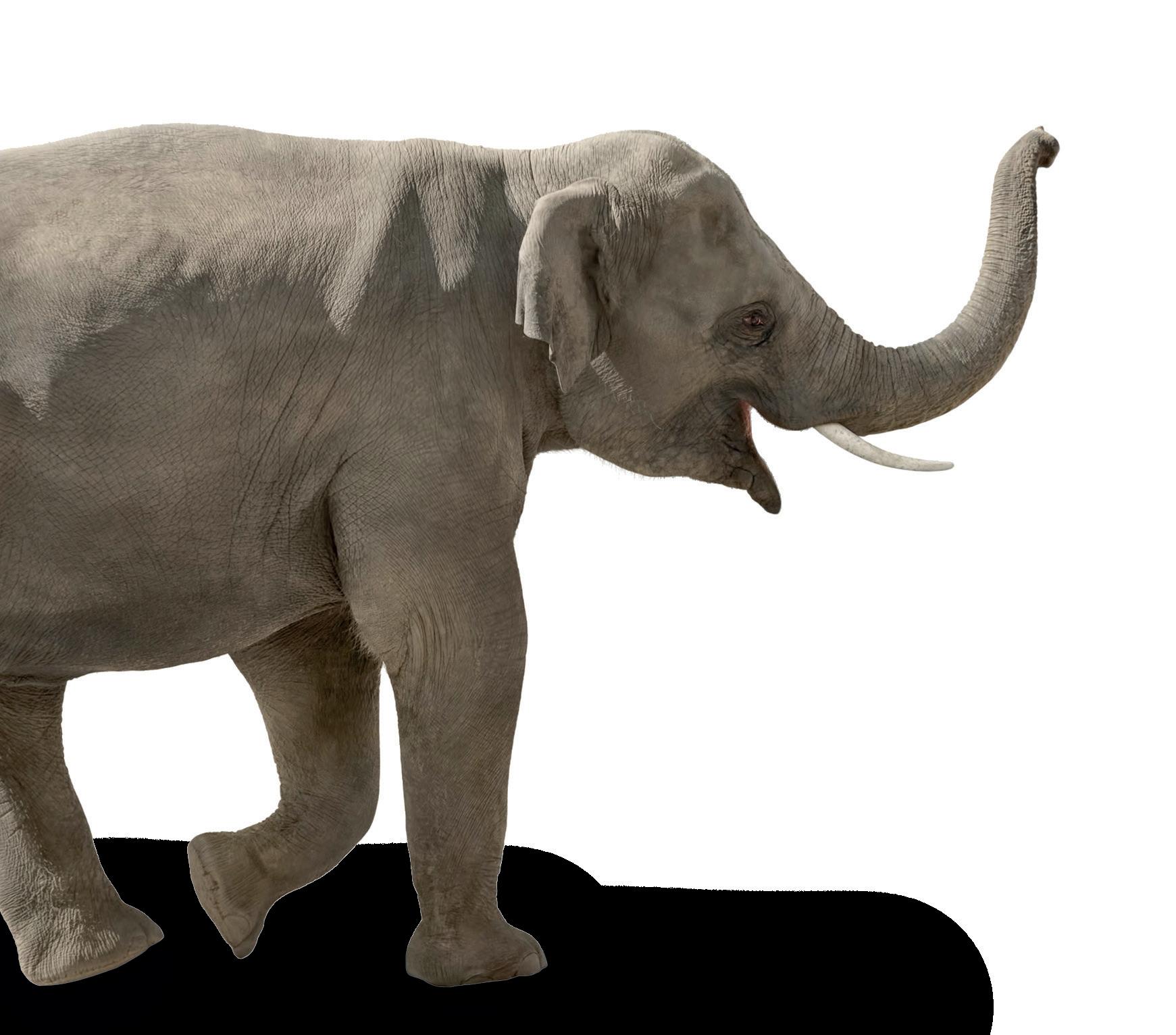
Martin Troxler | naturwissenschaftlicher Präparator im Naturhistorischen Museum Bern, neben einem australischen Nackthund, der aufwändig präpariert wurde. Bei der Präparation des Nackthundes galt es, die Haut mit Farbe zu behandeln, weil sie nicht behaart war. Für die Tiefenwirkung sorgte ein Gemisch aus Wachs und Farbe.

Besondere Hautphänomene aus dem Tierreich
Zebra: Streifenlook gegen Insekten

Chamäleon: blaue Haut bei UV-Licht Forschende der Zoologischen Staatssammlung München haben herausgefunden, dass die Haut des Chamäleons unter UV-Licht blau leuchtet. Die sonst unsichtbaren Muster der Haut überziehen bei UV-Bestrahlung den Kopf der Tiere und setzen sich bei einigen Tieren offenbar auch über den Körper fort. Eine dünne, durchlässige Haut spannt sich gemäss einem Bericht im Fachblatt «Scientific Reports» über die knöchernen Höcker des Kopfes, sodass das UV-Licht direkt auf den Knochen trifft und von dort in blaues Licht umgewandelt wird. Die Forschenden vermuten, dass dies dem Tier das Signal zur Erkennung von Artgenossen dient.
Wal: Farbkörper und Häutung
Kein Lebewesen hat eine dickere Haut als die Grosswale. Bei gewissen Exemplaren wie etwa beim Pottwal misst die äussere Hülle bis zu 35 Zentimeter. Der Walforscher Günther Behrmann aus Bremerhaven wies 22 unterschiedliche Farbkörperchen (Chromatozyten) in der Haut der Waltiere nach. Durch diese Farbkörper entsteht die dunkle Hautfarbe der Wale. Wenn die Tiere zu lange der Sonne ausgesetzt sind, werden Zellschäden in der Haut von Reparatur-Genen sofort behoben. Andere Wale wie etwa der Blauwal bilden auf ihrer Haut ein MelaninPigment, das einen Teil der Sonnenstrahlung abfängt. Wie Forschende um Robert Pitman vom National Marin Fisheries Services im kalifornischen La Jolla im Fachmagazin «Marine Mammal Science» berichten, schwimmen Wale gemäss neuesten Erkenntnissen wahrscheinlich zweimal im Jahr um die halbe Welt, um ihre Haut zu erneuern. In kalten Gewässern reduzieren die Wale ihre Durchblutung in den obersten Hautschichten, um Energie zu sparen. In warmen Gewässern wird die oberste Hautschicht genügend mit Blut versorgt. Auf diese Weise erneuert sich die Walhülle. Anschliessend können die Tiere ihre Reise in die Arktis oder in die Antarktis antreten. Aus Erzählungen der Inuits ist bekannt, dass sich die Belugas bzw. Weisswale im Sommer in wärmere Flussmündungen zurückziehen, um dort ihre Haut zu regenerieren.
Eisbären: schwarze Haut unter dem weissen Fell Unter dem weissen Fell der Eisbären befindet sich eine pechschwarze Haut. Das Fell des Eisbären ist – obwohl es gelblich-weiss wirkt – transparent und innen sogar hohl. Das Sonnenlicht kann als Folge davon fast ungehindert die Haut des Bären erreichen. Durch die schwarze Hautfarbe sind die Bären jedoch in der Lage, alle Wellenlängen des Lichts zu absorbieren. So kann gleichzeitig mehr Wärme aufgenommen und gespeichert werden. Auch die fünf bis zehn Zentimeter dicke Fettschicht speichert Wärme. Die Haut der Eisbären ist allerdings nicht von Geburt an schwarz. Die Tiere werden mit einer rosafarbenen Haut geboren; diese färbt sich nach und nach schwarz.
Warum sind Zebras gestreift? Studien haben offenbar ergeben, dass die schwarzen und weissen Streifen helfen, Fliegen auf dem Körper des Zebras zu verscheuchen. Die weissen Streifen geben ein polarisiertes, die schwarzen ein unpolarisiertes Licht ab. Das scheint die Insekten zu verwirren. Ob das auch für jenes «goldene» Zebra gilt, dass vor wenigen Jahren im Serengeti-Nationalpark in Tansania gesichtet wurde? Greg Barsh, Genetiker des HudsonAlpha Institute for Biotechnology in Huntsville, Alabama (USA), erklärte gegenüber dem Magazin National Geographic, dass es sich bei diesem Phänomen um eine Art Albinismus handle. Dabei produziere das Tier deutlich weniger Melantin als seine Artgenossen. Melantin ist ein natürliches Pigment, das in der Haut gebildet wird. Deshalb wirken die Streifen blasser.
Krokodil: steif und empfindlich zugleich
Auch wenn sie als wilde und blutrünstige Tiere gelten, die Haut der Krokodile ist ausserordentlich empfindlich. Zum einen ist die Krokodilhaut steif und stark, deshalb wird sie gerne von Menschen zur Herstellung von Kleidung und Accessoires verwendet. Zum andern jedoch verfügt die Haut über spezielle Sensoren, die empfindlicher auf Druck und Vibrationen reagieren als die Fingerspitzen eines Menschen. Somit verfügen die Krokodile über den stärksten Tastsinn unter anderen Tieren. Spezielle chemische Rezeptoren auf der Haut sollen den Räubern helfen, Beute aufzuspüren oder einen geeigneten Lebensraum zu finden.
Elefanten: sensible Dickhäuter Elefanten gelten als Dickhäuter. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Verletzliche Stellen wie der Rüsselansatz, die Beine oder der Rücken sind tatsächlich bis zu drei Zentimeter dick. Doch hinter den Ohren, an den Augen, am Bauch, an der Brust und den Achseln hingegen ist die Haut dünn wie Papier. Ein Elefant braucht eine dicke Haut, um seine Masse bzw. den inneren Druck zusammenzuhalten. Trotz ihrer Dicke ist die Elefantenhaut ein sensibles Organsystem mit einer dichten Nervenversorgung. So bemerkt ein Elefant jede Fliege, die sich auf seiner Haut niederlässt. Übrigens: Elefanten sind auch kitzelig, wenn ein*e Elefanten-



krebs
Mars
Erste Tonaufnahmen vom Mars ausgewertet
Wie hört sich der Mars an? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten erstmals Tonaufnahmen vom roten Planeten analysieren. Das Ergebnis: Auf dem roten Planeten herrscht Stille, nur gelegentlich durchbrochen von Windböen. «Es gibt nur wenige natürliche Schallquellen, mit Ausnahme des Windes.» Dies erklärten die Wissenschaftler*innen anlässlich der Veröffentlichung ihrer Studie in der Fachzeitschrift «Nature» am Freitag. Eine Überraschung hielten die fünfstündigen Tonaufnahmen jedoch bereit: Auf dem Mars gibt es zwei unterschiedliche Schallgeschwindigkeiten. Ska
Regelmässige Bewegung und gesunde Ernährung können das Brustkrebsrisiko senken. Deshalb bietet die Organisation «Pink Ribbon Schweiz» gemäss einer Medienmitteilung eine 4500 km langen Schleifenroute an, um die Bevölkerung zu motivieren, Bewegung in den eigenen Alltag einzubauen. Sportliche Betätigung in der freien Natur kann helfen, das Immunsystem zu stärken, Energie zu tanken und sich ausgeglichener zu fühlen. Das Projekt wird dieses Jahr von engagierten Pink Ribbon Ambassador*innen wie Christa Rigozzi, Eliane Müller, Caroline Chevin, Jesse Ritch, Franco Marvulli und diversen weiteren unterstützt, denn auch für sie ist es eine Herzensangelegenheit, die Früherkennung von Brustkrebs zu fördern.
Das Planungstool der Pink Ribbon Schleifenroute bietet 100 Routenempfehlungen und jeder Nutzerin oder Nutzer kann seinen eigenen Streckenabschnitt auf den Übersichts- und Detailkarten selbst auswählen und planen. Diverse Suchfunktionen, Darstellung der Touren mit interaktivem Höhenprofil, Ausdruck der Toureninformationen als PDF-Datei, Download von GPX-Dateien, mobiloptimierte Darstellung usw. –dies sind nur einige der fantastischen Features, welche die Website den Nutzer*innen bietet. Umfangreiche Kommentarfunktionen für eine dialogorientierte Darstellung lassen die Website zu einer aktiven CommunityPlattform wachsen. Die Schleifenroute ist Teil der grössten europäischen Outdoor-Plattform «Outdooractive».
Weitere Informationen unter www.schleifenroute.ch
Ska


Vögel
Vögel
Stromschläge gehören für hiesige Uhus zu den häufigsten Todesursachen. Von 36 Jungvögeln, die Forschende nach dem Jahr 2000 in der Schweiz mit Sendern versahen und danach mittels Peilgerät verfolgten, starben sieben auf diese Weise. Der häufige Tod an Strommasten ist vermutlich der Hauptgrund dafür, dass der Uhubestand im Schweizer Alpenraum seit Jahren stagniert. Manche geeigneten Reviere bleiben unbesetzt. Auch für den Storch sind Strommasten lebensgefährlich. Dies ergab eine Analyse der Totfunde von in der Schweiz beringten Weissstörchen. Zwei Fünftel von ihnen kamen durch einen elektrischen Schlag ums Leben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Mittelspannungsnetz stromschlagsicher zu gestalten. Idealerweise verlegt man die Kabel in die Erde. Das wird zurzeit in der Schweiz ohnehin meist getan. Leider ist eine Verkabelung nicht überall möglich. Weil die Elektrobranche bisher keine Lösung für dieses Problem anbieten konnte, lancierte das Bundesamt für Umwelt (BAFU) 2018 im Rahmen des Aktionsplans Biodiversität Schweiz das Projekt «Vogelsichere Mastschalter». Eine technische Knacknuss blieben bisher die Mastschalter. Bei manchen Masten sind sie zuoberst angebracht – also da, wo Vögel gerne landen. Ska

buchtipp
Gegen Ende ihres Lebens beschliesst die Schauspiellegende Evelyn Hugo endlich ihre Geschichte preiszugeben. Anhand ihrer sieben Ehemänner erzählt sie, wie es ihr gelang, im Los Angeles der 1950er-Jahren an die Spitze Hollywoods aufzusteigen. Ihre Geschichte ist geprägt von rücksichtslosem Ehrgeiz, einer geheimen Liebe und einer Freundschaft, die ein Leben lang hält.
Taylor Jenkins Reids Roman entführt die Leser*innen ins goldene Zeitalter Hollywoods und lässt einen bis zum Ende nicht mehr los.
Taylor Jenkins Reid
«Die sieben Männer der Evelyn Hugo» Ullstein Taschenbuch 2022, ca. Fr. 17.90
ISBN 9783548066738
Der Mai gilt als Wonnemonat mit blühenden Pflanzen und angenehmer Wärme. Allerdings kommen markante Kälteeinbrüche auch im Mai noch regelmässig vor. Am Frühlingsanfang sind die Meerestemperaturen immer noch kühl, während die Landmassen von der Sonne bereits stark erwärmt werden können. Deshalb wird der Alpenraum von Luftmassen überströmt, die je nach Herkunft grosse Temperaturunterschiede aufweisen. Deshalb entstehen bis in den Mai hinein immer noch Wettersituationen, die markante Kälteeinbrüche verursachen. So bildet die erste Hälfte des Monats Mai oft mit einen kräftigen Vorstoss arktischer Kaltluft den Abschluss des Aprilwetters. Diese regelmässig auftretende Erscheinung ist den Bauern schon seit Urzeiten bekannt und gab den «Eisheiligen» ihren Namen.
Es können also auch im Mai noch Kälteeinbrüche auftreten, die bis in tiefe Lagen sehr kühle Temperaturen verursachen. Ist dann der Himmel noch klar, so kann die nächtliche Abstrahlung zu Bodenfrost führen, der eine beträchtliche Gefahr für empfindliche Pflanzen darstellt. Ab Mitte Mai treten in der Regel dann keine Fröste mehr auf. Ab diesem Zeitpunkt darf man dann auch Kälte empfindliche Pflanzen wieder auf die Terrasse oder den Balkon stellen.
Andreas Walker

und wissen


Am frühen Morgen des 16. Mai können wir wieder eine totale Mondfinsternis beobachten. Dann befinden sich Sonne, Mond und Erde exakt in einer Linie und der Vollmond taucht in den Kernschatten der Erde ein. Das kosmische Schauspiel beginnt um 4.28 Uhr. Der Vollmond tritt in den Kernschatten der Erde ein und beginnt dabei auf der linken oberen Seite dunkler zu werden. Um 5.29 Uhr beginnt die Totalität, die eigentlich eine Stunde und 25 Minuten lang dauern würde. Während dieser Zeit hat der Mond eine rötliche Farbe, die andauernd variiert. Allerdings ist die gesamte Totalität bei uns nicht sichtbar, da der Mond – selbst bei flachem Horizont – bereits um 5.49 Uhr untergeht. Zu dieser Zeit geht auch bereits die Sonne auf. Wenn also die Totalität beginnt, hat bereits die Morgendämmerung eingesetzt. Der blutrote Mond wird dann in der fortschreitenden Dämmerung unsichtbar werden. Um die Mondfinsternis beobachten zu können, ist klares Wetter eine Voraussetzung. Bei lockerer Bewölkung hat man die Chance den Mond hin und wieder klar zu sehen. Bei dieser Mondfinsternis ist es wichtig, im Westnordwesten einen niedrigen Horizont zu haben, damit der Mond nicht durch einen Berg oder Hügel verdeckt wird. Das Ereignis ist gut mit blossem Auge zu beobachten. Ein Feldstecher leistet bereits sehr gute Dienste.
Andreas Walker

Online via QR-Code (www.natuerlich-online.ch/abo) oder per Mail mail@weberverlag.ch
Talon einsenden an: Weber Verlag AG, Gwattstrasse 144, 3645 Thun / Gwatt,
1-Jahresabo: 10 Ausgaben für CHF 89.–
2-Jahresabo: 20 Ausgaben für CHF 159.–
Name
Adresse
PLZ | Ort
Datum
Unterschrift
Geschenkabo Lieferadresse
Name
Adresse
PLZ | Ort
natuerlich-online.ch | Ausgabe Mai 2022 | www.weberverlag.ch
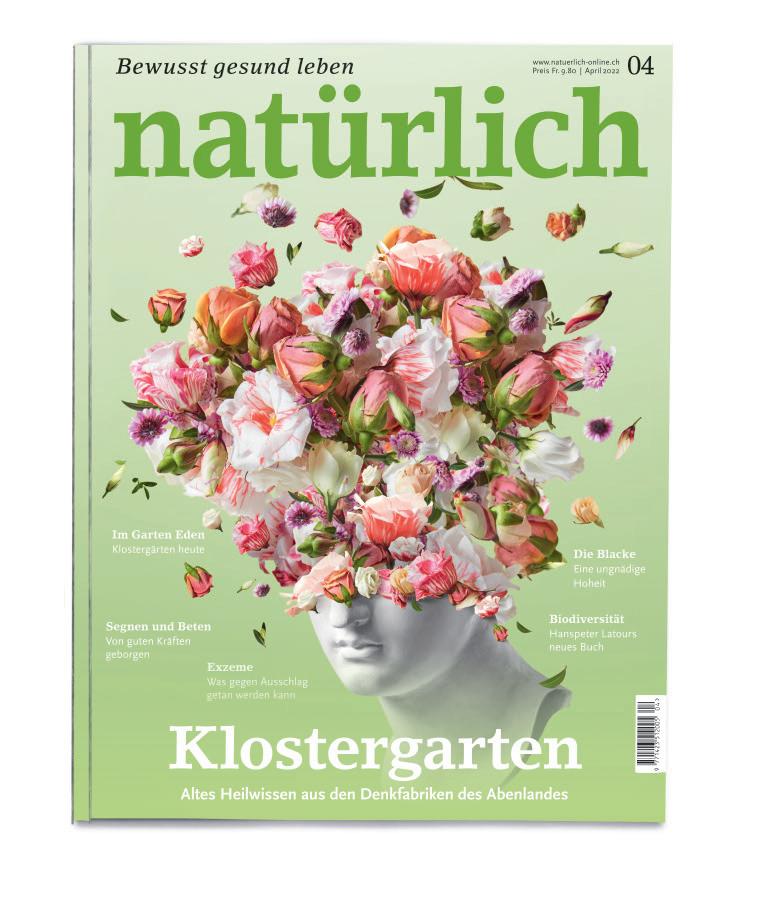
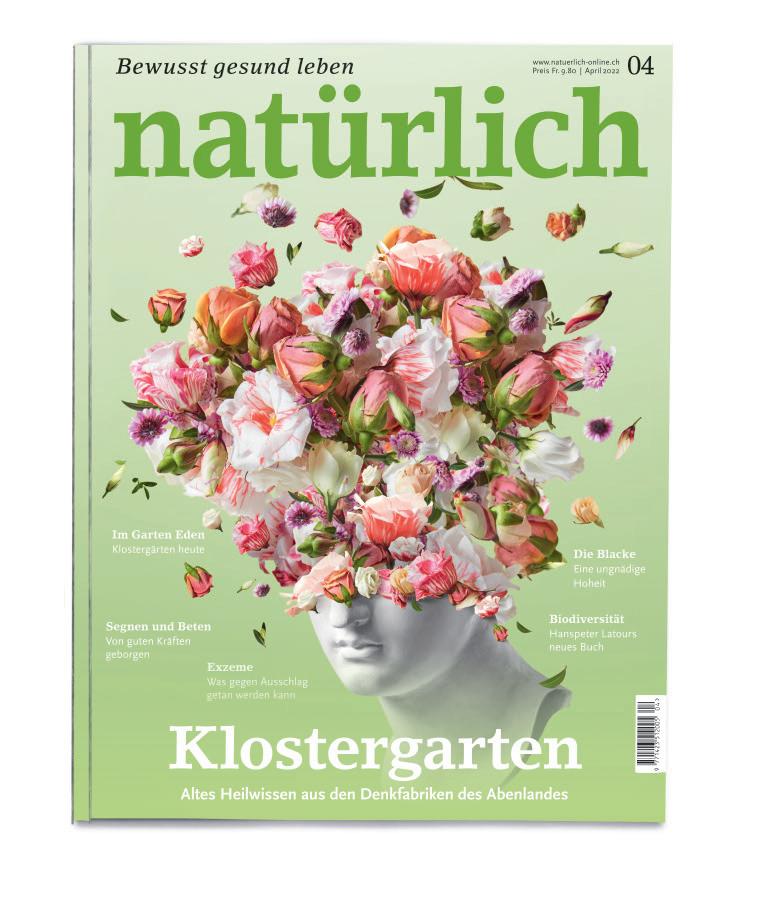



Heilige Geometrie
Wandbild Yantra Passion
Die Wandbild-Gestaltungen von Anima-Pura entspringen der heiligen Geometrie und des Feng-Shuis. Die Wandbilder sind ausserdem auch auf Textilleinwände erhältlich. Lassen Sie sich inspirieren auf: www.anima-pura.ch, oder laden Sie unseren Gesamtkatalog mit allen Bildern herunter.
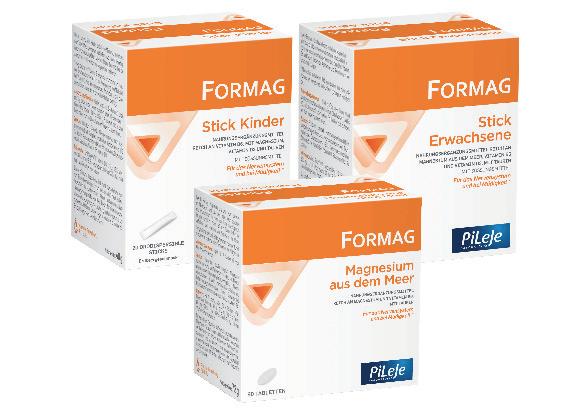
Magnesium
Gestresst? Müde?
Formag für die ganze Familie
Formag ist ein gut verträgliches Magnesium aus dem Totenmeer mit Vitamin B6 und Taurin. Erhältlich als Tabletten oder neu als Stick mit natürlichem Orangenaroma und für Kinder mit natürlichem Erdbeeraroma. Magnesium und Vitamin B6 tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit bei. Vitamin B6 und Taurin fördern die Aufnahme und Retention von Magnesium im Körper. Erhältliche in Apotheken und Drogerien. www.phytolis.ch

Komplementärmedizinsche Fachtagung
Long-Covid: Genesen, aber nicht gesund.
Die Pandemie endet, Long-Covid bleibt. Was wissen wir mittlerweile? Wo stehen wir nach zwei Jahren Pandemie?
Diese und weitere Fragen werden an der Fachtagung thematisiert. Praxisbezogene Therapie- und Behandlungsmethoden werden aufgezeigt. www.forum-cam.ch

Weiterbildung
CAS Achtsamkeit und Resilienz:
Emotionen prägen das aktuelle Geschehen. Festige dein Bewusstsein für den ganzheitlichen Umgang mit dem was ist. Praxisnahe, 15-tägige Lehrgänge auf der Basis von Achtsamkeit, Resilienz und Positiver Psychologie. Zertifikatsabschluss als Achtsamkeits- oder Resilienztrainer*in mit 15 ECTS Punkten gemäss Bologna System. Akademie für Achtsamkeit Lenzburg www.achtsamkeit.swiss

Träumen auf der Spur
Psychologen und Neurowissenschaftler zeigen: Jeder kann lernen, sich lebhaft an seine Träume zu erinnern. In den Traumwelten geschehen oft merkwürdige Dinge: Unser Gehirn vertauscht Personen und Orte, eröffnet Zeitreisen und ungeahnte Möglichkeiten. Es können Erkenntnisse aus dem Unterbewusstsein für das Leben gewonnen werden. Träume sind Gefühle in bewegten Bildern. Samstag 14. Mai mit Domenica Meier-Durisch. LIKA GmbH in Stilli b. Brugg, Tel. 056 441 87 38, www.lika.ch.

Erleben & Geniessen
Im Tessiner Frühling
Wandern, Yoga, Massagen, Sonne und die grüne Natur geniessen!
Individuell oder in der Gruppe
07.5. – 12.5. Yoga & Pilates
12.5. – 15.5. Yogaretreat
15.5. – 20.5. Yoga & Auszeit à la carte
20.5. – 25.5. Yogaferien
25.5. – 29.5. Yoga & Shiatsu an Auffahrt
29.5. – 02.6. Yoga Energize
02.6. – 06.6. Yoga & Hike an Pfingsten
18.6. – 22.6. Yogaferien
22.6. – 26.6. Pilates & Yoga
Casa Santo Stefano – Miglieglia 091 609 19 35 | casa-santo-stefano.ch

Das Konzept der Permakultur ist heute aktueller denn je. Doch was versteckt sich genau hinter diesem Begriff? Und wie können wir die Leitsätze der Permakultur umsetzen? Wir geben Antworten.
Text: Walter Bühler llustration: Sonja Berger


Die Permakultur ist keine Erfindung der Neuzeit. Dennoch ist die Thematik aktueller denn je. Täglich kommen wir mit Begriffen wie nachhaltig, ressourcenschonend oder achtsam im Kontext unseres täglichen Lebens in Berührung. Dass all dies in der Permakultur zusammenfindet, möchte ich Ihnen einmal zusammenfassend darlegen. Da sich mit dem Thema ein ganzes Buch füllen liesse, ist das Ganze in zwei Teile gegliedert. In dieser Ausgabe erhalten Sie einen Einblick was Permakultur überhaupt ist, wie sie entstanden ist und welche Ideologien sie verfolgt. In der nächsten Ausgabe zeige ich Ihnen einige Praxisbeispiele, wie sich ein Garten in Richtung der Permakultur bewegen kann.
Weshalb gerade jetzt?
In unserem Alltag sind wir oder unser Umfeld mit vielen globalen Problemen wie Armut, Krieg, Wasserverschmutzung oder unserer Wegwerfgesellschaft konfrontiert. Unter vielen dieser Schwierigkeiten haben schon frühere Generationen gelitten. Die zentrale Frage ist jedoch: Was ist unser Vermächtnis an die kommenden Generationen? Man kann bei dieser Frage einfach weghören und sich die Welt schön malen oder die Problematik erkennen und nach Lösungen suchen. Aber wie soll man als einzelnes Individuum im grossen Ganzen handeln und es verbessern oder gar heilen, ohne dabei nicht zu verzweifeln? Hier will die Permakultur uns zum Anpacken animieren. Der Ursprungsgedanke ist klar eine Landwirtschaft, die den Einklang mit der Natur zum Ziel hat. Dies beinhaltet viele zentrale Punkte. Die Selbstversorgung ist einer davon. Wenn ich in der Stadt lebe, habe ich vielleicht weder einen Garten noch ein Hochbeet. Wenn ich aber den Kleiderschrank reparieren kann oder, falls er aus der Mode kommt, mit Farbe auffrische, produziere ich weniger Abfall und mache mich zu einem gewissen Teil zum Selbstversorger.
Und wie ist Permakultur entstanden?
Wir haben zu grossen Teilen verlernt auf die Natur achtzugeben und mit Ihr zu arbeiten. Dies motivierte den Australier Bill Mollison in den Siebzigerjahren, einen anderen Weg zu suchen. So entstand die Permakultur. Permakultur setzt sich aus den Begriffen permanent und «agriculture» zusammen, was sich als nachhaltige oder Kreislauflandwirtschaft übersetzten lässt. 1981 erhielt Mollison dafür den alternativen Nobelpreis. Auch Mollison erkannte, dass sich die Monokulturbewirtschaftung kontraproduktiv auf das Bodeleben und die Biodiversität auswirkt.
Mollison war für australische Forschungsorganisationen unterwegs, für die er verschiedene Ökosysteme beobachtete. Zudem lebte zusammen mit verschiedenen Naturvölkern, die Ihn einen respektvollen Umgang mit der Natur lehrten. Seine Erkenntnisse mündeten in sein Konzept einer nachhaltigen Landwirtschaft, welche sich an der Natur orientiert, den gesunden Boden erhaltet und so auf langfristige Erträge zielt. Er hat sie in seinem ersten Buch «Permaculture: A Designers’ Manual» beschrieben. Es folgten weitere Bücher zusammen mit seinem Schüler David Holmgreen. Mit ihm zusammen hat er auch drei ethische Grundsätze formuliert.
«Care for the Earth»: Sorge zur Erde tragen «Care for the People»: Sorge für die Menschen tragen «Fair share»: Gerecht teilen und Grenzen für Konsum setzen
Und was steckt dahinter?
Nun gut: Man könnte nun auf den Verdacht kommen, dass der Autor ein richtiger Träumer sei, der sich die Welt richtig schön zu recht lege. Deshalb wollen wir der Frage nachgehen, was die Permakultur wirklich will. Mollison selbst strebte ein vernetztes Ökosystem an, in welchem die Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit im Zentrum stehen. Wir Menschen sollen die Verantwortung für unser Tun und Handeln übernehmen. Das
Wiederverwendung vorbereiten Anpflanzen
Ernten
Kompostieren und Aufbereiten

In der Permakultur wird alles verwendet, sei es ein Hochbeet aus Paletten oder alten Kisten oder einfach nur eine kleine Trockenmauer mit Sandlinse aus Reststücken von Natursteinen.

Blühstreifen zwischen den Beeren schaffen Lebensraum und Korridore für Tiere was wiederum eine grosse Diversität schafft.

Fliessendes Wasser und Wellen sind als Formen in der Gestaltung ebenso gefragt wie Spiralen und Kreise (Steine und Astspirale).

Obstreihen mit Beeren im Vordergrund sowie Wildobst im Hintergrund.

Das Spinnennetz symbolisiert auf treffendste Weise wie in der Permakultur alles miteinander verbunden ist.

Astknoten oder Astspiralen sind natürliche Gestaltungselemente, welche bewusst erhalten bleiben und den Garten gestalten helfen.


Ziel dabei ist, egal ob grosse landwirtschaftliche Flächen oder der eigene Kleingarten bewirtschaftet werden, produktive und der Natur nachempfundene Ökosysteme zu gestalten. Diese sollen eine lokale Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie sicherstellen. Gleichzeitig sollen die hohen Ansprüche an Konsumgüter gesenkt und dabei Ressourcen effizient genutzt werden. Durch eine grosse Vielfalt sollen die Systeme stabil und widerstandsfähig sein. Die vorab genannten ethischen Grundsätze lassen sich weiterspinnen zu wegweisenden Punkten. Das ist gerade das, was die Permakultur attraktiv macht. Ich kann mich an diesen Wegweisern orientieren. Dabei kann ich das mir mögliche umsetzen und so Veränderungen bewirken. Sprich: Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Wenn ich mich für die Ideologie der Permakultur entscheide, heisst es nicht, dass ich mein Leben komplett auf den Kopf stellen muss, sondern ich begebe mich schrittweise in einen Prozess, bei welchem ich mich weiterentwickeln kann. Nachfolgend will ich einige wegweisende Punkte aufzeigen. Zu diesen möchte ich dann in der nächsten Ausgabe einige Praxisbeispiele aufzeigen.
Von der Natur lernen
Ich lerne die Eigenheiten meines Grundstücks kennen. Dabei achte ich auf jahreszeitliche Veränderungen, beobachte und arbeite mit, nicht gegen die Natur.
Vielfalt ermöglichen: Ich baue Misch- und nicht Monokulturen an. Eine gute Kulturplanung mit geeigneten Pflanzgemeinschaften ist dabei zentral. Ich biete Pflanzen und Tieren in verschiedenen Zonen und Lebensräumen Platz, dadurch stärke ich mein System.
Fördern von Vernetzung: Ich verbinde neue Erkenntnisse mit bestehendem Wissen älterer Generationen. Die Elemente um uns herum sind ebenfalls in einer Beziehung zueinander. Alle erfüllen verschiedene Aufgaben, respektive eine Aufgabe wird von vielen Elementen verrichtet.
Resilienz im System: Durch eine Vielfalt der Elemente und Pflanzen kann mein System auf Wetterextreme und Schadorganismen reagieren. Ich strebe ein ausgeglichenes Ökosystem an. Das führt zu einer grossen Widerstandsfähigkeit, sprich einer hohen Resilienz.
Energie nutzen: Ich speichere meine Energie auf dem Grundstück so effizient wie möglich. Sei es im Treibhaus, an Fassaden oder in Wasserflächen. Dadurch versuche ich so wenig Fremdenergie wie möglich zu beanspruchen. Kreisläufe einrichten und Ressourcen nutzen: Den Boden dauerhaft gesund halten, mit der Kompostwirtschaft den Kreislauf im Garten schliessen. Materialien zu Ende nutzen gemäss dem 6-R-Prinzip: «Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle». Zu deutsch: Reduzieren, Überdenken, Reparieren, Wiederverwenden, Recyceln.
Kooperieren und Integrieren: Mit Wildpflanzen verschiedene Bedürfnisse decken, also beispielsweise Naschhecken als Nahrungs- und Schutzquelle für Mensch und Tier anlegen. Gesellschaftlich sollten sich Stadt und Land als Miteinander sehen. Denn auch Produzentinnen und Produzenten stehen mit Konsumentinnen und Konsumenten in einer wichtigen Beziehung.
Kreativ und lösungsorientiert: Je nach Garten individuelle
Möchten Sie jetzt schon mehr zur Permakultur sehen? Auf dem Areal der Gartenbauschule Oeschberg in Koppigen BE befindet sich ein kleiner, aber feiner Beerengarten als ein ideales Anschauungsbeispiel einer Dauerkultur für Mensch und Natur. Neben Früchten bauen wir dort auch Gemüse an. Meist in wildem Polykultur durcheinander. Es gibt ausserdem viele Möglichkeiten sich in die Permakultur hineinzubegeben. Workshops und Seminare bieten unter anderem folgende Institutionen in der Schweiz an: Permaterra (geben Starthilfe für das eigene Permakulturprojekt) www.permaterra.ch
Stiftung Visio-Permacultura (sind in engem Kontakt mit lokalen Betrieben) www.visio-permacultura.ch
Morgarot Permakultur (Seminare und Workshops) www.morgarot-permakultur.ch
setzt Leitungswasser in Garten und Haus (Spülung). Wasser im Teich wird als Wärmespeicher genutzt.
Gestalten und optimal einrichten: Ich halte die intensiv genutzten Flächen im Vergleich zu den extensiven klein. Achte aber darauf, dass die Wege für mich ideal und kurz sind. Ich plane also den Regenwassertank oder eine Zuleitung zum Gemüsegarten. Ich übernehme organische Formen aus der Natur wie Netz, Wellen oder Tropfen. Diese kann ich vor allem bei der Geländegestaltung einfliessen lassen.
Arbeit mit der Natur im Zentrum
So und jetzt haben Sie hoffentlich einen groben Einblick in die Denkweise der Permakultur erhalten und ich hoffe, dass Sie etwas davon mitnehmen können. Mag die Anstrengung manchmal auch gross sein, steht doch schlussendlich die Arbeit mit und nicht gegen die Natur im Zentrum. Und wenn wir uns darauf einlassen, die Hände in die Erde legen und sogar noch deren Früchte ernten können, werden wir entdecken, wie erfüllend diese Arbeit sein kann. Oder wie es schon der Gärnter und Landschaftsarchitekt Dieter Kienast (1945–1998) treffend formulierte: «Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum.» •

Walter Bühler ist gelernter Landschaftsgärtner und Landwirt. Er arbeitet als Berufsbildner an der Gartenbauschule Oeschberg in Koppigen (BE). In seiner Freizeit interessiert er sich für Pflanzen, Permakultur und


Dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend ist, ist längst klar geworden. Auch in der Schweiz entstehen immer mehr kreative Projekte, die sich für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen einsetzen.
Text: Blanca Bürgisser
Das Thema Nachhaltigkeit ist heute wichtiger denn je – und das ist auch gut so. Auch wenn in manchen Fällen Verzicht die beste Option wäre, ist ein bewusster, nachhaltiger Konsum die beste Alternative dazu. So kann jede*r Einzelne mit fairem und umweltbewusstem Verhalten einen kleinen Beitrag leisten für eine bessere Zukunft. Wer bei den zahlreichen Optionen etwas überfordert ist, für den ist «#bewusstwie» genau richtig. Der Ratgeber nimmt mit auf eine nachhaltige Reise in 13 der grössten Städte der Schweiz. Dabei gibt der Guide wertvolle Tipps für einen bewussteren Konsum und stellt unzählige kleinere und grössere Unternehmen vor, die sich auf ökologischer und sozialer Ebene für eine bessere Zukunft einsetzen. Sie engagieren sich für faire Arbeitsbedingungen, einen rücksichtsvollen Umgang mit Ressourcen und eine möglichst hohe Regionalität und Saisonalität.

Foodwaste verringern
In der Schweiz werden pro Jahr rund zwei Millionen Tonnen geniessbare Lebensmittel weggeworfen. Zahlreiche kreative Unternehmen und Organisationen arbeiten daran, dies zu verhindern. Einer unter ihnen ist der Verein Madame-Frigo. Wenn Sie zu viel eingekauft haben, können Sie die überschüssigen Lebensmittel in einem der öffentlichen Madame Frigo-Kühlschränke deponieren, von dem sich alle, die etwas brauchen, sich bedienen können.
Den Madame-Frigo-Kühlschrank in Ihrer Nachbarschaft finden Sie unter: www.madamefrigo.ch.

Reparieren statt wegwerfen
Mit ihrem Motto «reparieren statt wegwerfen» kämpfen schweizweit 185 Repair Cafés gegen den zunehmenden Ressourcenverschleiss und die wachsenden Abfallberge. Wenn Sie defekte Dinge jeglicher Art haben, können Sie damit ins Repair Café gehen. Dort bemühen sich freiwillige Profis darum, Ihre beschädigten Gegenstände zu retten. Während des Wartens können Sie gemütlich Kaffee und Kuchen geniessen. Ein Besuch im Repair Café schont nicht nur die Umwelt, sondern auch das Portemonnaie, denn alle Reparaturen sind kostenlos.
Das Repair Café in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.repair-cafe.ch.
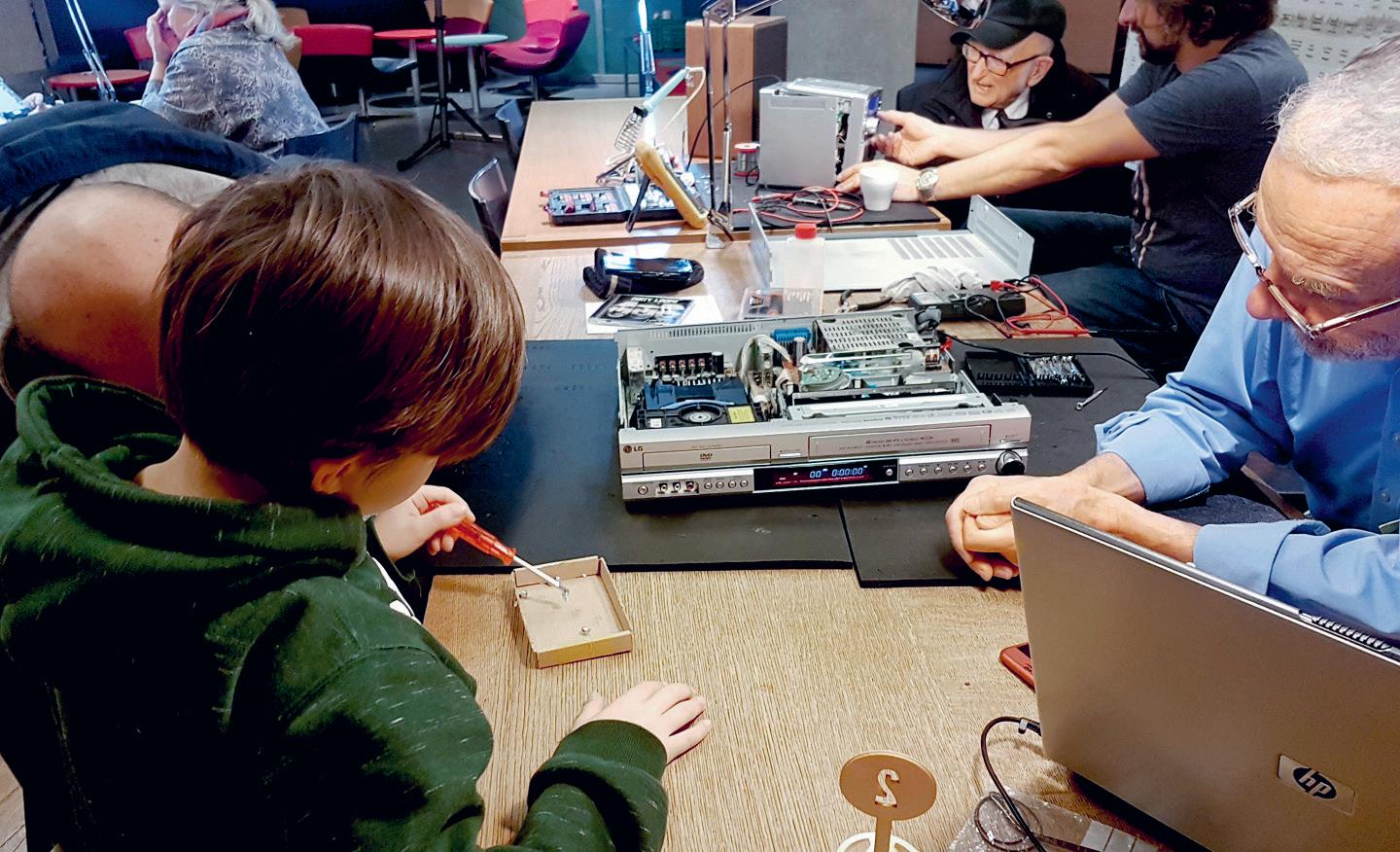
Trends ändern sich immer schneller, und grosse Kleidermarken bringen fast monatlich neue Kollektionen auf den Markt. Secondhandläden und Flohmärkte sind eine einfache und oft günstige Alternative, diesem Wegwerfgedanken entgegenzuwirken und der Umwelt etwas Gutes zu tun. In der Schweiz gibt es für fast alle den passenden Secondhandladen. Wer auf der Suche nach aktuellen Trends ist, der ist im Marta Flohmarkt in Luzern und Zürich am richtigen Ort. Aber auch die Brockis der Caritas oder der IG Arbeit bieten Kleidung zu guten Preisen. Wer Designerstücke sucht, findet in Zürich mit REAWAKE und abito allora gleich zwei passende Lokale.

Verpackungsfreie Läden sind ein doppelter Gewinn: Man kauft nur so viel, wie man wirklich benötigt, und vermeidet unnötige Plastikabfälle. Mittlerweile findet sich in fast allen grösseren Schweizer Städten ein Unverpackt-Laden, ob die Abfüllerei Basel, Unverpackt in Aarau oder OHNI in Thun. Neben Lebensmitteln finden Sie von Putzmitteln bis Hygieneartikel alles, was Sie sonst noch so brauchen im Alltag. Viele dieser Läden engagieren sich auch mit interessanten Workshops und Veranstaltungen für mehr Nachhaltigkeit.
Eine Übersicht aller Unverpackt-Läden in der Schweiz finden Sie unter: www.minimalwaste.ch. •

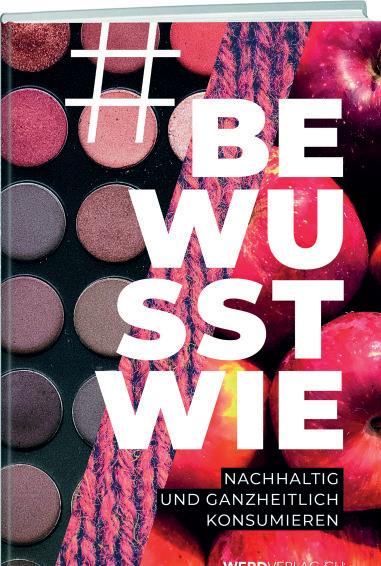
Zahlreiche weitere Tipps für mehr Nachhaltigkeit finden Sie im Buch «#bewusstwie». «natürlich»-Leser*innen erhalten das Buch mit dem Gutscheincode «natürlich» zum Vorzugspreis von 29.– statt 39.– Franken (inklusive Versand).
104 Seiten, 13,5 × 20,5 cm, broschiert, Softcover ISBN 978-3-03818-367-9 www.weberverlag.ch
Im Wein liegt Wahrheit, heisst es. Aber wer im Wein liegt, kann auch seiner Haut eine Wohltat spenden. Hier berichten wir von Anwendungen von Naturprodukten in Obwalden, dem Wallis und dem Tessin –neben Wein auch Heu, Nachtkerzenöl und Molke.
Text: Artur K. Vogel

Molkebad in Engelberg Anselm Töngi, «Sälmi», ist «so etwas wie der Star unter den Engelberger Alpkäsern», heisst es auf Engelbergs offizieller Tourismus-Webseite. Das habe einen guten Grund, liest man weiter: «Sälmis Alp Sbrinz AOP räumt immer wieder Preise ab und ist deshalb noch berühmter als er selbst.»
Ber ühmtheit kommt allerdings nicht von allein. Das erkannte Sälmi Töngi schon vor 47 Jahren, als er begann, auf der Gerschnialp auf 1300 Metern am Fuss des Titlis hoch über Engelberg Käse zu produzieren. Deshalb hatte der Mann mit dem Seehundeschnauz, der inzwischen im AHVAlter steht, vor etwa 30 Jahren eine brillante Idee: Er bietet seither Molke-Bäder in der freien Natur an, in einem der kupfernen Käsekessi, die dafür ins Freie gebracht werden, oder in einem hölzernen Zuber. Ein «Marketing-Gag» sei das gewesen, sagt der Käser lachend, aber einer, der einschlug. In den Sommermonaten pilgern viele Gäste zu seiner Käserei hoch, um sich in der warmen Molke zu suhlen.
Molke ist die Flüssigkeit, die bei der Käseherstellung übrigbleibt, das heisst nach der Gerinnung der Milch zu Käse oder Quark. Heilkräfte sprach man ihr schon im Mittelalter zu, aber im 18. und 19. Jahrhundert entstand ein eigentlicher Hype: Molke galt als Allheilmittel. Allein in der Schweiz gab es um 1890 fast 30 Molkenkurorte, doch schon um 1900 war der Boom vorbei. Sälmi Töngi gibt keine Heilsversprechen ab, sondern meint nur, dass ein Bad in der Molke «das Gemüt und die Nerven beruhigt und eine schöne Haut gibt».
Molke ist auch die Basis für die Herstellung von Ricotta und Ziger. Das wertvolle Naturprodukt wird auf der Gerschnialp nicht verschüttet: Was nicht für badende Gäste verwendet und auch nicht zu Ricotta verarbeitet wird, fressen die Schweine mit grossem Appetit, wie Sälmi Töngi erzählt. www.engelberg.ch

wöhnen lassen: Sie werden auf Heu gebettet. Heu wird seit Urzeiten für die Fütterung von Nutztieren im Winter verwendet. Rohmilchkäse wie Greyerzer, Emmentaler und Sbrinz werden noch heute mit der Milch von Tieren hergestellt, die ausschliesslich mit Gras und Heu gefüttert werden. Im Spa des Walliserhof, einem Mitglied von Relais & Châteaux, der internationalen Vereinigung hochstehender Hotels und Restaurants, hat das Heu eine andere Funktion: Der unnachahmliche Duft des getrockneten Grases, den man von gemähten Sommerwiesen kennt, soll besonders entspannend wirken.
Die Spa- Anwendung mit dem poetischen Namen «Bergblumenwiese» besteht darin, dass die auf Heu gebetteten Gäste «mit einer intensiven Nachtkerzenöl-Cremepackung umhüllt werden», erklärt man im Walliserhof. Das Öl aus den Samen der Nachtkerze ist unter indigenen Völkern Nordamerikas seit Jahrhunderten als Mittel gegen Hautprobleme bekannt. Es enthält unter anderem Vitamin E und Omega-6-Fettsäuren, ist «stark rückfettend und feuchtigkeitsspendend», wie es im Walliserhorf heisst, «regeneriert und wirkt zugleich dem Alterungsprozess entgegen.» www.walliserhof-saasfee.ch

Im Wein baden in Ascona
Dass die Traube kraftvolle Wirkungen erzielen, und dass der Wein nicht nur als Genussmittel, sondern auch zu Therapiezwecken eingesetzt werden kann, ist seit der Antike bekannt. Die Vinotherapie, wie man sie heute kennt, ist etwa vierhundert Jahre alt und stammt aus Frankreich. Mit Tresterbädern behandelte man dort Ischias, Arthritis und verwandte Krankheiten.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts erforschte der französische Arzt, Wissenschaftler und Universitätsprofessor Serge Renaud (1927 – 2012), der aus einer Weinbauernfamilie stammte, die Wirkung des Weines auf den menschlichen Organismus und belegte die vorbeugende Wirkung der sogenannten Mittelmeerdiät mit viel Früchten, Gemüse und Fisch, wenig rotem Fleisch, Olivenöl und Rotwein. Er erkannte die Eigenschaften der Omega-3-Fettsäuren und die positive Wirkung eines mässigen Rotweinkonsums bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die VinoAqua-Therapie, wie sie im Spa des Hotels Castello del Sole angeboten wird, basiert auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie besteht aus einem Peeling zur Erneuerung der Hautzellen, aus einem vitalisierenden Chardonnay- oder einem beruhigenden Merlot-Bad, einer entschlackenden und entwässernden Packung und feuchtigkeitsspendender Körperpflege.
Mit den Wirkstoffen, Fettsäuren und Anti-Oxidantien des dazu verwendeten kaltgepressten Traubenkernöls, so heisst es im Castello del Sole, kann der Zellalterung entgegengewirkt werden. Aggressive sogenannte freie Radikale, die durch Luftverschmutzung, UV-Strahlung, Nikotinund Alkoholkonsum, Stress und Schlafmangel entstehen und die Haut strapazieren, können bekämpft werden.
Alle Produkte für die VinoAqua-Therapie im Castello del Sole, auch dieses Fünfsterne-Haus übrigens ein Mitglied

Tut gut.
Burgerstein Vitamine – Feiern Sie mit uns das 50-Jahre-Jubiläum!
Alle Informationen zu unserer Firmengeschichte finden Sie hier:

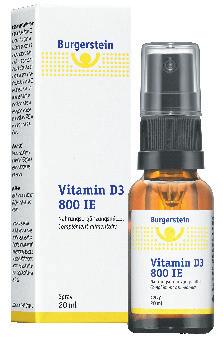
Lösung des Rätsels aus dem Heft 04/2022
Gesucht war: Olivenoel
Vorname Name
Strasse PLZ / Ort
Lösung

Und so spielen Sie mit: Senden Sie den Talon mit der Lösung und Ihrer Adresse an: Weber Verlag, «natürlich», Gwattstrasse 144, 3645 Gwatt Schneller gehts via Internet: www.natuerlich-online.ch/raetsel
Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 20. Mai 2022. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnen Sie eine von 10 Burgerstein Vitamine-Geschenkboxen im Wert von je 150 CHF Die Geschenkboxen enthalten eine Auswahl unserer beliebtesten Burgerstein Vitamin-Produkte für die ganze Familie.


Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.
Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit

362318_bearbeitet.qxp 19.3.2009 16:50 U
Kurhaus St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch
Sass da Grüm – Ort der Kraft Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Solch ein Ort ist die Sass da Grüm. Baubiologisches Hotel, Bio-Knospen-Küche, Massagen, Meditationen, schönes Wandergebiet, autofrei, traumhafte Lage. Hier können Sie Energie tanken. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen. Hotel Sass da Grüm CH-6575 San Nazzaro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch
Seit 30 Jahren setzen sich Solarspar-Mitglieder für die Zukunft ein: 100 Solar-Anlagen sparen in der Schweiz jährlich über 2000 Tonnen CO2 ein. Mit Ihrer Unterstützung bauen wir weiter. www.solarspar.ch/mitmachen

Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Antoinette Bärtsch, Pete Kaupp, Renate von Ballmoos, Marcel Briand, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Kokopelli Guadarrama, u.a.
Nächster Ausbildungsbeginn: Samstag/Sonntag 01./02. April 2023
«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»
Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen Tel. 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch



Info-Abend: 14. Juli
3 Jahre, ASCA u. SGfB-anerk

Info-Abend 25. Aug.
3 Jahre, ASCA u. SGfB-anerk
«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt.»
Neu: Finanzierung Ihrer Ausbildung durch Bundesbeiträge
Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung.
Ernährungs-Psychologische/r Berater/in IKP Angewandte Psychologie: Fundierte, praxisnahe Kompetenzen in Ernährung und Psychologie, mit welchen Sie Menschen mit Ernährungsproblemen ganzheitlich und lebensnah beraten.
Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden. IKP Institut, Zürich und Bern
Seit 30 Jahren anerkannt




Es giesst! Im Nu bin ich klitschnass bis auf die Haut, schwimme in meinen Schuhen. Dann eben barfuss weiter! Schritt für Schritt übermütiger pflatsche ich wie ein Kind durch die Pfützen. Bäume und Pflanzen recken sich dankbar dem Wasser entgegen, ein grosses Aufatmen scheint durch die Natur zu gehen.
Unverhofft gerate ich in ein Volksfest der anderen Art; was für ein Getümmel auf den Wegen, immer zahlreicher kriechen sie aus ihren Erdverstecken: Regenwürmer. Ihren Namen müssen sie von irgendwoher haben, sinniere ich. Doch was ist hier genau Sache? Geniessen sie diese Himmelsdusche tatsächlich, oder entfliehen sie eher dem qualvollen Ertrinkungstod aus überschwemmten Erdgängen? Regenwürmer atmen Sauerstoff über ihre Haut ein, diese einfachen blinden und tauben Wesen haben ja keine Lunge. Haben sie sich panisch an die frische Luft gerettet? Und jetzt? Qualvoll im Dreck und Staub verendete Würmer kommen mir in den Sinn. Regenwurm-Haut verträgt nicht lange Sonne und Licht. Arme Würmer!
Oder sind sie etwa auf Partnersuche, jetzt, wo es sich auf regennassen Wegen so schön rutscht? Womöglich wollen sie alles andere als von mir «gerettet» und ins Erdreich bugsiert werden? Eingreifen ist oft Übergreifen
Temperatur und Feuchtigkeit sind im Frühling und Herbst ideal für «würmische» Paarung. Meist nach Regenfällen, im Schutz der Dämmerung oder nachts kommen die fortpflanzungsfähigen Würmer zur «Hochzeit» an die Bodenoberfläche. Regenwürmer sind Zwitter, mache ich mich kundig. Bei der Paarung lassen sie sich mehrere Stunden Zeit. Ihren Kopf legen sie dabei zum Schwanzende des Partners. Klebriger Schleim und spezielle Klammerborsten halten die Bauchseiten beim Samenaustausch eng aneinander, so dass beide Würmer je ihre Samen in die Samentasche des anderen drücken können. Diese Taschen sind im Innern des Körpers. Erst, wenn die eigenen Eizellen reif sind, wird aus dem «Gurt» – dieser gut sichtbaren Verdickung am Körper – Schleim abgesondert, der eine schützende Hülle bildet und an der Luft zum Kokon wird. Sobald der Wurm dann aus dieser Schleimhülle herausschlüpft, werden die Eizellen befruchtet. Je nach Bodentemperatur entwickeln sich daraus innerhalb von drei bis vier Wochen die jungen Regenwürmchen.

Diese Single-Würmer hier sind wohl gerade erst auf Brautschau? Vielleicht ist auch alles anders und es war schlicht das Klopfen des Regens, das sie an die Oberfläche gelockt hat? Mit ihrem feinen Drucksinn können diese «simplen» Tiere ihre Feinde wie grabende Maulwürfe, Mäuse, Marder, Kröten und Co wahrnehmen und zeitig die Flucht ergreifen. Dass die Anglerkollegen meines Vaters sie dereinst durch Klopfen herauslockten und als FischKöder schnappten, fand ich ebenso faszinierend wie empörend. «Es ist ja bloss ein Wurm», argumentierten sie. Bloss?
Was diese unscheinbaren Gesellen, die sich mit kaum sichtbaren Borsten fortbewegen, für den Erdboden leisten, ist schier unglaublich. Ihr ständiges Graben in bis zu drei Metern Tiefe durchlüftet die Erde. Pflanzenteile ziehen sie unter die Erde, indem sie sich mit ihrem Maul daran festsaugen und mit Schleim verkleben. Sie haben alle Zeit, zu warten, bis Pilze und andere Kleinlebewesen sie zersetzt haben, um sie dann mit etwas Erde zu verzehren. Die Wurmhäufchen, derer sie sich nach der Verdauung entledigen, sind der beste Dünger für gute Bodenfruchtbarkeit.
Wird es Würmern zu trocken oder zu kalt, so graben sie sich tief in die Erde hinein, ringeln sich ein und halten Sommer- beziehungsweise Winterschlaf. Wasser kann ihnen wenig anhaben, sofern der Sauerstoffgehalt hoch genug ist. So sind sie auch gute Bioindikatoren. Wie komplex ist doch die Natur, selbst beim Hervorbringen und Versorgen der einfachsten Lebensformen – die wiederum wichtige Nahrung sind für so viel andere Tiere. Nein, die Samariterin ist hier definitiv nicht gefragt – umso mehr deren Staunen und Achtsamkeit. Während ich mich zuhause endlich meiner regennassen Kleider entledige, fühle ich mich auf sanfte Weise geerdet und glücklich. •
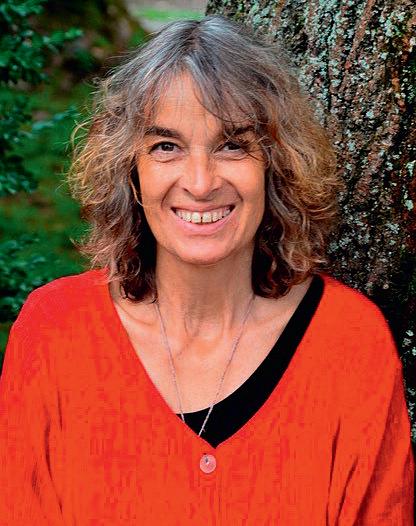
Eva Rosenfelder ist Autorin/Journalistin BR. In ihrer Serie schreibt sie für «natürlich» über kleine und grosse Glücksmomente des Alltags. Mehr über die Autorin und ihre Angebote wie Naturspaziergänge und Naturorakel erfahren Sie unter www.natur-und-geist.ch
41. Jahrgang 2022, ISSN 2234-9103
Erscheint 10-mal jährlich
Druckauflage: 22 000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 14 820 Exemplare (WEMF/KS beglaubigt 2020)
Kontakt
mail@natuerlich-online.ch www.natuerlich-online.ch
Herausgeber und Verlag
Weber Verlag AG
Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun/Gwatt Tel. +41 33 336 55 55 leserbrief@natuerlich-online.ch
Verlegerin
Annette Weber-Hadorn a.weber@weberverlag.ch
Verlagsleiter Zeitschriften
Dyami Häfliger d.haefliger@weberverlag.ch
Redaktionsadresse
«natürlich»
Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun/Gwatt
Chefredaktor
Samuel Krähenbühl s.kraehenbuehl@weberverlag.ch
Leserberatung
Sabine Hurni s.hurni@weberverlag.ch
Autor*innen
Andreas Krebs, Samuel Krähenbühl, Sabine Hurni, Susanne Gedamke, Leila Dregger, Fabrice Müller, Lioba Schneemann, Rolf Wenger, Alice Hofer, Steven Wolf, Andreas Walker, Walter Bühler, Blanca Bürgisser, Arthur K. Vogel, Eva Rosenfelder Grafik/Layout
Shana Hirschi
Copyright Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung durch den Verlag. Für unverlangte Einsendungen wird jegliche Haftung abgelehnt.
Anzeigenleitung
Dino Coluccia, Tel. +41 76 324 64 45 d.coluccia@weberverlag.ch
Anzeigenadministration/Marketing
Blanca Bürgisser Tel. +41 33 334 50 14 b.buergisser@weberverlag.ch
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Aboverwaltung abo@weberverlag.ch Tel. 033 334 50 44
Druck
Vogt-Schild Druck AG, CH-4552 Derendingen
Weber Verlag AG www.weberverlag.ch
Bildnachweise
Adobe Stock
Seiten: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 21, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 30, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 63, 67
Andrea Abegglen
Seiten: 53, 54
Sonja Berger: Seiten: 5, 35, 36, 37, 57
Andreas Walker Seiten: 46, 47

Wasser. Genug und richtig trinken hält unseren Körper in Schwung. Wir zeigen, auf was es ankommt. Kneippen. Auch die äussere Anwendung von Wasser tut unserem Körper gut. Sei es als Kneippen oder als Moorbad. Verunreinigtes
Wasser. Unsere Gewässer leiden immer mehr unter Mikroverunreinigungen. Was wir dagegen tun und wie wir damit umgehen können.
Informationsträger. Wasser kann Informationen speichern. Knappes Gut
Wasser. Im Nahen Osten besonders. Wie Israel mit dem raren Gut umgeht.
«natürlich» 06/22 erscheint am 25. Mai 2022
Kontakt /Aboservice: Telefon 033 334 50 44 oder abo@weberverlag.ch, www.natuerlich-online.ch

✓ nachfüllbar
✓ mikroplastikfrei
✓ vegan
✓ swiss made

