natürlich

Im Garten Eden
Klostergärten heute
Segnen und Beten
Von guten Kräften geborgen
Die Blacke
Eine ungnädige Hoheit
Biodiversität
Hanspeter Latours neues Buch
Exzeme
Was gegen Ausschlag getan werden kann


Im Garten Eden
Klostergärten heute
Segnen und Beten
Von guten Kräften geborgen
Die Blacke
Eine ungnädige Hoheit
Biodiversität
Hanspeter Latours neues Buch
Exzeme
Was gegen Ausschlag getan werden kann
Altes Heilwissen aus den Denkfabriken des Abenlandes

Spannende Hintergruninformationen


Liebe Leserin, lieber Leser
Es wird Frühling! Und mit dem Frühling erwacht die Natur. Mit den Pflanzen wachsen auch zahlreiche Stoffe heran, welche uns als Heilmittel dienen. Das Wissen um die Pflanzen und ihre Wirkungen auf die Gesundheit ist alt. Kein Wunder, denn früher gab es neben dem, was uns die Natur von sich aus gibt, keine Alternativen.
Während mehr als einem Jahrtausend wurde dieses Wissen im Abendland vor allem in den Klöstern gepflegt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Klöster insbesondere im Mittelalter neben den geistlichen Aufgaben in praktisch allen Lebensbereichen wichtige Funktionen ausübten. Die Klöster waren denn auch die intellektuellen «Think Tanks», oder zu gut deutsch «Denkfabriken» dieser Zeit. Die Mönche aber insbesondere auch die Nonnen sammelten und praktizierten ein zu ihrer Zeit erstaunliches Wissen über Kräuter und Heilpflanzen.
Besonders berühmt ist die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098–1179), welche im Kloster Rupertsberg in Bingen am Rhein wirkte. Sie gilt gar als eine der ersten Universalgelehrten. Über sie werden Sie in dieser Ausgabe selbstverständlich einiges erfahren. Aber auch die Schweiz hat ein bedeutendes Erbe im Bereich der Klöster. Sie werden deshalb lesen können, wie im Kloster Jakobsbad bei Gonten AI noch heute Heilproddukte aus dem eigenen Klostergarten produziert werden. Da in Klöstern bekanntlich nicht nur gearbeitet, sondern auch gebetet wird, haben wir auch hierzu etwas zu bieten. Und zwar unter dem Motto «Segnen und Beten».
Eine Pflanze, die nicht nur in Klostergarten wächst, aber meist nicht sonderlich beliebt ist kennen wir alle: Die stumpfblätterige Ampfer, auch als Blacke bekannt. Viel weniger bekannt ist aber, dass die Blacke auch als Heilpflanze namentlich im Verdauungsbereich eingesetzt werden kann.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen der neusten Ausgabe von «natürlich». Und machen Sie doch halt, wenn Sie das nächste Mal bei alten Klostermauern vorbeikom men. Es lohnt sich!
Samuel Krähenbühl

Chefredaktor
Zellavie® Bio-Wietofu ist die Alternative zu herkömmlichem Tofu aus Soja. Wietofu sieht genauso aus und hat eine ähnliche Konsistenz, die Nährwerte und Inhaltsstoffe sind jedoch hochwertiger.
Unser Wietofu «Nature» ist cremig fein, mit leicht nussigem Aroma und besteht lediglich aus 2 Zutaten: Bio-Hanfsamen und Wasser.
Wietofu kann Soja-Tofu mehr als gleichwertig ersetzen, ist sogar wesentlich gehaltvoller und weist bessere Nährwerte auf (je 100 g):
✓ Mehr Protein (20 g)
✓ Mehr Ballaststoffe (4 g)
✓ Mehr und wertvolleres Öl mit Omega Fettsäuren (12 g)
Probieren Sie es aus, verwenden Sie Wietofu in Ihren Lieblingsrezepten anstelle von Fleisch und Tofu.



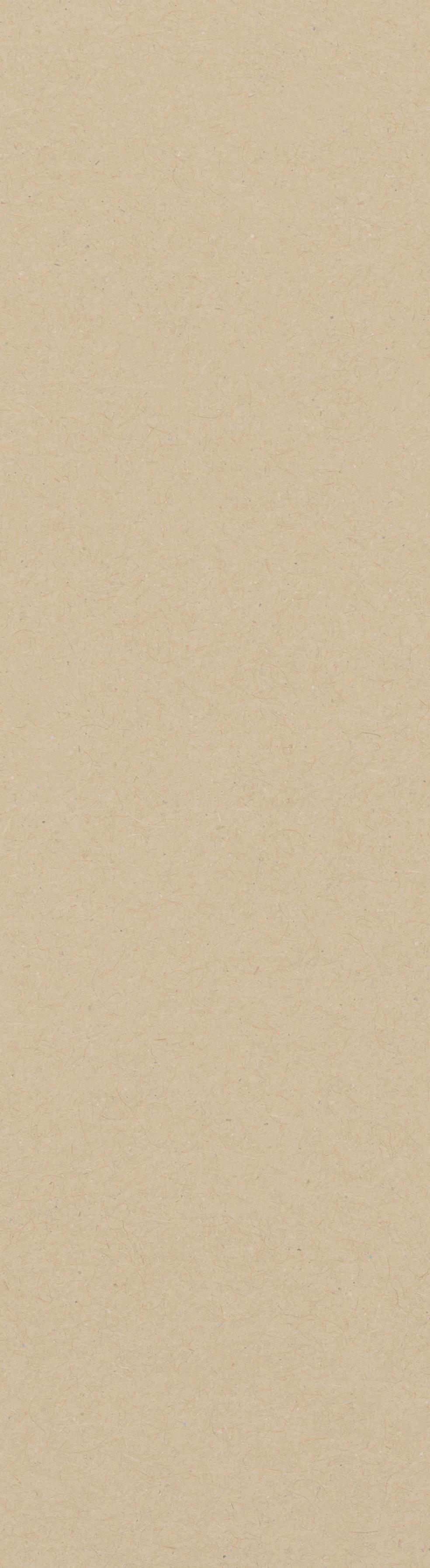

Seit über 20 Jahren zeichnet das ErfahrungsMedizinische Register EMR qualifizierte, erfahrene Therapeut:innen der Komplementär- und Alternativmedizin mit dem EMR-Qualitätslabel aus – für fast alle Krankenversicherer auch die Grundvoraussetzung, um deren Leistungen zu vergüten.
Finden auch Sie Therapeut:innen mit EMR-Qualitätslabel ganz einfach mit der Suchfunktion auf emr.ch
Mehr zum EMR erfahren Sie aus der Publireportage in diesem Heft

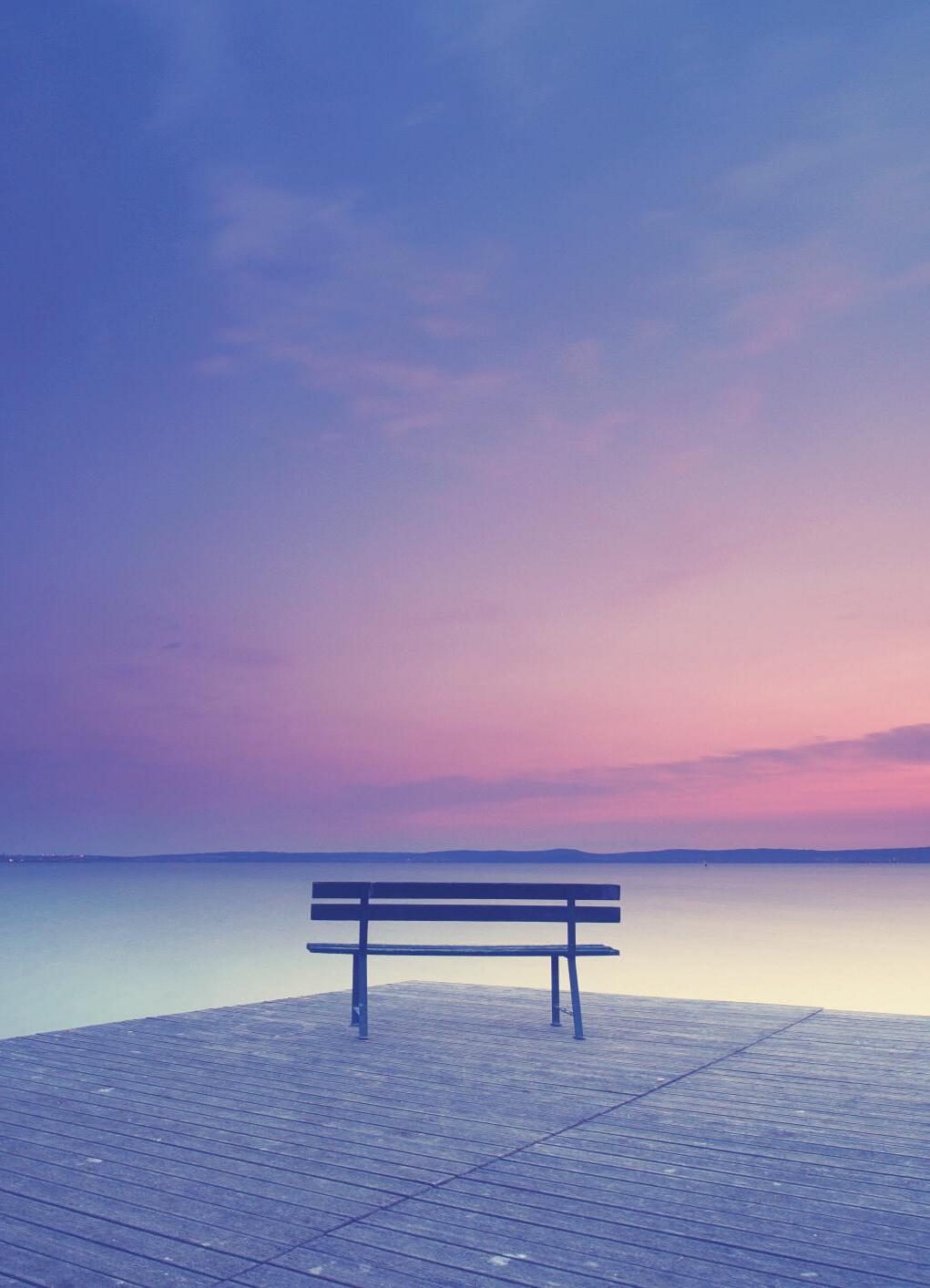


einzigartig * wohltuend * bekömmlich
GESUND SEIN
8 Im Garten Eden Klostergärten heute.
14 Heilende Worte
Warum wir wieder öfters Segen sprechen sollten.
20 Sabine Hurni über … … die Sehnsucht.
22 Leserberatung
Was hilft bei Entzündungen und Nervenschmerzen.
GESUND WERDEN
28 Klostergärten
Jahrhundertealte Orte der Heilung.
32 Harninkontinenz
Das hilft bei Blasenschwäche.
36 Wolfs Heilpflanzen
Wieso die Blacke mehr ist als nur ein Unkraut.
40 Klinik Arlesheim
Wie eine Ärztin Schul- und Komplementärmedizin vereint.
DRAUSSEN SEIN
48 Biodiversität
Wie sich Hanspeter Latour für unsere Natur einsetzt.
50 Zimmerpflanzen
So klappt es mit dem grünen Wohnzimmer.
54 Draussen kochen
Das Feuer lockt nicht nur zum Bräteln.
58 Aus dem Herzen gesprochen
Von Erfahrungen, die das Leben prägten.
04 Editorial / 06 Leben und heilen / 18 Rezepte / 27 Liebesschule / 43 Alice im Wunderland / 44 Staunen und wissen / 62 Neu und gut / 63 Hin und weg / 64 Rätsel / 65 Vorschau / 66 Eva unterwegs

Kostenlos Proben bestellen p-jentschura.com/nch18 Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ www.jentschura-shop.ch



Kollagen
Dieses Eiweiss hält jung und beweglich
Straffe Haut, kräftige Knochen, belastbare Gelenke und starke Muskeln:
Kollagen ist der Stoff, der unseren Körper jung und robust hält und als wahrer Jungbrunnen gilt. Das Eiweiss Kollagen ist mit sechs Prozent unseres Körpergewichts das häufigste Eiweiss und hält unsere Körper zusammen. Die Einnahme von Kollagen kann die körpereigene Kollagensynthese verbessern und so Sehnen, Bänder und Gelenke schützen sowie die Hautstruktur verbessern, schreibt «Die Vollwertige». Kollagen kommt hauptsächlich in zähen Fleischteilen vor. Früher war Kollagen –beispielsweise durch Knochenbrühe – ein fester Bestandteil unserer Ernährung. Heute fehlen Kollagenquellen oft. Es kann deshalb auch durch Präparate ersetzt werden. ska

Der Krankheit davonlaufen
Eigentlich unterschied sich die untere Lendenwirbelregion der Neandertaler*innen kaum von der unsrigen, berichten Forschende. Frühere Annahmen über Unterschiede beruhten offenbar darauf, dass die Wirbelsäulen von Neandertaler*innen mit denen von heutigen Menschen verglichen wurden, die von der modernen Lebensweise geprägt sind. Die Merkmale im Kreuzbereich bei unseren präindustriellen Vorfahren unterscheiden sich demnach kaum von denen der archaischen Menschenform. Erst ab dem späten 19. Jahrhundert zeichnen sich bestimmte Veränderungen ab, die möglicherweise mit dem Auftreten von Rückenschmerzen zusammenhängen, sagen die Forschenden. Wie sie berichten, ging aus ihren Auswertungen hervor: Im Vergleich zu den Wirbelsäulen der postindustriellen Zeit weisen diejenigen der vorindustriellen Menschen eine Anordnung der Lendenwirbel auf, die zu einer stärkeren Krümmung im Kreuzbereich führt. Offenbar handelt es sich demnach um einen Effekt der modernen Lebensweise. Die vorindustrielle Version ist somit die natürliche Konfiguration beim modernen Menschen, legen die Ergebnisse nahe. Wissenschaft.de

Chloe Brown ist chronisch krank, als sie beinahe stirbt, beschliesst sie eine Liste zu machen, die ihr helfen soll aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Doch das stellt sich als schwerer heraus als gedacht. Kurzerhand bittet sie ihren Nachbar Red Morgan um Hilfe.
Trotz anfänglicher Abneigung, kommen sich die beiden immer näher. Talia Hibberts romantische Komödie hat die perfekte Portion Humor gemischt mit liebenswerten Charakteren, herzerwärmenden Momenten und einer Liebesgeschichte, die die Lesenden zum Schwärmen bringt.
Talia Hibbert
«Kissing Chloe Brown», Ullstein 2020, ca. Fr. 20.–ISBN 9783548062846

Gesundheit
Täglich ein bis zwei Karotten zu essen, kommt unserer Gesundheit zugute. Der Grund: Das Gemüse enthält viel Vitamin A. Nicht grundlos sollten Karotten in keiner Küche fehlen. Die Rüben zählen zu den kalorienärmsten Gemüsesorten, sind reich an Carotin und enthalten zudem viel Vitamin A. Ein regelmässiger Konsum kommt sowohl unserem Körper als auch unserer Gesundheit zugute, schreibt «nau.ch». In kaum einem Gemüse steckt so viel Betacarotin wie in Karotten. Der Körper wandelt dieses in Vitamin A um, das wiederum gut für unsere Augen ist. Denn die Netzhaut benötigt dieses, um hell und dunkel sehen zu können. Zudem schützt es die Haut vor schädlichen UV-Strahlen und die Zellen vor freien Radikalen. Nur zwei Karotten reichen aus, um den Tagesbedarf an Vitamin A zu decken. ska

„Weniger müde, mehr munter.“
Vitamin B12 Boost ist hochdosiert und sinnvoll bei grosser geistiger und körperlicher Belastung sowie einer veganen Lebensweise, da Vitamin B12 vor allem in tierischen Lebensmitteln vorkommt.
Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.


Es gibt wohl kaum ein Kloster ohne Klostergarten. Er diente nicht nur der Selbstversorgung, sondern auch als Ort der Heilung, Mystik und Kontemplation, wie dieser Beitrag aufzeigt.
Text: Fabrice Müller
Mit ruhiger Hand füllt Schwester Dorothea die kleinen weissen Döschen mit der minzgrünen Crème, die gegen allerlei Rheumaerkrankungen helfen soll. Verschiedene Kräuter wie zum Beispiel Thymian, Minze, Wacholder, Rosmarin und Lavendel werden für diese Crème nach einem alten, überarbeiteten Rezept des Kapuzinerinnenklosters «Leiden Christi» im appenzellischen Jakobsbad beigemischt. Die Crèmes seien bei der Kundschaft des Klosterladens sehr beliebt, erzählt Schwester Dorothea und zeigt mir in einem Nebenraum das Kräuterlager. Einige der Kräuter stammen aus dem eigenen Klostergarten, doch der Grossteil wird bei spezialisierten Herstellern eingekauft. Der Aufwand für den Anbau und die Ernte, um auf die benötigte Menge zu kommen, wäre zu gross. Zu den Produkten des Klosterladens, der auch einen Online-Shop betreibt, zählt beispielsweise auch das Jakobsbader Stärkungs- und Zellvitalisierungsmittel bei Müdigkeit und Leistungsabfall im Alltag. Das Kloster verfügt über einen weit herum bekannten Laden. Er befindet sich seit 2010 in grosszügigen Räumlichkeiten im Nebengebäude zum Kloster, dem ehemaligen Knechtenhaus. Die Kraft der Naturheilmittel sei –so Schwester Dorothea – die natürliche Ergänzung zur «geistigen» Apotheke der Schwestern mit den Kraftquellen Gottes und der Kirche.
Gartenteam mit drei
Ein Ort zum Auftanken ist auch der Klostergarten, den man durch ein schmiedeeisernes Tor betritt. Doch nur ein Teil des grossen Klostergartens ist öffentlich zugänglich. Der Rest bleibt den Ordensfrauen vorbehalten. Der Garten wird mit viel Liebe von den Schwestern Chiara, die als Jugendliche eine Floristinnenlehre absolvierte und in einer Gärtnerei arbeitete, M. Veronika und M. Josefa gepflegt. Beim Spaziergang zwischen den geometrisch angeordneten Beeten hindurch begegnet man allerlei Gemüse und Salaten. Bereits anfangs Februar beginnt die Saat des Salates. Bis tief in den Winter können verschiedene Kohlsorten, Lauch, Randen und andere Wintergemüse geerntet werden. Jahrzehntelang nahm die Selbstversorgung mit Landwirtschaft und eigenem Gemüsegarten einen hohen Stellenwert im Kloster Jakobsbad ein. Heute ist die Landwirtschaft verpachtet, der Gemüsegarten wird weiterhin liebevoll gehegt und gepflegt und einige Rohstoffe für den Klosterladen und die Apotheke daraus gewonnen. Dazu gehören zum Beispiel die Pfefferminze und Zitronenmelisse, die für Tinkturen oder Getränke verwendet werden. Weiter geht es an Beeten voll Agera«
Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen, und ein Vernünftiger verachtet sie nicht.
Bibel (Jesus Sirach 38,4)

Brunnen | Der Brunnen mitten im Klostergarten ist zum einen ein Symbolbild fürs Leben. Er hat aber natürlich auch ganz praktische Bedeutung.

Schwestern | Drei Schwestern des Klosters in Jakobsbad kümmern sich um den grossen Garten.

Gemüse | Im Klosgergarten wächst auch Gemüse. Federkohl, auch bekannt als Grünkohl oder Kale, ist ein sehr gesundes und vielseitiges Wintergemüse.

tum, Korn- und Ringelblumen vorbei, die von den Schwestern für Salben und Tees genutzt werden. Nur als Zierde für den Salat dienen die blauen Borretsch-Blüten. Wichtig für den Kirchenschmuck sind die goldenen Sonnenblumenblüten. «Durch die Sonnenblume reichen wir den Schein Gottes weiter», sagt Schwester Chiara und erklärt, dass die Mitte der Sonnenblume mit ihren nahrhaften Körnern ein Energiespeicher für verschiedenste Lebewesen sei. Zu den weiteren «Bewohnern» des Klostergartens zählen zum Beispiel auch Maiglöckchen, die in der christlichen Symbolik für Maria stehen. Eine knallrote Rose lenkt nun die Blicke auf sich. Als Symbol der Liebe blüht sie in mehreren Arten und Farbtönen, ebenso wie die Apfelbäume. Im Frühling werden sie ausgelichtet, damit das Licht in die Mitte kommen kann – auch in die Mitte der Menschen.
Der Heilige Benedikt legte in seinem Regelwerk vieles im Leben seiner Glaubensbrüder fest – auch was den Klostergarten betrifft. So schreibt er im Kapitel 65: «Das Kloster soll, wenn möglich, so angelegt werden, dass sich alles Notwendige, nämlich Wasser, Mühle und Garten, innerhalb des Klosters befindet und die verschiedenen Arten des Handwerks dort ausgeübt werden können. So brauchen die Mönche nicht draussen herumzulaufen, denn das ist für sie überhaupt nicht gut.» Die von Benedikt geforderte Beständigkeit des Mönchs ist die Grundbedingung für das Werden und Wachsen eines Gartens, seiner Pflanzenwelt im Speziellen und für die Entwicklung der Gartenkultur im Allgemeinen, schreibt Peter Paul Stöckli in seinem Kunstführer «Die Gärten des Klosters Muri». Der Landschaftsarchitekt beschäftigt sich beruflich seit über 50 Jahren mit historischen Gärten und Anlagen und dabei auch mit den Gärten mehrerer Klöster (siehe auch Interview).
Barockes Bauwerk mit nationaler Bedeutung
Nun blüht es wieder in den Gärten des Klosters Muri. Und das Wasser plätschert aus dem 2008 wiederhergestellten Martinsbrunnen mit der Figur von Martin von Tour, dem Klosterpatron von Muri. Insgesamt vier Gärten prägen diese Klosteranlage. Das im Jahre 1027 von den Habsburgern gestiftete und vom Mutterkloster Einsiedeln gegründete Kloster Muri gehört zu den wichtigsten barocken Klosteranlagen der Schweiz. Der Klosterhof ist die Eingangspforte für die Besuchenden. Von hier aus erreicht man den Konventgarten und den grossen Küchengarten. Früher befanden sich hier auch die zwei ehemaligen Apothekergärten, die jedoch im Zuge der politisch initiieren Klosteraufhebung 1841 verschwanden. «Der Konventgarten diente der stillen Erholung, der Kontemplation, dem Gebet, dem Gespräch, der Naturbetrachtung und der gärtnerischen Arbeit», erklärt Peter Paul Stöckli. Der neben dem Klosterhof liegende Konventgarten übernimmt in seiner heutigen Gestaltung die ursprüngliche Gliederung in drei etwa gleich grosse Gartenteile, ausgerichtet auf die Sichtachsen der Klostergebäude. Die Beete wurden im barocken Stil bepflanzt mit Gehölzen, Buchsstauden und Zwiebelpflanzen, die jedoch herrlich zu blühen beginnen. Mit Ausnahme des Fürstengartens – des heutigen Pflegiparkes – wurden alle Gärten zwischen 1996 und 2004 durch das Wettinger Büro SKK Landschaftsarchitekten AG neu, aber im Geiste und in den Grundzügen der nach 1841 zerstörten Vorgängergärten gestaltet.
Aufgrund seiner herausgehobenen Stellung des Abtes im Benediktinerorden erhielt dieses demokratisch gewählte Klosteroberhaupt einen eigenen Garten – den Fürstengarten. «Hier empfing der Abt seine Gäste, führte mit ihnen Gespräche und speiste mit ihnen», berichtet Peter Paul Stöckli. Im Zusammenhang mit der Restaurierung des Ostflügels wurde 1987 mit einer freien Rekonstruktion eine Erinnerung an den durch die Klosterauflösung verlorenen Fürstengarten in Form einer barocken Gartenterrasse geschaffen. Im Zentrum befindet sich ein Wasserbecken – ein Attribut, das den Abtgarten über viele Jahrhunderte schmückte. Wie Peter Paul Stöckli informiert, gehörte einst auch eine Orangerie mit exotischen Pflanzen zum Abt- bzw. Fürstengarten. Die Orangerie fiel dem Neubau des Klosters von 1789 bis 1798 zum Opfer. Im Ostbereich des Klosters liegt der grosse Küchengarten. Er ist symmetrisch aufgebaut. Die Gartenbeete und Wege sind auf ein Zentrum hin ausgerichtet. Der klösterliche Küchengarten dient heute – wie alle anderen Gärten auch – den Bewohnerinnen und Bewohnern des im Klostergebäude integrierten Pflegeheims als Arbeits- und Erholungsort. Hier gedeihen Gemüse und Beeren. Als ein mystischer Ort präsentiert sich der Kreuzganggarten des Klosters: «Er ist kein Innen-, sondern ein Freiraum», sagt Peter Paul Stöckli. Um diesen nach oben, dem Himmel zugewandten Raum ist das ganze Kloster angeordnet. Im Vergleich zu anderen Klöstern ist der Kreuzganggarten von Muri klein. Heute nimmt die kreuzförmige Gliederung mit vier Rahmen aus niederen Buchshecken und einem kreisrunden Beet im Zentrum Bezug auf die Gartenausgänge des Kreuzganges. www.klosterleidenchristi.ch www.klosterapotheke.ch www.klostermuri.ch

Apotheke | In der klostereigenen Apotheke werden Kräuter zu Heilmittel und Kosmetika verarbeitet.
Hildegard von Bingen
Heilpflanzen spielten bei Hildegard von Bingen (1098-1179) eine zentrale Rolle. Die deutsche Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin und Komponistin war zugleich eine bedeutende natur- und heilkundige Universalgelehrte. Hildegard von Bingen arbeitete in der Volksheilkunde vor allem mit einheimischen Heilkräutern. In ihren medizinischen Werken geht Hildegard von Bingen auf über hundert Heilpflanzen ein und formuliert Rezepte für ihre Anwendung als Kräuterwein, Pulver, Tee, Auflage, Salbe und Tinktur.

Kloster Jakobsbad | Aussenansicht des Kapuzinerinnenklosters «Leiden Christi» im appenzellischen Jakobsbad.

Kunstführer
«Die Gärten des Klosters Muri»
Peter Paul Stöckli
September 2013, ISBN 978-3-03797-112-3, CHF 16.90

Klostergärten – Paradiese der Stille
Kriemhild und Aloys Finken
August 2015, ISBN 978-3-7995-0680-9, CHF 36.90
«Der
Paul Peter Stöckli setzt sich als Landschaftsarchitekt und Fachexperte für Gartendenkmalpflege seit einem halben Jahrhundert für den Schutz und die Pflege von historischen Gärten als wichtiges Kulturgut ein – so auch im Kloster Muri. Wir haben uns mit ihm über die Faszination von Klostergärten unterhalten.
Sie beschäftigen sich schon seit Längerem mit Klostergärten. Was fasziniert Sie daran?
Peter Paul Stöckli: Ich beschäftige mich praktisch und theoretisch mit dem Kulturgut der historischen Gärten und Anlagen. Dazu gehören sicher die Gärten der Klöster, denn sie sind es, die die Gartenkunst der Antike in die Neuzeit übertragen haben. Die Gärten sind immer Ausdruck der gesellschaftlichen und persönlichen Verhältnisse der Gartenbesitzer, aber auch des Kenntnisstandes und des Zeitgeschmacks. Gerade in einem Klostergarten wie Muri hat sich ein fast tausendjähriger Erfahrungsschatz angesammelt.
Wodurch zeichnen sich Klostergärten aus?
Es gibt nicht den klassischen Klostergarten. Zudem verfügen viele Klöster über mehrere Gärten innerhalb ihres Bezirks. Meist allen Klöstern gemein ist der Kreuzgarten. Er ist das Herz des Klosters und auf allen vier Seiten vom Gebäude umschlossen, aber nach oben offen. Der Kreuzgarten ist in der Regel der älteste Garten der Anlage und diente zur Kontemplation. In vielen Klöstern findet man zudem einen Konventgarten als Erholungsort, einen Apothekergarten mit Heilkräutern, einen Küchengarten sowie – wie in Muri – einen Abtgarten mit repräsentativen Aufgaben. Die meist orthogonale Struktur der Gartengestaltung sowie der Bezug zu den umliegenden Gebäuden darf man in den meisten Fällen als weitere Gemeinsamkeit von Klostergärten bezeichnen.
Der Klosterplan St. Gallen spielte bei der Planung von Klostergärten eine zentrale Rolle. Weshalb?
Dieser Plan gilt als Ursprung für die Planung solcher Gärten und ist mit über 800 Jahren einer der ältesten seiner Art. Er beinhaltet die Bereiche Essen, Heilen, Erholung und Kontemplation.
Dem Klostergarten kommt ja auch eine spirituelle bzw. religiöse Bedeutung zu?
Der Klostergarten repräsentiert sozusagen das Paradies, den Garten Eden auf Erden. Er fördert die geistige Versenkung und das Gebet. Die Hinwendung zur Natur und zu den Pflanzen ist in diesem Sinne ein geistliches Werk.
Wer war für den Unterhalt der Klostergärten verantwortlich – die Klosterbrüder und -frauen?
Am Anfang schon. Später dann wurden eigene Gärtner angestellt. Nach der Aufhebung der Klöster machten sich die Klostergärtner nicht selten selbständig, schliesslich waren sie die einzigen, die diesen anspruchsvollen Beruf wirklich beherrschten. So wurden durch die Gärten und Gärtner der Klöster die Hortikultur entwickelt, und manche Pflanze, die sich in den Bauerngärten der Umgebung fand, hatte ihren Ursprung in einem Klostergarten.
Interview: Fabrice Müller www.skk.ch

Der St. Galler Klosterplan ist die früheste Darstellung eines Klosterbezirks aus dem Mittelalter und zeigt die ideale Gestaltung einer Klosteranlage zur Karolingerzeit. Er ist an den Abt Gozbert vom Kloster St. Gallen adressiert, entstand vermutlich zwischen 819 und 826 im Kloster Reichenau unter dem Abt Haito und ist im Besitz der Stiftsbibliothek St. Gallen. Er wird dort unter der Bezeichnung Codex 1092 aufbewahrt. Der Klosterplan mit seinen 52 Gebäuden besteht aus fünf zusammengenähten Pergamentblättern (112 cm mal 77,5 cm). Der St. Galler Klosterplan ist der einzige Bauplan, der aus dem frühen Mittelalter erhalten ist. Die Bedeutung des Planes erschliesst sich schnell bei genauerer Betrachtung des Plans. Dargestellt werden etwa 50 Gebäude in ihrer Lage, ihrer Grösse und ihrer

Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.
Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit
Kurhaus St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch
Funktion. In nicht wenigen Gebäuden finden wir Darstellungen von der Inneneinrichtung, Betten, Tischen und vielem mehr. Damit liefert er eine Beschreibung eines Klosters mit den Bedürfnissen seiner Einwohner. Der Zeichner des Plans stellte die Anordnung der Gebäude dar, wie es ihm für ein grösseres Kloster nach der Regel des heiligen Benedikts ideal erschien. Und eben auch die verschiedenen Gärten. Das sind der Arzneimittelgarten, der mit dem Friedhof kombinierte Obstgarten und der Gemüsegarten. sam •
1 Arzneikräutergarten
2 Obstgarten und Friedhof
3 Gemüsegarten
362318_bearbeitet.qxp 19.3.2009 16:50 U
Sass da Grüm – Ort der Kraft Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Solch ein Ort ist die Sass da Grüm. Baubiologisches Hotel, Bio-Knospen-Küche, Massagen, Meditationen, schönes Wandergebiet, autofrei, traumhafte Lage. Hier können Sie Energie tanken. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen.
Hotel Sass da Grüm CH-6575 San Nazzaro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch

Ist Segnen und Beten noch zeitgemäss? Wir meinen Ja. Worte des Segens können heilend wirkend und Liebe vermitteln.
Text: Eva Rosenfelder Illustration: Sonja Berger
Segnen und Beten, das mag in vielerlei Ohren etwas altmodisch oder allzu «religiös» anklingen. Schade, denn hier findet sich ein Quell der Kraft, der für alle Menschen unabhängig einer Glaubensrichtung zur Verfügung steht.
Wer dereinst um Segen bat, betete zu (einem) Gott oder zur geistigen Welt, je nach Religion. Das «Segnen» überliess man der Kirche auf Grundlage der Bibel, wie z. B. das Segensgebet von Moses für das Volk Israel: «Der Herr segne dich und bewahre dich! Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen! Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden!» (4. Moses 6, 24–26)
Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit war das Segensprechen wie auch das Wahrsagen durch «nicht als dazu befugte Laien» – sprich keine Kirchenvertreter – «als verbotene und verdächtige Handlung» bewertet und von staatlichen und kirchlichen Behörden bekämpft und geahndet. Es wurden Verordnungen erlassen gegen «Medikaster und Segensprecher, Zauberer, Wahrsager und Teufelsbeschwörer», so dass das «hochverpoente und verdammliche Laster des Segensprechens ganz ausgerottet werde». Ob von daher eine gewisse Scheu kommt, das Segnen als einen kraftvollen Akt ins persönliche Leben einfliessen zu lassen und für unseren modernen Alltag zu beleben?
Der Glaube an «etwas Höheres» ist in unseren Breitengraden stark in den Hintergrund getreten, vielmehr hat man sich einer Art von «materieller Religion» zugewandt, dem Glauben an die Allmacht der Wissenschaft. Das eine scheint neben dem anderen wenig Platz zu haben.
Stille Wirkkraft
«Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen», schrieben wir uns dereinst ins Poesiealbum, was mich dies als Kind jedes Mal mit Freude erfüllte. «Heile, heile, Säge!», ein weitherum bekannter Segen, dessen kraftvolle Wirkung kaum jemand nicht selbst oder mit seinen Kindern erfahren hat. Er wirkte immer zu 100 Prozent: Der Schmerz war wie weggeblasen. Bekommen wir den Segen oder zumindest die Absegnung für ein neues Projekt, gibt das guten Fahrtwind; ein wohlgemeinter Reisesegen oder Segenswünsche zum Geburtstag nehmen wir ebenfalls gerne an, während ein schiefhängender Haussegen uns schwer zu schaffen macht.
«Grüss Gott», bzw. «Grüezi» ist ebenfalls ein Segensspruch, genauso wie das Anstossen mit einem Glas Wein und dem Ausspruch «auf dich!».
In Alltagsfloskeln verwenden wir alte Segenswünsche ohne uns dies gross bewusst zu sein: «Adieu» etwa, was so viel bedeutet wie «Gott sei mit dir», nahe verwandt mit dem arabischen «Salam» oder hebräischen «Schalom», was soviel bedeutet wie «Friede sei mit dir». Was bei uns in wenig bewussten «Relikten» noch vorhanden ist, halten dafür andere Kulturen umso lebendiger. Das indische «Namaste» (Sanskrit = Verbeugung) in der Yogastunde ist uns lustigerweise vertrauter geworden, als eine «gesegnete Mahlzeit», oder ein warmer Händedruck mit einem «Sei gesegnet», wie es vielleicht schon längst verstorbene Grosseltern zu tun pflegten. Gesten, die einfach nur guttun.
Das exotische «Namaste» ist Ausdruck derselben Wertschätzung, dass die Begrüssten in der Göttlichkeit ihrer Seele gesehen und anerkannt werden – ein echter Segen also.
Das deutsche Wort «segnen», ist eine Verstärkung von «sagen», es stammt vom Lateinischen «benedicere» (Lateinisch: bene = gut, dicere = sagen), also «Gutes sagen, loben, preisen», was den Hauptaspekt des Segnens ausdrückt: Der Segen ist ein gutes Wort, das zu oder über einem Menschen oder eine Situation ausgesprochen wird.
Der Segen meint es einfach nur gut mit dem angesprochenen Menschen, er will ihn stärken, nähren und vor allem: in keinerlei Weise verändern. Sei gesegnet, als das, was du bist. Anders als Hoffen oder Wünschen beinhaltet der Segen mehr: Er schafft Verbindung zu einer tragenden Kraft, die über uns hinausgeht. Sie soll in den Menschen einströmen und ihn bewahren. Sie soll bewirken, dass er mit seinem Tun in Einklang kommen und mit sich selbst Frieden finden kann. Der Segen ist ein Schutzraum, in dem Geborgenheit spürbar wird; zugänglich alle, unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze. Ein Segen schliesst niemanden aus, so wie die Sonne, die allen Lebewesen ihre wärmenden Strahlen schenkt. Dieses Geschenk, das wir vom Leben selbst erhalten haben und weitergeben dürfen, erfordert aber auch eine gewisse Demut, denn für einmal geht es nicht um unser Ego oder ums Machen: Segnen ist ganz einfach Liebe.
Eine Einladung, dem Leben mit allen seinen Erscheinungen das Herz zu öffnen und Liebe fliessen zu lassen. Eine Liebe, welche die Freiheit haben soll, so zu wirken wie sie möchte.
Wer segnet, gibt. Ein Geschenk, das auf die Gebenden zurückwirkt und sie ebenfalls erhellt. Das ist das Wunderbare und Unerklärliche daran.
Gedanken und Materie
Erstaunlich, dass gerade grosse Wissenschaftler*innen, wie beispielsweise der grosse Physiker Albert Einstein, als religiöse Menschen bekannt waren und über ihr Forschen zu einer erweiterten Religiosität fanden: «In jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden …»
Die Wahrnehmung, dass es Kräfte geben könnte, die hinter all den Erscheinungen wirken, rückt bei der «Krone der Schöpfung» gern in den Hintergrund. Die menschliche Spezies schreibt sich vor allem eigene «Schöpferkraft» zu, um sich zuweilen vor lauter freien Willen und begnadetem Individualismus ihre eigenen Wurzeln zu kappen. Gerade in diesem Zusammenhang sind die Erkenntnisse der modernen Physik ungemein spannend, die belegen, dass allein die Betrachtung eines Experimentes durch eine*n Versuchsleiter*in selbst schon dessen Ergebnis mitbestimmt. Der amerikanische Nobelpreisträger John Wheeler prägte dafür den Begriff «Beobachter-Universum». So findet etwa eine Person, welche «neutral» das physikalische Verhalten von Licht untersucht je nach ihrer eigenen Erwartungshaltung das Licht einmal als Welle, das andere Mal als Teilchen. Erwartet sie die Welle, dann tritt sie ein, das andere Mal das Teilchen – also immer genau das Ergebnis, das sie im vornherein zu entdecken glaubt. Die Kraft unserer
• Segnen ist einfach. Wo immer Sie mit dem Herz dabei sind, jemandem helfen, ihre Anteilnahme zeigen, jemanden beschützen oder verteidigen, wirken Sie «segnend».

• Ein Segen ist immer eine klare und direkte Ansage: «Du schaffst es!», «Viel Kraft», «Gott sei mit dir» (indirekter Befehl).
• Segnen verändert uns selbst, unser Umfeld, sowie unsere Beziehung zur Schöpfung.
• Alles, was es für einen Segen braucht, haben Sie immer dabei: Ein mitfühlendes, warmes Herz und einen achtsamen, bewussten Geist.
• Segnen ist praktizierter Selbstwert. Hören Sie auf zu jammern und zu schimpfen, sondern fragen Sie sich: Was möchten Sie wirklich? Welchen Segen möchten Sie verschenken durch Ihr Sein in dieser Welt?
• Segnen zieht Segen nach sich.
• Segnen ist nicht beschränkt auf die menschliche Perspektive, sondern folgt dem Sinn der Schöpfung.
Gedanken und Worte wirken also auf der Schwingungsebene in einem ganz anderen Ausmass, als wir uns es je vorstellen würden.
Alles schwingt miteinander
Auch in anderen Disziplinen, etwa der Medizin, beobachtete man dieselbe feine Schwingungsebene, so beim «PlaceboEffekt»: Hier ist die Erwartungshaltung aller Beteiligten wesentlich für den Genesungserfolg – ebenso beim «Nocebo-Effekt», wo der Glaube an eine hoffnungslose Situation fatale Auswirkungen haben kann. Dies insbesondere bei einer erfolgten Fehldiagnose, die sich dann selbst bewahrheitet.
Was bedeutet das für unser Leben? Nicht nur, dass unsere Erwartungen offensichtlich eine viel grössere Rolle spielen als wir je glaubten, sondern noch viel mehr: Diese Tatsachen zeigen, dass wir nicht getrennt sind von unserer Umwelt, sondern in ständiger Wechselwirkung mit anderen Menschen und mit der Natur. Auf feinste, unsichtbare Weise ist alles verwoben mit allem, was lebt. Oder um es mit Mahatma Gandhis Worten zu sagen: «Ich kann dir nicht weh tun, ohne mich selbst zu verletzen.»
So belegen wissenschaftliche Studien auch längst, dass die scheinbar unbelebte Materie Erinnerungsvermögen hat, was z. B. der Japaner Masaru Emoto mit seinen Wasser-Kristallbildern eindrücklich sichtbar machen konnte. Auch Klang und Schwingung von Wörtern wirken messbar lange nach. Doch dies nicht nur in unserer Umgebung, sondern auch in der eigenen Erinnerung und im Unbewussten – was sich nicht nur die Werbung zunutze macht …
Achtsam sein in alle Richtungen
Ein Segen wirkt über diese unsichtbare Schwingungsebene heilend und gerade darum ist das bewusste Segnen heute wichtiger denn je. Indem wir uns dem Guten zuwenden, bewirkt es dies auch in der Welt, die uns umgibt.
Doch wo Worte wirken, da gilt auch der Umkehrschluss: Wenn wir mit ständigem Klagen, Jammern und Motzen der Unzufriedenheit zu den Umständen dieser Welt unseren «Segen» geben, so kann dieser zum Fluch werden. Ein echter Jammer, denn es ist eine neurologische Tatsache, dass sich unsere Gehirnsynapsen gemäss unseren Gedanken und Worte prägen, sie brüten das aus, was wir ihnen ins Nest legen. Worte haben sehr viel Potenzial – zum Heilen und Vernichten.
Es gilt also achtsam zu bleiben in alle Richtungen, was auch einen guten Bodenkontakt bedingt: «Vertraue auf Gott, aber binde dein Pferd an …», so der Dalai Lama kurz und bündig. Der Selbstverantwortung sind wir auch aller Gebete und Segnungen wegen nicht entbunden. Doch, wer sich auf diese nährende Ebene des Urvertrauens begibt, wird dort immer wieder Kraft schöpfen, und kann sich getrost in die widrigen Winde des Lebens wagen und für diese Welt ein echter Segen sein. •
gefragt: Gisula Tscharner

Kurzinterview mit Gisula Tscharner
Was unterscheidet ein Gebet und eine Segnung?
Beten ist Kommunikation, man will etwas, erbittet etwas. Segnen ist eine Kraftübertragung, man gibt etwas.
Können alle Menschen natürlicherweise segnen und beten, oder braucht es dafür eine Glaubensrichtung, Kirche, besondere Rituale?
Segnen bedeutet ganz einfach «Gutes sagen», das können wir alle. Dies etwa mit Worten wie «Mögest du gesegnet sein» oder «Du wirst es schaffen». Ein Segenswunsch ist immer verbindlich: «Das grosse Geheimnis behütet und begleitet dich». Wünsche oder Hoffnungen sind schwächer: «Ich hoffe, (wünsche dir), dass du gesund wirst» – im Gegensatz zu: «Mögest du gesund sein!», was einem Segen gleichkommt.
Was gibt einem Gebet oder einem Segen seine eigentliche Kraft?
Man gibt mehr als nur Worte. Unterstützend ist die rituelle Wortfolge, wie im Kindervers «Heile heile Säge». Wichtig ist auch die Wiederholung, aber auch Berührung so etwa mit den Worten «Mögest du stark sein» die Schultern zu berühren. Oder dann auch mit Gesten - schlussendlich ist es immer die Energie, die heilt.
Zur Person
Gisula Tscharner ist ehemals freiberufliche Seelsorgerin und Ritualbegleiterin.
Sehnsucht nach etwas Wärme und nach dem «Land, wo die Zitronen blühn»?
Jetzt darf beim Kochen und Geniessen etwas Italianita für sonnig-helle Stimmung sorgen. Dieser Klassiker aus dem Süden – mit Mehl vom Schweizer Acker – schmeckt selbstgemacht wie von der Mamma und ganz wie reine Poesie!
RAVIOLI MIT RICOTTAZITRONENFÜLLUNG für 4 Personen
Teig
200 g Biofarm Dinkelhalbweissmehl
50 g Biofarm Hartweizenmehl
2 Eier
2 EL Biofarm Olivenöl
3 EL Wasser
Füllung
1 Bio-Zitrone, Schale und Saft
250 g Ricotta
1 Eigelb
130 g Greyerzer, gerieben wenig Salz und Pfeffer
1 Eiweiss wenig Salz
Zubereitung
1. Beide Mehle in eine Schüssel geben, gut mischen und danach eine Mulde in die Mitte drücken.
2. Eier, Öl und Wasser in einem Messbecher verrühren und in die Mitte der Mulde giessen. Flüssigkeit mit dem Mehl von innen nach aussen mit einer Gabel vermengen.
3. Den Teig etwa 10 Minuten kneten bis eine schöne, glatte Kugel entsteht. Die Teigkugel in einer mit einem feuchten Tuch bedeckten Schüssel etwa 30 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen.
4. In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten. Von der Zitrone die Schale in eine Schüssel reiben und danach eine Hälfte der Zitrone auspressen. Ricotta, Eigelb und Käse dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Alles gut mischen bis eine gebundene Masse entsteht.
5. Nun den Pastateig sehr dünn auswallen oder durch eine Teigwarenwalze geben.
6. Mit einer runden Ausstechform (ca. 8 cm Durchmesser) Raviolihälften ausstechen. Den ausgestochenen Teig mit Eiweiss bestreichen und etwa einen Kaffeelöffel von der Masse in die Mitte geben. Mit einem weiteren Kreis bedecken und den Rand leicht andrücken.
7. In einer Pfanne Wasser aufkochen und Salz dazugeben. Die Ravioli portionenweise im Wasser garkochen.



Zubereitung
1. Butter mit einer Prise Salz aufschlagen, Zucker daruntermischen und kurz weiterschlagen. Eier hinzufügen und schlagen, bis die Masse ein wenig heller wird.
2. Mit Vanilleextrakt, Kirsch und geriebener Zitronenschale verfeinern. Zum Schluss Mehl unterheben und ca. 20 Minuten zugedeckt kühl stellen.
3. Bretzeleisen erhitzen (dabei Bedienungsanleitung beachten) und mit ganz wenig Öl bestreichen, dies ist nur vor dem ersten Backvorgang notwendig. Aus dem Teig nussgrosse Kugeln formen und portionenweise hellbraun backen.
für 75 bis 100 Stück
125 g Butter, zimmerwarm
1 Prise Salz
125 g Zucker
2 Eier
1 TL Vanilleextrakt
15 ml Kirsch
½ Zitrone (Schale)
225 g Mehl

ALPE-CHUCHI BERNER OBERLAND
Anna Husar, Fr. 39.–weberverlag.ch | ISBN 978-3-03818-148-4


Wonach sehnen Sie sich? Vielleicht nach den ersten warmen Sonnenstrahlen? Nach Regen? Nach fester Nahrung, falls Sie am Fasten sind oder nach Erlösung, falls Sie Schmerzen haben? Unser Leben ist voller Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Dingen, die nicht sind. Dinge, die in der Vergangenheit wichtig waren und Umstände, mit denen wir uns eine schönere Zukunft erhoffen. Die Sehnsucht ist das Feuer, das uns am Leben hält. Was wäre das Leben, ohne Feuer? Wir alle kennen das bittersüsse Gefühl der Sehnsucht. Süss, weil es so oft mit Liebe und verheissungsvollem Glück zusammenhängt. Bitter, weil es unerreichbar ist. So sehr, dass Sehnsucht ein schmerzliches Ziehen in der Brust hervorrufen kann. Sehnsucht ist der Liebeskummer. Aber nicht nur! Sehnsucht ist auch Vorfreude und führt zum glückseligen Dauerlächeln, wenn man die grosse Liebe gefunden hat. Sehnsucht liegt im Schmerz der endgültigen Trennung und im vorübergehenden Getrenntsein zweier frisch Verliebten.
In der Psychologie ist das komplexe Phänomen der Sehnsucht wenig untersucht. Vermutlich deshalb, weil das Gefühl so individuell ist wie die Vorstellung des perfekten Lebens. Eine Forschergruppe der Universität Zürich hat sich diesem Thema angenommen und verschiedene Merkmale der Sehnsucht herausgefiltert. So entstanden verschiedene Definitionen der Sehnsucht: Sehnsucht ist die Unerreichbarkeit einer persönlichen Utopie, wie das Leben aussehen sollte. Sehnsucht ist die Trauer darüber, dass das Leben nie vollkommen sein kann. Sehnsucht ist im-
über die Sehnsucht
mer gleichzeitig auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ausgerichtet. Das heisst, wir sehnen uns in der Gegenwart nach etwas, das in der Vergangenheit existierte und hoffen, dass es in der Zukunft wieder da IST. Eine verstorbene Person, eine verflossene Liebe, ein verspieltes Vermögen. Sehnsucht ist aber auch eine Möglichkeit, wie wir uns selbst erforschen können. Sie gibt Aufschluss über den eigenen Lebensweg, die Wünsche und Träume, die wir entweder leben oder unterdrücken. Sehnsucht ist die Chance, die innersten Bedürfnisse hinter dem Konsumverhalten zu entdecken. Das heisst, wenn ich mich nach einem schnittigen Sportwagen sehne, könnte das heissen, dass ich mir im Leben mehr Freiheit, Unabhängigkeit und Unbeschwertheit gönnen sollte. Diese Gefühle lassen sich mit dem Kauf des Wagens nur vorübergehend befriedigen. Ihnen hingegen auf die Spur zu kommen, kann für das eigene Leben sehr sinngebend sein. Solange die Sehnsucht im Bereich des Kontrollierbaren liegt, kann sie sehr inspirierend sein. Diesen Umgang mit der Sehnsucht muss man im Laufe des Lebens allerdings erlernen. Junge reagieren oft viel melancholischer auf Sehnsucht als ältere Menschen. Vielleicht haben die Älteren gelernt, damit umzugehen, vielleicht werden die Träume mit zunehmendem Alter auch bescheidener und demütiger, weil das Leben selbst bereichernd und erfüllt war.
Sehnsucht und Kunst
Wonach sehnen Sie sich? Nach einer geliebten Person? Nach dem Haus an der Amalfiküste? Sehnsucht ist ein Gefühl des schmerzlichen Verlangens. Es ist ein inni-

ges Zehren nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen, immer in Verbindung damit, dass das Ziel der Begierde nicht erreicht werden kann. Das ist Stoff für allerbeste Dramen. Es verwundert nicht, dass die Sehnsucht jegliche Formen der Kunst seit jeher inspiriert. Die Theaterbühne, die Literatur, den Tanz, die Musik und die Oper. Sie alle leben vom Schmerz der unerfüllten Liebe, der Sehnsucht nach Rache oder der Sehnsucht nach einem besseren Leben. Wie schön sind doch all die Klagelieder, die Arien und Chansons, die von Schmerz, von Trennung oder von unerfüllter Liebe handeln? Wie berührend die Klänge der Geige, die das Gefühl der Sehnsucht so eindringend an uns heranträgt. Nicht zu vergessen die Poesie, wo über reduzierte Worte so unendlich viel Sehnsucht, Schwärmerei und Schwelgen in einen Text gepackt wird.
Neben der Literatur und der Musik, befassten sich auch die Philosophie, die Mythologie und die Mystik auf unterschiedlichste Weise mit der Wissenschaft der Sehnsucht. Der Philosoph Immanuel Kant bezeichnete die Sehnsucht als Zeitspanne, zwischen Begehren und Erwerben des Begehrten. In der griechischen Mythologie wird unsere Suche nach Vollkommenheit mit einer Geschichte erzählt, die von Kugelmenschen handelt. Diese hatten vier Hände, vier Füsse und einen Kopf mit zwei Gesichtern. Weil sie den Himmel stürmen wollten, bestrafte Zeus sie und zerlegte die Kugelmenschen in zwei Hälften. Diese Hälften sind die heutigen Menschen. Sie leiden unter Unvollständigkeit, suchen ständig nach der verlorenen zweiten Hälfte und sehnen sich nach der einstigen Ganzheit.
Sehnsucht und Spiritualität
Mit der Ganzheit und dem Getrenntsein vom Göttlichen befasst sich auch die Sehnsucht nach einer spirituellen Verbindung. Die Suche nach dem eigenen Ursprung, das Erforschen der Spiritualität und die Auseinandersetzung mit den Sinnfragen des Lebens hat sehr viel mit Sehnsucht zu tun. In der Mystik des Islam, dem Sufismus, wird die Sehnsucht nach der Rückverbindung mit dem Göttlichen oft mit der Suche nach dem Geliebten, dem Falter, der um den Schein der Kerzenflamme flattert oder mit der klagenden Flöte beschrieben, die sich nach dem Bambusrohr sehnt, von dem sie getrennt worden war, bevor sie zur Flöte wurde. In allem ist die unstillbare Sehnsucht nach der Liebe, dem Licht und der Wurzel, die in keiner Art und Weise befriedigt werden kann.
Die Bambusflöte sehnt sich nach der Wurzel des Rohres, von dem Sie getrennt wurde. Jede Blume welkt in der Sehnsucht nach dem Stängel, von dem Sie getrennt wurde. Ist diese Vorstellung nicht herzzerreissend schön? •
Sabine Hurni arbeitet als Naturheilpraktikerin und Lebensberaterin in Baden, wo sie auch Ayurveda Kochkurse, Lu Jong – und Meditationskurse anbietet. Sie befasst sich intensiv mit allen Richtungen der Naturheilkunde, Ernährung und spirituellen Lebensthemen.

Ich habe sehr trockene, zu Ekzemen neigende Haut. Vermutlich hormonbedingt, da es mit der Geburt meiner Tochter begonnen hat. Ich verwende dermatologische Hautlotionen und Flüssigseife, dusche nur alle zwei Tage und nehme Nachtkerzen- und Leinöl ein. Die Ernährung ist abwechslungsreich und gesund.
S. W., Aarau
Eine Schwangerschaft verlangt vom Körper sehr viel ab. Der Nährstoffbedarf steigt zum Teil um das Doppelte, der Wasserbedarf ebenso und auch viele essenzielle Fettsäuren wandern direkt zum Kind. Schliesslich wird das ungeborene Kind zu 100 Prozent über die Nährstoffe versorgt, welche die Mutter zu sich nimmt. Es kann sein, dass die trockene Haut mit einem leichten Defizit an Nährstoffen wie Eisen, Omega-3-Fettsäuren oder Zink zusammenhängt. Es wäre sicher sinnvoll, wenn Sie Ihren Nährstoffhaushalt mit einer geeigneten Nahrungsergänzung aufbauen. Um direkt auf der Haut eine Beruhigung zu erzielen, sollten Sie diese vorwiegend mit Öl pflegen. Zum Beispiel Mandelöl, Kokosfett oder Sesamöl. Die stark entzündeten Hautstellen ölen Sie VOR dem Duschen ein. Sie sollten auf keinen Fall mit Wasser in Kontakt kommen. Sehr wohltuend sind auch Selbstmassagen mit Öl. Falls Sie sich einmal pro Woche die Zeit nehmen können, sich von Kopf bis Fuss einzuölen, wäre das ein ideales Wellnessprogramm für Körper und Seele. Auch von Seiten der Homöopathie und der Pflanzenheilkunde gibt es Möglichkeiten, die Haut zu unterstützen. Zum Beispiel mit Produkten, die Cardiospermum enthalten. Cardiospermum, auch Ballonrebe oder Herzsame genannt, ist eine stark wuchernde Schlingpflanze. Sie gilt als leicht giftig, weshalb sie hierzulande ausschliesslich in
homöopathischen Heilmitteln zu finden ist. Wie Sie vielleicht wissen, werden in der Homöopathie pflanzliche Urtinkturen verdünnt und verschüttelt, sodass nur die feinstoffliche Information der Heilpflanze im Heilmittel gespeichert bleibt. Das homöopathische Heilmittel Cardiospermum hat eine kortisonartige Wirkung. Es wird oft sehr erfolgreich bei allergischen Hauterkrankungen, Hautentzündungen oder schuppiger Haut angewendet. Hier arbeitet man am besten innerlich wie auch äusserlich. Von aussen mit einer fettreichen Salbe oder einer leichten Lotion, je nach dem, was geeigneter ist. Innerlich mit einem SpagyrikSpray, den Sie gut auch während dem Stillen anwenden können, weil der Alkoholgehalt sehr gering ist. Der Spagyrik-Spray hat den Vorteil, dass Sie sich ihre ganz individuelle Mischung zusammenstellen lassen können und neben dem Cardiospermum auch andere Substanzen hineinmischen lassen können, die den Hautstoffwechsel in Schwung bringen, den Hormonhaushalt ausbalancieren und den Energiehaushalt stärken.
Noch ein Tipp aus dem Ayurveda: Nehmen Sie jeden Abend einen Teelöffel Ghee (ayurvedische Bratbutter) mit etwas warmem Wasser ein. Das hilft beim Rückfetten. Im Reformhaus finden Sie zudem die Süssigkeit mit dem Namen «Laddhu». Das fettreiche Konfekt essen indische Frauen nach der Geburt, weil es das Windelement ausgleicht und den Darm befeuchtet.


Lungenkollaps
Mein Sohn (18), Nichtraucher, hatte einen Lungenkollaps. Was kann er präventiv machen, damit sich das nicht wiederholt?
A. C., Bern
Es gibt einige Erkrankungen, bei denen man etwas salopp sagen muss: «Einmal ist keinmal.» Ein Lungenkollaps kann beim Sport entstehen, infolge eines Rippenbruchs oder während einer Operation. Dabei dringt Luft in den Lungenfellraum ein, was zum

Kollaps des Lungengewebes führt. Was nach so einem Ereignis zur Stärkung der Lunge sicher gut tut, ist die Atemtherapie. Dort erlernt man spezielle Atemtechniken zur Kräftigung der Atemmuskulatur.
Falls Ihr Sohn im Moment allgemein eine emotional intensive Zeit durchmacht, wäre es zudem wichtig, dass er Menschen um sich hat, die ihm zuhören, sich seinen Anliegen annehmen und sich Zeit für ihn nehmen – Freunde, Eltern, Verwandte oder auch ein*e Lehrer*in oder Lehrmeister*in. Für Jugendliche ist es eh schon keine einfache Zeit. Selbst sind sie in einer Lebensphase des Umbruchs, die Pandemie, die ganze Welt steht Kopf – es ist alles andere als einfach, Orientierung zu finden. Ich denke, es wäre jetzt wichtig, dass er nicht alles in sich hineinfrisst, sondern sich «Luft macht», indem er redet, sich mitteilt und wenn nötig auch mal laut wird und seinen Ärger hinausschreit. Das «Dampf ablassen» muss nicht zwingend verbal sein. Auch mit Schreiben, Malen oder mit Musik kann man sich Luft verschaffen.
Druckstelle am Knöchel
Mein Mann hat am rechten Fussknöchel seit längerer Zeit eine Druckstelle mit Rötung und Kruste. Da es keine andere Lagerung gibt, haben wir nun ein Fellpolster gekauft und ich mache ihm eine Paste mit Schüsslersalz 3. Was könnte ich sonst noch tun?
R. H., Bern
Druckstellen sind immer auch ein Durchblutungsproblem. Vielleicht könnten Sie anfangen, ihm den Fuss vor dem Schlafengehen mit etwas Öl einzumassieren. Zum Beispiel ein Mandelöl, in das Sie einige Tropfen ätherisches Lavendelöl geben. Das macht die Haut geschmeidig, lindert die Entzündung und fördert die Durchblutung. Es könnte auch helfen, ein Stück unbehandelte Schafwolle auf die Stelle zu legen. Man benutzt die Rohwolle auch bei Kindern, die um die Windeln herum wund sind. Zuerst ölen, dann die Wolle drauf und fixieren. Rohwolle, oder auch Fettwolle oder Wundwolle bekommen Sie im Internet oder über ein Fachgeschäft.



Richtige Ernährung bei Hämorrhoiden
Ich leide unter Hämorrhoiden. Ich pflege sie mit Hametumsalbe und Hämorrhoisenzäpfli. Zudem nehme ich 3-mal nach den Mahlzeiten 1 Löffel eingeweichte Leinsamen gegen die Verstopfung und trinke 1,5 Liter Tee pro Tag. Kann ich Salbe und Zäpfli bedenkenlos über längere Zeit nehmen?
Hametumsalbe und die pflanzlichen Zäpfchen sind schon mal eine gute Basis für die Pflege und Schmerzlinderung von aussen. Beides eignet sich für die Langzeittherapie. Wenn Sie an Verstopfung leiden, ist es zudem sinnvoll, den Darm so zu pflegen, dass der Stuhl nicht zu stark herausgepresst werden muss. Da können Sie mit der Ernährung einiges machen. Vermeiden Sie zum Beispiel Brot/Kräcker/Knäckebrot am Abend, das trocknet den Darm aus. Besser ist gekochtes Getreide, Kartoffeln, Suppen, Gemüse und so weiter. Essen Sie zudem viele Ballaststoffe. Nüsse zum Beispiel, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und natürlich viel Gemüse. Wenn Sie Reis kochen, der ja kaum mehr Ballaststoffe enthält, könnten Sie in den letzten fünf Minuten eine Handvoll Rosinen und gehackte Nüsse begeben. Was ebenfalls super schmeckt sind geröstete Kürbiskernen oder Sonnenblumenkernen über dem Salat, zusammen mit ein paar Datteln. So können Sie diese Ballaststofflieferanten in die Hauptmahlzeiten integrieren.
Kennen Sie das Gerstengraspulver? Ich finde es ein geniales Nahrungsergänzungsmittel für den Darm. Zur Herstellung werden junge, frisch gekeimte Gerstenpflanzen getrocknet und pulverisiert. Sie enthalten zu diesem Zeitpunkt Unmengen von Mineralstoffen, Eiweissen, den grünen Pflanzenstoff Chlorophyll und andere wertvolle Substanzen. Gerstengras vermag im Darm vieles zu regulieren. Der Stuhl wird weicher und oft verschwinden auch Entzündungen. Man mischt jeweils morgens als Erstes und abends als Letztes je einen Teelöffel mit etwas Wasser. Achten Sie darauf, dass Sie unmittelbar davor und danach keinen Kaffee trinken und keine Milchprodukte essen, damit Sie sämtliche Inhaltstoffe gut aufnehmen können.
Noch kurz zu den Leinsamen: Bei Verstopfung nimmt man die geschroteten, oder im Mörser leicht gequetschten Leinsamen trocken ein, zusammen mit einem sehr grossen Glas Wasser. Auf diese Weise quellen die Samen im Darm und vergrössern dort das Volumen. Ich würde Ihnen empfehlen, dies morgens zu tun. Die Wirkung sollte 24 Stunden später einsetzen. Dreimal täglich ein Löffel Leinsamen erscheint mir eher etwas viel. Zusammen mit dem Gerstengras und einer Anpassung der Nahrung sollte ein Esslöffel morgens ausreichen.

Lagerungsschäden: Keine Chance auf Entschädigung?
Für alle Operationen ist eine spezifische Lagerung der Patientinnen und Patienten vorgeschrieben. Werden Patient*innen unter Narkose nicht korrekt gelagert, kann es insbesondere bei längeren OP-Zeiten zu Nervenschädigungen kommen. Grundsätzlich gehören solche Schädigungen zum Risiko einer Operation und werden als Komplikationen gewertet. Das bedeutet auch, dass sie in der Regel nicht haftpflichtrelevant sind. Aber ist das immer so?
Bei Frau Z. kam es bei einem operativen Eingriff zu einer Nervenschädigung am Arm, die sie im Alltag deutlich einschränkte: Sie musste über längere Zeit in ambulante Physiotherapie und benötigte mehrere Monate Hilfe im Haushalt. Dadurch entstanden ihr erhebliche Mehrkosten.
Nachdem Frau Z. ihr Anliegen an die Haftpflichtversicherung des Spitals gemeldet hatte, erhielt sie tatsächlich eine Entschädigung dafür.
Was können wir aus solchen Beispielen lernen? Zwar gehören mögliche Lagerungsschäden zum Risiko einer Operation. Das Operationsteam ist jedoch auch bei der Lagerung dafür verantwortlich, Schaden von den Patientinnen und Patienten abzuwenden. Kommt es durch mangelnde Sorgfalt zu Schäden, kann es sich lohnen, diese zu melden.
Chantal Agthe, Patientenberaterin SPO.
Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min. Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).

Mein Sohn hat eine Augenentzündung, die nicht heilen will und muss nun Kortisontropfen nehmen. Sie wirken für kurze Zeit, dann ist das Problem wieder da. Er trinkt oft Ingwershots. Kann das einen Einfluss haben? H. N., Tessin
Die Augen sind ein sehr heikles Thema. Ideal wäre es, wenn ihr Sohn mithilfe der Akupunktur die Energie und die Selbstheilungskräfte im Auge unterstützen könnte. Da wird er bestimmt ein Angebot finden. Ergänzend zum kortisonhaltigen Präparat könnte er natürliche Augentropfen auf der Basis von Homöopathie oder Anthroposophie verwenden, welche eher das Ziel haben, die Selbstheilungskräfte anzuregen. Das Eine schliesst das Andere nicht aus! Von Seiten der Nahrungsergänzungen wirken die Omega3-Fettsäuren entzündungshemmend und haben zudem einen starken Bezug zu den Augen. Ich würde sie in Form von Kapsel aus Fisch- oder Leinöl einnehmen. Auch mit dem Konsum von Nüssen und Kernen können wir den Omega-3-Fettsäure-Konsum erhöhen. Gleichzeitig lohnt es sich, das Schweinefleisch zu reduzieren, weil dieses die Entzündungen eher fördert. Es gibt auch Vitaminpräparate, die extra auf die Bedürfnisse des Auges eingestellt sind. Sie enthalten in der Regel Zink, Selen, Vitamin A und verschiedene Aminosäuren. Ingwer ist in der Tat nicht ideal bei entzündeten Augen. Am besten ersetzt er den Shot mit Aloe-vera-Saft. Dieser wirkt im Gegensatz zum Ingwer leicht kühlend und besänftigend. Zudem befeuchtet er den ganzen Körper, auch die Augen und regt mit seinen Bitterstoffen den ganzen Stoffwechsel an. Ein entzündetes Auge signalisiert zudem, dass dringend eine Pause nötig ist. Bildschirme aller quadratischen Geräte, die wir ständig nutzen, sind für unsere Augen leider sehr anstrengend. Ebenso künstliches Licht im blauen Bereich. Deshalb: Machen Sie immer mal wieder dicht. Legen Sie die Arbeit und die Sozialen Medien zur Seite, schliessen Sie die Augen und richten Sie den Blick nach innen. Das hilft uns, vom Visuellen zum Fühlen, Hören, Riechen und Schmecken zu wechseln. Es sind Sinneseindrücke, die genauso wichtig und wertvoll sind, wie das Sehen.
Ich leide unter den Folgen einer Gürtelrose im Gesicht. Trotz Schmerzklinik und Medikamenten sind die Nervenschmerzen immer noch da, zum Teil fast unerträglich. Was kann ICH dagegen noch tun?
H. R., Winterthur
F angen Sie an, mit Öl zu arbeiten. Am besten mit Johanniskrautöl. Es beruhigt sehr stark die Nerven. Am besten massieren Sie jeden Abend Gesicht und Nacken mit dem Öl ein. Das ist sehr wohltuend. Essen Sie möglichst oft warme und gekochte Mahlzeiten und versuchen Sie auch, warm zu trinken. Regelmässige, warme Mahlzeiten beruhigen das Nervenkostüm sehr effektvoll. Kennen Sie CBD-Hanf-Öl? Es hilft ebenfalls sehr gut bei Nervenschmerzen und wäre durchaus ein Versuch wert. Sie erhalten das Öl in vielen Drogerien und Apotheken. Wenn Sie so nicht weiterkommen, könnte Ihnen eine homöopathische Behandlung helfen. Aconitum ist zum Beispiel ein sehr gutes Nervenmittel, aber es gibt bestimmt noch andere. Soweit zum körperlichen Aspekt. Sie haben sich bereits sehr intensiv mit Ihrer Krankheit auseinandergesetzt. Nun ist es wichtig, dass Sie sich mit der Gesundheit verbinden wenn eine Krankheit nicht weggehen will, ist es häufig so, dass es nicht daran liegt, dass man das richtige Heilmittel noch nicht gefunden hat, sondern dass man am falschen Ort sucht. Jede Krankheit oder jedes Beschwerdebild ist dazu da, uns etwas zu zeigen. Solange wir die anstehenden Schritte noch nicht sehen und noch nicht aus dem Hamsterrad herausgesprungen sind, kann die Krankheit nicht weggehen weil sie uns an etwas erinnern möchte. Nehmen Sie sich SEHR viel Zeit für sich selber. In der hektischen Alltagswelt kann man den Ruf des Herzens manchmal nur schlecht hören. Gönnen Sie sich viel Ruhe zum Innehalten und zum inneren Erforschen, welche Wünsche/Träume/Ziele Sie in ihrem dritten Lebensabschnitt verfolgen möchten. Das können auch innere, spirituelle Themen sein, da ja das Alter die Zeit der Weisheit ist. Und holen Sie sich wenn nötig Hilfe in einem Coaching oder ähnlichem.
Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. s.hurni@weberverlag.ch

Zeit, den Stein im Bauch abzuwerfen
Der anspruchsvolle Alltag und schnelle, oft kalte Mahlzeiten zwischendurch fordern die Verdauung, insbesondere im Magen. Dies zeigt sich durch ein Gefühl von Kälte, das als Stein im Bauch empfunden wird. Nutze das alte Wissen der Tibeter um das Gleichgewicht zwischen warm und kalt, Aktivität und Ruhe für ein aus

Isst du etwas Kaltes, trink etwas Warmes oder iss eine Suppe dazu. Bist du gehetzt, nimm dir Zeit zum Essen und Kauen. Aus Sicht der Tibetischen Konstitutionslehre verleihen auch viele Gewürze einer kalten oder deftigen Mahlzeit balancierende Wärme. Dein Gewürzregal passt nicht in die Tasche? Fertige Tibetische Kräuterkompositionen in kontrollierter Qualität als Kapseln sind praktisch zum Mitnehmen. PADMA DIGESTIN plus mit Granatapfel, Kardamom, Cassia-Zimt, langem Pfeffer, kleinem Galgant und Calcium ist ideal zur Ergänzung, wenn die Küche kalt bleibt. Calcium unterstützt die normale Funktion der Verdauungsenzyme.





«Ankommen, ausatmen, abschalten –ein Aufenthalt, der gut tut»
Eingebettet in eine grosse Parklandschaft und umgeben von zwei Naturschutzgebieten bietet das Deltapark Vitalresort den idealen Ort für Entspannung und tiefe Erholung. Für einen gesunden Schlaf und einen vitalen Start in den Tag sorgen high performance Schlafanzüge, ein Kissen- und Duvetprogramm sowie das einmalige Bettensystem. Wohltuende Behandlungen und sanfte Aktivitäten runden das Angebot ab.
In unseren neuen Packages lassen wir Sie in 3-4 Tagen wesentliche Elemente der Schlafqualität live erleben.
Entdecken Sie mit uns den positiven Effekt von entspannungsfördernden Treatments und Ritualen. Während Ihrem Aufenthalt steht Ihnen zudem unser Vital-Coach mit wertvollen Tippsund Ticks für bessere Entspannung und Regeneration zur Seite.
Buchbar ab Juni 2022 deltapark.ch/betteryoursleep

Eine Beziehung zu führen, ist wie einen gemeinsamen Tempel aufzubauen – einen Tempel der Liebe. Das ist ein völlig anderes Konzept als jede Beziehung unter Hollywood-Bedingungen. Denn dort sind wir wie Konsumbabies: Alles muss perfekt sein, sonst ist es nichts wert. Und wenn der Partner nichts wert ist, wird er halt umgetauscht auf dem großen Markt, es gilt die Devise: «Beim nächsten Mann wird alles anders.»
I n Konsum-Mentalität trennen sich Paare viel zu früh. Sie haben eine Weile über all die auftauchenden, kleinen, störenden Details hinweg geschaut. Erst als sie sich zu einem riesigen Müllhaufen auftürmten, als sie nicht mehr anders konnten, bequemten sie sich, hinzuschauen – und dann war es oft zu spät. Sie hatten vergessen, dass Beziehung kein vollautomatischer, rosaroter Traum ist, sondern Arbeit. Liebesarbeit. Diese Arbeit besteht aus hinschauen, hineinfühlen, verstehen, erkennen, ansprechen, annehmen, verzeihen, fühlen, reden, reden, reden, sich ändern, versöhnen – für die Liebe.
Ein Paar, welches diese Arbeit leistet, baut damit einen Tempel auf. Stein für Stein, Moment für Moment. Ihren Tempel der Liebe, errungen durch jeden Schritt aufeinander zu, durch geteilte Werte, durch jeden Moment echten Interesses am Wohlergehen des anderen, durch jede gemeinsam vergossene Träne, jedes Stück geteilter Anteilnahme für die Welt und jeden Blick, den sie dem Partner in die eigene Seele gewähren.
Damit dieser Tempel bleibt, gilt es, ihn zu schützen, zu erweitern und immer schöner zu machen. Nicht, indem wir andere ausschliessen – denn bekanntermassen wird Liebe mehr und nicht weniger, wenn wir sie teilen. Sondern schützen vor Alltäglichkeit, Unachtsamkeit, falschen Gewohnheiten, mangelnder Selbstliebe, falschen Gedanken – und manchmal auch vor uns selbst.
So schmerzhaft es ist, das zu erkennen: Aber auch der wunderbarste Mensch kann sich trotz aller Schwüre gegen den Liebestempel wenden, den er selbst mit auf-
gebaut hat. Er – oder sie – kann ihn verlassen, ihm entgegenhandeln, ihn leugnen, ja sogar verraten. Das sind die Momente, wo wir unseren Geliebten – im Namen der Liebe – eine Grenze setzen müssen. Wo wir aus Liebe nein sagen müssen. So wie ich mir wünsche, dass mein Geliebter mir ein Nein setzt, wenn ich aus einem alten Schmerz, aus Bequemlichkeit, Eitelkeit oder einer traumatischen Erfahrung heraus unsere Liebe verrate. Da brauchen wir einander, in aller Klarheit und Deutlichkeit.
I m äussersten Fall kann das auch Trennung bedeuten. Sich aus Liebe zu trennen, ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die es gibt. Aber alles in Kauf zu nehmen, was der Geliebte in einer Phase von Selbsthass mir, sich selbst und unserem Tempel antut – das würde den Tempel zerstören. Wir würden vielleicht zusammenbleiben, aber ohne Liebe, ohne Werte, ohne Tempel. Uns in Liebe zu trennen, zerstört den Tempel nicht. Es bewahrt ihn.
Trennung bedeutet nicht Rache. Es bedeutet nicht das Ende meiner Liebe. Natürlich kann ich auch weiterhin für ihn da sein und ihm als guter Freund zur Seite stehen, wenn das sinnvoll ist. Echte Treue bedeutet, den Tempel zu schützen. Dann bleibt er stehen mit all seiner Schönheit und Würde. Und falls sich der Geliebte eines Tages besinnt und den Weg zurückfindet, dann wird der Tempel immer noch da sein. •

Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin. Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen, lebte u. a. über 18 Jahren in Tamera, Portugal, sowie anderen Gemeinschaften auch in anderen Kontinenten. Am meisten liebt sie das Thema Heilung von Liebe und Sexualität sowie neue Wege für das Mann- und Frau-Sein.
Er ist still und versteckt sich meist hinter dicken Mauern. Der sagenumwobene Klostergarten birgt die Geheimnisse einer Pflanzenwelt, deren Heilkräuter schon vor der Christianisierung Tradition hatten. Wild wuchs im Klostergarten kaum ein Kraut: Schon im Frühmittelalter hatte im «hortulus» alles seine Ordnung.
Text: Erna Jonsdottir
Friedvolle Nonnen, die in ihrem idyllischen Garten Unkraut jäten, rote Äpfel und Feigen, die von den Bäumen hängen und bunte Schmetterlinge, die von einer Blume zur anderen tanzen. Dazu ein warmer Wind, der die Ziersträucher streichelt und das Summen der Bienen, die vom süssen Nektar der Rosen und des Salbeis angelockt werden: Diese Schilderung eines Klostergartens ist beinah paradiesisch. Und das war kein Zufall.
Tatsächlich wollten Nonnen und Mönche mit ihren Klostergärten den biblischen Garten Eden aus dem Buch Genesis auf die Erde holen. Eine noch wichtigere Rolle spielte die wirtschaftliche Unabhängigkeit. So heisst es im Klosterregularium des Benediktiner-Ordens aus dem frühen Mittelalter (540), das Kloster solle so angelegt werden, dass sich alles Nötige wie Wasser, Mühle und Garten innerhalb des Klosters befinde. Diese Unabhängigkeit erreichten die Mönche gemäss Ulrich Willdering, Professor für Botanik, mit Hilfe von Laienbrüdern und Feldarbeitern nicht nur innerhalb, sondern auch ausserhalb der Klostermauern, womit sie ihr Wissen über Kulturpflanzen, Anbaumethoden und Gartenanlagen an die Allgemeinheit weitergaben.
Strabo und sein «hortulus»
Mit der frühmittelalterlichen Realität schwindet das Bild des wildromantischen Klostergartens: Wie der St. Galler Klosterplan aus dem 9. Jahrhundert zeigt, unterlag dieser gewissen Vorschriften. Nach der Benediktsregel, oder «Regula Benedicti», sollte ein Musterkloster über einen Kreuz-, einen Heilkräuter- und Gemüsegarten sowie über einen Obstbaumgarten (gleichzeitig Friedhof) verfügen. Abgesehen vom Kreuzgarten sollten alle nach bestimmten Anbaumethoden bepflanzt werden.
Das Pflanzenbild prägte Walahfrid Strabo, Abt des Klosters Reichenau, nicht nur in St. Gallen. Das um 840 in Versen verfasste Lehrgedicht «De cultura hortorum», kurz «hortulus» (Gärtlein), oder «Über die Gartenpflege», beschreibt 24

Der Mensch, der Gutes wirkt, gleicht einem Obstgarten, der von den Früchten guter Werke voll ist.
Hildegard von Bingen (1098–1179)

Heilkräuter, Küchen- und Zierpflanzen (siehe Box) und gilt als älteste Abhandlung über den Gartenbau. Die von Strabo beschriebene Anordnung der Pflanzen dient noch heute als Vorlage für mittelalterliche Heilkräutergärten.
Ganzheitlicher Ansatz in der Klostermedizin
Der zweite Namen, mit dem wir das Thema Klostergarten verbinden, ist «Hildegard von Bingen». Die Benediktinerin und Äbtissin (1098–1179), die oft als erste deutsche Ärztin, Naturwissenschaftlerin und Apothekerin beschrieben wird, hinterliess mit ihren Schriften ein verlässliches Bild hochmittelalterlicher Klostergärten. Weil sie den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele sah, legte sie den Grundstein für die ganzheitliche Medizin. Eine gesunde Ernährung nahm dabei eine wichtige Rolle ein.


In ihrem Werk «Physica» hinterliess sie fast 2000 Rezepte, die der österreichische Arzt Gottfreid Hertzka (1913–1997) aufarbeitete. Er ist Begründer der sogenannten Hildegard-Medizin und war überzeugt, dass ihre Ernährungslehre zusammen mit der «rechten Lebensweise» das einzig richtige ist, um Krankheiten zu verhindern und zu heilen. Tatsächlich decken Hildegards Empfehlungen fast alle Krankheiten ab, die wir unter dem Betriff Zivilisationskrankheiten zusammenfassen: Diabetes mellitus, Übergewicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Allergien lassen sich auf einen modernen Lebensstil sowie auf Ernährungsfehler zurückführen.
Göttliche Eingebungen
Das wichtigste Lebensmittel der «Hildegard-Medizin» ist der Dinkel. Sein positiver Einfluss auf die Gesundheit ist heute unumstritten; genauso wie ihrer empfohlenen Gemüse Fenchel, Karotten oder Sellerie und Gewürze wie Quendel, Galgant, Minze oder Zimt. Viele ihrer beschrieben Pflanzen werden noch heute in der Naturheilkunde und Homöopathie eingesetzt. Dazu gehören Gewürznelken, Hirschzungenfarn, Schafgarbe und Ingwer oder bitterstoffhaltige Heilpflanzen wie Andorn, Salbei, Mariendistel, Tausendgüldenkraut und Wermut. Bitterstoffen schrieb Hildegard wegen ihrer positiven Eigenschaften auf die Gesundheit der Leber und des Magen-Darms grosse Bedeutung zu.
Wie Hildegard zu ihren Lebzeiten betonte, schrieb sie nur nieder was sie in ihren Visionen sah und selbst die Dinge nicht kannte – ein intelligenter Schachzug einer kräterkundigen Frau im Mittelalter. Zweifellos hinterliess sie uns mit ihren medizinischen Werken «Physica» und «Causae et cu-
Kräuterhexen und Schaman*innen waren des Teufels
Die Volksmedizin war mit der Christianisierung in Verruf geraten. Damals gehörten heidnische Heilpriester*innen und Schaman*innen zu den grössten Rivalen der Missionar*innen. «Sie waren des Teufels, genau wie ihre Kräuter und Heilung», schreibt der bekannte Ethnobotaniker WolfDieter Storl. Weil das Volk trotzdem zu den Kräuterhexen lief, «konnte die Kirche nicht anders, als die Kräuter wieder zuzulassen». Allerdings erhielten nur die Pflanzen der Bibel und diejenigen aus den Ländern, in denen die Apostel gewirkt hatten, einen Platz im Hortulus der Klöster. Viele Heilkräuter aus der Volksmedizin erhielten dabei einen biblischen Namen. So wurde das «Hartheu», die «Teufelsflucht» oder der «Jagdteufel» in «Johanniskraut» umgetauft. Gut, dass es heute keine göttlichen Eingebungen mehr braucht, um dem Scheiterhaufen zu entkommen – auch wenn eine gewisse Kluft zwischen den «Göttern in Weiss», der Pharmaindustrie und den Kräuterkundigen geblieben ist.

Mit Beginn des Frühjahrs sollte man in die Natur hinausgehen und mit dem Sammeln von Kräutern beginnen.
Maria Treben (1909–1991)







Heilkräuter aus dem Garten Gottes
Die Auswirkungen dieser Kluft zu spüren bekam Maria Treben (1909-1991); eine gläubige Hausfrau, die sich besonders gut mit Kräutern auskannte und als Pionierin in der Kräuterheilkunde gilt: Nachdem der Dorfpfarrer sie dazu motivierte hatte, ihre Kräutererfahrungen für das örtliche Kirchenblatt aufzuschreiben, wurde daraus zuerst eine Broschüre und später – mit über acht Millionen verkauften Exemplaren – ein Beststeller. Die «Gottesapothekerin» war umstritten, und wurde aus den Kreisen der Ärzteschaft und der pharmazeutischen Industrie «regelmässig scharf, und nicht immer fair, angegriffen», wie sie in ihrem Vorwort «Heilkräuter aus dem Garten Gottes» schreibt. Von der Arnika über die Goldrute bis hin zum Zinnkraut – über 30 einheimische Heilpflanzen beschreibt Maria Treben in ihrem Nachschlagewerk, das nebst Pflanzenporträts hilfreiche Kräuterrezepte enthält. Damit können sich moderne Kräuterhexen an eine RingelblumenSalbe wagen (bei offenen Wunden), einen Bärlauch-Wein kochen (bei Atembeschwerden und Atemnot) oder ein Schwedenbitter (siehe Rezept) herstellen. Dieses bezeichnete sie als «wahres Lebenselixier» – genauso hatte es Hildegard von Bingen mit ihren Bittertropfen.
Übrigens haben die beiden Frauen noch mehr gemeinsam: Während Hildegard an einer chronischen Krankheit litt, wäre Treben ohne das Schöllkraut und das Schwedenbitter wohl an Typhus verstorben. Es muss dank ihrer Lebensweisen und dank der Kräuter gewesen sein, dass beide ein hohes Alter erreichten. •
Buchtipps:
• Kräuterkunde – Das Standardwerk, Wolf-Dieter Storl, Aurum
• Heilkräuter aus dem Garten Gottes – Guter Rat aus meiner Kräuterbibel für Gesundheit und Wohlbefinden, Maria Treben, Ennsthaler Verlag, Steyr
Maria Treben: «Kleiner Schwedenbitter»
Gegen Schmerzen und Erkrankungen jeglicher Art als Vorsorgemassnahme morgens und abends einen kleinen Teelöffel mit etwas Wasser verdünnt einnehmen.
Kräutermischung
10 g Aloe, ersatzweise Enzianwurzel oder Wermutpulver, 10 g Angelikawurzel, 5 g Eberwurzwurzel, 10 g Manna, 5 g Myrrhe, 10 g Natur-Kampfer, 10 g Rhabarberwurzel, 0,2 g Safran, 10 g Sennesblätter, 10 g Theriak Venezian, 10 g Zitwerwurzel.
Kräuter in eine Flasche füllen und mit 1,5 Liter 38- bis 40%igem Kornbranntwein übergiessen. Unter täglichem Schütteln mindestens 14 Tage in der Wärme stehen lassen.
Mit fortschreitender Lagerung reift die Heilkraft des Kleinen Schwedenbitters an.
Quelle
Heilkräuter aus dem Garten Gottes, Ennsthaler Verlag
Die Strabo-Pflanzen
Das sind die 24 von Walahfrid Strabo in seinem «hortulus» beschriebenen Pflanzen. Diese werden noch heute in der Heilkunde, in der Küche und als Zierpflanzen verwendet.
• Salbei
• Weinraute
• Eberraute
• Flaschenkürbis
• Melone
• Schlafmohn
• Muskatellersalbei
• Frauenminze
• Minze
• Poleiminze

• Das Heilwissen der Hildegard von Bingen – Naturheilmittel, Ernährung & Edelsteine, Günther H. Heepen, Gräfe und Unzer Verlag GmbH
• Wermut
• Andorn
• Fenchel
• Schwertlilie
• Liebstöckel
• Kerbel
• Lilie



• Sellerie


Harninkontinenz, besser bekannt als Blasenschwäche, bezeichnet den ungewollten Abgang von Urin. Im Laufe des Lebens trifft es rund jede dritte Frau. Und auch Männer sind betroffen. Trotzdem ist das Leid nach wie vor mit Scham behaftet. Wir brechen mit dem Tabu, reden darüber und erfahren: Meist ist eine Heilung oder zumindest deutliche Besserung möglich.
Text: Andreas Krebs
Vielleicht trifft es einem so hart, weil es uns an unsere Vergänglichkeit erinnert. Wenn es unwillkürlich tropft oder wir uns gar wieder einnässen wie ein Baby, dann ist das unangenehm. Aber in der Regel kein Drama. Es gibt Hilfsmittel wie Einlagen; und die Aussicht auf Heilung oder zumindest starke Besserung. Man ist mit dem Problem auch nicht alleine: Schätzungsweise 500 000 Menschen in der Schweiz leiden an einer Form der Harninkontinenz, dem unwillkürlichen Verlust von Urin. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl der Betroffenen; Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer. Die Hauptursache einer Harninkontinenz bei Männern ist eine operative Entfernung der Prostata (Prostatektomie). Neben Alten leiden Schwangere und Übergewichtige besonders häufig an Harninkontinenz.
«Der unkontrollierte Abgang von Harn muss nichts mit der Blase zu tun haben», erklärt Apotheker Simon Trösch. «Es gibt viele möglichen Ursachen.» Oft liege dem Problem eine schwache Beckenbodenmuskulatur zugrunde. Auch eine Bindegewebeschwäche oder die hormonelle Umstellung in den Wechseljahren – insbesondere ein Mangel an Östrogen – könne zur Harninkontinenz führen respektive diese verschlimmern; ebenso starkes Übergewicht, Nervenstörungen, eine vergrösserte Prostata, eine Blasenentzündung oder eine hyperaktive Blase («Reizblase»). Bei letzterer haben Betroffene ständig das Gefühl, aufs WC zu müssen, obwohl die Blase nicht voll ist. Sehr selten sind Grunderkrankungen wie z. B. Tumore, Multiple Sklerose oder Verletzungen der Rückenmarksnerven verantwortlich für eine Harninkontinenz. «Es ist wichtig, zunächst die Ursache zu ergründen», betont Trösch. Denn je nach Anamnese fällt die Behandlung unterschiedlich aus.
Unterschiedliche Formen der Inkontinenz
Die gute Nachricht: «Eine Harninkontinenz ist in den meisten Fällen heilbar beziehungsweise deutlich verbesserbar», weiss Trösch. «Die Behandlung muss individuell angepasst werden – an die Ursache, die Art und das Ausmass der Beschwerden sowie an die Lebenssituation der
«Der
unkontrollierte Abgang von Harn muss nichts mit der Blase zu tun haben.»
Betroffenen.» Liegt der Inkontinenz zum Beispiel eine Blasenentzündung zugrunde, muss natürlich diese ursächlich behandelt werden.
Gemäss der International Continence Society (ICS) unterscheidet man fünf Formen der Harninkontinenz:
• Dranginkontinenz: Der Harnverlust tritt durch einen starken, nicht zu unterdrückenden Harndrang auf. Ursachen: Alter, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, Schlaganfall, Blasensteine und -entzündung, psychosomatische Faktoren. Symptome: plötzlicher, starker Harndrang; unfreiwillige Blasenentleerung.
• Stress- oder Belastungsinkontinenz: Harnverlust bei körperlicher Anstrengung. Ursachen: schwacher Beckenboden; operative Entfernung der Prostata. Symptome: unkontrollierter Harnverlust beim Tragen schwerer Lasten, Treppensteigen sowie beim Husten, Niesen oder Lachen.
• Unbewusste Inkontinenz: Harnverlust der nicht wahrgenommen wird und auch nicht mit Harndrang einhergeht.
• Post-miktionelles Tröpfeln: Nachtröpfeln von Urin nach der willentlichen Blasenentleerung.
• Kontinuierlicher Harnverlust: Ständiger Verlust von Urin.
Weiter gibt es Mischformen. Am häufigsten ist die Belastungsinkontinenz. Ursache ist oft eine ungenügende Funktion des Schliessmuskels der Harnröhre infolge einer Schwächung der

Beckenbodenmuskulatur und/oder eine Schädigung des Bandhalteapparats, der unter anderem für den korrekten Verschluss der Harnröhre zuständig ist. Ausgelöst wird diese Form z. B. durch die starke Dehnung der Beckenbodenmuskulatur bzw. des Bindegewebes während einer Schwangerschaft und Geburt. Bei rund jeder zweiten Frau kann dies zu einer Belastungsinkontinenz führen. In der Regel bessert sich der Zustand nach der Geburt. Rückbildungsgymnastik hilft dabei. «Wir haben fast keine jungen Mütter bei uns in der Beratung», sagt Trösch. Weitere Ursachen für eine Belastungsinkontinenz sind schwere körperliche Arbeit, starkes Übergewicht und chronische Bronchitis bei Raucher*innen.
Prävention und Behandlungsmöglichkeiten
Ein gesunder Lebensstil mit einem gesunden Körpergewicht sowie viel Bewegung, Sport wie Velofahren, Walken oder Schwimmen und Beckenbodentraining sind eine gute Prävention. Beckenbodenübungen kann man ganz leicht in den Alltag integrieren, so Trösch: «Spannen Sie einfach mehrmals am Tag den Muskel an, der Urin zurückhält. Wichtig ist, dass das Beckenbodentraining konsequent und über eine längere Zeit durchgeführt wird, bis sich eine Wirkung zeigt.»
Betroffene sollten Lebensmittel meiden, die die Blase reizen: Alkohol, Koffein und Zitrusfrüchte zum Beispiel. Gegen Abend kann man die Trinkmenge zwar reduzieren; allgemein sei es aber wichtig, über den Tag verteilt genug zu trinken, betont Trösch. «Denn wenn man wenig trinkt, wird der Urin konzentrierter und wirkt aggressiver auf die Blase. Etwa zwei bis maximal drei Liter am Tag sollte man deshalb schon trinken, abhängig natürlich auch von der körperlichen Tätigkeit.» Ideal sind stilles Wasser und harntreibende Tees aus Brennnessel oder Goldrute; letztere hilft, wie Petersilie, bei Blasenentzündung und -schwäche. Zu den wichtigsten
Der Beckenboden
Die etwa zwei bis drei Zentimeter dicke Muskelplatte, die den Bauchraum und die Organe, die sich im Becken befinden (Blase, Gebärmutter und Enddarm), von unten abschliesst, wird als Beckenboden bezeichnet. Er bildet die untere Begrenzung zwischen Schambein, Steissbein und den beiden Sitzbeinhöckern und besteht aus Muskeln, Bindegewebe, Sehnen und Nerven. Die Muskeln und Bänder des Beckenbodens halten die Beckenorgane in Position und stützen den Blasenschliessmuskel. Ein geschwächter Beckenboden fördert die Blasenschwäche.
Werden die Muskeln und das Bindegewebe geschwächt, können sie die inneren Organe nicht mehr an ihrem Platz halten und es kommt zu Senkungszuständen. Es können eine Genitalsenkung oder auch eine Harninkontinenz entstehen.
gefragt:
Simon Trösch

Herr Trösch, dass ab und zu mal ein paar Tröpfchen daneben gehen, ist noch kein Grund zur Sorge. Wann wird es Zeit für eine Inkontinenzberatung?
Die Harninkontinenz ist immer noch ein grosses Tabuthema. Deshalb gibt es wohl eine hohe Dunkelziffer. Dabei geht es vielen gleich. Man muss sich nicht schämen. Für Betroffene ist das Leid eine grosse Belastung. Deshalb sollten sie das Problem nicht anstehen lassen, sondern frühzeitig Hilfe holen. Je früher desto besser. Mit unserem niederschwelligen Angebot gehen wir auf das Problem ein und zeigen Möglichkeiten auf, die Inkontinenz in den Griff zu bekommen.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Wir empfehlen Einlagen und geben Muster mit. Sie lindern zwar nicht die Symptome, können Betroffenen aber helfen, Lebensqualität zurückzugewinnen. Weiter muss abgeklärt werden, um was für eine Form von Inkontinenz es sich handelt. Je nach Ursache gibt es dann verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Bei der häufigsten Form, der Stress- oder Belastungsinkontinenz, ist z. B. Beckenbodentraining sehr effizient. Es gibt einfache, sehr wirkungsvolle Übungen, die man zuhause machen kann, um die Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Viele kennen solche Übungen vom Yoga, Pilates oder von der Physiotherapie, etwa Übungen, um die Hüften zu stärken. Auch eine Art Liebeskugeln sind eine Möglichkeit, den Beckenboden zu aktivieren.
Dabei muss man nicht einmal aktiv etwas dafür tun. Beckenbodentraining lässt sich also quasi nebenbei erledigen.
Braucht es eine professionelle Anleitung für das Beckenbodentraining?
Nicht unbedingt; man muss aber schon eine Ahnung haben. Es gibt gute Websites oder auch YouTube-Videos. Wer unsicher ist, sollte sich aber professionell beraten lassen. Das kann auch im Rahmen der Physio sein, die man sowieso schon macht. Wichtig dabei ist vor allem die Regelmässigkeit. Optimal wäre dreimal pro Woche 30 Minuten Training mit Übungen zur Stärkung des Rumpfs, der Hüfte, der Oberschenkelmuskulatur und eben auch des Beckenbodens. Ihn kann man sehr effizient trainieren.
Und wann sollte man einen Arzt aufsuchen?
Wenn auf einmal grössere Mengen Urin abrupt abgehen. Denn dann kann eine physische Schädigung vorliegen, die man operativ behandeln muss.
Zur Person
Simon Trösch ist eidg. dipl. Apotheker ETH und Geschäftsführer der Waldegg Rotpunkt Apotheke in Uitikon Waldegg (ZH). Bei der diskreten Inkontinenzberatung informiert er Betroffene über das Problem und erläutert Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsmittel.
«Eine Harninkontinenz ist in den meisten Fällen heilbar beziehungsweise deutlich verbesserbar.»
Heilpflanzen bei Harnwegsinfekten gehören Bärentraubenlätter. Die Kieselsäure aus dem Schachtelhalm wiederum stärkt das Bindegewebe und schützt ebenfalls vor Infektionen der Harnwege. Hopfen wirkt antibakteriell und beruhigt die Reizblase. Auch Löwenzahn kann bei Reizblase helfen, ebenso bei einer Blasenentzündung. Ein bekanntes Hausmittel bei Reizblase, Prostatabeschwerden und Blasenschwäche sind Kürbiskerne. Besonders Männer sollten regelmässig welche knabbern.
Eine weitere Möglichkeit, einer Harninkontinenz entgegen zu wirken ist das Blasen- oder Toilettentraining. Dabei werden bestimmte Trinkmengen und feste Toilettenzeiten festgelegt, über die die Betroffenen Buch führen. Sie versuchen, dem ersten Harndrang nicht nachzugeben und damit die Dauer bis zum Wasserlassen immer weiter hinauszuzögern.
Mit diesen Hilfsmitteln verschwinden die Beschwerden nach einer gewissen Zeit. Und wenn nicht? Dann können Medikamente oder eine Operation helfen. Bei einer mässigen Inkontinenz wird dabei die Harnröhre mit einem Kunststoffband angehoben. Bei einer starken Inkontinenz legt der Chirurg einen künstlichen Schliessmuskel um die Harnröhre. Über einen Knopf im Hodensack (Skrotum) kann der Mann die Manschette steuern und so den Urin abfliessen lassen. Bei Frauen werden operativ meist die anatomischen Verhältnisse korrigiert. Das geschieht meist durch Raffung, Anhebung und Stabilisation der bindegewebigen Haltestrukturen. Eine Operation sollte aber erst in Erwägung gezogen werden, wenn alle anderen Therapiemöglichkeiten keinen Erfolg gebracht haben. •
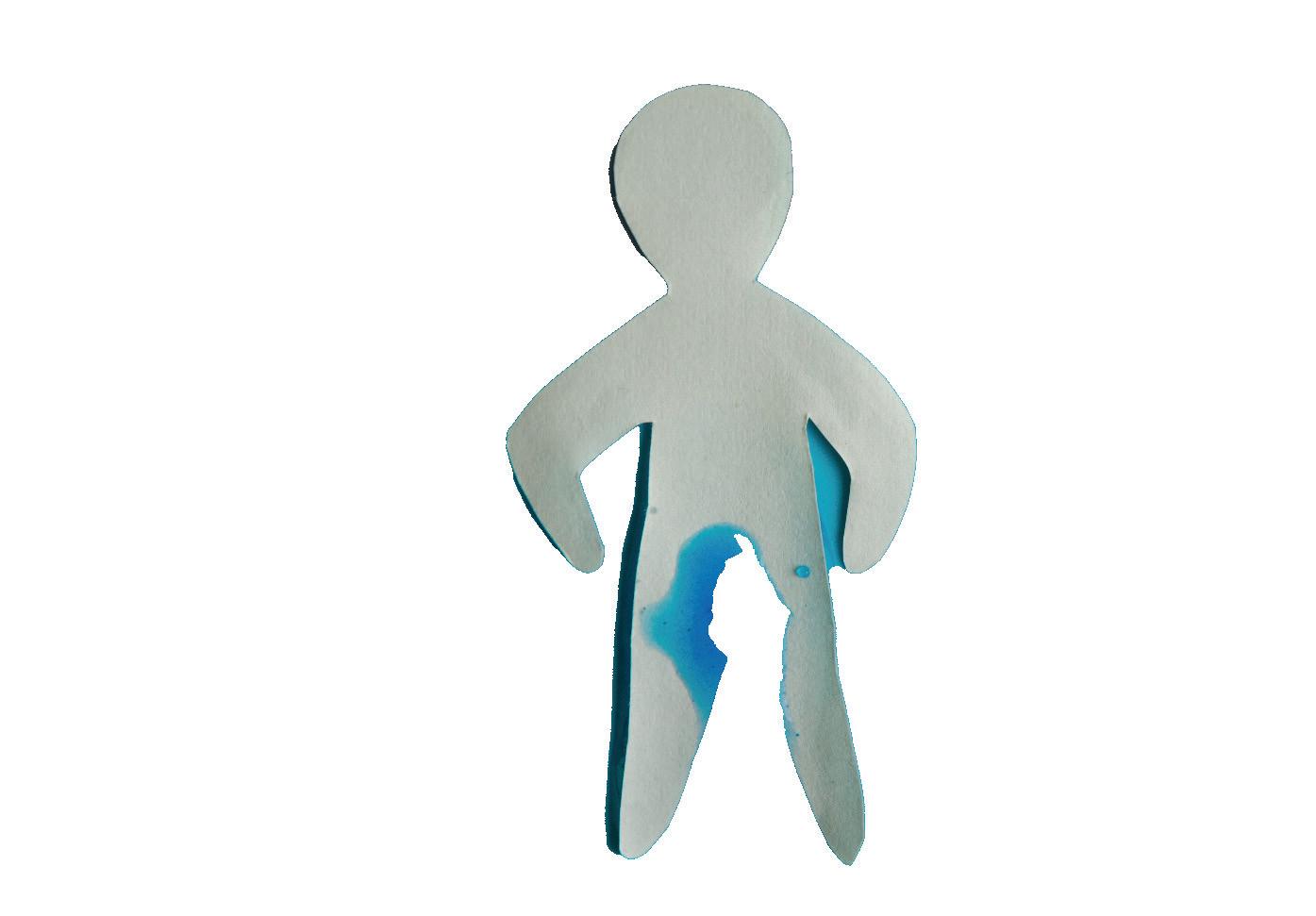


ERFAHRE MEHR: HAENSELER.CH
Hänseler Angelica mit Engelwurz und Magnesium trägt zu einer normalen Funktion der Muskeln und des Nervensystems bei.


Der stumpfblättrige Ampfer ist eine wahre Plage. Wo er wächst, ist er fast nicht mehr wegzukriegen. Der Ampfer ist gleichzeitig ein wichtiger Bodenreiniger. Erst wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, kann er sich zurückziehen.
Text: Steven Wolf
Die Natur erwacht. Es wird lebendiger, wärmer und bunter um uns herum. Das Vogelgezwitscher, das frische Grün und die summenden Insekten wecken Frühlingsgefühle in mir und die Schmetterlinge in meinem Bauch beginnen zu tanzen. Das Jahresrad dreht sich Richtung Walpurgirsnacht (Beltane), die in der Nacht auf den 1. Mai gefeiert wird. In dieser Nacht wird im Jahreskreis der Natur das winterliche Bärenfell abgestreift. Die zeugungsfähige Sonne vermählt sich mit der jungen Mutter Erde. Sie kleiden sich feierlich in ein zartes Frühlingsgrün, schmücken ihr Haar mit den prachtvollen Blüten der Frühblüher und bereiten sich vor auf den Maientanz.
Im April, in den Wochen vor der Walpurgisnacht, steigert sich die natürliche Symphonie, bis sie am Ende des Monats zu einem Orchester anschwillt, dessen Klang erfüllt ist von lieblicher Verschmelzung, Funken sprühendem Vermählungsfeuer und der Wiedervereinigung von Sonne und Erde. Aus der einst zarten Kerzenflamme, welche in den ersten Wochen des Jahres leuchtete, hat sich ein immer stärker werdendes Lebensfeuer entwickelt. Dieses bildet die Grundlage für das Wachstum der Natur.
Pionier unter den Pflanzen
Eine wunderbare, wenn auch ziemlich ungeliebte Pflanze, gibt uns im Frühling Schwung und Lebenskraft: Der stumpfblättrige Ampfer, vielerorts auch bekannt als Blacke. Er keimt als eine der ersten Wildpflanzen, wenn die kräftigen Sonnenstrahlen die Erde zu wärmen beginnen. Wir finden ihn an Wegrändern, auf Wiesen, Weiden, Schuttplätzen, unbewirtschafteten Flächen und Feuchtzonen. Oft teilt sich die Blacke ihre Standorte mit nah verwandten Pflanzen wie dem Krause- oder dem Sauerampfer. Die Blacke gehört wohl zu den am meisten gehassten Pflanzen. Sie liebt die, mit Stickstoff und Phosphor überdüngten, nährstoffreichen und verdichteten Ton- und Lehmböden. Auf Schnittwiesen und Weiden ist sie ein Zeichen für Überdüngung und Störherde. Die Besiedelung erfolgt rasant und in grosser Zahl. Daher verdrängt sie viele andere Arten

Das Vogelgezwitscher, das frische Grün und die summenden Insekten wecken Frühlingsgefühle in mir und die Schmetterlinge in meinem Bauch beginnen zu tanzen.

und gilt als Nährstoffkonkurrent für Futterpflanzen. Blacken sind mehrjährig und äusserst hart im Nehmen. Die Pfahlwurzeln reichen bis zu zwei Meter tief ins Erdreich. Selbst aus kleinen Wurzelstücken, die nach dem Ausstechen in der Erde verbleiben, bilden sich neue Blacken. Ältere Exemplare produzieren bis zu 6000 hoch keimfähige Samen. Diese sind bereits nach wenigen Wochen keimfähig und überleben im Erdreich 40 bis 50 Jahre lang.
Allem Wuchern zum Trotz hat der Stumpfblättrige Ampfer auch sein Gutes. Dank den grossen und starken Pfahlwurzeln lockern die Ampfern verdichtete Böden und reichern sie wieder mit Luft an. Auf diese Weise regulieren sie den hohen Stickstoffgehalt im Boden und geben Arten eine Lebensbasis, die magere Böden benötigen. Zusammen mit ihrem Blätterwerk vermag die Blacke die Erde zu reinigen, indem sie dem Boden Dünger entzieht. So verrichtet sie eine wichtige Aufgabe in der Regulation des Erdmilieus. Und das ausgesprochen hartnäckig: Sie wird so lange in grosser Anzahl vorhanden sein, bis ihre Aufgabe erfüllt ist.

Wenn ich mir Zeit nehme, mich niederlasse und lausche, welche Informationen die Energie der Blacke mit sich trägt, so vernehme ich ein grosses Seufzen: «Schon zu lange werde ich verachtet, verflucht, ausgestochen, vergiftet und verbrannt. Doch egal was mir geschieht, ich bleibe standhaft. Ich bin mir meiner Aufgabe auf Erden bewusst, erkenne meinen Sinn. Ich bin die nicht enden wollende Widerstandsfähigkeit, ich bin die Kraft des keimenden Mutes und des Lebenswillens. Mal stürmisch, mal leise. Bring dich mit ein und wisse du bist nicht allein. Hör auf, dich zu verstecken und entdecke deine wahre Grösse wieder. Nichts und niemand soll dich daran hindern, in die Freiheit zu gehen. Wirst du oder fühlst du dich eingeengt, blockiert, deiner Freiheit, der Lebenskraft und deiner Träume beraubt? Dann verbinde dich mit mir und ich bringe deine geschwächte Lebenskraft von Neuem ins Fliessen. Ich entspanne, löse, öffne, dünne aus und erhöhe deine körperliche wie auch deine geistige Flexibilität. Meinst du nicht, dass es Zeit ist, umzudenken? Erkenne in dir deine alten Verhaltensmuster der Abgrenzung und deine Gefühle von Niedergeschlagenheit, von Macht- und Auswegslosigkeit. Verzweifle nicht, hab Vertrauen. Alles kann beginnen, wenn die Ängste schwinden».
Symbolik der Pflanze
In den, am Grund herzförmigen, stumpfen Blättern, die wie Lanzenspitzen wirken erkenne ich die Tugenden der unbesiegbaren Krieger:innen. Deshalb verwende ich die Heilpflanze bei dumpfen stechenden oder brennenden Schmerzen. Immer dann, wenn sich der Schmerz anfühlt, wie ein durchdringender Stich durch ein Gelenk oder in der Nähe des Herzens. Auch bei drückend dumpfen Schmerzen am Kopf, im Nacken, am Rücken, besonders am unteren Rand
des Schulterblattes kann die Blacke helfen. Ihre grossen Blätter verweisen zudem auf die Lunge. Die lungenähnlichen Blätter mit dem, darin enthaltenen Schleimstoff wirken auf die Schleimhäute der oberen und unteren Atemwege. Ebenso bei Entzündungen des Kehlkopfes und des Rachens, der Luftröhre, bei Schnupfen, Husten oder trockenem Reizhusten. Besonders dann, wenn Sprechen und tiefes Atmen den Reiz verschlimmern.
Ich nutze die Blacke gerne als gutes Notfallkraut, weil sie wie ein pflanzlicher Eisbeutel wirkt und Gestautes wieder in Fluss bringen kann. Ihr kühlendes, fliessendes Wesen wirkt sich stark auf geschwollene, gestaute Körperbereiche aus. Deshalb nutze ich sie bei Verspannungen, Prellungen und Verstauchungen. Wer beim Ausstechen von Blacken Rückenschmerzen bekommt, kann die Blätter auf den Rücken auflegen. Sie lindern die Schmerzen, wirken krampflösend und fördern die allgemeine Beweglichkeit. Frische zerdrückte Blätter legt man auf Entzündungen, Schürfungen und Schnittwunden. Erwärmte Blätter auf nässende Ekzeme oder auf entzündete Euter bei Kühen. Für die Auflagen zu äusserlichen Zwecken kann man die dunkelgrünen Blätter das ganze Jahr hindurch verwenden.

Ich bin die nicht enden wollende Widerstandsfähigkeit, ich bin die Kraft des keimenden Mutes und des Lebenswillens. Mal stürmisch, mal leise.


Blackenblätter enthalten viel Nitrat und galten früher sich als Notfallmittel bei Angina pectoris. Hierzu wurde das Blatt so lange gekaut, bis der Arzt oder die Ärztin eingetroffen war. Das Kauen der Blätter hilft auch bei Zahnschmerzen, Zahnfleisch- und Mundschleimhautentzündungen.
Der Ampfer als Heilmittel
Blackenpräparate werden immer aus den frischen Samen, Wurzeln und Blättern hergestellt, weil im trockenen Zustand wesentliche Eigenschaften verloren gehen. Nebst Auflagen aus Frischpflanzen oder frisch aufgebrühtem Tee, eignet sich die Blacke auch für einen Ölauszug und oder zur Herstellung einer Tinktur, die ich dann zusammen mit Bienenwachs zu einem Balsam weiterverarbeite. Im Gegensatz zu den kühlenden Blättern ist ein Auszug aus den Wurzeln wärmend. Die Wurzel wirkt abführend bei Verstopfung, weshalb man sehr vorsichtig damit umgehen muss. Zu viel wirkt abortiv, kann Krämpfe und oder gar blutige Stuhlgänge herbeiführen. Die Wurzel vermag aber auch Harnsäuresalze auszuschwemmen, was zu einer Linderung bei Rheuma und Gicht führen kann.
Die Samen hingegen stillen starken Durchfall und lindern Verdauungsstörungen. Daher auch der Name «Büchwehchrüt». Wie Blatt und Wurzel wirken die Samen auch bei Ekzemen und anderen Hautproblemen. Sie sind blutreinigend und blutbildend, stärken das Immunsystem und beseitigen wie alle Teile der Pflanze pathogene Keime.
Zu dieser Zeit im Frühling, kann man die jungen, noch zarten Frühlingstriebe der Blätter und Stängel nutzen, ebenso die Wurzeln von jüngeren Pflanzen. Für die Frühjahrskur empfehle ich jeden Tag ein paar junge Blättchen zu essen. So früh im Jahr sind sie noch nicht besonders bitter. Diese Blackenkur darf höchstens drei Wochen dauern. Sie wirkt stark tonisierend und kräftigt den ganzen Organismus. •
Ampferblätter Umschläge
Mehrere frische Blätter, ungefähr fünf Stück auf die Körperstelle platzieren und fixieren. Wenn möglich mehrmals täglich wechseln, vor allem wenn man sie für Wunden verwendet.
Küche
Ein wenig Presssaft der jungen Blätter und Stängel gemischt mit Fruchtsaft, Gin oder Sprudelwasser ist ideal als Aperitif und Verdauungsförderer. Wie auch andere Ampferarten enthält auch die Placke viel Oxalsäure. Man kann sie minimieren, indem man die Pflanzenteile kurz im kochenden Wasser blanchiert. Die zweite Methode ist, etwas Milch oder Rahm zum gekochten Gericht zu geben. Milchprodukte binden die Oxalsäure in den Speisen. Der Nachteil aber ist, dass auch das Kalzium der Milch nur reduziert aufgenommen werden kann.
Teezubereitung aus Blättern
Junge Blätter mit kochendem Wasser übergiessen und zehn Minuten ziehen lassen. Der Tee treibt das Wasser und den Harn zum Beispiel bei Wasseransammlungen in den Knien, auch nach Operationen. Den Blättertee verwende ich auch kalt oder warm zur äusserlichen Anwendung für getränkte Umschläge bei schlecht heilenden Wunden, Entzündungen, Hautproblemen (z. B. Schuppenflechte), Insektenstichen, Schwellungen, Verspannungen,

Steven Wolf seiner Grossmutter altes Pflanzen wissen gelernt und weiss um die Kraft der Natur mit all ihren sicht baren und unsichtbaren Wesen. Er lebt in Escholzmatt, wo er zusam men mit seiner liche Pflanzenkurse für Menschen durchführt. Im Loch weidli steht dafür eine eigens gebaute Schuljurte. www.pflanzechreis.ch

Blacken Ölauszug
Ein öliger Auszug ist die Basis für die Blackensalbe, die zur Behandlung von Insektenstichen, Wunden, Sonnenbrand, Schwellungen und vielen der oben genannten Beispielen verwendet wird. Hierzu werden frische Blackenblätter klein gezupft, in ein Glas gefüllt (Füllmenge maximal ¾) und mit Olivenöl sechs Wochen ans Licht stellen. Täglich leicht schütteln. Danach siebe ich das Öl ab, fülle es in eine dunkle Flasche und bewahre es lichtgeschützt auf. Dieses Öl ist mindestens ein Jahr haltbar. Ich nutzte den Ölauszug als Einreibemittel um mich besser Abgrenzen zu können. Es regt den Energiefluss an und gewährleistet, dass vieles einfach durch mich hindurch fliesst und nicht hängenbleibt. Es ist ein ideales Öl für all jene Menschen, die therapeutisch arbeiten.


Ihr Weg als Ärztin führte Nina Artinger-Reis von Russland über Deutschland in die Schweiz – in die Klinik Arlesheim. Im Gespräch erzählt sie von ihren Erfahrungen in der Onkologie und ihrem Anliegen, Schulmedizin und ergänzende Therapien zu kombinieren.
Text: Jürg Lendenmann
Als Kind deutscher Eltern 1957 in Russland geboren, studierte Nina Artinger-Reis Medizin in Nowosibirsk. «Nach meinem Abschluss 1981 bin ich mit meinem Mann und den Kindern ins nahe Altai-Gebiet gezogen», erzählt die Ärztin. «Bei uns in der Klinik gab es keine Trennung zwischen der Schul- und Komplementärmedizin. Ein Heilmittellabor versorgte uns mit den gewünschten Arzneimitteln. Als ich 1999 nach Deutschland gekommen bin, erhielt ich eine Stelle als Gastärztin an der Universität Heidelberg in Bad-Mergentheim. Was ich bei meinem neuen Arbeitsbereich im Westen nicht begreifen konnte, war die Trennung von Schul- und Komplementärmedizin – vor allem in der Onkologie. Wie konnte man es unterlassen, den vom Krebs bedrohten menschlichen Körper nicht parallel zu einer Chemotherapie, Strahlentherapie oder Anti-Hormontherapie zu unterstützen?»
Der Mensch im Zentrum einer ganzheitlichen Behandlung
Noch etwas bedrückte die Ärztin: «Bereits in Russland, wo ich schnell Karriere gemacht habe, hatte ich gemerkt, dass ich immer mehr von den Patient*innen wegkam. Doch ich wollte nicht, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Darum entschied ich mich, fortan in Deutschland mit onkologischen Patient*innen zu arbeiten.» In der Hufeland-Klinik im deutschen Bad Mergentheim fand sie einen Ort, wo ganzheitlich behandelt wurde. «Da wir dort auch Misteltherapien gemacht haben, bin ich immer wieder in die Schweiz zur Weiterbildung in die Lukas Klinik gefahren», erinnert sie sich. 2014, als ihre beiden Kinder ihr Studium abgeschlossen hatten, bewarb sie sich in der Klinik Arlesheim, die damals aus dem Zusam menschluss der Lukas Klinik und der Ita Wegman Klinik hervorgegangen war.

«Ich habe den Eindruck, dass die Patient*innen die Chemotherapie besser vertragen, wenn zu schulmedizinischen Methoden parallel anthroposophische Mittel gegeben werden», erklärt Nina Artinger. «Sie sind länger ohne Rezidiv und in viel besserem Allgemeinzustand, denn die Komplementärmedizin baut den physiologischen Zustand auf und erhöht die Lebensqualität. Es zählt nicht nur, wie viele Krebszellen der Mensch im Körper hat; wichtig ist, wie es ihm geht.»
«
Das grösste Geschenk für mich ist, für kranke Menschen da sein zu dürfen.









Die Kraft der Mistel Mistelextrakte, so die Ärztin, würden den Wärmeorganismus aktivieren. Sie enthalten Lektine, die im Körper Wärme auslösen. «Wärme und Licht sind für mich bei der Behandlung einer Krebserkrankung die zwei wichtigsten Elemente, denn der Krebs ist kalt.» Kälter seien in der modernen Welt auch die Menschen geworden, gegenüber ihren Mitmenschen und der Natur. Dem möchte sie entgegenwirken: «Von Krebs können wir die Menschen oft nicht heilen, doch wir können versuchen, Körper, Psyche und Seele aufzubauen, um die Krebszellen im Körper ruhig zu halten. Es geht um Balance, ums Gleichgewicht. Mit Krebs kann man leben. Dazu muss der Mensch auch das Vertrauen zum eigenen Körper finden.» Es würden auch sehr viele junge Patient*innen in die Klinik kommen, die neben einer schulmedizinischen Therapie ganz intensiv auch die komplementärmedizinischen Therapien anwenden. Der onkologische Patient sei ein besonderer Patient; viele würden spüren, dass sie sehr viel zu einem Behandlungserfolg beitragen können.












«Das grösste Geschenk für mich ist, für kranke Menschen da sein zu dürfen», sagt Nina Artinger-Reis. Eine hervorragende Kollegin, die in Pension gegangen sei, habe einst zu ihr gesagt: «Unser Beruf ist der einzige, bei dem du nicht alt wirst.» Das könne sie bestätigen: «Je mehr du arbeitest, desto mehr Erfahrung hast du, und du kannst diese auch jungen Ärzt*innen weitergeben.» •









Kostenlose Broschüre bestellen: www.iscador.ch/gkb0322
Ganzheitliche Krebsbehandlung Erfahren Sie mehr über die Ursachen und integrativen Behandlungsmöglichkeiten von Krebserkrankungen.




Text: Alice Hofer
Neulich war ich bei der Mental-Hygienikerin. Ich gehe da sporadisch hin zum «Realitäts-Check». Bekanntlich ist ja die Realität etwas für Leute, die mit Drogen nicht klarkommen (wie eben auch ich). Jedenfalls war es mein dringendes Anliegen, ein paar alte Zöpfe abzuschneiden und frischen Wind in mein Leben strömen zu lassen.
Ich liess mich also auf ihrem Vegan-Kunstledersofa nieder und rang nach Worten. Aus dem Lautsprecher über der Couch rieselte Eric Saties Geklimper sanft und wohltuend auf meine rastlose Seele herab. Ich wähnte mich in Sicherheit und gleichzeitig im Labyrinth von Zimmerlinden und Räucherstäbchen. Schliesslich gelang es mir, aus der Komplexität meiner aktuellen Befindlichkeit folgenden Sachverhalt zu destillieren:
Nachdem ich zeitlebens zugetextet worden sei mit hinderlichen, entwicklungshemmenden, verdorrten, unnötigen Leitsätzen und billigen oder gar kostenlosen Ratschlägen, die sich im Laufe der Zeit zu betonharten, unverdaulichen Glaubensmustern verdichtet hatten, sei es jetzt überfällig, mich endgültig davon zu befreien und sie alle am Wegrand liegen zu lassen.
Damit sie verstand, wovon ich sprach, offerierte ich ihr ein paar Häppchen aus meiner Konditionierungs-Software, teilweise gefühlte drei Jahre älter als der Eiger und dennoch auf beängstigende Weise immer wieder massgebend für mein inneres Barometer. Ich wollte diese alten Programme deinstallieren und neue Versionen herunterladen. Insbesondere störten mich folgende veralteten Sprüche:
«Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!» Wie bitte? Arbeit und Vergnügen müssen zweierlei sein, wovon Arbeit grundsätzlich keinen Spass machen darf? Das sehe ich anders: Arbeit sollte unbedingt von der grössten Freude begleitet sein, das steigert ihren Wert um ein Vielfaches! Talent, Freude und Schaffenslust bedeuten die Dreifaltigkeit des Erfolgs.
«Ohne Fleiss keinen Preis.» Im Schweisse Deines Angesichts sollst Du Dein Brot verdienen? Von wegen: Die besten Einfälle sind diejenigen, die einem zufliegen, ohne Anstrengung, womöglich gar im Traum; und wer seinen Träumen wirklich vertraut, wird reich belohnt.
«Schönheit will gelitten haben.» Das klingt nach wie vor unverständlich: Wer definiert Schönheit? Leiden etwa die Rosen? Denen ist doch völlig egal, ob sie gesehen werden, sie blühen aus reinem Selbstzweck.
«Liebe muss verdient sein!» Aha, es gibt also wirklich nichts umsonst? O doch, das gibt es! Liebe ist eben gerade das Eine, das sich multipliziert, je mehr man es verschenkt.
«Selbstlob stinkt!» Das war bisher der härteste Brocken, an dem ich mir beinahe die dritten Zähne ausgebissen hatte. Meine heutige Erkenntnis: Selbstlob stimmt! Die eigene Individualität inklusive Stärken und Schwächen zu honorieren, ist die höchste Anerkennung, die man sich selber geben kann, und darauf zu warten, dass man gelobt wird, kann womöglich mit grauen Haaren quittiert werden.
Später am Abend reflektierte ich nochmals über meine geistigen Errungenschaften. Dabei bediente ich mich eines dieser Vergrösserungsgläser, aus denen man auch trinken kann, denn ich hatte nun die vornehme Absicht, die Wahrheit zu finden («in vino veritas»). Ich wählte intuitiv eine Medizin, die nicht im Basler Labor entworfen worden war, sondern im französischen Eichenfass. Ausserdem bin ich vertraut mit der allgemeinen Beobachtung, dass Probleme im Alkohol nicht ertrinken, da sie ja schwimmen können, was ihnen allerdings auch in anderen Getränken gelingt.
Schliesslich schrumpften dann die Beschwerden dieses weitverbreiteten alten Erbguts (Prädikat: «pädagogisch wertlos») in sich zusammen. Die heutige Tat brachte ein gutes Resultat. Um mich nachhaltig aufzuheitern, notierte ich noch ein paar Bonmots aus dem Fundus früherer geistreicher Geschöpfe, wie etwa:
«Manch einer arbeitet so eifrig für seinen Lebensabend, dass er ihn gar nicht mehr erlebt.» (Markus M. Ronner)
«Die Vorbedingung zur schöpferischen Persönlichkeit ist nicht nur, sich selber zu akzeptieren, sondern sich in der Tat zu glorifizieren.»
(Dr. Otto Rank) •

Alice Hofer, Inhaberin der «Praxis für angewandte Vergänglichkeit», sieht den Tod nicht als Ende, sondern als Vollendung des irdischen Lebens. Sie ermutigt Menschen zum ganzheitlichen, selbstbewussten Abschiednehmen. www.alicehofer.ch

Wälder
Klimawandel beeinträchtigt Europas Buchenwälder
Die Rotbuche ist eine der wichtigsten Baumarten in den europäischen Laubwäldern. Doch schon jetzt setzt ihr der Klimawandel zu, wie eine europaweite Studie gemäss einer Meldung von «wissenschaft.de» aufzeigt. Vor allem im Süden Europas hat das Wachstum der Buchen in den letzten rund 60 Jahren bereits um bis zu 20 Prozent abgenommen. Prognosen zufolge wird sich dieser Rückgang in den nächsten Jahrzehnten noch verstärken und ausbreiten: Selbst geringe Zuwächse in Nordeuropa gleichen dann den Verlust der Buchen im restlichen Europa nicht mehr aus. Nach Angaben des Forschungsteams könnte dies erhebliche Konsequenzen für die Ökologie und Pufferfunktion der europäischen Wälder haben. Ska

Mit EGK freier Zugang zu Natur- und Komplementärmedizin.
Gott und die Natur tun nichts umsonst. »
Aristoteles (384–322 v. Chr.), griechischer Philosoph



Bello, Fido oder Momo waren zu Grossmutters Zeiten die gängigsten Hundenamen. Heute sind Luna, Rocky und Kira hoch im Kurs. Je nach Sprachregion variieren aber die Präferenzen, schreibt die «Tierwelt». Jeder kennt eine Hündin mit dem Namen Luna. Weshalb wohl? Es ist in allen Sprachregionen der Schweiz der häufigste Name für Hündinnen. Auf dem ersten Platz bei den Hunden findet sich in der Deutschschweiz Rocky. Die Sprachregionen sind sich jedoch nicht einig: In der französischsprachigen Schweiz triumphiert Lucky, im Tessin Jack. ska «
Die von Hundekot verursachten Stickstoffeinträge sind vergleichbar mit denen aus Landwirtschaft und Industrie. Das ist laut vetion.de das Ergebnis einer Studie belgischer Forschenden. Sie haben 18 Monate lang die Nährstoffeinträge von mehr als 1600 Hunden untersucht und waren überrascht, wie hoch die Nährstoffeinträge sein können. Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft würden viel Aufmerksamkeit durch die Politik bekommen, aber die der Hunde komplett vernachlässigt. «Insgesamt haben wir mehr als 1600 Hunde gezählt – im Durchschnitt drei bis vier Tiere pro Tag und Hektar Naturfläche. Wir gehen davon aus, dass jeder Hund beim Ausführen 100 Gramm Kot abgegeben hat und ein Viertel seiner täglichen Urinmenge. Diese Zahlen leiten wir aus früheren Studien anderer Forscher ab», so die Wissenschaftler*innen der Universität Gent. Gemäss den Hochrechnungen der Forschenden tragen Landwirtschaft, Verkehr und Industrie in Belgien rund 22 Kilogramm Stickstoff pro Jahr und Hektar in Ökosysteme ein. «Durch Hunde kommen nach unseren Ergebnissen weitere elf Kilogramm hinzu, was bisher übersehen wurde. Das ist eine beträchtliche Extraportion Stickstoff», so die Forschenden weiter. Da im Beutel entsorgter Kot die Stickstoffeinträge halbieren kann, appellieren die Forschenden an alle Hundehalter*innen, den Hundekot stets zu entfernen. ska
staunen und wissen


schen Konzil von Nicäa beschlossen, dass das Osterfest jeweils nach dem ersten Frühlingsvollmond stattfinden soll. Damals legte man als Frühlingsbeginn den 21. März fest. Dieses Jahr ist der erste Vollmond nach dem 21. März am Samstag, dem 16. April. Der folgende Sonntag, 17. April, ist daher der Ostersonntag. Mit dieser Regelung ergibt sich für Ostern ein Zeitfenster zwischen dem 22. März und dem 25. April. Feste, die an den Ostertermin gebunden sind wie Pfingsten (jeweils sieben Wochen nach Ostern), Aschermittwoch (40 Tage vor Ostern) oder Weisser Sonntag (Sonntag nach Ostern), verschieben sich jeweils auch mit dem jeweiligen Ostertermin.
Als historisch gesichert gilt, dass Jesus von Nazareth an einem Pessachfest in Jerusalem gekreuzigt wurde. Das Pessachfest beginnt jeweils am Abend des 15. des Monats «Nisan», dem Monat mit dem Frühlingsvollmond. Deshalb spielt der Frühlingsvollmond beim Termin von Ostern noch heute eine Rolle.
Im Gegensatz zum Weihnachtstag, der immer am 25. Dezember gefeiert wird, ist Ostern ein beweglicher Feiertag. Im Jahre 325 nach Christus wurde am 1. ökumeni-

Online via QR-Code (www.natuerlich-online.ch/abo) oder Talon aufüllen und absenden (aufkleben oder via Couvert)
1-Jahresabo: 10 Ausgaben für CHF 89.–
2-Jahresabo: 20 Ausgaben für CHF 159.–
Name
Adresse
PLZ | Ort
Datum
Unterschrift
Geschenkabo Lieferadresse
Name
Adresse
PLZ | Ort
natuerlich-online.ch | Ausgabe April 2022 | www.weberverlag.ch
Weber Verlag AG
Gwattstrasse 144
CH-3645 Thun / Gwatt
«GESUNDHEIT – 7000 Jahre Heilkunst» ist eine Zeitreise durch die Medizingeschichte, die zum Riechen, Spielen und Beobachten einlädt (in Deutsch und Englisch). Zahnschmerzen, Entzündungen und Knochenbrüche – auch in der Steinzeit litten Menschen unter gesundheitlichen Problemen. In den Zeiten vor der modernen Medizin waren wirksame Behandlungsmethoden rar und die Lebenserwartung entsprechend tief. Doch gegen manches Leiden war ein Kraut gewachsen.
Die Sonderausstellung zeigt auf, wie Krankheiten und ihre Heilmittel im archäologischen Fundgut nachgewiesen werden. So geben Blütenpollen, verkohlte Pfanzenteile und Funde aus Feuchtbodensiedlungen Auskunft darüber, welche Pflanzen früher wuchsen. Ergebnisse von anthropologischen Untersuchungen zeigen, an welchen Krankheiten und Verletzungen die Menschen litten. Überlieferungen aus der Volksmedizin und antike Schriftquellen schaffen Verbindung zwischen Krankheit und möglichen Medikamenten.
Die Sonderausstellung «GESUNDHEIT – 7000 Jahre Heilkunst» ist während den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Öffentliche Führungen finden jeweils am 1. Sonntag des Monats um 14.30 Uhr statt. Führungen für private Gruppen und Schulklassen können direkt gebucht werden. Die Sonderausstellung wurde verlängert bis 17. Juli 2022.
Ort: Kulturama – Museum des Menschen, Englischviertelstrasse 9, 8032 Zürich. www.kulturama.ch

Bewusst glücklich sein. Privat und im Beruf.
Studienlehrgänge (CAS)
«Resilienz und Positive Psychologie»
«Achtsamkeit im Alltag und in der Führung»
Achtsamkeits-Workshops, Vorträge, Seminare MBSR-Kurse
Coaching & Meditation
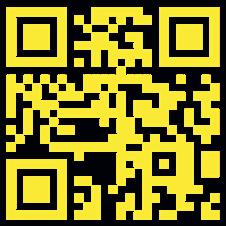
www.achtsamkeit.swiss
Das Aprilwetter ist unbeständig und wechselhaft. Nicht umsonst heisst es: «Der April macht was er will.» Zu dieser Jahreszeit sind die Meerestemperaturen noch kühl, während die Landmassen von der Sonne bereits stark erwärmt werden. Deshalb wird unser Land von Luftmassen überströmt, die je nach Herkunft grosse Temperaturunterschiede aufweisen. Viele markante Kälteeinbrüche charakterisieren das Aprilwetter und verleihen diesem die typische Launenhaftigkeit.
Zieht kalte Polarluft zum Alpenraum, nimmt sie auf ihrem Weg Feuchtigkeit auf. Wenn diese Luft über das Festland strömt, wo es bodennah durch die Sonneneinstrahlung bereits eine stärkere Erwärmung gab, entsteht ein grosser vertikaler Temperaturunterschied. In solchen Situationen entsteht eine labile Luftschichtung. Die Luft steigt schnell in die Höhe, kühlt sich ab und es entstehen Wolken, woraus Regen, Graupel oder Schnee fällt. Obwohl im April die Temperaturen tagsüber bereits ziemlich warm sind, können in der Nacht noch Bodenfröste auftreten. Die Sorge der Landwirt*innen über diese Situation wird in der folgenden Bauernregel klar ausgedrückt: «Heller Mondschein in der Aprilnacht schadet oft der Blütenpracht.» Der April bildet den Übergangsmonat von der kalten zur warmen Jahreszeit. Kälteeinbrüche mit Bodenfrösten sind jedoch auch in tiefen Lagen bis zu den «Eisheiligen» Mitte Mai immer noch möglich.
Andreas Walker


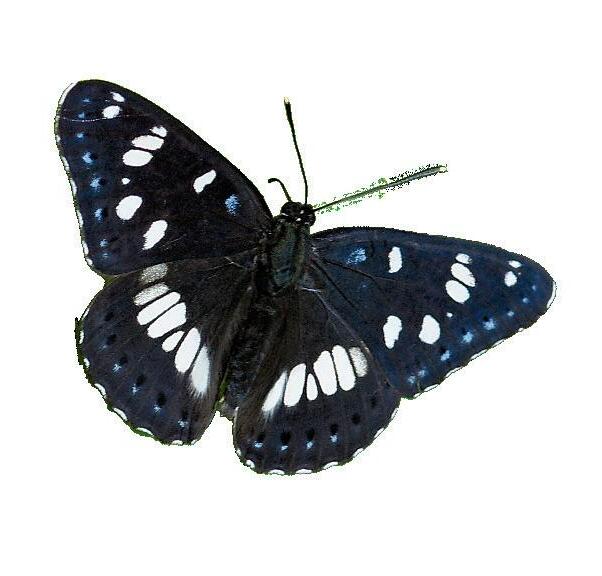
«Man kann nur schützen, was man kennt»
Hanspeter Latour ist vor allem durch seine frühere Tätigkeit als Fussballtrainer bekannt. Doch seit seiner Pensionierung widmet er sich vor allem der Naturbeobachtung. Davon zeugen mehrere Bücher. Im Interview berichtet er, wie es dazu kam.
Interview: Samuel Krähenbühl
eigene Tiere. Er war viel in der Region Thun unterwegs. Weiter gereist ist er eigentlich nie. Darf ich noch ein Wort zu den Kunstrasen sagen?
Ja, sicher.

Hanspeter Latour: Das hat mit meiner Familie zu tun. Damals konnte man noch nicht mit acht Jahren in einen Fussballclub, sondern erst mit zwölf. Mein Vater war ein grosser Naturliebhaber. Deshalb war ich viel mit ihm unterwegs. Er hat fast alle Tiere und Vögel gekannt. Und wenn wir unterwegs waren, hat er Futter für seine Kanarienvögel gesammelt. Von ihm habe ich so gelernt, die Natur genau zu beobachten. Das hat mich während meiner Fussballkarriere begleitet. Auch wenn ich nicht viel Zeit hatte, habe ich mir immer vorgenommen, mich später für die Natur zu interessieren. Aber schon als Fussballtrainer habe ich wenn ich etwa mit meinen Spielern regenerativ unterwegs war, sie auf auf Bäume oder Vögel aufmerksam gemacht. In der Nähe von hier in Thun-Gwatt, wo wir das Interview durchführen, liegt der wunderbare Bonstettenpark. Dort habe ich mit der ersten Mannschaft des FC Thun eine Hecke angesetzt. Das kam so: Die Stadtgärtnerei hatte versehentlich eine Hecke vor dem Wald abgeholzt, was zu grossen Protesten der Naturschützer*innen führte. Als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, fand ich das eine gute Idee, mit den Spielern unter Mithilfe der Stadtgärtnerei wieder eine Hecke anzupflanzen. Ich habe jedes Mal Freude daran, wenn ich in den Bonstettenpark gehe.
Wissen Sie, warum ihr Vater sich so sehr für die Natur interessiert hat?
Das weiss ich auch nicht so genau. Er ist in einem Haus mit grossem Garten aufgewachsen und hatte schon als Schulkind
Es stimmt: Mit Natur hat das wenig zu tun. Das Gummigranulat ist ein Problem. Aber gerade für die unteren Ligen sind die Kunstrasen wichtig. Sie können so öfter und besser trainieren und sind weniger von der Witterung abhängig. Noch ein Müsterchen zum Thema Kunstrasen. Als Trainer von GC war ich oft im Trainingscampus Niederhasli in der Nähe des Neeracher Rieds. Auch mein Büro war dort. Am Morgen war ich meist der Erste vor Ort. Ich habe vom Büro aus auf die Kunstrasenplätze gesehen. Dabei konnte ich des öfteren beobachten, wie die Amseln versucht haben, Würmer aus dem Kunstrasen zu picken. Erfolglos natürlich. Da dachte ich mir, dass die Amseln nicht die intelligentesten Tiere sein können.
Aber so richtig mit dem Thema Natur haben Sie sich erst später beschäftigt?
Ja, das ist so. Ich habe immer alles mit Leidenschaft gemacht. Aber ich habe auch alles konsequent abgeschlossen, wenn die Zeit da war. Meine Karriere als Fussballtrainer habe ich 2009 beim Grasshopper Club Zürich abgeschlossen. Ich wäre gerne noch ein Jahr länger geblieben. Aber die Clubleitung hatte mir signalisiert, dass sie einen Jüngeren wollten. In der Schweiz sind nur zehn Fussballclubs in der obersten Liga. Da herrscht logischerweise ein grosser Konkurrenzkampf im Trainergeschäft. Ich habe dann eine Einzelfirma gegründet und habe Referate zu Teambildung, Führung und Motivation gehalten. Damit konnte ich die Anlage meines naturnahen Gartens finanzieren. Heute rede ich viel lieber über die Vögel und «natürlich»: Sie waren jahrzehntelang im Fussballgeschäft. Zunächst als Spieler, dann als Profitrainer auf höchster Stufe, sogar in der deutschen Bundesliga. Fussballrasen sind bekanntlich eine Monokultur. Kunstrasenplätze unnatürlich. Wie kommt es, dass Sie sich für Natur und Biodiversität interessieren und engagieren?

Schmetterlinge als über Fussball. Manchmal gibt es auch Kombinationen bei Vorträgen. Ich mache dann zwei Halbzeiten: Die erste rede ich über Motivation und Führung. In der zweiten über die Natur.
Ihr Garten bei Ihrem Haus im Eriz ist heute ihre Leidenschaft. Wie kam es dazu?
Ich wollte schon länger einen naturnahen Garten anlegen. Meine Frau und ich hatten bereits ein kleines Biotop. Ich musste das aufheben, weil das Biotop viel zu nahe an einem Haus zu liegen gekommen wäre, das neu gebaut wurde. Dazu brauchte es mehr Platz. Aber ganz so einfach war es nicht. Es hat dazu gar eine Umzonung eines Stücks Land bedingt. Ich musste die Behörden davon überzeugen. Mein Argument dabei war: Ich gebe der Natur mehr zurück als ich ihr nehme. Und in unseren Gärten können wir so der Natur etwas zurückgeben. So sehe ich es auch mit unseren Schutzgebieten. Wir müssen der Natur wieder mehr Sorge tragen. Die Nachhaltigkeit muss gepflegt werden. Doch es braucht auch ein Nebeneinander mit Flächen, die beispielsweise von der Landwirtschaft genutzt werden. Das ist mir wichtig. Denn ich bin gegen alle Extreme.
Einen naturnahen Garten anzulegen ist das eine. Beobachtungen zu fotografieren und aufzuschreiben das andere. Wie kam es dazu?
Aus lauter Freude an der Natur habe ich sie immer mehr und immer länger beobachtet. Und dann auch Beobachtungen fotografisch festgehalten. Zuerst habe ich es für mich gemacht. Aber dann habe ich mir gedacht, dass ich das mit anderen teilen möchte. Früher habe ich über Fussball referiert. Warum sollte ich nun nicht über die Natur referieren? Das brauchte eine gewisse Zeit, um Akzeptanz zu erhalten. Ich galt ja bis anhin nicht als Experte auf dem Gebiet. Nach und nach habe ich mich aber über Literatur weitergebildet. Durch alles das lernte ich andere Leute kennen, die sich für die Natur interessieren. Und darunter auch richtige Fachleute. Mit meinen Referaten fand ich sogar Anklang bei diesen. Sie schätzten es, dass ich mit meinem Fussballer-Hintergrund ganz andere Kreise erreichen kann. Und mein Netzwerk funktioniert super. Wenn ich eine Pflanze oder ein Tier bestimmen will, das ich noch nicht kenne, dann bekomme ich immer sofort eine Antwort.
Vorträge sind das eine. Bücher das andere. Wie sind Sie zum Bücherschreiben gekommen?
Als meine Fussballkarriere zu Ende gegangen war, meinten einige, ich solle eine Biographie herausgeben. Das wollte ich zunächst nicht. Denn meine Familie hatte es geschätzt, dass ich

unser Privatleben nicht in die Öffentlichkeit getragen hatte. Eines Tages erhielt ich von Philipp Abt ein Buchkonzept zugesandt, welches uns zu gefallen wusste. Darauf sagte meine Frau eher unerwartet, dass sie und die Kinder Freude an einem Buch hätten. Dann habe ich mich mit dem Autoren Beat Straubhaar getroffen. Für mich war wichtig, dass ein Verlag aus der Region Thun das Buch herausgeben würde. Also gingen wir zur Verlegerin Annette Weber vom Weber Verlag Thun. Das Resultat war das Buch «Das isch doch e Gränni!». Ich lernte selber auch viel über das Bücherschreiben. Das nächste Buchprojekt enstand mit mir als Co-Autor. Der Titel war mit «Das isch doch e Schwalbe» noch ziemlich fussballnah. Ich habe aber die richtige Schwalbe gemeint. Das Buch «Natur mit Latour» folgte als nächstes. Und jetzt erscheint als Neustes das Buch «Biodiversität – 365 Beobachtungen und Geschichten».
Was erwartet uns in Ihrem in neuem Buch zum Thema «Biodiversität»?
Ich möchte mit meiner Tätigkeit dazu beitragen das Wort und den Begriff Biodiversität für die Allgemeinheit verständlicher zu machen. Ich will die Artenvielfalt zeigen. Man sagt, dass in einer grossen Handvoll Walderde mehr Lebewesen enthalten seien als es Menschen auf der ganzen Erde gibt. Die Natur ist wie das menschliche Leben. Es gibt Grandioses, es gibt Unscheinbares. Ich denke etwa daran, wie ein Kuckuck aufwächst. Was es braucht, bis er nach Afrika und wieder zurück fliegen kann. Dann ist da aber auch ein unscheinbares Pflänzlein, welches aus einer Felsritze wächst. Ich möchte auch Mut machen. Damit die Gesellschaft Wege findet, wie sich Natur und Mensch besser vertragen können. Zum Glück gibt es viele gute Projekte für die Natur. Alle, die einen Garten oder ein Stück Land besitzen, sollten der Natur etwas zurückgeben. Hier ist nicht nur die Landwirtschaft gefordert. Auch in privaten Gärten ist mehr Biodiversität möglich. Aber es ist auch wichtig, die Natur zu kennen. Man kann die Natur nur schützen, wenn man sie auch kennt. Denn nur wenn wir die Arten kennen, merken wir auch, wenn sie verschwinden. Dazu braucht es das Engagement von uns allen. Dort holt mich dann auch wieder der Fussball ein. Wenn sich alle Menschen so für die Natur wie für den Fussball interessieren würden, dann wüssten sie viel mehr. Und das würde auch der Natur dienen. •
Hanspeter Latour (*1947) ist bekannt aus der Zeit als Trainer des FC Thun, des Grasshopper Clubs Zürich und des 1. FC Köln und war beliebt als kompetenter SRF-Fussballexperte. Hanspeter Latour ist auch ein begeisterter Naturbeobachter und -fotograf. Er ist ein gefragter Redner für Anlässe und gerngesehener Gast in Fernsehsendungen und setzt alles daran, dass sich Gesellschaft, Wirtschaft und Natur positiv ergänzen.
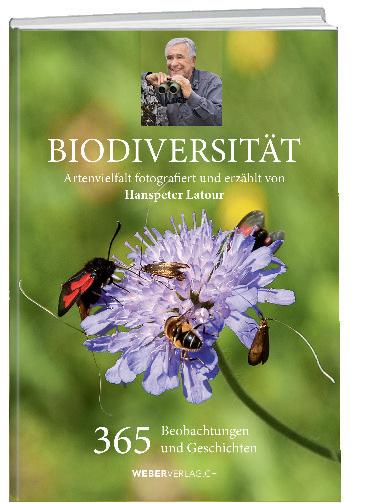
Unzählige spannende Fakten zu Natur und Artenvielfalt finden Sie in Hanspeter Latours Buch «Biodiversität – 365 Beobachtungen und Geschichten». «natürlich»-Leser*innen erhalten mit dem Gutscheincode «natürlich» 20 % Rabatt und können das Buch zum Preis von 31.20 statt 39.– Franken bestellen.
Format 17 × 24 cm Gebunden, Hardcover, 412 Seiten
ISBN 978-3-03818-381-5


Freuen Sie sich auch schon auf den Frühling? Holen Sie sich doch etwas verfrüht frisches Grün in Ihr Wohnzimmer. Doch die Auswahl an Zimmerpflanzen ist gross. Damit Sie die richtige Wahl für sich treffen, zeigt Ihnen «natürlich», auf was es ankommt.
Text: Gabriela Gerber
Vielleicht haben Sie sich heuer vorgenommen, ab jetzt mehr mit Ihren Zimmerpflanzen zu sprechen oder sich zum Erfreuen Ihrer Sinne im Homeoffice pflanzliche Mitbewohner anzuschaffen? Damit liegen Sie voll im Trend. Die Natur im Wohnzimmer feiert ein ebenso grosses Comeback wie die Biodiversitätsgärten in den letzten Jahren. Zimmerpflanzen sehen nicht nur gut aus, verschönern Wohn- oder Büroräume, sondern können auch zur Gesundheit beitragen. Diese grünen Lebewesen produzieren frischen Sauerstoff, befeuchten die Luft und bereichern aufgrund ihrer Ästhetik den menschlichen Geist und Körper. Wir Menschen assoziieren Grün mit der Natur, weshalb die Farbe ein entspannendes sowie beruhigendes Gefühl vermitteln kann. Eins ist klar, mit der richtigen Pflege garantieren Ihnen Zimmerpflanzen auf jeden Fall jahrelange, treue Begleitung.
Die Pflege von Zimmerpflanzen ist grundsätzlich einfach und wird schon seit Jahrtausenden praktiziert. Bereits im alten Ägypten vor über 2000 Jahren stellten königliche Familien Duftpflanzen in ihren Innenhöfen auf. Auf Wandgemälden aus der Zeit der Römer wird gezeigt, wie Zimmerpflanzen gepflegt wurden. Ab dem 16. Jahrhundert kamen zur Zeit des Barocks an europäischen Fürstenhöfen Zitrusfrüchte in Mode, welche zu Zier- und Repräsentationszwecken in Orangerien gehalten wurden. Diese hellen Gewächshäuser dienten dazu, frostempfindliche Pflanzen zu überwintern. Im Schloss Jegenstorf kann die im 19. Jahrhundert errichtete Orangerie beispielsweise noch heute bestaunt werden. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts brachten immer mehr Botaniker*innen
und Forschende Pflanzen von ihren Schiffsexpeditionen aus allen Kontinenten dieser Welt nach Europa. Die meisten Zimmerpflanzen stammen ursprünglich aus tropischen Regenwäldern oder angrenzenden Gegenden.
Im Blumenladen der Gartenbauschule Oeschberg in Koppigen BE werden Sie in Sachen Zimmerpflanzen gut beraten. Gönnen Sie sich doch vor dem Einkauf einen Besuch in unserem Pflanzenschauhaus. Hier laden tropische und subtropische Pflanzen zu einem, die Sinne inspirierenden und anregenden Rundgang ein. Zahlreiche exotische Sukkulenten wie beispielsweise der Schwiegermuttersitz oder schmucke Blattpflanzen wie die Korbmaranten können hier ganzjährig bestaunt werden. Sukkulenten haben ihren Namen von lateinisch «Sucus» für «Saft» und gelten also als besonders saftreich. Zusammen mit vielen Aufsitzpflanzen, sogenannten Epiphyten, zu welchen auch die Orchideen zählen, geniessen hier über 1000 Zimmerpflanzen fachmännische Pflege durch unsere Lernenden, welche von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern begleitet werden. Als Epiphyten gelten Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen. Ein Besuch des Schauhauses lohnt sich in jedem Fall, und zwar ganzjährig. Immer wieder kann beobachtet werden, wie Zimmerpflanzen ihre volle Blütenpracht entfalten. Mit etwas Glück entdecken Sie sogar eine Bananenblüte oder die als Delikatesse geltende Frucht des Fensterblattes (Monstera deliciosa).
Als Neuling die richtige Wahl treffen Vielleicht sind Sie Neuling in Sachen Zimmerpflanzen oder Sie möchten Ihrer bestehenden Sammlung neue Nachbarn gönnen. Aus tausenden von Arten und Sorten die richtige

Bananenblüte

Wahl zu treffen, ist gar nicht so schwierig. Je nach Ihrem Wissensstand ist es ratsam, schon vor dem Kauf einer Zimmerpflanze über folgende Aspekte nachzudenken:
Der richtige Standort: Die meisten Zimmerpflanzen lieben einen hellen Standort. Sehen Sie jedoch davon ab, Ihre Pflanzen direkt an stark besonnte Fenster zu stellen. Sie könnten Blattverbrennungen erleiden. Achten Sie im Winter darauf, sie nicht zu nahe an der Heizung zu platzieren, da die Luft zu trocken und zu warm ist. Ebenso mögen Zimmerpflanzen keine Zugluft und sollten daher nicht an geöffneten Fenstern stehen.
Wassergaben: Zum entscheiden, wann Sie giessen müssen, machen Sie am besten eine Fingerprobe. Sind die ersten ein bis zwei Zentimeter der Erde angetrocknet, sollten Sie zur Giesskanne greifen. Viele Leute machen den Fehler, zu oft zu giessen. Ich persönlich giesse die meisten meiner über 50 Zimmerpflanzen zu Hause altbewährt einmal wöchentlich. Dies gilt jedoch nicht für Kakteen oder andere Sukkulenten. Diese bekommen nur alle zwei bis drei Wochen eine mässige Wassergabe. Sollten Sie einmal längere Zeit abwesend sein, organisieren Sie am besten eine gut instruierte Giessvertretung.
Topfwahl: Höchstwahrscheinlich wurde Ihre neu gekaufte Zimmerpflanze in einem Kunststofftopf kultiviert. Entscheiden Sie sich zu Hause zum Umtopfen in ein hübscheres Gefäss, sollten Sie der Pflanze vorher ein paar Tage Zeit zur Akklimatisierung in ihrem neuen Zuhause geben. Achten Sie darauf, dass auch der neue Topf über Abzugslöcher im Boden verfügt, da die meisten Zimmerpflanzen keine Staunässe vertragen. Wenn Sie statt dem Umtopfen einen hübschen Übertopf verwenden, gilt besondere Vorsicht. Schütten Sie einige Minuten nach dem Giessen überschüssiges Wasser weg. Sie fördern mit diesem Restwasser nur Wurzelfäule und die perfekte Umgebung für lästige Trauermücken.
Düngergaben und Erdwahl : Neu gekaufte Zimmerpflanzen benötigen über längere Zeit keine Düngergaben. Die Nährstoffversorgung im Topf genügt für die nächsten drei bis vier Monate. Um Mangelerscheinungen vorzubeugen, geben Sie dem Giesswasser nach ein paar Monaten regelmässig
Oeschberg | Im Schauhaus der Gartenbauschule können viele Zimmerpflanzen im kleinen und im grossen Massstab bestaunt werden.

einen Flüssigdünger bei. Im Winter verlangen Zimmerpflanzen nur einen Viertel der Düngergaben vom Sommer. Wenden Sie nur die vorgegeben Dosierungen an. Wenn Sie sich nach ein paar Tagen zum Umtopfen entscheiden, verwenden Sie am besten eine Zimmerpflanzenerde. Am Oeschberg werden viele Erdmischungen noch selbst hergestellt. Achten Sie beim nächsten Kauf darauf, torfreduzierte Erde zu kaufen. Damit tragen Sie zur Schonung der Umwelt und zur Erhaltung von Lebensräumen seltener Pflanzen bei.
Pflegeleichte und genügsame
Zimmerpflanzen
• Leuchterblume – Ceropegia woodii
• Königsbegonie – Begonia Rex-Gruppe
• Bogenhanf – Sansevieria trifasciata
• Grünlilien – Chlorophytum comosum
• Diverse «Minigrünpflanzen» in kleinen Schalen als Starterkit (am Oeschberg erhältlich)
Nun wünsche ich Ihnen gutes Gelingen mit Ihren grünen Mitbewohnern. Vergessen Sie nicht, ab und zu lieb zu sprechen, denn die Zimmerpflanzen beklagen sich schliesslich nur, wenn Sie von Ihnen nicht die richtige Pflege erhalten. •

Gabriela Gerber, ist gelernte Staudengärtnerin, kaufm. Angestellte und dipl. Arbeitsagogin. Sie ist als Berufsbildnerin in der Vorlehre Integration an der Gartenbauschule
Oeschberg in Koppigen BE tätig. In ihrer Freizeit sammelt sie gerne Pilze, kocht leidenschaftlich gerne und liebt die Natur.
Der Oeschberg bietet unter anderem Lehrstellen für ZierpflanzengärtnerInnen EBA oder EFZ an. Auf der Internetseite www.oeschberg.ch können Sie sich jederzeit gerne informieren.


Was Sie über Zimmerpflanzen wissen sollten
Schaden Zimmerpflanzen im Schlafzimmer?
Ohne Licht kann eine Pflanze nachts keine Photosynthese betreiben. Sie nimmt daher Sauerstoff auf statt wie tagsüber abzugeben. Dies kann im Schlaf nachteilig sein, jedoch kein Grund, keine Zimmerpflanze im Schlafzimmer zu platzieren.
Sind Zimmerpflanzen für Katzen giftig?
Ja, es gibt solche, die für Katzen giftig sind. Hier sind die wichtigsten aufgelistet: Amaryllis, Cyclamen, Philodendron, Efeutute, Einblatt, Weihnachtsstern und Schefflera. Wenn Ihre Katze ständig nach draussen darf, können Sie sie auch nicht rund um die Uhr überwachen und vor Giftpflanzen schützen. In unserem Blumenladen wird übrigens Katzengras angeboten, welches in der Wohnung aufgestellt werden kann. Daran darf Ihr Liebling ohne Bedenken knabbern.
Woher kommen die lästigen Trauermücken in der Wohnung?
Die kleinen schwarzen Mücken, die nur 2-3 mm gross werden, können durch offene Fenster in die Wohnung fliegen. Das adulte Tier kann Ihnen zwar lästig um den Kopf schwirren. Doch das eigentliche Problem sind die Larven. Das Weibchen legt seine Eier gerne in feuchte Erde, also z. B. in zu nasse Zimmerpflanzenerde. Die Larve frisst die Wurzeln der Zimmerpflanze und kann diese zum Absterben bringen. Hier ein paar Tipps, was Sie dagegen tun können:
• Gelbe Klebfallen in der Nähe der Pflanze anbringen. Diese locken die Mücken an und sie bleiben kleben
• Über der Erdoberfläche eine ungefähr 1 Zentimeter dicke Abdeckschicht aus Sand oder Kiesel verteilen
• Pfanzen von unten giessen, dabei aber darauf achten, dass das Wasser im Untertopf aufgenommen wird und nicht über längere Zeit stehen bleibt (Gefahr, dass die Wurzeln faulen)
• Bei schlimmem Larvenbefall sollten Sie Ihre Pflanze in frische Erde umtopfen
Was ist besser? Hydro- oder Erdkultur?
Es sind beide Varianten gut geeignet. Im Gegensatz zu Erdkulturen sind jedoch in Blähton oder alternativen Pflanzgranulaten keine Nährstoffe enthalten. Daher muss den Hydrokulturen mit den Wassergaben Dünger zugeführt werden. Alle Pflanzen eignen sich grundsätzlich für Hydrokulturen. Möchten Sie all Ihre Pflanzen in Hydrokulturen halten, spülen Sie vor dem Eintopfen in die Kügelchen die Wurzeln ganz gut ab und entfernen Sie alle Erde. Die umgekehrte Variante, von Hydrozu Erdkultur, ist ohne Probleme machbar. Der grösste Vorteil von Hydrokulturen ist, dass Sie durch den Wasserstandsanzeiger einen besseren Überblick haben, wann Sie giessen müssen und dies vor allem weniger oft als bei Erdkulturen.


Im Freien über dem Feuer kochen, ist ein archaisches Erlebnis. Es muss nicht immer nur «Cervelat am Stecken» sein. Auch Suppen und Eintopfgerichte lassen sich gut zubereiten. Der Aufwand für eine Mahlzeit hält sich in Grenzen. Umso grösser ist das Erlebnis.
Text: Monika Neidhart
Das brennende Holz knistert, helle Flammen lodern. Mit der Wärme und dem Duft nach Holzfeuer breitet sich auch eine wohlige Atmosphäre am Lagerfeuer aus. Wenn dann noch der gebratene Cervelat, ein abgekochter Tee oder etwas anderes zum Essen dazu kommt, ist die Welt für viele in Ordnung. Um das Feuer zu sitzen – sei es an einem Flussufer, im Wald, am Waldesrand oder irgendwo in den Bergen –und in die Flammen zu sehen, birgt eine Faszination, der sich niemand entziehen will. Es ist etwas Ursprüngliches. Feuer begleitet die Menschheit seit Jahrtausenden. Es fordert Respekt und gleichzeitig ermöglicht es Essen zuzubereiten, spendet Wärme und Geborgenheit. Ja, das Feuer steht am Ursprung der menschlichen Zivilisation. «Am Feuer zu sitzen und in die Flammen zu sehen war wohl das Fernsehen unserer Urahn*innen», schmunzelt Reto Bühler, Outdoorspezialist und Erlebnispädagoge aus Edlibach ZG. Er kocht mit bis zu 100 Personen im Freien, zu jeder Jahreszeit.
Respekt gegenüber fremdem Eigentum
Für das Kochen draussen auf offenem Feuer braucht es weniger als man denkt. Für Reto Bühler sind es robuste Handschuhe – vorzugsweise aus Leder –, einen Topf, ein Sackmesser und Zündhölzer. Dann auch Improvisation und das Auge dafür, was die Umgebung anbietet. Das Happening beginnt bereits mit dem Feuer machen. Unkompliziert ist es, wenn eine fertig eingerichtete Feuerstelle benutzt wird. Zu beachten gilt hier, dass diese meist von den Gemeinden betrieben und vermietet werden. Diese entsorgen dann auch den Abfall und stellen Brennholz zur Verfügung. Eine kurze Anfrage für die

Benutzung bei der Gemeindeverwaltung ist schon daher angebracht. Das schützt auch Fauna und Flora. Gibt es keine fixe Brätlistelle, darf in der Schweiz, mit einigen Ausnahmen (u. a. Trockenperioden, Naturschutzgebiete, einzelne Gemeinden), überall im Wald ein Feuer entfacht werden. In Deutschland und Österreich sind dagegen nur offizielle Feuerstellen erlaubt. Reto Bühler rät, das Laub auf dem Waldboden grossräumig zu entfernen und ausreichend Abstand zu den Bäumen, bzw. den Wurzeln zu nehmen. Das Sammeln von geeignetem Brennholz ist in Schweizer Wäldern normalerweise gestattet. Gemeint ist herumliegendes Holz, nicht das Kappen von lebenden Ästen und Bäumen. «Jeder Wald hat seinen Eigentümer. Der Respekt vor der Natur aber auch der Respekt gegenüber fremdem Eigentum (Wald), welches uns als Erholungsraum gratis zur Verfügung gestellt wird, gebietet einen entsprechend sorgsamen Umgang» erklärt Theo Weber, Vorsteher Amt für Wald und Naturgefahren im Kanton Schwyz, die Rechtslage in der Schweiz. Dass die Verantwortung gegenüber fremdem Eigentum auch beim sorgsamen Aufräumen und Verlassen der Feuerstelle gilt, sollte selbstverständlich sein.
Auch Kinder beteiligen sich gerne an den Vorbereitungsarbeiten. So können sie mit dem Taschenmesser Späne von dürren Stecken abschneiden. Diese Holzstücke sind eine ideale Anzündhilfe für das aufgestapelte Holz. Dünne Äste von Nadelhölzern, trockenes Gras und Birkenrinde oder herumliegende Papierschnipsel helfen, den Funken zu entfachen. Als eigentliches Brennholz eignen sich die meisten Laubhölzer wie etwa Buche oder Esche, die weniger schnell verbrennen und eine bessere Glut ergeben.

Rezept: Tomatenteigwaren
für 4 Personen
• 1,2 Liter Wasser
• 1 Dose Pelati (gehackt oder ganz)
• 1 Zwiebel, gehackt
• 1 Knoblauchzehe, gehackt
• 400 g Teigwaren
• 1 Kaffeelöffel Salz
• evtl. 1–2 Esslöffel Tomatenpüree
• Basilikumblätter (je nach Saison)
• geriebener Greyerzer oder Käsebröckli
Zubereitung:
• Wasser und alle Zutaten bis und mit Salz in einen feuerfesten Topf geben.
• Aufkochen.
• Zugedeckt 10–15 Minuten kochen lassen. (etwa 4–5 Minuten länger, als auf der Verpackung angeben) Immer wieder umrühren, damit das Gericht nicht am Pfannenboden anbrennt.
• Gegen Ende der Kochzeit nach Belieben Tomatenpüree beigeben.
• Wenn nötig Wasser zufügen; am Schluss sollte alles Wasser verdampft sein.
• Mit Basilikumblättern ausgarnieren. Geriebener Käse oder Käsebröckli dazu servieren.
Die Umgebung ergänzt die Ausrüstung Zum Kochen selbst braucht es keine teure Ausrüstung. Drei grosse Steine können im Dreieck so platziert werden, dass der Topf darauf sicher steht. Weil das Feuer an der Flammenspitze am heissesten ist, kann auch ein Dreibein aus feuerfestem Material gute Dienste leisten. Die Erfahrung hat Reto Bühler gezeigt, dass sich ein Topf auf die unterschiedlichsten Arten aufhängen lässt. Teamwork und Kreativität ist gefragt. Ein herumliegender Stacheldraht oder etwas anderes kann beim Aufhängen des Topfes helfen. Den Kochtopf sucht sich der Outdoorfreak gerne auch in einem Brockenhaus. «Geeignet sind eigentlich alle Pfannen. Vorsicht ist bei Plastikgriffen geboten.»
Wer kein Feuer fürs Kochen oder Aufwärmen von Mahlzeiten entfachen will, findet in Outdoor-Geschäften alternative Heizquellen mit Spiritus, Benzin oder Gas und das zugehörige Material in unterschiedlichen Preislagen. Gleichzeitig heisst das aber auch, mehr Gewicht und Volumen im Rucksack mitzutragen.
Die Atmosphäre sorgt für den kulinarischen Genuss
Holzfeuer fasziniert immer wieder neu. Das allein ist schon ein Genuss. Da braucht es keine grossen Kochkünste oder komplizierte Rezepte, um den Hunger zu stillen. Reto Bühler gibt den Teilnehmenden gerne den Auftrag, irgendein Nahrungsmittel mitzubringen. Schön arrangiert bei der Feuerstelle, ist die Vielfalt der mitgebrachten Lebensmittel bereits eine Augenweide. Die Zutaten werden dann für eine Teigwarensauce oder auch für eine Suppe verwendet. Beide Gerichte brauchen ausser einem feuerfesten Topf kaum Material. Für eine Suppe berechnet man vier bis fünf Deziliter Wasser pro Person. Weil die Flüssigkeit sicher zehn Minuten kocht, kann das Wasser aus dem Bach oder aus geschmolzenem Schnee stammen. Allfällige Unreinheiten werden in dieser Zeit abgetötet. Während es mit etwas Bouillon gewürzt auf dem Feuer steht, können alle nach Belieben Saisongemüse in kleine Stücke schneiden und direkt in die Flüssigkeit geben. Für gute Stimmung, Gemeinschaft und eine individuelle


Suppe ist damit gesorgt. Damit Suppen auch sättigen, eignen sich Teigwaren, Reis, Gerste, Kartoffelwürfel oder rote Linsen, die in rund 15 Minuten gar sind. Werden die Zutaten von Beginn weg dem Wasser beigegeben, müssen ein paar wenige Minuten mehr dazu gerechnet werden. Die Suppe kann zu einer ausgewogenen Mahlzeit mit gekochten Kichererbsen, roten Bohnen oder Wursträdli ergänzt werden. Wer will, streut sich am Schluss noch geriebenen oder in Stücke gebrochenen Käse darüber.
Eintopfrezepte ebenfalls gut möglich
Auch sogenannte «one pot»-Rezepte (Eintopfrezepte) sind für das Kochen auf dem Feuer geeignet. Dabei gibt man alle Zutaten, zum Beispiel für Tomatenteigwaren, von Beginn weg in den feuerfesten Topf und kocht es mit dem Wasser gemeinsam auf. Wichtig ist dabei, dass man immer wieder gut rührt; je mehr Wasser verkocht umso mehr. Sonst brennt es schnell am Topfboden an. Robuste Handschuhe oder ein dicker Lappen schützen vor Verbrennungen. Sind die Teigwaren al dente, sollte auch das ganze Wasser verdampft sein. So bleiben alle Nährstoffe und Aromen im Gericht drin und müssen nicht mit dem Kochwasser weggegossen werden. Wer sich die Rüstarbeit draussen sparen will, kann wahlweise zu Hause alles schneiden oder getrocknete Gemüsestücke, tiefgekühltes Gemüse oder ausserhalb der Tomatensaison aus der Dose mitnehmen. Die Verpackungen bitte anschliessend zu Hause fachgerecht entsorgen. Bekannt ist das Backen von Schlangenbrot an einem Stecken. Reto Bühlers Variante für Fortgeschrittene: In einen grossen Topf drei Zentimeter Sand einfüllen. Den Brotteig in einen kleineren Topf legen und auf den Sand stellen. Nun die grössere Pfanne zudecken, in die Glut drücken und zusätzlich Glut auf den Deckel legen. Simpler ist das Prinzip «fire straight». Hier werden die Nahrungsmittel, wie Blumenkohl oder Kartoffeln, aber auch ganze Fische - ohne Topf - direkt ins Feuer gelegt. Die Kartoffel, egal, wenn die Schale etwas verbrannt ist, aufschneiden und mit Crème fraîche auslöffeln. Ein echter, einmaliger und unverfälschter Genuss. •

gefragt: Reto Bühler
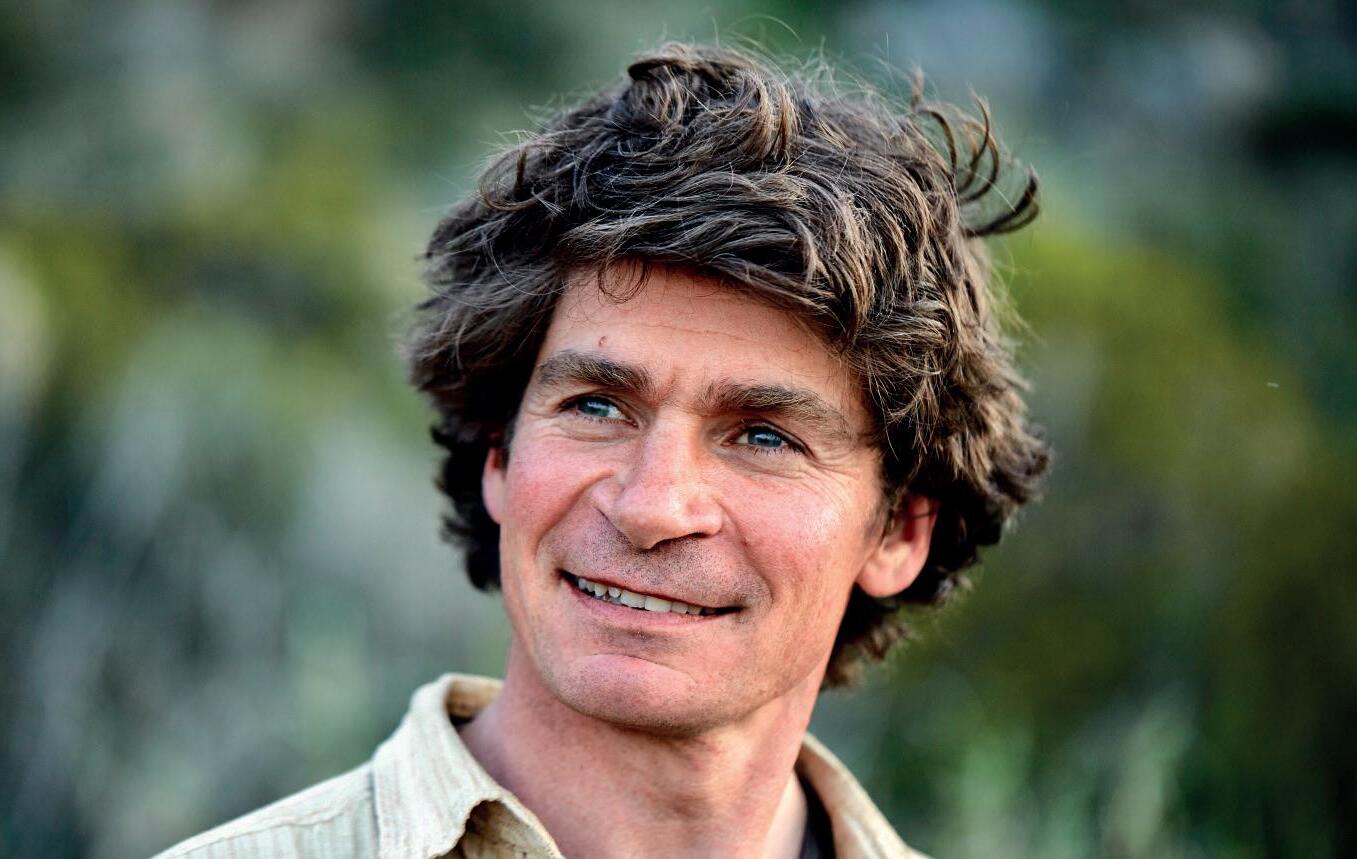
Ausbildner für natursportliche Erlebnispädagogik bei planoalto.
Was bedeutet für Sie das Kochen draussen?
Das Kochen im Freien ist für mich immer mit dem Feuer verbunden. Das allein ist faszinierend. Das Feuer hat so viele verschiedene Qualitäten, von der lodernden Flamme bis zur Glut.
Eignet sich das Kochen draussen für alle?
Auf jeden Fall. Es ist eine elementare, ja archaische Sache, die die Menschen seit Urzeiten über Generationen hinweg verbindet. Es erdet, weckt die Lebensgeister und nährt auf vielen Ebenen.
Welche Kompetenzen können sich die Gruppen in Ihren Ausbildungsgängen beim Kochen draussen aneignen?
Es ist ein Gemeinschaftswerk, bei dem jede und jeder etwas beitragen kann. Das Kochen auf dem Feuer fördert und fordert Kommunikation, Geduld, Improvisation und Kreativität. Das Befriedigen der Grundbedürfnisse stärkt das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit und hat heilsames Potential.
Zur Person
Reto Bühler hat sich nach einer Ausbildung zum Grund- und Realschullehrer zum Outdoorspezialist entwickelt. Er ist unter anderem als Wander-, Kletter- und Skitourenleiter tätig. Mehr über ihn erfahren Sie auf www.retobuehler.ch.



Was geschieht bei Nahtoderfahrungen? Wie erleben Menschen das Koma? Barbara Zanetti hat in Gesprächen hingehört auf Erfahrungen von Menschen, welche deren Leben prägten und eine neue Ausrichtung gaben. Das Ergebnis ist das Buch «Aus dem Herzen gesprochen».
Text: Barbara Zanetti
Die Idee zu diesem Büchlein ist nach einem Gespräch mit einem Menschen, dem die Stille und der Friede buchstäblich aus den Augen sprachen, langsam in mir herangereift. Es fragte in mir, was uns denn ermöglichen könnte, in diese Stille und diesen Frieden hineinzuwachsen. Welche Tore uns zur Verfügung stehen für den Zugang zum All-Eins-Sein und zur Quelle in unserem Herzen? Es zeigte sich, dass in diesem Büchlein Erfahrungen von ganz unterschiedlichen Menschen zu Worte kommen sollen. Bei der Auswahl habe ich mich von der Intuition leiten lassen und so einerseits vertraute und andererseits ganz unbekannte Personen zum Gespräch einladen dürfen. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes sind ihre Namen hier nicht genannt. Damit dennoch ein konkreter Mensch aus Fleisch und Blut hinter den Erfahrungen gespürt werden kann, sind der Jahrgang und die Berufsbezeichnungen dem Bericht angefügt. Wir haben uns jeweils aus dem Moment heraus in einem freien Gespräch leiten lassen, was gesagt sein soll. Es stellte sich heraus, dass es von meiner Seite her wenig zu bearbeiten gab an dem Erzählten. Ich versuchte, so nahe wie möglich bei dem Gesagten zu bleiben und kleidete es in eine mir sprachlich passend erscheinende Form.
Welche Absicht liegt hinter dem Text?
Die Hauptabsicht liegt darin, die Lesenden an eigene entsprechende Erfahrungen zu erinnern und sie zu ermutigen, diese wertzuschätzen und ihnen den nötigen Raum in ihrem Leben und im Alltag zu geben. Für einige von uns ist es noch fast ein Tabu, mit der Gabe von übersinnlicher Wahrnehmung oder mit heilenden Kräften gesegnet zu sein. Sie sprechen nicht darüber, zweifeln an ihren Wahrnehmungen und können so ihre Gaben nicht wirklich in den Dienst für alle stellen. Diese Erfahrungen, in denen Menschen sich besonders berührt, erfüllt, frei, verbunden mit allem, in Frieden gefühlt haben, sind uns allen zugänglich. Und sie können vertieft und erweitert werden, wenn wir daran anknüpfen und sie nähren und wachsen lassen. Sie können auch erinnern, dass wir das Getöse des Alltags und den Lärm der Gedanken im Kopf hinter uns lassen und nach innen lauschen können. Lauschen, hineinspüren, was die Seele uns mitteilen möchte. Erfahren, was sich durch die Stille ausdrücken könnte, welches Potential noch in uns schlummert. Den Erfahrungsberichten vorangestellt sind einige Besinnungen zu Themen, welche mir in den erwähnten Zusammenhängen wesentlich erschienen. Sie sollen dazu dienen, die Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen zu lesen und zu
meditieren. So wie wir Menschen vielschichtige Wesen sind, kann uns das Erzählte auf unterschiedlichen Ebenen berühren und Resonanz geben. Diese Reflexionen mögen auch anregen, eigene Befindlichkeiten und Erlebnisse in neuen Zusammenhängen zu sehen und ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln.
Erfahrungen die das Leben prägten und ihm eine neue Ausrichtung gaben
Zwei Text-Ausschnitte geben einen Vorgeschmack auf die 18 Erfahrungsberichte ganz unterschiedlicher Coleur: Zwei junge Frauen reisen nach Indien in einen Ashram, wo sie eine bekannte spirituelle Lehrerin anzutreffen hoffen: «Da holte sie eine Swami und führte sie durch all die Leute hindurch direkt vor Gurumayi, welche vorne auf einem Sessel war. Die abgemachte Zeit verpasst, unpassend angezogen im ärmellosen T-Shirt, nicht wissend wie man sich zu verhalten hätte vor einer spirituellen Lehrerin, standen die beiden da wie Ölgötze. Eine ganze Weile, eine Ewigkeit schien es, sah sie Gurumayi einfach an. Welch eine Erfahrung: wirklich gesehen zu werden! Erkannt zu sein mit allem, was einem ausmacht, auch mit der Vergangenheit und Zukunft! Gesehen und erkannt zu werden ohne dass man bewertet wird, einfach so. Irgendwann hielten sie es nicht mehr aus und gingen weg, wieder in den Garten. Sie weinte und ihre Freundin lachte Tränen. Die nächsten drei Tage blieben sie den Darshans fern.»
Ein Liedermacher erzählt, wie er zu seinen Texten und Melodien kommt: «Ideen zu Hauf kamen daher, damals nahm er sie auf und liess Lieder daraus entstehen, ohne viel damit zu arbeiten. Heute hat sich das geändert, er ist anspruchsvoller geworden und feilt manchmal lange an den Texten. Ja, die Ideen, sie können nicht erzwungen werden. Leise klopfen sie an, manche mehrmals, immer wieder. Bis er aufmerkt, erkennt, dass sie eingefangen werden möchten. Die Idee ist konkret, zum Beispiel taucht ein Reim auf zu einem Thema. Sie will im Moment des Auftauchens aufgeschrieben werden, sonst ist sie weg, meldet sich vielleicht nicht mehr. Der Liedtext dazu ist dann Arbeit, eine ganzheitliche, wo er mit Herz und Kopf mitwirkt. Wenn der Text einmal steht, ergibt sich für ihn die Melodie fast wie von selbst. Er braucht einen freien Kopf, Raum, damit die Ideen kommen können. Oder damit er sie wahrnehmen kann? Häufig geschieht es beim Wandern, dass eine daherkommt. Manchmal auch beim Zähneputzen. Er unterscheidet zwischen Ideen, welche von irgendwoher anklopfen und solchen, die im Kopf entstehen. Erstere sind überzeugender, von besserer Qualität.»
Wir erleben mehr als wir begreifen
Ein Gemeinsames dieser Erfahrungen ist der Umstand, dass sie alleine mit dem Verstand nicht zu erfassen und einzuordnen sind. Wenn wir nur glauben, was wir messen und wägen können, bedeuten uns solche Erlebnisse nichts. Dann werden sie als Phantasterei oder Tagträume abgetan. Häufig wird das Argument der sogenannten Wissenschaftlichkeit gegen sie angewendet. Sie sind weder mit dem Intellekt fassbar noch in einem Experiment wiederholbar. Dieser Begriff von Wissenschaft ist jedoch überholt, beruht auf veralteten Modellen der klassischen Physik. Wegweisende Forschungen in der Quantenphysik sind zu revolutionären Erkenntnissen gekommen, welche uralte spirituelle Weisheit schon seit langer Zeit in anderer Form verkündet.

Der Psychiater und Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung betonte: Wirklichkeit ist, was wirkt. Die Auswirkung im Leben ist also gemäss ihm der Prüfstein, ob eine Erfahrung lediglich Wunschdenken ist oder eine Realität, die in das Leben eingreift, es prägt und wandelt. Dieser Ansatz ist phänomenologisch, orientiert sich nicht an irgendwelchen methodischen Vorgaben oder Konzepten. Er nimmt voll ernst, was Menschen widerfährt und gibt die Bedeutung.
Bilder
Passend zu den Texten malte und zeichnete Eva Jakob intuitiv gefühlte Bilder. Sie entstanden durch ihren Bezug zur Natur und zu spirituellen Themen. Sie arbeitete als Ergotherapeutin und in der heilpädagogischen Frühförderung mit Familien. Geomantische Aus- und Weiterbildungen vertieften die Naturwahrnehmung sowie das kreative Gestalten mit Naturmaterialien.

Barbara Zanetti, *1962, Studium der ref. Theologie in Bern und Aix-en-Provence, 27 Jahre tätig als Pfarrerin im Berner Oberland. Es folgten Psychotherapiestudium am C.G. Jung-Institut in Küsnacht, Aus- und Weiterbildungen in Integraler Spiritualität, Kontemplation, Wahrnehmungs- und Intuitionsschulungen und langjähriger Kursbesuch von Yoga, Tai Ji / Qigong. Freischaffend führt sie eine Praxis für spirituelle Begleitung mit Traumarbeit (www.traeume-deuten.ch).

Weitere aussergewöhnliche Geschichten finden Sie in Barbara Zanettis Buch «Aus dem Herzen gesprochen». «natürlich»-Leser*innen erhalten mit dem Gutscheincode «natürlich» 20 % Rabatt und können das Buch zum Preis von 23.20 statt 29.– Franken bestellen.
104 Seiten, 13,5 × 20,5 cm, broschiert, Softcover ISBN 978-3-03818-367-9 www.weberverlag.ch

emaria/depositphotos.com
Haben Sie sich schon mit Methoden der Komplementär- und Alternativmedizin behandeln lassen oder damit geliebäugelt? Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie geeignete und qualifizierte Therapeut:innen finden, damit Sie sicher in guten Händen sind. Wäre doch schön, gäbe es ein verlässliches Label in der Art der Bio-Knospe – und auch noch mit entsprechender Suchmöglichkeit? Das existiert tatsächlich: das EMR-Qualitätslabel und die Therapeutensuche des EMR.
Text: Roger Delle
Damit wird Ihnen bei der Wahl einer Therapeutin oder eines Therapeuten geholfen: Auf der Website des ErfahrungsMedizinischen Registers EMR www.emr.ch finden Sie die Therapeut:innen, die über das EMR-Qualitätslabel verfügen. Diese bieten Ihnen die Wahl unter rund 200 Behandlungsmethoden und Berufsabschlüssen aus der Erfahrungsmedizin an – ein Oberbegriff, der Komplementär- und Alternativmedizin (KAM), aber auch noch weitere therapeutische Bereiche zusammenfasst und das zugrunde liegende Erfahrungswissen betont.1)
Sicherheit und Orientierung im Angebots-Dickicht Es scheint nicht einfach, sich bei dieser Vielzahl im AngebotsDickicht zu orientieren. Auch dafür gibt Ihnen die EMR-Online-Therapeutensuche (kurz: EMR-Guide) eine Orientierungshilfe. Zu jeder Methode – von der Naturheilkunde bis zur Kunsttherapie – erhalten Sie eine Beschreibung mit Definition, Herkunft und Grundlagen. Und vor allem erlaubt Ihnen der EMR-Guide, zur gewünschten Methode die qualifizierten Therapeut:innen in Ihrer Nähe zu finden.
Es gibt in der Schweiz vermutlich weit über 30’000 Personen, die im weitesten Sinn KAM-Methoden anbieten. Im EMRGuide sind jene Therapeut:innen aufgeführt, die mit dem EMR-Qualitätslabel ausgezeichnet sind. Das heisst, dass Sie auf deren Qualität vertrauen können. Und das ist eine not-
wendige Grundvoraussetzung, denn die Wahl einer Therapeutin oder eines Therapeuten ist Vertrauenssache, wie die Umfrage «KAM-Barometer» ergeben hat – eine repräsentative Erhebung zu den Erfahrungen der Schweizer Bevölkerung mit der Komplementär- und Alternativmedizin (siehe natürlich 01-02/22).
Seriöse Ausbildung – stetige Weiterbildung Wer über das EMR-Qualitätslabel verfügt, hat zum einen eine seriöse Ausbildung abgeschlossen und wurde vom EMR beurteilt und zertifiziert. Zum anderen lassen diese Therapeut:innen ihre Qualität regelmässig überprüfen. Nur wer sich nachweislich weiterbildet und entsprechende Kriterien erfüllt, erhält die jährliche Erneuerung des EMR-Qualitätslabels.
Auch in der Erfahrungsmedizin sind berufliche Kompetenzen eine wichtige Grundlage für die Patientensicherheit. Das EMRQualitätslabel gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten gut aufgehoben sind. Dafür, dass Sie sich auf den Wert des EMR-Qualitätslabels verlassen können, garantieren die qualifizierten Mitarbeitenden und Fachspezialisten des EMR. Dieses verfügt über eine lange Erfahrung: Das EMR-Qualitätslabel ist seit 1999 schweizweit anerkannt und trägt zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit bei. (Mehr über das EMR-Qualitätslabel und die Kriterien dafür erfahren Sie in der Spalte am rechten Seitenrand.)
So funktioniert die Therapeutensuche Mit dem EMR-Qualitätslabel und der Therapeutensuche EMR-Guide unterstützt das EMR die Öffentlichkeit bei der Wahl qualifizierter Therapeut:innen. Und wie funktioniert diese Therapeutensuche? Geben Sie einfach auf www.emr.ch die gewünschte Methode und den Ort ein und wählen Sie Ihre Therapeutin oder Ihren Therapeuten aus. Dazu stehen Ihnen verschiedene Suchkriterien zur Verfügung wie Sprache, Öffnungszeiten, Ausstattung, Zahlungsmöglichkeiten oder Erreichbarkeit – zum Beispiel, ob ein barrierefreier Zugang besteht. Sie können auch direkt nach dem Namen einer Therapeutin oder eines Therapeuten an einem gewünschten Ort suchen.
Krankenversicherer stützen sich auf das EMR-Qualitätslabel ab Ein wichtiger Aspekt, der ebenfalls für das EMR-Qualitätslabel spricht: Fast alle Schweizer Krankenversicherer nutzen dieses als Entscheidungsgrundlage für die Vergütung von Leistungen im KAM-Bereich. Diese gehören nicht zur Grundversicherung. Eine Behandlung durch nicht-ärztliche Therapeut:innen wird nur dann vergütet, wenn Sie eine entsprechende Zusatzversicherung abgeschlossen haben.
Welche Behandlungsmethoden vergütet, welche Kosten übernommen und welche Therapeut:innen als Leistungserbringer akzeptiert werden – all dies ist von Versicherer zu Versicherer und von Vertrag zu Vertrag verschieden. Gleiches gilt auch für die Übernahme von Kosten aus dem Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention.
Informationen zu Grundlagen für Vergütung Bezüglich der Vergütungen durch die Versicherer leistet Ihnen der EMR-Guide ebenfalls wertvolle Hilfe. Zu jeder KAM-Methode, für die Therapeut:innen EMR-zertifiziert werden können, erfahren Sie, ob Ihr Versicherer diese anerkennt. Das stellt zwar noch keine Garantie für den Einzelfall dar, die Aussichten sind aber gut, dass Ihr Versicherer in diesem Fall die Kosten für die Behandlung übernimmt.
Eines ist auf alle Fälle sicher: Jede Therapeutin und jeder Therapeut im EMR-Guide verfügt über ein aktuelles EMR-Qualitätslabel. Sie können also darauf vertrauen, dass Sie bei diesen Therapeut:innen in guten Händen sind. Selbstverständlich ist die Therapeutensuche des EMR kostenlos. Nutzen Sie diese Orientierungs- und Entscheidungshilfe, um Ihre Therapeutin oder Ihren Therapeuten mit der geeigneten Behandlungsmethode zu finden.
Verlässliche Kriterien –laufend weiterentwickelt
Therapeut:innen, die mit dem EMR-Qualitätslabel ausgezeichnet sind, unterziehen sich einer sorgfältigen Prüfung. Sie müssen nachweisen,
• dass sie über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung und umfangreiche fachliche Kompetenzen verfügen.
• dass sie sich regelmässig fortbilden.
• dass sie strafrechtlich unbescholten sind.
• dass sie praktische Erfahrung mit Patient:innen haben.
• dass sie über eine Berufshaftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung verfügen.
Darüber hinaus verpflichten sich die Therapeut:innen den Werten und Normen des EMR-Berufskodex. Und damit nicht genug: Das EMR-Qualitätslabel ist jeweils für ein Jahr gültig. Um es zu erneuern, belegen Therapeut:innen jedes Jahr aufs Neue, dass sie den EMR-Qualitätsstandard erfüllen und die geforderten Fort- und Weiterbildungen absolviert haben.
Auch die EMR-Qualitätskriterien stehen Jahr für Jahr auf dem Prüfstand. Sie werden laufend mit Berufsverbänden, Organisationen der Arbeitswelt, Bildungsanbietern, Versicherern und Behörden abgestimmt und bei Bedarf aktualisiert. So ist sichergestellt, dass der EMR-Qualitätsstandard immer aktuell ist.
Das Team des EMR ist hochqualifiziert und verfügt über ein umfangreiches Fachwissen. Einige der Mitarbeitenden sind selbst Therapeut:innen und bringen vielfältige Spezialkenntnisse mit. Die Vergabe des EMR-Qualitätslabels erfolgt nach einem standardisierten, qualitätsgesicherten Prozess. Dabei wird jeder Antrag sorgfältig geprüft. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle Anträge gleich bearbeitet und beurteilt werden. Kurzum: Sie können auf das EMR-Qualitätslabel vertrauen.
Qualifizierte Therapeut:innen einfach online finden
Wie finde ich qualifizierte komplementär- und alternativmedizinische Therapeut:innen? Und werden ihre Leistungen von meiner Versicherung rückerstattet? Das sind Fragen, die sich die meisten von Ihnen wohl immer wieder stellen.
Qualifizierte Therapeut:innen erkennen Sie am EMR-Qualitätslabel: Aktuell sind über 24’000 Therapeut:innen für rund 200 Behandlungsmethoden sowie Berufsabschlüsse EMRzertifiziert und von den meisten Versicherern anerkannt. Und Sie finden sie am einfachsten und schnellsten auf: www.emr.ch
1) Der Einfachheit halber verwenden wir in diesem Beitrag die Abkürzung KAM (Komplementär- und Alternativmedizin) für den gesamten erfahrungsmedizinischen Bereich.

Feng-Shui
Wandbild Universum
Die Wandbild-Gestaltungen von Anima Pura beruhen auf Feng-Shui-Grundsätzen. Sie bringen die Atmosphäre eines Raumes in ein gutes Gleichgewicht und erleichtern ein harmonisches Fliessen des Qi. Mit ihren klaren Formen und Farben wirken sie unaufdringlich und fein. Anima Pura Wandbilder eignen sich für Therapieräume, Erholungsräume, Empfangsbereiche, Meditationsräume und Wohnräume.
www.anima-pura.ch

U Mami!
Gesund, Fein und Bio!
Zellavie® Bio-Wietofu ist eine tofuartige Zubereitung aus hochwertigen, regionalen Bio-Hanfsamen und Wasser. Probieren Sie es aus, verwenden Sie Wietofu in Ihren Lieblingsrezepten, anstelle von Fleisch und Tofu.
Jetzt bestellbar auf zellavie.ch

Seminare
Psychologie Grundkurs für den Berufs- und Praxisalltag
Eignen Sie sich psychologisches Wissen an, um Denken, Handeln, verbale und nonverbale Kommunikation besser zu verstehen. Stärken Sie durch diesen 5-tägigen Kurs Ihre Ressourcen und Ihre Resilienz. Entwickeln Sie Ihr eigenes Potenzial zu mehr Wahrnehmung und Selbstsicherheit. Start: 08.10.22, via Zoom. Mehr Infos unter: www.ikp-therapien.com (Rubrik Seminare)

Weiterbildung
Spirituelle Sterbebegleitung aus der Sicht des tibetischen Buddhismus
Der Mensch kann weder seinen Körper noch sein Geld oder seine Liebsten mitnehmen. Was von ihm übrig bleibt, ist sein Geist, seine Seele. Für den Begleiter ist es daher wichtig zu wissen, wer oder was der Geist ist, wie er funktioniert und wie wir ihm begegnen können. Am 23./ 24. April mit Dorothea Mihm, Mitautorin des Buches: Die sieben Geheimnisse guten Sterbens.
LIKA GmbH in Stilli b. Brugg, Tel. 056 441 87 38, www.lika.ch.

Reizdarm
Hilfe bei den Symptomen des Reizdarmsyndroms
Lactibiane Plus enthält den mikrobiotischen Stamm Lactobacillus gasseri LA806. Mit seinem grossen Anhaftungsvermögen an den Zellen des Darms, bildet er einen Schutzfilm auf der Darmwand gegen pathogene Bakterien und Toxine, die Symptome wie Verstopfung, Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen verursachen. Ohne Konservierungsstoffe, Süssstoffe, Aromen, Laktose oder Gluten.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.phytolis.ch

Weiterbildung
Luven – ein kleines Bergdorf –ein berührendes Erlebnis
Erlebnis- und Themenwochen im sonnigen Kanton Graubünden.
Coaching, Yoga, Morgenritual, Kosmetik, Massage und viel Natur
01.05. – 07.05.22 Erlebniswoche 18.09. – 24.09.22 Erlebniswoche 15.10. – 22.10.22 Themenwoche 22.01.– 28.01.23 Erlebniswoche
www.berg-luft.ch, Ricarda 077 202 26 33, Gerda 079 820 14 71


Gesundheit
Kräuterwissen noch und noch
Kräuter stehen für Gesundheit, aber auch für Genuss und Lebenslust. Ihre Vielfalt reicht weit über die Stars wie das Johanniskraut oder den Thymian hinaus. Durchstöbern Sie die umfassende Kräuterwissen-Sammlung der EGK-Gesundheitskasse. Erfahren Sie dabei, wo Sie die Kräuter finden und wie Sie sie anwenden – schmackhafte Rezepte inklusive. www.egk.ch/kraeuterwissen



Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Antoinette Bärtsch, Pete Kaupp, Renate von Ballmoos, Marcel Briand, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Kokopelli Guadarrama, u.a.
Nächster Ausbildungsbeginn: Mittwoch 27. April 2022
(die Ausbildung vom 26. März 2022 ist ausgebucht)
«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»
Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen
Tel. 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch

Entspannung pur Auszeit im Wald
In einem wildromantischen Wandergebiet mit Kastanienwäldern und Wasserfällen. Und Übernachten im B&B und Seminarhaus Albergo Casa Santo Stefano.
09.4. – 14.4. Yogaferien
18.4. – 22.4. Yogaretreat
22.4. – 24.4. Yogaweekend
02.5. – 07.5. Yogaretreat
07.5. – 12.5. Yoga & Pilates
12.5. – 15.5. Yogaretreat
15.5. – 20.5. Yoga & Auszeit à la carte
20.5. – 25.5. Yogaferien
Casa Santo Stefano – Miglieglia 091 609 19 35 | casa-santo-stefano.ch
«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt.»
Neu: Finanzierung Ihrer Ausbildung durch Bundesbeiträge Mit Option zum eidg. Diplom
Info-Abend: 19. Mai
Info-Abend: 2. Mai 3 Jahre, ASCA u. SGfB-anerk
Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung.

Dipl. Paar- und Familienberater/in IKP Ganzheitliche systemische und psychosoziale Beratung sowie Coaching-Tools rund um Beziehungen. 3 Jahre, SGfB-anerk.
Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden. IKP Institut, Zürich und Bern
Seit 30 Jahren anerkannt




Lösung des Rätsels aus dem Heft 03/2022
Gesucht war: Entspannung
Vorname Name
Strasse PLZ / Ort
Lösung
Gewinnen Sie!
Gewinne eins von vier Jentschura
DreiSprung-Sets im Wert von je CHF 86.50 mit 7×7® KräuterTee, WurzelKraft® und MeineBase®

Und so spielen Sie mit: Senden Sie den Talon mit der Lösung und Ihrer Adresse an: Weber Verlag, «natürlich», Gwattstrasse 144, 3645 Gwatt Schneller gehts via Internet: www.natuerlich-online.ch/raetsel
Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 27. April 2022. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

41. Jahrgang 2022, ISSN 2234-9103
Erscheint 10-mal jährlich
Druckauflage: 22 000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 14 820 Exemplare (WEMF/KS beglaubigt 2020)
Kontakt
mail@natuerlich-online.ch www.natuerlich-online.ch
Herausgeber und Verlag
Weber Verlag AG
Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun/Gwatt Tel. +41 33 336 55 55 leserbrief@natuerlich-online.ch
Verlegerin
Annette Weber-Hadorn a.weber@weberverlag.ch
Verlagsleiter Zeitschriften
Dyami Häfliger d.haefliger@weberverlag.ch
Redaktionsadresse «natürlich»
Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun/Gwatt
Chefredaktor
Samuel Krähenbühl s.kraehenbuehl@weberverlag.ch
Leserberatung
Sabine Hurni s.hurni@weberverlag.ch
Autor*innen
Fabrice Müller, Eva Rosenfelder, Sabine Hurni, Chantal Agthe, Leila Dregger, Erna Jonsdottir, Andreas Krebs, Steven Wolf, Jürg Lendenmann, Alice Hofer, Samuel Krähenbühl, Gabriela Gerber, Monika Neidhart, Barbara Zanetti, Roger Delle, Andreas Walker
Grafik/Layout
Shana Hirschi
Copyright Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung durch den Verlag. Für unverlangte Einsendungen wird jegliche Haftung abgelehnt.
Anzeigenleitung
Dino Coluccia, Tel. +41 76 324 64 45 d.coluccia@weberverlag.ch
Anzeigenadministration/Marketing
Blanca Bürgisser Tel. +41 33 334 50 14 b.buergisser@weberverlag.ch
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Aboverwaltung
abo@weberverlag.ch
Tel. 033 334 50 44
Druck
Vogt-Schild Druck AG, CH-4552 Derendingen
Weber Verlag AG www.weberverlag.ch
Bildnachweise
Adobe Stock
Seiten: 1,3,5,6,7,9,10,11,12,13,22,23,24,25,29,30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 65
Andrea Abegglen
Seiten: 3,20
Andreas Walker Seiten: 46, 47
Mai

Haut. Unsere Haut ist eines der grössten und wichtigsten Organe des Körpers. Ihre Pflege ist deshalb wichtig. Wir sagen, wie es geht. Psioriasis.
Eine unangenehme Hauterkrankung. Aber es gibt Wege zur Heilung. Gesichtsmaske aus dem Kühlschrank. Eine gute Gesichtsmaske muss weder kompliziert noch teuer sein. Ein Griff in den Kühlschrank genügt. Berührungen. Unsere Haut reagiert sehr sensibel auf KonHäute in der Tierwelt. So verschieden die Tierarten, so verschieden die Häute, welche die Tiere tragen. Wir zeigen einige Rekorde und Kuriositäten.


«natürlich» 05/22 erscheint am 28. April 2022
Kontakt /Aboservice: Telefon 033 334 50 44 oder abo@weberverlag.ch, www.natuerlich-online.ch

Das vielstimmige Vogelkonzert frühmorgens, die Rückkehr der Schwalben, zarte Blumen noch wie ein Hauch über den Gräsern; was für ein Zauber ist doch dieses Erwachen der Natur! Schon gaukeln Schmetterlinge wie ein «Kleiner Fuchs» oder ein «Tagpfauenauge» über den Blüten und schlürfen ersten Nektar, es knackt und raschelt im Geäst. Wer ist da unterwegs?
Unser Naturparadies ist verwildert. Gleich will ich mal den frechen Brombeeren an den «Kragen», die sich allzu viel Raum erobert haben. Da bekomme ich Gesellschaft. Ein Rotkehlchen hüpft herbei, wagt sich erstaunlich nahe heran, um mich aufmerksam zu beäugen, nicht ohne sein Köpfchen hektisch hin- und her zu drehen, um mögliche Gefahren im Blick zu behalten. Auf seinen dünnen, staksigen Beinchen hüpft es noch etwas unsicher hin und her. Da ich aber still und unbeweglich verweile, fasst es bald mehr Vertrauen und wir mustern uns eingehender. Was für ein überaus hübsches Kerlchen mit diesem leuchtend orangen Brüstchen, ein flauschiges und echt putziges «Kügelchen»!
Seine Vorsicht schwindet immer mehr. In nur wenigen Metern Abstand pickt der Vogel eifrig in einem Laubhaufen, um dann die von mir offen gelegte Erde zu inspizieren. Bald erwischt er etwas, das ich – etwas kurzsichtig leider –, nicht genau erkenne. Schwupps –und weg ist das Kerlchen, im Dickicht verschwunden. Insekten und ihre Larven, Spinnen oder kleine Würmer, Baumsamen oder Beeren – alles, was so ein Kerlchen braucht, ist hier zuhauf vorhanden. Ein echtes Rotkehlchen-Schlaraffenland.
Der Vogel hat mich daran erinnert, mit Sorgfalt zu wirken und kein Nest herunterzureissen. Die Brutzeit hat begonnen. Hier wäre ein gutes Brutrevier, eine halbe Hektare Naturgarten, wo sich die bodennah brütenden Vögel bestens vor Raubvögeln wie Habicht, Sperber oder Falken verbergen können. Allerdings bauen Rotkehlchen ihr Nest manchmal direkt auf der Erde oder sehr bodennah im Gebüsch. Leichte Beute, wenn Fuchs, Marder, Wiesel, freilaufende Katzen oder Igel die Eier oder Jungvögel entdecken – lieber stelle ich es mir gar nicht erst vor

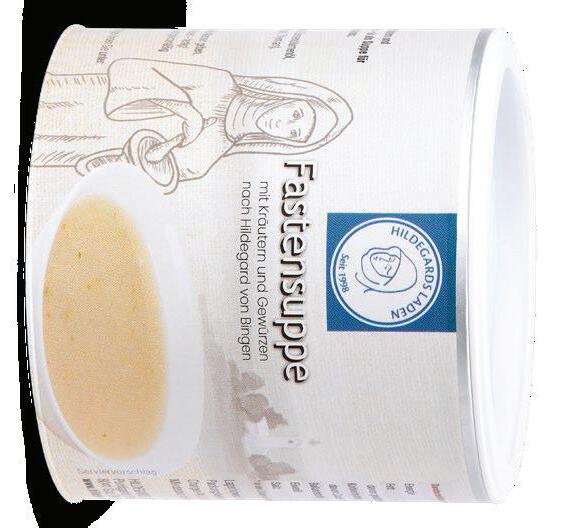
Ob ich eben ein treusorgendes Männchen auf Futtersuche getroffen habe? Bei den Rotkehlchen sind die beiden Geschlechter kaum zu unterscheiden. Während der Brutzeit füttern die Männchen das Weibchen. Für eine Saison monogam bewältigen sie die Brutzeit gemeinsam. Danach geht es wieder auf in getrennte Reviere, die kämpferisch und aggressiv bis zur nächsten Balzzeit gegen alle anderen Artgenoss*innen verteidigt werden. Und da fliegen zuweilen die Fetzen – gar nicht mehr so putzig. Die «Rotkehlinnen» sind echt emanzipierte «Weiber». Sie sind die Konstrukteurinnen und alleinigen Bauarbeiterinnen des Nestes, singen den Männchen gleich aus voller Kehle und verteidigen wie diese mit ihrem hübschen Gesang ihr Revier, meist nahe ihrem einstigen Brutplatz.
In germanischen und keltischen Legenden galt dieser kleine Vogel gar als Überbringer der Sonne, das orange Brüstchen dieses Kerlchens leuchtet bis heute wie eine kleine Sonne. Während ich nach getaner Arbeit dem Abendlied der Vögel lausche, meine ich die perlende Melodie meines kleinen «Freundes» herauszuhören. Mancherorts soll die Vielfalt seines Gesangs mehr als hundert Strophen umfassen – durch so zahlreiche Varianten gaukelt der schlaue Vogel seinen Artgenoss*innen vor, dass sich im Revier schon mehrere kraftvolle und wehrhafte «rote Brüste» aufhalten, was konkurrierende Eindringlinge garantiert abschreckt.
Nun, bei mir bewirkt es das pure Gegenteil: Ich bleibe umso länger hier in der Dämmerung sitzen, lausche den langsam verstummenden Vogelstimmen, während die orange-goldene Abendsonne mein Herz mit Wärme erfüllt – und nicht nur sie •
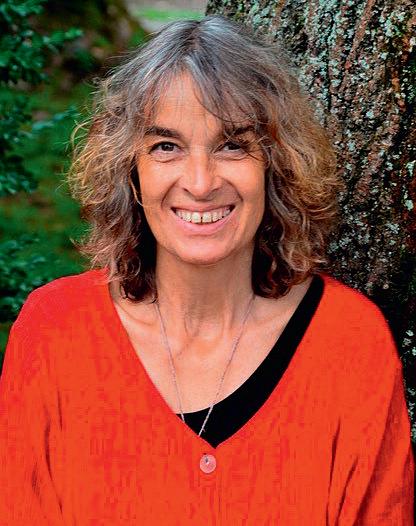
Eva Rosenfelder ist Autorin/Journalistin BR. In ihrer Serie schreibt sie für «natürlich» über kleine und grosse Glücksmomente des Alltags. Mehr über die Autorin und ihre Angebote wie Naturspaziergänge und Naturorakel erfahren Sie unter www.natur-und-geist.ch

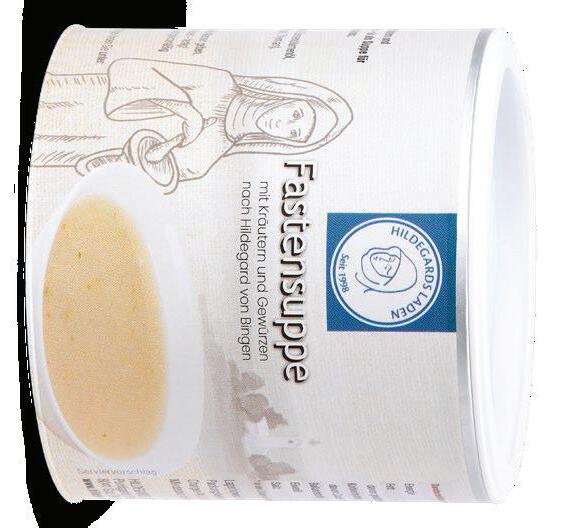

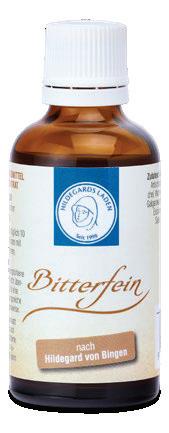







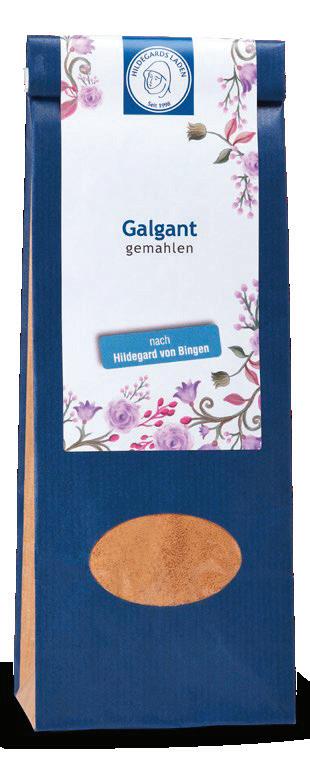



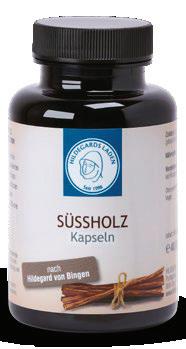
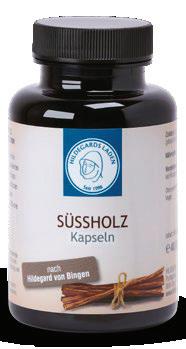









Excellence – kleine Schweizer Grandhotels
Die Excellence Royal bietet Platz für 144 Gäste. Die Kabinen befinden sich aussen, sind erstklassig-exquisit ausgestattet: Dusche/ WC, Sat.-TV, Minibar, Safe, Föhn, Haustelefon, individuell regulierbare Klimaanlage, Heizung und Stromanschluss (220V). Lift von Mittel- zu Oberdeck. Entrée mit Lobby, Rezeption und Boutique. Stilvolles Restaurant, Panoramalounge mit Bar. Sonnendeck mit Sitzgruppen und Schattenplätzen, Whirlpool, Fitnessbereich mit Sauna. Willkommen an Bord!
Von der Weltstadt Paris bis zu den endlosen Stränden der Côte Fleurie: Auf dieser Genussreise erwarten Sie Uferkulissen, wie sie abwechslungsreicher kaum sein könnten. Hier das pulsierende Leben der französischen Metropole, dort die sattgrüne Idylle der Normandie.
Tag 1 Schweiz > Paris Busanreise nach Paris.
Tag 2 Paris Morgens gemütliche Bootsrundfahrt auf der Seine* oder Workshop in einer Parfumerie (Fr 125). Nachmittags Besuch des Quartiers Montmartre und Sacré-Coeur* oder Massanfertigung eines Hutes (Fr. 120). Abends legt die Excellence Royal ab.
Tag 3 Les Andelys Ausflug* nach Lyons la Forêt mit Besuch der Ruine des Schlosses Gaillard oder kleine Wanderung zum Schloss Gaillard (Fr. 48).
Tag 4 Caudebec-en-Caux > (Honfleur)
Ganztagesausflug* nach Honfleur mit Stadtrundgang und Mittagessen. Nachmittags Besuch einer Calvados-Brennerei inkl. Degustation.
Tag 5 Caudebec-en-Caux > (Étretat) Ausflug* nach Étretat zur Alabasterküste. 6-Gang-Gourmetmittagessen inkl. Getränke (Fr. 175) im Restaurant von David Goerne.
Tag 6 Rouen Stadtrundgang* in Rouen, der Stadt der 100 Türme. Am Nachmittag Schloss Vascoeuil mit grossem Garten und unzähligen Skulpturen (Fr. 55).
Tag 7 Vernon Busausflug* nach Giverny. Besuch Wohnhaus und Garten von Claude Monet oder malerische E-Bike-Tour entlang der Seine (Fr. 80).
Tag 8 Paris > Schweiz Busrückreise zu Ihrem Abreiseort.
*Excellence Ausflugspaket
8 Tage ab Fr.
inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord
Reisedaten
* Reise mit leicht geändertem Reiseverlauf Preise pro Person Fr.
Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis Hauptdeck 2-Bett
Oberdeck 2-Bett, frz. Balkon
Sofortpreis mit beschränkter Verfügbarkeit Das Excellence-Inklusivpaket
• Excellence Flussreise mit eleganter Flussblick-Kabine
• Genuss-Vollpension, Willkommenscocktail
• Excellence Fluss-Plus: Komfort-Reisebus für An-/Rückreise und Ausflüge, während der ganzen Reise
• Chansonabend mit Patrice Mestari
• Excellence-Kreuzfahrtleitung Zuschläge
• Reise 29.05.,12.06. 55
• Alleinbenützung Mittel-/Oberdeck 895
• TGV An-/Rückr. 1. Kl. inkl. Transfer ab 275
• TGV An-/Rückr. 2. Kl. inkl. Transfer ab 175
• Königsklasse-Luxusbus 245
• Klimaneutral reisen, myclimate +1.25%
• Excellence Ausflugspaket, 7 Ausflüge 263
• Treibstoffzuschlag 40
Europa neu sehen:
excellence.ch/mittendrin
Wählen Sie Ihren Abreiseort
06:10 Wil p
06:30 Burgdorf p
06:35 Winterthur-Wiesendangen SBB
07:00 Zürich-Flughafen p
07:00 Aarau SBB
08:00 Baden-Rütihof p
08:35 Basel SBB
08:50 Arlesheim, c/o Birseck Reisen p
Ihre

Mehr zu dieser Reise & Buchung