Starkes Ich 10 Schritte für psychische Gesundheit
natürlich Optimismus
Überleben
Vom Mut, nie aufzugeben
Erholsame Nachtruhe
So schlafen Sie wie ein Murmeltier

Fliegen lernen Dein Potenzial entfalten
Humor Lachen ist die beste Medizin
Was eine lebensbejahende Grundhaltung auszeichnet
Trockene Haut? Ausschlag? Juckreiz?



OMIDA® Cardiospermum-N Salbe bei trockenen, juckenden Hautausschlägen sowie akuten und chronischen Entzündungen.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.


Erwarten Sie das Beste!
Liebe Leserin, lieber Leser
Samuel Krähenbühl
Sind Sie optimistisch? Viele werden jetzt bereits etwas ins Grübeln kommen. Denn das Wort «Optimismus» ist auf der einen Seite positiv besetzt. Aber bei einigen mag ein starker Optimismus vielleicht schon als Naivität gelten. Gehen wir doch mal zurück zum Ursprung des Wortes. «Ad fontes», zur Quelle, wie es auf Lateinisch heisst. Denn Optimismus ist ein pur lateinisches Wort. Es ist die grösste Steigerung des Wortes «bonus», was «gut» bedeutet. Der Komparativ heisst in diesem Falle «melior», also «besser». Und «Optimus» ist der Superlativ, also die höchste Steigerungsform und bedeutet der oder das «Beste» oder «am besten».
Optimismus ist also eine Lebenshaltung, die immer das Beste will, auf das Beste hofft, das Beste sucht. Und nun noch einmal zurück zur Frage, ob eine solche Lebenshaltung nicht als naiv gelten könnte? Nicht alles ist immer gut, geschweige denn am besten. Wir erleben als Menschen und als Gesellschaft immer wieder Rückschläge, schwierige Zeiten, Krankheit und Tod.
Im Porträt über Rolando Schutzbach lesen Sie, warum man bei allen Herausforderungen des Lebens optimistisch sein sollte. Er ist ein Paradebeispiel eines Menschen, der diese optimistische Haltung lebt. Ja, er predigt sie geradezu. Zentral für ihn ist das Lachen. Seine klare Meinung: Man lacht nicht, weil man fröhlich ist. Man ist fröhlich, weil man lacht.
Immer optimistisch enden auch die Märchen der Gebrüder Grimm. Zwar ist der Inhalt manchmal brutal. Da verstossen Eltern ihre Kinder, Stiefmütter starten gar Mordversuche gegen ihre Pflegkinder und böse Hexen treiben ihr sprichwörtliches Unwesen. Doch am Ende werden die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Und wenn die Guten nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Wir gehen auch hier der Frage nach, was dahintersteckt.
Kein Märchen, aber eine Geschichte, die letztendlich hoffnungsvoll stimmt, hat Patrizia Manolio erlebt. Sie wurde vergewaltigt, erkrankte schwer an Krebs und brauchte eine Nierentransplantation. Wie hat sie all die Schicksalsschläge er- und überlebt? So viel sei schon hier verraten: Sie ist eine Kämpferin. Und auch eine Optimistin.
Dies alles und noch mehr gibt es in der Winterausgabe von «natürlich» zu lesen. In diesem Sinne wünschen wir allen ein optimistisches neues Jahr und stets gute Gesundheit!
Samuel Krähenbühl

Chefredaktor

Schweizer Vielfalt.

Spannende Hintergruninformationen




Inhalt Service
GESUND SEIN
10 Lach dich frei!
Roland Schutzbach zelebriert die beste Medizin: den Humor.
14 Starke Psyche
10 Tipps, wie Sie sich selbst etwas Gutes tun können.
18 Wie Märchen wirken
Die tiefen Botschaften hinter den oft schaurigen Geschichten.
26 Sabine Hurni über… … das gesunde Frühstück.
28 Leserberatung
Von Fusskrämpfen, laufenden Nasen und steifen Gelenken.
GESUND WERDEN
32 Überlebensmut
Die dramatische Geschichte von Patrizia Manolio gibt verzweifelten Menschen Mut.
36 Persönliches Wachstum Wie wir unser Potenzial voll entfalten können.
40 Gesunder Schlaf
Wieso die Nachtruhe so wichtig ist und wie wir wieder richtig gut schlafen können.
46 Wolfs Heilpflanze
Der Hasel steht für Harmonie und Vollkommenheit.
DRAUSSEN SEIN
54 Mein Apfelbaum
Jetzt ist es Zeit, Bäume zu pflanzen. «natürlich» zeigt, wie es geht.
58 In die Pilze gehen
In heimischen Wäldern wachsen jetzt die delikaten «Kalbfleischpilze».

Jentschuras BasenKur
04 Editorial / 06 Leben & heilen / 31 Liebesschule / 45 Alice im Wunderland / 50 Staunen & wissen / 62 Neu und gut / 62 Hin und weg / 64 Rätsel / 65 Impressum und Vorschau / 66 Eva unterwegs


Fasten erleichtert den Körper und beflügelt Geist und Seele nach der bewährten P. Jentschura Methode 7x7® KräuterTee – der geniale Basentee mit 49 Kräutern WurzelKraft® – der Rundumversorger mit 103 Pflanzen MeineBase® – das Original unter den Basenbädern mit pH 8,5
Kostenlos Proben & Infos bestellen p-jentschura.com/nch18
Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ www.jentschura-shop.ch
& leben heilen

Operation

Erkältung
Ingwer schützt
Ingwer (Zingiber officinale) enthält reichlich ätherische Öle wie das Gingerol. Diese sind sehr gesund und verleihen der Knolle die typische Schärfe. Wegen seiner «wärmenden» Eigenschaften ist Ingwer ein ideales Naturmittel zur Vorbeugung von Erkältungen:
Es fördert die Durchblutung der Schleimhäute im Mund- und Rachenraum und wirkt so Infektionen entgegen. Dazu kann man mehrmals täglich ein Glas Ingwertee trinken (schmeckt besonders gut mit einem Schuss Orangensaft). Als Alternative bietet sich Ingwermilch an. Dazu 1 TL geriebenen Ingwer in 200 ml warme Milch geben, ein paar Minuten sanft köcheln und bei Bedarf mit etwas Honig süssen. krea
Ohr-Akupunktur lindert die Angst
Fast jeder Patient verspürt Angst vor einem operativen Eingriff. Eine Ohr-Akupunktur kann über die Stimulation des Vagusnervs präoperative Ängste wirksam, kostengünstig und ohne Nebenwirkungen lindern. Dies zeigt eine systematische Übersichtsarbeit, für die Mediziner von der Berliner Charité 15 randomisierte, kontrollierte Studien mit insgesamt 1603 Teilnehmern ausgewertet hatten. Demzufolge war eine Ohr-Stimulation deutlich wirksamer als keine Behandlung und auch einer Scheintherapie (Placebo) überlegen. Die beobachteten Effekte waren vergleichbar mit denen von angstlösenden Psychopharmaka (Benzodiazepine). MM
Antibiotikaresistenz
Hoffnung dank Künstlicher Intelligenz
Forschende des Universitätsspitals Basel und der ETH Zürich haben gezeigt, dass sich Resistenzen von Bakterien mittels neuartigen Computeralgorithmen deutlich schneller ermitteln lassen als bisher. Dies könnte helfen, schwere Infekte in Zukunft effizienter zu behandeln – und wäre ein grosser Fortschritt im Kampf gegen antibiotikaresistente Bakterien. Rund 300 Menschen versterben alleine in der Schweiz pro Jahr an Infektionen, die durch multiresistente Bakterien verursacht wurden. unispital-basel.ch
«
Es ist der Geist, der sich den Körper baut. »
Friedrich
Schiller (1759 – 1805), deutscher Arzt und Dichter

Pollenallergie
Das hilft kurzfristig

Psychotherapie hilft vor allem älteren Patienten
Pensionäre mit einer Depression oder anderen seelischen Krankheit profitieren stärker von einer Psychotherapie als jüngere Patienten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des University College London. Diese Erkenntnis widerspreche Vorurteilen, wonach Menschen über 65 schlechter auf eine Psychotherapie ansprechen, weil sie kognitiv weniger flexibel seien, schreiben die Forscher im Fachblatt «Journal of Affective Disorders». gesundheitstipp/krea
Schon bald reizen die ersten Pollen von Hasel, Erle und Esche die Schleimhäute von Allergikern. Für eine – ohnehin umstrittene – Hyposensibilisierung oder Immuntherapie ist es zu spät. Daher ist schnelle Hilfe unverzichtbar. Das hilft: Kleider wechseln, öfters kurz abduschen und Nasenspülungen sowie spezielle Heuschnupfenpräparate auf Pflanzenbasis. Die Blätter der Pestwurz (siehe Foto) etwa enthalten sogenannte Petasine, die allergieauslösende Reaktionen hemmen. Tees aus natürlichen Heilpflanzen wie der Brennnessel wirken bei der Behandlung von Heuschnupfen-Beschwerden ebenfalls unterstützend. Auch Schwarzkümmelöl und Vitamin C können helfen, die Symptome zu reduzieren. Auf www.pollenundallergie.ch finden Betroffene die «Pollenprognose Schweiz». Bei starker Belastung sollten sie den Aufenthalt im Freien allenfalls reduzieren und danach duschen und die Kleider wechseln. krea

So finden Sie qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten
Seit über 20 Jahren zeichnet das ErfahrungsMedizinische Register EMR qualifizierte, erfahrene Therapeut:innen der Komplementär- und Alternativmedizin mit dem EMR-Qualitätslabel aus – für fast alle Krankenversicherer auch die Grundvoraussetzung, um deren Leistungen zu vergüten.
Finden auch Sie Therapeut:innen mit EMR-Qualitätslabel ganz einfach mit der Suchfunktion auf emr.ch
Mehr zum EMR erfahren Sie aus der Publireportage in diesem Heft

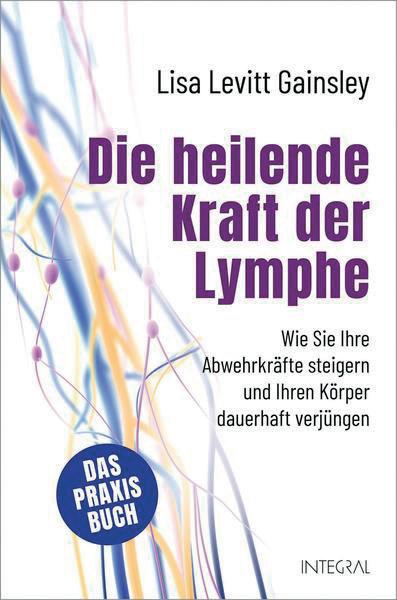
Wie das Lymph- das Immunsystem stärkt
Während einer Infektion schwellen häufig die Lymphknoten an. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern in erster Linie ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem auf Hochtouren läuft und der Körper gegen die Erreger ankämpft. Denn was viele nicht wissen: Das lymphatische System, ein komplexes Netzwerk von Zellen, Geweben und Regulationsmechanismen, steht in engem Zusammenhang mit dem körpereigenen Abwehrsystem und dem Blut bildenden System im Knochenmark. Mit diesem Buch erfährt der Leser mehr über die heilsame und regenerierende Kraft der Lymphe und wie sanfte Selbstmassagen Vitalität und Lebensqualität steigern können.
Lisa Levitt Gainsley
«Die heilende Kraft der Lymphe. Wie Sie Ihre Abwehrkräfte steigern und Ihren Körper dauerhaft verjüngen»
Integral 2021, ca. Fr. 30.–
buchtipp gewusst?

Hausarbeit hält im Alter fit
Wenn Senioren ihren Haushalt selbst erledigen, hat dies gleich mehrere gesundheitliche Vorteile für sie. Dies ergab eine Studie des Instituts für Technologie in Singapur. Demnach steht Hausarbeit bei älteren Menschen im Zusammenhang mit einem besseren Gedächtnis, einer längeren Aufmerksamkeitsspanne, einer stärkeren Beinkraft und damit einem besseren Schutz vor Stürzen. In der Folge sinkt das Risiko von Langzeiterkrankungen, Immobilität und Abhängigkeit. Hausarbeit ist laut den Forschern diesbezüglich sogar effizienter als andere Arten von regelmässiger körperlicher Betätigung. MM
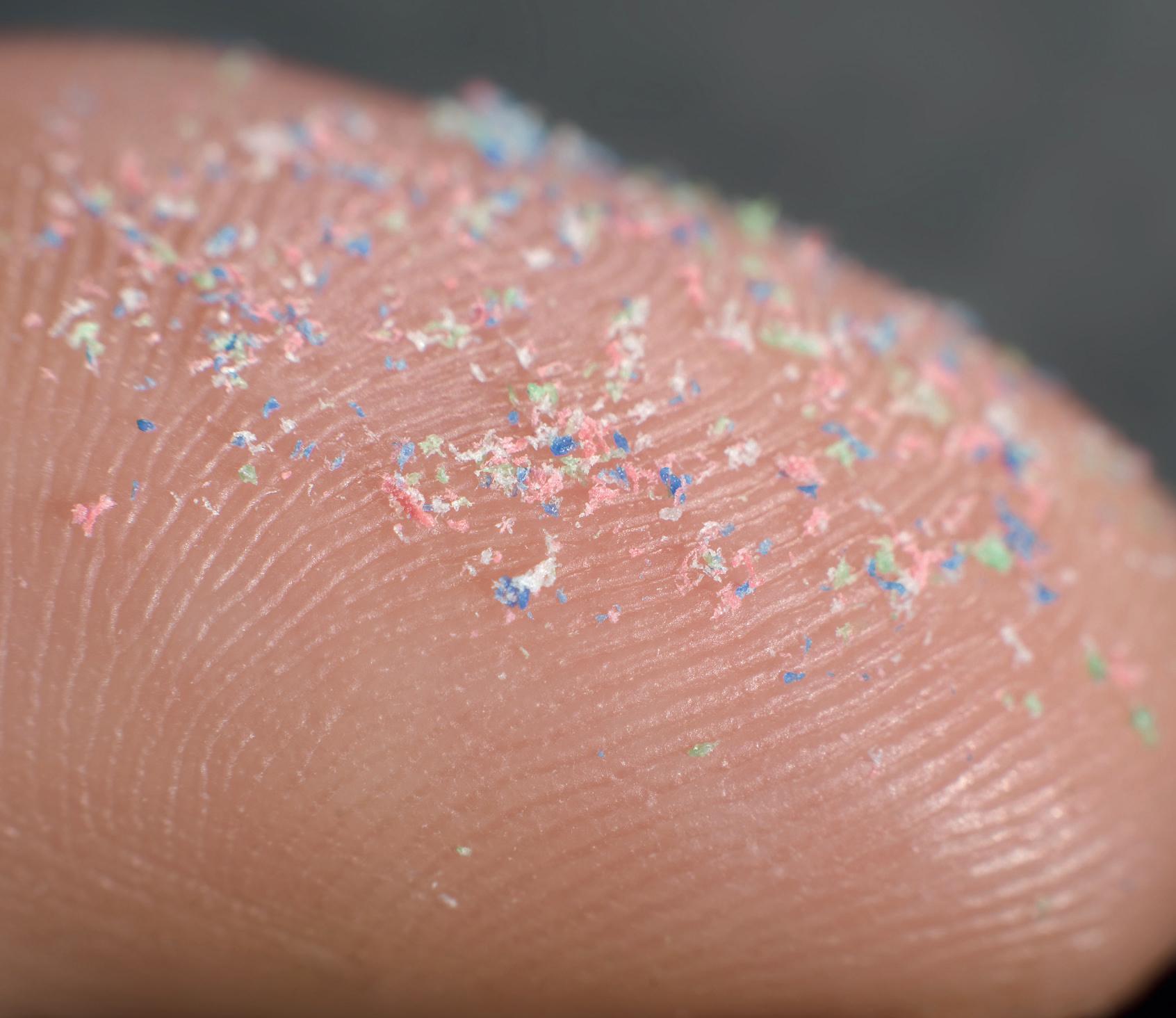
Umweltgift Mikroplastik kann Zellen schädigen
Forschende aus Grossbritannien haben festgestellt, dass Mikroplastik zumindest im Reagenzglas schädlich für menschliche Zellen ist: Es kann die Zellwände schädigen, allergische Reaktionen auslösen und bis zum Absterben der Zelle führen. «Wir sollten uns Sorgen machen», so die Forscher. Denn solche Zellschädigungen lösten in vielen Fällen andere gesundheitsschädliche Effekte aus, z. B. entzündliche Reaktionen, die Krankheiten Vorschub leisten.
In Tierversuchen fanden Forschende bereits, dass Mikroplastik aus der Lunge von schwangeren Ratten in die Organe ihrer Föten wandert. Auch in der Plazenta von Menschen wurden die winzigen Partikel schon gefunden. Bei Mäusen überwindet Mikroplastik die Blut-Hirn-Schranke. Ausserdem gibt es Hinweise darauf, dass Mikroplastik Bakterien dabei unterstützt, Antibiotikaresistenzen zu entwickeln. infosperber.ch

«Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt»
Rolando Schutzbach lacht. Und lacht. Und lacht. Täglich. Möglichst oft. Das hat ihn bekannt gemacht. Nun berät der 73-Jährige andere Senioren, wie auch sie im dritten Lebensabschnitt mehr Freude haben können.
Text: Samuel Krähenbühl
Nein, ein typischer Lehrer ist er nicht. Obschon der studierte Philosoph in der Heimschule «Schlössli Ins» und anderswo als Lehrer tätig war. Mit seinem Lockenkopf und dem sonnigen Gemüt würde er hingegen gut in ein Kinderbuch passen. Etwa in eines der «Pippi Langstrumpf»-Bücher der schwedischen Autorin Astrid Lindgren. Und selbstverständlich mag er die quirlige «Pippi». Auf sie angesprochen hat er sofort eines ihrer Bücher zur Hand. Ihre positive Lebenseinstellung, ihre Offenheit allem Neuen gegenüber, die fasziniert auch Rolando Schutzbach. Pippis Lebensmotto «Ich mach’ mir die Welt, Widdewidde wie sie mir gefällt!» macht er sich zu eigen. Sein früheres Wohnhaus hatte nicht umsonst den Namen «Villa Kunterbunt», so wie Pippi Langstrumpfs Haus. «Es ist gesünder, optimistisch zu sein», sagt Schutzbach, lacht laut und erklärt: «Ich bin ein Optimystiker.»
Der studierte Philosoph mit Doktortitel, der 1982 aus Bayern mit der Familie in die Schweiz gekommen ist, war nach eigenem Bekunden schon immer ein Optimist. Und schon als Kind habe er immer andere Wege begangen als seine Geschwister. Später, als 20-Jähriger, fuhr er in bester Hippie-Manier mit einem VW-Bus nach Indien, um sich dort inspirieren zu lassen. Dass er heute besonders viel und vor allem auch bewusst lacht, das hat eine besondere Bewandtnis: «Vor 21 Jahren habe ich das Lachen für mich entdeckt. Es war wie eine persönliche Neuerfindung», erklärt er. Und lacht schallend. Damals habe er einen Artikel in der Zeitung «Der Bund» über das Thema «Lachyoga» gelesen. «In Mumbai haben 10 000 Menschen auf einem Platz zusammen gelacht. Das hat mich schwer beeindruckt», erklärt er.
Später habe er den Gründer der Lachyogabewegung und Initiator des Weltlachtags, den indischen Arzt Madan Kataria, persönlich kennengelernt. An der Landesausstellung Expo 02, die im Dreiseenland, also in Schutzbachs neuer Heimat am Bielersee, stattfand, konnte er sich mit einem Beitrag beteiligen: Unter dem Motto «Quelle des Lachens» hat er ein «Lachlabyrinth» realisiert. In den Folgejahren sei er bekannt gewesen als «der oberste Lach-Philosoph der Schweiz», sagt Schutzbach – und lacht.
Nicht alles auf sich einprasseln lassen Schutzbach wäre nicht Philosoph, wenn er neben Pippi Langstrumpf nicht noch andere Vorbilder hätte. Er nennt etwa Meister Eckhart (1260 – 1328). Der Theologe und Philosoph des Spätmittelalters hat stets die universelle Einheit betont. Und dann natürlich der altgriechische Philosoph Epikur (341 v. Chr–270 v. Chr.). Epikur, der Hedonist. Hat der nicht einfach das Lustprinzip gepredigt? Ob das ethisch vertretbar ist, fragen wir Schutzbach. «Ja, Epikur hat gesagt, man solle aus Lust leben», antwortet der. «Aber das wurde und wird manchmal falsch aufgefasst. Teilweise haben die Epikureer auch mit sehr wenig irdischen Gütern gelebt, auf viel verzichtet. Aber sie hatten die Freude der Freundschaft.»


So gesund ist lachen
Regelmässiges Lachen hat viele gesundheitliche Vorteile, gerade in unserer gehetzten und pandemiebelasteten Zeit. So werden beim Lachen von Kopf bis Bauch rund 300 Muskeln angespannt, 17 allein im Gesicht. Durch die schnellere Atmung erhöht sich der Gasaustausch um ein Dreifaches; das Zwerchfell spannt sich, dadurch dehnen sich die Lungenflügel, sodass beim Lachen viel Luft in den Körper und Sauerstoff in den Blutkreislauf gelangt. Für kurze Zeit ist der Organismus sehr aktiv. Der Stoffwechsel wird angeregt. Nach der Aufregung durch den Lachanfall entspannt sich der Körper. Die Arterien weiten sich, der Blutdruck sinkt wieder, es folgt ein wohliger Entspannungszustand. So baut Lachen Stress ab.
Zudem werden beim Lachen Endorphine und das «Glückshormon» Dopamin freigesetzt – mitunter so viel, dass sie Schmerzen lindern. Und auch das Immunsystem wird durch das Lachen angeregt: Antikörper, die der Körper zum Schutz vor Bakterien und Viren braucht, werden neu gebildet. Lachen hat also mindestens drei positive Auswirkungen auf den Menschen: Es stärkt die Abwehrkräfte, senkt den Stresspegel und sorgt für Glücksgefühle. Das alles gilt übrigens nicht nur für spontanes, sondern auch für künstliches oder erzwungenes Lachen. krea
« Ich lache nicht, weil ich glücklich bin. Ich bin glücklich, weil ich lache. »
Doch zurück zum Lachen. Kann man denn einfach so lachen, quasi ohne Grund? Und das jeden Tag? «Ich lache nicht, weil ich glücklich bin. Sondern ich bin glücklich, weil ich lache», sagt Schutzbach. Lachen helfe den Menschen, ist er überzeugt. Viele seien gefangen in ihren Ängsten. Gerade auch in den vergangenen Monaten. Und dagegen helfe das Lachen. Wobei Lachen für ihn nicht ein Reflex ist, sondern etwas Bewusstes. Übrigens findet Schutzbach, dass nicht nur Lachen, sondern auch Gähnen wichtig sei. «Bei uns ist das alles tabuisiert. Das finde ich schade», meint er.
Aber was ist, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert? Wenn zum Beispiel ein Mensch stirbt, mit dem der Philosoph in einer engen Beziehung stand. «Wenn etwas Trauriges passiert, dann bin ich auch traurig», sagt er. «Aber ich habe erfahren, dass ich mit einer fröhlichen Grundhaltung auch mehr Mitgefühl habe.» Und noch etwas sei ihm wichtig: «Ich beschäftige mich nicht mit all den schlechten Nachrichten, die mich gar nicht betreffen. Ich überlege mir bewusst, was ich wissen will und was nicht.» Schutzbach lässt sich auch nicht entmutigen, wenn etwas nicht auf Anhieb gelingen will. Etwa sein Projekt des Lachturms. «Der Lachturm soll ein grosser Turm sein. 20 Meter hoch. Aber er kostet einige Millionen. Und die wollte bisher noch niemand bezahlen», erläutert er lachend. Schutzbach wäre nicht Schutzbach, wenn er nicht auch dafür eine Alternative hätte. So baut er in seiner Garage einen kleinen Lachturm aus Holzklötzen. Auf jedem Klotz steht ein positives Wort, das ihm Freunde zugesandt haben.

Weiser und heiterer werden
Neben dem Lachen hat der fröhliche Rentner eine neue Leidenschaft: «Inspiriertes Älterwerden» nennt er es. «Forschungen zeigen, dass Altern umkehrbar ist», sagt er. «Sie weisen darauf hin, dass Altern zu einem grossen Teil ein mentaler Prozess ist, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Ich werde immer schwächer und verliere meinen Schwung, ich werde nicht mehr gebraucht, ich sollte mich zurückziehen. Wenn wir diese Gedankenmuster umkehren, dann werden wir jünger! Das erlebe ich an mir selbst, und das habe ich im Gespräch mit vielen inspirierten Älteren immer wieder gehört.» Auf seinen vielen Reisen, etwa in Indien oder Thailand, habe er erlebt, dass dort die Alten viel mehr geehrt würden als in unserer Kultur. Auch das sei ein wesentlicher Beitrag zu ihrer Gesundheit. Schutzbach zitiert Rabbi Zalman Schachter-Shalomis Buch «From Aging to Saging» (Vom Älter werden zum Weiser werden). «In dem revolutionären Buch geht es darum, wie ein älterer Mensch nicht nur gesünder lebt, sondern auch positiv auf die Menschheit einwirken kann.»
Schutzbach bietet in diesem Sinne Lebensfeiern «mit Humor und Firlefanz für lebenslustige und inspirierte» ältere Menschen an («Lebensfeier 60+»): «Es ist mir ein Anliegen, dass die Alten sich feiern lassen.» Und wie läuft so eine Feier ab? «Das Element des gemeinsamen Musizierens, Singens und Tanzens gehört dazu. Im Mittelpunkt steht aber meine Rede. Ich interviewe den Jubilar etwa ein halbes Jahr vor der Feier. Wie geht es Dir? Was hast Du für Pläne? Was hast Du für Hobbies? Mit viel Humor fasse ich dann das Ganze zusammen und würdige den zu Feiernden.» Es gebe viele Anlässe für so eine Feier: die Pensionierung, einen Geburtstag, eine Feier zum 1. Enkelkind oder vor dem Umzug in die Seniorenresidenz. Für viele Menschen ist das Thema Älterwerden indes eher belastend, da es auch mit dem irdischen Tod, der zwangsläufig näherkommt, zusammenhängt. Aber auch hier ist Schutzbach Optimist: Als Anthroposoph glaubt er an die Reinkarnation. Und als Epikureer bleibt er auch im Alter ein gegenwärtiger Mensch. Und wiederum zitiert er ein Buch, diesmal mit dem Titel «Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen». Eines davon sei, dass Freundschaften nicht gepflegt worden seien. Deshalb sei es ihm besonders wichtig, die Beziehungen zu seiner Familie, seinen Enkeln, seinen Freunden zu pflegen. Und was ist sein eigenes Vermächtnis? «Mein Wirken hat etwas bewirkt», ist er überzeugt. «Mit der Ausbildung von Lachtrainern, mit Lachevents auf den Strassen, mit einer Lachparade in Bern.» Generell sei die Welt weniger spiessig als noch in seiner Jugend, so Schutzbach. «Der Glaube daran, etwas verändern zu können, bewirkt die Veränderung», ist er überzeugt. «Die Welt ist so, wie ich sie wahrnehmen will. Wie bei Pippi Langstrumpf.» •

Schutzbachs Lebenslauf in seinem eigenen Telegrammstil
Geboren 1948 – stop – Aufgewachsen in Ingolstadt, Bayern – stop – Vater war Augenarzt, ich Jüngster von vier Kindern – stop – Nach dem Abitur als Profimusiker mit dem Kontrabass unterwegs – stop – Studium in Hamburg, München und Würzburg, Pädagogik und Philosophie –stop – 1970 ab nach Indien mit grosser Verwandlung –stop – Heirat 1973 – Anthroposophisches Studium in Stuttgart – stop – Kinder kommen, Beginn als Waldorflehrer in Würzburg – stop – 1982 wandert die Familie aus in die Schweiz – stop – Lehrer 10. bis 12. Klasse im Schlössli Ins bis 1993 – Promotion Dr. phil. in Philosophie, 1994 – Leiter Drogentherapie im Schlüssel Detligen – stop – Zen-Meditation – stop – 1999 Scheidung – stop – 2000 Beginn der lachenden Inspirationen – stop – Begegnung und Verbindung mit Christina Fleur de Lys – stop – Aufbruch ins Freudenfeuer – stop – 2005 Auswanderung nach Spanien – stop – 2009 Rückkehr, Heirat – stop – 2010 bis 2018 gemeinsame Reisen und Weltreisen jeweils im Winter – stop – Thema seit 2015: «Inspiriertes Älterwerden».


Wie Zähneputzen für die Seele

Nicht nur der Körper, auch die Psyche will gepflegt sein, damit wir uns rundum wohlfühlen in unserer Haut. Wie das spielerisch geht, zeigen die «10 Schritte zur psychischen Gesundheit».
Autorin: Annette Hitz, Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz*
Illustration: Sonja Berger
Die psychische Gesundheit ist ein vielschichtiger Prozess, der laut Weltgesundheitsorganisation
WHO Aspekte wie Wohlbefinden, Optimismus, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Beziehungsfähigkeit, Sinnhaftigkeit, Alltagsbewältigung und Arbeitsbewältigung umfasst. Oder anders gesagt: Ein Mensch fühlt sich psychisch gesund, wenn es ihm möglich ist, seine geistigen und emotionalen Fähigkeiten zu nutzen, die alltäglichen Lebensbelastungen zu bewältigen, produktiv zu arbeiten und in der Gemeinschaft einen Beitrag zu leisten.
Die meisten Menschen wissen, wie sie ihre körperliche Gesundheit fördern können: Durch gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Alltagshygiene. Was man zur Pflege seiner psychischen Gesundheit tun kann, wird hingegen kaum thematisiert. Die Kampagne «10 Schritte für psychische Gesundheit» ist als Denkanstoss hierzu gedacht. Jede und jeder fördert seine psychische Gesundheit am besten, wenn sie oder er etwas findet, das Spass macht und guttut. Die zehn Schritte für psychische Gesundheit wollen dazu inspirieren.
1. Steh zu dir: Niemand ist perfekt
Mich selbst annehmen bedeutet, dass ich meine Fähigkeiten kenne und nutze und weiss, was mich zufrieden macht. Ich bin in der Lage, meinen Körper und seine Signale bewusst wahrzunehmen, und daraus Sicherheit zu gewinnen. Ich kann meine Gefühle erkennen und deshalb Entscheidungen treffen, die mir guttun. Im Wissen um meine Stärken und Fähigkeiten gelingt es mir, auch meine Fehler und Schwächen als einen Teil von mir zu akzeptieren. Zu mir selbst Sorge tragen heisst, an mich selbst zu denken, auch wenn es anderen nicht gefällt. Das braucht Mut. Dabei achte ich darauf, wo meine Grenzen sind und spüre, was für mich gut ist und was mir schadet.
Tipps dazu:
• Schreibe deine Gedanken auf: Was tut mir momentan gut? Was nicht? Was kann ich selbst verändern, sodass es mir besser geht?
• Verzeih dir und deinem Gegenüber, wenn du gereizt reagierst.
• Setze dir Tagesziele, die du einhalten kannst.
2. Bleibe aktiv:
Bewegung ist Vorausset zung für Entwicklung
Körperliche Bewegung ist ein wertvoller Ausgleich in unserem oft stressigen, hektischen und reizüberfluteten Alltag. Doch wir bewegen uns immer weniger. Als Faust regel gilt: Man soll sich mindestens 2½ Stunden pro Woche bewegen in Form von Alltagsaktivitäten oder Sport. Dazu zählt jede Form der Bewegung ab zehn Minuten, bei der Puls und Atmung leicht beschleunigt sind und man allenfalls auch leicht ins Schwitzen kommt. Schlendern zählt also nicht, schnell spazieren schon.
Tipps dazu:

• Tanze durch die Wohnung zu deinen Lieblingsliedern.
• Übe dich im Seilspringen und mache Liegestützen, bis du schwitzt.
• Mach einen Wohnungsputz: Wasche die Vorhänge, miste die Schubladen aus, räume den Keller, putze die Küche.
3. Entspanne dich bewusst: In der Ruhe liegt die Kraft
Unser Denkprozess ist ein fortwährender Strom aus Bildern und Gedanken, ein Zustand des steten Aufruhrs. Deshalb ist es wichtig, dass auf aktive Zeiten eine Phase der Entspannung und Erholung folgt. Wenn wir entspannt sind, fühlen wir uns wohl; wir sind ruhig, gelöst und wach. Wer entspannt ist, kann darüber hinaus sich und andere besser einschätzen und in Ruhe Entscheidungen fällen. Entspannungsmöglichkeiten findet man überall, und das meist kostenlos.
Tipps dazu:
• Versetze dich in deiner Vorstellung an deinen Lieblingsort und verweile dort, solange du magst.
• Höre Musik und schliesse die Augen.
• Mach eine Medienpause, leg das Handy weg und höre höchstens einmal pro Tag Nachrichten.
• Wickle dich in eine kuschelig warme Decke und setze dich auf den Balkon oder in einen Park.
4. Sei kreativ: Kreativität steckt in uns allen Viele Menschen tragen Sehnsüchte, Wünsche, Ängste und Gedanken in sich, die sie nicht in Worte fassen können. Durch kreatives Gestalten – malen, musizieren, basteln, kochen, Blumen pflücken und vieles mehr – können sie diese Gefühle ausdrücken. Kreativität schafft einen Ausgleich für die vielen Spannungen, die mich einengen. So kann ich mich entspannen und Kraft schöpfen.
Tipps dazu:
• Mach ein digitales Album mit deinen letzten Ferienfotos.
• Kreiere deinen eigenen Risotto oder deine spezielle Pastasauce.
• Stricke einen Schal mit Restwolle. Häkle eine Decke für die Eltern.
• Erstelle mit Kindern ein Naturbild im Wald («Land Art»).
5. Lerne Neues: Lernen ist Entdecken
Neues zu lernen, heisst eine Entdeckungsreise zu machen, die mich aus dem Alltag herausführt, mir neue Impulse verleiht und mein Selbstwertgefühl hebt. Wer bereit ist, Neues zu lernen, zeigt auch, dass er sich weiterentwickeln will – persönlich und beruflich. Lernen ist nicht nur Kopfsache, sondern beansprucht all unsere Sinne. Es ist nie zu spät, etwas Neues auszuprobieren.
Tipps dazu:
• Besuche einen (online) Kunstkurs.
• Lerne Vogelstimmen kennen.
• Gestalte deine eigene Website.
6. Beteilige dich: Menschen brauchen eine lebendige Gemeinschaft
Teil einer Gemeinschaft zu sein gehört zu den wichtigsten Lebenserfahrungen. Gemeinschaft fordert von uns Mut zur Begegnung. Sich beteiligen bedeutet, dort Wünsche, Interessen, Fähigkeiten, Ängste und Hoffnungen einzubringen, wo es um Dinge geht, die mir wichtig sind. In einer Gemeinschaft zu Leben heisst auch: Ich fühle mich getragen und unterstütze Nahestehende.
Tipps dazu:
• Trainiere den Tennisnachwuchs.
• Organisiere mit deinen Freunden einen (virtuellen) Buchclub und lest und diskutiert zusammen über Bücher mit Mehrwert.
• Mache etwas für andere; schon etwas Kleines kann sehr viel sein. Es ist schön, zusammenzustehen und kleine Gesten können viel bewirken.


7. Halte Kontakt mit Freunden:
Freunde sind wertvoll
Mit Freunden und Freundinnen bin ich vertraut, wir können über alles sprechen. Intimes bleibt unter uns. Von Freundinnen will ich keinen Druck und ich bin da, wenn sie mich brauchen. Freundinnen und Freunde dürfen kritisieren und lassen mich den Menschen sein, der ich bin.
Tipps dazu:
• Organisiere einen Spieleabend.
• Schreibe jede Woche eine Postkarte an jemandem aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis.
• Verabrede dich auch im Winter mit dem Nachbarn auf dem Balkon oder zu einem Café und Schwatz.
8. Sprich darüber:
Alles beginnt im Gespräch
Über Dinge sprechen, zuhören, ordnen, klären, Anteil nehmen, in Worte fassen, was mich bewegt – das hilft, Anspannung und Druck zu mildern. Für Betroffene und oft auch für Mitbetroffene ist es nicht immer einfach, offen über Sorgen zu sprechen. Wenn ich mich aber traue, mit anderen Menschen über meine Probleme zu sprechen, entstehen daraus für beide Seiten oft neue Sichtweisen oder Lösungsansätze. Es liegt in der Natur des Menschen, Freud und Leid miteinander zu teilen.
Tipps dazu:
• Telefoniere regelmässig mit einem Freund oder einer Freundin und redet darüber, was euch bewegt.
• Für Eltern und Paare: Organisiert einen regelmässigen Paarabend und redet, nur zu zweit.
• Bei Suizidgedanken: Hilfe holen, z. B. bei www.reden-kann-retten.ch.
9. Frage um Hilfe: Hilfe annehmen ist ein Akt der Stärke, nicht der Schwäche
Wer um Hilfe fragt, zeigt Stärke und nicht Schwäche. Es gibt Menschen, die mir helfen wollen, wenn ich mich ihnen anvertraue. Ich darf mir Hilfe holen und bin trotzdem kein Schwächling. Um Hilfe bitten, heisst auch, jemandem Vertrauen entgegenbringen. So kann ich wieder aktiv handeln und fühle mich nicht hilflos meinen Gefühlen und Sorgen ausgeliefert. In besonders belastenden Situationen ist es wichtig, sich auf seine wesentlichen Fähigkeiten zu konzentrieren, Aufgaben abzugeben und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das erfordert Ver- und Zutrauen – auch in andere. Tipps dazu :
• Kontaktiere die Dargebotene Hand, Tel-Nr. 143.
• Für Jugendliche: Tel. 147.
• Nimm Unterstützung und Hilfe an. Du hilfst damit an deren, sich nützlich zu fühlen.
10. Glaub an dich und gib dich nicht auf: die Krisen des Lebens meistern
Die emotionale Verarbeitung von Schock, Trauer und traumatischen Ereignissen braucht Zeit. Deshalb ist es wichtig, sich diese Zeit zu nehmen und sie auch anderen in Krisensituationen zu gewähren. Wenn scheinbar nichts mehr geht, ist es gut, sich auf den vitalen Rhythmus (Ernährung, Atmung, Schlaf, Bewegung) zu konzentrieren. Ich muss da nicht alleine durch. Ich habe das Recht, in Krisensituationen professionelle Hilfe zu holen und diese auch anzunehmen.
Tipps dazu:
• Schreibe jeden Tag in ein Tagebuch, was dich belastet und was dich freut.
• Schenke den schönen Momenten im Alltag mehr Aufmerksamkeit und verankere diese Momente: Mit einer kleinen Perle im linken Hosensack, die du bei einem schönen Moment herausnimmst, dir diesen nochmals bewusst machst (gedanklich und gefühlsmässig), tief ein- und ausatmest und die Perle dann in den rechten Hosensack versorgst. Beim nächsten Mal wandert sie dann von rechts nach links.
• Kontaktiere die Meldestelle für Glücksmomente, die es in vielen Kantonen gibt (siehe Internet). •
* Danke an das Gesundheitsamt des Kantons Aargau und dureschnufe.ch für die Texte
10 Schritte für psychische Gesundheit

«10 Schritte für psychische Gesundheit» ist eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung der psychischen Gesundheit in jedem Alter. Die zehn Schritte für psychische Gesundheit sind wissenschaftlich evaluiert. Das Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz (www.npg-rsp.ch) hat die Nutzungsrechte für die Schweiz erworben und stellt sie kostenlos seinen Mitgliedorganisationen zur Verfügung.
Aktuell setzen über 80 Institutionen in der Schweiz die «10 Schritte für die psychische Gesundheit»-Kampagne um. Die Wirkung der Kampagne für die Förderung der eigenen psychischen Gesundheit, wird dadurch verstärkt, indem möglichst viele Akteure mit der gleichen Botschaft

Weiterführende Informationen zur Kampagne finden sich www.10schritte.ch.

Mit Märchen fürs Leben gewappnet
Die Hausmärchen der Gebrüder Grimm gehören nach der Bibel zu den am häufigsten übersetzten und publizierten Texten der Welt. Doch was fasziniert die Menschen an diesen 200 Jahre alten Geschichten? Und sind sie überhaupt kindgerecht? Teils brutal und ungerecht werden Märchen kontrovers diskutiert.
Text: Erna Jonsdottir
Es war einmal ein junger Mann namens Omar, der in die Schweiz gereist war, um die deutsche Sprache zu erlernen. Vorbildlich erschien er jeden Morgen pünktlich in der Sprachschule, hörte gespannt dem Unterricht zu und machte fleissig mit. Substantive, Adjektive, Verben, Genus oder Casus – nichts schien den bezaubernden Mann aus dem Norden Afrikas aus der Ruhe zu bringen.
Doch als seine Lehrerin eines Tages einen Lückentext zum Märchen-Klassiker «Rotkäppchen» aushändigte, sollte er nicht nur sprachlich herausgefordert werden: Nachdem der böse Wolf die Grossmutter gefressen und danach das arme Rotkäppchen verschlungen hatte, der Jäger dem schla fenden Tier den Bauch aufschlitzte und ihm nach seinem Tod auch noch das Fell abzog, fragte Omar entsetzt: «Erzählt ihr euren Kindern solch’ schrecklichen Geschichten?!» Die Lehrerin hielt inne. «Das tun wir seit Generationen. Diese Geschichten sind literarische Meisterwerke und haben eine erzieherische Funktion», erklärte sie kurz und knapp. «Ich würde meinen Kindern niemals solche grausamen Märchen erzählen», antwortete Omar und seine Mitschüler nickten.
Das Entsetzen ihrer fremdländischen Schüler über raschte die Lehrerin, waren die grimmschen Märchen doch ein fester Bestandteil ihrer Kindheit gewesen. Niemals hatte sie diese als grausam oder schrecklich empfunden. Im Ge genteil: Sie war fasziniert von den alten Geschichten, in denen das Gute meist über das Böse siegte.
Diese Faszination für Märchen erklärt der deutsche So zialpsychologe Dieter Frey wie folgt: «Pech und Glück, Feig heit und Mut, Gut und Böse – in den Märchen kommen die ganzen menschlichen Komödien und Tragödien des Lebens vor, meist mit glücklichem Ausgang. Die Geschichten sind durch einfache Gegensätze wie Gut und Böse, Arm und Reich, Schön und Hässlich geprägt.» Das sei sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene deshalb faszinierend, weil es besonders einfach und somit nachvollziehbar sei. Hinzu komme, dass man im Märchen meist einer gutmütigen und unschuldigen Hauptfigur mit reinem Herzen begegne, die ihren beschwerlichen Weg tapfer und beständig bis zum Ende gehe. «Menschen identifizieren sich gerne mit solchen Helden.»

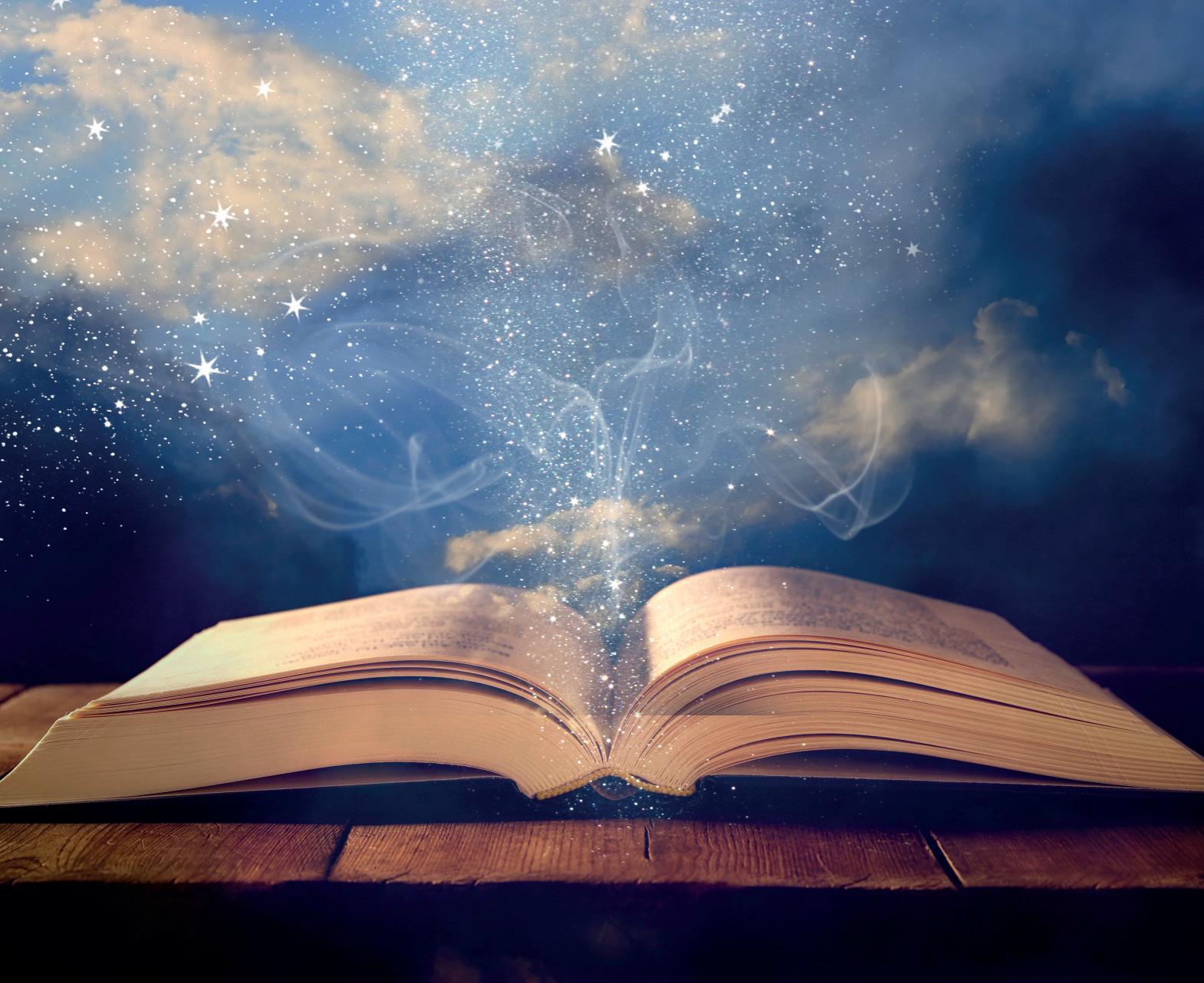
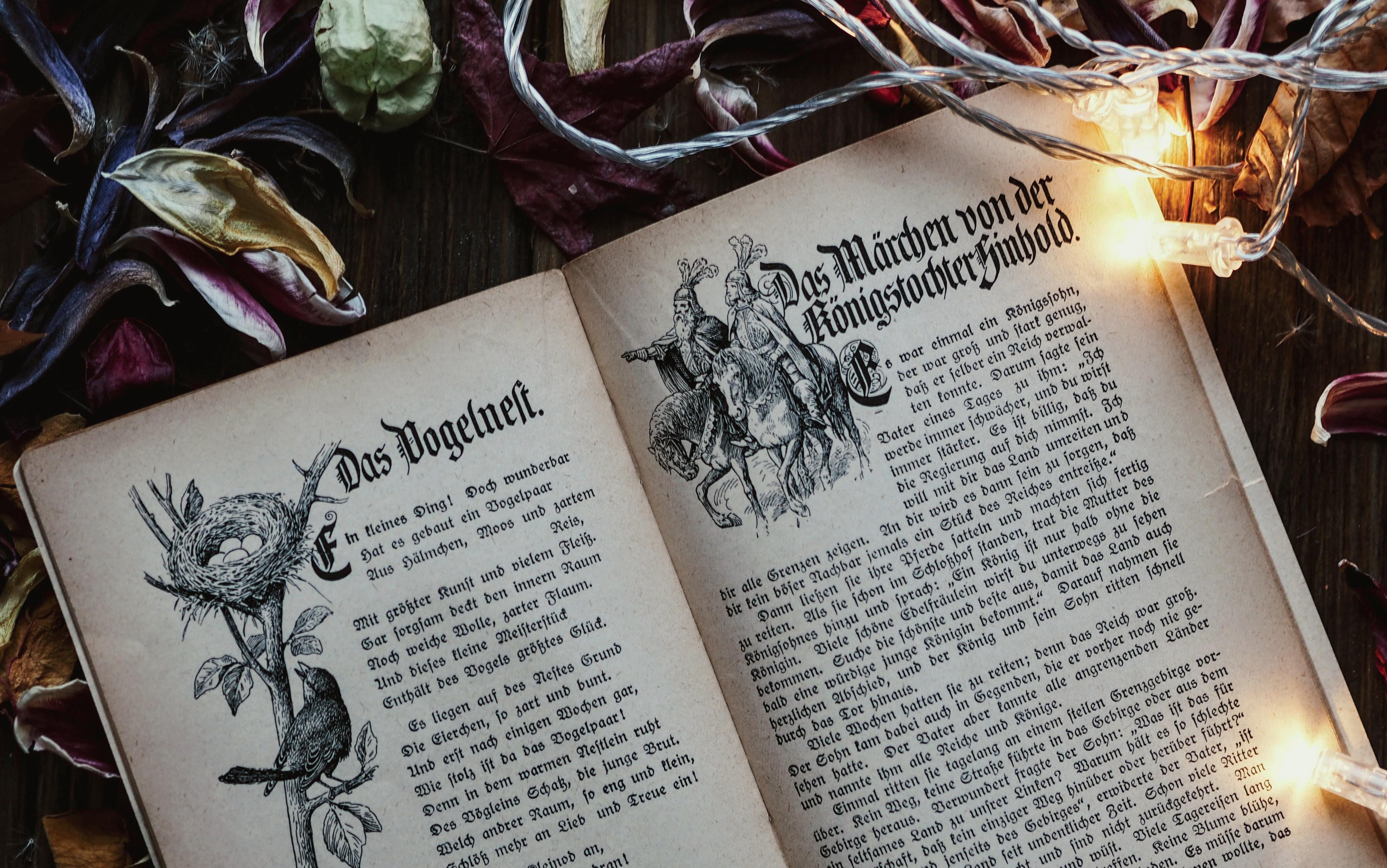
«Nazi-Märchen» verbannen?
Trotzdem ist Omars Frage berechtigt: Märchen werden schon länger kontrovers diskutiert. Tatsache ist, dass sich hinter vielen Märchen auch Ungerechtigkeit und Gewalt verbergen. In Deutschland waren die grimmschen Märchen nach dem zweiten Weltkrieg umstritten und für eine kurze Zeit sogar verboten. Die Nationalsozialisten hatten den deutschen Märchenschatz für sich beansprucht, weshalb die Alliierten davon ausgegangen waren, dass diese für die Gräueltaten der Nazis mit verantwortlich waren. 30 Jahre später wurden die Märchen mit ihren boshaften Stiefmüttern, kannibalistischen Hexen, abgeschnittenen Fingern und ausgestochenen Augen als Werkzeug schwarzer Pädagogik kritisiert. An den Heidelberger Märchentagen 1972 forderten die Teilnehmenden sogar, die Märchen aus der Kindererziehung zu verbannen. Eine Antwort auf diese Forderung gab der mittlerweile verstorbene Kinderpsychologe Bruno Bettelheim 1977 mit seinem Buch «Kinder brauchen Märchen». Als Professor für Psychologie und Psychiatrie sowie als Therapeut von psychisch schwer kranken Kindern stellte er die These auf, dass Märchen dem Kind die Möglichkeit geben, «innere Konflikte, die es in den Phasen seiner seelischen und geistigen Entwicklung erlebt, zu erfassen und in der Fantasie auszuleben und zu lösen». Märchen seien eine wichtige Lebenshilfe, um die chaotischen Spannungen ihres Unterbewussten zu bewältigen. Seit Bettelheims Publikation sind 45 Jahre vergangen. Omars Frage – «kann man Kindern diese Geschichten zumuten?» –, ist allerdings nach wie vor aktuell.
Märchensymbolik versus Gewalt im TV Für Dieter Frey ist klar: «Ja, man kann.» Einerseits hätten Kinder einen unbewussten Zugang zur Märchensymbolik: «Sie verstehen, dass die Todesbedrohung der Heldin und des Helden zu deren Entwicklungsweg gehört und das Geschehen überhaupt erst recht in Gang bringt», erklärt der Professor für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Anderseits würden Kinder heutzutage in ihrer realen Welt laufend mit Gewalt konfrontiert. Sei es im Fernsehen, im Kino oder in Computerspielen. «Die medialen Gewalt- und Kriegsgeschichten überfordern Kinder», so Frey.
Märchen hingegen erzählten ruhig; die Sprache komme mit wenigen Adjektiven wie etwa arm, reich, alt oder jung aus und beschreibe keine Details. «Schmerz und Leid werden mit klaren Worten dargestellt und nicht ausgeschmückt», erklärt Frey den Unterschied zur Gewalt an TV und Co. Und: «Auf die Gefühle der Beteiligten wird wenig eingegangen. Anstelle dessen werden die Handlungen beschrieben.» So weinen etwa die sieben Zwerge um Schneewittchen und Aschenputtel verrichtet ohne Gram ihre Aufgaben. An «schrecklichen Stellen» eines Märchens sei es wichtig, einen respektvollen Umgang mit dem beim Kind aufkommenden Gefühl zu haben. Die Aussage: «Die Stiefmutter mit dem Apfel ist wirklich ganz schön bedrohlich» sei besser als: «Du brauchst keine Angst zu haben!» Sie zeigte dem Kind, dass seine Empfindungen durchaus angemessen ist.

Die Moral von der Geschichte
Märchen werden laut Frey seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitererzählt, weil in ihnen sehr viel Lebensweisheit steckt und sie Orientierung für das eigene Leben geben. «So helfen die Geschichten zu reflektieren, was gut und was böse oder faires und unfaires Verhalten ist.» Nicht umsonst heisse es meist zum Schluss: «Und die Moral von der Geschichte …». Weiter würden Märchen eine Art Lebenshilfe bieten: «Sie geben Mut und Hoffnung, weil sie immer wieder aufs Neue zeigen, dass Probleme – egal wie ausweglos sie scheinen mögen – lösbar sind.»
Dabei handelt der Held stets werteorientiert und übernimmt somit eine Vorbildfunktion. Der Gegenspieler hingegen fordert den Helden heraus, ihn in seiner positiven Haltung noch besser hervorzuheben. Werte, die vermittelt werden, sind zum Beispiel
• dass sich Grossherzigkeit und Gutmütigkeit lohnen,
• dass es nicht auf Äusserlichkeiten, sondern auf die inneren Werte ankommt,
• dass Neid und Missgunst auf das Äusserste bestraft werden, während sich Bescheidenheit und Mitgefühl auszahlen,
• dass Zivilcourage Leben retten kann,
• dass Durchsetzungskraft und Selbstvertrauen zum Erfolg führen können und
• dass die Liebe so mächtig ist, dass sie sich selbst von den spitzesten Dornen (Rapunzel) nicht aufhalten lässt.
Doch weshalb ist die Vermittlung von Werten so wichtig? Erstens: Werte erleichtern unser Zusammenleben und machen es wertvoll. Zweitens: Wir richten unser Verhalten an Werten oder moralischen Prinzipien aus, müssen uns an Werten und Normen orientieren und die Perspektive anderer Menschen mit in unsere Entscheidungen einbeziehen. Dies alles lernen wir im Laufe unseres Lebens.
Lernen können wir einerseits von unseren Eltern oder Lehrpersonen. «Moralische Vorbilder können aber auch durch Figuren wie in Bilderbüchern, Geschichten und Märchen symbolisiert werden. Diese erfordern ein Mitdenken, Mitfühlen und Mithandeln», erläutert Frey. «Und weil sich Kinder mit dem Helden identifizieren, können sie auf diese Weise Erfahrungen in einer parallelen Welt sammeln.» Interessant dabei sei, dass die meisten Menschen Ansätze einer gesellschaftlichen Moral zuerst in der Märchenstunde empfangen. Durch die Übertreibung und Personalisierung des Guten und Bösen würden dabei Normen und Werte exemplarisch vorgeführt. ➞
Rotkäppchen psychologisch analysiert
Bleiben wir bei «Rotkäppchen», einem der bekanntesten und meist interpretierten Märchen Europas. Folgende Charaktere dienen als Grundlage der psychologischen Analyse:
• Die Mutter wird lediglich am Anfang der Geschichte erwähnt und nimmt damit eine Nebenrolle ein. Sie schickt ihr Kind zur kranken Grossmutter. In der Ermahnung, nicht vom Weg abzukommen, ist bereits zu erkennen, dass sie sich Sorgen um ihr Kind macht.
• Die kranke Grossmutter hat ebenfalls eine Nebenrolle. Sie ist der Auslöser dafür, dass sich das Mädchen auf den Weg in den Wald begibt.
• Das Rotkäppchen steht im Zentrum des Märchens. Klischeehaft und den Stereotypen entsprechend wird es als kleines, süsses und anständiges Mädchen beschrieben. Ihr naives und vertrauensseliges Verhalten bietet Angriffsfläche für das «Böse» und trägt zur Dramatik des Märchens bei. Rotkäppchen lässt sich vom Weg abbringen, um Blumen für die Grossmutter zu pflücken. Dabei verliert das Mädchen sein Ziel aus den Augen und bricht sein Versprechen gegenüber der Mutter.
• Der Wolf widerspiegelt das Böse. Er wittert bei Rot käppchen die Chance auf leichte Beute. Während er von Gier getrieben das Kind vom Weg abbringt, schafft er sich Zeit, um zuerst die Grossmutter und dann das Mädchen zu fressen. Schamlos und gerissen nutzt er dessen Naivität aus und täuscht es durch sein gerisse nes Vorgehen.
• Der starke Jäger stellt den positiven Gegenpol zum Wolf dar. Er tritt als Retter und Verteidiger auf. Durch seine Achtsamkeit und hohe Sensitivität bemerkt er das laute Schnarchen der Grossmutter. In der Notsituation handelt er umsichtig und bedacht: Er erschiesst den Wolf nicht sofort, sondern schneidet ihm den Bauch auf, um Rotkäppchen und die Grossmutter zu retten.
Das Rotkäppchen nimmt aufgrund seiner Hilflosigkeit und ungeschickten Handlungen die Opferrolle ein, während der Wolf den Verfolger, Machthaber und Unterdrücker symbolisiert. In die Rolle des Retters schlüpft der Jäger. Mit seinem Helfersyndrom signalisiert er ein sogenanntes prosoziales Verhalten (freiwillige Handlungen, die darauf abzielen, einem Menschen Gutes zu tun). Die drei Charaktere mit ihren entsprechenden Rollen bilden in der Psychologie das «Dramadreieck»: Das Opfer, der Täter und der Retter – ein Muster, das sich in gewissen Lebenssituationen immer wieder finden lässt.


Was wir daraus lernen können
Kinder und Erwachsene können aus dem prosozialen Verhalten der Akteure vieles lernen. Unsere Gesellschaft ist von einem demografischen Wandel gekennzeichnet, weshalb es immer wichtiger ist, Verantwortung für die ältere Generation zu übernehmen. Bei allem Leid und aller Ungerechtigkeit auf dieser Welt, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, benachteiligten Menschen Unterstützung zu bieten.
Ein weiteres Märchen-Phänomen ist das Versprechen: «Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen» – diesen Spruch kennen schon Kinder. Das Dilemma: Mit einem Versprechen werden Erwartungen geweckt. Und: Wer sein Versprechen bricht, wird mit Vertrauensverlust und Distanzierung rechnen müssen.
Zusammengefasst illustrieren die «Rotkäppchen»Charaktere und deren Handlungen die wichtige Bedeutung von Versprechen, Vertrauen und prosozialem Verhalten. (siehe Seite 22) Darauf bauen nicht nur unsere persönlichen Beziehungen, sie begründen ebenso die gesamte Gesellschaft.
Und die Moral der Geschichte? Kinder, insbesondere attraktive, wohlerzogene Mädchen, sollten niemals mit Fremden reden, da sie in diesem Fall sehr wohl das Opfer eines für einen Wolf (in Menschengestalt) abgeben könnten. Diese Moral gilt noch heute! •




















Ganzheitliche Krebsbehandlung









Ihre kostenlose Broschüre unter www.iscador.ch/gkb0122
Erfahren Sie mehr über die Ursachen und integrativen Behandlungsmöglichkeiten von Krebserkrankungen.
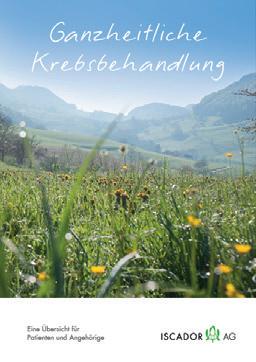

Rezepte des Monats

Jetzt den Gaumen feiern lassen
Seinen Senf dazugeben mit auserlesenen Zutaten hiesiger Felder? Unbedingt und bitte ganz ungeniert! In diesem einfachen Gericht spielt Schweizer Birnensenf mit Birnel die grosse Geige. Seine ebenso rassige wie süsse Musik wirkt erheiternd auf unsere Geschmackspapillen. Ein Fest vom ersten bis zum letzten Löffel.
Zubereitung
1. Grobfasrige Teile des Lauchs entfernen und die Stange in sehr feine Ringe schneiden.
2. Butter bei schwacher Hitze in einer Pfanne erwärmen, den Lauch darin andünsten, mit Mehl bestäuben und mit Gemüsebouillon ablöschen.
3. Suppe unter Rühren aufkochen und anschliessend bei schwacher Hitze 10 Minuten köcheln lassen.
4. Crème fraîche und Birnensenf unterrühren.
5. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
BIRNENSENFSUPPE
Für 4 Personen
1 Lauch
50 g Butter
40 g Biofarm Dinkelweissmehl
1 l Gemüsebouillon
250 g Crème fraîche
100 g Biofarm Birnensenf Salz und Pfeffer
Offeriert von biofarm.ch

Härdöpfelgratin mit Bire

Zubereitung
1. Milch und Rahm zum Kochen bringen und bei kleiner bis mittlerer Hitze ein wenig einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
2. Kartoffeln und Birnen schälen und die Birnen entkernen. Hobeln oder sehr dünn schneiden und mit dem Guss vermischen.
3. Die Auflaufform mit Knoblauch ausreiben und mit geschmolzener Butter bestreichen. Die KartoffelBirnen-Mischung in die Form füllen und bei 200 Grad ca. 35 bis 40 Minuten backen.
4. Käse reiben und auf die Kartoffeln verteilen, bei der gleichen Ofentemperatur weitere 15 bis 20 Minuten backen.
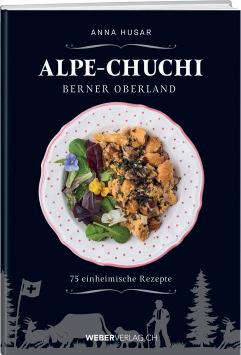
ALPE-CHUCHI BERNER OBERLAND
ISBN 978-3-03818-148-4
KARTOFFELGRATIN MIT BIRNEN
Für 4 Personen
750 g Kartoffeln
350 g Birnen
200 ml Milch
200 ml Vollrahm
5 bis 6 Knoblauchzehen
125 g Käse
Butter, geschmolzen
Muskatnuss, gerieben Salz, Pfeffer

Frühstücken Sie? Ich stelle in meinen Beratungen fest, dass dieses wichtige Ritual, das auch von der Schweizerischen Ernährungsgesellschaft empfohlen wird, etwas aus der Mode gekommen zu sein scheint. Oft fehlt die Zeit dazu oder der Tag beginnt so früh, dass schlicht noch kein Appetit vorhanden ist. Das hat zur Folge, dass viele Leute mit einem Kaffee im Magen aus dem Haus eilen, unterwegs ein Brötchen essen und erst am Mittag endlich eine richtige Mahlzeit zu sich nehmen. Ist das Frühstück tatsächlich eine derartige Zeitverschwendung? Oder gar ein Dickmacher?
Breakfast, das englische Wort für Frühstück, heisst wörtlich übersetzt Fastenbrechen. Nicht nur im englischen ist das so: Auch das spanische desayuno kommt von ayunar, was fasten bedeutet; und auch das französische petit-déjeuner bedeutet kleines Fastenbrechen. Weil das Frühstück die erste Mahlzeit des Tages ist, nachdem man über Nacht mehrere Stunden nicht gegessen und somit gefastet hat.
Betrachtet man das Frühstück aus Sicht der Ernährungsmedizin, so versorgt ein regelmässiger Mahlzeitenrhythmus den Körper besonders gut mit Energie und Nährstoffen. Dadurch bleiben Konzentrations- und Leistungsfähigkeit über den Tag erhalten und Heisshungerattacken können verhindert werden. Sinnvoll sind deshalb drei Hauptmahlzeiten: ein leichtes Frühstück, ein Mittagessen und ein frühes und leichtes Abendessen. Wenn nötig sind ein bis zwei Zwischenmahlzeiten okay. Diese sind insbesondere für Kinder wichtig, die auf diese Weise genügend Energie für den Tag erhalten. Am besten isst man dazu einen Apfel und ein paar Nüsse oder Trockenfrüchte. Mehrere Studien zeigen, dass sich Kinder, die ein ausgewogenes Früh-
Sabine Hurni
über das gesunde Frühstück
stück einnehmen, in der Schule besser konzentrieren können und leistungsfähiger sind. Das kann auch eine Kombination aus Frühstück und Znüni sein. Wichtig dabei ist, dass die Lebensmittelgruppen Wasser oder ungezuckerter Tee, Obst und Gemüse, Getreide und Milchprodukte abgedeckt sind. Frühstücksmuffel sollten zu Hause zumindest ein Glas Wasser oder warme Milch trinken und zum Znüni einen Apfel mit etwas Brot und einem Stück Käse essen. Sind Kinder nicht zum Frühstücken zu bewegen, können es die Eltern mit Porridge oder Griessbrei versuchen. Viele Kinder lieben eine solche warme Morgenmahlzeit.
Das warme Frühstück ist in vielen Ländern gang und gäbe. Von der Nudelsuppe über gekochte Eier, Reis, Bohnen mit Tomatensauce, Würstchen bis hin zum Kartoffelcurry mit Fladenbrot wird insbesondere in den asiatischen Ländern eine breite Auswahl zum Zmorge aufgetischt. Demgegenüber stehen viele Trends, die kommen und gehen: das Budwig-Müseli mit Quark, Leinsamen und Leinöl etwa oder die Vollwertflocken mit frischen Früchten und Kefir, der Smoothie mit allen möglichen Superfoods, Selleriesaft und vieles mehr. Hierzulande werden wohl vorwiegend Butterbrote gestrichen mit Konfitüre, Honig, Joghurt und Käse genossen; oder man startet den Tag mit einem Müesli aus Getreideflocken, einem geriebenen Apfel und Milch oder Quark.
Das perfekte Frühstück gibt es nicht. Es gibt nur das ganz persönliche ideale Frühstück – das wiederum variieren darf, je nach Jahreszeit, Lebensalter und individuellen Bedürfnissen.
Im Auyrveda und in der chinesischen Medizin, wo Lebensmittel gleichsam als Arznei angesehen werden, heisst es, dass wer keinen Hunger hat, sich nicht zum


Essen zwingen soll. Stattdessen kann man zwei grosse Gläser Wasser trinken, am besten warmes, um die Organe, den Stoffwechsel, den Magen und den Darm am Morgen anzuregen. Spätestens um 9 Uhr sollte der Magen allerdings etwas zu tun bekommen. Denn um diese Zeit zieht der Körper reichlich Kraft aus der Nahrung. Es lohnt sich, dieses Potential auszunutzen und dem Körper vollwertige und aufgewogene Nahrung zu gönnen: Haferflocken, Datteln, Nüsse oder Früchte sind ideal. Das Gipfeli und das Schoggi-Brötli schmecken zwar köstlich, liefern jedoch «leere Energie», die schnell abgebaut ist, und führen deshalb zu Heisshunger am Mittag.
Manchmal hilft ein Selbstexperiment, um herauszufinden, ob der Tag mit Kohlenhydraten, Eiweiss oder Fett starten soll. Das Frühstück soll immer im Kontext des ganzen Tages betrachtet werden: Essen wir gekochte oder rohe Früchte am Morgen, soll am Mittag eine vollständige Mahlzeit auf den Tisch kommen; wer mittags gern einen Salat über die Gasse holt, sollte morgens den Magen mit einem Porridge wärmen; und wer nicht auf sein Honigbrot verzichten möchte, kann sich am Mittag Gemüse und Eiweisse einverleiben und die Finger lassen von Spaghetti, Pizza oder Sandwiches. So kommt man der Ganzheitlichkeit in der Ernährung näher. Und das tut rundum gut, der Gesundheit wie dem Wohlbefinden. Man hat einfach mehr Energie und Lebensfreude, wenn man sich gut ernährt. Mit einem Blick auf die östlichen Lehren, die Chinesische, Tibetische und Indische Medizin, ist die Nahrung für das Frühstück gut, welche vollständig verdaut werden kann, nicht müde macht, im Magen ein gutes Gefühl hinterlässt, mindestens drei Stunden anhält und den Appetit auf das Mittagessen, der wichtigsten Mahlzeit des Tages, nicht unterbindet.
Grundsätzlich gilt: Je kälter das Wetter ist, desto wärmer darf das Frühstück sein. Die Rhythmen der Natur prägen unser Leben genauso wie die Rhythmen des Tages. Der Darm braucht Strukturen, die sich täglich wiederholen, sei es mit den Mahlzeiten wie auch mit den Schlafenszeiten. Wer die Essenszeiten nicht mehr beachtet, gerät aus diesem inneren Rhythmus und findet nur mit grossen Schwierigkeiten zur eigenen Balance zurück. Viele haben im Moment so viele Freiheiten wie noch nie. Sie können den Tag dank Homeoffice selbst einteilen, (theoretisch) von überall auf der Welt arbeiten, Ideen verwirklichen und sich mit anderen Menschen über den ganzen Erdball hinweg zu jeder Tages- und Nachtzeit austauschen. Der Verdauungsapparat ist jedoch auf uralte Rhythmen getrimmt. Es hilft ihm – und schlussendlich auch unserer Konzentrationsfähigkeit, der Zentriertheit und der Bodenhaftigkeit – enorm, dreimal täglich mit gesunden und möglichst warmen Mahlzeiten die eigene Mitte zu stärken.
Auch wenn wir in einer Zeit der enormen Veränderungen sind: Die Rhythmen der Organe, der Natur und der Wach- und Schlafenszeiten bleiben. Begrüssen Sie die anbrechende Nacht mit einem frühen und leichten Abendessen; und heissen Sie den neuen Tag willkommen mit einem Frühstück, das zu Ihnen passt. Und nicht vergessen: dankbar sein für das, was wir haben und das Essen in Ruhe geniessen. In diesem Sinne: wohl bekomms! •
Sabine Hurni ist dipl. Drogistin HF und Naturheilpraktikerin, betreibt eine eigene Gesundheitspraxis, schreibt als freie Autorin für «natürlich», gibt Lu-Jong-Kurse und setzt sich kritisch mit Alltagsthemen, Schulmedizin, Pharmaindustrie und Functional Food auseinander.

Beratung
Fusskrämpfe
Ich trage orthopädische Mass-Schuheinlagen. Nun bekomme ich seit zwei bis drei Jahren immer wieder heftige Krämpfe im Fuss und/oder in den Zehen, öfters nachts als tagsüber. Tagsüber tritt dieses Phänomen fast nur dann auf, wenn ich z. B. in eine Hose schlüpfe und dabei den Fuss kurz durchstrecke. Ich nehme Magnesium und massiere die Füsse mit einer wärmenden Kupfersalbe ein. Trotzdem treten die schmerzhaften Krämpfe immer wieder auf. Was würden Sie mir empfehlen?
Frau D. R.
Es kann sei n, dass die Füsse aufgrund der Einlagen etwas «erstarrt» sind. Aufgrund der Stützfunktion der Einlagen nimmt das natürliche Muskelspiel ab; das führt dazu, dass der Muskel nicht mehr ganz so intensiv durchgeknetet wird beim Gehen.
Mit dem Magnesium und der Kupfersalbe haben Sie eine gute Basis geschaffen. Ergänzend dazu können Sie die Fussmuskulatur, die Sehnen, Bänder und Knochen entspannen, aktivieren und entlasten. Am besten kaufen Sie sich dazu eine Mini-Black-Roll. Es geht zwar auch mit einem Besenstil oder anderen runden Holzstück oder auch einem Tennisball; aber der feste Schaumstoff der Faszienrolle ist schonender und für das Abrollen der Füsse ideal. Und so geht’s: die Rolle auf den Boden legen. Ein Fuss steht auf dem Boden, der andere rollt mit dem Druck des eigenen Körpergewichtes über die Rolle; mehrmals wiederholen. Dabei können Sie sich an der Wand abstützen, damit Sie die Balance behalten. Danach wechseln Sie die Füsse. Das Abrollen der Füsse löst die Faszienplatte an den Fusssohlen und aktiviert die Durchblutung der Füsse und des
ganzen Beines. Oft wirkt diese einfache Übung Wunder. Ich benutze die Rolle jeweils nach einem Wandertag in Bergschuhen mit starrer Sohle – jeden Fuss mehrmals abrollen und die Strapazen der Wanderung sind wie weggeblasen.
Zudem würde ich Ihnen empfehlen, als Abendritual vor dem Zubettgehen möglichst oft ein warmes Fussbad zu nehmen. Sie können eine Handvoll Meersalz – z. B. Salz vom Toten Meer – ins Wasser geben, allenfalls vermischt mit ein paar Tropfen Lavendelöl. Das ätherische Öl zuerst ins trockene Salz tröpfeln und dann alles zusammen im Badewasser lösen. So vermengt sich das Öl und schwimmt nicht auf der Wasseroberfläche. Nach dem Bad die Füsse mit Johanniskrautöl einölen, dicke Socken anziehen und schlafen gehen. Auch dieses kleine Verwöhnprogramm lockert die Fussmuskulatur und entspannt den ganzen Körper; darüber hinaus sorgt es für einen tiefen Schlaf. Gerade jetzt, im Winter geht nichts über ein Fussbad. Aber auch zu jeder anderen Jahreszeit sollte man sich öfters mal ein Fussbad gönnen, besonders in Stresssituationen, nach einem langen Arbeitstag auf den Beinen oder in emotional anspruchsvollen Zeiten.
Hilfe, die Nase läuft
Sobald es kühl wird, beginnen bei meinem Partner die Nase zu laufen und die Augen zu tränen. Haben Sie Tipps, um das auszugleichen? Vielleicht kennen Sie sogar ein «Wundermitteli»? Sollte er weniger Käse essen? Es ist das einzige Milchprodukt, das er grosszügig zu sich nimmt.
C. H., Zürich
Säm tliche Beschwerden, die sich durch Wind verstärken, werden im Ayurveda mit Öl behandelt. Öl ist der perfekte Ausgleich zu Kälte und Trockenheit. Doch wie beim trockenen Auge, das überläuft, könnte die Ursache für das Laufen der Nase auch die Trockenheit sein.
Ihr Partner könnte die Nase mit einem Sesamöl-Nasenspray pflegen oder mit dem Finger etwas Sesamöl in jedes Nasenloch reiben. Achten Sie darauf, dass es das normale Sesamöl ist, nicht jenes aus geröstetem Sesam – das wäre viel zu intensiv. Sesamöl nährt und schützt die Nasenschleimhaut. Dadurch können auch allergieauslösende Stoffe wie Hausstaub, Milben oder Pollen weniger gut über die Nase in den Körper eindringen. Ob das nun das Wundermittel für die Nase Ihres Partners ist, kann ich nicht versprechen; aber es ist sicher ein guter Anfang. Für die Augen sollte er Augentropfen kaufen für trockene Augen. Also kein Augentrost, sondern ein Tränenersatzprodukt. Denn auch das Überlaufen der Augen ist eine Reaktion des Körpers auf zu wenig Tränenflüssigkeit. Was die Ernährung betrifft, so würde ich empfehlen, mehrheitlich warm zu essen. Da Brot ohnehin sehr trocken ist, wären zum Frühstück ein Porridge, gedämpfte Apfelschnitze oder gebratene Bananen ideal. Am Abend statt Brot und Käse lieber gedämpftes Gemüse, Suppen oder Eintöpfe mit Gemüse. Käse wirkt bedeutend weniger kühlend und verschleimend, wenn er zusammen mit etwas Warmem gegessen wird. Das Ersetzen von Brot durch Kartoffeln oder Gemüse kann bereits eine Linderung bringen. Zusätzliche Entlastung gäbe die Bevorzugung von Schaf- und Ziegenkäse anstelle von Kuhmilchkäse und grundsätzlich nur solchen aus Rohmilch. Denn im Rohmilchkäse sind sämtliche verdauungsfördernden Enzyme noch enthalten. Zudem könnten Sie die Käsespeisen mit etwas Scharfem ergänzen. Eine scharfe Sauce, Feigensenf oder ein Frucht-Chutney (eine Art scharf gewürzte Marmelade) kann man einfach selbst herstellen. So isst man die verdauungsfördernden Gewürze gleich mit.
Kalkwasser
Bis anhin habe ich ein bis zwei Liter Wasser zehn Minuten kochen lassen und durch einen Kaffeefilter gegossen. Ohne diesen Filter ist das Wasser für mich ungeniessbar, weil mich der verbleibende Kalk im Hals kratzt. Nun wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Methode nicht gut sei, da das Wasser keine Mineralien mehr enthalten würde. Ich habe das so zubereitete Wasser immer sehr gerne getrunken, da es sehr leicht ist und mir schmeckt. Was meinen Sie dazu?
R. H. Igis
Mag sein, d ass mit dem Kalk ein Teil des Kalziums gefiltert wird. Sie haben aber immer noch sehr viele Mineralien im Wasser. Ein Kaffeefilter hält diese kaum zurück. Ausserdem sind sie hitzestabil und werden durch das Kochen nicht zerstört. Ich sehe deshalb keinen Grund, dass Sie von Ihrer Routine abweichen. Im Gegenteil: Wenn Sie zwei Liter abgekochtes Wasser trinken, wirkt sich das in Ihrem Körper aus wie ein Heilmittel. Der Grund: Das Wasser wird durch das längere Kochen energetisiert und kann besser von den Zellen aufgenommen werden. So zumindest lautet das überlieferte Wissen aus der AyurvedaLehre. Demnach stärkt abgekochtes Wasser wichtige Stoffwechselprozesse. Und allgemein gilt: Wichtiger als die Kalziummenge im Wasser ist die Gesamttrinkmenge, die bei vielen Menschen viel zu gering ist.
Und noch ein Tipp: Es gibt von der Firma Phytodor die Bachblütentropfen 40, Wasserbelebung. Man verwendet sie in der Regel für die Bachblütenmischungen. Bei uns zu Hause sind diese Tropfen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Ein Tropfen pro Liter Wasser reicht aus, um hartes Leitungswasser in bekömmliches Trinkwasser zu verwandeln. Ich fülle jeweils morgens einen grossen Krug mit Wasser, gebe die Tropfen rein und trinke tagsüber davon. So haben die Tropfen Zeit, ihre Wirkung zu entfalten. Gesundheitstipp

Knoblauch schützt vor Viren und Bakterien
Lieber stinkend das Leben geniessen als wohlriechend krank sein. Das könnte man Kritikern des Knoblauchgenusses entgegenhalten. Denn Knoblauch hilft bei Erkältungen und hält die Blutgefässe gesund. Er stärkt im Winter die Immunabwehr und regt im Frühling den Leberstoffwechsel an. Wirkung: Knoblauch wirkt auf den Körper erhitzend. Das stark anregende Heilmittel hilft so der Verdauung auf die Sprünge und bringt viele Stoffwechselprozesse in Gang bringt. Allicin, der Hauptwirkstoff im Knoblauch, wirkt schleimlösend, entzündungshemmend und antibakteriell. Zudem senkt er die Cholesterinwerte, erhält die Gesundheit der Blutgefässe und könnte sogar eine vorbeugende Wirkung bei Darmkrebs haben. Studien dazu laufen.
Wie anwenden: Es ist der Saft des Knoblauchs, der so wertvoll für unsere Gesundheit ist. Knoblauchzehen kann man pressen, quetschen oder kleinschneiden und über die Speisen geben oder zum Kochen verwenden. Um den Knoblauch als Heilmittel zu nutzen, zum Beispiel bei Erkältungen, zerdrückt man gleich mit den ersten Symptomen zwei bis vier Knoblauchzehen und nimmt den Saft zusammen mit etwas Wasser ein. Das soll die Schwere und die Dauer der Erkältung reduzieren. Knoblauch gibt es auch in Form von Fertigpräparaten im Fachhandel zu kaufen.
Tipps rund um den Knoblauch:
• Frühlingskur: Knoblauch hilft der Leber, ihre Entgiftungsfunktion wahrzunehmen. Der enthaltene Schwefel regt die Leberenzyme an und hilft der Leber beim Abbau und der Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten.
• Tipp für die Küche: Wer rohen Knoblauch nicht mag, kann ihn nach dem Quetschen mit zwei Esslöffel heissem Pflanzenöl übergiessen und das Ganze ins Salatdressing, in die Dipp-Sauce oder über das Gemüse geben.
Haben Sie Fragen?
Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. s.hurni@weberverlag.ch
• Gegen die Knoblauchfahne: Vermeiden oder zumindest vermindern lässt sich die Ausdünstung des Knoblauchs mit Chlorophyll. Etwa in Form von Blattgrüntabletten oder durch das Kauen frischer, grüner Kräuter wie Oregano oder Salbei.

Steife Gelenke
Ich habe seit einiger Zeit morgens beim Aufstehen oder nach langem Sitzen steife Gelenke. Was kann ich aus Sicht der ayurvedischen Medizin dagegen tun? Ich bin jemand, der eher kalt hat. Ich versuche, drei Mal pro Tag warm zu essen, turne jeden Morgen, fahre Velo und schwimme. An Knie und Hüfte habe ich eine Arthrose und am Knie eine Zyste, die schmerzhaft sein kann. Kann ich mit einem Öl, einer Massage, mit der Ernährung oder einem Nahrungsergänzungsmittel meine Gelenke geschmeidig machen?
H. K., Wohlen
S teife Gelenke und Kältegefühl sind ayurvedisch betrachtet eine Störung des Windelements. Auch Ihr Kältegefühl deutet darauf hin. Das Windelement besänftigen heisst im Ayurveda: warm, ölig, süss und regelmässig essen.
Den ersten Schritt mit den warmen Mahlzeiten haben Sie bereits gemacht, das ist super. Suppen, Eintöpfe und gekochtes Wurzelgemüse sind ideal. Beobachten Sie eine Zeit lang, was das Abendessen mit ihrem Körper macht. Und essen Sie zwei Wochen lang keine tierischen Eiweisse am Abend, stattdessen Gemüse, Kohlenhydrate und Kartoffeln. Denn Eiweisse am Abend übersäuern den Körper und führen
zu Ablagerungen. Man sollte sie lieber über Mittag geniessen, dann hat der Körper Zeit, sie abzubauen. Verwenden Sie wärmende Gewürze wie Fenchel, Kardamom, Zimt, Lorbeer, Basilikum und Ingwer.
Machen Sie zudem zwischendurch mit warmem Wasser sanfte Entgiftungskuren. Dazu lassen Sie morgens in einer Pfanne zwei Liter Wasser während zehn Minuten köcheln und füllen es dann in eine Thermoskanne. Von diesem heissen Wasser trinken Sie alle 30 bis 60 Minuten ein Glas. Stellen Sie den Wecker. Das klingt vielleicht etwas banal, aber Sie werden sehen, es tut sehr gut. An Tagen, an denen dieses Vorgehen nicht möglich ist, trinken Sie morgens zwei grosse Gläser abgekochtes Wasser und den Rest über den Tag verteilt immer dann, wenn es ihnen einfällt.
Ein weiteres Heilmittel ist Öl: Massieren Sie die steifen Gelenke, Knie und Hüfte regelmässig mit Johanniskrautöl ein. Es wärmt, bringt Geschmeidigkeit in den Körper und dringt tief ein, sodass auch die Knorpelsubstanz genährt wird. Vielleicht könnte es ihnen auch helfen, wenn Sie ein Knorpelaufbaupräparat einnehmen. Grünlippmuschelextrakt oder «Gelenkkapseln» mit Glucosamin und Chondroitin zum Beispiel.
Und noch etwas: Achten Sie beim Schwimmen darauf, dass Sie nicht kalt haben und nehmen Sie am Tag des Schwimmens abends ein warmes Fussbad.
Die Patientenfrage

Todesfall nach Routineoperation – was wir daraus lernen können
E ine Patientin sucht ein kleineres Regionalspital auf, um ihre Gallenblase entfernen zu lassen – ein Eingriff, der in fast jedem Spital häufig durchgeführt wird. Nachdem die OP zunächst gut zu verlaufen schien, stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Leber beschädigt worden war. Nachdem detaillierte Untersuchungen zu spät eingeleitet worden waren, verstarb die Patientin an multiplem Organversagen. Dieser tragische Fall zeigt mehrerlei:
• Auch bei Routineoperationen können Komplikationen vorkommen, gerade im Bauchraum, wo lebenswichtige Organe nahe beieinanderliegen. Doch die Gefahr für Patienten könnte minimiert werden, indem frühzeitig das beste verfügbare Wissen beigezogen wird, ggf. durch Kontaktaufnahme mit einer spezialisierten Klinik.
• Zu diesem wichtigen Wissen muss auch das Wissen der Angehörigen gezählt werden. Der Partner der Verstorbenen ist zurecht verstört, dass auf seine eindringlichen Hilferufe erst so spät reagiert wurde – niemand kannte die Patientin besser als er.
Daher gilt: Informieren Sie sich auch bei häufigen Operationen darüber, wie oft ein Eingriff am jeweiligen Spital vorgenommen wird. Routine schliesst Fehler nicht aus, aber erhöht die Chance, dass auch bei Komplikationen richtig reagiert wird.
Chantal Agthe, Patientenberaterin SPO. Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min. Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).
Liebe und . . . die Angst davor
K ennen Sie das? Ein Leben lang haben Sie davon geträumt, und jetzt geschieht es: Die grosse Liebe – oder mindestens der erträumte Lebensabschnittsgefährte – und er zeigt, dass er «der Richtige» ist. Alle Versuche, Irrwege und Neustarts Ihres Lebens haben zu diesem Moment, zu diesem Menschen geführt. Sie müssen nur noch ja sagen, aufmachen, den anderen einlassen – und lieben. Einfach nur diesen einen Schritt weitergehen und das Zeichen geben, dass Sie ihn (oder sie) meinen. Sie sollten es tun. Jetzt. Sie wollen auch – aber … Sie bleiben verstockt. Sie sagen etwas Unverbindliches, schinden Zeit – und schon ist der Augenblick vorbei.
I hr Gegenüber ist sichtlich enttäuscht. Was hält Sie zurück? Gibt es noch jemand anders, der ihnen mehr bedeutet? Einen Ex oder einen Treueschwur, den Sie einmal geleistet haben? Ist Ihr Erwählter doch nicht die heisseste Wahl? Doch, das ist er. Er – oder sie – ist wunderbar und alles, was Sie sich gewünscht haben. Was also ist passiert? Sie allein wissen es: Sie haben die Hosen gestrichen voll.
A ngst in der Liebe. Bindungsangst, Einlassstörung, Berührungshorror schreien Ihnen ins Genick; und gehorsam und verängstigt ziehen Sie die Handbremse. Wie schon so oft. Manche Angsthasen werden in diesem Moment mittels «Ghosting» zum Geist. Sie verschwinden von der Bildfläche, melden sich nicht mehr, antworten nicht auf Anrufe, ändern die E-Mail-Adresse oder finden andere Wege, ganz aus dem Leben des geliebten Menschen zu verschwinden. Das scheint besser, als zu erklären, was los ist. Besser, als die Peinlichkeit zu ertragen. Und ganz sicher besser, als wirklich Gefahr zu laufen, sich doch noch einzulassen. Und so bleibt man allein, tut, was man so tut, und versucht zu vergessen – bis man es wieder mit einem neuen Flirt versucht.
Ich selbst habe mir lange vorgemacht, meine Angst vor Nähe wäre eine besondere Art der Freiheit: Es gibt doch noch so viele Blüten, an denen ich schnuppern, so viele Menschen, die ich lieben kann. Das stimmt. Aber mit einem muss man mal anfangen, und dafür muss ich einen Weg um die Angst herum finden.
Seit einiger Zeit habe ich etwas entdeckt: Ich muss mich nicht für meine Angst schämen und fertig machen. Ich muss sie auch nicht besiegen oder kleinreden. Ich muss ihr aber auch nicht blind folgen. Es gibt etwas viel besseres: Ich kann meine Angst lieb haben.
Wenn die Stimme der Angst brüllt, ich soll abhauen – dann drehe ich mich um und stelle mir vor, sie ganz lieb in den Arm zu nehmen. Manchmal frage ich sie auch: «Was ist denn los? Was soll denn schon passieren? Sag du mir doch, wie ich lieben soll.» Und wie erstaunlich: Die Stimme der Angst, sonst so allwissend, weiss an dieser Stelle gar nichts. Mit Liebe kennt sie sich nicht aus. Sie will nur eines: mich beschützen vor Schmerz; und notfalls vor der Liebe. Dann nehme ich sie fester in den Arm, knuddle und liebkose sie, fühle mich in sie hinein und finde … meinen uralten Liebeskummer. Ja, ich bin verlassen worden! Das tut immer noch weh. Und es war einmal so heftig, dass ich nie wieder lieben wollte! Nie wieder so verletzlich sein und so verletzt werden.
Na und? Das soll mich davon abhalten zu lieben?! Jetzt, wo ich das wieder fühle, kann ich auch neue Entscheidungen treffen: Ich will Nähe. Ich will mich einlassen auf die Liebe. Komm ruhig mit, meine Angst. Du darfst auch da sein; aber du bist nicht mehr Herrin in meinem Haus. Unser beider Herrin ist die Liebe.

Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin. Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen, lebte u. a. über 18 Jahren in Tamera, Portugal, sowie anderen Gemeinschaften auch in anderen Kontinenten. Am meisten liebt sie das Thema Heilung von Liebe und Sexualität sowie neue Wege für das Mann- und Frau-Sein.

Dem Schicksal die Stirn bieten
Patrizia Manolio wurde vergewaltigt, erkrankte schwer an Krebs und brauchte eine Nierentransplantation. Wie hat sie die brutalen Schicksalsschläge er- und überlebt? Eine Geschichte von Tiefschlägen und dem Mut, nie aufzugeben.
Text: Blanca Bürgisser
Patrizia Manolio ist eine Kämpferin. Sie hat brutale Schicksalsschläge überlebt: 2004 wurde sie vergewaltigt; 2011 wurde bei ihr Knochenkrebs diagnostiziert, die Ärztinnen und Ärzte gaben ihr nur noch drei Monate zu leben. Nach 13 Chemozyklen hatte sie den Krebs besiegt. Kurz darauf versagten ihre Nieren. Deren wichtige Hauptaufgabe ist die Entgiftung des Körpers. Drei Jahre lang ging Manolio, die damals noch Maurer hiess, in die Bauchfelldialyse und wartete auf eine Nierentransplantation. Die Rettung brachte dann die Nierenspende ihrer Schwester.
Während ihres langen Kampfes hat die heute 38-Jährige nach Geschichten gesucht, die Mut machen. Doch sie wurde nicht fündig – die meisten endeten mit dem Tod. So hat sie sich selbst das Versprechen gegeben, das zu ändern: Sollte sie jemals mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit, dann in Form eines Buches, das Mut macht.
Als es ihr einige Monate nach der Nierentransplantation wieder besser ging, erinnerte sich die junge Frau an ihr Versprechen. Sie dachte daran, wie viele Menschen am Kämpfen sind wie sie und vielleicht genau auf so einen Hoffnungsschimmer warteten. Das gab ihr den Anstoss, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Die Umsetzung ihres Buches «Überleben» sei ihr sehr leicht von der Hand gegangen, erzählt Manolio. «Vielleicht gerade deshalb, weil ich mir schon viele
Gedanken über alles gemacht hatte.» All das Erlebte zu Papier zu bringen, habe ihr auch ein Stück weit geholfen, abzuschliessen und die Gedankenkreise im Kopf etwas zu beruhigen: «Mit dem Aufschreiben war es raus, und ich kann es seither ruhen lassen.»
Woher kommt die Kraft?
Wenn man ihre Geschichte hört, fragt man sich, wie Patrizia Manolio die Kraft gefunden hat, weiterzuleben. Darauf antwortet sie: «In erster Linie war es ein Stück weit Trotz und meine Sturköpfigkeit.» Aber auch der Glaube an Gott habe ihr während ihres Kampfes immer wieder Kraft gegeben. «Ich hatte einige Schutzengel hatte auf meinem Weg», erzählt sie, «und sicher eine grosse Portion Glück.» Letzteres betont sie besonders, denn sie möchte auf keinen Fall implementieren, dass Menschen, die den Kampf verloren haben, nicht stark genug waren.
Manolio erzählt im Gespräch auch, wie es ihr gelingt trotz allen Schicksalsschlägen das Positive zu sehen. Für sie sei das auch eine Art Schutz: «Vielleicht liegt es daran, dass ich tief in mir eine Romantikerin bin und an Happy Ends glaube.» Andersherum sei sie überzeugt, dass man Schlechtes anzieht, wenn man nur noch das Schlechte sieht. Trotz dieser Überzeugung: «Oft gelingt es mir erst im Nachhin-


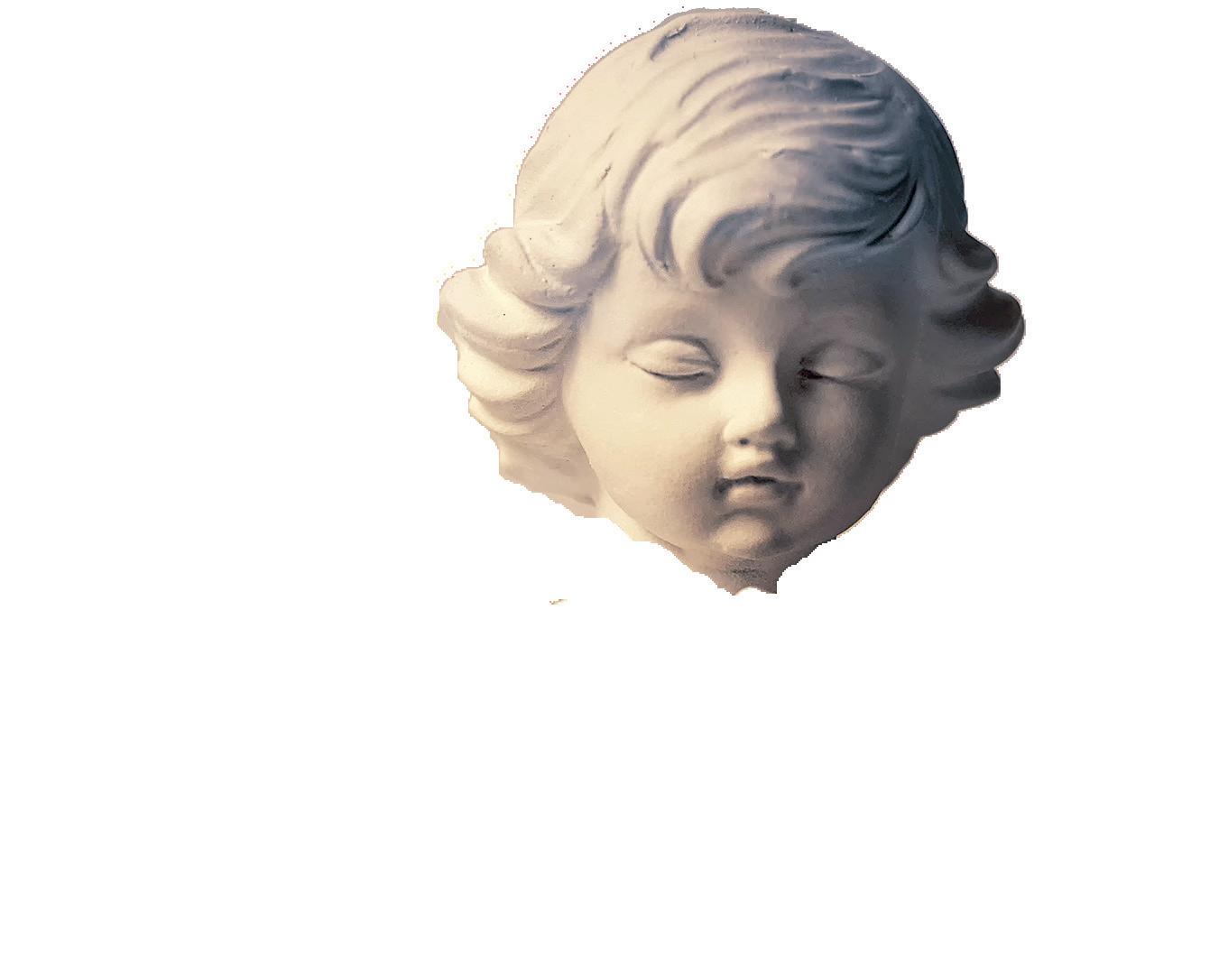



Vom Wert der «bucket list»
Patrizia Manolio ist es aber auch wichtig, dass «positiv zu sein» nicht bedeutet, dass man immer alles positiv sieht. Auch mit Ratschlägen, wie «du darfst nur die Hoffnung nicht verlieren», ist sie vorsichtig. «Schliesslich möchten alle, die so einen Schicksalsschlag durchmachen, überleben und wieder nach vorne schauen.» Sie betont, dass es normal ist, dass man manchmal einfach wütend ist oder keine Energie mehr hat. «Wenn man in einer Sackgasse landet und das Gefühl hat, es geht nicht vorwärts, besteht immer noch die Möglichkeit rückwärts oder nach links oder rechts zu gehen.» Manolio ist überzeugt, dass man sich auch Rückschläge erlauben darf, wenn man in eine positive Richtung steuert.
Der lange
Weg in die Normalität
Und wie gelang es ihr, die extremen Traumata zu überwinden? Sie selbst sagt, dass zu einem grossen Teil Zeit tatsächlich die Wunden heilt. Gespräche mit Bekannten und Familie hätten ihr dabei sehr geholfen. Und ebenso die Tatsache, endlich wieder in der «Normalität» zu leben.
Den Weg zurück in diese Normalität sei für sie enorm schwierig gewesen. «Denn tief im Innern hat man eine Wehmut an alte Zeiten, und möchte diese möglichst schnell wieder zurückhaben. Doch in der Realität ist das schwierig. Man muss lernen mit den körperlichen und psychischen Veränderungen umzugehen und diese ein Stück weit zu akzeptieren.» Als sie diese neuen Voraussetzungen zu akzeptieren und auf ihnen aufzubauen begann, habe sie ihren Weg gefunden: «Ich musste mir auch sagen, dass zehn Jahre vergangen sind seit dem Schicksalsschlag mit dem Krebs. Selbst ohne diese Erkrankung, wäre jetzt nicht mehr alles so möglich wie damals. Ich glaube, mit diesem Bewusstsein konnte ich mich etwas trösten.» Auch der Fokus auf «normale» oder bescheidene Ziele habe ihr sehr geholfen. Darunter waren beispielsweise die Wünsche, wieder arbeiten zu können oder einen eigenen Haushalt zu führen; wieder Velofahren lernen, war ebenso ein grosser Vorsatz, den sie erreicht hat. Auch Alltagsprobleme wieder zuzulassen sei ein grosser Schritt für sie gewesen: «Als ich mich wieder über Dinge wie Stau aufregen konnte, zeigte mir das, dass ich langsam wieder in der Normalität angekommen bin.»
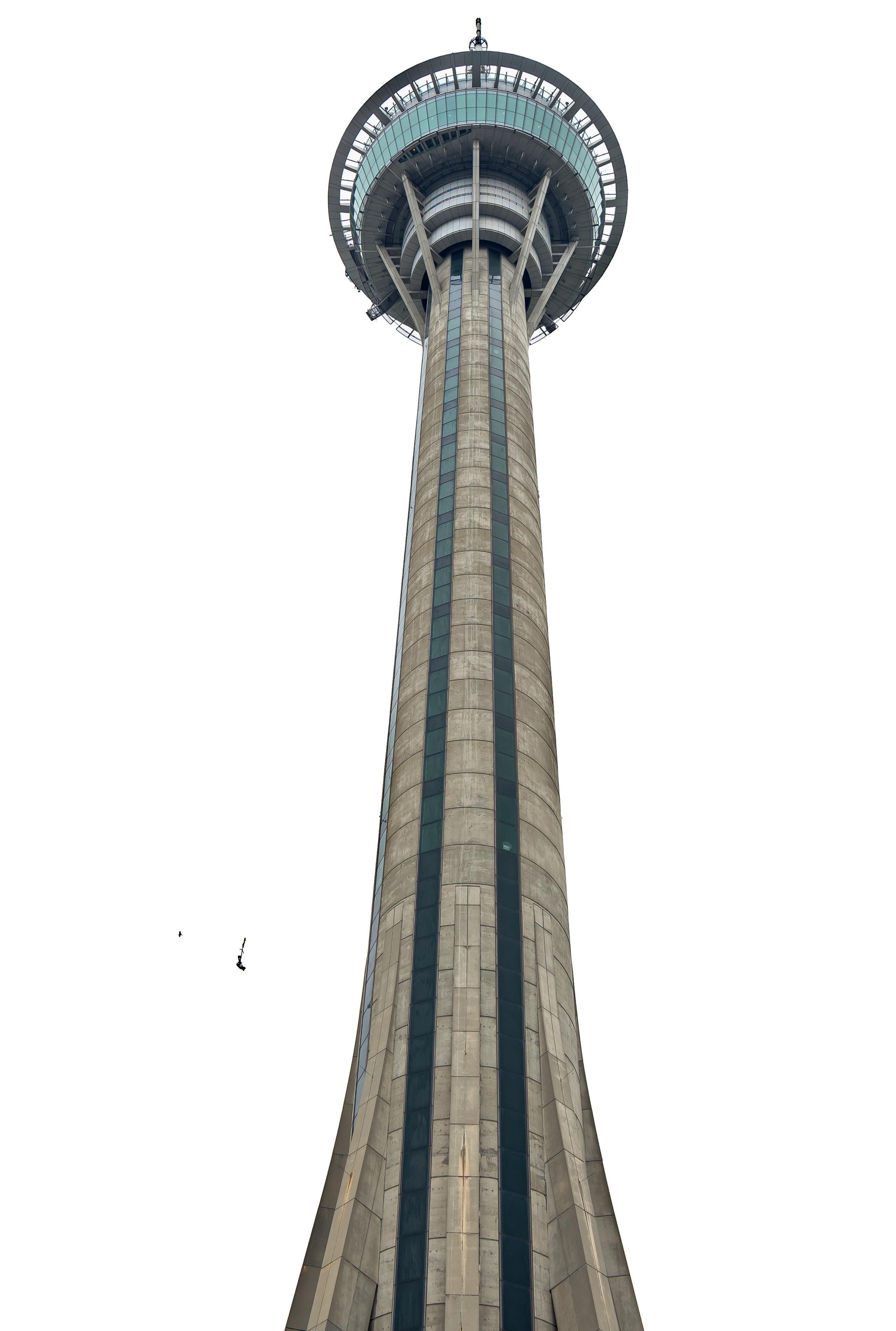
Die schweren Schicksalsschläge haben auch zur Folge, dass Patrizia Manolio heute viel intensiver lebt. «Als ich die Diagnose Knochenkrebs erhielt, wurde mir bewusst, wie viel ich immer machen wollte, es aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben habe.» Im Zuge der Diagnose habe sie sich geschworen, nie mehr in eine Situation zu kommen, wo sie das Gefühl habe, sie hätte nicht das bestmögliche aus ihrem Leben rausgeholt. «Ich will auf Jahre zurückblicken können, von denen ich sagen kann, dass ich wirklich gelebt habe.»
Als sie im Spital den Film «Das Beste kommt zum Schluss» (Original: «The Bucket List») gesehen habe, habe sie realisiert, dass sie auch so eine Liste brauche. Eine bucket list ist im gängigen angelsächsischen Sprachgebrauch eine Liste, auf der man alles aufzählt, was man bis zu seinem Lebensende noch gerne machen möchte. Und Patrizia Manolio wollte noch so vieles erleben! Das begann bei Sachen, die vielen «normal» erscheinen, wie wieder selbständig zu duschen oder die Türe abschliessen zu können, um für sich zu sein. Aber auch Dinge wie einen Cervelat bräteln, an ein Konzert gehen, Heiraten und vieles mehr schrieb sie auf ihre bucket list. Auch Bungee-Jumping war auf ihrer Liste. «Das mit dem Bungee-Jumping habe ich auf die Liste gesetzt, weil ich im Spital im Bett oft in Situationen geraten bin, in denen ich mich gefangen gefühlt habe. Und nachts habe ich oft vom freien Fall geträumt», erzählt Manolio. «Ich glaube, meine Psyche hat mir damit zu verstehen gegeben, dass mir die Freiheit fehlt.» abzugewinnen.» Ein extremes Beispiel dafür: Die heftige Gewalteinwirkung in der Nacht der Vergewaltigung hat dazu geführt, dass ihre Schilddrüsen beschädigt wurden. Jahre später sagte ein Arzt, dass der Krebs sich aufgrund ihrer fehlenden Schilddrüse weniger schnell gestreut habe.




Macao Turm | Die höchste Bungee-Anlage der Welt – sie befindet sich 233 Meter über dem Grund.
Als sie in der chinesischen Sonderverwaltungszone
Macao die Chance hatte, von der welthöchsten kommerziellen Bungee-Station (Absprunghöhe: 233 Meter) zu springen, ergriff sie die Gelegenheit ohne zu zögern. «Als ich oben gestanden bin, war mir schon etwas mulmig zumute», räumt sie ein. Doch sie hat sich daran erinnert, wie sehr sie es sich damals im Spital gewünscht hat und habe sich gesagt: «Wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es irgendwann bereuen.» Das Gefühl vom freien Fall sei unbeschreiblich gewesen: «Es war für mich wie ein Befreiungsschlag. Es war ein Gefühl von jetzt ist auf einmal alles weg. Das war einfach unglaublich schön. Danach war ich noch drei Tage lang wie auf Adrenalin.»
Das Leben als Hürdenlauf
Seit der Erscheinung ihres Buches im Jahr 2020 hat sich für Patrizia Manolio einiges verändert. Trotz den äusseren Einschränkungen durch die Coronapandemie hat sie den Fokus auf etwas Schönes gelegt: auf ihre Hochzeit. Diese musste zwar um ein Jahr verschoben werden; «umso schöner war dafür das Fest in der Toskana letzten Sommer». Auch in der Arbeitswelt hat für Manolio ein neues Kapitel begonnen: seit einem Jahr arbeitet sie bei der Stiftung Swisstransplant. Wenn sie davon erzählt, wird ihre enorme Begeisterung spürbar: «Es ist interessant, das Ganze von der anderen Seite zu sehen. Gleichzeitig habe ich sehr viele spannende Austausche mit Menschen, die ähnliche Schicksalsschläge erlebt haben wie ich.»
Auch in Zukunft möchte Patrizia Manolio für andere Menschen, die schwere Schicksalsschläge durchlitten haben, da sein. Sie plant nächsten Januar eine Weiterbildung Richtung Coaching. Sie möchte eine Plattform aufbauen für andere «Kämpferinnen und Kämpfer», eine Plattform wo man sich austauschen und vernetzen kann. Und sie möchte Menschen begleiten, die ähnliche Schicksalsschläge erlitten haben wie sie; möchte ihnen zuhören, als jemand, der aufgrund der Eigenerfahrung Verständnis hat für die Situation und dadurch wertvolle Ratschläge geben kann: «Mich mehr und mehr in diese Menschen hineinzuversetzen und ihnen zu helfen, das ist mein aufrichtiger Wunsch», sagt sie. «Menschen, die wie ich nicht den langweiligen einfachen Weg gewählt haben, sondern den schwierigen Hürdenlauf.» •
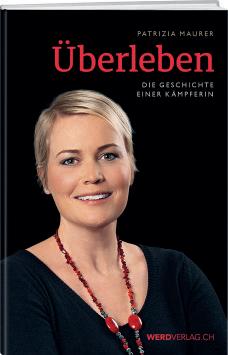
Buchangebot
Mehr über Patrizia Manolios Geschichte erfahren Sie in ihrem Buch «Überleben».
Leser:innendes «natürlich» können es mit dem Gutscheincode «natürlich» für Fr. 29.–statt 39.– bestellen (inklusive Versand). weberverlag.ch


Bungee-Jumping | In Macao hat Patrizia Manolio den freien Fall gewagt –und damit einen weiteren Punkt auf ihrer bucket list abgehakt.


Lass dir Flügel wachsen
Ohne Metamorphose erblickt kein «Imago» das Licht der Welt. Was können wir aus dieser Erkenntnis aus dem Reich der Insekten für unser persönliches Wachstum lernen?
Text: Eva Rosenfelder
Das Gefühl täuscht nicht: Die Erde dreht tatsächlich schneller, habe ich neulich gelesen. Das belegen hochpräzise Aufzeichnungen der Erdrotation, die seit rund 70 Jahren erfasst werden. Und die erhöhte Erdrotation führt dazu, dass unsere Tage kürzer werden, die Zeit schneller rennt. Auch wenn es im genannten Zeitraum nur um zwei Millisekunden ging: Für mich ist das eine Bestätigung, dass alles stets mehr zu rasen scheint. Offensichtlich ist das doch nicht nur eine Alterserscheinung. Und so suche ich weiter nach neuen Strategien, weil ich stän dig «in letzter Minute» unterwegs bin. Umso beeindruckender sind für mich Lebewesen, die in der Ruhe weilen, was auch immer geschieht. Denn in der Ruhe liegt nicht nur die Kraft, sondern noch vielmehr auch die Möglichkeit zur Wandlung: hin zu dem, was wir uns Imaginieren – und das ist mehr als nur ein Fantasiegespinst.
Imaginieren bedeutet «sich vorstellen, einbilden». Unter «ein-bilden» verstehe ich vielmehr, als das blosse Entwickeln innerer, sinnlicher Bilder, die man geistig schaut. Denn diese Bilder können immense Kraft entwickeln und in die soge nannte Realität hineinwirken – was dann oft als «Magie» be zeichnet wird. Doch was ist denn diese Vermittlerin zwischen Sinnlichkeit und Verstand, wie Kant die Imagination einst beschrieb, anderes als unser «Urfunke»?
Die Kraft der Vorstellung ist von grosser Wichtigkeit. Sie schenkt uns die Freiheit ungeahnter Möglichkeiten und kann ein hilfreicher Kompass sein auf unserem Lebensweg. Ein Weg, den wir in vielen Bereichen un bewusst gehen. Genetische, frühkindliche oder soziale Prägungen, Kultur, Religion, das kollektive Unbewusste, frühere Leben, vielleicht Karma und allerhand weitere Einflüsse sind – ob wir es wollen oder nicht – mit dabei am Steuer.
Ein Traum wird wahr
Umso wichtiger ist es, soweit überhaupt möglich, innere Bilder bewusst zu entwickeln – und zwar solche, die der persönlichen und kollektiven Heilung und Entwicklung dienen. Das machen sich unter anderem Metho den wie autogenes Training, Hypnose, Meditation, luzides Träumen, schamanische Techniken usw. zunutze. Doch wir können auch einfach bei der Natur abschauen, wie das geht.
Jedes Projekt, jede Entwicklung, jeder Fortschritt wächst aus einem Impuls oder einer Idee (Larve) heran, muss sich in einer Zeit der Stille verpuppen und wird irgendwann reif, um zu schlüpfen und (als Imago) beflügelt die

«
Jede Entwicklung braucht ihre Zeit. Daran führt kein Weg vorbei. »
Ein Blick in den Mikrokosmos öffnet den Zugang zu Langsamkeit und Geduld; und zum Vertrauen ins zyklische Leben. Haben Sie gewusst, dass viele Wildbienen neun Monate (!) brauchen, um sich von der Larve zur adulten, fliegenden Biene zu entwickeln? Es ist dies der grösste Teil ihres Lebens. Danach lebt sie nur noch für kurze Zeit, von Luft und Liebe, bis zur Eiablage. Dafür sucht sie sich einen passenden Ort, mit genug Nahrung für den Nachwuchs, denn sie wird ihn bald komplett sich selbst überlassen. Während dieser kurzen Zeit, welche die adulte und reife Biene am Licht verbringt, wird das Tierchen «Imago» genannt. Wie treffend! Es ist im wahrsten Sinn zu dem geworden, was es sich im Dunkeln erträumt – oder eben imaginiert – hat: zum beflügelten Wesen inmitten von Licht und Liebe.
Was reifen soll braucht seine Zeit
Der Begriff Imago hat seinen Ursprung – gleich der Imagination – aus dem lateinischen imago, was so viel bedeutet wie Erscheinung oder Bild. Im Deutschen hat Imago laut Duden auch die Bedeutung «im Unterbewusstsein vorhandenes (Ideal)Bild einer anderen Person der sozialen Umwelt». In der Zoologie wird mit Imago das fertig ausgebildete, geschlechtsreife Insekt nach der letzten Häutung benannt. Es ist das letzte Stadium der faszinierenden Metamorphose, so wie man sie bei Wildbienen, Schmetterlingen und vielen anderen Insekten sichtbar miterleben kann. In dieser kleinen Welt ist noch sinnlich nachvollziehbar, was in unserem ganzen Leben geistig immer wieder neu geschehen kann. Oder eher: könnte.
Denn leider bleiben wir Menschen allzu oft im Larvenoder Puppenstadium stecken. Menschlein. Larvengleich. Entweder, weil wir erst gar nicht an unsere eigene mögliche Verwandlung zur Imago glauben, diesem voll entwickelten Wesen mit all seinen Möglichkeiten. Oder weil das Bild, das
wir als unsere Imago vor uns sehen, nicht gesellschaftsfähig ist. Oder schlicht, weil uns Zeit, Geduld oder Vertrauen fehlen. Verwandlungen sind bei uns Menschen oft zart und kaum sichtbar. Dabei verlaufen sie genau gleich wie in der Welt der Insekten: Jedes Projekt, jede Entwicklung, jeder Fortschritt wächst aus einem Impuls oder einer Idee (Larve) heran, muss sich in einer Zeit der Stille verpuppen und wird irgendwann reif, um zu schlüpfen und (als Imago) beflügelt die Welt zu befruchten.
Den verschiedenen Lebensstadien der Insekten, die eine Metamorphose durchleben, sind unterschiedliche Funktionen zugeordnet, die durch Hormone gesteuert werden. Ähnlich ist es beim Menschen: Auch bei uns ändern sich die Hormone mit dem Alter. Und hat nicht jede Lebensphase ihren tiefen Sinn, gerade für die innere Entfaltung?
Kleiner entomologischer Exkurs
Lassen Sie uns die Welt der Insekten noch etwas genauer betrachten. Vielleicht können wir so unsere eigenen Entwicklungsphasen besser verstehen. Die weibliche Imago legt ihre Eier dort ab, wo für die Larven ein gutes Nahrungsangebot besteht. Im Larvenstadium geht es hauptsächlich um Wachstum. Typische Larvenformen sind Raupe (Schmetterling), Engerling (Käfer) oder Made (Fliege). Die fetten Larven verwandeln sich in weitgehend unbewegliche Puppen. Im Kokon respektive in der Puppenhülle aus Chitin geschieht das Wunder der Metamorphose: Während dieses Übergangsstadiums wird der Insektenkörper vollständig umgebaut. Nach der vollständigen Verwandlung schlüpft die Imago als Käfer, Falter, Biene oder Fliege. Die Imagines sind zuständig für Fortpflanzung und Verbreitung der Art – das ist ihre Hauptaufgabe, um nicht zu sagen: die einzige.

Ungefähr 85 Prozent aller Insektenarten vollziehen diese vollständige Verwandlung. Man nennt sie holometabole Insekten. Den grössten Teil ihres Lebens widmen sie der Entwicklung ihres Imagos. Die kurze Zeit als Imago –als vollkommenes Wesen – ist «nur» dazu da, sich dem Leben ganz und gar hinzugeben und zu verschenken. Manche Insekten wie etwa Läuse, Heuschrecken, Wanzen oder Libellen gehen einen etwas anderen Weg. Man nennt sie
hemimetabole Insekten. Ihre Larven ähneln bereits dem ausgewachsenen Insekt, wenn sie aus ihren Eiern schlüpfen; doch fehlen diesen «Nymphen» meist Geschlechtsorgane und Flügel. Auch sie müssen sich noch entwickeln, und zwar indem sie sich häuten; zum Teil bis zu zehnmal. Erst dann sind sie flug- und fortpflanzungsfähige Imagines.
Einzig die einfacher gebauten Ur-Insekten, wie etwa Silberfischchen oder Springschwänze, durchlaufen keine Metamorphose, sondern eine direkte Entwicklung. Hier gleichen die frisch aus den Eiern geschlüpften Tierchen fast vollständig der Imago. Doch selbst sie müssen sich mehrfach häuten, bis sie das Erwachsenenstadium erreicht haben.
Und nun rein ins Gespinst!
Daran führt offenbar kein Weg vorbei: Jede Entwicklung braucht ihre Zeit. Doch das haben wir scheinbar vergessen. In unserer optimierten Welt gilt es stetig, zu funktionieren; nichts von Verpuppen, Ruhen oder Häuten. Diese Zeit der Verinnerlichung, die das Wachstum überhaupt erst ermöglicht, empfinden wir als lästigen Bremsklotz. Warum nicht schneller, wenn es doch schneller geht? Wozu Stille und Dunkelheit, wenn sich doch die Nacht so leicht zum Tag machen lässt? Wozu den Wandel des Lebens zulassen, wo wir doch Hormone, Botox, Gentechnik haben? Wozu alt werden?! Lieber bleiben wir als Gesellschaft im Larvenstadium: fette, infantile, räuberische Larven, die den Planeten kahlfressen. Hauptsache für uns ist genug da. Sichtbar wird diese Haltung auch im Kleinen. Etwa in unseren Gärten: im Herbst wird alles geputzt, geschnitten und weggeräumt. Mit solch linearem Ordnungssinn herrscht zwar «Sauberkeit», doch die heranwachsenden Larven werden samt dem Schnittgut entsorgt, leben sie doch in Stängeln und Totholz. Manche Stängelnister sind darauf angewiesen, dass zum Beispiel Königskerzen und Karden über mehrere Jahre erhalten bleiben! Im ersten Jahr blüht die Pflanze und verdorrt im Herbst. Die oft ortstreuen Wildbienen nisten erst im zweiten Jahr darin; und schlüpfen im dritten. Wievielmal jäten und räumen wir in dieser Zeit unseren Garten?
gleich der Larve, die in der Grünabfuhr landet. Doch ohne die Larvenzeit gut durchstanden zu haben, wird nichts mit dem Frei-Flug. Ohne diese Zeit der Verinnerlichung wachsen uns keine Flügel. Alles Hirngespinste? Ja, genau: darum geht es! Ich suche mir jetzt eine ruhige Nische, um die Zeit anzuhalten und mich tüchtig zu nähren. Um in mich zu lauschen. Der Winter ist eine ideale Zeit dazu: Um sich in Demut und Dankbarkeit zu üben und immer weniger im Verstand, als vielmehr aus dem Herzen zu leben. •

Brut-Anleitung für Flug-Künstler:innen
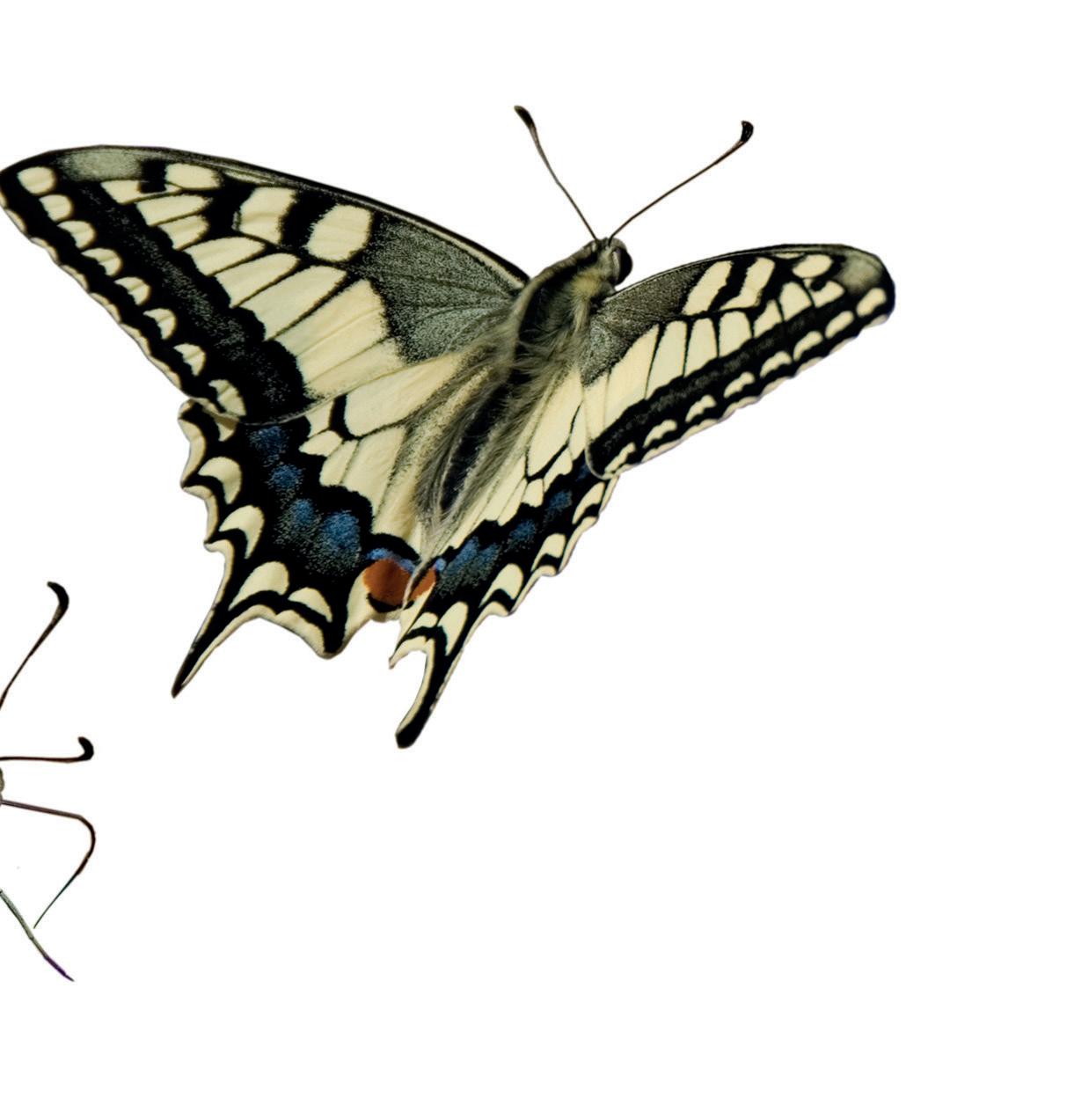
Wie den Wildbienen geht es auch unserem «geistigen» Imago; man könnte auch sagen unserer Seele oder im übertragenen Sinne: unserer Lebensvision. Was wir uns einst vorgestellt und «ein-gebildet» haben, als wir den Weg in diese Inkarnation antraten – dieses Imago bleibt auf der Strecke,
Larvenzeit
• Nimm dir Leer-Zeit.
• Brainstorming: Was sind deine Hirngespinste? Welche Projekte wolltest du immer verwirklichen? Welche Lebensträume wurden dir ausgeredet?
Puppenzeit
• Behalte deine Hirngespinste für dich; hüte sie, und lass sie sich in aller Stille verpuppen.
• Das Schwierigste ist jetzt: Geduld, Geduld, Geduld!
• Und: Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen!
• Erinnere dich daran: Alles entfaltet sich zu seiner Zeit.
Flugzeit (Imago)
• Wenn du fliegst: Verschenke dich bedingungslos!

«
Fünf bis zehn Prozent der Erwachsenen in den westlichen Ländern leiden an einer krankhaften Schlafstörung.
Erholsamer SchlafSäule des Lebens
Schlaf gehört wie Essen und Trinken zu unseren biologischen Grundbedürfnissen. Was aber tun, wenn wir nicht in den Schlaf finden oder der Schlaf uns keine Erholung beschert?
Text: Gundula Madeleine Tegtmeyer
Erholsamer Schlaf ist essenziell. Denn während wir schlafen, spielen sich in unserem Körper lebensnotwendige Prozesse ab: unser Immunsystem läuft auf Hochtouren, Körperzellen regenerieren, Wunden heilen, lebenswichtige Proteine bilden sich. Auch unser Stoffwechsel gönnt sich keine Nachtruhe – er verarbeitet, was wir tagsüber aufgenommen haben. Bekommt unsere Körper nicht genügend Schlaf, so hat er nicht ausreichend Zeit, um Nahrung zu verstoffwechseln; das kann zu Übergewicht führen. Schlafstörungen sind ausserdem ein Risikofaktor für Bluthochdruck und Herzinfarkte. Und der durch Schlafmangel erhöhte Cortisolspiegel kann sich negativ auf den Blutzuckerspiegel auswirken und Diabetes Typ 2 begünstigen. Tagesmüdigkeit wiederum erhöht die Unfall- und Sturzgefahr. Eine fortwährende Übermüdung kann zudem Depressionen und Angstzustände auslösen. Doch wieso sind die Folgen von Schlafmangel so dramatisch?

achtet.» Diese Ansicht wurde in den letzten Jahren revidiert und Schlafprobleme als eine eigenständige Erkrankung kategorisiert. Doch wie kommt es überhaupt zu Schlafproblemen? Um das zu klären, schauen wir uns das Phänomen Schlaf genauer an.
Sobald die Abenddämmerung eintritt, produziert unsere Zirbeldrüse Melatonin, das «Schlafhormon». Es macht müde und bereitet uns auf das Zubettgehen vor. Während des Einschlafens verlangsamen sich im Normalfall Herzfrequenz und Atmung, der Blutdruck sinkt, ebenso die Körpertemperatur (um einige Zehntelgrad). Sind wir gestresst, stellt sich dieses Ruhe-Level nicht ein und wir schlafen schlecht; wenn überhaupt. Der Grund: die erhöhte Cortisol-Ausschüttung. Das Hormon Cortisol ist der Gegenspieler zum Melatonin.
Unser Gehirn ist nachts hochaktiv, nicht nur wenn wir träumen. Es sortiert eine Fülle von Informationen, löscht Unwichtiges, speichert Wichtiges und schüttet zudem Hormone aus, wie etwa Somatotropin, umgangssprachlich «Wachstumshormon» genannt. Dieser Botenstoff erfüllt wichtige Funktionen: Bei Erwachsenen fördert er den Fettabbau zur Energiegewinnung, den Muskelaufbau und eine gute Knochendichte; Kinder lässt Somatotropin wortwörtlich im Schlaf wachsen – wenn sie denn gut schlafen.
Wieso wir keinen Schlaf finden «Noch vor einigen Jahren wurden Einschlaf- und Durchschlafstörungen als ein Symptom betrachtet, das im Rahmen oder als Folge einer körperlichen oder psychischen Erkrankung auftritt. Schlafstörungen galten also nicht als eigenständige Krankheit oder Störung», sagt Daniel Brunner, Spezialist am Zentrum für Schlafmedizin der Hirslanden-Gruppe in Zollikon (ZH). «Man nahm an, dass eine wirksame Behandlung der ‹Grunderkrankung›, wie etwa einer Depression, auch die Schlaflosigkeit zum Verschwinden bringt. Eine Therapie des Schlafproblems wurde als unnötig er-




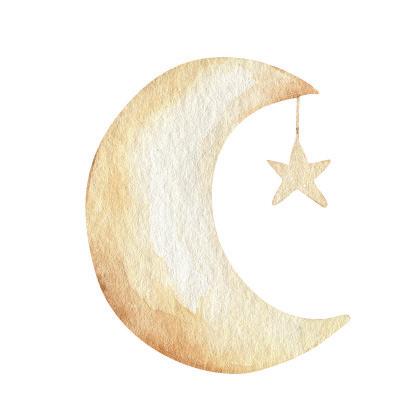
Unter einer stressbedingten Insomnie –einer krankhaften Schlafstörung – leidet laut Definition, wer über einen Zeitraum von mehr als einem Monat mindestens an drei Tagen in der Woche Probleme beim Einschlafen hat, sich mehr als 30 Minuten schlaflos herumwälzt oder in den frühen Morgenstunden erwacht und nicht mehr zurück in den Schlaf findet, obwohl man noch nicht ausgeschlafen ist. Dauern die Probleme länger als drei Monate an, gehört man zu den schätzungsweise fünf bis zehn Prozent der erwachsenen Bevölkerung in den westlichen Ländern, die an einer chronischen Insomnie leiden.
Stressquellen reduzieren
Schlafmediziner Daniel Brunner erklärt die Mechanismen der Chronifizierung, dem Übergang von der vorübergehenden zu einer dauerhaften Schlafstörung: «Eine chronische Insomnie besteht einerseits aus dem Teufelskreis von wenig Schlaf und der Angst vor wenig Schlaf. Andererseits entsteht infolge langer und frustrierender Wachzeiten im Schlafzimmer eine Atmosphäre von Anspannung und Wachsein, die in der Einschlafsituation als erlernte, also konditionierte Erregung den Schlaf erschwert.» Brunner zufolge führt die Sorge um den Schlaf bei den Betroffenen zu hoher Aufmerksamkeit bezüglich ihres Schlafzustandes. «Dieses ‹wachsame Schlafen›, die erlernte Erregung rund um das Thema Schlaf, und der Teufelskreis mit der Schlafangst machten eine Schlafstörung chronisch und unabhängig von anderen Krankheiten oder Stressoren», fasst der Experte zusammen. Andererseits kann schlechter Schlaf auch ein Warnsignal des Körpers sein, der damit auf andere Krankheiten aufmerksam machen will (siehe linke Spalte). Umso wichtiger ist es, dem Thema Schlafqualität auf den Grund zu gehen, insbesondere wenn diese schlecht ist.
Eine umfassende Anamnese ist das wichtigste Instrument, um Betroffenen helfen zu können. Stress- und Schlafcoachs können helfen, ihre persönlichen Stressquellen zu entdecken und zu reduzieren. Die Schlafmedizin, Somnologie genannt, wird in der Schweiz vor allem in zertifizierten Zentren für Schlafmedizin betrieben. Betroffene können sich bei ihrer Krankenkasse oder im Internet nach entsprechenden Angeboten informieren. Besser früher als später. Denn: Erholsamer Schlaf ist eine der wichtigsten Säulen für ein gesundes und glückliches Leben.
Der richtige Speiseplan
Studien des Institute of Human Nutrion an der US-amerikanischen Columbia University zeigen, dass Menschen, die mehr Ballaststoffe, weniger Zucker und weniger gesättigte Fettsäuren essen, besser schlafen. Eine mediterrane Ernährungsweise aus viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukten und Olivenöl kann also eine erholsame Nachtruhe fördern. Nehmen Sie die letzte Mahlzeit etwa drei Stunden vor dem Schlafengehen ein. Alkohol, Zigaretten, Cola und Schokolade rauben Schlaf. Wer schlecht schläft sollte ab mittags auf koffeinhaltige Getränke verzichten.
Helfer aus dem Pflanzenreich
Lavendelblüten, Baldrianwurzel, Passionsblume, Hopfenzapfen und Melissenblätter können förderlich sein für das Einschlafen. Bei depressiven Verstimmungen oder Ängsten können Johanniskraut oder Lavendelblüten stimmungsaufhellend und angstlösend wirken. Einnahme (in Form von Tee oder Kapseln) eine halbe bis eine Stunde vor dem Zubettgehen, dann steigt der Schlafdruck. Pflanzliche Mittel können in ein abendliches Ritual integriert werden und so helfen, feste Schlafzeiten zu etablieren.
Schlafmittel sollten in Absprache mit Ihrem Arzt und nicht länger als drei Wochen eingenommen werden. Sonst besteht das Risiko einer Gewöhnung und von unerwünschten Nebenwirkungen. Vorsicht auch vor dem sogenannten «HangoverEffekt»: Manche Schlafmittel wirken länger als sieben Stunden, man kommt dann morgens kaum mehr aus dem Bett. Die bessere Wahl können kürzer wirkende Mittel sein, sogenannte Z-Substanzen.
Überhitzt? So kühlen Sie sich richtig ab Lauwarm Duschen. Danach nicht abtrocknen, sondern die Feuchtigkeit verdunsten lassen. Alternativ hilft ein Armguss mit kühlem Wasser: Er kühlt das in den Gliedmassen zirkulierende Blut und senkt die Temperatur im Körperinnern. Auch Kühlpads aus dem Kühlschrank, nicht tiefgefroren, können Erleichterung verschaffen. Die Pads auf den Nacken, die Waden oder in der Leistengegend auflegen. ➞
«
Der Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung!
Heinrich Heine (1797–1856), deutscher Dichter





Schlechter Schlaf – ein Warnsignal des Körpers?
Ständiges Aufwachen, wilde Bewegungen oder häufiger Harn drang können auf unterschiedliche Erkrankungen hindeuten. Die Zeichen sollte man ernst nehmen und, wenn sie länger anhalten, abklären lassen.
• Zuckende Beine

Wenn die Beine im Schlaf zucken, kann das ein Hinweis auf PLMS (Periodic Limb Movement in Sleep) sein, eine Vorstufe des Restless Legs-Syndroms. Bei PLMS zucken Betroffene alle 30 Sekunden mit dem Schienbeinmuskel. Sie selbst merken das oft gar nicht. Der Partner im selben Bett aber sehr wohl. In den meisten Fällen deutet PLMS auf einen zu behandelnden Eisenmangel hin.
• Nächtlicher Harndrang
Starker nächtlicher Harndrang kann auf eine Blasen- oder Prostataerkrankung sowie auf eine Herzinsuffizienz hindeuten. Letzteres äussert sich tagsüber durch Wassereinlagerungen in den Beinen.
• Starkes Schnarchen
Lautes Schnarchen gehört zu den normalen Alterserscheinungen. Wer aber von seinem Schnarchen selbst aus dem Schlaf gerissen wird oder unter 30 Jahre alt ist, sollte das Problem angehen und sich beraten lassen. Erste Anlaufstelle dafür ist der Hausarzt.
• Ständiges Aufwachen Häufiges Aufwachen ohne ersichtlichen Grund kann stressbedingt sein; oft hat es aber eine körperliche Ursache, z. B. eine obstruktive Schlafapnoe. Das sind nächtliche Atemaussetzer. Sie bringen den Herz-Lungen-Kreislauf durcheinander und sorgen in der Folge für hohen Blutdruck, was wiederum das Risiko eines Infarkts oder Schlaganfalls erhöht.
• Wilde Bewegungen
Wer in der zweiten Nachthälfte sehr unruhig schläft und um sich schlägt, leidet womöglich an einer REM-Schlafverhaltensstörung. Sie tritt i. d. R. bei älteren Menschen auf, entsteht, weil bestimmte Nervenzellen kaputtgehen und deutet auf eine sich anbahnende Alzheimer- oder Parkinsonerkrankung hin. Diese kann man um Jahre hinauszögern, wenn die Schlafstörung früh diagnostiziert wird.



Für die NERVEN und innere GELASSENHEIT.
Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zu einer normalen psychischen Funktion bei.
Tibetische Rezepturen. Hergestellt in der Schweiz.
Tipps für eine erholsame Nachtruhe
Die richtige Schlafhygiene
• Treiben Sie regelmässig Sport. Das Training sollten Sie etwa drei Stunden vor der geplanten Schlafzeit beenden. Bewegung tagsüber verstärkt den inneren 24-Stunden-Rhythmus von Ruhe und Aktivität und erleichtert das Einschlafen.

gefragt: Jens Acker

• Vermeiden Sie Konfliktgespräche vor dem Schlafengehen.
• Ein persönliches Abendritual kann helfen den Alltag hinter sich zu lassen. Anregungen: Abendlicher Spaziergang, Entspannungsübungen, warmes Bad mit Zusätzen wie Hopfen, Melisse, Baldrian oder Lavendel. Entspannungsmusik hören.
• Vor dem Zubettgehen ein Glas warme Kuh-, Haferoder Mandelmilch trinken. Sie enthalten die Aminosäure Tryptophan, eine Vorstufe des Schlafhormons Melatonin
• 85:15-Regel: Sie besagt, dass man zu 85 Prozent zur selben Zeit schlafen gehen sollte, auch an den Wochenenden und im Urlaub. Eine Abweichung von der Bettgehzeit-Routine bis zu 15 Prozent liegt im Toleranzbereich und stört den Schlaf-Rhythmus nicht.
• Führen Sie ein Schlaftagebuch: Was haben Sie vor dem Schlafengehen gemacht, was zu Abend gegessen, was hat sie tagsüber gestresst, wie haben Sie geschlafen, was geträumt? Das kann sehr aufschlussreich sein.
• Sorgen Sie für ausreichend Schlafhygiene: Schirmen Sie Licht- und Lärmquellen so gut wie möglich ab; mindestens eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen offline gehen und auch nicht mehr auf einen Bildschirm (Blaulicht) schauen. Fernsehgerät, Smartphone, Tablett & Co am besten aus dem Schlafzimmer verbannen. Besser noch ein Buch lesen. Oder meditieren. Legen Sie Uhr und Wecker aus dem Blickfeld, z. B. unter das Bett.
• Das Bett nur zum Schlafen benutzen. Okay, für den Sex natürlich auch.
• 16° bis 20° C im Schlafzimmer – je nach Bettdecke –sind eine optimale Schlaftemperatur.
• Wichtige Grundlage für eine erholsame Nacht ist auch die richtige Matratze.
• Blau- und Grüntöne im Schlafzimmer schaffen eine beruhigende Atmosphäre.

• Drehen sich Ihre Gedanken trotz allem im Kreis und können deshalb nicht einschlafen, sollten Sie das Bett verlassen und ihre Sorgen aufschreiben. Kehren Sie erst wieder ins Bett zurück, wenn Ihre Gedanken abschweifen und die Müdigkeit Sie überkommt.
«Männer grübeln weniger»
Herr Dr. Acker, viele Schweizer klagen über schlechten Schlaf. Auch ich konnte die letzten Nächte nicht durchschlafen. Muss ich mir Sorgen machen?
Es ist völlig normal, dass es Phasen gibt, in denen wir schlechter schlafen. Störungen in unserem Schlafrhythmus können durch Hyperarousal, das heisst einer erhöhten Alarmbereitschaft, ausgelöst werden. Etwa durch die COVID-19-Pandemie. Aber auch erfreuliche Ereignisse, wie eine turbulenten Hochzeitsvorbereitung, können uns den Schlaf rauben. Viele Betroffene fühlen sich trotz Schlafstörungen in ihrer Tagesfunktion und Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt.
Wann ist ein kritischer Punkt erreicht?
Kritisch wird es, wenn Schlafstörungen über einen längeren Zeitraum anhalten und sich chronifizieren. Wir Schlafmediziner sprechen in dem Fall von einer Schlaferkrankung, der Insomnie. Betroffene sollten ihren Hausarzt konsultieren, um abzuklären, ob organische Ursachen wie etwa Eisenmangel, Leber-, Nieren- oder -Schilddrüsenfunktionsstörungen der Grund für die nächtliche Unruhe sein könnten. Kann dies ausgeschlossen werden, ist es ratsam, sich an eine Klinik für Schlafmedizin zu wenden.
Stress spielt als Auslöser von Schlafstörungen eine zentrale Rolle. Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen Mann und Frau?
Ja, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Besonders gefährdet sind ledige Frauen mittleren Alters mit hoher Beanspruchung, also einer Verdichtung von beruflichen und privaten Anforderungen bei wenig sozialer Unterstützung. Frauen hinterfragen sich mehr, das könnte ein Grund sein. Bei Männern ist die Bereitschaft zum nächtlichen Grübeln geringer.
Ist Insomnie eine anerkannte Krankheit?
Bislang hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO Insomnie in ihrem ICD-10-Katalog, der Internationalen Klassifikation von Krankheiten, nicht gelistet. In der Revision, dem ICD-11-Katalog wird Insomnie nun als eigenständige Krankheit gelistet. Das ICD-11 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. •
Jens Acker, Facharzt für Neurologie, Psychatrie und Psychologie FMH, ist Chefarzt der Klinik für Schlafmedizin Bad Zurzach und Airport Zürich.
Lochmuster
Alice Hofer Alice Wunderland
Text: Alice Hofer
Schon bald ist er vorbei, der erste Monat des Jahres. Wissen Sie, was ich am Januar ganz besonders liebe? Das Loch. Haben Sie es auch zelebriert? Zwar weiss keiner genau, was es ist, doch alle scheinen es zu kennen. Niemand kann seine Dimensionen beschreiben oder benennen. Das finde ich so faszinierend daran. Manchen Leuten ist das Loch etwas unheimlich, denn seine Erscheinungsformen sind vielfältig und unberechenbar. Man weiss nie so recht, wann es sich plötzlich vor einem auftut und wie es sich präsentieren wird –manchen auch erst im Februar. Mal zeigt es sich als klaffende Lücke im Portemonnaie, dann wieder als gähnende Leere oder als leergefegte Strasse, wo lediglich ein paar gurrende Tauben sich lauthals über einen Krümel streiten.
Gelegentlich erfahren wir das Januarloch als Zeit der Rückblende; ja gar als Reue darüber, dass wir nicht reüssiert haben oder nicht das taten, was wir hätten tun wollen, oder etwas taten, was wir nicht hätten tun sollen, oder dass wir den breiten Bogen aus den Augen und uns selber in Details verloren haben. Wurden wir den Ansprüchen und Erwartungen gerecht? Den Ansprüchen an uns selbst oder jenen an andere, oder denen von anderen an uns? Vielleicht wurde unsere Leistung von andern als ungenügend benotet; oder wir selber waren damit unzufrieden. Möglicherweise klebt uns etwas Fett am Absatz, weil wir in ein Näpfchen getreten sind. Bestimmt haben wir jemanden gekränkt oder wurden selber enttäuscht. Sowas kommt vor. Deshalb habe ich mir angewöhnt, zuerst ausgiebig meine Wunden zu lecken, dann die Chose zu bereinigen und schliesslich zu verlochen. Auch das lässt sich bestens im Januarloch bewerkstelligen; es hat sich bewährt, und bald ist es verjährt. Ich nenne diese Methode «Ctrl-Alt-Del» oder auch: «Tabula Ragusa».
Jetzt ist die Gunst der Stunde, um die Leinwand des Lebens erneut zum schönsten Gemälde zu machen. Für mich liegt ein grosser Zauber in diesem neugeborenen Jahr, das wie ein schnuckeliges Bébé vor uns liegt, mit staunenden Augen, bereit, diese Welt zu entdecken. Oder wie ein weisses Papier, mit der wunderbaren Einladung, es zu bezeichnen, zu bemalen, zu zerknüllen
und nochmals von vorne zu beginnen. Kein anderer Monat birgt so viele leere Seiten und unbeschriebene Blätter, während Mutter Erde sich in Schweigen hüllt und geduldig darauf wartet, mit neuen Keimen und Trieben aufzutrumpfen. Die Natur irrt sich nicht, das wird vor allem in Brachzeiten sichtbar. Dieses Nichts, dieses Loch – einfach grossartig! Es macht mich jeweils empfänglich für neue Inspiration und Kreativität. Da werde ich ergriffen von der beglückenden, besonderen Chance, mein eigenes Neues Jahr zu erschaffen, zu gestalten, zu zelebrieren.
Als bekennende Hedonistin hebe ich heute das Glas, auf kalte Füsse und warme Herzen, auf das unerschöpfliche Potential des Neuen, auf die grossen und kleinen Momente, die salzigen Tränen, die süssen Lächeln; auf Gelassenheit, Heiterkeit und Klarheit. Auf die bitteren Pillen, die wir auch heuer wieder zu schlucken haben dürften, auf die Gewissheit, dass nichts so bleibt, wie es war, und dass wir niemals in den gleichen Fluss steigen werden wie gestern. Alles wandelt sich. Das Tröstliche an der Vergänglichkeit ist, dass sie alles betrifft: das Schwere, das Leichte, das Lustige, das Traurige … Deshalb: Ob wir das Leben als Tragödie oder als Komödie inszenieren, ist uns selbst überlassen – denn die Ereignisse sind ja stets dieselben und wiederholen sich seit Menschengedenken; sie reihen sich aneinander wie bunte Perlen und strahlen jede auf ihre Weise: Geburt, Liebe, Glück, Verrat, Schmerz, Freude, Schadenfreude, Hass, Freundschaft, Feindschaft, Rache, Schwäche, Stärke, Angst, Wut, Mut, Übermut, eroberte und gebrochene Herzen, Erfolg, Niederlagen, Versöhnung, Blamagen, Weinen, Wein, Weiber, Gesang, alte und neue Liebe, Lachen, Sterben, in Ewigkeit, Amen.
Ein Hoch also auf das Loch! Es darf und will gefühlt und gefüllt werden. Es ist unser ganz persönliches Tun, wie und womit wir es diesmal anreichern. Wir mögen daraus das Meisterwerk unseres Lebens machen oder das beste Januarloch aller Zeiten. Es könnte auch das kostbarste sein. Grosses Loch, ich lobe Dich. •

Alice Hofer, Inhaberin der «Praxis für angewandte Vergänglichkeit», sieht den Tod nicht als Ende, sondern als Vollendung des irdischen Lebens. Sie ermutigt Menschen zum ganzheitlichen, selbstbewussten Abschiednehmen. www.alicehofer.ch
Der Weltverbesser
Der Hasel besitzt die Fähigkeit, alles abzurunden. So steht der Strauch für Harmonie und Vollkommenheit – die ideale Pflanze, um nochmals in die Stille und Tiefe des Winters einzutauchen und ihn schon bald zu verabschieden.
Text: Steven Wolf
Ich wische mit einem Haselbesen mit kräftigem Schwung den Winter aus dem Haus und schaffe Platz für Neues. Genährt und gestärkt durch die winterliche Tiefe, beginne ich mich zu recken und zu strecken. Ich lasse die wärmende Lebendigkeit in all meine Glieder fliessen und schreite heraus aus der Zurückgezogenheit des Winters, hinein in die erwachende Natur. Diese Aufbruchsstimmung kommt bereits in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar zum Ausdruck, wenn wir im Jahreskreis das Fest des Imbolc feiern. Man nennt es auch Lichtmess oder das Fest der Brighid.
Imbolc bedeutet «im Bauch/im Schoss» und symbolisiert die schlafende Natur, die im Bauch der Mutter Erde zu neuem Leben erwacht. Die Kraft der Brighid entfacht das Lebensfeuer und schenkt uns Lebendigkeit und Mut. Sie löst mit ihrer lichtvollen Gestalt die dunkle, schwarze Göttin ab, die den Winter beherrscht. Imbolc oder eben Lichtmess wird auch heute noch mit Lichtprozessionen gefeiert. Mit dem Brauch werden die Felder auf die bevorstehende Pflanzzeit vorbereitet: Die Äcker werden mit dem Licht gereinigt und gedüngt; man dankt den Wesenheiten der Landschaft und küsst die Bäume wach, damit sie bald spriessen und weiterhin gut wachsen.
Fördert Intuition und Ausdruck
Neben der Birke («natürlich» 01-02-20) und dem Schneeglöckchen («natürlich» 01-02-21) ist auch der Hasel ein Wesen, das die winterliche Kältestarre durchbricht. Im Hasel (Corylus avellana) kommen die Elemente Luft und Wasser zum Tragen. Luft steht für den Kopf und das Geistige, Wasser für die Intuition und die Gefühlswelt. Daher nutzen wir den Hasel bei Themen des Wandels und der Heilung auf der Ebene der Emotionen. Er fördert das Wissen, das Erkennen und Verstehen. Er hilft uns, zu verzeihen, uns zu versöhnen und mit Hilfe unserer Intuition in Träumen, beim Orakeln und in der Meditation Dingen auf den Grund zu gehen. Hierfür verwende ich das Haselholz als Talisman. Blätter, Blüten und Rinde eigenen sich zum Räuchern oder zur Herstellung von Essenzen und Tinkturen. Und natürlich für Tees (siehe S. 49).
«
Imbolc, auch Lichtmess genannt, läutet das Erwachen der Natur im Bauch von Mutter Erde ein. »
Eine weitere Eigenschaft der «Frau Haselin» bezieht sich auf Ausdruck und Sprache. Sie hilft uns, klug zu handeln und bewusst zu reden. Sie stärkt den kreativsprachlichen Ausdruck und die Diplomatie. Zudem verhilft sie zu Scharfsinn und unterstützt die Entwicklung einer ungewöhnlichen Urteilskraft. Ihr geselliges und liebevolles Gemüt versprüht gute Laune und Hilfsbereitschaft. Der Haselstrauch steht zudem für Offenheit, Ehrlichkeit, eine ausgeprägte soziale Ader und Zivilcourage. So steckt in jeder Haselnuss auch etwas von einem Weltverbesserer mit einem sicheren Gespür für seine Mitmenschen. Es ist eine Energie, die sich für die Schwächeren einsetzt, weil sie nach Harmonie und Vollkommenheit strebt. Dadurch erweckt sie im Herzen der Menschen die weibliche Seite und ebnet so den Weg der Zärtlichkeit.
Im Dialog mit «Frau Haselin»
Wenn ich mir die Zeit nehme und mich bei einer Haselin niederlasse und mich öffne für den stillen Dialog, gibt sie mir folgende Informationen: «In mir verborgen, im Schosse meiner Wurzeln, ruht die Quelle der Weisheit. Setz dich nieder und lausche meiner tiefen sprudelnden Quelle, die

leiser klingt als deine Ohren zu hören vermögen. Aber keine Sorge: Durch ein ehrliches Herz und gute Absichten fördere ich deine Intuition, deine Urteilskraft und das Streben nach Weisheit. Ich bilde die Brücke in der Tiefe der Quelle zwischen dem Alten und dem Neuen. Aus meiner Tiefe kannst du Weisheit schöpfen und neue Einblicke gewinnen. Ich schütze dich vor den chaotischen Kräften und lasse alles symbiotisch ineinander wachsen. Meine Baummedizin lasse ich wohldosiert in dich einfliessen. So mache dich auf den Weg, das alte Wissen zu finden. Ich ermuntere dich, dein Bewusstsein mit wertvollen Erinnerungen und Erkenntnissen anzureichern. Empfange die Inspiration deiner Quelle, sie verleiht dir die Kraft des Ausdrucks und der Umsetzung deines alten Wissens. Ich lindere den Kontrollzwang und schenke dir stattdessen die Freiheit. Lass dich anregen und beleben. Lass es fliessen bis du staunend vor deinen neuen Einsichten stehst und spürst, wie schön das Leben ist! So findest zu zurück in Einklang mit deinem natürlichen inneren Lebensrhythmus.»
Der Hasel als Heilmittel
Ich verwende den Hasel im zeitigen Frühjahr, wenn ich mich müde und geschwächt fühle. Aufgrund seiner harn-, wasser-, und schweisstreibenden Wirkung hilft er, den Körper zu entschlacken und die Bildung sowie Reinigung des Blutes in den Nieren anzuregen. Hasel kann auch bei Ödemen helfen, bei Harnwegserkrankungen, Nierenschwäche, Gicht und Rheuma. Er stärkt den Kreislauf, lindert Frühjahrsschnupfen, wirkt aufgrund der enthaltenen Gerb-
stoffe wundheilend und entzündungshemmend bei Hämorrhoiden, Augenleiden und Durchfall.
Und wer Lust hat, kann mit einem Haselstab ein Heilund Schutzritual für seinen Garten vollziehen. Es soll, so steht es geschrieben, das Gemüse, die Samen und die Früchte vor Zaubervolk, allzu gefrässigen Vögeln und Insekten schützen. Gehe wie folgt vor, um den alten Brauch zu zelebrieren: Suche dir mit einer guten Gesinnung einen Haselstab aus und schneide oder säge ihn ab. Nun stellst du dich in deinen Garten, erhebst den Haselstab zum Himmel und zeichnest ein symmetrisches Kreuz mit gleich langen Armen in die Luft. Darauf folgen ein Herz und ein weiteres Kreuz. Dann senkst du den Stab zur Erde und zeichnest das gleichschenklige Kreuz, das Herz und ein weiteres Kreuz in die Erde vor deinen Füssen. Danke dem Hasel, den Elementen und Himmelsrichtungen, danke allen Wesen, die deinen Garten beleben. Dieses kleine Ritual kann man im Laufe des Jahres immer mal wieder wiederholen. Auf dass der Garten – und damit die Welt – ein besserer Ort wird.
« Danke dem Hasel, den Elementen und Himmelsrichtungen, danke allen Wesen, die deinen Garten beleben. »

Kraftpakete | Haselnüsse enthalten unter anderem Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen und Zink; der Anteil an Vitamin E ist im Vergleich mit anderen Nusssorten recht hoch. Durch ihren hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren können sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindern.
Anwendungsmöglichkeiten des Hasels
Tee aus den Blättern
Haselblätter werden in den Sommermonaten geerntet. Sie wirken blutreinigend und hel fen bei der Blutstillung. Mir hilft der Ha selblättertee auch bei Husten und Darmkatarrh. In Tee getränkte Kompressen zur äusserlichen Anwendung helfen bei schlecht heilenden Wunden und schmerzenden Venen. So geht’s: Ein bis zwei Teelöffel der Blätter mit 250 ml kochendem Wasser übergiessen und zehn Minuten ziehen lassen. Man sollte maximal drei Tassen pro Tag trinken, und zwar jeweils nach dem Essen.
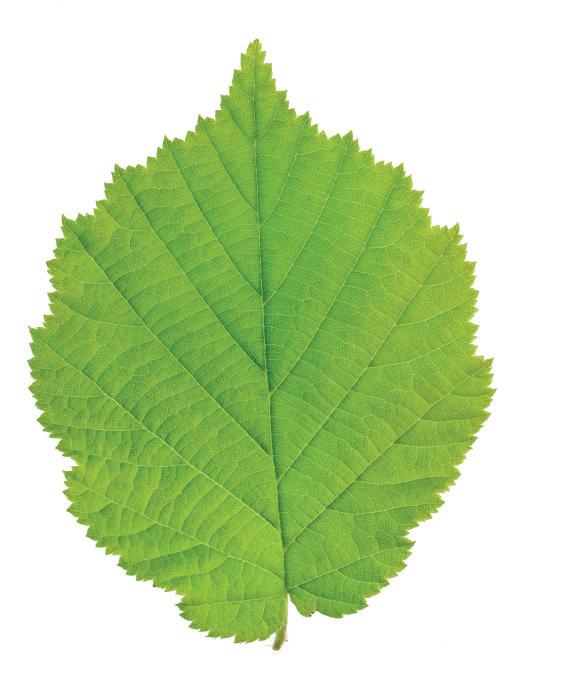

Tee aus den Blütenkätzchen
Um den Organismus bei einer Grippe oder Lungenentzündung zu unterstützen, trinke ich Tee aus den Haselkätzchen. Dieser wirkt schweisstreibend und stoffwechselanregend und ist auch für eine Frühjahrskur geeignet. Ein Esslöffel der Blüten mit 250 ml kochendem Wasser übergiessen und nach 10 Minuten abseihen. Übrigens: Während der Blüte sind die Haselkätzchen reich an Proteinen und man kann sie roh naschen.
Tee aus der Rinde
Ein Rindentee wirkt fiebersenkend und fördert die Blutgerinnung. Bei gereizter, unreiner Haut, Rötungen, Akne, Ekzemen, Wunden verschaffen im Tee getränkte Umschläge Linderung. Die Rinde wird im Frühjahr von einem Ast geschält, der ohnehin abgeschnitten wird. Anschliessend wird sie getrocknet und zerkleinert. So geht’s: Ein Esslöffel Rinde in 250 ml kaltem Wasser ansetzen und aufkochen lassen. Nach zehn Minuten abseihen. Man sollte maximal drei Tassen pro Tag trinken, jeweils nach dem Essen.
Rezept für Frühjahrspickels
Die proteinreichen, herb und bitter schmeckenden Haselkätzchen mache ich süss/sauer ein. So eignen sie sich als Beilage zu Käse, als Antipasti oder kombiniert mit Tofu.
Du brauchst: 200 g männliche Haselkätzchen, 300 ml Apfelsaft, 200 ml milder Apfelessig, 2 bis 3 TL Honig, 1 gestrichener TL Koriandersamen, 1/2 gestrichener TL Salz, 2 Lorbeerblätter, einige Pfefferkörner und Wacholderbeeren.
So geht’s: Gewürze in einem Mörser mischen und leicht anmörsern. Die Gewürzmischung mit Apfelsaft, Essig, Honig und Salz aufkochen. Die Haselkätzchen hinzufügen und zehn Minuten köcheln lassen. Danach heiss in sterile Gläser abfüllen und luftdicht verschliessen. Das Glas auf dem Kopf auskühlen lassen. Vier Wochen dunkel und kühl ziehen lassen.

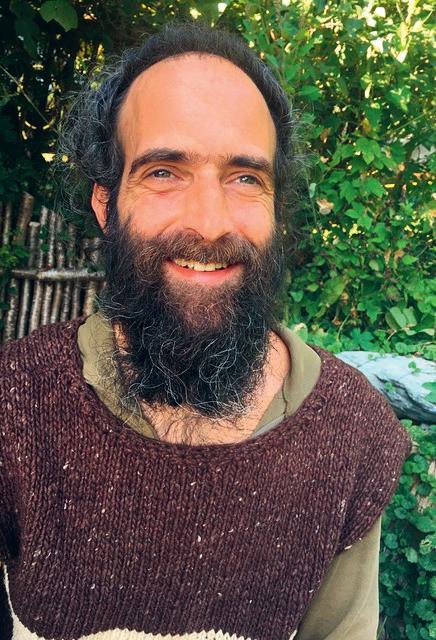
Steven Wolf hat schon als Kind von seiner Grossmutter altes Pflanzenwissen gelernt und weiss um die Kraft der Natur mit all ihren sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Er lebt in Escholzmatt, wo er zusammen mit seiner Partnerin ganzheitliche Pflanzenkurse für interessierte Menschen durchführt. Im Lochweidli steht dafür eine eigens gebaute Schuljurte. www.pflanzechreis.ch

& staunen wissen

Verpackung
Plastikfolie ist besser als ihr Ruf
Eine neue Studie der Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa zeigt: Eine dünne Folie aus Polyethylen ist bei korrekter Entsorgung umweltfreundlicher als andere Zeitschriftenhüllen. Die schlechteste Ökobilanz wies der vermeintlich umweltfreundliche Papierumschlag auf. k-tipp/krea

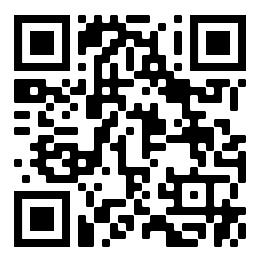
Materialkunde
Faltbares Holz
Zwar biegt man Holz schon seit Jahrhunderten. Nun aber haben Forschende unter der Leitung der US-Universität Maryland ein Holz geschaffen, das sich sogar falten lässt. Gleichzeitig weise das vielseitig formbare Holz eine Festigkeit wie Aluminium auf, berichten sie im Fachmagazin «Science». Das Verfahren eröffne neue Möglichkeiten für Holz als leichtes Strukturmaterial, das Gewichtseinsparungen und entsprechende Umweltvorteile für Fahrzeuge und Flugzeuge bieten könnte, schreiben die Autoren, zu denen auch Ingo Burgert von der ETH Zürich und der Empa gehört. krea



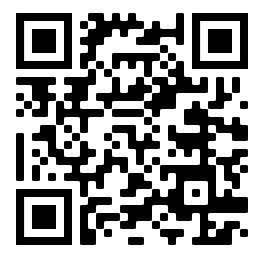
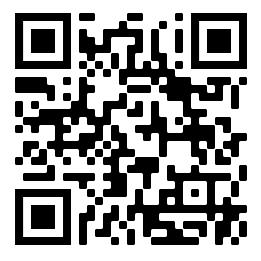

Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit, das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut. »
Thukydides (um 454 – 398 v. Chr.), griechischer Stratege und Historiker
30-60

Baumnüsse senken Cholesterin
Wer regelmässig eine Handvoll Baumnüsse isst, ca. 30 bis 60 Gramm, verbessert seine Cholesterinwerte. Das wiesen Forscher der American Heart Association nach. Der Grund: Baumnüsse sind gute Lieferanten von Omega-3-Fettsäuren. Zudem machen sie lange satt. krea «

Sauerstoff-Kollaps
Der Erde geht die Luft aus
Die Sonne wird heisser, folglich sinkt der Sauerstoffgehalt der Erdatmosphäre dramatisch ab: Experten der Nasa haben berechnet, wann der Erde endgültig die Luft ausgeht. Sie führen damit die CO2-Theorie ad absurdum. Gemäss den Forschern wird die Erdatmosphäre in einer Milliarde Jahren so wenig Sauerstoff enthalten (weniger als ein Prozent), dass unser Planet für komplexes aerobes Leben unbewohnbar wird. Der zentrale Grund für die dramatische Entwicklung: Die Sonne wird immer heisser – und setzt damit auch viel mehr Energie frei. Die Experten haben ermittelt, dass dies zu einem dramatischen Rückgang des Kohlendioxids in der Atmosphäre führen wird, da CO2 Wärme absorbiert und dann zerfällt. Die Forscher schätzen, dass der sinkende Kohlendioxidgehalt die Photosynthese verunmöglichen wird. Damit werde es zu einem Massenaussterben von Pflanzen und anderen photosynthetischen Organismen kommen. Dieses wird die Hauptursache für den enormen Rückgang des Sauerstoffs sein. fr.de/krea

Die Sonne steht uns im Winter am nächsten

«nur» noch 147,1 Millionen Kilometer vom Tagesgestirn entfernt. Diese Distanz wächst bis zum 4. Juli wieder auf 152,1 Millionen Kilometer an.
Obwohl uns die Sonne Anfang Januar am nächsten steht, herrscht zu dieser Zeit bei uns tiefster Winter. Die Schwankungen der Strahlung sind auf diese Distanzunterschiede so gering, dass sie nicht ins Gewicht fallen. Die unterschiedliche Entfernung zur Sonne bewirkt aber eine Veränderung der scheinbaren Grösse der Sonne. Deshalb ist der scheinbare Sonnendurchmesser bei uns Anfang Januar um 7 Prozent grösser als Anfang Juli und das Sonnenlicht braucht 17 Sekunden weniger lang, bis es unseren Planeten erreicht hat. Im Allgemeinen braucht das Sonnenlicht etwa 8 Minuten, bis es die Erde erreicht hat. Bei Beginn des Sonnenaufganges ist unser Mutterstern demnach schon vor 8 Minuten aufgegangen.
Der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne beträgt etwa 149,6 Millionen Kilometer. Die Erde umkreist die Sonne jedoch nicht auf einer kreisförmigen Bahn, sondern auf einer Ellipse. Deshalb variieren die Sonnenabstände über das Jahr hinweg: Am 4. Januar um 8 Uhr durchlief die Erde den sonnennächsten Punkt ihrer elliptischen Bahn; sie war dann
JETZT «NATÜRLICH» ABONNIEREN staunen und wissen
BEWUSST GESUND LEBEN
Das Magazin «natürlich» ist das Sprachrohr in der Schweiz für alle Belange der Naturheilkunde. Unabhängig und mit grossem Nutzwert für interessierte Leserinnen und Leser berichtet es über Therapien, Methoden, Anwendungen, Kräuter und Mixtu ren. Mit seinen ergänzenden Artikeln über gesunde Ernährung und die wohltuende Wirkung der Natur ist es eine Inspirationsquelle für alle, die bewusst und gesund leben wollen.
Beim Sonnenuntergang ist die Situation genau umgekehrt: Wenn die Sonne am Horizontrot rot erscheint, sind dies nur noch die «restlichen Strahlen» auf dem Weg zur Erde, die das Sonnenbild mit Verzögerung zeigen, während sich die wirkliche Sonne bereits seit 8 Minuten unter dem Horizont befindet.
Andreas Walker
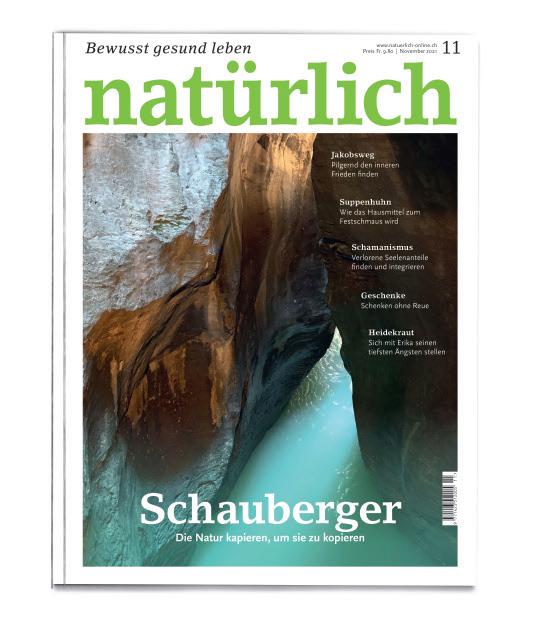

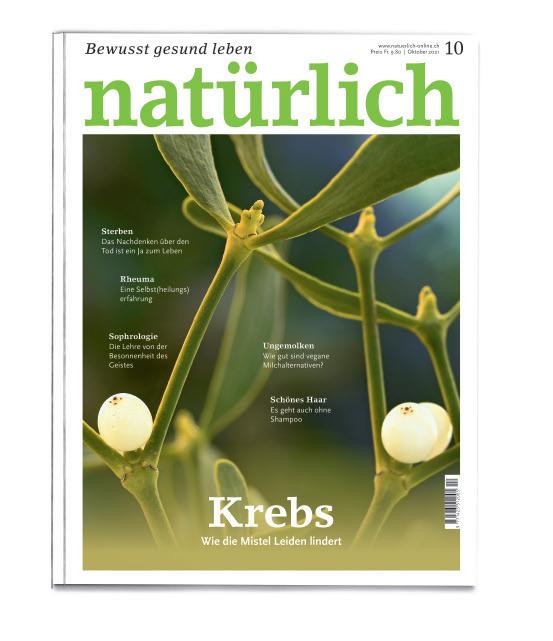
10x
JÄHRLICH
Abonnement 1 Jahr Fr. 89.–
2 Jahre Fr. 159.–
uerlich-online.ch/abo-service
Heft
Abo-Angebot natürlich 2022
Talon einsenden / faxen an: Weber Verlag AG, Gwattstrasse 144, 3645 Thun / Gwatt, Fax 033 336 55 56 oder bestellen Sie online oder per Mail: www.weberverlag.ch, mail@weberverlag.ch
Name/Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Datum
Unterschrift
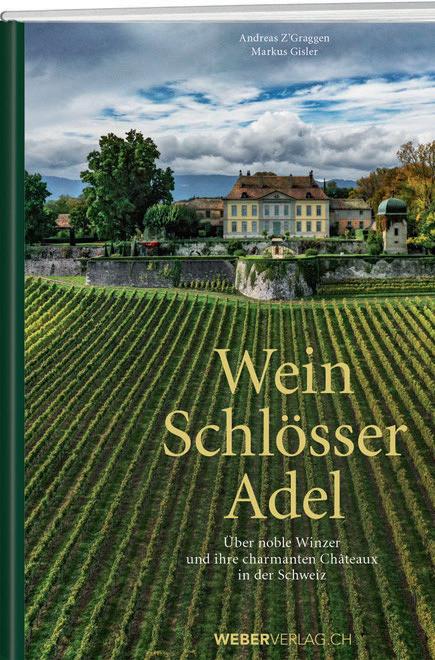
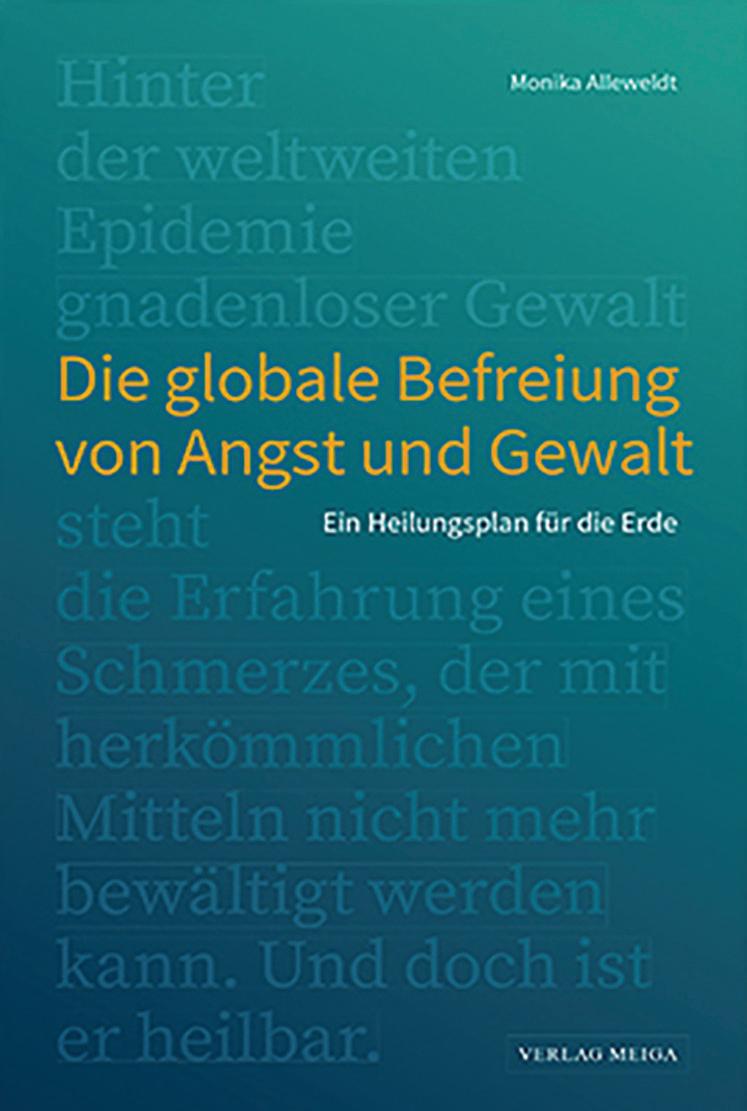
Für eine gewaltfreie Erde
K limawandel, Artensterben, Hunger, Krieg und Terror – können wir die Probleme unserer Zeit lösen, Angst und Gewalt überwinden? Ja, ist die Friedensaktivistin Monika Alleweldt überzeugt: «Es ist eine Frage unseres Willens und unserer Ausrichtung.» In ihrer Mut machenden Schrift zeigt sie eine positive Perspektive für die Zukunft der Erde auf. Sie basiert auf der politischen
Theorie des Psychoanalytikers und Soziologen Dieter Duhm, Initiator des Plans der Heilungsbiotope, und ihrer «revolutionären Botschaft» für eine gewaltfreie Erde. Ein wichtiges Buch dem eine grosse Leserschaft zu wünschen ist.
Monika Alleweldt
«Die globale Befreiung von Angst und Gewalt. Ein Heilungsplan für die Erde»
Verlag Meiga 2021, ca. Fr. 27.–
gewusst?

Mikromobilität
Leih-E-Trottis und -E-Bikes schaden eher
E-Trottis und E-Bikes, die im öffentlichen Raum für alle bereitstehen, gelten als umweltschonende Verkehrsmittel. Eine Studie der ETH Zürich zeigt nun aber, dass das gar nicht stimmt. Im Gegenteil: Gemäss den Forschern ersetzen Leih-E-Trottis und -EBikes hauptsächlich Verkehrsmittel, die schon nachhaltig sind, also etwa eine Tram- oder Velofahrt. Autofahrten werden seltener ersetzt. «Unter den aktuellen Nutzungsbedingungen schaden geteilte E-Trottis und E-Bikes dem Klima mehr, als sie nützen», kommen die Forscher deshalb zum Schluss. Trotzdem sehen sie Potenzial in Sharing-Diensten. Etwa dann, wenn geteilte E-Trottis oder E-Bikes das Einzugsgebiet des ÖV vergrössern würden. Auch als Entlastung in Stosszeiten seien diese sinnvoll. Besser abgeschnitten haben in der Studie übrigens private E-Scooter und E-Bikes: Diese ersetzen deutlich häufiger Fahrten mit dem Auto. eth zürich/krea
Bisensturm lässt Landschaft erstarren
Wenn sich unser Land auf der Vorderseite eines Hochdruckgebietes befindet, herrscht bei uns eine Bisenlage vor. Der Wind aus Nordosten führt im Winter oft zu Nebel in tieferen Lagen und kann unangenehm kalt auftreten. Besonders ausgeprägt ist die Bise in der Westschweiz: Da in Richtung Westschweiz die Alpen- und Jurakette zusammenlaufen, wird die Strömung der Nordostwinde durch diese Gebirgszüge verengt. Bei einer konstanten Windströmung hat dies zur Folge, dass bei einer Verengung die Windgeschwindigkeit höher werden muss, damit die gleiche Luftmenge durchfliessen kann. So können die Windgeschwindigkeiten bei einer ausgeprägten Bise je nach Gebiet stark variieren. Während die Bise z. B. in Zürich einer frischen Brise entspricht, kann sie im Extremfall zur gleichen Zeit in der Westschweiz Sturmstärken erreichen. Deshalb tritt die Bise am Neuenburger- und Genfersee manchmal äusserst stark auf. Herrschen während eines Bisensturmes noch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, führt diese Situation an den Seeufern der Westschweiz oft zu grössräumigen Vereisungen mit bizarren natürlichen Eisformationen, wie hier im Bild, im Februar 2012 in Versoix am Genfersee.
Andreas Walker



So können Sie bald in den eigenen Apfel beissen
In einen saftigen, roten Apfel aus dem eigenen Garten beissen – das ist ein Wunsch, der sich erfüllen lässt. Doch so einfach geht es dann doch nicht. Denn der Obstbaum braucht die richtige Pflege, damit er gedeiht. «natürlich» zeigt, wie es geht.
Text: Walter Bühler
Schon im Paradies verführte ein Apfel die Menschen (siehe «natürlich» 09/21). Heute ist es nicht viel anders: Äpfel sind des Schweizers liebstes Obst. Mit Abstand. Ein besonderer Genuss ist der Apfel frisch vom eigenen Baum gepflückt. Wer einen eigenen Garten oder ein Pachtgrundstück hat, kann sich diesen Wunsch erfüllen. Zumindest der Anfang ist ganz einfach: Obstsetzlinge werden überall angeboten. Also nichts wie los ins nächste Gartencenter, das Wunschobst kaufen und ab damit in den Boden!
Doch so einfach ist es dann leider doch nicht. Ohne etwas Fachwissen bleibt die Ernte auch nach fünf Jahren vermutlich mickrig, der Baum wuchert und der fachgerechte Schnitt wird zur Tortur. Damit die eigene kleine Obstplantage von Anfang an gelingt, gibt es einige Punkte, die unbedingt zu beachten sind.

Standort: Apfelbäume mögen einen sonnigen Standort. Der Wind darf gerne gut zirkulieren, so trocknen die Blätter schnell ab, das schützt ein wenig vor Pilzkrankheiten. Der Boden darf leicht feucht sein; der Wasserabzug sollte aber jederzeit gewährleistet sein. Lehmige oder gar verdichtete Böden sollten vor dem Pflanzen entsprechend verbessert oder leicht drainiert werden, z. B mit Splitt oder Betonkies. Ist der Boden in Ihrem Garten eher trocken und stark durchlässig, ist es empfehlenswert auf einen Birnenbaum auszuweichen.
Die Qual der Wahl: Wenn nun der richtige Platz im Garten gefunden ist, geht es weiter zum Einkaufen. Das schöne Bild des grossen und üppig blühenden Hoch- oder Halbstammapfelbaums, das wir aus malerischen Landschaften kennen, lässt sich nur in sehr grossen Gärten umsetzten. Darum seien hier zwei Baumformen vorgestellt, die sich für den Hausgarten eignen.
1. Der Spindelbusch: Bei der Spindel ist bereits nach fünf Jahren mit sehr guten Erträgen zu rechnen. Sie braucht wenig Platz und wird maximal drei Meter hoch. Pflege und Ernte sind vom Boden aus gut möglich. Die Schnittmassnahmen sind bescheiden. Diese Baumform ist auf einer schwachen Unterlage veredelt. Das heisst, dass sie ein Leben lang auf einen Pfahl als Stütze angewiesen ist. Ansonsten würde die Spindel kippen.
2. Das Säulenobst: Diese auch «Ballerina»-Apfelbäume genannte Form braucht ebenfalls sehr wenig Platz. Ihr schlanker bis zu vier Meter hohe Wuchs ist auch gut als Gestaltungselement im Garten einsetzbar. Zudem ist Säulenobst nach zwei bis drei Jahren ohne Pfahl standfest, da es über eine entsprechend starke Unterlage verfügt. Die Schnittarbeiten sind wie beim Spindelbusch minim. Durch ihre Grösse ist beim Pflegen und Ernten des Säulenobsts hingegen eine Leiter nötig.
Sorten: Bei den Spindelbüschen steht meist das volle Sortenpotential zur Verfügung. Für den Hausgarten eignen sich robuste Züchtungen wie Florina, Topaz, Opal, Rewena oder Boskoop. Diese sind wenig anfällig für Krankheiten und führen deshalb auch zu guten Erträgen. Und dies ohne oder mit nur geringem Pflanzenschutz.
Beim Säulenobst ist die Sortenwahl eingeschränkter. Da diese Baumform aus einer Spontanmutation hervorgegangen ist, konnte auch nur aus dieser weitergezüchtet werden. Die Sorten, die es hier im Handel gibt, sind zum Beispiel Rondo, Rumba oder Red Spring.
Unterlagen: Wichtig zu wissen ist, dass Obstbäume veredelt werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass die eigentlich gewünschte Apfelsorte auf eine andere Sorte aufgepfropft wird. Die Unterlage, und hier in erster Linie das Wurzelwerk, definiert die Wuchskraft des Baumes. Fragen Sie beim Kauf immer nach, ob es sich um eine schwache Unterlage (z. B. M9 oder M28) oder um eine starke (M25 oder Sämling) handelt. Die starke Unterlage ist wie gesagt für den Hausgarten suboptimal.
«
Für den Hausgarten eignen sich robuste Züchtungen wie Florina, Opal oder Boskoop.









Apfelbaum pflanzen: Gewappnet mit Obstbaum, Pfahl und Kokosstrick kann es Zuhause ans Einpflanzen gehen. Am besten pflanzt man Obst in der Zeit von November bis April mit nackten Wurzeln. Die Wurzeln unbedingt bis zur Pflanzung feucht halten! Bis zu einem Tag reicht das Einstellen in einem Kessel Wasser. Dauert es länger, bis der Baum gepflanzt wird, ist ein leeres Gemüsebeet geeignet, wo die Wurzeln des Jungbaums mit Erde zugedeckt und angefeuchtet werden.
Nun können Sie in Ruhe das Pflanzloch ausheben. Zur Verbesserung des Bodens kann nebst den oben genannten Materialien auch Kompost beigemischt werden. Nach dem Ausheben des ausreichend grossen Loches wird der Pfahl eingeschlagen, bis dieser fest im Boden sitzt. Nun kann auch der Apfelbaum in den Boden. Idealerweise wird der Stamm auf der Westseite des Pfahls positioniert. So bietet er einen minimalen Schutz gegen die Sonne im Winterhalbjahr; das beugt Rindenschäden etwas vor. Die oft vertrockneten Wurzelspitzen werden an den Enden um etwa einen Zentimeter angeschnitten. Das fördert die Bildung von feinen Saugwurzeln. Falls sie in Ihrem Garten Probleme mit Mäusen haben, empfiehlt es sich, ein verzinktes Maschengitter (10–13 mm) um den Wurzelballen herum einzubauen ins Pflanzloch.
Wie schon erwähnt sind Obstbäume veredelt und gerade die Veredelungsstelle (Bild 1) muss zwingend mindestens 15 Zentimeter über dem Boden sein. Ansonsten kann die Unterlage Ihren Zweck nicht erfüllen. Ist der Baum eingepflanzt und an drei Stellen mit den Fersen angedrückt, können Sie noch einen Giessrand erstellen (Bild 2). Nun kann der Baum zünftig eingeschwemmt werden. Giessen Sie dazu so lange Wasser in den Giessrand bis es nur noch langsam versickert. Den Giessrand kann man gut während eines Jahres belassen. Denn gerade in Trockenperioden ist der Apfelbaum noch auf Wassergaben angewiesen. Zum Schluss binden wir den Baum mit Kokosstrick am Pfahl fest. Achten Sie dabei auf ein gutes Polster und eine feste Bindestelle (Bild 3), damit der Baum genügend Abstand hat und sich nicht am Pfahl verletzen kann.
Der Schnitt: In Fachkreisen wird oft gesagt, dass es so viele Schnitttechniken gebe, wie es Menschen gibt, die Bäume schneiden. Diese Aussage hat einen grossen Wahrheitsgehalt, zumal sich fast jede Technik begründen lässt. Alle Techniken haben jedoch die gleichen Ziele: die Baumform erhalten, die Fruchtansätze verjüngen und so den Ertrag steuern. Wir unterscheiden bei den hier genannten Baumformen zwischen dem Erziehungsschnitt in den ersten zwei Jahren und dem Erhaltungsschnitt ab dem dritten Jahr. Beim Säulenobst erübrigt sich ein Erziehungsschnitt.
Wichtig: Um die Gefahr von Infektionen und Verschleppung von Krankheiten zu reduzieren, achte ich auf sauberes und scharfes Schneidewerkzeug. Zudem desinfiziere ich es vor und nach jedem Einsatz mit Brennsprit und flamme es mit dem Gasbrenner ab. Dies ist zwar keine hundertprozentige Garantie gegen eine Erkrankung, aber ein vernünftiges Minimum an Hygiene bei Schnittarbeiten. 1. Erziehungsschnitt: Damit der Spindelbusch auch schön aufrecht wächst, binde ich die Spitze (Bild 4) falls
nötig zusätzlich an den Pfahl. Konkurrenztriebe (Bild 5) werden entfernt. Ich binde steil stehende Triebe flach bis in die Waagrechte nach unten (Bild 6). Dabei achte ich schon jetzt darauf, dass mein Baum pyramidal ist, also oben schmaler als unten. Habe ich im oberen Bereich Äste, die bereits jetzt die unteren Äste in Länge und Grösse überragen, so entferne ich diese.
2. Erhaltungsschnitt: Beim Spindelbusch kann ich ab dem zweiten Jahr die Spitze weiterhin anbinden. Ist die Höhe von drei Metern erreicht wird die Spitze gekappt. Konkurrenztriebe werden auch abgeschnitten. Steile Triebe kann man flach binden. Die Triebe aus dem Vorjahr kann man jetzt unter die Waagrechte binden damit die Blütenbildung noch mehr angeregt wird (Bild 7). In den weiteren Jahren muss man vermehrt darauf achten, dass die schlanke Pyramidenform erhalten bleibt. Das erfordert es, nach innen und oben wachsende Triebe wegzuschneiden. Längere Fruchtäste, die älter als vierjährig sind, entferne ich. Dabei lasse ich einen kleinen Stummel stehen, um das Wachstum anzuregen. Stamm und Stockausschläge entferne ich ebenfalls, lasse dabei jedoch keine Stummel stehen (Bild 8).
Beim Säulenobst wende ich wie gesagt nur einen Erhaltungsschnitt an. Hierbei entferne ich Konkurrenztriebe zur Spitze hin und Seitentriebe, die aus der Säulenform ausbrechen (Bild 9). Lässt nach neun bis zehn Jahren der Ertrag stark nach, kann man den Säulenapfel verjüngen. Dazu kürzt man den Mitteltrieb bis zur Hälfte ein. Das Fruchtholz kürzt man auf jüngere Verzweigungen. Bilden sich mehrere Neuaustriebe wird nur der stärkste berücksichtigt und die übrigen entfernt.
So, und nun hoffe ich, dass ich Sie nicht abgeschreckt, sondern im Gegenteil ermutigt habe, einen Apfel- oder auch anderen Obstbaum für Ihren Garten zu wählen, pflanzen, hegen und pflegen. Schon allein das Einpflanzen eines Baumes ist eine der schönsten Tätigkeiten, die man sich vorstellen kann, gerade auch mit der Familie. Beim Schneiden sollen Sie keine Scheu haben. Denn auch wenn es nicht ganz so fachmännisch wie beschrieben geschieht: Die Triebe wachsen in fast allen Fällen wieder nach. Wer stark am Obstbau interessiert ist, für den bietet der Verband Jardin Suisse oder auch das Bildungszentrum Inforama an diversen Orten immer wieder Obst- und Schnittkurse für Quereinsteiger an. • Walter Bühler ist gelernter Landschaftsgärtner und Landwirt. Er arbeitet als Berufsbildner an der Gartenbauschule Oeschberg in Koppigen (BE). In seiner Freizeit interessiert er sich für Pflanzen, Permakultur und produziert unter dem Namen «Pommebastisch» leidenschaftlich Cidre aus dem eigenen Obstgarten.


Jetzt spriesst der Kalbfleischpilz
Im Winter essbare Pilze suchen? Aber natürlich! Auf Totholz findet man derzeit in unseren Wäldern eine Delikatesse: den Austernseitling. Er ist auch als «Kalbfleischpilz und Vitalpilz» bekannt.
Text: Werner Bangerter
Eine putzige Mäusefamilie, die sich an einen Baumstamm klammert. So wären die jungen Austernseitlinge ( Pleurotus ostreatus) recht treffend beschrieben, die an jener absterbenden Rotbuche dort wachsen, mitten im Winter. Dicht gedrängt ragen die jungen Fruchtkörper aus dem Stamm, gegen den Stiel hin sind sie leicht pelzig. Zehn bis zwanzig Zentimeter gross werden die maus- oder blaugrauen Hüte. An Nadelholz kommt der Austernseitling sehr selten vor, es lohnt sich nicht da nach ihm zu suchen. Auch an kraftstrotzenden Laubbäumen wird man nicht fündig. Der Austernseitling befällt nur absterbende Bäume und vor allem Totholz.
Viele Köchinnen und Köche kennen den Austernseitling, der Seite an Seite mit dem Champignon, dem Shiitake und dem Kräuterseitling im Angebot von Grossverteilern und Feinkostgeschäften feilgeboten wird. Das sind Pilze, die in riesigen Zuchtanlagen auf künstlichem Substrat
heranwachsen – und oft lange Transportwege hinter sich haben. Wie viel naturnaher ist da doch das Sammeln im nahen Wald. Es ist ein gefreutes und gesundes Erlebnis, den Austernseitling jetzt mitten im Winter in «freier Wildbahn» im nahen Wald aufzuspüren. Der «Kalbfleischpilz», wie er wegen seiner Konsistenz und dem Aroma auch genannt wird, scheut weder Schnee noch leichten Frost. Im Gegenteil: Er wächst erst bei Temperaturen unter acht Grad. Wer seine Gäste zwischen November und März mit einem fein abgeschmeckten Ragout aus frischem Austernpilz-Wildfang überrascht, wird mit Sicherheit Beifall ernten.
Weitere winterharte Pilze
Wenn im Herbst die letzten Blätter fallen, geht die Hauptpilzsaison zu Ende. Aber es gibt neben dem Austernseitling noch zahlreiche weitere Winterpilze, die Schnee und leichten Frost nicht scheuen. Darunter der honiggelbe Samtfussrü-
bling und das Judasohr, das bei uns auf Holunder fruchtet und in der chinesischen Medizin und der Mykotherapie als «Vital- oder Heilpilz» geschätzt wird. Auch Austernseitlinge haben heilsame Eigenschaften (siehe Kasten).
Um den Austernseitling zu finden, muss man einiges über den Pilz wissen. Im Tannenwald müssen wir nicht suchen, das ist schon mal klar. Und das mit dem Totholz: Der Austernseitling erzeugt sein Pilzgeflecht nicht wie die meisten anderen Pilze im Erdreich, sondern in absterbendem Holz. Damit fördert er auf natürliche Weise den Zersetzungsprozess und hilft, gemeinsam mit vielen Kleinlebewesen, den Wald nachhaltig «aufzuräumen».
Richard Christen, amtlicher Pilzkontrolleur in Lyss (BE), hat einen Tipp parat: «Der Seitling gedeiht vornehmlich auf stehendem oder liegendem Buchenholz. Er kommt aber auch auf Pappeln oder Weiden vor.» Noch Jahre nach dem Sturm Lothar habe er diese «Holz-Recycler» in grosser Anzahl vorfinden können. Die oft dicht gedrängten Hüte sind muschelförmig und dachziegelartig übereinander angeordnet. Die Farbe des Pilzhutes ist sehr variabel, von ockerfarben über meistens schiefergrau bis hin zu braun. Immerhin: «Der Austernseitling ist mit giftigen Pilzen kaum zu verwechseln», sagt Christen. Ob denn eine App zur Bestimmung von Pilzen generell hilfreich sei, wollen wir wissen. «Wir haben solche Hilfsmittel getestet. Meiner Meinung nach sind sie heute in vielen Fällen noch nicht zuverlässig, wenn es um die Lebensmittelkontrolle geht», meint der Pilzkontrolleur. Wer Pilze nicht eindeutig bestimmen kann, sollte also nicht einer App blind vertrauen. Vielmehr ist der Besuch bei einer amtlichen Pilzkontrollstelle angesagt. Zum Kennenlernen der verschiedenen Arten würden sich Apps aber durchaus eignen» meint Christen.
Der Austernseitling als Vitalpilz Austernpilze werden wegen ihrer Heilkraft in der Volksheilkunde vieler Länder hoch geschätzt, vor allem in Asien. In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) werden sie getrocknet zur Stärkung der Venen und Entspannung der Sehnen verschrieben. Zu den bedeutendsten bisher bekannten Wirkstoffen der Seitlinge zählt das Beta-1,3/1,6-D-Glucan Pleuran. Studien belegen, dass Beta-Glucane den Blutzucker regulieren bzw. normalisieren, das Sättigungsgefühl verbessern, die Darmgesundheit positiv beeinflussen, den Cholesterinspiegel im Blut senken und das Immunsystem stimulieren. Das Beta-Glucan des Austernseitlings ist zudem ein starker Radikalfänger, der in der Lage ist, Tumor- und Metastasenbildung zu hemmen. So wird der Austernseitling denn auch begleitend zu Tumorthera pien eingesetzt, längst nicht mehr nur in in China und Japan, sondern auch hierzulande. Mykothe rapeutinnen empfehlen ihn auch bei Allergien und Asthma, entzünd lichen Erkrankungen, zur Gewichtsregulation, bei se xuellen Störungen und prä ventiv gegen vorzeitiges
Altern. •
Schmackhaft und gesund
Der Austernseitling ist ein exzellenter Speisepilz mit einem sehr hohen Anteil an Eiweiss, inklusive allen essenziellen Aminosäuren. Auch Spurenelemente sowie die Vitamine C, D, B1, B2 und Folsäure sind enthalten. Der Pilz ist zudem kalorienarm und weist verdauungsfördernde Ballastund Mineralstoffe auf, darunter Kalium und Phosphor.
Der Austernseitling gehört zu den nahrhaften und würzigen Speisepilzen. Sein exzentrischer Hut ist vor allem bei jungen Exemplaren sehr saftig und besitzt ein zartes Fleisch. Austernseitlinge können blanchiert, gebraten, gedünstet, grilliert oder eingemacht werden. Man sollte sie trocken putzen, also nicht waschen, da sie sonst Feuchtigkeit aufnehmen und an Aroma verlieren. Zum Reinigen benötigt man ein Schneidbrett, ein spitzes Messer sowie nach Möglichkeit einen Rundpinsel.
Pilzrezept Austernseitling (für 2–3 Personen)
• 300 g Austernseitlinge
• 30 g Butter
• 50 g Schinken oder Räuchertofu, gewürfelt
• 1 kleine Zwiebel, gewürfelt
• etwas Pfeffer und Salz
• Petersilie
• 4 EL Sahne
1. Pilze selber (gesammelt oder gekauft) reinigen und zerkleinern.
2. Butter in einer grossen Pfanne auslassen, Speck und Zwiebeln glasig dünsten, dann die Pilze dazugeben und unter gelegentlichem Wenden braten, bis die Flüssigkeit fast verdampft ist.
3. Erst jetzt würzen. Wenn die Pilze eine goldbraune Farbe angenommen haben, die Sahne hineinrühren; noch einmal abschmecken, dann mit frischer Petersilie bestreut servieren.

Passt als Beilage zu Fleischgerichten ebenso wie zu einem Wintersalat oder frischem Brot.
Komplementär- und Alternativmedizin
Wie Herr und Frau Schweizer dazu stehen

Was bewegt Menschen dazu, komplementär- und alternativmedizinische Behandlungen in Betracht zu ziehen? Welche Art von Beschwerden sind die häufigsten Beweggründe?
Was trägt zur Wahl der Behandlungsmethode bei? Wie sucht man entsprechende Therapeut:innen? Und wie zufrieden ist man mit den Ergebnissen? – Das wollte das ErfahrungsMedizinische Register EMR aus erster Hand erfahren. Also überliess es der Schweizer Bevölkerung das Wort.
Text: Maurizio Schianchi
Das ErfahrungsMedizinische Register EMR (mehr zum EMR in der Spalte am rechten Seitenrand) gab vergangenes Jahr eine bevölkerungsrepräsentative Erhebung zu Verbreitung, Nutzung und Behandlungserfolg der Komplementär- und Alternativmedizin (auch: Erfahrungsmedizin) in der Schweiz in Auftrag.1) Es handelt sich um die bisher grösste hierzulande durchgeführte Umfrage dieser Art.
Wie ist es also um die Einstellung zur Komplementär- und Alternativmedizin (KAM) bestellt?
Laut Studie haben beinah zwei Drittel der Bevölkerung schon einmal Methoden der KAM genutzt. Und bei 47%2) der Befragten liegt das nicht mehr als drei Jahre zurück.
Ein Röstigraben liegt nicht vor: Der Anteil aktuell Nutzender ist in der französischsprachigen Schweiz nur geringfügig grösser als in der Deutschschweiz. Frauen nutzen KAM etwas häufiger (51%) als Männer (41%). Der Anteil aktuell Nutzender ist bei unter 55-Jährigen höher als bei älteren Personen, bei den 36- bis 45-Jährigen am höchsten (55%) und bei Rentner:innen nicht signifikant tiefer als im Jahrzehnt vor der Pensionierung (37%).
9 von 10 Befragten erachten KAM-Einsatz als sinnvoll 88% der Befragten sind der Ansicht, KAM könne entweder als Ergänzung (63%) oder, wenn angebracht, als Alternative zur
Schulmedizin (25%) sinnvoll eingesetzt werden. Lediglich 4% sehen keine sinnvollen Einsatzmöglichkeiten (und 8% wissen es nicht). 58% der Befragten haben eine Zusatzversicherung, die auch Kosten für KAM-Behandlungsmethoden rückvergütet.
Wahl von Behandlungsmethode und -fachkraft Das Spektrum der KAM-Behandlungsmethoden ist breit und vielfältig – allein schon zu den EMR-zertifizierten zählen rund 180 Methoden: von der gängigen Akupunktur bis hin zur Kunsttherapie. Die Wahl der Methode ist für die Schweizer Bevölkerung eindeutig Vertrauenssache: In jedem dritten Fall (36%) trifft man sie auf Empfehlung aus dem persönlichen Umfeld, ähnlich oft auf ärztliche Empfehlung oder anderer Gesundheits-Fachpersonen (29%) und in ebenso vielen Fällen (32%) aufgrund der Erfahrungen aus früheren Behandlungen.3) Für entsprechende Behandlungen werden mehrheitlich (63%) Therapeut:innen aufgesucht. Etwa jede fünfte Behandlung (21%) erfolgt bei Ärzt:innen, die auch KAM-Methoden anbieten. In 17% der Fälle haben die Befragten Medikamente ohne Verordnung eingenommen oder sich selbst behandelt – aber auch diese «Selbstbehandler» lassen sich mehrheitlich von Gesundheits-Fachpersonal (Apotheke/Drogerie, Arzt/Ärztin, Therapeut/Therapeutin) beraten. Bei knapp der Hälfte aller KAM-Behandlungen (48%) liessen sich die Befragten noch ergänzend behandeln: in 39% der Fälle schulmedizinisch, in nur 9% durch eine weitere KAM-Methode.
Doch wie wirksam sind nun KAM-Behandlungen?
Die Mehrheit der genutzten Behandlungen (84%) wurde von den Befragten als sehr erfolgreich bis genügend wirksam empfunden. Lediglich 3% stuften sie als gänzlich erfolglos ein. Fast 90% der Befragten würden bei gleicher Beschwerde die gleiche Methode sehr wahrscheinlich oder ganz sicher nochmals anwenden.
Eine grosse Mehrheit sieht eine KAM-Behandlung nicht als einmalige therapeutische Methode, sondern will sie als gesundheitsfördernde Massnahme weiter anwenden: regelmässig bei 34% der Behandlungsmethoden und sporadisch bei 48%. Nur eine kleine Minderheit von 2% verzichtete auf eine Weiterbehandlung, weil sie eine Methode als ungeeignet empfand.
Bei 87% der Behandlungen nannten die Befragten zudem weitere positive Wirkungen wie einen allgemein verbesserten Gesundheitszustand oder verändertes Alltagsverhalten – indem sie beispielsweise vermehrt auf Ausgleich und Entspannung achteten, bewusster mit sich selbst und ihrer Gesundheit umgingen, sich mehr bewegten, besser mit ihren Beschwerden umzugehen lernten oder sich gesünder ernährten.
Ganze 91 Beschwerden wurden genannt, die mit KAM behandelt wurden: am häufigsten Nacken- oder Rückenschmerzen, allgemeine Muskelschmerzen oder -krämpfe und Gelenkschmerzen. Ähnlich vielfältig verhält es sich, mit 74 verschiedenen Nennungen, auch bei den Methoden.
Bedeutende Ergebnisse für uns alle Von diesen Umfrageergebnissen können Patient:innen, die eine entsprechende Behandlung in Betracht ziehen, profitieren – aber auch Versicherer, Berufsverbände, Bildungsanbieter und die Therapeut:innen selbst. Die Tatsache, dass die Schweizer Bevölkerung die KAM rege nutzt und offensichtlich zufrieden ist mit den Behandlungsergebnissen, bestätigt nicht zuletzt auch die Arbeit des EMR, das seit jeher für Professionalität und Sicherheit in der Branche sorgt.
ErfahrungsMedizinisches Register EMR
Entstehung und gesellschaftliche Rolle 1999 entstand das EMR, weil der Bedarf nach einem Label zur Qualitätssicherung in der Komplementär- und Alternativmedizin (KAM) aufgekommen war. Auslöser war die 1994 erfolgte Revision des Krankenversicherungsgesetzes, die der Rückvergütung komplementär- und alternativmedizinischer Leistungen über die obligatorische Grundversicherung endgültig den Riegel vorschob. Fortan sollten sich diese Leistungen über die private Zusatzversicherung finanzieren. Für Versicherer wie auch Therapeut:innen stellte sich somit die Frage nach einem neuen Leistungsanerkennungs-Modell. Die Lösung fand man in der Entwicklung des EMR-Qualitätslabels.
Seither prüft das EMR Kompetenzen, Erfahrung, jährliche Fortbildungen und den Umgang mit Patient:innen von Therapeut:innen im KAM-Bereich und zeichnet sie mit dem EMRQualitätslabel aus, das für die meisten Versicherer die Grundvoraussetzung darstellt, um KAM-Leistungen über die privaten Zusatzversicherungen zu vergüten.
So wurde das EMR zum Brückenbauer zwischen Versicherern und KAM – und je länger je mehr auch zwischen KAM, Schulmedizin und Gesellschaft. Denn mit zunehmender Nachfrage nach KAM- Behandlungsmethoden wuchs zwangsläufig auch der Angebots-Dschungel an. Und damit das Bedürfnis nach Orientierungs- und Entscheidungshilfen bei der Bevölkerung. Das EMR ist insofern eine «richtungsweisende» und sichere Instanz, als es Standards für die Qualität von therapeutischen Dienstleistungen setzt und regelmässig überprüft. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zum Patientenschutz und bietet Sicherheit und Orientierung im KAM-Bereich.
Qualifizierte Therapeut:innen einfach online finden
Wie finde ich qualifizierte komplementär- und alternativmedizinische Therapeut:innen? Und werden ihre Leistungen von meiner Versicherung rückerstattet? Das sind Fragen, die sich die meisten von Ihnen wohl immer wieder stellen.
Qualifizierte Therapeut:innen erkennen Sie am EMR-Qualitätslabel: Aktuell sind rund 24‘000 Therapeut:innen für rund 180 Behandlungsmethoden EMR-zertifiziert und von den meisten Versicherern anerkannt. Und Sie finden sie am einfachsten und schnellsten auf www.emr.ch
1) Die Umfrage führte das auf dem Gebiet spezialisierte Institut Polyquest AG mit methodischer Unterstützung der Büro Vatter AG durch. Die nachfolgenden Zusammenfassungen von Ergebnissen und Erkenntnissen wurden weitgehend im Wortlaut übernommen. Quelle: Christian Bolliger, Markus Simon (2021). KAMBarometer – Studie zu den Erfahrungen der Schweizer Bevölkerung mit der Komplementär- und Alternativmedizin. Initiiert und herausgegeben vom ErfahrungsMedizinischen Register EMR. Basel
2) Bei den nachfolgend wiedergegebenen Prozentwerten ist zu beachten, dass sie nur eine Schätzung des «wahren Werts» in der Bevölkerung darstellen und dieser um einige Prozentpunkte um den Schätzwert streuen kann.
3) Es konnten mehrere Nennungen gemacht werden.
&neu gut
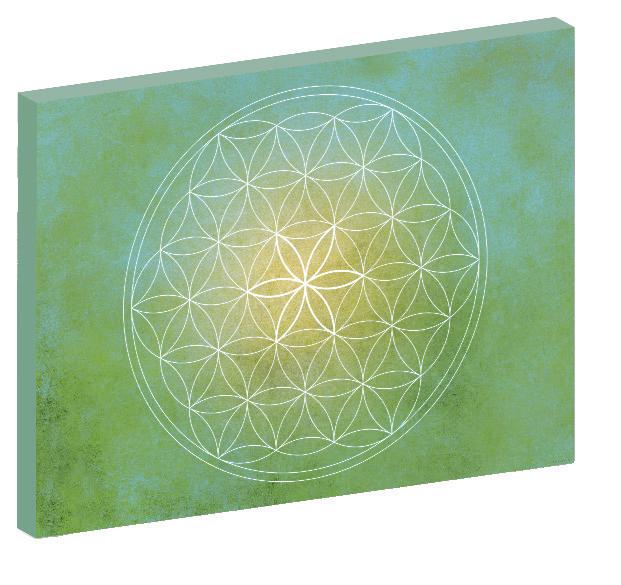
Heilige Geometrie Wandbild
«Blume des Lebens»
Die Wandbild-Gestaltungen von Anima Pura entspringen der heiligen Geometrie und dem Feng Shui. Sie verhelfen Wohnräumen zu einer positiven Energie und damit Menschen zu Wohlbefinden. Sämtliche Wandbilder sind auf Fotopapier und Textilleinwänden erhältlich. Laden Sie unseren Gesamtkatalog herunter oder lassen Sie sich auf unserer Webseite inspirieren: www.anima-pura.ch

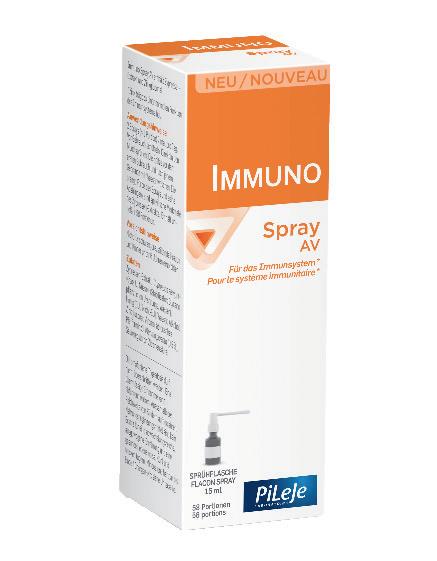
Immunsystem
Für das Immunsystem
Mit dem langen Sprüharm des Immuno Spray AV verteilen Sie einen feinen Sprühnebel tief im Rachen. Zusammengesetzt aus Zypressen- Extrakt, Honig und Zinkgluconat trägt der Immunospray AV zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. In Frankreich wird der Zypressen-Extrakt seit Jahren wissenschaftlich erforscht. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.Phytolis.ch
& hin weg

Feng Shui
Mit Feng Shui Räume beleben, 27. März
Schenken Sie Ihren Wohn- und Arbeitsräumen neue Energie, Ordnung und ein «Update». Veränderung und Wachstum gehören ganz natürlich zum Leben dazu und dürfen auch im Aussen ersichtlich sein! Wenn Sie unzufrieden mit Ihren Lebensräumen sind oder das Gefühl haben, dass man sie schöner oder praktischer einrichten könnte, dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig. LIKA GmbH in Stilli b. Brugg, Tel. 056 441 87 38, lika.ch

Yoga- & Wanderferien
Vorfrühling im Tessin
Wandern, Yoga, Massagen, Sonne und grüne Natur. Gönnen Sie sich Entspannung und Genuss!
06.3. – 12.3. Yoga & Detoxwoche
12.3.– 18.3. Yoga & Wanderferien
20.3.– 26.3. Yoga & Intervallfasten
26.3.– 31.3. Yoga & Wanderferien
31.3.– 03.4. Thai Yoga Massage
03.4.– 09.4. Yoga-Intensivretreat
24.4.– 29.4. Yoga & Wanderferien
Casa Santo Stefano – Miglieglia | 091 609 19 35 | casa-santo-stefano.ch

Weiterbildung
Atem und Psyche
Studien belegen, dass psychosomatische Störungen mit Atemtherapie positiv beeinflusst werden. Das IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie bietet seit über 30 Jahren die 3-jährige, berufsbegleitende und von der OdA KT akkreditierte Ausbildung in Ganzheitlich-Integrativer Atemtherapie IKP an. Lernen Sie, mit der Atmung Körper und Psyche zu beeinflussen. Nächster Info-Abend: 28.2.2022.
Weiterführende Infos: www.ikp-therapien.com

Fasten
Individuelle Fastenwoche
7 Tage Fasten, u.a. mit täglichem Leberwickel, 2 Schröpfbehandlungen und mehr. Spezifische naturheilkundliche Behandlungen, sowie eine Ernährungsberatung nach der Säftelehre können dazu gebucht werden. Krankenkassenanerkannt mit entsprechender Zusatzversicherung.
Alle Infos unter 041 260 09 02 (J. Söchtig) Airbnb/Menznau/Fastenwochen Facebook/ Sophias Unterkunft
Wir machen Klimaschutz
Seit 30 Jahren setzen sich Solarspar-Mitglieder für die Zukunft ein:
100 Solar-Anlagen sparen in der Schweiz jährlich über 2000 Tonnen CO2 ein. Mit Ihrer Unterstützung bauen wir weiter. www.solarspar.ch/mitmachen

Solarspar T +41 61 205 19 19 www.solarspar.ch
Solarspar, Natürlich Magazin , 90 × 132 mm

jalMQ�j'l
Schule für Sterbe- und Trauerbegleitung
Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:
Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Antoinette Bärtsch, Pete Kaupp, Renate von Ballmoos, Marcel Briand, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Kokopelli Guadarrama, u.a.
Nächster Ausbildungsbeginn: Mittwoch 27. April 2022
(die Ausbildung vom 26. März 2022 ist ausgebucht)
«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»
Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil, 9552 Bronschhofen Tel. 071 – 911 03 67 info@jemanja.ch | www.jemanja.ch


LSolarspar_Inserat_2021_Vorlagen_DE.indd
«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt.»
Neu: Finanzierung Ihrer Ausbildung durch Bundesbeiträge

Info-Abend: 13. Jan.
3 Jahre, ASCA
u. SGfB-anerk

Info-Abend 12. Jan.
3 Jahre, ASCA
u. SGfB-anerk
Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung.
Ernährungs-Psychologische/r Berater/in IKP Angewandte Psychologie: Fundierte, praxisnahe Kompetenzen in Ernährung und Psychologie, mit welchen Sie Menschen mit Ernährungsproblemen ganzheitlich und lebensnah beraten.
Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden.
IKP Institut, Zürich und Bern




Fasten. Gesundheit. Auszeit.
Anzeigen & Beilagen
Seit 30 Jahren anerkannt


Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.
Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit
St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch
Aqua Dynamic Schweizer Qualitäts-Wasserbetten, die Nummer 1 seit 1982, zeichnen sich aus durch ideales Bettklima sowie unübertroffene Körperanpassung ohne Druckstellen. Ideal für die perfekte Abstützung der Wirbelsäule und damit weniger Rückenschmerzen. Neu auch mit RoyalStabilsierung. Wasserbetten sind gewärmt und ungewärmt erhältlich. Es handelt sich um ein freistehendes Wasserbett (Einerbett) inkl.Lieferung und Montage. www.wasserbett.ch

Lösung des Rätsels aus dem Heft 12/2021
Gesucht war: Rosskastanie
Wettbewerbstalon
Vorname Name
Strasse PLZ / Ort
Lösung
Gewinnen Sie!
Gewinne ein Wasserbett von Aqua Dynamic im Wert von CHF 2030.00

Und so spielen Sie mit: Senden Sie den Talon mit der Lösung und Ihrer Adresse an: Weber Verlag, «natürlich», Gwattstrasse 144, 3645 Gwatt Schneller gehts via Internet: www.natuerlich-online.ch/raetsel
Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 18. Februar 2022. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

41. Jahrgang 2022, ISSN 2234-9103
Erscheint 10-mal jährlich
Druckauflage: 22 000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 14 820 Exemplare (WEMF/KS beglaubigt 2020)
Kontakt
mail@natuerlich-online.ch www.natuerlich-online.ch
Herausgeber und Verlag
Weber Verlag AG
Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun/Gwatt Tel. +41 33 336 55 55 leserbrief@natuerlich-online.ch
Verlegerin
Annette Weber-Hadorn a.weber@weberverlag.ch
Verlagsleiter Zeitschriften
Dyami Häfliger d.haefliger@weberverlag.ch
Redaktionsadresse «natürlich»
Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun/Gwatt
Chefredaktor
Samuel Krähenbühl s.kraehenbuehl@weberverlag.ch
Redaktionsteam
Andreas Krebs a.krebs@weberverlag.ch
Sabine Hurni (Leserberatung) s.hurni@weberverlag.ch
Autor:innen
Samuel Krähenbühl, Andrea Hitz, Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz, Erna Jonsdottir, Sabine Hurni, Chantal Agthe, Leila Dregger, Blanca Bürgisser, Eva Rosenfelder, Gundula Madeleine Tegtmeyer, Alice Hofer, Steven Wolf, Andreas Walker, Walter Bühler, Andreas Krebs, Werner Bangerter, Maurizio Schianchi
Grafik/Layout
Shana Hirschi
Copyright Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung durch den Verlag. Für unverlangte Einsendungen wird jegliche Haftung abgelehnt.
Anzeigenleitung
Dino Coluccia, Tel. +41 76 324 64 45 d.coluccia@weberverlag.ch
Anzeigenadministration/Marketing
Blanca Bürgisser
Tel. +41 33 334 50 14 b.buergisser@weberverlag.ch
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Aboverwaltung abo@weberverlag.ch Tel. 033 334 50 44
Druck
Vogt-Schild Druck AG, CH-4552 Derendingen
Weber Verlag AG www.weberverlag.ch
Bildnachweise
Adobe Stock
Seiten: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10,12, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 65
Unsplash
Seiten: 18, 20, 41
Andrea Abegglen
Seiten: 3, 30
Samuel Krähenbühl
Seiten: 12, 13
Walker
Seiten: 52, 53
Bühler
Seiten: 56,57
Vor schau März

Gebeine. Dank unseren Knochen können wir sitzen, stehen und gehen, sie schützen unsere inneren Organe und spielen eine wichtige Rolle für Stoffwechsel und Blutbildung. Osteoporose. So können Sie Ihre Knochendichte verbessern und damit Brüchen vorbeugen. Chiropraktik. Wie Chiropraktiktoren durch Druck und Zug Muskelverspannungen beseitigen und Blockaden lösen. Stille Entzündungen. Falsche Ernährung, Bewegungsmangel, Umweltgifte und chronischer Stress können Entzündungsprozesse befeuern – mit verheerenden Folgen für die Gesundheit. «natürlich» zeigt, was dagegen hilft. Kräutergarten für Anfänger. Die besten Tipps von «Lazy Gardener» Remo Vetter.
«natürlich» 3/22 erscheint am 24. Februar 2022
Kontakt /Aboservice: Telefon 033 334 50 44 oder abo@weberverlag.ch, www.natuerlich-online.ch

« Eva unterwegs Rosenfelder

Im Urmeer
(aka Keller)
Der Apfelkeller verströmt einen lieblichen Duft. Hier inmitten der Harassen voller rotbackiger Äpfel einen Moment zu verweilen, Kälte und Pflichten draussen zu lassen, entführt er mich in eine andere Welt. Ich fülle genüsslich meinen Korb mit der kostbaren Ernte und spüre Dankbarkeit: Der Sommer war verregnet und hart für alle Obstbäume – nichtsdestotrotz ist eine solche Pracht gediehen.
Ich trödle herum, lange unter das Gestell, um zwei faule Äpfel hervorzuklauben, die sich verselbständigt haben, als unverhofft eine Gruppe Kellerasseln hervorkrabbelt. Eilig ergreifen die Tierchen die Flucht vor den im Halbdunkeln grappschenden Fingern. Diese «blutten», schiefergrauen Gesellen gruseln mich ein wenig, während ich mich frage, was sie hier unten eigentlich zu tun haben. Ich erinnere mich an frühere Begegnungen, etwa im Kartoffelkeller meines Grossvaters, verbunden mit dem modrigen Geruch seines Naturkellers. Oft finde ich Asseln auch unter meinen Blumentellern, zwischen Steinen, in feuchte Ritzen und Spalten.
Feucht – ja, das scheint ihr Ding zu sein. Die Kellerasseln gehören nämlich zu den Krebstieren und ihre Atmung erfolgt teilweise über Kiemen. Ich fühle mich zurückversetzt ins Urmeer – welche Zeitspanne an Entwicklung in diesen Winzlingen doch steckt, denke ich ehrfürchtig. Kellerasseln können den Sauerstoff aber nicht nur über Kiemen aus dem Wasser, sondern auch aus der Luft gewinnen; ihre lungenartigen Organe befinden sich auf der Körperunterseite bei den Hinterleibsfüssen. Doch ich hüte mich, dies zu überprüfen. Schliesslich will ich keines dieser Viechlein zerdrücken (gute Ausrede, nicht?). Lieber lese ich über sie. Dabei erfahre ich allerlei Interessantes. Etwa, dass sich unter jedem der sieben Brustsegmente – die an ein kleines Gürteltier erinnern – ein Beinpaar befindet. Neben diesen sieben Paar Schreitbeinen haben sie auch noch fünf Paar Blattbeine, wie sie für Blattfuss- und Kiemenfusskrebse typisch sind. Diese Blattbeine dienen gleichzeitig dem Nahrungsfang, der Atmung und oft auch der Fortbewegung. Verrückt, oder?
Wie so manches andere Kriechtier sind Asseln sehr nützlich. So tragen sie unter anderem zur Bildung von Humus bei, verdauen sie doch vermoderte Pflanzenteile, morsches Holz und Pilze – oder ebenauch mal faule Äpfel. Die Kellerassel-Bande in meinem Keller war also im Teamwork daran, das vergessene «Fallobst» zu entsorgen. Asseln leben in Gemeinschaft und scheinen äusserst familiär zu sein. Die geschlechtsreifen Weibchen tragen dreissig bis achtzig befruchtete Eier in ihrem Brutbeutel an der Körperunterseite. Nach rund einem Monat schlüpfen die Larven und verweilen dann noch zwei Wochen in der schützenden Bauchtasche, bevor sie sich vom Muttertier lösen. Neben den ausgewachsenen schiefergrauen Tieren finden sich oft weissliche Jungtiere: die verkleinerten Ausgaben des erwachsenen Tieres. Über ein Dutzend Mal müssen diese Jungspunde sich häuten, bis sie die Grösse der Erwachsenen erreicht haben. Dann können sie sich mehrmals fortpflanzen in ihrem bis zu zwei Jahre währenden Leben.
Ich halte Ausschau nach meinen sozialen Urtierchen Stattdessen entdecke ich eine Wasserpfütze an der Türschwelle, die sie vermutlich zum Bleiben eingeladen hat. Ob sie wohl mit dem letzten Regen hier Einzug gehalten haben? Oder sind sie schon immer hier? Schon lange vor mir? So wie sie lange vor dem Menschen die Erde besiedelt haben? So sinniere ich vor mich hin. Dann schalte ich das Licht aus und verlasse den Keller in aller Stille mit meinem Korb voller leckerer, rotbackiger Äpfel. •
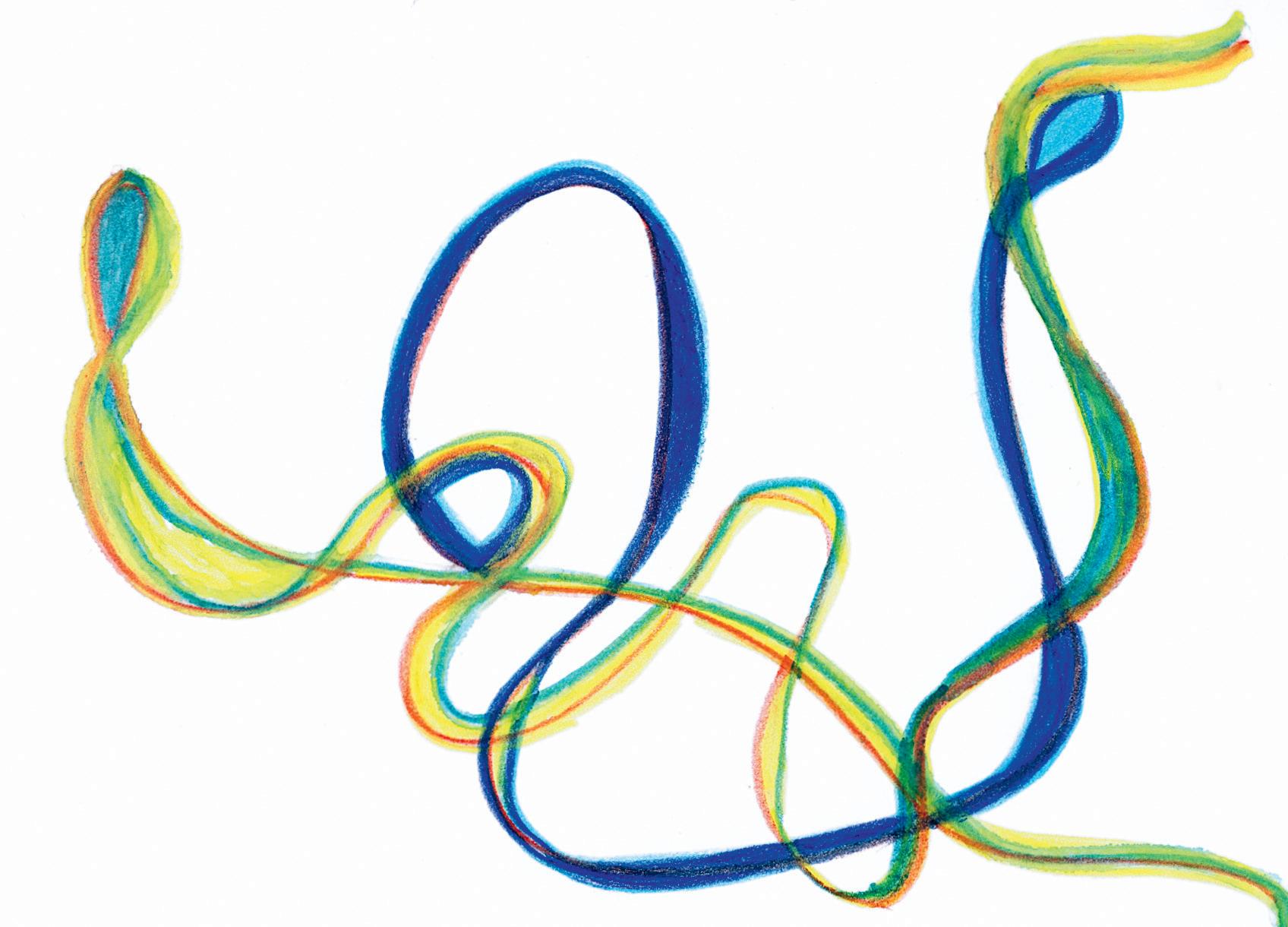
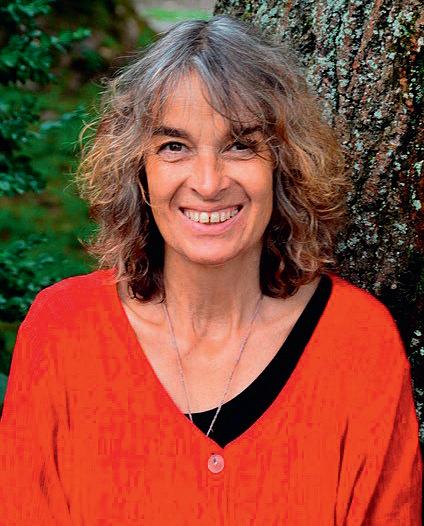
Eva Rosenfelder ist Autorin/Journalistin BR. In ihrer Serie schreibt sie für «natürlich» über kleine und grosse Glücksmomente des Alltags. Mehr über die Autorin und ihre Angebote wie Naturspaziergänge und Naturorakel erfahren Sie unter www.natur-und-geist.ch
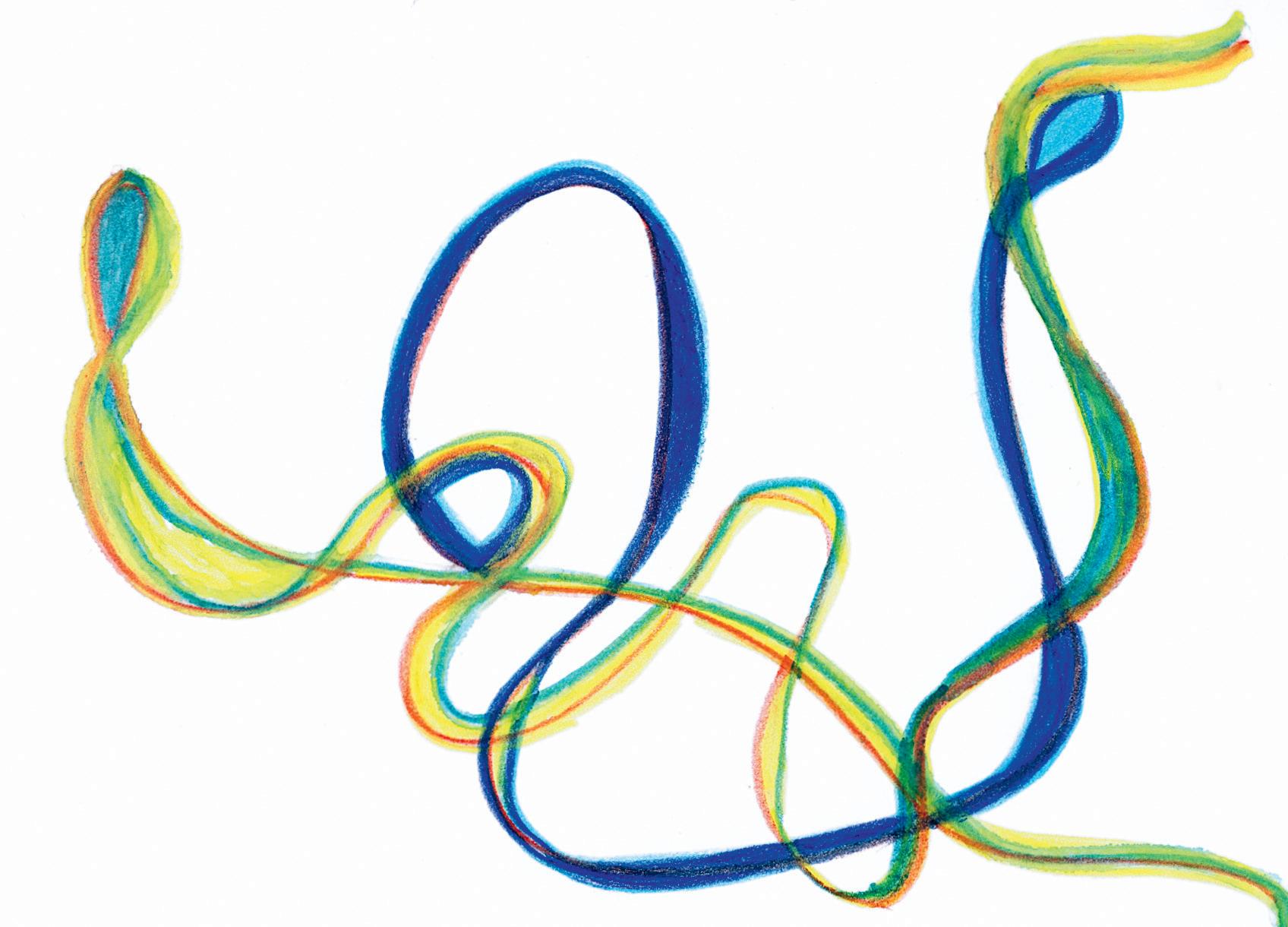

AUS DEM HERZEN GESPROCHEN
Nahtoderfahrung und Zusammenarbeit mit Elementarwesen, «Es musiziert durch mich hindurch» und Bilder im Koma: Das Gemeinsame dieser Erfahrungen ist eine Wirklichkeit, welche die Vernunft und die Wahrnehmung mit den fünf Sinnen übersteigt. Barbara Zanetti hat in Gesprächen hingehört auf Erfahrungen von Menschen, welche deren Leben prägten und ihm eine neue Ausrichtung gaben. Vorangestellte Reflexionen über grundlegende Themen eröffnen auch theoretisch ein Verständnis für solche Vorgänge. Intuitiv gemalte Bilder von Eva Jakob vertiefen in symbolischer Weise das Geschriebene.
Autorin: Barbara Zanetti
104 Seiten, 13,5 × 20,5 cm, broschiert, Softcover
ISBN 978-3-03818-367-9
CHF 29.–
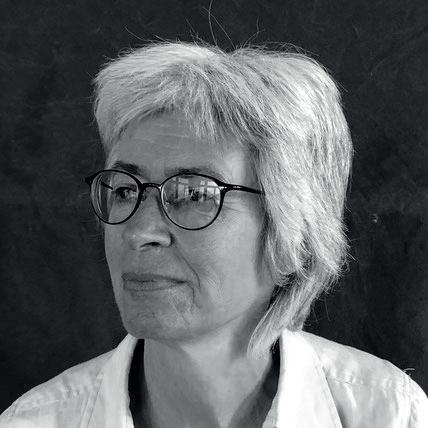

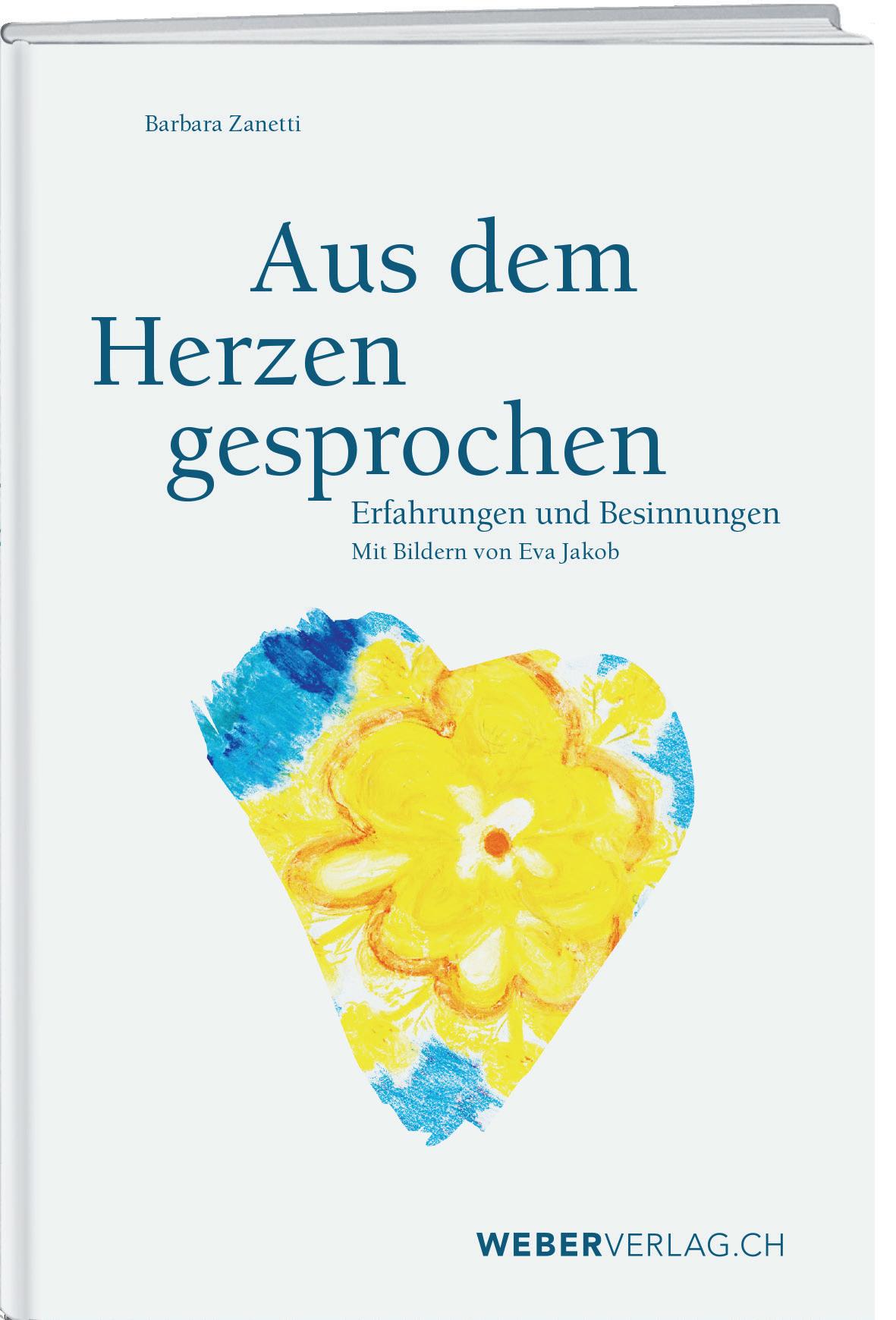
AUCH IM BUCHHANDEL ERHÄLTLICH
Barbara Zanetti, *1962, Studium der evangelischen Theologie in Bern und Aix-en-Provence, seit 27 Jahren tätig als Pfarrerin im Berner Oberland. Psychotherapiestudium am C. G. Jung-Institut, Aus- und Weiterbildungen in Integraler Spiritualität, Kontemplation, Wahrnehmungs- und Intuitionsschulungen und langjähriger Kursbesuch von Yoga, Tai Ji/Qigong. Freischaffend tätig in Praxis für spirituelle Begleitung.
Bestellung
Bitte senden Sie mir ___ Ex. « AUS DEM HERZEN GESPROCHEN » zum Preis von je CHF 29.– (inkl. Versandkosten).
ISBN 978-3-03818-367-9
Talon einsenden / faxen an: Weber Verlag AG, Gwattstrasse 144, 3645 Thun / Gwatt, Fax 033 336 55 56 oder bestellen Sie online oder per Mail: www.weberverlag.ch, mail@weberag.ch
Name/Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Datum
Unterschrift

Natur-Flussreisen
Der feine Unterschied

’22: Oasen für Pflanzen und Tiere
An Bord der kleinen Schweizer Grandhotels Flora & Fauna entdecken

Passau > Dürnstein > Wien > Budapest > Bratislava > Weissenkirchen > Passau Reisedaten 2022 29.03.–04.04. / 04.04.–10.04.
& Buchung mittelthurgau.ch/eepas4

Amsterdam > Alkmaar > Insel Texel > Lemmer > (Friesland) > Groningen > Emden > Leer > Bremerhaven > Bremen > Minden > Hannover
Reisedaten 2022 Amsterdam – Hannover 05.06.–13.06. / 07.07.–15.07. / 23.07.–31.07. Hannover – Amsterdam 13.06.–21.06. / 15.07.–23.07.

Weissenkirchen > Wien > Budapest > Mohacs > (Pecs) > Belgrad > Eisernes Tor > Vidin > Giurgiu > (Bukarest) > Oltenita > Tulcea > Donaudelta >Tulcea Reisedaten 2022 Wien – Tulcea 18.04.–27.04. / 18.06.–27.06. / 09.08.–18.08. Tulcea – Wien 05.05.–14.05. / 27.06.–06.07. / 18.08.–27.08.

Jena > Stralsund > Barth > Rügen > Peenemünde > Stettin > Eberswalde > Berlin Reisedatum 2022 05.08.–13.08.
Behaglicher Luxus an Bord, vielfältige Erlebnisse an Land. Massgeschneiderte Themenreisen in Excellence-Qualität –jetzt zum Bestpreis!
Das Excellence-Paket
Excellence Natur-Flussreise
Genuss-Vollpension an Bord –ganz nach Ihren Wünschen
An-/Rückreise, Transfers
Pure-Air-Ionisierung gegen Viren-/ Aerosolverbreitung
Gepäckservice, Bord-WiFi
Weitere Leistungen gemäss Ausschreibung
Paket-Spezialpreise pro Person mit beschränkter Verfügbarkeit.
Buchen Sie online ohne Buchungsgebühr.

Paris > Rouen > Caudebec-en-Caux > (Honfleur) > Vernon > Paris Reisedaten 2022 28.03.–02.04. / 02.04.–07.04. / 07.04.–12.04. / 12.04.–17.04. / 16.10.–21.10. / 21.10.–26.10. / 26.10.–31.10.
