
Wechsel und Mur
Hrsg. Bettina Habsburg-Lothringen und Leopold Toifl


Hrsg. Bettina Habsburg-Lothringen und Leopold Toifl
Hrsg. Bettina Habsburg-Lothringen und Leopold Toifl
Landeszeughaus
Universalmuseum Joanneum
Vorwort
Bettina Habsburg-Lothringen
Eine Konfliktgeschichte recherchieren, eine Wehrlandschaft lesen
Spuren der Geschichte im Archiv und im Raum
Bettina Habsburg-Lothringen
Fehden, Aufstände, kriegerische Auseinandersetzungen
Die Ost- und Südoststeiermark zwischen 1407 und 1709
Leopold Toifl
Orte und Wehrlandschaften
Register
Impressum
Infoboxen
Osmanen oder Türken? (S. 23)
Burgen bauen (2)
Wehrkirchen bauen (6)
Die Topografie nutzen (15)
Tschardaken errichten (20)
Städte befestigen (22)
Tabore errichten (25)
Zeughäuser einrichten (34)
Blick in die Ferne: Eine Militärgrenze anlegen (34)
Orte und Wehrlandschaften
1 Bärnegg in der Ebenau
2 Friedberg
3 Dechantskirchen
4 Thalberg
5 Burg Festenburg
6 Vorau
7 Aichberg
8 Schloss Raitenau
9 Grafendorf
10 Bildstock in Seibersdorf
11 Schloss Klaffenau
12 Hartberg
13 Burg Neuberg
14 Pöllau
15 Schloss Herberstein
16 Blaindorf
17 Obermayerhofen und Untermayerhofen
18 Die Schlösser Feistritz und Kalsdorf bei Ilz
19 Ilz
20 Burgau und Neudau
21 Die Lafnitz
22 Fürstenfeld
23 Riegersburg
24 Schloss Kornberg
25 Feldbach
26 Kirchberg an der Raab
27 Fehring
28 Kapfenstein
29 St. Anna am Aigen und der Kuruzzenwall
30 Straden
31 Klöch
32 Zelting
33 Dedenitz
34 Radkersburg
Sehr geehrte Leser*innen!
Die Zeit vom 15. bis in das frühe 18. Jahrhundert ist in der Ost- und Südoststeiermark durch anhaltende bewaffnete Überfälle und Auseinandersetzungen geprägt: Im 15. Jahrhundert gibt es in der Region Fehden und Aufstandsbewegungen, die zu Angriffen auf Burgen und Orte im Grenzraum führen. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts erstreckt sich das Osmanische Reich über große Teile Ungarns und Kroatiens. Das habsburgische „Innerösterreich“ ist davon lediglich durch einen Grenzstreifen im heutigen Kroatien getrennt. Streif- und Plünderungszüge aus den osmanisch besetzten Gebieten in die Steiermark sind die Folge. Bis in das frühe 18. Jahrhundert fallen zudem „Haiduken“ und „Kuruzzen“ in die Grenzregion ein: ungarische Aufständische, die sich gegen die habsburgische Herrschaft wehren und die Bevölkerung der Grenzdörfer in Angst und Schrecken versetzen.
Vor diesem Hintergrund machen sich Generationen von Menschen daran, ihren Lebensraum in eine Wehrlandschaft umzugestalten. Sie errichten Wälle und Schanzen, befestigen die Städte, bauen Wehrkirchen und Tabore, Festungen und Zeughäuser. Über das Werden dieser Wehrlandschaft sind zahlreiche Dokumente in Archiven und Museen erhalten. Die Reste der Wehrarchitekturen prägen heute den Raum.
Das vorliegende Buch möchte beides zusammenzubringen. Es ist aus dem Wunsch entstanden, die Geschichte hinter den räumlichen Spuren bekannt zu machen, die Reste im Raum in ihrer Bedeutung zu erschließen. Basis dafür bildet die jahrzehntelange Arbeit von Leopold Toifl, Militärhistoriker und pensionierter Wissenschaftler des Grazer Landeszeughauses, der sich nicht nur mit den Beständen des Landesarchivs intensiv befasst hat, sondern sich auch in einer Vielzahl von Exkursionen mit der Region zwischen Hartberg und Bad Radkersburg beschäftigt hat.
Viel Freude beim Entdecken!
Bettina Habsburg-Lothringen Leiterin Abteilung Kulturgeschichte Universalmuseum Joanneum
Bettina Habsburg-Lothringen
Wie entsteht eigentlich Wissen um die Vergangenheit? Wie gelangen Historiker*innen zu ihren Erkenntnissen? Darauf gibt es mehrere mögliche und richtige Antworten: Sie gehen ins Archiv und studieren die schriftlichen und bildlichen Quellen. Sie besuchen die Depots einschlägiger Museen und untersuchen die dort erhaltenen Objekte. Sie sprechen mit Zeitzeug*innen. Sie nehmen die räumliche Seite der geschichtlichen Welt in den Blick und gehen dorthin, wo sich die Geschichte zugetragen hat.
Das Archiv war über Jahrzehnte der Arbeitsort des Militärhistorikers Leopold Toifl. Allen voran hat er im Steiermärkischen Landesarchiv geforscht, das mit rund 60.000 Regalmetern Archivgut das größte seiner Art in Österreich ist. Seine Bestände, schriftliche und bildliche Quellen, reichen bis ins 9. Jahrhundert zurück. Sie entstammen der Steiermark sowie dem ehemaligen Innerösterreich und werden im Archiv nicht nur bewahrt, sondern auch erschlossen und zugänglich gemacht. Leopold Toifl hat dort im Laufe seines Berufslebens sämtliche für das Zeughaus relevante Aktenbestände durchforstet: Zeughausakten und Hofkammerakten, Ausgaben-, Registratur- und Expeditbücher etc., um dessen Geschichte zu rekonstruieren. So lassen sich sämtliche Lieferungen in das und aus dem Zeughaus in den periodischen Zeugwartsabrechnungen nachvollziehen. In den Ausgabenbüchern der Kanzleischreiber finden sich penibel jene Summen notiert, die vom 16. bis ins 18. Jahrhundert für die Finanzierung des Kriegswesens aufgewendet werden. Selbst jene Briefe an die Monarchin Maria Theresia sind im Landesarchiv erhalten geblieben, die von den Verordneten und der „steirischen Landschaft“ geschrieben wurden, um die drohende Schließung des landschaftlichen Zeughauses im 18. Jahrhundert abzuwenden.
Die Ergebnisse seiner Recherchen hat Leopold Toifl in sogenannten Regesten zusammengefasst und in Aktenordner gepackt. 67 dieser Ordner mit etwa 21.000 Einträgen stehen heute in unseren Büroräumlichkeiten. Erst seine jahrelange Forschungsarbeit hat es ermöglicht, die Sammlung des Landeszeughauses vielfach einwandfrei zuzuordnen. Sie war Basis für Dutzende Vorträge und Publikationen. Sie war schließlich auch eine wichtige Voraussetzung dafür, in die Region zu gehen und in Zusammenarbeit mit lokalen Museen, Initiativen und Vereinen Exkursionen in die Steiermark, nach Slowenien, Kroatien und Bosnien durchzuführen, um Geschichtsinteressierten anschaulich zu machen, wo überall die Geschichte des Zeughauses spielt.
Wie der deutsche Historiker Karl Schlögel in seinem 2003 publizierten Buch Im Raume lesen wir die Zeit ausführt, spielt Geschichte eben nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raum. Sie hat Zentren und Peripherien, Schauplätze und Tatorte, Schnittstellen und Zwischenräume. Forscher*innen, die sich diesen annähern, nehmen Landkarten und Stadtpläne in die Hand. Sie studieren historische Ansichten und Baupläne oder den Verlauf von Straßen und Eisenbahnlinien. Sie gehen ins Land hinein und lesen es mit all den Ablagerungen des Zeitlichen: Sie sehen Berge und Täler, ausgedehnte Ebenen, Flüsse und Seen, die seit Jahrtausenden das menschliche Handeln mitbestimmen. Sie vollziehen nach, wie Menschen je nach technischer Möglichkeit und Zielsetzung die Natur zu ihrem Vorteil verändert und sich so in sie hineingeschrieben haben: durch das großflächige Roden von Wäldern und das Abtragen ganzer Berge im Tagebau, durch das Regulieren von Flüssen oder das Trockenlegen ganzer Landstriche. Über Generationen haben Menschen Verkehrswege wie Nervenbahnen durchs Land gezogen. Sie haben Siedlungen und Städte an sicheren und klimatisch begünstigten Orten angelegt oder mit Burgen und Schlössern ihre Macht demonstriert.
Dort, wo sich Menschen über einen langen Zeitraum aufgehalten haben, trifft sich heute möglicherweise vieles gleichzeitig, ist die Geschichte Gegenwart, wenn das Alte neben dem weniger Alten und Neuen steht. Oder aber die Schichten überlagern sich, wenn sich das neu Geschaffene wie eine Decke über das Historische legt. Teilweise präsentieren sich die Zeitschichten bis zur Untrennbarkeit miteinander verwoben: Das Zeughaus ist heute Museum und Teile einer Befestigung sind in die moderne Freizeitarena integriert. Dort, wo einmal um Einflussbereiche und Grenzen gekämpft wurde, nutzt heute der Tourismus die Ruinen als Bühnen. Andere Orte sind indes verbrannt und verschwunden, durch Krieg oder Katastrophen zu
Wüstung und Erinnerung geworden. Geschichte im Raum bedeutet Überschreiben, Neubeschriftung, Recycling, Ausradieren.
Will man dies alles im Raum lesen, braucht es eine bestimmte Arbeitsweise. Wer nichts weiß, kann nichts sehen. Die Kenntnis der Quellen und Literatur schärft das Auge, ermöglicht es oft erst, eine Suchbewegung aufzunehmen, in einem Haufen von Fragmenten einen Zusammenhang zu sehen. Wer als „Feldforscher*in“ unterwegs ist, wird stöbern, graben, nachfragen, vermessen, identifizieren und eine Erzählung aus der Summe aller Elemente formulieren.
Auch die Steiermark und ihre Geschichte lassen sich in dieser Art lesen: Archäologische Spuren verweisen auf Menschen, die sich vor Zehntausenden Jahren im klimatisch begünstigten Süden des Landes niederlassen, sesshaft werden und schließlich als Teil des römischen Weltreichs erstmals in kontinuierlichen Austausch mit einem größeren Teil der Welt treten. Am Verfall der Orte und Infrastrukturen wird ersichtlich, dass mit dem Niedergang des römischen Imperiums territoriale Ordnungen obsolet werden. Und man erkennt, wie nach einer Phase der Abkühlung und Leere im frühen Mittelalter neue Strukturen entstehen und Macht erneut durch Architekturen und Wehranlagen gesichert wird. Man entdeckt mittelalterliche Dörfer, planmäßig von den Grundherren zur bestmöglichen Kontrolle ihrer Untertanen angelegt. Man sieht, wie an den mittelalterlichen Handelsrouten Märkte und in kurzer Zeit die zentralen Städte entstehen. Man begegnet den Mönchsorden, die durch ihre landwirtschaftliche Tätigkeit sowie ihre mächtigen Klosteranlagen die Landschaft prägen. Man lernt Graz als neuzeitliches Zentrum von Innerösterreich und Knotenpunkt lokaler und überregionaler Vernetzung kennen. Man nimmt die Macht der Aristokratie in der räumlichen Ausdehnung ihrer Grundherrschaften und der repräsentativen Ausgestaltung ihrer Schlösser wahr. Man blickt auf neuzeitliche Krisengebiete. Man erkennt den Aufstieg und die Blüte neuer Zentren, die im 19. Jahrhundert den Hunger Europas nach Stahl stillen. Man sieht die ausgedehnten Eisenbahnnetze, die diesen Kontinent in neuer Weise durchdringen. Man blickt auf die kleineren und größeren Städte, die um 1900 einen tiefgreifenden Wandel erfahren, bevor es im 20. Jahrhundert zu einer radikalen Neubeschriftung der Oberfläche kommt. Man kann das Aufschließen und Stilllegen von ganzen Regionen, das Verschieben von Grenzen, das Aufblühen und Verschwinden von Orten, das Beschreiben und Überschreiben der Oberflächen nachvollziehen.
Was uns im vorliegenden Band besonders interessiert, ist die Ostund Südoststeiermark, das Gebiet zwischen Hartberg und Bad
Radkersburg, das vom 15. Jahrhundert an als Krisengebiet schrittweise zur Wehrlandschaft wird. Die Zeit bis in das frühe 18. Jahrhundert ist vor allem dort durch anhaltende bewaffnete Überfälle und Auseinandersetzungen geprägt: Das Osmanische Reich erstreckt sich seit Beginn des 16. Jahrhunderts über große Teile Ungarns und Kroatiens. Lediglich ein Grenzstreifen im heutigen Kroatien trennt das habsburgische „Innerösterreich“ davon. Schon seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts nehmen Streif- und Plünderungszüge aus den osmanisch besetzten Gebieten in die Steiermark zu. In der Frühen Neuzeit häufen sich zudem die Einfälle durch „Haiduken“ und „Kuruzzen“ – ungarische Aufständische, die sich gegen die habsburgische Herrschaft wehren und bis ins frühe 18. Jahrhundert die Bevölkerung der Grenzgebiete in Angst und Schrecken versetzen. Ihr Vordringen ist im Raabtal leicht möglich, weil es dort kaum natürliche Hindernisse im Gelände gibt.
So machen sich Generationen von Menschen daran, ihren Lebensraum in eine Wehrlandschaft umzubauen: Um sich zu schützen, setzen sie bei dem an, was die Natur bereithält, oder beziehen diese in eigene wehrtechnische Projekte ein: Gräben und Erdwälle werden genutzt, um Eindringlinge „im Vorfeld“ zu stoppen. Schanzen werden aus Erde aufgeschüttet und in die Erdwälle integriert. Hölzerne Befestigungstürme entlang dieser Wälle verbessern den Überblick. Verhacke oder Verhaue aus Bäumen und Ästen, Hecken und Dornengebüsch erhöhen die Wirkkraft der Anlagen. Hügel werden zur Errichtung sogenannte Kreidfeuer-Stationen genutzt, um die Bevölkerung bei Gefahr durch das gezielte Entzünden von Feuern zu warnen.
Um sich zu schützen, werden die Städte bereits im Mittelalter mit Mauern umfasst. Die Verbreitung von Feuerwaffen erfordert neue Verteidigungskonzepte. So werden ab dem 16. Jahrhundert die mittelalterlichen Stadtmauern kostspielig adaptiert und erweitert: Nach italienischem Vorbild werden Gräben um die Städte gezogen, Bastionen aufgebaut und durch Kurtinen verbunden. Tore steuern den Zutritt der Menschen. Wo möglich, werden Flüsse, Erhöhungen oder Felsen in die Befestigung einbezogen. In etlichen kleineren steirischen Orten werden indes „Tabore“ errichtet. Dazu werden Mauern, Wohnräume, Speicher und Ställe meist um die Kirchen oder an den Ortsrändern angelegt.
Zum Bestandteil der Wehrarchitektur werden auch die Kirchen: Im Spätmittelalter und der Neuzeit werden in der Grenzregion bestehende Gotteshäuser umgebaut und ergänzt. Mauern um Friedhöfe werden befestigt und mit Schießscharten versehen.
An den Ecken werden Wehrtürme hochgezogen, fallweise ein Wassergraben angelegt. Der Eingang erfolgt von nun an über robuste Tore und Portale, um im Bedarfsfall Schutzsuchende ein- und Angreifer auszuschließen.
Ebenfalls Teil der Wehrarchitektur sind die mittelalterlichen Burgen, die fallweise an die neuzeitliche Kriegsführung angepasst werden: Burgen sichern Siedlungen und Verkehrswege. Sie sind Orte der Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Mit dem ausgehenden Mittelalter endet ihre Zeit, sie halten den neuen Feuerwaffen nicht mehr stand, viele verfallen. Die Herren über Grund und Boden wohnen fortan in repräsentativen und leichter erreichbaren Schlössern und Landsitzen. In Einzelfällen werden die mittelalterlichen Burgen im Hinblick auf die neue Bedrohungslage und Waffentechnik adaptiert.
Zur Lagerung von Waffen entstehen in der Frühen Neuzeit Zeughäuser als spezieller Gebäudetyp: Ihr Sinn besteht allein darin, Kriegsgerät möglichst effizient unter maximaler Ausnützung von Raum und Tageslicht unterzubringen. Das wichtigste Zeughaus, weil „Ausrüstungszentrale“ im Südosten des habsburgischen Reiches, ist das heutige Landeszeughaus in Graz. Von hier aus werden die Zeughäuser in der Region versorgt. Fast jede Stadt, Klosteranlage und Festung besitzt Räumlichkeiten zur Lagerung von Waffen, die zur Selbstverteidigung erworben werden. Im Kriegsfall erhalten sie zusätzliches Kriegsmaterial aus Graz. Zu solchen „privaten“ Rüstkammern kommen Zeughäuser von überregionaler Bedeutung in Fürstenfeld, Marburg/Maribor, Pettau/Ptuj oder Varaždin als Grazer Dependancen.
Auf den folgenden Seiten versuchen wir, zentrale Spuren der neuzeitlichen Wehrgeschichte, die sich heute noch in der Ost- und Südost-Steiermark finden, zu erfassen und damit ins Bewusstsein zu holen: Dies erfolgt durch die Fotos von Clemens Nestroy, die im Zeitraum von einigen Wochen im Sommer 2022 entstanden sind. Sie dokumentieren den Erhaltungszustand von Schanzen und Wällen, Befestigungen und Burganlagen zu diesem Zeitpunkt. Der Witterung, den Bedingungen und Interessen der Gegenwart ausgesetzt, wissen wir nicht, was davon in 20, 50 oder 100 Jahren noch erhalten sein wird. Lesbar und kontextualisiert werden die Fotografien durch die Texte und Quellenbelege von Leopold Toifl zu den Hintergründen der diversen Wehrmaßnahmen und Architekturen. Eine umfangreichere Einführung zu den Fehden und Kriegen der Neuzeit bietet der unmittelbar anschließende chronologische Überblick.

Das Landeszeughaus in Graz
Leopold Toifl
„Styria est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Superiore Styrii, aliam Occidentalis Styrii, tertiam qui ipsorum lingua „popolus ante montis Predel“, nostra Orientes Styrii appellantur […] Horum omnium fortissimi sunt Orientes Styrii proximique sunt Hungaris, qui trans flumen Lafnitz incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.“
„Steiermark ist in drei Teile geteilt, deren einen die Obersteirer bewohnen, den anderen die Weststeirer und den dritten jene, die in ihrer Sprache ,Volk vor dem Berg Predel‘, in unserer Oststeirer genannt werden […] Die Tapfersten all dieser sind die Oststeirer, weil sie den Ungarn, die jenseits der Lafnitz leben, sehr nahe sind und mit ihnen ständig Kriege führen.“
Wer bei dieser Persiflage an Gaius Julius Caesars Worte aus De bello Gallico denkt, liegt richtig. Und der Vergleich zum Original Caesars, der die „Belgae“ wegen deren ständiger Kämpfe mit den Germanen die „Tapfersten“ nennt, hinkt nicht einmal. Tatsächlich haben die Oststeirer – gleich den „Belgae“ – jahrhundertelange Erfahrungen mit Gegnern aus dem Osten gemacht.
Zu einem ungewöhnlichen Buch passt diese ungewöhnliche Einleitung also recht gut. Ein ungewöhnliches Buch ist deswegen entstanden, weil in der Folge nicht wie sonst üblich nüchterne Fakten zu einem bestimmten Ereignis zusammengetragen werden. Stattdessen wird Geschichte oder vielmehr werden Geschichten aus der Sicht von kriegsbetroffenen Orten im oststeirischen Grenzland zu Ungarn (heute: Burgenland) erzählt. Eingeflossen in die kurzen Geschichten sind Zitate von Chronisten, Zeitzeugen und Betroffenen ebenso wie Zitate aus Matrikeln, Inschriften auf Grabsteinen,
Votivbildern und an Gedenkstätten. Sie alle widerspiegeln jenes Leid, dem die Bevölkerung des Grenzlandes über Jahrhunderte hinweg ausgesetzt war.
Betrachtet wird der Zeitraum von 1407 bis 1709. Es ist jene Zeit, in die die Anfänge der Grazer Rüstkammer sowie die Hochblüte des daraus hervorgegangenen landschaftlichen Zeughauses (heute: Landeszeughaus) fallen. Viele der beschriebenen Orte, Burgen und Klöster erhalten damals von ebendort Waffen und Munition zur Selbstverteidigung bzw. Ausrüstung von Soldaten. Nach dem Ende des Kuruzzenkrieges 1709 enden gleichermaßen die Bedrohung des Landes und die Bedeutung des landschaftlichen Zeughauses. Die Reihung der Orte erfolgt nicht alphabetisch, sondern von „Nord nach Süd“. So ist eine Art Wegweiser hin zu architektonischen Spuren und Resten der Geschichte entstanden, die im Rahmen einer Tour mit 34 Stationen durchs Grenzland „erfahren“ werden können: Burgen und Schlösser, ehemalige Stadtbefestigungen, Bildstöcke, Votivbilder oder Bodendenkmäler. Wo die 34 Ortsgeschichten relevante Bezüge zu weiteren Orten enthalten, wird dies im Text mit einem einfachen → Pfeil markiert, während fett gedruckte Pfeile auf die im Anschluss folgende chronologische Übersicht verweisen.
So mancher Ort in der östlichen Steiermark mag in der folgenden Auflistung vermisst werden. Das liegt einerseits an der „Topografie des Krieges“: Nahezu alle der im Folgenden beschriebenen Fehden, Überfälle und Kriege spielen sich nämlich in einem Gebiet ab, das von der Lafnitz und der Kutschenitza als Ostgrenze nur wenige Kilometer Richtung Westen reicht. Auf Orte außerhalb dieser Zone einzugehen, würde den Rahmen des Bandes sprengen. Eben dies gilt auch für die etwa hundert betroffenen Ortschaften, die zwar innerhalb des oben genannten Gebietes liegen, in welchen aber keine räumlichen Spuren erhalten sind. Ihre Geschichte bleibt in zahlreichen Spezialpublikationen lebendig.
Eine historische Einordnung der vorgestellten Orte gibt der folgende chronologische Überblick zu zentralen kriegerischen Auseinandersetzungen vom frühen 15. bis zum frühen 18. Jahrhundert:
Die Wolfsauerfehden (1407, 1430–1436 sowie 1438–1441)
Am 25. September 1379 vereinbaren die Herzoge Leopold III. und Albrecht III. im obersteirischen Neuberg an der Mürz die Teilung des Hauses Habsburg in eine steirisch-leopoldinische und eine österreichisch-albertinische Linie. Sie ahnen nicht, dass dies
innen- wie außenpolitisch eine beträchtliche Schwächung der Erblande nach sich ziehen wird. Deutlich erkennbar wird diese Schwäche während eines Streites, den die Söhne Leopolds III. namens Ernst „der Eiserne“ und Leopold IV. um die einträgliche Vormundschaft für den aus albertinischer Linie stammenden Albrecht V. führen. In Österreich kommt es deswegen sogar zum Krieg, in der Steiermark zu einer Fehde gegen den Landesfürsten Ernst den Eisernen. Das Salzburger Ministerialengeschlecht der Wolfsauer sowie Berthold II. von Emerberg mischen sich in den Vormundschaftsstreit ein und stellen sich auf die Seite Leopolds IV. Im Auftrag Emerbergs und der Wolfsauer schädigen Reiter landesfürstliche Güter, überfallen Kaufleute und plündern diese aus. Um die Situation in den Griff zu bekommen, ordnet Ernst der Eiserne im Herbst 1407 die Eroberung der den Landfriedensbrechern gehörigen Burgen an. Diese Maßnahme beendet die Übergriffe der Wolfsauer und Emerberger, die ihren Besitz Kapfenstein bzw. Bertholdstein, Halbenrain und Klöch aber schon im Folgejahr wieder zurückerhalten.
Trotz dieser Erfahrung dauert die neue Friedfertigung der Wolfsauer nicht lange. Christoph und Sigmund von Wolfsau stellen sich gegen ihren Herrn, den auch in der Steiermark begüterten Erzbischof von Salzburg. Ab 1425 bauen sie Burg Kapfenstein zum Hauptstützpunkt für etwaige Kämpfe mit ihrem Dienstherrn aus. Zu den Waffen greifen sie erst 1430. Während der folgenden Jahre lassen sie „lediglich“ salzburgischen Besitz in der mittleren Steiermark plündern, begehen dann aber den Fehler, sich auch an steirischlandesfürstlichem Eigentum zu vergreifen. Herzog Friedrich V. (der spätere Kaiser Friedrich III.) sucht um Vermittlung des ungarischen Königs Sigismund an, weil die Wolfsauer auf die Hilfe magyarischer Adeliger zurückgreifen und damit einen Grenzkrieg provozieren. Parallel zu den Verhandlungen geht Friedrich mit Waffengewalt gegen die Wolfsauer vor und stärkt damit dem Salzburger Erzbischof Johann II.von Reisberg den Rücken. Darin liegt wohl der Grund, dass sich Christoph von Wolfsau im Frühjahr 1432 mit dem Kirchenfürsten aussöhnt und Urfehde, also den Fehdeverzicht, schwört. Sein Bruder dagegen setzt den Kampf fort, weswegen er des Landfriedensbruches für schuldig befunden wird. Friedrich V. beruft das steirische Landesaufgebot ein, das noch im Sommer 1432 Kapfenstein erobert. Seines Rückhaltes beraubt, flieht Sigmund von Wolfsau nach Ungarn und unterwirft sich, als er auch dort durch König Sigismund verfolgt wird. Im Friedensschluss vom 15. Juli 1436 erkennt er den Verlust seiner Güter Kapfenstein und Auenhof an. Sie werden durch Herzog Friedrich V. als Lehen weitergegeben.
Nur noch einmal greift das Geschlecht der Wolfsauer aktiv in die Kriegsgeschichte des Grenzlandes ein. 1438 kommt es zur Auseinandersetzung zwischen Herzog Friedrich V. und den Grafen von Cilli. Christoph von Wolfsau greift auf der Seite der Cillier in die bloß lokalen Kämpfe ein, schädigt im Grenzland den landesfürstlichen Markt Feldbach. Zwei Jahre später, im August 1440, stürmen seine Leute die der Familie Teuffenbach gehörige Burg Obermayerhofen und zünden das Mobiliar an. Im Zuge der im Oktober 1441 gestarteten Gegenkampagne Friedrichs V. dürfte der Wolfsauer gefallen zu sein.
Die erwähnten Querelen zwischen den Brüdern Ernst dem Eisernen und Leopold IV. um die Kuratel für Albrecht V. werden außerhalb der Steiermark beigelegt. Österreichische Hochadelige entführen unter Beteiligung Reinprechts II. von Walsee den vierzehnjährigen Albertiner nach Österreich, erklären ihn für volljährig und verloben ihn mit der Tochter des ungarischen Königs Sigismund. Ernst der Eiserne ist klug genug, sich nicht mit den Ungarn anzulegen. Stattdessen hält er sich an dem in der Steiermark reich begüterten Reinprecht von Walsee schadlos. Seinen ersten Schritt setzt er am 2. Dezember 1411 mit der Konfiskation der Walsee’schen Güter in der Steiermark wegen Ungehorsams gegen ihn als Landesfürsten. Reinprecht reagiert mit der Anwerbung bayrischer und böhmischer Söldner, mit deren Hilfe er zwei Schlösser Ernsts in Niederösterreich erobert.
Im Verlauf des Jahres 1412 eskaliert die Lage. Arg betroffen ist die mittlere Oststeiermark, wo Peter Anhanger von Köppach, Verwalter der Walsee’schen unteren Riegersburger Festung Lichtenegg für zahlreiche Überfälle verantwortlich ist. Er lässt im landesfürstlichen Markt Fehring zehn Häuser in Brand stecken, den Pfarrhof von St. Ruprecht an der Raab sowie zwei Höfe in Storcha verbrennen. Untertanen des Heinrich Rindscheit und des Jörg Narringer aus den teilweise in Brand gesteckten Dörfern Glatzau und Dörfla werden beraubt. Etliche landesfürstliche Vasallen werden auf die Riegersburg bzw. Lichtenegg verschleppt und gegen Lösegeld wieder freigelassen. Dem Prior des Augustinerklosters Fürstenfeld werden vier Dörfer geödet vnd die laeut verjagt, ettlich geuangen vnd geschaeczt. Im Oktober 1412 gelingt Köppach beinahe die Eroberung von Feldbach. Ähnliche Szenen spielen sich auch in der Untersteiermark (heute Štajerska, Slowenien) sowie der Mittelsteiermark ab. Nicht einmal vor den Gütern des Seckauer Bischofs Friedrich II. von Perneck machen die Anhänger Reinprechts II. von Walsee halt.
Die Rache Ernsts des Eisernen lässt nicht lange auf sich warten. Unter Einsatz von Feuerwaffen (!) belagert und erobert das herzogliche Heer im Oktober 1412 die untere Burg Lichtenegg in Riegersburg, woraufhin sich auch die höher gelegene Festung Kronegg ergibt. Auch die in der Unter- und Mittelsteiermark verübten Übergriffe bleiben nicht ungesühnt: Nahezu alle Besitzungen Reinprechts II. von Walsee werden durch herzogliche Truppen eingenommen oder zerstört. Beendet werden die Kampfhandlungen durch einen Waffenstillstand vom 4. Februar 1413. Da er nach Ansicht Ernsts des Eisernen mit seiner Fehde wider das landthrecht in Steir verstoßen hat, verfällt Reinprecht einer finanziellen Pönale: Für jeden Schadensfall hat er die ungeheure Summe von hundert Mark Gold an die herzogliche Kasse zu bezahlen. Der den Untertanen Ernsts zugefügte Schaden wird mit mehr als 600.000 Gulden beziffert. Der Waffenstillstand muss mehrmals verlängert werden, weil der offizielle Frieden erst am 15. Juni 1417 zustande kommt. Reinprecht II. von Walsee leistet Abbitte und erhält daraufhin am 10. August seine nicht zerstörten Besitzungen zurück, darunter die beiden Riegersburger Festungen Lichtenegg und Kronegg.
Das Jahr 1418
Der Einfall der Ungarn im Frühjahr 1418 steht in engem Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen dem steirischen Herzog Ernst dem Eisernen und dem deutschen König Sigismund aus dem Haus Luxemburg, der seit 1387 zugleich König von Ungarn war: Im November 1417 stellt sich Ernst der Eiserne auf die Seite seines in Tirol regierenden Bruders Friedrich IV., der am Konzil von Konstanz den Gegenpapst Johannes XXIII. unterstützt hat und deshalb in Gegensatz zu König Sigismund geraten ist. Wie man am Konzil munkelt, steht ein 25.000 Mann starkes ungarisches Heer bereit, die Steiermark zu erobern. Tatsächlich brechen die Ungarn im Frühjahr 1418 in die Oststeiermark ein und verheeren sie schrecklich. Die Weiler und Dörfer von insgesamt 19 Pfarren werden geplündert und teilweise verbrannt: Altenmarkt bei Fürstenfeld, Burgau, Ebersdorf, Feistritz bei Anger, Friedberg, Grafendorf, Großsteinbach, Hainersdorf, Hartberg, Kaindorf, Klöch, Mureck, Neudau, Riegersburg, St. Lorenzen am Wechsel, St. Marein am Pickelbach, Straden, Waltersdorf und Wörth. Wie der Pfarrer von Riegersburg anzeigt, werden manche Orte mehrfach überfallen. Inwieweit Menschen zu Schaden kommen, ist unbekannt. Ebenso unbekannt ist, in welcher Weise die Verwüstungen ihr Ende finden. Wir wissen nur, dass Ernst der Eiserne und König Sigismund bereits am 26. April 1418 Frieden schließen. Im November 1418 fordert ein Provinzialkonzil in Salzburg von den steirischen Pfarren die Zahlung
einer Steuer zur Schadensbehebung, doch nur Fehring, Feldbach, Lind, Passail, Preding, St. Stefan ob Stainz und Wolfsberg im Schwarzautal sind dazu in der Lage.
Die Baumkircherfehde 1469–1471
Andreas Baumkircher steht zunächst als Söldnerführer in Diensten Kaiser Friedrichs III. und leistet dem Herrscher in dessen diversen Auseinandersetzungen mit Ungarn treue Dienste. Weil aber politische Umstände seinen Interessen widersprechen und Geldzahlungen ausbleiben, distanziert sich Baumkircher von seinem Dienstherrn. Der Anlass zur offenen Fehde ergibt sich, als Friedrich III. seinem Söldnerführer auch die versprochenen jährlichen 500 Gulden Einkünfte aus der Herrschaft Radkersburg versagt. Ende Jänner 1469 schließt sich Baumkircher mit etlichen unzufriedenen steirischen Adeligen – darunter Ulrich von Pesnitz, Hans V. von Stubenberg, Andreas und Christoph Narringer sowie Ludwig Hauser – zu einem Bund gegen den Herrscher zusammen und schickt am 2. Februar 1469 einen Absagebrief an ihn.
Die Lage eskaliert rasch zu einem regelrechten Krieg. Bereits am Tag nach der Fehdeerklärung lässt Andreas Baumkircher die oststeirischen Orte Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg und Wildon besetzen. Angeblich unterstützen insgesamt 555 (!) Grundherren, Orte und Schlösser den Aufstand. Anders als sonst reagiert Friedrich unverzüglich. Trotz steter Geldnot lässt er ein hauptsächlich aus Böhmen bestehendes Söldnerheer anwerben, das zusammen mit einem im März aufgestellten obersteirischen Landesaufgebot an die Rückeroberung der besetzten Gebiete schreitet. Dabei kommt es im Mai bei Fürstenfeld, Mürzzuschlag und Radkersburg zu blutigen Schlachten. Große Gebiete vor allem der Oststeiermark werden von beiden Seiten zwecks Requirierung von Nachschub geplündert. Zu den kriegerischen Ereignissen gesellt sich eine steuerliche Belastung. Um sein Kriegsvolk finanzieren zu können, schreibt der Kaiser eine außerordentliche Steuer aus, die Bürgerschaft, Adel und Klerus gleichermaßen belastet. Das Patent vom 3. September 1469 fordert von jedem steirischen Wohnhaus die Zahlung von einem Dukaten. Die drastische Erhöhung der Weinsteuer, eine Vermehrung der Mautgebühren sowie eine zweiprozentige Steuer auf den Wert von Edelhöfen und Schlössern zwecks Finanzierung besserer Wehranlagen tun ein Übriges.
1470 weitet sich die Fehde in die bisher verschont gebliebene Obersteiermark und Weststeiermark aus. Dort allerdings stoßen die Truppen Baumkirchers auf energischen Widerstand
kaisertreuer Adeliger, die eine Selbsthilfeorganisation gebildet haben. Der Gjaidhof in Dobl, der Markt Groß-St. Florian sowie der Sitz der Familie Peuerl in Schwanberg fallen Baumkircher noch in die Hände. Es ist aber offensichtlich, dass der Fehdeführer keine ausreichende Unterstützung mehr hat: Einerseits haben Mitte Juni und im November 1469 zwei Türkeneinfälle weite Teile von Krain verheert und die getroffene Bevölkerung mutmaßt, Baumkircher habe die Osmanen gerufen. Andererseits sind die bisher durch die Fehde verursachten Schäden in der Ost- und Untersteiermark enorm. Auch das wird Baumkircher übel vermerkt. Beides trägt dazu bei, dass der Großteil seiner Anhänger von ihm abfällt. Nur der harte Kern rund um ihn führt den Kampf gegen Friedrich III. weiter. Im Februar 1470 trifft dieser in Wien mit dem ungarischen König Matyas Corvinus zusammen, um mit ihm über eine Lösung des Konfliktes zu beraten. Währenddessen kann sich Radkersburg von der Besatzung befreien.
Der Streifzug Baumkirchers in die westliche Steiermark veranlasst den mittlerweile in Völkermarkt mit dem Kaiser beratenden innerösterreichischen Landtag zum Handeln. Baumkircher erhält freies Geleit, kommt aus Windischfeistritz/Slovenska Bistrica nach Kärnten und nimmt an den Verhandlungen zur Beendigung der Auseinandersetzungen persönlich teil. Nach zähem Ringen kommt am 30. Juni 1470 eine Einigung zustande. Die Stände bewilligen dem Fehdeführer 14.000 Gulden, im Gegenzug hat dieser sämtliche Forderungen gegenüber Friedrich III. aufzugeben. Beide Seiten haben ihre Eroberungen zurückzustellen. Die Burgen der Aufrührer, ausgenommen Oberkapfenberg, sollen gebrochen werden. Am 2. Juli begnadigt der Kaiser Andreas Baumkircher, Hans V. von Stubenberg, Ulrich von Pesnitz, Andreas und Christoph Narringer sowie Ludwig Hauser.
Die Chance auf Frieden wird jedoch vertan, weil akuter Geldmangel die versprochene Zahlung an den darüber empörten Baumkircher verhindert. In der Folge brechen wieder Kämpfe aus, wenn auch nicht mehr in der bekannten Intensität. Im Herbst 1470 gelingt den Kaiserlichen die Rückeroberung von Wildon, das dabei so schwere Zerstörung erfährt, dass der Ort auf fünf Jahre Steuerfreiheit erhält. Anfang 1471 plündern Baumkirchers Söldner Gleichenberg, Feldbach, Halbenrain, Hartberg, Schloss Raitenau und Vasoldsberg. Zeitgleich steht der Fehdeführer in Verhandlungen mit kaiserlichen Räten. Im April kommt er sogar zu persönlichen Gesprächen mit Friedrich nach Graz. Doch der zieht einen radikalen Schlussstrich. Am Nachmittag des 23. April 1471 lässt er Andreas Baumkircher, von Stubenberg und Andreas von Greissenegg ungeachtet deren
freien Geleites festnehmen. Ohne Gerichtsverhandlung werden Greissenegg und Baumkircher beim Inneren Murtor enthauptet, Stubenberg wird mit Haft bis 1472 und dem Verlust von Oberkapfenberg belegt.
Zehn Jahre Besatzung durch die Ungarn (1480–1490)
Über mehrere Jahre kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Friedrich III. und König Matyas Corvinus von Ungarn, die sowohl in Österreich als auch in Ungarn ausgetragen werden. Ab 1479 spitzt sich die Lage zu. Grund dafür ist die Absicht des Kaisers, Bischof Johannes Beckenschlager von Gran/ Esztergom anstelle des amtsmüden Bernhard von Rohr zum neuen Erzbischof von Salzburg zu bestellen. Als dies publik wird, revidiert Rohr seinen Rücktrittsgedanken, schließt mit Matyas Corvinus einen Vertrag und räumt ihm 1479 die in der Steiermark gelegenen salzburgischen Orte und Festungen ein. Die Ungarn nutzen die einmalige Gelegenheit und besetzen ab dem 29. September sechs Städte im heutigen Slowenien. Danach wenden sich die ungarischen Truppen nordwärts und okkupieren am 21. Dezember Leibnitz und Schloss Seggau. Gegen Jahresende nehmen sie Deutschlandsberg, Bischofegg, Arnfels und Schwanberg ein. Weil die Ungarn offiziell von den besetzten Festungen aus nur die Türken angreifen wollen, herrscht rein amtlich betrachtet zu diesem Zeitpunkt noch Frieden. Die Steirer aber rüsten sich bereits und berufen das Landesaufgebot ein.
Erst im März 1480 bricht der Krieg de jure aus, indem Matyas Corvinus dem Kaiser übertriebene Rüstungspolitik und den Bruch einiger Abkommen vorwirft. Eine der ersten Aktionen der Ungarn besteht in der Belagerung und Eroberung von Radkersburg, das am 10. März nach drei Stürmen in die Hände der Truppen des Istvan Zapolya fällt. Als kurz darauf auch noch Halbenrain und St. Georgen an der Stiefing an die Eindringlinge verloren geht, befindet sich die gesamte südliche Murlinie westwärts bis Spielfeld in ungarischer Hand. Der sächsische Kanzleischreiber Kunz Rumpf berichtet als Bobachter des Geschehens am 9. März 1480 nach Dresden, dass Matyas Corvinus in der Steiermark rund 20.000 Mann unterhalte, die täglich des Kaisers Leute verderben, im Land hin und her ziehen und alles mitnehmen; aber sie morden und brennen nicht.
Zumindest für Fürstenfeld ist das falsch: Im Mai beginnen die Ungarn mit der Belagerung der Stadt, die durch eine aus Graz und Marburg/Maribor herbeieilende Entsatztruppe erheblich erschwert wird. Allerdings brechen die 400 Mann dieser Hilfsschar etliche
Weinkeller auf, betrinken sich und werden prompt von den Magyaren erschlagen. Fürstenfeld selbst geht nach schweren Stürmen durch Brandpfeile in Flammen auf. Als die Stadt am 21. Mai 1480 kapituliert, sind bereits 800 Bewohner gefallen oder Krankheiten erlegen. Nun werden reiche Bürger nach Ofen/Budapest verschleppt, das Augustinerkloster geplündert.
Nach dem Fall von Fürstenfeld steht die Steiermark den Invasoren beinahe schutzlos gegenüber. Friedrich III. hat seine Residenzstadt Graz bereits am 5. Jänner Richtung Wiener Neustadt verlassen und keine landesfürstliche Verteidigungstruppe gestellt. Und auch das von den steirischen Ständen rekrutierte Landesaufgebot erweist sich für eine effektive Gegenwehr als zu schwach. Während des Frühsommers 1480 verlagert sich das Kriegsgeschehen in die Obersteiermark. Speziell Neumarkt wird von den Ungarn und einer Truppe aus dem osmanischen Reich gleichzeitig (!) bedroht. Erst jetzt ringt sich Kaiser Friedrich zur Entsendung von Truppen durch und schickt unter dem Kommando des Georg von Wolframsdorf stehende Einheiten ins obere Murtal, wo gerade heftige Kämpfe toben. Es gelingt die Gefangennahme des ungarischen Heerführers Janos Haugwitz, der bald darauf durch einen gewissen Paniško ersetzt wird. Mit dem Kriegseintritt Salzburgs an der Seite Ungarns zu Jahresbeginn 1481 weiten sich die Kämpfe in der Obersteiermark aus. Und auch im Südosten des Landes kommt es wieder zu Zusammenstößen.
Jakob Szekely, dem ungarischen Hauptmann Radkersburgs, gelingt im März die Eroberung von Burg Ankenstein/Borl, er scheitert im Mai aber mit der Belagerung Marburgs/Maribors. Ungeachtet eines bis zum 25. Juni 1481 geltenden Waffenstillstandes liefern sich auf kaiserlicher Seite kämpfende böhmische Söldner unter Wenzel Wlk (richtig: Václav Vlček) am 11. Juni ein Scharmützel mit den Ungarn und unterliegen. Zurückerobert werden kann dagegen St. Georgen an der Stiefing. Die Reaktion des Kaisers ist erstaunlich: Mit der Begründung, der gescheiterte Feldzug sei nicht befohlen gewesen, verweigert er die Entlohnung des Václav Vlček, der daraufhin die Seiten wechselt und die Kriegsführung der Ungarn in Österreich übernimmt. Eine reelle Chance auf Frieden ergibt sich im November 1481, als der Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr sich mit Kaiser Friedrich III. versöhnt und Johannes Beckenschlager als Koadjutor die Betreuung des Erzstifts übernimmt. Teil dieser Versöhnung ist die geplante Rückgabe sämtlicher salzburgischer Güter in der Steiermark durch die Ungarn. König Matyas Corvinus kümmert sich nicht darum und betraut seine Heere weiterhin mit der Eroberung von landesfürstlichem Eigentum. Wieder spielen sich
die Ereignisse in der Obersteiermark ab und auch Kärnten wird zum Kriegsschauplatz. Nicht besser steht es im heutigen Niederösterreich, wohin sich die Kämpfe ab dem Jahr 1483 verlagern.
In der Oststeiermark ist es in den Jahren 1482 und 1483 weitgehend ruhig, auch wenn die bisher schon besetzten Burgen und Orte weiterhin ungarisch bleiben. Daher wagt der Kaiser eine Strafexpedition gegen die Erben des am 22. Oktober 1483 verstorbenen Hans III.von Neuberg, der zu den Magyaren übergelaufen war und etliche oststeirische Herrschaften ausgeliefert hat. Am 17. April 1485 zieht er die neubergischen Besitzungen Neuberg, Pöllau, Thalberg und Neudau ein. Kurz zuvor richtet Friedrich an alle steirischen Adeligen die Bitte, Waffen, Rüstungen und Mannschaft zum Kampf gegen die Ungarn zu stellen.
Die für den Gesamtkriegsverlauf entscheidenden Ereignisse finden indes in Österreich statt. Als am 1. Juni 1485 Wien in die Hände der Ungarn fällt und Corvinus dort Residenz nimmt, scheint das Schicksal des Kaisers besiegelt. Der tut, was er am besten kann: Er wartet ab, lässt aber durch Johannes Beckenschlager Ende Juli 1485 in Rottenmann Friedensverhandlungen forcieren. Als diese scheitern und Jakob Szekely für die Ungarn weststeirische Orte erobert, sinkt die Stimmung auf einen neuen Tiefpunkt. Der steirische Landtag ersucht den tatenlos zusehenden Kaiser um Hilfe, andernfalls das Land gänzlich ungarisch würde. Die Reaktion besteht am 9. September 1485 in der Ernennung des Reinprecht von Reichenburg zum innerösterreichischen Feldhauptmann, dem zusammen mit Georg von Wolframsdorf einige Rückeroberungen gelingen. Derlei Erfolge können die Besetzung weiterer Orte in der mittleren Steiermark und im oberen Mürztal durch die Ungarn nicht verhindern. Am 17. August 1487 fällt sogar das bisher verschonte (damals steirische) Wiener Neustadt in ihre Hände.
Die Situation ist für die Ungarn nach einigen Erfolgen auch in der Untersteiermark (heute: Štajerska, Slowenien) so weit gefestigt, dass sie durch die Söldner des Wilhelm Baumkircher im Oktober 1487 unbehelligt mit der Belagerung der oststeirischen Stadt Hartberg beginnen können. Gleichzeitig werden Schloss Bertholdstein, Stift Vorau und der Markt Friedberg bedrängt. Die Besatzungen der schon seit 1480 ungarischen Orte Hohenbrugg an der Raab und Fehring erhalten Verstärkung.
Parallel zu neu ausbrechenden Kämpfen im Mürztal, zur erneuten Einberufung des Landesaufgebotes und zu Rekrutierungen Reinprechts von Reichenburg sucht man nach einem
diplomatischen Weg aus dem Krieg. Erster Schritt ist ein Waffenstillstand, ausgehandelt am 29. November 1487 zwischen Matyas Corvinus und Herzog Albrecht von Sachsen als kaiserlichem Vertreter. Die steirischen und Kärntner Belange regeln gesonderte Verhandlungen zu Wolfsberg im Lavanttal. Wie brüchig die Abkommen jedoch sind, wird aus der Einnahme des seit Oktober 1487 belagerten Hartberg und einem angeblichen neuerlichen (?) ungarischen Angriff auf das nur notdürftig wiederaufgebaute Fürstenfeld im Frühjahr 1488 deutlich. Obwohl der Waffenstillstand mehrmals verlängert wird, ändert sich in der Steiermark nicht viel: Immer noch ist ein Großteil des Landes von den Magyaren besetzt, immer noch sind unbotmäßige kaiserliche Söldner in Zaum zu halten, immer noch geraten Anhänger des Kaisers und des Ungarnkönigs aus privater Feindschaft und Raubgier aneinander. Die bisherigen großen kriegerischen Ereignisse aber bleiben aus.
Letztlich verändert ein Todesfall die Lage quasi über Nacht: Am 6. April 1490 stirbt der fünfzigjährige Matyas Corvinus in Wien. Ihrer Leitfigur beraubt, werden aus den überlegenen ungarischen Angreifern von gestern kopflose, entmutigte Verteidiger. Schneller als erwartet, bricht ihre Herrschaft im Land zusammen, zumal etliche magyarische Hauptleute von sich aus Frieden schließen oder auf die kaiserliche Seite übertreten. Kaiser Friedrichs III. Sohn Maximilian I. stellt 500 Fußknechte und 600 Reiter ins Feld und dringt mit diesen ab dem 13. Juni 1490 von Rottenmann Richtung Mittel- und Oststeiermark vor. Anfang August ergibt sich ihm Hartberg, Voitsberg und Leibnitz folgen. Schwere Schäden durch Beschießung und Erstürmung erleidet dabei Schloss Seggau. Zu Allerheiligen sind die meisten Burgen, Städte und Märkte von den Ungarn geräumt, nur Hohenbrugg an der Raab und Kapfenstein werden noch von diesen kontrolliert.
Das Jahrzehnt zwischen 1480 und 1490 ist für die Steiermark eines der furchtbarsten und kriegerischsten. Raub, Brand und Mord gehören zum Alltag vieler Menschen. Kaiserliche wie Ungarn bleiben einander nichts schuldig. Die Leidtragenden sind die den Soldaten meist schutzlos ausgelieferten Bewohner*innen des Landes. In Anbetracht der Ereignisse zieht der zeitgenössische Chronist Jakob Unrest ein erschütterndes Resümee: In dem krieg ist mancher man auf paiden tailen umb leib, leben, guet, haus und hof komen, manig fraw zu wittib worden und in das elennd komen, manig guet verprannt und veroed worden, manig sel an [Seele ohne] peicht, puess und rew verschiden. Got sey den armen selen genedig, die armen lewtten in dem krieg offt ir guet unpillichen genomen haben und nye kain gewissen gehabt haben darum.
Osmanen oder Türken?
In engem Zusammenhang mit der frühen ungarischen Besetzung steht der erste Einfall von Truppen aus dem Osmanischen Reich in die heutige Steiermark. Die Heere des ungarischen König Matyas Corvinus dringen seit dem Frühjahr 1480 aus dem Bereich Radkersburg–Fürstenfeld eher gemächlich Richtung oberes Murtal vor. Die rasch agierenden osmanischen Truppen dagegen kommen aus Bosnien, überqueren am 2. August die Grenze zum Habsburgerreich und erreichen zwei Tage später Kärnten und von dort aus am 6. August das obersteirische Neumarkt. Dort stoßen sie unerwartet auf die Ungarn, die gerade den Ort belagern. In dieser Situation gewähren die Bürger den Magyaren Zuflucht im Ort – mit dem Ergebnis, dass diese Neumarkt sechs Jahre lang besetzt halten. Die Türken dagegen ziehen weiter nach Judenburg, wo sie sich teilen: Eine Abteilung dringt über Obdach ins Lavanttal und ins Packgebiet ein. Eine zweite gelangt über Hohentauern nach Rottenmann und von dort weiter nach Leoben und Bruck an der Mur. Das Hauptheer bleibt im Murtal, zieht am 7. August flussabwärts weiter und erreicht nach der Zerstörung vieler Kirchen am 9. August ebenfalls Bruck. Wieder vereint, unternimmt die Truppe einen kurzen Streifzug ins Mürztal und bricht anschließend nach Graz auf. Zwar wagen die osmanischen Streifscharen keinen Angriff auf die befestigte steirische Hauptstadt, doch wird deren Umgebung geplündert, Renner und Brenner verwüsten die Oststeiermark bis hin zur Raab. Um den 16. August verlassen die Eindringlinge bei Radkersburg den heute steirischen Boden.
Während des Einfalles werden alte Menschen und jene, die sich wehren, ohne Umstände ermordet. Junge Personen, vor allem Mädchen und Frauen, werden verschleppt, Priester verbrannt oder ertränkt. Die unbeerdigt gebliebenen Leichen und Tierkadaver beginnen zu verwesen und locken Ratten an. Es bricht die Pest aus, die wiederum weitere Todesopfer fordert. Ähnliche Erfahrungen hat man in der Untersteiermark (heute Štajerska, Slowenien) bereits
Der Begriff „Osmanen“ bezeichnet die Mitglieder der in Istanbul residierenden Herrscherdynastie, deren Name sich von Sultan Osman I. ableitet. Ihr Herrschaftsbereich vergrößert sich im Laufe von Jahrhunderten massiv und reicht seit dem 15. Jahrhundert bis an die Südostgrenze des Habsburgerreiches. Jene Männer, die die Expansion des „Osmanischen Reichs“ in Eroberungszügen vorantreiben, stammen aus der heutigen Türkei, aber auch aus Albanien, Bosnien, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Ungarn etc. Sie waren Angehörige der „osmanischen Heere“ oder der „Truppen aus dem Osmanischen Reich“. In den Originalzitaten des 15. bis 17. Jahrhunderts werden sie als „Türckhen“ oder „Tirggen“, also als „Türken“ bezeichnet.
in den Jahren zuvor gemacht. Erstmals 1471 und danach fast alljährlich bis 1483 brechen „türkische“ Truppen aus dem heutigen Bosnien ins Land ein.
Truppen aus dem Osmanischen Reich im Durchmarsch (1529 und 1532)
Nach den fast jährlichen Einbrüchen der Osmanen zwischen 1471 und 1483 in der Untersteiermark bzw. dem ersten großen Einfall von 1480 in Kärnten und der Steiermark, herrscht 35 Jahre lang Waffenruhe. Dass die vom Osmanischen Reich ausgehende Gefahr aber nicht vorbei ist, beweisen die Ereignisse in den Nachbarländern Kärnten und Krain sowie die türkischen Heerzüge von 1529 und 1532 in der Steiermark selbst. Und auch die Entwicklungen auf dem Balkan und in Ungarn bezeugen eine rasche Ausbreitung des Osmanischen Reiches Richtung Nordwesten.
Empfindlich gestört wird diese Expansion durch die Bestrebungen König Ferdinands I., in dem zu Ungarn gehörigen Kroatien eine stehende Truppe aufzubauen. Die Stationierung von 1.000 Reitern und 200 Fußknechten bildet den bescheidenen Anfang der später so bedeutsam werdenden Militärgrenze. Es entsteht eine Vorfeldverteidigung, die später auch die Steiermark lange Zeit effizient vor Einfällen aus dem Südosten schützen wird.
Gefährlich für die Steiermark wird die Lage, als die feindlichen Truppen von Osten und Nordosten in das Land einfallen: Im Frühsommer 1529 bricht Sultan Suleiman I. mit etwa 150.000 Mann von Istanbul auf, erreicht am 17. Juli Belgrad/Beograd, erobert am 8. September Ofen/Budapest und rückt unaufhaltsam Richtung Wien vor. Dass die Türken, die am 18. September begonnene Belagerung der Stadt knapp vier Wochen später erfolglos abbrechen, ist nicht nur Schlechtwetter, sondern auch dem Wehrwillen der Wiener und dem Eingreifen einer steirischen Hilfstruppe geschuldet. Schon während der Belagerung stoßen kleinere osmanische Streifscharen über den Semmering bis ins Mürztal vor.
Zwar zieht das türkische Hauptheer, das die Belagerung Wiens am 15. Oktober 1529 aufgibt, über Ungarn ab, doch die Nachhut wählt ihren Weg über die Oststeiermark. Bei ihrem schnellen Durchritt überfallen sie nicht geschützte, unbewehrte Orte. Die ersten Angriffe am 19. Oktober gelten Friedberg und der Festenburg, in deren Torbereich zwei eingemauerte Kanonenkugeln mit der eingeritzten Jahreszahl „1529“ an das Ereignis erinnern. In der Folge geraten Dechantskirchen, Thalberg, Aichberg, Grafendorf
und Raitenau unter Beschuss. Während das befestigte Hartberg unbehelligt bleibt, werden während der nächsten Tage die westlich der Lafnitz gelegenen Orte Burgau, Hohenbrugg bei Waltersdorf, Längenbach, Leitersdorf, Mitterndorf, Neudauberg, Obermayerhofen, St. Johann in der Haide, Unterlimbach und Wörth geplündert. Eine türkische Unterabteilung attackiert sogar das weiter südwestlich gelegene Dorf Ilz und brennt es nieder, ehe die ganze Nachhut über die nahe Grenze nach Ungarn abzieht.
Die beiden folgenden Jahre sind von kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich in Krain ebenso geprägt wie von Beratungen über Defensionsordnungen, in deren Verlauf der Krainer Landeshauptmann Hans Katzianer am 24. März 1530 zum obersten Feldhauptmann der innerösterreichischen Länder bestellt wird. Zudem einigt man sich ein Jahr später auf eine gemeinsame Grenzverteidigung durch die Länder Steiermark, Kärnten und Krain. Dessen ungeachtet richtet Sultan Suleiman I. sein Augenmerk weiterhin auf den „Goldenen Apfel“, wie er Wien nennt. 1532 marschiert sein Heer abermals Richtung Wien und erscheint unter Suleimans persönlicher Führung am 5. August vor dem kleinen westungarischen Güns/Köszeg. Tags darauf beginnt die Belagerung der von Leuten des Niklas Jurisich verteidigten Stadt. Allerdings setzt der Sultan nicht seine gesamten Streitkräfte ein, sondern ordnet Scharen zu Streifzügen in die benachbarte Steiermark ab. So werden am 7. August Neudau und Waltersdorf angegriffen, das Safen- und Feistritztal bis Blumau geschädigt. Zwei Tage später dringen die Renner und Brenner in das Gebiet zwischen Fürstenfeld und Hartberg ein.
In der Steiermark wurde der Aufmarsch des feindlichen Heeres mit wachsender Sorge beobachtet und das Landesaufgebot einberufen. Etwa 3.000 Mann sichern zusammen mit etlichen Hundert Bauern die Ostgrenze des Landes. Am 14. August gelingt dieser von Ungarn unterstützten Truppe bei Schlaining ein Teilerfolg mit der Gefangennahme einiger Gegner, deren vollständige Vertreibung aber misslingt. Ein Rückschlag folgt fünf Tage später, als etwa 200 Steirer bei Stegersbach auf eine zehnfache Übermacht treffen und sich deshalb nach Fürstenfeld retten müssen. Kurz darauf flammen zwischen Hartberg und Thalberg sowie gegen Aspang zu Feuer auf, das Gebiet um St. Lorenzen am Wechsel und Vorau wird geplündert, ehe die Türken wohl über Bernstein nach Güns zurückkehren. In dieser prekären Situation erhalten die Steirer den fatalen Befehl, Truppen nach Linz zu schicken, weil eine feindliche Abteilung unter Kasim Beg über den Wienerwald nach Westen durchgebrochen ist. Hans Katzianer führt daraufhin 3.000 gerüstete Reiter nach
Oberösterreich, weshalb an der steirischen Ostgrenze nur leichte Kavallerie steht, die für eine effiziente Abwehr nicht ausreicht. Tatsächlich nutzen die Angreifer die Schwächung und fallen am 25. und 26. August abermals in die Steiermark ein. Diesmal gelangen sie bis Gleisdorf, werden dann durch Söldner des in Graz stehenden krainischen Feldhauptmanns Hans von Werneck zurückgeschlagen.
Das Schlimmste steht dem Land noch bevor: Am 28. August 1532 ergibt sich das belagerte Güns. Sultan Suleiman I. begreift, zu viel Zeit verloren zu haben, um noch an einen Angriff auf das mittlerweile durch Reichstruppen abgeschirmte Wien denken zu können. Der deutsche Chronist Hieronymus Ortelius verhöhnt den Osmanen später (1602), ohne an die Steiermark zu denken: Als aber Soliman dieße grosse macht vnnd nachtruck des Teutschen Kriegsvolcks vernommen, fieng im an der Muth zu sincken, vnangesehhen, dz er funffmal hundert Tausent Mann beysamen, vnd mit 300 grosse stück Geschütz versehen war, aber Gott der Allmechtig leget diesem hochmütigen vnd Blutdurstigen Tyrannen ein Ring in die Nasen, also dz er ohne einiges löbliches verrichten mit schand vnd spott abziehen müssen.
Suleiman I. entschließt sich deshalb zum Rückzug durch die Steiermark. Am 4. September überschreiten seine Scharen bei Friedberg die steirische Grenze. Lediglich eine durch Kasim Beg geführte Abteilung, die dann am 18. September in der Schlacht am Steinfeld beinahe vollständig aufgerieben wird, bleibt im heutigen Niederösterreich. Der ungarischstämmige türkische Chronist Bedschwi berichtet dazu: Kasim Woywoda fand in einem schwer zu passirenden Passe des allemannischen Gebirges den Weg von den Ungläubigen versperrt, so daß sie nirgends. wohin sie sich auch wandten, durchdringen konnten. Die meisten Sieger fanden keinen Ausweg des Heils, tranken den Trunk des Martyrthums und marschirten in das Paradies ab. Diesen Bericht vernahm der glückliche Padischah von einigen der Geretteten erst, als er nach dem Rückzuge nach Essek kam.
Der von Bedschwi erwähnte Rückzug des Padischahs (Suleiman I.) nach Esseg/Osijek bzw. der Durchmarsch des osmanischen Heeres wird für die betroffenen steirischen Landstriche zu einem Verwüstungszug sondergleichen, dessen wichtigste Vorkommnisse die Chronisten Bedschwi und Celalsade Nicanci-baši sowie Suleiman I. selbst in Kriegstagebüchern festhalten. In der Zeit zwischen dem 4. und 10. September fallen (in alphabetischer Reihenfolge) Bärnegg in der Elsenau, Blaindorf, Dechantskirchen, Eichberg, Friedberg, Gleisdorf, Grafendorf, Ilz, Kaindorf, Obermayerhofen, Pischelsdorf, Pöllau, Raitenau, Rohrbach, St. Johann bei Herberstein,
Waltersdorf und Wildbach Verbrennung und Plünderung anheim. Einzig die Festenburg kann widerstehen.
Am 11. September 1532 lagert das osmanische Heer unweit Graz. Bedschwi schreibt dazu: Am 11. des obgedachten Monaths lagerte man vor der unvergleichlichen Stadt Gradsch. Wenn es im Lande der Ungläubigen eine ihr gleiche Stadt gibt, so ist es nur die Residenz des Königs, Wien. Eine spätere Sage kolportiert falsch eine Besetzung von Graz und auch der Bericht des Celalsade Nicancibaši trifft nicht zu: Am 11. passirte man durch den Paß des Laithgebirgs, und kam zur großen Stadt Gradschasch, welche die alte Residenz des mißglückten Königs […] Durch den hohen Muth des Länder erobernden Padischah wurde demselben auch die Eroberung dieser Stadt beschert, und ihre Bewohner dem Schwerte zum Fraß gewährt. In Wahrheit zieht das osmanische Heer ohne Angriff auf Graz weiter, äschert Hausmannstätten ein, übersetzt bei Fernitz die Mur und brennt Leibnitz nieder. Tags darauf kehren die von Hans Katzianer befehligten Reiter aus Linz in die Steiermark zurück. Dass diese den abziehenden Türken nachgeeilt und deren Nachhut bei Fernitz geschlagen hätten, gehört ins Reich der Fabel.
Unbehelligt weichen Renner und Brenner vom Weg des Hauptheeres ab und verwüsten das Koralmgebiet sowie die Gegend östlich der Mur bis St. Georgen an der Stiefing. Währenddessen bewegt sich das Hauptheer über den Platsch und Witschein/Svečina nach Marburg/Maribor, das am 15. und 16. September erfolglos bestürmt wird. Wieder lösen sich Truppenteile vom Hauptheer, das an Pettau/ Ptuj und Varaždin vorbei nahe Osijek osmanischen Boden erreicht. Die zweite Schar hält sich südlich, zerstört in der heutigen Štajerska zahlreiche Orte und verlässt bei Rohitsch/Rogatec damals steirisches Territorium.
Dem wohl schwersten Einfall aus dem Osmanischen Reich fallen allein in der Steiermark an die Hundert Dörfer sowie über ein Dutzend Märkte und Städte zum Opfer. Tausende Menschen sterben oder werden verschleppt. In einem Bericht der Aggressoren heißt es dazu: Das deutsche Land war rings verbrennet und versengt, des Himmels reine Luft mit dichtem Rauch vermengt, und jeder Zufluchtsort ungläubiger Gebete, verheeret und verkehrt in eine wüste Stätte.
Die Causa Rödern 1593
Wegen der Eskalation der ohnehin ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen an der Militärgrenze im heutigen Kroatien lässt Erzherzog Maximilian Hilfstruppen anwerben. Eine davon,
sogenannte Arkebusier-Reiter, führt Melchior von Rödern aus Schlesien an die Militärgrenze. Auf ihrem Weg dorthin besetzt die eigentlich zum Kampf gegen die Türken bestimmte 500 Mann starke Einheit von Ende März bis Anfang Mai 1593 die Stadt Fürstenfeld. Die Reiter haben ihren ersten und bislang einzigen Sold aufgebraucht, eine weitere Bezahlung ist nicht in Sicht. So sichern sie sich ihren Lebensunterhalt durch Plünderungen, Erpressungen und Räubereien. Davon ist nicht nur die Bevölkerung in Fürstenfeld betroffen, sondern auch jene in Altenmarkt bei Fürstenfeld sowie im Raabtal zwischen Fladnitz, Kirchberg an der Raab und Gleisdorf.
In der zweiten Maiwoche ziehen die Arkebusiere Röderns weiter und erreichen über Varaždin und Zagreb Anfang Juni schließlich das Krisengebiet an der Kulpa. Gemeinsam mit anderen christlichen Kriegsvölkern erleben sie, wie die osmanische Gegenseite unter Hasan Predojević († 1593) zum Angriff übergeht und im Juni 1593 die Belagerung der Festung Sissek/Sisak beginnt. Diese Ereignisse von 1593 markieren den Beginn eines 13 Jahre dauernden Krieges zwischen dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich, in dessen Zusammenhang die Revolte des siebenbürgischen Fürsten Istvan Bocskay (1557–1606) gegen Habsburg 1605 steht.
Die Haidukeneinfälle 1605
Mit Rückendeckung aus dem Osmanischen Reich lässt sich der siebenbürgische Fürst Istvan Bocskay zu einem Aufstand gegen Kaiser Rudolf II. hinreißen. Als offiziellen Grund führt Bocskay versuchte habsburgische Einmischung in Belange seines Fürstentums an, in Wahrheit besteht sein Ziel aber in der Erlangung der ungarischen Königskrone. Die 1604 begonnene Rebellion weitet sich rasch zu einem Raubkrieg gegen die Zivilbevölkerung in Westungarn und der benachbarten Steiermark aus. Die als „Haiduken“ bezeichneten Anhänger und Truppen Bocskays stoßen über die heutige Slowakei vor und gelangen über das heutige Niederösterreich und Burgenland in die Steiermark. Als der Rebellenoberst Gregor Nemethy mit rund 6.000 Haiduken und etwa 2.000 Türken am 26. Mai die steirische Grenze überschreitet, reagieren die für die Organisation der Landesverteidigung zuständigen Verordneten in Graz äußerst zögerlich und berufen nicht einmal ein Landesaufgebot ein.
Als Erstes haben Hohenbrugg an der Raab, Schiefer und Fehring diese Sorglosigkeit zu büßen. An der Riegersburg vorbei gelangen die Haiduken nach Fürstenfeld, das am 28. Mai kampflos erobert wird. Weil gut koordinierte Wehrmaßnahmen noch immer fehlen, gelingt den Haiduken ein ungehinderter Vorstoß ins Safental. Als
sie in der Nacht zum 4. Juni Hartberg erreichen, liegt die Plünderung von 52 Dörfern hinter ihnen. Wie schlecht die von Graz organisierte Landesverteidigung in diesen Tagen ist, lässt die Klage des Hans von Stadl erahnen: Es ist gott wais in gott zu erparmen, daz bei so vilfeltiger Warnung und vermonung so gar kain fürsehung in dißen viertl Vorau fürgenomen wil werden und daz die armen leut so jämerlich nidergehaut, verprent und in der pluethund dienstparkait gebracht müessen werden. Wie nun daz geschrei gehet, das der feind mit starker anzal her noch solde komen, also werden e[uer] h[erren] mitl und weg für zu nemen wissen, das dem feind doch ain widerstand beschehe.
Der Angriff der Haiduken auf Hartberg selbst erfolgt am 4. Juni gegen 2:30 Uhr früh, scheitert jedoch nach drei Stunden am Widerstand der Bevölkerung unter Führung des Landprofosen Wolf Glöderl und des Burgherrn Hans Christoph von Paar. Niedergebrannt aber werden die Grazer Vorstadt sowie sämtliche Dörfer der Umgebung. Noch am gleichen Tag fallen die Soldaten über Schloss Aichberg her, dessen Besitzer sich ins nahe gelegene Stift Vorau gerettet hat. Am folgenden 5. Juni verlassen die Haiduken über Thalberg und Friedberg steirisches Gebiet. Ein Zeitgenosse namens Andreas Ochs von Sonnau fasst die Ereignisse in seinem Tagebuch so zusammen: Den 28. Mai 1605 haben Freibeuter, darzu sich auch wertloß gesindt, thails so zu Grätz auß der Soldateska vnd Guardia wegen vbl verhalten außgemustert worden, vnd auch Türkhen geschlagen, item Tarttarn ec, ain Straiff vnd Einfall in das land Steyr gethan, Furstenfeldt eingenommen, geplündert, Item Feldpach vnd andere vill märkt vnd Dörffer in Prandt gesteckt. Des Stainpaiß aines des Ritterstandt Edelmann Sitz vnversehens vberfallen, ja auf die anderthalb Meill nach Grätz zuegestraiffet, also daß ein solche jammer, Forcht vnd Flucht darauß worden, daß vill hundert Menschen ir beste Sachen nach Grätz vnd auf die nächstgelegnen Perckschlösser geflüchtet. Haben vill Menschen vnd auch Viech mit sich hinwegk gefiert. Da war kain defenion noch gegenwöhr, hat etliche tage gewehrt.
Im Sommer verlagert sich das Hauptkampfgeschehen nach Ungarn, weshalb Ende Juni und Anfang Juli „nur“ die Herrschaften Kapfenstein, Bertholdstein und Stainz bei Straden Angriffen der Rebellen ausgesetzt sind. Dann aber wenden sich die Haiduken abermals nach Norden und überfallen im Viertel Vorau am 21. Juli acht Dörfer. Zwar werden endlich das Landesaufgebot einberufen, Reiter angeworben und durch Erzherzog Ferdinand II. 800 Musketiere und weitere 400 Reiter ins Feld gestellt, doch gesamt gesehen sind die steirischen Wehrmaßnahmen im Juli noch immer als gering
einzuschätzen. Hauptquartiere dieser Truppen sind Feldbach und Radkersburg. Die Haiduken zeigen sich von der ihnen entgegengestellten Streitmacht unbeeindruckt und plündern die Umgebung von Burgau und Neudau. Sogar der Stadt Hartberg droht ein zweiter Angriff. Währenddessen gelingt den Steirern am 17. Juli die Rückeroberung des von Leuten Nemethys schon seit Mai besetzten Klosters St. Gotthard/Szentgotthárd und damit die Sicherung des Raabtales. Zunichte gemacht wird dieser Erfolg durch jene Niederlage, die das steirische Landesaufgebot unter Sigmund Friedrich von Trauttmansdorff am 1. September bei Sümeg in Ungarn erleidet. Die strategisch wichtige Raablinie geht abermals verloren, was den Haiduken weitere Angriffe in der Steiermark erleichtert. Zudem wälzt sich ein aus Haiduken und Türken zusammengesetztes Heer unter dem Oberbefehl des Gregor Nemethy durch Ungarn westwärts und bereitet einer die steirische Ostgrenze sichernde Einheit am 27. September bei Steinamanger/Szombathely eine katastrophale Niederlage.
Vor diesem Hintergrund beschließen die Verordneten in Graz am 30. September ein neues Landesaufgebot sowie die Wiedereinberufung kurz zuvor aus Kostengründen abgedankter Reitereinheiten. Dass diese Maßnahmen zu spät kommen, beweisen die weiteren Ereignisse: Beunruhigt über die schlechten Nachrichten der jüngsten Zeit lässt Wolfgang von Teuffenbach das von ihm besetzte Kloster St. Gotthard sprengen und zieht seine Truppe in die Steiermark zurück. Weil er damit die Raablinie preisgibt, können die Haiduken bereits am 2. September ungehindert bis Hainfeld nahe Feldbach vordringen. Von dort wendet sich der Trupp Nemethys südwärts und verwandelt das Gebiet zwischen Wernsee/ Veržej, Luttenberg/Ljutomer, Straden und Feldbach zwischen dem 15. und dem 20. Oktober in einen Kriegsschauplatz: Neun Dörfer und unzählige Bauernhöfe werden geplündert und teilweise verbrannt. Lediglich das befestigte Straden kann widerstehen. Im Morgengrauen des 26. Oktober greifen die Haiduken Feldbach an, das während des Einfalls im Mai verschont geblieben ist. Sie plündern den Ort, scheitern aber an der Einnahme des Tabors, in den sich die Bevölkerung geflüchtet hat. Fast gleichzeitig mit diesem Streifzug in die Südoststeiermark sucht eine zweite Haidukenschar unter Kristóf Hagymassy von Ödenburg aus die im Feistritz- und Safental gelegenen Orte heim. Viele Siedlungen dieses Gebietes werden so innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal schwer getroffen.
Ungeachtet dieses später so bezeichneten Herbsteinfalls der Haiduken beweisen die Verordneten Kurzsichtigkeit. Zwecks Kostenersparnis verfügen sie die Abdankung der Reiterei, sodass
nur noch 800 Musketiere und 500 Fußknechte, vermehrt um 1.000 aus Österreich eingetroffene Reiter zur Landesverteidigung, bereitstehen. Zumindest die lokalen Grundbesitzer sind zur Selbstverteidigung ihrer Ländereien bereit. Anstelle einer geschlossenen Defensionslinie entsteht so eine lose Kette von befestigten Stützpunkten zur Abwehr. Letztlich führen Geheimverhandlungen mit Istvan Bocskay Anfang November zu einem Waffenstillstand.
Zu einzelnen lokalen Kampfhandlungen kommt es weiterhin: Am 11. November unternimmt eine kleine Schar Haiduken einen Angriff auf Radkersburg, der zurückgeschlagen werden kann. Obwohl der kaiserliche Feldmarschall Johann Tserclaes von Tilly zusammen mit Leuten des steirischen Landobristen Wolf Wilhelm von Herberstein diese von Radkersburg abgedrängte Schar bei Rabahidveg besiegt, unternimmt Kristóf Hagymassy am 13. Dezember einen weiteren Angriff auf Radkersburg. Schäden kann er nicht mehr anrichten, da er von den Leuten Herbersteins rechtzeitig entdeckt und vertrieben wird. Es war der letzte Angriff auf die Steiermark anno 1605. Den bisherigen kriegerischen Aktionen, die nicht nur die Steiermark, sondern auch Niederösterreich und das heutige Burgenland betroffen haben, folgen langwierige Verhandlungen zwischen kaiserlichen Vertretern und Gesandten des Istvan Bocskay. Diese führen schlussendlich zum Frieden von Wien, der die Rebellion am 23. Juni 1606 offiziell beendet. Der siebenbürgische Fürst hat sein Ziel, die Erlangung der ungarischen Königskrone, nicht erreicht. Er stirbt am 29. Dezember 1606 in Kaschau, dem heutigen Košice, im Alter von nur 49 Jahren.
Die lokale Bevölkerung nimmt vom Tod des Fürsten kaum Notiz. Sie ist mit der Beseitigung der Schäden befasst, die von einer Kommission erhoben werden. Es dauert Jahre, bis 1.551 niedergebrannte Häuser aufgebaut sind, 5.017 geraubte Pferde, 12.408 gestohlene Rinder sowie 2.401 weggetriebene Schafe ersetzt sind. Viel schlimmer ist der Verlust an Menschen: 3.513 wurden getötet oder entführt.
Die Bedrohung der Steiermark durch Bethlen Gabor (1619–1626)
Gabor Bethlen, von Sultan Murads IV. Gnaden Fürst von Siebenbürgen, ist erbitterter Gegner des Hauses Habsburg und überzeugter Calvinist. Als solcher nutzt er den zwischen Katholiken und Protestanten 1618 ausgebrochenen (Dreißigjährigen) Krieg: Um die Habsburger zu vertreiben und selbst König von Ungarn zu werden, paktiert er mit den protestantischen Böhmen und führt ihnen Truppen zu. Bereits im Frühjahr 1619 befürchtet man in der
Steiermark einen ungarisch-siebenbürgischen Angriff mit böhmischer Rückendeckung. Doch erst im Oktober werden geworbene Fußtruppen sowie Aufgebote aus den Landesvierteln Vorau und Zwischen Mur und Drau an der Grenze stationiert. Hauptquartier für die Musketiere ist Radkersburg, für die Landsknechte Feldbach und Fürstenfeld. Reiterkontingente können aus finanziellen Gründen vorerst nicht entsandt werden.
Im November 1619 rückt das böhmisch-ungarisch-siebenbürgische Heer gegen Wien vor. Die nur auf die eigene Landesverteidigung bedachten Steirer ignorieren den Hilferuf Kaiser Ferdinands II. und verweigern ihm jeden militärischen Beistand. Doch der Kaiser hat Glück: Ein Tatareneinfall in Siebenbürgen zwingt Gabor Bethlen zum Rückzug. Der am 16. Jänner 1620 zwischen Ferdinand II. und dem Fürsten geschlossene Waffenstillstand entspannt die Lage auch an der steirischen Grenze. Das nicht zum Einsatz gekommene Kriegsvolk wird entlassen.
Sorge breitet sich in der Oststeiermark aus, als Gabor Bethlen sich am 25. August 1620 von seinen Anhängern zum (Gegen-)König von Ungarn proklamieren lässt und daraufhin mit einem Heer Richtung Westen aufbricht. Am 6. Oktober erreicht er Güns/Köszeg, wo sich ihm der ungarische Magnat Ferenc II. Batthyany anschließt. Wieder muss die steirisch-ungarische Grenze durch Aufgebotssoldaten geschützt werden. Jene des „Dreißigsten Mannes“ stehen in Radkersburg und Fürstenfeld. Auch in Hartberg und Fürstenfeld werden Reiter stationiert. Doch auch im Herbst 1620 kommt kein Gegner. Das Kriegsgeschehen verlagert sich nämlich an die Donau und nach Böhmen. Letztlich führt die Niederlage der mit ihm verbündeten Böhmen am 8. November 1620 am Weißen Berg bei Prag nicht nur zur Isolation des Gabor Bethlen, sie bedeutet gleichzeitig auch das Ende der Gefährdung der Steiermark.
Neue Kämpfe zwischen kaiserlichen Truppen und Leuten Batthyanys entbrennen im Frühjahr 1621 nach dem Scheitern von Friedensverhandlungen in Ungarn. Und diesmal ist auch die Steiermark vom Krieg betroffen: Am 26. April überquert eine Reiterabteilung des Ferenc II. Batthyany die steirische Grenze und überfällt das Dorf Dechantskirchen. Der dortige Pfarrer Jakob Textor wird vom Kirchturm geworfen und dann erschlagen. Ein weiterer Bewohner kommt in den Flammen des brennenden Pfarrhofs ums Leben. Während ihres Rückzugs greifen die Ungarn zwei weitere (namentlich nicht bekannte) Dörfer an. Wie instabil die Lage ist, beweisen Übergriffe des auf kaiserlicher (!) Seite stehenden Grafen Tamas II. Erdödy. Seine Leute streifen am 20. und 21. Juni 1621 von Eberau
aus bis an die Lafnitz und entwenden den oststeirischen Bauern in der Umgebung von Neudau das Vieh. Die Reaktion der Steirer besteht in der Entsendung von je 30 Reitern und Musketieren nach Burgau. Im benachbarten Neudau quartiert Ortolf von Teuffenbach 16 Musketenschützen ein. Derlei Präventivmaßnahmen erweisen sich letztendlich als nutzlos. Am 24. Juni dringen rund 300 Ungarn in Unterrohr ein, plündern und verwüsten das ganze Dorf, treiben sämtliche Pferde und Kühe weg. Einer der ungarischen Anführer wird während des Raubzuges erschossen.
Die geschilderten Ereignisse in der Steiermark veranlassen die Grazer Verordneten zur Aufstellung zweier neuer Reiterkompanien. Damit stehen Anfang September 1621 insgesamt 2.500 Mann an der steirisch-ungarischen Grenze. Diese greifen nicht ein, als ungarisch-türkische Streifscharen im benachbarten niederösterreichischen Wechselgebiet etliche Ortschaften und Gehöfte niederbrennen und zahlreiche Personen verschleppen. Die Feindseligkeiten enden am 6. Jänner 1622 mit dem Friedensschluss von Nikolsburg/ Mikulov. Die Hälfte der Soldaten wird daraufhin abgedankt, den Rest belässt man vorsichtshalber bis Anfang August 1622 in oststeirischen Quartieren.
Noch zweimal, 1623 und 1626, versucht Gabor Bethlen durch Vertreibung des Hauses Habsburg ein „unabhängiges“ Ungarn zu schaffen. Seine Pläne scheitern nicht nur an der osmanischen Vormachtstellung im geteilten Ungarn, sondern auch an der Unzuverlässigkeit und an Niederlagen seiner Verbündeten.
Auch wenn nur einer der drei Kriege des Gabor Bethlen gegen Kaiser Ferdinand II. die Steiermark unmittelbar betrifft, so müssen doch für präventive Wehrmaßnahmen und Rekrutierungen enorme Geldsummen aufgebracht werden: Allein an Unterhalt für die geworbenen Soldaten fallen zwischen 1619 und 1622 nicht weniger als 377.557 Gulden an. Hinzu kommen die materiellen Schäden durch Plünderungen und im Kontext von Kampfhandlungen. Vor diesem Hintergrund wird die Nachricht vom Tod Bethlens am 15. November 1629 mit Erleichterung aufgenommen – nicht ahnend, dass das Land für lange Zeit von einer ernsthaften ungarischen Bedrohung verschont bleiben wird.
Der letzte Angriff aus dem Osmanischen Reich 1655
Offiziell besteht seit 1606 Frieden mit dem Osmanischen Reich. Der Frieden von Zsitva Torok, der den in historischen Geschichtswerken so bezeichneten „Dreizehnjährigen Türkenkrieg“ 1593–1606
beendet hat, wird mehrmals verlängert. Trotzdem ist die Steiermark von Übergriffen betroffen: Immer wieder unternimmt die Festungsbesatzung von Kanischa/Nagykanizsa, das anno 1600 von einem osmanischen Heer erobert worden ist, Streifzüge in die benachbarte Steiermark. Weil derlei Unternehmungen mit weniger als 3.000 Mann und ohne Einsatz von Geschützen erfolgen, gelten sie als „Tschetten“ und damit nicht als Friedensbruch. Um solchen Angriffen zu begegnen, stationiert die steirische Regierung Soldaten in den besonders gefährdeten Orten und bewaffnet sie aus dem Grazer Zeughaus. Darüber hinaus verlässt man sich auf die westungarischen Magnatenfamilien Batthyany und Zrinyi, die mit ihren Söldnern den Gegnern einigermaßen Paroli bieten. Dies rächt sich 1655: Damals weilen Adam I. Batthyany und Miklos VII. Zrinyi mit dem Großteil ihrer Husaren am ungarischen Landtag in Preßburg/Bratislava, weshalb nur wenige Verteidiger im Übermurgebiet stehen. Die Besatzung von Nagykanizsa nutzt diese Situation, um ab dem 26. Februar 1655 eine weitere Tschetta zu begehen. Ziel ist Radkersburg. Auf dem Weg dorthin überfällt sie die Dörfer Zelting und Kaltenbrunn/Čankova. Dabei kommen elf Personen ums Leben, 71 weitere werden über die nahe Grenze nach Ungarn verschleppt. Größeres Unheil verhindert ein unvermittelt einsetzendes Unwetter, das die Angreifer zum Rückzug zwingt.
Als am 1. März Landeshauptmann Johann Maximilian von Herberstein Nachricht vom Überfall erhält, fordert er kurzerhand den Grazer Hofkriegsrat zu raschem und energischem Handeln. Dadurch wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der in der ersten Märzwoche zur Einquartierung von Soldaten in Zelting, Radkersburg und den umliegenden Orten führt. Entlang der steirisch-ungarischen Grenze entstehen Verhackungen. Zu einem militärischen Gegenschlag kommt es nicht. Nachforschungen ergeben, dass der feindliche Rückzug nach Nagykanizsa nicht sofort nach dem Überfall erfolgt ist. Noch am 2. März harrt eine Schar im Wald südöstlich von Zelting auf steirischem Boden aus, und der Kommandant von Nagykanizsa droht unverhohlen mit weiteren Angriffen. Die aus Zelting und Kaltenbrunn verschleppten Menschen werden in Nagykanizsa eingesperrt, misshandelt und kommen erst gegen Lösegeld frei. Nur die wenigsten Rückkehrer lassen sich wieder in der alten Heimat nieder. Die meisten wählen eine Bleibe abseits der Grenze.
Der Überfall vom 26. Februar 1655 ist der letzte Angriff aus dem Osmanischen Reich auf steirischem Boden. Das heißt aber nicht, dass keine Gefahr mehr aus dem seit 1541 türkisch besetzten Mittelteil Ungarns besteht. Das beweisen die Ereignisse von 1663/ 1664 sowie 1683 deutlich.
ohne Grenzverletzung 1663/1664
Als das osmanische Heer 1663 unaufhaltsam Richtung Westen vordringt, breitet sich in der Steiermark Angst und Schrecken aus. Um für einen möglichen Angriff gewappnet zu sein, werden längst fällige Instandsetzungen an den Befestigungen von Radkersburg, Fürstenfeld und Graz vorgenommen, Soldaten werden rekrutiert, neue Waffen beschafft, Burgen und Städte mit Geschütz versehen. Die steirische Landbevölkerung sucht Schutz hinter den Mauern von Taboren, Schlössern und Festungen. Menschen machen sich mit ihrem Hausrat auf ins sicher scheinende Graz. Fürstenfeld sowie die Riegersburg, von Katharina Elisabeth von Galler in den Jahren zuvor zu einem uneinnehmbaren Bollwerk ausgebaut, sind voll mit Flüchtlingen. Jedoch der Feind kommt nicht. Erst verhindert der einbrechende Winter den gegnerischen Vormarsch, dann beendet am 1. August 1664 der Sieg des christlichen Koalitionsheeres unter Raimondo Montecuccoli bei Mogersdorf den Krieg.
Dass die Bedrohung aus dem Osmanischen Reich durch diesen militärischen Erfolg nicht nachhaltiger eingedämmt wird, liegt am Friedensschluss von Eisenburg/Vasvar, der am 10. August 1664 den Status quo und damit die bisherige Dreiteilung Ungarn auch für die Zukunft besiegelt. Speziell die ungarischen Magnaten und deren Untertanen zeigen sich mit den Bedingungen von Eisenburg unzufrieden – einer der Gründe für die Magnatenverschwörung gegen Kaiser Leopold I. (1669–1671) sowie für den Kuruzzenkrieg (1704–1711). Alle wirken später in militärischer Hinsicht auch auf die Steiermark ein.
Magnatenverschwörung gegen Kaiser Leopold I. (1669–1671)
Viele ungarische Magnaten, allen voran Petar IV. Zrinyi, Ferenc Kristóf Frankopan und Ferenc III. Nadasdy, zeigen sich über den Eisenburger Friedensschluss vom 10. August 1664 empört. Zudem fürchten sie einen wiederkehrenden Absolutismus und weitere Gegenreformation. Der Ausweg besteht aus ihrer Sicht in einer Verschwörung gegen Habsburg, deren Ziel die Etablierung eines neuen Königs sein soll. In ein vorentscheidendes Stadium tritt die Konspiration im September 1667, als sich der Görzer Landeshauptmann Karl von Thurn neben dem innerösterreichischen Regimentsrat Johann Erasmus von Tattenbach den ungarischen Verschwörern anschließen. Geplant ist nun – zur Eroberung und Besetzung wichtiger niederösterreichischer und steirischer Städte wie Pettau/Ptuj, Radkersburg, Fürstenfeld und Graz – auch die Beseitigung Kaiser Leopolds I. durch Mord.
Nachdem schon im Oktober 1666 eine Entführung des Monarchen gescheitert war, schlägt während des sogenannten „Pottendorfer Fischerfestes“ am 5. April 1668 auch ein Giftanschlag Nadasdys gegen Leopold I. fehl. Der Aufstand der Magnaten zeigt auch für die Steiermark Folgen – nicht nur hinsichtlich der Teilnahme Tattenbachs. Wenn auch nicht eindeutig erwiesen, dürften Husaren Petars IV. Zrinyi am 5. Dezember 1669 für einen Überfall auf Schloss Aichberg bei Hartberg verantwortlich sein. Obwohl noch im Frühjahr 1670 Warnungen vor weiteren ungarischen Einfällen einlangen und Zrinyi von Friedau/Ormož und Pettau/Ptuj die Huldigung verlangt, bleibt es ruhig. Anfang April 1670 erfolgt die Stationierung der kaiserlichen Regimenter Zoiß und Leslie im Grenzgebiet um Pettau/Ptuj, Radkersburg und Fürstenfeld. Außerdem erhält jeder dieser Orte 400 Musketen samt Pantelieren, Pulver, Blei und Lunten sowie 100 Piken. Wenige Tage später, am 13. April 1670, dringen die beiden Regimenter zusammen mit Söldnern von der Militärgrenze in die Zrinyi gehörige Murinsel in Kroatien ein. Genommen werden die Festungen Legrad, Kotoriba und Tschakathurn/Čakovec. Zrinyi und Frankopan geraten in Gefangenschaft.
Die Verschwörung scheitert nicht zuletzt an zu geringer Entschlossenheit der Magnaten, sondern auch an zu großer Mitwisserschaft. Sogar aus dem Osmanischen Reich gelangt eine Warnung vor der ungarischen Untreue nach Wien. Obwohl über die Pläne der Verschwörer informiert, warten die habsburgischen Behörden zu, weil vor allem Petar IV. Zrinyi zwischen Unterwerfung und weiterem Widerstand schwankt. Als aber im Frühjahr 1670 in Ost- und Oberungarn sowie in Kroatien Kämpfe der Aufständischen mit kaiserlichen Truppen ausbrechen, findet die bisherige Nachsicht ein Ende. Die oben geschilderte Einnahme der Murinsel und die Verhaftung der beiden Grafen sind die Folge. Der Niederwerfung der offenen Rebellion folgt am 3. September 1670 die Verhaftung auch des Ferenc III. Nadasdy. Der steirische Mitverschwörer Johann Erasmus von Tattenbach wird bereits am 22. März 1670 festgenommen. Nach langwierigen Verhandlungen und Untersuchungen fallen die Köpfe der Verschwörer: Am 30. April 1671 werden Frankopan und Zrinyi in Wiener Neustadt hingerichtet. Die Hinrichtung von Johann Erasmus von Tattenbach erfolgt am 1. Dezember 1671 in Graz. Die Mitläufer an der Verschwörung fallen Güterkonfiskationen, Ehrenund Geldstrafen anheim. Graf Karl von Thurn beendet sein Leben im März 1689 als Gefangener in der Grazer Schloßbergfestung.
Das Jahr 1683
Der nach der Schlacht von St. Gotthard-Mogerdorf 1664 in isenburg/Vasvar vereinbarte Frieden ist für die Dauer von 20 Jahren geschlossen worden. Obwohl diese Zeitspanne noch nicht abgelaufen ist, führt Großwesir Kara Mustafa eigenmächtig ein gewaltiges Heer gegen Wien und beginnt am 14. Juli 1683 mit dessen Belagerung. In der Steiermark werden die Ereignisse mit Sorge beobachtet: Die Ostgrenze wird mit Regimentern besetzt, die oststeirischen Schlösser, Burgen, Klöster, Städte und Märkte werden mit Waffen aus dem landschaftlichen Zeughaus in Graz ausgestattet. Anders reagiert der bisher kaisertreue ungarische Magnat Kristóf II. Batthyany: Um seine Güter zu schützen, huldigt er am 11. Juli den Türken. Außerdem kündigt er an, Grenzverletzungen durch steirische Truppen mit Streifzügen in die Steiermark zu beantworten. Die Regierung in Graz beruhigt Batthyany mit dem Versprechen, keine Soldaten auf ungarischen Boden zu entsenden. Frieden und gute Nachbarschaft seien beiden Seiten wichtig. Das Abkommen erweist sich rasch als wertlos. Bereits am 16. Juli plündern Untertanen Batthyanys das Dorf Wagerberg, Fürstenfeld wird zur Huldigung aufgefordert und mit Mord und Brand bedroht. Eine persönliche Intervention des Stadtrichters Georg Schedenegg bei Batthyany in Güssing kann das Unheil abwenden. Weniger gut ergeht es anderen Orten: Am 18. Juli brennen in der Umgebung Hartbergs acht Dörfer sowie Schloss Aichberg. Zuflucht findet die Bevölkerung in Hartberg, Stift Vorau, auf der Festenburg sowie in Burg Thalberg. Mit der Stationierung der Reiterregimenter Metternich und Saurau an der Grenze kehrt vorübergehend Ruhe ein. Karl von Saurau begeht jedoch den Fehler, als Vergeltung für den Einfall vom 16. bis 18. Juli mit seinen Arkebusierreitern auf ungarischen Boden vorzudringen. Die Antwort gibt Batthyany nach dem Abzug der Regimenter Richtung Wien. Am 22. August schickt er Söldner gegen Rudersdorf und Speltenbach, sogar Fürstenfeld will er angreifen lassen. Das Unternehmen scheitert, weil die durch Warnschüsse alarmierten Regimenter umkehren, ihrerseits 300 Ungarn töten und Rudersdorf sowie Deutsch Kaltenbrunn anzünden.
Im Rahmen einer in Graz einberufenen Konferenz am 3. September 1683 werden intensiv weitere Wehrmaßnahmen besprochen, doch alle Vorsorge nutzt wenig. Bereits vier Tage später plündern die Leute Batthyanys die Dörfer Oberrohr und Unterrohr und verschleppen von dort etwa 150 Personen. Im Gegenzug setzen die Steirer am Abend des 8. September die Regimenter Saurau, Aspremont und Metternich in Richtung Ungarn in Marsch. Ziel ist der Batthyany gehörige Markt Pinkafeld, der in Flammen aufgeht. Für die Dauer
des Feldzugs übernehmen 4.000 kroatische Söldner von der Militärgrenze den Schutz der östlichen Steiermark. Einen sehr zweifelhaften Schutz! Anstatt gegen die Rebellen vorzugehen, berauben sie heimische Passanten.
Unmittelbar nach Bekanntwerden der Niederlage der osmanischen Armee vor Wien am 12. September 1683 vollzieht Kristóf II. Batthyany eine radikale Kehrtwendung. Er bittet um Vergebung und bietet der steirischen Landschaft seine Dienste an. Zusammen mit steirischen Truppen besiegen Batthyanys Husaren am 17. September bei Körmend 300 Türken.
Eine germanisierende Politik und die religiöse Bevormundung reizen den siebenbürgischen Fürsten Ferenc II. Rakoczi zum militärischen Aufstand gegen Habsburg. Seine als „Kuruzzen“ bezeichneten Anhänger greifen ab 1704 die heutige Steiermark an, um dadurch militärische Kräfte des Hauses Habsburg zu binden und sie dem im Westen Europas tobenden Spanischen Erbfolgekrieg zu entziehen. Von einer Niederlage der kaiserlichen Armeen erhofft sich Rakoczi die Unabhängigkeit Ungarns und Siebenbürgens.
Am 12. Februar 1704 verwüsten die Kuruzzen die Umgebung von Friedau/Ormož, 31 Dörfer gehen in Flammen auf. Erst Anfang März können die Aufständischen zurückgedrängt werden. Um weitere Angriffe zu unterbinden oder wenigstens zu erschweren, beginnt man mit dem Bau einer Kette von Wehranlagen entlang der Kutschenitza und der Lafnitz bis nach Friedberg. Zusätzlich wird das Landesaufgebot in den Vierteln Vorau und Zwischen Mur und Drau einberufen. Am 28. Juni bricht die Truppe von Radkersburg auf und gelangt bis Mogersdorf, wo sie am 4. Juli gegen die von Alexander Karolyi befehligten Kuruzzen eine vernichtende Niederlage erleidet. Die Nachricht von der Niederlage bei Mogersdorf ruft zwar Angst und Schrecken hervor, sie bestärkt aber auch den allgemeinen Wehrwillen. Eine der Konsequenzen ist die endgültige Abschaffung der steirischen Landesaufgebote. Fortan werden die aufgebotenen Personen der kaiserlichen Armee eingegliedert.
Bald zeigt sich, dass die noch nicht fertiggestellten Wehranlagen –Tschardaken, Gräben und Wälle – entlang der steirisch-ungarischen Grenze weitere Einfälle der Kuruzzen nicht aufhalten können.
Der Plünderung von Schloss Burgau am 23. Juli 1704 folgt die Verwüstung des Gebietes zwischen Feldbach, Hartberg, Sinabelkirchen und Pischelsdorf. Nicht weniger als 62 Dörfer werden
niedergebrannt oder ausgeraubt. Selbst das befestigte Schloss Untermayerhofen kann den Angriffen nicht standhalten. Hoffnung in der leidgeprüften Bevölkerung erweckt das Eintreffen kroatischer Truppen unter Janos Palffy am 6. August. Doch auch diese können einen Überfall der Kuruzzen auf 13 Dörfer nördlich von Hartberg tags darauf nicht verhindern. Die Reaktion der Steirer besteht in zwei Streifzügen in heute burgenländisches Gebiet. Nach den Ereignissen der ersten Jahreshälfte 1704 beruhigt sich die Lage, weshalb mit dem Wiederaufbau der zerstörten Gehöfte und Orte begonnen werden kann. Die Schuld an der Misere kreiden die schwer geschädigten Bauern dem mangelnden Wehrwillen ihrer meist geflohenen Grundherrn an. Die noch anwesenden sollen zur Teilnahme an der Verteidigung gezwungen werden. Einer der Adeligen, Graf Wolf Friedrich von Wurmbrand, widersetzt sich und wird von seinen eigenen Untertanen am 6. August 1704 ermordet. Weil jenseits der Lafnitz unablässig mehrere Tausend Rebellen streifen, erhalten die wichtigsten steirischen Grenzorte Besatzungen. Friedenshoffnungen schürt ein Ende Oktober 1704 geschlossener Waffenstillstand, der allerdings mit den gescheiterten Verhandlungen zwischen Ferenc II. Rakoczi und Kaiser Leopold I. ein rasches Ende findet. Immerhin blieb die Steiermark während des ganzen Jahres 1705 von Übergriffen verschont. Das Kriegsgeschehen verlagert sich nach Niederösterreich, Mähren und in die heutige Slowakei.
Verheißungsvoll beginnt das Jahr 1706. Generalfeldwachtmeister Hannibal von Heister erringt mit seiner Truppe am 18. März bei Körmend einen Sieg über die Kuruzzen, der jedoch durch den verfrühten Abzug Heisters zunichtewird. Die Folge ist ein Vergeltungsschlag der Rebellen unter Führung des Mihaly Csaky und des György Kis. Allein am 31. März 1706 fallen ihrem verheerenden Raub- und Plünderungszug in die Gegend um St. Anna am Aigen 53 Dörfer sowie an die 600 Bauernhöfe, Keuschen und Winzerhäuser zum Opfer. Nur das befestigte Straden kann erfolgreich verteidigt werden. Betroffen ist ein Gebiet von 300 (!) Quadratkilometern.
Entspannung bringt ein von Kaiser Joseph I. abgesegneter Waffenstillstand mit den Kuruzzen. Das Abkommen verschafft Zeit für die Planung und teilweise Realisierung neuer Verteidigungslinien. So entstehen zwischen Radkersburg und St. Anna am Aigen bis Oktober 1706 eine Schanze, der sogenannte Kuruzzenwall, und zahlreiche Tschardaken. Temporären Schutz bietet die Rückberufung der kaiserlichen Miliz unter Hannibal Heister und Janos Palffy. Neues Unheil beginnt aber mit der Abkommandierung dieser Truppe Ende Juli 1706 nach Ödenburg/Sopron. Denn kurz darauf wiederholt sich der Kuruzzeneinfall vom Frühjahr. Abermals betroffen ist
das Gebiet um Straden, in dem am 10. und 11. August 42 Dörfer in Brand gesteckt werden. Wiederum wird geraubt und Vieh weggetrieben. Viele Orte sind damit dem Wüten der Kuruzzen innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal zum Opfer gefallen. Wieder muss Aufbauarbeit geleistet werden. Möglich ist sie, weil sich das Kriegsgeschehen abermals nach Niederösterreich und Ungarn verlagert. Wenige Monate später, am 6. November 1706, eröffnet eine Niederlage der Truppen des Hannibal Heister bei Egervár den Kuruzzen unter Janos Bezeredy die Möglichkeit zu einem weiteren Angriff auf die Oststeiermark: Am 21. Jänner 1707 legt seine Truppe im Grenzgebiet an der Lafnitz 13 Dörfer in Schutt und Asche. Der vermeintliche Schutz durch „Tolpatschen“ genannte Söldner, die in größeren Grenzorten stationiert sind, ist wirkungslos: Sie ergreifen beim Erscheinen der Kuruzzen genauso die Flucht wie die ortsansässige Bevölkerung. Eine Verbesserung der Lage ergibt sich erst mit dem Eintreffen einer neuen kaiserlichen Truppe unter Feldmarschallleutnant Johann Ludwig Rabutin de Bussy an der Grenze.
Ferenc II. Rakoczi setzt nicht nur auf militärische Schläge, er setzt auch einen politischen Schritt: Am 8. Juni 1707 erklärt er das Haus Habsburg in Ungarn für abgesetzt und bietet die ungarische Krone dem bayrischen Kurfürsten Maximilian II. Emanuel an.
Damit bricht Rakoczi alle diplomatischen Brücken ab und beschwört eine militärische Lösung des Konflikts herauf. So lässt der nächste schwarze Tag für die Steiermark nicht lange auf sich warten. Am 27. August 1707 dringen etwa 4.000 Kuruzzen von Stegersbach her Richtung Neudau vor, zerstören im Ort 17 seit dem Jännereinfall wiederaufgebaute Häuser und zünden nordwestlich von Neudau 18 Ortschaften an. Lediglich Burgau kann nicht eingenommen werden. Gerüchte über einen weiteren Kuruzzeneinfall bewahrheiten sich am 11. November. Betroffen ist diesmal das Gebiet zwischen Friedberg und Hartberg, in dem 14 Dörfer beraubt und teilweise verbrannt werden. Die Rebellen haben leichtes Spiel, da beinahe alle Grenzgarnisonen zu einer konzertierten Militäraktion gegen Rakoczi nach Ungarn abkommandiert sind. Das ersatzweise gerufene Regiment Breuner ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetroffen. So können bereits am 3. Dezember 1707 etwa 1.200 berittene Rebellen die schlecht besetzten Verhacke und Schanzen östlich von Radkersburg überwinden und die Dörfer Dedenitz, Hummersdorf, Laafeld, Sicheldorf und Zelting ausrauben. Die in Radkersburg stationierte Garnison sieht dem Treiben untätig zu. Drei Tage später wiederholt sich das Szenario. Widerstand gibt es mangels Söldnern und Munition kaum noch, die Bevölkerung ist geflüchtet. Das Ersuchen der Geschädigten um Hilfe lehnt die
steirische Landschaft schlichtweg ab, weil das Regiment Breuner inzwischen im Grenzgebiet eingetroffen ist.
Im Jahr 1708 erfolgen weniger Überfälle auf steirisches Gebiet, wofür es zwei Gründe gibt: Zum einen breitet sich bei den Kuruzzen eine gewisse Kriegsmüdigkeit aus, zum anderen bindet ein Feldzug kaiserlicher Truppen unter Siegbert Heister in der heutigen Slowakei ihre Kräfte. Am 2. August 1708 erleiden sie bei Trentschin/ Trenčin eine bedeutsame Niederlage, die die Truppen Rakoczis deutlich schwächt. Selbst Siebenbürgen, das Stammland Rakoczis, gerät fest in kaiserliche Hand. Trotzdem geht der Partisanenkampf der ungarischen Rebellen, nun unter der Leitung des Antal Eszterhazy, weiter. Oberst Johann Ludwig von Moltenberg, der das Regiment Breuner inzwischen abgelöst hat, lässt die Grenze besser bewachen und organisiert zwischen dem 7. und dem 15. September 1708 einen erfolglosen Streifzug nach Ungarn. Ein Monat später, am 14. Oktober, folgt der Gegenschlag. Mit 6.000 bis 8.000 Mann verwüstet Eszterhazy Neudau. Oberst Moltenberg wagt wegen der großen Zahl der Kuruzzen kein Eingreifen, blockiert aber die Wege ins steirische Landesinnere. Eszterhazy erweist sich als hartnäckiger und beweglicher Gegner. Zwischen dem 17. Oktober 1708 und dem 14. Jänner 1709 fallen ihm das Dorf Wörth, die weiter südlich gelegene Umgebung der Stadt Luttenberg/Ljutomer sowie einige Dörfer an der Mur zum Opfer. Die Stationierung von Dragonern entlang des Flusses hilft nichts. Erst als die Rebellentruppen des Antal Eszterhazy abziehen und sich dem Kuruzzenheer des Janos Bottyan nördlich der Donau anschließen, bleibt die Steiermark für etliche Monate unbehelligt. Am 8. Juli 1709 unternehmen dann neue Kuruzzenscharen einen abermaligen Einfall ins Gebiet zwischen Fehring und St. Anna am Aigen, woran die sogenannte „Kuruzzenkapelle“ in Maierdorf bei Gnas erinnert. Zu Monatsende folgen noch Viehdiebstähle bei Friedberg und Hartberg. Ein letztes Mal betreten die Rebellen am 8. September 1709 die Steiermark anlässlich eines Überfalls auf Schloss Neudau.
Die zeitgleichen Erfolge der kaiserlichen Armee unter Siegbert Heister und Janos Palffy 1709 in Ungarn bewirken die Niederschlagung der Rebellion südlich der Donau und verdeutlichen, dass der Stern Rakoczis im Sinken ist. Länger dauern die Auseinandersetzungen in Oberungarn (der heutigen Slowakei) an. Sie ziehen sich bis in den Jänner 1711 hin. Politisch beendet der Frieden von Szatmar/Satu Mare den Krieg am 29. April dieses Jahres. Ferenc II. Rakoczi flieht nach Istanbul, wo er 1735 stirbt.
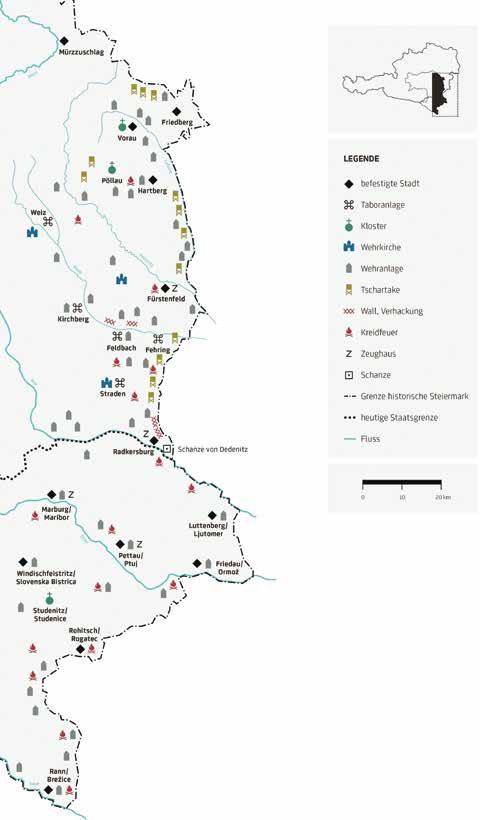
Wehrtechnische Anlagen in der Ost- und Südoststeiermark um 1800, Grafik: © UMJ, Katharina Schwarz, 2021.
Von der Landesstraße L146 in Richtung Schäffern zweigt links eine schmale Straße nach Karnegg ab. An dieser ist nach einigen Kurven und einer markanten Spitzkehre linkerhand die Ruine der Nikolauskirche und bald darauf ebenfalls linkerhand ein Marterl zu sehen. Neben diesem Marterl verweist eine Informationstafel auf die ehemals stolze Festung Bärnegg in der Elsenau, heute eine stark verfallene Ruine. Zu ebendieser führt direkt gegenüber rechts von der Straße abgehend ein Forstweg hinauf. Seit dem 19. Jahrhundert dem Verfall preisgegeben, ist die Ruine Bärnegg ziemlich verwachsen und kann wegen Einsturzgefahr nur von außen bzw. im Winter nur aus der Ferne besichtigt werden.
Die Burg Bärnegg wird im 12. Jahrhundert als wichtiges Glied in einer ganzen Kette von Burgen gegen die Ungarn errichtet. Die Reste dreier Türme verweisen auf eine einst stattliche Wehranlage. Bereits seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert findet sich Bärnegg im Besitz der ritterlichen Familie Perner von Schachen und bleibt es mit einer Unterbrechung nach
der Baumkircherfehde bis 1550. Während der Auseinandersetzung des Andreas Baumkircher mit Kaiser Friedrich III. zählt Wilhelm Perner zu den Anhängern des Fehdeführers und verliert deshalb Bärnegg. Ungeachtet mehrerer Gesuche seines Sohnes und Enkels bleibt die Burg in kaiserlicher Hand und wird erst 1529 an Niklas Perner zurückgegeben.
Bald nach der Rückgabe sieht sich dieser mit Truppen aus dem Osmanischen Reich konfrontiert. 1532, nach einem vorzeitig abgebrochenen Feldzug des türkischen Sultans Suleiman I. Richtung Wien, zieht sich dessen Heer nach der Belagerung der ungarischen Stadt Güns/ Köszeg zurück. Von einem Nachtlager in Kogl bei Pilgersdorf (im heutigen Burgenland) kommend, überschreiten die feindlichen Scharen am 4. September die steirisch-ungarische Grenze und plündern als Erstes die Umgebung von Bärnegg in der Elsenau. Dabei dürfte auch die Burg einige Schäden erlitten haben, denn sie erfährt bald darauf einige bauliche Erweiterungen. Den folgenden Marsch seines Heeres durch die Oststeiermark hält Suleiman I. in einem Kriegstagebuch fest.



1571 fällt Bärnegg an Michael Rindmaul, dessen Familie die Burg bis 1798 innehat. Während ihrer Herrschaftszeit ist die Oststeiermark vom Kuruzzenkrieg 1704 bis 1709 schwer betroffen. Auch Bärnegg wird drei Mal von den Rebellen angegriffen, der schlimmste Angriff ereignet sich am 11. November 1707: Fast alle Bauernhöfe rund um die Burg werden niedergebrannt, die Burg selbst geplündert. Weitere 13 Dörfer in der Umgebung werden ebenfalls attackiert. Ihren wehrhaften Charakter verliert Bärnegg 1720. Sigmund Albrecht von Rindsmaul (1687–1745) lässt die Burg damals zu einem Wohnschloss umbauen.
Weithin bekannt ist die Geschichte der Gefangennahme des englischen Königs Richard Löwenherz durch Gefolgsleute von Herzog Leopold V. von Österreich 1192 nahe Wien. Weniger bekannt ist, was mit dem für Richard gezahlten Lösegeld passiert: Mit dem auf Herzog Leopold fallenden Anteil werden 1194 Wiener Neustadt und Friedberg errichtet. Friedberg wird an der Ostgrenze der Steiermark
als Grenzfestung angelegt. Oberhalb der Stadt entsteht eine Burg zur Sicherung der Stadt. Im Laufe ihrer Geschichte entwickelt sich diese durch Erweiterungen und Umbauen vom mittelalterlichen Wehrbau zur prachtvollen Schlossanlage.
Den ersten feindlichen Angriff im Beobachtungszeitraum dieses Buches erfährt der Ort 1418. Bei Auseinandersetzungen zwischen Herzog Ernst der Eiserne und dem deutschen und ungarischen König Sigismund von Luxemburg fallen magyarische Truppen im Frühjahr in die Oststeiermark ein und verwüsten die zugehörigen Dörfer fast aller Pfarren. Welche Schäden in Friedberg damals zu beklagen sind, ist nicht überliefert.
Die Baumkircherfehde 1469–1471 trifft Friedberg nur am Rande. Das gilt jedoch nicht für die beiden Kriegszüge des türkischen Sultans Suleiman I. im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. 1529 zieht dessen Hauptheer, das die Belagerung Wiens am 15. Oktober aufgegeben hat, über Ungarn ab, doch die Nachhut wählt ihren Weg über die östliche Steiermark. Ihre ersten Angriffe am 19. Oktober gelten Friedberg und der → Festenburg. Was folgt, ist eine fast flächendeckende Verheerung der Orte südostwärts bis → Neudau.
1532, nur drei Jahre später, hinterlässt das osmanische Heer nach dem abgebrochenen Feldzug gegen Wien wiederum eine Spur der Verwüstung in der Region. Bereits am 4. September greifen die Osmanen → Bärnegg

Blick von der ehem. Burganlage auf Friedberg mit der Pfarrkirche

Burgen bauen
Der Begriff „Burg“ wird seit der Antike unter anderem zur Bezeichnung bewohnter Wehrbauten oder von Fluchtorten auf befestigten Anhöhen genutzt. Im Verlauf des Mittelalters entstehen in der Steiermark zahlreiche solcher Anlagen. Sie sichern Siedlungen und Verkehrswege. Sie sind Orte der Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Mit dem ausgehenden Mittelalter endet ihre Zeit. Burgen halten den neuen Feuerwaffen nicht mehr stand, viele verfallen. Die Herren über Grund und Boden wohnen fortan in repräsentativen und leichter erreichbaren Schlössern und Landsitzen. Die Adaption einer mittelalterlichen Burg im Hinblick auf neue Bedrohungslagen und Waffentechnik bildet die Ausnahme. Die oststeirische Riegersburg ist eine davon.
in der Elsenau an und verheeren noch am gleichen Tag Friedberg. Der Eintrag im Kriegstagebuch verherrlicht ein Massaker: „Nachdem nun beschlossen worden, die welterobernden Fahnen in diese Gegend zu tragen, schlug der glorreichste Kaiser (dessen Regierung ewig dauern möge) am 4ten Ssafar sein glückliches Gezelt nahe am Schlosse Friedberg auf. Da die darin eingeschlossenen, zur Hölle bestimmten Ungläubigen sich zu unterwerfen weigerten, liefen einige löwenmütige Tapfere ohne Verzug Sturm, verbrannten in einem Augenblicke die Tore, opferten die Höllenhunde dem Säbel und reinigten den Ort von ihren Körpern.“
Im Frühsommer 1605 plündern die Haiduken Friedberg, bevor sie über die nahe Grenze nach Ungarn zurückkehren. Vom Kuruzzenkrieg hundert Jahre später ist Friedberg zunächst nicht betroffen, was mit Verhackungen und Tschardaken entlang der Lafnitz zu tun haben könnte. Zwar nähern sich die Rebellen in den Jahren ab 1704 mehrmals, Friedberg selbst greifen sie aber nicht an. Das ändert sich am 11. November 1707: Gewarnt durch Gerüchte über einen bevorstehenden Einfall der Kuruzzen zwischen Hartberg und Friedberg, bringt sich die lokale Bevölkerung erfolgreich auf der Burg in Sicherheit. Die Kuruzzen ziehen sich für weitere Überfälle nach
Süden zurück. Zu einer Grenzverletzung und Viehdiebstählen bei Friedberg kommt es erst wieder am 16. Juli 1709. Es ist eine der letzten Aktionen der mittlerweile kriegsmüden und militärisch geschwächten Kuruzzen.
Im 18. Jahrhundert verfällt die Burg und wird abgetragen, Restgebäude stehen bis ins 20. Jahrhundert. Nach archäologischen Untersuchungen kann man sich heute auf dem „Erlebnisberg“ über die Geschichte des Ortes informieren.
1155 wird Dechantskirchen an der Wechselstraße unter der Bezeichnung „in villa Techanschirche“ erstmals urkundlich genannt. Von den Konflikten des 15. Jahrhunderts im oststeirischen Grenzland bleibt es verschont. Eine Ausnahme stellt das Jahr 1418 mit dem später fälschlicherweise als „Türkeneinfall“ dargestellten ungarischen Angriff dar: Im Frühling dieses Jahres geraten fast alle oststeirischen Pfarren in die Auseinandersetzung zwischen dem steirischen Herzog Ernst dem Eisernen und dem deutschen und ungarischen König Sigismund. Sie werden von ungarischer Seite angegriffen, darunter auch Dechantskirchen.
Nicht besser als sämtlichen umliegenden Orten ergeht es Dechantskirchen dann im Jahr 1529. Nach erfolgloser Belagerung Wiens zieht eine Nachhut des türkischen Hauptheeres im Herbst über den Wechsel durch die Steiermark Richtung Osmanisches Reich. Von Angriffen und Plünderungen ist am 21. Oktober auch die Bevölkerung von Dechantskirchen betroffen.
Drei Jahre später wiederholt sich das Szenario, als Suleiman I. sein Ziel, Wien zu erobern, abermals nicht erreicht. Vor Güns/Köszeg lange aufgehalten, führt er diesmal sein gesamtes Heer persönlich durch die Steiermark. Am 5. September 1532 plündern seine Leute Dechantskirchen. Bevor sie vorbei an Graz nach Marburg/Maribor zurück in osmanisch kontrollierte Gebiete ziehen, schlagen sie hier auch ein Lager auf: „Donnerstag den 5. Ssafer

lagerte man an dem Orte Dehan in dem Passe der fortgesetzten Bergschlucht des Schlosses Kogel (Kogl bei Pilgersdorf). Hier begann großes Gebirge, und man stand unbeschreibliche Beschwerlichkeiten aus, welche eine Probe von dem Ende der Welt schien.“
In den Jahren zwischen 1619 und 1626 unternimmt der siebenbürgische Fürst Gabor Bethlen drei Versuche, das Haus Habsburg vom ungarischen Königsthron zu stürzen und selbst König zu werden. Dabei sichert er sich den Beistand der ebenfalls gegen Habsburg opponierenden Böhmen sowie des ungarischen Magnaten Ferenc II. Batthyany. Am 26. April 1621 überqueren Reiter Batthyanys die steirische Grenze und überfallen den Pfarrort Dechantskirchen, was nachweislich zwei Todesopfer fordert: Der Chronist Aquilin Julius Caesar berichtet, „daß Herr Jakob Textor, Pfarrer der uralten Pfarr zu Dechantskirchen von diesen hungarischen Rebellen gefangen, von dem Kirchthurme gestürzet […] sey“. Aus einem Fenster geworfen, bleibt der Geistliche schwer verletzt am Friedhof liegen, wird aus dem

Kirchhof gezerrt und anschließend erschlagen, was das Sterbebuch Vorau 1595–1700 wie folgt bestätigt: „Den 26 Aprilis ist Herr Jacob Textor Can(onicus) Vorau(iensis) vnd Vicarius zu Dechantskirchn selliger von dennen Rebellischen Vngern auff dem Freithoff daselbst erstlich tötlich verwundt, dan ausser des Freithoffs gar erschlagen, vnd den 27 dits begraben vnd eingesegnet wordten.“ Jakob Textor (lat., dt.: „Weber“) wird tags darauf in Vorau bestattet, ist aber nicht das einzige Opfer an diesem Tag. Eine zweite, namentlich nicht bekannte Person kommt in den Flammen des angezündeten Pfarrhofs ums Leben.
Auch wenn keine detaillierten Berichte über Dechantskirchen zur Zeit der Haidukeneinfälle 1605 und des Kuruzzenkriegs (1704–1709) vorliegen, dürfte die lokale Bevölkerung davon betroffen gewesen sein: Als die Haiduken nach erfolgloser Bestürmung → Hartbergs am 4. Juni 1605 Richtung Nordosten ziehen und dabei → Thalberg und → Friedberg schädigen, ist das dazwischen liegende Dechantskirchen wohl auch geplündert worden. Ähnliches gilt für den 11. November 1707, an dem die Kuruzzen einen Raubzug ins Gebiet zwischen Hartberg und Friedberg unternehmen.
Bedingt durch die geringe Entfernung von etwa 2 Kilometern zwischen → Dechantskirchen und Thalberg, unterscheidet sich die Geschichte der beiden Orte nicht wesentlich voneinander. Einen unschätzbaren Vorteil besitzt Thalberg aber doch: Die starke Festung bietet der Bevölkerung im Bedarfsfall Schutz und Zuflucht.
Thalberg wird zwischen 1171 und 1180 von den Herren von Krumbach erbaut und 1209 erstmals urkundlich genannt.
Ab 1480 besetzen die Ungarn im Krieg zwischen Kaiser Friedrich III. und König Matyas Corvinus über zehn Jahre lang weite Teile der Steiermark. Hans III. von Neuberg, dessen Familie Thalberg seit der Mitte des 15. Jahrhunderts besitzt, läuft auf die ungarische Seite über und liefert etliche oststeirische Herrschaften aus. Sein Stammschloss → Neuberg sowie → Pöllau und Thalberg behält er selbst. Zunächst machtlos, nutzt der erzürnte Kaiser 1485 eine Kriegspause in der Oststeiermark und veranlasst eine Strafexpedition gegen die Erben des am 22. Oktober 1483 verstorbenen Hans III. von Neuberg. Am 17. April zieht Friedrich III. in → Neuberg, → Pöllau und Thalberg ein. Letzteres gibt er als Lehen an die Familie Rottal weiter, die die Burg 1499 durch die Errichtung einer Vorburg wesentlich erweitert.
Die folgende Besitzerfamilie Dietrichstein vergrößert ab 1523 die Herrschaft und macht Thalberg zu einem Zentrum des Protestantismus.

Jedenfalls wiederholt betroffen von den Überfällen und Angriffen ist die Kirche des Ortes. Teils umfangreiche Baumaßnahmen im 15., 16. und 18. Jahrhundert lassen darauf schließen. Die heutige Erscheinung der Kirche verdankt sich Renovierungen im 19. und 20. Jahrhundert. Halbmonde mit Stern auf den Dachreitern der Vorburg

Sie sieht sich aber auch mit Truppen aus dem Osmanischen Reich konfrontiert. Während die Ortschaften → Dechantskirchen und Thalberg 1529 geplündert werden, kann sich die Burg Thalberg halten. Auf den Dachreitern der Vorburg (1499 errichtet) erinnern eiserne Halbmonde mit Stern an die Ereignisse von damals. Das gleiche Schicksal ereilt die beiden Siedlungen drei Jahre später. Am 5. September 1532 brennt Thalberg, die Burg selbst wird nicht angegriffen.
Zwischen 1557 und 1610 sind gleich fünf verschiedene Eigentümer Thalbergs belegt. Als aggressiv soll sich Andreas Eberhard Rauber erwiesen haben, nachdem er Thalberg 1603 aus wirtschaftlichen Gründen an Wolfgang Unverzagt verkauft hat. Weil er sich mit dem Verlust nicht abfinden kann, soll er versucht haben, die Burg mit Gewalt zurückzuholen. Tatsächlich ereignet sich ein blutig zurückgeschlagener Angriff am 4. Juni 1605, dieser wird jedoch den Haiduken angelastet.
Fünf Jahre später kaufen die Grazer Jesuiten die intakte Festung. Als 1683 – bedingt durch
den Verrat des Kristóf II. Batthyany – ungarische Söldner plündernd durch die nördliche Oststeiermark ziehen, findet die Bevölkerung dort Schutz. Gleiches gilt für die Zeit des Kuruzzenkriegs zwischen 1704 und 1709: Die Burg selbst wird dank ihrer mächtigen Wehranlagen nie angegriffen und dient als sicherer Zufluchtsort. Ganz besonders gilt dies auch während jenes Raubzuges, den die Kuruzzen am 11. November 1707 im Gebiet zwischen → Hartberg und → Friedberg verüben.
Die Jesuiten bleiben bis zur Aufhebung ihres Ordens 1773 in Besitz von Thalberg. Danach fällt die Burg an den Staat und gelangt 1797 nach einer öffentlichen Versteigung in rasch wechselnde private Hände.
Im Gegensatz zu den Dörfern der Umgebung, bleibt die um 1200 im Auftrag der Familie Stubenberg errichtete Festenburg auf einem Felssporn am Fuße des Hochwechsels von kriegerischen Ereignissen weitgehend verschont. Im frühen 16. Jahrhundert ist die topografisch




abgeschiedene Burg dann gleich zweimal hintereinander von Angriffen betroffen. Am 19. Oktober 1529 attackiert die Nachhut des von Wien abziehenden türkischen Heeres die jetzt der Familie Saurau gehörige Burg, die verteidigt werden kann. Zwei im Torbereich der Festenburg als Spolien verbaute Kanonenkugeln mit der eingeritzten Jahreszahl „1529“ erinnern an das Ereignis.
Drei Jahre später wiederholen sich die Geschehnisse. Zwischen dem 4. und dem 10. September 1532 zieht wieder ein osmanisches Heer durch das oststeirische Grenzland und brennt die Dörfer in der Umgebung nieder. Am 4. September kann ein Angriff auf die Festung selbst abgewehrt werden.
Seit 1616 befindet sich die Festenburg im Besitz des Stiftes Vorau und wird zu einer Klosterburg umgebaut. Dies macht sich bezahlt: Als am 18. Juli 1683 der ungarische Magnat Kristóf II. Batthyany ihr Umland überfallen lässt, dient die Festenburg der Landbevölkerung als Zufluchtsort.
6. Vorau
Neben Burgen und befestigten Städten bzw. Märkten finden sich in der Steiermark auch zahlreiche Sakralbauten, die mit ihren schützenden Mauern und Nebengebäuden als „Wehrkirchen“ und „Wehrklöster“ gedient haben. Im oststeirischen Grenzland zählen dazu → Grafendorf und → Dechantskirchen sowie → Pöllau und Vorau.
Das Augustinerchorherrenstift Vorau wird 1163 zwischen dem Wechselmassiv und dem Masenberg gegründet. Stark befestigt, ist es selten gegnerischen Angriffen ausgesetzt. Im Jahr 1453 erhält Propst Leonhard von Horn von Kaiser Friedrich III. die Erlaubnis, eine Rüstkammer zu errichten und Waffen einzulagern. Fünf Jahre später beginnt der Ausbau zu einer Klosterburg: Stift und Kirche werden dabei durch einen Wassergraben sowie eine hohe Wehrmauer mit Türmen geschützt. Das Innere ist nur noch über eine Zugbrücke erreichbar.
Weder die ungarische Besetzung noch Angriffe aus dem Osmanischen Reich im ausgehenden


15. und frühen 16. Jahrhundert betreffen das Kloster selbst. Indirekt zeigen jedoch die Einfälle der Haiduken im Jahr 1605 Folgen: Nachdem die Rebellen am frühen Morgen des 4. Juni → Hartberg erfolglos angegriffen haben, fallen sie über Schloss → Aichberg her. Sein Besitzer Christoph Steinpeiß rettet sich mit seiner Familie ins bereits mit Flüchtlingen überfüllte Kloster. Propst Benedikt Perfall beklagt, „daß meine aigne leith und unterthanen mit ihren geflohnten haab und güettern sich des freyen himmels betragen müessen, auch ich selbst nur umb nachperlichen willen und hilff zuertzaigen meines schönsten gewölbs mich entschlagen“, er also Steinpeiß in seinen Privatgemächern unterbringen muss. Immerhin bringt dieser einen Mörser, 11 Doppelhaken und 3 Zentner Schießpulver zu Verteidigungszwecken mit ins Stift. Auch diesmal wagen sich die Gegner nicht an das befestigte Vorau heran. Am 5. Juni verlassen die Haiduken die Steiermark.
Von den kriegerischen Ereignissen des Jahres 1683 bzw. der Aggression des Kristóf II. Batthyany bleibt Vorau verschont. Ob für die
Leute Batthyanys dabei eine Rolle gespielt hat, dass der landschaftliche Zeugwart Sigmund von Klaffenau dem Vorauer Propst Georg Christoph Pratsch zuvor 30 Musketen, 100 Panteliere, 100 Degen und einen Mörser leihweise zur Verfügung gestellt hat, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall lässt sich Propst Pratsch mit der Rückgabe Zeit. Erst als Franz Otto von Klaffenau (der Sohn und Nachfolger Sigmunds von Klaffenau) im Auftrag der steirischen Landschaft urgiert, werden die Waffen 1698 durch Propst Philipp Leisl ins Grazer Zeughaus zurückgestellt.
Zu Beginn des Kuruzzenkrieges wiederholt sich das Spiel. Am 26. Februar 1704 folgen die Verordneten des landschaftlichen Zeughauses in Graz dem Wunsch des Propstes Johann Philipp Leisl nach „außfolglassung Landt defensions requisiten“ und stellen ihm einen Zentner Pulver, zwei Zentner Blei und 40 Steinschlossgewehre samt Spannern und Feuersteinen kostenlos zur Verfügung. Zwei Jahre später bekommt Leisl „bey iezt widerumben hin vnd heer annäherndten Neuen gefährligkheiten“ mehrmals Pulver und Blei, ebenso im Jahr 1707.

Zur direkten Verteidigung des Klosters benötigt wird diese Munition aber nie. Im Gegensatz zu seiner Umgebung bleibt Stift Vorau von Angriffen der Kuruzzen verschont.
Neben dem Markt und Stift Vorau gibt es eine militärisch-administrative Einrichtung, die ebenfalls „Vorau“ in ihrer Bezeichnung führt: 1462 beschließt die steirische Landschaft die Schaffung sogenannter „Landesviertel“, in denen fortan mit Steuergeld je eine „Aufgebotsmannschaft“ rekrutiert und finanziert wird. Neben den Vierteln „Ennstal und Mürztal“, „Judenburg“ und „Viertel zwischen Mur und Drau“ wird in der östlichen Steiermark das „Viertel Vorau“ eingerichtet, das sich vom Wechselgebiet bis an die Mur erstreckt. Im frühen 16. Jahrhundert kommt noch das „Viertel Cilli“ dazu. Vorerst wird in jedem dieser Viertel alljährlich ein Aufgebot zu Fuß und zu Pferd gemustert, ab 1631 nur noch bei akuter
Bedrohung. Sammelorte und Musterungsorte im „Viertel Vorau“ sind Hartberg, Gleisdorf, Fürstenfeld und Radkersburg. Gemeinsam bilden die Viertel das sogenannte Landesaufgebot zur Verteidigung der Steiermark.
Die Wehranlage von Aichberg auf einem Höhenrücken oberhalb von Rohrbach gehört zur Kette jener Grenzburgen, die zum Ende des 12. Jahrhunderts in der Nähe der → Lafnitz (Reichsgrenze seit 1043) gegen Einfälle aus dem Osten errichtet werden. Besitzer sind die Familien Aichberg, Welzer und schließlich seit 1412 die Steinpeiß. Bereits sechs Jahre nach seinem Einzug in die Burg erlebt Seyfried von Steinpeiß den Ungarneinfall von 1418. Fast alle oststeirischen Pfarren mit ihren dazugehörigen Dörfern sind davon betroffen. Auch die Pfarre Grafendorf, zu der Aichberg damals gehört. Nicht zweifelsfrei geklärt ist, ob Mitglieder der Familie Steinpeiß ein halbes Jahrhundert später tatsächlich aufseiten des Andreas Baumkircher an der Baumkircherfehde teilnehmen, wie mitunter tradiert wird. Die zuverlässige Primärquelle zur Baumkircherfehde und Besetzung der Steiermark durch die Ungarn ab 1480 – die „Österreichische Chronik“ des Pfarrers Jakob Unrest – erwähnt nämlich den Namen Steinpeiß kein einziges Mal.
Klare Informationen besitzen wir zu den Durchzügen der osmanischen Heere 1529 und 1532:
Wehrkirchen bauen
Im Spätmittelalter und in der Neuzeit werden in der Grenzregion, besonders entlang der Invasionsrouten der osmanischen Truppen, Kirchen zum Teil der Wehrarchitektur. Bestehende Gotteshäuser werden adaptiert und ergänzt – so auch in der Steiermark. Bei früheren Einfällen zeigte sich, dass unbefestigte Kirchen meist zuerst angegriffen werden. Die darin Zuflucht suchenden Menschen kamen dabei um. Aus diesem Grund verbietet die „Kreidfeuerordnung“ vom 15. Mai 1557 die Flucht in Kirchen ausdrücklich. Ausgenommen sind solche, die mit starken Mauern und Türmen umfasst sind. Viele Gotteshäuser sind von Friedhöfen und Mauern umgeben, die nun befestigt werden. Man versieht die Mauern mit Schießscharten, an den Ecken werden Wehrtürme hochgezogen, fallweise ein Wassergraben angelegt. Der Eingang erfolgt von nun an über robuste Tore und Portale. Ziel ist es, den Menschen aus der Umgebung bei einem Überfall kurzzeitig Schutz zu bieten. Für längerfristige Belagerungen sind die Kirchen nicht ausgelegt.

Als nach erfolgloser Belagerung Wiens eine Nachhut des osmanischen Heers am 19. Oktober 1529 die steirische Grenze erreicht, kommt es zur Plünderung ungeschützter Ortschaften. Davon ist auch Aichberg betroffen. Gleiches wiederholt sich drei Jahre später: Suleiman I. führt das gesamte türkische Heer durch die östliche Steiermark, das angesichts seiner Größe und der topografischen Bedingungen nur langsam vorankommt. So verbringt das Heer zwei Tage im kleinen Gebiet zwischen Grafendorf, Kirchberg am Walde und Raitenau. Der Sultan notiert dazu am 6. September: „Freytag den 6. Ssafer lagerte man diesseits des Schlosses Botendrof (Grafendorf). Sonnabends den 7. Ssafer wurde in demelben Passe gelagert, Grafendorf und ein kleines Schloss ergaben sich freywillig.“ Mit dem „kleinen Schloss“ ist wohl Aichberg gemeint, das sich laut steirischen Berichten am 7. September 1532 kampflos ergeben hat.
Jahrzehnte später werden Schloss Aichberg und das zugehörige Dorf Eichberg von den einfallenden Haiduken bedroht. Nach einem
gescheiterten Angriff auf → Hartberg in den frühen Morgenstunden des 4. Juni 1605 ziehen diese gegen das nordwestlich gelegene Vorau und fallen auf dem Weg dorthin über Aichberg her. Während der Besitzer Christoph Steinpeiß und seine Familie ins Stift → Vorau flüchten, werden Schloss Aichberg und Dorf Eichberg geplündert und sämtliches Vieh fortgetrieben. Ohne das befestigte Stift anzugreifen, ziehen sich die Haiduken tags darauf wieder nach Ungarn zurück. Die Wehranlagen des Schlosses werden in der Folge um ein Rondell an der Ostseite erweitert.
In den 1660er-Jahren rückt die vom Osmanischen Reich ausgehende Gefahr wieder in den Vordergrund. Höhepunkt ist die Schlacht von St. Gotthard-Mogersdorf, gefolgt vom Frieden von Eisenburg/Vasvar 1664. Weil demnach weite Teile Ungarns weiterhin unter osmanischer Kontrolle bleiben, verschwören sich ungarische Magnaten gegen Kaiser Leopold I. Sie planen nicht nur seine Ermordung, sondern auch die Eroberung von Fürstenfeld, Graz und Radkersburg. Obwohl nicht eindeutig erwiesen,

dürfte einer der Anführer, Petar IV. Zrinyi, am 5. Dezember 1669 für einen Überfall auf Schloss Aichberg verantwortlich sein. Dramatisch gestaltet sich auch das Jahr 1683: Als Großwesir Kara Mustafa erneut Richtung Wien zieht, erhält er Unterstützung vom ungarischen Magnaten Kristóf II. Batthyany. Um seine eigenen Güter zu schützen, lässt dieser ab dem 16. Juli zahlreiche oststeirische Herrschaften angreifen. Davon betroffen ist auch Aichberg, das von 500 Leuten Batthyanys überfallen, ausgeplündert und fast vollständig verwüstet wird.
Im frühen 18. Jahrhundert – Schloss Aichberg befindet sich immer noch im Besitz der Steinpeiß – folgt der Kuruzzenkrieg. Josef Friedrich von Steinpeiß steht damals dem 1706 geschaffenen Landesdefensionsausschuss vor und verlangt zur Verteidigung seiner eigenen Grundherrschaft Aichberg Waffen und Munition aus dem landschaftlichen Zeughaus in Graz. Er erhält einen halben Zentner Pulver, 12 Böller und 12 Gewehre. Das Schloss wird nicht angegriffen und bleibt noch bis 1772 in Besitz seiner Familie.


8. Schloss Raitenau
Die aus einem um 1160 errichteten Rodungsstützpunkt hervorgegangene und zu Beginn des 14. Jahrhunderts in der Ebene gebaute kleine Wasserburg heißt zunächst noch gar nicht Raitenau. In einer Urkunde von 1340 als „Burg zu Grafendorf“ bezeichnet, manifestiert sich der Name Raitenau erst, nachdem die Familie Reuter die Wehranlage als freies Lehen erhalten hat.
Mit einem ersten militärischen Angriff auf Raitenau sieht sich das seit 1427 dort wohnende Adelsgeschlecht der Zebinger in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts konfrontiert: Während der Baumkircherfehde wird die Anlage im Jänner 1471 durch die Söldner des Andreas Baumkircher geplündert. Nähere Nachrichten dazu fehlen. Jahrzehnte später ist Schloss Raitenau von den Durchmärschen der osmanischen Truppen betroffen: 1529 kommt die Nachhut des von Wien abziehenden Belagerungsheeres am 22. Oktober vor → Grafendorf an. Überfälle und Plünderungen, die Streifzüge der Renner und Brenner in die Umgebung

bedrohen auch Raitenau. Während des zweiten Durchmarsches 1532 – diesmal ist es das von Güns/Köszeg kommende Hauptheer unter Führung Sultan Suleimans I. – sind die Vorzeichen anders: Erfolgte der Durchzug der osmanischen Truppen 1529 zügig, so gerät nun ihr zunächst rascher Vormarsch westlich von Grafendorf ins Stocken. Am 7. September lagert das Heer vor „Kiri“, Schloss Kirchberg am Walde in der Grafendorfer Katastralgemeinde Erdwegen nördlich von Raitenau. Am folgenden Morgen setzt es sich in Bewegung und erreicht nach nur etwa fünf Kilometern Tagesleistung am Nachmittag des 8. September Raitenau. Von hier aus erfolgt nun ein verheerender Angriff auf → Grafendorf. Sultan Suleiman I. selbst vermerkt in seinem Tagebuch: „Sonnabends den 7. Ssafer wurde in demselben Passe vor dem Schlosse Kiri gelagert, dieses wurde erobert, Grafendorf und ein kleines Schloß ergaben sich freiwillig. Man stand heute noch mehr Beschwerlichkeiten als gestern aus. Sonntags den 8. Ssafer wurde noch immer in der selben Schlucht mit vieler Beschwerlichkeit zu Reitenau gelagert.“ Das Lager vor „Kiri“ erwähnt neben Suleiman I. selbst auch der ungarischstämmige Chronist Bedschwi: „Da die darin befindlichen, der Hölle bestimmten Ungläubigen, sich zu ergeben
weigerten, so wurde in kurzer Zeit von allen Seiten Feuer angelegt, und der Ort verbrannt.“
Doch zurück zu Raitenau: In den Quellen taucht es im frühen 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Schicksal von Graf Wolf Friedrich von Wurmbrand wieder auf, dessen Familie das Schloss bereits seit 1602 besitzt. Er wird am 7. August 1704 von seinen eigenen Untertanen erschossen und in Raitenau bestattet.
1822 verkauft Franz Carl von Wurmbrand die Herrschaft Raitenau an Ludwig Graf Schönfeld und lässt alle in der Gruft der Kapelle stehenden Särge abtransportieren. Schloss Raitenau steht heute in Privatbesitz.
Das im Safental am Fuße des Masenberges gelegene Grafendorf ist sowohl vom Einfall der Ungarn 1418 als auch von den Durchmärschen osmanischer Truppen 1529 und 1532 schwer betroffen: Am 19. Oktober 1529 quert eine Nachhut die steirische Grenze über die Lafnitz und steht drei Tage später vor Grafendorf, das geplündert wird. Streifzüge in die nähere Umgebung folgen. Gleiches wiederholt sich drei

Pfarrkirche Grafendorf; in der Marktgemeinde Grafendorf bei Hartberg finden sich die Schlösser Kirchberg am Walde, Reitenau und Aichberg.
Jahre später. Diesmal kommt das Heer unter Suleiman I. nur schleppend voran. Zwischen dem 4. und 10. September 1532 plündern und brandschatzen die Eindringlinge zahlreiche oststeirische Gehöfte und Dörfer. Besonders schlimm erwischt es Grafendorf („Farfondar“), wo am 8. September von einem Massaker berichtet wird. Der ungarischstämmige türkische Chronist Bedschwi schreibt: „Am folgenden Tage wurde zu Raitenau gelagert, von wo man gegen die Stadt Fardfondar kam. Die Einwohner, auf ihre Menge stolz, flüchteten sich in ihre durch Mauern stark befestigte Kirche, und schossen aus selber auf den Vortrab der Moslimen. Sogleich legten die Sieger an die Thore der Kirche Feuer an, und verbrannten die Halsstärrigen sammt ihren Familien.“ Mit dieser Schilderung widerspricht Bedschwi der Darstellung Suleimans, der von einer kampflosen Kapitulation Grafendorfs berichtet: „Freytag den 6. Ssafer lagerte man diesseits des Schlosses Botendrof (Grafendorf). Sonnabends den 7. Ssafer wurde in demelben Passe vor dem Schlosse Kiri gelagert gelagert, Grafendorf und ein kleines Schloss ergaben sich freywillig.“
Verhältnismäßig glimpflich übersteht Grafendorf den Kuruzzenkrieg 1704–1709. Nur ein einziges Mal erfolgt ein Angriff der ungarischen Rebellen: Anfang November 1707 mehren sich Gerüchte über einen bevorstehenden Kuruzzeneinfall ins Gebiet zwischen → Friedberg und → Hartberg. Sie bewahrheiten sich am 11. November. Neben Grafendorf werden dabei zehn weitere Dörfer ausgeraubt. Ehrenschachen, Kroisbach und Unterlimbach erleiden Brandschäden. Tragisch für die betroffene Bevölkerung dabei: Trotz im Vorfeld eingegangener Warnungen werden kurz vor dem Überfall größere Teile der bis dahin an der Grenze stationierten Truppen zu General Siegbert Heister nach Ungarn abkommandiert.
Zu Beginn des Kuruzzenkrieges im Jahr 1704 fliehen zahlreiche Adelige aus ihren oststeirischen Schlössern und Burgen, während die bäuerliche Bevölkerung den Angriffen der Kuruzzen mehr oder minder schutzlos ausgeliefert ist. Einer der wenigen Adeligen, die zurückbleiben, ist Wolf Friedrich von Wurmbrand, Besitzer des Schlosses → Raitenau. Seine Untertanen verdächtigen ihn fälschlicherweise der Kooperation mit den Rebellen und zwingen ihn zur Herausgabe von Lebensmitteln, Waffen und Munition. Zudem soll er eine Gruppe von Bauern führen, die sich selbst gegen die Kuruzzen verteidigen wollen. Wurmbrand zeigt sich zunächst willig, verweigert aber dann die weitere Zusammenarbeit. Aus diesem Grund wird er am 7. August in Seibersdorf von seinen Untertanen erschossen, das Schloss geplündert. Der Leichnam wird zunächst in die Kapelle von Grafendorf gebracht und dort aufgebahrt, die Bestattung erfolgt tags darauf: „Den 8 dito ist Herr Wolff Fridrich Graff Wurmbprandt, so durch die Rebellischen Paurn Erschossen worden, in die Neue Capeln in seiner Grufft bestätt worden.“ Erst Jahre später werden einige der Mörder verurteilt und hingerichtet.
An das Ereignis erinnert ein Bildstock unweit der Wechselbundesstraße B54 in Seibersdorf bei Grafendorf mit der Aufschrift:

„Zur Sühne wardt dies Kreuz errichtet, uns mahnend: nicht zu morden! Der Krieg hat Leben viel vernichtet, durch unseren Herrn ist Friede worden.“
Als das osmanische Heer 1683 Wien belagert, huldigt der ungarische Magnat Kristóf II. Batthyany den osmanischen Machthabern, um seine eigenen Besitztümer zu schützen. Vor diesem Hintergrund greifen Anhänger Batthyanys ab dem 16. Juli oststeirische Orte an, zwei Tage später brennt auch Schloss Klaffenau. Der landschaftliche Zeugwart Sigmund von Klaffenau schreibt dazu: „Tett‚s gschloß noch mier gehören, wär ich ietzt böss. Aber schad drum ist’s.“ Mit seiner Bemerkung deutet Sigmund von Klaffenau darauf hin, dass sich das Schloss zu jener Zeit nicht mehr in seinem Familienbesitz befindet.
Errichtet wird das Anwesen 1567 als kleine Wasserburg östlich vor den Toren Hartbergs in der Ebene des Safentales. Sie gelangt im Jahre 1600 an die Familie Wilhelm und wird von ihr
stetig erweitert. Bereits 1605 brennen jedoch die Haiduken das Schloss nieder. Zwischen 29. Mai und 3. Juni plündern diese 52 oststeirische Orte, darunter auch Schloss Klaffenau, das dabei schweren Schaden nimmt. Folglich wird es 1607 von der Witwe des Balthasar Wilhelm an den Propst von Stift Vorau, Johann Benedikt Perfall, verkauft. Allerdings erhält der Bruder Balthasars, der 1639 verstorbene Erhard Wilhelm, im Schloss Wohnrecht auf Lebenszeit. Danach lässt das Stift Vorau Klaffenau zu einem feudalen Wohnschloss ausbauen.
Obwohl das Schloss nun zum Besitz der Vorauer Augustiner-Chorherren gehört, dürfen sich Erhard Wilhelm und all seine Nachkommen trotzdem „von Klaffenau“ nennen. Grund dafür ist ein Gesuch Erhards bei Hof, „daß Jr Kay: May: [Kaiser Ferdinand II.] gnedigist verwilligen wolden, damit Er sein habendes Praedicat von dem Edlman gueth vnd Siz Claffenaw in Jr Kay: May: Fürstenthumb Steyr gelegen, welches Jnen denen Wilhelmben aigentlich zuehörig gewesen, hinfüran sambt seinen Ehelichen Leibs Erben zu einen Zue Namben gebrauchen vnd den Taufnamen Wilhelbm, welcher Zuuor

Zuenamen gewesen, außlassen, vnd sich allein von Claffenaw nennen vnd schreiben mögen.“ Tatsächlich folgt Kaiser Ferdinand II. diesem Ansuchen. So wird am 4. März 1627 das erbetene Adelsdiplom ausgestellt, woraufhin Erhard und „seine Ehelichen Leibs Erben mit außlassung Jres vorigen Zuenambens Wilhelbm hinfüran allein die von Claffenaw genennt“ werden: Aus der Familie Wilhelm ist die Adelsfamilie „von Klaffenau“ geworden.
Bereits seit mehr als 100 Jahren im Besitz des Stiftes → Vorau stehend, erleidet Klaffenau zu Beginn des 18. Jahrhunderts erneut Schaden, diesmal durch Angriffe der Kuruzzen. Erstmals betroffen ist das Schloss am 7. August 1704 während eines Streifzuges, dem 13 Dörfer in der Umgebung von Hartberg zum Opfer fallen. Als Reaktion darauf lässt der Grazer Hofkriegsrat am 31. Oktober 1704 300 Mann des Regiments „de Went“ in Fürstenfeld stationieren. Verantwortlich für die Maßnahme zeichnet der stellvertretende Kriegskommissär des Viertels Vorau, Sigmund Karl von Klaffenau. Beim zweiten Angriff der Kuruzzen auf Klaffenau am 23. Juli 1709 fällt der unmittelbar beim Schloss
gelegene Meierhof den Flammen zum Opfer. Dabei wird der Lebzeltergeselle Anton Weillner „durch die Coruzn erschossn“, zwei weitere Personen werden verschleppt.
Noch bis 1951 bleibt Schloss Klaffenau im Besitz von Vorau und gelangt danach in private Hände.


Reckturm aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts als Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Er diente auch als Gefängnis.
Hartberg wird im frühen 12. Jahrhundert am südlichen Auslauf des Ringkogels planmäßig auf einem erhöhten Plateau rund um eine Burg, eine Kapelle, einen Meierhof und eine Mühle angelegt. Im 13. Jahrhundert wird eine fortan das Stadtbild prägende Befestigungsanlage mit insgesamt zehn Wehrtürmen errichtet.
In der hier verhandelten Zeitspanne ist Hartberg aufgrund seiner Lage und Bedeutung immer wieder Ziel von Angriffen. Betroffen sind auch die zur Pfarre Hartberg gehörigen Dörfer: So brechen im Frühjahr 1418 die Ungarn in die Oststeiermark ein. Sie plündern und verwüsten zahlreiche Pfarren, darunter auch Hartberg. Inwieweit dabei Menschen zu Schaden kommen, ist nicht bekannt.
Jahrzehnte der Unsicherheit, Bedrohung und Gewalt erlebt die Bevölkerung der Stadt zwischen 1469 und 1490. Damals wird Hartberg sowohl im Zuge der Baumkircherfehde als


auch während der zehnjährigen Besatzungszeit der Steiermark 1480–1490 durch die Ungarn mehrfach angegriffen, belagert und besetzt. Nach Bericht des Chronisten Jakob Unrest nehmen Anhänger des Andreas Baumkircher gleich zu Beginn der Fehde die Stadt ein, um sie als Stützpunkte zu nutzen: „Der vorgenannt herr Anndre Pamkircher“ und seine Helfer „uberfiellen und abtrungen die stat Marpurgk, Furstenfeld, Harperg, Fewstruz und Veldtpach … und von den stetten und geschlossen pekryegten sy den kayser und all sein inwanner einer lanndt.“
Im Jänner 1471 lässt der Söldnerführer Hartberg dann plündern, um seinen Geldforderungen gegenüber dem Kaiser Nachdruck zu verleihen.
Ab 1480 besetzen Truppen des ungarischen Königs Matyas Corvinus steirische Städte und Märkte. Hartberg bleibt zunächst in kaiserlicher Hand. Im Oktober 1487 aber beginnen Söldner des mit den Ungarn verbündeten Wilhelm Baumkircher mit der Belagerung der Stadt, die im Frühjahr 1488 mit der Einnahme durch die Ungarn endet. Erst mit dem Tod des Matyas
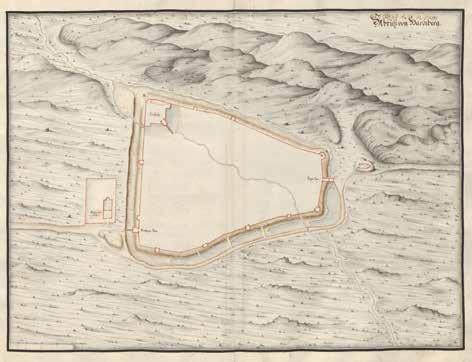
„Abriss von Hartberg“ mit Schlossanlage und dem Grazer Tor (links) sowie dem Ungartor (rechts), Kartograf Martin Stier, um 1660, Steiermärkisches Landesarchiv
Corvinus bricht die Ungarnherrschaft in der Steiermark zusammen. Hartberg ergibt sich
Anfang August 1490 den habsburgischen Truppen König Maximilians I.
Vom Durchmarsch der osmanischen Truppen in den Jahren 1529 und 1532 ist die Stadt Hartberg nicht betroffen, wohl aber ihr Umland. Interessanterweise führt die Bedrohung durch das Osmanische Reich in dieser Zeit nicht zu einem Ausbau der Stadtbefestigung. Im Gegensatz zu → Fürstenfeld und → Radkersburg bleibt in Hartberg die mittelalterliche Ringmauer bestehen. Man begnügt sich mit Verstärkungen, Ausbesserungen und Instandhaltungsarbeiten.
Einen heftigen Angriff erlebt die Bevölkerung Hartbergs mit den Einfällen der Haiduken in die östliche Steiermark im Jahr 1605. Die ungarischen Rebellen wenden sich nach ihrem Angriff auf Fürstenfeld Richtung Norden und plündern mehr als 60 Ortschaften. Am späten Nachmittag des 3. Juni erreichen sie Hartberg und stecken die Grazer Vorstadt in Brand. Die
folgenden Ereignisse beschreibt der in der Stadt weilende Landprofos Wolf Glöderl: „Dieweil man aber Khuntschaft hat bekhumben, dass alda die rebellischen Vngem (so nunmehr das gantze Viertl Voraw neben andern umbligenden Dörfern nit allein verbrent, sondem auch, welches ja zu erbarmen, alles Viech und Leitt hinweckh gefiert) ihr Haill versuechen und dieselbe auch in ihr Gewalt zu bringen Vorhabens sein, als gestern ungeuer umb halb drey Vormittag in aller Frue in einem grossen Nebl, und zwar mit sehr grosser ernsthafter Praeparation und Sturmzeug die Statt beim Ungerthor angriffen, welcher Sturmb dan bey drey ganzer Stund lang ernstlich und also starckh geweret, dass die ehrlichen Leut, so in der Statt der Zeit gewesen, auf starkhes Vermanen des Herrn Hans Christoff‘ von Paar, sowol auch meiner, den Feinden ernstlichen dapfern Widerstandt gethan, dass man auf gar gewisse Khundtschaft derselben aufs wenigist bei anderthalb Hundert erlegt und beschedigt. Weillen aber die Feindt unsern starckhen Widerstandt mit Ernst gesehen, haben sy vom Sturm nachgelassen, und die
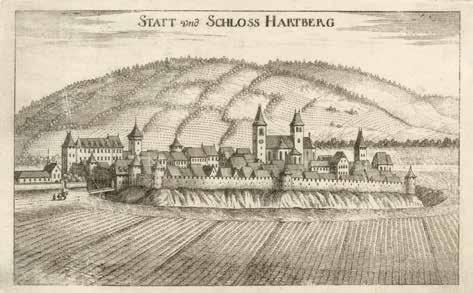
totten Cörper alle (ausser 6 Personen, die wier gleich vor der Statt und beim Tohr albereit tott gefunden, ihre Khöpf aber, dem gewönlichen Khriegsbrauch nach, mit Spiessen auf der Statt Rinckhmawren gesteckht) haben sy auf die bei sich gehabten Wägen gelegt, die Vorstat sowol, auch alle Dörfer in der Gegent hierumb angezündt, und in Grundt verprendt. Der Unserigen aber in der Statt ist kheiner ausser vier Personen, so vom Schiessen geschedigt worden, tott gebliben.“ Weil die Haiduken drohen, „gedachte Statt Hartberg in khurzen Tagen widerumb anzugreifen und sy in ihr Gewalt zubringen“, werden eilends Arkebusierreiter unter dem Kommando des Andrä Rindscheit aus Burgau geholt. Ein zweiter Angriff findet nicht statt.
1683 verbreiten sich Nachrichten vom Vormarsch eines osmanischen Heeres Richtung Wien. Bereits am 15. März ersucht Georg Adam von Lengheim, wegen der „besorgendter Türggen gfar füer sein guett Hartperg“ um einen Zentner Pulver und drei Zentner Blei aus dem landschaftlichen Zeughaus in Graz. Doch noch lehnen die Verordneten ab: „Mit seiner Bitt wiße der Herr noch ein weill gedult zu tragen“. Ausgeliefert wird das Kriegsmaterial erst am 19. Juli, nachdem sich der ungarische
Magnat Kristóf II. Batthyany auf die Seite des Großwesirs Kara Mustafa stellt und Söldner mit der Bandschatzung des Grenzgebietes beauftragt. Nachdem Lengheim im Namen der Stadt „Harperg vnd derselben benachparten“ Orte abermals um Schießzubehör ersucht, erhält der landschaftliche Zeugwart Sigmund von Klaffenau den Auftrag, zwei Zentner Pulver und einen halben Zentner Lunten kostenfrei nach Hartberg zu senden. Die Landbevölkerung findet Zuflucht in der Stadt, an die sich die Truppen Batthyanys nicht heranwagen. In der Stadt sind nämlich 70 Mann des steirischen Landesaufgebotes stationiert, die Umgebung wird durch die Regimenter Saurau, Aspremont und Metternich gesichert.


Neuerlich schwer in Mitleidenschaft gezogen wird die Gegend um Hartberg im Zuge des Kuruzzenkrieges 1704–1709. Allein am 25. Juli 1704 werden zwischen → Feldbach und Hartberg 62 Dörfer niedergebannt. Am 6. August sind es weitere 13 Dörfer nördlich der Stadt. Hartberg selbst bleibt zunächst verschont und wird erst am 31. Jänner 1707 angegriffen, wobei den Kuruzzen die Plünderung der westlich der Ringmauer gelegenen Grazer Vorstadt gelingt. Weil an der nahen ungarischen Grenze viel zu wenige Truppen stationiert sind, können die Kuruzzen sowohl das Gebiet nördlich von Hartberg als auch die Dörfer südöstlich der Stadt nahezu ungehindert verwüsten.
Hartberg gehört zu den wenigen steirischen Städten, deren mittelalterliche Befestigung in der Neuzeit nicht maßgeblich adaptiert oder erneuert wird. Auch wenn Mauertürme und Tore im 19. Jahrhundert weitgehend abgetragen werden, lässt sich die mittelalterliche Befestigung bis heute gut nachvollziehen und ist mit Graben, zwei Türmen und Mauerwerk an vielen Stellen zu besichtigen.
Einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Stadt bietet das Museum Hartberg im historischen Steinpeißhaus.
Westlich von Hartberg steht in der Gemeinde Löffelbach an einem Ausläufer des Ringkogels die mittelalterliche Höhenburg Neuberg. Im 12. Jahrhundert errichtet, gehört sie zu einer Reihe von Grenzbefestigungen gegen das benachbarte Ungarn. Möglicherweise leitet sich aus dieser Funktion die ältere Bezeichnung „Nitperg“ oder „Neitperg“ ab, was so viel wie Trutzburg bedeutet. Die heute übliche Bezeichnung „Neuberg“ manifestiert sich im 14. Jahrhundert mit der Familie Neuberg, Verwandte der Stubenberger. Zu dieser Zeit besteht die Kernburg aus einem viereckigen, circa 36 Meter hohen Bergfried aus dem 12. Jahrhundert samt anschließendem Palas. Die umliegenden Wirtschaftsgebäude bilden ein unregelmäßiges Fünfeck mit schmucklosem Innenhof.
Burg Neuberg steht in enger Verbindung mit den Anfängen der organisierten Landesverteidigung und der ersten steirischen Wehrordnung vom 4. Dezember 1443, in deren Zentrum der Schutz der Grenze zu Ungarn steht. Im Bedarfsfall sollte die wehrfähige Bevölkerung zu den Waffen gerufen werden, gestellt und ausgestattet von den Ständen, Städten und Märkten.


Befehligt wird die so aufgebotene Truppe durch drei Hauptleute – einer davon ist Heinrich III. von Neuberg.
Heinrichs Sohn Hans kündigt später dem Landesfürsten die Treue: Er schlägt sich nämlich zu Beginn der zehnjährigen Besatzung durch die Ungarn 1480–1490 auf die Seite des Ungarnkönigs Matyas Corvinus und rettet so seine Herrschaft vor Plünderung. Hans stirbt am 22. Oktober 1483, ohne mit den Konsequenzen seines Handelns unmittelbar konfrontiert zu werden. Diese treffen aber die Erben, seine Schwester Elisabeth von Neuberg und ihren ersten Ehemann Friedrich von Pottendorf: Kaiser Friedrich III. nutzt eine Zeit relativer Waffenruhe in der Oststeiermark für eine Strafexpedition gegen sie und zieht die neubergischen Besitzungen Neuberg, Pöllau, Thalberg und Neudau am 17. April 1485 ein. Obwohl Elisabeth den Kaiser persönlich um Verzeihung bittet und sich mit anderen Adeligen vergleicht, bleibt Neuberg verloren. Erst 1507 übergibt Friedrichs Sohn Maximilian I. Burg und Herrschaft Neuberg pflegeweise an Wilhelm von Graben. Elf Jahre später erhält die Familie Herberstein Neuberg als kaiserliches Lehen.
In den Jahren bis 1603 wird die noch relativ kleine Burg nach dem Vorbild des italienischen Basteiensystems großzügig erweitert und modernisiert. Vor dem Eingangstor zum mittelalterlichen Burghof entsteht eine Zwingeranlage, nach Südosten wird eine Vorburg mit dem mächtigen Geschützturm errichtet. Maßgeblich am Ausbau beteiligt ist Hans Sigmund von Herberstein, der als Kommandant der windischen Militärgrenze 1595 bis 1603 viel Geld aus dem ständigen Kleinkrieg lukriert. 1603 geht Hans Sigmund als kaiserlicher Hofkriegsrat nach Wien und verkauft Neuberg am 25. Jänner 1603 an Gabriel von Teuffenbach.
Die starke Befestigung schützt nun zwar die Burg Neuberg vor Angriffen der Haiduken, als jene das Gebiet zwischen Fürstenfeld und Hartberg verwüsten. Das grundherrschaftlich zugehörige Dorf fällt jedoch am 3. Juni 1605 den Ungarn zum Opfer. Betroffen macht eine Liste, die Gabriel von Teuffenbach am 5. Februar 1606 an die steirische Landschaft sendet. Aus ihr gehen die Namen jener 15 Menschen hervor, die im Jahr zuvor von den Haiduken in Neuberg und → Untermayerhofen ermordet oder verschleppt worden sind. Ebenfalls vermerkt werden die gestohlenen Pferde, Kühe und Kälber, wie ein Auszug zeigt:
Paul Ertl 1 dienstkhnecht, 4 khüe, 1 stier vnnd 2 kalbin wekhgefiert
Paul Grabner 1 pueben vnnd drey roß entfiert
Paul Heschel 3 roß vnnd 1 sterzen entfiert
Paul Radfuchs 1 pueben, 1 diern, 1 roß, 3 khüe und 2 khalbizen entfiert
Peter Schoberwalter sein weib entfiert
In der Folgezeit wechselt Neuberg mehrfach die Besitzer: 1613 erwirbt Hans Ruprecht von Glojach Burg und Herrschaft, der jedoch 16 Jahre später als bekennender Protestant des Landes verwiesen wird. 1629 folgt Hans Albrecht von Herberstein, 1632 Ernreich III. von Trauttmansdorff. Etwas länger, nämlich von 1636 bis 1660, bleibt die Familie Saurau in Besitz von Neuberg. Die häufigen Besitzwechsel verhindern einen weiteren Ausbau der Burg. 1660 fällt diese an die Familie Herberstein zurück, die Neuberg

bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ihr Eigen nennt. Unter ihrer Herrschaft entstehen um 1669 große Säle, die teilweise mit kostbaren Kassettendecken ausgestattet sind.
Neuberg befindet sich heute in Privatbesitz. Mit dem hoch aufragenden Bergfried und dem mächtigen dreigeschossigen Geschützturm, in dem seit 1660 die Schlosskapelle untergebracht ist, präsentiert sich die Burg nach wie vor als eindrucksvolle, wehrhafte Renaissancefestung.
Pöllau liegt in einem Talkessel zwischen dem Masenberg und dem Rabenwald. Aus einer mitteralterlichen Talburg soll sich später das den Ort beherrschende Stift entwickeln:
Hans III. von Neuberg verfügt 1482 in seinem Testament die Umwandlung der Burg Pöllau n ein Augustiner Chorherrenstift. Nach seinem Tod setzen sich seine Schwester Elisabeth und ihre beiden Ehemänner, Friedrich von Pottendorf und ab 1489 Christoph von St. Georgen-Bösing, vehement für die
tatsächliche Umsetzung der Stiftung ein. Weil aber Kaiser Friedrich III. 1485 die neubergischen Besitzungen eingezogen hat (siehe dazu: → Neuberg), verzögert sich die Realisierung des frommen Ansinnens: Erst 22 Jahre nach Ausstellung der Stiftungsurkunde kann das Augustiner Chorherrenstift schließlich geweiht werden. Am 28. August 1504 stellt Christoph von St. Georgen-Bösing den endgültigen Stiftbrief aus, und acht Chorherren aus Vorau beziehen das neue Kloster. Elisabeth von Neuberg erlebt dies nicht mehr. Sie stirbt am 11. Juni 1503 und wird in der Pfarrkirche von Pöllau, der heutigen Stiftskirche, bestattet. Auch ihre Eltern, ihre Geschwister und ihr Bruder Hans liegen dort begraben, wie ein Wappenstein samt Inschrift in der rechten Wand des Chores bezeugt: „Hie ligt begrabn der wolgeborn herr her hanns von neyperg vnd fraw elizabet sein sewster die lecztn ihres namens des wolgeboren herrn herrn cristoffs grauen zw sand georgn vnd bosinau gemaehl die gestorben ist an sannd warnaba tag mccccc [11. Juni 150] vnd im drittn jar alls die stiffter des goczhaus mitsambt irn vatter mutter und geswistrarn den allen got genadig sey. neyperg sand jörg vnd Pössing“.

Blick in den „Steirischen Petersdom“: Die ehem. Stiftskirche Pöllau mit ihren Wand- und Kuppelfresken repräsentiert den Hochbarock in der Steiermark.
Mit seinen Wehrmauern erfüllt die Klosteranlage im Krisenfall eine wichtige Schutzfunktion für die umliegende Bevölkerung. Inwiefern das Stift selbst von den Durchzügen der osmanischen Truppen in den Jahren 1529 und 1532 betroffen ist, ist nicht überliefert. Mehrfach stellt das ab 1677 barockisierte Kloster jedoch seine Bedeutung als Schutz- und Rückzugsort im frühen 18. Jahrhundert unter Beweis: Im Verlauf des Kuruzzenkriegs 1704–1709 finden immer wieder Menschen aus dem Umland Aufnahme, die vor den Ungarn aus ihren Häusern und Dörfern geflohen sind. Vom 24. Jänner 1707 ist ein Schreiben von Propst Johann Ernst II. von Ortenhofen an das landschaftliche Zeughaus in Graz erhalten. Um das Kloster im Bedarfsfall verteidigen zu können, ersucht er um Pulver und Blei, wird aber aufgefordert, sich anderswo zu versorgen: „Inmassen die löbliche Stöll die Confin Pläze mit genuegsamber Munition zuuersehen nicht gefolgen khann, alß würdet der Herr Supplicant die gehörige Notturfft anderwerts zu beschafen wissen.“
Schlussendlich führt jedoch nicht der Krieg zum Niedergang des Stiftes Pöllau, sondern die Reformen Kaiser Josephs II.: Er hebt das Kloster 1785 auf, bestehen bleiben die Gebäude und Teile der Wehranlagen. Doch das fast 300-jährige Wirken der Chorherren hat Pöllau zum geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkt des Pöllauer Tales gemacht. Heute befindet sich das Schloss im Besitz der Marktgemeinde Pöllau.
Das auf eine hochmittelalterliche Burg zurückgehende Schloss Herberstein ist die einzige Wehranlage der Oststeiermark, die im Betrachtungszeitraum vom 15. bis zum 18. Jahrhundert gänzlich von feindlichen Angriffen verschont bleibt. Dafür sind mehrere Faktoren ausschlaggebend: So ist Schloss Herberstein aus der Entfernung nicht zu sehen, es liegt strategisch günstig auf einem nach Norden hin steil abfallenden Felssporn, hoch über dem Fluss Feistritz, und wird bis zum 17. Jahrhundert in mehreren Etappen zu einer fortifikatorischen Musterburg ausgebaut: 1584 ist die Anlage mit dem Bau des mächtigen Geschützturms an der Südflanke vollendet. Tendenziell greifen feindliche Scharen derartig gelegene und gut befestigte Orte und Wehranlagen selten an. Lediglich das nächstgelegene Dorf St. Johann bei Herberstein wird am 9. Oktober 1532 von einer türkischen Streifschar geplündert und teilweise niedergebrannt.
Während das Schloss von kriegerischen Auseinandersetzungen verschont bleibt, nehmen zahlreiche Mitglieder der Familie Herberstein aktiv am Kriegsgeschehen teil: Sie dienen in kämpfenden Truppen, als Grenzkommandanten und Verwaltungsbeamte beim Militär oder fungieren als steirische Landeshauptleute. Das dabei verdiente Geld wird u. a. in den sukzessiven Umbau der mittelalterlichen Burg in ein neuzeitliches Renaissancewohnschloss mit repräsentativem Rittersaal investiert. Zwischen 1648 und 1667 erhält Schloss Herberstein sein heutiges Aussehen.


Die Topografie nutzen
Um sich zu schützen, bauen die Menschen auf die naturräumlichen Gegebenheiten oder beziehen diese in eigene wehrtechnische Anlagen ein: Man setzt auf Hügel und Engstellen, die den Vormarsch von Truppen ins Stocken bringen. Gräben und Erdwälle werden genutzt, um Eindringlinge „im Vorfeld“ zu stoppen. Schanzen werden aus Erde aufgeschüttet und in die Erdwälle integriert. Sie dienen den Soldaten und der lokalen Dorfbevölkerung als Flucht- und Rückzugsorte. Sogar Brunnen werden in den Schanzbauten angelegt, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Hölzerne Befestigungstürme entlang der Gräben und Wälle verbessern den Überblick. Verhacke oder Verhaue aus Bäumen und Ästen, Hecken und Dornengebüsch erhöhen die Wirkkraft der Anlagen. Auf Hügeln werden sogenannte Kreidfeuer-Stationen errichtet, um die Bevölkerung bei Gefahr durch das gezielte Entzünden von Feuern sowie durch Schusslärm zu warnen.
16. Blaindorf
Wie beinahe alle Orte im Feistritztal, ist auch Blaindorf von den Durchzügen der osmanischen Truppen 1529 und 1532 betroffen. Genaueres ist nur zu den Ereignissen des Jahres 1532 bekannt: Am 9. September bricht das von Sultan Suleiman I. geführte osmanische Heer vom Lager bei Schloss Raitenau auf. Vorbei an → Hartberg bewegt sich der Tross Richtung Südosten und erreicht am Abend desselben Tages → Obermayerhofen. Während des Marsches
weichen Renner und Brenner vom Weg ab und verwüsten etliche Orte der Umgebung, darunter Blaindorf in der Pfarre Großsteinbach.
Gut 70 Jahre später sieht sich die Bevölkerung von Blaindorf mit den Haiduken konfrontiert: Von Fürstenfeld kommend, ziehen die ungarischen Rebellen im Frühsommer 1605 nach Nordwesten Richtung → Hartberg. Innerhalb von nur vier Tagen brandschatzen sie 52 Dörfer. Die Bevölkerung flieht, ebenso Bernhardin II. von Herberstein, zu dessen Besitzungen

Blaindorf und das benachbarte Großsteinbach gehören. So können die Haiduken am 2. Juni beide Orte ungestört plündern und teilweise niederbrennen. Damit sind die Verwüstungen aber noch nicht zu Ende, denn das aus → Fürstenfeld nachrückende steirische Kriegsvolk nimmt mit, was übriggeblieben ist. Bernhardin II. von Herberstein klagt später: „Waß der feindt gleich übergelassen, das ist hernach durch das füerstenfelderisch khriegsvolkh den armen leuthen nit allain in dörffern, sondern gar in weingebürgen, alda sy den armen leuthen ire kheller mit gwalt aufprochen, die wein außtrunkhen, die schwein nidergeschossen, leinbath, plochen, khleider, schmer vnd waß sy nuer gefunden, wöckgetragen vnd in summa die armen leith also verdörbt, das innen nit ain henn, geschweigen mehrers überbliben.“ Was folgt, ist der Angriff der Haiduken auf → Hartberg am frühen Morgen des 4. Juni 1605.
Als „Tag eines Wunders“ geht der 25. Juli 1704 ins lokale Gedächtnis von Großsteinbach und Blaindorf ein: Damals fällt das gesamte Gebiet zwischen Feldbach und Hartberg, westwärts bis Sinabelkirchen und Pischelsdorf den Einfällen der Kuruzzen zum Opfer. Nicht weniger als 62 Dörfer versinken an einem einzigen Tag in Schutt und Asche. Als die Bauern von
Großsteinbach die Rauchsäulen und Feuer sehen, organisieren sie eine spontane Wallfahrt ins nahegelegene Blaindorf, um dort bei der Statue des hl. Florian um Hilfe zu bitten. Tatsächlich schwenken die Kuruzzen unmittelbar vor Großsteinbach nach Norden ab und beide Orte bleiben verschont. Als Dank stiftet die Pfarrgemeinde ein großes Votivbild mit der Darstellung der umliegenden Dörfer, u. a. Großsteinbach und Blaindorf. Rund um die Pfarrkirche ist auch die Wehrmauer gut zu erkennen. Der darunter stehende Text beschreibt die Ereignisse:


„Anno 1704. Am Festag des Hl. Apostl JACOBI Haben die Hungerische Rebellen alle Umbligente Pfarn mit Sengen und Brennen Dergestalten angegriffen daß vill Taußent Heusser Dadurch in Aschen gelegt worden, Diße Pfarr Stainbach aber Ist durch vorbütt des H. Floriani befreieth bliben, dem zu Ewiger dankhsagung hat die Pfarrmengge von Stainbach dißes Bilt anhero auf Blaimbdorff geopfert“.
Das Votivbild in der Filialkirche von Blaindorf ist heute nur jeweils vor und nach den Gottesdiensten zugänglich. Eine Kopie des Blaindorfer Votivbildes, das an der Außenseite der nahen Pfarrkirche Großsteinbach in Form einer Sonnenuhr angebracht ist, kann aber dort jederzeit besichtigt werden.
Wie die meisten Wehrbauten des oststeirischen Grenzraumes, geht auch das ältere Obermayerhofen südlich von Neustift im Safenbachtal auf eine hochmittelalterliche Burg zurück. Im Jahr 1377 wird es von der Familie Teuffenbach erworben. 63 Jahre später fällt die damals noch kleine Wehranlage einer Auseinandersetzung zwischen dem steirischen Herzog Friedrich V. und den Grafen von Cilli zum Opfer:
Christoph von Wolfsau, schon zuvor durch die sogenannten Wolfsauerfehden in Erscheinung getreten, greift seit 1438 aufseiten der Cillier in die Kämpfe ein und schädigt 1438 den landesfürstlichen Markt → Feldbach. Zwei Jahre später, im August 1440, stürmen seine Leute die Burg Obermayerhofen und zünden die Innenausstattung an. Bei den im Oktober 1441 begonnenen Gegenmaßnahmen Friedrichs V. scheint der Wolfsauer selbst gefallen zu sein. In den folgenden Jahren bauen die Teuffenbacher Obermayerhofen zum Zentrum einer großen Grundherrschaft aus. Von 1552 bis 1574 lässt

Schloss Obermayerhofen, umgeben von einer großzügig angelegten Parkanlage

Untermayerhofen: Moarhof des ehem. Schlosses mit nachträglich angebrachtem Graffito der einstigen Anlage
hier Servatius von Teuffenbach seinen oststeirischen Besitz mit dem Neubau eines repräsentativen Renaissanceschlosses abrunden.
Zu dieser Zeit liegen die verheerendsten Kriegsereignisse – die beiden Durchmärsche der osmanischen Truppen von 1529 und 1532 –einige Jahre zurück: Während des Rückzuges 1529 durchstreift die Nachhut des osmanischen Heeres die östliche Steiermark und greift um den 20. Oktober Obermayerhofen an. Genaueres ist zum zweiten Durchmarsch im September 1532 bekannt: Von Güns/Köszeg kommend, bricht das osmanische Heer am 9. September von → Raitenau auf und erreicht am Abend desselben Tages das Feld zwischen Burg Obermayerhofen und dem Gutshof Untermayerhofen. Noch am Nachmittag werden beide Mayerhofen geplündert. Anschließend schlägt das Heer unterhalb der Mauern von Obermayerhofen sein Nachtlager auf, bevor es Richtung Süden weiterzieht.
Auch Untermayerhofen, im Safental gelegen, zählt zum Besitz der Familie Teuffenbach. 1490 hat Bernhard von Teuffenbach hier einen Hof errichten lassen, der nach der Zerstörung von
1532 auf Geheiß des Andrä von Teuffenbach zu einem großen Meierhof ausgebaut wird. Sein Sohn Gabriel lässt Untermayerhofen bis 1581 schließlich zu einem mauerumgürteten Bollwerk erweitern. Es bietet allerdings 1605 keinen ausreichenden Schutz vor den anrückenden Haiduken. In der Woche nach dem 29. Mai plündern diese 52 oststeirische Orte, darunter am 3. Juni Untermayerhofen. Das benachbarte Obermayerhofen bleibt verschont. Wie Gabriel von Teuffenbach am 5. Februar 1606 der steirischen Landschaft berichtet, töten die Leute des Rebellenoberst Gregor Nemethy in seinen Herrschaften Untermayerhofen und → Neuberg 15 Menschen und verschleppen weitere 69 (siehe dazu → Neuberg). Sämtliches Vieh wird geraubt. Infolge des Haidukeneinfalles verschlechtert sich die Wirtschaftslage, das Schloss kann daraufhin nur mehr notdürftig instand gesetzt werden. Die Herrschaften Obermayerhofen und Untermayerhofen werden vereinigt.
Ab dem beginnenden 17. Jahrhundert häufen sich die Besitzwechsel. Nach dem Kuruzzeneinfall 1704 verfällt Untermayerhofen. Lediglich der lange Zeit als Gasthaus geführte Meierhof hat überdauert. Eine andere Entwicklung nimmt Obermayerhofen, das 1777 von den Grafen Kottulinsky erworben und heute als Hotel geführt wird.


Schloss Kalsdorf bei Ilz: dreigeschossiger Vierflügelbau mit zwei Ecktürmen
18. Die Schlösser Feistritz und Kalsdorf bei Ilz
Zu Beginn der Haidukeneinfälle im Jahr 1605 bedrohen diese im Auftrag des Istvan Bocskay kämpfenden ungarischen Aufständischen auch → Ilz. Am 23. Juli halten sie sich vor dem Ort auf, werden aber durch gezielte Schüsse vertrieben.
Ähnliches gelingt sechs Kilometer nördlich nicht: Schloss Feistritz, das sich im Eigentum
der Adelsfamilie Mindorf befindet, wird am selben Tag angezündet. Obwohl 1570 zu einem befestigten Wasserschloss ausgebaut, können die Haiduken nicht abgewehrt werden. Spuren des Brandes sind – nicht allgemein zugänglich –bis heute im Treppenturm erkennbar, der im 15. Jahrhundert an den Bergfried angebaut wurde.
Für die künftige Verteidigung der Anlage erhält Bernhardin von Mindorf am 30. Jänner 1606
einen Zentner Pulver sowie einen Zentner Blei aus dem Grazer Hofzeughaus. Außerdem wird die mittelalterliche Burg verstärkt und ausgebaut: Eine langgestreckte zweigeschossige Vorburg mit zwei Türmen entsteht und ein rund umlaufender Wassergraben wird angelegt. 1630 werden die Arbeiten unter Hans Christoph von Mindorf abgeschlossen. Nach seinem Tod im Jahr 1648 fällt Feistritz an die Grafenfamilie Wildenstein, die 1704 den ersten großen Überfall der Kuruzzen miterlebt: Am 25. Juli 1704 werden innerhalb eines einzigen Tages 62 Dörfer angezündet und beraubt. Auch Schloss Feistritz ist vom Treiben der aufständischen Ungarn betroffen. Eben dies gilt auch für ein weiteres Schloss der Wildenstein: das sich zwei Kilometer nordöstlich von Ilz befindliche Schloss Kalsdorf, das schon 1605 (damals noch im Besitz der Herbersdorf) von den Haiduken angegriffen wurde.
Heute befinden sich im ehemalige Wasserschloss Feistritz eine Gutsverwaltung sowie Privatwohnungen. Schloss Kalsdorf findet sich in Privatbesitz.
Ungewöhnlich für das oststeirische Grenzland, bleibt Ilz von den Fehden des 15. Jahrhunderts sowie von einer Besetzung durch die Ungarn 1480–1490 verschont. In den Fokus kriegerischer Konflikte tritt der Ort erst während der Ereignisse der Jahre 1529 und 1532. Im Herbst 1529 tritt das Heer Sultan Suleimans I. nach der erfolglosen Belagerung Wiens seinen Rückzug durch Ungarn an. Die Nachhut wählt den Weg durch die östliche Steiermark. Sie verheert ab dem 19. Oktober das Gebiet zwischen → Friedberg und Wörth. Bevor die Truppe über die Grenze nach Ungarn abzieht, überfallen einige Reiter am 23. Oktober das weiter südwestlich gelegene Ilz. Einige Häuser brennen nieder, Menschenleben sind nicht zu beklagen.
Anders sieht es drei Jahre später aus, als das von Suleiman I. geführte osmanische Heer auf seinem Rückzug in das Gebiet einbricht. Von → Raitenau kommend, erreicht es

am 10. September 1532 Ilz, brennt das gesamte Dorf nieder und zieht anschließend nach Gleisdorf weiter. Zwar erwähnt der Chronist Celalsade Nicanci-baši Ilz nicht ausdrücklich, gibt aber die Route des Heeres an: „Auf der nächsten Station wurde Schloß Reitenau eingenommen, und am 10. Ssafer zu Gleisdorf ein paar Tage Rast gemacht.“
Im Gegensatz zu anderen oststeirischen Orten wird Ilz von den Haiduken nicht mit voller Wucht getroffen. Zwar bedrohen einzelne Reiter am 23. Juli 1605 das Dorf, können aber – wie in Gleisdorf – durch gezielte Schüsse vertrieben werden.
Weniger glücklich verläuft die Konfrontation mit den Kuruzzen: Am 25. Juli 1704 überfallen die ungarischen Aufständischen an einem einzigen Tag 62 Dörfer zwischen → Fürstenfeld und Kaindorf, berauben diese und zünden sie teilweise an. Die Bevölkerung von Ilz flieht teils in die Wälder, teils wird die oberhalb
Pfarrkirche Ilz

Pfarrkirche Ilz
des Marktplatzes stehende Wehrkirche zum Zufluchtsort. Johann Baptist Schmidt, der seit dem 8. April 1691 Pfarrer in Ilz ist, tritt den Kuruzzen entgegen, um mit ihnen zu verhandeln. Seinen Mut bezahlt Schmidt mit dem Leben: „Den 25. July ist der Woll Ehrwürdig: in Gott Edl vnd Woll gelehrte Herr Mgr: Johann Baptist Schmidt durch die Rebellischen Vngarn als Pfarrer zu Ilz in den Freydhof alhir nidergehaut worden, vnd den 27. dito in der Kirchen begraben worden“. Heute erinnert ein vor dem Eingang zur Kirche im 20. Jahrhundert aufgestellter Gedenkstein an den Geistlichen.
Die beiden benachbarten Orte bzw. Schlösser Burgau und Neudau teilen weitgehend eine Geschichte: Beide liegen an der damaligen steirisch-ungarischen Grenze im Lafnitztal. Sie entstehen fast zeitgleich (Burgau 1367, Neudau 1371) und haben zu Beginn die gleichen Eigentümer: die Herren von Puchheim, Neuberg und
Polheim. Erst im 16. und 17. Jahrhundert ändern sich die Besitzverhältnisse: Burgau fällt 1665 an die Grafen Trauttmansdorff, 1753 an die Grafen Batthyany und 1871 an die Marktgemeinde Burgau. Neudau geht 1571 an die Grafen Rottal und 1705 an die Grafen Kottulinsky, die das dortige Schloss noch heute ihr Eigen nennen.
Im frühen 15. Jahrhundert herrscht Krieg zwischen Herzog Ernst dem Eisernen und dem Ungarnkönig Sigismund: Im Frühjahr 1418 wird die Oststeiermark durch die Ungarn verheert: Beinahe alle Pfarren und die zugehörigen Dörfer werden geplündert und teilweise niedergebrannt. Wie sehr Burgau und Neudau betroffen sind, ist nicht bekannt. Sind die Schäden so schwerwiegend, dass Wilhelm Puchheim beide Herrschaften am 24. Juni 1429 an die Herren von Neuberg verkauft? Diese bleiben zwei Generationen die Besitzer, bevor die Burgen eingezogen werden (→ Neuberg und → Pöllau). Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts gehen sie wieder in private Hände über, jene der Familie Polheim.







Von den Durchmärschen osmanischer Truppen in den Jahren 1529 und 1532 sind die Burgen Neudau und Burgau kaum betroffen. Wohl sind es aber am 18. Oktober 1529 die umliegenden Höfe. Es dauert Monate, bis die Schäden erhoben sind. Erst am 8. März 1530 erstattet Weikhart von Polheim seinem Vater Erhard Bericht über die beraubten und verschleppten Personen sowie die gestohlenen Tiere:
„Vermerkt die pranttler so die turgkenn am 18. tag Octobris beschechenn verprennt worden seind Im 29 Jahr:
Dem Munssen Jegkl sein hauss vnnd hoff verprennt vnnd die turgken haben Im sein muetter kopfft.
Dem Karner Steffl haben die Turken ein pueben be 9 Jarn wegkh gefuert.
Schalckh Cristl steet sein hoff noch, aber die turgkhen haben Im ain Ross vnd ain micheln pueben wegkh gefuert vnd ain grosse diern, ist sein schwester gewesn.
Paur Hanns steet sein hoff noch, aber die turgken haben Im das maul von ainander gehagkt; ist nit todt.
Michel Haubtman ist sein hoff verprent, auch haben Im die turgken sein weib mit zwain Kinden vnd zwain rossen wegkh gefuert.“

Ähnliches geschieht im nur 4 Kilometer nördlich von Burgau gelegenen Neudau drei Jahre später. Noch während das osmanische Heer die westungarische Stadt Güns/Köszeg belagert, unternehmen Streifscharen Raubzüge in die angrenzende Steiermark. Davon ist am 7. August 1532 auch Neudau betroffen. Vom Rückzug des Hauptheeres durch die Oststeiermark Anfang September bleiben Neudau und Burgau verschont.
Ende Mai 1605 kommt es zum sogenannten Frühjahrseinfall der Haiduken. Innerhalb von sechs Tagen plündern die Aufständischen 52 Dörfer, darunter am 2. Juni auch die beiden gut befestigten Burgen Burgau und Neudau. Die dort stationierten Arkebusierreiter können den Angriffen nichts entgegensetzen und werden

Schloss Neudau, aus: Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, Graz 1681, Steiermärkisches Landesarchiv
am 4. Juni in das ebenfalls angegriffene Hartberg verlegt. Erst Mitte Juni kann den Haiduken eine ansehnliche steirische Streitmacht entgegengestellt werden. Trotzdem berauben die Rebellen die Umgebung von Burgau und Neudau am 16. Juli erneut.
In den Jahren zwischen 1619 und 1626 unternimmt der siebenbürgische Fürst Gabor Bethlen drei Versuche, die Habsburger vom ungarischen Königsthron zu stürzen. Dabei sichert er sich den Beistand der ebenfalls gegen Habsburg opponierenden Böhmen sowie des ungarischen Magnaten Ferenc II. Batthyany. Nach dem Angriff der Ungarn auf → Dechantskirchen im April 1621 werden kaiserliche Truppen zum Schutz der Grenzregion aufgeboten. Wie instabil die Lage ist, beweisen Übergriffe des auf kaiserlicher (!) Seite stehenden Grafen Tamas II. Erdödy: Seine Leute streifen am 20. und 21. Juni 1621 von Eberau aus bis an die Lafnitz und entwenden den Bauern um Neudau das Vieh. Die Steirer entsenden daraufhin je 30 Reiter und Musketiere des Landesaufgebotes nach Burgau. Im benachbarten Dorf Neudau quartiert Ortolf von Teuffenbach 16 Musketenschützen ein. Die Maßnahmen erweisen sich letztlich als nutzlos. Am 24. Juni überfallen rund 300 Ungarn Unterrohr, plündern und verwüsteten das ganze Dorf, treiben sämtliche Pferde und Kühe fort. Erst der Friede von Nikolsburg/Mikulov vom 6. Jänner 1622 beendet die Feindseligkeiten.
Als das osmanische Heer 1683 Wien belagert, schlägt sich der ungarische Magnat Kristóf II. Batthyany auf deren Seite, um seine eigenen Besitztümer zu schützen. Ab dem 16. Juli greifen seine Anhänger Orte im oststeirischen Grenzland an. Die lokale Bevölkerung flieht in die umliegenden Burgen und Schlösser, darunter auch Neudau und Burgau. Beide werden am 7. September aber selbst von den Söldnern Batthyanys angegriffen. Zahlreiche Menschen werden verschleppt, was auch von der Militärgrenze geholte Soldaten nicht verhindern können. Erst mit dem Abzug des Osmanisches Heeres von Wien am 12. September ist die Gefahr vorüber und Kristóf II. Batthyany schließt mit den Steirern Frieden.
Auch vom Kuruzzenkrieg 1704–1709 sind Burgau und Neudau betroffen: Bereits am 23. Juli 1704 wird Schloss Burgau durch die Kuruzzen erobert und geplündert. Kurz nach dem verheerenden Einfall der ungarischen Rebellen vom 25. Juli 1704, der zur Vernichtung von 62 Dörfern führt, trifft es Neudau. Am 29. Juli überfallen Leute des Kuruzzenführers Alexander Karolyi Neudau und brennen Schloss und Dorf nieder. Weil Streif- und Plünderungszüge der Rebellen anhalten, werden in den Grenzorten sowie im notdürftig wiederaufgebauten Burgau und Neudau steirische Truppen stationiert. Trotz Friedensbemühungen und weiterer Truppenstationierungen wiederholen sich die Überfälle der Kuruzzen fast jährlich. Ein Angriff auf Neudau am 21. Jänner 1707 bleibt erfolglos, bei einem weiteren am 27. August 1707 gehen 17 Häuser in Flammen auf. Während Schloss Burgau diesmal Widerstand leisten kann, steht Neudau der schlimmste Angriff noch bevor: Am 14. Oktober 1708 brechen die Kuruzzen mit 6.000 bis 8.000 Mann in den Ort ein. Nach langem Beschuss des Schlosses und der Weigerung der Besatzung, die geforderte Brandschatzung (Geld und Naturalabgaben) zu leisten, zünden die Rebellen das Dorf an. Nur der Pfarrhof, die Kirche und sechs Häuser überstehen das Inferno. Das Vieh auf der Weide wird fortgetrieben. Der in Neudau stationierte Oberst Johann Ludwig von Moltenberg wagt angesichts der Größe der angreifenden Truppe keinen Gegenangriff, blockiert mit seinen Leuten aber
Tschardaken errichten
Um ein Frühwarnsystem und zugleich eine Verteidigungslinie gegen die ungarischen Rebellen zu schaffen, wird im Frühjahr 1706 die Errichtung von Erdwällen und zahlreichen Tschardaken entlang der damaligen steirisch-ungarischen Grenze beschlossen. Während die Erdwälle Annäherungshindernisse darstellen, dienen die Tschardaken als Beobachtungs- und Wehrtürme. Ihre Bauweise und Schießluken in alle Richtungen ermöglichen der Besatzung einen guten Rundumblick und flexibles Agieren. Ihre Positionierung in Sichtweite zueinander ermöglicht im Bedarfsfall die Verständigung über Signale. Da Tschardaken reine Holzkonstruktionen sind, ist keine der originalen erhalten geblieben. Daher wurde im Zuge der steirischen Landesausstellung Zum Schutz des Landes 1986 auf Schloss Herberstein bei Burgau eine Tschardake nachgebaut. Sie steht noch heute südöstlich des Ortskerns von Burgau, flussaufwärts der über die Lafnitz führenden Brücke („Krois Straße“), und kann das ganze Jahr über besichtigt werden.

Tschardake und Grenzfluss Lafnitz bei Burgau
die Wege in die Steiermark. Der letzte Angriff auf Neudau ereignet sich am 8. September 1709: Gegen 16 Uhr dringen etwa 60 Kuruzzen in den Ort ein, töten drei Garnisonssoldaten und verwunden sechs weitere schwer. 18 Stück Vieh werden geraubt, den Kuruzzen aber wieder abgenommen. Wenige Tage später ist der Krieg in der Steiermark zu Ende.
Die am Masenberg entspringende Lafnitz spielt in keiner der kriegerischen Auseinandersetzungen eine entscheidende Rolle: Die Breite des

Flusses und sein Wasser reichen nicht aus, um feindliche Heere und Streifscharen aus dem Osten aufzuhalten. Immer wieder dient sie über die letzten 1.000 Jahre aber als Orientierung beim Aushandeln und Festlegen von Grenzverläufen.
So wird die Lafnitz 1043 – nach einem siegreichen Feldzug des deutschen Königs Heinrich III. gegen Ungarn – Grenze zwischen dem „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“ und Ungarn. Zusammen mit der Leitha und der Kutschenitza behält sie diese Funktion bis zur Auflösung des Reiches im Jahr 1806 bei.

Lafnitz/Lapincs, Grenzfluss zwischen Österreich und Ungarn
Seitdem markiert sie die Grenze zwischen dem habsburgischen Kaisertum Österreich und dem gleichfalls habsburgischen Königreich Ungarn. Nach dem Zusammenbruch des Habsburgerreichs 1918 bleibt die Lafnitz für drei Jahre die Grenze zwischen der Steiermark und Ungarn. Mit dem Friedensschluss von Trianon bzw. der Abtrennung des heutigen Burgenlandes („Deutschwestungarn“) von Ungarn wird sie zur Landesgrenze zwischen der Steiermark und dem Burgenland. Östlich von Jennersdorf bildet die Lafnitz auch heute noch auf einer Länge von rund 800 Metern die Grenze zwischen Österreich und Ungarn, ehe sie in St. Gotthard/ Szentgotthárd in die Raab mündet.
Seit jeher Grenzstadt, ist Fürstenfeld öfter mit kriegerischen Ereignissen konfrontiert als jeder andere oststeirische Ort. Vor diesem Hintergrund wird Fürstenfeld wie auch Graz und → Radkersburg schon im Mittelalter stark befestigt und ab Mitte des 16. Jahrhunderts durch das neuartige Basteiensystem geschützt.
1412 ist Fürstenfeld von der Walseerfehde betroffen. Dem Prior des Augustinerklosters werden durch Leute des Walsee’schen Burggrafen Peter Anhanger von Köppach vier Dörfer „geödet vnd die laeut verjagt, etlich gevangen vnd geschaect“. Im Frühjahr 1418 überfallen dann im Zuge der Auseinandersetzung zwischen dem steirischen Herzog Ernst dem
Eisernen und dem ungarischen König Sigismund ungarische Truppen fast alle oststeirischen Pfarren. Betroffen ist auch Fürstenfeld.
Besonders stark trifft Fürstenfeld die Baumkircherfehde 1469–1471. Bereits am zweiten Tag, am 2. Februar 1469, wird Fürstenfeld von Leuten des rebellierenden Adeligen besetzt. Weil Kaiser Friedrich III. böhmische Söldner unter Jan Holub ins Land holt und sich gegenüber Andreas Baumkircher unnachgiebig zeigt, weitet sich die Fehde aus. Mitte Juli 1469 bemüht sich Holub um die Rückgewinnung des ebenfalls besetzten → Radkersburg, als ihn die Nachricht von der Einnahme eines Wehrturms in der Ummauerung Fürstenfelds durch seine Gefolgsleute erreicht. Daraufhin führen sowohl er als auch Baumkircher weitere Truppen nach Fürstenfeld. Die folgenden Ereignisse beschreibt der Kärntner Pfarrer und Chronist Jakob Unrest: „Der Holupp cham dar mit vil gueten lewdten. Des ward gewar der Pamkircher und cham mit seinen zewg auch dar, der stat zu retung, und des mitichen vor sannd Maria Magalenatag chum payd hawffen vor der stat zusam und tetten ein treffen miteynannder.“
Diese Schlacht von Fürstenfeld findet am 21. Juli statt, verläuft äußerst blutig und bedeutet auf der Seite Baumkirchers über 300 Tote, 500 Schwerverletzte und etwa 400 Gefangene. Die Verluste der Kaiserlichen sind zwar geringer, doch wird Holub schwer verletzt und stirbt kurz darauf in Graz. Fürstenfeld und seine Bürger treffen die Kampfhandlungen schwer, Gebäude werden zerstört, zu den Verwundeten kommen Seuchen hinzu. Von den weiteren Ereignissen der Fehde bis zur Gefangennahme des Andreas Baumkircher und seiner Hinrichtung in Graz am 23. April 1471 ist Fürstenfeld nicht betroffen.
An der Jahreswende hin zu 1480 beginnen Truppen des ungarischen Königs Matyas Corvinus mit der Besetzung steirischer Orte und Burgen. Viele öffnen den Ungarn kampflos ihre Tore. Fürstenfeld dagegen leistet Widerstand, weshalb die Ungarn im Mai mit der Belagerung der Stadt beginnen. Kaiserliche Entsatztruppe werden zur Hilfe entsandt, doch „dye versawmbten sich underwegen pey den
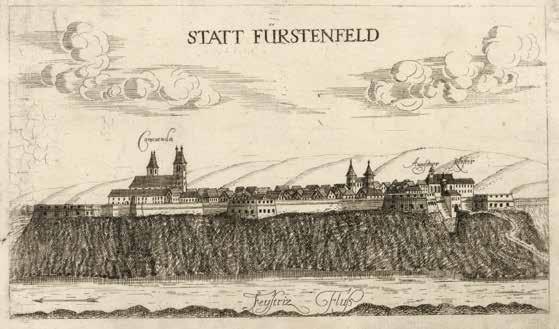
Ansicht der Stadt Fürstenfeld, aus: Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, Graz 1681, Steiermärkisches Landesarchiv
weynkellernn, das die zeyt vergienng, darin man ir in der statt gewart hett, und wurden der mayst tayl unterwegen von den Vngrischen erschlagen und nidergelegt“. Fürstenfeld kann einen schweren Ansturm der Ungarn abwehren, wird aber dann durch Brandpfeile in Flammen gesetzt und kapituliert am 26. Mai 1480. An die 500 Bewohnerinnen und Bewohner werden getötet oder erliegen Krankheiten. Reiche Bürger werden nach Ofen/Budapest verschleppt. Die Stadt wird bis auf einige Häuser und das Augustinerkloster niedergebrannt. Nicht einmal vor diesem machen die Ungarn halt. Sie plündern das Gebäude, der aus Rattenberg stammende Mönch Heinrich Harder wird erwürgt. Jakob Unrest schreibt dazu: „Am freytag vor Gotsleychnamstag tetten die Vngrischen ainen swarn sturm an der Statt, doch muesten sich mit schaden abtretten. Nachdem gewunen sy die statt mit anfewern; darynn verprannen vill lewdt vnd wurden funffhundert menschen darynn gevangen; also wardt die stat von den Vngrischen genott vnd verwuest.“ Nach dem Fall von Fürstenfeld steht die Steiermark den Invasoren schutzlos gegenüber und wird für die Dauer von zehn Jahren größtenteils besetzt.
Während der folgenden Jahre verlagert sich das Kriegsgeschehen in die Obersteiermark und nach Niederösterreich, Fürstenfeld wird notdürftig wiederaufgebaut. Für 1488 gibt es unbestätigte Angaben zu einem erneuten Angriff auf die Stadt. Erst 1490, mit dem Tod des Ungarnkönigs Matyas Corvinus, wird Fürstenfeld wieder habsburgisch. Aufbauarbeiten im frühen 16. Jahrhundert werden mehrfach durch Brände zurückgeworfen. Ein amtlicher Bericht aus dem Jahr 1543 gibt an, dass ein Gutteil der Häuser verödet ist.
Der Durchzug der osmanischen Truppen 1529 und 1532 berührt Fürstenfeld nur indirekt: Eine 200 Mann starke steirische Truppe nimmt in Fürstenfeld Quartier, die am 19. August 1532 bei Stegersbach auf eine zehnfache feindliche Übermacht gestoßen und geflüchtet ist. Was folgt, ist aber eine Modernisierung der Stadtbefestigung: Für den Ausbau der Festung wird die Topografie genutzt: Fürstenfeld liegt auf einer steil abfallenden Terrasse und ist daher gegen Nordosten hin geschützt. Die flach gegen Ungarn gelegene Seite muss hingegen stark befestigt und zusätzlich durch einen Graben

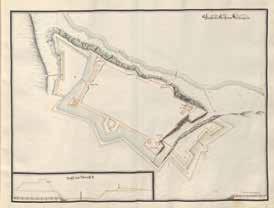
„Abriss von Fürstenfeld“, Kartograf Martin Stier, um 1660, Steiermärkisches Landesarchiv
gesichert werden. Die bereits bestehende Pfeilburg wird in den neuen Festungsgürtel einbezogen. Die mittelalterliche Ringmauer wird ab 1553 mit modernen Basteien versehen, die Stadttore durch Türme verstärkt. Verantwortlich dafür ist der italienische Festungsbaumeister Domenico dell’Allio, der auch in Radkersburg aktiv ist. Mit seinem Tod im Jahr 1563 übernimmt Francesco Thibaldi die Bauleitung und vollendet Basteien und Ungartor. Weil sich die Kurtinen zwischen den Basteien mit 530 bzw. 430 Metern als zu lang erweisen, werden Mittelbollwerke geplant, aber erst wesentlich später errichtet. Schäden an der Befestigung entstehen 20 Jahre später: Am 13. Juni 1683 explodiert nach einem „Thunderskhnal“ (Blitzeinschlag) der Pulverturm. Durch die Druckwelle stürzen Basteien ein, Geschütze werden durch die Luft geschleudert, das Augustinerkloster, das Rathaus und viele Bürgerhäuser schwer beschädigt. Die Schäden sind noch nicht behoben, als am 16. Juli ungarische Truppen mit Billigung des Grafen Kristóf II. Batthyany die Umgebung Fürstenfelds verwüsten, die Stadt selbst aber nicht angreifen.
Im Verlauf des 16. Jahrhunderts kommt es an der Militärgrenze im heutigen Kroatien zu
zahlreichen Kämpfen zwischen christlichen und osmanischen Truppen. 1593 eskaliert die Situation, weshalb Erzherzog Ernst Melchior von Rödern mit der Anwerbung von Hilfstruppen in Schlesien betraut. Auf ihrem Weg nach Kroatien nimmt diese 500 Mann starke Einheit vom 28. März bis Anfang Mai 1593 Quartier in Fürstenfeld. Weil sie ihren Sold aufgebraucht haben und keine weitere Bezahlung erhalten, sichern die Reiter ihren Lebensunterhalt durch Plünderungen, Erpressungen und Räubereien in Fürstenfeld und im nahen Altenmarkt.
Als verheerend erweist sich der Beginn der Haidukeneinfälle für Fürstenfeld. Nachdem die Haiduken ab dem 26. Mai 1605 etliche Orte im Raabtal sowie im Tal des Grazbaches um Hatzendorf zerstört haben, erreichen sie am 28. Mai die Stadt. Trotz der Hilferufe des dortigen Hauptmannes Jonas von Wilfersdorf gelingt es nicht, die Stadt in Verteidigungsbereitschaft zu setzen. Große Teile der Bevölkerung sind geflohen, noch nicht einmal die Zugbrücken wird hochgezogen. So dringen die Haiduken kampflos in den Ort ein, zünden 92 Gebäude an, töten oder verschleppen 20 Bewohner, rauben 300 Rinder, 130 Schweine und 56 Pferde. Während es in Fürstenfeld in der Folge keinen weiteren Haidukeneinfall mehr gibt, werden weite Teile der Oststeiermark in zwei weiteren großen Angriffswellen bis in den Dezember 1605 schwer in Mitleidenschaft gezogen.
In den Jahren 1619 bis 1626 unternimmt der siebenbürgische Fürst Gabor Bethlen drei Versuche, Kaiser Ferdinand II. vom ungarischen Königsthron zu stürzen. Die Steirer verfolgen das Geschehen mit Sorge und stationieren das Landesaufgebot an der Grenze. Fürstenfeld wird zum Hauptquartier der Landsknechte, 1620 auch von Reitern. Abgesehen von einem Einfall in → Dechantskirchen 1621, unterbleiben Angriffe von Bethlens Truppen auf steirisches Gebiet aber. Trotzdem bleiben in Fürstenfeld und anderen Grenzstädten steirische Aufgebotstruppen stationiert, die erst nach dem Frieden von Preßburg/Bratislava am 20. Dezember 1626 entlassen werden.
1663 führt die Nachricht vom Vormarsch eines osmanischen Heeres Richtung Westen in Fürstenfeld zu einer Reihe von Maßnahmen: Die Grazer Vorstadt und Schloss Falbenegg werden abgerissen, die Zugbrücken an den Stadttoren erneuert und Geschütze auf den Mauern postiert. Ein kaiserliches Regiment soll zusammen mit Söldnern des Stadtkommandanten Wilhelm Anton von Daun die Stadt schützen. Diese aber bestehlen die Bürger, rauben den Bauern das Vieh und erpressen Lebensmittel und Wein, was beinahe zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den Fürstenfeldern und ihren „Beschützern“ führt. Als im Folgejahr 1664 osmanische Truppen im ungarischen Raabtal weiter vorrücken, füllt sich Fürstenfeld mit Flüchtlingen. Zu ihnen kommen desertierte Soldaten, die durch falsche Nachrichten von einer Niederlage der kaiserlichen Armee für Panik sorgen. Seuchen, die sie einschleppen, verbreiten sich zwischen August und Oktober 1664 rasch in und vor der Stadt und fordern 300 Todesopfer. Die vom Krieg selbst ausgehende Gefahr endet mit dem Sieg des christlichen Koalitionsheeres unter Raimondo Montecuccoli am 1. August bei St. Gotthard-Mogersdorf und dem Frieden von Eisenburg/Vasvar zehn Tage später. Während der Schlacht ist Fürstenfeld Auffanglager und Lazarettstadt. Bis heute erinnert eine Mariensäule am Fürstenfelder Hauptplatz an die Ereignisse.
Weil etliche ungarische Magnaten mit den Bestimmungen des Friedensschlusses

unzufrieden sind, zetteln sie gegen Kaiser Leopold I. eine Verschwörung an. Petar IV. Zrini, Ferenc Kristóf Frankopan, Ferenc III. Nadasdy sowie der steirische Adelige Johann Erasmus von Tattenbach planen die Ermordung des Herrschers und die Einnahme von Fürstenfeld, Graz und Radkersburg. Die Konspiration wird jedoch aufgedeckt und endet mit der Hinrichtung der Verschwörer im Jahr 1671. Fürstenfeld erhält eine kaiserliche Besatzung.
1683 zieht wieder ein gewaltiges Heer aus dem Osmanischen Reich Richtung Wien. Um seine Besitzungen zu schützen, huldigt der ungarische Magnat Kristóf II. Batthyany den Gegnern. Zunächst signalisiert er den Steirern Friedensbereitschaft, veranlasst dann aber doch Einfälle ins oststeirische Grenzgebiet. Am 16. Juli 1683 wird das Gebiet südlich von Fürstenfeld geplündert. Als tags darauf Fürstenfeld mit Brand und Plünderung gedroht wird, interveniert Stadtrichter Georg Schedenegg erfolgreich persönlich bei Batthyany in Güssing. Zwei Wochen später führt Karl von Saurau einen grausamen Rachefeldzug nach Ungarn durch. Ihm zur Seite stehen neben Regimentssoldaten auch geschädigte Bauern sowie die Besatzung von Fürstenfeld. Nicht alle heißen das Unternehmen Sauraus gut und meinen, „der Bathiani werde sich grausam rechen auf das, welches also mit Sengen vnd Prennen geschehen“ wird. Tatsächlich lässt die Vergeltung der Anhänger Batthyanys nicht lange auf sich warten. Am 22. August stoßen sie bis Rudersdorf vor, brennen Speltenbach nieder und
Städte befestigen
Bereits im Mittelalter sind Städte hierzulande durch Mauern geschützt. Die Verbreitung von Feuerwaffen erfordert aber neue Verteidigungskonzepte. So werden ab dem 16. Jahrhundert die mittelalterlichen Stadtmauern adaptiert und erweitert: Nach italienischem Vorbild werden Gräben, fünf bis sieben Meter unter dem Normalniveau, um die Städte gezogen. Von diesen aus ragen Bastionen (Bollwerke) 10 bis 14 Meter in die Höhe. Kurtinen (gerade Wälle) verbinden die max. 400 Meter voneinander entfernt liegenden Basteien miteinander. Teilweise werden zum Schutz der Kurtinen eigene Bauwerke (Ravelins) vorgelagert, um den neuen waffentechnischen Standards zu entsprechen. Der Zugang der Menschen wird über Tore gesteuert. Wo möglich, wird die Topografie genutzt, werden Flüsse, Erhöhungen oder Felsen in die Befestigung einbezogen. Die Errichtung einer solchen Befestigungsanlage ist kostspielig und braucht einen finanzkräftigen Auftraggeber: Neben den Materialien gilt es, den Festungsbaumeister und die Handwerker zu entlohnen, die als Experten Jahre mit dem Bau einer Festung zubringen.


Wehrgraben und Kavalier der Stadtbefestigung sowie das Grazertor
greifen Fürstenfeld an. Die heftige Gegenwehr der Bürger und der kaiserlichen Besatzung kostet 300 Rebellen das Leben. Zwei Tage später verlassen die Soldaten Fürstenfeld und werden durch einen Teil des steirischen Landesaufgebotes ersetzt. Mit der Niederlage des osmanischen Heeres am 11. September 1683 vor Wien wendet sich Kristóf II. Batthyany von ihnen ab. Am 15. September ersucht er durch Paul Schölley in Fürstenfeld um Vergebung und bietet den Steirern seine Dienste an.
Gut 20 Jahre später, am 26. Mai 1704 erhält
Fürstenfeld die Nachricht von 20.000
Kuruzzen, die beim Kloster St. Gotthard/ Szentgotthárd zum Angriff auf die Stadt bereitstünden. Anstatt der verlangten Unterwerfung nachzukommen, ersuchen die Fürstenfelder in Graz um Hilfe. Das einberufene steirische Landesaufgebot erleidet am 4. Juli bei Mogersdorf eine Niederlage und wird fast komplett aufgerieben. Damit steht die Steiermark den Kuruzzen ungeschützt offen. Allein am 25. Juli 1704 fallen ihnen 62 Dörfer zum Opfer, unmittelbar vor Fürstenfeld sind Altenmarkt und Stein betroffen. Aus Rache plündern Fürstenfelder Bürger am 24. August das benachbarte Rudersdorf in Ungarn. Dankt seiner Befestigung sowie der wechselnden Besatzung durch kaiserliche und steirische Truppen bleibt Fürstenfeld bis zum Ende des Kuruzzenkrieges von weiteren Angriffen verschont.
Der Befestigungsgürtel um die Stadt wird 1775 aufgelassen. Die heute teilweise noch sehr gut im Original erhaltenen Wehranlagen aus dem 16. und 17. Jahrhundert sind durch den „Festungsweg“ erschlossen. Von der mittelalterlichen Befestigung ist der Schwarzturm sowie das Grazertor in veränderter Form erhalten. Die wechselvolle Geschichte der Stadt wird anschaulich im Museum in der Pfeilburg präsentiert.

23. Riegersburg
Die andauernde Bedrohung der Steiermark im 16. und 17. Jahrhundert sowie waffentechnische Neuerungen machen die Adaptierung mittelalterlicher Burgen notwendig. Eine davon ist die oststeirische Riegersburg. Wo heute die Riegersburg thront, existiert vermutlich schon im 7. Jahrhundert eine kleine Fluchtburg. Die erste größere Burganlage entsteht um 1100 auf der Nordkuppe des etwa 100 Meter hohen Basaltfelsens. 1138 wird die Riegersburg erstmals als „Ruotkerspurch“ urkundlich erwähnt. Im Laufe des Mittelalters ist die fortan „Kronegg“ genannte Obere Burg Spielball in Auseinandersetzungen und politischen Machtkämpfen. Räumlich näher zum Tal wird die „Burg Lichtenegg“ samt zugehörigem Markt errichtet. Beide Burgen verschmelzen im Laufe der Jahrhunderte zu einer einzigen Wehranlage.
Was die Bedeutung der Riegersburg in den Auseinandersetzungen des 15. bis 18. Jahrhunderts angeht, ist zu Beginn die Walseerfehde zu nennen: Im Konflikt des Reinprecht II. von Walsee mit dem steirischen Herzog Ernst dem
Eisernen erweist sich Burggraf Peter Anhanger von Köppach als besonders aggressiv und verwüstet mit seinen Leuten landesfürstlichen Besitz. Entführte Personen werden in der Riegersburg eingesperrt und nur gegen Lösegeld freigelassen. Die Reaktion von Ernst dem Eisernen lässt nicht lange auf sich warten: Im Oktober 1412 belagert und erobert das herzogliche Heer die untere Burg Lichtenegg, woraufhin sich auch die höher gelegene Festung Kronegg ergibt. Das Besondere an dieser Belagerung: Erstmals werden zu diesem Zweck in der Steiermark Feuerwaffen (Steinbüchsen) eingesetzt. Da Reinprecht II. von Walsee mit seiner Fehde „wider das landthrecht in Steir“


Ansicht von Schloss Riegersburg, aus: Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, Graz 1681, Steiermärkisches Landesarchiv
verstößt, erhält er eine Geldstrafe und verliert die Riegersburg vorübergehend. Erst im August 1417 bekommt er die beiden Riegersburger Festungen zurück. Bereits im Folgejahr 1418 bedrohen die Ungarn sämtliche oststeirische Pfarren, darunter auch Riegersburg.
Mittlerweile über die Stubenberger, Reichenburger und Graben an die Herren von Stadl gefallen, ist die Riegersburg im 16. Jahrhundert zu einer gut ausgebauten Fluchtburg geworden. Das kommt der Bevölkerung zugute, als die Haiduken am 27. Mai 1605 sich der Burg zwar nähern, einen Angriff auf das Bollwerk aber unterlassen. Als ein osmanisches Heer 1663/1664 in Richtung Wien vordringt, bewährt sich die Riegersburg neuerlich als Fluchtort.
Zu dieser Zeit ist das Hochschloss bereits zu einem uneinnehmbaren Bollwerk geworden. Den Hauptverdienst daran trägt Katharina Elisabeth Galler. Als sie im 17. Jahrhundert ihr Erbe auf der Riegersburg antritt, ist diese in keinem guten Zustand. Über viele Jahre lässt sie die Vorburg, das Zeug- und Offiziershaus erbauen. Mit der Errichtung zahlreicher Bastionen, Tore, Türme und Mauern soll der Zugang erschwert werden, meterdicke Kurtinen dem Beschuss durch die Artillerie standhalten. Erst
nach dem Tod der „Gallerin“ 1672 werden die Arbeiten an der Burg unter Johann Ernst von Purgstall fertiggestellt. Damit erlangt die Festung ihr heutiges Aussehen.
Seit 1822 befindet sich die Riegersburg im Besitz der Fürstenfamilie Liechtenstein und kann von April bis Oktober besichtigt werden.
Eine vorgelagerte Schutzfunktion für die nahe → Riegersburg haben die Herren von Kornberg inne, seitdem sie Mitte des 13. Jahrhunderts im Auftrag der Wildonier die Burg Kornberg auf einem Höhenrücken über dem Auersbachtal errichtet haben. 1284 erstmals urkundlich



erwähnt, dient die Anlage ursprünglich noch nicht als Wohnschloss. Neben der Kontrolle des südlichen Zugangs zur Riegersburg gilt es, das Grenzland gegen die Ungarn zu sichern, eine Aufgabe, der Kornberg aber nie gerecht wird. Vielmehr dient die Burg als Verwaltungssitz für die in der Oststeiermark begüterte Familie Graben, der Kornberg seit 1328 gehört. Den Umbau der Burg zum Wohnschloss vollzieht im Laufe des 17. Jahrhunderts Hans Rudolf von Stadl, der in Graz als Hofkriegsrat wirkt. Als 25-Jähriger heiratet er die 66-jährige reiche Witwe Katharina Elisabeth von Capell, besser bekannt als die „Gallerin“ und Besitzerin der
Riegersburg. Auf diese Weise gelangt er an die für den Umbau nötigen Finanzmittel. Mit der Umfunktionierung zum Wohnschloss verliert Kornberg seinen Wehrcharakter und seine Wehrfunktion endgültig. Heute befindet sich das Schloss im Besitz der Familie Bardeau und kann besichtigt werden.
Am rechten Rand des breiten, offenen Raabtals, am Kreuzungspunkt der Nord-Süd- und WestOst-Verbindungen gelegen, wird Feldbach 1188 als „Velwinbach“ erstmals genannt. Im hier verhandelten Zeitraum ist es mehrfach von Fehden und Kampfhandlungen betroffen:
Während der Walseerfehde fällt im Oktober 1412 der noch unbefestigte Ort beinahe den Anhängern des Riegersburger Burggrafen Peter Anhanger von Köppach in die Hände. Die Bürgerschaft kann den Angriff im Morgengrauen aber abwehren. Sechs Jahre später wird der Markt geplündert, als die Ungarn im Frühjahr 1418 in die Oststeiermark einfallen. Als am 18. November ein Provinzialkonzil Steuern zur Reparatur der Kriegsschäden einfordert, ist die Pfarre Feldbach eine der wenigen, die zahlen kann. 20 Jahre später gerät der Markt während der Wolfsauerfehden zweimal zum Angriffsziel des Christoph von Wolfsau. 1438 zünden dessen Söldner einige Häuser an, ehe das Landesaufgebot für Herzog Friedrich V. (der spätere Kaiser Friedrich III.) die Lage wieder unter Kontrolle bringt. 1440 wiederholt sich das Szenario. Im Streit zwischen den habsburgischen Brüdern Albrecht VI. und Friedrich V. stellt sich der Wolfsauer auf Albrechts Seite und wieder gehen seine Anhänger gegen landesfürstlichen Besitz vor. Die Schäden sind so schwerwiegend, dass Feldbach am 2. Dezember 1441 Steuernachlass zur Finanzierung von Reparaturen gewährt wird.
Die bisher genannten Ereignisse führen stets zum Wiederaufbau, nicht aber zur Errichtung von Wehrbauten in Feldbach. Das ändert sich mit der Baumkircherfehde 1469–1471: Bereits am zweiten Tag seiner Auseinandersetzung mit Kaiser Friedrich III. lässt Andreas Baumkircher



Tabore errichten
In den mittelalterlichen Burgen gibt es den Bergfried als letzte Zufluchtsstätte. Ähnlich besitzen etliche steirische Orte sogenannte Tabore, um der lokalen Bevölkerung zumindest kurzfristig Schutz zu bieten. Der Begriff Tabor bezeichnet eine frühneuzeitliche Wehranlage aus Mauern, Wohnräumen, Speichern und Ställen. Tabore werden innerhalb der Orte, im Regelfall rund um die Kirchen oder am Rande der eigentlichen Siedlung erbaut. In die bereits bestehende Befestigung integriert, müssen relativ wenige zusätzliche Mauern oder Gebäude errichtet werden. In der östlichen Steiermark sind Tabore in Fehring, Feldbach, Kirchberg an der Raab, Straden und Weiz bekannt.
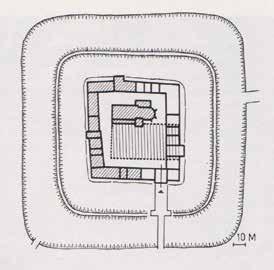
Plan gotischer Tabor, Rekonstruktion 15. Jahrhundert, Neuanfertigung UMJ nach Peter Krenn, Die Oststeiermark. Ihre Kunstwerke, historischen Lebens- und Siedlungsformen, Salzburg 1987.
neben anderen Orten auch Feldbach angreifen. Jakob Unrest schreibt dazu: „Herr Anndre Pamkircher, herr Andre Stubenberg“ und andere, „all Steyrer, mit irren helffern uberfiellen und abtrungen die stat Marburgk, Furstenfeld, Harperg, Fewstruz und Veldpach […] und von den stetten und geschlossen pekryegten sy den kayser und all sein inwanner seiner lanndt.“ Den blutigen Kampfhandlungen folgen zwar Verhandlungen zwischen kaiserlichen Räten und Baumkircher, im Jänner 1471 kommt es aber erneut zu Kämpfen, die Feldbach treffen. Der Konflikt, der mit der Hinrichtung Baumkirchers am 23. April 1471 endet, gibt schließlich den Anstoß zum Bau eines Tabors als Zufluchtsstätte nördlich des Ortskerns. Vermutlich im Jahr 1474 fertiggestellt, besteht dieser aus elf zwei- bis dreigeschossigen Häuschen („Gaden“) mit Wehrgängen, Wohnstuben und Vorratsspeichern. Annähernd in einem quadratischen Geviert angeordnet, wird das Äußere des Tabors durch eine Umfassungsmauer, einen Graben sowie Türme verstärkt. Das Zentrum steht die Kirche St. Leonhard.
Der Umstand, dass der Ortskern weiter ohne Ummauerung bleibt, führt während der Angriffe der Haiduken 1605 zu einer weiteren
Plünderung Feldbachs. Im Morgengrauen des 26. Oktober wird der Markt eingeschlossen. 200 deutsche Knechte unter Georg Christoph Rüd von Kollenberg verstärken die im Tabor verschanzte Bevölkerung. Der übrige Ort wird den Haiduken preisgegeben. Diese ziehen sich schon nach kurzer Zeit zurück, nachdem sie einige Häuser angezündet und die Kirchen geplündert haben. Bei ihrem Rückzug Richtung Ungarn brennen die Rebellen noch den sogenannten Scheithof nieder und vernichten die Mühle in Leitersdorf.
Die Ereignisse von 1605 führen schließlich zur Befestigung des gesamten Ortes, auch wenn die Arbeiten dazu erst Jahre später beginnen – die Sicherung der größeren Grenzstädte → Fürstenfeld und → Radkersburg hat Vorrang. 1620 aber lässt der Grenzbaumeister Hans Albrecht Wendschütz einen Graben ausheben und einen Erdwall rund um den Ort aufwerfen. Ein vierzig Jahre später von Martin Stier gezeichneter Plan zeigt endlich ein unregelmäßiges Sechseck, das den Tabor an der Nordseite miteinschließt und zudem fünf Basteien sowie drei Stadttore aufweist.
Die neuen Wehranlagen schützen Feldbach in den folgenden Jahrhunderten ebenso wie die beinahe durchgehende Stationierung von Aufgebots- und Regimentssoldaten im Ort. Selbst während des Kuruzzenkrieges wird Feldbach nicht angegriffen, obwohl die Gegend nördlich davon bis → Hartberg am 25. Juli 1704 fast flächendeckend verwüstet wird.
Kirchberg an der Raab
Trotz seiner Lage wird Kirchberg an der Raab vom 15. bis zu 18. Jahrhundert nie von äußeren Feinden angegriffen. Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass in Kirchberg eines der wenigen hochherrschaftlichen Prunkschlösser des steirischen Grenzlandes steht. Dieses geht im Kern auf eine mittelalterliche Wehranlage zurück, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Graf Siegbert Heister, einem wahren Kriegsprofiteur, zu einer barocken Schlossanlage umgebaut wird. Als kaiserlicher General und Feldmarschall in den Kriegen des späten 17.
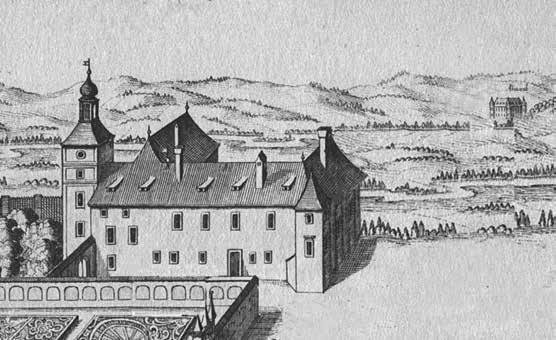
Zustand des Zebingerschlosses anno 1605, Collage auf der Basis von Vischers Topographia Ducatus Styriae, 1681, Steiermärkisches Landesarchiv
und frühen 18. Jahrhunderts sowie aus dem Verkauf der geerbten Burg Goschütz/Gosccz im heutigen Polen kann er jenes Geld lukrieren, mit dem er 1696 von Johann Josef von Steinpeiß Schloss Kirchberg kauft. Er bezahlt es erst drei Jahre später, um dann umgehend mit dessen Umbau zu einer dreiflügeligen Barockanlage zu beginnen. Am Gebäude selbst befindet sich noch ein aufschlussreiches Detail, nämlich die Darstellung von Waffen und Kriegsgerät des frühen 18. Jahrhunderts, gleichsam Hinweis auf die kriegerische Entstehungszeit des Schlosses wie auch den Wirkungsbereich Heisters.
Die Architektur des Schlosses baut auf jenen mittelalterlichen Kern und Bergfried auf, der im Verlauf der Walseerfehde im 15. Jahrhundert beschädigt wird. Angeblich gehört Burg Kirchberg damals dem „Erasm dem Phuntan“ und wird 1412 vom Riegersburger Burggrafen Peter Anhanger von Köppach teilweise zerstört. In den Akten ist diese Zerstörung jedoch nicht nachweisbar. In welchem Ausmaß Kirchberg von der Baumkircherfehde, der blutigsten Fehde des 15. Jahrhunderts, betroffen ist, lässt sich
aus den Quellen nicht eindeutig rekonstruieren. Sicher ist, dass die ortsansässige Bevölkerung unter Plünderungen und hohen Steuerleistungen zu leiden hat. Höfe veröden oder können aus Mangel an Arbeitskräften nicht mehr bewirtschaftet werden. Laut Marchfutterurbar von 1479 liegen in Kirchberg von ehemals 15 Höfen sieben brach. Die Besetzung weiter Teile des Landes durch Matthias Corvinus in den Jahren 1480 bis 1490 tangiert Kirchberg weder militärisch noch wirtschaftlich. Die Zahl der Untertanen steigt wieder an.
Eine kurzzeitige Militärpräsenz ergibt sich erst wieder im Jahr 1600 im Zuge der Gegenreformation: Erzherzog Ferdinand II. verfügt die Ausweisung sämtlicher Protestanten aus der Steiermark und betraut Religionsreformationskommissionen mit der Durchführung. Eine solche kommt auch nach Kirchberg und stellt die Bevölkerung vor die Wahl, katholisch zu werden oder das Land zu verlassen. Die begleitende bewaffnete Garde geht gegen protestantische Einrichtungen vor: „Folgenden / nemblich den 4. Tag Junij / hat der Guardi Haubtman den nit

weit entlegenen Luthrischen Freythoff mit Boecken eingestossen / vnd die gegen S. Marein gehoerige Filial zu Kirchberg / welche ein Predicant possidiert, eingenomen / vnd dieselbig sampt einer Monstrantzen / drey Kelchen / vnnd etlich Meßgewändern dem Pfarrer zu S. Marein eingeraumbt.“
Fünf Jahre später werden kaiserliche Söldner stationiert, um Kirchberg vor den anrückenden ungarischen Haiduken zu schützen. Gemeinsam mit ortsansässigen Bauern sollen diese die Verteidigung übernehmen. Die Haiduken kommen zwar nicht, doch treiben die Söldner ihr Unwesen. So berichtet der damalige Besitzer Kaspar Zebinger: „Zum andern und das noch mehr ist, haben sich unterschiedlicher Herren Unterthanen, in die 400 stark, zusammen gerottet und alldort am Kirchperg, in Meinung des Feindes Einfall zu verhindern, in die fünf Wochen gelegen, welche nicht allein meiner Unterthanen Häuser mit Gewalt aufgebrochen und was sie darinnen gefunden, hinweg genommen, reverender die Schweine niedergeschossen und verzehrt, sondern auch mir meinen
Edelmanns-Sitz oder Stock alldort am Kirchperg gewaltthätig aufgestossen, meinen Maier, als er sie gebeten, solchen Gräuel zu verlassen, geschlagen, mir alle Kisten und Kasten geöffnet und was sie darinnen gefunden, hergenommen und verzehrt; bei dem haben sie es nicht verbleiben lassen, sondern haben mir meinen Maierhof beraubt und alles kleine Vieh, was sie gefunden, gar die Schweine hergenommen und verzehrt.“
Im Dezember 1605 wiederholt sich das Szenario, nur sind diesmal keine kaiserlichen Söldner, sondern Reiter des Landesaufgebots daran beteiligt. Kaspar Zebinger schreibt am 18. des Monats: „Item am dritten als vor den vergangenen Weihnachtsfeiertagen drei Fahnen Reiter, als des Herrn Träxl, Herrn von Herberstein und des Marin dort um Kirchberg herumgelegen haben, sie meinen armen Unterthanen ihre Keller aufbrachen, die Wein austrunken und verwüstet, ihnen auch Haber, Heu und andere Sachen, was sie gefunden, hinweg genommen und die armen Leut Winterfütterung, also entblösst, dass sie ihr Vieh aus Mangel derselben mit Schaden fast um halbes Geld verkaufen müssen.“
In den folgenden Jahren kommt es innerhalb der Familie Zebinger zu Erbstreitigkeiten, die 1612 in eine Teilung der Herrschaft münden. Es entstehen die Burg Oberkirchberg mit dem Dorf und der von einem Tabor umgebenen Kirche sowie Unterkirchberg mit dem späteren

Schloss Kirchberg an der Raab: Stuckverzierung, 1. Viertel 18. Jahrhundert an der Hoffront des Mittelpavillons

Pfarrkirche Hl. Josef in Fehring, rechts das Zugbrückentor des Tabors (1615)
Steinpeiß- bzw. Heisterschloss. Die Trennung scheint zementiert, als nun beide Teile aus dem Besitz der Zebinger in fremde Hände gelangen: Oberkirchberg an die Familie Parvo, Unterkirchberg an die Grafen Steinpeiß. Erst 1671 gelingt
Georg Christoph Steinpeiß die Wiedervereinigung beider Ortsteile. Es folgt der Verkauf des „wiedervereinigten“ Kirchbergs an Siegbert Heister im Jahr 1696. Dass Kirchberg und Schloss 1704 durch die Kuruzzen angegriffen, zerstört und danach wiederaufgebaut wurden, gehört ins Reich der Legenden.
Das im 19. Jahrhundert unter der Herrschaft der Familie Liechtenstein arg demolierte und verkleinerte Schloss Kirchberg befindet sich heute in Privatbesitz und ist nur vom Raabtal aus zu erspähen. Die Reste der einstigen Taboranlage bei der Pfarrkirche sind dagegen jederzeit frei zugänglich. Am besten erhalten ist die originale Tabormauer an der Nordseite unweit des Hauses Kirchberg 100. Die Ziegelmauer entlang der Hauptstraße ist jüngeren Datums.

27. Fehring
Im frühen 15. Jahrhundert ist auch Fehring, am Südhang des Raabtales gelegen, ein Schauplatz der Walseerfehde: 1412 stecken Anhänger des Reinprecht II. von Walsee, der gegen Herzog Ernst den Eisernen rebelliert, zehn Häuser des Marktes in Brand. Ähnliches ereignet sich in den umliegenden Pfarren sechs Jahre später, als ungarische Truppen 1418 die Oststeiermark verwüsten. Weil Fehring selbst aber verschont bleibt, kann es jene Steuer zum Wiederraufbau der geschädigten Dörfer entrichten, die noch im Dezember desselben Jahres von einem Provinzialkonzil zu Salzburg gefordert wird.
Wie in vielen anderen oststeirischen Orten errichten die Ungarn gleich zu Beginn ihrer zehnjährigen Besatzung in der Steiermark 1480–1490 auch in Fehring eine Garnison. Trotz etlicher Kämpfe gegen die kaiserlichen Truppen können diese ihre Herrschaft im Land festigen. 1487 verstärken die Ungarn die

Fehringer Besatzung sogar. Erst nach dem Tod des ungarischen Königs Matyas Corvinus 1490 bricht ihr Machtgefüge zusammen und der junge habsburgische König Maximilian I. kann die steirischen Städte und Märkte, darunter Fehring, befreien.
Hart getroffen wird Fehring dann im Jahr 1605: Bereits am zweiten Tag ihres Einfalles in die Steiermark greifen die Haiduken Fehring an. Der Ort wird am 27. Mai fast vollständig verwüstet, 53 Menschen kommen ums Leben, 551 Pferde und Rinder werden fortgetrieben. Verteidigt werden kann nur der Tabor rund um die Kirche, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet, aber zu jener Zeit noch nicht gänzlich fertiggestellt ist. In der Folgezeit legen die Haiduken zwar ihr Hauptaugenmerk auf die nördliche Oststeiermark, doch kommt es am 29. Juni und 15. Juli zu weiteren Überfällen südlich von Fehring. Angriffe auf den Markt selbst unterbleiben aber.
Vor dem Hintergrund der Haidukeneinfälle sowie eines Angriffs ungarischer Marodeure im März 1612 plant Fehring den Vollausbau des Tabors, der sich aber über Jahre hinzieht. Am Ende besteht die Anlage aus einer geschlossenen Reihe von kombinierten Wohn- und Vorratshäuschen, angeordnet in einem unregelmäßigen Sechseck. An der Südseite wird ein Graben angelegt, zusätzlich entstehen zwei Türme und Basteien. Die Mauern zwischen den Basteien besitzen Schlüsselschießscharten,
die noch aus dem 15. Jahrhundert stammen. Im Jahr 1615 beschließt die Errichtung eines Tores mit Zugbrücke den Ausbau dieser Fortifikation. Der neue Tabor ermöglicht in Krisenzeiten eine rasche Stationierung von Garnisonen, sodass Fehring lange Zeit unbehelligt bleibt. Selbst die Truppen des ungarischen Magnaten Kristóf II. Batthyany, der sich 1683 an die Seite der Osmanen stellt, bringen nur Plünderungen im Umland des Marktes, aber keinen unmittelbaren Vorstoß auf Fehring. Auch die Kuruzzen wagen keinen direkten Angriff, als sie am 8. Juli 1709 ins Gebiet zwischen St. Anna am Aigen und Fehring einfallen.
Mit dem Ende des Kuruzzenkrieges und der Zurückdrängung des Osmanischen Reiches weit auf den Balkan verliert der Tabor seine Wehrfunktion. Die Häuschen werden teilweise abgetragen oder in reine Wohnhäuser umgewandelt. Bis auf zwei an der Nord- und Ostseite fallen auch die Basteien der Spitzhacke zum Opfer. 1972 wird das letzte verbliebene Speicherhaus („Gaden“) an der Südseite abgetragen. Geblieben sind neben den erwähnten Basteien ein Rundturm sowie das mit der Jahreszahl „1615“ datierte Tor, an dem noch die Öffnungen für die Ketten der ehemaligen Zugbrücke zu sehen sind.
Im frühen 15. Jahrhundert gelangt das Geschlecht der Wolfsauer in den Besitz der auf einem Basalttufffelsen errichteten Burg Kapfenstein. Es löst damit die nach der Walseerfehde enteigneten Walseer als Burgherren ab. Ab 1425 wird die Wehranlage zum Hauptstützpunkt der Fehde Sigmunds und Christophs von Wolfsau gegen den steirischen Landesfürsten sowie den Erzbischof von Salzburg. Ab 1430 gehen die beiden Brüder gegen deren Besitzungen im Land vor, weshalb Herzog Friedrich V. das Landesaufgebot einberuft, welches Kapfenstein im Sommer 1435 erobert. Christoph ergibt sich, Sigmund aber führt die Fehde fort und erkennt den Verlust seiner Burg erst im Friedensschluss vom 15. Juli 1436 an.

1481 fällt die landesfürstliche Wehranlage an den Ungarnkönig Matyas Corvinus, der im Laufe seines Krieges gegen Kaiser Friedrich III. ab 1480 beinahe die gesamte Steiermark besetzen lässt. Während die Besatzung 1490 zum Fest Allerheiligen fast allerorts endet, bleiben Hohenbrugg und Kapfenstein okkupiert, können aber später durch die Truppen König Maximilians I. befreit werden. Im Jahre 1594 gelangen Burg und Herrschaft Kapfenstein in den Besitz der Familie Lengheim.
Von den Einfällen der Haiduken im Jahr 1605 bleibt die Burg anfangs verschont. Zwei Angriffe am 29. Juni und 15. Juli können durch Arkebusierreiter abgewehrt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung stehen den Haiduken dagegen schutzlos gegenüber: In der zur Burg gehörigen Herrschaft verbrennen 16 Häuser, 42 Menschen werden getötet oder verschleppt, 96 Pferde, 399 Rinder und 50 Schafe fortgetrieben.
Wesentlich schlimmer trifft es die Gegend um Kapfenstein 101 Jahre später im Kuruzzenkrieg, wie der Lengheim’sche Verwalter Johann Marx Elegast am 31. März 1706 beschreibt: „Die ganze gegent ist voller feur, rauch und grosses donern, welches woll erschrökhlich anzusehen, noch erbärmlicher aber
ist es, das sie alles lebentige darniterhauen. Waß vor ein lamentiern, schreien und laufen unter den pauersleithen anzutreffen, kann ich nit genuegsamb beschreiben. O Gott, was vor ein rotes ay [Ei] bekhumbt Steyer auf Ostern.“
Ein Waffenstillstand am 15. April beendet nur kurzfristig die Konfrontation mit den Kuruzzen, denn das Abkommen erweist sich sehr bald als brüchig. Schon am 10. August kehren die Rebellen zurück und verwüsten binnen zwei Tagen 42 Dörfer im Gebiet um Straden, darunter auch den Ort Kapfenstein. Nach 1706 erfolgen keine weiteren Einfälle in das Herrschaftsgebiet der Familie Lengheim, die noch bis 1806 in Besitz von Kapfenstein bleibt.
Seit 1898 besitzt die Familie Winkler-Hermaden das Schloss, in dem sie ein Hotel und Restaurant betreiben.
29. St. Anna am Aigen und der Kuruzzenwall
Unweit der heutigen Landesstraße L204, die von Bad Radkersburg nach Fehring führt, ist eines von nur zwei originalen Bodendenkmälern in der Steiermark erhalten, die an den Kuruzzenkrieg 1704–1709 erinnern. Es handelt sich dabei um eine mehrere Hundert Meter lange und gut sichtbare Geländestufe, die

Pfarrkirche St. Anna am Aigen


Kuruzzenwall: Spuren der Wehrlandschaft im Gelände

zwischen der L204 und der slowenisch-österreichischen Grenze verläuft. Die Stufe wurde händisch in den vom Grenzbach Kutschenitza steil ansteigenden Hügelzug südöstlich von St. Anna am Aigen gegraben. Ihr Ziel war es, den Kuruzzen den Übertritt zu erschweren. Gut erreichbar ist dieser „Kuruzzenwall“ südöstlich von St. Anna am Aigen: Von der L204 zweigt der Sinnersdorf- Weg ins slowenische Kramarovci ab. Kurz vor dem Grenzhäuschen geht von diesem nach links der Weinberg-Sulzfeldweg ab, der zu einem Gedenkstein führt. Von diesem verläuft ein Feldweg mit der Bezeichnung „Auf der Schanz“ zurück Richtung Sinnersdorfer Weg. In diesem Bereich ist der Kuruzzenwall am deutlichsten zu erkennen.
Ab dem 31. März 1706 greifen die Kuruzzen unter Michael Csaky und György Kis die Gegend rund um St. Anna am Aigen an. Nach der Zerstörung der dortigen Kapelle auf dem Höhenrücken, wo heute die Pfarrkirche steht, verwüsten die Kuruzzen über Tage das Gebiet zwischen Hochstraden, St. Anna, Radkersburg und Gosdorf. 53 Dörfer sind betroffen, an die 600 Bauernhöfe, Keuschen und Winzerhäuer brennen nieder. Weil auch die erst 1705 errichteten
auch so gar nicht des Brodts (welches doch Jeglicher Bettler auf der Straßen findet)“ auskommen müssen.
Schon bald zeigt sich, dass der Kuruzzenwall keinen zuverlässigen Schutz gegen Einfälle bietet. Am 4. Jänner 1709 überwinden etwa 100 berittene Rebellen das Hindernis und berauben das Dorf Risola. Fünf Tage später trifft es das Dorf Waltra. Ein weiterer Einfall zwischen St. Anna am Aigen und Fehring ereignet sich am 8. Juli 1709. Zwei Monate später ist der Krieg in der Steiermark zu Ende. Infolge des Krieges wird die Filialkirche St. Anna als Wehrkirche mit Ummauerung konzipiert. 1788 wird die besonders von Süden weithin sichtbare Kirche zur Pfarrkirche erhoben.
Wie alle anderen oststeirischen Pfarren, ist auch das 1265 erstmals als „Merin“ genannte Straden im Jahr 1418 von ungarischen Angriffen betroffen. Das damalige Erscheinungsbild des Ortes unterscheidet sich vom heutigen: Markant ist eine romanische Kirche, einen schützenden Tabor gibt es noch nicht. Ob es bereits eine kleine Wehranlage an der höchsten Stelle der Bergkuppe gibt, ist nicht bekannt. Ebenso, ob und inwieweit Straden von den Fehden des 15. Jahrhunderts in Mitleidenschaft gezogen wird. Urbare belegen jedenfalls einen starken Rückgang der Hofstätten.
Befestigungslinien mit zahlreichen Tschardaken zerstört werden, beruft die steirische Landschaft Ende April einen Ausschuss zur Planung neuer Verteidigungsanlagen ein. Federführend dabei ist der Baumeister und Hauptmann Jacob de Rollois vom Regiment Heister. Zwischen dem 15. Juli und dem 3. Oktober 1706 bereist die Kommission die steirisch-ungarische Grenze und legt im Anschluss Vorschläge zur Errichtung von Defensionsbauten im Raabtal sowie entlang der Kutschenitza vor. Noch im Spätherbst des gleichen Jahres wird der geplante Kuruzzenwall in Verbindung mit Tschardaken und kilometerlangen Gräben zwischen St. Anna am Aigen und Radkersburg fertiggestellt. Nicht untypisch für diese Zeit bleiben Sold und Verpflegung für die Arbeiter und Soldaten aus. Jacob de Rollois beschwert sich darüber bei den Verordneten in Graz: Es gehe nicht an, dass „kayserliche Soldaten, so zur Defension des Lants täglich ihre Dienste praestiren müessen, 72 tag lang ohne der geringsten Verpflegung Ansicht von Straden


Doppelkirche St. Sebastian – Schmerzhafte Muttergottes
Erstaunlich ist, dass bereits während der zehnjährigen Ungarnbesatzung der Steiermark 1480–1490 mit der Neuerrichtung der um 1460 brandgeschädigten Kirche begonnen wird. 1513 ist die Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt am „Himmelsberg“ vollendet. Vier Jahre später wird mit dem Bau der Tabormauern begonnen, die den Kirchhof umschließen und bis zu zehn Meter hoch sind. Vermutlich in Zusammenhang mit der Gründung der Sebastianibruderschaft 1517 wird mit dem Bau der Doppelkirche Sankt Sebastian – Schmerzhafte Muttergottes südlich der Pfarrkirche begonnen. Diese 1535 dem Hl. Sebastian geweihte Kirche mit ihrer Unterkirche ist Teil der oben genannten Wehrmauer. Die Fenster der Unterkirche sind in die Tabormauer integriert. Sein heutiges Escheinungsbild – vier Kirchen und drei Kirchtürme – erlangt Straden aber erst durch die Florianikirche. Diese wird von 1644 bis 1668 am höchsten Punkt des Berges errichtetet.
Mit Tabor, Pfarrkirche und Doppelkirche entsteht eine Wehranlage, die die lokale
Bevölkerung im frühen 17. Jahrhundert gegen die Haiduken schützt. Weil im südlichen Teil des Grenzlandes Truppen stehen, gelingt den Haiduken Ende Mai der erhoffte Durchbruch aus dem Raabtal nach Süden nicht. Sie gelangen nur bis Stainz bei Straden. Mitte Oktober ändert sich die Lage: Nach der ersten Plünderungswelle der Haiduken im Frühjahr und Sommer 1605 sowie folgenden Kämpfen in Ungarn gelingt dem Rebellenführer Gregor Nemethy im Herbst bei Luttenberg/Ljutomer ein Vorstoß in die Untersteiermark, der heutigen Štajerska in Slowenien. Bald zeigt sich, dass sein Ziel Feldbach ist. Auf dem Weg dorthin unternehmen seine Truppen kurz vor dem 20. Oktober einen nächtlichen Angriff auf das befestigte Straden, in das sich bereits viele Flüchtlinge gerettet haben. Der Angriff kann abgewehrt werden. Der Augenzeuge Pfarrer Pankraz Khren schreibt dies göttlicher Hilfe zu: „Inmassen es mir mit göttlich Beistand also gelungen, dz die Feind auf dem Straden mit ihren gewöhnlich Raub, Brand und Mord nichts gericht, sondern wohl mit Schanden abziehen müssen.“ Dass Pfarrer

Khren etwas später auf eigene Kosten ein kleines Geschütz gießen lässt, wissen wir aus seinem Gesuch an Erzherzog Ferdinand II. um Bereitstellung von Kanonenkugeln: „Hab ich nicht sollen unterlassen in diemittigister Unterthenigkheit zuberichten, welchermassen ich unter der werenden laidigen Feindtsgefahr umb mehrer meiner Pfarr und meiner Pfarrkinder defension willen aus eigenen säkel ein scharfetinl gießen lassen und dazue kain ainpfindige kugl zu bekumben waiß.“
Es besteht kein Zweifel, dass dem Tabor von Straden neben seiner Schutzfunktion auch eine wichtige Rolle als Arsenal zukommt. Dies legt u. a. ein Inventar aus dem Jahr 1622 nahe. Damals lagert die Kirchenobrigkeit in einer Zeughütte eine Kanone mit Messingrohr (wohl jene, die Pfarrer Khren hat gießen lassen), eine „Orgel“ zu fünf Rohren (in einer Lafette mit einem Zündloch zusammengefasste fünf Gewehrläufe), 30 Doppelhaken (lange, schwere Gewehre), 33 Musketen, 76 Hellebarden und Piken (lange Spieße) sowie eine große Anzahl von Pechkränzen. Elf der Doppelhaken tragen die Initialen Ferdinands II., acht befinden sich Eigentum der Kirche, bezeichnet mit B. V. M. (Beata Virgo Maria).

Wie lange dieses Waffenarsenal in Gebrauch bleibt, ist nicht bekannt. Ebenso ist nicht klar, ob Straden während des Verrats des Kristóf II. Batthyany 1683 angegriffen wird. Es gibt nur einen vagen Hinweis. Als Pfarrer Matthias Marco 1692 der Hexerei (!) beschuldigt wird, verteidigen ihn die Bauern: „Sie hätten ihm es zu danken, daß er sie anno 1683 bei dem Einfall der Rebellen bei Haus und Hof und er ihre Weiber und Kinder erhalten hatte.“
Mehr zur Lage in Straden wissen wir hinsichtlich des Kuruzzenkrieges. Während des groß angelegten Raubzugs der ungarischen Rebellen ab dem 31. März 1706 (→ St. Anna am Aigen) kann nur das taborbefestigte Straden von der Bürgerschaft unter dem Kommando des Bürgermeisters Johann Fieger und des Schulmeisters Matthias Gänster erfolgreich verteidigt werden. Eine „Specification Derienigen Persohnen, so den Lezten Martij 706: durch dz Rebelische gesind nider gehauen, verbrendt vnnd vmbkhumben seind“ im Sterbebuch Straden 1687–1706 zeigt, dass dagegen in den Orten Sulzbach, Jörgen, Geiselsdorf, Hof bei Straden, Stainz bei Straden, Frutten, Laasen, Tieschen, Risola, Unterlaasen, Haselbach, „Würn“ und „Salßa“ mindestens 58 Tote, 5 Verletzte und

zwei verschleppte Personen zu beklagen sind. Zwei weitere Personen sind „verbrunen“.
Truppen des kaiserlichen Generals Janos Palffy vertreiben schließlich die Kuruzzen. Die Ruhe währt nicht lange, denn schon am 10. und 11. August 1706 kehren die Rebellen zurück. Wieder werden 42 Dörfer in Brand gesteckt oder geplündert, wieder wird Vieh fortgetrieben. Anders als im Frühjahr wird diesmal auch Straden durch Beschuss beschädigt. Letztlich wird der Vorstoß der Kuruzzen durch die bewaffnete lokale Bevölkerung aus Gnas unter Führung des Georg Tatzl aufgehalten. In Maierdorf bei Gnas erinnert heute die sogenannte Kuruzzenkapelle daran.
31. Klöch
In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts lässt Otto von Wolfsau auf einem Basalthügel die Burg Klöch errichten, die 1365 erstmals urkundlich erwähnt wird. Bereits sein Sohn Friedrich verliert diese aufgrund hoher Schulden um 1375 an die Familie Emerberg.
1407 stellt sich der neue Besitzer Dietegen von Emerberg zusammen mit den Wolfsauern in einem Vormundschaftsstreit zwischen Herzog Ernst dem Eisernen und dessen Bruder Leopold IV. auf die Seite Leopolds. Beide lassen durch ihre Reiter steirisch-landesfürstlichen Besitz attackieren. Daher ordnet Ernst der Eiserne im Herbst 1407 die Eroberung ihrer Burgen Bertholdstein, Halbenrain und Klöch an. Nach Abbruch aller Wehranlagen erhalten die Wolfsauer und Emerberg ihren Besitz schon im Folgejahr zurück.
Rund zehn Jahre später ist die Pfarre Klöch vom Ungarneinfall von 1418 betroffen. Ab 1491 besitzt die Familie Stubenberg Klöch, die es mit ihrer Herrschaft Halbenrain vereinigt. Von den Einfällen der Haiduken 1605 bleibt Klöch vollkommen verschont und auch der Kuruzzenkrieg tangiert Ort und Burg nur am Rande. Weil aber die nähere Umgebung verwüstet wird, stationiert die steirische Landschaft landfremde Truppen entlang der damaligen steirisch-ungarischen Grenze. Klöch erhält zu seinem Schutz im Herbst 1707 kroatische

Söldner, die sich teilweise eher als Bedrohung erweisen. In einer Schadensmeldung vom 27. Jänner 1708 heißt es: „Wie die Schweine auf der Erde liegend haben sie die Weinbeeren mit dem Maul von den Stöcken abgenascht und abgestrupfet. Sie vernichten der Herrschaft 15.000 Weinstöcke, stehlen Kraut und Rüben, berauben Kirchgeher. Bauern, die sich bei den Offizieren beschweren, werden verprügelt. In den Schlössern Halbenrain und Klöch zerhacken die Kroaten die Türen, zerbrechen die Sessel und verheizen sie. Aus den Bleifassungen der Fenster gießen sie Kugeln.“ Kaum sind die Kroaten abgezogen, nähern sich die Kuruzzen. Am 8. Juli 1709 fallen sie zwischen Fehring und St. Anna in die Steiermark ein, plündern BairischKölldorf, Jamm, Plesch und Waltra, ehe sie bei Klöch auf ungarisches Gebiet zurückkehren. Die sogenannte Kuruzzenkapelle in Maierdorf bei Gnas erinnert an diesen Einfall. Zwei Monate später ist der Krieg in der Steiermark zu Ende.
Als die Stubenberger Klöch und Halbenrain 1724 an den Grafen Georg Christoph Stürgkh verkaufen, ist Burg Klöch nicht mehr bewohnt und vom Verfall bedroht. Die Burgruine ist seit 1997 an die Gemeinde Klöch verpachtet und dient nach Renovierungsmaßnahmen als Veranstaltungsort.



Zelting wird 1362 als „dorf za zelkhen“ erstmals genannt. Der Name leitet sich vermutlich vom mittelhochdeutschen Wort „zelgn“ ab, ein Begriff, der im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Aufteilung von Grund und Boden in Verwendung steht. Das Dorf Zelting ist, wie auch Sicheldorf, als „Rundling“ angelegt: Die Höfe sind in einem Oval rund um einen zentralen Dorfplatz angeordnet. Der Grund für diese spezifische Anordnung ist nicht bekannt, sie dürfte aber eine gewisse Schutzfunktion erfüllt haben.

Kutschenitza/Kučnica, Grenzfluss zwischen Österreich und Slowenien
Zelting bildet, gemeinsam mit Goritz, Dedenitz und Sicheldorf, einen Verteidigungsgürtel um die Stadt Radkersburg, der sich allerdings in Krisenzeiten als ineffizient erweist. Zum ersten Mal wird dies deutlich, als 1480 osmanische Streifscharen am 16. August die Umgebung Radkersburgs berauben. Schon im Frühjahr desselben Jahres haben ungarische Truppen mit der Besetzung weiter Teile der Steiermark begonnen. Zelting bleibt zwar eine Besatzung erspart, doch versorgen sich die Ungarn hier während der Belagerung → Radkersburgs am 9. und 10. März 1480 mit Proviant. Im Juni 1603 kehren Tartaren und Türken von einem Plünderungszug im Murtal nach Kanischa/ Nagykanizsa zurück. Dabei berauben sie die Zeltinger Bevölkerung. Als schlimmer erweisen sich die Haiduken, die von Mai bis Dezember 1605 beinahe die gesamte Oststeiermark bekriegen. Zuletzt tauchen sie am 11. November und nochmals am 13. Dezember 1605 vor Radkersburg auf, verwüsten die Vorstädte und werden letztlich zurückgeschlagen.
Die Bedrohung durch das Osmanische Reich bleibt während der kommenden 50 Jahre aufrecht. 1600 wird die Festung Kanischa von den Türken erobert und besetzt, wiederkehrende Streifzüge im Gebiet sind die Folge. Schutz für die Bevölkerung soll die Stationierung von Soldaten in den gefährdeten Orten sowie deren Bewaffnung aus dem Grazer Zeughaus garantieren. Zudem verlässt man sich auf die westungarischen Magnatenfamilien Batthyany und Zrinyi, die mit ihren Söldnern den Gegnern einigermaßen Paroli bieten, was sich 1655 als problematisch erweist.
„Demnach die Türggen am nechst verwichenen 26. February, ohne des zurukh verblibenen Hinterhalts, Zway Tausendt starckh, vnd in die fünffzehen Trouppen gethailter durch die Vngarisch Frontirn, bis nechst an Radkherspurg gestraifft, vnd daselbsten das Dorff Zelting, so nacher Ober Radkherspurg gehörig, außgeblindert, etlich vnnd Sibenzig gefangene daraus weckhgeführt, vnd ein anzall nidergemacht, auch noch ein anders Vngrisches Dorff Khaltenprun genandt, beraubt, entlich durchs vngewitter weiter zugehn abgehalten worden, sich aber gleichwoll außtrükhlich verlautten lassen, dieselbe gegent heraufwerths bis an die Lanndtschafft Pruggen mit dem negsten zubesuchen vnd zublindern.“
Mit diesen Worten an Landeshauptmann Johann Maximilian von Herberstein setzt der Grazer Hofkriegsrat einen Mechanismus in Gang, der letztendlich zu verstärkter Einquartierung von Soldaten in Zelting, Radkersburg und den umliegenden Orten führt. Außerdem werden entlang der steirisch-ungarischen Grenze Verhackungen angelegt und Wachtposten aufgestellt. Und man versucht Geld zu sammeln, damit die verschleppten Personen, „so erbarmblichen geprügelt vnd scharpff gehalten werden, liberirt werden möchten“. Letztlich kehren nur wenige der freigekauften Personen nach Zelting zurück. Die meisten wählen eine Bleibe nicht mehr direkt an der Grenze. Die Gehöfte Zeltings werden während des Angriffs nicht nachhaltig zerstört. Von den 18 Anwesen sind nach dem Überfall noch 17 intakt bzw. können rasch wiederhergestellt werden.
Mit dem Überfall vom 26. Februar 1655 ist die Gefahr durch die Osmanen gebannt. Im frühen 18. Jahrhundert überfallen dann die Kuruzzen wiederholt die östliche Steiermark, wobei auch Zelting angegriffen wird: Bei einem Einfall vom 31. März bis zum 4. April 1706 wird das Dorf beinahe vollständig zerstört. Kaum wiederaufgebaut, berauben die Kuruzzen Zelting – neben Dedenitz, Laafeld und Sicheldorf – im Dezember 1707 erneut.
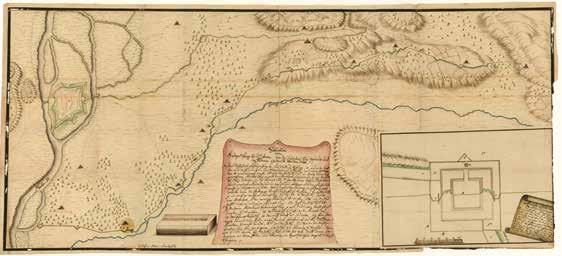
33. Dedenitz
Nordöstlich des Ortskerns von Dedenitz, gut im Wald verborgen, ist neben dem → Kuruzzenwall bei St. Anna am Aigen das zweite erhaltene Bodendenkmal aus der Kuruzzenzeit zu finden. Knapp westlich der Kutschenitza und damit der Grenze zu Slowenien bzw. der ehemaligen steirisch-ungarischen Grenze erheben sich aus dem Waldboden die Reste einer Wallanlage. Diese ist teilweise bis zu eineinhalb Meter hoch und trotz des dichten Bewuchses noch relativ gut erkennbar. Ältere Literatur des 19. Jahrhunderts spricht von einer „Türkenschanze“, während ein im Steiermärkischen Landesarchiv verwahrter Plan an gleicher Stelle die 1704 errichtete „Kuruzzenschanze“ verzeichnet.
Die Schanze besteht aus einem etwa 60 × 60 Meter messenden Innenhof, der nur von einer Seite betretbar ist. Der Innenhof ist von einem rund zwei Meter hohen Wall umgeben. Geschützt ist er zudem durch einen mehrere Meter tiefen und breiten Graben sowie Pfähle aus Holz. Der Zugang zum Inneren erfolgt über eine Zugbrücke und durch ein hölzernes Tor. Die Wasserversorgung stellt ein Brunnen sicher. Die Schanze wird aus Erde und gestampftem Lehm errichtet. Ob es eine Verstärkung durch Steinoder Ziegelmauern gibt, geht aus dem Plan von 1704 nicht hervor.


Direkt an die Schanze schließt der in Richtung Mur bzw. entlang der Kutscheniza in Richtung St. Anna am Aigen verlaufende → Kuruzzenwall an.

34. Radkersburg
An der Grenze zu Ungarn gelegen, ist Radkersburg bereits im Mittelalter als Grenzfeste von strategischer Bedeutung. Dementsprechend ist die Stadt mit einer mächtigen Ringmauer samt Türmen und einem Graben umgeben. Über zwei Tore wird der Zutritt kontrolliert.
Im hier behandelten Zeitraum bleibt Radkersburg von den Zerstörungen des Jahres 1418 durch die Ungarn verschont. Darüber hinaus ist es aber stark von den Fehden und Konflikten des 15. Jahrhunderts betroffen.
Die Baumkircherfehde 1469–1471 bringt bereits im Mai 1469 die Eroberung der Burg Oberradkersburg/Gornja Radgona mit sich, die damals der Familie Stubenberg gehört. Zwei Monate später bemüht sich der böhmische Söldnerführer Jan Holub um die Rückeroberung der Burg, als er Meldung erhält, dass seine Gefolgsleute einen Turm der ebenfalls von Baumkirchers Truppen besetzten Stadt
→ Fürstenfeld eingenommen haben. Holub bricht die Belagerung von Oberradkersburg ab, eilt nach Fürstenfeld und erlebt dort am 21. Juli ein Fiasko. In blutiger Schlacht wird seine Truppe besiegt, er selbst stirbt nach schwerer Verwundung in Graz. Oberradkersburg bleibt besetzt und kann sich erst im März 1470 selbst befreien.
Zu Beginn der zehnjährigen Besetzung der Steiermark durch die Ungarn 1480–1490 gerät Radkersburg als eine der ersten heute steirischen Städte unter feindliche Kontrolle. Am 10. März 1480 befehligt der ungarische Hauptmann Istvan Zapolya drei Stürme gegen die damals noch mittelalterliche Ringmauer. Radkersburg wird mit Kanonen beschossen und so zur Kapitulation gezwungen. Reiche Bürger werden nach Ofen/Budapest verschleppt. Der Kärntner Pfarrer Jakob Unrest schreibt dazu: Die Ungarn unter „Steffan weyda“ kamen zu „der statt Rackhenspurg und wurden ir veynndt und machten veldt fur die statt und schussen darin mit grossen zeug und notten die statt zu
tayding, das sich sy dem kunig ergab […] Und der kunig ervordert die pessten burger ab gen Offen“. Radkersburg erhält eine ungarische Besatzung, deren Befehlshaber Jakob Szekely ab 1481 etliche Streifzüge in den heute slowenischen Süden der Stadt unternimmt. Mit dem Kriegseintritt Salzburgs auf ungarischer Seite weitet sich die Auseinandersetzung auf die Obersteiermark aus, später auch auf Wien und Niederösterreich. Der Krieg dauert noch zehn Jahre, ohne dass Radkersburg durch kaiserliche Truppen befreit wird. Erst mit dem Tod des ungarischen Königs Matyas Corvinus wendet sich das Blatt – zu Allerheiligen 1490 ist Radkersburg wieder frei. Jakob Szekely wechselt umgehend auf die Seite Habsburgs und bleibt für kurze Zeit Hauptmann der Stadt.
Zeitgleich mit dem Ungarnkrieg trifft der erste Angriff aus dem Osmanischen Reich die heutige Steiermark. 1480 fallen Truppen aus dem Paschalik Bosnien – von 1580 bis 1865 eine unmittelbare Provinz des Osmanischen Reichs –in Kärnten ein. In drei Abteilungen verwüsten diese Truppen daraufhin das Murtal, die Packgegend sowie das Tauerngebiet. Sie ziehen durch das Murtal Richtung Süden und verlassen um den 16. August bei Radkersburg heute steirischen Boden. Jakob Unrest berichtet dazu: Die Angreifer „lyessen den sackman aus. Der kam vast in die ganntze Steyrmarckh auff dem gepirg und in die teler untz geyn Rackenspurg und vienngen da unmesslich groß volckh, pryesster und layen, man, weyb und kindt“.
Die kriegerischen Erfahrungen des 15. und frühen 16. Jahrhunderts führen in der Steiermark zu einer Ausweitung der Schutzmaßnahmen. Ältere Burgen werden zu Festungen ausgebaut, Städte erhalten verbesserte Wehranlagen. Neben Graz und → Fürstenfeld gilt das auch für Radkersburg, das, wegen seiner unmittelbaren Grenzlage zu Ungarn, als Teil eines Befestigungsgürtels vor Graz sowie in seiner Funktion als Versorgungbasis für die Militärgrenze eine wichtige strategische Stellung einnimmt.
Mitte des 16. Jahrhunderts wird hier mit der Errichtung eines modernen Bastionensystems

begonnen, für dessen Bau man aufgrund ihrer ausgezeichneten Kenntnisse italienische Baumeister engagiert: Unter der Leitung von Domenico dell’Allio, Francesco Thibaldi, Hieronymus Arconat, Josef Vintana und schließlich Franz Marbl werden dem mittelalterlichen Mauerring zwischen 1546 und 1591 sieben fünfeckige Basteien, Kurtinen (Verbindungsmauern) und ein Graben vorgelagert. Der bestehende Wassergraben wird dazu verbreitert und vertieft: Eine Wassertiefe von 1,5 bis 2 Metern sollte ein Durchqueren des Grabens mit Kriegsgerät unmöglich machen. Das ausgehobene Erdmaterial findet beim Bau der Basteien und Kurtinen Verwendung. Der Zutritt zu Stadt bleibt weiterhin über zwei Stadttore organsiert. Eine besondere Rolle kommt der Mur zu: Anders als heute, wird Radkersburg im 16. Jahrhundert auch im Norden von der Mur umflossen und weist dadurch eine Insellage auf. Sicherheitstechnisch ist dies ideal. Ungelöst bleibt die Frage nach der Sicherung der Burg, die erhöht auf der anderen Seite des Flusses liegt. Zwar werden Pläne entwickelt, diese aber nicht realisiert.
Radkersburg erfüllt eine wichtige Funktion als Stapelplatz für Munition und Proviant, um im Kriegsfall steirische Truppen in Westungarn und dem heutigen Slowenien zu versorgen. Ein in der Stadt existierendes Proviant- und Zeughaus wird zu klein, weshalb die Landstände im späten 16. Jahrhundert zwei Häuser in Radkersburg kaufen und umbauen lassen. Das neue Zeughaus in der heutigen Emmenstraße hat ein
Zeughäuser einrichten
Zeughäuser entstehen in der Frühen Neuzeit als spezieller Gebäudetypus: Ihr Sinn besteht allein darin, Kriegsgerät möglichst effizient unter maximaler Ausnützung von Raum und Tageslicht unterzubringen. Auf Regalen und Stellagen, an Holzwänden, auf Holzrechen und in Nischen lagern Harnische, Gewehre und Pistolen, Blank- und Stangenwaffen. Die schwersten Waffen, wie etwa die Geschütze, werden im Erdgeschoss deponiert. Ein repräsentatives Äußeres sind nicht vorgesehen.
Das wichtigste Zeughaus, weil „Ausrüstungszentrale“ im Südosten des habsburgischen Reiches, ist das heutige Landeszeughaus in Graz. Von hier aus werden die Zeughäuser in der Region und die Militärgrenze versorgt. Fast jede Stadt, Klosteranlage und Festung besitzt Räumlichkeiten zur Lagerung von Waffen, die zur Selbstverteidigung von den Verantwortlichen erworben werden. Im Kriegsfall erhalten sie zusätzliches Kriegsmaterial aus Graz. Zu solchen „privaten“ Rüstkammern kommen Zeughäuser von überregionaler Bedeutung in Fürstenfeld, Marburg/Maribor, Pettau/Ptuj oder Varaždin. Sie sind Dependancen des Zeughauses in Graz und werden von dort ausgestattet. Der Waffentransport von Graz zum Zielort erfolgt so weit wie möglich auf dem Wasserweg. Zu Land werden „Heerwägen“ von Ochsen oder Pferden gezogen. Zeitaufwendig ist beides. So benötigen schwere Geschütze für die 130 Kilometer von Graz nach Varaždin etwa eine Woche. Leichtere Gewehre oder Stangenwaffen sind rund drei Tage lang unterwegs.
relativ kleines Waffenlager, dessen Bestände im Bedarfsfall mit Waffen aus Graz erweitert werden. Im angeschlossenen Provianthaus können 9.000 Viertel Getreide gelagert werden, die als Nachschub für die Militärgrenze dienen. Die Ausstattung umfasst auch eine Backstube und zwei Handmühlen. Der Transport der Nachschubgüter erfolgt von Graz aus in erster Linie über die Mur, während untersteirische Adelige das von ihnen verkaufte Getreide am Landweg direkt nach Radkersburg bringen.
Bereits im 17. Jahrhundert beginnt die Stadtbefestigung von Radkersburg zu verfallen und muss mehrfach nachgebessert werden. Hochwasser und Brände setzen der Anlage schwer zu, weshalb die Stadtväter über ein offenes und schutzloses „Gränizstättl“ klagen. Nötige Ausbesserungen erfolgen 1620 bis 1633, zudem werden 1663 Ravelins (Vorwerke zum Schutz der Kurtinen) im Graben vor dem Ungartor und der Ungarbastei gebaut.
Zu dieser Zeit liegen die Einfälle der Haiduken bereits Jahre zurück. Zur Unterstützung des Landesaufgebotes in dieser Angelegenheit ordnet Radkersburg bereits im Juni 1605 100 Mann ihrer Stadtguardia ab. Im November ist die Stadt dann selbst betroffen, als eine haidukisch-türkisch-tartarische Streifschar
Radkersburg am 11. November trotz aufrechtem Waffenstillstand beschießt: Truppen des steirischen Landobristen Wolf Wilhelm von Herberstein vertreiben die Angreifer und besiegen sie kurz darauf bei Rabahidveg. Dennoch erreicht eine weitere Haidukenschar unter Kristóf Hagymassy am 13. Dezember bei dichtem Nebel die Vororte Radkersburgs. Schäden entstehen nicht, weil sie entdeckt und durch Söldner Herbersteins nach Ungarn abgedrängt wird. Es ist der letzte Angriff der Haiduken auf die Steiermark.
Es ist seinen imposanten Wehranlagen sowie der fast durchgehenden Einquartierung von Soldaten zu verdanken, dass Radkersburg während der kommenden 100 Jahre keinen direkten Angriff mehr erlebt. Die Rebellion des Gabor Bethlen 1619–1626, der letzte Angriff aus dem Osmanischen Reich 1655, die ungarische Magnatenverschwörung gegen Kaiser Leopold I. 1667–1671 (die unter anderem auch die Eroberung Radkersburgs zum Ziel hat) sowie der Verrat des Kristóf II. Batthyany 1683 betreffen die Stadt nur indirekt: durch die Finanzierung und Stellung von Soldaten, durch erhöhte Steuerleistung oder notwendige Einquartierungen. 1655 und 1664 werden in Radkersburg auch Flüchtlinge aufgenommen. Die Kuruzzen bedrohen im frühen 18. Jahr-
hundert vor allem die nähere Umgebung: Am 31. März 1706 verwüsten die Rebellen ein rund 300 Quadratkilometer (!) großes Gebiet zwischen Radkersburg, Gosdorf und Hochstraden. Dabei werden 53 Dörfer und rund 600 Bauernhöfe verwüstet. Eine unmittelbare Folge ist die Stationierung von Konstablern in Radkersburg, die im Bedarfsfall die hier aufgestellten Geschütze bedienen können. Eine weitere Folge ist die Errichtung des Kuruzzenwalls zwischen Radkersburg und → St. Anna am Aigen. Weil auch dieser nur bedingt Schutz gewährt, können am 3. Dezember 1707 etwa 1.200 berittene Rebellen die Verhacke und Schanzen östlich von Radkersburg überrennen und die Dörfer → Dedenitz, Laafeld, Sicheldorf und → Zelting ausrauben. Die in Radkersburg stationierte Garnison sieht dem Treiben untätig zu. Drei Tage später überfallen die Kuruzzen die gleichen Orte abermals.
1773 wird Radkersburg als Reichsfestung aufgelassen und der Obhut der Bürgerschaft übergeben.
Auch wenn einiges auf ein Wiederaufbauprojekt im 20. Jahrhundert zurückgeht, kann man heute in Bad Radkersburg einen sehr guten Eindruck von einer neuzeitlichen Stadtbefestigung gewinnen. Zudem sind – mit Turm, Mauerresten und anschließenden Gebäuden – auch Teile der mittelalterlichen Wehranlage erhalten. Der ehemalige Wassergraben säumt heute als Grüngürtel die historische Altstadt. Im ehemaligen Zeughaus ist das Stadtmuseum untergebracht, das anschaulich die wechselvolle Geschichte Radkersburgs präsentiert.

Radkersburg, Stadtmauern

Pfarrbastei


Das Zeughaus in Varaždin
Blick in die Ferne: eine Militärgrenze anlegen
Mit der Ausdehnung des Osmanischen Reichs stellt sich die Frage, wie ein Vordringen seiner Truppen in habsburgische Gebiete verhindert werden kann. Die Antwort ist die schrittweise Schaffung eines 70 km breiten Grenzterritoriums: Schon ab 1522 entsteht im nahezu entvölkerten Kroatien zwischen den beiden Reichen eine Pufferzone, die als Militärgrenze bezeichnet wird. Das Gebiet ist durch frühere Kampfhandlungen zerstört. Die Bauern sind fort, selbst die Grundherrschaften haben sich zurückgezogen. Nun entsteht bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts eine Grenzergesellschaft, die völlig frei von feudalen Bindungen, aber zum Wehrdienst verpflichtet ist. Neben den sogenannten Wehrbauern werden Söldner aus ganz Europa angeworben bzw. Steirer im Zuge von Landesaufgeboten an die Grenze geschickt. Organisatorisch und finanziell übernimmt Innerösterreich die Grenze. Die Steiermark ist innerhalb dieses Verbandes für den Abschnitt zwischen Drau und Save zuständig. Die administrative Verwaltung der Militärgrenze erfolgt von Graz aus. Von hier werden Waffen, Lebensmittel und Soldaten in den Südosten geschickt.
Als Zentrum der Militärgrenze gilt die Festung von Varaždin. Dazu kommen noch die Hauptfestungen Iwanitsch (Ivanić Grad), Kopreinitz (Koprivnica), Kreuz (Križevci) und St. Georgen (Djurdjevac).
Diesen vier gemauerten Festungen sind mehrere kleine Festungen zugeordnet: Blockhäuser aus Holz, ca. 15 × 15 Meter groß, für 20 bis 30 Soldaten, die von je einem Kommandanten verwaltet werden. Die Soldaten bewachen die Gegend zu Fuß und zu Pferd. Die Häuser sind fünf bis zehn Kilometer v oneinander entfernt.
Militärgrenze, Kartograf
Martin Stier, Österreichische
Nationalbibliothek
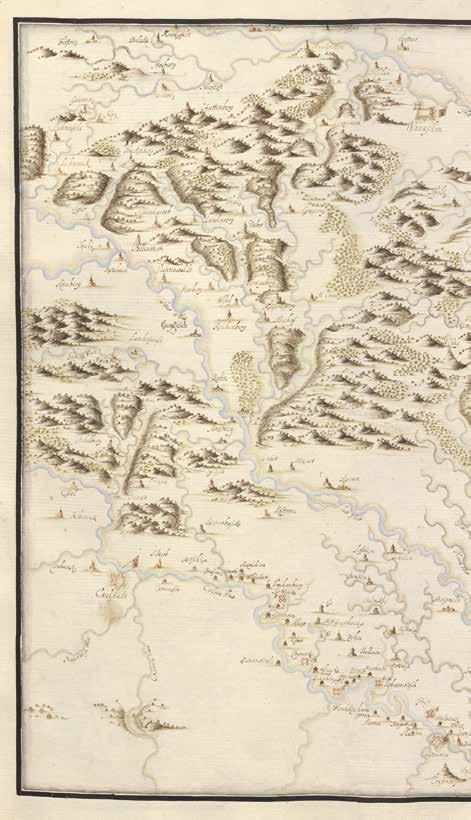

Aichberg (Familie) 53
Allio Domenico dell’ (um 1515–1563) 80, 102
Arconat Hieronymus 102
Bardeau (Familie) 85
Batthyany (Familie) 34, 73, 99
Batthyany Adam I. (1609–1659) 34
Batthyany Ferenc II. (1577–1625) 32, 47, 76
Batthyany Kristóf II. (1637–1687) 37, 38, 49, 51, 52, 55, 58, 62, 76, 80, 81, 82, 91, 96, 103
Baumkircher Andreas (1420–1471) 17, 18, 44, 45, 53, 55, 60, 78, 85, 87, 88, 101
Baumkircher Wilhelm († 1492) 21, 60
Bayern, Kurfürst
Maximilian II. Emanuel (1661–1726) 40
Bedschwi († 1552) 26, 27, 56, 57
Bethlen Gabor (um 1580–1629) 31, 32, 33, 47, 76, 81, 103
Bocskay Istvan (1557–1606) 28, 31, 71
Bottyan Janos (1643–1609) 41
Caesar Aquilin Julius (1720–1792) 47
Caesar Gaius Iulius (100 v. Chr.–44 v. Chr) 12
Capell Katharina Elisabeth von 85 → auch Katharina Elisabeth von Galler
Celalsade Nicanci–baši († 1567) 26, 27, 72
Cilli (Grafen) 15, 69
Csaky Mihaly (1676–1757) 39, 94
Daun Anton Wilhelm von (1621–1706) 81
Deutschland, Könige
Heinrich III. (1016/1017–1056) 77
Sigismund von Luxemburg → Ungarn, Könige
Dietrichstein (Familie) 48, 49
Elegast Johann Marx († 1719) 92
Emerberg Berthold II. von († 1403) 14
Emerberg Dietegen von († 1444) 97
Erdödy Tamas II. (1558–1624) 32, 76
Ertl Paul 64
Eszterhazy Antal (1686–1722) 41
Fieger Johann 96
Frankopan Ferenc Kristóf (1643–1671) 35, 36, 81
Galler Katharina Elisabeth von (1607–1672) 35, 84, 85
Gänster Matthias 96
Glöderl Wolf († nach 1615) 29, 61
Glojach Hans Ruprecht († vor 1640) 64
Graben (Familie) 85
Graben Wilhelm von († 1523) 64
Grabner Paul 64
Greissenegg Andreas von (um 1425–1471) 18, 19
Habsburg (Familie) 5, 9, 13, 19, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 47, 76
Habsburger
Albrecht III., Herzog (1349/1350–1394) 13
Albrecht V. (II.), Herzog und König (1397–1439) 14, 15
Albrecht VI., Herzog (1418–1463) 85
Ernst, Erzherzog (1553–1595) 80
Ernst der Eiserne, Herzog (1377–1424) 14–16, 45, 47, 73, 78, 83, 90, 97
Ferdinand I., König und Kaiser (1503–1564) 24
Ferdinand II., Kaiser (1578–1637) 29, 32, 33, 58, 59, 81, 88, 96
Friedrich III. Kaiser (1415–1493) 14, 15, 17–22, 44, 48, 51, 64, 65, 69, 78, 85, 91, 92
Friedrich IV., Herzog von Tirol (1382–1439) 16
Friedrich V. → Friedrich III.
Joseph I., Kaiser (1678–1711) 39
Joseph II., Kaiser (1741–1790) 66
Leopold I., Kaiser (1640–1705) 35, 36, 39, 54, 81, 103
Leopold III., Herzog (1351–1386) 13, 14
Leopold IV., Herzog (1371–1411) 14, 15, 97
Leopold V., Herzog (1157–1194) 45
Maria Theresia (1717–1780) 6
Maximilian I. (1459–1519) 22, 27, 61, 64, 91, 92
Rudolf II., Kaiser (1552–1612) 28
Hagymassy Kristóf 30, 31, 103
Harder Heinrich († 1480) 79
Haubtman Michel 75
Haugwitz Janos († 1526) 20
Hauser Ludwig 17, 18
Heister Hannibal (1665–1719) 39, 40
Heister Siegbert (1648–1718) 41, 57, 87, 88, 90
Herbersdorf (Familie) 72
Herberstein (Familie) 64, 66
Herberstein Bernhardin II. von (1566–1624) 67, 68
Herberstein Hans Albrecht von († 1666) 64
Herberstein Hans Sigmund von (1560–1611) 64
Herberstein Johann Maximilian von (1601–1679) 34, 99
Herberstein Wolf Wilhelm von († 1618) 31, 103
Heschel Paul 64
Holub Jan († 1469) 78, 101
Jurisich Niklas (1490–1543) 25
Kara Mustafa (1634/1635–1683) 37, 55, 62
Karner Steffl 75
Karolyi Alexander (1668–1743) 38, 76
Kasim Beg († 1532) 25, 26
Katzianer Hans (1491–1538) 25, 27
Khren Pankraz (1570–1619) 95, 96
Kis György 39, 94
Klaffenau Balthasar Wilhelm von († 1606) 58
Klaffenau Erhard Wilhelm von (1566–1639) 58, 59
Klaffenau Franz Otto von (1655–1699) 52
Klaffenau Sigmund von (um 1614–1683) 52, 58, 62
Klaffenau Sigmund Karl von (1671–1719) 59
Kollenberg → Rüd von Kollenberg
Köppach Peter Anhanger von 15, 78, 83, 85, 88
Kottulinsky (Familie) 70, 73
Krumbach (Familie) 48
Lengheim (Familie) 92
Lengheim Georg Adam von (1640–1713) 62
Liechtenstein (Familie) 84, 90
Löwenherz Richard 45
Marbl Franz († 1594) 102
Marco Matthias (1642–1700) 96
Mindorf (Familie) 71
Mindorf Bernhardin von († 1613) 71
Mindorf Hans Christoph von († 1648) 72
Moltenberg Johann Ludwig von (1650–17109) 41, 76
Montecuccoli Raimondo (1609–1680) 35, 81
Munssen Jegkl 75
Nadasdy Ferenc III. (1622–1671) 35, 36, 81
Narringer Andreas († 1475) 17, 18
Narringer Christoph 17, 18
Narringer Jörg 15
Nemethy Gregor († 1612) 28, 30, 70, 95
Neuberg (Familie) 63, 73
Neuberg Elisabeth von († 1503) 64, 65
Neuberg Hans III. von († 1483) 21, 48, 65
Neuberg Heinrich III. von (†1480) 64
Ochs von Sonnau Andreas († 1639) 29
Ortelius Hieronymus (1524–1614) 26
Osmanisches Reich, Sultane
Murad IV. (1612–140) 31
Suleiman I. (1494–14566) 24–26, 44–47, 54, 56, 57, 67, 72
Paar Hans Christoph († 1636) 29
Palffy Janos (1659–1751) 39, 41, 97
Pamkircher Anndre 60, 78, 87
Päpste
Johannes XXIII., Gegenpapst (um 1370–1419) 16
Paniško 20
Parvo (Familie) 90
Paur Hanns 75
Perner von Schachen (Familie) 44
Perner Niklas (um 1500–1550) 44
Perner Wilhelm († 1490) 44
Pesnitz Ulrich von 17, 18
Peuerl (Familie) 18
Phuntan Erasmus 88
Polheim (Familie) 73
Polheim Erhard von († 1538) 75
Polheim Weikhart von († 1550) 75
Pöllau, Pröpste
Ortenhofen Johann Ernst II. (1647/1697–1743) 66
Pottendorf Friedrich von († 1488) 64, 65
Predojević Hasan († 1593) 28
Puchheim (Familie) 73
Puchheim Wilhelm von 73
Purgstall Johann Ernst von (1637–1695) 84
Rabutin Johann Ludwig de Bussy (1642–1716) 40
Radfuchs Paul 64
Rakoczi Ferenc II. (1676–1735) 38,–41
Rauber Andreas Eberhard 49
Regimenter
Aspremont 37, 62
Breuner 40, 41 de Went 59
Heister 94
Leslie 36
Metternich 37, 62
Saurau 37, 62, 81
Zoiß 36
Reichenburg (Familie) 84
Reichenburg Reinprecht von (1434–1505) 21
Reuter (Familie) 55
Rindscheit Andrä († 1612) 62
Rindscheit Heinrich 15
Rindsmaul Michael (vor 1508–1584) 45
Rindsmaul Sigmund Albrecht von (1687–1745) 45
Rödern Melchior von (1540–1600) 27, 28, 80
Rollois Jacob de 94
Rottal (Familie) 48, 73
Rüd von Kollenberg Georg Christoph 87
Rumpf Kunz 19
Sachsen Albrecht von (1443–1500) 22
Salzburg, Erzbischöfe
Beckenschlager Johannes (um 1435–1489) 19–21
Reisberg Johann von († 1441) 14
Rohr Bernhard von (1421–1487) 19, 20
Saurau (Familie) 51, 64
Saurau Karl von (um 1545–1692) 37, 81
Schalckh Cristl 75
Schedenegg Georg († 1685) 37, 81
Schlögel Karl 7
Schmidt Johann Baptist († 1704) 72, 73
Schoberwalter Peter 64
Schölley Paul 82
Schönfeld Ludwig von (1791–1828) 56
Stadl (Familie) 84
Stadl Hans von († 1618) 29
Stadl Hans Rudolf von (um 1645–1696) 85
Steinpeiß (Familie) 29, 53, 54, 55, 90
Steinpeiß Christoph von († 1607) 52, 54
Steinpeiß Georg Christoph von († 1679) 90
Steinpeiß Josef Friedrich von (1677–1743) 55
Steinpeiß Johann Josef von (1671–1731) 88
Steinpeiß Seyfried von 53
Stier Martin (um 1620–1669) 61, 80, 87, 106
St. Georgen–Bösing Christoph von († nach 1504) 65
Stubenberg (Familie) 49, 63, 84, 97, 98, 101
Stubenberg Hans V. von († 1480) 17, 18, 19
Stubenberg Andre von († 1501) 87
Stürgkh Georg Christoph von (1666–1739) 98
Szekely Jakob († 1504) 20, 21, 102
Tattenbach Johann Erasmus von (1631–1671) 35, 36, 81
Tatzl Georg 97
Teuffenbach (Familie) 15, 69, 70
Teuffenbach Andrä von 70
Teuffenbach Bernhard von 70
Teuffenbach Gabriel von 64, 70
Teuffenbach Ortolf von († 1638) 33, 76
Teuffenbach Servatius von († vor 1592) 70
Teuffenbach Wolfgang von 30
Textor Jakob (1582–1621) 32, 47, 48
Thibaldi Francesco († 1568) 80, 102
Thurn Karl von († 1689) 35, 36
Tilly Johann Tserclaes von (1559–1632) 31
Trauttmansdorff (Familie) 73
Trauttmansdorff Ernreich III. von († 1669) 64
Trauttmansdorff Sigmund Friedrich von († 163) 30
Ungarn, Könige
Corvinus Matyas (1443–1490) 18–23, 48, 60, 61, 64, 78, 79, 88, 91, 92, 102
Sigismund von Luxemburg (1368–1437) 16, 45
Unrest Jakob (um 1430–1500) 22, 53, 60, 78, 79, 87, 101, 102
Unverzagt Wolfgang (um 1535–1605) 49
Vintana Josef 102
Vlček Václav (um 1425–1501) 20
Vorau, Pröpste
Horn Leonhard von (1453–1493) 51
Leisl Philipp (1691–1717) 52
Perfall Johann Benedikt von († 1615) 52, 58
Pratsch Georg Christoph (1681–1691) 52
Walsee (Familie) 15, 78, 83, 85, 88, 90, 91
Walsee Reinprecht II. von († 1422) 15, 16, 83, 90
Weillner Anton († 1709) 59
Welzer (Familie) 53
Wendschütz Hans Albrecht 87
Werneck Hans von († 1546) 26
Wilfersdorf Jonas von († 1613) 80
Wildenstein (Familie) 72
Wildonier (Familie) 84
Wilhelm (Familie) 58, 59
Wilhelm Balthasar († 1606) 58
Wihelm Erhard († 1639) 58, 59
Winkler–Hermaden (Familie) 92
Wlk Wenzel → Vlček Václav
Wolframsdorf Georg von († 1501) 20, 21
Wolfsau (Familie) 13–15, 85, 91, 97
Wolfsau Christoph von († 1441) 14, 15, 69, 85, 91
Wolfsau Friedrich von 97
Wolfsau Otto von 97
Wolfsau Sigmund von 14, 91
Wurmbrand Franz Carl von (1790–1855) 56
Wurmbrand Wolf Friedrich von (1652–1704) 39, 56, 57
Zapolya Istvan († 1499) 19, 101 (hier: „Steffan weyda“)
Zebinger (Familie) 55, 89, 90
Zebinger Kaspar († 1637) 89
Zrinyi (Familie) 34, 99
Zrinyi Miklos VII. (1620–1664) 34
Zrinyi Petar IV. (1621–1671) 35, 36, 55
Herausgegeben von
Bettina Habsburg-Lothringen
Leopold Toifl
Texte
Bettina Habsburg-Lothringen
Leopold Toifl
Lektorat
Jörg Eipper-Kaiser
Redaktionelle Mitarbeit
Daniela Assel
Walter Feldbacher
Grafische Gestaltung
Karin Buol-Wischenau
Umschlagabbildung
Schanze Dedenitz, Foto: Clemens Nestroy
Fotos
Clemens Nestroy
Mit Ausnahme der Abbildungen auf der Seite 75, die von Fam. Kottulinsky, auf den Seiten 52 (re.), 53, 54, 55 (li.), 69, 70, 84, 85 und 92, die von Walter Feldbacher, auf der Seite 89, die von Johann Köhldorfer, auf der Seite 104 (m.), die von Bettina HabsburgLothringen und auf der Seite 71 (o.) und 105, die von Ilse Toifl stammen.
Druck
Universitätsdruckerei Klampfer, St. Ruprecht/Raab
ISBN 978-3-903179-75-2
Alle Rechte vorbehalten
© 2024 Landeszeughaus
Universalmuseum Joanneum
Landeszeughaus
Herrengasse 16
8010 Graz, Österreich
T: +43-(0)316/8017-9800
www.landeszeughaus.at
