

Haupt stadt format.

Lesen Sie die Nr. 1 aus Berlin: 4 Wochen gratis.
Ohne Risiko.
Jetzt einlösen: tagesspiegel.de/gratislesen
Auf der Suche nach Geschenken? Wie wäre es mit hinreißender Musik und Geschichten voller Emotionen in atemberaubenden Bildern? Bereiten Sie Ihren Liebsten und sich eine Freude und sparen Sie 20% bei Ihrem Ticketkauf von Opern und Konzerten mit hochkarätigen Stars in magischer Atmosphäre.
Unser Geschenk für Sie:
Sichern Sie sich mit dem Aktionscode Geschenke25 20% Ermäßigung* auf ausgewählte Vorstellungen im Januar, Februar und März 2026.
staatsoperberlin.de/geschenke25
* Maximal 2 Karten pro Buchung im Rahmen eines begrenzten Kontingents. Nicht mit weiteren Ermäßigungen kombinierbar. Keine Premieren. Aktion gültig bis 31.03.2026.
2 Uraufführung Das kalte Herz
6 Premiere Les Contes d'Hoffmann
10 Christian Thielemann im Gespräch
14 Vielfalt mit der Staatskapelle Berlin
18 Junge Staatsoper
19 Tickets & Service
20 Festtage 2026
Liebes Publikum!
Begleiten Sie einen Komponisten und Dirigenten auf einem Waldspaziergang mit dem Librettisten seiner neuen Oper, stoßen Sie mit einem Tenor und einer Regisseurin auf die opulenten Phantastereien einer berühmten Dichterfigur an, entdecken Sie mit unserem Generalmusikdirektor ein Jahrhundertwerk genau einhundert Jahre nach der Uraufführung an unserem Haus neu und erfahren Sie von Musiker:innen der Staatskapelle Berlin ihre persönlichen Vorlieben dieser Spielzeit.
Mit diesem Magazin möchten wir Sie einladen, besondere Höhepunkte unseres Spielplans an der Staatsoper Unter den Linden zu entdecken und zu vertiefen. Der Komponist und Dirigent Matthias Pintscher hat gemeinsam mit dem Lyriker Daniel Arkadij Gerzenberg das bekannte Märchen Das kalte Herz von Wilhelm Hauff mit ästhetischen Mitteln unserer Zeit in eine Oper verwandelt, die im Januar 2026 zum ersten Mal zu erleben sein wird. Die geheimnisvollen und faszinierenden Stimmungen des Waldes – den der Komponist eine „Naturkathedrale“ nennt – verwandeln die beiden Künstler in einen poetischen und farbenreichen Klangraum. Wir haben sie an den Ort geführt, wo die Idee zu dieser neuen Oper entstand, und im Wald ihrem anregenden Gespräch über ihre Zusammenarbeit für diese „moderne Märchenoper“ gelauscht. Bevor Das kalte Herz uraufgeführt wird, kommt eine der kreativsten Künstlerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts auf die Bühne der Staatsoper. In seiner letzten Oper Les Contes d’Hoffmann lässt der Komponist Jacques Offenbach den Schriftsteller E. T. A. Hoffmann auf seine eigenen literarischen Figuren treffen. Zwischen Operettenseligkeit und Schauerromantik wandelt Offenbachs emotionsgeladene Musik elegant und mitreißend, zudem bietet sie äußerst virtuose Gesangspartien. Zwischen dem unheimlichen Gebaren des teuflischen Bösewichts und dem engelsartigen Schutz der Figur der Muse spitzt die Regisseurin Lydia Steier ihre Inszenierung zu einem Kampf dieser Gestalten um Hoffmanns Seele nach seinem Tod zu. Mit opulenten und überwältigenden Bühnenbildern und Kostümen wird sie dem Phantasiereichtum dieser französischen Oper gerecht. Gemeinsam mit dem Tenor Pene Pati, der die Titelfigur in der Premiere singen wird, hat sie in dem Berliner Lokal am Gendarmenmarkt das Glas erhoben, wo E. T. A. Hoffmann so manche Reise in seine unerschöpflichen Phantasien begonnen hat.

Die Reise einer der bedeutendsten Opern der Musikgeschichte auf die Opernbühnen weltweit begann vor genau 100 Jahren an der Staatsoper Unter den Linden. Nun widmet sich Generalmusikdirektor Christian Thielemann im Dezember der vielschichtigen Musik von Alban Bergs Wozzeck. Im Gespräch spürt er den Herausforderungen dieser Partitur nach und blickt freudig mehreren Konzerten entgegen, in denen er mit der Staatskapelle Berlin heiteres Repertoire auf die Bühne bringen wird. Worauf sich drei Musiker:innen des Orchesters im vielfältigen Opern und Konzertrepertoire dieser Spielzeit besonders freuen, erzählen die Konzertmeisterin Jiyoon Lee, die Trompeterin Noémi Makkos sowie der SoloPauker Stephan Möller. Wir freuen uns, wenn Sie sich von der Lektüre unseres Magazins zu zahlreichen Besuchen in der Staatsoper Unter den Linden ermuntern lassen und wünschen Ihnen anregende Stunden in unseren Aufführungen.
Elisabeth Sobotka Intendantin
& Matthias Pintscher
Das kalte Herz — Eine Märchenoper in der Naturkathedrale


Daniel Arkadij Gerzenberg
„Diese Oper ist eine moderne Märchenoper, vielleicht wie ein Traum“, sagt Daniel Arkadij Gerzenberg über Das kalte Herz. Der Autor und Pianist schrieb das Libretto für Matthias Pintschers Oper, die im Januar 2026 an der Staatsoper Unter den Linden uraufgeführt wird. Darin werden die vielen verschiedenen Stimmungen, Erinnerungen und Gefühle spürbar, die uns Menschen im Wald überkommen, wie Gerzenberg bei einem Waldspaziergang mit Pintscher erzählt: „Gleichzeitig geht es zentral um das Motiv aus dem Märchen Das kalte Herz, in dem ein menschliches Herz durch einen Stein ersetzt wird.“ Doch wie kam es überhaupt zu dieser Oper?
Seit vielen Jahren verbindet den Komponisten und Dirigenten Matthias Pintscher eine intensive Freundschaft mit Daniel Barenboim, der von 1991 bis 2023 als Generalmusikdirektor die Staatsoper Unter den Linden und die Staatskapelle Berlin maßgeblich prägte. Er war es, der Pintscher als Dirigent an die Staatsoper einlud und den Komponisten dafür gewann, eine neue Oper zu komponieren. Ab 2020 dirigierte Pintscher hier mehrere Vorstellungen von Richard Wagners Lohengrin und Der fliegende Holländer sowie die Uraufführung von Beat Furrers Oper Violetter Schnee. Beim Spaziergang erzählt Pintscher, wie ihm die Idee zur Oper bei einem Ausflug in den Schwarzwald kam: „Wir waren mit dem Ensemble Intercontemporain bei den

Donaueschinger Musiktagen und ich hatte einen Tag frei.“ Dieses in Paris beheimatete Ensemble für zeitgenössische Musik leitete Pintscher für zehn Jahre. „Auf einmal kamen viele Kindheitserinnerungen zurück von Wilhelm Hauffs Märchen Das kalte Herz, das ich als Fünf oder Sechsjähriger hunderte Male auf einer Kassette gehört habe. Die Worte kamen zurück, zusammen mit den Empfindungen, die wir mit Wald assoziieren, was es bedeutet, auf eine Lichtung zuzugehen, aber natürlich auch der Zustand von Angst und Horror. Klänge fingen an in mir zu schwingen, wissend, dass ich eventuell eine Oper schreiben würde.“ Wilhelm Hauffs 1827 veröffentlichtes Märchen erzählt von dem Köhler Peter, der sich wünscht, seiner schlecht bezahlten Arbeit entfliehen zu können, um ein wohlhabendes und angesehenes Leben zu führen. Er lässt sich auf einen Handel mit dem unheimlichen HolländerMichel ein, der ihm Wohlstand ermöglicht, ihm dafür aber ein Herz aus Stein in die Brust setzt, das ihm fortan jede Gefühlsregung verwehrt. Schnell wurde Pintscher klar, dass dieser noch immer faszinierende Stoff einen zeitgemäßen Zugriff erfordert, um auf der Opernbühne heute relevant zu sein. Er suchte das Gespräch mit Daniel Arkadij Gerzenberg, der nach seinem Klavierstudium jahrelang als Liedbegleiter bisher unter anderem beim Heidelberger Frühling, im Pierre Boulez Saal und in der Elbphilharmonie aufgetreten ist und parallel dazu immer auch als Lyriker aktiv an der Schnittstelle von Sprache und Musik arbeitet. Seit 2018 unterrichtet er an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ das Fach Lyrik. In seiner Arbeit als Liedbegleiter sog er unweigerlich die Sprache der Romantik in sich auf, in der auch Hauffs Märchen geschrieben ist. „Und trotzdem war es mir wichtig, aus diesem Fundus heraus für diesen Text eine ganz eigene Sprache zu finden.“ Die intensive Zusammenarbeit mit Pintscher am Libretto, von der beide schwärmen, währte mehrere Jahre, in der „wir uns gegenseitig befeuert haben und ich mir vielleicht, wenn ich den Text allein geschrieben hätte, nicht erlaubt hätte, mich solch einer poetischen Sprache hinzugeben.“
Pintscher:
„Ich möchte den singenden Menschen als sich emotional ausdrückenden Menschen in den Mittelpunkt stellen.“
So entstand ein Text voller Poesie, die der Musik Entfaltungsmöglichkeiten öffnet. Pintscher betont Gerzenbergs Wissen darum, „dass der Text Raum für Klang bereithält, der sich durch die Vertonung verwirklicht.“ Räume, in denen sich seine Musik entfaltet, eröffnet Pintscher seinem Publikum auf besonders faszinierende Weise. Schon als junger Komponist und Dirigent von gerade einmal 20 Jahren zog er mit seinen groß besetzten Orchesterwerken die Zuhörenden unmittelbar in den Bann. Mit den zahlreichen unterschiedlichen Instrumenten des Orchesters erzeugt Pintscher in seinen bisherigen Werken eine emotional wirkende Atmosphäre. Auch die Partitur von Das kalte Herz verspricht einen Reichtum an vielfältigen Klangfarben, die den geheimnisvollen und auch unheimlichen Spielort des Waldes auf der Bühne und in der Phantasie jeder einzelnen Person im Publikum entstehen lassen werden. Beim Komponieren hatte Pintscher den Klang der Staatskapelle Berlin im Ohr: „Ich darf wirklich sagen, dass das Stück für die Staatskapelle komponiert ist. Der Klang dieses Orchesters kennt die große Farbigkeit, das spontane Musizieren, das spontane Erkennen einer musikalischen Situation und das mit einer
Gerzenberg:
„Wenn wir das Herz als Metapher betrachten, dann steht das kalte Herz für die Absenz von Emotion und die Gefühllosigkeit.“

großen Flexibilität. Das Orchester hat diesen warmen, dunklen Klang. Und ja, es ist ein deutscher Klang, den dieses Orchester vertritt, und für mich war das auch eine Rückkehr in den deutschen Sprachraum.“ Seit vielen Jahren lebt Pintscher überwiegend in den Vereinigten Staaten, seit der Saison 2024/25 ist er Chefdirigent des Kansas City Symphony Orchestra, mit dem er auch in Europa im Concertgebouw in Amsterdam, der Berliner Philharmonie und der Elbphilharmonie in Hamburg zu erleben war. Der opulente und feinsinnige Orchesterklang in Das kalte Herz trägt die menschlichen Stimmen auf der Bühne. Pintscher war es bei der Komposition seiner vierten Oper – nachdem er über zwei Jahrzehnte für diese Gattung nicht geschrieben hatte – ein besonderes Anliegen, „den singenden Menschen als sich emotional ausdrückenden Menschen in den Mittelpunkt zu stellen“. Es hat auch mit seinen Erfahrungen als Dirigent von Opern Richard Wagners zu tun, dass er sich nun die Aufgabe stellte, „den Stimmen einen Raum zu geben, in dem sie sich frei bewegen können“. Gerzenberg betont die Einzigartigkeit der Gattung Oper, die Geschichten mit der emotionalen Kraft der menschlichen Gesangsstimme erzählen kann. Deshalb gibt es unter den sieben Figuren in der Oper auch eine Figur, die nicht singt, sondern nur spricht. Sie ist „nicht Teil des Geschehens im Sinne des menschlichen Miteinanders“, erklärt der Librettist. Dieser Azaël ist „sozusagen der Bösewicht“, der Peters Mutter einredet, dass sie ihrem Sohn in einem unheimlichen
Das kalte Herz
Matthias Pintscher & Daniel Arkadij Gerzenberg
Uraufführung
� 11. Januar 2026
Ritual das Herz entwenden muss. Unter anderem zeigt sich hier, wie Gerzenberg und Pintscher Wilhelm Hauffs Märchen verwandelt haben. Peters Mutter spielt eine herausragende Rolle, die sich von Azaël überzeugen lässt, dass ihr auserwählter Sohn in den Bann der Göttin Anubis gezogen werden soll. In diesen beiden übersinnlichen Figuren vereint das Libretto Motive aus den drei monotheistischen Religionen und dem alten Ägypten. Auf Anregung des Regisseurs James Darrah, mit dem Matthias Pintscher unter anderem die Leidenschaft für bildende Kunst verbindet, wird Azaëls Rolle in der Uraufführung von einer Schauspielerin dargestellt, wofür die zuletzt bei den Filmfestspielen in Cannes preisgekrönte Sunnyi Melles gewonnen werden konnte. Wie in Hauffs Märchen und doch ganz anders und mystischer lässt sich Peter schließlich bereitwillig darauf ein, ein kaltes Herz zu erhalten. „Wenn wir das Herz als Metapher betrachten, dann steht das kalte Herz für die Absenz von Emotion und die Gefühllosigkeit“, erläutert Gerzenberg und sieht in der Herzlosigkeit vieler Menschen in unserer Zeit die erstaunliche Bereitschaft, die eigenen Gefühle aufzugeben. In der vorletzten Szene wacht Peter mit seinem kalten Herz auf und ist nun ohne Gefühle. Der Librettist hat dem Komponisten quasi die Aufgabe erteilt, eine Musik zu schreiben, die gefühllos ist, „was in sich schon widersprüchlich ist. Also wie macht man das?“, wie Gerzenberg selbst gesteht. Verständlicherweise möchten die beiden den Klang dieser Szene nicht mit Worten beschreiben, das muss man sich anhören. Auch hier zeigt sich, wie eng verzahnt die Zusammenarbeit der beiden Künstler war: „Welche Rolle übernimmt die Sprache, welche Rolle übernimmt die Musik?“
Je mehr Pintscher und Gerzenberg über ihre gemeinsame Oper sprechen, desto größer wird das Geheimnis um sie. Wie der Wald, in dem die Oper spielt und in dem sie sich darüber unterhalten.
Ein Ort der Freiheit und des Lauschens sei der Wald, sagt Gerzenberg. „Ich mag es zum Beispiel, mich auf den Boden zu legen und einfach die Blätter zu beobachten. Und zuzuhören, wie das rauscht.“ „Aufgeladene Stille“ klinge im Wald, sagt Pintscher. „Der Wald ist ein spiritueller Ort, fast wie ein Ton.“ Darin erleben wir uns mit unseren komplexen Empfindungen, Erinnerungen, Assoziationen. Uns fallen Märchen ein, aber auch Horrorgeschichten. „Diese Komplexität ist in dieses Stück eingeflossen. Viele Details, aber auch eine große Einheit.“ Denn eigentlich, bringt es Pintscher auf den Punkt, „ist der Wald eine Naturkathedrale.“
Uraufführung Das kalte Herz

Zwischen Surrealismus und Romantik

Lydia Steier inszeniert Les Contes d’Hoffmann, Pene Pati ist in der Titelpartie zu erleben.
Im historischen Ambiente des Lokals „Lutter & Wegner“ in E. T. A. Hoffmanns Wohnhaus sprechen sie über die Neuproduktion an der Staatsoper.
Jacques Offenbachs unvollendete letzte Oper verfügt über eine ganz eigene Magie. In der „opéra fantastique“ Les Contes d’Hoffmann (Hoffmanns Erzählungen) verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Traum, zwischen Liebe und Kunst, zwischen Leben und Tod. Offenbach greift inhaltlich auf ein Schauspiel von Jules Barbier und Michel Carré zurück, die darin ihrerseits Motive aus den romantischdüsteren Geschichten E. T. A. Hoffmanns verarbeiten und den Dichter selbst zum tragischen Helden machen: Hoffmann wartet reichlich angezecht in einer Weinstube auf Stella, eine Sängerin, der er ganz und gar verfallen ist. Von seinen Freunden ermuntert beginnt er, von seinen prägenden Begegnungen mit drei Frauen zu erzählen: der mechanischen Puppe Olympia, der todkranken Sängerin Antonia und der verführerischen Kurtisane Giulietta. Drei Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten und doch sind sie auch Verkörperungen einer einzigen Idee. Jede von ihnen steht für eine Facette des Künstlertums: das Streben nach Perfektion, die Hingabe an die Kunst, die Verlockung der Sinnlichkeit – Hoffmann verliert jede von ihnen. Zugleich sind Olympia, Antonia und Giulietta Projektionsflächen Hoffmanns, sodass man als Zuschauer:in unweigerlich hinterfragen muss, wie subjektiv seine Erzählungen sind. Nicht nur der fragmentarische Charakter des Werks, das in zahlreichen Fassungen, Bearbeitungen und Editionen überliefert ist, trägt somit dazu bei, dass sich für jede Neuproduktion grundlegend verschiedene Deutungsmöglichkeiten der Geschichte ergeben.
Darüber unterhielten sich die Regisseurin Lydia Steier und der Tenor Pene Pati, der in der Titelpartie sein Rollendebüt gibt, im Anschluss an eine Probe an einem Ort mit unmittelbarem Bezug zum Stück. Denn die Rahmenhandlung von Les Contes d’Hoffmann spielt in einem noch heute existierenden Lokal, das sich inzwischen in Hoffmanns einstigem Wohnhaus befindet: Lutter & Wegner am Gendarmenmarkt. Hier verlor sich E. T. A. Hoffmann einst in Erinnerungen – und sein Rausch wurde zum Ausgangspunkt einer der faszinierendsten, aber auch komplexesten Opern des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
„Es hat anfangs ein bisschen gedauert, bis ich einen Zugang zu dem Stück gefunden habe“, gibt Lydia Steier zu und verweist dabei auf die jüngere Rezeptionsgeschichte. „Immer wieder wird versucht, den drei Frauen im Sinne einer feministischen Lesart eine Agenda zu geben, die ich aber nicht erkennen kann.“ Gleichzeitig ist sie fasziniert von den unzähligen Farben der Oper, die sich unter anderem durch die verschiedenen Welten ergibt, in denen die Akte angesiedelt sind. „Es gibt die tiefe Tragik Hoffmanns, die
„Das Konzept hat mir eine vollkommen neue Perspektive auf das Stück eröffnet, weil es nicht nur um Hoffmann als Künstler geht, sondern um eine Reflexion seines gesamten Lebens.“
Düsternis, aber auch jede Menge melodramatische, komische oder groteske Momente, alles, was das Leben ausmacht.“ Der schier allumfassende inhaltliche Reichtum der Oper ist für Steier letztlich auch der Schlüssel zu ihrer Interpretation: „Ich erzähle die Geschichte als Rückblick auf ein Leben. Hoffmann wird in unserer Inszenierung gleich zu Beginn sterben und in einer Art surrealem Purgatorium – ich finde den Begriff ‚Fegefeuer’ nicht ganz passend – auf sein bisheriges Tun als Mensch, weniger als Künstler, zurückblicken.“
Pene Pati, der in der mörderisch langen und fordernden Partie praktisch pausenlos auf der Bühne ist, freut sich über die Zusammenarbeit mit Lydia Steier. „Ich finde das Konzept unglaublich überzeugend. Es hat mir eine vollkommen neue Perspektive auf das Stück eröffnet, weil es nicht nur um Hoffmann als Künstler geht, sondern um eine Reflexion seines gesamten Lebens. Hoffmann muss lernen, mit seinen inneren Dämonen umzugehen, das empfinde ich als lebensnah und allgemeingültig.“ Und auch die Regisseurin ist begeistert von der Besetzung, mit der sie die Oper erarbeitet: „Besonders die komischen Momente brauchen ein so großes Maß an Präzision, das kann nicht jeder Sänger umsetzen.“ Neben der Titelfigur macht Lydia Steier besonders zwei Charaktere zu Hauptfiguren: Die Muse in Gestalt eines Engels und der Teufel – verkörpert durch die vier „Bösewichte” Lindorf, Coppélius, Dr. Miracle und Dapertutto – streiten um den toten Hoffmann und wollen anhand der Rückschau auf sein Leben entscheiden, ob er in die Hölle hinabgezogen wird oder in den Himmel emporsteigen darf – ein existenzieller Konflikt. „In der Rahmenhandlung ist Hoffmann ein vom Leben gezeichneter Künstler im New York der 1980er Jahre. Im Fegefeuer findet er sich plötzlich in einer grün schimmernden, zwielichtigen Bar wieder, in der er zahlreichen toten Künstlern begegnet“, beschreibt Lydia Steier die Szenerie. „Hier erzählt Hoffmann von den drei Frauen und nimmt gleich im OlympiaAkt die Außenperspektive ein: Hoffmann beobachtet sein etwa 10jähriges Selbst bei seiner ersten desaströsen Liebeserfahrung. Dieser Blick auf die eigene Figur gefällt mir besonders”, führt Pene Pati aus.


Lydia Steier
Die Verortung der Geschichte an der Schwelle von Leben und Tod, von Diesseits und Jenseits führt schließlich auch wieder zu E. T. A. Hoffmann und seinen Erzählungen zurück, die von einer ausgeprägten Faszination für Traum und Phantasiewelten zeugen. Die Figuren, die in der Oper als Widersacher Hoffmanns in Erscheinung treten, werden auch in den literarischen Vorlagen mit diabolischer Metaphorik charakterisiert. Das Zwischenreich, in dem Engel und Teufel in Lydia Steiers Inszenierung wirken, wird somit zu einem neoromantischen Wimmelbild – bunt, skurril und vor allem kurzweilig.
Dies entspricht auch der durchaus heterogenen Musik von Les Contes d’Hoffmann. Ihre stilistische Bandbreite reicht von der geradezu übermenschlich virtuosen Arie der Olympia, die wie eine Parodie auf die mechanische Perfektion der Opernkunst scheint, bis hin zur berühmten „Barcarole“ – ein Nachtlied über Liebe, Lust und Vergänglichkeit. Chor und Ensemble verkörpern zahlreiche mitunter merkwürdige Gestalten, die Hoffmanns Phantasiewelten bevölkern. Ebenso gibt es aber auch berührende Momente von großer Intimität, besonders im kammerspielartigen AntoniaAkt. Die Berliner Fassung fußt überwiegend auf der Neuedition von Michael Kaye und Jean Christophe Keck und entstand in der Zusammenarbeit von Lydia Steier und dem Dramaturgen Maurice Lenhard mit dem musikalischen Leiter Bertrand de Billy, der ein ausgewiesener Kenner von Offenbachs Musik ist.
Seit der letzten Neuinszenierung von Les Contes d’Hoffmann an der Staatsoper Unter den Linden sind 38 Jahre vergangen, sodass eine ganze Generation von Opernliebhaber:innen herangewachsen ist, ohne Offenbachs Meisterwerk in einer neuen Deutung an diesem Haus zu erleben. Am 16. November 2025 findet die Premiere auf der Bühne der Staatsoper statt – unweit der historischen Wirkungsstätten E. T. A. Hoffmanns, an denen sich Berlin zumindest auf den zweiten Blick von seiner romantischen Seite zeigt. Zur weiteren Beschäftigung mit E. T. A. Hoffmann regt ab Mitte November zudem ein Audiowalk an, der auf der Webseite der Staatsoper zu finden ist und zu den wichtigsten Wirkungsstätten des romantischen Dichters führt.
Les Contes d'Hoffmann
Die Gegenwart der Zwanziger: Über Berg, Lehár und Rundfunkmusik –im Gespräch mit Christian Thielemann
Ihre erste Saison als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden ist vorüber, die zweite hat sehr erfolgreich mit zwei zyklischen Aufführungen von Wagners Ring-Tetralogie begonnen. Für die Staatskapelle Berlin wie für Sie persönlich gab es enorm viel Zuspruch. Wie hat sich denn das Orchester und dessen Klang in diesem vergangenen Jahr verändert?
Gemeinsam haben wir ein weites Feld erschlossen, mit unterschiedlichem Repertoire: mit Mendelssohn und Liszt, mit Bruckner und Strauss, aber auch mit Musik aus den 1920er Jahren, abseits von großer Oper und Symphonik. Solche Ausflüge in eher ungewohnte Bereiche – Operette, Jazz oder auch Varieté – sind für das Orchester sehr produktiv, da sie Perspektiven öffnen und sich spürbar positiv auf die Spielkultur auswirken. Außerdem haben wir die Sitzordnung im Orchestergraben sowie auf dem Konzertpodium verändert, mit hörbarem Effekt. Die Holzbläser sind im Graben nun auf der linken Seite platziert, die Hörner befinden sich dahinter, während die Blechbläser rechter Hand sitzen. Auf diese Weise ist es möglich, regelrechte Stereowirkungen zu erzielen, was bei den RingAufführungen schon deutlich zur Geltung kam. Und da ich die Staatskapelle nun innerhalb der letzten Saison genauer kennengelernt habe, war es möglich, einen enorm differenzierten Klang zu erzeugen, wie ich es noch in keinem von mir dirigiertem Ring zuvor erlebt habe. Wir haben mit viel Freude die Pianissimi ausgekostet – und wenn es klanglich intensiv wurde, dann haben wir das ebenso verwirklichen können. Die Staatskapelle hat da in der Tat eine Meisterleistung geboten.
Nach dem Ring steht nun die nächste Herausforderung an, eine Aufführungsserie von Alban Bergs Wozzeck anlässlich von dessen 100. Jahrestag der Uraufführung, hier an der Staatsoper Unter den Linden. Welche Bedeutung hat dieses besondere Jubiläum für Sie und welche besonderen Qualitäten zeichnet dieses Werk aus?
Für mich ist Wozzeck eines der bedeutendsten Musiktheaterwerke überhaupt. Es ist immer noch ein erstaunlich „modernes“ Stück, das auf engem Raum viele Qualitäten versammelt. Beschäftigt man sich ein wenig länger mit der Partitur, so erweist sich die Musik aber auch als ausgesprochen gesanglich, geradezu „spätromantisch“, von großer Ausdruckskraft erfüllt. Ein ganzes musikgeschichtliches Kompendium lässt sich darin finden: Charakterstücke verschiedenster Art etwa, auch traditionelle Formen wie Fuge und Passacaglia sowie die Teile einer Symphonie oder Sonate – und das alles sehr komprimiert und substanzreich. Und dass wir jetzt auf den Tag genau 100 Jahre nach der Uraufführung am selben Ort, in der Staatsoper Unter den Linden, mit einer neuen Vorstellungsserie einer szenisch eindrucksvollen Produktion in hervorragender Besetzung an die Öffentlichkeit treten, ist natürlich ein besonders schöner Brückenschlag zwischen Geschichte und Gegenwart dieses traditionsreichen Hauses.
Vor einer ganzen Reihe von Jahren haben Sie Wozzeck bereits dirigiert. Welche Erinnerungen haben Sie an die damaligen Aufführungen in Italien?
Das war 1989 in Turin, am Teatro Regio, an einem Haus, wo man nicht unbedingt eine Aufführung von

„Bergs
Musik erweist
sich als ausgesprochen gesanglich, geradezu ‚spätromantisch’, von großer
Ausdruckskraft erfüllt.“
Wozzeck erwartet. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Premiere im Februar einem Streik zum Opfer fiel, erst mit der zweiten Vorstellung begann dann die Aufführungsserie, die eine gute Resonanz gefunden hat. Nach mehr als 35 Jahren studiere ich jetzt die Partitur im Grunde komplett neu, auch wenn Manches von damals natürlich noch präsent ist.
Der Uraufführungsdirigent Erich Kleiber, einer Ihrer Amtsvorgänger, hat im Blick auf die Premiere im Dezember 1925 außergewöhnlich viele Proben angesetzt, um mit den Sängerinnen und Sängern und vor allem mit dem Orchester zu arbeiten. Sind die aufführungspraktischen Schwierigkeiten auch heute noch so eminent hoch?
Erich Kleiber halte ich für einen immens wichtigen Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Er neigte zu raschen Tempi, man denke nur an seine legendären Einspielungen von Strauss’ Rosenkavalier und Mozarts Figaro mit den Wiener Philharmonikern aus den 50er Jahren. Und dann brachte er einen Klang zustande, der vollkommen unsentimental war. Die Musik von Bergs Wozzeck, deren Bedeutung er als junger Dirigent offenbar mit viel Gespür erkannte, muss ihm in dieser Hinsicht sehr entgegengekommen sein. Die Instrumentierung ist ja nicht luxuriös, gewissermaßen „straussisch“, sondern wesentlich trockener, sachlicher, holzschnittartiger. Ab und an gibt es aber sogar Melodien von fast puccinesker Art, mit großem Atem und weitem Ausschwingen. Nach wie vor schwierig ist es sicherlich, die Haupt und Nebenstimmen klanglich genau auszutarieren, Berg hat das in seiner Partitur konkret vermerkt und großen Wert darauf gelegt, dass diese mit äußerster Klarheit und Deutlichkeit zu realisieren sind. Rein rhythmisch ist diese vielschichtige Musik durchaus nicht einfach zu dirigieren, man muss schon sehr konzentriert zu Werke gehen. Auf der anderen Seite sind aber viele Passagen auch sehr organisch komponiert und in einen natürlichen Fluss eingebettet, was es dem Dirigenten wiederum ermöglicht, das musikalische Geschehen gut unter Kontrolle zu haben und gestalterische Impulse zu geben.
Bergs Wozzeck gilt als eine der zentralen Opern des 20. Jahrhunderts und zugleich als eine Ikone der „Weimarer Kultur“. Immer wieder ist das Werk auch mit dem Begriff und
Phänomen des „musikalischen Expressionismus“ in Zusammenhang gebracht worden. Was hat es damit auf sich?
Der Expressionismus, im Sinne eines übersteigerten Ausdrucks, liegt vor allem im Sujet begründet. Das Stück lässt das Publikum beklommen zurück, im Grunde in einer furchtbaren Stimmung, wenn man sich vollen Ernstes auf den Inhalt der Oper einlässt. Obwohl das Drama Georg Büchners mit seiner ausgeprägten Sozialkritik bereits aus den 1830er Jahren stammt, passte es noch überaus genau in die Zeit der Weimarer Republik mit ihren tiefgreifenden Unsicherheiten, der Arbeitslosigkeit, der Depression, den ganzen prekären Verhältnissen, aber auch dem fieberhaften „Tanz auf dem Vulkan“. Bergs Wozzeck war offenbar ein Werk, das der Gegenwart der insgesamt so widersprüchlichen Zwanziger Gesicht, Stimme und Klang gab.
Mit dem Wozzeck bewegen wir uns mitten im Berlin der Weimarer Zeit. Im Silvester- und Neujahrskonzert wird das auch der Fall sein, wenn Musik aus späten Operetten von Franz Lehár erklingt, aus Friederike, Paganini und Giuditta, den sogenannten „Tauber-Operetten“. Warum gerade diese Programmauswahl?
Ein LehárPasticcio zu entwickeln und zu dirigieren, war ein Wunsch von mir, da ich denke, dass es sowohl für das Publikum als auch für das Orchester eine schöne Sache ist, gerade zum Jahreswechsel. Die Staatskapelle hat in der Vergangenheit kaum einmal Musik von Lehár gespielt –dabei wird es den Musikerinnen und Musikern sehr gut tun, sich einmal in diese Gefilde zu begeben.
Die Werke siedeln ja an der Grenze von Operette und Oper, ohne richtiges „Happy End“. Trotzdem darf das Publikum hinreichend viel Esprit, Humor sowie regelrechte „Ohrwürmer“ erwarten, nicht wahr?
So ist es. Lehárs Musik, gerade aus den genannten drei Werken – hinzu kommt als Eröffnungsstück noch die nachkomponierte klangprächtige Ouvertüre zur Lustigen Witwe – ist populär im besten Sinne, besitzt einen hohen Wiedererkennungswert, verfügt über schmissige, zuweilen auch ein wenig schwermütige Melodien. Es ist eine Musik, die quasi zum Mitsingen geeignet ist – und dieser Charakter
„Ich denke, dass wir in Zukunft noch des Öfteren mit dem Orchester Ausflüge in eher unbekanntes Repertoire unternehmen werden.“

Wozzeck
Alban Berg
Musikalische Leitung: Christian Thielemann
ab 14. Dezember 2025 J001 a hreWozzeck
soll auch bei diesem Konzert mitschwingen und das Publikum animieren.
Im Februar 2026 steht dann ein weiteres Sonderkonzert der Staatskapelle unter Ihrer Leitung an, mit dem schönen Titel „Musik aus fernen Rundfunktagen“. Was verbirgt sich dahinter?
Es soll ein Ausflug werden in die Kultur der Kurorchester wie es sie etwa in Bad Reichenhall, Bad Kissingen oder Bad Ems lange Zeit gegeben hat bzw. immer noch gibt. Eine qualitativ hochstehende, anspruchsvolle Unterhaltungsmusik wurde und wird da geboten, immer sehr publikumsnah, mit
einer großen stilistischen Bandbreite, rhythmischem Schwung und Melodienseligkeit. Operette und Jazz haben da ebenso ihren Platz wie die sogenannte „leichte Klassik“ – und das wollen wir mit unserem Programm auch erreichen. Musik soll erklingen, wie sie sonntagnachmittags im Radio gespielt und von vielen Menschen mit großem Interesse gehört wurde, leichtfüßig von einem Stil zum anderen springend, oft mit tänzerischem Einschlag, aber auch mit der Klangintensität und schönheit eines großen Opern und Symphonieorchesters versehen. Ein Stück, das wir spielen werden, die Tänzerische Suite des als Operettenkomponist bekannt gewordenen Eduard Künneke, ist 1929 sogar eigens für den Rundfunk geschrieben worden. Ich denke, dass wir in Zukunft noch des Öfteren derartige Ausflüge in eher unbekanntes Repertoire, das wir dem Vergessen bzw. der Missachtung entreißen wollen, unternehmen werden. Alles gewiss zur Freude des Orchesters wie des Publikums!
Es scheint jedenfalls, dass die Ideen so schnell nicht ausgehen. Und wir können alle miteinander gespannt sein auf die kommenden Aufführungen in Oper und Konzert. Gutes Gelingen dafür!
Das Gespräch führte Detlef Giese.
Vielfalt und Flexibilität
Von großer Symphonik bis zum Kammerkonzert, von der Oper bis zum Familienkonzert – das programmatische Spektrum der Staatskapelle Berlin reicht von bekannten Meisterwerken bis hin zu spannenden Entdeckungen und bietet eine Fülle musikalischer Formate. Schöpfend aus seiner über 450jährigen Tradition begibt sich das Orchester als lebendiges Ensemble mit Neugier und Leidenschaft dabei immer wieder neu – bei jeder Probe, bei jeder Aufführung – auf die Suche nach dem „richtigen Ton“ in diesem reichhaltigen Spielplan. Über die ebenso herausfordernde wie abwechslungsreiche Arbeit in einem Spitzenorchester und ihre persönlichen Herzensprojekte der Saison berichten drei Mitglieder der Staatskapelle.
Jiyoon Lee
Jiyoon Lee – Erste Konzertmeisterin
Ein besonderes Erlebnis in dieser Spielzeit ist für mich die Wiederaufnahme von Alban Bergs Wozzeck unter Christian Thielemann, denn es war diese ausdrucksstarke Oper, die mich mit der Staatskapelle erstmals in Berührung brachte. Damals war ich noch Studentin und ergatterte eher zufällig ein Ticket für die Staatsoper. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieser Abend eine so intensive und tatsächlich lebensverändernde Erfahrung für mich werden würde. Die Musik hat mich absolut mitgerissen – ich werde nie vergessen, wie ich damals im Publikum saß und völlig gefesselt war vom Spiel auf der Bühne, vor allem aber von dem im Orchestergraben. Das war mein erster Eindruck von der Staatskapelle – und seitdem war es mein Wunsch, einmal im Leben die Gelegenheit zu erhalten, dort im Graben zu sitzen und diese Oper zu spielen. Ich bin überglücklich, dass sich mir diese Möglichkeit nun bietet. Die Opernarbeit liegt mir seit jenem Abend sehr am Herzen, aber ich bin auch leidenschaftliche Kammermusikerin und dankbar, diese Leidenschaft regelmäßig in den verschiedenen Kammermusikreihen der Staatsoper ausleben zu können. Die Art und Weise des musikalischen Austauschs ist im kammermusikalischen Spiel einzigartig. Es ist das perfekte Training für Präzision und Zusammenspiel, denn bei einem Streichquartett oder einem Klavierquintett muss man seine Antennen immer auf Empfang halten. Hier lernt man im Kleinen zu verstehen, was die Musik im Großen ausmacht – aus einem Kammerkonzert kann ich viel für die großen Symphoniekonzerte mitnehmen. Ich glaube, es ist genau diese Bandbreite vom Kammerkonzert bis zur großen Oper, die ich als Musikerin an der Staatskapelle liebe. Dabei ist es für das Orchester essenziell, sich immer wieder

Noémi Makkos


Stephan Möller
Konzert zum Jahreswechel
Staatskapelle Berlin & Christian Thielemann
31. Dezember 2025
1. Januar 2026

neu auf die Suche nach der richtigen Klangfarbe zu machen. Die Staatskapelle ist bekannt für ihren dunklen, warmen Klang, und es ist wichtig, dass wir dieses Klangprofil behalten. Die Stärke des Orchesters ist aber, fein im Klangbild zu differenzieren, je nachdem, was auf dem Programm steht. An einem Abend spielen wir Wagner, und am nächsten Tag führen wir Mozart oder Rossini auf. Und jede Oper erarbeiten wir uns neu und werden – auch dank der unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten am Dirigierpult – zu Spezialistinnen und Spezialisten für ein bestimmtes Repertoire. Diese Vielfalt und Flexibilität auf höchstem künstlerischem Niveau ist für mich die Qualität der Staatskapelle. Und auch ich persönlich brauche diese Impulse, die von all den verschiedenen Genres, Stilen und Menschen ausgehen – durch sie fühle ich mich lebendig!
Noémi Makkos – Trompeterin
Seit sieben Jahre bin ich als Trompeterin an der Staatskapelle Berlin engagiert und habe in dieser Zeit weit über 50 verschiedene Opern gespielt – nicht zu vergessen, das vielseitige symphonische Programm, das ich in diesen Jahren mitgestalten durfte. Diese verschiedenen Stile zu beherrschen und in jeder Spielzeit aufs Neue zu pflegen ist mir sehr wichtig. Dennoch freue ich mich immer besonders, wenn ein Werk auf den Spielplan gesetzt wird, das mir noch unbekannt ist. Daher bin ich besonders auf die Uraufführung von Matthias Pintschers Oper Das kalte Herz gespannt. Es ist immer eine große Herausforderung, aber auch Freude, solche Stücke gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Orchester und natürlich mit dem Komponisten selbst zu erarbeiten – man betritt zusammen Neuland und erkundet als Klangkörper eine neue musikalische Sprache. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese neuen Werke brauchen und den „frischen Wind“, den sie mit sich bringen, auch damit wir nicht zu einem Museum erstarren. Was jedoch nicht bedeutet, dass wir nicht auch unsere musikalische Tradition kultivieren sollten. Komponisten wie Gustav Mahler oder Johannes Brahms gehören zur Identität der Staatskapelle. Ich freue mich daher in dieser Spielzeit besonders auf die Aufführungen von Mahlers Auferstehungssymphonie, die definitiv eine meiner Lieblingssymphonien ist – schon allein weil hier zehn Trompeten besetzt sind, sechs im Orchester und vier als Bühnenmusik! Mein zweiter Höhepunkt wird das BrahmsRequiem sein, mit dem wir auf Gastspiel in die Elbphilharmonie gehen und das gerade unter der Leitung von Christian Thielemann für mich ein einzigartiges Erlebnis sein wird. Für mich muss es aber nicht immer die große Symphonik sein: Ein Herzensprojekt dieser Spielzeit ist für mich das Familienkonzert, in dem ich gemeinsam mit Lindenbrass, dem Blechbläserensemble der Staatskapelle, Ausschnitte aus Hänsel und Gretel spiele. Zusammen mit einem Sprecher laden wir das Publikum ein, sich in diese Märchenwelt hineinzuträumen. Zu erleben, wie die Musik die Phantasie und kreative Vorstellungskraft unserer jungen Zuhörerinnen und Zuhörer beflügelt, ist für mich sehr bereichernd.
Stephan Möller – SoloPauker
Als Musiker schätze ich die Vielfalt meiner Tätigkeiten in der Staatskapelle, doch mein Herz gehört der Oper. Da meine Eltern beide Musiker sind, war ich schon von Kindesbeinen an in der Oper und habe gemeinsam mit meinem Bruder viel Zeit im Zuschauerraum, aber auch auf Proben verbracht. Bis heute liebe ich den Opernbetrieb, das Lebendige, den Geruch, wenn man das Haus betritt, das geschäftige Treiben von Maske und Kostüm. Für mich gibt es keine interessantere Kunstform, weil man einerseits Bezug nehmen kann auf das Zeitgeschehen und andererseits eine gewachsene Tradition pflegt – das ist für mich ein ganz bedeutender Input. Schon bei meinem allerersten Auftritt mit der Staatskapelle – wir haben Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss gespielt – hat mich das Zusammenwirken all dieser verschiedenen Künste und Gewerke, aber auch die Intensität des Orchesterklangs überwältigt. Strauss zu spielen ist immer nervenaufreibend, weil es so eine anspruchsvolle Musik ist, die unheimlich dicht komponiert ist. Aber es ist eine Musik, die dem Orchester vertraut ist, sie ist tradiert und erprobt. Ähnlich wie bei den Musikdramen Richard Wagners gibt es hier bestimmte Mechanismen in der Staatskapelle – da herrscht so ein tiefes Einverständnis, dass man sofort ins Detail gehen kann, das ist phantastisch. Manchmal schaue ich über mein Notenpult und kann gar nicht fassen, welches Glück es ist, mit diesem Orchester und all seinen großartigen Dirigenten und Dirigentinnen musizieren zu dürfen. Für mich ist es aber auch wichtig, das Opernhaus und die Staatskapelle für gesellschaftliche Diskurse zu öffnen und zugänglich zu machen für Menschen, die mit unserer Kunstform sonst vielleicht nicht in Berührung kämen. An einer Reihe wie Sustainable Listening mitzuwirken, die auf eine performative Weise Themen der Nachhaltigkeit und des Klimawandels in den Mittelpunkt stellt und mit akustischer und elektronischer Musik verbindet, ist mir daher ein besonderes Anliegen. Hier kann ich mich engagieren für die Themen, die meine Kinder später einmal bewegen werden – und kann als Musiker und Mensch zumindest einen kleinen Beitrag zum Umdenken leisten.
Sonderkonzert
„Musik aus fernen Rundfunktagen“
Staatskapelle Berlin & Christian Thielemann
14. 15. Februar 2026
Freunde & Förderer der Staatsoper Unter den Linden
Als Mitglied unseres Vereins unterstützen Sie die künstlerische Arbeit der Staatsoper Unter den Linden und die Staatskapelle Berlin. Doch nicht nur das: Sie treffen interessante Persönlichkeiten, die Ihre Begeisterung für Oper teilen. Bereichern Sie Ihr Leben mit Musik und engagieren Sie sich für die Staatsoper, denn …
! Mitgliedsantrag!Mit
Kunst braucht Freunde und wir brauchen Kunst!
!gartnasd

Werden auch Sie Teil der musikalischen Familie!
Im Kreise der Freunde & Förderer erleben Sie die Künstler:innen der Staatsoper hinter den Kulissen und erhalten einmalige Einblicke in das Opernleben. Bei Generalproben, Premierenempfängen, unserem Gesprächsformat ZwischenTöne, dem OpernSalon und Mitgliederkonzerten genießen Sie eine besondere Nähe zur Staatsoper. Unser Kartenservice mit besonderen Vorkaufsrechten und Ticketkontingenten sichert Ihnen stets die besten Plätze.
Unsere Jungen Freund:innen sind ein musikhungriges Netzwerk junger Menschen unter 35 Jahren. Die APOLLOS erleben gemeinsam musikalische Sternstunden auf der Opernbühne, besuchen Proben sowie Künstler:innengespräche und entdecken auf Reisen großartige Opernhäuser in Europa.
Oper ist ein traditionsreiches und zugleich immer wieder neu entstehendes Erlebnis, das wie kaum eine andere Kunstform Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbindet. Durch die Stiftung Staatsoper Unter den Linden können Personen, die eine tiefe Verbundenheit mit der Staatsoper verspüren, durch Schenkungen, Zustiftungen, Testamentspenden oder Vermächtnisse die herausragende künstlerische Arbeit der Staatsoper nachhaltig unterstützen. Als Stuhlpatin oder Stuhlpate der Staatsoper Unter den Linden unterstützen Sie herausragendes Musiktheater von Ihrem Lieblingsplatz aus.
Weitere Informationen finden Sie unter www.staatsoperberlin.de/freunde
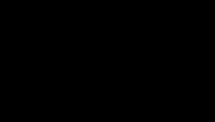
Eine Oper zum Mitmachen
„Ich habe so etwas Schönes noch nie gesehen und gehört.“
Eine Schülerin nach der Aufführung

Der Freischütz für Kinder
Carl Maria von Weber
Eine Oper zum Mitmachen für Kinder ab 8 Jahren
ab 22. Januar 2026
Telefonisch unter +49 ( 0 ) 30 20 35 45 55 per EMail an tickets@staatsoperberlin.de oder an unserer Theaterkasse im Foyer des Opernhauses
In Kontakt bleiben
Folgen Sie uns auf unseren SocialMediaKanälen hinter die Kulissen der Staatsoper Unter den Linden. Sie erhalten spannende Einblicke in die Entstehungsprozesse von Opern und Konzerten und erleben renommierte Gäste, unser Ensemble und die Staatskapelle Berlin hautnah. Aktuell und regelmäßig informiert Sie unser Newsletter, den Sie einfach online abonnieren können.
@staatsoperberlin
#staatsoperunterdenlinden

Ihre individuelle Konzertsaison!
Für KlassikFans, die sich ihr Programm gerne selbst zusammenstellen, ist das WahlAbo Symphoniekonzerte 25/26 das ideale Angebot. Wählen Sie aus unseren Symphoniekonzerten der Saison 2025/26 mindestens drei Termine aus, sichern Sie sich Ihren Wunschplatz in der Staatsoper oder der Philharmonie und sparen dabei auch noch bis zu 20 % (das Kontingent ist begrenzt).
Jetzt WahlAbo Symphoniekonzerte 25/26 buchen!
Flexibel bleiben mit der StaatsopernCard!
Für nur 35 € (ermäßigt 20 €) genießen Sie 20 % Rabatt auf Opern, Konzerte und Ballett in der Staatsoper Unter den Linden – so oft Sie möchten, auch bei Premieren!
Ihre Vorteile:
• 20 % sparen – auf alle Preiskategorien, unbegrenzt viele Vorstellungen
• Exklusiver Vorverkauf – sichern Sie sich die besten Plätze vor allen anderen
• 10 % Rabatt im Opernshop auf ausgewählte Artikel
• Exklusive Aktionen – profitieren Sie von besonderen Angeboten
Die StaatsopernCard ist für eine ganze Spielzeit gültig. Ihr Vorverkaufsrecht gilt im Zeitraum der Spielzeit, für die Sie eine StaatsopernCard erworben haben.
Jetzt sichern und flexibel genießen!
Hier bestellen:
Festtage 2026
28. März
�
6. April

Der Rosenkavalier
Richard Strauss
Un ballo in maschera
Giuseppe Verdi � Premiere
Konzert zum
Karfreitag
Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem
Mit u. a.
Christian Thielemann
Anna Netrebko
Ludovic Tézier
Charles Castronovo
Matthias Goerne
Julia Kleiter
Impressum
Staatsoper Unter den Linden
Unter den Linden 7, 10117 Berlin
Herausgeberin: Staatsoper Unter den Linden
Intendantin: Elisabeth Sobotka
Generalmusikdirektor: Christian Thielemann
Geschäftsführender Direktor: Ronny Unganz
Redaktion: Carolin Bitzer, Detlef Giese, Christian Graf, Olaf A. Schmitt
Projektkoordination: Christian Graf, Marlene Roth
Autor:innen: Detlef Giese (S. 10 f.), Elisabeth Kühne (S. 14 f.), Christoph Lang (S. 6 f.), Olaf A. Schmitt (S. 2 f.)
Fotonachweise:
Maximilian Semlinger (Cover / S. 25)
Maurizio Gambarini (S. 1)
Foto: Maximilian Semlinger /
Artwork: Laura Buechner (S. 67 / U4)
Jenny Bohse (S. 89)
Matthias Creutziger (S. 1113)
Peter Adamik (S. 1415)
Arno Declair (S. 19)
Herburg Weiland (S. 20)
Anzeigen: Staatsoper Unter den Linden
Gestaltung: HERBURG WEILAND, München
Herstellung: Katalogdruck Berlin
Druck: Druckhaus Sportflieger, Berlin
Lithographie: MXM Digital Service, München
Redaktionsschluss: 29.10.2025
Änderungen vorbehalten!
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stiftung Oper in Berlin.
Urheber:innen, die nicht erreicht werden konnten, werden um Nachricht gebeten.



„Ein Klangparadies“
Süddeutsche Zeitung


„Wagner at his best“


„Eine musikalische Offenbarung“

Berliner Morgenpost



„Der Jahrzehnt-Ring“










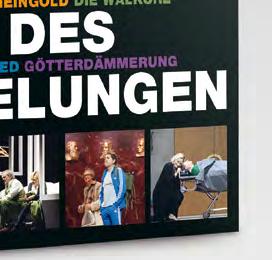

DER RING DES NIBELUNGEN
Christian Thielemann · Staatskapelle Berlin
Dmitri Tcherniakov

