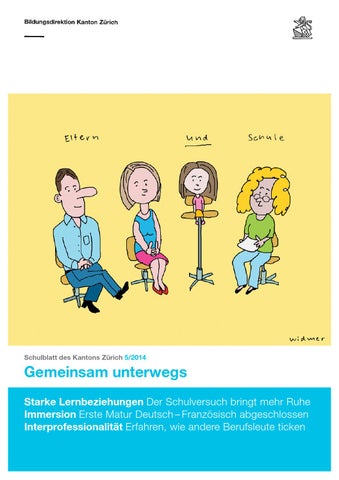Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Gemeinsam unterwegs Starke Lernbeziehungen Der Schulversuch bringt mehr Ruhe Immersion Erste Matur Deutsch – Französisch abgeschlossen Interprofessionalität Erfahren, wie andere Berufsleute ticken
2D, 3D, 4Dranbleiben.ch Kurse in Gestaltung und Kunst!
HS14 / FS15 01 ACCESSOIRES DESIGN | 02 AKT / FIGÜRLICHES ZEICHNEN | 03 AKT / FIGÜRLICHES ZEICHNEN / PORTRAIT | 04 AKTMODELLIEREN | 05 ANATOMIE UND KOMPOSITION | 06 AQUARELLIEREN | 07 BERATUNGSGESPRÄCHE & PROJEKTBEGLEITUNG | 08 BILD MEDIUM BLICK | 09 DIE ZEICHNUNG: EXPERIMENT ZWISCHEN POESIE UND KONSTRUKTION | 10 ENTWERFEN UND DARSTELLEN VON GÄRTEN UND ANLAGEN | 11 EXPERIMENTELLE DRUCKTECHNIKEN | 12 GESTALTEN MIT WEICHEM STEIN | 13 GRAFISCHE DRUCKTECHNIKEN | 14 GUSSTECHNIKEN | 15 HOLZSCHNITT | 16 ILLUSTRATION | 17 KERAMIK | 18 KLASSISCHE SCHRIFTEN SCHREIBEN UND EXPERIMENTIEREN | 19 KUNSTKURS 1 FÜR ERWACHSENE | 20 KUNSTKURS 2 FÜR ERWACHSENE | 21 KUNSTKURS FÜR JUGENDLICHE | 22 MALEN UND ZEICHNEN | 23 MALEN, MEDITIEREN, ERLEBTES NOTIEREN | 24 MALEN, ZEICHNEN, IMAGINIEREN UND ABSTRAHIEREN | 25 MANUELLE DRUCKTECHNIKEN | 26 MENSCH IM KONTEXT – FIGÜRLICHES ZEICHNEN UND MALEN | 27 MODE-DESIGN | 28 MODELLIEREN UND SILIKONFORM BAUEN | 29 MUT ZUM SKIZZENBUCH (Herbst 2014) | 30 MUT ZUM SKIZZENBUCH (Sommer 2014) | 31 MUT ZUM SKIZZENBUCH (Winter 2015) | 32 PERSÖNLICHKEIT IN DER BILDNERISCHEN ARBEIT | 33 PERSPEKTIVZEICHNEN FÜR GARTENPROJEKTE | 34 PLASTISCH-RÄUMLICHES ZEICHNEN IM MUSEUM UND IM BOTANISCHEN GARTEN | 35 PORTRAIT MALEREI 1 | 36 PORTRAIT MALEREI 2 | 37 RUNDGÄNGE DURCH ZEITGENÖSSISCHE GALERIEN, OKT/NOV | 38 RUNDGÄNGE DURCH ZEITGENÖSSISCHE GALERIEN, SEPT/OKT | 39 STILLLEBEN MALEREI | 40 ZEICHNEN VON KÖRPER UND KLEIDUNG
NEUE KURSE IM FRÜHJAHRSSEMESTER FS15 AQUARELLIEREN | DIGITALE FOTOGRAFIE | HOLZBEARBEITUNG | STUDIENWOCHE NAH UND FERN
Weitere Angebote in Planung. Detaillierte Informationen und Anmeldung unter: www.dranbleiben.ch Verein gestalterische Weiterbildung Zürich | 8000 Zürich
Inhalt
24
Französisch-Immersion: Der Lehrgang bietet auch Ungewohntes.
32
Für Einsatzfreudige: der Beruf der Forstwartin.
36
Auf Erfolgskurs: Gymnasiastin und Comic-Zeichnerin Sina Stähli.
Editorial von Katrin Hafner Kommentar von Bildungsdirektorin Regine Aeppli
5
Magazin Im Lehrerzimmer: Kantonsschule Wiedikon Militärpilotin Murielle von Büren unter der Lupe
6 7
Fokus: Gemeinsam unterwegs
8
Volksschule Der Schulversuch Starke Lernbeziehungen bewährt sich Lehrmittelplanung: Übersicht über die wichtigsten Projekte Stafette: Die Rudolf Steiner Schule in Zürich Kurzmeldungen
16 19 20 23
Mittelschule Deutsch-Französische Matur: Mehr als bloss Zweisprachigkeit Schulgeschichte(n): Künstlerisches Flair an der KS Rychenberg Kurzmeldungen
24 26 29
Berufsbildung Interprofessionelle Zusammenarbeit als Ausbildungsthema Berufslehre heute: Forstwartin Kurzmeldungen
30 32 35
Porträt Die 15-jährige Sina Stähli gewinnt Preise für ihre Comics
36
Service Schule und Kultur Hinweise auf Veranstaltungen Weiterbildung
38 40 43
Amtliches
53
Impressum und wichtige Adressen
79
Titelbild: Ruedi Widmer
Tausende Väter und Mütter treffen in diesen Wochen auf Hunderte Lehrerinnen und Lehrer: Das Schuljahr hat begonnen, es finden vielerorts Elternabende und Begrüssungsveranstaltungen statt. Ein Heft über das Verhältnis Schule – Eltern zu machen, sprengt den Rahmen, dachten wir zuerst. Denn: Den Prototyp «Eltern» gibt es ebenso wenig wie den Prototyp «Lehrperson». In der Volksschule, in Mittel- und Berufsfachschulen stellen sich den Lehrpersonen unterschiedlichste Fragen bezüglich Umgang mit Eltern, selbst von Schule zu Schule variieren die Themen und sogar innerhalb einer Klasse haben die Eltern verschiedene Bedürfnisse und Eigenheiten. Doch der Austausch über das Thema ist zentral, denn es gibt eine Gemeinsamkeit: Der Umgang mit Eltern ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit als Lehrerin oder Lehrer – und nicht immer ein problemloser. Es gibt Eltern, die in jedem Detail mitreden wollen, andere drohen rasch mit dem Anwalt und wieder andere sind schlicht nicht erreichbar. In den meisten Fällen aber, das darf nicht vergessen werden, klappt der Kontakt gut. Wie hat sich das Verhältnis denn in den letzten Jahren verändert und was bedeutet es für die Schule? Wir hörten uns um bei Fach- und Lehrpersonen – und wagen uns aufs Glatteis mit Anregungen, wie man den Kontakt mal anders angehen könnte. ! Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 3
Klassenfotos Foto Bruno Knuchel Tössstrasse 31 8427 Rorbas 079 352 38 64 bruno.limone@bluewin.ch
4 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Kommentar
Eine Investition, die sich lohnt Die Elternmit wirkung ist heute in allen Schulen institutionalisiert. Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehr personen und Eltern braucht es eine echte Partnerschaft. Diese entsteht nicht von selbst.
An vielen Schulen pflegt man ein gutes Verhältnis zu den Eltern der Schülerinnen und Schüler. Gleichwohl bleibt die Zusammenarbeit mit den Eltern für Lehrpersonen eine permanente Herausforderung im Schulalltag. Den Prototyp «Eltern» gibt es nicht und damit auch kein allgemeingül tiges Rezept, wie mit Eltern umgegangen werden soll. So unterschiedlich die Kinder sind, so verschieden sind auch deren Mütter und Väter. Vor Kurzem erklärte mir eine Lehrerin: «In meiner ehemaligen Schule war ich froh, wenn überhaupt jemand an den Elternabend kam. In der neuen Schule vergeht kaum ein Tag, ohne dass sich eine Mutter über das Wohlergehen ihres Kindes erkundigt oder nochmals nachfragt, ob sie ihrem Sprössling statt Wasser auch Tee für den Ausflug mitgeben dürfe.» Schule und Elternhaus, das waren früher zwei ge trennte Welten. Seit 2005 ist die Elternmitwirkung im Volksschulgesetz verankert. Seither ist an den Schulen viel passiert: Elternräte oder Elternforen wurden installiert und verschiedene Formen der Zusammenarbeit erprobt. Neue institutionelle Beziehungen brauchen ihre Zeit, bis den verschiedenen Beteiligten klar ist, was sie voneinander erwarten dürfen. Dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus der Förderung der Kinder zuträglich ist, bestreitet niemand. Einige Studien kommen sogar zum Schluss, dass der Einfluss des Elternhauses auf den Bildungserfolg der Kinder grösser ist als der Einfluss von Schulen und Lehrpersonen. Wenn es uns gelingt, dass Schule und Elternhaus näher zusammenrücken, erhöhen wir die Bildungschancen der Kinder. Im Idealfall ziehen Schule und Eltern am selben Strick. Doch welche Voraussetzungen braucht es für diese partnerschaftliche Zusammenarbeit? Aufseiten der Schule gibt es aus Angst vor der Einmischung der Eltern zum Teil Abwehrreaktionen oder die Befürchtung, dass die zeitliche Beanspruchung dafür zu gross ist. Umgekehrt fehlt es aufseiten der Eltern aber manchmal auch an der Bereitschaft, sich für die Schule des Kindes zu engagieren. Wieder an dere Eltern möchten am liebsten auch bei der Unterrichtsgestaltung mitreden. Beide Seiten, Lehrpersonen und Eltern, wollen nur das Beste für die Kinder. Sie verstehen aber nicht immer das Gleiche darunter. Ist die gute Note in Mathematik das Ziel? Oder die hohe soziale Kompetenz? Ist es wichtig, dass das
Foto: Béatrice Devènes
Von Regine Aeppli, Bildungsdirektorin
Kind ein Instrument spielt? Oder braucht ein Kind ge nügend freie Zeit zum Spielen? Eine gute Zusammenarbeit funktioniert nur dann, wenn beide Seiten die Zuständigkeiten der andern kennen und respektieren. Es braucht Eltern, die bereit sind, sich für die Schule zu engagieren, und zwar über das Zeugnis gespräch ihres Sprösslings hinaus. Es braucht ausserdem Lehrpersonen, Schulleitungen und Behördenmitglieder, welche die Eltern als wichtige und gleichwertige Partner ernst nehmen und am Schulbetrieb teilhaben lassen. Wenn die Eltern besser verstehen, was an den Schulen von den verschiedenen Beteiligten geleistet wird, bringen sie den Lehrpersonen mehr Verständnis entgegen. Ich bin überzeugt, dass es sich längerfristig lohnt, in die Beziehung zu den Eltern zu investieren. ! Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 5
Magazin
Im Lehrerzimmer der Kantonsschule Wiedikon ist die grosse Pause kurz, französisch und fröhlich.
Fotos: Marion Nitsch
Altehrwürdig: ist das 110 Jahre alte Schulhaus. Modern: dagegen sein Innenleben, das jüngst erneuert wurde. Heterogen: Die 150 Lehrpersonen und über 800 Schülerinnen und Schüler kommen aus unterschiedlichen Milieus – aus dem Langstrassenquartier oder auch vom Land. Anklang: finden im renovierten Lehrerzimmer die Deckenleuchten. Und die Pausenäpfel – obwohl sie pro Stück 1 Fr. kosten. Umstritten: sind die dunklen Einbauschränke, besonders die Lehrerkästli, die an Urnengräber erinnern und «Krematorium» genannt werden. Einheitslook: Die zwei anwesenden Prorek6 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
toren und der Rektor tragen kurz geschorenes Haar. Hohle Gasse: heisst der Durchgang vom Vorraum zum eigentlichen Lehrerzimmer. Atmosphäre: Heiter, an den Tischen wird angeregt diskutiert. Themen: das 50-Jahr-Jubiläum der Schule im Jahr 2015. Unüberhörbar: sind die Französischlehrerinnen – ihre Zimmer liegen besonders nah. Kurz: Die grosse Pause dauert nur eine Viertelstunde, damit morgens fünf Lektionen reinpassen. Geschirrablage: Am Schluss legen alle ihre Tassen ins Abwaschbecken, der Hausmeister will den Geschirrspüler selber einräumen. [as]
Magazin
Unter der Lupe Fünf Fragen an Militärpilotin Murielle von Büren Wenn Sie an Ihre Schulzeit denken, was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn? Es war eine tolle und auch eine unbelastete Zeit! Ich genoss es, den Schulweg mit meinen Freundinnen zu teilen und nach der Schule mit ihnen zu spielen. Diese Freundschaften standen für mich im Vordergrund. Auch hatte ich das Glück, in einer stabilen Familie aufzuwachsen. Meine Mutter war Hausfrau und immer für uns da, mein Vater kam jeden Mittag zum Essen nach Hause. Welcher Lehrperson geben Sie rückblickend die Note 6 und warum? Meinem Mathematiklehrer am Lehrerseminar in Bern. Vielleicht lag es daran, dass Mathematik mein Lieblingsfach war. Der Lehrer vermittelte uns den Stoff immer sehr sachlich und logisch und trotzdem stets mit etwas Humor und viel Geduld. Inwiefern hat die Schule Ihnen geholfen, eine bekannte Schweizer Militärpilotin zu werden? In der Schule habe ich gelernt, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten. Das hilft mir heute, denn bei uns ist Zusammenarbeit ein ganz wichtiger Faktor, im Cockpit sind wir manchmal zu zweit. Ausserdem habe ich gelernt, zu l ernen. Dank der grossartigen Lehrer, die ich während meiner gesamten Schulzeit hatte, bin ich immer sehr gerne zur Schule gegangen und hatte Freude da ran, Wissen zu erwerben. Ich hatte auch grossen Respekt vor meinen Lehrern – im positiven Sinn. Dies motivierte mich, das Lehrerseminar zu besuchen, um selber Lehrerin zu werden. Und diese Ausbildung wiederum, die sehr breit ausgerichtet ist, öffnet einem viele Türen für die Zukunft. Was ist das Wichtigste, was Kinder heute in der Schule lernen sollen, und warum? Für mich ist es wichtig, dass ein Kind gerne zu Schule geht und somit Freude hat, etwas zu lernen. Die Kinder sollen lernen, ihre Fähigkeiten zu kennen und weiterzuentwickeln. Sie sollen sich gegenseitig unterstützen, Menschen aus anderen Kulturen achten und sich für ihre Mitmenschen interessieren. Auch sollen sie lernen, dass es Regeln gibt, die es einzuhalten gilt. Gleichzeitig soll ihnen die Schule vermitteln, dass sie es offen und ehrlich sagen können, wenn sie eine Regel mal nicht einhalten konnten. Denn Angst vor Strafe ist kein probates Mittel, um Kinder von der Notwendigkeit gewisser Dinge zu überzeugen. Warum wären Sie eine gute Lehrperson – oder eben nicht? Nach dem Lehrerseminar, bevor ich mich für die Fliegerei entschied, unterrichtete ich zwei Jahre als Klassen lehrerin an einer Primarschule. Ich versuchte, möglichst alle Kinder auf ihrem Niveau zu fördern. Die eher schwächeren Schüler be kamen mehr Unterstützung und die schnelleren erhielten immer wieder Zusatzaufgaben, damit ihnen nicht langweilig wurde und sie deswegen den Unterricht störten. Diese zwei Jahre sind mir in sehr guter Erinnerung, und wer weiss: Vielleicht zieht es mich später wieder einmal zurück in die Schulstube. [red]
Zur Person Murielle von Büren (34) ist Primarlehrerin und Berufsmilitärpilotin. Sie unterrichtete zwei Jahre und absolvierte dann die Rekrutenschule bis hin zur Offiziersschule. Die Ausbildung zur Militärpilotin schloss sie 2009 ab. Seither ist sie auf dem Militärflugplatz Payerne stationiert und wurde als jüngste Militärpilotin der Schweiz bekannt. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern (2- und 4-jährig) in Murten.
Das Zitat «Erfolg ist wichtig, und gleichzeitig ist es auch fast cool, wenn jemand aus der Schule fliegt. Man hat irgendwie das Gefühl, der trotzt den andern.» Isabelle, 16, Gymischülerin, zur Frage, was in ihrer Generation als cool gilt, in «Das Magazin»
Die Zahl Im Kanton Zürich müssen sich Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ab dem 9. Schuljahr (gymnasiale Oberstufe / Kurzgymnasium) zwischen 5 Profilen entscheiden: dem altsprachlichen, dem neusprachlichen, dem mathematisch-naturwissenschaftlichen, dem wirtschaftlichrechtlichen oder dem musischen. Die ganze Profilpalette bieten 6 Schulen an, nämlich die Gymnasien in Zürich-Nord, Uster, Wetzikon, Bülach und Urdorf sowie die Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene (KME). 3 Gymnasien hingegen konzentrieren sich auf ein Profil: Hottingen (Zürich) und Büelrain (Winterthur) auf das wirtschaftlichrechtliche, das Liceo Artistico auf das musische. Alle anderen bewegen sich irgendwo dazwischen. Weitere Zahlen finden Sie in der neuen Publikation «Die Schulen im Kanton Zürich 2013/14» der Bildungsplanung. Mehr über das An gebot der einzelnen Kantonsschulen ab Seite 53. [red] ∑
www.bista.zh.ch Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 7
Fokus
8 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Fokus
Gemeinsam unterwegs So unterschiedlich wie Kinder und Jugendliche in den Schulzimmern sind auch ihre Eltern. Was bedeutet dies für die Lehrpersonen? Wie können sie Eltern ein binden, wo müssen sie sich abgrenzen? Und wie gut gelingt dies im Schulalltag? Cartoons: Ruedi Widmer
Wie sich das Verhältnis zu den Eltern verändert hat Lehrpersonen, ein Ausbildner und eine Mutter erzählen Anregungen für den Umgang mit Eltern
10 10 14
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 9
Fokus
Neue Beziehung zu Eltern Der Kontakt mit den Eltern gehört heute zum Schulalltag, verläuft aber nicht immer konfliktfrei. Hilfreich sind die offene Kommunikation und der persönliche Austausch. Text: Katrin Hafner
Vor ihnen haben viele Lehrerinnen und Lehrer Respekt: den Eltern. Die Befragung von Berufseinsteigenden an der Volksschule im Kanton Zürich zeigt: Die Zusammenarbeit mit Eltern gilt als eine der grössten Herausforderungen. Und dies ist kein kantonales Phänomen; gemäss dem Buch «Die ‹neuen› Lehrerinnen und Lehrer» zählen Lehrpersonen in der Deutschschweiz die Elternarbeit «zu den drei am stärksten belastenden Faktoren». Warum ist das so? In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verhältnis zwischen Eltern und Schule verändert. «Generell kritisiert die Öffentlichkeit staatliche Institutionen heute mehr als früher – so auch Eltern die Schule», erklärt Markus Neuenschwander, Leiter Zentrum Lernen und Sozialisation an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Der Respekt vor einer Autorität, wie sie der Lehrer bis in die 60er-Jahre verkör perte, hat abgenommen. Zudem haben viele Eltern eine ge-
steigerte Leistungserwartung. Das hängt mit dem wirtschaftlichen Druck zusammen, aber auch mit der diffusen Angst, die Nachkommen fänden in einer sich schnell ver ändernden, globalisierten Welt ihren Platz nicht. Verkürzt ausgedrückt: Heutige Eltern wollen mehr denn je, dass ihre Tochter oder ihr Sohn Erfolg hat in der Schule. Das ist – so belegen verschiedene Untersuchungen – eine gute Voraussetzung für die gelingende Schullaufbahn, denn die Erwartungen der Eltern beeinflussen das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler. Es hat aber auch zur Folge, dass sich Eltern vermehrt einmischen in die Tätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer. Mehrheit der Eltern ist zufrieden Der Umgang mit den Eltern ist überdies herausfordernd, weil es sich um eine immer heterogenere Gruppe handelt.
Karin Friess, Kindergärtnerin, QUIMS-Schule Schulstrasse, Schlieren Wie gelingt es Ihnen, bildungsferne Eltern einzubeziehen? Ich unterscheide nicht zwischen bildungs fernen oder -nahen Eltern. Ich nehme mir für alle Eltern viel Zeit und zeige ihnen so, dass sie mir wichtig sind. Das heisst, dass ich pro Kind je nach Bedarf auch mehrere Elterngespräche pro Jahr führe, denn die meisten Eltern haben auf dieser Stufe viele Fragen rund um die Erziehung und die Schule. Regelmässig lädt unsere Schule ausserdem zu Elternanlässen unterschiedlicher Art ein. Ich rufe die Eltern meiner Kindergärtner jeweils ein zeln an, um sie persönlich einzuladen und ihnen zu vermitteln, dass ich mir ihre Unterstützung wünsche. Nach Eltern bildungsveranstaltungen coachen wir die Eltern, wenn sie das Gelernte in der Familie umzusetzen versuchen, das heisst, sie können mit weiteren Fragen 10 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
jederzeit zu uns kommen und wir be raten und unterstützen sie. Und wie können Sie sich gegen über engagierte Eltern abgrenzen? Indem ich auf sie zugehe und ihnen Mög lichkeiten zur Mitwirkung anbiete. Zum Beispiel lade ich Eltern in den Unterricht ein, damit sie ihr Know-how an die Kin der weitergeben können – indem sie mit ihnen etwas nähen, hämmern oder am PC arbeiten. Allerdings zeige ich den Eltern auch auf, wo Mitwirkung möglich ist und wo nicht. Ich habe bisher nur ein mal erlebt, dass Eltern dies nicht akzep tieren wollten und ich noch deutlicher werden musste. Eine gute Zusammen arbeit mit den Eltern hängt von der eigenen Haltung ab: Wenn man möchte, dass sie mitwirken, muss man ihnen die Tür öffnen, muss bereit sein, etwas zu geben und etwas anzunehmen.
Fokus
Man kann kaum eindeutige Unterscheide ausmachen nach Herkunft, Migrations- oder Bildungshintergrund. Ein ak tuelles Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich zeigt, dass mittlerweile fast alle Eltern an Zürcher Primarschulen die Gelegenheit des jährlichen Elterngesprächs wahrnehmen – solche mit Migrationshintergrund sogar mehrmals pro Jahr. Die Mehrheit der Eltern im Kanton Zürich bezeichnet die Beziehung zur Schule und zu den Lehrpersonen als gut. Die kantonale Fachstelle für Schulbeurteilung (FSB), welche die Volksschulen im Kanton Zürich regelmässig analysiert, hält im jüngst erschienenen Jahres bericht 2012/13 fest, dass die Zahl der Schulen, die in der Elternzusammenarbeit als «gut» oder «sehr gut» beurteilt werden, deutlich gestiegen ist gegenüber der Erstevaluation vor vier Jahren. «In einem Grossteil der Schulen fühlten sich die Eltern besser über ihr Kind informiert, sich von der Schule ernster genommen und schätzen ihre Mitwirkungsmöglichkeiten positiver ein», heisst es im Bericht. Jürg Frey, Chef der FSB, begründet dies damit, dass die meisten Schulen in zwischen ihre Konzepte der Elternmitwirkungen umgesetzt und sinnvoll geregelt hätten, wie die Schulleitung mit den Eltern kommuniziere und was die Aufgabe der Klassenlehrperson sei. Prozess, der Zeit braucht Das sieht nach Widerspruch aus: auf der einen Seite zufriedene Eltern, auf der anderen Lehrpersonen mit grossem Respekt vor dem Austausch mit ihnen. Es ist wohl Ausdruck
dafür, dass die Annäherung zwischen Eltern und Schule hierzulande grundsätzlich noch jung, vieles noch nicht selbstverständlich ist. In Ländern, in denen die Schulen traditionell privat sind oder freie Schulwahl besteht, mussten die Schulen ihre potenziellen Kunden – die Eltern – seit jeher umwerben und intensiv informieren, aber auch in schulische Entscheide
3
Thema Eltern in der Aus- und Weiterbildung Die PH Zürich bereitet angehende Lehrerinnen und Lehrer der Eingangs- und Primarstufe sowie der Stufen Sek I und Sek II in verschiedenen Trainingssequenzen auf die Zusammenarbeit mit den Eltern vor. Bestandteile sind unter anderem Rollenspiele, Analyse filmisch auf genommener Situationen mit Eltern, Reflexion sowie das Planen eines Elternabends oder des ersten Eltern gesprächs. Ein Grossteil der Kompetenz wird allerdings on the job erworben. In der Berufseinführungsphase unterstützen Fachpersonen vor Ort die neuen Lehrper sonen. In der Ausbildung der Mittelschul- und Berufs fachschullehrpersonen spielt Elternarbeit eine kleinere Rolle; Berufsfachschullehrer wenden sich – in Konflikt fällen – in der Regel an den Betrieb. Für Interessierte bietet die PH Weiterbildungsangebote zum Thema Eltern. ∑
www.phzh.ch/weiterbildung, Suchbegriff «Eltern»
Thomas Bleiker, Mittelstufenlehrer, Primarschule Herrliberg Und wenn Eltern versuchen, Druck auszuüben? Wir Lehrpersonen müssen eine klare gemeinsame Linie haben, wie wir die Einstufungen vornehmen, und diese gegenüber den Eltern konsequent ver treten, auch wenn dies nicht immer leicht ist. Es sind vielleicht zehn Prozent der Eltern, die trotz all unserer Bemü hungen um Transparenz mit der Einstu fung nicht einverstanden sind, sodass ein weiteres Gespräch nötig wird. In diesen Fällen ist es besonders wichtig, als Team geschlossen aufzutreten und auch die Schulleitung hinter sich zu haben. Bis jetzt ist es uns noch immer gelungen, am Ende das Verständnis der Eltern zu erreichen. Fotos: zvg
Wie gehen Sie mit den hohen Er wartungen um, die Eltern im Hinblick auf den Stufenübertritt haben? Etwas vom Wichtigsten ist Transparenz. Ich führe schon in der 4. Klasse viele Gespräche mit den Eltern, denn sie wol len genau informiert sein darüber, was wir tun und wo ihr Kind steht. Die Zeug nisnoten müssen wir begründen können, was uns zwingt, während des Semesters zahlreiche Prüfungen durchzuführen. Diese gebe ich den Kindern immer mit nach Hause, damit sie sie von den Eltern visieren lassen. In der 5. Klasse zeige ich Eltern und Kind die Bandbreite der Mög lichkeiten für die Zukunft auf und woran das Kind noch arbeiten muss. So ist in der 6. Klasse dann klar: Wenn es sich verbessert hat, wird die Einstufung in der oberen Hälfte dieser Bandbreite er folgen, andernfalls in der unteren.
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 11
Fokus
miteinbeziehen. Im Kanton Zürich sieht das vor wenigen Jahren umgesetzte Volksschulgesetz für Väter und Mütter individuelle Mitwirkungsrechte vor bei Schullaufbahnentscheiden sowie bei sonderpädagogischen und disziplina rischen Massnahmen, nicht aber bei methodisch-didaktischen oder personellen Fragen. Die grössere Informiertheit und Mitsprache der Eltern kann den Wunsch nähren, sich in den Schulalltag einzumischen – auch in nicht dafür vorgesehenen Bereichen wie Notengebung oder Schülerbeurteilung und ebenso später in den Mittelschulen. Gleichzeitig
vereinfachen es neue Kommunikationsmittel wie E-Mail und SMS, Fragen und Kritik jederzeit direkt an die Lehr person zu richten. Fordernde, sich sehr stark engagierende Eltern, die über Didaktisches mitbestimmen wollen und, wenn sie mit der Notengebung oder Leistungsbeurteilung nicht zufrieden sind, mit dem Anwalt drohen, gehören mittlerweile zum Schulalltag. Speziell bei Übertrittsfragen steige der Druck vonseiten der Eltern auf die Lehrerinnen und Lehrer zum Teil enorm, sagt Peter Gerber, Präsident des Zürcher Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter. FSB-Chef Jürg Frey ergänzt: «Generell sind die Eltern mit der Beurteilung der Schülerleistungen zufrieden, aber beim Stufenübertritt sind viele Schulen mit Elternkritik konfrontiert.»
Die Kantonale Eltern Organisation (KEO) Vor einem Jahr hat sich die Kantonale Eltern Organisa tion (KEO) konstituiert. Hauptziel ist gemäss der Prä sidentin Gabriela Kohler-Steinhauser, dass die Lehr personen, Schulleitenden und -behörden «die Eltern ernst nehmen und diese einen anderen Blick auf die Schule und ihre Komplexität» gewinnen. Die KEO sieht sich als Stimme der Eltern auf Kantonsebene und will die qualitative Mitwirkung fördern. Zusammen mit der PH Zürich bietet sie Weiterbildungskurse für Eltern vertretungen an. Bald erscheint für Mitgliederschul gemeinden das Handbuch für Elternräte mit Hinweisen, worauf Elternräte achten müssen. ∑
www.keo-zh.ch
Aktiver Einbezug hilft Was bedeutet das für die Schule? Wie kann eine Lehrerin oder ein Lehrer vorgehen? Susanna Larcher von der PH Zürich rät, das Schulteam wie auch die einzelne Lehrperson sollten sich überlegen, wie sich die Gruppe der Eltern ak tuell zusammensetze und welche Bedürfnisse und Erwartungen sie hätten. Denn diese unterscheiden sich nicht nur von Schule zu Schule, sondern verändern sich zuweilen an der gleichen Schule innert kurzer Zeit – beispielsweise als Folge von städtebaulichen Prozessen: Im Zürcher Kreis 3 etwa sind die Wohnungspreise seit der Stilllegung der Weststrasse gestiegen und einst ansässige Familien in günstigere Agglomerationsregionen gedrängt worden. Seither hat sich die Zusammensetzung der Eltern stark verändert.
Ursula Furter, Mutter einer ehemaligen Sekschülerin, Egg Im Berufswahlprozess sollten Lehr personen und Eltern möglichst eng zusammenarbeiten. Fühlten Sie sich als Mutter genügend eingebunden? Grundsätzlich ja. Die Schule hat schon in der 1. Sek mit den Schülerinnen und Schülern angefangen mit dem Thema «Was sind meine Stärken, was meine Schwächen», es gab auch eine Eltern orientierung gemeinsam mit der Berufs beratung. Die Lehrerin hat zwar nicht systematisch mit allen Eltern das Ge spräch gesucht, aber wir wussten: Wenn wir Fragen hätten, wäre sie jeder zeit bereit dazu. Was hätte besser laufen können? Aufgrund unserer Erfahrung mit den beiden älteren Söhnen hatten wir das Gefühl, das Vorgehen der Schule sei zu langsam und wir müssten die Fäden selber in die Hand nehmen. So haben 12 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
wir unsere Tochter beispielsweise dazu angehalten, in den Herbstferien der 1. Sek ein erstes Mal schnuppern zu gehen. Das war für sie schwierig, weil Schnuppern in der Schule noch gar nicht Thema war. Auch habe ich teil weise grundlegende Informationen durch die Schule vermisst, zum Beispiel einen Zeitplan, wann wo welche Multichecks stattfinden. Der Berufswahlprozess ist eine sehr heikle Phase für Kinder und Eltern, und je mehr Informationen ver fügbar sind, desto mehr gewinnt man an Sicherheit. Gut wäre es auch, wenn zwischen Lehrperson und Eltern klar ab gesprochen würde, wer welche Aufga ben übernimmt. So erhalten die Jugend lichen die bestmögliche Unterstützung.
Fokus
«Wir empfehlen, regelmässig zu überprüfen, wie man in verschiedenen Settings möglichst alle Eltern erreichen und mit in den Schulalltag einbeziehen kann, aber auch, wie sich Lehrpersonen abgrenzen können», sagt Susanna Larcher. Die Schulen sind verpflichtet, die Form der Zusammenarbeit mit den Eltern im Organisationsstatut zu regeln – etwa, in welchen Fragen die Lehrperson die Verantwortung trägt und wann sie die Eltern an die Schulleitung weiterleiten darf. Wie die Lehrperson etwas den Eltern mitteilt, wann ein persönliches Gespräch oder der schriftliche Kontakt vorzuziehen ist, regeln viele Schulen in ihrem Kommunikationskonzept. Immer mehr Volks- und Mittelschulen suchen zudem die Nähe und das Vertrauen der Eltern mit spezifischen Projekten. Die Sekundarschule Büelwiesen in Winterthur etwa lädt Eltern ein, jede Woche einmal während einer Lektion Präsenz zu markieren, wenn ihr Kind Motivationsprobleme hat oder den Unterricht stört. Auf Sek-Stufe helfen Eltern in der Berufsfindungsphase, beispielsweise als Bewerbungscoach. Einige Schulen – da runter auch Gymnasien – nutzen das Know-how der Erwachsenen, indem sie diese im Unterricht von ihrem Fachwissen erzählen lassen oder deren Beziehungen nutzen für Besuche von Firmen. Schule kann Einstellung der Eltern beeinflussen Erziehungswissenschafter Markus Neuenschwander beschreibt in seinem Buch «Schule und Familie – was sie zum Schulerfolg beitragen», dass zwei Hauptfaktoren die Einschätzung der Eltern zur Schule prägen: Ausschlaggebend
ist, wie gut informiert sie sich fühlen und wie sie die Gesprächs- und Beziehungsqualität zur Lehrperson erleben. Das Vertrauen, das durch den persönlichen Kontakt entsteht, beeinflusst das Verhältnis tendenziell positiv – und dies ist gemäss Markus Neuenschwander zentral. Er bezeichnet es als wichtigstes Ziel der Zusammenarbeit mit Vätern und Müttern, bei ihnen eine positive Haltung der Schule gegenüber zu erzeugen. Denn: «Erwiesenermassen beeinflusst die Einstellung der Eltern diejenige der Schü lerinnen und Schüler. Eine gute Einstellung hat zwar keinen direkten Einfluss auf die erbrachten Leistungen, fördert aber das Lernklima.» !
Eltern mit wenig Deutschkenntnissen • Das Volksschulamt hat die Empfehlungen für den Einsatz von interkulturell Dolmetschenden zwischen Lehrpersonen und Eltern überarbeitet: www.vsa.zh.ch/ fremdsprachige/eltern • Es bietet Elterninformationen und Merkblätter zu den wichtigsten Themen der Volksschule in 12 Sprachen an: www.vsa.zh.ch/international • Das Programm «Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)» fokussiert die Elternzusammenarbeit im Kindergarten. Die Website bietet Hintergrundwissen, Hinweise auf Handbücher und Praxisbeispiele: www.vsa.zh.ch/quimsab2014
Matthias Sutter, Direktor Hotel Glockenhof, Zürich Die Eltern unterschreiben den Lehr vertrag. Was bedeutet dies für Sie? Wenn es zum Vertragsabschluss kommt, laden wir die Eltern zusammen mit dem Jugendlichen zu einem Gespräch ein, in dem alle wichtigen Fragen geklärt wer den, etwa die unregelmässigen Arbeits zeiten, wie man sich zu verhalten und zu kleiden hat und so weiter. Es ist mir ganz wichtig, dass beide Eltern mit am Tisch sitzen, auch bei getrennt lebenden. Bisher haben wir das mit Überzeugungs arbeit immer hinbekommen. Sie müssen bei uns auch beide den Vertrag unter schreiben. Danach haben wir mit den Eltern nur noch Kontakt, wenn es ernst hafte Schwierigkeiten gibt. Wie erleben Sie die Eltern in schwieri gen Situationen? Meistens findet man zusammen einen Weg. Manche Jugendliche brauchen
inen gewissen Druck, damit sie dran e bleiben und ihre Pflichten wahrnehmen, und der muss auch von den Eltern kommen, ihre Unterstützung ist für uns und die Lernenden wichtig. Genauso suchen viele Eltern die Unterstützung des Lehrmeisters, wenn etwas nicht gut läuft, selbst wenn die Probleme die Schule betreffen. Suchen Eltern heute rascher den Kontakt zu Ihnen? Diesen Eindruck habe ich nicht. In dem Alter sollten Jugendliche langsam Eigen verantwortung übernehmen, das sehen auch viele Eltern so. Wir versuchen schwierige Situationen erst mit den Ler nenden zu regeln, bevor wir das Ge spräch mit den Eltern suchen. Die Eltern bleiben aber bis zum Abschluss der Lehre mitverantwortlich, auch nachdem der Jugendliche volljährig geworden ist. Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 13
Fokus
Anregungen für den Umgang mit Eltern • Know-how der Eltern nutzen: Das Fachwissen der Eltern nutzen, indem man zum Beispiel Eltern einlädt, die ihren Beruf vorstellen oder im Rahmen der Berufswahlvorbereitung mit Jugendlichen Bewerbungsgespräche üben. Oder ein Projekt «Gesundheitsförderung» lancieren unter Mit hilfe qualifizierter Eltern (eine Mutter, die Ärztin ist, erklärt der Klasse den menschlichen Körper etc.). • Eltern Einblick geben in den Schulalltag: Einmal im Jahr etwas für Schülerinnen, Schüler und Eltern organisieren – zum Beispiel einen Spielmorgen oder einen Nachmittag, an dem Schülerinnen und Schüler den Eltern zeigen, wie und was sie am Computer lernen. • Ortswechsel für Elterngespräch: Eltern mal ausserhalb des Schulzimmers zum Gespräch treffen – in einem nahe gelegenen Café oder zu Hause bei der Familie. • Kommunikationsform anpassen: Nach der Schule schnell persönlich vorbeigehen, wenn der E-Mail-Kontakt oder das Telefongespräch schwierig ist (zum Beispiel aus sprachlichen Gründen). • Kommunikationswege mitbestimmen lassen: Am ersten Elterngespräch verschiedene Optionen für den individuellen Kontakt vorschlagen und die Eltern entscheiden lassen, was ihnen am liebsten ist. • Eltern vernetzen: Den Austausch der Eltern untereinander aufbauen, auch im Sinne gegenseitiger Unterstützung: Mut ter A nimmt Mutter B an den Elternabend mit. Ausserdem: Gut integrierte Eltern mit Migrationshintergrund anregen,
ndere Eltern aus ihrem Kulturkreis über unser Schulsysa tem zu informieren und zur Mitarbeit zu motivieren. • Freiwillige Elternsprechstunde einrichten: Einmal im M onat steht am späten Nachmittag die Schulzimmertüre während einer Stunde offen für Fragen und Anliegen der Eltern. • Feedback-Kultur: Rückmeldungen von Eltern auch individuell bei Gelegenheit – zum Beispiel an einem Schulanlass – einholen: Wie läuft es mit den zwei Fremdsprachen? Haben Sie das Gefühl, viel helfen zu müssen bei den Hausaufgaben? Fühlen Sie sich gut informiert? • Prägnante Elterngespräche: Dauer des Elterngesprächs dem effektiven Bedarf anpassen. Damit sich beide Seiten aufs Wesentliche konzentrieren, zum Beispiel höchstens 30 Minuten einplanen. • Elternrat aktiv einbinden: Umfrage bei Eltern, welche schu lischen Themen sie interessieren, und gemeinsam mit der Elternmitwirkung (z. B. Elternrat) passende Elternbildung organisieren. Beispiel einer aktiven Einbindung des Elternrats: www.projekt-sls.ch > Schulen im Projekt > ausgezeichnete Primarschulen > Primarschule Birmensdorf [kat] Training der PH Zürich: «Elterngespräche führen – Kompetent auch in schwierigen Situationen mit Eltern», 19.11.2014, 21.1.2015, 4.3.2015, 25.3.2015 je 13.30 –17.00 Uhr. www.phzh.ch
∑
Die Anregungen basieren auf Ideen von Lehrpersonen und von Susanna Larcher, Leiterin des Forschungsprojekts Beratung im Rahmen von Elterngesprächen (elbe) an der PH Zürich.
Daniel Reichmuth, Rektor MNG Rämibühl, Zürich Hat die Zahl der Rekurse durch Eltern zugenommen? Sie hat sicher zugenommen, wie auch generell Situationen, in denen Eltern von den Lehrpersonen Erklärungen für Ent scheide verlangen, beispielsweise im Falle von Disziplinarmassnahmen. Das verunsichert einige Lehrpersonen. Ich möchte diese Entwicklung aber nicht dramatisieren. Viele Eltern zeigen durch aus Verständnis, wenn es zu einem Ge spräch kommt. Wenn sie trotzdem das Rechtsmittel des Rekurses ergreifen, müssen wir als Schule Stellung nehmen. Die meisten Rekurse werden abgelehnt. Gelegentlich bringt ein Rekurs auch Fak ten zutage, die der Schule noch nicht bekannt waren. Dann kann sie von sich aus auf ihren Entscheid zurückkommen. Sind Eltern heute in den Mittelschulen generell präsenter als früher? 14 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
In den vier Jahren, in denen die Schüler bei uns sind, sollen sie den Schritt zur Volljährigkeit vollziehen können. Wir ver suchen deshalb bewusst, Distanz zu den Eltern zu halten, haben aber selbstver ständlich immer ein offenes Ohr und kontaktieren sie, wenn sich Probleme abzeichnen. In den oberen Klassen wer den die jährlichen Besuchstage sehr schlecht besucht, die Eltern ziehen sich also selber zurück oder werden von den Jugendlichen dazu gedrängt. Allerdings bleiben sie über die Volljährigkeit der Schüler hinaus unterstützungspflichtig während der Ausbildung. Wenn die jun gen Leute 18 sind, regeln wir Problem situationen zwar direkt mit ihnen, von wichtigen Entscheiden – Promotions entscheide oder disziplinarische Mass nahmen – geht aber immer eine Kopie an die Eltern.
Fokus
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 15
Volksschule
«Es ist ruhiger geworden» Schulleiterin Verena Kocher und ihr Team aus Schlieren nehmen seit einem Jahr am Schulversuch Fokus Starke Lernbeziehungen (FSL) teil. Für sie überwiegen die Vorteile – trotz anfänglicher Unsicherheit. Text: Katrin Hafner Foto: Dieter Seeger
Ruhiger sei es geworden im Schul haus und in den Klassenzimmern. So beschreiben drei Lehrerinnen und die Schulleiterin die Situation an der Schule Hofacker in Schlieren im Ver gleich zu vor einem Jahr. Damals star teten sie zusammen mit vier anderen Schulgemeinden im Kanton Zürich mit dem Schulversuch Fokus Starke Lern beziehungen (FSL). Vor wenigen Wo chen kamen weitere Schulen dazu – und in einem Jahr wird die dritte und letzte Staffel folgen. Mit dem Schulversuch wird die Zahl der Lehrpersonen pro Klasse grundsätzlich auf zwei begrenzt. Damit sollen die Absprachen und Koordina tionssitzungen weniger, die Lernbezie hungen im Unterricht stärker werden und die Eltern weniger Ansprech personen haben. Neu ist die Rolle der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und der Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Sie beraten das Lehrerteam. Teamfindung nicht immer einfach Seit Start des Versuchs haben andere Kantone ihr Interesse an FSL be kundet. Wie aber geht es den betroffe nen Zürcher Schulen? Verena Kocher, Schulleiterin im Hofacker, sagte vor einem Jahr (vgl. Schulblatt 3/13): «Die ser Versuch ist etwas vom Besten, was mir passieren konnte.» Was sagt sie heute? «Es ist sogar etwas vom Aller besten, was mir passieren konnte!» Sie lehnt sich zurück auf ihrem Stuhl im Schulleitungsbüro und lacht. «Aber nicht nur mir, sondern auch den Schü lerinnen, Schülern, den Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Ich glaube, das ist die Zukunft unserer Schulen.» 16 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Beteiligen sich motiviert am Schulversuch: Lehrerin Nadine Behrend, Heilpädagogin Eva Durisch-Simioni, Lehrerin Ruzica Grgic und Schulleiterin Verena Kocher (Foto Sommer 2013).
So viel Euphorie macht skeptisch. Frau Kocher, vor dem Start des Schul versuches sprachen Sie von einem ho hen Mehraufwand. Ist der vergessen? «Nein», lautet die Antwort, «im Ge genteil.» Es sei ein anstrengendes Jahr gewesen. Vor allem die Bildung der
Zweierteams, die eine Klasse betreuen, sei nicht zu unterschätzen. «In fast allen Fällen klappte es – und zeigten sich sofort Vorteile: Die Lehrpersonen müssen sich weniger absprechen, sind dadurch weniger belastet, bereichern und unterstützen einander.» In 3 von
Volksschule
19 Teams jedoch funktionierte die Zusammenarbeit zwischen den Lehr personen nicht gut, was Probleme im zwischenmenschlichen Bereich mit sich brachte und Interventionen der Schul leiterin erforderte. Ein Team zerfiel, eine Lehrperson verliess die Schule. Die Betroffenen arbeiten inzwischen in anderer Zusammensetzung. «Man muss bereit sein, sich aufeinander und auf Veränderungen einzulassen, muss Vertrauen haben und offen miteinan der kommunizieren. Das ist auch an strengend», fasst Schulleiterin Verena Kocher zusammen. Lehrerinnen sind «sehr zufrieden» Und man müsse mit anfänglichen Un sicherheiten umgehen können, sagen die beiden Lehrerinnen Nadine Beh rend und Ruzica Grgic. «Am Anfang hatte ich Angst, etwas falsch zu ma chen, weil es keine fixen Zeiten mehr gibt, in denen die DaZ-Lehrperson oder die Heilpädagogin mit gewissen Kindern arbeitet», erzählt Nadine Beh rend. Sie setzte sich zu Beginn des Schulversuchs unter Druck, ihre Schü lerinnen und Schüler «individueller und noch intensiver zu fördern – und das klappt halt nicht immer sofort». Ihre Kollegin Ruzica Grgic irritierte am An fang, dass einige Schulkinder bei Pro blemen zu ihr kamen und in anderen Fächern lieber zu ihrem Teamkollegen gingen – «man fragt sich dann, warum das so ist». Verena Kocher, die Schulleiterin, sieht solche Entwicklungen als C hance. «Der Schulversuch bringt die Lehre rinnen und Lehrer dazu, sich zu beob achten und miteinander zu reden, um Instrumente für eine noch professio nellere Zusammenarbeit zu schaffen.» Sowohl Nadine Behrend wie R uzica Grgic bestätigen dies. Sie beschreiben sich heute als «sehr zufrieden» mit ihrem Arbeitsalltag. Nadine Behrend: «Weil vier Augen mehr sehen als zwei und zwei Personen mehr Ideen haben, als es eine hat, können wir die Schüle rinnen und Schüler besser fördern – nicht nur die Schwachen.» Für Eva Durisch-Simioni, die schu lische Heilpädagogin, hat sich mit dem Schulversuch besonders viel verändert. Sie arbeitet nur noch zu einem kleinen Teil mit einzelnen Kindern. Per Mail melden sich Lehrpersonen bei ihr,
wenn sie für ein Kind Förderbedarf sehen. Danach beobachtet sie den Jun gen oder das Mädchen während einer Lektion. Meistens trifft sie das Kind noch zu einem Gespräch, bevor sie mit der Lehrperson einen Förderplan er arbeitet. «Ich berate, setze meine Vor schläge aber selbst nicht mehr um, sondern überlasse dies der Lehrerin oder dem Lehrer.» Mehr Abwechslung für Heilpädagogin Bevor der Versuch begann, befürchtete Eva Durisch-Simioni, damit gehe fach liches Know-how verloren. Das sieht sie heute nicht mehr so. «Es funktio niert gut, da die Lehrerteams gewillt sind, sich auf meine Vorschläge einzu lassen.» Schulleiterin Verena Kocher geht einen Schritt weiter: «Das Fach wissen ist ja nicht weg, es wird einfach von der schulischen Heilpädagogin oder dem DaZ-Lehrer ins Team trans feriert und multipliziert sich damit. Davon profitieren alle.» Ihr Berufsfeld habe sich stark ver ändert, ihrer Meinung nach jedoch zum Positiven, stellt Eva Durisch-Simioni fest: «Ich vermisse nichts. Im Gegen teil: Es ist abwechslungsreicher gewor den. Ich tausche mich intensiver aus mit den Lehrpersonen und neu auch mit der Schulsozialarbeiterin oder der Logopädin.» Die Schulleiterin Verena Kocher erwähnt einen weiteren «positiven Nebeneffekt» des Versuchs: «Weil die Klassenlehrpersonen nun aktiv Bera
tung holen müssen, schärft sich ihr Blick. Wir haben denn auch mehr spe zifische Förderung als vor dem Ver such – es wird weniger übersehen.» So sei auch zu erklären, warum seit dem Versuch nicht weniger, sondern mehr disziplinarische Massnahmen ausge sprochen worden seien: «Wenn bis zu sieben Lehrpersonen für eine Klasse zuständig sind, geht der einzelnen Lehrperson manches durch die Lap pen, weil sie nicht alleine verantwort lich ist. Zwei Personen hingegen neh men mehr wahr und reagieren in der Regel schneller.» Weiterhin in Bewegung bleiben Noch fünf Jahre wird der Versuch dau ern – für diese Zeit wünscht sich die Schulleiterin, dass ihre Schule in Be wegung bleibt. «Der Versuch und die Umstrukturierungen brachten so viel Drive in das Team, den möchte ich nutzen.» Bereits hat sie zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ein neues Schulprogramm erarbeitet. Nun möchte sie vermehrt über methodischdidaktische Möglichkeiten diskutieren und sich zum Beispiel eine Schule mit Lernlandschaften anschauen gehen. «Einfach, damit wir offen und im Geiste flexibel bleiben», wie sie erklärt. Auch bezüglich des Schulversuchs sieht sie noch nicht alles in Stein ge meisselt: «Es ist immer noch ein Ver such. Wir dürfen weiterhin ausprobie ren, was sich bewährt und was nicht. Und das ist sehr reizvoll.» !
Der Versuch Der Schulversuch Fokus Starke Lernbeziehungen (FSL) wird derzeit in 110 Klassen im Kanton Zürich durchgeführt. Es sind städtische und ländliche Schulen vertreten, grosse und kleine, solche mit hohem und mit tiefem Sozialindex, solche mit grossem oder kleinem Anteil fremdsprachiger Kinder. Gemäss ersten Rückmeldungen von Schulleitungen vereinfacht sich unter anderem das Erstellen der Stundenpläne und die Lehrpersonen sind von Koordinationsaufgaben entlastet. Der Wechsel der schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen sowie der Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache in die Beratungsfunktion stellt zu Beginn eine Herausforderung dar. Die Projektleitung im Volksschulamt begleitet die Betroffenen mit Angeboten wie etwa einer Supervision. Die Bildungsdirektion lässt den Schulversuch vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich evaluieren. Schulgemeinden, die sich für den Versuch interessieren, können sich bis zum 17. November für die Teilnahme an der dritten und letzten Staffel bewerben. Der Versuch dauert bis Ende Schuljahr 2018/19. ∑
www.vsa.zh.ch > Schulbetrieb & Unterricht > Projekte Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 17
Bildung Beratung Supervision Coaching 101-Einführungsseminare Juni‐Seminar 2014 Mittwoch 11.6.14, Mittwoch 18.6.14 Mittwoch 25.6.14 jeweils von 13.30 bis 20.30 Uhr Oktober‐Seminar 2014 Donnerstag 16.10.14 , Freitag 17.10.14 Samstag 18.10.14 Fr 17.00–21.00 Uhr, Sa 9.00–18.00 Uhr So 9.00–16.00 Uhr Methodenkompetenz nächster Start Januar 2015 weitere Angebote siehe Homepage
18 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Volksschule
Welche Lehrmittel sind in der Pipeline? Der Lehrmittelverlag Zürich überarbeitet verschiedene Lehrmittel und entwickelt einige neu – auch im Hinblick auf den Lehrplan 21. Eine Übersicht. Text und Tabelle: Lehrmittelverlag Zürich
Der Lehrmittelverlag Zürich (LMV) will den Zürcher Volksschulen didak tisch und pädagogisch innovative so wie lehrplankonforme und preiswerte Lehrmittel zur Verfügung stellen – auch hinsichtlich der Einführung des Lehrplans 21. Dieser wird nach einer breiten Konsultation gegenwärtig über arbeitet und voraussichtlich Ende 2014 zuhanden der Kantone verabschiedet. Über die Art und Weise der Einführung entscheidet jeder Kanton in eigener Kompetenz. Im Kanton Zürich erfolgt sie frühestens ab Schuljahr 2017/18.
Kindergarten
Seit Beginn des neuen Schuljahrs 2014/15 sind nur noch für sechs Fach bereiche Lehrmittelobligatorien vorge sehen, nämlich für Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Religion und Kultur sowie für Natur und Technik. Die unten stehende Tabelle gibt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Übersicht über die wichtigsten laufenden Lehrmittelprojekte (Stand Sommer 2014). Wo bereits bekannt, wird das voraussichtliche Erschei nungsjahr genannt. Die Tabelle zeigt auch die neue Aufteilung der elf Schul
1. Klasse
2. Klasse
3. Klasse
4. Klasse
Zyklus 1
Hoppla First Choice Neubeurteilung 2016
Englisch
6. Klasse
7. Klasse
Sprachwelt
Pipapo
Kontakt1 ab 2017
Explorers Neubeurteilung 2016
Voices + Voices basic Neubeurteilung 2016 dis donc!2 2018
dis donc!2 2019
dis donc!2 2020
dis donc!2 2021
Mathematik 52 2015
Mathematik 62 2016
Mathematik 1
Mathematik 2
Mathematik 3
Mathematik 1
NMG Natur und Technik
Natur und Technik1 ab 2018
Karussell2 2016
Riesenrad2 2016
Phänomenal2 2016
Natur und Technik1 ab 2018
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaft und Arbeit
Wirtschaft und Arbeit
Spuren – Horizonte
Geografie ab 2018
NMG Ethik, Religionen, Gemeinschaft
Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG)
Kinder begegnen Mathematik
NMG Räume Zeiten Gesellschaften
Lernstandserhebung Lernplattformen
Mathematik 4
dis donc!2 2017
Mathematik
NMG Wirtschaft, Arbeit, Haushalt
Mathematik 3
Geografie, Geschichte
9. Klasse
Oberstufe
Sprachland Begutachtung 2014
Französisch Mathematik 2
8. Klasse Zyklus 3
Mittelstufe
Sprachfenster1 ab 2018
DaZ Deutsch als Zweitsprache
Lehrmittelverlag Zürich, 044 465 85 85, lehrmittelverlag@lmv.zh.ch
∑
Zyklus 2 Unterstufe
Deutsch
5. Klasse
jahre in drei Zyklen auf, wie sie der Lehrplan 21 vorsieht. Für einige Lehrmittel arbeitet der LMV mit anderen Verlagen zusammen. Der Schulverlag plus ist Kooperations partner bei «Sprachland», «Sprachwelt Deutsch», «Hoppla», «Pipapo», «Karus sell», «Riesenrad», «Phänomenal» und «Spuren – Horizonte»; der Lehrmittel verlag St. Gallen bei «dis donc!», «Lern lupe» und «Lernpass». !
Geschichte / Politische Bildung ab 2017 Blickpunkt 1 Religion und Kultur
Blickpunkt 2 Religion und Kultur
Blickpunkt 3 Religion und Kultur
Ethik 1
Ethik 2
Ethik 3
DaZ Deutsch als Zweitsprache Sprachgewandt Lernpass2 ab 2017
Lernlupe2 ab 2017
Bestehende Lehrmittel gänzlich oder weitestgehend kompatibel mit dem Lehrplan 21 Bestehende Lehrmittel in Überarbeitung Neue Lehrmittel in Arbeit Vorabklärungen im Gang, Anpassungen wahrscheinlich Massnahmen werden geprüft, Entscheidung offen
1 Konzeptauftrag
des Bildungsrates des Kantons ürich an den Lehrmittelverlag Zürich ist erfolgt. Z 2 Produktionsauftrag des Bildungsrates des Kantons Zürich an den Lehrmittelverlag Zürich ist erfolgt. Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 19
Volksschule
Stafette Die im letzten Schulblatt vorgestellte Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach Herrliberg an der Goldküste gibt den Stab weiter an die Rudolf Steiner Schule Zürich. Text: Katrin Hafner Fotos/Collage: Marion Nitsch
Volksschule
Steckbrief: drei Kindergärten, je eine 1. bis 9. Klasse, ins gesamt 300 Schulkinder und 45 Lehrpersonen. Lage: in Zürich-Hottingen. Herkunft der Schulkinder: unterdurch schnittlicher Anteil von Eltern mit Migrationshintergrund und Familien aus bildungsfernem Umfeld. Grosses regio nales Einzugsgebiet. Spezialität: Die Schule basiert auf der Pädagogik von Rudolf Steiner. Sie wird staatlich nicht un terstützt, sondern finanziert sich über Elternbeiträge (je nach Einkommen) sowie über Fundraising und Sammel aktionen. Pädagogische Haltung: Gemäss Joy Gerber, Leh rerin und Mitglied der Schulleitung, stehen die individuel len Entwicklungsschritte jedes Kindes im Vordergrund – die kognitiven sowie auch die emotional-psychologischen und kreativen. Bis zur 9. Klasse gibt es keine Noten. Kein Schü ler und keine Schülerin muss ein Schuljahr wiederholen. Die Idee des «Vergessens»: Während drei bis vier Wochen, einer sogenannten Epoche, beschäftigt sich eine Klasse täg lich mit einem bestimmten Hauptfach – zum Beispiel Spra che, Mathematik, Formenzeichnen oder Geschichte. Danach wird das entsprechende Fach während bis zu drei Monaten ruhengelassen. Die intensive Auseinandersetzung erlaubt es laut Joy Gerber, mit allen Kindern tief in die Materie ein zutauchen. Die darauf folgende Phase des Ruhenlassens sei sehr wichtig. Insbesondere Kinder, die Schwierigkeiten
«Meine Frau und ich besuchten schon diese Schule. Wir schätzen es sehr, dass unsere Kinder hier in praktischen und musischen Fächern unterrichtet werden – zum Beispiel lernen sie Gartenbau und Handwerkliches. Und sie üben Qualitäten im Zwischen menschlichen. Das scheint mir auch fürs Berufsleben zentral: Es ist immer wichtig, sich im Team einbringen und sich auf Neues einlassen zu können. Ich bin froh, kommen unsere Kinder nicht schon mit 12 unter Stress, sich für Gymi oder Sek entscheiden zu müssen; die Atelierschule, die nach der 9. Klasse folgt, bietet ihnen guten Anschluss an Uni, Fachhochschule oder Berufslehre. Kinder haben eine natürliche Fähigkeit zu lernen; wenn diese nicht verschüttet wird, ist es bloss eine Frage des Willens, dass sie ihren Weg finden. Da bringt früher Druck nichts.»
hatten mit dem Stoff, verstünden ihn nach einer langen Pause oft besser. «Sie verarbeiten viel, auch wenn sie sich nicht aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Nach der Phase des Vergessens erleben sie dann ein Aha-Erlebnis und lernen oft motivierter weiter.» Rolle der Eltern: Be vor ein Kind in die Steiner Schule eintritt, findet ein Ge spräch mit den Eltern statt. Pro Quartal gibt es mindestens einen Elternabend. Die Väter und Mütter begleiten die Klassen (freiwillig) auf Waldausflügen oder helfen mit bei Festen und dem Geldsammeln. Durch das hohe Engage ment seien die Erwartungen zum Teil hoch, sagt Joy Gerber. Umso wichtiger seien die direkte und regelmässige Kom munikation – aber auch Geduld und Nachsicht vonseiten der Lehrerinnen und Lehrer. !
Stafette Das Schulblatt besucht Schulen, die im Unterricht und Schulalltag interessante Wege entwickeln. Die vorgestellte Schule bestimmt, welche Primaroder Sekundarschule in der kommenden SchulblattAusgabe vorgestellt wird. Die in dieser Ausgabe vorgestellte Schule wünscht sich als Nächstes: eine heilpädagogische Schule.
Valentin: «Pro Woche haben wir zwei Stunden Eurythmie. Das ist aber mehr als farbige Tüechli schwingen: man erfährt viel über Bewegung. Zu uns kommen immer wieder Neue, die sich in der alten Schule nicht wohlfühlten. Mich stresst die Schule überhaupt nicht. Nur schade, dass wir wenig Geld haben – der Fussballplatz ist nur fünf Meter breit. Dafür lernen wir viel Handwerkliches. Ich möchte später mit Kindern arbeiten oder eine hand werkliche Lehre machen.» Larissa: «Wir haben es nicht streng, das kommt wohl in der 9. Klasse mit den Noten. Ich möchte später etwas mit Kunst oder Medizin machen. Ent scheiden muss ich noch nicht, zuerst mache ich das 10. Schuljahr in der Atelierschule. Meine Gymikolleginnen haben es richtig hart, sie müssen jeden Tag viel lernen. Mich dünkt das übertrieben in diesem Alter.»
«Es freut mich, dass wir Eltern und Kindern einen alternativen Weg anbieten können. Weil sich gerade bei Stufenübertritten viele Neue anmelden, müssen wir uns jedoch vermehrt fragen, ob eine bestehende Klasse zusätzliche Kinder verträgt. Wir sind keine Sonderschule und wollen kein Auffangbecken sein für Probleme. Doch Leistung soll bei uns nicht ein Instrument sein, das Stress erzeugt. Am wichtigsten ist uns, dass die Kinder ein gutes Lebensgefühl und Eigenverantwortung entwickeln. Lernen und Leisten geschieht dann praktisch von alleine. Wir möchten vermeiden, dass jemand für eine Note lernt. Am besten lernt man, wenn man etwas erlebt oder macht. Denn wer mit Leib und Seele bei einer Sache ist und nicht nur im Kopf, erinnert sich später besser daran. Und das ist wich tiger als jede Note.»
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 21
22 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Volksschule
Delegiertenversammlung vom 18. Juni 2014 Am 18. Juni 2014 fand die zweite Delegiertenversammlung der Lehr personenkonferenz statt. Neben vie len administrativen und informellen Traktanden standen Referate zum Lehrplan 21 und zur neuen Lehrmit telpolitik, die Vernehmlassung zum Gesetzesentwurf des Lehrmittelver lags und die Begutachtung des Mittel stufenlehrmittels «Sprachland» an. Bei Letzterer wurde die Basis erstmals mittels elektronischer Befragung einbezogen. Die Rückmeldungen zu diesem Teil des neuen Begutachtungs konzepts waren durchwegs positiv. Ein Moratorium zum Lehrplan 21 wurde in der Versammlung per Antrag diskutiert, dann aber in der Abstim mung wuchtig abgelehnt. Das voll ständige Protokoll der Delegiertenver sammlung ist auf der Homepage zu finden. [Anna Richle, Aktuarin LKV] ∑
www.lkvzh.ch
Bildungsmesse
Lehrmittelverlag Zürich an der «Didacta Schweiz Basel» Die grösste Bildungsmesse der Schweiz findet statt vom 29. bis 31. Oktober 2014 in der neuen Messehalle der Archi tekten Herzog & De Meuron in Basel. Die «Didacta Schweiz Basel» ist Treff punkt für die nationale Bildungswelt. Alle zwei Jahre besuchen rund 18 000 Interessierte die Bildungsmesse. Die internationale Worlddidac Basel fin det zur gleichen Zeit im selben Messe gebäude statt. Der Lehrmittelverlag Zürich (LMV) tritt gemeinsam auf mit den Lehrmittelverlagen St. Gallen, Solothurn und der Interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz in der Halle 1.1, Stand A62. Zu entdecken sind unter anderem Neuerscheinungen des LMV sowie die Lehrwerke «Mathematik Primarstufe 1–3» und für das Fach Religion & Kultur «Blickpunkt 1–3», die den internationalen Bildungspreis Worlddidac Award 2014 gewonnen haben. Ausserdem zu sehen ist die neuste LMV-Publikation «Zürcher Pioniergeist». Man kann zudem das digitale Angebot des LMV kennen lernen und einen ersten E-Book- Prototyp für das neue Französisch
lehrmittel «dis donc!» ausprobieren. Öffnungszeiten: Mi, 29.10., 9 –18 Uhr; Do, 30.10., 9 –18 Uhr; Fr, 31.10., 9 –17 Uhr. [red] ∑
Foto: zvg
Lehrpersonenkonferenz
www.didacta-basel.ch
Suchtprävention
Eltern über Risiken von Medikamenten informieren Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich haben einen Eltern flyer zum Thema «Medikamente bei Kindern und Jugendlichen» entwickelt. Dieser zeigt auf, wie Medikamente gegen kleinere Beschwerden wie z. B. Kopf- oder Bauchweh bei Kindern eigesetzt werden sollten, und geht ins besondere auf deren Suchtpotenzial ein. In einfacher und verständlicher Sprache wird aufgezeigt, was Eltern tun können, um späteren Suchtent wicklungen vorbeugen zu können. Ein Flyer ist diesem Schulblatt beigelegt. Schulen aus dem Kanton Zürich kön nen weitere Exemplare kostenlos be stellen. Der Flyer wird auch in Fremd sprachen erscheinen. [an] www.suchtpraevention-zh.ch > Publikationen > Informationsmaterial > Familie ∑
Weiterbildung Sportunterricht
Neues Kursprogramm erschienen Der Kanton und die Stadt Zürich arbeiten beim Weiterbildungsangebot für den Sportunterricht zusammen. Nun ist das Programm für das Schul jahr 2014/15 erschienen. Die Aktivi täten umfassen freiwillige und kosten lose Weiterbildungskurse. Sie richten sich sowohl an sportbegeisterte als auch an weniger sportfreudige Lehr personen auf allen Schulstufen. Sie haben zum Ziel, die Qualität und die Kompetenzorientierung im Sport- und Bewegungsunterricht zu entwickeln und zu sichern. Das aus erfahrenen Turn- und Sportlehrpersonen beste hende Kursteam filtert aus bewährten Inhalten das Wesentliche heraus und präsentiert motivierende Organisa tionsformen, welche ausprobiert und anschliessend direkt als Vorlage in den Unterricht mitgenommen werden können. [red] ∑
www.sportamt.ch/weiterbildung
Die neue Berufswahl-Fahrplan-App liefert wichtige Informationen und Tipps.
Berufswahl
Neue Berufswahl-Fahrplan-App für Sekschülerinnen und -schüler Die Berufsberatung des Kantons Zürich unterstützt Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Sek neu mit einer Berufswahl-Fahrplan-App. Als erster Kanton bietet der Kanton Zürich damit Hilfe im Berufswahl-Prozess auf diese Art an. Der Inhalt der App ist speziell auf den Kanton Zürich zugeschnitten. Das bietet die Berufs wahl-Fahrplan-App: • Berufswahl-Fahrplan mit Zusatz- Infos und Tipps: Was läuft wann, wie und wo? (z. B. Termine von Mittel schulprüfungen) • Info-Veranstaltungen, Berufs besichtigungen: Hinweise, wichtige Links, Tipps • Schnupperlehre suchen: Wunsch beruf eingeben und erfahren, wo man in der Umgebung schnuppern kann • Lehrstelle suchen: Freie Lehrstellen finden im Wunschberuf • Berufsorakel: Welcher Beruf könnte auch noch zu einem passen? Handy schütteln und sich überraschen lassen! • Interessante Informationen zu allen Lehrberufen • Meine Berufsberatung: Bei Fragen zur Berufswahl kann man ganz ein fach den Berufsberater kontaktieren, der für das Schulhaus zuständig ist Die Berufswahl-Fahrplan-App ist kostenlos. [red] ∑
www.berufswahlfahrplan.zh.ch Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 23
Mittelschule
«Le volume d’une pyramide» berechnen Im Juli haben die ersten Mittelschülerinnen und -schüler die zweisprachige Matur Deutsch/Französisch abgeschlossen. Viel gelernt haben sie im Immersionslehrgang auch in kultureller Hinsicht. Text: Andrea Schafroth Foto: Reto Schlatter
Immersion einmal anders: junge Schweizer und Franzosen im Kampf um den Ball.
«Les mathématiques, ce n’est pas plus difficile en français qu’en allemand», sagt Janie Molard. Sie ist Mathematiklehrerin an der Kantonsschule Freudenberg in Zürich-Enge und unterrichtet auf Französisch. Obwohl ihre 4. Klasse nur zehn Schülerinnen und Schüler zählt, ist das Schulzimmer heute rappelvoll: Der nächste Jahrgang, der in Geometrie auch schon bald über «base fois hauteur» und das «volume d’une pyramide» brüten wird, ist zu Besuch, um zu schnuppern. Die Kantonsschulen Freudenberg und Zürich Nord bieten seit 2010 in 24 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
inem Pilotprojekt die Französische Immersion an. Diesen Sommer haben die ersten Absolventinnen und Absolventen dieses Lehrgangs mit der zweisprachigen Maturität abgeschlossen, jene der Kantonsschule Freudenberg erhielten aus diesem Anlass sogar eine Einladung zum «apéro riche» vom französischen Generalkonsulat. Die Schulleitungen der beiden Gymnasien sind stolz auf den Lehrgang, der mit viel Aufwand und Herzblut auf die Beine gestellt wurde. «Während die Englisch-Immersion sozusagen ‹horssol› abläuft, liegen beim Französischen
die Sprache und Kultur, in die wir unsere Schülerinnen und Schüler ein tauchen lassen, vor der Haustür», sagt Daniele Fumagalli, Prorektor der Kantonsschule Zürich Nord. Die dortigen Absolventen des Lehrgangs besuchen zwingend ein Semester lang ein Lycée in der Romandie. An der Kantonsschule Freudenberg ist ein solcher Aufenthalt zwar nicht obligatorisch, aber praktisch alle Immersionsschüler absolvieren ihn – und betrachten ihn auch als Highlight. Ebenso machten die vielen niederschwelligen Austauschmöglichkeiten den Reiz der Französisch-Immersion aus, erzählt Prorektor Beat Gyger: ein Besuch der «Fête de l’Escalade» in Genf, eine Reise nach Paris oder die regelmässige Zusammenarbeit mit dem Lycée Français in Dübendorf. «Wir organisieren gemeinsame kulturelle Veranstaltungen oder helfen uns gegenseitig mit Stellvertretungen aus. Aus Anlass der diesjährigen Fussball-WM haben wir einen Fussballmatch gegeneinander gespielt, bei dem wir Schweizer, anders als in Brasilien, Frankreich glorios mit 9:0 besiegt haben.» Immersivunterricht im Kurssystem In der Ausgestaltung des Lehrgangs sind die Schulen relativ frei. Laut Reglement der Schweizerischen Ma turitätskommission müssen mindestens drei Maturfächer und insgesamt 800 Lektionen immersiv unterrichtet werden. An der Kantonsschule Zürich Nord sind das Geografie und Geschichte, ausserdem muss die Maturarbeit auf Französisch verfasst werden; im Freudenberg sind es Mathematik, Physik, Chemie und Geschichte. Beide Schulen setzen auf das Kurssystem:
Mittelschule
Die Schülerinnen und Schüler werden für die immersiv unterrichteten Fächer, den Französischunterricht und die kulturellen Unternehmungen zusammengeführt, ansonsten sind sie in ihren Stammklassen «zu Hause». Das hat den Vorteil, dass der Lehrgang in Kombination mit sämtlichen Profilen gewählt werden kann. Nach dem Schlussbericht der wissenschaftlichen Evaluation durch die Universität Fribourg wird der Bildungs rat im Laufe des Schuljahrs 2014/15 entscheiden, ob und in welcher Form der Lehrgang regulär weitergeführt wird. Vorerst haben zwei weitere Schulen Interesse angemeldet. An den Kantonsschulen Zürich Nord und Freudenberg absolvieren pro Jahrgang je 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler den Immersionslehrgang Deutsch/Französisch. Die Bedeutung des Französischen werde generell unterschätzt, meint Beat Gyger, obwohl Studien be-
legten, dass es in Schweizer Unter nehmen fast ebenso häufig wie das Englische verwendet werde, mündlich sogar öfter. Kulturelle Unterschiede im Unterricht Martina Wider, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Verantwortliche für die Immersionslehrgänge im Mittelschulund Berufsbildungsamt, meint: «In zwischen bieten zahlreiche Schweizer Gymnasien Immersionslehrgänge für Englisch an, aber nur wenige für Französisch. Wer also eine Französisch matur absolviert, kann sich sprachlich auf dem Arbeitsmarkt profilieren.» Sie hat den methodisch-didaktischen Lehrgang mitentwickelt, der im Kanton Zürich für Immersionslehrpersonen vorgeschrieben ist. Darin geht es etwa darum, welche Lehrmittel geeignet sind, wie Quellentexte vereinfacht werden und wie in den Immersions fächern angesichts der geringeren
Sprachkompetenz der Schüler adäquat benotet werden kann. Die französischsprachigen Lehrpersonen werden aber nicht nur mit praktischen, sondern auch mit kul turellen Herausforderungen konfrontiert. Janie Molard, die zuvor am Lycée Français unterrichtet hatte, wurde an der Kantonsschule Freudenberg zunächst aus der Bahn geworfen: «Ich war es nicht gewohnt, dass Schüler mich als Lehrperson anzweifeln, das gibt es in Frankreich nicht.» Inzwischen kann sie damit umgehen, wenn Schüler sie für ein schlechtes Prüfungsresultat verantwortlich machen oder Hausaufgaben verschieben wollen. Und sie freut sich, wenn sie an der mündlichen Maturprüfung eine Viertelstunde wie selbstverständlich auf Französisch parlieren. «Ich staune immer wieder über das sehr unmittelbare Erfolgserlebnis, das die Immer sion ihnen ermöglicht.» !
Fotos: zvg
Sprachlich und persönlich profitiert Eine Maturandin und ein Maturand erzählen von ihren Erfahrungen mit der Französisch-Immersion. Hélène Hüsler, Gymnasium Freuden berg «Ich konnte nicht gut Französisch, aber meine Grosseltern stammen aus Frankreich, deshalb hat mich der Immersionslehrgang natürlich angesprochen. Als in der Vierten die immersiven Fächer starteten, hatte meine Klasse mit den neuen französischsprachigen Lehrkräften zum Teil happige Konflikte. Die kulturellen Unterschiede im Unterricht sind ziemlich gross. Im Geschichtsunterricht zum Beispiel werden bei uns viel mehr Zahlen und Fakten gefordert. Der Geschichtslehrer aus Neuchâtel brachte als Lehrmittel ein schmales Büchlein mit ganz vielen Bildern mit. Das stresste viele von uns, weil wir wussten: An der Matura würden wir den gleichen Stoff beherrschen müssen wie die nicht immersiv unterrichteten Schüler. Aber mit der Zeit hat man diese Probleme in den Griff bekommen. Ich würde die Französisch-Immersion jedenfalls weiterempfehlen. Französisch ist viel komplexer als Englisch, dementsprechend profitiert man sprachlich extrem, vor allem auch vom Aufenthalt in der Romandie oder in Frankreich. Auch das Kurssystem hat mir gefallen, man ist mit Schülern aus allen Klassen zusammen und lernt dadurch viel mehr Leute kennen. Demnächst möchte ich noch Griechisch lernen und vielleicht Schauspielerin werden.»
Michel Meier, Kantonsschule Zürich Nord «Ich habe den Lehrgang vor allem wegen des Austauschsemesters gewählt. Ursprünglich wollte ich ein ganzes Jahr nach Australien, aber danach hätte ich wiederholen müssen. Also wählte ich die Französisch-Immersion und ging nach Yverdon. Das war am Anfang schon ein Sprung ins kalte Wasser. Im Basketball-Verein, bei dem ich mich gleich anmeldete, um mehr Leute kennenzulernen, verstand ich anfangs nur Bahnhof. Ich habe mich aber ziemlich schnell eingelebt, und der Schulstoff war für mich einfach. Bei uns ist alles viel leistungsorientierter, die Schüler sind ehrgeiziger. Für die Jugendlichen in der Romandie ist das Lernen eher Nebensache, man schaut mal, ob man durchkommt, sonst wiederholt man halt. Ich habe nach wie vor Kontakt zu meinen Kollegen in der Westschweiz. Für meine Maturarbeit zum Thema Sprungkraft hat mir mein Sportlehrer in Yverdon französischsprachige wissenschaftliche Bücher mitgegeben, und vor der Abgabe habe ich sie den Westschweizer Klassenkollegen und meinem Gastvater zum Lesen gegeben. Die Erfahrung, sich an einem fremden Ort alleine durchzukämpfen, finde ich sehr wertvoll. Nun schalte ich mal ein Zwischenjahr ein, danach habe ich vor, mit Kollegen aus dem Immersionslehrgang in Lausanne zu studieren – vielleicht Medizin.» Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 25
Mittelschule
Schulgeschichte(n) Eine idyllische Lage und ein Anflug von künstlerischem Flair – an der Kantonsschule Rychenberg in Winterthur vergisst man, dass sie eine der grössten Zürcher Kantonsschulen ist. Text: Jacqueline Olivier Fotos: Conradin Frei
Wer durch die Gänge und über das Gelände der Kantonsschule Rychenberg schlendert, kann sich ihrer Präsenz nicht entziehen: Hier sitzen zwei junge Männer auf einem Mäuerchen und trommeln auf ihren Djemben, dort huscht eine junge Frau mit rötlichem Wuschelschopf, barfuss, in grünen Plu derhosen und besticktem Gilet vorbei, und unvermittelt beginnt eine andere junge Frau mit unverkennbar geschulter Stimme Tonleitern auf und ab zu trillern. Neben dem Langgymnasium mit dem alt- und dem neusprachlichen Profil beherbergt die KS Rychenberg auch die einzige Fachmittelschulabteilung Musik und Theater im Kanton Zürich. Es sind wenige Schülerinnen und Schüler, die dieses Profil belegen, aber sie verleihen der Schule eine gewisse Buntheit und bereichern den All tag mit hochstehenden Konzerten und Theateraufführungen. Natürlich wird am Gymnasium ebenfalls musiziert 26 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
und Theater gespielt, dabei greift man gerne auf das Know-how der angehenden Profis im eigenen Haus zurück. «Cross-over» wird am Rychenberg auch personell grossgeschrieben. So gut wie alle Lehrpersonen unterrichten am Gymi wie an der FMS, die neben Musik und Theater die Profile Pädagogik sowie Kommunikation und Information anbietet. Offenheit pflegt man nicht minder nach aussen. Mit der Kantonsschule Im Lee arbeitet man beispielsweise in Sachen Raumnutzung oder Ergänzungs- und Freifächerange bot eng zusammen. Das ist nicht weiter verwunderlich, leben die zwei Schulen doch in unmittelbarer Nachbarschaft und sind auch durch ihre gemeinsame Geschichte miteinander verbunden: Beide entstanden aus dem 1919 kantonalisierten Winterthurer Gymnasium. Aufgrund zunehmender Platzprobleme wurde später direkt n eben dessen Gebäude, das heute die KS Im Lee be
herbergt, ein Neubau erstellt. In diesen zogen 1962 das Langgymnasium und die Mädchenschule – die spätere Diplom- und heutige Fachmittelschule – und wurden zur Kantonsschule Rychenberg. Heute gehen hier rund 1300 Schülerinnen und Schüler und 170 Lehrpersonen ein und aus. Erste Rektorin einer Kantonsschule Von extern dazu kommen die Dozenten der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), welche die FMS-Absolventinnen des Profils Musik und Theater in den berufsspezifischen Fächern un terrichten: Rhythmik, Perkussion oder Auftrittskompetenz. Für den Instrumentalunterricht – auch am Gymnasium – setzt man auf die Lehrpersonen der Jugendmusikschule, ebenfalls eine Nachbarin auf dem von hohen Bäumen und alten Villen dominierten Hügel. Dass diese herrliche Lage für den Bau eines Gymnasiums einst heftig kriti-
Mittelschule
Simon Giesch, SO-Präsident
Franziska Widmer Müller, Rektorin «Mit dem Langgymnasium und der Fachmittelschule hat unsere Schule einen akademisch geprägten Grundpfeiler mit einem star ken kreativen Gegenpol. Ich finde es zentral, dass unsere Lehr personen sowohl am Gymi als auch an der FMS unterrichten, so weiss jeder, was in den beiden Abteilungen läuft. Die FMS musste und muss aufgrund ihrer bewegten Geschichte ihren Platz an der Schule immer wieder neu finden. Der jüngste Wandel betrifft die Einführung der Fachmaturität Pädagogik, die wir Ende dieses Schuljahrs erstmals vergeben werden – ein wichtiger Schritt. Am Langgymnasium haben wir die meisten Schüler sechs Jahre lang bei uns, wodurch sich enge Beziehungen zu den Schülern wie auch unter diesen ergeben. Sehr erfrischend finde ich die 40-Minuten-Lektionen, die für viel Abwechslung im Alltag sorgen.»
siert wurde, weil sie einen 15-minütigen Fussmarsch vom Bahnhof erforderlich machte, ist längst vergessen. Heute steigen die auswärtigen Schüler am Bahnhof in den Bus um, viele einheimische kommen hergeradelt, wie ein Blick in den vollgestellten Velo keller bestätigt. Dicht ist ebenso der Stundenplan. Die Unterrichtslektionen dauern lediglich 40 Minuten. Eine alte Winterthurer Eigenheit, an der die beiden benachbarten Kantonsschulen bis heute festhalten. Ein Tag umfasst also mehr Lektionen als anderswo, pro Fach sind mehr Wochenlektionen nötig.
«Für den SO-Vorstand suchen wir immer wieder FMS-Schüler, denn es ist uns wichtig, dass auch sie vertreten sind. Wir im Gymi wissen meistens nicht sehr viel über die FMS. Ich habe Kontakt mit ein paar Schülern, mit denen unsere Klasse ein Musical realisiert hat. Am Rychenberg schätze ich die breite Palette an Angeboten. So gibt es jedes Jahr eine Reise, zum Beispiel eine dreitägige kulturhistorische Exkursion, eine Fachwoche im In- oder Ausland oder die Semaine Romande in der 3. Klasse. Von einigen Lehrern werden auf freiwilliger Basis auch Reisen während der Ferien organisiert. Im Frühling waren wir mit dem Chor und der Big Band in Irland. Nun steht die Maturreise bevor. Hier ist es eine alte Tradition, dass sie ins Hochgebirge führt. Darauf freue ich mich riesig: Zusammen einen Drei- oder Viertausender zu bewältigen und dieses Erlebnis gemeinsam zu geniessen.»
Und noch etwas ist «typisch Winterthur»: die lange Tradition der Koedukation. Bereits 1898 wurde das städtische Gymnasium für Mädchen geöffnet. Als aus der Mädchenschule die Diplommittelschule wurde, waren von Anfang an auch Jungen zugelassen. Es ist wohl kein Zufall, dass gerade im Rychenberg ab 1987 mit Sibyll Kindlimann die erste Rektorin einer Zürcher Kantonsschule amtete, die wenig später auch als erste Frau die Schulleiterkonferenz präsidierte. Aktuell sind an Zürcher Mittelschulen nur drei Rektorinnen zu zählen – darunter Franziska Widmer Müller vom Rychenberg. !
Schulgeschichte(n) Die Zürcher Mittelschullandschaft ist während 180 Jahren gewachsen und hat entscheidende Entwicklungs schritte durchlaufen. Das Schulblatt porträtiert in einer neuen Serie einzelne Schulen, deren Geschichte für eine bestimmte pädagogische oder bildungspolitische Entwicklung steht, und lässt die Rektorin oder den Rektor sowie die Präsidentin oder den Präsidenten der Schüler organisation erzählen, was für sie von der Vergangenheit spürbar ist und wie sie die Schule heute erleben.
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 27
Chancen ausbauen. Sie wollen Lehrperson an einer Berufsfachschule oder an einer Höheren Fachschule werden? Hier erfahren Sie alles zum umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebot der Pädagogischen Hochschule St.Gallen: Informationsanlass Sekundarstufe II Donnerstag, 30. Oktober 2014, 18.00 – 20.00 Uhr PHSG, Hochschulgebäude Hadwig, Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis spätestens Montag, 27. Oktober 2014, unter www.phsg.ch/infosek2
in Kooperation mit Zentrum für berufliche Weiterbildung
Mittelschule
Dritte Landessprache soll gefördert werden Die Konferenz der kantonalen Er ziehungsdirektionen (EDK) möchte das Fach Italienisch an den Schweizer Gymnasien stärken, das zurzeit nur von etwa 13 Prozent aller Schweizer Gymnasiasten belegt wird. Sie empfiehlt den Gymnasien deshalb, dafür zu sorgen, dass jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit hat, Italienisch als Maturitätsfach zu belegen, sei es als Schwerpunkt-, sei es als Grundlagenfach. Schulen, die Italienisch nicht selber anbieten können, sollen mit benachbarten Gymnasien zusammenarbeiten – auch über Kantonsgrenzen hinweg. Ausserdem soll Italienisch als Immersionssprache eingesetzt werden. Bis Ende September dauert die Anhörung, die sich an die kantonalen Erziehungsdirektionen, den Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer sowie die Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorinnen und -rektoren richtet. Im Kanton Zürich bieten heute schon alle staatlichen Mittelschulen Italienisch an, alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Italienisch als Maturitätsfach zu belegen. Deutsch-Italienisch-Immersion bietet das Liceo Artistico an. [red]
HSGYM
Positive Zwischenbilanz nach fünf Jahren 2006 fiel der Startschuss für das Projekt HSGYM (Hochschule und Gymna sium, Treffpunkte an der Schnittstelle). Rund 500 Mittelschullehrpersonen aus dem Kanton Zürich, Dozierende von Universität und ETH Zürich sowie von zwei Zürcher Fachhochschulen erarbeiteten gemeinsam über 200 Empfehlungen für 25 Fachbereiche mit dem Ziel, Hochschulreife und Studierfähigkeit zu verbessern und den Übergang von den Mittel- an die Hochschulen zu optimieren. Anfang 2009 wurden diese Empfehlungen ver öffentlicht. Nun liegt eine erste Zwischenbilanz vor. Der Grundtenor ist positiv. Viel sei bereits erreicht worden, meint Koordinator Thomas Schmidt. So seien etwa der Dialog zwischen
Gymnasien und Hochschulen sowie weiteren an der Schnittstelle beteiligten Bildungsinstanzen verstetigt, ein Expertenpool für Maturitätsprüfungen eingerichtet oder diverse Nachfolgeprojekte ausgelöst worden. Und vor allem herrscht unter allen Akteuren Einigkeit: HSGYM muss weitergehen. Ausserdem wird der Kreis erweitert: Noch dieses Jahr soll je ein Delegierter pro Fach aus den Kantonen Schwyz, Glarus, Zug, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau und Thurgau in den Fach konferenzen Einsitz nehmen. Der Bericht «Hochschulreife und Studierfähigkeit – eine Zwischenbilanz» kann auf www.educ.ethz.ch/ hsgym/ eingesehen werden oder als PDF bei Thomas Schmidt, th.a.schmidt@ bluewin.ch, bezogen werden. [red]
Wissenschafts-Olympiaden
Erfolgreiche Schweizerinnen und Schweizer Von der diesjährigen internationalen Mathematik-Olympiade in Südafrika kehrten alle sechs Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Medaille nach Hause. Mit 114 Punkten erzielte die Schweizer Delegation aus serdem das beste Mannschaftsresultat. Unter den Bronzemedaillengewinnern ist auch Daniel Rutschmann von der Kantonsschule Im Lee in Winterthur. Ebenfalls gut abgeschnitten haben die Schweizer Nachwuchswissenschafter an der internationalen Physik-Olympiade in Kasachstan. Zwei mal Silber, einmal Bronze und zwei Honorable Mentions lautet hier das Resultat. Aus dem Kanton Zürich stand Barbara Roos vom Mathematisch-
naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl auf dem Podest, sie war die Gewinnerin der Bronzemedaille. [red]
Internationale Physik-Olympiade
Austragung 2016 findet in Zürich statt Die Universität Zürich (UZH) wird im Sommer 2016 Gastgeberin der 47. Internationalen Physik-Olympiade sein. Organisiert wird der Wettbewerb vom Verein Swiss Physics Olympiad und vom Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden. Sie erwarten aus diesem Anlass Delegationen aus circa 90 Ländern sowie rund 1000 Gäste von nah und fern an der UZH. Natürlich hoffen Organisatoren und Gastgeber auf möglichst viele teilnehmende Jugendliche aus Zürich. Wer sich heute schon mit anderen Jugendlichen in einer der Wissenschaftsdiszplinen Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik und Philosophie messen möchte, muss aber nicht bis 2016 warten: Bereits diesen Herbst beginnen die Vorausscheidungen für die Schweizer Wissen schafts-Olympiaden 2015. [red] ∑
www.olympiads.ch
Personelles
Mutationen in den Schul leitungen der Mittelschulen Der Regierungsrat hat nachstehende Wahlen vorgenommen: auf Beginn des Schuljahres 2014/2015 • Kantonsschule Küsnacht: Sandra Pitel Alessandri, Mittelschullehrperson mbA für Englisch, als Prorektorin. [red]
Foto: www.olympiads.ch
Italienischunterricht
Erfolgreiche Schweizer Delegation an der internationalen Mathematik-Olympiade in Südafrika. Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 29
Berufsbildung
Vorurteile abbauen, Hierarchien überwinden In vielen Branchen müssen heute verschiedene Berufsleute an einem Strick ziehen – etwa in der Pflege. Das Careum thematisiert die inter professionelle Zusammenarbeit an Projekttagen. Text und Fotos: Jacqueline Olivier
Ausnahmezustand am Careum, dem Bildungszentrum für Berufe im Ge sundheitswesen in Zürich. Durch die Korridore drängen sich überwiegend junge Leute von einem Raum zum nächsten. In den Zimmern, in denen normalerweise unterrichtet wird, gibt es heute allerlei zu sehen – Präsenta tionen zum Thema interprofessionelle Zusammenarbeit, erarbeitet von 23 ge mischten Gruppen von Lernenden und Studierenden aus fast allen im Haus angebotenen Ausbildungsgängen. In Aus stellungen, Parcours oder Multi media-Darbietungen werden Fragen aufgegriffen und beantwortet, die den angehenden Berufsleuten in ihrem Praxisalltag begegnen: Wie können Vorurteile zwischen den Berufsgrup pen abgebaut werden? Wie erlebt der Patient eine Zusammenarbeit, die nicht reibungslos verläuft, und wie kann eine optimale Zusammenarbeit zum Wohl des Patienten gelingen? Wie wird über Hierarchiestufen hinweg ein gutes Ar beitsklima geschaffen?
Ihre Schlüsse haben die Lernen den und Studierenden oft anhand fiktiver Fallbeispiele veranschaulicht, nicht ohne – teilweise schwarzen – Hu mor. Die Stimmung im Haus ist fröh lich, die Besucher, unter ihnen auch Lehrpersonen sowie Berufsbildnerin nen und Berufsbildner der Praxisorte, lassen sich mit den jeweils anwesen den Vertretern der einzelnen Gruppen gerne ins Gespräch verwickeln und einzelne Aspekte ihrer Arbeit genauer erklären. Erfahren, wie der andere tickt «In diesen Tagen lebt das Careum an ders, weil der gesamte Unterricht mit allen Bildungsgängen gleichzeitig in diesem Gebäude stattfindet», sagt Su sanne Lampe. Die diplomierte Pflege pädagogin ist an der Höheren Fach schule Pflege tätig und Mitorganisatorin der Projekttage «Interprofessionelles Lernen». Diese finden dieses Jahr zum dritten Mal statt und sollen laut Susanne Lampe in erster Linie das gegenseitige
Interprofessionalität als Ausbildungsthema Wie am Careum wird auch am Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich (ZAG) in Winterthur die interprofessionelle Zusammenarbeit verschiedentlich thematisiert – bisher schwerpunktmässig auf Stufe Höhere Fachschule –, einerseits theoretisch im Unterricht, andererseits in Rollen spielen. Ausserdem wird Interprofessionalität in Prüfungssituationen praktiziert, indem etwa zwei Studierende aus verschiedenen Berufen gemeinsam eine Pflegesituation zu lösen haben. Auch in anderen Branchen wird auf die zuneh mende Bedeutung der Interprofessionalität resp. Interdisziplinarität reagiert. So erstellt die Baugewerbliche Berufsschule Zürich zurzeit ein Konzept, wel ches das Thema in den Lehrgängen der Höheren Fachschule für Technik im Bereich Gebäudetechnik curricular abbilden soll. Marc Kummer, Chef des Mittelschul- und Berufsbildungsamts in der Bildungsdirektion, findet es sinn voll, wenn Führung und Zusammenarbeit im interprofessionellen Umfeld schon in der Ausbildung angesprochen werden und man von Analogien in anderen Branchen lernt – im Rahmen der Möglichkeiten der einzelnen Schulen. [jo] 30 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Verständnis unter den verschiedenen Berufsleuten wecken, die heute in Spi talzimmern, in Operationsräumen, in der Alterspflege oder selbst im Falle nicht stationärer Patienten teilweise eng zusammenarbeiten müssen. Am Careum selber werden die bei den Grundbildungen Fachangestellte(r) Gesundheit (FaGe) und Assistent(in) Gesundheit und Soziales (AGS) sowie diverse Lehrgänge auf Stufe Höhere Fachschule angeboten: Pflege, Medizi nisch-technische Radiologie, biomedi zinische Analytik, Operationstechnik, Dentalhygiene. In der Praxis kommen weitere Berufe auf Stufe Fachhoch schule hinzu, beispielsweise in den Be reichen Pflege, Ergo- und Physiothe rapie oder Hebammen. Und schliesslich natürlich die Ärzte, die an den Hoch schulen studiert haben. Und oft weiss die eine Berufsgruppe von der anderen nicht, wie sie arbeitet, wie sie «tickt». Einblick in andere Betriebe Aus diesem Grund wird am Careum auch im regulären Unterricht die In terprofessionalität regelmässig thema tisiert und im Rahmen des sogenann ten «Problem based learning» anhand von Fallbeispielen geübt. An den drei Projekttagen können Lernende und Studierende dann einen echten Pers pektivenwechsel vornehmen. Nicht nur im Rahmen ihrer Arbeit, sondern auch bei einem Besuch in einem ande ren Betrieb, indem ebenfalls die ver schiedensten Berufe miteinander auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten müssen, etwa bei den Verkehrsbetrie ben Zürich, im Opernhaus oder im Kunsthaus. «Anlässlich solcher Besu che sehen die Lernenden, wie andere Branchen die interprofessionelle Zu
Berufsbildung
neu.» Auch wenn die drei Projekttage etwas lang gewesen seien, betrachte sie jetzt vieles, was in der Praxis läuft, aus einem anderen Blickwinkel. «Und ich habe das Careum besser kennen gelernt. Mir war vorher gar nicht be wusst, wie viele Ausbildungsgänge hier geführt werden und was sie alles be inhalten.»
Kreative Präsentationen am Careum – die Gruppe «Kontraste» (unten) gewann einen Preis. In ihr arbeiteten auch Munira Omerkic und Ektoras Dokos (beide rechts im Bild) mit.
sammenarbeit lösen, und können da raus Schlüsse für sich selber ziehen», meint Susanne Lampe. Was macht denn diese Zusammen arbeit so schwierig? «Es geht um Zu ständigkeiten und darum, dass jeder, der an einem Prozess beteiligt ist, auf grund seiner Sicht der Dinge andere Vorstellungen darüber hat, wie dieser Prozess ablaufen sollte», antwortet die Pflegepädagogin. Einmal zu hören, was die anderen beschäftigt, wie sie die Zusammenarbeit erleben, gemein sam Lösungsvorschläge zu erarbeiten, helfe, solche Barrieren in der Praxis abzubauen, ist sie überzeugt. Überraschende Erkenntnisse Munira Omerkic, studierende Fachfrau Operationstechnik, hat sich in ihrer
Gruppe unter dem Motto «Kontraste» mit den Hierarchien auseinanderge setzt, an denen sie sich selbst immer wieder stösst. «Insbesondere von den Ärzten und teilweise von den Anästhe sisten habe ich oft den Eindruck, dass sie auf uns herabschauen. Das habe ich in meinem letzten Praktikum eben wieder erlebt.» In der Gruppe habe sie schnell gemerkt, dass sie damit nicht allein sei. «Das Hierarchiedenken tut den meisten weh.» Dies festzustellen und darüber reden zu können, tat der 23-Jährigen gut. Am überraschendsten war für Mu nira Omerkic im Übrigen der Einblick in die Arbeit der Fachfrauen für medi zinisch-technische Radiologie: «Unter welchem Druck sie stehen und was sie alles wissen müssen, das war für mich
Sich nicht gegenseitig blockieren Das sieht Ektoras Dokos ähnlich. Der 19-jährige FaGe-Lernende hat eben falls in der Gruppe «Kontraste» mitge arbeitet und vor allem davon profitiert, Einblick in andere Berufe bekommen zu haben. «Gerade als Lernender in der Grundbildung finde ich es wichtig, mir zu überlegen, was andere am Pa tienten leisten.» Bei der Zusammen arbeit zwischen verschiedenen Beru fen entstünden viele Schnittstellen, die mangels Kommunikation nicht immer gut funktionierten. Dass dies nicht so sein muss, hat er beim Besuch im Schauspielhaus erfahren. «Es war sehr spannend zu sehen und zu spüren, wie gut Leute mit verschiedenen Berufen und Nationalitäten auf einen Punkt kommen, wenn sie sich gegenseitig re spektieren, sich freundlich begegnen und aufeinander eingehen.» Im ge genteiligen Fall, meint Ektoras Dokos, klappe gar nichts, weil man sich ge genseitig blockiere. Auch innerhalb ihrer Gruppe habe die Zusammenarbeit auf Anhieb sehr gut funktioniert, erzählt er weiter. Das sei nicht in allen Gruppen der Fall ge wesen, wie er gehört habe. Die Gruppe von Ektoras Dokos und Munira Omer kic hat ihre Erkenntnisse dreidimen sional dargestellt: Mit Pulten, Karton und Papier hat sie zwei Häuser gebaut. Auf der Fassade des einen sind die auf farbigen Zettel notierten Berufsgrup pen fein säuberlich von unten nach oben hierarchisch aufgeklebt – es macht einen etwas tristen Eindruck. Auf der Fassade des anderen kleben die Zettel kunterbunt durcheinander – hier lacht die Sonne, der Baum vor dem Haus trägt Blüten, Schmetterlinge und Vögel fliegen vorbei. Von den anderen Lernenden ist die Gruppe dafür mit dem Preis für die kreativste Arbeit belohnt worden, je des Gruppenmitglied hat einen Kino gutschein erhalten. ! Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 31
Berufsbildung
Berufslehre heute Forstwart ist kein Beruf für Romantiker, im Vordergrund stehe das Handwerk liche, sagt Willy Spörri, Betriebsleiter des Stadt zürcher Waldreviers Üetliberg. Für seine Lernende Eva Dräyer ist Forstwartin der Traumberuf und Holzen die Lieblingsarbeit. Text: Paula Lanfranconi Foto: Sabina Bobst
32 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Berufsbildung
Auch an diesem Morgen ist sie mit dem Velo zur Arbeit gekommen, pünktlich um 6.45 Uhr. Dann ist Einturnen für das 18-köpfige Forstwartteam – ein ge sunder Körper ist zentral in diesem Beruf. Eva Dräyer hat soeben das dritte Lehrjahr begonnen und ist die einzige Frau hier. Sie ist mit dem Wald aufge wachsen, ihr Vater arbeitet als Wild hüter. Forstwartin, sagt die 17-Jährige, sei seit der 1. Sek ihr Traumberuf: «Ich bin gerne draussen und wollte eine spezielle Herausforderung.» Herausfordernd war dann bereits das Auswahlprozedere. Die Schnup perlehre dauert mindestens zwei Wo chen. «Wer sich für diesen Beruf in teressiert», sagt Willy Spörri, «muss erlebt haben, wie es ist, wenn es eine Woche lang einfach nur regnet.» Man sehe dann auch, ob jemand handwerk lich begabt und beweglich sei. 15 bis 20 Bewerbungen erhält der Betriebs leiter des Waldreviers Üetliberg pro Lehrstelle. Manche dieser jungen Leute wüssten allerdings nicht wirklich, für welchen Beruf sie sich bewerben. Motivierte Sek-B-Bewerber sind ihm allemal lieber als Sek-A-Schüler, die sich gerade so durchwinden. Wich tig sei auch, dass jemand ins Team passe: «Forstwarte arbeiten zu zweit, unsere Sprache ist direkt, auch aus Sicherheitsgründen.» Weshalb machte Eva Dräyer das Rennen, als Frau? Sie sei einfach besser gewesen als die männlichen Interessenten, sagt ihr Chef: «Geschickter, einsatzfreudiger.» Die Natur gibt den Takt vor Forstwarte arbeiten im Rhythmus der Jahreszeiten. An diesem Sommermor gen stehen das Reparieren von Ruhe bänken und Arbeiten im Forstgarten auf dem Programm. Im Oktober dann beginnt der Holzschlag, im November und Dezember hat der Christbaum verkauf Priorität. Vom Januar bis März geht es wieder ans Holzen – Eva Drä yers Lieblingstätigkeit, denn «das ist Action». Die theoretischen Grundlagen dafür erlernt die junge Frau seit dem ersten Lehrjahr an der Berufsbildungs schule Winterthur. Der Schulstoff be reitet der Sek-A-Absolventin kaum Mühe. Am anspruchsvollsten findet sie gewisse Stoffe des Allgemeinbil denden Unterrichts – Politik, Recht. Am Anfang, räumt sie ein, sei es ihr
schwergefallen, frühmorgens bei je dem Wetter hinauszugehen und den ganzen Tag mit der schweren Ketten säge zu hantieren: «Am Abend fällst du ins Bett wie ein Baum. Aber mit der Zeit baust du Muskeln auf.» Hat sie nie Angst beim Ansetzen der Motorsäge? Wenn man den Kopf bei der Sache habe, passiere selten et was, antwortet sie auf ihre nüchterne Art. Sicherheit werde in den überbe trieblichen Holzerkursen drillmässig geübt, ergänzt ihr Chef: «Wer eine Motorsäge in die Hand nimmt, trägt Schnittschutzhose und Helm. Wer hier schlampt, muss mit schlechteren No ten rechnen, denn Risiken zu vermei den ist oberstes Gebot.» Dereinst Forstmaschinenführerin? Willy Spörri lockte damals vor allem die frische Luft in den Forstwartberuf. Zuerst, erzählt der 56-Jährige, habe er als Maurer geschnuppert, danach als Forstwart. Nach sieben Jahren bildete er sich an der Höheren Fachschule zum Förster weiter. Heute arbeitet er mehrheitlich im Büro. Er ist für die Be wirtschaftung des Waldreviers Üetli berg zuständig, ebenso für Personal fragen und Öffentlichkeitsarbeit. Eva Dräyer möchte nach der Lehre ins Bündnerland, in ein Holzunterneh men: «Holzen, holzen, holzen, bis ich richtig Routine habe.» Danach könnte sie sich eine Weiterbildung zur Forst maschinenführerin vorstellen. Kinder?
Das sei noch weit weg. «Vielleicht in zehn Jahren.» Man könne, fügt ihr Chef hinzu, inzwischen auch in der Forst wirtschaft Teilzeit arbeiten. Die Berufs chancen seien gut, in der Fachpresse gebe es viele Jobangebote. Vorerst freut sich die angehende Forstwartin nun auf ihr bevorstehen des Gebirgspraktikum im Engadin. Dort benutzen einige Berufskollegen heute wieder Pferde, um das gefällte Holz zum nächsten Verladeplatz zu schleppen – etwas, was sie ebenfalls lernen möchte. Das Praktikum im Bergwald habe nicht bloss berufstech nische Gründe, sagt Willy Spörri: «Wir bilden jedes Jahr zwei Lernende aus. Aufgrund des Stellenplafonds können wir sie nach Lehrabschluss nicht wei ter beschäftigen. Mit dem Gebirgsprak tikum bereiten wir sie auch auf das Leben auf eigenen Beinen vor.» Eine weit verbreitete Vorstellung möchte Willy Spörri noch korrigieren: Ein Forstwart sei keiner, der Rehlein und Vögel rette. «Wir sind vor allem Handwerker.» Allerdings ziemlich spe zielle: Wenn die gut aussehende junge Frau im Ausgang erzählt, sie werde Forstwartin, finden die Leute das cool. Kollegen, die es ihr gleichtun wollen, empfiehlt sie: «Du musst Kondition mitbringen und dich im Team durch setzen können.» Nicht nötig ist indes, dass man am Abend nach einem kör perlich anstrengenden Tag auch noch joggen geht, wie es Eva Dräyer tut. !
Der Beruf Forstwart/in EFZ Ausbildung: dreijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähig keitszeugnis. Anforderungen: abgeschlossene Volksschule, Freude an der Arbeit im Freien, körperliche Fitness, technisches Verständnis, berufsbezoge nes ärztliches Zeugnis. Arbeitgeber: kommunale oder kantonale Forstbetriebe, private Forstunternehmen, Unternehmen in verwandten Gebieten (Holzindus trie, Landschafts- und Gartenbau, Umweltbereich etc.). Lernende im Kanton Zürich: circa 25 pro Jahrgang. Karrieremöglichkeiten: zum Beispiel Forst wart-Vorarbeiter/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Förster/in HF, Master in Science FH, Master in Umweltnaturwissenschaften ETH. ∑
www.codoc.ch (Koordination und Dokumentation Bildung Wald)
Berufslehre heute Jedes Jahr treten im Kanton Zürich rund 12 500 Jugendliche eine Lehrstelle an. Sie erlernen neue, altbekannte oder exotische Berufe, solche, die schulisch hohe Anforderungen mit sich bringen, und andere, die mehr auf praktisches Talent ausgerichtet sind. Das Schulblatt porträtiert in einer Serie jeweils eine Berufsbildnerin oder einen Berufsbildner (Lehrmeister) und eine Lernende oder einen Lernenden (Lehrling) in ihrem Arbeitsalltag. Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 33
Mit dem öV den Kanton Zürich entdecken Die ZVV-Schulinfo bietet fixfertiges Unterrichtsmaterial und spannende Projekte rund um den öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich.
ZVV-Trophy 2014 – Wettbewerb für die 7. bis 9. Klasse
Die ZVV-Entdeckungsreise – Lehrmittel für die 4. bis 6. Klasse
Bei der ZVV-Trophy treten Ihre Schülerinnen und Schüler gegen über 400 andere Klassen an. Sie reisen in Gruppen mit S-Bahn, Bus, Tram und Schiff durch den Kanton und beantworten unterwegs den Trophy-Fragebogen. Dabei lernen sie, sich selbständig im ZVV-Netz zu bewegen. Die Teilnahme an der ZVV-Trophy ist kostenlos. Die Siegerklasse gewinnt einen zweitägigen Ausflug in den Europapark inkl. Übernachtung mit Frühstück und Hin- und Rückreise.
Entdecken Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern den Kanton Zürich! «Die ZVV-Entdeckungsreise» bringt Kindern bei, sich selbständig mit Bahn, Bus, Tram und Schiff zu bewegen. Mit einem originell illustrierten Schülerheft erarbeiten sie einen Reiseplan. Danach geht es in Gruppen oder als ganze Klasse auf Entdeckungsreise mit interessanten Aufträgen rund ums Thema öffentlicher Verkehr.
Durchführung: 1. September bis 28. November 2014 Infos und Anmeldung: www.zvv.ch/trophy
34 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Die Tickets für die Reise stellt der ZVV kostenlos zur Verfügung. Bestellungen: www.verlagzkm.ch, Tel. 052 364 18 00 Preis: Fr. 49.–
Berufsbildung
Foto: André Albrecht, aus «Handwerk 1/14»
Swiss Skills
Diverse Berufe sind dieses Jahr zum ersten Mal dabei Zum ersten Mal finden dieses Jahr die Swiss Skills nicht als dezentrale Austragungen der Branchen, sondern als nationaler Grossanlass in Bern statt. Auf dem Bern-Expo-Gelände treffen sich vom 18. bis 21. September 2014 die besten jungen Berufsleute aus Handwerk, Industrie und Dienst leistung. In rund 70 Berufen werden sie gegeneinander antreten und um den Titel des Schweizer Meisters oder der Schweizer Meisterin kämpfen. Einige Berufe nehmen zum ersten Mal an einer Berufsmeisterschaft teil, etwa die Landwirte oder die Fachan gestellten Gesundheit (FaGe). Insge samt werden an die 1000 Wettkämpfe rinnen und Wettkämpfer erwartet. Ebenso wichtig wie die Wett kämpfe sind die Berufsschauen von rund 130 Berufen. Eine Sonderschau ist dabei den Kleinstberufen gewidmet: Hufschmiede, Küfer, Instrumenten bauer, Holzbildhauer, Seilbahnmecha troniker, Korb- und Flechtwerkgestal ter und viele mehr werden sich hier präsentieren. Eine zweite Sonderschau hat die höhere Berufsbildung und die Weiterbildung zum Thema. [red] ∑
www.swissskillsbern2014.ch
Zukunftstagung
Die Berufsmaturität soll gestärkt werden 87 Prozent der jungen Erwachsenen mit einer Berufsmaturität meistern ihr erstes Jahr an einer Fachhochschule erfolgreich. Dies hat eine vor Kurzem veröffentlichte Studie, die von der Schweizerischen BerufsbildungsämterKonferenz (SBBK) in Auftrag gegeben worden ist, ergeben. Doch die Zahl der Lernenden, die sich während der be ruflichen Grundbildung auf die Be rufsmaturität vorbereiten, stagniert, in einigen Berufen ist sie gar rückläufig. Um Wege zu finden, wie man hier Ge gensteuer geben und die Berufsmatu rität stärken könnte, lud das Mittel schul- und Berufsbildungsamt im Juni rund 100 Fachpersonen aus Bildung, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie Berufsmaturanden und Eltern organisationen zur Zukunftstagung Berufsmaturität nach Winterthur ein.
Stellen sich an den Swiss Skills vor: Korbflechterinnen und -flechter.
«Die Berufsmaturität muss be kannter werden», waren sich die Teil nehmenden einig. In mehreren Work shops erarbeiteten sie Vorschläge, wie dies gelingen könnte – etwa mit einer Kommunikationskampagne, flexible ren Ausbildungsmodellen (Einstieg in den Berufsmaturitätsunterricht erst im zweiten Lehrjahr) oder organisato rischen Anpassungen (mehr schuli sche Zeitblöcke statt ganze Schultage). Das Mittelschul- und Berufsbil dungsamt entwickelt nun mit verschie denen Anspruchsgruppen aus all die sen Ideen Massnahmen, die an der Ergebnisveranstaltung am 30. Okto ber 2014 präsentiert werden. [red]
Berufsbildungsfonds
Lehrbetriebe konnten entlastet werden 19,8 Millionen Franken aus dem Be rufsbildungsfonds konnten im Jahr 2013 an die Lehrbetriebe im Kanton Zürich ausgeschüttet werden. Umge kehrt wurden von rund 13 000 Arbeit gebern 18,6 Millionen in den Fonds einbezahlt. Unterstützt wurden 2013 insbesondere die überbetrieblichen Kurse mit 14,4 Millionen und die zent ral durchgeführten Qualifikationsver fahren mit 2,6 Millionen Franken. Für insgesamt 1 Million wurden ausser dem Kurse für Berufsbildnerinnen
und Berufsbildner finanziert. Ab 2013 soll zudem ein Kostenanteil in der Höhe von 400 Franken pro Lehrling vom Fonds übernommen werden, wenn das Qualifikationsverfahren im eigenen Betrieb stattfindet. [red] ∑
www.berufsbildungsfonds.zh.ch
Personelles
Mutationen in den Schulleitungen der Berufsfachschulen Neue Abteilungsleitende bzw. neue Stellvertretungen Abteilungsleitende: auf Beginn des Schuljahres 2014/2015 • Berufsschule für Gestaltung Zü rich: Jonas Schudel, Berufsschullehr person mbA für berufskundlichen Unterricht, als Abteilungsleiter. Er tritt die Nachfolge von Paul Zübli an, der auf Ende des Schuljahres 2013/2014 von seinem Amt zurückgetreten ist. • Technische Berufsschule Zürich, Abteilung Elektro/Elektronik: Edgar Frei, Berufsschullehrperson mbA für berufskundlichen Unterricht, als Ab teilungsleiter. Er tritt die Nachfolge von Elmar Schwyter an, der auf Beginn des Schuljahres 2014/2015 das Amt als Rektor übernommen hat. • Technische Berufsschule Zü rich, Abteilung Höhere Fachschule: Beat Hartmann, Berufsschullehr person mbA für Informatik, als Ab teilungsleiter. [red] Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 35
Porträt
«Vielleicht habe ich die Gabe von der Ururgrossmutter geerbt» Die 15-jährige Sina Stähli gewinnt mit ihren Comics international renommierte Preise. Text: Niels Walter Foto: Dieter Seeger
Plötzlich all diese Fragen: Wann hast du begonnen zu zeichnen? Weshalb zeich nest du? Woher hast du deine Ideen, dein Talent? Warum dieses traurige Ende? Sina weiss nicht so recht, was sie auf all diese Fragen antworten soll, sie sagt, sie mache sich gar nicht viele Gedanken, «ich zeichne einfach gern, hab schon immer gern gezeichnet». Die Fragen kamen auf, als die Gy mi-Schülerin Sina Stähli aus Hedingen diesen Frühling am Comix-Festival Fumetto in Luzern den Publikums preis des internationalen Wettbewerbs gewann, eines der wichtigsten in Eu ropa, bei dem jedes Jahr über 1000 Kunstschaffende aus aller Welt ihre Werke zu einem Thema einreichen. Dieses Jahr hiess es «Genuss oder Sucht». Sinas Beitrag auf vier A4-Sei ten: Ein Fuchs lässt sein Weibchen und sein Junges im Bau zurück, um in der Stadt nach Nahrung zu suchen. In Hin terhöfen bei Glascontainern verfällt der Fuchs dem Alkohol, schafft es nicht mehr zurück zu seiner hungernden Familie, er stirbt auf der Gasse, seine Familie im Bau. Ein stilles Drama, von einer 15-Jährigen brillant gezeichnet, minimal in Strich und Farbe, ein roter Fuchs in einer grauen Umwelt, darge stellt in gekonnten Bildkompositionen und Perspektiven. Kein anderes Werk hat dem Publikum so gut gefallen. Über Nacht in den Schlagzeilen Sina Stähli war noch 14, als sie diesen Comic zeichnete und Anfang Januar dieses Jahres für den Wettbewerb ein reichte. Im April hatte die Familie gar keine Zeit, das Comic-Festival zu be suchen. Als dann am Abend vor der Preisverleihung das Telefon klingelte und der Mutter mitgeteilt wurde, ihre Tochter habe den Preis gewonnen, fuhren die Stählis am letzten Festival tag doch noch nach Luzern. Sina er hielt ein Preisgeld von 500 Franken. In den Tagen darauf kamen die Jour 36 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
nalisten mit ihren Fragen, dann die Schlagzeilen: «15 Jahre und schon ein Comic-Star», «15-Jährige überzeugt an Comic-Festival», «La jeune Sina Stähli a séduit les bédéphiles» (Die junge Sina Stähli hat die Comic-Liebhaber verführt). Als wäre ein neuer Stern aus dem Nichts aufgetaucht. Dabei: Sina hat dieses Jahr bereits zum vierten Mal am Wettbewerb teilgenommen, und es ist auch nicht ihr erster Preis. Das erste Mal dabei war sie, als sie zehn Jahre alt war. Ihre damalige Primarlehrerin hatte sie auf das Festival aufmerksam gemacht und dazu animiert, teilzuneh men. Schon beim zweiten Mal hatte ihr die internationale Jury den ersten Preis ihrer Alterskategorie verliehen. Dieses Jahr liess Sina erstmals alle Grossen hinter sich. «Eher unlogische Geschichte» Sinas Comic war mit den 50 anderen nominierten Werken ausgestellt. Die Mittelschülerin versteht bis heute «nicht so recht», weshalb ihre «doch eher unlogische und einfache» Ge schichte am besten angekommen ist. Ihre Mutter, Susanne Stähli, sagt, die Geschichte mit dem Fuchs und die Farbigkeit hätten sich von den ande ren ausgestellten Beiträgen abgeho ben. Viele erzählten Geschichten von Menschen und ihrer Sucht nach illega len Drogen. Solche Bilder gingen Sina zuerst auch durch den Kopf. Doch sie dachte: «Das machen wahrscheinlich viele, ich muss mir etwas anderes aus denken.» Sie suchte wochenlang wei ter – und fand in ihrer eigenen, klei nen heilen Welt zu ihrer traurigen Geschichte. Die Familie Stähli wohnt idyllisch gelegen in einem umgebauten Bauernhaus und Stall auf einer An höhe ausserhalb des Dorfes, rundum grüne Wiesen und Wald. Sina hat da schon oft Füchse beobachtet. Als sie ihre Geschichte im Kopf hatte, unterteilte Sina die vier weissen
Blatt Papier in verschieden grosse Fel der mit diversen Formaten, auf an deren Notizblättern skizzierte sie und schrieb die wenigen Worte auf, mit denen sie ihre Bilder ergänzen wollte. Erst dann, zehn Tage vor Einsende schluss, zeichnete und kolorierte sie ihren Comic. Sina kann nicht sagen, weshalb sie etwas so oder so mache und wie sie zu ihren Motiven und Figu ren finde, die sie auf A4-Blätter und allerlei Sudelpapier zeichnet und die zuhause Kartonschachteln füllen. «Ich mache einfach. Alles entsteht irgend wie.» Wenn ihre Mutter sagt, Sina zeichne am besten, wenn sie wütend auf ihre Eltern sei, schweigt die Toch ter und verdreht kurz die Augen. Der Zeichenlehrer weiss von nichts Ihre Zeichnungen fertigt sie im Stil len für sich alleine an einem kleinen Pult in ihrem Zimmer. Tipps bekomme sie von niemandem, Comics lese sie selten, früher hie und da «Donald Duck», in der Schulbibliothek habe sie einmal ein Manga ausgeliehen. Ihre Eltern haben «gar nichts am Hut mit Zeichnen». Sina sagt: «Vielleicht habe ich die Gabe von der Ururgrossmutter geerbt.» Die habe «so klassische Bil der» gemalt, Landschaften, See mit Se gelschiff. Wenn es ums Zeichnen geht, kommt Sina ohne viele Worte aus. Im Gymnasium in Urdorf, wo sie das mu sische Profil absolviert, hat sie nicht einmal ihrem Zeichenlehrer von die sem bedeutenden Preis erzählt – je nem Lehrer, der ihre erste Arbeit mit einer 4,5 benotet hatte. Das hatte die junge talentierte Zeichnerin etwas ver stimmt. Inzwischen steht im Zeugnis bei «Zeichnen» eine 5,5. Damit sei sie zufrieden, sagt sie und fügt an: «Wahr scheinlich mache ich beim nächsten Wettbewerb wieder mit, und vielleicht möchte ich in Zukunft einmal Grafi kerin werden.» !
Porträt
Sina Stähli: «Ich mache einfach. Alles entsteht irgendwie.» Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 37
Foto: ZFF
Schule und Kultur
«Bilder einer anderen Welt» «ZFF für Schüler» zeigt Filme jenseits des Mainstreams Zum mittlerweile dritten Mal ist am Zurich Film Festival 2014 ein sorgsam kuratiertes Kinder- und Jugendfilm-Programm zu sehen. Darunter sind Filme für die Primar- wie auch für die Sekundarstufe. Das ZFF hat die Filme in Zusammenarbeit mit schule&kultur ausgewählt. In einem zunehmend von Mainstreamfilmen dominierten Kinoprogramm für Kinder und Jugendliche gibt «ZFF für Schüler» den Jungen die Gelegenheit, eine andere, anspruchsvollere Filmkultur für sich zu entdecken. Auf dem Programm stehen Werke aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen, die normalerweise im Kino nicht zu sehen sind. Zugleich schafft das Schülerprogramm einen Rahmen, die Wirkung von Bildern bewusst wahrzunehmen und die Eindrücke in einer Diskussion mit den Filmemachern, den Mitschülerinnen und -schülern und der Lehr
schule&kultur: Kulturangebot für Schulen schule&kultur, Walchestrasse 21, 8090 Zürich, Tel. 043 259 53 52, www.schuleundkultur.zh.ch 38 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
person zu verarbeiten. Das fördert die Medienkompetenz und ermöglicht den Lehrpersonen, gesellschaftlich rele vante Themen auf eine andere Weise in den Unterricht einzubinden. Die Kinderfilme für die Primarstufe werden im Original gezeigt und parallel live vor Ort auf Deutsch eingesprochen – ein mittlerweile bewährtes Konzept und für die Kinder ein einmaliges Erlebnis. Für die Sekundarstufe werden entweder deutschsprachige Filme gezeigt oder fremdsprachige Filme mit deutschen Untertiteln angeboten. Wenn immer möglich sind Filmemacher/innen während der Vorführungen anwesend und die Schulklassen können nach dem Abspann direkt mit den Fimschaffenden diskutieren. Das komplette Programm (ab Freitag, 22. August) sowie pädagogisches Material zur Vor- und Nachbereitung im Unterricht (ab Montag, 15. September) stehen auf der Website des Festivals zur Verfügung. www.zff.com Weitere Informationen und Anmeldung: www.schuleundkultur.zh.ch
∑
Schule und Kultur
Kunst und Wissen
[1] Hand statt Pinsel Malen versteht sich als kreative Aktion, in welcher Farbe gespritzt, geschüttet oder gespachtelt wird. Kleider, Objekte oder Möbel werden zu Bildträgern und zu raumfüllenden Installationen. Im Workshop bemalen wir mitgebrachte T-Shirts experimentell mit Textilfarbe.
7
Migros Museum für Gegenwartskunst / Kindergarten bis 10. Schuljahr / September bis November
∑
[2] Eiszapfen, Roxy und Feurio! Alles Gemüse oder was? Gemüse ist mehr als Rüebli und Gurken! Auf einem Rätsel parcours entdecken die Schüler/innen einen Hofgarten mitten in der Stadt. In der Ausstellung erfahren sie mehr rund um den Gemüsegarten. Und dann darf gegessen werden … ∑
Mühlerama / 3.– 6. Schuljahr / September bis Oktober
3
[3] Fashion Talks High Heels oder Flip-Flops? Bevor wir etwas sagen, hat unsere Kleidung bereits über uns ge sprochen. Mode ist in oder out, sie schafft Zugehörigkeit und grenzt aus. Die Ausstellung zeigt, wie Codes und Trends entstehen, und durchleuchtet das raffinierte System «Mode». Nach der dialogischen Führung entwickeln wir mit Kleidern und Accessoires unseren eigenen Style.
1
2
Gewerbemuseum Winterthur / 7.–10. Schuljahr / Dezember bis Januar
∑
Theater
[4] Sigg Sagg Sugg – und du wählsch us! Ein Forumtheater zu Berufswahl und Rollenbildern In der Stadt hört das Publikum über Kopfhörer Einspielungen und trifft auf live gespielte Szenen zu den Themen Beruf und Lebensentwürfe. Im Forumtheater setzen sich dann die Jugendlichen spielerisch mit ihren Vorstellungen über Männer und Frauen auseinander.
4
Vorbereitung für den Zukunftstag / 11. und 12. November / 7.–10. Schuljahr, Kantons- und Berufsschulen
∑
[5] Rosas Schuh Wie war das damals mit Rosa? Was ver bindet David mit seinem Freund Peter? Hätte er die Strasse wechseln sollen, als er Jule wiedersah? – Eine raffinierte, berührende und auch witzige Produktion über eine un erwiderte Jugendliebe. Schauspielhaus Schiffbau / ab 20. Oktober / 7.– 10. Schuljahr, Kantons- und Berufsschulen
∑
[6] Rock’n’Revolt In ihrem letzten Teil der Trilogie «Sex, Drugs and Rock’n’Roll» widmet sich die Zürcher Theatergruppe Kolypan nach Aufklärungsmission in Sachen Liebe («Pussy’n’Pimmel»), nach tiefem Einblick in die Welt der Süchte («Joints’n’Chips) nun dem Musikbusiness zu und der Frage – wie der Rock ins Rollen kam. Fabriktheater / Donnerstag, 30. Oktober / 7.–10. Schuljahr, antons- und Berufsschulen K
∑
6
5
[7] Piggeldy und Frederick Das kleine Schwein Piggeldy hat viele Fragen. Das grosse Schwein Frederick hat viele Antworten – diese Kombination macht aus den beiden rosa Tieren das perfekte Bruderpaar –, philosophierend gehen sie durch die Welt. Theater Stadelhofen / Montag, 3. November / Kindergarten, 1.– 2. Schuljahr
∑
Information und Anmeldung: www.schuleundkultur.zh.ch Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 39
Termine
Hinweise auf Veranstaltungen Chancen und Risiken einer Früheinschulung Das Referat von Sandra Beriger, Entwicklungspsychologin, IF- und Unterstufenleh rerin, beleuchtet Fragen wie: Welche Konsequenzen hat eine Früh einschulung für die Entwicklung eines Kindes und für seine weitere Schullaufbahn? Welche Vor- und Nachteile erwachsen einem Kind, das zu den jüngsten in einer Jahrgangsklasse gehört? Das Referat vermittelt stichhaltige Argumente, um Eltern umfassend beraten zu können. Im zweiten Teil präsentiert die Referentin zudem verschie denes Material aus der Praxis für die Praxis. Die Teilnehmenden erhalten ein Dossier zum Thema. Donnerstag, 30. Oktober 2014, 19.30 Uhr, Aula Bildungszentrum für Erwachsene (BiZE), Riesbachstrasse 11, Zürich. Eintritt: 20 Franken. www.zal.ch > Aktuell > Events > Referat Sandra Beriger
Austauschkongress 2014: Rendez-vous im Jura Der Austauschkongress vom 20. und 21. November 2014 in Delémont legt den Fokus auf das Thema «la richesse par la diversité». Er gilt als Treffpunkt für austauschinteressierte Lehrpersonen aller Stufen, für Schulleitungen, Fachleute aus den Bildungsverwaltungen und generell Bildungsinteressierte. Die Teilnehmenden erwartet ein attraktives Programm mit zahlreichen Ateliers, Praxisbeispielen, interaktiven Sequenzen sowie einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Anmeldeschluss: 11. Oktober 2014. Die Teilnahme ist kostenlos. Reise und Unterkunft gehen zu Lasten der Teilnehmenden. Kontakt und Information: ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, Franziska Müller, info@chstiftung.ch, Tel. 032 346 18 00, www.ch-go.ch > Über GO > Veranstaltungen
Berufsmesse Zürich: Rollenbilder umkrempeln Der Fachmann Betreuung und die Elektroninstallateurin – in der Schweiz noch immer eine Seltenheit. Nur gerade drei Prozent der Jugendlichen lernen einen Beruf, in dem ihr Geschlecht untervertreten ist. Mit dem Slogan «Dem Beruf ist dein Geschlecht egal!» und diversen Veranstaltungen rund um dieses Thema möchte die Berufsmesse Zürich Schülerinnen und Schüler ermuntern, auch in geschlechtsuntypischen Berufen zu schnuppern. An der Berufsmesse Zürich, die dieses Jahr zum zehnten Mal stattfindet, werden über 500 Lehrberufe, Ausbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten präsentiert. 18. bis 22. November 2014, Messe Zürich. www.berufsmessezuerich.ch
Internationale Kurzfilmtage Winterthur Die Veranstalter der internationalen Kurzfilmtage Winterthur engagieren sich unter anderem für die Vermittlung des Kurzfilms an Jugendliche und bieten Weiterbildungskurse für Lehrpersonen und Jugendarbeitende an. Das Angebot des diesjährigen Festivals bietet die Möglichkeit, den Kurzfilm auf diverse Arten kennenzulernen. Dazu gehören ein Expertenbesuch im Unterricht, ein Festivalbesuch mit Jugendprogramm, der Einsatz in einer Jugendjury sowie eine Lehrerweiterbildung am Festival. 4. bis 9. November 2014. Um rasche Anmeldung online wird gebeten. www.kurzfilmtage.ch
unvorherSehbar – Erdbeben in der Schweiz Sonderausstellung des Schweizerischen Erdbebendienstes anlässlich seines 100-jäh rigen Bestehens. Erdbeben lassen sich gegenwärtig nicht vorher sagen. Gute Kenntnisse haben wir jedoch darüber, wo, weshalb und wie häufig sie auftreten. Die Ausstellung vermittelt ein Bild der vielseitigen Tätigkeiten des Schweizerischen Erdbebendienstes rund um die Naturgefahr mit dem grössten Schadenspotenzial der Schweiz. Vom 6. September bis 30. November 2014 im Museum Focus Terra an der ETH Zürich. Führungen für Schulklassen und Gruppen zum Thema Erdbeben inklusive Besuch des Erdbeben simulators können jederzeit gebucht werden. Erdbeben-Workshop für Lehrpersonen inklusive Einführung in die Ausstellung: 10. September, 14 bis 17 Uhr, kostenfrei. Anmeldung per E-Mail: info_focusterra@erdw.ethz.ch. www.focusTerra.ethz.ch Sonderausstellungen im Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf Das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf befasst sich mit der zeitgenössischen hu manitären Arbeit und beleuchtet diese anhand der geschichtlichen Entwicklung. Es gibt zahlreiche Angebote und Führungen speziell für Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 8 und 20 Jahren – aktuell etwa zum Ersten Weltkrieg oder zum humanitären Völkerrecht. Bis 4. Januar 2015 läuft die Sonderausstellung über Kunstschaffende des 20. und 21. Jahrhunderts im Angesicht des Leidens; ab April 2015 eine Ausstellung über Gandhi und die Gewaltlosigkeit. Weitere Informationen: Marie-Dominique De Preter, Museums pädagogik, md.depreter@redcrossmuseum.ch, Tel. 022 748 95 02. www.redcrossmuseum.ch > de > Schulen/Lehrer Fashion Talks – Mode und Kommunikation High Heels oder FlipFlops? Chinos oder Trainerhose? Mit der Überlegung «Was ziehe ich heute an?» stellen wir uns auch täglich die Frage: «Wer möchte ich sein?» Denn noch bevor wir etwas sagen, hat unsere Kleidung bereits über uns gesprochen. Mode ist in oder out, sie schafft Zugehörigkeit und grenzt aus. Angeregt durch Ausstellungsteile wie «DIY – Do it yourself!», «Lass dich inspirieren!» oder «Sei du selbst!» reflektieren die Schülerinnen und Schüler in den Workshops ihren individuellen Style oder auch die Marktmechanismen, in denen sie sich bewegen. Im Angebot sind altersgerechte Workshops ab Unterstufe bis Sekundarstufe sowie Begleitmaterialien für den selbstständigen Besuch mit der Klasse. www.gewerbemuseum.ch/ Museumspädagogik
40 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Lern- und Mathematik-Atelier Samstag, 20. September 2014, oder Samstag, 29. November 2014: «Sprachförderung im Kindergarten». Umfassende Einführung in die Theorie und Praxis der Sprachförderung im Kindergarten. Dazu gehören die Förderbereiche Phonologische Bewusstheit, Grammatik, Lautbildung, Wortschatz und weitere. Der Kurs zeigt auf, wie die Förderung mit der ganzen Klasse, in Kleingruppen und einzelnen Kindern aussehen kann. Samstag, 1. November 2014: «Jahresplanung Mathematische Förderung im Kindergarten». Umfassende Einführung in die Theorie und Praxis der mathematischen Förderung im Kindergarten. Dazu gehören die Förderbereiche Zählen, Mengen, Formen, Muster, Zeit und Messen. Der Kurs stellt Vorschläge für altersdurchmischtes Lernen mit der ganzen Klasse und eine Jahresplanung für Kinder im 2. Kindergartenjahr vor. Er zeigt auf, wie die Förderung mit der ganzen Klasse, in Kleingruppen und einzelnen Kindern aus sehen kann. www.lerntherapie-zh.ch «Ungewohnte Wege gehen» – Fachtagung Bildungslandschaften Schweiz In jeder Bildungslandschaft müssen alle beteiligten Ak teure in der Praxis flexibel und bereit sein, ungewohnte Wege zu begehen, um ans Ziel zu kommen. «Ungewohnte Wege gehen» zieht sich denn auch als roter Faden durch die Tagung der Jacobs Foundation. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, welche unter schiedlichen Lernmotivationen es gibt, welche wichtige und oftmals verkannte Rolle Emotionen beim Lernen spielen, was es mit dem Lernen im Schlaf auf sich hat und was Bildung für «schwierige» Jugendliche bedeutet. Die Referate werden in einer der Landessprachen gehalten und simultan auf Deutsch, Französisch und allenfalls Italienisch übersetzt. Anregungen, Ideen und Fragen, die Sie uns bei der Anmeldung mitteilen, fliessen direkt in die Tagung ein. Freitag, 12. September 2014, 9.30 bis 17 Uhr, Hotel Marriott in Zürich. http://bildungslandschaften.ch/fachtagung
Gerne nimmt die Schulblatt-Redaktion Veranstaltungs hinweise als Word-Datei entgegen auf schulblatt@bi.zh.ch, behält sich aber Auswahl und Kürzung der Texte vor. Die Tipps sollen max. 800 Zeichen (inkl. Leerschlägen) umfassen. Wichtige Angaben: Was, wann, wo, für wen, zu welchen Kosten. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der Tipps.
∑
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 41
IHR SCHULFOTO-SPEZIALIST Seit mehr als 40 Jahren zeichnen wir uns aus durch hochwertige Qualität und zuverlässigen Service.
Die Creative Foto AG fotografiert Kinder, kleine und grosse, mit Spass und Können und das seit über 40 Jahren! Vereinbaren sie heute noch einen Termin mit der CREATIVE FOTO AG und profitieren sie als Lehrperson oder Schulleitung von unseren einmaligen und attraktiven Angeboten: • Für alle Schulkinder ist das Klassenfoto garantiert gratis • Die Lehrperson erhält ihr gesamtes Set kostenlos • Sie erhalten weitere Geschenke wie ein 18x24 von ihrem Klassenbild, eine Postkarte oder ein Memory • Für ganze Schulhäuser oder Schulgemeinden erstellen wir Schulhausposter im Format 1.6 m x 2.0 m • Lehrpersonen und Schulleitungen erhalten kostenlos die digitalen Daten der Klassenfotos • Rabatte auf die Setpreise gibt es ab 100 Schülerinnen und Schüler • Abholservice der nicht verkauften Fotos Mülacher 12
6024 Hildisrieden
Tel 041 288 85 10
Fax 041 288 85 29
info@creative-foto.ch
www.creative-foto.ch
Weiterbildung
Kreativität, Kooperation und Kompetenzen Wie kann die Schule mit der rasanten Entwicklung der digitalen Medien Schritt halten? Und gibt es kreative didaktische Konzepte? Um solche Fragen dreht sich die Jahrestagung «Unterrichten mit neuen Medien» an der PH Zürich. Text: Thomas Stierli, Peter Suter, Bereich Medienbildung, PH Zürich
Ideen, Erfahrungen und Tipps für den Unterricht mit neuen Medien – das sind die Eckpfeiler, auf denen die jährliche Tagung des Bereichs Medienbildung der PH Zürich aufgebaut ist. Seit nun mehr 16 Jahren treffen sich jeweils kurz nach den Herbstferien über 200 inter essierte Lehrpersonen, Schulleitende und Fachleute, um sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich Schule und neue Medien zu informieren, neue Im pulse zu erhalten, Ideen auszuprobieren und sich miteinander über gemachte Erfahrungen auszutauschen. Ihrer Struktur ist sich die Jahres tagung «Unterrichten mit neuen Me dien» (UNM) in den vergangenen Jah ren weitgehend treu geblieben. Ne ben interessanten Plenumsreferaten von etablierten Referenten aus dem deutsch sprachigen Raum können die Tagungsbesucherinnen und -besucher aus rund 20 Parallelveranstaltungen für verschiedene Stufen ihr indivi duelles Tagesprogramm auswählen. In den Workshops werden die Teilneh menden selbst aktiv, in den Sessions erhalten sie Informationen über er folgreiche Unterrichtskonzepte und konkrete Umsetzungsideen. Beim Mit tagessen, in den Pausen und beim ab schliessenden Apéro bieten sich zudem viele Gelegenheiten zum informellen Austausch mit andern Tagungsteilneh menden. Facettenreiche Medienbildung Die Kombination von Schule und digi talen Medien hat zahlreiche Facetten. Einige von ihnen wurden an früheren
UNM-Tagungen ins Zentrum gerückt und näher beleuchtet, zuletzt beispiels weise das Thema «Medien – Körper – Virtualität». Auch die diesjährige Aus gabe widmet sich einem spannenden und aktuellen Begriffstrio: kommu nikative, kreative und kooperative Mediennutzungsformen. Von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen quasi selbstverständlich praktiziert, werden diese Aspekte des Medienhan delns automatisch auch in die Schule getragen und eröffnen dort sowohl Chancen wie auch Herausforderun gen. Und gleichzeitig generiert der technische Fortschritt laufend neue Nutzungsformen, welche es ebenfalls zu beobachten und allenfalls für schu lische Zwecke zu nutzen gilt. In diesem dynamischen Umfeld müssen die Schülerinnen und Schüler die richtigen Kompetenzen erwerben, um sich in ihrem zukünftigen berufli chen, kulturellen und sozialen Leben erfolgreich bewegen zu können. Diese Kompetenzen zu bestimmen und zu vermitteln stellt eine anhaltende He rausforderung für Schulen und Lehr personen dar. Das Ziel der aktuellen UNM-Tagung ist es, die schulischen Akteure in dieser wichtigen und an spruchsvollen Aufgabe zu unterstützen. Die zentralen Fragen der kommen den Tagung lauten deshalb: Wie kann und soll die Schule auf den rasanten technischen Fortschritt reagieren? Gibt es kreative didaktische Konzepte als Antwort auf den schnellen Wandel? Wie können Kooperation und Kreativität in der Schule mit digitalen Medien ge
fördert werden? Welche Kompetenzen müssen Kinder und Jugendliche heute erwerben, um morgen sowohl das be rufliche als auch das private Leben er folgreich meistern zu können? Mögliche Antworten geben Me dienfachleute und Lehrpersonen an hand konkreter kreativer Projekte wie «Bluescreen-Technik in der Primar schule», «Vom Interview mit Senioren zum multimedialen Buch», «3D-Dru cken in der Schule», «Das iPad im Kin dergartenalltag», «Radio im Klassen zimmer», «Roboter als Mittler zwischen Kinderspital und Schulklasse», «Mine craft für die Schule» und vielen mehr. Die Tagung richtet sich an Lehr personen aller Schulstufen – vom Kin dergarten bis zur Berufs- und Mittel schule – sowie an Schulleitende und interessierte Fachleute. Veranstaltungs ort ist der Campus der Pädagogischen Hochschule Zürich. Lehrkräfte der Volksschule des Kantons Zürich be zahlen einen ermässigten Tagungs beitrag. !
«Kreativität, Kooperation und Kompetenzen», 16. Tagung «Unterrichten mit neuen Medien», Samstag, 25. Oktober 2014, 9 bis 16 Uhr, an der Pädagogischen Hochschule Zürich
∑
∑
www.phzh.ch/unm
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 43
Weiterbildung
Weiterbildungsangebote
Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt
Weiterbildungen für Schulleitungen und Schulbehörden
Schulungs- und Weiterbildungsangebot für Zürcher Schulbehörden und Schulleitungen
B14303.01 Umgang mit schwierigen Personalsituationen Peter Kubli / 13.11.2014, 17.00–19.00
Einführungskurse für neue Mitglieder von Schulbehörden
B15302.01 VZE und Stellenplanung Matthias Weisenhorn / 13.1.2015, 17.00–19.00
B14101.17 Grundlagen Peter Altherr, Martin Stürm / 1./2.10.2014, 8.30–17.00
B15302.02 VZE und Stellenplanung Matthias Weisenhorn / 14.1.2015, 17.00–19.00
B14101.18 Grundlagen Regina Meister, Martin Kull / 10./11.11.2014, 8.30–17.00
Detailausschreibungen, weitere Kurse und Anmeldung: www.vsa.zh.ch > Ausbildung & Weiterbildung > Behörden > Programm der Behörden- und Schulleitungsschulung Information: Bildungsdirektion/Volksschulamt, Behörden- und Schulleitungsschulung, Walchestrasse 21, 8090 Zürich / behoerdenschulung@vsa.zh.ch / 043 259 22 58
B14201.09 Einführung in die MAB Michael Brugger, Peter Toller / 14./15.11.2014, 8.30–17.00 B14201.10 Einführung in die MAB Regine Schuler, Jürg Freudiger / 21./22.11.2014, 8.30–17.00 Vertiefungsangebote für neue Mitglieder von Schulbehörden B14701.01 Schulfinanzen Markus Wagner, Peter Altherr / 14.11.2014, 8.30–17.00 B14701.02 Schulfinanzen Markus Wagner, Peter Altherr / 17.11.2014, 8.30–17.00 B14801.01 Sonderpädagogik I Philippe Dietiker / 24.11.2014, 8.30–17.00 B14801.02 Sonderpädagogik I Philippe Dietiker / 1.12.2014, 8.30–17.00 B15802.01 Sonderpädagogik II Philippe Dietiker / 19.1.2015, 8.30–17.00 B15802.02 Sonderpädagogik II Philippe Dietiker / 26.1.2015, 8.30–17.00 B14401.01 Kommunikation Martin Stürm, Roly Brunner / 5.12.2014, 8.30–17.00
B14301.01 Kranke Lehrperson – was tun? Eva Bachmann, Mariette Berchtold / 11.11.2014, 17.00–19.00
PH Zürich ∑
www.phzh.ch/weiterbildung
Weiterbildungsangebote für Schulleitende Certificate of Advanced Studies (CAS) CAS FBO 24 Führen einer Bildungsorganisation* Leitung: Johannes Breitschaft, Eliane Bernet / Februar 2015 bis Oktober 2016 CAS PER 06 Personalentwicklung Leitung: Cornelia Knoch / Start 17.11.2015 / Aufnahmegespräche 10.9., 26.11.2014 / 16.00–17.00 Information und Anmeldung: www.phzh.ch/cas / 043 305 54 00
B15401.01 Kommunikation Martin Stürm, Roly Brunner / 16.1.2015, 8.30–17.00
*Amtierende oder designierte Schulleitende der Zürcher Volksschulen können durch das VSA finanziell unterstützt werden. Information und Anmeldung: www.vsa.zh.ch > Ausbildung & Weiterbildung > Schulleitungen
B15305.01 Personaleinsatz – Personalführung Peter Kubli, Andrea Zolliker / 9.1.2015, 8.30–17.00
Master of Advanced Studies (MAS)
B15305.02 Personaleinsatz – Personalführung Peter Kubli, Andrea Zolliker / 12.1.2015, 8.30–17.00
44 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Sie absolvieren drei CAS-Lehrgänge (nach spezifischem Profil) und führen das Ganze im Diplomstudium zu Ihrem MAS-Abschluss zusammen. MAS-Infoveranstaltung 23.9.2014. Information und Anmeldung: www.phzh.ch/mas
Weiterbildung
QUIMS: Fokus A – Schreiben auf allen Schulstufen
Think-Tank Personalentwicklung
QUIMS-Schulen, die sich für dieses Angebot entscheiden, werden während zweier Jahre bei der Weiterentwicklung ihrer Schreibförderung begleitet. Information und Anmeldung: www.phzh.ch/schilw
Sie möchten aktuelle und künftige Fragen zur Personalentwicklung klären? Wünschen Sie sich einen Erfahrungsaustausch? Möchten Sie mit Ihren Verantwortlichen Sichtweisen austauschen und gemeinsame Richtlinien festlegen? Wir unterstützen Sie auf diesem Weg mit einem Angebot, das wir gemeinsam mit Ihnen definieren. Information und Anmeldung: www.phzh.ch/schilw
Schulinterne Weiterbildung (SCHILW) www.phzh.ch/schilw / wba@phzh.ch / 043 305 68 68 Kurse / Themenreihen
Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung/EMU
3014T06.01 Schulrecht; Anstellungsrecht der Lehrpersonen Hans Frehner / Mo, 27.10.2014, 18.00–20.30
Voraussetzung für erfolgreiche Massnahmen der Unterrichts entwicklung sind die Diagnosen der Lernvoraussetzungen und des jeweiligen Leistungsstandes der Schülerinnen und Schüler sowie die Reflexion des eigenen Unterrichts. Dafür eignet sich u. a. EMU nach Helmke. Wir unterstützen und beraten Sie bei Fragen, die sich mit der Nutzung von EMU ergeben, und begleiten Ihre Schule bei der Unterrichtsentwicklung im Sinne Ihres Schulprogrammes. Information und Anmeldung: www.phzh.ch/schilw
3014T07.01 Schulrecht; Sonderpädagogische Massnahmen Hans Frehner / Mo, 10.11.2014, 18.00–20.30
QUIMS: Fokus A – Schreiben auf allen Schulstufen
3014T08.01 Schulrecht; Schullaufbahnentscheide und deren Verfahren Hans Frehner / Mo, 24.11.2014, 18.00–20.30
QUIMS-Schulen, die sich für dieses Angebot entscheiden, werden während zweier Jahre bei der Weiterentwicklung ihrer Schreibförderung begleitet. Information und Anmeldung: www.phzh.ch/schilw
351405.01 Sich selbst und andere besser verstehen Johannes Breitschaft / Mi, 22.10.2014, 8.30–17.00 3514G05.01 Integrative Schule gestalten; Beurteilen im integrativen Unterricht Peter Diezi-Duplain / Mi, 5.11.2014, 13.30–17.00
Information: 043 305 51 00 Anmeldung: www.kurse.phzh.ch / weiterbildungskurse@phzh.ch Module WM FFS.2014 Finanzielle Führung einer Schule Leitung: Andreas Bergmann, Daniel Brodmann / Do–Sa, 30./31.10./1.11.2014 WM LMC.2014 Qualität leben Leitung: Daniel Brodmann / Do–Sa, 11./12./13.12.2014 Information und Anmeldung: www.phzh.ch/weiterbildungsmodule / 043 305 52 00 «Talk-Business» mit Dr. Alex Rübel, Zoodirektor des Zoo Zürich Dr. Alex Rübel ist Tiermediziner und seit 1991 Zoodirektor des Zoo Zürich. Als Kulturinstitut versteht sich der Zoo Zürich mit etwa 375 Tierarten aus sechs Kontinenten heute insbesondere als Naturschutzzentrum. Dieser Anspruch ist komplex und stellt die Leitung des Zoos vor ethische Herausforderungen. Was beinhaltet eigentlich Führung zwischen Mensch und Tier? 1.10.2014, 18.00–19.30. Information und Anmeldung: www.kurse.phzh.ch > Angebot für Schulleitende UNM-Tagung «Kreativität, Kooperation und Kompetenzen» Wir nutzen im Alltag digitale Medien kommunikativ, kooperativ und kreativ. Gleichzeitig generiert der technische Fortschritt laufend neue Nutzungsformen. Schülerinnen und Schüler müssen die richtigen Kompetenzen erwerben, um sich in ihrem zukünftigen beruflichen, kulturellen und sozialen Leben bewegen zu können. 25.10.2014. Information und Anmeldung: http://unm.phzh.ch
Schulinterne Weiterbildung (SCHILW) www.phzh.ch/schilw / wba@phzh.ch / 043 305 68 68
Weiterbildungsangebote Certificate of Advanced Studies (CAS) CAS FBO 24 Führen einer Bildungsorganisation Leitung: Johannes Breitschaft, Eliane Bernet / Februar 2015 bis Oktober 2016 CAS PER 06 Personalentwicklung Leitung: Cornelia Knoch / Start 17.11.2015 / Aufnahmegespräche 10.9., 26.11.2014 / 16.00–17.00 CAS PICTS 15 CAS Pädagogischer ICT-Support (EDK-anerkannt) / Leitung: Rahel Tschopp, Monika Schraner Küttel (FHNW) / September 2015 bis November 2016 CAS ASP 2013 Ausbildungscoach Schulpraxis Leitung: Kathrin Futter / Einstieg laufend / Infoveranstaltung Zertifikatsarbeit 29.10.2014 Information und Anmeldung: www.phzh.ch/cas / 043 305 54 00 Master of Advanced Studies (MAS) Sie absolvieren drei CAS-Lehrgänge (nach spezifischem Profil) und führen das Ganze im Diplomstudium zu Ihrem MAS-Abschluss zusammen. MAS-Infoveranstaltung 23.9.2014. Information und Anmeldung: www.phzh.ch/mas
Schulforum «Vielfalt, Dynamik, gesellschaftlicher Wandel – was Schulentwicklung antreibt»
Gesundheitsförderung und Prävention im Schulhaus (Volksschule)
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel. Auch Schulen sind betroffen. Wie stellen sich Schulen den vielfältigen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen? Acht öffentliche Schulen berichten von ihren Projekten und Erfahrungen. Hauptvorträge ergänzen das Programm. 13./14.11.2014, Vaduz (FL). Information und Anmeldung: www.phzh.ch/schulforum
Für eine nachhaltige Schulentwicklung ist Gesundheitsförderung von zentraler Bedeutung. Das kantonale Netzwerk Gesundheits fördernder Schulen richtet sich an Schulen, die ihr Engagement in diesem Bereich verstärken wollen. Verbunden mit dem Beitritt zum Netzwerk ist die Verpflichtung zur «Weiterbildung Kontakt lehrperson für Gesundheitsförderung und Prävention» für eine Lehrperson der Schuleinheit. Information und Anmeldung: www.gesunde-schulen-zuerich.ch
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 45
Weiterbildung
Module WM HUD.2014 Heterogenität – mehr als Unterricht und Didaktik Leitung: Petra Hild / Sa, 25.10., 8.11., Mi, 19.11., 3.12.2014 WM PUM.2014 Moderation und Präsentation Leitung: Alain Desarzens / Mi, 29.10., 12.11., 3.12.2014
411412.01 Multimediale Bücher mit dem iPad selbst gemacht* Peter Suter / Mi, 5.11., 19.11.2014, 14.15–17.15 511419.01 Storytelling and Story Creation*/K Käthi Staufer-Zahner / Mi, 5./12./19.11.2014, 14.15–16.45
WM PUV.2014 Projektmanagement und Veränderungsprozesse Leitung: Regina Meister / Mi/Do, 29./30.10., Sa, 13.12.2014
601413.01 Zeitgemässe Tanzformen für Anfänger/innen Elfi Schäfer-Schafroth / Do, 6./13./20./27.11., 4.12.2014, 18.00–19.45
WM PKM.2014 Persönliches Konfliktmanagement im beruflichen und privaten Bereich Leitung: Ernst Huber / Sa, 8.11., Fr/Sa, 21./22.11.2014
601414.01 Zeitgemässe Tanzformen (Aufbaukurs) Elfi Schäfer-Schafroth / Do, 6./13./20./27.11., 4.12.2014, 19.45–21.30
Information und Anmeldung: www.phzh.ch/weiterbildungsmodule / 043 305 52 00
601415.01 Zeichnen – Ausdruck, Abbild, Erfindung Brigitte Stadler Gut / Sa, 8./15./22.11.2014, 8.30–12.00 281417.01 Die Klasse / Das Team lebt und lernt Peter A. Zoller / Sa, 8.11.2014, 8.30–16.30
Kurse * für Berufs- und Wiedereinsteigende gratis K Angebote zu kompetenzorientiertem Unterricht 281411.01 Gewaltfreie Kommunikation Dorothea Vollenweider / Do/Fr, 16./17.10.2014, 9.00–16.00, Mi, 5.11.2014, 15.00–18.00 KindergartenarbeitK
501403.01 Portfolio als Bereicherung der Helen Hanselmann, Christina Schroer / Mi, 22.10., 12.11.2014, 14.15–17.15
411413.01 Update Gamen Peter Suter / Di, 11.11.2014, 19.15–21.15 561406.01 Kleine Pausen mit grossem Effekt Claude Weill / Mi, 12.11.2014, 18.00–21.00 411414.01 Von Schnabelwetzern und OhrenspitzernK Silvie Spiess / Mi, 12./19.11.2014, 13.30–17.00 411415.01 Digital StorytellingK Silvie Spiess / Mi, 12./19.11.2014, 18.00–21.30
511418.01 Hörverständnis fördern und beurteilenK Elisabeth Holinger / Mi, 22.10., 5.11.2014, 14.00–16.45
281418.01 Kompetent und erfolgreich reagieren Ursina Anliker Schranz / Mi, 12./19.11.2014, 14.00–17.00
281412.01 Schlagfertigkeit, Humor und Empathie Alain Desarzens / Mi, 22.10., 5./26.11.2014, 14.00–17.30
411418.01 E.02 Mit der Maus im Kindergarten E / Präsentieren – Veröffentlichen – Kompetenter Auftritt Silvie Spiess / Do, 13.11.2014, 18.00–21.30
851417.01 Gerechtigkeit will geübt sein?/!K Yves Karrer / Mi, 22.10., 19.11.2014, 13.30–17.30 801412.01 Update Sportunterricht 4. bis 6. Klasse René Vuk Rossiter / Do, 23./30.10.2014, 18.15–21.00
141406.01 Resilienz und Resilienzförderung Jürg Frick / Sa, 15.11.2014, 8.30–16.30
281413.01 Was uns Menschen antreibt Jürg Frick / Sa, 25.10.2014, 8.30–16.15
281419.01 Training – Elterngespräche führen Susanna Larcher, Eliane Bernet / Mi, 19.11.2014, 13.30–17.00 / 21.1., 4./25.3.2015, 13.30–17.00
511420.01 Zusammenarbeit von DaZ- und Klassenlehrperson Katja Schlatter Gappisch / Sa, 25.10.2014, 8.30–16.30
281420.01 Schwierige Situationen mit Eltern Brigitte Stirnemann / Mi, 19./26.11.2014, 14.15–17.00
851418.01 Clever konsumieren – richtig recyceln Andreas Brütsch / Sa, 25.10.2014, 8.30–17.00
Information: 043 305 51 00 Anmeldung: www.kurse.phzh.ch / weiterbildungskurse@phzh.ch
121402.01 Geschlechtergerecht unterrichten Dorothea Vollenweider / Sa, 25.10.2014, 9.00–16.00 / Mi, 12.11.2014, 15.00–18.00
Themenreihen
411418.01 D.02 Mit der Maus im Kindergarten D / Kommunizieren – Kooperieren – Gezielt informieren Silvie Spiess / Mo, 27.10.2014, 18.00–21.30 281414.01 Schützen vor Über(be)lastung und Burnout Jürg Frick / Mi, 29.10., 12.11.2014, 14.00–17.30 Geografieunterricht*/K
851420.01 Politische Bildung im Beatrice Bürgler, Monika Reuschenbach / Mi, 29.10.2014, 14.00–17.00
281415.01 Führungskompetenz für Lehrpersonen Ursula Ochsner / Mi, 29.10., 12.11.2014, 14.15–17.30 851419.01 Elektrischer Strom 1:1K Markus Vetterli / Mi, 29.10., 5.11.2014, 13.15–17.00 281416.01 Sitzungen erfolgreich leiten Eliane Bernet, Reto Kuster / Do, 30.10., 27.11.2014, 17.30–20.00 411418.01 C.02 Mit der Maus im Kindergarten C / Unterrichten – Vermitteln – Lernangebote entdecken Silvie Spiess / Di, 4.11.2014, 18.00–21.30 851421.01 Film im Geschichts- und Geografieunterricht Sabina Brändli, Stefan Baumann / Mi, 5.11.2014, 13.30–17.00
46 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Klassenführung 2614K09.01 Bindung und Beziehung als Basis für nachhaltiges Lernen Urs Ruckstuhl / Do, 23.10.2014, 18.00–20.30 2614K10.01 Mit Körper, Sprache und Stimme führen Yaël Herz / Di, 25.11.2014, 18.00–20.30
Ansteckungsgefahr! Good Practice von Zürcher Schulen Gute Beispiele wirken ansteckend. Wir stellen Ihnen Good-PracticeAnsätze von Zürcher Schulen vor, damit Sie Ideen für die Schulund Unterrichtsentwicklung mitnehmen können. Lassen Sie sich inspirieren und anstecken! Tagesschule konkret – informieren, diskutieren, vernetzen Erfahren Sie mehr über den Alltag von (gebundenen) Tagesschulen, tauchen Sie in den Arbeits- und Schulalltag ein. Erfahrene Schul leitende und Mitarbeitende laden Sie ein, die Schulen zu besichtigen. Sie berichten über die Positionierung der Schule, Konzeption der Zusammenarbeit und Gestaltung mit den Eltern. Information: 043 305 51 00 / Anmeldung: www.kurse.phzh.ch / weiterbildungskurse@phzh.ch
Weiterbildung
HSK-Lehrpersonen – Impulse für den Unterricht
Holkurse / schulinterne Weiterbildung
HSK-Lehrpersonen verfügen über einen reichhaltigen Fundus an Unterrichtsmaterialien und -ideen. Unter dem Aspekt der Zweitund Mehrsprachigkeitsdidaktik werden die Materialien analysiert, überarbeitet, vorgestellt und in der Praxis umgesetzt. Information: 043 305 51 00 / Anmeldung: www.phzh.ch/weiterbildung > Weitere Angebote > Heimatliche Sprache und Kultur (HSK)
Holen Sie sich einen Kurs aus dem Weiterbildungsprogramm in Ihre Schule. Der Kurs wird in der Regel ohne Anpassung der Kursinhalte oder -ziele an die lokalen Gegebenheiten durchgeführt. Sie sind verantwortlich für die organisatorischen Arbeiten zur Durch führung an Ihrer Schule. Sie können auch weitere Interessierte am Angebot teilnehmen lassen. Information: www.phzh.ch/schilw / wba@phzh.ch / 043 305 68 68
Intensivweiterbildungen (IWB): Eine Auszeit nehmen – etwas für Sie? Die IWB ermöglicht Lehrpersonen eine spezielle Auszeit vom beruflichen Alltag. Diese Auszeit (13 Wochen) beinhaltet einen Bildungsurlaub, ist aber nicht auf einen zertifizierenden Weiter bildungsabschluss ausgerichtet. Information und Anmeldung zur obligatorischen Infoveranstaltung (beschränkte Platzzahl) www.phzh.ch/iwb / iwb@phzh.ch / 043 305 57 00 Gesundheitsförderung und Prävention im Schulhaus (Volksschule) Für eine nachhaltige Schulentwicklung ist Gesundheitsförderung von zentraler Bedeutung. Das kantonale Netzwerk Gesundheits fördernder Schulen richtet sich an Schulen, die ihr Engagement in diesem Bereich verstärken wollen. Verbunden mit dem Beitritt zum Netzwerk ist die Verpflichtung zur «Weiterbildung Kontakt lehrperson für Gesundheitsförderung und Prävention» für eine Lehrperson der Schuleinheit. Information und Anmeldung: www.gesunde-schulen-zuerich.ch Weiterbildungen im Auftrag des Volksschulamts WBA QRKS2015.xx Qualifikation Religion und Kultur Sek I Leitung: Dozierende des Fachbereichs Religion und Kultur / Diverse Daten, Anmeldeschluss 24.5.2015 Information und Anmeldung: www.phzh.ch/weiterbildung > Weitere Angebote > Religion und Kultur / 043 305 68 68 Lehrmitteleinführungen WBA LME RKP «Blickpunkt 1 / 2 / 3 – Religion und Kultur» Termine ab September 2014 WBA LME MK.2014.02 «Medienkompass» 22.10.2014, 18.00–21.30 WBA LME MK-LP.2014.02 Mit dem Medienkompass durch den Mediendschungel 22./29.10., 3.12.2014, 18.00–21.30 Information und Anmeldung: www.phzh.ch/weiterbildung > Lehrpersonen > Lehrmitteleinführungen Medienbildung ICT-Evaluation: Analyse und Optimierung von Medien und ICT Ihrer Schule Welcher Nutzen resultiert aus den Investitionen? Wie effektiv werden Ressourcen eingesetzt? Wo liegen Optimierungsmöglichkeiten und Stärken? Wir liefern fundierte Antworten und geben Empfehlungen für die wirksame und nachhaltige Integration von Medien und ICT. Information und Anmeldung: www.medienbildung.ch > Evaluation und Forschung Computer im Schulalltag Sie lernen in dieser individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Schule / Ihres Teams zugeschnittenen Weiterbildung Hintergrundwissen zum Einsatz des Computers im Unterricht kennen und erhalten konkrete Impulse. Wir arbeiten mit konkreten Beispielen und passenden Organisationsformen für die Arbeit mit dem Computer im Schulalltag. Die praxisbetonte Weiterbildung bietet auch Raum für den Gedankenaustausch über die pädagogischen Inhalte. Information und Anmeldung: www.medienbildung.ch > Weiterbildung > Weiterbildung für Teams
Ergänzungsstudien PH Zürich ERP Ergänzungsstudien Primarstufe Für Lehrpersonen mit einem Stufendiplom Primarstufe, die berufsbegleitend eine Lehrbefähigung in einem weiteren Fach erwerben möchten. / Nächster Start: Herbstsemester 2014 / Anmeldeschluss: 1. Mai 2014 oder solange freie Studienplätze www.phzh.ch > Ausbildung > Primarstufe > Studiengänge > Ergänzungsstudium / ergaenzungsstudium.ps@phzh.ch / 043 305 58 36 (Englisch, Französisch, Bewegung und Sport) / 043 305 60 68 (Bildnerisches Gestalten, Werken, Werken Textil, Musik)
ZfB – Zentrum für Beratung ∑
www.phzh.ch/zfb
Beratung für Lehrpersonen, Schulleitende und Schulbehörden Die Beratung von Schulpersonal ist unsere Kompetenz. Wir sind für Sie, Ihr Team und Ihre Schule da, wenn es um die Unterstützung bei Anliegen im Schulfeld geht. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Beratungspersonen über das kostenlose Beratungs- und Informationstelefon. Information und Anmeldung: www.phzh.ch/beratung / 043 305 50 50 / beratungstelefon@phzh.ch Ganztagesbildung an Ihrer Schule Ganztagesschulen einzuführen ist mit vielseitigen Herausforderungen verbunden, denn Ganz tagesbildung steht im Spannungsfeld von Arbeitsmarkt-, Familienund Bildungspolitik. Gestützt auf das Zürcher Modell für Ganz tagesbildung beraten wir Sie bei einer Standortbestimmung oder bei der Umstellung auf den Tagesschulbetrieb. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und klären Sie mit unseren Fachpersonen Ihre ersten Fragen. Information und Anmeldung: phzh.ch/ganztagesbildung / 043 305 50 50 / beratungstelefon@phzh.ch Stress- und Burnoutprävention ist Führungsaufgabe Greifen Sie auf unsere Kompetenzen zurück, wenn Burnout in Ihrem Schulumfeld ein Thema ist oder sie es zum Thema machen möchten. Wir bieten Ihnen und den Lehrpersonen in Ihrer Schule Beratungen, interne Schulungen und Coachings an, die Wirkung zeigen. Information und Anmeldung: tiny.phzh.ch/srs / 043 305 50 50 / beratungstelefon@phzh.ch Intensivberatung am Arbeitsplatz Die Intensivberatung unterstützt Sie – beim Wunsch nach professioneller Begleitung zu Unterrichtsfragen und Klassenführung – bei schwieriger Beziehungsgestaltung mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, mit der Klasse, mit Eltern oder mit dem Team – nach einer Mitarbeiterbeurteilung (MAB) mit spezieller Entwicklungsaufgabe – bei einer Impulssetzung nach langer beruflicher Tätigkeit – in der Burnout-Prophylaxe Die Intensivberatung am Arbeitsplatz ist ein Instrument für Schul leitungen und Behörden zur Personalförderung. Ebenso ist sie eine Chance für Lehrpersonen, die Kompetenzen in ihrer Berufs ausübung zu erweitern. Information und Anmeldung: tiny.phzh.ch/aib / 043 305 50 50 / beratungstelefon@phzh.ch
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 47
Weiterbildung
Development Center für Schulleitende – Führungskompetenzen gezielt weiterentwickeln Zentrale Kompetenzen und Fragestellungen von Schulleitenden stehen im Fokus: Wie führe ich? Wie verhalte ich mich im Team? Wie plane und entscheide ich? Wo liegt mein persönliches Entwicklungspotenzial? Nutzen Sie das Angebot für einen Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild, zur Einschätzung der eigenen Führungsqualitäten und um professionelles Feedback und gezielte Entwicklungsimpulse zu erhalten. Das nächste Development Center findet am 25. November 2014 statt (Anmeldung bis 25.10.2014). Information und Anmeldung: phzh.ch/sl-dc / 043 305 50 50 / beratungstelefon@phzh.ch Beratungsangebote zur Kompetenzorientierung Die Weiter entwicklung von Kompetenzorientierung in der Schule hält inhaltliche und organisatorische Herausforderungen bereit. Für Schul leitende und Teams, die kompetenzorientiert arbeiten möchten, bietet das ZfB drei Beratungsangebote an. Informieren Sie sich auf der Website über die Details. Information und Anmeldung: tiny.phzh.ch/kobe / 043 305 50 50 / beratungstelefon@phzh.ch
Weiterbildungskurse Berufsfachschulen ∑
www.phzh.ch/wb-s2
P02.142 Philosophieren mit Jugendlichen Erika Langhans, Berufsschullehrerin ABU, Dozentin für Fach didaktik ABU, PH Zürich / Fr, 26.9.2014, 8.30–16.30 P04.142 Selbst organisiertes Lernen – SOL Heinz Brunner, Coach und Gymnasiallehrer, Andreas Sägesser, Dozent für Fachdidaktik, PH Zürich, Berufsfachschullehrer / Mi, 29.10.2014, 8.30–17.00 P05.142 Visualisieren – Wie Ihre Lernsequenzen zum Erlebnis werden! Susanna Baumberger, Erwachsenenbildnerin / Fr, 7.11.2014, 9.00–17.00 P06.142 Produktivität steigern mit PEP Willy Knüsel, Betriebsökonom HWV, Trainer für Arbeitstechnik / Fr, 14.11.2014, 9.00–17.00 P07.142 Pensionierung – Schritte in die neue Freiheit Ursula Braunschweig-Lütolf, seit 2013 pensionierte Berufsfachschullehrerin / Fr, 31.10.2014, 8.30–17.00 B04c.142 Coaching einer Gruppe von Mentorinnen und Mentoren Dagmar Bach, Dozentin Weiterbildung für Berufsfachschulen, PH Zürich / Do, 25.11.2014, 17.00–19.30 F01.5.142 Modul 5: Lokales Netzwerk – wer macht was? Raphael Gägauf, Sozialarbeiter FH, Markus Spillmann, Sozialpädagoge FHS / Fr, 7./21.11., 5.12.2014, 8.30–17.00 F01.2.142 Modul 2: Förderdiagnostik, individualisierte Lernplanung und Erfolgskontrolle Joseph Eigenmann, Pädagoge, Didaktiker / Fr/Sa, 9./10.1., 13./14.3., 10./11.4., 29./30.5.2015, Fr, 9.15–17.00, Sa, 9.15–13.30 F03.142 Lernende begleiten – Ermutigung für Mutmacherinnen und -macher Jürg Meier, langjähriger FiB- und ABU-Lehrer, Genderspezialist, Erwachsenenbildner, Schriftsteller / Do, 2.10., 4.12.2014, 29.1., 26.3., 28.5.2015, 13.00–17.00 L01.142 SOL live Andreas Sägesser, Berufsfachschullehrer, Dozent für Fachdidaktik Berufskunde PH Zürich / Mo, 3.11.2014, 18.00–20.30 L03.142 Wissen verwalten und teilen mit Evernote Thomas Stierli, Dozent für Medienbildung, PH Zürich / Do, 6.11.2014, 13.30–17.00 W01.2.142 Die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen der Schweiz Dr. Daniel Lampart, Chefökonom Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) / Mi, 29.10.2014, 18.00–20.00 W01.3.142 Die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen der Schweiz Dr. Jean-Philippe Kohl, Leiter Wirtschaftspolitik Swissmem / Mi, 19.11.2014, 18.00–20.00
48 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
W05.142 Kunst im Unterricht Reto Müller, Berufsfachschullehrer für bildnerisches Gestalten / Do, 18./25.9.2014, 17.00–20.00 X01.142 Weiterbildungsapéro: Das Geheimnis klugen Selbst managements Verena Glatthard, Coach, Dozentin für Selbst management / Mi, 24.9.2014, 17.15–19.00 X02.142 Weiterbildungsapéro: Informationskompetenz Stefanie Sorge, dipl. Medienwirtin, Master Bibliotheks- und Informationswissenschaft / Di, 27.11.2014, 17.15–19.00 Information und Anmeldung: www.phzh.ch/wb-s2 / 043 305 66 72
Unterstrass.edu Weiterbildungsangebote ∑
www.unterstrass.edu
Kurse 200000.05 «Mit Kindern lustvoll experimentieren» für Kinder garten- und Unterstufenlehrpersonen / Leitung: Florence Bernhard / florence.bernhard@unterstrass.edu / Mi, 1.10.14, 14.00–17.30, weitere Samstage nach Wahl. Abschluss: Mi, 25.3.15, 14.00–17.30 Information und Anmeldung: www.kinderforschen.ch 200000.06 DaZ-Kurs – Deutsch als Zweitsprache für Lehr personen aller Stufen der Volksschule / Leitung: Inge Rychener / inge.rychener@unterstrass.edu / Sa, 18./25.10., 1./8./15./22./ 29.11.2014, 9.00–12.30 200000.08 Vielfalt – heisst Chancengleichheit Für Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen / Leitung: Anita Schaffner Menn, Annette Fluri / anita.schaffner@unterstrass.edu / annette.fluri@unterstrass.edu / 13.–17.10.2014, 9.00–16.00 www.unterstrass.edu > Institut > Weiterbildung > Kurse Leitung und Auskunft: matthias.gubler@unterstrass.edu
UZH / ETH Zürich Weiterbildungskurse Mittelschulen ∑
www.webpalette.ch > Sekundarstufe II > UZH und ETH Zürich
Kursdaten Herbstsemester 2014 Naturwissenschaften, Mathematik Technik und Informatik HS 14.56 25. Schweizerischer Tag über Mathematik und Unterricht Meike Akveld u. a. / Mi, 10.9.2014 HS14.52 Chemie: Kleine Experimente – mit grosser Wirkung im Unterricht Dr. Amadeus Bärtsch / Fr, 12.9.2014 HS14.53 Vertiefte Grundlagen der Chemie Antonio Togni, Roger Alberto / ab Do, 15.9.2014 HS14.64 Das Orbitalmodell und die moderne Quanten chemie im gymnasialen Unterricht Dr. Juraj Lipscher, Dr. Ralph Schumacher / Fr/Sa, 3./4.10.2014 HS14.55 Kolloquium über Mathematik, Informatik und Unterricht 2014 Meike Akveld u. a. / ab Do, 23.10.2014 HS14.58 Differentialrechnung I (11. und 12. Schuljahr, Gymna sium) / Armin Barth, Ralph Schumacher / Fr/Sa, 24./25.10.2014 HS14.65 Precalculus: Folgen, Reihen und Grenzwerte (10. und 11. Schuljahr, Gymnasium) / Michael Brunisholz / Fr/Sa, 24./25.10.2014
Weiterbildung
HS14.63 Mobile Energiequellen – Batterien, Akkus und Brennstoffzellen in der Redox-Chemie Roger Deuber, Ralph Schumacher / Fr/Sa, 31.10./1.11.2014 HS14.50 Biologie: Ein experimenteller Abstecher in die Neuroinformatik Dr. Daniel Kiper / Di, 4.11.2014 HS14.51 Biologie: Moderne Neurowissenschaften und ihre Bedeutung für die Pädagogik Dr. Daniel Kiper / Di, 11.11.2014 HS14.57 Schweizerischer Tag für Physik und Unterricht: Mobilität und Energie der Zukunft Fr, 14.11.2014 HS14.67 Schallausbreitung: Wie man mit Schall Entfernungen messen und Verborgenes sichtbar machen kann (7. bis 9. Schuljahr, Sekundarstufe I) / Dr. Herbert Rubin, Ralph Schumacher / Fr/Sa, 21./22.11.2014 HS14.60 Energie in der Thermodynamik (9. und 10. Schuljahr, Gymnasium) / Dr. Herbert Rubin / Fr/Sa, 28./29.11.2014 HS14.61 Flussrevitalisierung Armin Barth, Roger Deuber, Patrick Faller, Herbert Rubin / Fr/Sa, 5./6.12.2014 HS14.59 Energie in der Mechanik Herbert Rubin, Ralph Schumacher / Fr/Sa, 14./15.11.2014 HS14.62 Grundkonzepte der Mechanik I: Trägheit und Wechselwirkung als Schlüssel zum Verständnis von Kräften (9. und 10. Schuljahr, Gymnasium) / Herbert Rubin, Ralph Schu macher / Fr/Sa, 14./15.11.2014 HS14.66 Precalculus: Funktionen I (9. und 10. Schuljahr, Gymnasium) / Armin Barth, Ralph Schumacher / Fr/Sa, 21./22.11.2014 HS14.22 Biochemie im Kontext Ernährung Mo, 6.10.2014
HS14.10 Dokufiction – Modeformat oder anschauliche Wissensvermittlung / Do, 27.11.2014 HS14.06 Lyrik lesen: Rilkes «Neue Gedichte» Mi, 10.12.2014 HS14.12 Die Transformation historischer Konfliktstrukturen und der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa Mi, 21.1.2015 Wirtschaft und Recht HS14.15 Wirtschafts- und Finanzkrisen: Eine historische Einführung Do, 23.10.2014 HS14.18 Grundlagen der Unternehmensverantwortung Fr, 14.11.2014 HS14.17 Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen Mo, 17.11. 2014 HS14.16 Grundlagen zum Strafrecht Mi, 14.1.2015 Weiterbildungen für den Berufseinstieg HS14.47 Schulentwicklung an einzelnen Schulen: Mentorats begleitende Weiterbildung für Mentorinnen und Mentoren (Holangebot) / nach Absprache Information und Anmeldung: www.webpalette.ch > Sekundar stufe II > UZH und ETH Zürich / Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft, Weiterbildung Maturitätsschulen, Beckenhofstrasse 35, 8006 Zürich, weiterbildung.llbm@ife.uzh.ch / ETH Zürich, Weiterbildung Maturitätsschulen, Universitäts strasse 41, 8092 Zürich, peter.greutmann@ifv.gess.ethz.ch
HS14.21 Musterbildung in Physik, Chemie und Biologie Fr, 7.11.2014 HS14.27 Zoologie erleben Di, 13.1.2015 Überfachliche Kompetenzen HS14.37 Zunehmende Digitalisierung der Ausbildung – Chancen und Herausforderungen Prof. Dr. Ernst Hafen, ETH Zürich / Di, 23.9.2014 Überfachliche Kompetenzen und Interdisziplinarität
HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich Weiterbildungskurse ∑
www.hfh.ch
Tagungen
HS14.35 Daten erheben und auswerten Mi/Do, 5./6.11.2014
2014-87 Tagung «Heilpädagogik und Neurowissenschaften im Dialog» Leitung: Prof. Claude Bollier, Dr. Dominik Gyseler / Sa, 20.9.2014, 8.30–14 Uhr
HS14.32 Konfliktmanagement für Lehrpersonen Do, 13./20.11.2014
2014-88 Demotivierte Lernende – Was können wir tun? Leitung: Rupert Tarnutzer / Sa, 15.11.2014, 9.30–17 Uhr
HS14.02 Ihr Auftritt im Klassenzimmer Vertiefungskurs Fr/Sa, 21./22.11.2014
Zertifikatslehrgänge und Zusatzausbildungen
HS14.31 Grundlagen der Mediendidaktik Mi, 22.10.2014
HS14.30 Logische Grundlagen des Denkens und der Sprache 2 Fr, 23.1.2015 HS14.34 Schule gesund machen! Nach Absprache Geistes- und Sozialwissenschaften, Medien und Künste HS14.04 Aktuelle philologische Lektüreverfahren für den Deutschunterricht Mi, 22.10.2014 HS14.13 Syntax im Klassenzimmer – Sprachwissenschaftliche Betrachtungen zu ausgewählten «Problemfeldern» der Grammatik romanischer Schulsprachen (Schwerpunkt Französisch) / Fr, 24.10.2014 HS14.07 Kinokultur im Schulzimmer. Der Dokumentarfilm im Unterricht am Beispiel des Films «Mit dem Bauch durch die Wand» / Fr, 7.11.2014
2015-2 CAS Management und Leadership Leitung: Prof. Claude Bollier, Esther Brenzikofer / August 2015 bis März 2017 / Anmeldeschluss: 30.4.2015 / nächste Infoveranstaltungen: 3.12.2014, 16.15–17.30 Uhr / 20.1.2015, 17.15–18.30 Uhr 2015-3 CAS Projekt- und Changemanagement Leitung: Prof. Claude Bollier / Mai 2015 bis April 2016 / Anmeldeschluss: 31.3.2015 / nächste Infoveranstaltungen: 3.12.2014, 14.15–15.30 Uhr / 15.1.2015, 17.15–18.30 Uhr 2015-4 CAS Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) im Kindesund Jugendalter: Grundlagen, Interventionen und Perspektiven Leitung: Prof. Dr. Andreas Eckert, Remi Frei / September 2015 bis Januar 2017 / Anmeldeschluss: 31.5.2015 / nächste Info veranstaltungen: 4.2.2015 und 25.3.2015, 17–18 Uhr 2015-5 CAS Neurowissenschaften und Heilpädagogik Leitung: Dr. Dominik Gyseler / März 2015 bis März 2016 / Anmeldeschluss: 15.1.2015
HS14.08 Zwischen Ost und West? Geschichte und Gegenwart der Ukraine / Di, 11.11.2014 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 49
Weiterbildung
2015-6 CAS Integrative Schulung bei geistiger Behinderung Leitung: Roman Manser, Chris Piller / September 2015 bis Juni 2016 / Anmeldeschluss: 31.5.2015 / nächste Infoveranstal tungen: 14.1.2015, 14.15–15.15 Uhr / 25.3.2015, 17.15–18.15 Uhr 2015-7 CAS Wirksam fördern Leitung: Esther Brenzikofer, Prof. Markus Sigrist / September 2015 bis September 2016 / Anmeldeschluss: 31.5.2015 / nächste Infoveranstaltungen: 11.2.2015, 16.30–17.30 Uhr / 18.3.2015, 13.30–14.30 Uhr 2015-9 CARE-Index: Einschätzung der Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson Leitung: Alex Neuhauser / 18./19.9., 2./3. und 23./24.10. und 13./14.11.2015 / Anmeldeschluss: 15.6.2015 / nächste Infoveranstaltungen: 9.12.2014 und 10.3.2015, 19 Uhr Kurse 2014-36 Der Atem als Türöffner – Einführung in die ressourcenorientierte Atemarbeit nach Prof. I. Middendorf Leitung: Regula Burger, Roger Stutz / 2 Samstage, 9.30–17.30 Uhr / 1. und 15.11.2014 (Anmeldeschluss: 30.9.2014) 2014-71 Gesprächsführung und Beratung: Was wirkt in schwierigen Situationen? Leitung: Regula Haeberli, Prof. Markus Sigrist / 4 Mittwochnachmittage, 14.15–17.15 Uhr / 5.11., 3.12.2014, 7. und 28.1.2015 (Anmeldeschluss: 1.10.2014) 2014-45 Workshop «Guten Appetit» – Essen und Trinken mit Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung Leitung: Christine Bayer, Verena Scheiwiler / Sa, 8.11.2014, 9.00–11.30 und 14.00–16.30 Uhr (Anmeldeschluss: 1.10.2014) 2014-67 Integrative Didaktik an der Oberstufe – Gelingens faktoren und Beispiele Leitung: Dr. Marianne Willhelm / Di, 11.11.2014, 9.15–16.30 Uhr (Anmeldeschluss: 1.10.2014) 2014-40 Handling und Transfer im heilpädagogischen Schul alltag am Beispiel Kinder mit Cerebralparesen Leitung: Beate Bielfeldt / Fr, 14.11.2014, 8–16 Uhr (Anmeldeschluss: 1.10.2014) 2014-58 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Asperger Syndrom Leitung: Markus Kiwitt, Antje Tuckermann, Matthias Huber (Gastreferent) / 3 Tage, 9.15–16.30 Uhr / Montag bis Mittwoch, 17.–19.11.2014 (Anmeldeschluss: 1.10.2014) 2014-59.2 Autismus und Schule: Klassenassistenz bei Schul kindern mit Autismus Leitung: Remi Frei / Fr, 21.11.2014, 9.15–16.30 Uhr, und Sa, 22.11.2014, 9.15–12.15 Uhr (Anmeldeschluss: 15.10.2014) 2014-37 Lernen und Bewegung – Bewegung, ein kindgerechtes Mittel als Weg zum Lernen Leitung: Marianne Häfliger-Buob / Sa, 22.11.2014, 9.15–16.30 Uhr (Anmeldeschluss: 15.10.2014) 2015-11 Hochbegabte Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse: Sind alle Hochbegabten gleich? Leitung: Prof. Dr. Esther Brunner, Dr. Dominik Gyseler / 27.2.2015, 17–21 Uhr und 28.2.2015, 8.30–12.30 Uhr (Anmeldeschluss: 15.1.2015) Onlinekurse 2014-83 Neurowissenschaften und Heilpädagogik Leitung: Dr. Dominik Gyseler / Onlinekurs ohne Präsenztage / Anmeldung und Start jederzeit möglich: www.onlinekurse-hfh.ch 2014-84 1×1 der Heilpädagogik Leitung: Anna Cornelius / Onlinekurs ohne Präsenztage / Anmeldung und Start jederzeit möglich: www.onlinekurse-hfh.ch Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik / www.hfh.ch/weiterbildung > CAS, Kurse bzw. Tagungen / 044 317 11 81 / wfd@hfh.ch
ZAL – Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen des Kantons Zürich Weiterbildungskurse ∑
kurse.zal.ch
ZE18.14.41 Klare Köpfe – innere Stärke Wirth U. / Mi, 17.9.2014, 14.00–16.00 / Mi, 24.9.2014, 14.00–16.00 / Zürich ZP55.14.41 Schulevents kreativ gestalten Rump J. / Sa, 20.9.2014, 9.00–16.00 / Zürich ZGA53.14.41 Kreschendo 1/2 Steffen C. / Sa, 20.9.2014, 9.00–16.30 / Brüttisellen ZB12.14.41 Bewegt durch den Wald Schwarzer-Kraus A. / Mi, 24.9.2014, 13.30–20.00 / Zürich ZB50.14.41 Lernen in Bewegung Maurer S. / Mi, 24.9.2014, 14.00–17.00 / Wetzikon ZI19.14.41 Am Ball bleiben mit Computer und Internet Bäriswyl-Heim S. / Di, 30.9.2014, 18.00–21.00 / Di, 28.10.2014, 18.00–21.00 / Di, 11.11.2014, 18.00–21.00 / Zürich ZGA54.14.51 Kreschendo 3 Steffen C. / Mi, 22.10.2014, 14.00–17.00 / Schwerzenbach ZV25.14.51 Warum, wieso, weshalb Detken F., Nussberger S. / Sa, 25.10.2014, 9.00–16.30 / Zürich ZE16.14.51 Einführung in KiDiT® Walter C., Pfiffner M. / Do, 6.11.2014, 18.00–20.15 / Zürich ZM25.14.51 Mathematik mit Musik und Bewegung Brack Lees J., Müller C. / Sa, 8.11.2014, 9.00–16.00 / Zürich ZE20.14.51 Bewegung im Kindergarten- und Schulalltag Lorek Z. / Sa, 15.11.2014, 9.30–16.30 / Zürich Schulinterne Weiterbildung: Die ZAL organisiert für Teams auch schulinterne Weiterbildungen. Diese richten sich nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden und finden in deren Schulhaus statt. Beratung und Coaching: Die ZAL organisiert für Einzelpersonen und Kleingruppen bis maximal 3 Personen auch Beratungen zu konkreten fachlichen Fragen und Coachings bei Aufgaben und Fragen im Berufsalltag (Ausgangslage analysieren, Lösungen entwerfen). Information und Anmeldung: www.zal.ch / Zürcher Arbeits gemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen, Bildungs zentrum für Erwachsene BiZE, Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich / info@zal.ch / 044 385 83 94
EB Zürich, Kantonale Berufsschule für Weiterbildung Weiterbildungskurse ∑
www.eb-zuerich.ch
IN46.14.41 Das Android-Tablet nutzen Czech A. / Mi, 17.9.2014, 8.30–12.00 / Mi, 24.9.2014, 8.30–12.00 / Zürich PE33.14.41 Effizient Sitzungen leiten Stalder G. / Mi, 17.9.2014, 9.00–17.00 / Mi, 24.9.2014, 9.00–17.00 / Zürich IN17.14.41 Social Media: Facebook, Twitter & Co. Würmli-Thurner M., Böhler M. / Do, 18.9.2014, 8.30–12.00 / Do, 25.9.2014, 8.30–12.00 / Do, 2.10.2014, 8.30–12.00 / Zürich
50 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Weiterbildung
DE50.14.41 Attraktiv und verständlich schreiben Ulmi M. / Fr, 19.9.2014, 9.00–16.00 / Fr, 26.9.2014, 9.00–16.00 / Fr, 3.10.2014, 9.00–16.00 / Zürich IN44.14.41 Das iPad nutzen Bollinger F. / Do, 25.9.2014, 8.30–12.00 / Do, 2.10.2014, 8.30–12.00 / Zürich PE11.14.41 Wirkungsvoll visualisieren: Durch Bilder reden Kunzmann A. / Do, 25.9.2014, 9.00–17.00 / Fr, 26.9.2014, 9.00–17.00 / Zürich DE45.14.41 Schreibdenken: Schreiben als Denkwerkzeug nutzen Geiser B. / Fr, 26.9.2014, 9.00–16.00 / Zürich
Weitere Weiterbildungsangebote 3. Interkantonale Weiterbildung für Fachlehrpersonen Haus wirtschaft Interessiert, in Zukunft an einer bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschule zu unterrichten? Der 18-tägige Weiter bildungskurs vermittelt praktische Grundlagen für die Aus- und Weiterbildung auf der Tertiärstufe in den Fachbereichen Produkteverwertung und Hauswirtschaft mit Schwerpunkt Landwirtschaft. Ausschreibung unter: www.wallierhof.ch oder www.liebegg.ch Auskunft erteilt regula.gygax@vd.so.ch / Informationsabend am 23.9.2014 um 18.30 Uhr am LZ Liebegg, Gränichen (AG)
SE25.14.51 Englisch C1 Luginbühl-Maloof C. / Mo, ab 20.10.2014, 18.00–20.05, 20 Mal / Zürich PS77.14.51 Autogenes Training Kasper Hartmann U. / Mo, ab 20.10.2014, 18.00–18.45, 6 Mal / Zürich DE54.14.51 Schreibimpuls und Textdiskussion Spalinger B. / Di, 21.10.2014, 18.00–21.00 / Di, 18.11.2014, 18.00–21.00 / Di, 16.12.2014, 18.00–21.00 / Di, 13.1.2015, 18.00–21.00 / Zürich DE71.14.51 Schreibwerkstatt Spalinger B. / Mi, 22.10.2014, 18.30–21.30 / Mi, 29.10.2014, 18.30–21.30 / Mi, 5.11.2014, 18.30–21.30 / Mi, 12.11.2014, 18.30–21.30 / Mi, 19.11.2014, 18.30–21.30 / Mi, 26.11.2014, 18.30–21.30 / Mi, 3.12.2014, 18.30–21.30 / Zürich SD41.14.51 First Certificate in English (FCE) B2 Luginbühl-Maloof C. / Mi, ab 22.10.2014, 18.00–20.25, 20 Mal / Zürich SD82.14.51 Certificate of Proficiency in English (CPE) C2 Brupbacher B. / Mi, ab 22.10.2014, 18.00–20.25, 20 Mal / Zürich SF64.14.51 DELF B2 n. N. / Mi, ab 22.10.2014, 18.00–20.10, 19 Mal / Zürich SI78.14.51 PLIDA-Zertifikat B2 Schirinzi-Petti A. / Mi, ab 22.10.2014, 18.00–20.05, 20 Mal / Zürich SD61.14.51 Certificate in Advanced English (CAE) C1 Brown J. / Do, ab 23.10.2014, 18.00–20.30, 19 Mal / Zürich PF22.14.51 Motivation unter Druck Tommasi F. / Do, 23.10.2014, 9.00–17.00 / Fr, 24.10.2014, 9.00–17.00 / Do, 27.11.2014, 9.00–12.30 / Zürich IA52.14.51 PowerPoint: Einführung Widmer B. / Mo, ab 27.10.2014, 13.30–17.00, 4 Mal / Zürich ID81.14.51 Digitale Fotografie: Einstieg Canali R. / Mo, ab 27.10.2014, 18.00–21.30, 6 Mal / Zürich IA32.14.52 Excel: Einführung Siegrist H. / Di, ab 28.10.2014, 18.30–21.30, 8 Mal / Zürich IV11.14.51 Video: Kamera und Filmsprache Gsell G. / Di, ab 28.10.2014, 14.00–17.00, 8 Mal / Zürich IL05.14.51 FileMaker: Einführung Herrmann F. / Do, ab 30.10.2014, 13.30–17.00, 6 Mal / Zürich DE12.14.51 Epochen der deutschen Literatur Grosjean E. / Sa, 8.11.2014, 9.30–12.00 / Sa, 15.11.2014, 9.30–12.00 / Sa, 22.11.2014, 9.30–12.00 / Sa, 29.11.2014, 9.30–12.00 / Sa, 6.12.2014, 9.30–12.00 / Sa, 13.12.2014, 9.30–12.00 / Zürich Information und Anmeldung: www.eb-zuerich.ch
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 51
52 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Amtliches 5/2014
Inhalt Anmeldung neuer Mittelschülerinnen und Mittelschüler für das Schuljahr 2015/16
53
Überarbeitung und Erweiterung der Lernplattform Lernpass auf der Sekundarstufe I der Volksschule
64
Kriterien und Verfahren zur Festlegung der Einzugsgebiete von Berufsfachschulen
64
Bildungsrätliche Kommission Volksschule – Berufsbildung, Amtsdauer 2011/2015, Ersatzwahl
65
Lehrpläne Ergänzungsfach Informatik: Verlängerung der befristeten Bewilligung
66
Volksschule. Pilotprojekt Sek: Aktive Lernzeit und Lernerfolg für ALLE. Projektauftrag
66
Verordnung über die Anforderungen an Lehrpersonen in Berufsvorbereitungsjahren, Neuerlass (ersetzt die bisherige Verordnung über die Zulassung zu den Berufs vorbereitungsjahren 2013/2014 und die Anforderungen an die Lehrpersonen)
68
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an Zürcher Mittelschulen
70
Neues Anschlussprogramm für die Fachmittelschule
71
Stärkung von Naturwissenschaft und Technik an den Zürcher Mittelschulen: Umsetzung
73
Kantonsschule Büelrain: Neue Stundentafel
74
Bildungsrätliche Kommission Bildungsstandards und Lehrplan 21. Mutationen.
75
Weitere Informationen finden sich auf dem Portal www.zen traleaufnahmepruefung.ch. Seit dem 1. Januar 2008 ist der zwei Jahre dauernde Kinder garten im Kanton Zürich Teil der obligatorischen Schulzeit. Diese verlängert sich somit von neun auf elf Jahre. Die Schulpflicht be steht demnach aus 2 Jahren Kindergartenstufe, 6 Jahren Primar stufe und 3 Jahren Sekundarstufe. Der Übertritt ins Gymnasium geschieht also nach 8 (früher 6) Jahren ins Langgymnasium be ziehungsweise nach 10 oder 11 (früher 8 oder 9) Jahren ins Kurz gymnasium. Im Folgenden werden die neuen Begriffe und die neue Zählweise verwendet. Die Anmeldung erfolgt durch die Eltern. Anmeldeschluss für das Schuljahr 2015/16: 10. Februar 2015 (Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl: 15. Januar 2015) Informatikmittelschule (IMS): Anmeldeschluss für das Schuljahr 2015/16: 30. September 2014
Anmeldung neuer Mittelschülerinnen und Mittelschüler für das Schuljahr 2015/16 Die Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe und der Unter stufe des Gymnasiums sind verpflichtet, ihre Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern rechtzeitig und umfassend über die verschiedenen Wege der Mittelschulbildung aufzuklären und die hier gegebenen Informationen weiterzutragen. Es soll auch auf die Möglichkeiten von Studienbeiträgen (Stipendien) aufmerk sam gemacht werden. Die Rektorate der Mittelschulen sind zu Auskünften ebenfalls gerne bereit. Zudem finden an den Schulen Orientierungsveranstaltungen für Eltern und künftige Schülerin nen und Schüler statt, die sich aber auch zur weiteren I nformation der Primar- und Sekundarlehrpersonen eignen. Die Broschüre «Mittelschule ja, aber welche?» gibt eine detaillierte Übersicht über die Angebote der einzelnen Schulen (siehe auch unter www.mba.zh.ch).
A Beschreibung der verschiedenen Mittelschultypen Gymnasien Der Kanton Zürich hat das Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) wie folgt umgesetzt. Er führt: – Maturitätsausbildungen von 6 Jahren Dauer (9.–14. Schuljahr, Langgymnasium) – Maturitätsausbildungen von 4 Jahren Dauer (11.–14. Schuljahr, Kurzgymnasium) – das Liceo Artistico von 5 Jahren Dauer (11.–15. Schuljahr) – das Kunst- und Sportgymnasium am MNG Rämibühl als Kurzgymnasium von 5 Jahren Dauer (11.–15. Schuljahr) und eine gymnasiale Unterstufe (9.–10. Schuljahr) – die Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene (KME, 2. Bildungsweg) von 3 Jahren bzw. berufsbegleitend 3¾ Jahren Dauer. Ein Quereinstieg ins 3. Semester ist möglich. An fünfzehn Kurz- und Langgymnasien wird ab dem elften Schul jahr ein zusätzlicher Ausbildungsgang zweisprachige Maturi tät «Deutsch/Englisch» und an zwei weiteren Kantonsschulen «Deutsch/Französisch» angeboten. Am Literargymnasium Rämi bühl und am Realgymnasium Rämibühl kann zusätzlich das In ternational Baccalaureate erworben werden (Doppelabschluss Matura/IB). An der Kantonsschule Küsnacht besteht die Mög lichkeit zum Besuch eines zweisprachigen Untergymnasiums im Anschluss an die Primarstufe. Die Bildungsgänge der Gymnasien führen zu einem schwei zerisch anerkannten Maturitätsausweis, der zum Studium an al Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 53
Amtliches
len schweizerischen Universitäten und an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen berechtigt. Das Abschlusszeugnis des Liceo Artistico berechtigt zudem zum Studium an italienischen Kunstakademien und Hochschulen. Die Maturität wird im Abschlussjahr seit 2012 auf der Basis von 13 Maturitätsnoten erteilt. Die Noten werden gesetzt für die Leistungen in einem einzelnen Fach. Massgebend sind 10 Grund lagenfächer sowie ein Schwerpunktfach und ein Ergänzungs fach. Zusätzlich ist eine Maturitätsarbeit zu verfassen, die eben falls benotet wird. Im Kanton Zürich werden folgende Maturitätsfächer angeboten: (1) Erstsprache Deutsch (2) Zweite Landessprache Französisch Italienisch (3) Dritte Sprache Italienisch/Französisch Englisch Griechisch Latein (4) Mathematik (5) Biologie (6) Chemie (7) Physik (8) Geschichte (9) Geografie (10) Musisches Fach Bildnerisches Gestalten und/oder Musik (11) Schwerpunktfach Latein, Griechisch Italienisch/Französisch, Englisch, Spanisch, Russisch Physik und Anwendungen der Mathematik, Biologie und Chemie Wirtschaft und Recht Philosophie/Pädagogik/Psychologie (siehe Abschnitt E) Bildnerisches Gestalten, Musik (12) Ergänzungsfach Physik, Chemie, Biologie, Anwendungen der Mathematik, Geschichte inkl. Staatskunde, Geografie, Philosophie, Religionslehre, Wirtschaft und Recht, Pädagogik/Psycho logie, Bildnerisches Gestalten, Musik, Sport, Informatik (13) Maturitätsarbeit in einem Fach oder mehreren Fächern nach Wahl Der Bildungsrat legt fest, welche Schwerpunktfächer eine Schule führt. Das Angebot an Ergänzungsfächern wird von der Schule festgelegt. Es besteht kein Anspruch auf uneingeschränkte Wahl des Ergänzungsfaches. Die einzelnen Kurse können nur bei einer genügenden Zahl von Anmeldungen geführt werden.
–
ist eine Einschränkung in der Zahl der möglichen Schwer punktfächer verbunden. Wahl des Schwerpunktfaches und des Ergänzungsfaches: Die einzelnen Schulen bestimmen die Zeitpunkte für die Wahl von Schwerpunkt- und Ergänzungsfach.
Der Kanton Zürich unterscheidet fünf Maturitätsprofile, die in erster Linie durch das Schwerpunktfach bestimmt sind: Altsprachliches Profil: (A) Die Sprachenkombination enthält Latein und/oder Griechisch, Schwerpunktfach ist eine Sprache. Neusprachliches Profil: (N) Die Sprachenkombination enthält nur moderne Fremdsprachen, Schwerpunktfach ist eine Sprache. Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil: (MN) Schwerpunktfach ist «Biologie und Chemie» oder «Physik und Anwendungen der Mathematik». Wirtschaftlich-rechtliches Profil: (WR) Schwerpunktfach ist «Wirtschaft und Recht». Musisches Profil: (M) Schwerpunktfach ist «Bildnerisches Gestalten» oder «Musik». Bemerkungen: Wer im altsprachlichen Profil Griechisch belegen will, muss nach der 6. Klasse der Primarstufe ans Gymnasium übertreten. In allen Profilen kann Italienisch an Stelle von Französisch als 2. Landessprache belegt werden. (Diese Möglichkeit wird nicht an allen Schulen angeboten.) Die aktuellen Profile sind: Schule
Unterstufe
Profil A
N
Literargymnasium Rämibühl, Zürich
1
2
2
Realgymnasium Rämibühl, Zürich
1
2
2
Kantonsschule Hohe Promenade, Zürich
1
2
2
Math.-Nat. Gymnasium Rämibühl, Zürich
MN WR M
2/3
Kunst- und Sportgymnasium am MNG
1
2/3
Kantonsschule Freudenberg, Zürich
1
2
2
Kantonsschule Wiedikon, Zürich
1
2
2
Kantonsschule Enge, Zürich
2/3*
2/3
2*/3
2/3 2/3
Kantonsschule Hottingen, Zürich Kantonsschule Zürich Nord
2/3
1
Kantonsschule Stadelhofen, Zürich
2
2/3
3
3
2/3 2/3 2/3 2/3*
2/3
Liceo Artistico, Zürich
Die Wahlen erfolgen mehrstufig. – 6-jährige oder 4-jährige Maturitätsausbildung: In der Unterstufe des 6-jährigen Bildungsganges sind Latein, Französisch und Englisch obligatorisch. – Maturitätsprofil: Auf den Beginn der 3. Klasse der 6-jähri gen Ausbildung bzw. mit Eintritt in die 4-jährige Ausbildung muss ein Maturitätsprofil gewählt werden. Mit dieser Wahl 54 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
2/3
Kantonsschule Büelrain, W interthur
2/3
Kantonsschule Im Lee, W interthur
3
3
Kantonsschule Rychenberg, Winterthur
1
2
2
Kantonsschule Uster
1
2
2/3
2/3
2/3
2/3 2/3 2/3
Amtliches
Schule
Unterstufe
Profil A
Kantonsschule Küsnacht
1**
Kantonsschule Limmattal, Urdorf
1
Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach Kant. Maturitätsschule für Erwachsene 1 2 3 4
N
MN WR M
2/3
2/3
2/3
2/3 2/3 2/3
1
2/3 2/3
2/3 2/3 2/3
1
2/3 2/3
2/3 2/3 2/3
2
4
4
4
4
4
nach 6 Jahren Primarstufe nach 2 Jahren Unterstufe des Gymnasiums nach 2 Jahren Sekundarstufe für Studierende mit Berufsausbildung oder Berufspraxis
1** Unterricht auf der Unterstufe z.T. immersiv (Deutsch/Englisch) 2*/3 Übertritt aus gymnasialer Unterstufe nur bei Russisch oder Akzent «Internationale Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit» 2/3* mit Schwerpunktfach Biologie und Chemie
Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl (am MNG Rämibühl) Der Kanton Zürich führt am Mathematisch-Naturwissenschaft lichen Gymnasium Rämibühl (MNG) Klassen für musikalisch, tänzerisch oder sportlich besonders begabte Jugendliche. An der Unterstufe (9.–10. Schuljahr) ist die Lektionenzahl reduziert. Der Anschluss an jedes Maturitätsprofil am Ende der Unterstufe bleibt dabei gewährleistet. Am Kurzgymnasium (11.–15. Schul jahr) wird der Schulstoff von vier auf fünf Jahre erstreckt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten so genügend Freiraum, um sich neben dem Gymnasium intensiv ihrer Sonderbegabung zu widmen. Unterrichtet wird im Rahmen einer 5-Tage-Woche an fünf Vormittagen und an einem Nachmittag. (Spezielle Lösungen für Morgentrainings werden angeboten.) Musikalisch besonders Begabte erwerben eine Maturität mit Schwerpunktfach Musik und absolvieren während der Gymnasialzeit den Vorkurs und bis zu zwei Jahre des Bachelorstudiums an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Tänzerisch und sportlich besonders Begabte können zwischen dem neusprachlichen Profil und dem mathe matisch-naturwissenschaftlichen Profil mit Schwerpunktfach Biologie und Chemie wählen. Liceo Artistico Das Liceo Artistico wird vom Kanton Zürich in Zusammenarbeit mit der Republik Italien als bikulturelle Schule geführt. Es vermit telt eine sprachlich-historische Bildung mit dem Ziel einer zwei sprachigen Maturität. Deutsch und Italienisch werden, unabhän gig von der Erstsprache der Schülerinnen und Schüler, so weit gefördert, dass sie nicht nur als Umgangs- und Literatursprache, sondern auch als Wissenschaftssprache beherrscht werden. Nach Erarbeitung der sprachlichen Grundlagen werden daher Mathematik und Biologie und der grösste Teil der Kunstfächer auf Italienisch unterrichtet. Neben Deutsch und Italienisch haben die Schülerinnen und Schüler die Wahl zwischen Englisch und Französisch. Grosses Gewicht liegt mit neun Wochenstunden auf dem Unterricht in Bildender Kunst. Das Abschlusszeugnis gilt als schweizerische Maturität und ist in Italien als «maturità artis tica» anerkannt. Es berechtigt auch zum Studium an italienischen Hochschulen und Kunstakademien.
B Weitere Angebote an Mittelschulen 1. Handelsmittelschule mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis und Berufsmaturitätsabschluss (HMS) Die HMS schliesst an die 2. Klasse der Sekundarstufe an. In den ersten drei Jahren steht der schulische Teil im Vordergrund. An schliessend absolvieren die angehenden Berufsmaturandinnen und -maturanden ein Praxisjahr. Der erfolgreiche Abschluss führt zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis Kauffrau/Kaufmann in Verbindung mit der kaufmännischen Berufsmaturität. Die HMS legt einerseits die Basis für eine qualifizierte kaufmännische Tätig keit, bietet andererseits aber auch eine Grundlage für andere, erst später zugängliche Berufe, bei denen kaufmännische und wirtschaftliche Kenntnisse von Vorteil sind. Die Berufsmaturität ermöglicht den prüfungsfreien Eintritt in die Fachhochschule. 2. Fachmittelschule (FMS) Die FMS schliesst an die 3. Klasse der Sekundarstufe an. Sie dauert 3 Jahre, schliesst mit dem Fachmittelschul-Ausweis ab und ermöglicht den Zutritt zu einer Höheren Fachschule. In e inem vierten Jahr, das im Wesentlichen aus einem Praktikum und einer Fachmaturitätsarbeit im gewählten Berufsfeld besteht, kann zu sätzlich eine Fachmaturität erworben werden, die den Zugang zu Studiengängen an Fachhochschulen eröffnet. Im Kanton Zürich werden 5 Profile angeboten: «Gesundheit und Naturwissenschaf ten», «Theater», «Musik», «Pädagogik» und «Kommunikation und Information». Im ersten Jahr ist der Unterricht in allen Profilen der gleiche. Im Verlauf dieses Basisjahres treffen die Schülerinnen und Schüler eine Profilwahl für die folgenden Jahre. Neu wird für Absolventinnen und Absolventen der Fachmittelschule mit päda gogischem Profil das Aufnahmeverfahren an der Pädagogischen Hochschule Zürich durch die Fachmaturität ersetzt. Die Fach maturität Pädagogik berechtigt zu einem prüfungsfreien Zugang zur Ausbildung als Lehrperson der Primarstufe. Sie besteht aus einem Semester Unterricht, der mit einer Prüfung abschliesst; parallel zum Unterricht wird die Fachmaturitätsarbeit verfasst. Bei entsprechendem Notenschnitt ist im Anschluss an den Fachmittelschulabschluss der prüfungsfreie Eintritt ins zweite Jahr der kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene möglich. 3. Informatikmittelschule (IMS) Die Informatikmittelschule mit Berufsmaturitätsabschluss und eidgenössischem Fähigkeitszeugnis «Informatikerin/Informatiker» basiert auf dem Konzept der HMS und richtet sich an Schülerin nen und Schüler mit grossem Interesse im Bereich Informatik. Sie schliesst an die 3. Klasse der Sekundarstufe an. Die Aus bildung dauert vier Jahre: drei Schuljahre sowie anschliessend mindestens ein Jahr Praxis in einem Informatikunternehmen oder der Informatikabteilung eines Betriebes. Die IMS bietet zwei Abschlüsse an: die kaufmännische Be rufsmaturität und das eidgenössische Fähigkeitszeugnis in Infor matik (Richtung Applikationsentwicklung). Die Abschlüsse der IMS öffnen den Zugang zu Fachhoch schulen. So erhalten Absolventinnen und Absolventen der IMS prüfungsfreien Zugang sowohl zu Informatik-Studiengängen (z. B. Kommunikation und Informatik) wie auch zu den Lehr gängen des Departements Wirtschaft und Verwaltung der Zür cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Für
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 55
Amtliches
andere Fachhochschulen gilt dies sinngemäss. Die Aufnahme prüfungen an die IMS finden jeweils bereits im Oktober/Novem ber der 3. Sekundarstufe statt. C Zulassungsbedingungen, allgemeine Hinweise 1. Vorbildung und Altersgrenze Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung für die erste Klasse des Langgymnasiums (Unterstufe) setzt grundsätzlich den Besuch von 6 Jahren Primarstufe oder eine gleichwertige Ausbildung vo raus. Es sind nur Bewerberinnen und Bewerber zur Prüfung zu gelassen, die nach dem 30. April 2000 geboren sind. Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung für die erste Klasse des Kurzgymnasiums und der Handelsmittelschule setzt grund sätzlich den Besuch von 6 Jahren Primarstufe und 2 Jahren Se kundarstufe oder eine gleichwertige Ausbildung voraus. Es wer den nur Bewerberinnen und Bewerber zur Prüfung zugelassen, die nach dem 30. April 1998 geboren sind. Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung für die erste Klasse der Fachmittelschule setzt den Besuch von 6 Jahren Primarstufe und 3 Jahren Sekundarstufe oder eine gleichwertige Ausbildung voraus. Es werden nur Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, die nach dem 30. April 1997 geboren sind. Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung für die erste Klasse der Informatikmittelschule (Eintritt im Sommer 2015) setzt den Besuch von 6 Jahren Primarstufe und 3 Jahren Sekundarstufe oder eine gleichwertige Ausbildung voraus. Es werden nur Be werberinnen und Bewerber zugelassen, die nach dem 30. April 1997 geboren sind. Für die 1. Klasse des Kurzgymnasiums, der Handelsmittel schule, der Fachmittelschule und der Informatikmittelschule gilt gleichermassen: Es werden Schüler und Schülerinnen zu den Aufnahmeprüfungen zugelassen, welche zum Zeitpunkt der An meldung die Abteilungen A oder B der Sekundarstufe besuchen. Für die Aufnahme in eine Klasse mit zweisprachiger Maturi tät (D/E, D/F) ist Englisch bzw. Französisch als Muttersprache nicht erforderlich, hingegen ein guter Notendurchschnitt in den Fächern Deutsch und Mathematik. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme. An der Aufnahmeprüfung werden diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten verlangt, die gute Schülerinnen und Schüler durch den Besuch von 6 Klassen der zürcherischen Primarstufe resp. 2 bzw. 3 Klassen der zürcherischen Sekundarstufe, je nach Mittel schultyp gemäss Abschnitt A, bis zum Prüfungstermin erwerben können. Für alle Mittelschulen sind folgende vom Bildungsrat erlas senen Anschlussprogramme verbindlich: – Primarstufe – Mittelschulen: Ausgabe Mai 2011 – Sekundarstufe – Mittelschulen: Ausgabe Mai 2011 Im Internet unter www.zentraleaufnahmepruefung.ch Für den Eintritt in höhere Klassen erstreckt sich die Aufnahme prüfung grundsätzlich auf den gesamten bis zum Prüfungstermin in der entsprechenden Klasse behandelten, lehrplanmässigen Stoff. Die Altersgrenze verschiebt sich entsprechend. Beispiele von Aufnahmeprüfungen der letzten Jahre finden sich im Internetportal www.zentraleaufnahmepruefung.ch
56 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
2. Anmeldung Schülerinnen und Schüler können grundsätzlich an die Schule ihrer Wahl angemeldet werden (§ 25 Mittelschulgesetz). Bei Über belegungen bzw. bei Unterbeständen in Schulen können bereits vor der Aufnahmeprüfung oder auch nach bestandener Auf nahmeprüfung Umteilungen vorgenommen werden. Grundlage sind dabei die regionale Zuordnung und die Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel. Es ist nicht möglich, sich gleichzeitig an zwei oder mehr Schulen zur Aufnahmeprüfung anzumelden (Ausnahmen unter 4.). Anmeldeschluss ist der 10. Februar 2015. Ausnahmen: Kunst- und Sportgymnasium Rämbühl: 15. Januar 2015, Infor matikmittelschulen: 30. September 2014 (Schuljahr 2015/16). Verspätete Anmeldungen haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung. (Dieser Termin gilt auch bei einem Schulwech sel für prüfungsfreie Übertritte aus dem Untergymnasium.) Für die Bestimmung der Erfahrungsnote bei der Aufnahme prüfung ins Langgymnasium gilt das Februarzeugnis 2015 der öffentlichen Volksschule. Für weitere Angaben verweisen wir auf die einschlägigen Aufnahmereglemente. 3. Anmeldeunterlagen Die Anmeldung erfolgt an der gewünschten Schule. Die Orien tierungsveranstaltungen finden im November/Dezember 2014 (Informatikmittelschule: August/September 2014; Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl, Kurzgymnasium: 31. Oktober 2014) statt. Die Anmeldeunterlagen können an den Orientierungsaben den bezogen, bei den Sekretariaten der einzelnen Schulen abge holt bzw. telefonisch bestellt werden. Gebühr: Fr. 20.– zuzüglich allfälliger Versandspesen. Die Anmeldung erfolgt in der Regel per Internet über die Adresse www.zentraleaufnahmepruefung.ch oder schriftlich per Anmeldeformular. Den notwendigen Zugangs code (PIN) für die Internetanmeldung bzw. das Anmeldeformular erhält man an den Orientierungsabenden oder anschliessend bei den Sekretariaten der Schulen. 4. Doppelanmeldungen Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe besteht die Möglichkeit, sich sowohl für ein Gymnasium als auch für die HMS, FMS oder IMS anzumelden. Dabei gilt Folgendes: 4.1 Doppelanmeldung Gymnasium – Handelsmittelschule Die Kantonsschulen Enge, Hottingen und Büelrain (Winterthur) führen eine Handelsmittelschule. Schülerinnen und Schüler, die sich auch für die Handelsmittelschule anmelden wollen, müssen dies auf der Gymnasiums-Anmeldung im entsprechenden Ab schnitt vermerken. Nachträgliche Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Schülerinnen und Schüler, welche an der schriftlichen Auf nahmeprüfung ans Gymnasium mindestens einen Durchschnitt von 3,87 erreichen, werden in die Handelsmittelschule aufge nommen. 4.2 Doppelanmeldung Gymnasium – Fachmittelschule Die Kantonsschulen Zürich Nord (Oerlikon) und Rychenberg (Winterthur) führen eine Fachmittelschule. Schülerinnen und Schüler, die sich auch für die Fachmittelschule anmelden wollen,
Amtliches
müssen dies auf der Gymnasiums-Anmeldung im entsprechen den Abschnitt vermerken. Nachträgliche Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Schülerinnen und Schüler legen zuerst die ordentliche Prüfung ans Gymnasium ab. Wenn sie an dieser Prüfung min destens einen Durchschnitt von 3,25 erreichen, werden sie an der Fachmittelschule zu einer Nachprüfung zugelassen. 4.3 Doppelanmeldung Gymnasium – Informatikmittelschule Die Kantonsschulen Hottingen und Büelrain (Winterthur) führen eine Informatikmittelschule. Wer bereits an die IMS aufgenom men ist (Prüfung im Oktober 2014 für Schuljahr 2015/16), kann sich auch noch für die Prüfung an ein Kurzgymnasium anmelden, sofern die Altersgrenze nicht überschritten ist. Die bestandene IMS-Prüfung gilt nicht als prüfungsfreier Zutritt ans Kurzgymna sium. 4.4 Doppelanmeldungen HMS – FMS, HMS – IMS oder FMS – IMS sind nicht möglich. 5. Aufnahmeprüfungen Die Aufnahmeprüfungen an die Lang- und Kurzgymnasien so wie an die Handels- und Fachmittelschulen werden je einheitlich durchgeführt. Die Aufgaben richten sich nach dem kantonalen Anschlussprogramm und entsprechen in der Art den bisherigen Prüfungen. Die Orientierungsveranstaltungen finden im Oktober/November/Dezember 2014 statt. Anmeldeschluss ist der 10. Februar 2015. Ausnahmen: Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl: 15. Januar 2015, Informatikmittelschulen: 30. Sep tember 2014. 5.1 Schriftliche Prüfungen Die schriftlichen Prüfungen werden am Montag, 9. März 2015 (Langgymnasium nur 9. März 2015), und Dienstag, 10. März 2015, je am Vormittag an der Schule durchgeführt, an der man sich angemeldet hat (Umteilungen vorbehalten). Schriftliche Prüfun gen IMS für Schuljahr 2015/16: Montag/Dienstag, 27./28. Okto ber 2014. 5.2 Mündliche Prüfungen (nur Kurzgymnasien, Handelsmittelschulen, Fachmittelschulen) Die mündlichen Prüfungen – nur für Grenzfälle – finden gemäss individuellem Aufgebot am Mittwoch, 25. März 2015, statt. 5.3 Nachprüfungen Für Schülerinnen und Schüler, die wegen Krankheit oder Unfall verhindert sind, die Prüfung abzulegen, finden Nachprüfungen statt. In solchen Fällen ist ein ärztliches Zeugnis einzureichen. Eine abgelegte Prüfung ist gültig und kann nicht wegen nach träglich geltend gemachter Krankheit wiederholt werden. Termine der Nachprüfungen an die Lang- und Kurzgymnasien sowie Handels- und Fachmittelschulen: – Nachprüfung schriftlich: Montag, 30. März 2015 (Langgymnasium); Montag/Dienstag, 30./31. März 2015 (Kurzgymnasium, Fachmittelschule, Handelsmittelschule), – Nachprüfung mündlich: Dienstag, 14. April 2015 (Kurzgymnasium, Fachmittelschule, Handelsmittelschule)
D Ausschreibung der einzelnen Schulen Kantonsschulen in Zürich Kantonsschule Hohe Promenade, Literargymnasium Rämibühl und Realgymnasium Rämibühl Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Unterstufe Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) IB (Literar- und Realgymnasium) a) Schriftliche Anmeldungen sind (je nach Zuteilungswunsch) zu richten an: – www.kshp.ch. oder Kantonsschule Hohe Promenade, Promenadengasse 11, Postfach, 8090 Zürich, Telefon 044 224 64 64 – www.lgr.ch oder Literargymnasium Rämibühl, Rämistrasse 56, 8001 Zürich (Erdgeschoss), Telefon 044 265 62 11 – www.rgzh.ch oder Realgymnasium Rämibühl, Rämistrasse 56, 8001 Zürich (1. Stock), Telefon 044 265 63 12 b) Orientierungsabend Mittwoch, 12. November 2014, 17.00 Uhr, 18.00 Uhr, 19.00 Uhr, 20.00 Uhr, Aula der Kantonsschule Rämibühl, Cäcilienstrasse 1, 8032 Zürich (Nähe Kunsthaus und Hottinger platz; Tramlinien 3, 5, 8 und 9; gebührenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage Rämibühl, Einfahrt Zürichbergstrasse 10) c) Schnuppertage für künftige Erstklässlerinnen/Erstklässler und deren Eltern – Kantonsschule Hohe Promenade: Donnerstag, 4. Dezember 2014 (Anmeldung nicht nötig) – Literargymnasium Rämibühl: Donnerstag, 4. Dezember 2014 (ohne Anmeldung) – Realgymnasium Rämibühl: Donnerstag, 11. Dezember 2014 (Anmeldung auf www.rgzh.ch ab November) Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) – Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) a) Adresse www.mng.ch oder Rektorat des Mathematisch-Naturwissen schaftlichen Gymnasiums Rämibühl (MNG), Rämistrasse 58, 8001 Zürich, Telefon 044 265 64 64 b) Orientierungsabende – Anschluss an die Sekundarstufe: Donnerstag, 13. November 2014, 20.00 Uhr – Anschluss an die Unterstufe des Langgymnasiums: Donnerstag, 13. November 2014, 17.00 Uhr
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 57
Amtliches
jeweils in der Aula der Kantonsschule Rämibühl, Cäcilien strasse 1, 8032 Zürich (Nähe Steinwiesplatz; gebührenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage Rämibühl, Einfahrt Zürichberg strasse 10) c) Besuchstag für Interessierte: Montag, 1. Dezember 2014 Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl (am MNG Rämibühl) – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Unterstufe – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe bzw. die Unterstufe des Gymnasiums: MusikerInnen: Musisches Profil mit Schwerpunktfach Musik SportlerInnen/TänzerInnen: Neusprachliches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil mit Schwer punktfach Biologie und Chemie a) Adresse www.ksgymnasium.ch oder Rektorat des Mathematisch- Naturwissenschaftlichen Gymnasiums Rämibühl, Rämistrasse 58, 8001 Zürich, Telefon 044 265 64 64 b) Orientierungsabende – Anschluss an die Sekundarstufe und die Unterstufe des Langgymnasiums: Donnerstag, 30. Oktober 2014, 20.00 Uhr – Anschluss an die Primarstufe: Donnerstag, 6. November 2014, 19.00 Uhr jeweils in der Aula der Kantonsschule Rämibühl, Cäcilien strasse 1, 8032 Zürich (Nähe Steinwiesplatz; gebührenpflichtige Parkplätze in der Tiefgarage Rämibühl, Einfahrt Zürichberg strasse 10) Kantonsschulen Freudenberg und Wiedikon Zürich Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Unterstufe Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Musisches Profil Zweisprachige Maturität – Deutsch/Englisch (KS Wiedikon) – Deutsch/Französisch (KS Freudenberg) a) Adressen – Rektorat der Kantonsschule Wiedikon oder www.kwi.ch Goldbrunnenstrasse 80, 8055 Zürich, Tel. 044 457 71 11 oder – Rektorat der Kantonsschule Freudenberg oder www.kfr.ch Gutenbergstrasse 15, Postfach 1864, 8027 Zürich, Tel. 044 286 77 11 b) Orientierungsabende – Montag, 17. November 2014, 20.00 Uhr (Familiennamen A–M) – Dienstag, 18. November 2014, 20.00 Uhr (Familiennamen N–Z) jeweils in der Aula der Kantonsschule Freudenberg, Brand schenkestrasse 125, 8002 Zürich (keine Parkplätze vorhanden)
58 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
c) Besuchsanlässe für Primarschülerinnen und Primarschüler Besuchstage (Kantonsschule Wiedikon) – Donnerstag, 8. Januar 2015, Nachmittag 13.30–15.55 Uhr (Familiennamen A–M) – Donnerstag, 15. Januar 2015, Nachmittag 13.30–15.55 Uhr (Familiennamen N–Z) Treffpunkt jeweils: reformiertes Kirchgemeindehaus, Bühlstrasse 9/11 Schnuppervormittag (Kantonsschule Freudenberg) – Mittwoch, 10. Dezember 2014, 8.45–12.15 Uhr Besammlung in der Aula der Kantonsschule Freudenberg, Brandschenkestrasse 125 Kantonsschule Wiedikon Zürich – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Musisches Profil – Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Musisches Profil a) Adresse www.kwi.ch oder Rektorat der Kantonsschule Wiedikon, Goldbrunnenstrasse 80, 8055 Zürich, Telefon 044 457 71 11 b) Orientierungsabend Montag, 10. November 2014, 20.00 Uhr, im Singsaal der Kantonsschule Wiedikon, Schulhaus Schrennengasse 7, 8003 Zürich, 2. Stock, Zimmer 208 (Eingang Pausenplatz, Goldbrunnenstrasse 80; keine Parkplätze) c) Besuchstag für Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler Mittwoch, 26. November 2014, Nachmittag 13.15 –16.00 Uhr Treffpunkt: reformiertes Kirchgemeindehaus, Bühlstrasse 9/11 Kantonsschule Enge Zürich – Anschluss an die 2.oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Wirtschaftlich-rechtliches Profil Neusprachliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch im Profil W+R) Akzent «Internationale Zusammenarbeit und Nachhaltig keit» (in den Profilen N und W+R) Handelsmittelschule – Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Wirtschaftlich-rechtliches Profil Neusprachliches Profil mit Russisch Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch im Profil W+R) Akzent «Internationale Zusammenarbeit und Nachhaltig keit» (in den Profilen N und W+R) Handelsmittelschule a) Adresse www.ken.ch oder Rektorat der Kantonsschule Enge, Steinentischstrasse 10, 8002 Zürich, Telefon 044 286 76 11 b) Orientierungsabend Dienstag, 11. November 2014, 19.00 Uhr, in der Aula der Kantonsschule Enge, Brandschenkestrasse 125, 8002 Zürich, keine Parkplätze vorhanden
Amtliches
c) Schnupper- und Besuchstage Donnerstag, 8. Januar, und Freitag, 9. Januar 2015, von 7.50 bis 16.00 Uhr, keine Parkplätze vorhanden Kantonsschule Hottingen Zürich – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Wirtschaftlich-rechtliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) Akzentklasse in Ethik und Ökologie Akzentklasse Entrepreneurship Handelsmittelschule – Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Wirtschaftlich-rechtliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) Akzentklasse in Ethik und Ökologie Akzentklasse Entrepreneurship Handelsmittelschule – Anschluss an die 3. Klasse der Sekundarstufe und des Gymnasiums: Informatikmittelschule a) Adresse www.ksh.ch oder Rektorat der Kantonsschule Hottingen, Minervastrasse 14, 8032 Zürich, Telefon 044 266 57 57, E-Mail: hottingen@ksh.ch b) Orientierungsabende – Dienstag, 18. November 2014, 19.30 Uhr, Aula Kantonsschule Hottingen, Gymnasium und Handels mittelschule für Schuljahr 2015/16 – Mittwoch, 3. September 2014, 19.30 Uhr, Aula Kantonsschule Stadelhofen, Informatikmittelschule für Schuljahr 2015/16 Vororientierung Informatikmittelschule für das Schuljahr 2016/17 1. Orientierungsabend: Mittwoch, 2. September 2015, Aula Kantonsschule Hottingen 2. Anmeldeschluss: Mittwoch, 30. September 2015 3. Aufnahmeprüfung (nur schriftlich): Montag/Dienstag, 26./27.10.2015 Kantonsschule Zürich Nord – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Gymnasium: Unterstufe als Vorbereitung für alle Profile – Anschluss an die Unterstufe oder die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Gymnasium: Altsprachliches Profil (nur im Anschluss an die Unterstufe) Neusprachliches Profil Mathematisch-Naturwissenschaftliches Profil Musisches Profil zusätzlich: zweisprachige Maturität Deutsch/Englisch in den sprachlichen Profilen zusätzlich: zweisprachige Maturität Deutsch/Französisch in allen Profilen Wirtschaftlich-rechtliches Profil
–
Anschluss an die 3. Klasse der Sekundarstufe: Fachmittelschule: Basisjahr, dann Profil Gesundheit und Naturwissenschaften Profil Kommunikation und Information Profil Pädagogik Profil Musik Profil Theater
a) Information und Anmeldung – Kantonsschule Zürich Nord, www.kzn.ch, zap.anmeldungen@kzn.ch – Telefonische oder persönliche Auskunft über das Gymnasium (Anschluss an Primar- und Sekundarstufe) und die Fachmittelschule (Anschluss an 3. Klasse Sekundarschule): Tel. 044 317 23 00 b) Orientierungsabende – Gymnasium, Anschluss an die Primarstufe: Montag, 17. November 2014, 19.00 Uhr Dienstag, 18. November 2014, 19.00 Uhr Mittwoch, 19. November 2014, 19.00 Uhr – Gymnasium, Anschluss an die Sekundarstufe: Mittwoch, 12. November 2014, 19.00 Uhr – Fachmittelschule, Anschluss an die Sekundarstufe: Donnerstag, 13. November 2014, 19.00 Uhr jeweils in der Aula der Kantonsschule Zürich Nord, Birchstrasse 97, 8050 Zürich c) Schulführungen für neue Schülerinnen und Schüler – Gymnasium, Anschluss an die Primarstufe: Mittwochnachmittag, 10. Dezember 2014 Mittwochnachmittag, 17. Dezember 2014 Mittwochnachmittag, 7. Januar 2015 Mittwochnachmittag, 14. Januar 2015 Mittwochnachmittag, 21. Januar 2015 Für die Teilnahme an den Schulführungen ist eine Anmeldung über die Website der Kantonsschule Zürich Nord (www.kzn.ch) erforderlich. d) Schnuppertage – Fachmittelschule, Anschluss an die Sekundarstufe: Freitag, 28. November 2014, 7.30 bis 15.05 Uhr Donnerstag, 8. Januar 2015, 7.30 bis 15.05 Uhr Montag, 26. Januar 2015, 7.30 bis 15.05 Uhr Die FMS organisiert spezielle Schnuppertage für Sekundarschü lerinnen und Sekundarschüler mit Interesse am schulgestützten Weg in die Gesundheitsberufe (FMS Profil Gesundheit und Na turwissenschaften). Die Termine dieser Schnuppertage werden auf der Website der Kantonsschule Zürich Nord www.kzn.ch publiziert. Für die Teilnahme an den Schnuppertagen der FMS ist eine Anmeldung über das Rektorat der Kantonsschule Zürich Nord (Tel. 044 317 23 00) erforderlich.
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 59
Amtliches
Kantonsschule Stadelhofen Zürich – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch im Neusprachlichen Profil) Musisches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil mit Schwerpunktfach Biologie und Chemie – Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Musisches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil mit Schwerpunktfach Biologie und Chemie a) Adresse www.ksstadelhofen.ch oder Rektorat der Kantonsschule Stadelhofen, Schanzengasse 17, 8001 Zürich, Telefon 044 268 36 60 b) Orientierungsabend (doppelt geführt!) Montag, 17. November 2014, 18.00 Uhr und 19.30 Uhr, Saal Hallenbau Kantonsschule Stadelhofen, Promenaden gasse 5, 8001 Zürich Liceo Artistico an der Kantonsschule Freudenberg Zürich – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Musisches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Italienisch) – Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Musisches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Italienisch) a) Zusätzlich wird eine gestalterische Prüfung gemäss esonderem Aufgebot durchgeführt. b b) Adresse www.liceo.ch oder Liceo Artistico, Parking 30, Postfach, 8027 Zürich, Telefon 044 202 80 40 c) Orientierungsabend Freitag, 21. November 2014, 19.00 Uhr, in der Aula der Kantonsschule Freudenberg, Brandschenkestrasse 125, 8002 Zürich d) Schnupperhalbtag für interessierte Schülerinnen und Schüler Mittwoch, 10. Dezember 2014, 13.30 bis 16.30 Uhr Anmeldung per Mail über sekretariat@liceo.ch e) Offener Samstag – Besuchsmorgen Samstag, 17. Januar 2015, von 8.45 bis 12.00 Uhr Kantonsschulen in Winterthur Kantonsschule Büelrain – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Wirtschaftlich-rechtliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) Handelsmittelschule
60 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
–
–
Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Wirtschaftlich-rechtliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) Handelsmittelschule Anschluss an die 3. Klasse der Sekundarstufe und des Gymnasiums: Informatikmittelschule
a) Adresse www.kbw.ch oder Sekretariat der Kantonsschule Büelrain, Rosenstrasse 1, 8400 Winterthur, Telefon 052 260 03 03 b) Orientierungsabende – Wirtschaftsgymnasium Anschluss an die Unterstufe des Langgymnasiums: Montag, 8. Dezember 2014, 19.00 Uhr, in der Aula der Kantonsschule Im Lee, Rychenbergstrasse 120, 8400 Winterthur – Wirtschaftsgymnasium und Handelsmittelschule Anschluss an die Sekundarstufe: Mittwoch, 12. November 2014, 20.00 Uhr, in der Aula der Kantonsschule Büelrain, Rosenstrasse 1, 8400 Winterthur – Informatikmittelschule: Donnerstag, 28. August 2014 (Schuljahr 2015/16), 20.00 Uhr, in der Aula der Kantons schule Büelrain, Rosenstrasse 1, 8400 Winterthur c) Schnuppertage – Dienstag, 16. September 2014, nur für Informatikmittelschule – Mittwoch, 10. Dezember 2014, für alle Profile – Dienstag, 20. Januar 2015, für alle Profile Anmeldeunterlagen über www.kbw.ch oder via E-Mail: mw@kbw.ch d) Besuchstage Donnerstag, 26. Februar, und Freitag, 27. Februar 2015 Vororientierung Informatikmittelschule für das Schuljahr 2016/17 1. Orientierungsabend: Donnerstag, 27. August 2015, in der Aula der Kantonsschule Büelrain 2. Anmeldeschluss: Mittwoch, 30. September 2015 3. Aufnahmeprüfung (nur schriftlich): Montag/Dienstag, 26./27. Oktober 2015 Kantonsschule Im Lee – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Musisches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) – Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Musisches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) a) Adresse www.ksimlee.ch oder Rektorat der Kantonsschule Im Lee, R ychenbergstrasse 140, 8400 Winterthur, Telefon 052 244 05 05
Amtliches
b) Orientierungsabende – Anschluss an die Sekundarstufe: Montag, 10. November 2014, 20.00 Uhr – Anschluss an die Unterstufe des Langgymnasiums: Montag, 8. Dezember 2014, 19.00 Uhr jeweils in der Aula der Kantonsschulen Im Lee und Rychenberg, Rychenbergstrasse 120, 8400 Winterthur c) Schnupperhalbtage auf Anfrage Kantonsschule Rychenberg – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Unterstufe Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) – Anschluss an die 3. Klasse der Sekundarstufe: Fachmittelschule a) Adresse www.ksrychenberg.ch oder Rektorat der Kantonsschule R ychenberg, Rychenbergstrasse 110, 8400 Winterthur, Telefon 052 244 04 04 b) Orientierungsabende – Gymnasium: Dienstag, 11. November 2014, 18.00 und 20.00 Uhr – Fachmittelschule: Donnerstag, 13. November 2014, 19.30 Uhr – Profilwahlabend: Dienstag, 9. Dezember 2014, 19.30 Uhr jeweils in der Aula der Kantonsschule Rychenberg, R ychenbergstrasse 110, 8400 Winterthur Kantonsschulen Zürcher Landschaft Kantonsschule Küsnacht – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Neusprachliches Profil Musisches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) – Anschluss an die Unterstufe des Gymnasiums: Neusprachliches Profil Musisches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch) – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Zweisprachiges Untergymnasium (Deutsch/Englisch) a) Adresse www.kantonsschulekuesnacht.ch oder Rektorat der Kantonsschule Küsnacht, Dorfstrasse 30, 8700 Küsnacht, Telefon 044 913 17 17 b) Orientierungsabende – Musisches und neusprachliches Profil, Zweisprachige Maturität: Donnerstag, 20. November 2014, 20.00 Uhr – Zweisprachiges Untergymnasium: Dienstag, 11. November 2014, 20.00 Uhr jeweils in der HesliHalle, Untere Heslibachstrasse 33, Küsnacht
c) Öffentliche Besuchstage Donnerstag, 8. Januar, und Freitag, 9. Januar 2015 (jeweils 8.00–15.50 Uhr) Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Unterstufe – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil Musisches Profil a) Adresse www.kzo.ch oder Rektorat der Kantonsschule Zürcher Oberland, Bühlstrasse 36, Postfach 1265, 8620 Wetzikon, Telefon 044 933 08 11 b) Orientierungsabende – Anschluss an die Primarstufe: Dienstag, 9. Dezember 2014, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr – Anschluss an die Sekundarstufe: Montag, 8. Dezember 2014, 19.30 Uhr jeweils in der Aula der Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon c) Öffentlicher Besuchsmorgen Mittwoch, 7. Januar 2015, 7.30 bis 12.05 Uhr (inkl. Fragestunde), keine Anmeldung nötig Kantonsschule Uster – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Unterstufe Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil Musisches Profil – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Neusprachliches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil Musisches Profil a) Adresse www.ksuster.ch oder Sekretariat der Kantonsschule Uster, Krämerackerstrasse 11, Gebäude F, 8610 Uster, Telefon 043 444 27 27 b) Orientierungsabende – Anschluss an die Primarstufe: Mittwoch/Donnerstag, 12./13. November 2014, 19.30 Uhr Festsaal Wagerenhof, Asylstrasse 24, 8610 Uster – Anschluss an die Sekundarstufe: Dienstag, 18. November 2014, 19.30 Uhr Aula Kantonsschule Uster (Gebäude A, A01), Krämerackerstrasse 11, 8610 Uster
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 61
Amtliches
c) Schnupperhalbtage – Freitag, 12. Dezember 2014, vormittags – Freitag, 9. Januar 2015, vormittags Anmeldung über Internet erforderlich d) Besuchstag Mittwoch, 3. Dezember 2014 Kantonsschule Zürcher Unterland, Bülach – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Unterstufe Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Immersiver Lehrgang mit alt- bzw. neusprachlichem Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Musisches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil – Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Immersiver Lehrgang mit alt- bzw. neusprachlichem Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Musisches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil a) Adresse www.kzu.ch oder Rektorat der Kantonsschule Zürcher Unterland, Kantonsschulstrasse 23, 8180 Bülach, Telefon 044 872 31 31 b) Orientierungsabende – Anschluss an die Primarstufe, für Interessierte aus dem Bezirk Dielsdorf: Dienstag, 11. November 2014, 19.30 Uhr – Anschluss an die Primarstufe, für Interessierte aus dem Bezirk Bülach: Mittwoch, 12. November 2014, 19.30 Uhr – Anschluss an die Sekundarstufe für alle Interessierten: Montag, 10. November 2014, 19.30 Uhr jeweils in der Aula der Kantonsschule Zürcher Unterland, Kantonsschulstrasse 23, 8180 Bülach c) Besuchstage für Schülerinnen und Schüler der Volksschule – allgemeiner Besuchstag/Schnuppertag: Freitag, 21. November 2014 (Unterricht nach Stunden plan / 7.55 Uhr) – Tag der offenen Tür/Schnuppertag: Samstag, 22. November 2014 (1.– 3. Klassen; Unterricht gemäss spez. Stundenplan / 8.45 Uhr) Kantonsschule Limmattal Urdorf – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: Unterstufe Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Musisches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch)
62 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
–
Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Neusprachliches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Musisches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil Zweisprachige Maturität (Deutsch/Englisch)
a) Adresse www.kslzh.ch oder Rektorat der Kantonsschule Limmattal, In der Luberzen 34, 8902 Urdorf, Telefon 044 736 14 14 b) Orientierungsabende – Anschluss an die Primarstufe: Dienstag, 11. November 2014, 19.00 Uhr – Anschluss an die Sekundarstufe: Mittwoch, 12. November 2014, 19.00 Uhr jeweils in der Mensa der Kantonsschule Limmattal, In der Luberzen 34, 8902 Urdorf c) Öffentliche Besuchstage Donnerstag, 15. Januar, und Freitag, 16. Januar 2015, Unterricht nach Stundenplan E Anerkannte nichtstaatliche Mittelschulen Freie Evangelische Schule – Fachmittelschule Anschluss an die 3. Klasse der Sekundarstufe: Profile: Pädagogik Kommunikation und Information Soziales Gesundheit und Naturwissenschaften a) Anmeldeadresse Freie Evangelische Schule, Fachmittelschule, Kreuzstrasse 72, 8008 Zürich, Telefon 043 336 70 00, Fax 043 336 70 07, E-Mail: sekretariat.fms@fesz.ch b) Orientierungsabend – 1. Informationsabend an der Kreuzstrasse 72, Aula, Dienstag, 4. November 2014, 18.00 Uhr – Tag der offenen Tür für interessierte Lernende an der Kreuzstrasse 72: Donnerstag, 6. November 2014, 8.00–14.50 Uhr – 2. Informationsabend an der Kreuzstrasse 72, Aula, Donnerstag, 15. Januar 2015, 18.00 Uhr c) Aufnahmeprüfungen – Schriftlich: Montag, 16. März 2015, in den Fächern Deutsch, Französisch, Englisch und Mathematik – Mündlich: Dienstag, 17. März 2015, für alle Kandidaten/ Kandidatinnen nach individuellem Plan in den Fächern Deutsch und Mathematik Anmeldeschluss für die Aufnahmeprüfung ist Montag, 2. März 2015
Amtliches
Freies Gymnasium Zürich – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: einsprachige oder zweisprachige gymnasiale und progymnasiale Unterstufe (Deutsch/Englisch) – Anschluss an die 2. bzw. 3. Klasse der Sekundarstufe: einsprachig oder zweisprachig (Deutsch/Englisch) Neusprachliches Profil Altsprachliches Profil Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil a) Anmeldeadresse Freies Gymnasium, Sekretariat, Arbenzstrasse 19, Postfach, 8034 Zürich, Telefon 043 456 77 77; Fax 043 456 77 78; E-Mail: sekretariat@fgz.ch b) Orientierungsveranstaltungen – Dienstag, 28. Oktober 2014, 18.30 Uhr: Informationen zur zweisprachigen Ausbildung – Mittwoch, 5. November 2014, 18.30 Uhr: Informationen über alle unsere Abteilungen – Samstag, 6. Dezember 2014, 10.00 Uhr: Informationen über alle unsere Abteilungen – Mittwoch, 21. Januar 2015, 18.30 Uhr: Informationen zu den Vorbereitungsklassen – Halbtage der offenen Tür Samstag, 10. Januar 2015, von 8.20 bis 11.40 Uhr Samstag, 31. Januar 2015, von 9.10 bis 11.40 Uhr c) Aufnahmeprüfungen Lang- und Kurzgymnasium Schriftlich: Montag bis Mittwoch, 9. bis 11. März 2015 Mündlich: Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. März 2015 Gymnasium der Freien Katholischen Schulen Zürich Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe und 10. Schuljahr: Altsprachliches Profil Neusprachliches Profil Wirtschaftlich-rechtliches Profil a) Anmeldeadresse Gymnasium der Freien Katholischen Schulen Zürich, Sekretariat Sumatrastrasse 31, 8006 Zürich, Telefon 044 360 82 40; Fax 044 360 82 41, E-Mail: gymnasium@fksz.ch, www.fksz.ch Anmeldeschluss: Freitag, 27. Februar 2015 b) Orientierungsabende – Informationsabend: Mittwoch, 5. November 2014, 19.30 Uhr – Informationsabend: Dienstag, 2. Dezember 2014, 19.30 Uhr – Informationsabend: Donnerstag, 8. Januar 2015, 19.30 Uhr im Saal des Gymnasiums, Sumatrastrasse 31, 8006 Zürich – Schulbesuchstage für interessierte Eltern und Schüler/innen Freitag und Samstag, 16. und 17. Januar 2015
c) Aufnahmeprüfungen Schriftlich: Montag und Dienstag, 9. und 10. März 2015 Mündlich: Mittwoch, 25. März 2015 Möglichkeit der Passerelle vom 10. Schuljahr der Freien Kath. Schulen Zürich zur Aufnahmeprüfung in die 1. oder 2. Klasse des Kurzgymnasiums. Gymnasium Unterstrass Anschluss an die 2. oder 3. Klasse der Sekundarstufe: Musisches Profil Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie a) Anmeldeadresse Gymnasium Unterstrass, Sekretariat, Seminarstrasse 29, 8057 Zürich, Telefon 043 255 13 33; Fax 043 255 13 00, E-Mail: gymnasium@unterstrass.edu Anmeldeschluss: Dienstag, 20. Januar 2015 b) Orientierungsabende – Schnuppermorgen für interessierte Schüler/innen: Dienstag, 25. November 2014, 7.50–12.20 Uhr – 1. Informationsabend: Donnerstag, 27. November 2014, 19.30 Uhr – 2. Informationsabend: Dienstag, 13. Januar 2015, 19.30 Uhr jeweils im Theatersaal des Gymnasiums Unterstrass, Seminarstrasse 29, 8057 Zürich (beim Schaffhauserplatz) – Tag der offenen Tür: Freitag, 16. Januar 2015, 7.50–16.30 Uhr c) Aufnahmeprüfungen Schriftlich: Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Januar 2015 Mündlich: Montag bis Mittwoch, 2. und 3. März 2015 ChagALL Förderprogramm für begabte, jugendliche igrantinnen und Migranten: M Kostenlose Intensivvorbereitung auf Mittelschul-Aufnahmeprü fungen (Kurzgymnasium, FMS, BMS) während dem 9. Schuljahr (jeweils am Mittwochnachmittag und am Samstagvormittag) a) Anmeldeadresse: Gymnasium Unterstrass, ChagALL, Seminarstrasse 29, 8057 Zürich, Telefon 043 255 13 33, Fax 043 255 13 00, E-Mail: stefan.marcec@unterstrass.edu Anmeldeschluss: Dienstag, 26. Mai 2015 b) Informationen siehe www.unterstrass.edu/projekte/chagall/ c) Aufnahmeverfahren ab Frühjahr 2015 via Sekundar lehrperson Atelierschule Zürich Integrative Mittelschule der Rudolf Steiner Schulen Sihlau, W interthur und Zürich Anschluss an 9. Klasse aus Rudolf Steiner Schulen oder aus 3. Sekundarstufe Schwerpunktfach-Angebot: Mathematisch-naturwissenschaftliches Profil: Biologie & Chemie Musisches Profil: Bildnerisches Gestalten oder Musik
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 63
Amtliches
a) Anmeldeadresse Atelierschule Zürich, Sekretariat, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich, Telefon 043 268 20 50, Fax 043 268 20 51, E-Mail: info@atelierschule.ch, www.atelierschule.ch Anmeldeschluss: 31. Januar 2015 b) Orientierungsabende – 1. Informationsabend: Montag, 12. Januar 2015, 19.00–21.00 Uhr – 2. Informationsabend: Montag, 19. Januar 2015, 19.00–21.00 Uhr im Musiksaal Atelierschule Zürich, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich – Tag der offenen Tür: Mittwoch, 28. Januar 2015, 8.00–15.30 Uhr – Hospitationstag: Donnerstag, 15. Januar 2015, 9.00–17.00 Uhr (mit Anmeldung) c) Aufnahmeprüfungen Schriftlich: Dienstag, 24. März, und Mittwoch, 25. März 2015 Mündlich: nach Vereinbarung d) Aufnahmegespräche ab Februar 2015 SIS, Swiss International School – Anschluss an die 6. Klasse der Primarstufe: zweisprachiges Untergymnasium (Deutsch/Englisch) zweisprachige Sekundarschule A (Deutsch/Englisch) – Anschluss an die 2. bzw. 3. Klasse der Sekundarstufe: zweisprachiges Kurzgymnasium (Deutsch/Englisch) Schwerpunkte: Wirtschaft und Recht Philosophie/Pädagogik/Psychologie a) Anmeldeadresse SIS Swiss International School, Seidenstrasse 2, 8304 Wallisellen, Telefon: 044 388 99 44, E-Mail: info.zuerich@swissinternationalschool.ch b) Orientierungsveranstaltungen Individuelle Beratungsgespräche nach telefonischer Vereinbarung jederzeit möglich Tage der offenen Tür: – Dienstag, 4. November 2014, 8.30–12.00 Uhr – Donnerstag, 9. April 2015, 8.30–12.00 Uhr Schnuppertage nach Vereinbarung c) Aufnahmeprüfungen Lang- und Kurzgymnasium Schriftlich: Montag und Dienstag, 11. und 12. Mai 2015 Mündlich: nach Vereinbarung
64 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Bildungsratsbeschluss vom 7. Juli 2014 Überarbeitung und Erweiterung der Lernplattform Lernpass auf der Sekundarstufe I der Volksschule Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Die Überarbeitung und Erweiterung von Lernpass für die 7. bis 9. Klasse (Sekundarstufe I) ist auf der Grundlage des vorliegenden Konzepts vorzunehmen. II. Die Überarbeitung und Erweiterung von Lernpass erfolgt in Koordination mit dem Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. Die Federführung liegt beim Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. III. Die Lehrpersonen der Sekundarstufe I werden bei der Entwicklung der Orientierungsaufgaben und der Lernmodule sowie bei der Erprobung der Erweiterung von Lernpass einbezogen. IV. Für das Know-how in der Fachdidaktik, der Psycho metrie, der Erstellung und Überprüfung des Aufgabenpools und der Aus- und Weiterbildung werden nach Möglichkeit die Pädagogischen Hochschulen Zürich und St. Gallen einbezogen. V. Der Lehrmittelverlag Zürich wird beauftragt, für die Überarbeitung und Weiterentwicklung von Lernpass eine Kooperation mit dem Lehrmittelverlag St. Gallen einzugehen. VI. Der Lehrmittelverlag Zürich wird beauftragt, unter Einbezug der Bildungsplanung und des Volksschulamtes für die Einzelheiten der Normierung im Kanton Zürich dem Bildungsrat Antrag zu stellen. Der ganze Bildungsratsbeschluss ist abrufbar unter www.bi.zh.ch/bildungsrat
Bildungsratsbeschluss vom 7. Juli 2014 Kriterien und Verfahren zur Festlegung der Einzugsgebiete von Berufsfachschulen A. Ausgangslage Gemäss § 3 lit. a des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 14. Januar 2008 (EG BBG) bestimmt der Bildungsrat das Einzugsgebiet der einzelnen Berufsfach schulen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Lehrbe triebe. An seiner Sitzung vom 27. Mai 2013 hat der Bildungsrat Richtlinien zur Berufszuteilung an Berufsfachschulen erlassen. Darin hat er festgehalten, dass der Bildungsrat aufgrund der Komplexität des Verfahrens, der grossen Anzahl von Einzelfällen und der kurzfristig zu fällenden Entscheide Kriterien und Ver fahren zur Bestimmung des Einzugsgebiets festlegt und die da rauf gestützte Umsetzung durch das MBA erfolgt. Gleichzeitig hat er das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) beauftragt, ihm bis im Herbst 2014 ein Konzept mit Kriterien und Verfahren zur Festlegung der Einzugsgebiete von Berufsfachschulen zum Entscheid vorzulegen. Das MBA hat mit Unterstützung der Firma Res Publica Con sulting (RPC), welche bereits bei der Entwicklung der Richtlinien mitgewirkt hat, ein solches Konzept erarbeitet. Dabei wurden die bisher angewandten Grundsätze und Verfahrensweisen berück sichtigt.
Amtliches
B. Erwägungen Bei der erstmaligen Zuweisung eines Berufs an eine oder meh rere Berufsfachschulen erfolgt die Festlegung des Einzugsge biets durch den Bildungsrat. Veränderungen eines bereits durch den Bildungsrat bestimmten Einzugsgebietes werden ausgelöst durch die Veränderung des Standortes eines Lehrbetriebs, den Antrag einer Schule, eines einzelnen Lehrbetriebs oder einer Or ganisation der Arbeitswelt. Weiter kann das MBA selbst aktiv werden, wenn sich zum Beispiel die Anzahl der Lehrverhältnisse wesentlich ändert und damit eine Anpassung der Anzahl Schul orte bzw. die Eröffnung eines weiteren Schulortes angezeigt ist. Dabei spielen neben schulorganisatorischen, räumlichen und be triebswirtschaftlichen Aspekten (Klassengrösse, Auslastung des Schulraums, ausgewogene Auslastung der Berufsfachschulen) auch die Professionalität und Qualität des Unterrichts eine wich tige Rolle. Drei Kriterien werden für die Zuordnung von Standortge meinden und Lehrbetrieben zum Einzugsgebiet von Berufsfach schulen und von Veränderungen dieses Einzugsgebietes ver wendet: – Erreichbarkeit Wird ein Beruf an mehreren Standorten angeboten, erfolgt die Zuweisung in der Regel zum Standort mit der besten Erreichbarkeit, d. h. der kürzesten Reisezeit mit den öffentli chen Verkehrsmitteln. Neben der Distanz zwischen Berufs fachschule und Lehrbetrieben kann auch die Distanz zwi schen Lehrbetrieb und den Zentren, die überbetriebliche Kurse anbieten, berücksichtigt werden. –
–
Besondere Verhältnisse Liegen besondere Verhältnisse vor, können Ausnahmen be willigt werden. Bsp. wenn: – der Lehrbetrieb mit anderen Lehrbetrieben eng zusam menarbeitet, die einem anderen Einzugsgebiet einer Berufsfachschule zugeordnet sind; – die Zusammenarbeit zwischen Lehrbetrieb und Berufs fachschule ernsthaft und unüberbrückbar gestört ist; – ein Lehrbetrieb umzieht und durch die Neuzuordnung des Schulstandorts die ausgewogene Auslastung der betroffenen Berufsfachschulen erheblich gestört würde. Räumliche Kapazitäten und ausgewogene Auslastung der Berufsfachschulen Die Kriterien Erreichbarkeit und besondere Verhältnisse sind gegenüber der räumlichen Kapazität der Berufsfachschulen abzuwägen. Würden durch die Zuteilung an eine Berufs fachschule räumliche Engpässe entstehen, die nur mit bau lichen Massnahmen behoben werden könnten, oder müss ten dauerhaft zusätzliche Klassen geführt werden, kann vom Grundsatz der besten Erreichbarkeit und der Berücksich tigung besonderer Verhältnisse abgewichen werden. Um einen qualitativ hochstehenden und fachlich kompetenten Unterricht zu gewährleisten, ist ein Mindestpensum für den berufskundlichen Unterricht und damit eine ausgewogene Auslastung notwendig. Die Grösse der Fachschaft und die Anzahl Klassen pro Lehrjahr sind bei der Änderung des Ein zugsgebiets entsprechend zu berücksichtigen.
Das Einzugsgebiet von Berufsfachschulen wird unter Berücksich tigung der vorliegenden Kriterien und Verfahren festgelegt, nach Anhören der betroffenen Berufsfachschule(n), der betroffenen Lehrbetriebe und/oder der betroffenen Organisation der Arbeits welt. In Konfliktfällen versucht das MBA mit den Beteiligten eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Ist dies nicht möglich, ent scheidet das Amt. Die Festlegungen werden jährlich ins «Verzeichnis der Schulorte und Schulkreise für Lernende mit Lehrort im Kanton Zürich» eingearbeitet und als Verfügung publiziert. Entscheide auf Grund besonderer Verhältnisse können befristet werden. Im Antrag für die Zuweisung einer Standortgemeinde bzw. eines Lehrbetriebs zum Einzugsgebiet einer Berufsfachschule sind die relevanten Informationen zu den Kriterien für die Fest legung des Einzugsgebietes aufzuzeigen. Damit kann eine ver gleichende Beurteilung der möglichen Standorte vorgenommen werden. Das MBA verwendet dafür ein standardisiertes Antrags formular (Beilage 2). Dieses wird periodisch aufgrund der Er fahrungen angepasst. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Die Kriterien und Verfahren zur Festlegung der Einzugsgebiete von Berufsfachschulen werden festgelegt. II. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt wird mit der Umsetzung beauftragt. Der Bericht ist abrufbar unter www.bi.zh.ch/bildungsrat
Bildungsratsbeschluss vom 7. Juli 2014 Bildungsrätliche Kommission Volksschule – Berufsbildung, Amtsdauer 2011/2015, Ersatzwahl Der Bildungsrat beschloss an seiner Sitzung vom 19. März 2012 das Mandat und die Zusammensetzung der bildungsrätlichen Kommission Volksschule – Berufsbildung für die Amtsdauer 2011/2015. Mit Beschluss des Bildungsrats vom 9. Dezember 2013 wurde Frau Claudia Gambacciani als Ersatzmitglied für Herrn Bénjamin Christen gewählt. Frau Claudia Gambacciani ist als Vertreterin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands zurückgetreten. Als Ersatz mitglied für die Kommission wird Frau Claudia Rusert vorge schlagen. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Frau Claudia Gambacciani wird unter Verdankung ihrer Dienste als Mitglied der bildungsrätlichen Kommission Volksschule – Berufsbildung per 31. Juli 2014 entlassen. II. Frau Claudia Rusert wird als Vertreterin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands (ZLV) für den Rest der Amtsdauer 2011/2015 als neues Mitglied der bildungsrätlichen Kommission Volksschule – Berufs bildung gewählt.
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 65
Amtliches
Bildungsratsbeschluss vom 7. Juli 2014 Lehrpläne Ergänzungsfach Informatik: Verlängerung der befristeten Bewilligung
Bildungsratsbeschluss vom 16. Juni 2014 Volksschule. Pilotprojekt Sek: Aktive Lernzeit und Lernerfolg für ALLE. Projektauftrag
Ausgangslage Der Bildungsrat bewilligte am 9. Juli 2012 die Lehrpläne für das Ergänzungsfach Informatik befristet bis Ende Schuljahr 2013/14. Dies betrifft die Lehrpläne der Kantonsschulen Enge, Freuden berg, Uster (vormals Glattal), Hohe Promenade, Limmattal, Ma thematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl, Wie dikon, Zürcher Oberland, Zürich Nord sowie des Verbundes der Kantonsschulen Stadelhofen, Hottingen und Küsnacht und des Verbundes Büelrain, Rychenberg und Im Lee. Mit Beschluss vom 3. September 2012 beauftragte der Bildungsrat das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA), bis Ende Schuljahr 2012/13 die Bedeutung, Funktion und Ausge staltung des maturarelevanten Ergänzungsfachs Informatik zu überprüfen und zu klären sowie bis Ende 2012 eine Anhörung unter Einbezug der Mittel- und Hochschulen vorzubereiten. Mit weiterem Beschluss vom 3. September 2012 beauftragte der Bildungsrat das MBA, ebenfalls bis Ende Schuljahr 2012/13 eine Auslegeordnung über die heutige Bedeutung, Funktion und Aus gestaltung aller im Kanton Zürich angebotenen maturarelevanten Ergänzungsfächer zu erarbeiten und ihm die Ergebnisse und den damit verbundenen Handlungsbedarf im Rahmen einer Ausspra che zu unterbreiten. Anlässlich der Sitzung des Bildungsrats vom 17. Dezember 2012 wurde eine Anhörung zum Ergänzungsfach Informatik EFI durchgeführt. Am 1. Juli 2013 fand im Bildungsrat eine Aussprache zur Bedeutung und Ausgestaltung der Ergän zungsfächer, inklusive Ergänzungsfach Informatik, statt. Der Bil dungsrat beauftragte damals das MBA, das Thema in Zusam menarbeit mit der Schulleiterkonferenz (SLK) aufzunehmen.
1. Ausgangslage An der Medienkonferenz vom 5. Dezember 2011 wurden der Öf fentlichkeit mögliche Massnahmen präsentiert, wie die Bildungs direktion der Tatsache begegnen will, dass gemäss PISA 2009 rund 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler die minimalsten Leistungsziele der 9. Klasse nicht erreicht haben. Eine Arbeitsgruppe des Volksschulamtes und der Bildungs planung hat in der Folge Grundlagen erarbeitet und Zielsetzun gen für mögliche einzelne Massnahmen formuliert. Zu prüfende Fragen, welche sich im Hinblick auf eine Umsetzung stellten, wurden aufgelistet und die Chancen und Risiken der verschiede nen Massnahmen bewertet. Am 20. März 2012 wurden die Massnahmen anlässlich einer Aussprache der Bildungsdirektorin mit Vertreterinnen und Ver tretern des Schulfeldes diskutiert. Die Stossrichtung der Mass nahmen wurde grundsätzlich positiv aufgenommen. Anschliessend wurden in fünf Teilprojektgruppen zusammen mit Vertretungen des Schulfeldes die verschiedenen Massnah men konkretisiert und in einem Bericht zuhanden des Bildungs rates zusammengefasst. Der Bildungsrat hat an seiner Sitzung vom 18. November 2013 den zusammenfassenden Bericht über die Ergebnisse der Vorbereitungsarbeiten im Projekt «Folgemassnahmen PISA 2009» anlässlich einer Aussprache zur Kenntnis genommen. Da bei hat der Bildungsrat das weitere Vorgehen bei der Umsetzung der geplanten Massnahmen unterstützt. Für die Weiterbearbei tung sind das Volksschulamt und die Abteilung Bildungsplanung zuständig. In der Folge wurde das Volksschulamt mit der Planung und Durchführung eines zeitlich befristeten Pilotprojekts beauftragt. Dieses soll geeignete Massnahmen bündeln, mit dem Ziel, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler mittels fach didaktisch gut genutzter Lernzeit und individuell angepasster Lernsituationen in den Fächern Mathematik und Deutsch noch gezielter unterstützt werden. Statt neue Massnahmen zu er greifen, soll auf der Grundlage der bisher umgesetzten Projekte die Förderung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler überprüft und intensiviert werden. Das Pilotprojekt «Aktive Lernzeit und Lernerfolg für ALLE» soll im Einsatz von Instrumenten und in der Prozessgestaltung an die Erfahrungen aus der Umsetzung des Projekts Neuge staltung 3. Sek anknüpfen und das bestehende Gesamtkonzept auf die ganze Sekundarstufe der Volksschule ausweiten. Dazu müssen die Massnahmenvorschläge im Bereich von «Mehr Lern zeit für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in Ma thematik und Deutsch», «Einsatz von Schulassistenzen» und «Unterstützung und Begleitung der Lernenden ausserhalb des Unterrichts» inhaltlich koordiniert und integriert werden. Dabei soll insbesondere das Zusammenspiel der verschiedenen Mass nahmen erprobt und evaluiert werden. In einer ersten dreijähri gen Pilotphase von 2015/16 bis 2017/18 werden nur Schulen der Sekundarstufe der Volksschule einbezogen, in einem zweiten Schritt könnte das Pilotprojekt auf die Mittelstufe der Primarstufe ausgeweitet werden.
Erwägungen Das MBA bearbeitet zurzeit zusammen mit der SLK den Auftrag des Bildungsrats auf Erarbeitung einer Auslegeordnung der Er gänzungsfächer. Die diesbezüglichen Arbeiten, welche auch die weitere Ausgestaltung des Ergänzungsfachs Informatik betref fen, werden im Schuljahr 2014/15 abgeschlossen werden. Die per Ende Schuljahr 2013/14 auslaufende Bewilligung der Lehr pläne des Ergänzungsfachs Informatik muss in der Zwischenzeit um ein Jahr verlängert werden, damit das Fach weiter unterrich tet werden kann und die Lehrpläne im Kontext der generellen Bearbeitung des Ergänzungsfachs behandelt werden können. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Die befristete Bewilligung der Lehrpläne für das Ergänzungsfach Informatik der Kantonsschulen Enge, Freudenberg, Uster, Hohe Promenade, Limmattal, MathematischNaturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl, Wiedikon, Zürcher Oberland, Zürich Nord, des Verbundes der Kantonsschulen Stadelhofen, Hottingen und Küsnacht sowie des Verbundes Büelrain, Rychenberg und Im Lee wird bis Ende Schuljahr 2014/15 verlängert.
66 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Amtliches
Das geplante Pilotprojekt ist kein Schulversuch im Sinne des Bildungsgesetzes und wird innerhalb der geltenden Gesetze und Verordnungen umgesetzt. 2. Erwägungen Die Bearbeitung der einzelnen Massnahmen erfolgt durch das Volksschulamt in drei Teilprojekten. Dazu wird eine interne Pro jektorganisation eingesetzt, welche in einem ersten Schritt die sorgfältige Abstimmung und Koordination zwischen den einzel nen Abteilungen und Verantwortungsbereichen gewährleistet. In einem zweiten Schritt ist der Einbezug von Verbänden und Inte ressensvertretungen vorgesehen. 2.1 Teilprojekte Teilprojekt 1: Lernzeitnutzung für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in Mathematik und Deutsch optimieren, Unterrichtsmittel und Lernsituationen auf die Erreichung der Grundkompetenzen konzentrieren. Schülerinnen und Schüler mit Leistungsschwächen in Mathe matik und Deutsch erhalten und nutzen mehr Lernzeit in diesen Fachbereichen durch geeignete Lernsituationen und/oder zu Lasten von anderen Unterrichtsinhalten. Zentrales Element ist die Lernentwicklung und damit verbunden die Bearbeitung der Frage, wie in der Praxis ein wirkungsvollerer Unterricht entwickelt und umgesetzt werden kann. Zielvorgabe und Aufgaben Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler müssen fach didaktisch sehr gut begleitet und betreut werden. Dies erfordert von Lehrpersonen spezifische Qualifikationen in der Unterrichts gestaltung, in diagnostischen Fähigkeiten mit Blick auf den Lern stand bezogene Förderung sowie in der Anwendung eines brei ten Repertoires von Lernmethoden und -settings. Dabei sollen praxisnahe und erfolgreich erprobte Methoden der Unterrichts diagnostik für die Entwicklung und Sicherung der Unterrichts qualität in den Fächern Mathematik und Deutsch sowie für die Entwicklung einer innerschulischen Feedback-Kultur genutzt werden. Vorgehen und Produkt Um die gesteckten Ziele in den Bereichen Deutsch und Mathe matik zu erreichen, müssen einerseits die Vorgehensweise, an dererseits auch die Produktbedürfnisse geklärt werden. Benö tigte Ressourcen für unterstützende Massnahmen im Bereich der Weiterbildung und Unterrichtsmittel können davon abgeleitet werden. Zudem sind die rechtlichen Rahmenbedingungen hin sichtlich der Dispensation von Unterrichtsinhalten zu klären. – Fokus Mathematik Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, den Bedarf an ergän zenden Unterrichtsmitteln zum obligatorischen Lehrmittel Mathe matik Sek 1 zu prüfen und zu klären. Gleichzeitig sind Lehrper sonen und Schulleitungen durch geeignete schulinterne Weiter bildungen (z. B. fachspezifisches Coaching) für den entsprechen den Förderunterricht zu qualifizieren.
– Fokus Deutsch Lesen und Schreiben sind Schlüsselkompetenzen, welche für die Anschlussfähigkeit beim Übergang von der Sekundarstufe in die berufliche Grundbildung mitentscheidend sind. Da am Ende der Primarschulzeit aber nicht alle Schülerinnen und Schüler die Grundansprüche in Lesen und Schreiben beherrschen, müssen diese Fähigkeiten auf der Sekundarstufe I spezifisch ausgebaut werden. Kompensatorische Fördermassnahmen sind hierfür not wendig. Das Programm QUIMS verfolgt die Erreichung dieser Ziele in Schulen, die einen Anteil von fremdsprachigen und aus ländischen Schülerinnen und Schülern von über 40 Prozent ha ben. Aus dem Wissen von QUIMS sollen geeignete Massnahmen für die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler erarbei tet, im Pilotprojekt erprobt und weiteren Schulen und Lehrper sonen zugänglich gemacht werden: − die Vermittlung von geeigneten Unterstützungsangeboten wie Workshops, schulinterne Weiterbildungen und Fach veranstaltungen; − die Nutzung von didaktischen Materialien wie beispiels weise Musteraufgaben für die Schreibförderung auf der Sekundarstufe (Bildungsratsbeschluss vom 9. September 2013) unterstützen; − die Schaffung von Synergien im Bereich der fachlichen Unterstützung und der Instrumente zur Lernbeurteilung. Teilprojekt 2: Unterstützung und Begleitung der Lernenden usserhalb des obligatorischen Unterrichts a Zielvorgabe und Aufgaben Schulen setzen vermehrt schulergänzende Massnahmen zur ge zielten Unterstützung und Begleitung von Lernenden ausserhalb des obligatorischen Unterrichts ein. Das Volksschulamt und die Schulgemeinden unterstützen und vermitteln Angebote externer Anbieter. Vorgehen und Produkt − Bei den Schulen und Schulbehörden die Nutzung von qualitativ ausgewiesenen Angeboten im Bereich der Unter stützung und Begleitung von Lernenden ausserhalb des Unterrichts fördern, durch Bekanntmachung und Bewer bung der Angebote im Schulfeld sowie durch geeignete und leicht zugängliche Informationen; − Für den Aufbau und die periodische Aktualisierung einer Informationsplattform über qualitativ ausgewiesene Angebote im Bereich der Unterstützung und Begleitung von Lernenden ausserhalb des Unterrichts sorgen; − Erarbeitung von Empfehlungen mit praxisorientierten Bei spielen zur wirkungsvollen Nutzung von ausserschulischen Unterstützungsangeboten (Aufgabenhilfe, Coaching- und Mentoring-Projekte) für alle Schulen zugänglich machen; − Die Förderung geeigneter Angebote gilt für alle interes sierten Schulen, auch für solche ausserhalb des geplanten Pilotprojektes; − Die Bildungsdirektion sorgt für eine angemessene finanzielle Unterstützung, die das Bestehen und den Ausbau dieser Angebote ermöglicht.
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 67
Amtliches
Teilprojekt 3: Einsatz von Schulassistenzen Schulassistenzen können Kinder und Jugendliche in der Schule betreuen und begleiten. Sie können Ansprechpersonen und Übungspartnerinnen sein und in der Aufgabenhilfe eingesetzt werden. Zielvorgabe und Aufgaben Dabei ist darauf zu achten, dass der Koordinationsaufwand in der Schule nicht erhöht wird. Schulassistenzen werden heute schon verschiedenen Orts eingesetzt, so dass auf bereits ge machte Erfahrungen aufgebaut werden kann. Zu prüfen ist auch die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden. Vorgehen und Produkt Das Volksschulamt unterstützt interessierte Schulgemeinden und Schulleitungen bei der Einführung von Schulassistenzen durch die Erarbeitung von Empfehlungen betreffend − Umfang der Assistenzen in Relation zu den Lehrpersonen und VZE − Stellenbeschreibung und Anforderungsprofilen − Aus- und Weiterbildung − Anstellungsbedingungen und Entlohnung − Rechtlichen Fragen 2.2 Projektorganisation Mit der Bearbeitung der drei Teilprojekte und der Umsetzung des Pilotprojekts wird das Volksschulamt beauftragt. Dieses setzt die erforderliche Projektorganisation ein und stellt die personellen und finanziellen Ressourcen sicher. Die Projektsteuerung erfolgt durch die Geschäftsleitung des Volksschulamtes, welche die Koordination zwischen der Weiterarbeit an den Themen der Teil projekte innerhalb der Abteilungen und der Erprobung und Um setzung im Rahmen des Pilotprojekts gewährleistet. Die Projekt arbeiten sind breit abzustützen, die Verbände und Hochschulen werden auf der Grundlage der bisherigen Vorarbeiten einbezo gen. 2.3 Begleitkommission Die Projektziele und der Umsetzungsprozess werden regel mässig überprüft. Die Projektleitung erstattet der «Bildungsrätli chen Kommission Volksschule – Berufsbildung» regelmässig Be richt zum Projektstand. Die Kommission hat die Erprobung und die flächendeckende Einführung des Pilotprojekts Neugestaltung 3. Sek begleitet und verfügt über Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Volksschule, insbesondere der Sekundarstufe sowie der Berufsberatung, ergänzt durch die Vertretungen der Wirtschaft und der Berufsbildung. 2.4 Evaluation Das Pilotprojekt soll durch eine verwaltungsunabhängige Institu tion evaluiert werden. Die begleitende Wirkungsanalyse bilanziert die Ergebnisse und Erfahrungen aus der Sicht der beteiligten Schulleitungen, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern. Sie soll Informationen über die Effektivität und die Effizienz der einzelnen Massnahmen und Programme liefern, dies unter Berücksichtigung der verschiedenen Zielgruppen, Ri sikolagen und programmspezifischen Ziele.
68 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Für die begleitende schulinterne Erfahrungsauswertung wird EMU (Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung) eingesetzt, ein handlungsorientiertes Programm, das für die Praxis entwickelt wurde, viele Einstiegsmöglichkeiten bietet und den Schulen kostenfrei zur Verfügung steht. Die dazu gehörigen Grundlagen wurden den Schulleitungen der Sekundar schulen im Rahmen einer dreiteiligen Tagungsreihe vermittelt, bei Bedarf sind auch begleitende Beratungsangebote verfügbar. 2.5 Weiteres Vorgehen Die Weiterbearbeitung der Massnahmen innerhalb der drei Teil projekte soll auf der Grundlage des Projektauftrags bis im Som mer 2014 erfolgen. Damit eine vergleichbare Umsetzung in den Pilotschulen gewährleistet werden kann, soll ein Rahmenkonzept erarbeitet werden, das die Minimalanforderungen für die Erpro bung sowie die pädagogischen, rechtlichen und organisatori schen Rahmenbedingungen der Pilotschulen festlegt. Das Rah menkonzept ist dem Bildungsrat bis im Herbst 2014 vorzulegen. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Das Volksschulamt wird beauftragt, für das Pilotprojekt «Sek: Aktive Lernzeit und Lernerfolg für ALLE» ein Rahmenkonzept zu erarbeiten und dem Bildungsrat bis im Herbst 2014 vorzulegen.
Bildungsratsbeschluss vom 16. Juni 2014 Verordnung über die Anforderungen an Lehrpersonen in Berufsvorbereitungsjahren, Neuerlass (ersetzt die bisherige Verordnung über die Zulassung zu den Berufsvorbereitungsjahren 2013/2014 und die Anforderungen an die Lehrpersonen) 1. Ausgangslage Der Bildungsrat hat mit Beschluss vom 9. Dezember 2013 die Regelungen über die Zulassung und die Abschlussbeurteilung der Berufsvorbereitungsjahre revidiert und in einen unbefristeten Erlass überführt (neu: Verordnung über die Zulassungsvoraus setzungen und die Abschlussbeurteilung der Berufsvorberei tungsjahre, LS 413.311.1). Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 30. April 2014 die bis Ende Schuljahr 2013/2014 befristete Verordnung über die Berufsvorbereitungsjahre 2009/2010 bis 2013/2014 in die Verordnung zum EG BBG vom 8. Juli 2009 und in die Verordnung über die Finanzierung von Leistungen der Berufsbildung vom 24. November 2010 überführt (RRB Nr. 521/2014). Nun ist noch die Verordnung über die Zulassung zu den Berufsvorbereitungsjahren 2013/2014 und die Anforde rungen an die Lehrpersonen vom 27. April 2009, welche bis Ende Schuljahr 2013/2014 befristet ist, in einen unbefristeten Erlass zu überführen. 2. Die einzelnen Bestimmungen Die neue Verordnung entspricht weitgehend den bisherigen Re gelungen. Es erfolgten jedoch Präzisierungen, da die Umsetzung bei den für die Anstellung der Lehrpersonen zuständigen Schu len zu Unsicherheiten führte. Neu hinzugekommen sind die Zu satzqualifikationen für Lehrpersonen im integrationsorientierten Angebot und für die Durchführung der zusätzlichen Begleitung.
Amtliches
– § 1 Berufspraktischer Unterricht (bisher § 3 und 4) Es wird präzisiert, dass die höhere Berufsbildung in dem zu un terrichtenden Fach zu absolvieren ist. Bei den unterrichtenden Lehrpersonen handelt es sich um Personen, welche berufsprak tischen Unterricht erteilen. Die berufliche Praxis muss im Lehrge biet erworben worden sein. In § 1 lit. c wird die Formulierung von Art. 45 der Verordnung des Bundes vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV; SR 412.101) übernommen. – § 2 Allgemeinbildender Unterricht (bisher § 5) Die Lehrpersonen für die Berufsvorbereitungsjahre benötigen eine Befähigung für die Sekundarstufe I oder eine gleichwertige Ausbildung. Für die Beurteilung, ob eine gleichwertige Ausbil dung gegeben ist, ist das Merkblatt «Lehrdiplome» des Volks schulamtes Zürich vom 1. Februar 2008 zu konsultieren. – § 3 Zusatzqualifikationen, a. Lernfeld Berufswelt (bisher § 5 Abs. 2) Die bisherige Vorgabe, wonach pro Klasse eine Lehrperson des allgemeinbildenden Unterrichts über eine Zusatzausbildung ver fügen muss, erwies sich als nicht zielführend (bisher § 5 Abs. 2 der Verordnung Lehrpersonen). In den Schulen werden geeig nete Lehrpersonen mit der entsprechenden Zusatzausbildung sowohl im allgemeinbildenden als auch im berufspraktischen Unterricht eingesetzt. Neu wird die Anforderung an die Zusatz qualifikation nicht mehr an die Klassen gebunden, sondern an das Unterrichten im Fach «Lernfeld Berufswelt» (Berufswahl und Berufsfindung, Lehrstellensuche, Bewerbungsgespräche etc.). Verlangt wird eine Zusatzausbildung zur «Fachlehrerin/Fachlehrer Berufswahlunterricht» oder als Berufswahlcoach im Umfang von 15 ECTS-Kreditpunkten bzw. 450 Lernstunden. – § 4 Zusatzqualifikationen, b. integrationsorientiertes Angebot (neu) Eine Mehrheit der Jugendlichen, welche ein integrationsorien tiertes Angebot besuchen, sprechen kein oder wenig Deutsch (Sprachniveau A1 bis B1). Entsprechend wird für den Deutsch unterricht in diesen Klassen, in Absprache mit den Rektorinnen und Rektoren der Berufsvorbereitungsjahre, als Zusatzqualifika tion der Lehrgang «Deutsch als Zweitsprache» verlangt. Der Un terricht wird im Regelfall von Lehrpersonen für den allgemein bildenden Unterricht gemäss § 2 erteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass das Grundlagenwissen für die Förderung von Deutsch als Zweitsprache bei den Lehrpersonen vorhanden ist. – § 5 Zusätzliche Begleitung (neu) Analog zur fachkundigen individuellen Begleitung für Lernende in zweijährigen beruflichen Grundbildungen (vgl. Art. 10 Abs. 4 und 5 BBV) hat der Regierungsrat die zusätzliche Begleitung für Lernende in den Berufsvorbereitungsjahren eingeführt. Diese wird ab Schuljahr 2014/2015 angeboten. Sie richtet sich an leis tungsschwache Lernende, deren Integration in den Arbeitsmarkt gefährdet ist. Ziel der zusätzlichen Begleitung ist die Erhöhung der Chancen auf dem Lehrstellenmarkt. Personen, welche die zusätzliche Begleitung durchführen, müssen die gleichen Anforderungen erfüllen wie diejenigen, wel che die fachkundige individuelle Begleitung im Rahmen der zwei jährigen beruflichen Grundbildungen übernehmen. Entsprechend
wird eine Weiterbildung im Umfang von 10 ECTS-Kreditpunkten bzw. 300 Lernstunden gefordert. – § 6 Ausnahmen (bisher § 6) Verfügt eine Lehrperson oder eine Person, welche die zusätzli che Begleitung durchführen will, nicht über die geforderten Aus bildungen bzw. Zusatzqualifikationen gemäss §§ 1 bis 5, so darf sie nur mit der Zustimmung des Mittelschul- und Berufsbildungs amtes (MBA) eingesetzt werden. Das MBA entscheidet, ob die vorhandenen Qualifikationen mit den Anforderungen gemäss §§ 1 bis 5 vergleichbar sind oder ob die Person fehlende Qualifi kationen nachzuholen hat. Nachqualifikationen haben innerhalb von fünf Jahren seit der Zulassung zu erfolgen. Die Nachqualifi kation ist gegenüber dem MBA zu belegen. – § 7 Schlussbestimmung Lehrpersonen, welche vom MBA vor dem Schuljahr 2014/15 zugelassen wurden, dürfen in den Fächern, auf welche sich die Zulassung bezieht, weiterhin unterrichten. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Es wird eine Verordnung über die Anforderungen an Lehrpersonen in Berufsvorbereitungsjahren erlassen. II. Die Verordnung gemäss Ziff. I tritt auf Beginn des Schuljahres 2014/2015 (18. August 2014) in Kraft. Wird ein Rechtsmittel ergriffen, wird über die Inkraft setzung erneut entschieden. III. Gegen die Verordnung gemäss Ziff. I und Dispositiv Ziff. II, Satz 1, kann innert 10 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Regierungsrat des Kantons Zürich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Anhang 1 413.311.95 Verordnung über die Anforderungen an Lehrpersonen in Berufsvorbereitungsjahren (vom 16. Juni 2014) Der Bildungsrat beschliesst: gestützt auf § 7 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zum Berufsbildungsgesetz vom 14. Januar 2008 (EG BBG) Berufspraktischer Unterricht
§ 1. Lehrpersonen für den berufspraktischen Unterricht verfügen über: a. eine berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fä higkeitszeugnis sowie über einen Abschluss der höheren Berufsbildung auf dem Gebiet, in dem sie unterrichten, b. mindestens zwei Jahre berufliche Praxis im Lehrgebiet, c. mindestens zwei Jahre Erfahrung in der betrieblichen Ausbildung von Lernenden, d. eine berufspädagogische Bildung im Umfang von: 1. 600 Lernstunden bei hauptamtlicher Tätigkeit, 2. 300 Lernstunden bei nebenamtlicher Tätigkeit. Allgemeinbildender Unterricht
§ 2. Lehrpersonen für den allgemeinbildenden Unterricht ver fügen mindestens über eine Zulassung zum Schuldienst für die Sekundarstufe I gemäss den gesetzlichen Be stimmungen über die Lehrerbildung.
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 69
Amtliches
Zusatzqualifikationen a. Lernfeld Berufswelt
§ 3. Lehrpersonen, welche das Lernfeld Berufswelt unterrichten, verfügen neben einer Qualifikation gemäss § 1 oder 2 über eine Zusatzausbildung als Fachlehrerin bzw. Fachlehrer Berufswahlunterricht oder als Berufswahlcoach im Umfang von 15 ECTS-Kreditpunkten bzw. 450 Lernstunden. b. integrationsorientiertes Angebot
§ 4. Lehrpersonen, welche im integrationsorientierten Angebot das Fach Deutsch unterrichten, verfügen neben einer Qua lifikation gemäss § 2 über einen Abschluss eines zertifizier ten Lehrganges in Deutsch als Zweitsprache im Umfang von 10 ECTS-Kreditpunkten bzw. 300 Lernstunden. Zusätzliche Begleitung
§ 5. Personen, welche die zusätzliche Begleitung gemäss § 8 der Verordnung zum EG BBG vom 8. Juli 2009 durchführen, verfügen über eine Zusatzausbildung mit dem Schwer punkt «Fachkundige individuelle Begleitung» im Umfang von 10 ECTS-Kreditpunkten bzw. 300 Lernstunden. Ausnahmen
§ 6. 1 Erfüllt eine Person die Anforderungen gemäss §§ 1–5 nicht, darf sie nur mit Zustimmung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (Amt) eingesetzt werden. 2 Das Amt entscheidet, ob fehlende Qualifikationen nachzuholen sind. 3 Nachqualifikationen gemäss Abs. 2 sind innerhalb von fünf Jahren nach der Zulassung zum Unterricht nachzuho len und dem Amt zu belegen. Schlussbestimmung
§ 7. Lehrpersonen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Regle ments vom Amt für den Unterricht zugelassen wurden, unterstehen in denjenigen Fächern, auf die sich die Zulas sung bezieht, nicht diesem Reglement. Die Synopse ist abrufbar unter www.bi.zh.ch/bildungsrat
Bildungsratsbeschluss vom 16. Juni 2014 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an Zürcher Mittelschulen 1. Ausgangslage Der Bildungsrat hat an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2013 von den Ergebnissen der Befragung der Zürcher Mittelschülerinnen und Mittelschüler zwei Jahre nach ihrer Matur (Erhebung im Rah men des NW EDK-Projektes «Benchmarking Sekundarstufe II», Teilprojekt 3) Kenntnis genommen. Mit Bezug auf die Ergebnisse zur Studien- und Laufbahnberatung stellte der Bildungsrat die Frage, (1) welches die Gründe für das schlechtere Abschneiden der Zürcher Mittelschulen im Verhältnis zu den teilnehmenden Schulen aus anderen Kantonen sind und (2) wo allenfalls Hand lungsbedarf besteht. Er hat deshalb die Bildungsdirektion be auftragt, entsprechende Auswertungen vorzunehmen und darü ber Bericht zu erstatten. Eine vertiefte Analyse der Praxis der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an Zürcher Mittelschulen hat folgende Resul tate ergeben (siehe Beilage 1): (1) Die Einschätzung der ehemaligen Maturandinnen und Maturanden von Zürcher Mittelschulen und diejenige von Ehemaligen aus Mittelschulen anderer Kantone unter 70 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
scheiden sich insgesamt nicht wesentlich. Die Streuung ist in allen Kantonen beträchtlich. Auch im Kanton Zürich gibt es Schulen, die ähnlich hohe Werte aufweisen wie die besten Schulen in anderen Kantonen. Das deutet auf eine unterschiedliche Praxis der Mittelschulen hin. (2) Eine schriftliche Umfrage bei allen Zürcher Mittelschulen hat ergeben, dass sich die heutige Praxis der Schulen nicht grundlegend voneinander unterscheidet. (Die Er hebung im Rahmen des «Benchmarking»-Projektes bezog sich auf den Maturajahrgang 2010.) (3) Die Schulen haben seit 2010 ihre Informations- und Bera tungsangebote – vor allem auch diejenigen in Zusammen arbeit mit der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Amtes für Jugend und Berufsberatung AJB – zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in Fragen der Berufs- und Studienwahl deutlich ausgebaut. Es ist des halb anzunehmen, dass die Beurteilung der Informationsund Beratungsleistungen durch Maturandinnen und Matu randen des Maturajahrgangs 2010 die heutige Situation zu einem grossen Teil nicht mehr abbildet. Das Teilprojekt «Studien- und Laufbahnberatung» des EDK-Pro jektes «Gymnasiale Maturität – Langfristige Sicherung des Hoch schulzugangs» unter der Leitung der Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs- und Studienberatung (KBSB) schlägt fünf Handlungsfelder vor, um die Studien- und Laufbahnvorbereitung an den Gymnasien zu verbessern. Dabei geht es neben der Förderung von überfachlichen Kompetenzen um die Stärkung der Kenntnisse über Anforderungen und inhalt liche Schwerpunkte der verschiedenen Studienrichtungen. Ver schiedene Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Kennt nisse der zukünftigen Studentinnen und Studenten über die Anforderungen bestimmter Studienrichtungen sowie darüber, ob sie diese Anforderungen persönlich erfüllen, wichtige Faktoren für die Studierfähigkeit und den Studienerfolg sind. Auch die Publikation «Fokus Studienwahl: So finde ich die richtige Auswahl» des Schweizerischen Dienstleistungszentrums Berufsbildung (SDBB) stellt neben überfachlichen Kompetenzen vor allem das «Wissen über die eigene Person» (eigene Inte ressen und Fähigkeiten kennen und sich selber realistisch ein schätzen) sowie «Kenntnisse von Ausbildungslandschaft und Berufswelt» als wichtige Voraussetzung für eine gelingende Stu dienwahl in den Vordergrund. 2. Erwägungen Im Rahmen der Arbeiten zum Bericht «Unterstützung bei der Studienwahl an den Zürcher Mittelschulen» der Bildungsdirektion zuhanden des Bildungsrates stimmen die beteiligten Akteure (Mittelschulen, MBA, Studien- und Laufbahnberatung des AJB) in den folgenden Erkenntnissen überein: (1) Bedeutung des Themas Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass die Unterstützung der Mittelschülerinnen und Mittelschüler in Fragen der Berufs- und Studienwahl wichtig ist. Die Schulen und die für die Information und Beratung zuständigen Institutionen auf kantonaler Ebene tragen im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags dafür die Verant wortung.
Amtliches
(2) Beteiligte Akteure Neben den einzelnen Mittelschulen sind die Studien- und Lauf bahnberatung des AJB (biz Oerlikon) und die Ausbildungsinsti tutionen der Tertiärstufe (Hochschulen, Fachhochschulen, Päda gogische Hochschule, Höhere Fachschulen) wichtige Akteure bei der Planung und Umsetzung zielführender Informations- und Beratungsangebote für Mittelschülerinnen und Mittelschüler. (3) Mittelschulen als Trägerinnen der Umsetzung Für die stufengerechte Vermittlung wichtiger Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sowie die Koordination der vielfältigen Informations- und Beratungsangebote tragen die einzelnen Mit telschulen die Verantwortung. Sie planen die Kompetenzvermitt lung im Verlauf des gymnasialen Ausbildungsganges und gestal ten das Informations- und Beratungsprogramm mit Unterstützung schulexterner Anbieterinnen und Anbieter. (4) Kantonales Rahmenkonzept Ein kantonales Rahmenkonzept soll die Verantwortlichkeiten der an der Studien- und Laufbahnberatung an Zürcher Mittelschulen beteiligten Akteure festlegen. Insbesondere ist in einem solchen Konzept die Schnittstelle zwischen den kantonalen Informationsund Beratungsangeboten durch die Studien- und Laufbahnbera tung des AJB und den von den einzelnen Schulen definierten Umsetzungskonzepten («Studienwahlfahrplan») zu definieren. 3. Kantonales Rahmenkonzept und schulspezifische Umsetzungskonzepte Kantonales Rahmenkonzept Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt regelt die Berufs- und Studienwahlvorbereitung an Zürcher Mittelschulen in einem kan tonalen Rahmenkonzept. Dieses hat zum Ziel, die Berufs- und Studienwahlvorbereitung an Zürcher Mittelschulen so zu regeln, dass sich die Mittelschülerinnen und Mittelschüler im Verlauf der gymnasialen Ausbildungszeit optimal auf die Wahl eines Hoch schulstudiums, einer anderen Tertiärausbildung oder die Berufs wahl vorbereiten können. Das kantonale Rahmenkonzept wird vom Bildungsrat verabschiedet. Es umfasst: a) Gemeinsame Zielsetzungen und Eckwerte für die Infor mations- und Beratungsangebote sowie die Kompetenz vermittlung an den einzelnen Mittelschulen; b) Informations- und Beratungsangebote, die Bestandteil des «Studienwahlfahrplans» der einzelnen Schulen sind (u. a. Angebote der Studien- und Laufbahnberatung des AJB im biz Oerlikon, Informations- und Assessment angebote der Hochschulen); c) Liste mit wichtigen überfachlichen Kompetenzen, die für eine zielführende Berufs- und Studienwahl der Maturandin nen und Maturanden notwendig sind (Kenntnisse über Anforderungen einzelner Studien- und Berufsrichtungen, Selbstkompetenzen, realistische Einschätzung eigener Stärken etc.); d) Katalog von best practice, wie sie an Schulen bereits umgesetzt werden. Für die Erarbeitung des kantonalen Rahmenkonzeptes arbeitet das Mittelschul- und Berufsbildungsamt mit den V erantwortlichen von Bildungsinstitutionen der Tertiärstufe sowie mit Anbieterin nen und Anbietern von Studienberatungen zusammen.
Schulspezifische Umsetzungskonzepte («Studienwahlfahrplan») In einem weiteren Schritt sollen die einzelnen Schulen die Ver mittlung wichtiger Studienwahlkompetenzen, die verschiedenen schulinternen und -externen Informations- und Beratungsan gebote gemäss kantonalem Rahmenkonzept sowie eigene An gebote im Rahmen eines schuleigenen «Studienwahlfahrplans» verbindlich festlegen. Mit dem Begriff «Fahrplan» kommt zum Ausdruck, dass die Vermittlung der Kompetenzen von Schülerin nen und Schülern sowie die Informations- und Beratungsange bote über die Zeit des Gymnasiums (Lang- und Kurzgymnasium) verteilt festzulegen sind. Die Vermittlung der für die Berufs- und Studienwahl relevanten Kompetenzen verteilt über die ganze gymnasiale Ausbildungszeit hinweg stellt sicher, dass Schülerin nen und Schüler bereits im Untergymnasium auf Entscheidungen bezüglich der Wahl des Schwerpunktfaches oder einer Berufs ausbildung vorbereitet werden können. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) wird beauftragt, mit den Zürcher Mittelschulen, den Verantwortlichen von Bildungsinstitutionen der Tertiärstufe sowie in Zusammenarbeit mit der Studien- und Laufbahnberatung des Amtes für Jugend und Berufsberatung (AJB) ein kantonales Rahmenkonzept für die Unterstützung der Mittelschülerinnen und Mittelschüler in Fragen der Berufs- und Studienwahl zu erstellen. Das kantonale Rahmenkonzept wird dem Bildungsrat bis im Frühling 2015 zur Genehmigung vorgelegt. Der Bericht ist abrufbar unter www.bi.zh.ch/bildungsrat
Bildungsratsbeschluss vom 16. Juni 2014 Neues Anschlussprogramm für die Fachmittelschule 1. Ausgangssituation Für die Aufnahmeprüfung an die Fachmittelschule (FMS) wie auch an die Kurzgymnasien, die Handelsmittelschule (HMS) und die Informatikmittelschule (IMS) gilt das vom Bildungsrat am 2. Mai 2011 erlassene «Anschlussprogramm Sekundarstufe – Mittelschulen» (Anschlussprogramm). Die Anwendbarkeit des Anschlussprogramms für die FMS geht aus § 6 des Reglements des Regierungsrats für die Aufnahme in die Fachmittelschulen vom 13. Januar 2010 (OS 413.250.4; FMS-Aufnahmereglement) hervor. Das Anschlussprogramm macht keinen Unterschied zwi schen Schülerinnen und Schülern aus der 2. und 3. Sekundar schule. Da die Aufnahmeprüfungen im März stattfinden, umfasst das Anschlussprogramm Prüfungsstoff lediglich im Umfang von ca. eineinhalb Jahren. Die FMS schliesst an die 3. Sekundar schule an (§ 1 Abs. 1 FMS-Aufnahmereglement), wobei die Auf nahmeprüfungen im 2. Semester des Schuljahres stattfinden (§ 3 Abs. 1 FMS-Aufnahmereglement). Die FMS-Aufnahmeprü fungen werden somit im März der 3. Sekundarschule durchge führt. Dadurch basieren die Aufnahmeprüfungen in die FMS auf einem um ein Jahr zu tiefen Niveau. Schülerinnen und Schüler, welche sich auf die FMS-Aufnahmeprüfung vorbereiten, können nur den weit zurückliegenden Sekundarschulstoff der ersten ein einhalb Jahre verwerten. Die bisherige Lösung kann bei diesen Schülerinnen und Schülern zudem den Eindruck erwecken, der nicht prüfungsrelevante Stoff sei nicht so wichtig. Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 71
Amtliches
Die Thematik wurde vom Mittelschul- und Berufsbildungs amt gemeinsam mit der Bildungsrätlichen Kommission Mittel schulen (Kommission) und teilweise unter Beizug von Vertretern der betroffenen Schulen bearbeitet. Als Resultat der Diskussio nen schlägt die Kommission dem Bildungsrat ein separates An schlussprogramm für die FMS in zwei möglichen Varianten vor: – Variante 1: Aufnahmeprüfung im März mit 2½ Jahren Prüfungsstoff der Sekundarschule – Variante 2: Aufnahmeprüfung im Herbst mit 2 Jahren Prüfungsstoff der Sekundarschule 2. Separates Anschlussprogramm für die FMS Die Kommission erachtet ein vom Bildungsrat separat für die FMS erlassenes Anschlussprogramm als notwendig. Indem die in der Sekundarstufe I erbrachten Leistungen im Rahmen der FMSAufnahmeprüfung umfassender berücksichtigt werden könnten, würde die Motivation der an der FMS interessierten Sekundar schülerinnen und -schüler erhöht und die Sekundarstufe I auf gewertet. Gleichzeitig würden die Bemühungen unterstützt, die FMS als eigenen Schultyp statt als «Minusvariante» des Gymna siums zu begreifen. Im Folgenden werden die beiden von der Kommission geprüften Varianten dieses Vorschlags mit Angabe der Vor- und Nachteile dargelegt. Variante 1: Aufnahmeprüfung im März mit 2½ Jahren Prüfungsstoff der Sekundarschule Für die FMS wird das Anschlussprogramm um den Stoffteil aus der zweiten Hälfte der 2. und der ersten Hälfte der 3. Sekundarschule erweitert, d. h., es kommt Stoff von einem ganzen Jahr hinzu. Bei dieser Version muss aus terminlichen Gründen die auf wändige FMS-Nachprüfung gemäss FMS-Aufnahmereglement beibehalten werden. § 16 des FMS-Aufnahmereglements schreibt vor, dass Schülerinnen und Schüler, welche sich sowohl an eine Maturitätsschule als auch an eine FMS anmelden, zuerst die Auf nahmeprüfung an der Maturitätsschule ablegen. Sofern sie dabei ein bestimmtes minimales Prüfungsergebnis erreichen, werden sie an der FMS zu einer gesonderten Nachprüfung zugelassen. Eine solche Nachprüfung kennt weder die HMS noch die IMS. Variante 2: Aufnahmeprüfung im Herbst mit 2 Jahren Prüfungsstoff der Sekundarschule Bei Variante 2 findet die Aufnahmeprüfung der FMS neu bereits im Herbst statt. Deshalb ist die Erweiterung des Prüfungsum fangs etwas kleiner, indem lediglich der Schulstoff der zweiten Hälfte der 2. Sekundarschule, d. h. von zusätzlich einem halben Jahr, hinzukommt. Für die Vorverlegung der FMS-Aufnahmeprüfung in den Herbst sprechen folgende Gründe: – Wüssten Jugendliche bereits im Herbst, dass es mit der Aufnahme in die FMS nicht klappt, hätten sie für die Lehr stellensuche deutlich mehr Zeit. Heute, da die FMS-Auf nahmeprüfung im März der 3. Sekundarschule stattfindet, wird die Zeit zur Suche nach einer anderen Lösung, ins besondere nach einer Lehrstelle, für Schülerinnen und Schüler, welche die FMS-Aufnahmeprüfung nicht bestehen, vielfach knapp. Aus analogen Überlegungen ist es sinnvoll,
72 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
–
– –
dass die IMS-Prüfung weiterhin im Herbst stattfindet. Eine Vorverschiebung der HMS- und der BM 1-Prüfung ist zu prüfen. Bei einem vom Prüfungstermin des Gymnasiums deutlich abgesetzten Herbsttermin ist mit mehr Doppelanmeldungen zu rechnen. Jugendliche dürften eher in Betracht ziehen, beide Optionen (Übertritt in die FMS und ins Kurzgymna sium) statt nur eine zu prüfen. Bei einer Vorverlegung erhal ten sie somit grössere Wahlmöglichkeiten. Es ist zu erwarten, dass der Herbsttermin generell einen bewussteren Entscheid für die FMS auslöst. Die aufwändige Nachprüfung wird hinfällig: Doppelanmel derinnen und Doppelanmelder absolvieren im Herbst die Aufnahmeprüfung an die FMS. Wer diese bestanden hat, kann sich auch noch für die Prüfung an ein Kurzgymnasium anmelden, sofern die Altersgrenze nicht überschritten ist.
Gegen die Vorverlegung der FMS-Aufnahmeprüfung sprechen die folgenden Gründe: – Die Schulleitungen der Fachmittelschulen befürchten einen starken Anstieg der Doppelanmeldungen (bisher durch schnittlich ca. 300 pro Jahr) und rechnen mit vielen Schüle rinnen und Schülern, welche die vorgezogene FMS-Auf nahmeprüfung im Sinne eines Testlaufs für die Aufnahme prüfung ins Kurzgymnasium im März absolvieren würden. Dies wäre für die betroffenen Schulen mit einer beträchtli chen administrativen, organisatorischen und auch finanziel len Mehrbelastung verbunden. – In den Sekundarschulen würde ein Herbsttermin die Pla nung und Durchführung der im Rahmen des obligatorischen Unterrichts stattfindenden Vorbereitung zu Aufnahme prüfungen erschweren, indem neu sowohl vor dem März termin wie auch vor dem Herbsttermin entsprechende Prüfungsvorbereitungen angeboten werden müssten. 3. Schlussfolgerungen Die Empfehlung der Kommission, für die an die 3. Sekundarschule anschliessende FMS ein separates Anschlussprogramm einzu führen, wird aus den genannten Erwägungen im Sinne einer Auf wertung der Sekundarschule und der FMS als richtig erachtet. In Abwägung der Vor- und Nachteile eines in den Herbst vorgezogenen Prüfungstermins überwiegen erstere. Dem grös seren Aufwand an den Sekundar- und den Fachmittelschulen stehen die grösseren Wahlmöglichkeiten der Jugendlichen für ihre Berufs- und Ausbildungsfindungsentscheide sowie der Zeit gewinn für die Lehrstellensuche gegenüber. Anders als die frühere Diplommittelschule bietet die FMS mit ihren berufsorientierten Profilen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, allgemeinbildende Inhalte mit einem konkreten Ausbildungsschwerpunkt zu verknüpfen. Damit richtet sich die FMS primär an Jugendliche, welche bereits in der Sekundar schule ein bestimmtes Berufsfeld bzw. berufliches (Bildungs-)Ziel vor Augen haben. Mittels vorgezogenen Prüfungstermins an die FMS werden die Ausbildungsmöglichkeiten dieser Jugendlichen erweitert, indem sie dadurch mehr Zeit zur Vorbereitung für die im Frühjahr stattfindende Aufnahmeprüfung der BM 1 erhalten, sollten sie sich doch für den berufsgestützten Weg über die BM 1 (statt für den schulisch gestützten Weg über die FMS) entschei den. Ein Herbsttermin für die FMS-Aufnahmeprüfung fügt sich
Amtliches
zudem in den allgemeinen Berufswahlfahrplan der Sekundar schülerinnen und Sekundarschüler ein, die bevorzugt im 1. Se mester der 3. Sekundarschule Lehrstellenverträge abschliessen. Der Variante 2 ist deshalb der Vorzug zu geben. 4. Weiteres Vorgehen Das erwähnte Anschlussprogramm soll von den Prüfungsfach kommissionen der zentralen Aufnahmeprüfung (ZAP) um den er wähnten Schulstoff aus der 2. und 3. Sekundarschule erweitert und durch Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker (Sekundar lehrpersonen und Mittelschullehrpersonen) überprüft werden. Die Entwürfe des erweiterten Anschlussprogramms sollen der Kom mission sowie dem Vorstand der Lehrpersonenkonferenz der Volksschule (LKV) zur Stellungnahme vorgelegt werden. Die Vorverlegung des Prüfungstermins der Aufnahmeprü fung der FMS in das 1. Semester der 3. Sekundarschule sowie die dadurch wegfallende Nachprüfung erfordern eine Änderung des FMS-Aufnahmereglements (§ 3 und § 16). Diese Anpassung ist dem Regierungsrat zu beantragen. Im Anschluss daran wird der Bildungsrat über das separate Anschlussprogramm der FMS befinden. Die Anpassungen des Anschlussprogramms und des FMSAufnahmereglements können frühestens ab Beginn 2016 ein geführt werden. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt wird beauftragt, für die Zürcher kantonalen Fachmittelschulen ein separates Anschlussprogramm erarbeiten zu lassen. II. Die Bildungsdirektion wird eingeladen, dem Regierungs rat eine Änderung des kantonalen Reglements für die Aufnahme in die Fachmittelschulen vom 13. Januar 2010 zu beantragen.
Bildungsratsbeschluss vom 16. Juni 2014 Stärkung von Naturwissenschaft und Technik an den Zürcher Mittelschulen: Umsetzung Ausgangslage Der Bildungsrat beschloss am 26. April 2010, dass Naturwissen schaft und Technik an den allgemeinbildenden Schulen im Kan ton Zürich zu fördern seien. Das Projekt wurde in fünf Teilprojekte unterteilt, wobei eines die Stärkung von Naturwissenschaft und Technik an den Mittelschulen betraf. In der Folge befasste sich der Bildungsrat an einem Hearing vom 16. Juni 2012 und in einer Aussprache vom 17. Dezember 2012 u. a. mit dem Teilprojekt Mittelschulen. Am 27. Mai 2013 legte er mit Beschluss fest, wie die Stärkung von Naturwissen schaft und Technik an den Mittelschulen konkret umzusetzen sei. Er bestimmte, dass alle Mittelschulen bis Ende Schuljahr 2013/14 schulspezifische Massnahmenkonzepte zur Stärkung von Naturwissenschaft und Technik entwickeln sollen. Die zwan zig Massnahmenkonzepte der Mittelschulen werden dem Bil dungsrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Erwägungen 1. Entwicklungsprozess Die Schulen wurden während des Entwicklungsprozesses durch das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) unterstützt. Der Prozess wurde durch einen Kick-off-Workshop im Frühling 2013 gestartet, an welchem Good-Practice-Beispiele aus dem Kanton Zürich und aus dem Kanton Bern vorgestellt wurden. In der fol genden Entwicklungsphase fanden Sitzungen mit den einzelnen Schulen statt, an denen die Massnahmenvorschläge analysiert wurden. Anlässlich eines Austauschtreffens mit allen Schulen wurden Vorschläge in Gruppen vorgestellt. Zusammen mit der Projekt- und der Begleitgruppe (mit diversen Vertretern aus Schulleiterkonferenz, Hochschulen, Lehrerschaft, Fachdidaktik und der kantonalen Bildungsverwaltung) erstellte das MBA eine Vorlage für die Projekteingabe an das MBA bzw. den Bildungs rat. Vor der Erstellung eines definitiven Konzepts erhielten alle Schulen vom MBA Rückmeldungen zu ihren Entwürfen. Zum Schluss wurden die Massnahmen in einer Übersicht in der Be gleitgruppe besprochen, und alle Konzepte wurden in der Pro jektgruppe mit einer Vertretung der Schulleiterkonferenz einzeln diskutiert. 2. Einschätzung der Massnahmen a) Formelle Ebene: – Anzahl der entwickelten Massnahmen: Die Massnahmen lassen sich in die fünf Bereiche MINT-Kultur; Interdisziplina rität; ausserschulische Lernorte; Interesse wecken an Naturwissenschaften und Technik, insbesondere bei jungen Frauen; und Studienwahl unterteilen. Jede Schule erar beitete mindestens eine Massnahme pro Bereich, wobei die meisten Schulen sich nicht auf eine Massnahme pro Bereich beschränkten. – Art der entwickelten Massnahmen: Einige Schulen führen in ihrem Konzept nur neu entwickelte Massnahmen auf, um den Unterschied zur bisherigen Situation hervorzuheben. Andere Schulen nennen auch bereits bestehende Mass nahmen, auf die sich die neu entwickelten Massnahmen beziehen. – Zuordnung zu den fünf Bereichen: Einzelne Massnahmen wie z. B. Sonderwochen wurden von mehreren Schulen gewählt, wurden aber nicht jeweils demselben Bereich zu geordnet. b) Inhaltliche Ebene: – Einstieg in den Bereich NaTech: Die Konzepte bauen auf die jeweils spezifische Ausgangslage mit bereits bestehenden Fördermassnahmen der Schulen auf. Es wurde der Ansatz gewählt, in den ersten Jahren des naturwissenschaftlichen Unterrichts Interesse zu wecken und in den letzten Jahren Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten zu geben. Schulen mit interdisziplinärem NaTech-Unterricht in der Unterstufe führen in ihren Konzepten Massnahmen auf, die propädeutische Themen in der Unterstufe stärker gewichten. – Weiterbildung und Evaluation: Alle Massnahmenkonzepte enthalten Angaben über die vorgesehene Weiterbildung der betroffenen Lehrpersonen sowie die Form der Evaluation der geplanten Massnahmen.
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 73
Amtliches
–
Vergleichbarkeit der Massnahmenkonzepte: Die Schulen beschreiben ihre Massnahmen in unterschiedlichem Detail lierungsgrad. Dieser Umstand sowie die unterschiedlichen Ausgangssituationen an den einzelnen Schulen machen einen Vergleich der Konzepte schwierig.
3. Schlussfolgerung Die Auswertung der Massnahmenkonzepte zeigt, dass das The ma der Förderung von Naturwissenschaft und Technik an den Mittelschulen als wichtig wahrgenommen wird und dass viel Kreativität und Einsatz in die Entwicklung der Konzepte investiert wurden. Die Massnahmen der einzelnen Schulen bezwecken unter anderem ein grösseres NaTech-Angebot (z. B. zusätzliche Sondertage), eine grössere Sichtbarkeit von Naturwissenschaft und Technik im Schulalltag (z. B. durch die Bearbeitung von wis senschaftlichen Texten in den Sprachfächern), einen Ausbau und eine Vertiefung von Themen in den NaTech-Fächern (z. B. durch Physikunterricht im letzten Schuljahr) sowie eine verstärkte Ver netzung mit anderen Fächern (z. B. bei der Durchführung einer Energiewoche) wie auch die Weiterentwicklung des NaTech- Unterrichts selber (z. B. durch Befragungen der Schülerinnen und Schüler). Gleichzeitig wird der Kontakt der Schülerinnen und Schüler zu NaTech im Alltag sowie mit der Praxis ausserhalb der Schule verstärkt (durch Exkursionen und Praktika), und die Re flexion über naturwissenschaftliches und technisches Denken wird angeregt (z. B. durch den Kurs «Werte und Wissen»). Die vorgesehenen Massnahmen ermöglichen zudem eine Sensibili sierung für die Genderthematik im naturwissenschaftlichen Un terricht (durch Weiterbildungen) und schliesslich eine intensivere Beschäftigung mit der Studienwahl im Zusammenhang mit Na Tech (z. B. durch den Austausch mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern). 4. Qualitätssicherung Im Bildungsratsbeschluss vom 27. Mai 2013 wird festgehalten, dass die Umsetzung der Konzepte zwischen 2014 und 2020 erfolgen soll. In dieser Zeit sollen die Schulen dem Mittelschulund Berufsbildungsamt im Rahmen der jährlichen Gespräche mit den Schulleitungen über ihre Erfahrungen mit den getroffenen Massnahmen, über deren Wirkung sowie über die Weiterent wicklung ihrer NaTech-Förderung berichten. Das MBA unter stützt die Schulen bei der Umsetzung und Weiterentwicklung ihrer Fördermassnahmen. Dabei sollen Konvergenz und Ge meinsamkeiten der Massnahmen herausgearbeitet werden, als Grundlage für eine Wirksamkeitsanalyse. Per Ende 2017 soll dem Bildungsrat vom MBA ein Zwischen bericht erstattet werden. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Die Massnahmenkonzepte zur Stärkung von Natur wissenschaft und Technik an den Zürcher Mittelschulen der Kantonsschulen Literargymnasium Rämibühl Zürich, Realgymnasium Rämibühl Zürich, Mathematisch-Naturwissenschafltiches Gymnasium Rämibühl Zürich, Hohe Promenade Zürich, Stadelhofen Zürich, Hottingen Zürich, Freudenberg Zürich, Liceo Artistico, Enge Zürich, Wiedikon Zürich, Rychenberg Winterthur, Im Lee Winterthur, Büelrain Winterthur, Zürich Nord, Zürcher Oberland Wetzikon, Uster, Zürcher Unterland 74 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Bülach, Limmattal Urdorf, Küsnacht sowie Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene werden zur Kenntnis genommen. II. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt erstattet dem Bildungsrat per Ende 2017 einen Zwischen bericht über die Umsetzung und Weiterentwicklung der NaTech-Fördermassnahmen. Die Tabelle und das Konzept sind abrufbar unter www.bi.zh.ch/bildungsrat
Bildungsratsbeschluss vom 16. Juni 2014 Kantonsschule Büelrain: Neue Stundentafel Ausgangslage Der Bildungsrat legte mit Beschluss vom 27. Mai 2013 im Rah men der bezweckten Stärkung von Naturwissenschaft und Tech nik fest, dass während der obligatorischen Schulzeit (7.– 9. Schul jahr) an den Mittelschulen die drei Fächer Physik, Chemie und Biologie einen minimalen Umfang von sechs Jahreslektionen umfassen sollen, wobei jedes der drei Fächer mindestens eine Jahreslektion aufzuweisen hat. Mittelschulen, welche diese An forderungen noch nicht erfüllen, sollen ihre Stundentafel bis Ende Schuljahr 2014/15 entsprechend anpassen und dem Bil dungsrat zur Genehmigung einreichen. Zudem entschied er, dass alle Mittelschulen bis Ende Schuljahr 2013/14 schulspezi fische Massnahmenkonzepte zur Stärkung von Naturwissen schaft und Technik entwickeln und diese dem Bildungsrat vor legen sollen. Die nunmehr vorliegenden Schulkonzepte werden mit separatem Beschluss behandelt. Die Vorgabe des Bildungsrats bezüglich Minimalumfang des naturwissenschaftlichen Unterrichts betrifft die Kantonsschule Büelrain Winterthur als Kurzgymnasium nicht. Im Rahmen ihres Massnahmenkonzepts beantragt die Schule folgende Stunden tafeländerung: NW = Naturwissenschaften ICT = Information and Communication Technology (Informations- und Kommunikationstechnologie IKT) SL = Semesterlektion Fach
Semester bisher
neu
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
Chemie
–
–
3
neu: im 1. Jahr im Rahmen von NaTech1 NaTech1
–
–
–
neues Gefäss Physik
1.5 1.5 2 Änderung
Projekt NW Physik
0.5 0.5 – Änderung
2
3
3
–
–
2
1
3
2
3
3
–
–
Dota tion: + 3 SL
Zielsetzung der Änderung gemäss Unter lagen: Gleich zu Beginn der Ausbildung alltagsbezogene, gesellschaftlich relevante Projektarbeit anbieten
–
–
–
+ 1 SL 2
2
2
gleich
–
–
gleich
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
NaTech als Teil des Fachs Chemie mit interdisziplinärer Arbeitsweise –
–
–
– 1.5 1.5 2
2
2
2
Ein naturwissenschaftliches Fach wird bis zur Matur unterrichtet; Anspruchsniveau steigt –
–
–
–
– 0.5 0.5 –
–
–
–
Mit der Verschiebung des Grundlagenfachs (vgl. oben) verschiebt sich auch der dazugehörige Projektunterricht
Amtliches
Fach
Semester bisher
neu
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
Informatik
ICT
1
1
–
Wirtschaft und Recht Deutsch
–
–
–
–
4
4
3
Änderung
–
–
4
–
3
4
4
4
4
3
3
–
4
–1 SL
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Informatik wird auf das neue Gefäss NaTech1 abgestimmt
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–
–
4
4
ICT vermittelt Office-Skills
4
– 1 SL
– 1 SL
4
–
+ 2 SL
Änderung
Änderung Total Lektionen
–
– 2 SL
neu anstelle von Informatik Mathe matik
–
Informatik neu im Gefäss NaTech1
4
5
4
4
3
3
4
4
Mathematische Methoden werden vermehrt im Fach Physik angewendet; verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mathematik und Physik 4
6
5
–
–
4
4
4
4
5
5
Ausgleich der Gesamtlektionenzahl 4
4
5
4
4
3
3
4
4
4
4
Ausgleich der Gesamtlektionenzahl
11 11 15 14 17 17 14 15 11 11 15 14 17 17 15 15
Erwägungen Die Kantonsschule Büelrain möchte ihren Schülerinnen und Schü lern am Kurzzeitgymnasium einen fächerübergreifenden Einstieg in die Naturwissenschaften ermöglichen. Aus diesem Grund soll das Fach Chemie bereits im ersten Schuljahr eingeführt werden und über das Gefäss NaTech1 verfügen. Darin soll insbesondere aufgezeigt werden, wie Chemie mit Biologie und Physik zusam menhängt. Mit Chemie bereits in der ersten Klasse und Physik bis Ende der 4. Klasse wird neu durchgängig mindestens ein naturwissen schaftliches Fach mit technischen Aspekten erteilt. Die Aufstockung der Dotation im Fach Chemie um vier Semesterlektionen bedingt einen anderweitigen Abbau von drei Semesterlektionen, damit die Obergrenze von 132 Lektionen in den vier MAR-Jahren eingehalten wird. Die Fächer Mathematik, Wirtschaft und Recht sowie Deutsch werden deshalb je um eine Semesterlektion gekürzt. Der Abbau im Fach Mathematik kann durch die künftig verstärkte Zusammenarbeit in den Fächern Physik und Mathematik aufgefangen werden. Der Abbau im Fach Deutsch ist nicht übermässig gross, da er das Kurzsemester 4.2 betrifft. Das Fach Wirtschaft und Recht ist als Schwerpunktfach ohnehin stark dotiert und umfasst zudem Sonderveranstaltungen (z. B. Wirtschaftswoche). Die beantragte Stundentafeländerung führt insgesamt zu keiner wesentlichen Mehrbelastung der Schü lerinnen und Schüler. Die beantragten Stundentafeländerungen der Kantons schule Büelrain entsprechen den kantonalen Vorgaben gemäss Bildungsratsbeschluss vom 10. Mai 2004 sowie den Vorgaben des Maturitätsanerkennungsreglements MAR vom 16. Januar / 15. Februar 1995, Fassung vom 14. Juni 2007. Mit der bean tragten Stundentafeländerung wird die Stossrichtung des Bil dungsrats auf Förderung von Naturwissenschaft und Technik aufgenommen: Das diesbezügliche Interesse der Schülerinnen und Schüler wird möglichst früh geweckt, und die Interdisziplina rität wird gefördert. Zudem wird mit dem Integrationsfach Natur wissenschaft und Informatik das Bewusstsein gesteigert, dass
Kenntnisse in Naturwissenschaft und Technik wesentliche As pekte der Allgemeinbildung sind. Die Stundentafeländerungen wurden vom Gesamtkonvent am 28. Januar 2014 sowie von der Schulkommission am 14. Januar 2014 verabschiedet. Die beantragten Stundentafeländerungen sind auf Beginn des Schuljahrs 2015/16 zu bewilligen. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Die beantragten Anpassungen in der Stundentafel der Kantonsschule Büelrain Winterthur werden auf Beginn des Schuljahrs 2015/16 bewilligt.
Bildungsratsbeschluss vom 16. Juni 2014 Bildungsrätliche Kommission Bildungsstandards und Lehrplan 21. Mutationen. Der Bildungsrat hat an seiner Sitzung vom 12. April 2012 das Mandat und die Zusammensetzung der bildungsrätlichen Kom mission Bildungsstandards und Lehrplan 21 für die Amtsdauer 2011– 2015 beschlossen. Aufgrund von personellen Mutationen im kantonalen Ge werbeverband, im Lehrmittelverlag Zürich, im Zürcher Lehrerin nen- und Lehrerverband, im Departement Schule und Sport der Stadt Winterthur sowie im Generalsekretariat (Bildungsplanung) der Bildungsdirektion nehmen seitens dieser Organisationen Er satzmitglieder in der Kommission Einsitz. Thomas Hess tritt die Nachfolge von Martin Arnold als Ver treter des kantonalen Gewerbeverbandes an. Georgina Bach mann wird als Vertreterin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrer verbands von Lilo Lätzsch abgelöst. Für den Lehrmittelverlag Zürich nimmt Beat Schaller anstelle von Peter Bucher Einsitz. Das Departement Schule und Sport der Stadt Winterthur ent sendet für Reto Zubler neu David Hauser in die Kommission. Die Arbeiten der Geschäftsstelle bezüglich des Themas Bildungs standards werden anstelle von Susanne Ender neu von Max Mangold, Generalsekretariat, Bildungsplanung, übernommen. Auf Antrag der Bildungsdirektion beschliesst der Bildungsrat: I. Martin Arnold, Georgina Bachmann, Peter Bucher, Susanne Ender und Reto Zubler werden mit Dank für die geleisteten Dienste aus der bildungsrätlichen Kommission Bildungsstandards und Lehrplan 21 entlassen. II. Als neue Mitglieder werden ernannt: − David Hauser, Departement Schule und Sport der Stadt Winterthur − Thomas Hess, kantonaler Gewerbeverband − Lilo Lätzsch, Zürcher Lehrerinnen- und Lehrer verband − Max Mangold, Bildungsdirektion, Bildungsplanung − Beat Schaller, Lehrmittelverlag Zürich
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 75
76 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014 77
78 Schulblatt des Kantons Zürich 5/2014
Adressen
Bildungsdirektion Bildungsdirektion www.bildungsdirektion.zh.ch Generalsekretariat 043 259 23 09 Bildungsplanung Walcheturm / Walcheplatz 2 / 8090 Zürich 043 259 53 50 / bildungsplanung@bi.zh.ch Volksschulamt www.volksschulamt.zh.ch, Walchestrasse 21 / 8090 Zürich / 043 259 22 51 – Rechtsfragen / 043 259 53 55 – Behördenschulung / 043 259 22 58 – Abt. Lehrpersonal / 043 259 22 66 – Lehrpersonalbeauftragte / 043 259 22 74 – Vikariate / 043 259 22 70 – Abt. Pädagogisches (Unterrichtsfragen) / 043 259 22 62 – Interkulturelle Pädagogik/QUIMS / 043 259 53 61 – schule&kultur / 043 259 53 52 – Aufsicht Privatschulen / 043 259 53 35 – Abt. Sonderpädagogisches / 043 259 22 91 – Schulärztlicher Dienst / 043 259 22 60 – Projekt Sekundarstufe 9. Schuljahr / 043 259 53 11 – Projekt «Fokus Starke Lernbeziehungen» / 043 259 22 48 Mittelschul- und Berufsbildungsamt www.mba.zh.ch Ausstellungsstrasse 80 / 8090 Zürich / 043 259 78 51 Amt für Jugend und Berufsberatung www.ajb.zh.ch Dörflistrasse 120 / 8090 Zürich / 043 259 96 01 – www.ajb.zh.ch – Amt für Jugend und Berufsberatung – www.lotse.zh.ch – Webweiser zu Jugend, Familie und Beruf – www.berufsberatung.zh.ch – Berufsberatung Kanton Zürich – www.elternbildung.zh.ch – Elternbildung Kanton Zürich – www.lena.zh.ch – Lehrstellennachweis Kanton Zürich – www.stipendien.zh.ch – Stipendien Kanton Zürich Lehrmittelverlag Zürich Räffelstrasse 32 / 8045 Zürich / 044 465 85 85 / lehrmittelverlag@lmv.zh.ch / E-Shop: www.lehrmittelverlag-zuerich.ch Fachstelle für Schulbeurteilung www.fsb.zh.ch / Josefstrasse 59 / 8090 Zürich / 043 259 79 00 / info@fsb.zh.ch Bildungsratsbeschlüsse www.bi.zh.ch > Bildungsrat > Beschlussarchiv (ab 2006 elektronisch) / frühere Beschlüsse bestellen unter 043 259 23 14 Regierungsratsbeschlüsse www.rrb.zh.ch (ab 1. Oktober 2008, soweit zur Veröffentlichung freigegeben, über Ausnahmen beschliesst der Regierungsrat) / Einsicht in Regierungsratsbeschlüsse, die vor dem 1. Oktober 2008 gefasst wurden, kann auf der gleichen Website (Link > Staatskanzlei) beantragt werden. Medienmitteilungen www.bi.zh.ch > Aktuelles (> Archiv) Gesetze und Vernehmlassungen (alle Stufen) www.bi.zh.ch > Gesetze Lehrpläne Kindergarten sowie Primar- und Sekundarstufe www.vsa.zh.ch > Schulbetrieb und Unterricht > Unterrichtsbereiche, Fächer und Lehrpläne
Weitere Adressen Pädagogische Hochschule Zürich www.phzh.ch / Lagerstrasse 2 / 8090 Zürich – Kanzlei / 043 305 51 11 / kanzlei@phzh.ch – Prorektorat Ausbildung / 043 305 52 52 / ausbildung@phzh.ch – Prorektorat Weiterbildung und Forschung / 043 305 53 53 / prorektorat.wb@phzh.ch Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen www.ife.uzh.ch/llbm / Kantonsschulstrasse 3 / 8001 Zürich – Ausbildung: Lehrdiplom für Maturitätsschulen / 044 634 66 55 – Weiterbildung für Maturitätsschullehrpersonen / 044 634 66 15 Hochschule für Heilpädagogik www.hfh.ch / Schaffhauserstrasse 239 / 8090 Zürich / 044 317 11 11 Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen (ZAL) www.zal.ch / Riesbachstrasse 11 / 8090 Zürich / 044 385 83 94 / info@zal.ch – Kurse und Referate – Schulinterne Weiterbildungen – Beratung und Coaching Logopädisches Beratungstelefon staefa@sprachheilschulen.ch Sprachheilschule Stäfa / 044 928 19 19 Audiopädagogische Dienste Zürich APD / Förderung und Beratung Frohalpstrasse 78 / 8038 Zürich / 043 399 89 21 Schule der Stadt Zürich für Sehbehinderte SfS / Beratung und Unter stützung Eugen-Huber-Strasse 6 / 8048 Zürich / 043 311 79 00 Beamtenversicherungskasse Stampfenbachstrasse 63 / 8090 Zürich / 043 259 42 00
Impressum Nr. 5/2014
5.9.2014
Schulblatt des Kantons Zürich Kantonales Publikationsorgan der Bildungs direktion für Lehrkräfte und Schulbehörden, 129. Jahrgang Erscheinungs weise 6-mal pro Jahr Auflage 19 000 Exemplare Redaktion [red] Redaktionsleiterin Katrin Hafner [kat], E-Mail: katrin.hafner@bi.zh.ch, Redaktorin Jacqueline Olivier [jo], E-Mail: jacqueline.olivier@bi.zh.ch Ständige Mitarbeit Andreas Minder, Charlotte Spindler Adresse Redaktion Schulblatt, Bildungsdirektion Kanton Zürich, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Verena Schwizer Gebert, Tel. 043 259 23 14, Fax 044 262 07 42, E-Mail: schulblatt@bi.zh.ch Gestaltung www.bueroz.ch Druck Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Bern Anzeigen verwaltung Stämpfli AG, Anzeigenverwaltung, Wölflistrasse 1, 3001 Bern, Tel. 031 767 83 30, E-Mail: inserate@staempfli.com Abonnement Stämpfli AG, Abonnementsmarketing, Wölflistrasse 1, 3001 Bern, Tel. 031 300 62 52, E-Mail: abonnemente@staempfli.com Abo-Preis Fr. 40.– pro Jahr
Schulferiendaten www.vsa.zh.ch > Service > Ferienkalender Plattform Stopp Gewalt www.stopp-gewalt.ch Lehrpersonenkonferenzen www.bi.zh.ch > Downloads & Publikationen > Lehrpersonenkonferenzen Erlasse zum Mittelschulrecht www.mba.zh.ch > Mittelschulen > Mittelschulrecht > Rechtsgrundlagen Erläuterungen zum Bildungsrecht www.mba.zh.ch > Mittelschulen > Mittelschulrecht > Stichworte / FAQ Erlasse zum Berufsbildungsrecht www.mba.zh.ch > Berufsbildung > Berufsbildungsrecht Formulare, Schulleistungsstudien, Evaluationen und Berichte etc. www.bi.zh.ch > Downloads & Publikationen Informationen zu gegenwärtigen Projekten www.bi.zh.ch > Unsere Direktion > Bildungsplanung > Projekte Zahlen und Fakten www.bista.zh.ch Wer das Gewünschte nicht findet, kann sich an das zuständige Amt oder an das Generalsekretariat der Bildungsdirektion wenden / 043 259 23 09
Erscheinungs- und Annahmeschlussdaten Heft-Nr. Erscheinungsdatum Redaktionsschluss Inserateschluss 6/2014
7.11.2014
2.10.2014 10.10.2014
Power fürs Studium
10%tt Raba
6% t
alle Apple Computer
Rabat
alle iPad Modelle
Studenten-Aktion gültig bis 19. Oktober 2014.
HF nur C
50.–
University für Studenten Jede Menge Zubehör Profitieren Sie zusätzlich von den Spezialpreisen für Studenten auf das ganze Zubehörsortiment.
Bahnhofplatz 1 8001 Zürich Tel. 044 265 10 10
• • • • • • •
Für 2 Geräte (PC / Mac /Tablet) Windows / Mac / OS X / iOS Automatischer Versions-Upgrade Lizenz für 4 Jahre gültig Kostenloses Office Mobile + 60 Skype-Freiminuten + 20 GB OneDrive Weinbergstrasse 71 8006 Zürich Tel. 044 360 39 14