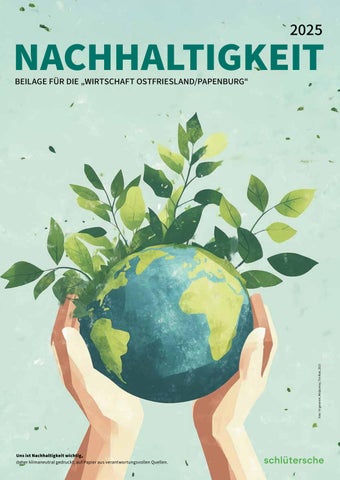NACHHALTIGKEIT
BEILAGE FÜR DIE „WIRTSCHAFT OSTFRIESLAND/PAPENBURG“
Nachhaltig investieren für unsere Zukunft.

Wer aus derselben Region kommt, spricht die gleiche Sprache. Genau wie unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden sind wir tief verwurzelt und kennen als mittelständische Banken die Bedürfnisse der regionalen Unternehmen besonders gut. Wir beraten authentisch und auf Augenhöhe und bringen gemeinsam den Fortschritt dorthin, wo er am schönsten ist: direkt vor die eigene Haustür.
Wir machen den Weg frei. Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment, R+V Versicherung, easyCredit, DZ BANK, DZ PRIVATBANK, VR Smart Finanz, DZ HYP, MünchenerHyp, Reisebank.
„Es geht um eine Kultur der Nachhaltigkeit!“
Im Februar dieses Jahres trafen sich auf Einladung des „Deutschen Klima-Konsortiums“ mehr als hundert führende Vertreter der Sozial-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften im Zentrum für Klimaresilienz der Universität Augsburg und diskutierten die aktuelle „Umsetzungskrise“ von Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit in Deutschland.
Das ist insofern bemerkenswert, als bisherige Tagungen des Klima-Konsortiums vorzugsweise von den naturwissenschaftlichen Disziplinen und deren Erkenntnissen zum Thema geprägt waren. Sie galten naturgemäß als zuständig für die messbaren „Grenzen des Wachstums“, wie sie der Club of Rome bereits 1972 kommen sah. Doch inzwischen – über 50 Jahre später – ist klar, dass alle relevanten Fakten zum menschengemachten Klimawandel und zur Notwendigkeit nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens auf dem Tisch liegen. Was jedoch nach wie vor fehlt, ist die breite gesellschaftliche Konsequenz im Handeln.
Das hat nachweislich auch mit Akzeptanz zu tun. Die öffentliche Debatte ist teilweise geprägt von (auch aktiv betriebener) Verunsicherung, Desinteresse oder Ausflüchten. Dies erklärt sich wohl zu nicht unerheblichen Teilen als menschlich nachvollziehbare Reaktion auf Gefühle der Angst und Überforderung angesichts der großen Aufgaben.
Was hilft, ist Aufklärung, im offenen, informierten Austausch. Und ein Überzeugen durch beispielhaftes Handeln. Viele in Ostfriesland tun dies bereits sehr engagiert. Auch die Ostfriesische Landschaft hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben: Ein neues Projekt („KIO“) der Regionalen Kulturagentur motiviert und unterstützt die Kultureinrichtungen Ostfrieslands, sich auf den nachhaltigen, klimagerechten Weg zu machen, überzeugtes Vorbild zu sein für gesamtgesellschaftliches Engagement und somit einzustehen für eine „Kultur der Nachhaltigkeit“.
Denn das brauchen wir: Gute, nachhaltige Beispiele und die gelebte Zuversicht, dass der Aufwand sich auf lange Sicht lohnt. Das ist ja die Herausforderung bei der Nachhaltigkeit: Wir gehen eine Wette auf die

Zukunft ein. Der Ertrag unserer Bemühungen stellt sich kaum sofort ein. Aber handeln wir nicht, bleiben jedwede Erträge in Zukunft womöglich für immer aus. Erst unsere Kinder und Kindeskinder werden uns später einmal danken.
Der Klimawandel und mit ihm die Erkenntnis, wie unabdingbar Nachhaltigkeit zur Maxime unseres Handelns werden muss, ist vor unserer Haustür angekommen. Stürme, Überschwemmungen und Dürren sind in der Region keine Seltenheit mehr. Für Ostfriesen sind solche Unwägbarkeiten der Natur sicher erst einmal nicht ungewöhnlich. Seit Jahrhunderten leben und wirtschaften wir in Auseinandersetzung mit der Natur. Die Qualität dessen, was uns heute und in Zukunft herausfordert, ist jedoch ungleich größer.
Trotzdem macht mir gerade unsere lebendige Tradition hier Hoffnung: Wer, wenn nicht die Ostfriesen hat das Zeug dazu, sich auch den neuen Herausforderungen erfolgreich zu stellen. Beispiele dafür gibt es bereits in der Region. Wir sollten uns daran orientieren.
Rico Mecklenburg, Präsident Ostfriesische Landschaft
Inhalt
6 Nachhaltigkeit systematisch integriert
Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg nimmt im Interview Stellung zum Thema Nachhaltigkeit im Schulunterricht
7 Ausgezeichnete Biosphärenschule
Als neues Mitglied des Netzwerks der Biosphärenschulen in der niedersächsischen Wattenregion setzt sich die Grundschule Mittegroßefehn aktiv für nachhaltige Regionalentwicklung und den Schutz des Wattenmeers ein.
8 Erhaltenswerte Bausubstanz schützen
Die Arbeitsgruppe Baukultur der Ostfriesischen Landschaft engagiert sich für die Erhaltung historisch wertvoller Gebäude. Denn diese sind nicht immer geschützt.
10 Klimaschutzmanagement für die Zukunft
Womit beschäftigen sich lokale Klimaschutzmanagerinnen und -manager? Antworten gibt’s im Interview.
12 Einmal quer rüber
Der Ems-Jade-Kanal verbindet Emden und Wilhelmshaven miteinander. Ihm verdanken auch Wanderer und Radtouristen, dass sie Ostfriesland auf angenehme Weise durchqueren können.
Impressum
Verlag:
Schlütersche
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover Telefon 0511 8550-0 info@schluetersche.de, www.schluetersche.de Geschäftsführung: Ingo Mahl und Roland Hauke
Das Manuskript ist Eigentum des Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Auswahl und Zusammenstellung sind urheberrechtlich geschützt. Für die Richtigkeit der im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Autorenbeiträge und der PR-Texte übernehmen Verlag und Redaktion keine Haftung.
Layout und Herstellung:
14 Ein Treffpunkt für die Nachhaltigkeit
Die „Machbar“ in Emden dient als Raum für Austausch und gemeinschaftliches Engagement. Sie bringt Bürger:innen zusammen und fördert kulturelle Initiativen aus der Region.
16 Grüne Ferien auf 22 m²
Mit seinen grünen Ferienunterkünften will das Unternehmen Green Tiny Houses umweltfreundlichen Urlaub einfach machen. Ein Beispiel dafür: Das Green Tiny Village in Harlesiel.
18 Meyer Werft – grüner Schiffbau?
Die Meyer Werft in Papenburg ist eines der traditionsreichsten Unternehmen Deutschlands und ein weltweiter Vorreiter im modernen Schiffbau. Auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit.
20 Neues Leben für alte Kleidung?
Secondhand statt fast Fashion – das ist längst keine Eintagsfliege mehr. Sogar große Player auf dem Modemarkt springen auf den Trend auf. Aber ist das noch nachhaltig?
22 Nachhaltiges Handeln beginnt im Kopf
Als Klimapsychologin nutzt Janna Hoppmann, Gründerin von ClimateMind, wissenschaftliche Erkenntnisse, um Menschen, Organisationen und Firmen zum Umdenken zu motivieren.
Ramona Bolte Kommunikation & Wirtschaft GmbH
Redaktion: Mediavanti GmbH
Donnerschweer Straße 90 26123 Oldenburg mediavanti.de
Autor*innen:
Vera Busch
Detlef Herwig
Lisa Knoll
Claus Spitzer-Ewersmann Alke zur Mühlen
Druck: Bonifatius GmbH Druck – Buch – Verlag Karl-Schurz-Straße 26, 33100 Paderborn
Printed in Germany 2025
Gender-Hinweis: Es oblag den jeweiligen Verfassern der Texte – AnzeigenKunden, Autor(en), Redaktion, Interviewten – ob sie ihre Beiträge „gendern“ oder aus praktischen Gründen wie Platzersparnis und bessere Lesbarkeit die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern wählen. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung der jeweils anderen Geschlechter (weiblich, männlich, divers), die mit den Inhalten der Texte gleichermaßen angesprochen werden.
Sicher, wirtschaftlich, umweltbewusst: Der Name Janssen steht seit 1949 für „Kompetenz in Elektrotechnik“.
Wir sind die Spezialisten für die Planung, Entwicklung und Fertigung komplexer elektrotechnischer Großanlagen an Land und auf See.
Rolf Janssen GmbH Elektrotechnische Werke Emsstraße 4, 26603 Aurich www.rolf-janssen.de

Lernen. Forschen. Zukunft gemeinsam gestalten.
Grüne Technologien für unsere Region und die Welt von morgen
Von emissionsarmer Schifffahrt über nachhaltigen Tourismus bis hin zur klimaneutralen Mobilität: die Hochschule Emden/Leer steht für praxisnahe Studiengänge und zukunftsorientierte Forschung mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln wir Lösungen für die Herausforderungen von morgen. Sprechen Sie uns an. Gemeinsam gestalten wir Zukunft.
Komm näher » www.hs-emden-leer.de
Nachhaltigkeit systematisch in den Schulalltag integriert
Wann ist der richtige Zeitpunkt, Kinder mit Nachhaltigkeitsthemen vertraut zu machen?
Und welche Rolle kann dabei der Schulunterricht spielen? Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg nimmt Stellung.
Interview: Claus Spitzer-Ewersmann
Frau Ministerin, wie findet sich das Thema „Nachhaltigkeit“ in den Lehrplänen der niedersächsischen Schulen wieder?
Julia Willie Hamburg: Nachhaltigkeit ist ein Thema, das unsere Kinder und Jugendlichen nicht nur bewegt, sondern auch direkt betrifft. Durch frühzeitige Bildung rund um das Thema Nachhaltigkeit lernen Kinder und Jugendliche, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Mit dem Erlass „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) wird seit 2021 sichergestellt, dass Nachhaltigkeit systematisch in den Schulalltag integriert wird. Uns geht es darum, zukunftsfähiges und transformatives Denken und Handeln in der globalisierten Gesellschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit zu fördern. Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, welche Auswirkungen ihr eigenes Handeln auf die Welt hat, kritisch hinterfragen und aktiv mitgestalten können. Dabei verfolgt der Erlass einen ganzheitlichen Ansatz: Themen wie Umweltschutz, Klimaschutz und das verantwortungsvolle Handeln in einer globalen Gesellschaft können so immer wieder in Unterrichtsfächern aufgegriffen, gesondert in Projekten beleuchtet werden und spielen im Schulleben eine wichtige Rolle.
Niedersachsens Kulturministerin
Julia Willie Hamburg

Wäre es sinnvoll, ein eigenes Unterrichtsfach zu diesem Themenkomplex einzuführen?
Hamburg: Schule bedeutet heute weit mehr als nur die Vermittlung von Fachwissen. Wir möchten junge Menschen dazu befähigen, ihr Leben selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und aktiv mitzugestalten. Nachhaltigkeit ist dafür ein zentrales Thema – und deshalb bereits fächerübergreifend im Unterricht verankert. Statt ein eigenes Fach einzuführen, setzen wir darauf, dass Nachhaltigkeit in vielen verschiedenen Fächern und Kontexten eine Rolle spielt. Durch den BNE-Erlass haben Schulen die Möglichkeit, ihre Unterrichtsgestaltung flexibel anzupassen, so dass freiere Lernräume entstehen, in denen Schülerinnen und Schüler verstärkt Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können. Dadurch kann Nachhaltigkeit mit unterschiedlichen Aspekten praxisnah vermittelt werden - in allen Unterrichtsfächern unter der Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven.
Gab es – vielleicht auch in anderen Bundesländern – bereits entsprechende Versuche?
Die 1986 in Hannover geborene Julia Willie Hamburg ist seit November 2022 niedersächsische Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes. Die Politikerin ist Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. „Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, welche Auswirkungen ihr eigenes Handeln auf die Welt hat, kritisch hinterfragen und aktiv mitgestalten können.“
Können Sie ein Beispiel nennen?
Hamburg: Ein Beispiel für Nachhaltigkeit im Unterricht ist das Projekt und Schulnetzwerk „Internationale Nachhaltigkeitsschule/Umweltschule in Europa“, bei dem bereits 449 Schulen in Niedersachsen für ihr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurden. So wollen wir Kinder befähigen, sich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Auch an den berufsbildenden Schulen ist „Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE)“ ein fester Bestandteil des Unterrichts. Dabei werden sowohl die Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ als auch das Konzept eines ganzheitlich nachhaltigen Lernorts berücksichtigt – von der energetischen Sanierung der Schulgebäude bis hin zu umweltfreundlicher Mobilität. So entsteht eine Bildungskette, die Nachhaltigkeit umfassend integriert.
Hamburg: Eine wichtige Barriere ist die psychologische Distanz: die Vorstellung, die Klimakrise sei weit weg. Klimagefühle wie Angst oder Hilflosigkeit und soziale Ablehnung, die wir wegen unseres klimafreundlichen Handelns erfahren können, sind auch von Bedeutung. Außerdem muss die Intentions-Verhaltens-Lücke überbrückt werden. Das meint die Kluft zwischen Absicht und Handeln, umgangssprachlich gesagt: den inneren Schweinehund.
Ab welchem Alter ist es sinnvoll, Schulkindern Nachhaltigkeitsthemen näherzubringen?
Hamburg: Wie schon erwähnt, ist die Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit bereits in jungen Jahren sinnvoll. Denn Kinder sind von Natur aus neugierig und offen für Neues – das ist die beste Voraussetzung, um ihnen auch spielerisch den respektvollen Umgang mit Natur und Tieren oder kleine Projekte zum Wassersparen, näherzubringen. All das fördert ein Bewusstsein für verantwortungsvolles Handeln.

Ausgezeichnete Biosphärenschule
Grundschule Mittegroßefehn
Von Alke zur Mühlen
Als neues Mitglied des Netzwerks der Biosphärenschulen in der niedersächsischen Wattenregion setzt sich die Grundschule Mittegroßefehn aktiv für nachhaltige Regionalentwicklung und den Schutz des Wattenmeers ein. Für die Schule ist es ein logischer Schritt, ihr Selbstverständnis auch auf diesem Weg zu leben.
Seit jeher sind die Fehntjer auch Seefahrer gewesen. Im benachbarten Timmel gab es eine Navigations- und Seefahrerschule, in der Kirche Mittegroßefehns hängt bis heute als Erinnerung daran das Modell eines Großseglers. Das Motto der örtlichen Grundschule: „Gemeinsam Segel setzen – miteinander in einem Boot“. Im Herzen des Landkreises Aurich gelegen, gehört zu Mittegroßefehn auch eine intensive Verbindung zum nahegelegenen Wattenmeer und seinem Nationalpark. Seit Ende 2024 darf sich die Grundschule Mittegroßefehn nun „Biosphärenschule“ nennen.
Nachhaltigkeit im Schulalltag fest verankert
Schulleiterin Cordula Aulke betonte bei einer Feierstunde zur Zertifizierung, dass die Grundschule schon seit Jahren nachhaltige Bildungsarbeit leiste. Die Schulgemeinschaft setzt sich dafür ein,
Schüler:innen für die Natur- und Kulturlandschaft vor und hinter dem Deich zu sensibilisieren. Als Plattdüütsk School bringt sie den Kindern die Heimat Ostfriesland und ihre Sprache näher. Und als „Umweltschule in Europa“ und aktiv im Projekt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ hat die Schulgemeinschaft bereits Erfahrung in den Handlungsfeldern Biodiversität und Partizipation gesammelt. Das Lernen über die Natur wird mit der Förderung der regionalen Sprache kombiniert – ein Ansatz, der den jungen Menschen ihre Heimat näherbringt.
Das Wattenmeer als Lernort und Inspiration
Mit der Zertifizierung als Biosphärenschule ist die Grundschule Mittegroßefehn nun Teil eines Netzwerks von 18 Schulen, die sich gemeinsam für den Schutz des Wattenmeers und eine nachhaltige Regionalentwicklung einsetzen. In den Lehrplänen, praxisnah im Unterricht und in fächerübergreifenden Projekten wird sowohl die Identifikation der Schüler:innen mit ihrer Region als auch die Motivation, sie aktiv mitzugestalten, integriert. In der Grundschule Mittegroßefehn hilft dabei immer wieder das Schulmaskottchen, die aufgeweckte Möwe Kieki mit dem gestreiften Schal. Mit ihr machen Entdeckungsreisen durch die Natur gleich doppelt so viel Spaß.
Foto:

Die Projektgruppe „Ortsbildanalyse“ innerhalb der AG Baukultur
– Kulturlandschaft der Ostfriesischen Landschaft testet den Erfassungsbogen bei einem Rundgang durch Nesse.
Besonders erhaltenswerte
Bausubstanz schützen
AG Baukultur
Von Alke zur Mühlen
Die Scheune mit dem besonderen Klinkermuster im Giebel, das Bauernhaus mit seinen historischen Fensterläden, der alte Spieker – viele Ortsbilder werden von prägnanter Baukultur geprägt. Doch nicht immer sind diese Gebäude geschützt. Die Arbeitsgruppe Baukultur der Ostfriesischen Landschaft engagiert sich für besonders erhaltenswerte Bausubstanz.
Historisch wertvolle Gebäude stehen in der Regel unter Denkmalschutz. Das gilt aber nicht immer für Bauten, Ensembles und städtebauliche Zusammenhänge, die wichtige Bestandteile eines historisch gewachsenen Ortes darstellen. „Abbruch oder nicht sachgemäßer Umbau können Verluste dieser Baukultur bedeuten und das jeweilige charakteristische Ortsbild stark und nachhaltig beeinträchtigen“, erläutert der Architekt und Denkmalpfleger Kai Nilson. Er engagiert sich in der „AG Baukultur – Kulturlandschaft“ für besonders erhaltenswerte Bausubstanz. Seit 2022 gibt es diese Gruppe der Ostfriesischen Landschaft. Nach der Startphase begann 2023 die Arbeit an konkreten Projekten. Dazu gehören ein Architekturwettbewerb für Studierende, die Bestandsaufnahme im KulturLandschaftsElementeKataster (KLEKs) und die Ortsbildanalysen zur Benennung schützenswerter Baukultur.
Entdecken, schützen, weiterentwickeln
Bei den Analysen vor Ort suchen Expert:innen nach „besonders erhaltenswerter Bausubstanz“. So lautet der Fachbegriff für
die nicht zwingend denkmalgeschützten Gebäude. „Die Arbeit der Projektgruppe ist so wichtig, weil es im Gegensatz zu den geschützten Baudenkmälern keine offiziellen Listen für die besonders erhaltenswerte Bausubstanz gibt“, betont Dr. Nina Hennig, Leiterin der Museumsfachstelle / Volkskunde bei der Ostfriesischen Landschaft. Hier setzt das Projekt zur Ortsbildanalyse an – ein kostenloser Service für die Gemeinden. „Übrigens können Hausbesitzer von einer Einordnung in die Kategorie besonders erhaltenswerter Bausubstanz profitieren“, ergänzt Nilson. Denn im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes (GEG 2024) bestehe die Möglichkeit einer KfW-Förderung, um Erhaltungsmaßnahmen zu unterstützen.
Bessere Förderungsmöglichkeiten
Das Projekt-Team Ortsbildanalyse besteht aus erfahrenen Expert:innen aus den Bereichen Architektur, Energieberatung, Landschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege und Kunstgeschichte; einige verfügen über Erfahrungen in der Kommunalpolitik. Aktuell berät es die Gemeinde Neuharlingersiel. Dort führte die Projektgruppe bereits einen ersten Rundgang mit einem eigens entwickelten Erfassungsbogen durch. Zwei weitere Gemeinden haben bereits ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit der AG Baukultur bekundet.
Foto: Sonja König, Ostfriesische Landschaft
Regionale Kompensation mit




Sind Sie an diesem Thema interessiert und haben Fragen?
Dann melden Sie sich gerne bei uns unter der Tel. 04941 - 177 244.



Wie das Klimaschutzmanagement
die Zukunft prägt
Womit beschäftigen sich eigentlich lokale Klimaschutzmanagerinnen und -manager?
Diese und weitere Fragen stellen wir Kathrin Klaffke (Papenburg), Johannes Fuchs (Uplengen) und Christoph Runden (Emden).
Interview: Claus Spitzer-Ewersmann
Worin bestehen Ihre wichtigsten Aufgaben als Klimaschutzmanager?

Christoph Runden: Hauptaufgabe ist, die seitens Verwaltung und Politik beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen strategisch umzusetzen und Emden zukunftsfähig aufzustellen. Als MasterplanKommune im bundesweiten Programm „100% Klimaschutz“ hat die Stadt Emden bereits mit Projektbeginn 2016 entscheidende Weichen gestellt. Ein wichtiger Meilenstein ist die Fortschreibung des „Masterplans 100 % Klimaschutz“ im Frühjahr 2024:
Die Stadt Emden hat beschlossen, das Tempo beim Klimaschutz zu erhöhen, um das Ziel der Treibhausgasneutralität spätestens bis 2040 zu erreichen. Nun liegt der Fokus darauf, konkrete Maßnahmen umzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei ist die größte Herausforderung die Dekarbonisierung der Energieversorgung. Ein entscheidender Baustein dafür ist die kommunale Wärmeplanung, die aktuell für Emden aufgestellt wird. Sie bildet die Grundlage für eine klimafreundliche Wärmeversorgung. Gleichzeitig treiben wir den Ausbau erneuerbarer Energien – insbesondere im Bereich Windkraft und PV – weiter voran.
Kathrin Klaffke: Meine Aufgabe besteht darin, die Stadt Papenburg auf dem Weg zur Klimaneutralität zu begleiten und die Maßnahmen, die dazu notwendig sind auf den Weg zu bringen und zu koordinieren. Dazu zählen unter anderem die kommunale Wärmeplanung, die Förderung des Radverkehrs und anderer alternativer Mobilitätsangebote wie das Carsharing. Darüber hinaus
kümmere ich mich um die Zusammenarbeit mit Schulen und die Beratung von Bürgern.

Johannes Fuchs: Da der Dis kurs um das Thema Klima wandel mitunter sehr umkämpft ist, halte ich es für ungemein wichtig zu bestimmten Thematiken zu sensibilisieren (sowohl nach innen als auch nach außen), um darüber Bewusstsein und auch Akzeptanz zu schaffen. Hierfür ist es u.a. zentral, ein guter Zuhörer zu sein und zu erkennen, welche Akteure vor Ort als Multiplikatoren in Frage kommen. Darüber hinaus ist es essentiell, die durchaus dynamische Förderlandschaft sowie entsprechende Gesetzgebungen oder auch -novellierungen im Blick zu behalten, um zeitnah reagieren zu können. Hierfür ist es unerlässlich, sich ein Netzwerk aufzubauen, da man als „Einzelkämpfer“ sonst oft auf verlorenem Posten wäre.
Welches Thema liegt Ihnen ganz besonders am Herzen?
Fuchs: Mir liegt kein Thema besonders am Herzen, sondern vielmehr eine „Akteursgruppe“: die Kinder. Dies vor folgendem Hintergrund: Jeder Mensch ist dazu bestimmt, ein Erfolg zu sein, auch unsere Kinder! Auch sie werden ihre eigene Geschichte machen, „aber nicht unter selbstgewählten Bedingungen, sondern unter unmittelbar vorhandenen, gegebenen und überlieferten Umständen“ (nach Karl Marx). Deswegen liegt mir im Hinblick auf Generationengerechtigkeit die Enkeltauglichkeit in Verbindung mit der Implementierung von entsprechenden Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung am Herzen. Daher möchte ich an dieser Stelle auch auf das Leitmotiv „Es geht um die Kinder“ aus dem Buch „Konferenz der Tiere“ von Erich Kästner verweisen, das ich stets versuche im Hinterkopf zu behalten!
Runden: Als Kommune hat die Stadt Emden eine Vorbildfunktion. Es muss gezeigt werden, dass Klimaschutz nicht nur notwendig, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich sinnvoll ist. Ein Beispiel ist der Ausbau von Photovoltaikanlagen. Sie sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Zusätzlich spielen energetische Sanierungen eine zentrale Rolle, denn sie senken langfristig die Energiekosten und steigern gleichzeitig den Wohnkomfort. Wenn die Stadt als Vorbild bei eigenen Gebäuden vorangeht und die Vorteile sichtbar macht, motiviert das die Bürger*innen und Unternehmen, selbst aktiv zu werden. Klimaschutz hat immer auch eine starke soziale Komponente und muss die gesamte Gesellschaft einbeziehen. Ein gutes Beispiel dafür ist die erfolgreiche Arbeit in den städtebaulichen Sanierungsgebieten in Emden. Hier werden mit Hilfe der Städtebauförderung gezielt private energetische Modernisierungen gefördert, die sonst nicht oder so nicht möglich wären.
Klaffke: Das Thema Radverkehr liegt mir besonders am Herzen, da ich als Bürgerin der Stadt mehr Menschen dazu bewegen möchte, das Fahrrad zu benutzen. Wir streben die Zertifizierung als Fahrradfreundliche Kommune an und versuchen, die Stadt für den Radverkehr attraktiver zu gestalten. Ausbau und Sanierung von Radwegen sind allerdings sehr kostenintensiv und nur mit Fördermitteln finanzierbar.
Wie ist die Resonanz auf Ihre Tätigkeit?
Fuchs: Als relativ neuer Mitarbeiter in der Verwaltung, nicht vor Ort wohnend und auch noch aus der Südhälfte Deutschlands zugezogen, gepaart mit den nicht ganz einfachen Themen rund um den Klimawandel war es zu Beginn vielleicht etwas verhalten. Aber die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzepts hat gezeigt, dass es durchaus eine Vielzahl interessierter Bürgerinnen und Bürgern gibt. So hat sich aus den durchgeführten Workshops heraus das Format des „Klimadialogs“ entwickelt und auch mit einem festen Kern an Teilnehmenden etabliert. Weiterhin reift innerhalb der Verwaltung sukzessive das Bewusstsein für die Notwendigkeit ins Handeln zu kommen, sodass sich vielfältige Handlungsmöglichkeiten ergeben. Das bereits angesprochene Netzwerk wächst kontinuierlich, erste Multiplikatoren haben sich herauskristallisiert. Dies zeigt mir, dass mein Wirken erste Früchte trägt.
Klaffke: Wir informieren die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig in der Presse und den Sozialen Medien über Termine und Themen im Bereich Klimaschutz. Außerdem bin ich auf Veranstaltungen präsent, so dass Bürgerinnen und Bürger sowie andere Akteure Gelegenheit haben, mit mir in Kontakt zu treten. Das Stadtradeln organisiere ich und nehme an den Auftakt- und Abschlussveranstaltungen teil. Insgesamt ist die Resonanz positiv zu bewerten.

Runden: Die Klimaschutzbemühungen Emdens werden in der Politik und der Bevölkerung durchaus wahrgenommen und finden viel Zuspruch. Viele Emderinnen und Emder sind sich bewusst, wie wichtig die Transformation zu einer klimafreundlichen Stadt ist. Dennoch kommt hin und wieder die Frage auf, warum manche Projekte nicht schneller umgesetzt werden können. Dies liegt häufig an komplexen Abstimmungsprozessen, begrenzten Ressourcen und langen Bewilligungszeiten für bestimmte Förderprogramme. Die Stadt Emden nutzt dabei alle vorhandenen Ressourcen effizient und sucht kontinuierlich nach Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren. Die insgesamt positive Resonanz zeigt, dass Emden auf dem richtigen Weg ist und immer mehr Menschen die Transformation aktiv mitgestalten möchten.
Foto:StadtPapenburg
Foto:GemeindeUp

Einmal quer rüber
Ems-Jade-Wanderweg
Von Detlef Herwig
Vor 145 Jahren begann der Bau des Ems-Jade-Kanals, der Emden und Wilhelmshaven miteinander verbindet. Ihm verdanken auch Wanderer und Radtouristen, dass sie Ostfriesland auf angenehme Weise durchqueren können.
Drei wesentliche Argumente gab es Ende des 19. Jahrhunderts für den Bau einer Wasserstraße zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil der ostfriesischen Halbinsel. So sollte die Belieferung des Kriegshafens Wilhelmshaven mit Kohle aus dem Ruhrgebiet erleichtert werden. Die wachsende Stadt am Jadebusen versprach zudem ein guter Markt für landwirtschaftliche Produkte, Baumaterial und Torf zu werden. Ebenso wichtig: Der Kanal half bei der Entwässerung des höhergelegenen, inneren Teils Ostfrieslands.
Mit 4,3 Knoten übers Wasser Wirtschaftlich hat der 72,3 Kilometer lange Kanal über die Jahrzehnte an Bedeutung verloren. Mit wenigen Ausnahmen wird er heute nur noch touristisch genutzt. Zur Überwindung der Höhenunterschiede gibt es sechs Schleusen, aufsteigend von der Ems bis östlich Aurich und wieder absteigend zur Jade. Sportboote dürfen ihn mit maximal 4,3 Knoten (acht km/h) befahren und an mehreren Stellen in das idyllische ostfriesische Kanalnetz abbiegen. Möglich ist über die Leda, den Elisabethfehnkanal und den Küstenkanal auch die Weiterfahrt nach Oldenburg.
Auf den parallel zum Kanal verlaufenden Wegen lässt sich die Region mit dem Fahrrad und zu Fuß erkunden. Wer genau hinsieht, identifiziert auf der Tour drei unterschiedliche Landschaftstypen: die Marsch, die Geest und das Moor. Zu meistern sind dabei keine großen Höhenunterschiede. Die Steigungen halten sich in Grenzen, sie bereiten niemandem Probleme. In Aurich kreuzt die Route den Ostfriesland-Wanderweg, anschließend ist der Ems-Jade-Weg Teilstück des Europäischen Fernwanderweges E9, der von der iberischen Halbinsel bis nach Polen führt.
Standbein im regionalen Aktivtourismus
Apropos Aurich: In Ostfrieslands heimlicher Hauptstadt haben die Oberen längst die Bedeutung des Wander- und Radwegs für einen nachhaltigen und achtsamen Tourismus erkannt. Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Radverkehr 2030 wurden deshalb mehrere Abschnitte umfassend saniert und neu gepflastert. Daneben wurde die Breite, die zuvor streckenweise bei nur etwas mehr als einem Meter gelegen hatte, verdoppelt.
Die Stadt Aurich erhofft sich von diesen Maßnahmen eine Verbesserung des Nutzerkomforts und darauf folgend eine Steigerung der Attraktivität sowie die Stärkung eines nachhaltigen und klimafreundlichen Rad- und Wandertourismus in der Region. So dürfte der Ems-Jade-Weg auch in Zukunft seiner Rolle als eines der wichtigsten Standbeine im ostfriesischen Aktivtourismus gerecht werden.
IHRE AUSZEICHNUNG FÜR NACHHALTIGES HANDELN
CREDITREFORM ECOZERT

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil Mit der Auszeichnung EcoZert können Sie das nachhaltige Handeln Ihres Unternehmens wirksam nach außen präsentieren.
Mehr unter www.creditreform.de/leer/ecozert
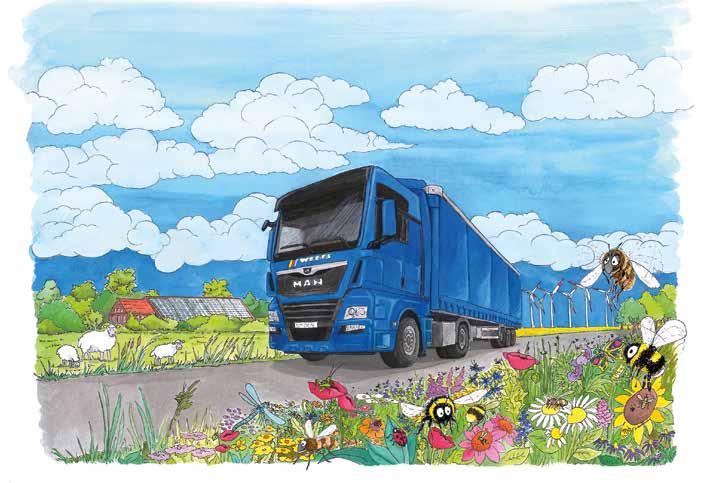

Ein Treffpunkt für die Nachhaltigkeit
„Machbar“
Emden
Von Lisa Knoll
Die „Machbar“ in Emden hat sich seit ihrer Gründung im Januar 2024 zu einem Raum für Austausch und gemeinschaftliches Engagement entwickelt. Sie bringt Bürger:innen zusammen und fördert kulturelle Initiativen aus der Region. Ein zentraler Schwerpunkt der „Machbar“ liegt auf ressourcenschonendem Handeln.
Die Gründung der „Machbar“ beruht auf der Idee, einen nachhaltigen und ganzheitlichen Wandel in der lokalen Gemeinschaft zu fördern. Hier sollen sowohl ökologische als auch soziale und kulturelle Impulse gesetzt werden. Die Projektidee entstand über einen Zeitraum von drei Jahren und konzentriert sich auf zwei zentrale Aspekte: Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Das Zentrum für Begegnung und Nachhaltigkeit wurde von mehreren regionalen Institutionen ins Leben gerufen und konnte schließlich im Januar 2024 in der Großen Straße 34, im Herzen der Emder Innenstadt, eröffnet werden.
Einer der Impulsgeber des Projekts ist die agilio gGmbH, die sich die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung zur Aufgabe macht. Zu den weiteren Gründungsmitgliedern zählen der Verein Das Boot e.V., die Evangelisch-reformierte Kirche und die Hochschule Emden/Leer. Zudem sind verschiedene Fachbereiche der Stadt Emden und der Verein Nachhaltige Entwicklung in Ostfriesland und der Welt (NEOW e. V.) bei der „Machbar“ engagiert.
Hilfe zur Selbsthilfe im Repair Café
Alle beteiligten Institutionen bieten regelmäßig Aktivitäten und Veranstaltungen für interessierte Bürger:innen allen Alters an. Dazu gehören u. a. Computergruppen, Spielenachmittage und Musik- und
Kulturabende. Außerdem können sich auch Privatpersonen hier ehrenamtlich engagieren und eigene Ideen für Treffpunkte einbringen. Einmal in der Woche findet zudem das beliebte Repair-Café statt, bei dem Reparatur-Profis Hilfe zur Selbsthilfe geben. So kann man defekte Gebrauchsgegenstände schnell wieder fit machen und ihnen ein zweites Leben schenken, statt sie entsorgen zu müssen. Das schont nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern auch den Geldbeutel. Repair-Cafés sind in Deutschland stark im Trend: Laut Verbraucherzentrale beläuft sich die Anzahl der Reparaturinitiativen inzwischen auf rund 1.200 bundesweit. Diese führen Schätzungen zufolge insgesamt mehr als 200.000 Reparaturen im Jahr durch. Eine Analyse des BUND aus dem Jahr 2021 ergab außerdem, dass durch die Arbeit von Repair-Cafés in Deutschland jährlich bis zu 15.000 Tonnen Elektroschrott vermieden werden können. Jedes reparierte Gerät spart im Durchschnitt nämlich 1,2 Kilogramm Elektroschrott ein.
Einblicke in nachhaltige Hochschulforschung
Übrigens: Auch die Hochschule Emden/Leer nutzt die „Machbar“, um Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Bürger:innen können sich hier regelmäßig über die Lehrangebote der Hochschule informieren und zudem spannende Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte erhalten. Zum Beispiel aus dem Studiengang „Nachhaltige Produktentwicklung im Maschinenbau“: Der interdisziplinäre Bachelor-Studiengang verknüpft klassischen Maschinenbau mit Lehrinhalten aus den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit der „Machbar“ hat Emden einen wertvollen Ort geschaffen, an dem Menschen in Kontakt kommen und gemeinsam positiven Wandel gestalten.




Leistungsstarke Mobilität mit CO2-Reduzierung
• Synthetischer Kraftstoff, frei von Erdöl!
• Ohne Umrüstung sofort für alle Dieselmotoren mit Herstellerfreigabe nutzbar!









Bis zu 90 %
Reduzierung der CO2-Neuemissionen








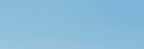


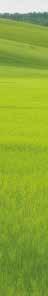










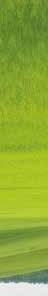

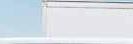














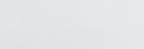
























Grüne Ferien auf 22 m²
Nachhaltigkeit im Urlaub
Mit dem Fahrrad zur Arbeit, danach mit dem Jutebeutel zum Einkaufen und abends fleischlos kochen – im Alltag sind nachhaltige Routinen bei vielen längst angekommen. Doch wie sieht es im Urlaub aus? Mit seinen grünen Ferienunterkünften will das Unternehmen Green Tiny Houses umweltfreundlichen Urlaub einfach machen. Ein Beispiel dafür: Das Green Tiny Village in Harlesiel.
Ein einladender Grillbereich, ein Coworking-Space mit Ruheraum, eine Sauna und achtzehn kleine Häuschen auf Rädern: Zwischen Kühen, Salzwiesen und dem Deich befindet sich das Green Tiny Village in Harlesiel. Bereits seit 2021 begrüßen die Ferienwohnungen im Miniaturformat hier regelmäßig zahlreiche umweltbewusste Gäste. Neben der Siedlung am Wattenmeer gibt es vom Gebirge bis zur Küste noch dreizehn weitere Standorte in Deutschland, an denen Reisende die ökologisch designten Häuschen buchen können. Natürlich immer mitten im Grünen, denn die Tiny Houses sind mobil und können auch dort platziert werden, wo kein Raum für Hotels oder herkömmliche Ferienhäuser ist. „Das Green Tiny Village bringt Mensch und Natur in Einklang und zeigt, dass weniger mehr ist.“, so Gründer Jan Sadowsky über das Konzept, für das sein Unternehmen 2021 als erstes in Deutschland den European Holiday Home Award in der Kategorie „Best Green Holiday Home“ gewonnen hat.
Ökologisch designt, nachhaltig eingerichtet
Die Verkleidung der Tiny Houses besteht aus skandinavischem Holz, dem sogenannten „Superwood“. Dieses kommt nicht nur ohne schädliche Chemikalien und Lacke aus, sondern ist noch dazu langlebig und robust. In Kombination mit der natürlichen Dämmung aus Ostsee-Seegras oder Schafwolle hält es die Unterkünfte sogar bei bis zu -20 Grad Celsius mollig warm. Gleich vier Personen können in den Tiny Houses, die über eine vollausgestattete Küche, einen komfortablen Schlafbereich, eine Lounge mit Holzofen und Panoramafenster sowie ein modernes Badezimmer verfügen, Platz finden. Letzteres ist mit einer Astronautendusche, die das genutzte Wasser sofort reinigt und aufbereitet, sowie einer Verbrennungstoilette ebenfalls gänzlich umweltfreundlich eingerichtet. Bogenhanfpflanzen in speziellen Töpfen runden letztlich nicht nur die gemütliche Einrichtung der Tiny Houses ab, sondern schaffen dazu saubere Luft und ein angenehmes Wohnklima.
Für ein gutes Gefühl sorgen darüber hinaus der Ausgleich der bei der Anreise der Gäste entstehenden CO₂-Emissionen sowie die Unterstützung lokaler Naturschutzprojekte, die durch einen Teil der Mieteinnahmen finanziert wird. So einfach geht Urlaub mit gutem Gewissen!
Von Vera Busch
Foto: Green Tiny Houses
ANZEIGE

Projektteam samt Geschäftsführern zum
Technologie treibt den Wandel
Mit einer großflächigen Photovoltaikanlage setzt die ROSEN Group in Lingen (Ems) ein starkes Zeichen für Klimaschutz, regionale Zusammenarbeit und technologische Verantwortung.
Die Energiewende beginnt vor der eigenen Haustür – das beweist die ROSEN Group mit einem ambitionierten Vorhaben am Unternehmensstandort in Lingen (Ems). Gemeinsam mit den Stadtwerken Lingen entsteht dort eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von rund zwei Megawatt. Die Investitionssumme von etwa zwei Millionen Euro unterstreicht den Anspruch des Technologieunternehmens, Nachhaltigkeit nicht nur zu fördern, sondern aktiv zu gestalten.

„Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, erklärt Carlos Sabido Ponce, Standortleiter der ROSEN Group in Lingen. „Wir übernehmen Verantwortung – für den Klimaschutz und für unsere Region.“
Regional geplant, gemeinsam umgesetzt
Die Anlage wird auf mehreren Gebäudedächern installiert und umfasst rund 4.500 Solarmodule auf einer Fläche von etwa 9.000 Quadratmetern. Ein intelligentes Energiemanagementsystem sorgt dafür, dass der erzeugte Strom zu fast 99 Prozent direkt im Unternehmen genutzt wird. Die jährliche CO₂-Einsparung beträgt über 750 Tonnen – das entspricht dem durchschnittlichen Jahresausstoß von mehr als 75 Haushalten.
Neben den Stadtwerken Lingen sind regionale Fachbetriebe wie Garten- und Landschaftsbau Lüske,
Vrielmann GmbH und E.M.S. Sun Control GmbH beteiligt. „Dieses Projekt ist ein Beispiel für regionale Wertschöpfung: von der Planung bis zur Umsetzung mit lokalen Fachbetrieben. ROSEN zeigt hier, wie Unternehmen zukunftsfähige Energielösungen umsetzen“, betont Thorsten Schlamann, Geschäftsführer der Stadtwerke Lingen.
Ein Vorzeigeprojekt für die Region
Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Anfang 2026 geplant. Schon jetzt gilt das Vorhaben als Vorzeigebeispiel für zukunftsorientierte Industrieentwicklung in der Region –und als Beleg dafür, wie technologische Innovationskraft und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können. Denn wer – wie ROSEN – Technologie als Schlüssel für eine sichere und nachhaltige Zukunft versteht, gestaltet den Wandel nicht nur mit, sondern treibt ihn aktiv voran.
Über die ROSEN Group Wir sind empowered by technology
Die ROSEN Group ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen in allen Bereichen der Integritätsprozesskette. Seit den Anfängen als Ein-Mann-Betrieb im Jahr 1981 ist ROSEN rasant gewachsen und ist heute eine in mehr als 110 Ländern operierende Technologiegruppe mit über 4.000 hochqualifizierten MitarbeiterInnen.
Weitere Informationen: www.rosen-group.com

Kontakt ROSEN Group Am Seitenkanal 8 49811 Lingen (Ems)
Das
offiziellen Baustart vor dem Innovation Center der ROSEN Group in Lingen (Ems).
Die ersten Dachflächen, wie die des Innovation Centers der ROSEN Group, sind bereits mit Solarmodulen ausgestattet.

Wie
die Meyer Werft den Schiffbau grüner machen will
Schiffbau im Wandel
Von Claus Spitzer-Ewersmann
Zwischen Deichen, Kanälen und Schafweiden liegt ein Ort, an dem Giganten entstehen – aus Stahl, Feuer und Präzision. Die Meyer Werft in Papenburg ist eines der traditionsreichsten Unternehmen Deutschlands und ein weltweiter Vorreiter im modernen Schiffbau. Auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit.
Es ist wie bei jeder Überführung ein großes Spektakel, als sich am 2. März 2025 die Asuka III von Papenburg aus Richtung Eemshaven aufmacht. Zu Tausenden stehen die Menschen am Emsufer und staunen. Der 230 Meter lange und 30 Meter breite Luxusliner ist das erste Kreuzfahrtschiff, das die Meyer Werft für die japanische Reederei NYK Cruises gebaut hat.
Die Asuka III zählt zur stetig wachsenden Flotte der Ozeanriesen, die mit verflüssigtem und umweltfreundlichem LNG-Erdgas angetrieben werden. Auch die AIDAnova, das erste Kreuzfahrtschiff, das seit 2018 mit LNG fährt, kommt aus dem Papenburger Baudock. Ihre drei Tanks fassen rund 3.500 Kubikmeter Flüssiggas. Genug für rund zwei Wochen auf See.
Tendenz zu Innovationen im Schiffbau
Mehr als 400 Kreuzfahrtschiffe unterschiedlichen Alters und Technologie sind zurzeit auf den Weltmeeren unterwegs. Große Reedereien
wie Carnival, Disney oder Royal Caribbean Cruise Line setzten auf modernste Antriebstechnologien. Während der Anteil an LNGbetriebenen Kreuzfahrtschiffen global zunimmt, arbeitet die Meyer Werft bereits an den neueren Lösungen der Zukunft.
Galt das Schweröl für viele Jahrzehnte als einziger Kraftstoff, der auf Kreuzfahrtschiffen zum Einsatz kam, so ist inzwischen eine klare Tendenz hin zu sauberen Kraftstoffen zu erkennen. Für das Papenburger Traditionsunternehmen genießt nachhaltiges Agieren einen hohen Stellenwert. Neben LNG-Antrieben wird ebenfalls an weiteren Optionen wie Methanol oder Wasserstoff gearbeitet. Die Aktivitäten der Meyer Werft bilden ein großes Spektrum ab, angefangen von kreislauffähigen Materialien, über klimaneutralen Stahl bis hin zu emissionsneutralen und emissionsfreien Antrieben.
Ein spannendes Beispiel aus der Forschung ist das Projekt „ReCab“: In Papenburg wird an einer modularen Schiffskabine gearbeitet, die den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft folgt. Ziel ist es, mit cleverem Design und nachhaltigen Materialien zwei Probleme anzugehen: den steigenden Ressourcenverbrauch und das zunehmende Abfallaufkommen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verwendung recycelbarer Werkstoffe und einer Konstruktion, die sich zerstörungsfrei demontieren lässt.
Fotos: Meyer Werft
Enge Abstimmung zwischen Kunde und Werft
Auch das Projekt „MariSteel“ zeigt, wo Nachhaltigkeit im Schiffbau ansetzt: Angestrebt wird, die Anzahl unterschiedlicher Stahlsorten zu verringern und gleichzeitig neue, leichtere Schiffbaustähle zu entwickeln. Diese sollen den Bau effizienter machen, das Gewicht der Schiffe reduzieren – und so letztlich den CO₂-Ausstoß senken. Um die geschilderten Vorhaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, ist von Beginn an eine enge Abstimmung zwischen Auftraggeber und Werft erforderlich. Schon in der Frühphase eines Projekts werden deshalb Maßnahmen zum Schutz der Umwelt identifiziert und für die weitere Planung festgeschrieben. Dies betrifft den Bereich der Antriebstechnik ebenso wie die Auswahl kreislauffähiger Materialien und die Verbesserung der Energieeffizienz – etwa durch moderne Steuerungssysteme wie sie auch auf der Asuka III zum Einsatz kommen. Auf Kundenseite sind diese Themen heute elementar, da sie zum einen die Betriebskosten der Schiffe stark beeinflussen und zum anderen zunehmend ein Alleinstellungsmerkmal ergeben, das der Reederei helfen kann, sich besser am Markt zu positionieren. Schließlich legen auch viele Reisende längst Wert auf umweltverträgliche Urlaubswochen.
Vier Säulen für die Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit gilt bei der Meyer Werft als zentrales unternehmensstrategisches Ziel. Deshalb spielt neben technologischen Innovationen auch die Einbeziehung von Belangen der Beschäftigten und die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur eine wichtige Rolle.
Ein Beispiel dafür ist die von Mitarbeitenden gestartete Initiative „Mey Action“. Unter dem Motto „Vom Beobachter zum Macher“ zielt sie darauf ab, die Zusammenarbeit auf der Werft aktiv neu zu gestalten. In großangelegten internen Workshops werden Ideen aus der Belegschaft aufgegriffen – etwa hinsichtlich der Förderung der Fehlerkultur, einer geringeren Verschwendung von Werkzeugen und Materialien oder der nachhaltigen Umsetzung von Unternehmensprozessen.
Darüber hinaus hat das Industriemanagement der Meyer Werft ein ganzheitliches und innovatives Energiekonzept erarbeitet, das auf vier wesentlichen Säulen basiert: der Nutzung von grünem Strom, der

Elektrifizierung der Wärmeversorgung und des Fuhrparks sowie der Dekarbonisierung der Produktion. Als eine der ersten Maßnahmen wurde im September 2024 auf dem Dach des Logistikzentrums eine große Photovoltaikanlage mit 1940 Modulen in Betrieb genommen. So kann das Unternehmen den Einsatz fossiler Brennstoffe reduzieren und jährlich rund 270 Tonnen CO2 einsparen. Weitere Anlagen auf dem Werftgelände sind geplant und sollen den Weg zur Energieunabhängigkeit ebnen.
Werften vor großen Herausforderungen
Wie viele andere Branchen auch steht der Schiffbau an einem Wendepunkt. Einerseits boomt der Kreuzfahrtmarkt nach Corona, andererseits sehen sich die Werften mit neuen technologischen, regulatorischen und ökologischen Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen investieren und Know-how aufbauen, obwohl noch nicht sicher ist, welche Lösungen sich am Markt durchsetzen werden.
Die Papenburger Meyer Werft zeigt jedoch, dass man sich von der Größe der Aufgabe und einer in vielerlei Hinsicht stürmischen See nicht schrecken lassen darf. Auch das größte Kreuzfahrtschiff kann mit einer guten Crew gewendet werden!


Neues Leben für alte Kleidung?
Nachhaltigkeit in der Modeindustrie
Von Vera Busch
Fast Fashion ist ein echtes Problem. Das haben mittlerweile die meisten Verbraucher:innen erkannt. Um trotzdem regelmäßig „neue“ Kleidung im Schrank zu haben, kaufen daher viele secondhand. Gebrauchte Textilien gibt es mittlerweile nicht mehr nur auf dem Flohmarkt. Sogar große Player auf dem Modemarkt springen auf den Trend auf. Ist das noch nachhaltig?
Wöchentlich wechselnde Kollektionen, Berge an billigen und schlecht verarbeiteten Kleidungsstücken und Unmengen von Müll –das ist Fast Fashion. Obwohl das Problem um die schnelllebige Mode weitläufig bekannt ist, steigt die Zahl an produzierten Kleidungsstücken immer weiter an. Mittlerweile ist die Textilproduktion für elf Prozent der globalen Treibhausemissionen verantwortlich und belastet zudem zahlreiche Arbeiter:innen, die sich für Hungerlöhne täglich gravierenden Arbeitsbedingungen und schädlichen Chemikalien aussetzen müssen, um unsere Kleidung zu nähen. Dabei kommen größtenteils Kunststofffasern zum Einsatz, die am Ende ihres Lebens als Mikroplastik in die Umwelt gelangen. Denn obwohl im Handel häufig die Rede von recycelten Materialien ist, wird nicht zuletzt aus technischen Gründen maximal ein Prozent der Altkleider wiederverwendet.
Das Geschäft mit der Nachhaltigkeit
All diese Probleme könnten eingedämmt werden, wenn wir nachhaltiger mit Kleidung umgehen, sie häufiger tragen und
seltener neu kaufen. Die Lösung scheint also einfach – und liegt zudem voll im Trend: Secondhand-Geschäfte sind so beliebt wie nie, Online-Börsen für gebrauchte Mode florieren und immer häufiger werden Kleidertauschpartys oder Vintage Kilo Sales veranstaltet, bei denen Secondhand-Kleidung verschenkt, getauscht oder zum kleinen Preis erworben werden kann. Das haben auch große Modehäuser wie Zara, H&M oder Zalando längst gemerkt. Alle drei Marken verfügen über eigene Online-Märkte, auf denen Kund:innen gebrauchte Kleidung verkaufen können.
Mit sellpy, einer der größten Secondhand-Plattformen Europas, geht H&M noch einen Schritt weiter. Doch die Bemühungen um Secondhand-Kleidung hat bei den genannten Labels wohl nur wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. „Die großen Konzerne wollen natürlich attraktiv für ihre Kundinnen und Kunden sein und sie merken, dass gerade Jüngere sehr stark auf das Thema Secondhand abfahren“, so Prof. Dr. Jochen Strähle, Experte in der Modebranche, im Gespräch mit dem ZDF. Fast Fashion bleibt währenddessen das Kerngeschäft der Marken, die durch die Gewinne auf dem SecondhandMarkt weiter wachsen können. Wer also wirklich Wert auf nachhaltige Kleidung legt, sollte genauer hinsehen und eher auf den kleinen Laden um die Ecke als auf große Modehäuser setzen.
Foto: Francois Le Nguyen auf Unsplash
Nachhaltige Wasserversorgung erfordert Innovation und Mut für neue Wege.
Zukunft nachhaltig mitgestalten www.oowv.de
neerGsboJsibegitlahhcantfnukuZV
B hciflurenürg
G efureBnedrewremmi.retbeilebtbig z -sgnudlibsuAdnunetiekhcilgömneidutSeiwos .negnudlibretieriWnebegned!kcilbrebÜW
tärebehcildneguJdnueneshcawrED .netiekhcilgöMtzteJnenienesolnetsokd B dnueidenürgdnuegitlahhcan tlewsfure.nehcuatnieB
A tmminrebügnutrowtnareVrüfeid R dnurüfnenie-nenohcsnecruosser gnagmUtimred.tlewmUd




Nachhaltiges Handeln beginnt im Kopf
Psychologie als Schlüssel zur Bewältigung der Klimakrise
Interview: Vera Busch
Die Klimakrise betrifft uns alle. Als Vorreiterin in der Klimapsychologie nutzt Janna Hoppmann, Gründerin des Unternehmens ClimateMind, wissenschaftliche Erkenntnisse, um Menschen, Organisationen und Firmen zum Umdenken zu motivieren.
Frau Hoppmann, einfach erklärt: Was macht eine Klimapsychologin?
Janna Hoppmann: Eine Klimapsychologin verbindet Theorie und Praxis, beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen in der Klimakrise und übersetzt Forschungsergebnisse in Handlungsempfehlungen.
Wie sind Sie zur Klimapsychologie gekommen?
Hoppmann: Schon in meiner Kindheit hat mich globale Gerechtigkeit beschäftigt. Im Psychologiestudium interessierten mich die gesellschaftspolitische Dimension und die praktischen Einsatzbereiche der Inhalte besonders. Ich wollte verstehen, warum Menschen wählen, wie sie wählen, und wie gesellschaftlicher Zusammenhalt oder Polarisierung entstehen. Meine Masterarbeit habe ich über die Verknüpfung zwischen Psychologie und Umwelt geschrieben. Da habe ich gemerkt, dass ich es nicht auf mir sitzen lassen kann, dass wir das Potenzial der Psychologie nicht nutzen, um die Klimakrise einzudämmen.
Welches Potenzial bietet die Klimapsychologie?
Hoppmann: Es geht um menschengemachte Krisen, die nur von Menschen gelöst werden können. Dafür müssen wir menschliches
Handeln begreifen. Wir müssen uns fragen, wie wir Barrieren abbauen und Menschen dazu motivieren, Teil des Wandels werden zu wollen. Diese klimapsychologischen Fragen sind entscheidend, um die Klimakrise zu lösen.
Welche Barrieren hindern uns am Handeln?
Hoppmann: Eine wichtige Barriere ist die psychologische Distanz: die Vorstellung, die Klimakrise sei weit weg. Klimagefühle wie Angst oder Hilflosigkeit und soziale Ablehnung, die wir wegen unseres klimafreundlichen Handelns erfahren können, sind auch von Bedeutung. Außerdem muss die Intentions-Verhaltens-Lücke überbrückt werden. Das meint die Kluft zwischen Absicht und Handeln, umgangssprachlich gesagt: den inneren Schweinehund.
Und was kann man konkret gegen diese Barrieren tun?
Hoppmann: Wir müssen emotionale Nähe schaffen. Die Klimakrise ist auch bei uns angekommen, wie uns die Katastrophe im Ahrtal zeigt. Negative Gefühle brauchen Raum, dürfen uns aber nicht lähmen. Deswegen sollte klimafreundliches Handeln einfach sein, Spaß machen und gesellschaftlich anerkannt werden. Das ist ein langer Prozess. Unsere Selbstwirksamkeit können wir aber schon durch kleine Aktionen stärken. Beispielsweise, wenn wir im Sportverein oder auf der Arbeit nachhaltiger denken. Als Individuen alleine sind wir nicht in der Lage, die Welt zu verändern, aber mit anderen zusammen können wir viel anstoßen.
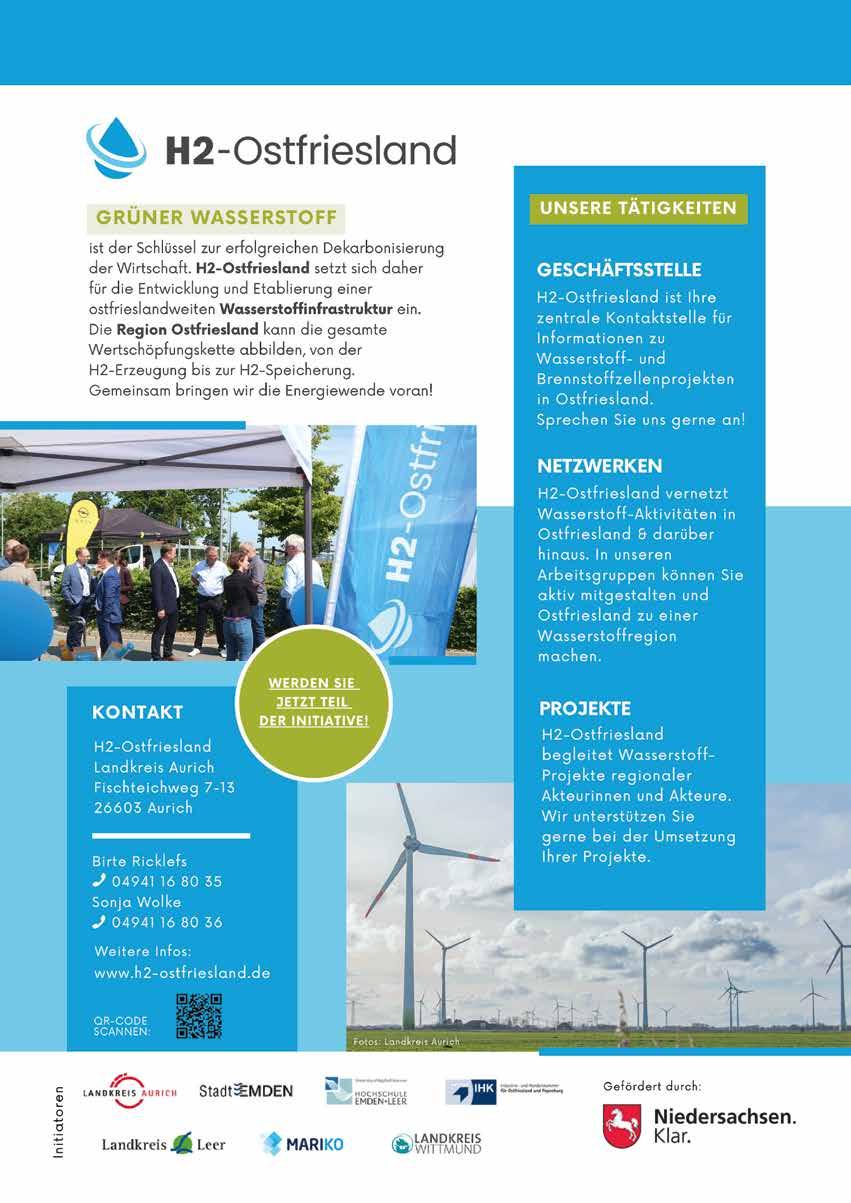




Heizgeräte mit neuer Klimaschutz-Technologie – zeitgemäß heizen.



Sie suchen nach einer Heizlösung, die nicht nur effizient ist, sondern auch die Umwelt schützt? Dann sind unsere KLIMA PLUS Geräte die Antwort auf Ihre Bedürfnisse!