Mai-Juni 2 025
6 9 707 I 6,50 Euro
www.dmm. t ravel

Geschäftsreisebranche setzt auf neue Regierung •••

Mai-Juni 2 025
6 9 707 I 6,50 Euro
www.dmm. t ravel

Geschäftsreisebranche setzt auf neue Regierung •••
Klimafreundliche
Mobilität •••
Eine To-do-Liste für Mobilitätsmanger
Neue VielfliegerSteuer für Europa ••• Wer viel fliegt, soll auch mehr bezahlen
Hotellerie-Siegel für Nachhaltigkeit •••
Check der Stiftung Warentest
Mobilitäsbudget statt Dienstauto ••• Immer mehr Firmen steigen um



Der geschäftliche Tourismus steht vor einem Neuanfang. In der Ära nach Corona erwartet Sie ein attraktives Feature mit „Wir sind Business Travel“ Unter diesem Motto steht unser neuer virtueller DMM-Online-Marktplatz.
Die Wahl der richtigen Partner für alle Mobilitäts- und Eventbereiche eines Unternehmens ist zu einer großen und verantwortungsvollen Aufgabe geworden: Von Flugreisen über Bahnfahrten, vom Geschäftswagen über das Mietfahrzeug und Carsharing, von der Wahl des passenden Geschäftsreisebüros bis hin zum gewünschten Hotel und Restaurant, vom effektivsten Kommunikationsmittel bis zur richtigen Software. Für alles, was die Planungs- und Organisationsabläufe des betrieblichen Mobilitätsmanagements erleichtern soll, brauchen unsere Leser verlässliche Ansprechpartner und Experten.


Mit „Wir sind Business Travel“ präsentieren Sie Ihr Unternehmen in all seinen Facetten für eine Dauer von jeweils 12 Monaten.
Wie so etwas aussehen kann? Ein Beispiel: www.dmm.travel/virtueller-marktplatz/ automobilhersteller/opel/
Im Rahmen der neuen Partner-Aktion bieten wir Ihnen ein attraktives Format an:
„Wir sind Business Travel“
• Dauerpräsenz im Marktplatz auf dmm.travel (Firmenporträt, Business-Kontakte, B2B-Angebote)
• Regelmäßige Logo-Darstellung auf der Startseite
• Preis für 1 Jahr: 7 750 Euro

Mit Ihrer Teilnahme präsentieren Sie Ihr Unternehmen einer exklusiven Zielgruppe und unterstützen die unabhängige Berichterstattung aus der gesamten Mobilitäts- und Geschäftsreise-Branche.
K ONTAKTIEREN SIE EINFACH:
Jürgen Dölling
+49 (0) 511 8550 2643 | juergen.doelling@schluetersche.de






Mit der Bundestagswahl 2025 sind die politischen Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Was Deutschland braucht ist eine wieder florierende Wirtschaft und ein Ende der illegalen Migration. Bekommt Friedrich Merz beides nicht in den Griff, ist laut Politikwissenschaftlern nicht ausgeschlossen, dass 2029 eine AfD-Regierung an die Macht kommt. •••
Der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) hofft nun auf konstruktive Gespräche im Hinblick auf eine zukunftsfähige betriebliche Mobilität für Deutschland. Denn Geschäftsreisen sind ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor: Sie treiben Innovation, Wachstum und internationale Vernetzung voran.
Unternehmen und Geschäftsreisende brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und Investitionen in moderne Mobilitätslösungen. Alles nichts Neues, das klang schon vor 20 Jahren so. Nur diesmal wird es ein ganz anderer Kraftakt, Deutschlands internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dem stehen aber Donald Trump mit seinen Zöllen und Abkehr vom Westen, Wladimir Putin mit seiner Kriegslüsternheit und Xi mit seiner inzwischen unglaublichen Wirtschaftsmacht entgegen.
Fahrradwege vor Autobahnen? Für CDUChef Friedrich Merz (69) war die Einigung mit den Grünen ein wichtiger Schritt Richtung Kanzlerschaft, da er die Grünen für die Zweidrittelmehrheit gebraucht hat, um das Grundgesetz zu ändern, die Schulden aufzunehmen und sich mit der SPD auf eine Regierung zu einigen. Erstmals findet der Begriff der Klimaneutralität nun ausdrücklich Eingang in das Grundgesetz. Um Deutschlands Klimaziel zu erreichen, könnte unsere Verfassung implizit vorschreiben, dass künftig. Fahrradwege vor Straßenbau gehen. Das heißt aber auch, dass die staatlichen Organe verpflichtet sind, die Klimaziele unbedingt und mit allen Mitteln erreichen zu müssen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Denn es gilt seit jeher, ohne einen gewissen Druck können Ziele nicht erreicht werden. Möglicherweise hilft das auch der E-Mobilität.
„Jetzt kommt es darauf an, Mobilität als zentrale wirtschaftspolitische Aufgabe zu begreifen“, appelliert VDR-Präsident Christoph Carnier. „Eine leistungsfähige und zuverlässige Verkehrsinfrastruktur, steuerliche Anreize für eine nachhaltige geschäftliche Mobilität sowie der Abbau administrativer Hürden sind entscheidend, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. „Der VDR will als Partner und Impulsgeber bereitstehen, um gemeinsam die Weichen für eine nachhaltige, effiziente und wirtschaftlich tragfähige Mobilitätsstrategie zu stellen.“
Luftverkehrs- und Frequent-Flyer-Steuer. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft fordert von der neuen Bundesregierung ein klares Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Deutschland. Ziel ist es, die massiven Wettbewerbsverzerrungen zulasten der heimischen Luftverkehrswirtschaft zu beseitigen, attraktive Standortbedingungen für den Luftverkehr zu schaffen und die Anbindung der deutschen Wirtschaft an ihre internationalen Märkte zu stärken. Wettbewerbsverzerrungen, wie hohe staatliche Standortkosten, einseitige EU-Regulierungen sowie höhere Kosten im EU-Asien-Verkehr aufgrund der Sperrung des russischen Luftraums, belasten den Luftverkehr hierzulande enorm. Zu den sechs Kernforderungen des BDL zählt die Abschaffung der Luftverkehrsteuer. Aber schon erscheinen neue dunkle Wolken am Horizont. In Brüssel und zuvor schon in UK ist
von der notwendigen Einführung einer Vielfliegersteuer die Rede.
Bergab. Die deutschen Autokonzerne haben in 2024 vor allem wegen des miesen Geschäfts in ihrem wichtigsten Markt China teils massive Gewinneinbrüche vermelden müssen. Grund: Die Chinesen wollen keine Verbrennerautos mehr und VW, Audi, BMW, Mercedes und Porsche können selbst mit ihren BEV den aufstrebenden Chinesen technisch nicht mehr das Wasser reichen. Zudem besteht die Gefahr, dass BYD, XPeng & Co. so manch‘ deutschen Autobauer aus den Firmenuhrparks verdrängen.
Preise steigen, Pünktlichkeit sinkt. Wir kennen es von der Deutschen Bahn. Aber auch die Airlines sind kaum besser. Für die bei der Bahn jährlichen, bei den Fluggesellschaften auch unterjährigen Preissteigerungen bekommen die Passagiere aber nicht etwa eine bessere Leistung. Im Gegenteil: die Pünktlichkeit sinkt. Und mit der Servicequalität ist es bei den Airlines auch nicht mehr weit her. Hoffen wir auf eine Änderung im positiven Sinn.
Freuen Sie sich auf eine spannende Lektüre und schauen Sie auch auf dmm.travel, das Infoportal für Unternehmensmobilität.
Gernot Zielonka Chefredakteur

Silberstreif am Horizont
Die Geschäftsreisebranche setzt alle ihre Hoffnungen auf die neue Bundesregierung. Aber seitens der schwarzroten Koalition ist im Koalitionspapier immer nur vom „Wir wollen“ die Rede und so gut wie nicht vom „Wir werden“.

Klimafreundliche Mobilität
Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute mehr als ein Trend. Sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Besonders in der betrieblichen Mobilität bietet sie enormes Potenzial, um nicht nur den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Das Dienstrad hat Konjunktur
Die Bedeutung des Fahrrads als resilienter Wirtschaftsfaktor nimmt zu. Gut eine Viertel Million der Unternehmen in Deutschland gibt seinen Beschäfigten die Möglichkeit, ein Dienstrad zu leasen. Infos dazu auch auf der Eurobike.
Trendmonitor
5 I Resturlaub mit Bleisure nutzen
News
6 I Wissenswertes in Kürze
Titelstory
12 I Silberstreif am Horizont Geschäftsreisebranche setzt alle ihre Hoffnungen auf die neue Regierung.
Geschäftsreise
18 I Teuer, intransparent, dreckig Autobahn-Rastanlagen, ob bewirtschaftet oder nicht, sind nicht nur für Geschäftsreisende eine Zumutung.
21 I Bonusprogramme April-Juni 2025 Dienstreisende können neuerdings auch ITA-Points sammeln.
22 I Kommt eine Vielfliegersteuer? Klimaorganisationen und UK wollen eine neue Luftfahrt-Abgabe.
24 I Klimafreundliche Mobilität Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute mehr als ein Trend.
27 I Elegante Suiten am Himmel Air France und die neue La Premiere First Class.
28 I Komfortablere Dienstreise Eine neue "TGVinOui"-Generation soll in Frankreich starten.
30 I 13 Generalsanierungen der Bahn Seit der Bahnreform 1994 ging es mit der Pünktlichkeit bergab. Erneuerte Strecken sollen‘s richten.
33 I Ranking der Bahnunternehmen Trenitalia und Regiojet bieten die beste Performance.
34 I Das Dienstrad hat Konjunktur Die gesündeste und umweltfreundlichste Form der Mobilität.
Hotel & MICE
38 I Check-in mit gutem Gewissen Stiftung Warentest nahm sich Nachhaltigkeitssiegel der Hotellerie vor.
Geschäftswagen
40 I Mobilitätsbudget als Benfit Attraktive Alternativen für den Dienstwagen gibt es zuhauf.
44 I Stromtanken ist viel zu teuer Der VDA übt heftige Kritik an den überzogenen Ladesäulen-Tarifen.
45 I Firmen flotten mehr BEV ein Batterieelektrische Autos landen bei immer mehr Unternehmen.
46 I Ein famoses E-SUV Audi‘s Q6 e-tron hat uns in nahezu allen Belangen überzeugt.
48 I Ein souveränes Flaggschiff EQS SUV- Ein fantastisches E-Mobil, groß, aber leider sehr teuer.
50 I Kompaktes intelligentes SUV BYD und seine absolut überzeugende Alternative: Der Atto 2.
Recht & Steuern
52 I Info-Pflicht bei Flugbuchungen Das oft ärgerliche Problem mit den Mietwagenreservierungen.
Vorbild & Modell
54 I Der Tarurs wird 25 1016, 1116 uns 1216 bringen zig Businesstraveller sicher ans Ziel.
Geschäftswagen
56 I Gewerblicher Markt Q2 2025 Was die Autohersteller alles planen und was sonst noch passiert.
Inside
57 I Köpfe & Skurriles
Vorschau
58 I DMM 07-09.2025 und Impressum



ZUR OPTIMIERUNG IHRES BUSINESS: IN JEDER AUSGABE DIE AKTUELLEN BRANCHENTRENDS IN ZAHLEN
Aktuelle Markt- und Preisentwicklungen im Business Travel Marktbeobachtungen von DMM
Der Markt I Mai–Juni 2025
Mobilitätsmanager/Business Traveller sollten ihren Urlaub für 2026 schon jetzt planen und die Gelegenheit nutzen, um anstehende Geschäftsreisen mit privaten Aufenthalten zu verbinden. Diese Bleisure-Reisen sind kein Nischentrend mehr. Eine SAP-Concur-Studie ergab, dass über die Hälfte der deutschen Geschäftsreisenden ihre Business-Trips um einen privaten Urlaub verlängern wollten (52 %). Ob die Kombination von Geschäftsreisen und Freizeit sich in der Arbeitswelt etablieren wird, man wird sehen. Vor allem Vielreisende interessieren sich für diese flexible Form des Reisens. Die Motivation ist dabei unterschiedlich: Während zwei von fünf Reisende laut DRV die Gelegenheit nutzen möchten, neue Orte zu erkunden, statt nur durchzufahren (44 %), steht für andere die Erholung nach intensiven Geschäftsterminen im Vordergrund (34 %). Mobilitätsmanager können diesen Trend nterstützen – etwa durch flexible Reiserichtlinien und transparente Regelungen zur Kostenübernahme.
1. Zeitliche Abgrenzung: Ein klar definierter Übergang zwischen Geschäftsreise und privatem Aufenthalt ist die Basis für erfolgreiche
Bleisure-Trips. Mitarbeitende und Vorgesetzte sollten von Anfang an festlegen, wann der geschäftliche Teil endet und die private Reisezeit beginnt.
2. Reisetyp und Destination: Die Art der Geschäftsreise eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten für die private Verlängerung. Konferenzen und Messen sind durch ihren festen Zeitrahmen perfekt für ein verlängertes Wochenende, während Kundentermine meist flexibler geplant werden können. Auch im Frühjahr locken viele Destinationen mit attraktiven Freizeitmöglichkeiten: die ersten Strandtage an der Küste Spaniens, Wandern entlang des Starnberger Sees nach einem Termin in München oder ein entspannter ThermenBesuch am nächsten Tag.
3. Unterkunftswahl: Eine GBTA-Studie zeigt, dass 82 % der Dienstreisenden für den privaten Teil in derselben Unterkunft bleiben – das vereinfacht die Organisation und ermöglicht eine stressfreie Verlängerung des Aufenthalts. Bei der Auswahl sollten Faktoren wie Lage, Ausstattung und Eignung für beide Reisezwekke berücksichtigt werden: zentral für Geschäftstermine, aber auch gut angebunden für Freizeitaktivitäten.
4. Professionelles Kostenmanagement: Für die steuerliche Behandlung von Reisekosten ist eine saubere Trennung von geschäftlichen
und privaten Ausgaben unerlässlich. Ebenso sollte eine eventuelle Kostenübernahme durch den Arbeitgeber transparent geregelt sein. Immerhin übernehmen laut DRV bereits 53 % der Unternehmen die An- und Abreisekosten bei Bleisure-Reisen, z. B. durch eine spätere An- oder Abreise zum Geschäftsreiseziel. Digitale Lösungen für die Reisekostenabrechnung unterstützen dabei durch automatisierte Prozesse und eine übersichtliche Aufschlüsselung der Ausgaben, durch die private Reiseteile nicht in die Abrechnung einfließen.
Bleisure: Ein Gewinn für beide Seiten. Wenn Mitarbeitende Geschäftsreisen und Urlaub miteinander verbinden können, steigert das ihre Zufriedenheit und Produktivität, glaubt man jedenfalls. Unternehmen gewinnen dadurch motivierte Teams und zeigen, dass sie moderne und flexible Arbeitsweisen unterstützen. Wer die Möglichkeit auf Bleisure hat, reist gerne geschäftlich – das macht Unternehmen auch für neue Talente attraktiv. Mit dem Frühling endet in vielen Unternehmen die Frist für den Resturlaub. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um Geschäftsreisen mit übriggebliebenen Urlaubstagen zu kombinieren, neue Orte zu entdecken oder stressige Phasen unterwegs mit einem privaten Tapetenwechsel auszugleichen. •••
Turkish Airlines: „SmartMic" hilft bei Verständnisfragen
Turkish Airlines hat an Flughäfen in der Türkei neue SmartMic-Übersetzungsgeräte eingeführt, mit denen Passagiere auch ganz ohne Englischkenntnisse problemloskommunizieren können. Die flächendeckende Einfürung idt erfolgt. Die Geräte übersetzen in 52 Sprachen und 72 Akzente und ermöglichen Passagieren, mit dem Personal der Airline in ihrer Muttersprache zu kommunizieren. Über zwei 7-Zoll-Bildschirme können sowohl Passagiere als auch Turkish Airlines Mitarbeitende das Gespräch in Echtzeit verfolgen, sodass die Reisenden die benötigten Informationen schnell und unkompliziert erhalten. Turkish Airlines hat 100 SmartMic-Geräte an ihrem Heimatflughafen in Istanbul sowie an den türkischen Regionalflughäfen Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman und Izmir installiert. Die Geräte sind auch in Großbritannien am LHR. CEO Bilal Eksi: „Wir freuen uns, dieses innovative SmartMic-Gerät vorstellen zu können, mit dem unsere Fluggäste im Transit durch die Türkei in ihrer eigenen Sprache mit unserem Personal sprechen können. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Passagiere unabhängig von ihrer Nationalität eine reibungslose und nahtlose Reiseerfahrung haben.” Die flächendeckende Einführung der SmartMic-Geräte ist bereits erfolgt. Die Airline fliegt derzeit 130 Länder und 346 Ziele auf fünf Kontinenten an.
••• Luftfahrt
Air Astana: 32LR für Flüge Frankfurt-Astana-Frankfurt. Ab 10. 05.2025 B767-300 ER mit mehr Sitzplatzkapazität.
Air China: Seit dem 04.04.2025 auf der Strecke Peking – Frankfurt 2x/Wo wieder größere B7478 statt B777-300 ER.
Air France-KLM: Vereinbarung mit Amadeus. Kunden können so einfacher Änderungen an ihren Reisen und Zusatzleistungen vornehmen.
Air Transat: Berlin-Toronto vom 19.06. bis 24.10.2025.2xWo.
British Airways: Lounge Seattle Tacoma nach umfassender Renovierung wiedereröffnet. Sie ist Teil eines Modernisierungsprogramms, das auch Lounges in

••• United Airlines
Am internationalen Flughafen
George Bush in Houston hat United Airlines einen neuen United Club Fly eröffnet. Der hochwertige Grab-and-Go-Service richtet sich an United-Passagiere, die zwischen zwei Flügen sich auf die Schnelle einen Snack oder etwas zu trinken holen möchten. Zugang haben Mitglieder des United Clubs sowie alle United-Passagiere in Premiumklassen. Für den Eintritt müssen sie lediglich ihre Bordkarte am Automaten scannen. Im United Club Fly erwartet
sie eine große Snackauswahl mit warmem Süßgebäck, Sandwiches, Salaten und Wraps sowie Softdrinks, frisch gepresstem Orangensaft u.a.m.. Ein Barista bereitet Kaffeespezialitäten frisch zu. Der United Club Fly in Houston ist bereits der zweite Standort dieses Konzepts. Der erste ist in Denver. In Houston befindet sich der Club an der Südseite des Terminalbereichs B. Sein modernes Design erinnert an das Image der Stadt als Space City. Insgesamt investiert UA in
DB und Condor kooperieren enger
Houston rund 2,6 Mrd. USD, u.a. in die Renovierung und Vergrößerung von Terminal B sowie in einen neuen United Club (Eröffnung 2026). Auch an anderen Flughäfen engagiert sich UA für zusätzlichen Komfort der Fluggäste. So erweitert die Airline die Polaris Lounges an den Airports von Chicago und New York/ Newark. In Denver wurde die Erneuerung der United Clubs abgeschlossen. Einen ganz neuen United Club kündugt UA in 2026 für San Francisco an.
Die Deutsche Bahn und die Fluggesellschaft Condor bauen ihre Zusammenarbeit aus und bieten künftig weitere Möglichkeiten für eine Anreise zum Rhein-Main-Airport an. So können künftig bereits bei der Flugbuchung auf Condor-Langstreckenflüge angepasste Zugverbindungen ausgewählt werden. Wo immer Luftfahrt und Bahn kooperieren, verzeichnet die Schiene zweistellige Wachstumsraten. Durch den Codeshare profitieren Gäste von einer einfacheren Buchung von Zug und Flug in einem Vorgang, einer kostenfreien Sitzplatzreservierung im ausgewählten Zug, optimierten und abgestimmten Umsteigezeiten, einer kostenlosen Umbuchung bei Verspätungen sowie Zugang zu DB Lounges für Condor Business Class Gäste.
Singapur, Washington, Lagos und London Gatwick umfasste.
Condor: Ab Ende Oktober zwei Mal/Tag Frankfurt -Wien.
Emirates: Neues TelemedizinSystem von Parsys, das auf 300 Flugzeugen installiert wird. Die Technologie ermöglicht hochauflösende Videoübertragung, Fernuntersuchungen und ein 12-Kanal-EKG, wodurch medizinische Notfälle effizienter behandelt werden können.
Korean Air: Neue Lackierung der Jets.
Lufthansa City Airlines: Sechs neue Routen ab München: Barcelona, Dublin, Oulu, Paris, Rom und Sevilla. Bis Juli 2025 bis zu 122 Flüge/Wo. auf 13 Routen.
Nigeria: Regierung erwägt Gründung einer neuen nationalen Airline. 2024 scheiterte das ursprüngliche Projekt Nigeria Air.
Qantas: Modernisierung der Kabinen von 42 der 75 B737-800:. Neue Sitze in Business und Economy, größere Gepäckfächer.
Qatar Airways: Ab 10.07.2025 21x/Wo und damit durchgehend drei Mal täglich von Berlin nach Doha.
Ryanair: In Dortmund, Dresden, Hamburg und Leipzig/Halle wird das Angebot reduziert. Seit 30. März von Lübeck nach London, Malaga und Mallorca.
SAS: Flüge von StockholmArlanda nach Keflavik auf Island vom 22.06. – 11.08.2025.
Singapore Airlines: Passagiere dürfen seit dem 01.04.2025 weden Powerbanks an den USBPorts der Flugzeuge laden noch ihre eigenen Geräte damit während des Fluges betreiben. Gilt auch bei Thai Airways.
Southwest: Ab dem 28.05.2025 Gebühren für aufgegebenes Gepäck. Kostenlos bleibt es für Rapid Rewards A-List Preferred Mitglieder und Passagiere mit Business Select Tickets. A-List Mitglieder sowie Kreditkarteninhaber des Rapid Rewards Programms erhalten ein kostenloses Gepäckstück.
Wizz Air: Ab dem 02.06.2025 verbindet sie 3x/Wo Friedrichshafen mit der serbischen Hauptstadt Belgrad.
••• Lindner
Der Generalbevollmächtigte der insolventen Lindner Hotels AG, Frank Kebekus, berichtet, dass bei den Verhandlungen mit Verpächtern derzeit konstruktive Lösungen erzielt werden. Somit hätten kurzfristige Schließungen von Hotels verhindert werden können. Arbeitsplätze in den Häusern seien erhalten geblieben. Die Sanierung der Lindner Hotels AG schreite zügig voran und verlaufe bisher planmäßig. Der gesamte operative Betrieb innerhalb der Gruppe läuft stabil. Als nächster Schritt werden die Sanie-
rungsbeiträge der Gläubiger gebündelt und in einem Insolvenzplan zusammengefasst. Dieser soll im zweiten Quartal 2025 finalisiert und dem Amtsgericht Düsseldorf zur Abstimmung vorgelegt werden. Ziel ist es weiterhin, im Sommer 2025 das Eigenverwaltungsverfahren planmäßig über einen Insolvenzplan abzuschließen. Dem Antrag auf Eigenverwaltung hatte das Amtsgericht Düsseldorf am 16. Dezember 2024 zugestimmt, die Verfahrenseröffnung erfolgte zum 01. März 2025.
Das Triest in Wien wird ein Radisson Blu
Die Radisson Hotel Group wird das Wiener Hotel „Das Triest“ wiedereröffnen. Das Haus, das 1995 als erstes Designhotel der Stadt eröffnete, wird nach Renovierung als „Radisson Blu Das Triest Hotel, Vienna“ firmieren. Das neue Hotel bringt auch die berühmte Silver Bar in der Lobby zurück. Fünf Tagungsräume für Meetings und Events mit bis zu 284 Personen. Fitnessraum und Sauna bieten Raum für Sport und Erholung. Die Radisson Hotel Group hat in Österreich aktuell über 10 Hotels im Betrieb oder in der Entwicklung. In Graz wurde im Sommer das Radisson Hotel Graz als erstes Haus der Upscale-Marke in der Alpenrepublik eröffnet. Weitere Hotels und Projekte unter den Marken Radisson RED, Radisson Individuals, Park Inn by Radisson und Prize by Radisson sind in Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien zu finden.
••• TFE
Vor wenigen Tagen eröffnete das neue A by Adina (eine Marke der australischen TFE Hotels) Vienna Danube, in Wien. Das Apartment-Hotel befindet sich im 180 m hohen Danubeflats Wolkenkratzer. Das Hotel bietet 120 Studios, One- und Two-Bedroom Apartments mit flexiblen Wohnbereichen inklusive Küche und Arbeitsbereichen. Zur Ausstattung gehören ein Infinity Pool, Saunen, ein Fitnessbereich und australische Speisen im Lottie’s, der hauseigenen Bar mit kleinem Restaurant. Das in Zusammenarbeit
mit BWM Designers & Architects entworfene A by Adina Vienna Danube verbindet europäische Ästhetik mit schlichter Eleganz. Die öffentlichen Bereiche überzeugen durch ein durchdachtes Design - warm und einladend. Asli Kutlucan, Chief Executive Officer Europe, TFE Hotels: „Wir freuen uns sehr, A by Adina mit diesem außergewöhnlichen Haus in einer wirklich erstklassigen Lage in Europa einzuführen. A by Adina verbindet stilvollen Hotelservice mit der Privatsphäre eines durchdacht gestalteten Apartments.“

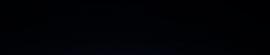



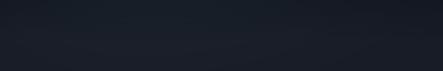
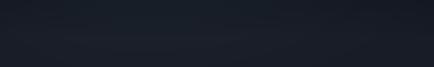
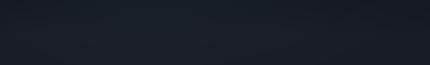
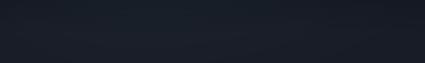

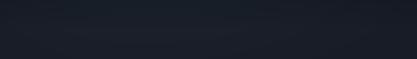

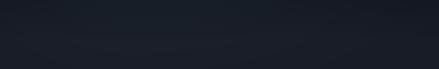

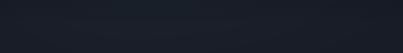
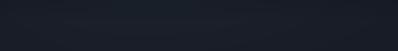










































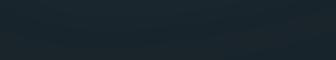
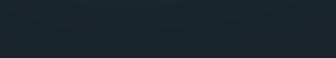

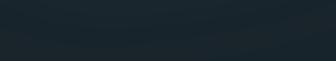
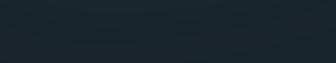


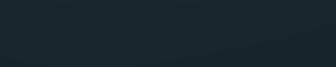

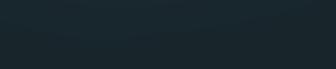

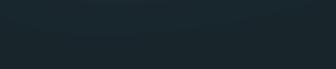
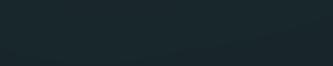








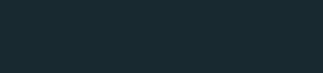
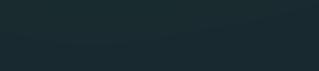

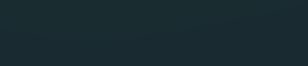
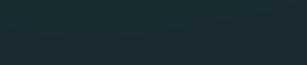
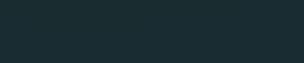

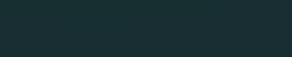
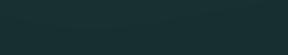

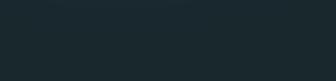



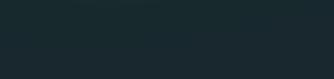
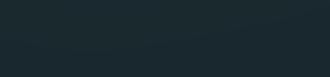
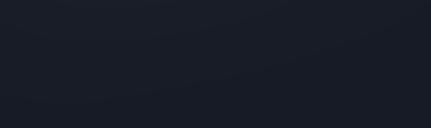
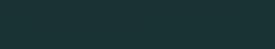


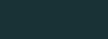










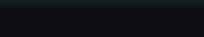


















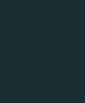





























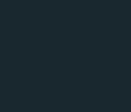
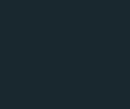



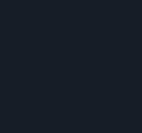

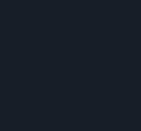



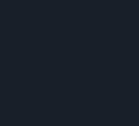

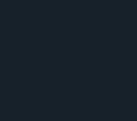


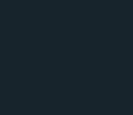
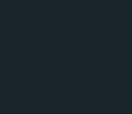
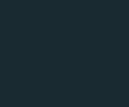










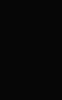



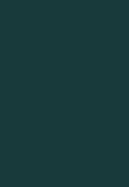





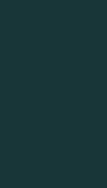









PROFESSIONELLE FLOTTENLÖSUNGEN FÜR ALLE UNTERNEHMENSGRÖSSEN
Für die individuellen Anforderungen Ihrer Flotte stehen wir Ihnen gerne zur Seite: Hotline: +49 (0)961 63186666 Internet: atu-flottenloesungen.de
Mehr Infos zur Elektromobilität:
BeNEX ist neuer Eigentümer von Abellio Deutschland
Nach Abschluss der wettbewerbsrechtlichen Prüfung und Zustimmung aller Aufgabenträger gehört die ATH Rail Transport Beteiligungsgesellschaft Deutschland GmbH nun dem auf regionalen Bahnverkehr spezialisierten Mobilitätsdienstleister BeNEX. Die Transaktion umfasst die Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland (Halle / Saale) und WestfalenBahn (Bielefeld) sowie die Servicegesellschaft PTS (Neuss). BeNEX übernahm Mitte Oktober 2024 100 % der Gesellschafteranteile an Abellio Deutschland von der niederländischen Staatsbahn. BeNEX baut mit der Übernahme von Abellio Deutschland das Angebot für umweltfreundliche Mobilität weiter aus und wird seine Fahrgastzahlen steigern. Abellio Rail Mitteldeutschland und WestfalenBahn werden dabei weiterhin ihre verkehrsvertraglich vereinbarten Leistungen erbringen. An den aktuellen Angeboten und Fahrplänen ändert sich für die Fahrgäste durch die Übernahme nichts.

••• Deutsche Bahn
Die Baureihe 406, die den ICE 3 vor 25 Jahren zum ICE International machte, ist am 12. April 2025 nach einer Sonderfahrt von Hannover nach Amsterdam in Rente gegangen. Vor einem Vierteljahrhundert läutete der ICE 3M eine neue Ära des internationalen Bahnverkehrs ein. Mit ihrem ersten Einsatz zur EXPO 2000 im internationalen Fahrgasteinsatz, begann die Erfolgsgeschichte von ICE International, die in diesem Jahr 25 Jahre wird. Der 406 machte den ICE-Verkehr nach Amster-
Neue Gepäckregeln für TGV
Geschäftsreisende mit Mehrtagesreisen zu Zielen in Frankreich, die ab Frankfurt, Stuttgart oder München TGV-Züge nutzen, müssen sich umstellen. Denn die französische Bahn SNCF hat neue Reisegepäckregeln eingeführt. In die TGV Hochgeschwindigkeitszüge dürfen nur noch zwei Gepäckstücke mit an Bord genommen werden, dazu noch ein kleines Handgepäck. Die zugelassenen Dimensionen in der Kategorie "Essentiel" – der Economy-Klasse der SNCF – betragen 90 x 70 x 50 cm für das größere Stück und 40 x 30 x 15 cm für
••• Bahn
DB Fernverkehr: Die noch vorhandenen 58 Garnituren der ersten ICE-Generation (IC1) sollen mindestens bis 2036 im Einsatz bleiben. Anstelle des vormaligen ICE fährt ein IC2 Dosto das Pendler IC-Paar 2081/2080 Nürnberg (ab 6.16 Uhr) – München (an 08.08 Uhr, ab 16.07 Uhr) – Nürnberg (an 17.59 Uhr). Das ist ideal für Geschäftsreisende.
DB Fernverkehr und SNCF: München-Paris über Stuttgart: 5 Zugpaare ab Dez. 2026.
DB Regio: Moderne vierteilige Siemens Mireo Triebzüge jetzt auf der Strecke NürnbergRegensburg-München-Flughafen.
EC-Verkehr Berlin-Warschau: PKP Intercity stellt Kulturwagen
(Konferenzwagen) in EC ein. An Bord Lesungen, Workshops, Konzerte. Projektpartner sind die Städte Berlin, Posen, Warschau.
Hochrheinbahn: Ausbau und Elektrifizierung der 75 km langen Strecke Basel-Erzingen. 3 neue Haltepunkte, 16 werden modernisiert. Schweiz steuert 50 Mio. Euro zu den Baukosten (430 Mio. Euro) bei. Baubeginn 2026.
Strecke Cottbus-Lübbenau: Zweigleisiger Wieder-Ausbau der seit 1945 eingleisig von den Russen zurückgebauten 29 km langen Strecke planfestgestellt. Inbetriebnahme Ende 2027.
Regio S-Bahn Ortenau: Auf den Linien Offenburg-Freudenstadt, Offenburg-Bad Griesbach, Offen-
dam, Brüssel und Paris erstmalig möglich – schnell, komfortabel und grenzenlos. Nutzer auf diesen Verbindungen waren hauptsächlich Geschäftsreisende. Denn mit den ICE 3M waren sie ab Frankfurt meist schneller in Paris, in Brüssel oder Amsterdam als mit dem Flugzeug. Aktuell hat die DB die Flottenmodernisierung im internationalen Schnellverkehr abgeschlossen. Die Baureihe 408 hat übernommen. Vom 406 hatte Siemens 17 jeweils achtteilige Einheiten gebaut. Die ICE-3M-Zü-
ge (darunter drei der NS) verkehrten bis 2024 hauptsächlich nach Amsterdm und Brüssel. Sechs Züge wurden 2007 für den Verkehr nach Frankreich umgerüstet und als ICE 3MF bezeichnet. Mit Vmax 330 km/h sind sie gemeinsam mit den 403 die schnellsten Reisezüge in Deutschland. Im Betrieb erreichen diese ICE in Deutschland planmäßig bis zu 300 km/h. Während des Einsatzes auf der LGV Est européene waren sie mit 320 km/h zwischen Straßburg und Paris unterwegs.
das kleinere. Dazu ist noch ein Handgepäckstück erlaubt. Die Maße wirken auf den ersten Blick eher großzügig. Wer sich allerdings nicht daran hält, muss seit März 2025 eine Geldstrafe von 30 bis 50 Euro berappen. Der Schritt nährt den Verdacht nährt, die Bahn wolle Reisende schrittweise an die Gepäck-Restriktionen von Billigfliegern gewöhnen. Ein Sprecher der französischen Bahngesellschaft rechtfertigte die neue Regel mit dem Verweis auf den „Komfort“ der Reisenden: Allzu oft versperrten Koffer den Mittelgang oder fielen gar aus den Ablagen herunter. Die neuen Normen lägen zudem „weit über den in Flugzeugen geltenden Limits“.
burg-Straßburg, Ofenburg-Riersbach setzt die SWG (mit Ausnahme Offenburg-Straßburg) 20 batterieelektrische Triebzüge Siemens Mireo Plus B ein.
S-Bahn Hamburg: Vollständig digitalisiertes Netz ab 2030. Mit Einführung von ATO (Automatic Train Operation) Und ETCS2 (European Train Control System) können 30 % mehr Züge fahren.
NWL: Angeschlagene Eurobahn für 1 € übernommen.
Bochum Hbf: Zweite Vollsperrung vom 05.09-31.10.2025.
DSB: Noch in 2025 zwei Tageszugpaare Kopenhagen-Oslo mit neuen Talgo-Garnituren der Dänischen Staatsbahn.
ÖBB: Nach dem ausgelieferten 13 neuen Nightjet-2-Zügen (siebenteilig) baut Siemens 20 weitere Garnituren.
RZD: Siemens ICE3-Pendants Velaso RUS „Sapsan“ werden 2028 durch neue russische selbst entwickelte Züge ersetzt.
SBB: Fern- und Regionalverkehr war 2024 pünktlich wie noch nie. 93,2 % aller Züge waren weniger als 3 Minuten verspätet. 98,7 % aller Anschlüsse wurden erreicht.
Trenitalia-France: Fernverkehr Paris Gare de Lyon - Milano Centrale mit Frecciarosse-Zügen wieder aufgenommen. 2x täglich. Zusätzlich 3 FrecciarosseZugpaare/Tag Paris-Marseille.

Bayern erlaubt kostenloses Parken für
und PHEV
Mit einer teilweisen Befreiung von Parkgebühren will die bayerische Staatsregierung den Umstieg auf Elektroautos attraktiver machen. Seit 01. April 2025 isr für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge auf öffentlichen Verkehrsflächen in Bayern für die ersten drei Stunden keine Parkgebühr fällig. Bernd Bukkenhofer, Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags, lehnt eine Verpflichtung der Kommunen ab. Es müsse jeder Stadt im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung weiter überlassen bleiben, wie sie die Parkraumbewirtschaftung auch unter Berücksichtigung des Klimaschutzes gestalten wolle. Das kostenfreie Parken für BEV, PHEV und H2-Autos ist vorerst bis Ende 2026 befristet. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann räumte ein, dass die Neuerung bei Kommunen zu Einnahmeausfällen führen könne. Aufgabe von Kommunen sei im Kern aber nicht, durch die Bewirtschaftung von Parkplätzen Einnahmen zu erzielen, "sondern die Parkplätze zu bewirtschaften". Die Gebührenbefreiung für E-Autos habe einen positiven Effekt, auch wenn er sich finanziell schwer messen lasse. Die Regelung werde die Innenstädte beleben und E-Autos attraktiver machen. "Und das ist etwas, was natürlich auch die Kommunen wollen." Denn auch für die Städte sei es von Vorteil, wenn mehr Elektroautos als andere Fahrzeuge unterwegs seien, allein schon der Umwelt zuliebe.
••• Luftfahrt
2025 wird Jahr der E-Mobilität: Die Preise für BEV fallen bei allen Herstellern, damit die E-Skepsis vieler potenzieller Kunden weicht.
Autobauer aus China: Nach dem verkorksten ersten Anlauf 2023/24 mit nur geringen Neuzulassungen wollen BYD, GWM, Lynk, NIO & Co. ihren Vertrieb in Deutschland forcieren.
Agenturmodell: Bei der Neuausrichtung des Vertriebs kommt die Rolle rückwärts. Nach Jaguar und Ford, Stellantis und VW bröckelt die Agentur-Euphorie.
BMW: Neue Klasse startet mit iX3 (auch Allradversion) und kurz danach mit dem 3er. 800 VoltSystem; 30 % höhere Reichweite,

Lange hat sich Mazda Zeit gelassen, ein Modell im C- bzw. D-Segment, das batterieelektrisch angetrieben wird, anzubieten. Mit dem neuen Mazda6e schlägt der japanische Hersteller das nächste Kapitel in der Designentwicklung der Marke auf. Mazda’s erstes vollelektrisches Mittelklassemodell erscheint als Mazda6e EV (Batterie 68,8 kWh) mit einer Reichweite von max. 479 km. Der Mazda6e EV Long Range mit einer 80 kWh Batterie soll eine Reichweite von bis zu 552 km bieten. Kunden haben die Wahl aus zwei Ausstattungslinien: TAKUMI und TAKUMI PLUS. Das durchdachte Kabinenlayout bietet höchsten Komfort, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Zu den Highlights gehören ein großes Head-up-Display (HUD), das aktive, fahrrele-
vante Informationen in die Windschutzscheibe projiziert. Ergänzend steht im Innenraum ein digitales 10,25-Zoll-Kombiinstrument zur Verfügung. Ein 14,6-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole bietet darüber hinaus den Zugriff auf Kommunikationsund Unterhaltungsfunktionen. Die schwebende, horizontale Armaturentafel erstreckt sich über die gesamte Breite des Innenraums und vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit. Überflüssige Knöpfe und Bildschirme werden durch eine intuitive, durchdachte Anordnung der Bedienelemente ersetzt.Das Mittelklassemodell verbindet eine dynamisch-elegante Ästhetik mit hoher Praktikabilität und einem minimalistischen, aber hochwertigen Innenraum. Die sportliche Silhouette ist von
einem Coupé inspiriert und mündet in ein kurzes Heck, das dem Wagen ein limousinenartiges Erscheinungsbild und gleichzeitig die Praktikabilität eines fünftürigen Schrägheckmodells verleiht. Serienmäßig ist ein PanoramaGlasdach. Die Ambientebeleuchtung mit 64 individuell einstellbaren Farben sorgt mit sanfter, indirekter Beleuchtung für eine hochwertige Atmosphäre. Die Monoform-Vordersitze mit integrierten Kopfstützen verbinden moderne Eleganz mit außergewöhnlichem Komfort. Mehrere hochwertige Polsterungen stehen zur Wahl: weißes oder schwarzes Kunstleder in der Ausstattung TAKUMI sowie eine luxuriöse Kombination aus Nappaleder und Velourledernachbildung in der Linie TAKUMI PLUS.
30 % schnelleres Laden, 25 % höhere Effizienz,neues innovatives Bedienkonzept.
Ford: Der elektrische Explorer läuft nicht wie geplant, weil zu teuer. 2024 wurden nur 3.071 Einheiten in Deutschland zugelassen. Rausreißen soll’s der neue Puma Gen-E. Was Ford fehlt, ist ein wettbewerbsfähiges kleines E-Auto.
Northvolt: Der angeschlagene schwedische Batteriehersteller produziert vorerst weiter. Die Aktionäre (u.a. VW) stimmten gegen die Liquidierung und damit für die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens.
Megadealer nach US-Vorbild: Zunehmend werden auch die
großen Autohändler zum Kaufobjekt. Die Interessenten kommen alle aus dem Ausland. Der niederländische Branchenriese Van Mossel will in Deutschland ebenso durch Aufkäufe wachsen wie die österreichische PappasGruppe oder die britische Pendragon Group, die zum US-Riesen Lithia Motors gehört. Die Letzt genannten wollen sich alle Mercdes-Niederlassungen unter den Nagel reißen.
Porsche: Die überzogenen Listenpreise und die Vertriebsflaute in China könnten dem Sportwagenbauer gefährlich werden. Neuer E-Macan und Taycan verkaufen sich eher schlecht als recht. Auch der 911 ist zunehmend ein Ladenhüter. Ob der neue
Cayenne als BEV kommt wie geplant, ist derzeit unklar. Der Abbau von bis zu 8.000 der 42.000 Jobs steht im Raum.
Toyota: Platz 8 bei den Neuzulassungen 2024. Auch nach Marktanteilen das beste Ergebnis seit 2009. Am stärksten legten die Kleinwagen Yaris und Aygo zu.
Volkswagen: In den deutschen Werken sollen ca. 25 % weniger Fahrzeuge gebaut werden. Bis 2030 sollen 35.000 Jobs entfallen. Golf wird ab 2027 nur noch in Mexiko für den Weltmarkt produziert. In Wolfsburg soll ab 2029 ein Elektro-Golf vom Band laufen. Passat nur noch aus Bratislava. Keine Zukunft haben Osnabrück und die Gläserne Manufaktur Dresden.
Die Bundesautobahnen sind gewissermaßen die Arterien des motorisierten Individualverkehrs in Deutschland, die genau wie ihre menschlichen Gegenstücke auch mal verstopfen können, wie die Staubilanz 2023 zeigt. Entsprechend gibt es auch politische Kräfte, die sich für ein weiteres Zubetonieren Deutschlands durch den Ausbau des Fernstraßennetzes einsetzen. Dass das ein eher mühsames Geschäft ist, zeigen Daten des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Denen zufolge ist das Autobahnnetz in den letzten zwei Jahrzehnten netto um 1.135 km gewachsen. Davon entfallen 249 Kilometer auf den Freistaat Bayern und jeweils 169 km auf Thüringen und Sachsen-Anhalt. Außerdem knacken noch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen die 100-km-Marke, wie der Blick auf die StatistaGrafik zeigt. Dagegen wurden im Westen vergleichsweise wenige Autobahn-Kilometer zugebaut - in Baden-Württemberg und Hamburg ist das Netz sogar leicht geschrumpft.

EU-Kommission
Die EU-Kommission kommt der Autoindustrie, vor allem der deutschen, bei der Berechnung der Klimaziele 2025 entgegen. Danach wird das EU-Gesetz zum Verbrenner-Aus 2035 bei der Revision des Gesetzes Ende 2025 wohl kippen. Es sieht ganz danach aus, als ob sich die Leugner des Klimawandels, also die Gegner des Verbrenner-Aus in Brüssel, durchsetzen. In einer ersten Version des Dokumentes gab die EU-Kommission noch ein klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus ab. Doch diese Passage wurde nun auf Druck des Kabinetts von
Neue Audi A6 Limousine
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestrichen. Die Verkaufserfolge von BEV sind mit Ausnahme aller skandinavischen Länder, von Belgien, den Niederlanden, von Großbritannien und anderen mehr, in Europa überschaubar. Die Neuzulassungen von Elektroautos in Europa verläuft bislang eher uneinheitlich und ist stark davon abhängig, welche staatlichen Fördermittel es gibt.
Zuletzt hatten immer mehr Autobauer ihre sehr hohen Verkaufsziele für E-Fahrzeuge der tatsächlichen Kunden-Nachfrage
anpassen müssen. Die E-Mobilität wächst zwar deutlich, aber noch nicht in dem Tempo, mit dem sich Brüssel das wünscht: „Es mangelt für die Erreichung der Flottengrenzwerte und den erfolgreichen Hochlauf der Elektromobilität offensichtlich an den Rahmenbedingungen – ob mit Blick auf Ladeinfrastruktur, Energiepreise oder auch Rohstoffversorgung“, fasst es der deutsche Autolobbyverband VDA in einer aktuellen Mitteilung zusammen. Bei dieser Ausgangslage sieht sich die EU nun offenbar gezwungen, ihre bisherige Strategie anzupassen.
Audi erweitert die A6-Modellreihe um eine Business-Limousine. Sie setzt Maßstäbe in Design und Aerodynamik, macht Innovation und Komfort in der Premium-Oberklasse in jedem Detail erlebbar. Ihr cw-Wert von 0,23 ist der beste eines Serienmodells mit Verbrennungsmotor in der Geschichte von Audi. Für erhöhte Effizienz bei gesteigerter Performance sorgen Benzin- und Dieselmotoren mit der Mild-Hybrid-Technologie MHEV plus. In Kombination mit ausgefeilten Fahrwerkstechnologien spielt die A6 Limousine ihre Alltags- und Langstreckenqualitäten aus: Sowohl das Luftfederfahrwerk als auch die Allradlenkung verbinden Fahrkomfort und agiles Handling in höchstem Maße. Viele Dinge, die Geschäftsreisen noch komfortabler machen, sind aufpreispflichtig. Die Auslieferung startet im Sommer.

NIO ET9 stellt deutsche Luxusautos in den Schatten
Allen wirtschaftlichen Turbulenzen zum Trotz geben sich die Chinesen ganz selbstbewusst und greifen mit ihrem neuen Flaggschiff ET9 nach den Sternen. Noch ist nicht entschieden, ob das Luxusmodell nach Europa kommt. Das Top-Modell liegt nicht nur preislich gute 20 % unter der deutschen Konkurrenz, ist aber in allen Belangen überlegen. Mit der spektakulären Fahrwerkstechnik "SkyRide" kann man die Fahrt im NIO mit einem Flug durchs All vergleichen. In Sachen Antrieb installiert Nio vorne 245 und hinten 462 PS (zusammen 707 PS und 700 Nm). Und obwohl der ET9 an jeder der über 3.500 Wechselstationen in China binnen 3 Minuten einen vollen Akku bekommt, sind innovativste Batterien mit 100 oder 120 kWh verbaut. Im Innern sitzt man in einer Luxuslounge aus Lack und Leder. Nio leistet sich den Luxus eines kaum 5 cm hohen 5K-Bildschirms quer durchs Cockpit. Alles was wichtig ist sieht man auf dem großen Tablet davor und natürlich auf dem HUD mit Augmented-RealityTechnik. Bei 3,25 m Radstand sind die Platzverhältnisse phänomenal. Lässt man sich chauffieren, erledigt man Arbeiten auf einem ausklappbaren Sekretär.
VW vereint Ladekarten- und Tankgeschäft
Die bisherige Tankkartentochter Logpay wurde mit dem Ladekarten-Bereich der Konzernsparte Elli zusammengefasst. Laut VW ging die neue Tochter unter dem Namen „Elli Mobility“ an den Start. Hauptsitz ist der bisherige Logpay-Standort in Eschborn bei Frankfurt. Mit der Zusammenlegung sollten u.a. Doppelstrukturen reduziert werden. Außerdem wollte man Kunden, vor allem Flottenbetreibern, den Umstieg von Verbrenner auf Elektro erleichtern. Logpay war 2002 gegründet worden und gehört seit 2019 zu 100 % zu Volkswagen Financial Services. Neben klassischen Tankkarten für VerbrennerFlotten bietet das Unternehmen bereits Ladekarten auch für umweltfreundliche Elektrofahrzeuge an, bei denen mit Elli kooperiert wird. Die Ladenetzmarke Elli hatte VW 2018 aufgelegt.
Gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl haben sich die Union und die SPD auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag für eine schwarz-rote Regierung geeinigt. In dem Papier ist fast immer nur von „Wir wollen… “ die Rede, so gut wie nie von „Wir werden…“ Dennoch hoffen die wichtigen Player der Geschäftsreisebranche auf lange vermisste Verbesserungen.

Deutschland steht vor historischen Aufgaben. Angesichts der drängenden wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen braucht es jetzt entschlossenes Handeln. Dafür wurde mit dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD eine starke und verlässliche Grundlage geschaffen – aus Verantwortung für Deutschland, wie die Koalitionäre betonen.
Teilweise Zweifel. Die Reaktionen auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD fallen sehr unterschiedlich aus. Vertreter von Linken, Grünen und AfD übten scharfe Kritik, während die Big Player der Geschäftsreisebranche weitgehend positiv gestimmt sind. Als „ambitionslos und in Teilen sogar rückschrittlich“ werten die Grünen die Koalitionsvereinbarung. Viele zentrale Aufgaben vom Klimaschutz über soziale Gerechtigkeit bis zur nachhaltigen Entwicklung würden konterkariert, wichtige Erfolge der Ampelkoalition rückabgewickelt. Die AfD spricht von einer Kapitulationserklärung. Von der Kernkraft sei keine Rede mehr. Und die Steuersenkungen bleiben minimal. Die Linke bezeichnet den Koalitionsvertrag als „Dokument der Verantwortungslosigkeit“. Verbände loben zwar wichtige Impulse, doch es gibt auch Zweifel. Besonders von den Gewerkschaften kommt Kritik. „Der Koalitionsvertrag enthält wichtige Punkte für dringend nötige Strukturreformen, etwa auf dem Arbeitsmarkt, zum Bürokratieabbau und beim Thema Steuern“, erklärte Christian Sewing, Chef des Bundesverbandes deutscher Banken und der Deutschen Bank. Der Anfang sei gemacht, mehr Mut müsse folgen, forderte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK).
BDL-Statement. „Die künftige Bundesregierung hat den Ernst der Lage in der Luftfahrtbranche erkannt und möchte erste Schritte einleiten, um den Luftverkehr in Deutschland wieder auf die Erfolgsspur zu bringen, bilanziert Jens Bischof, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) den von CDU/CSU und SPD vorgelegten Koalitionsvertrag.
„Die neue Koalition will unsere schwächelnde Wirtschaft wieder in Gang bringen und dazu gehört ein starker Luftverkehr. Erste richtungsweisende Maßnahmen wie die Senkung der Luftverkehrsteuer reichen jedoch nicht aus. Spürbare Entlastungen sind nötig, damit Deutschland am Aufwärtsschwung des Luftverkehrsmarktes teilnimmt.
Um langfristig Luftverkehr nach Deutschland zurückzuholen, braucht es entweder eine komplette Streichung der Luftverkehrsteuer oder eine Halbierung der Steuerlast plus eine Beteiligung des Staates an den Flugsicherungskosten und der Luftsicherheitsgebühr. Erst dann werden wir wieder wettbewerbsfähig und können die Abwanderung von Flugzeugen aus Deutschland aufhalten.“
Auch beim Klimaschutz müssen Wettbewerbsnachteile für deutsche und europäische Airlines dringend abgebaut werden. „Dass die widersinnige nationale, europarechtswidrige PtL-Quote abgeschafft werden soll, ist überfällig. Die Airlines sollen laut der Quote ab 2026 synthetischen Kraftstoff (Power-to-Liquid, PtL) tanken, obwohl es ihn auf dem Markt faktisch nicht gibt. Sonst drohen saftige Strafzahlungen.


„Die Geschäftsreisebranche setzt alle Hoffnung auf die neue Bundesregierung.
Doch da ist ja noch Trump ...“
Gernot Zielonka I CEO zic
Die Koalition schlägt auch bei der Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen zulasten europäischer Airlines den richtigen Weg ein. Bischof: „Es ist gut, dass die künftige Bundesregierung sich auf EUEbene dafür einsetzen will, dass es keine Wettbewerbsnachteile für europäische Airlines gegenüber der außereuropäischen Konkurrenz gibt. Die aktuelle Gesetzgebung der EU verzerrt den Wettbewerb zugunsten außereuropäischer Airlines. Die Folge: Flugverkehr verlagert sich nur und damit auch CO2-Emissionen. Dem Klima ist damit nicht geholfen. Die Bundesregierung sollte sich für eine Evaluierung und Reform des EU-Klimaschutzpakets „Fit for 55“ einsetzen. Wir haben als Verband bereits konkrete Vorschläge vorgelegt, wie Wettbewerbsverzerrungen beseitigt werden könnten.“
Der BDL-Präsident kündigt an: „Wir werden die künftige Bundesregierung konstruktiv, aber kritisch begleiten. Ziel muss es sein, den Luftverkehr in Deutschland als zentralen Baustein unseres Wirtschaftsstandortes wieder in eine Spitzenposition zu bringen.“
der neuen Bundesregierung, die wettbewerbsverzerrenden Sonderbelastungen abzubauen. Insbesondere die geplante Abschaffung der über die europarechtlichen Vorgaben hinausgehenden PtL-Quote (Powerto-Liquid) noch im Jahr 2025 sowie das angekündigte Gleichbehandlungsprinzip bei Sustainable Aviation Fuel (SAF) schaffen Planungssicherheit und entlasten deutsche Fluggesellschaften im internationalen Vergleich.
Zudem begrüßt der BDF die angestrebte Modernisierung in der Luftfahrtindustrie und des Luftverkehrs im Sinne der Dekarbonisierung und des fairen Wettbewerbs.
89 %
der Unternehmen in Deutschland sprechen laut DIHK von einer verschlechterten Lage in den letzten vier Jahren.
BDF. Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften sieht im neuen Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft des Luftverkehrs in Deutschland. Geschäftsführer Dr. Michael Engel: „Der Koalitionsvertrag von CDU/ CSU und SPD markiert eine wichtige Weichenstellung für den Luftverkehrsstandort Deutschland. Die Rücknahme der Luftverkehrsteuererhöhung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und sendet ein wichtiges Signal an die Branche. Doch um wirklich effektive Wachstumsimpulse für die Luftfahrt zu setzen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf europäischer Ebene zu sichern, bedarf es weitergehender Maßnahmen. Nur mit einer spürbaren Reduzierung der staatlichen Standortkosten und einer echten Entlastung der Luftfahrtunternehmen können wir langfristig den Luftverkehr stärken und die Position Deutschlands als attraktives Luftverkehrsdrehkreuz sichern.“ Positiv bewertet der BDF die Ankündigung
„Diese Maßnahmen weisen in die richtige Richtung“, so Dr. Engel. „Jetzt kommt es darauf an, die angekündigten Vorhaben zügig und ambitioniert umzusetzen. Der Luftverkehr ist Rückgrat der deutschen Exportwirtschaft, fördert den Tourismus und verbindet Menschen weltweit. Nur durch verlässliche und wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen kann der Luftverkehr in Deutschland wieder durchstarten.“ Der BDF will diesen Weg konstruktiv begleiten und sich weiterhin für eine starke Luftfahrt in Deutschland einsetzen.
VDA. Nicht zufrieden mit den Plänen von Union und SPD ist die Autoindustrie. Dass die Koalitionäre sich nun auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben, ist zwar begrüßenswert, betont VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Das Programm von Union und SPD setzt erste wichtige und richtige Akzente, bleibt in einigen Bereichen allerdings auch hinter den dringenden Notwendigkeiten zurück – insbesondere die Finanzierungsvorbehalte, die sich an vielen Stellen durch den Koalitionsvertrag ziehen, lassen viele Fragen offen.
Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität müssen Leitmotiv der neuen deutschen Bundesregierung sein – das ist für die Zukunft der deutschen Schlüsselindustrie, der deutschen Automobilindustrie – von entscheidender Bedeutung. Nur dann gelingt es auch, das von der Koalition gesetzte Ziel, das Potenzialwachstum zu erhöhen, tat-

Neue E-Förderung – bis jetzt Fehlanzeige.
sächlich zu erreichen. Die Einrichtung eines Deutschlandfonds kann positiv dazu beitragen, den Zugang zu Kapital – insbesondere für Investitionen von Mittelstand und Scale-ups – zu verbessern. Das Bekenntnis zum Auto, die klare Leitlinie, dass Deutschland Industrienation und Mittelstandsland ist, ist die Grundlage für einen Politikwechsel, mit dem Berlin die zuletzt überwiegend belastende Politik für den deutschen Wohlstandsmotor hinter sich lassen kann. Dieses Bekenntnis wird durch wichtige Punkte im Detail untermauert. Positiv ist, dass bei der Förderung von E-Autos auf steuerliche Anreize gesetzt wird. Die Verlängerung der Kfz-Steuer-Befreiung für E-Autos bis 2035, die Anhebung des Bruttolistenpreisdeckels bei der Dienstwagensteuer und die Einführung einer Sonderabschreibung sind wichtige Impulse und unterstützen den Hochlauf der E-Mobilität. Gleiches gilt für die vorgesehene allgemeine Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß, die einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Ladestrompreise darstellt.
••• Tourismus
Der Tourismus in Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der vielen Menschen Beschäftigung gibt, gerade auch in ländlichen Regionen. Dazu benötigt der Tourismus ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Es soll eine neue nationale Tourismusstrategie erarbeitet werdenn, die sowohl wirtschaftliche als auch nachhaltige Aspekte berücksichtigt und die Themen Tourismusakzeptanz, Lebensraumgestaltung und Digitalisierung in den Fokus rückt. Über die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) sollen die vorhandenen Wirtschaftspotenziale bestmöglich gehoben werden: Die institutionelle Förderung der DZT, die mindestens auf dem Niveau des Jahres 2024 liegen sollte, soll weiter gefördert werden. Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Anbindung und Konnektivität der Reisedestination Deutschland zu sichern, u.a. durch den Ausbau des Schienen- und Flugverkehrs. Um qualifizierte Fachkräfte muss sich das Gastgewerbe, etwa durch verbesserte Ausbildungsanstrengungen, verstärkt bemühen. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur muss mit den vorhandenen und bewährten Förderinstrumentarien wieter unterstützt werden.

Die Flughafengebühren in Deutschland nerven Airlines und Verbände.
Zentral ist dabei auch der stärkere Fokus auf den Ausbau der Lade- und H2-Tankinfrastruktur, sowohl für Pkw als auch für Nfz; wenngleich auch hier noch Konkretisierungsbedarfe bestehen. Außerdem muss die Ankündigung von Programmen für Haushalte mit kleineren Einkommen schnellstens geklärt werden, sonst werden Kaufentscheidungen verschoben. Die Anhebung der Entfernungspauschale ist sachgerecht. Das klare Bekenntnis zur Technologieoffenheit muss noch mit konkreten Ableitungen unterlegt werden – insbesondere auch mit Blick auf anstehende Entscheidungen in Brüssel hinsichtlich der CO2-Flottenregulierung. Auch bei der angekündigten Förderung von Plug-In-Hybrid-Technologie bedarf es in dem Zusammenhang zügiger Konkretisierungen. Deutschland als Spitzenstandort für digitale Zukunftstechnologien zu etablieren, speziell im Bereich der KI, ist ein richtiges Ziel, das natürlich mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden muss. Die Koalition hat sich angesichts der geopolitischen Verschiebungen und Herausforderungen vorgenommen, sich für eine pragmatische und regelbasierte Handelspolitik, für die zügige Ratifizierung von EU-Abkommen sowie den Abschluss weiterer Freihandelsabkommen einzusetzen. Dies sind gerade für eine Exportnation wie Deutschland entscheidende Hebel, bei denen es dringend einer Beschleunigung bedarf. Auch dass mit den USA ein Freihandelsabkommen geschlossen werden soll, ist ein richtiges Signal. Gleichzeitig müssen auch die Beziehungen zu China umsichtig ausgestaltet werden. Insgesamt setzt der Koalitionsvertrag richtige Impulse und Akzente, unterlässt allerdings in vielen Bereichen auch die notwendigen grundlegenden Strukturreformen. Wichtig ist jetzt, dass die beabsichtigten Vorhaben schnell und unkompliziert umgesetzt werden, dass die teils vagen Absichtserklärungen mit konkreten Maßnahmen – auch z.B. bei der Reform der Sozialsysteme –unterlegt werden und die neue Bundesregierung damit die Grundlage setzt, eine wirtschaftliche Trendwende und eine entsprechende Aufbruchstimmung zu ermöglichen.“
VDIK. Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) kritisierte die Punkte zur Elektromobilität, und dabei etwa die genann-

Unabhängiger werden. BMW baut riesiges Batteriewerk.
ten steuerlichen Anreize, die den E-Autoabsatz ankurbeln sollen, als zu vage. Unsicherheit und Kaufzurückhaltung werde bei den Kunden nicht weichen. „Der gewünschte Ruck wird nicht unmittelbar einsetzen“, ergänzte der Importeursverband. Die E-Mobilität bleibe in der Warteschleife.
Allianz pro Schiene. Die Allianz pro Schiene sieht im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung viele wichtige Weichenstellungen, um die Schieneninfrastruktur für die rekordverdächtige Nachfrage im ÖPNV fit zu machen. Geschäftsführer Dirk Flege mahnte jedoch an, es dürfe mit Schwarz-Rot in der Verkehrspolitik kein Weiter-so einer autozentrierten Verkehrspolitik geben. Die Menschen in Deutschland machten immer wieder deutlich, dass sie eine starke Schiene wollten. Die Allianz pro Schiene begrüßt insbesondere, dass die Koalition sich zu höheren Investitionen in die Schieneninfrastruktur bekennt und für mehr Planungssicherheit einen Eisenbahninfrastrukturfonds schaffen will. „Das ist das richtige Signal in die Branche und auch für die Bauunternehmen, dass die großen Baustellen im Netz in den nächsten Jahren angepackt werden können und die Schiene für die hohe Nachfrage weiter ausgebaut werden soll“, so Dirk Flege. Auch dass es nun das lange geforderte Bekenntnis zum Deutschlandticket gebe, sei eine gute Nachricht für die Menschen im Land. „Das bedeutet, all diejenigen, die jetzt schon das Deutschlandticket nutzen, können sich darauf verlassen, dass es dieses tolle Angebot auch weiterhin geben wird. Für all jene, die bislang noch gezögert haben, ist die angekündigte Preisstabilität bis Ende 2029 ein gutes Argument, den ÖPNV nun stärker zu nutzen und das Auto öfter stehen zu lassen. Mehrere Studien haben ja zuletzt das große Potenzial des Deutschlandtickets für die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene belegt.“
Zuletzt hatten sich 74 % der Menschen in einer von acatech beauftragten repräsentativen Umfrage des Allensbach-Instituts (https://www. acatech.de/allgemein/pm-mobilitaetsmonitor-2025/) dafür ausgesprochen, dass das Schienennetz in Deutschland ausgebaut wird. Noch hat der Pkw-Verkehr jedoch einen Marktanteil von 83 %. „Die Bun-

••• Koalitionsaussagen rund um das Thema Verkehr
Das Koalitionspapier steht unter dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ und beschreibt auf 146 Seiten, wie es mit Deutschland wieder aufwärts gehen soll. In der Planung für die kommende 21 Legislaturperiode spielt das Thema Mobilität eine vergleichsweise überschaubare Rolle. Dabei ist Grundlage vernünftiger Mobilität eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Sie sichert Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit.
Automobilindustrie: Die künftige Regierung will auch in Zukunft eine starke Automobil- und Zulieferindustrie als Schlüssel-Industrie und Arbeitsplatzgarant. Alle drei Koalitionäre bekennen sich klar zum Automobilstandort Deutschland und seinen Arbeitsplätzen. Dabei setzen sie auf Technologieoffenheit und wollen sich aktiv dafür einsetzen, Strafzahlungen aufgrund der Flottengrenzwerte abzuwehren. Eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotten begrüßen sie grundsätzlich, eine pauschale gesetzliche Quote lehnen sie jedoch ausdrücklich ab. Bemerkenswert: Sie wollen die E-Mobilität wieder mit Kaufanreizen fördern. Zudem wollen sie folgende Maßnahmen ergreifen:
• Eine steuerliche Begünstigung von Dienstwagen durch eine Erhöhung der Bruttopreisgrenze bei der steuerlichen Förderung von E-Fahrzeugen auf 100.000 Euro.
• Eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge.
• Die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis zum Jahr 2035.
• Ein Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen aus Mitteln des EU-Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen.
• Eine Förderung von Plug-In-Hybrid-Technologie (PHEVs) und Elektrofahrzeugen mit Range-Extender (EREV).
• Den beschleunigten Ausbau und die Sicherstellung der Finanzierung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladenetzes und des Schnellladenetzes für Pkw und Lkw.
• Sie wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass autonomes Fahren in den Regelbetrieb kommt.
• Sie wollen den Aufbau der Batteriezellfertigung inklusive der Rohstoffgewinnung, des Recyclings und des Maschinen- und Anlagenbaus fördern.
• Sie wollen prüfen, wie die Umrüstung und Ertüchtigung vorhandener Werke für die Bedarfe der Verteidigungsindustrie unterstützt werden können.
Luftverkehr: Ziel ist es, die Modernisierung in der Luftfahrtindustrie und des Luftverkehrs in Richtung fairer Wettbewerb und Dekarbonisierung zu gestalten. Die Koalition setzt sich dafür ein, die internationale Konnektivität deutscher Flughäfen zu verbessern. Die über das europarechtlich Notwendige hinausgehende Power To Liquid (PtL)-Quote soll noch 2025 abgeschafft werden. Mit geeigneten Instrumenten soll dafür gesorgt werden, dass europäische Fluggesellschaften bei der Sustainable Aviation Fuel (SAF)-Quote nicht schlechter gestellt werden als außereuropäische. Bis Ende 2025 soll eine Strategie entwickelt werden, die die Fragen der zivilen Luftfahrtindustrie sowie die Stärkung des Luftverkehrsstandortes zusammendenkt.


desregierung muss zeigen, dass sie Klimaziele und Verkehrsverlagerung ernst nimmt und ihre Verkehrspolitik danach ausrichtet. Ein Weiter-so darf es keinesfalls geben – das wäre auch nicht im Interesse der Bürger“, so Flege.
Die Bundesregierung sei darüber hinaus gefordert, schnellstmöglich übergeordnete Ziele für den Schienenverkehr in Deutschland zu erarbeiten. „Schon lange fordern wir von der Bundesregierung eine Strategie, wie sie sich den Schienenverkehr der Zukunft vorstellt. Wie viele Züge sollen auf dem Schienennetz Platz haben? Wie viele Menschen und Güter wollen wir von A nach B bringen? Welche Rolle soll die Eisenbahn im gesamten Verkehrssystem spielen? Nur mit einer klaren Strategie kann der Bund das Schienennetz in Deutschland gestalten und entwickeln. Er muss Ziele vorgeben und deren Einhaltung steuern. Das ist viel wichtiger als ein symbolischer Personalwechsel.“
DEHOGA. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bundesverband) begrüßt die zügige Einigung von CDU, CSU und SPD 45 Tage nach der Bundestagswahl. „Deutschland braucht gerade jetzt eine handlungsfähige Regierung“, erklärt DEHOGA-Präsident Guido Zöllick. „Der Koalitionsvertrag enthält wichtige Verbesserungen für die Branche – wie die
Umsatzsteuerreduzierung für Speisen in der Gastronomie zum 01. Januar 2026 auf dauerhaft 7 %, die Wochenarbeitszeit und Bürokratieabbau. Damit werden wichtige Weichen für die Zukunft der 200.000 gastgewerblichen Betriebe und ihrer 2 Mio. Beschäftigten gestellt. Eine Entscheidung von besonderer Relevanz für die Branche ist die vereinbarte dauerhafte Geltung der 7 % Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie. „Diese Maßnahme sorgt endlich für fairen Wettbewerb und beendet die steuerliche Benachteiligung der Branche gegenüber anderen Anbietern von Essen“, betont Zöllick. „Es geht um die Zukunftssicherung die häufig familiengeführten Cafés, Wirtshäuser und Restaurants. Dafür haben wir jahrzehntelang gekämpft und gute Argumente für die einheitliche Besteuerung von Essen mit 7 % vorgebracht“, so Zöllick. „Die 7 % Mehrwertsteuer sind eine Entscheidung für die heimischen Gastgeber, die täglich mit Leidenschaft für ihre Gäste da sind, sie sichern Existenzen, Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie die kulinarische Vielfalt – in der Stadt wie auf dem Land.“ Die Absichtserklärungen, Bürokratie abzubauen, begrüßt der DEHOGA-Präsident ebenso.
100.000

Einzelvorschriften lähmen den Mittelstand in der Bundesrepublik.
„Die Parteien haben den Ernst der Lage im Gastgewerbe erkannt. Jetzt muss daraus verbindliche Politik werden“, sagt Zöllick abschließend. „Nach fünf Jahren mit realen Verlusten kommt es für unsere Branche mehr denn je auf die richtigen wirtschaftspolitischen Impulse an, um wieder durchstarten zu können – für lebendige Innenstädte und Regionen, gastronomische Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.“
Bitkom. Der Digitalverband bezeichnete die Einrichtung eines Ministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung als „Meilenstein für Deutschland und das lange erwartete Aufbruchsignal der neuen Bundesregierung“. Richtig ausgestaltet, könne es die digitalpolitischen Themen im Bund in einer Hand zusammenführen und so zu einem echten Treiber für die Digitalisierung werden. „Mehr denn je müssen wir jetzt wettbewerbsfähig, innovativ und digital handlungsfähig werden.“ •••


Autobahn-Rastplätze, ob bewirtschaftet oder unbewirtschaftet, sind oft eine Zumutung. Automobile Geschäftsreisende können ein Lied von den Unzulänglichkeiten singen. Nicht immer sind die Brummikapitäne die schwarzen Schafe. Auch scheinen viele Pkw-Fahrer zu glauben, die Außenanlagen seien Müllabladeplätze.
Jahr für Jahr testen Automobilverbände wie der ADAC Autobahnrastanlagen und sie kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis: wenig Erholung, viel Dreck. Rastplätze an den deutschen Autobahnen sind ein einziger Saustall, erleben private wie automobile Geschäftsreisende Tag für Tag und Nacht für Nacht. Abfälle wild verstreut, Millionen achtlos weggeworfene Zigarettenkippen und oft genug an den Rändern der Rastanlagen menschliche Hinterlassenschaften. Und auch die WC-Anlagen sind häufig eine Zumutung: Ekel erregende Zustände wohin man blickt, man achte z.B. nur einmal auf die oft genug herumliegenden mit Urin gefüllten Flaschen. Immer wieder erreichen den ADAC Beschwerden seiner Mitglieder über den meist furchtbaren Zustand der rund 1.500 unbewirtschafteten Rastanlagen an den deutschen Fernstraßen. Geändert hat sich bis heute nichts. Das liegt u.a. daran, dass es offensichtlich kaum Personal gibt, das aufräumt und reinigt, was gewissenlose Elemente hinterlassen. Es gibt auch keinerlei Überwachung geschweige denn hohe Strafen.
Laut ADAC bekommt mehr als jede fünfte Anlage die Noten „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“. Nur ganz wenige dieser Rastan-
lagen schneiden mit „sehr gut“ ab. Viel zu tun gibt es für die Betreiber dieser Parkplätze an den Fernstraßen in puncto „Persönliche Sicherheit“ und „Sanitäre Anlagen“ – in diesen Kategorien gibt es die schlechtesten Bewertungen. Indes sind es auch die bewirtschafteten Rastanlagen, auf denen es nach umfangreichen Erfahrungen von DMM wenige Meter abseits der eigentlichen Rasthäuser und Shops aussieht, wie in den schlimmsten Elendsvierteln dieser Welt.
Beste Rastplätze im Test waren Engelmannsbäke an der A 1 in Niedersachsen und Plater Berg an der A 14 in Mecklenburg-Vorpommern. Am schlechtesten schnitten die beiden in Hessen gelegenen Rastplätze Stadtwald an der A 3 und Brühlgraben an der A 5 ab. Sie ließen alles vermissen, was Geschäfts- und Privatreisende bei einem Zwischenstopp an der Autobahn vorfinden sollten – saubere Sani-
81 %
der Sanitäranlagen gaben Hinweise auf mangelnde Reinigung.
tär- sowie gepflegte und beleuchtete Außenanlagen.
Der Sauberkeit in den Sanitäranlagen auf Rastplätzen eilt ein schlechter Ruf voraus. In einem ADAC-Test fielen 14 Anlagen mit mangelhaft oder sehr mangelhaft durch, nur bei knapp der Hälfte aller Tests gab es in puncto optische Sauberkeit geringe oder keine Beanstandungen. Die Hygieneproben waren allerdings lediglich bei 18 % unbedenklich, bei 81 % gab es aber Hinweise auf mangelnde Reinigung. Zwei Rastplätze wurden durch eine K.O.-Wertung in der Kategorie „Sanitäre Anlagen“ auf null Punkte gesetzt, da Toiletten dauerhaft und ohne Hinweis an der Autobahn gesperrt waren und es keine Alternative gab. DMM ist vergleichsweise oft auch in Deutschland (> 100.000 km/Jahr) auf den Straßen unterwegs. Wir beobachten immer wieder dieselben Schweinereien: Wasser funktioniert nicht, meist gibt es keine Seifenspender oder Trockner, und wenn ja, funktionieren auch sie nicht. Nicht selten sind Toiletten verstopft oder anderweitig verdreckt, oft fehlt Toilettenpapier und die Pissoirs kann man guten Gewissens kaum aufsuchen.
Über alle Plätze hinweg gilt das persönliche
„So manche AutobahnRastanlage löst einen Wutanfall aus. Vor allem an den Abenden, wenn Fluten von Lkw alle Zufahrten und auch so gut wie alle PkwStellplätze blockieren. Ganz zu schweigen von den hohen Preisen.

Sicherheitsempfinden der Nutzer als die schlechteste Kategorie im Test – fast ein Drittel der Rastplätze ist mit „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ durchgefallen. Zehn Anlagen verfügten über keinen Notruf, und mehr als die Hälfte der Pkw- und Lkw-Parkplätze waren nicht oder nicht ausreichend beleuchtet. Ganz brutal: Ab den Abendstunden sind auch alle Pkw-Plätze durch Lkw versperrt, oft ist es gar nicht erst möglich, wegen wild parkender Lkw die Rastanlagen anzufahren. Und noch etwas, was wir beobachtet haben: Lkw-Fahrer stellen mit ihren Riesengefährten oft genug die Parkbuchten an den E-Ladesäulen zu.
Mangelnde Kontrolle. Bemerkenswert ist, dass weder ADAC, noch das Bundesverkehrsministerium, noch die Autobahnpolizeiwachen etwas gegen den Lkw-Wahnsinn auf den Fernstraßen unternehmen. Denn
• Lkw erschweren (oder blockieren sogar) in den Abend- und Nachtstunden die Zufahrten zu den Rastanlagen und verfielfachen das Risiko für Pkw-FahrerInnen.
• Lkw blockieren in den Abend- und Nachtstunden die bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen oft komplett
• Pkw-Fahrern werden vor allem auf den unbewirtschafteten Rastanlagen sämtliche Stellplätze in den Abend- und Nachtstunden versperrt. Wer da mal zur Toilette muss, hat Pech gehabt.
• Lkw-Fahrer blockieren verbotenerweise selbst die Parkbuchten an den Ladesäulen für Elektroautos
• Lkw parken abends und nachts oft unbeleuchtet auf den Standstreifen der Autobahnen und sorgen durch so verursachte schwere Unfälle für Leid und Tod.
• Lkw-Fahrer werfen meist ihren Abfall an den Auf- und Abfahrten der Autobahnen ins Freie. Entsprechend versaut sieht es dort aus.
So geht Sauberkeit. Ganz anders sieh es in der Nachbarländern aus:. Schweiz, Österreich, Dänemark, Niederlande, aber auch Tschechien und selbst Polen fallen durch ihre verstärkte polizeiliche Präsenz auf und drohen Schmutzfinken mit drakonischen Strafen. Die Parkplätze dort sind i.d.R. sehr ordentlich und
••• DMM-Tipps für günstige Stopps
Wie den hohen Preisen entgehen, um sich nicht die Stimmung verderben zu lassen
• Längere Autobahnfahrten so planen, dass nicht an Autobahnraststätten getankt werden muss.
• Zeit für Tankstopps einplanen, um von der Autobahn abzufahren, Autohöfe oder alternativen Tankstellen anfahren. Oft ist es nur ein kleiner Umweg, der eine Menge Geld spart.
• Ist der Tankstopp an der AutobahnRaststätte unumgänglich, dann nur so viel nachtanken wie nötig und später abseits der Autobahn volltanken.
• Schon vorab an den kleinen Hunger zwischendurch denken: Eine geschmierte Stulle und Wasser von zuhause spart den teuren Griff ins Raststättenregal. Das Bundeskartellamt empfiehlt zudem, günstige Tankoptionen z.B. via SpritpreisApp ausfindig zu machen: „Das spart Zeit, Geld und Nerven während der Fahrt“. Tank und Rast weist übrigens die Vorwürfe möglicher Vorteile und überhöhter Preise stets zurück. Die meisten Raststätten würden von den jeweiligen Pächtern betrieben und diese würden letztlich auch die Preise vor Ort festlegen.
sauber; auch die Toilettenanlagen sind meist vorbildlich. Am besten aber sehen die Rastanlagen in USA und Kanada aus. Dort könnte man, bildlich gesprochen, selbst in den WCAnlagen essen. Keine Zigarettenstummel, kein Müll, alles wunderbar. Warum aber funktioniert das ausgerechnet in Deutschland überhaupt nicht?
Weil sich in den letzten Jahrzehnten kaum positive Veränderungen ergeben haben, erwartet der ADAC von der Autobahngesellschaft als Betreiberin der Rastplätze, dass sich der Gesamtzustand der Rastanlagen deutlich verbessert. Dazu ist es notwendig, dass auf allen Plätzen ein hohes Maß an Sauberkeit, Sicherheit und Erholung geboten wird.
BEWIRTSCHAFTETE RASTANLAGEN SIND EIN TEURES VERGNÜGEN
Tanken an der Autobahn ist sehr teuer. Geschäftsreisende wissen um die drastischen Unterschiede zu Tankstellen, die sich nicht an der Autobahn befinden. Auch das Bundeskartellamt bestätigt:
Autobahntankstellen haben im Schnitt 39 Cent höhere Benzin- und 36 Cent höhere Dieselpreise im Vergleich zu Tankstellen abseits der Autobahn. Dass Autobahn-Raststätten nicht deutlich teurer sein müssen, zeigen beispielsweise Österreich oder die Schweiz. Dort gibt es keinen so gut wie gar keine Preisunterschiede bei identischem Serviceangebot. Und die Spirtpreise bleiben ganztags stabil, d.h., sie werden nicht verändert.
Die allermeisten Tankstellen und Raststätten an deutschen Autobahnen gehören ein- und demselben Konzern, nämlich Tank und Rast. Rund 360 Tankstellen und 412 von 420


viele Rastanlagen nicjt.
bewirtschafteten Rastanlagen sind Teil des Unternehmens. Eine echte Konkurrenz gibt es nicht und damit auch keinen Wettbewerb.
Das Bonner Unternehmen Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG betreibt 412 Rastanlagen mit 360 Tankstellen und 50 Hotels. Die Gruppe gehört einem Unternehmenszusammenschluss aus verschiedenen Investoren. Neben der Allianz Capital Partners GmbH und der Munich Re haben auch ein staatlicher Pensionsfond aus Kanada (Omer Infastructure) und ein offizieller staatlicher Vermögensfonds aus China (China Investment Corporation, Beteiligung 15 %) Anteile an Tank und Rast.
Tank und Rast wird nicht nur aufgrund seiner vollkommen überzogenen Treibstoffpreise, sondern auch wegen überteuerter Waren und satter Essenspreise kritisiert. Das alles muss nicht sein. Die Wege des Herrn führen auch mal runter von der Autobahn. Dorthin, wo Deutschland schön ist: in Dörfer, zu kleinen Landgasthöfen, Obstbauern oder Winzern. Rasten statt Ausrasten, Reisen statt Rasen – die Zeit sollten wir uns nehmen.
„Autohöfe z.B. bieten den identischen Service, verkaufen Kraftstoffe und Essen/Trinken in der Regel aber deutlich günstiger, sagt z.B. die Verbraucherzentrale Bundesverband. Aber auch da winkt Ungemach: Tank und Rast bemüht sich aktuell, auch die etwas abseits der Fernstraßen gelegenen Autohöfe zu übernehmen, auf die schon viele (Geschäfts)Reisende ausweichen. Trotz Privatisierung der Rastanlagen (1998) muss sich der Bund immer noch um Bau und Instandhaltung der Infrastruktur, um die Zufahrten, die Parkplätze, den Müll kümmern – was viele Millionen Euro im Jahr kostet. Steuergeld, das den Weg zu Tank
& Rast ebnet. Vater der verkorksten Privatisierung: der damalige Bundesverkehrsminister und spätere Autolobbyist Matthias Wissmann.
Unangenehme Feststellungen an den bewirtschafteten Rastanlagen:
• Irre hohe Spritpreise. Durchschnittlich 42 Cent Aufschlag bei Super E10 ermittelte der ADAC im vergangenen Jahr an Stationen von Tank & Rast im Vergleich zu Tankstellen abseits der Autobahn.
• Wucher beim Reisebedarf. 3,29 Euro für eine Bifi, 6,90 Euro für eine Packung Pringles oder 8,18 Euro für eine Tasse Cappuccino – so etwas ist völlig inakzeptabel.
• Negativ fällt auf, dass die Preise sowohl im Shop als auch in der Gastronomie häufig erfragt werden müssen, da die Produkte
nicht ausgezeichnet waren. Auffällig waren auch die Preisdifferenzen zwischen den Rastanlagen.
• WC-Abzocke. Ein Euro für den Gang zur Toilette – nennt sich Sanifair, ist aber saniunfair. Den Euro-Wertbon schmeißt man angesichts der Preise im Shop am besten gleich weg. Und auch die Toilettenkabinen sind nicht immer so sauber, wie man es als Gegenleistung für einen Ein-Euro-SanifairBon erwarten würde. Für das menschliche Bedürfnis zu kassieren, um die Rendite zu steigern, halten auch Politiker, Verbraucherschützer und Autoclubs für unseriös. P.S.: In den USA und Kanada ist das Kassieren von Gebühren für den WC-Besuch verboten. Und trotzdem sind die dortigen WVs blitzsauber, zu jeder Tages- und Nachtzeit. •••
••• Ladeinfrastruktur an Rastanlagen verbesserungswürdig
Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos an deutschen Autobahnen ist nach wie vor verbesserungswürdig. Das zeigt ein ADAC Test an 40 Rastanlagen entlang der wichtigsten Autobahnrouten. Während an 37 der getesteten Rastanlagen eine Ladeinfrastruktur immerhin vorhanden war, zeigen sich bei genauer Betrachtung doch erhebliche Unterschiede, die sich auf den Komfort und die Praxistauglichkeit der E-Mobilität auf Langstreckenfahrten auswirken.16 dieser 37 Anlagen, also 43 %, boten ausschließlich Ladesäulen mit unter 150 kW Ladeleistung an, mehrheitlich konnte Strom hier sogar nur mit bis 50 kW geladen werden – zu wenig, um kurze Ladezeiten zu ermöglichen. 2024 ist die Zahl jener Rastanlagen mit Schnellladesäulen mit mindestens 150 kW sowie High-Power-Charging mit über 300 kW gewachsen. Eine unangenehme Erscheinung sind immer wieder Falschparker mit ihren klimaschädlichen Verbrennerautos, die temporär zumindest einen Ladeplatz blockieren. Der ADAC bemängelt auch den fehlenden Komfort an den Ladesäulen. Überdachte Ladeplätze, die Autofahrer bei Regen schützen – Standard beim Tanken – sind selten, nur ganz wenige Rastanlagen bieten diese Möglichkeit. Kritisch sieht der ADAC die Bezahlmöglichkeiten: An Schnellladesäulen mit einer Leistung von mehr als 150 kW müssen E-Autofahrer für die Ad-hoc Bezahlung weiterhin einen QR-Code benutzen, um dann mit Debit- oder Kreditkarte zahlen zu können. Dies birgt Sicherheitsrisiken, da Kriminelle mit gefälschten QR-Codes durch sogenanntes „Quishing“ an Kreditkartendaten gelangen können. Nur vereinzelt fanden die Tester bereits Kartenterminals an den Ladesäulen. Der ADAC fordert an Rastanlagen Ladeparks mit mindestens zehn Ladepunkten und einer Ladeleistung von mindestens 150 kW, deren Anzahl mit steigendem Bedarf erweiterbar sein sollten. Zudem sollten Ladeplätze überdacht und ausreichend beschildert sein.



Seit Kurzem können M&M-Mtglieder neben Meilen auch „Points“ für ihren Vielfliegerstatus auf Flügen von ITA Airways sammeln. Durch das Erfliegen von „Points”, “Qualifying Points” und – in der BC – „HON Circle Points” haben Frequent Flyer mehr Möglichkeiten, einen Vielfliegerstatus der LH-Group zu erhalten oder zu erreichen.
Iberia

ITA Airways

JetBlue


Lufthansa


Qantas
Skyteam
Angesichts des gemeinsamen Eigentümers IAG ist es kaum eine Überraschung, dass Iberia es British Airways nachmacht und ihr Programm nicht nur in Club Iberia Plus umbenannt, sondern die Statusqualifikation auch auf eine Umsatzbasis umgestellt hat. Überraschend ist jedoch, dass die notwendigen Umsatzwerte Iberias unter jenen des BA-Clubs liegen, aber man kann auch bis zu 30 % der Statuspunkte mit Non-Air Partnern sammeln. Auch die Flüge mit oneworld-Partnern werden stärker gewichtet. So kann man den Gold-Status z.B. mit nur zwei Hin- und Rückflügen mit Qatar Airways in der BC von West-Europa nach Fernost erhalten. Noch drastischer fällt der Vergleich für BA-Flüge aus: Fliegt man zu einem flexiblen Economy-Tarif für 400 € (vor Steuern und Gebühren) hin und zurück innerhalb Europas, benötigt man im BA-Programm jetzt 23 Hinund Rückflüge pro Jahr um die Silber-Stufe zu erreichen. Um die äquivalente Gold-Stufe im revidierten Iberia-Programm zu erhalten, wird man dort hingegen nur 14 Flüge benötigen.
Die Anzahl der „Points“ wird auf Flügen von ITA-Airways nach derselben Systematik vergeben wie bei allen anderen Lufthansa Group Airlines und den mitherausgebenden M&M-Airline-Partnern. M&M-Teilnehmende haben bereits die Möglichkeit, Meilen auf ITA-Flügen zu sammeln und einzulösen. Zudem können Mitglieder von Volare, dem ITA-Vielfliegerprogramm ebenfalls „Volare-Points“ bei Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines sammeln und einlösen. Volare wird wohl Ende 2025 beendet.
Sollte sich die Gerüchte bewahrheiten, dsss United an einer Übernahme der JetBlue interessiert sei, düfte JetBlue ein Kandidat für die Star Alliance werden. Inzwischen hat JetBlue eine gegenseitige Vielfliegerpartnerschaft mit Star-Partner TAP Portugal gestartet. TrueBlue-Mitglieder können somit bereits auf drei Star-Gesellschaften Punkte sammeln, zusätzlich zu TAP mit Singapores Airlines und South African. Weitere relevante Airline-Partner sind Qatar Airways, Etihad, Icelandair und Hawaiian Airlines.
Ab 03. Juni 2025 wird M&M die Preisgestaltung für Prämienflüge bei Lufthansa, Austrian und Swiss auf eine vollständig dynamische Preisgestaltung umstellen. Es wird eine massiven Erhöhung der Prämienpreise geben. Die Preise für Partnerfluggesellschaften werden weiterhin auf einer veröffentlichten Prämientabelle basieren und steigen insbesondere in der BC und First, aber größtenteils auf moderatem Niveau. Brussels Airlines, Eurowings, Discover und ITA Airways werden bei einer festen Preisgestaltung bleiben.
Der Carrier aus Down Under wird die Prämienhöhen im Frequent Flyer um rund 10 - 20 % erhöhen. Dies stellt die erste Prämienerhöhung seit 2019 dar, tritt aber erst zum 05. August in Kraft, was noch entsprechend Zeit lässt, Prämien noch zu den alten Preisen zu nutzen.
SkyTeam-Statuskunden können ab sofort die wichtigsten Lounges auch den Partner-Mitglieder nutzen. Zwei wichtige Ausnahmen: Flughafen-Lounges, die nicht von den Airines selbst betrieben werden. Hier wird es mehr oder weniger ein Glücksfall bleiben, ob man hereingelassen wird. Wenig überraschend bleibt auch die zweite Ausnahme, die Delta-Lounges. Hier wird man nach wie vor nur zugelassen, wenn man einen internationalen Anschlussflug mit einer SkyTeamGesellschaft hat, vor oder nach dem betreffenden Inlandsflug.

Die britische Regierung liebäugelt mit der Vielfliegersteuer.

Vielflieger wären eine wichtige Stütze im Kampf gegen den Klimawandel, so der Vorschlag des britischen Climate Change Committees (CCC) zur Einführung einer „Mehr fliegen, mehr bezahlen“-Abgabe. Auch die Klimakonferenz COP29 der Vereinten Nationen schlägt eine solche Abgabe vor. „Diese Steuer steigt mit der Anzahl der Flüge einer Person“, erklärt das CCC-Gremium, das die britische Regierung bei der Emissionsreduzierung berät und den Weg zu einem Netto-Null-Luftverkehr bis 2050 vorgibt.
In seinem siebten CO2-Budget, das im Februar veröffentlicht wurde, argumentiert der CCC, dass Fliegen eine Wahl und keine Notwendigkeit sei. Daher sollten sich „die Kosten der Dekarbonisierung des Luftverkehrs in den Flugkosten widerspiegeln“. Während der erste Flug des Jahres von der Abgabe ausgenommen wäre, würden nachfolgende Flugreisen von Business Travellern mit einer Steuer belegt, die auf den CO2-Emissionen jedes Fluges basiert. Die vorgeschlagene Abgabe soll schrittweise und mit jedem Flug steigen. Eine von Forschern der London School of Economics erstellte Modellierung lässt darauf schließen, dass die zweite Reise innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten – wobei jede Reise als Hin- und Rückflug gezählt wird – mit 50 Pfund pro Tonne ausgestoßenem CO2 verbunden sein könnte.
Ein Hin- und Rückflug London-Paris in der Economy Class mit einem Airbus A320 verursacht laut dem CO2-Flugrechner von MyClimate.org 0,289 Tonnen CO2. Bei einem zweiten Flug im Jahr auf dieser Verbindung käme eine zusätzliche Gebühr von 14,40 £ hinzu –kein großer Aufschlag gegenüber einem durch-
schnittlichen British-Airways-Tarif von 440 £. Aber je mehr und je weiter vielfliegende Geschäftsreisende fliegen, desto höher steigt diese „Kohlenstoffsteuer“.
Die LSE-Modellierung geht davon aus, dass sich die Abgabe beim dritten Flug des Jahres auf 100 £ pro Tonne verdoppelt, beim vierten Flug auf 150 £ pro Tonne und so weiter.
Nicht nur britische Vielflieger unternehmen sechs bis zehn Flüge pro Jahr und mehr. Bei der vorgeschlagenen Regelung mit einer schrittweisen Anhebung der Vielfliegersteuer kämen bei einem vierten Flug im Jahr bei einem Business-Class-Ticket London-New York 1.320 £ hinzu (für 8,8 Tonnen CO2). Bei einem Flug nach Singapur mit 14,1 Tonnen CO2 würde die Abgabe für die vierte Flugreise
Passagiere sind im Jahr 2024 an den deutschen Flughäfen gestartet oder gelandet.
den Preis für einen Hin- und Rückflug in der Business Class um 2.115 Pfund erhöhen.
Die britische Regierung ist nicht verpflichtet, den Empfehlungen des Climate Change Committee zu folgen. Ihre allgemeinen Empfehlungen stehen jedoch im Einklang mit den Forderungen anderer Organisationen nach einer „Ökosteuer“ für Flugreisen. Die britische Ökosteuer ginge weit über die aktuellen „Ökosteuer“-Zuschläge hinaus, die beispielsweise bei Lufthansa und Swiss zwischen 1 und 72 Euro liegen und sowohl von der Flugdauer als auch von der Reiseklasse abhängen.
COP29 schlägt Vielfliegersteuer vor. Auf der Klimakonferenz COP29 der Vereinten Nationen im November 2024 wurde eine Vielfliegersteuer als eine der notwendigen Maßnahmen vorgeschlagen, um Gelder aus Industrieländern zu sammeln und Entwicklungsländer beim Übergang zu saubereren Volkswirtschaften zu unterstützen. Die von UN-Generalsekretär António Guterres unterstützte Taskforce „Global Solidarity Levies“ plädiert für eine „Besteuerung emissionsintensiver Sektoren, die das Potenzial hat, erhebli-
„Brauchen wir eine Vielflieger-Steuer um das Klima zu retten? Ich meine Nein. Es gibt andere Stellhebel, z.B. den innerdeutschen Flugverkehr komplett zu streichen oder eine rigorose Beschneidung des aus den Fugen geratenen Lkw-Wahnsinns.“
Gernot Zielonka I CEO zic

che Einnahmen zu generieren, die zur Schließung der Klimafinanzierungslücke verwendet werden könnten“.
Zu den im COP29-Zwischenbericht der Gruppe genannten Steuern gehören eben auch eine Ticketabgabe, „die für Luxustickets (Business, First, Privat) zu einem höheren Satz obligatorisch wäre“, sowie eine „Vielfliegerabgabe, deren Satz progressiv mit der Anzahl der Flüge eines Passagiers pro Jahr ansteigt“. Dem Vorschlag zufolge würden Vielflieger für ihren zweiten Flug innerhalb eines Jahres zusätzlich zu ihrem Flugpreis 9 US-Dollar zahlen müssen.
Europäische Vielfliegersteuer? Die Umweltorganisationen Stay Grounded und die New Economics Foundation (NEF) haben die Idee einer europäischen Vielfliegersteuer ins Spiel gebracht, um Geld zu sammeln und gleichzeitig unnötige Flüge zu vermeiden. Die Frequentflyer-Abgabe soll folgendermaßen aussehen:
• Für die ersten beiden Flüge eines Jahres soll ein Zuschlag von 50 Euro für EconomyClass-Passagiere auf Mittelstreckenflügen erhoben werden.
• Für Reisende der Business- und First-Class sowie auf Langstreckenflügen soll dieser Zuschlag auf 100 Euro steigen.
• Für den dritten und vierten Flug soll eine Abgabe von 50 Euro auf jedes Flugticket erhoben werden – mit einem zusätzlichen Zuschlag von 50 Euro für Mittelstreckenflüge, der sich für Reisende der First-Class, Business-Class und auf Langstreckenflügen auf 100 Euro verdoppeln soll.
• Für den fünften und sechsten Flug soll die Abgabe erneut auf einen Basisbetrag von 100 Euro pro Mittelstreckenflug zuzüglich der zusätzlichen Zuschläge steigen.
• Beim siebten und achten Flug erreichte die Vielfliegerabgabe 200 Euro und sollze für jeden weiteren Flug auf 400 Euro steigen . Das träfe Firmenrisende hart.
Faire Maßnahme. Damit soll sichergestellt werden, dass die „übermäßige Umweltverschmutzung“ durch „wohlhabendere Vielflieger“ (Unternehmen) bekämpft werden soll.
„Egal, ob Sie zum ersten Mal seit Jahren wieder ihre Familie besuchen oder zum zehnten
Mal im Jahr zu ihrem Luxushaus an der Küste fliegen: Sie zahlen für jeden Flug die gleiche Abgabe“, erklärt Magdalena Heuwieser von Stay Grounded.
„Eine Vielfliegerabgabe wäre eine faire Maßnahme im Luftverkehr, die die Zahl der Flüge für wohlhabende Passagiere reduzieren und gleichzeitig die Einnahmen steigern würde –u.a. für den Ausbau und die Bereitstellung erschwinglicher Bahn- und öffentlicher Verkehrsmittel.“ •••
••• Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Deutschland
Die Spitzenvertreter der deutschen Luftverkehrswirtschaft haben sechs Kernforderungen an die neue Bundesregierung formuliert. Ziel ist es, die massiven Wettbewerbsverzerrungen zulasten der heimischen Luftverkehrswirtschaft zu beseitigen, attraktive Standortbedingungen für den Luftverkehr zu schaffen und die Anbindung der deutschen Wirtschaft an ihre internationalen Märkte zu stärken. Wettbewerbsverzerrungen, wie hohe staatliche Standortkosten, einseitige EU-Regulierungen sowie höhere Kosten im EU-AsienVerkehr aufgrund der Sperrung des russischen Luftraums, belasten den Luftverkehr hierzulande enorm.
Rund 245 Mio. Passagiere sind im Jahr 2024 an den deutschen Flughäfen gestartet oder gelandet, davon über 95 % auf internationalen Reisen. Die Entwicklung des Luftverkehrsstandortes Deutschland ist spätestens seit den Jahren der Corona-Krise besorgniserregend. Laut BDL fallen die deutschen Flughäfen immer weiter hinter andere europäische Standorte zurück: Im Sommer 2025 erreicht das Angebot in Deutschland 91 % des Niveaus von 2019, während es im übrigen Europa bereits auf 109 % des VorCorona-Niveaus steigt. Die überhöhten
staatlichen Standortkosten und nicht mehr wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen gefährden zunehmend die Anbindung der deutschen Wirtschaft an ihre internationalen Märkte. Auf dem Spiel stehen nicht nur Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der deutschen Luftverkehrswirtschaft, sondern auch in vielen anderen Bereichen der exportorientierten deutschen Industrie. Ohne politische Gegenmaßnahmen drohen Unternehmen über kurz oder lang in andere Länder mit attraktiveren Standortbedingungen abzuwandern.
• U.a. muss die Luftverkehrsteuer als wesentlicher Grund für die hohen Kosten abgeschafft werden.
• Die Einführung einer Frequent-Flyer-Steuer darf nicht geschehen.
• Die neue Bundesregierung soll in Brüssel verstärkt darauf hinwirken, Wettbewerbsverzerrungen (Beimischungsquote und Emissionshandel) zulasten des Luftverkehrs in Europa abzubauen, z.B. durch eine endzielbezogene Klimaabgabe.
• Zudem sollte die nationale Quote für Power-to-Liquid-Kraftstoffe (PtL/E-Kerosin) ab 2026 gestrichen werden.

Der Klimawandel bedeutet ain deutliches Aufbruchsignal, die Unternehmensmobilität umweltfreundlicher zu gestalten.
Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute weit mehr als ein Trend – sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Besonders in der Unternehmensmobilität bietet sie enormes Potenzial, um nicht nur den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern auch Effizienz und Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Gleichzeitig erwarten Kunden, Partner und Investoren zunehmend nachhaltige Lösungen. Doch wie kann eine nachhaltige Mobilitätsstrategie intelligent und wirkungsvoll umgesetzt werden?
Den CO2-Fußabdruck als strategischen Kompass nutzen – Der erste Schritt auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität ist die genaue Analyse des aktuellen CO2-Fußabdrucks. Unternehmen, die ihre Emissionen messen und transparent kommunizieren, können gezielt Schritte einleiten, um ihren Impact zu minimieren. Digitale Tools helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Nachhaltigkeitsziele messbar zu machen. Eine präzise Datenerhebung ist zudem essenziell, um die Effektivität von Maßnahmen kontinuierlich zu bewerten und anzupassen.
Drei zentrale Hebel für ein zukunftsweisendes Travel Management
• Reisevermeidung neu denken: Die digitale Transformation bietet zahlreiche Möglichkeiten, physische Meetings durch innovative virtuelle Kollaborationsformate zu ersetzen. Unternehmen, die konsequent auf hybride
Arbeitsmodelle setzen, profitieren von erhöhter Effizienz, geringeren Reisekosten und einer spürbaren Reduktion des CO2Ausstoßes. Virtuelle Meetings sind nicht nur ressourcenschonend, sondern steigern auch die Produktivität, da lange Reisezeiten entfallen.
• Mobilität mit Bedacht planen: Wenn Reisen unvermeidbar sind, sollten sie so nachhaltig wie möglich gestaltet werden. Dazu zählen eine intelligente Routenplanung, die vorrangige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und die Zusammenarbeit mit Partnern, die eigene Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Der vermehrte Einsatz von Bahnreisen statt Kurzstreckenflügen kann nachweislich den ökologischen Fußabdruck reduzieren.
• Kompensation als integraler Bestandteil: Unternehmen können ihren CO2-Ausstoß durch Investitionen in zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgleichen. Entscheidend ist
hierbei die Auswahl von Projekten mit nachweisbarer, langfristiger Wirkung. Integrierte Lösungen, bei denen der CO2-Ausgleich direkt in Buchungssysteme für Reisen eingebettet ist, erleichtern die Umsetzung im Alltag.
Stagnierende CO2-Effizienz. Bei den deutschen Airlines Lufthansa, Condor und TUIfly stagniert die CO2-Effizienz gegenüber der VorPandemie; die Lufthansa konnte sich zwar leicht verbessern, aber weniger als der Durchschnitt der globalen Branche. Damit fallen die deutschen Fluggesellschaften im aktuellen Ranking zurück (Lufthansa von Platz 66 auf Platz 97, Klasse F; Condor von Platz 9 auf Platz 36, Klasse D; TUIfly von Platz 4 auf Platz 14, Klasse C). Unter den großen Linienfluggesellschaften führt international die chilenisch-brasilianische LATAM das Ranking mit moderner Flotte und hohen Auslastungen an

Bei Luftfahrt und Verbrennerautos sind die CO2-Stellhebel am wichtigsten..
(Platz 4, 82 von 100 möglichen Effizienzpunkten). Innerhalb der EU liegen die spanischen Iberia (Platz 12, 78 Effizienzpunkte) und Air Europa (Platz 18, 76 Effizienzpunkte) vorne. Von den Top 50 CO2-effizientesten Airlines der Welt kamen 12 aus Europa und 7 aus China.
CO2-armes Kerosin spielt noch kaum eine Rolle. Der Airline Index berücksichtigt auch die Nutzung von alternativen Flugkerosin, das z.B. aus gebrauchten Speisefetten hergestellt wird und deutlich niedrige CO2-Emissionen hat als fossil basiertes Kerosin. Allerdings sind die Mengen bisher gering und erreichen maximal etwa 1 % des gesamten Kerosinverbrauchs einer Airline. Nur eine Airline konnte sich durch die Nutzung von Bio-Kerosin im Ranking um zwei Plätze verbessern. Das CORSIA Abkommen der internationalen zivilen Luftfahrtorganisation ICAO erlaubt, dass Fluggesellschaften zukünftig ihre wachsenden CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte außerhalb der Luftverkehrsbranche kompensieren können. Offen bleibt, wie die Branche selbst ihre CO2-Emissionen so senkt, dass sie im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen nach 2050 CO2-frei wird.
Billigflieger werden im AAI in einer eigenen Klasse gewertet. Der Grund: Die weltweiten Lowcost-Anbieter vom Schlage Ryanair, Easyjet, Wizzair, Southwest & Co. profitieren u.a. häufig von Subventionen der Staaten einerseits und der Flughäfen andererseits und setzen diese dann über künstlich niedrige Tik-
ketpreise in Flugkilometer und damit CO2Emissionen um, die sonst nicht entstanden wären. Vier Billigflieger finden sich in der Effizienzklasse B. Wie die übrigen Airlines landen die meisten in den Effizienzklassen C und D.
„Der Luftverkehr ist fast wieder auf das VorPandemie-Niveau angewachsen“ sagt Dietrich Brockhagen, Geschäftsführer von atmosfair. „Das gilt leider nicht für die Klimabemühungen. Bei diesen haben die Airlines selbst gegen-
1 %
Anteil hat alternatives Flugkerosin und spielt daher kaum eine Rolle.
über der schwachen Dekade vor der Pandemie weiter nachgelassen und verfehlen jetzt auch noch das ohnehin ungenügende ICAO-Ziel.“ Die Luftverkehrswirtschaft hat 2023 weltweit fast genau wieder die Auslastungen von 2019 erreicht. Aber Flottenmodernisierung und die Optimierung der Flugzeugtypen auf die Strekkenprofile haben 2024 nachgelassen. „Die Klimawende im Flugverkehr lässt auf sich warten“ so Brockhagen. „Unsere Zahlen bei der CO2-Effizienz und die Prognosen für die notwendigen synthetischen und CO2-neutralen Treibstoffe zeigen, dass der Sektor beim Klimaschutz einfach zu langsam ist.“
„Nachhaltige Mobilität sollte Teil einer jeden Unternehmenskultur sein. Sie kann weitreichend positive Effekte auslösen, z.B. höhere Mitarbeiterzufriedenheit und ein grundsätzlich besseres Image.“
Corinna Döpkens I CD Travelmanagement
Best Practices: Nachhaltige Mobilität im Unternehmenseinsatz
Die Förderung nachhaltiger Mobilität im Unternehmenskontext gewinnt zunehmend an Bedeutung. Im Folgenden einige inspirierende Beispiele:
SAP führt ein Mobilitätsbudget ein, das es den Mitarbeitenden ermöglicht, nachhaltige Verkehrsmittel wie Fahrräder oder ÖPNV zu nutzen.
Siemens arbeitet an klimaneutralem Fliegen und setzt Maßnahmen ein, um Emissionen bei Flugreisen zu senken.
Barmer motiviert ihre Mitarbeitenden mit einer „Rad Challenge“, um Fahrten mit dem Auto durch das Fahrrad zu ersetzen, und bietet JobRad-Leasing an.
EnBW fördert einen klimaneutralen Fuhrpark, indem sie nur noch vollelektrische oder hybride Dienstwagen zulassen.
VAUDE unterstützt seine Mitarbeitenden mit einem umfassenden Mobilitätskonzept, das unter anderem das Radfahren und die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln fördert. Der „Mobilitätslotto“-Anreiz motiviert umweltfreundlich zur Arbeit zu pendeln.
TUI Cruises fördert nachhaltige Mobilität durch flexible Arbeitszeiten, Home-OfficeMöglichkeiten und Fahrgemeinschaften. Zudem bieten sie das HVV-Profiticket und kostenlose Fahrradchecks an.
Diese Beispiele verdeutlichen, wie vielfältig und effektiv nachhaltige Mobilitätsmaßnahmen umgesetzt werden können – mit

Wir haben es in der Hand: Den Klimawandel können wir nicht mehr stoppen, aber hinauszögern.
klaren Vorteilen für Umwelt, Mitarbeitende und Unternehmen.
Teil der Unternehmenskultur. Eine nachhaltige Mobilitätsstrategie kann weitreichende positive Effekte auf die Unternehmenskultur haben. Eine Studie der Deutschen Bahn und Great Place to Work belegt, dass Unternehmen mit klaren Mobilitätskonzepten eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und stärkere Identifikation mit den Unternehmenswerten erzielen. Nachhaltige Mobilität wird so zu einem Schlüsselfaktor für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Unternehmenskultur.
Es gibt kein Standardrezept. Jedes Unternehmen muss individuelle Maßnahmen entwickeln. Die folgenden Punkte bieten praxisnahe Orientierung für eine langfristige Strategie mit ökologischen und ökonomischen Vorteilen:
• Bestandsaufnahme und Datenerhebung: Eine fundierte Analyse der aktuellen Mobilitätsstrukturen und Emissionen ist essenzi-
ell, um gezielte Maßnahmen abzuleiten.
• Festlegung von Nachhaltigkeitszielen: Unternehmen sollten konkrete und messbare Ziele für ihre Mobilitätsstrategie definieren, die sowohl ökonomische als auch ökologische Faktoren berücksichtigen.
• Definition konkreter Maßnahmen zur Emissionsreduktion: Hierzu zählen der Ausbau von Homeoffice-Angeboten, die Förderung von Bahnreisen und die Umstellung der Fahrzeugflotte auf alternative Antriebe.
• Einführung flexibler Mobilitätsbudgets: Statt auf Firmenwagen zu setzen, können Unternehmen Mobilitätsbudgets einführen, die eine nachhaltigere und individuellere Nutzung ermöglichen.
• Förderung alternativer Transportmöglichkeiten: Kooperationen mit Anbietern von CarSharing, Bike-Sharing und ÖPNV-Tickets machen umweltfreundliche Alternativen leicht zugänglich.

• Integration von CO2-Kompensation: Unvermeidbare Emissionen sollten durch Investitionen in hochwertige Klimaschutzprojekte Nachhaltige Unternehmensmobilität ist ein entscheidender Hebel für den Wandel hin zu einer ressourcenschonenden und zukunftsfähigen Wirtschaft. Durch eine intelligente Kombination aus Reisevermeidung, durchdachter Planung und CO2Kompensation können Unternehmen ihre Umweltziele erreichen – und gleichzeitig eine moderne, verantwortungsbewusste Unternehmenskultur fördern. Indem Arbeitgeber innovative Mobilitätsmodelle umsetzen und ihre Mitarbeitenden aktiv einbinden, entsteht ein nachhaltiger Wandel, der langfristig sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bringt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Mobilität neu zu denken – für eine Zukunft, in der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen. ••• Jetzt Mobilität neu denken kompensiert werden.
• Regelmäßige Erfolgsmessung und Anpassung: Kontinuierliches Monitoring der Maßnahmen sichert langfristigen Erfolg und ermöglicht eine Strategieanpassung.
• Kommunikation der Maßnahmen an Mitarbeitende und Stakeholder: Eine klare Kommunikation fördert die Akzeptanz und das Engagement für nachhaltige Mobilität.
Nachhaltigkeit als Teamprojekt. Erfolgreiche Mobilitätsstrategien erfordern Mitwirkung auf allen Ebenen. Unternehmen sollten Schulungen, Workshops und eine durchdachte Kommunikationsstrategie etablieren, um Akzeptanz und Engagement zu fördern. Durch gezielte Anreizsysteme – wie Prämien für CO2sparende Mobilitätsentscheidungen oder interne Nachhaltigkeitswettbewerbe – lässt sich der Wandel aktiv gestalten. •••


Eleganz auf höchstem Niveau: So lässt sich die neue La Premiere First Class von Air France wohl am treffendsten beschreiben. Die Nobelklasse greift das dezente Design der aktuellen und überaus schicken
777 La Premiere Suiten sorgfältig auf.
Mit über drei Metern Länge ist jede der vier First-Class-Suiten die längste am Himmel und verfügt über fünf Fenster der Boeing 777 (im Vergleich zu vier Fenstern in den heutigen Suiten). Dadurch bieten die neuen Air France La Premiere Suiten eine großzügige Grundfläche von 3,5 m2–25 % mehr als die aktuellen Suiten. Die neuen 777 La Premiere Suiten wurden in Zusammenarbeit mit dem französischen Unternehmen Stelia Aerospace entwikkelt und verfügen über einen separaten Sessel und ein Bett – genauer gesagt über eine Chaiselongue, die sich zu einem 2 m langen und 75 cm breiten Bett umbauen lässt.
Intelligenter Sitz. Air France lobt dies als „einzigartiges und vollständig anpassbares Design“, obwohl es in die gleiche Richtung geht wie die First-Class-Suiten im A380 von Etihad Airways und Singapore Airlines sowie der kommenden First Class im A350 von Qantas. Der Sitz passt sich den verschiedenen Flugphasen an: Start, Landung, Essen oder Entspannung. Die Chaiselongue bietet den perfekten Platz zum Entspannen im Sitzen –ideal zum Lesen oder Filmeschauen. Um das großzügige Raumgefühl zu unterstreichen, hat Air France die Gepäckfächer in der
First Class entfernt. Stattdessen bietet eine große Schublade Platz für bis zu zwei Handgepäckstücke. Unter der Chaiselongue befindet sich eine zweite Schublade für ihre Schuhe sowie ein eigener Kleiderschrank. Da Sessel und Chaiselongue in entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet sind, verfügt jede Suite über zwei 32-Zoll-4K-Videobildschirme – einen an jeder Wand – mit BluetoothAudio-Streaming auf die eigenen Kopfhörer oder Ohrhörer des Passagiers, falls dieser die mitgelieferten geräuschunterdrückenden Kopfhörer nicht anschließen möchte. Selbstverständlich gibt es Steckdosen für AC, USB-A und USB-C sowie kabelloses Laden und kostenloses WLAN. Ein kabelloses Touchscreen-Tablet ermöglicht die vollständige Steuerung der Videobildschirme, Sitzpositionen, der Suite-Beleuchtung und des Hoch- und
25 %
Herunterlassens der lichtdurchlässigen oder verdunkelnden Jalousien. Charakteristische Elemente bleiben jedoch erhalten, wie beispielsweise schalldämmende Vorhänge anstelle von Schiebetüren und die Wand- und Stehleuchten, die mit dem geflügelten Seepferdchen von Air France verziert sind.
Höchste Form des Reisens. Die Suiten sind aus hochwertigen Materialien wie Vollnarbenleder und flauschiger Wolle gefertigt und in einer harmonischen Farbpalette gehalten, die von Grautönen, champagnerfarbenen MetallicAkzenten und roten Akzenten dominiert wird. „Die Einführung unseres neuen La PremiereErlebnisses ist ein wichtiger Schritt in unserer strategischen Roadmap“, so Benjamin Smith, Chef der Air France-KLM Group. „Mit einem neuen privaten Bodenerlebnis am Flughafen Paris-Charles de Gaulle und einer komplett neu gestalteten, größeren La Premiere-Suite an Bord bietet dieses neue Erlebnis wahrlich die höchste Form des Reisens.“
Air France wird ihre neue Boeing 777-300ER La Premiere First Class im Frühjahr zwischen Paris und New York einführen. Weitere Ziele, darunter Los Angeles, Singapur und TokioHaneda, folgen ab Mitte 2025. •••

Komplett neugestalteter Bistrowagen.

In Frankreich nutzen Geschäftsreisende überwiegend die schnellen TGV anstelle des Flugzeugs. Denn die Hochgeschwindigkeitszüge sind i.d.R. schneller und komfortabler zwischen den Business-Zentren unterwegs. Auch in den Relationen Paris-London, Patis-Brüssel oder Paris-Köln (-Frankfurt) ist der Zug das bevorzugte
Verkehrsmittel. Nun hat die französische Bahngesellschaft SNCF ihren TGV Generation IV vorgestellt, den TGV inOUI. In den Plandienst gehen die Avelia Horizon in der zweiten Jahreshälfte 2025.
Mit der Einführung der neuen Superzüge im zweiten Quartal 2025 soll dem Bahnunternehmen zufolge eine neue Ära des Reisens beginnen, die Komfort, Innovation und Umweltfreundlichkeit vereint und ein „neues Reiseerlebnis in Frankreich und darüber hinaus“ bietet. Insgesamt sind 115 Einheiten bestellt. Die 350 km/h schnellen Hochgeschwindigkeitszüge basieren auf der von Alstom entwickelten Avelia-Horizon-Plattform. Der Name „TGV M“ wurde zugunsten der Marke „TGV inOui“ aufgegeben. Im Vergleich zum TGV Duplex sind die neuen Doppelstock-Garnituren sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb günstiger. Die SNCF setzt bereit seit vielen Jahren auf das Erfolgsmodell TGV Duplex, um möglichst viele Fahrgäste pro Zug unterbringen zu können. Mit diesen Zügen werden auch Frankfurt, München und Stuttgart erreicht. Allerdings sind Alstoms bisherige Doppelstockzüge nicht gerade günstig in der Anschaffung. Auch die Energie- und Wartungskosten pro Sitzplatz sind für heutige Verhältnisse zu teuer geworden – schließlich müssen die Superzüge der
SNCF mit den „Billig“-Airlinern und günstigen Fernbusunternehen konkurrieren.
SNCF bestellt 115 TGV inOui bei Alstom. Seit einigen Jahren bildet der Markenname „Avelia“ das Dach für die verschiedenen Hochgeschwindigkeitszug-Produkte von Alstom. Im Juli 2018 stand das gemeinsam erarbeitete Konzept, und seitens der SNCF wurde eine Bestellung von 15 Avelia-Horizon-Zügen ausgelöst. Technisch sehr ähnliche Züge fahren inzwischen auch auf dem Ostkorridor der USA zwischen Boston-New York und der USHauptstadt Washington D.C.. Der neue TGV inOui war ursprünglich als „TGV M“ bekannt. Das M steht für „Modula-
32 %
weiniger CO2-Emisison verursacht der TGV M.
rité, modernité et maîtrise“ (Modularität, Modernität und Kontrolle)“ – so beschreibt das Bahnunternehmen SNCF Voyageurs die wesentlichen Merkmale. Tatsächlich ist der Hochgeschwindigkeitszug sehr modular aufgebaut und kann äußerst flexibel auf Veränderungen des Marktes angepasst werden. Wahlweise können 7, 8 oder 9 Mittelwagen eingereiht werden. Die Sitzplätze sind variabel anpassbar. Schnell lässt sich die erste Klasse in eine zweite Klasse umkonfigurieren oder Abstellbereiche für Rollstühle, Gepäck (20 % mehr Anlagefläch für Reisekoffer) und Fahrräder schaffen. Bis zu 740 Sitzplätze lassen sich in einem TGV M unterbringen; ein TGV Duplex bietet derzeit maximal 600 Reisenden einen Sitzplatz.
Umweltfreundlicher und komfortabler. Die neue Gestaltung der kürzeren Triebköpfe und Verbesserungen bei der Motorisierung reduzieren den Energieverbrauch um 20 %. Alstom gibt an, dass der TGV M bis zu 32 % weniger CO2-Emissionen verursachen wird. Außerdem seien 97 % des Zuges nach Ende seiner
„Im Bahnverkehr rüsten alle Akteure auf. Die SNCF will ihre TGV der ersten und zweiten Generation nach und nach ersetzen mit innovativen doppelstöckigen Alstom-Züge der Avelia Serie."

Lebensdauer recycelbar. LTE und WiFi sind Kernkomponenten im TGV M. Das soll für einen ungehinderten und schnellen Internetzugang während der ganzen Reise sorgen. Zudem können sich Rollstuhlfahrer und körperlich eingeschränkte Fahrgäste über eine größere Barrierefreiheit freuen.
Der neue TGV TGV inOui bietet zahlreiche Verbesserungen für Reisende aller Klassen. In der 2. Klasse profitieren Bahnreisende von höhenverstellbaren Kopfstützen, einzelnen Steckdosen, einem Mini-Tablet mit Telefonhalterung sowie einem neu positionierten E-Reader. Zusätzlich sorgen Sitze mit mehr Beinfreiheit für ein angenehmeres Reisen. In der 1. Klasse bieten umlaufende, höhenverstellbare Kopfstützen sowie eine durchgehende Armlehne an der Gangseite mehr Komfort. Ein Regal mit „geheimem Schreibtischeffekt“ optimiert den Stauraum, während die breitere Sitzfläche mehr Bewegungsfreiheit ermöglicht, erklärt SNCF. Innovativer Schaumstoff in den Sitzen sorgt zudem für besonderen Sitzkomfort.Es gibt zudem ein komplett neu gestaltetes Bistro, das sich über Etagen erstreckt und den gesamten Wagen vier einnimmt. Im unteren Abteil befindet sich ein Selbstbedienungsladen mit automatischen Bezahlstationen, der ein schnelles und unkompliziertes Einkaufen ermöglicht. Der höhere Bereich ist für den Verzehr vorgesehen und bietet 28 Sitzplätze.
Ein besonderes Augenmerk liegt in den neuen Zügen auf der Barrierefreiheit. Erstmals wurde ein TGV-Design in enger Zusammenarbeit mit Verbänden wie „APF France handicap“ entwickelt, um die Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Reisender optimal zu berücksichtigen. Ein Highlight ist die neu
%
des Zuges sind nach Ende seiner Lebensdauer recycelbar.
integrierte Hebebühne, die Rollstuhlfahrern ermöglicht, selbstständig in den Zug zu gelangen. Im Zug selbst steht ein speziell konzipiertes UFR-Abteil mit bis zu fünf behindertengerechten Plätzen zur Verfügung.
Die Bord-WCs wurden geräumiger gestaltet, um eine einfachere Nutzung – auch mit Assistenz – zu gewährleisten. Zudem wurde das Sitznummerierungs- und Informationssystem für seh- und hörbeeinträchtigte Reisende optimiert.
An Bord verspricht SNCF „optimiertes“ WLAN, das dem neusten 5G-Standentspricht und eine „reibungslose Verbindung während der gesamten Reise“ ermöglichen soll.
Zum Einsatz kommen sollen die neuen Renner zunächst auf der Süd-Ost-Achse“ Paris – Lyon sowie auf der Strecke Paris-Marseille. •••


Seit der Bahnreform ging es mit der Pünktlichkeit im Fernverkehr der DB bergab. ICE, IC & Co. waren 2024 besonders oft unpünktlich: 37,5 % der Halte wurden mit einer Verspätung von mindestens 6 Minuten erreicht. Oft war es viel schlimmer, wovon vor allem Geschäftsreisende ein Lied singen können. Grund war und ist auch weiterhin meist die veraltete Infrastruktur.
Weil innerdeutsches Fliegen unter dem Gesichtspunkt des Umwelt- und Klimaschutz' bei vielen Mobilitätsmanagern und Business Travellern zunehmend zum No Go wird, steigen hunderttausende geschäftlich Reisender auf den Zug um. Mit dessen Zuverlässigkeit war und ist es freilich nicht sehr weit her. Das soll sich laut Bahn ändern. Sie investiert zur Verbesserung ihrer Schieneninfrastruktur bis Ende 2027 ca. 53 Mrd. Euro in Netz und Bahnhöfe in ganz Deutschland. Für die Generalsanierungen sind 8 Mrd. Euro geplant. Mit 26 Mrd. Euro soll ein Großteil der Mittel insbesondere in Maßnahmen jenseits der großen Korridore fließen, also in die so genannten Altbaustrecken, wie sie seit beinahe zwei Jahrhunderten existieren. Im März machte die Bahn eine neue Rechnung auf: Eigentlich braucht sie 150 Mrd. Euro, um wieder so leistungsfähig zu werden, wie das noch in den 1950er bis 1970er Jahren der Fall war. Damals nutzen Geschäftsreisende die Fernschnellzüge (F), die Trans Europ-Expreiss (TEE), dann die
Intercities und die waren beinahe auf die Minute pünktlich. Sogar in der früheren DDR kamen die Städte-Express (vergleichbar mit den westdeutschen IC) eher selten verspätet ans Ziel.
Auch bei der klassischen Instandhaltung wird die DB ihre Anstrengungen intensivieren. So werden im Zeitraum 2025 bis 2027 rund 5 Mrd. Euro pro Jahr eingesetzt. Das entspricht fast einer Verdoppelung gegenüber dem Beginn des Jahrzehnts. 400 Bahnhöfe will die DB kundenfreundlicher und zukunftsfähig gestalten. Darüber hinaus sorgen sogenannte kleine und mittlere Maßnahmen wie etwa zusätzliche Überleitstellen für mehr Kapazität. Vor allem
8 Mrd. €
sind für die Generalsanierungen geplant.
die wichtigen Überhol- und Ausweichgleise und -strecken hatten frühere Bahnchefs in einem Fall von geistiger Umnachtung und vorgeblicher Gewinnsucht rigoros zurück- und abbauen lassen. Den Wahnsinn mit den Stilllegungsorgien und Abhängen vieler Städte und Gemeinden fröntn auch die diversen Bundesverkehrsminister.
Die irre Entwicklung muss nun für teures Geld umgekehrt werden. Die Erweiterung von Kapazitäten in Service-Einrichtungen, der Aus- und Neubau sowie die Digitalisierung sollen dazu beitragen, dass die DB binnen drei Jahren wieder ihre Leistungsfähigkeit zurückgewinnt und auf den Wachstumspfad zurückkehren kann.
Konkrete Maßnahmen bis 2027:
• Die DB setzt 13 Generalsanierungen auf den Engpass-Korridoren bis Ende 2027 um. Auch die geplanten Maßnahmen im Flächennetz sind gesichert. Dazu gehört insbesondere ein
„Die Riedbahn war die erste generalsanierte Strecke. Weitere werden folgen. Vor allem aber sorgte der Schienenersatzverkehr für viel Frust. Am Steuer vieler Busse saßen oft des Deutschen und so mancher Straßenführungen unkundige Chauffeure.”

investives Tauschprogramm von Bahnanlagen wie beispielsweise Weichen. Die Bestandserneuerung im gesamten Netz führt u.a. zum Abbau von Langsamfahrstellen.
• Folgende Strecken werden bis 2027 generalsaniert: Frankfurt–Mannheim (abgeschlossen), Emmerich–Oberhausen (2025), Hamburg–Berlin (2025/26), Hagen–Wuppertal-Köln, Nürnberg–Regensburg, Obertraubling–Passau, Troisdorf–Koblenz–Wiesbaden (alle 2026), Frankfurt–Heidelberg, Lehrte–Berlin, Bremerhaven–Bremen, Lübeck–Hamburg, Rosenheim–Salzburg sowie Fulda–Hanau (alle 2027).
• 2025 gehen 33 Maßnahmen in Betrieb, darunter Überleitstellen und zusätzliche Weichenverbindungen. Mit dem Ausbau des Netzes für lange Güterzüge (740-Meter-Netz) entstehen zusätzliche Überholmöglichkeiten. Bis Ende 2027 werden mehr als 60 % der bis 2030 insgesamt geplanten 355 kleinen und mittleren Maßnahmen zur Stärkung von Robustheit und Qualität des Schienennetzes fertig.
• Nach dem Wahnsinn mit dem Verkauf von bundesweit 81 % aller Bahnhofsgebäude (2.800 von 3.500), die beinahe ausnahmslos dem Verfall preisgegeben worden sind, modernisiert die DB jedes Jahr 100 der verbliebenen 700 Bahnhöfe und nimmt dabei viele kleine und mittlere Stationen in der Fläche in den Blick. Elemente sind neu gestaltete Wartebereiche, bessere Kundeninformation und eine barrierefreie Ausstattung. Dabei sollen auch die Vorplätze gemeinsam mit den Kommunen gestaltet werden.
• Die DB wird insbesondere in der Fläche 200 veraltete Stellwerke ablösen und sie durch moderne, schnell zur Verfügung stehende Technik ersetzen. Es soll dadurch weniger Zugausfälle geben, gleichzeitig sollen attraktive Arbeitsplätze entstehen. So wirkt die DB dem Fachkräftemangel und damit verbundenen Besetzungsproblemen entgegen.
• Die DB modernisiert sieben Serviceeinrichtungen für Eisenbahnverkehrsunternehmen bis Ende 2027 und erweitert sie.
• Die DB rüstet zentrale Knoten und Korridore mit digitaler Leit- und Sicherungstechnik aus. Interoperabilität, Qualität und Kapazität stehen dabei im Fokus.
••• Messlatte sehr hoch gelegt
Bahnbauvorhaben laufen weiter. Bei wichtigen Neu- und Ausbauvorhaben geht es voran: Alle im Bau befindlichen Projekte werden weiter gebaut; in Planung befindliche Projekte werden weiter geplant. Die Riedbahn – Wiedereröffnng am 14.12.2024: Die Deutsche Bahn (DB) hat die erste Generalsanierung im hochbelasteten Schienennetz erfolgreich abgeschlossen: Seit 14. Dezember 2024 23 Uhr fahren wieder Züge wieder über die Riedbahn zwischen Frankfurt/Main und Mannheim. DB-Vorstandschef Richard Lutz und Bundesverkehrsminister Volker Wissing sowie Vertreter der Länder Baden-
Liest sich die Bilanz der Bahn unmittelbar nach Wiederinbetriebnahme der Riedbahn überschwänglich positiv, sah es in der Realität etwas anders aus. Beinahe täglich erschwerten Signal- und Weichenstörungen den Betriebsablauf, teils mit erheblichen Verspätungen und auch mit erneuten notwendigen Umleitungen der Fernverkehrszüge. Ein Oberleitungsschaden infolge eines Kurzschlusses in der benachbarten Weichenheizung und beim ersten großen Schneefall Anfang Januar ein quasi Totalausfall sämtlicher Weichenheizungen auf der gesamten 70 km langen „Neubaustrecke“ sowie beinahe tägliche kleinere Störungen ließen viele Fragen aufkommen. Der Chef der DB InfraGo, Dr. Philipp Nagl, betonte auf einer Online-Plattform, dass man Kinderkrankheiten natürlich erwartet habe und jene systematisch abarbeite.
Unterm Strich muss man feststellen, dass die anderen Verkehrsträger es kaum besser können, eher schlechter z.B. im Straßenbau, wo vieles noch sehr viel chaotischer abläuft. Nennen wir nur den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A3 zwischen Biebelrieder Kreuz und Fürth/Bayern. Hier kommt es seit Jahren zu Teil- und Ganzsperrungen zahlreicher Staatsund Landstraßen in den Anlieger-Landkreisen und zum Verdruss vieler Autofahrer, die oft lange und dann staugeplagte Umwege zurücklegen müssen. Am Ende wurden die einzelnen BAB-Abschnitte mit zum Teil erheblichem Zeitverzug beendet.
In Bezug auf die Bausituation beim Wettbewerber Straße hat die Deutsche Bahn aber bei der Generalsanierung der Riedbahn die Messlatte sehr hoch gelegt. Das muss sie bei den weiteren Generalsanierungen bestätigen. Besser können es vermutlich nur die Chinesen. Die haben in wenigen Jahren ein Hochgeschwindigkeitsnetz von aktuell bereits 50.000 km mit tausenden von Tunnels, Brücken und neuen meist futuristischen Bahnhöfen realisiert.

In absehbarer Zeit werden wohl viele Haltestellen der Bahn so aussehen, komfortabel erreichbar und mit überdachten Bahnsteigen.
Württemberg und Hessen gaben die Strecke bei einer Abschlussveranstaltung in Gernsheim am Mittag symbolisch wieder frei. Auf der rund 70 km langen Strecke hatten rund 800 Mitarbeitende der DB und der beteiligten Bauunternehmen seit 15. Juli die störanfällige und überalterte Infrastruktur nahezu komplett erneuert. Umleiter- und Ersatzverkehre brachten die Kunden des Personen- und Güterverkehrs in den fünf Monaten weiterhin verlässlich an ihr Ziel.
Seit dem Start der Erneuerung wurden insgesamt 111 km Gleise, 152 Weichen, 619 Signale, fast 16 km Schallschutzwände, 130 km Fahrdraht, 383 Oberleitungsmasten und acht Bahnsteige erneuert. Neben neuer Stellwerkstechnik kommt künftig auch das neue europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS zum Einsatz. Die Inbetriebnahme erfolgt in Stufen. Dabei geht ETCS zunächst auf dem Streckenabschnitt von Mannheim-Waldhof nach Biblis in Betrieb. Alle weiteren Abschnitte folgen im zweiten Quartal 2025. Darüber hinaus wurden 20 Stationen entlang der „Neubaustrecke“ modernisiert und aufgewertet. Dazu gehören u.a. moderne Bahnsteigdächer, Wetterschutzhäuser, verständliche Wegeleitsysteme, die durchgängige Ausstattung mit Rampen, Beleuchtung, Treppeneinhausungen sowie die Herstellung der Barrierefreiheit. In Zusammenarbeit mit den Kommunen sorgt die DB auch für verbesserte Anschlussmobilität und attraktivere Bahnhofsvorplätze.
Zwischen dem 15. Juli und 08. Dezember legten rund 20.000 Fernverkehrszüge auf den Umleitungsstrecken über 1,5 Mio. km mit einer durchschnittlichen Pünktlichkeit von 73 % zurück. Im Regionalverkehr hat die DB einen umfangreichen Ersatzverkehr mit 150
modernen Bussen auf die Straße gebracht. Seit Mitte Juli haben diese rund 6 Mio. km zurückgelegt und täglich bis zu 16.000 Fahrgäste an ihr Ziel gebracht. Neun von zehn Reisenden sind mit dem Ersatzverkehr dem klimafreundlichen öffentlichen Nahverkehr treu geblieben und nicht auf Auto oder Motorrad umgestiegen, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. 89 % der Befragten gaben ihrer Fahrt im Ersatzbus die Schulnote eins oder zwei.
150 Busse und Fahrer. Im Ersatzverkehr an der Riedbahn hat die DB ihre Fahrgäste zum ersten Mal in Echtzeit im DB Navigator sowie auf Infostelen an den Haltestellen über die Abfahrtszeiten und Standorte der Busse informiert. Zudem konnten sich Reisende erstmals per Augmented Reality auf ihrem Smartphone virtuell zu den Haltestellen des Ersatzverkehrs leiten lassen. Auch im Recruiting ist die DB
erfolgreich neue Wege gegangen: Viele der 400 europaweit angeworbenen BusfahrerInnen fahren auch in Zukunft für die DB in Linienund Ersatzverkehren in ganz Deutschland. Alle 150 Busse sind weiter im Einsatz und sorgen für ein stabiles und verlässliches Angebot.
In dieem Jahr sind zwei Magistralen dran. Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt Riedbahn fließen in die Planung der weiteren Generalsanierungen im hochbelasteten Schienennetz ein. In diesem Jahr stehen die gebündelte Erneuerung und Modernisierung der Strecken Hamburg–Berlin und Emmerich–Oberhausen an. Damit werden eine der wichtigsten Städte-Direktverbindungen sowie eine bedeutende Magistrale für den europäischen Güterverkehr leistungsfähiger und weniger störanfällig. •••
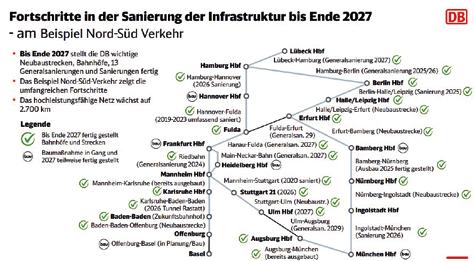


Welche Bahngesellschaften bieten den besten Service, faire Preise und echte Zuverlässigkeit – und welche enttäuschen? Eine aktuelle Studie von T&E zeigt, wo Zugreisen in Europa zum Vergnügen werden und wo etwa Geschäftsreisende frustriert zurückbleiben.
In Italien sind Geschäftsreisende mehr mit dem Zug als dem Flugzeug oder Automobil unterwegs. Das gut ausgebaut Hochgeschwindigkeitsnetz verbindet alle größeren Businessdestinationen von Turin über Mailand, Venedig, Rom und Neapel miteinander. Die komfortablen Züge und vor allem die Pünktlichkeit tragen zu einer hohen Zufriedenheit der Reisenden bei. Anders in Deutschland, wo aktuell etwa 15 % der Business Traveller ihr Ziel auf der Schiene suchen und mit dem Thema Pünktlichkeit seit Jahren hadern.
Top 3. Die italienische Trenitalia, die Schweizer SBB und das tschechische private Bahnunternehmen RegioJet belegen im Ranking der 27 Bahnbetreiber Europas den ersten Platz, so T&E (Transport and Environment). Die NichtRegierungs- und Dachorganisation von 53 nicht-staatlichen europäischen Organisationen, setzt sich seit vielen Jahren für einen nachhaltigen Verkehr ein. Sie zeigt in ihrer Studie auf, dass die Bahndienstleistungen in Europa insgesamt hinter den Erwartungen zurückbleiben, und dass hohe Ticketpreise nicht unbedingt zu einer höheren Qualität der Dienstleistungen führen. Betreiber, Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission müssen Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und das
Buchungserlebnis verbessern, sagt T&E. Das Ranking bewertet 27 Bahnbetreiber anhand von acht Kriterien, darunter Ticketpreise, Zuverlässigkeit und Annehmlichkeiten an Bord. Trenitalia, SBB und RegioJet erhalten die besten Noten. Mit einem Gesamtergebnis von 7,7 von 10 Punkten ist Trenitalia unangefochten die Nummer eins. Die italienische Bahn glänzt mit einem hervorragenden PreisLeistungs-Verhältnis und sehr guten Bewertungen in fast allen Kategorien. Die SBB und der tschechische Anbieter Regio Jet erreichen beide 7,4 Punkte. RegioJet verfügt über die günstigsten Tarife. Die SBB überzeugt durch Zuverlässigkeit (7,8) und FahrradFreundlichkeit (7,6). Zudem sind Schweizer Züge die pünktlichsten in Europa.
DB auf Platz 16. Die österreichische ÖBB (Platz 4) und die französische SNCF (Platz 5) gehören zu den besseren Anbietern. Die DB landet auf Platz 16 , Flixtrain auf Rang 20. Am unteren Ende der Rangliste zeigt sich ein erschreckendes Bild: Ouigo, die Billigtochter der französischen SNCF, landet trotz günstiger Preise auf Platz 25, da es an Sparangeboten und Zuverlässigkeit mangelt. Noch schlechter schneidet Eurostar ab. Die Bahngesellschaft, die für ihre hohen Ticketpreise bekannt ist –
doppelt so teuer wie der europäische Durchschnitt –, belegt den letzten Platz. T&E kritisiert besonders die mangelnde Zuverlässigkeit des Anbieters, der mit seinem superschnellen Zügen Paris mit London, Brüssel und Amsterdam verbindet und künftig auch nach Köln und Frankfurt/M.fehren will.
Kategorien. Für Bahnfahrgäste, die sich beruflich oder privat für Fernreisen mit dem Zug entscheiden, ist die Erschwinglichkeit von entscheidender Bedeutung. Und da schneiden DB und SNCF bei der Preisgestaltung mies ab.
• Bei den Sondertarifen (Sparpreise, Ermäßigungen...) gehen die Bestnoten an BDZ (Bulgarien), CP (Portugal), Hellenic Trains (Griechenland), SJ (Schweden) sowie an die italienischen Betreiber Italo und Trenitalia.
• Zuverlässigkeit und einfache Buchung: Die Schweizer SBB, die belgische SNCB und die spanische Renfe führen diesbezüglich, wohngegen die DB, die portugiesische CP und die schwedische Snälltåget am schlechtesten abschneiden.
• Nur 11 von 27 Betreibern erreichen Pünktlichkeitsraten von über 80 %. Was die Buchungserfahrung betrifft – liegt die SBB an der Spitze, gefolgt von DB und der österreichischen ÖBB. •••


Für Mobilitätsmanager, Dienstwagenberechtigte und weitere Mitarbeitende nimmt das Dienstrad einen immer wichtigeren Aspekt in Sachen Mobilität ein. Informieren können sich Mobilitätsverantwortliche,
Firmenchefs etc. auf der EUROBIKE 2025 (25. bis 29. Juni) auf dem Gelände der Messe Frankfurt.
Unter den Ausstellern finden sich auch Anbieter für Dienstradleasing.
Das Fahrrad ist nicht nur in den Niederlanden oder Dänemark, Europas Top-Fahrrad-Nationen, sondern auch in Deutschland ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Insbesondere Dienstfahrräder boomen. Die Bedeutung des Fahrrads als Wirtschaftsfaktor nimmt kontinuierlich zu. Mit dem „Wirtschaftsgut Fahrrad“ befasst sich ein aktueller Forschungsbericht aus dem Institut Arbeit und Technik (IAT/Westfälische Hochschule Gelsenkirchen). Das Forschungsteam attestiert der Branche gute Chancen, zu einer zukunftsfähigen und resilienten Wirtschaftsstruktur beitragen zu können: Fahrradherstellung und -handel haben sich während der Covid19-Pandemie als krisenfest erwiesen. Einige metallverarbeitende Betriebe, die für die Automobilindustrie produzieren, erweitern angesichts des von der EU festgesetzten Verbrenner-Aus bei Pkw ihre Geschäftsfelder in Richtung Fahrradindustrie. Und drittens leistet Fahrradfahren und somit auch die Fahrradwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende.
Vieles made in Germany. Die Unternehmenslandschaft der Fahrradproduktion in
Deutschland ist klein- und mittelständisch geprägt. Sie umfasst weite Bereiche der Wertschöpfungskette und reicht von Tüftlern bis zu hochwertigen Massenherstellern. Größere Hersteller sind häufig Bestandteil von international agierenden Konzernen. Außerdem gibt es viele metallverarbeitende Betriebe, die Komponenten wie Vorbauten, Felgen, Bremsscheiben und Lager herstellen, sowie spezialisierte Produzenten von Zubehör, etwa von Schlössern. Zudem gibt es elf deutsche Hersteller von Elektromotoren für E-Bikes, die einerseits von der hohen Inlandsnachfrage profitieren, andererseits sehr exportorientiert sind.
MID sieht weiteren Schwung. Die Menschen in Deutschland fahren immer mehr Wege und immer längere Strecken mit dem Fahrrad. Das geht aus der Studie „Mobilität in Deutschland (MiD)“ hervor, die das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) vorgestellt hat. Zum vierten Mal in Folge hat die Untersuchung ergeben, dass sowohl die Verkehrsbeteiligung als auch die Verkehrsmengen von Fahrrad und E-Bike zugenommen haben. Der Anteil des Fahrrades ist mit 11,2 % an den Alltagswegen
und 3,9 % der zurückgelegten Personenkilometer gewachsen. Burkhard Stork, Geschäftsführer des ZIV – Die Fahrradindustrie: „Fahrrad- und E-Bike haben ihre Bedeutung weiter ausgebaut. Weil in den letzten zwei Jahrzehnten die Verkehrsmenge – also die insgesamt zurückgelegten Personenkilometer – massiv gewachsen ist, ist das absolute Wachstum des Fahrradverkehrs noch deutlich größer als hier in den Prozentzahlen unmittelbar zu erkennen.“
Seit der letzten MiD, erhoben in 2017, hat die damalige Bundesregierung den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur mit dem Programm „Stadt und Land“ mit mehreren Mrd. Euro gefördert. Die Änderungen im Verkehrsverhalten der Menschen in der Coronaphase fallen ebenso in diese Zeit wie die Einführung des Deutschlandtickets. Burkhard Stork weiter: „Fahrrad und E-Bike werden sich weiter durchsetzen. Wenn jetzt die kommende Bundesregierung und die Politik über alle Ebenen, bis hinein in die Kommunen, den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur kräftig vorantreiben, werden wir in der MID 2028 noch viel bessere Zahlen sehen können.“
Dienstrad-Leasing – Anbieter-Vergleich
Jobrad Eurorad LeaseaBike Business Bike Bike Leasing mein-dienstrad.de www jobrad.org eurorad.de lease-a-bike.de businessbike.de bikeleasing.de mein-dienstrad.de Fahrradtypen Alle Alle Alle Alle Alle Alle Brutto-Mindestwert (€) 749
Brutto Höchstwert (€) 11.900
keiner Leasing-Laufzeit 36 Montate 36 Montate 36 Montate 36 Montate 36 Montate 36 Montate Abwicklung komplett digital komplett digital digital + automatisiert komplett digital komplett digital digital möglich Info/Kommunikation „meinJobRad-Portal“: Bestellungsverwaltung Fachhändlersuche Leasingrechner
Besonderheiten
Versicherung
Versicherungskomponenten
DemoDays, Marketingmaterial, Erster Dienstrad-Leasing-Anbieter
optional: White-LabelSolution-Microsite, Fachhändlersuche, Leasingrechner, Onlineschulungen
Premium-Versicherungspaket, Auftaktveranstaltung, Datensicherheit
„Lease a Bike Portal“: Statusübersicht, Leasingrechner, Team für persönl. Beratung
3 Premium-Schutz Pakete, Auftaktveranstaltung, Mitarbeiterevents
„Jobrad-Servicepaket“ inkludierter „PremiumRundumschutz“ inkludierter „Rundumschutz“
Vollkasko inkl. Mobilitätsgarantie, Inspektion, Full-Service
Inspektion/Verschleiß optional: 5€ Netto-Rate: jährl. Inspektion (70 € brutto), Verschleiß: 10 € netto/Monat FullService
UVV-Prüfung, Mobilitätsschutz, Verschleiß ab 1. Tag, keine Selbstbeteiligung
UVV-Prüfung nach 1. + 2. Versicherungsajahr, Verschleiß ab 1. Tag, keine Selbstbeteiligung
Vollkasko, Mobilitätsgarantie, UVV-Check
Budgets f. Verschleißreparaturen, u. UVVCheck je nach Auswahl: Basis: 75 €, Standard: 150 €, Premium: 200 €
Dienstrad-Leasing: In Deutschland gibt es eine Reihe attraktiver Anbieter.
Die Eurobike. Auch 2025 setzt die EUROBIKE neue Maßstäbe und bringt die globale Fahrradund Ecomobility-Community in Frankfurt/M. Als wichtigste Plattform der Branche vereint die EUROBIKE Innovationen, Business und Leidenschaft für nachhaltige Mobilität und Fahrrad-Lifestyle an einem Ort.
Mehr als 200 Firmen werden zum ersten Mal ihre Dienstleistungen und Produkte auf dem Gelände der Messe Frankfurt präsentieren –darunter auch zahlreiche Start-Ups. Besucher erleben die neuesten Produkte, Technologien und Konzepte führender Marken und innovativer Start-ups hautnah.
Die EUROBIKE BUSINESS DAYS an den ersten drei Messetagen sind der Hotspot für Fachbesuchende aus der Bike- und Ecomobility-Branche mit hochkarätigen Konferenzen, Panels
••• Die günstige Alternative
„BusinessBike-Portal“: Bestellungsverwaltung, Leasingrechner Portal für AG / AN / Händler, Printmedien, Leasingrechner, Fachhändlersuche
DemoDays, EchtzeitPortal, kostenloses Störfallmanagement
DemoDays, digitale Versicherungskarte, Risikoabsicherung für AG
„mein-dienstrad-de Portal“, Bestellungsverwaltung, Leasingrechner
Arbeitgeberschutz, Auftaktveranstaltung, maßgeschneidertes Dienstradmodell
inkludierte „Vollkaskoversicherung“ inkludierter „VollkaskoSchutz“ inkludiert
Vollkasko, Mobilitätsgarantie, UVV-Check
Kostenlose Durchsicht, 5 € netto/Monat für 75 € Guthaben, bei jährlicher Inspektion
und Keynotes zu den wichtigsten Trends und Innovationen. Am Festival-Wochenende wird die EUROBIKE zum größten Spielplatz für alle Bike-Fans. Man kann die neuesten Bikes auf dem gigantischen TEST TRACK ausprobieren, spektakulären Shows ansehen und in die Welt der nachhaltigen Mobilität eintauchen.
App zur Orientierung. Die EUROBIKE App ist eine smarte Orientierungshilfe vor und während der Messe. Hier findet man alle Aussteller und Produkte, den Geländeplan mit weiteren Standinfos sowie die Events und News der EUROBIKE 2025. Alle Inhalte sowie eine persönliche Merkliste (Login erforderlich), Notizen und Kontakte stehen in der App auch jederzeit offline zur Verfügung. Weitere Informationen unter: www.eurobike.com
Das Dienstrad kann bis zu 40 % günstiger sein im Vergleich zum Kauf. Durch die Gehalt-sumwandlung reduziert sich das zu versteuernde Bruttogehalt und somit auch die Sozialabgaben und Steuern. Mit dem Bike-Leasing Rechner können Mobilitätsmanager und Interessenten ganz einfach sehen, wie viel sie sparen können. Beim Dienstrad-Leasing per Gehaltsumwandlung zahlen sie weniger Steuern und Sozialversicherungsbeiträge – und damit auch weniger Beiträge in die Rentenversicherung. Allerdings sind die Einbußen für die spätere Rente minimal und in der Regel geringer als die Ersparnis durch das DienstradLeasing.
Ein Leasingvertrag für ein Dienstrad hat immer eine Laufzeit von 36 Monaten. Der Übernahmemonat ist kostenfrei, das Rad kann aber sofort nach Übernahme genutzt werden. Was passiert am Ende der Laufzeit? In der Regel übernimmt der Händler die e-Bikes nach der Laufzeit und man kann sich als Arbeitnehmer ein neues, aktuelles e-Bike aussuchen, welches auf dem neuesten Stand der Technik ist. Dem Händler steht es frei, dem Interessenten ein Übernahmeangebot zum aktuellen Marktwert zu machen. Für Arbeitnehmer kommen folgende Nachteile zusammen: Keine gesicherte Kauf-Option im Nachhinein auf das geleaste Elektrofahrrad. Sie erhalten die Möglichkeit der E-BikeÜbernahme nach Vollendung des Leasings nur, wenn ihr Arbeitsverhältnis bis zum LeasingEnde bei dem Arbeitgeber besteht.
Vollkasko, 150 € Mobilitätsgarantie, UVV-Sichtprüfung
optional: Verschleißversicherung, ab 5,90 € netto/Monat, optional: „Inspektion plus“, 4 € netto/Monat
Vollkasko, UVV-Check im 2. + 3. Jahr, 3 verschiedene Servicepakete
Paket UVV-Sichtprüfung, Paket Wartung/ Reparatur, Paket FullService
Ein Besuch der Zweirad-Leitmesse lohnt sich auch für Mobilitätsmanager. Denn in Frankfurt können sie sich auch über das Thema Dienstrad informieren. Dienstfahrrad-Leasing wird in Deutschland immer attraktiver. Laut einer Dienstrad-Markt-Studie von Deloitte bieten bereits rund 204.000 Arbeitgeber in Deutschland ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit ein Dienstrad zu leasen. 2019 waren es noch circa 45.000 Arbeitgeber. Damit steigt die Zahl der teilnehmenden Unternehmen kontinuierlich – seit 2019 im Durchschnitt jährlich um 46 %. Nicht ohne Grund: Das Bike Leasing wird von Arbeitnehmenden als attraktives Mitarbeiterbenefit wahrgenommen.
Dennoch gibt es weiterhin noch unausgeschöpftes Potenzial: Auch wenn 37 % der Arbeitnehmenden in Deutschland aktuell Zugang zu einem Dienstrad Leasing haben, gibt es zahlreiche Unternehmen, die bisher noch kein Leasing von Fahrrädern und E-Bikes anbieten.
Schon vor Jahren gab es beim einen oder anderen Dienstwagenberechtigten den Wunsch, bei seinem Arbeitgeber anstelle eines Dienstwagens ein Dienstfahrrad zu bekommen. Das war 2007 z.B. leider nicht möglich. Daraus entstand die Idee, das Dienstfahrrad als gleichwertige Alternative zum Dienstwagen in Deutschland zu etablieren und dadurch an den Erfolg des Geschäftswagens in Deutschland anzuknüpfen. 2008 wurde dann die Firma Leaserad gegründet, heute die JobRad GmbH und bedeutende Dienstrad-Leasing-


Anbieterin am Markt. Der Startschuss für den Boom der Branche war der sogenannte Dienstraderlass, bei dem es um die Gleichstellung des Dienstfahrrads zum Dienstwagen ging. Seit 2012 gilt die Ein-Prozent-Regel für Dienstwagen auch für Dienstfahrräder, seit 2020 sind Diensträder durch die 0,25 %-Regel sogar bevorteilt. Durch diesen Meilenstein konnter die Grundlage für die gesamte Dienstrad-Leasing-Branche geschaffen werden.
Der Erfolg des Fahrrad-Leasings hängt auch eng mit der Entwicklung beim Verkauf von Elektrofahrrädern zusammen: Drei von vier geleasten Diensträdern haben einen E-Antrieb. Durch das Dienstrad-Leasing wird den Angestellten Zugang zu Fahrrädern ermöglicht, die sie über den Direktkauf so wahrscheinlich nicht erwerben würden – vor allem Elektrofahrräder.
Eine weitere große Wachstumswelle kam durch den Fahrradboom während der Pandemie. Eine Studie von Deloitte belegt, dass sich der Gesamtumsatz aller Dienstrad-LeasingAnbieter seit 2019 fast verfünffacht hat. Die Absatzzahlen am Fahrradmarkt sind in diesen Jahren enorm gestiegen und haben sich jetzt auf einem sehr hohen Niveau eingependelt.
Herausforderndes Jahr 2024. Der Verband ZIV – Die Fahrradindustrie hat die Marktdaten der Fahrradbranche für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Demnach war das vergangene Jahr für die Branche herausfordernd. Dennoch zeigt sich der Verband in Anbetracht der Lage der Gesamtwirtschaft verhalten zuversichtlich:
„Die wirtschaftliche Situation unserer Branche bleibt angespannt. Und es ist noch nicht alles überstanden. Dennoch sind die Rückgänge
geringer als erwartet. Aktuell gehen wir von einer Normalisierung des Marktes ab dem Jahr 2026 aus“, so ZIV-Geschäftsführer Burkhard Stork.
2024 blieb der Anteil der in Deutschland verkauften Elektrofahrräder mit 53 % auf Vorjahresniveau. Insgesamt wurden in Deutschland 3,85 Mio. Fahrzeuge verkauft (2,05 Mio. E-Bikes und 1,8 Mio. Fahrräder), was einem Rückgang von 2,53 % gegenüber 2023 entspricht (2023: 3,95 Mio.). Relativ stabil sind 2024 die Umsätze geblieben: Auf über 6,33 Mrd. € (2023: 7,06 Mrd €.) belief sich der Gesamtumsatz bei Fahrrädern und E-Bikes, das entspricht einem Rückgang von 10,3 % zum Vorjahr, liegt aber noch deutlich über dem Umsatz des Jahres 2019 (4 Mrd. €). Über alle Verkaufskanäle hinweg – Fachhandel, Online, SB-Märkte etc. – verzeichnete die Branche 2024 einen Brutto-Durchschnittspreis von 500 € bei Fahrrädern (2023: 470 €) und 2.650 € bei E-Bikes (2023: 2.950 €).
53 %
Anteil hatten E-Bikes in 2024.
Der Bestand an klassischen Fahrrädern und E-Bike in Deutschland wuchs 2024 auf rund 89 Mio. Rückwirkend hat der ZIV, aufgrund neuer Erkenntnisse zur Verschrottung, die Bestände der vergangenen Jahre nach oben korrigiert. Für das Jahr 2024 ergibt sich nun ein Bestand von 15,7 Mio. E-Bikes. Auch interessant: Das sogenannte Bikepacking, also das Reisen mit Fahrrad und Gepäck, gewinnt für
den Tourismus in ganz Europa an Bedeutung. 2025 bleibt angespannt. Die Fahrradwirtschaft ist ein zentraler Bestandteil der Mobilitätswende, spielt eine immer größere Rolle für die deutsche Wirtschaft und trägt erheblich zur Wertschöpfung in Deutschland bei. Sie trägt nicht nur zur Reduktion von CO2Emissionen und zur Förderung der Gesundheit bei, sondern schafft auch zahlreiche Arbeitsplätze. „2024 war herausfordernd, doch langsam sehen wir Licht am Ende des Tunnels. Wir gehen von einem angespannten Jahr 2025 aus und hoffen auf ein gutes Frühjahrsgeschäft. Erste Anzeichen der Besserung zeigen sich bereits im Reparaturen- und im Zubehörgeschäft. Ab 2026 erwarten wir eine deutliche Verbesserung für unsere Branche“, resümiert Katharina Hinse. „Ein Großteil der in Deutschland verkauften Fahrzeuge wird bei uns im Land produziert. Wir erwarten, dass die künftige Bundesregierung das Potenzial unserer Zukunftsbranche als Teil der heimischen Wirtschaft entsprechend erkennt und fördert“, ergänzt ZIV-Geschäftsführer Burkhard Stork.
Gerade in den Bereichen Dienstleistungen und Digitalisierung in der Fahrradbranche herrscht großes Entwicklungspotenzial. Ziel der Leasinganbieter ist es, Radfahrenden einen Service zu bieten, wie sie ihn auch rund ums Auto gewohnt sind. Und es ist unerlässlich, dass die Leasingunternehmen sich gemeinsam mit den Verbänden für eine nachhaltige Mobilitätswende einsetzen. Der Zugang zu flexiblen, multimodalen Mobilitätslösungen und eine sichere Infrastruktur müssen gegeben sein, damit noch viel mehr Menschen aufs Rad umsteigen. •••

••• Knowhow rund ums Dienstrad-Lesing
Damit Unternehmen den passenden Anbieter für ein Dienstradoder E-Bike Leasing finden, lohnt ein Anbieter-Vergleich. DMM zeigt, worauf es bei einem Dienstrad Leasing Anbieter Vergleich 2025 ankommt.
Die wichtigsten Kriterien für einen Anbieter-Vergleich beim Dienstrad-Leasing
Kosten: Die monatlichen Kosten sind ein entscheidender Faktor bei der Auswahl des Leasing-Anbieters. Dabei sollten die Kosten des Leasingvertrags, die Kosten für Versicherung und mögliche Serviceoder Reparaturleistungen berücksichtigt werden. Die monatlichen Kosten setzen sich stets aus der Leasingrate, der Versicherungsrate und einem Servicebeitrag zusammen. Der Servicebeitrag kann je nach Anbieter-Paket variieren. Bei den Kosten sind immer beide Seiten zu betrachten: Arbeitgebende und Arbeitnehmende. Arbeitnehmenden sind die Konditionen der Finanzierung wichtig. Für Arbeitgebende sind eher potenzielle Einsparungspotenziale, unter anderem gegenüber dem Dienstwagen, relevant. Neben dem gewählten Anbieter und Fahrradmodell hängen die monatlichen Kosten auch von den individuellen Voraussetzungen des Leasingnehmers ab. Zu den Faktoren, die die tatsächliche Nettobelastung beeinflussen, zählen unter anderem: Steuerklasse, Bundesland, Kinderfreibeträge, Kirchenzugehörigkeit. Dabei wirken sich die individuellen Faktoren auf die tatsächliche Nettobelastung von Mitarbeitenden mal schwächer und mal stärker aus.
Angebote: Fahrradmarken und -modelle: Um das passende Fahrrad für die individuellen Bedürfnisse zu finden, sollten Unternehmen vor allem das Angebot an Fahrradtypen und -marken sowie das Zubehör-Angebot bei der Wahl des Fahrradleasing-Anbieters berücksichtigt. Dabei gilt es zu erwähnen, dass grundsätzlich kein Leasinganbieter an eine bestimmte Fahrradmarke gebunden ist und die Auswahl sich auch nicht nur auf E-Bikes beschränkt. Neben E-Bikes zählen hierzu beispielsweise Leasing-Modelle wie Citybikes, Trekkingbikes, Mountainbikes, Rennräder, Lastenräder, Pedelecs oder auch E-Cargo-Bikes. Die genaue Auswahl hängt jedoch von den individuellen Angeboten des jeweiligen Leasinganbieters ab. Die Dienstrad-Anbieter haben meist ein breites Sortiment an Fahrrädern und E-Bikes, aus dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmende wählen können.
Fahrradhändlernetzwerk: Neben den angebotenen Fahrradtypen und -marken ist das Händlernetzwerk der Bike-Leasing-Anbieter entscheidend. Dabei ist hervorzuheben, dass die allermeisten Fachhändler mittlerweile Partner mehrerer Leasinganbieter sind. Ein gut ausgebautes Netzwerk mit Fachhändlern in der Nähe ist wichtig, damit Mitarbeitende das Fahrrad oder E-Bike schnell und unkompliziert abholen, warten oder reparieren lassen können.
Laufzeit, Übernahme, Kündigung: Der Leasingvertrag eines Dienstfahrrads wird in der Regel auf 36 Monate festgesetzt. Aber was
passiert am Ende der Vertragslaufzeit? Nach Ablauf des Leasingvertrags haben Mitarbeitende zwei Optionen: Sie können das Fahrrad an den Leasinggeber zurückgeben oder, falls sie das Fahrrad behalten möchten, ein Kaufangebot abgeben und das Rad zum Vertragsende erwerben.
Übernahme des Fahrrads am Ende der Vertragslaufzeit: Will der Mitarbeitende das Dienstrad am Ende der Vertragslaufzeit übernehmen, wird für das Fahrrad nach dem Leasing ein Restwert angesetzt, der je nach Leasing-Anbieter bei 15 bis 18 Prozent des ursprünglichen Brutto-Anschaffungswertes liegt. Unternehmen und Mitarbeitende sollten hier die steuerlichen Details beachten: Die Finanzbehörden setzen für ein Fahrrad oder E-Bike nach einer Leasingdauer von drei Jahren einen wesentlich höheren Restwert an, der bei 40 Prozent liegt. Die Differenz zwischen diesem Wert und dem tatsächlich bezahlten Restwert muss durch den Käufer bzw. die Käuferin als geldwerter Vorteil versteuert werden. Allerdings bieten die Leasinganbieter in der Regel an, diese Steuerlast zu übernehmen und direkt mit den Finanzbehörden abzuwickeln, so dass für den Käufer bzw. die Käuferin weder Kosten noch administrativer Aufwand entstehen.
Sonderkündigungsrecht und Rückgabe: Für Arbeitgebende kommt es eventuell darauf an, welche Regelungen bei Kündigung des Mitarbeitenden oder bei Elternzeit gelten: Alle Anbieter bieten hier eine Schutzabsicherung an – eine Art Sonderkündigungsrecht, bei der das Dienstrad zurückgegeben werden kann. Dennoch können sich die Regelungen zwischen den Anbietern im Detail unterscheiden. Ein genauer Blick hilft für die richtige Entscheidung.
Service: Der Umfang des Serviceangebots wie Wartung, Reparatur, die Abwicklung von Schäden oder der Austausch von Verschleißteilen, unterscheidet sich von Leasinganbieter zu Leasinganbieter. Allerdings lässt sich feststellen, dass sich die Service- und Versicherungsleistungen der Leasing-Anbieter in den vergangenen Jahren stark angenähert haben. Ein Vergleich zwischen den Anbietern ist bei individuellen Bedürfnissen dennoch lohnenswert. Bei den allermeisten Anbietern gibt es keine Bagatellschadensgrenze mehr. Das bedeutet: Auch vermeintliche Kleinigkeiten können von den Anbietern übernommen werden, womit sich der Gang in die Fachwerkstatt auf alle Fälle empfiehlt. Zu chten ist ferner auf die Mobilitätsgarantie: Sie soll - wie der Name schon sagt – garantieren, dass Mitarbeitende auch im Falle eines Defektes oder Diebstahls mobil bleiben können. Für Anbieter bedeutet das, dass sie auch für eventuell anfallende Folgekosten, wie eine Übernachtung, aufkommen. Anzumerken ist hier, dass sich diese Leistungen je nach Leasingpartner erheblich unterscheiden. Ob, wie schnell und wie unbürokratisch die jeweiligen Leistungen im Schadensfall tatsächlich erbracht werden, variiert zudem von Anbieter zu Anbieter.


Nachhaltigkeitssiegel für Hotels, von denen es so viele wie Sand am Meer gibt, sollten es Mobilitätsmanagern, Geschäftsreisenden und privaten Hotelgästen erleichtern, eine umweltfreundliche Unterkunft zu finden. Stiftung
Warentest hat sechs geprüft, die in Deutschland eine bedeutende Rolle spielen – nur drei sind aussagekräftig.
Grün reisen liegt im Trend. Auch und vor allem in der Geschäftsreisebranche. Und weil das Thema Hotellerie eine starke Rolle spielt, sollten Umwelt-Siegel Orientierung bei der Auswahl einer Herberge bieten. Doch wie nachhaltig arbeiten zertifizierte Hotels wirklich? Nachhaltigkeitssiegel gibt es im Tourismus fast wie Sand am Meer. Einige zeichnen umweltfreundliche Strände aus, andere Campingplätze, wieder andere Hotels. Manche Label stekken klare ökologische Standards, andere sind kaum mehr als Marketing. Stiftung Warentest hat geprüft, wie aussagekräftig bekannte Hotel-Label sind. Dazu befragte die gemeinnützige und vom Bundesministerium für Wirtschaft geförderte deutsche Verbraucherorganisation sechs Siegelgeber nach ihren Kriterien und prüften, wie gut die ihre Vorgaben überprüfen.
Das Ergebnis: Drei der geprüften Siegel sind vertrauenswürdig – sie stellen umfangreiche und konkrete Anforderungen an die Unterkünfte und kontrollieren diese regelmäßig vor Ort. Die drei anderen Label sind dagegen wenig aussagekräftig, etwa weil sie zu wenig fordern oder schlicht und einfach die Kontrollen fehlen.
ISO 14001. Im Grunde genommen legt die internationale Norm für weltweit anerkanntes Umweltmanagementsystem den Schwerpunkt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess als Mittel zur Erreichung der jeweils definierten Ziele in Bezug auf die Umweltleistung fest. Kriterien sind eine schriftlich fixierte Umweltpolitik mit Verpflichtung zum Umweltschutz und zur fortlaufenden Verbesserung der Umweltleistung, Bestimmung der Umweltaspekte der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, Festlegung von Umweltzielen, funktionsfähiges Umweltmanagementsystem, Durchführung von internen Audits.
Drei Siegel mit umfassenden ökologischen Kriterien. Für die wenigsten Business Traveller und private Hotelgäste ist ersichtlich, welche Anforderungen ein Label stellt und wie gründlich und objektiv diese kontrolliert werden. Stiftung Warentest hat gecheckt, wie die Vergabe der Siegel abläuft und ob klare und umfassende Anforderungen existieren – etwa zum Wasser- und Energieverbrauch, zur Nutzung von Ökostrom, zu Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung oder gegen die Plastikflut. Wenn vorhanden, wurden auch
soziale Kriterien des Labels bewertet etwa zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Alle Siegelgeber erwiesen sich uns gegenüber Stiftung Warentest sehr transparent. Bei drei der Nachhaltigkeitssiegel im Test wurde das Anforderungsniveau mit „gut“ bewertet, zwei erhalten nur die Note „ausreichend“, also die Schulnote 4. Ein Siegelgeber kontrolliert die von ihm zertifizierten Hotels jedoch kaum und erhielt in dem Punkt ein „mangelhaft“.
Für den Test wurden die Label-Organisationen
Certified – Das Kundenzertifikat
Certified ist ein unabhängiges Prüfinstitut für die Hotellerie. Ähnlich wie die Stiftung Warentest Produkte testet, werden Certified Hotels und Locations von Travel –und Event Managern qualifiziert bewertet und zertifiziert. Als Bewertungskriterien werden spezielle Anforderungen für Business-Kunden als Maßstab genutzt. In neutralen und umfangreichen Prüfungen vor Ort entsteht so ein objektives Zertifikat mit verlässlichen Detail-Aussagen über die geprüften Hotels, Apartments und Locations- unabhängig von Kategorien, für Low-Budget-Hotels wie Luxus- Häuser, für Ketten- und für Privathotels. •••
„Deutschlandweit gibt es viel zu viele Nachhaltigkeitssiegel für Hotellerie & Co.. Nur wenige halten, was sie versprechen.”
Julia Zielonka I Editorial Director zic


mit einem detaillierten Fragebogen zu ihren Anforderungen, dem Vergabeprozess und den Kontrollmechanismen befragt. Dazu wurden die Siegelgeber um Belege gebeten und sie wurden persönlich besucht, um weitere Angaben zu verifizieren. Anhand von je zwei der ausgewählten Hotels mussten sie zeigen, dass ihre Stan-dards tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden. Dafür ließen sich die Experten der Stiftung Warentest etwa Kontrollberichte und Rechnungen vorlegen.
„Bio Hotels“. Das Label „Bio Hotels“ wird überwiegend von Hotels in Deutschland und Österreich getragen. Zwar wurde es insgesamt bisher erst 45-mal verliehen, aber da steckt auch mehr dahinter als nur der Ressourcenund Energieverbrauch des Hotels. Denn selbst die Lebensmittel und Kosmetika müssen alle bio sein in diesen Unterkünften. Geprüft wird das Ganze von unabhängigen Zertifizierern.
Greensign Hotel. Häufiger trifft man bei der Hotelsuche auf das Siegel „Greensign Hotel“; allein in Deutschland sind 741 Unterkünfte damit ausgezeichnet. Neben ökologischen Kriterien, wie etwa dem Energie- und Wasserverbrauch, werden auch soziale Kriterien in die Wertung eingebracht, wodurch ein umfassendes Bild des Hotels betrachtet wird.
Green Key. Das dritte von den Testern als aussagekräftig gewertete Siegel ist „Green Key“. Im Vergleich zu den anderen beiden ist es deutlich internationaler und deckt dem Bericht zufolge rund 4.900 Hotels ab. Die Hotels müssen zwar nur die Hälfte der Checkliste von den Vor-Ort-Prüfern erfüllen, dafür
sind einige wichtige Punkte aber auch verpflichtend. Dadurch geht das Siegel auch nur an tatsächlich nachhaltige Unterkünfte, so die Stiftung Warentest.
Green Key und GreenSign Hotel stellen noch umfangreichere Anforderungen als Bio Hotels, auch zu Arbeitsbedingungen wie etwa Gesundheitsschutz. Sie schreiben u.a. konkrete Maßnahmen vor, um Energie, Wasser, Plastikmüll und Chemikalien zu sparen. Ökostrom oder biozertifizierte Lebensmittel sind jedoch nicht Pflicht – anders als bei Bio Hotels. Alle drei Siegelgeber schicken regelmäßig geschulte Prüfer vorbei, um sicherzustellen, dass die Hotels die Vorgaben einhalten.
Note 4 für Dehoga Umweltcheck und Viabono. Das Anforderungsniveau von Dehoga Umweltcheck und Viabono ist dagegen laut Warentest, nur ausreichend. Beide setzen den Fokus auf die jährlichen Verbrauchswerte eines Hotels, wie Strom und Wasser. Diese müssen unter bestimmten Vergleichswerten
••• GSTC: Grundlegende Standards
liegen – wie hoch diese Werte sind, teilten Dehoga und Viabono den Testern nicht mit. Weitere Umwelt-Kriterien, etwa zu Lebensmitteln, seien zudem kaum vorhanden. Statt VorOrt-Prüfungen erfolgt die Kontrolle digital mithilfe einer Software. Laut Dehoga wird der Umweltcheck derzeit allerdings überabeitet.
Blaue Schwalbe. Seit 1989 wird es an ökologisch ausgerichtete Hotels, Pensionen, Gasthöfe und Campingplätze in Europa vergeben. Bewertet werden Speisen/Getränke, Verkehr, Energie, Wasser, Abfall, Gartenanlagen, Putzund Pflegemittel, Freizeit. 2022 waren 40 deutsche Hotels mit der Blauen Schwalbe ausgezeichnet.
Bei den drei Öko-Siegeln, denen die Stiftung Warentest nur eine niedrige Aussagekraft zusprach, gab es wenig bis gar keine Vor-OrtKontrollen. Auch soziale Kriterien – z.B. zu den Arbeitsbedingungen des Personals gab es hier nicht. •••
Deutschlandweit gibt es in der Hotellerie derzeit ca. 60 Labels, die Anbietern von Unterkünften zur Verfügung stehen. Es zeigt sich, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Hotellerie auch zu einem interessanten und mutmaßlich lukrativen Geschäftsmodell geworden ist. Die Bandbreite ist groß: Zertifikate mit relativ geringen Auflagen stehen solchen mit umfangreichen und aufwändigen Zertifizierungen gegenüber.
Ein Anhaltspunkt für die Güte eines Siegels ist die Anerkennung durch den Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Dieser globale Rat für nachhaltigen Tourismus, eine gemeinnützige Organisation, legt die grundlegenden Standards für eine nachhaltige Entwicklung im Tourismussektor auf globaler Ebene für Branchenexperten und Regierungen fest. Er wird von den Vereinten Nationen, insbesondere der Welttourismusorganisation (UNWTO), und Experten für nachhaltigen Tourismus global anerkannt.
Die Preisspanne für eine Zertifizierung reicht von wenigen Hundert bis zu mehreren Tausend Euro pro Jahr. In der Bundesrepublik sollen mehr als 1.000 Betriebe zertifiziert sein.

Ein Mobilitätsbudget lässt sich manniggaltig ausgestalten, etwa mit dem

Reine Verbrenner-Geschäftswagen vertragen sich schlecht mit Klimaschutz und Nachhaltigkeitszielen.
Daher bieten mehr als 1 Mio. Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitenden, darunter auch Geschäftsreisenden, stattdessen ein Mobilitätsbudget. Das ist eine Alternative zum Dienstwagen oder als zusätzlichen
Benefit in Form eines festgelegten Geldbetrags. Den können Angestellte für unterschiedliche Verkehrsmittel wie den ÖPNV, Carsharing, Fahrradleasing etc. nutzen.
Seinen Ursprung hat das Mobilitätsbudget vor allem im Flottenmanagement als Alternative zum klassischen Firmenwagen. Daneben kommt es im Travel- bzw. Dienstreisemanagement sowie im Corporate Benefit Management zur Anwendung.
Ein Bündnis aus Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Allianz pro Schiene, Zukunft Fahrrad und Bundesverband CarSharing fordert eine Alternative zu staatlich geförderten Dienstwagen. Stattdessen soll ein Bundesprogramm zur Förderung betrieblicher Mobilitätsbudgets geschaffen werden.
Die geltende steuerliche Förderung von Dienstwagen bremste die Klimaschutzbestrebungen der Ampel-Koalition erheblich aus und wird dies wohl auch bei der neuen schwarzroten Bundesregierung tun. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitenden die Wahlfreiheit geben können, indem sie alternativ zum Dienstwagen ein Mobilitätsbudget anbieten, beispielsweise bestehend aus Dienstfahrrad, BahnCard, JobTicket und einem Budget für Sharing-Angebote und Taxifahrten. So können innerhalb der neuen Legislaturperiode mindestens
½ Mio. Dienstwagen durch klimaschonende und nachhaltige Verkehrsmittel ersetzt werden.
Der Verkehrssektor in Deutschland stellt den Klimaschutz weiterhin vor große Probleme. Seine Emissionen sind zu hoch und sinken nicht. Dennoch fördern die geltenden steuerlichen Privilegien die Anschaffung und Nutzung emissionsintensiver Verbrenner- Dienstwagen. Zwei von drei neuen Pkw werden in Deutschland gewerblich zugelassen. Geleaste Dienstwagen, vornehmlich große, übermotorisierte Fahrzeuge der oberen Segmente, gehen nach kurzer Haltedauer in den Gebrauchtmarkt und prägen daher den Pkw-Bestand über viele Jahre. Zudem ist ein Drittel der Wege in Deutschland berufsbedingt. Eine
3 %
der Unternehmen bieten bislang ein Mobilitätsbudget an.
Abkehr von der aktuellen Dienstwagenpraxis ist dringend notwendig für die Minderung von klimaschädlichen Treibhausgasen im Verkehrssektor.
Mobilitätsbudgets sind eine moderne Möglichkeit, klimafreundliche Verkehrsmittel zu fördern und als Arbeitgeber einen Anreiz für Mitarbeitende zu bieten. Mobilitätsbudgets bündeln das Dienstfahrrad im Leasing oder Abo, ein steuerlich privilegiertes JobTicket für den ÖPNV, die BahnCard und ein flexibles Budget für Taxifahrten oder Car-, Fahrrad- und E-Scooter-Sharing in einer digitalen Lösung –je nach Lebenssituation können die Mobilitätsangebote flexibel ausgewählt und kombiniert werden. Dadurch wird ein umfassendes Mobilitätsangebot für alle Beteiligten mit einer besseren Klimabilanz geschaffen.
„Statt sich auf ein Verkehrsmittel wie beispielsweise den Dienstwagen festzulegen, erhalten die Mitarbeitenden ein Budget für verschiedene Mobilitätsangebote und können frei wählen, wofür sie dies einsetzen. Diese Form der multimodalen Mobilität ist nicht nur effizient und klimaschonend, sondern entspricht inzwi-

schen auch dem alltäglichen Mobilitätsverhalten der Menschen“, so VDV-Vizepräsident Knut Ringat.
Bislang bieten nur 3 % der Unternehmen Mobilitätsbudgets an. Der Umstieg ist mit personellem und finanziellem Aufwand verbunden. Die neue Bundesregierung muss Unternehmen daher mit einem Bundesprogramm bei der Einführung von Mobilitätsbudgets helfen, so dass dienstliche Mobilität schnell und umfassend verändert werden kann. Denn auch ein alleiniger Antriebswechsel auf elektrisch betriebene Pkw-Flotten wird den umfassenden Anforderungen an nachhaltige Mobilität nicht gerecht.
Die Einsparungen von CO2-Emissionen werden aus Klimasicht nicht ausreichen. Zudem würde auch der elektrifizierte motorisierte Individualverkehr unverhältnismäßig viel Fläche und Energie verbrauchen, wenn er in der heutigen Form weitergeführt wird. Stattdessen braucht es grundsätzlich nachhaltige Mobili-
••• So funktioniert das Mobilitätsbudget
tätsalternativen, um den Pkw-Verkehr insgesamt zu verringern.
Ein Mobilitätsbudget kann als Ergänzung oder als Alternative zum Dienstwagen umgesetzt werden. Unternehmen können mit dem Mobilitätsbudget den Geschäftswagen auch ersetzen oder ein modernes und nachhaltiges Mobilitätsangebot einführen. Letztlich handelt es sich um einen Betrag, mit dem Beschäftigte ihre Mobilität frei wählen können. Und das sowohl auf dem Arbeits- als auch Privatweg. Ob Auto, Fahrrad, Shared Mobility oder öffentliche Verkehrsmittel – Mitarbeitende können das passende Angebot ganz nach ihren individuellen Wünschen nutzen. Und das Beste: das Unternehmen profitiert von einem kosteneffizienten, nachhaltigen und leicht zu verwaltenden Mobilitätskonzept.
Für Mobilitätsbudgets gibt es keine definierte Norm. Sie können sowohl Jobtickets und Budgets für Sharing-Angebote beinhalten
• Unternehmen legen die Höhe des Mobilitätsbudgets fest und stellen es den Mitarbeitenden monatlich zur Verfügung.
• Arbeitgeber können dabei entscheiden, für welche Mobilität und Verkehrsmittel sie das Mobilitätsbudget ihren Mitarbeiter:innen gewähren.
• Mitarbeiter:innen wählen ihre Mobilität digital per App. Sie buchen und bezahlen ihre Fahrten und Mobilitätsdienste über die Apps diverser Mobilitätsanbieter.
• Die Ausgaben für die Mobilitätsnutzung werden direkt über das Guthaben der bereitgestellten Mobilitätsbudgetkarte abgerechnet.
• Übrig gebliebenes Budget kann, je nach Konfiguration durch den Arbeitgebenden, im Folgemonat genutzt werden oder verfällt.
• Die Abrechnung der verschiedenen Verkehrsmittel und eine intelligente Steueroptimierung wird vollständig vom Mobilitätsbudget-Anbieter (belmoto, Bonvoyo, MOBIKO, Navit, uRyd) übernommen.
„Über Jahrzehnte war der Dienstwagen das bedeutendste Verkehrsmittel. Inzwischen denken immer mehr Mobiliätsverantwortliche in den Unternehmen über alternative Reiseformen nach.”
Gernot Zielonka I CEO zic
als auch die Monatsbeträge für ein Fahrradleasing, ein Auto-Abo oder der monatliche Anteil einer BahnCard. Die Höhe des Mobilitätsbudgets kann dabei in Abhängigkeit vom Anwendungsfall und von der Zielgruppe im Unternehmen variieren.
Win-win für Arbeitgeber und Mitarbeitende. Mobilitätsbudgets stärken Unternehmen extern und bieten Mitarbeitenden intern vielfältige Mobilitätsvorteile. Auch denn der Dienstwagen noch höchst beliebt ist, bevorzugen doch Mitarbeitende zunehmend flexiblere Lösungen, wie sie das Mobilitätsbudget bietet. Unternehmen erhöhen mit Mobilitätsbudgets ihre Anziehungskraft im Wettbewerb um Talente, was langfristig auch dem Unternehmenserfolg zugutekommt. Zudem verbessern sie die Umweltbilanz und beeinflussen ihr Image positiv. Wählen Mitarbeitende im Rahmen eines Mobilitätsbudgets aktive Formen der Mobilität (Radverkehr, Fußwege zur Erreichung des ÖPNV), ist das auch ihrer Gesundheit zuträglich. Und das Mobilitätsbudget gilt bei immer mehr Firmen als starkes Argument im Recruiting, es ist eine effektive Maßnahme das Empolyer Branding – darunter versteht man die gezielte Gestaltung und Positionierung der Arbeitgebermarke eines Unternehmens. Dabei geht es darum, eine attraktive und authentische Identität als Arbeitgeber zu schaffen, um qualifizierte Bewerber anzuziehen und langfristig an die Organisation zu binden. Employer Branding ist für Firmen von großer Bedeutung, da es ihnen ermöglicht, sich positiv von der Konkurrenz abzuheben und Bindung und Motivation der bestehenden Mitarbeitenden zu stärken – zu verbessern. Ein Mobilitätsbudget lohnt sich für Arbeitnehmende oft mehr als eine Gehaltserhöhung


oder ein anderer Arbeitgeberzuschuss. Darüber hinaus unterstützt das Mobilitätsbudget Unternehmen dabei, ihre Klimaziele effektiv zu verfolgen.
Besser fürs Klima. Straßenverkehr und Luftfahrt leisten bislang kaum einen Beitrag zum Klimaschutz. Beide, insbesondere Verbrennerautos und natürlich Kerosin-betriebene Luftfahrzeuge verursachen u.a. durch ihre massenhafte Freisetzung von Treibhausgasen weitere Umweltschäden. Betriebliche Mobilität wird als eine starke Stellschraube für eine nachhaltigere und gerechtere Mobilität in ganz Deutschland erachtet. Welche Auswirkungen ein Mobilitätsbudget auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit hat, variiert erheblich – je nach den gewählten Mobilitätsangeboten und der Art ihrer Nutzung. Nutzen Angestellte statt ihres privaten Pkw oder Dienstwagens ein Mobilitätsbudget, kann das viele Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit bieten. Treibhausgasemissionen, Luftbelastung, Ressourcen- und Flächenverbrauch können reduziert werden in Abhängigkeit vo Grad der Nutzung der klimaschonenden Alternativen.
Besteuerung. Zu beachten sind dabei die unterschiedlichen steuerlichen Regelungen hinsichtlich Abrechnung und Verkehrsmittel. Für das Mobilitätsbudget als Form der Mitarbeitermobilität besteht keine einheitliche steuerliche Regelung. Die steuerliche Handhabung kann auf unterschiedliche Weise stattfinden, Arbeitgeber können dabei zwischen verschiedenen Steuermodellen wählen.. Zum einen sind die Regelungen zur Versteuerung der Mitarbeitermobilität abhängig vom Zweck der Fortbewegung (beruflich oder privat) und der
Wahl des Verkehrsmittels (z. B. ÖPNV oder Dienstwagen).
Unternehmen können das Mobilitätsbudget beispielsweise über den Sachbezug abrechnen. Die Steuerfreigrenze liegt 2025 bei 50 Euro im Monat (§ 8 Abs. 2 S.1 EStG). Darüber hinaus können Arbeitgeber bis zu 10.000 Euro im Jahr mit 30 % pauschal versteuern (§ 37b EStG). Für die Nutzung des ÖPNV bleiben Arbeitgeberzuschüsse, die für Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gezahlt werden, steuerfrei (§ 3 Nr. 15 EStG). So sind beispielsweise Fahrten mit dem ÖPNV, etwa mit dem Deutschlandticket als Jobticket steuerfrei, während Dienstwagen besteuert werden, wobei die Besteuerung für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor höher und für Elektroautos geringer ausfällt.
30 %
des Mobilitätsbudgets lässt sich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro versteuern.
Grundsätzlich lohnt es sich für Arbeitgeber, wenn sie das Mobilitätsbudget als Gehaltszusatz gewähren. Ein Mobilitätsbudget in Form einer Gehaltsumwandlung ist zwar möglich, allerdings aufgrund der Steuerlast nicht zu empfehlen, da das Mobilitätsbudget per Gehaltsumwandlung grundsätzlich steuerund sozialabgabenpflichtig ist.
Zunächst gilt es zu klären, ob das Mobilitätsbudget bzw. die Mobilitätsangebote als Gehaltsextra oder über eine Gehaltsumwand-
lung zur Verfügung gestellt werden sollen. Arbeitgeber können das Mobilitätsbudget als Gehaltsextra über den Sachbezug bis zu 50 Euro steuerfrei gewähren. Darüber hinaus lässt sich das Mobilitätsbudget bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Jahr pauschal mit 30 % versteuern. Zuschüsse des Arbeitgebers für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind zudem steuerfrei. Auch das Diensrad ist als Gehaltszusatz grundsätzlich lohnsteuerbzw. sozialabgabefrei.
Bei einer Gehaltsumwandlung kann für das Mobilitätsbudget weder Sachbezug noch Pauschalbesteuerung angewendet werden. Mitarbeitende müssen den geldwerten Vorteil regulär versteuern. Deshalb eignet sich die Gehaltsumwandlung nur für die Sonderregelung bei Auto-Abo/Leasing und Dienstrad.
Öffentliche Verkehrsmittel. Arbeitgeber können Tickets für öffentliche Verkehrsmittel als Sachzuwendung oder über den ÖPNVZuschuss als Barlohn (Erstattung) abrechnen. Das ist kostengünstiger als ein Dienstwagen und ermutigt Mitarbeitende zu klimaschonenden Arbeitswegen.
Mit dem Deutschlandticket als Jobticket haben Arbeitgeber eine zusätzliche Möglichkeit, ihren Beschäftigten nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Die Bereitstellung des Deutschlandtickets ist zusätzlich zum Mobilitätsbudget bzw. Sachbezug möglich. Bezuschussen Arbeitgeber das Ticket zudem mit mindestens 25 % wird es mit 5 % rabattiert.
Im Fernverkehr hingegen sind nur Fahrten zur Arbeitsstätte steuerfrei. Die private Nutzung von Fernverkehrtickets ist grundsätzlich steuerpflichtig. Die BahnCard 100 wird steu-
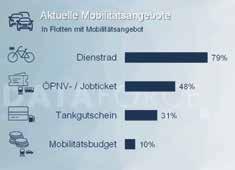
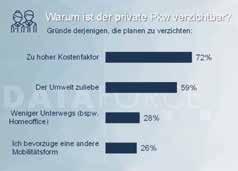

erfrei, wenn bestimmte Amortisationsgrundsätze erfüllt sind. Die Anschaffung der BahnCard für dienstliche Zwecke muss für das Unternehmen kostengünstiger sein als die Summe der entsprechenden Einzeltickets.
Dienstfahrräder. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitenden ein Dienstrad per Leasing anbieten. Die Abrechnung und Versteuerung des Dienstrades hängt dann davon ab, ob das Dienstrad als Gehaltsextra oder per Gehaltsumwandlung angeboten wird.
Was man zur Besteuerung wissen muss: Dienstrad-Leasing als Gehaltszusatz (0 %-Regel). Die Leasingrate wird vom Arbeitgeber gezahlt. Über eine Überlassung zusätzlich zum Gehalt: Die private Nutzung ist steuerfrei. Dienstrad-Leasing per Gehaltsumwandlung (0,25 %-Regel): Die Leasingrate wird über Gehalt gezahlt. Keine Lohnsteuer, aber geldwerter Vorteil (Privatnutzung) mit 0,25 % des Bruttolistenpreises zu versteuern.
Mobilitätsbudget als Sachbezug. Über den Sachbezug (bis 50 Euro steuerfrei) können als Mitarbeiter-Benefit verschiedene Services und Produkte den Angestellten angeboten werden. Darunter fallen neben Mobilitätsbudgets auch Mitgliedschaften für Fitnessstudios oder Sportvereine sowie Kita-Gutscheine. Mit dem 50 Euro-Sachbezug können Firmen ihre Mitarbeitenden mit einem monatlichen und steuerfreien Gehaltsextra unterstützen. Hierbei werden i.d.R. Gutscheine oder Prepaid-Karten von verschiedenen Anbietern und Angeboten an die Mitarbeitenden ausgegeben. Um das Mobilitätsbudget für Mitarbeiter anzubieten, können Arbeitgeber virtuelle Prepaid-
Karten ausgeben, die über eine Mobilitätsbudget-App den Mitarbeitenden bereitgestellt werden. Die Prepaid-Karten werden mit dem vereinbarten Guthaben aufgeladen, welches die Mitarbeitenden für ihre Mobilitätsbedürfnisse frei verwenden und mit dem sie bei allen verfügbaren Mobilitätsanbietern bezahlen können.
Zu beachten ist
• Die Sachleistung wird zusätzlich zum Lohn ausgezahlt. Eine Gehaltsumwandlung ist damit nicht möglich.
• Der Benefit darf auch nicht in bar ausgezahlt oder nachträglich erstattet werden.
• Übersteigt der Betrag den Wert von 50 Euro, wird der Betrag steuerpflichtig.
• Der Sachbezug wird grundsätzlich in der Gehaltsabrechnung ausgewiesen, unabhängig davon, wie hoch ise ausfällt.
Für Arbeitnehmende hat die Inanspruchnahme eines Sachbezugs einen steuerlichen Vorteil gegenüber einer entsprechenden Gehaltserhöhung. Sie erhalten eine Nettolohnoptimierung.
Diese Firmen bieten bereits das Mobilitätsbudget für Mitarbeiter an. Führende deutsche Unternehmen bieten Mobilitätsbudgets
••• Gehaltserhöhung oder Mobilitätsbudget?
Das Mobilitätsbudget bietet aufgrund der günstigen Regelungen steuerliche Vorteile für Arbeitgebende und Arbeitnehmende und lohnt sich deshalb für beide Seiten mehr als eine entsprechende Gehaltserhöhung.

Studie Mobilitätsmanagement 2023
5 % wird das Bahn-Ticket rabattiert wenn der Arbeitgeber es mit 25 % bezuschusst.
für ihre Mitarbeitenden bereits an oder planen dies künftig zu tun. Laut siner Studie nutzen etwa 30 % der Unternehmen in Deutschland ein Mobilitätsbudget. Standards setzt dabei die Lufthansa. Einer der Pioniere war SAP. Besonders drei Trends wirken sich auf die Entscheidung von Unternehmen aus, ein Mobilitätsbudget einzuführen:
• Urbanisierung: Arbeitnehmer ziehen flexiblere Optionen dem Auto bzw. Firmenwagen vor.
• CO2-Ziele: Gesetzlicher Druck auf Unternehmen zur CO2-Reduzierung (z.B CSRD, CO2Berichtspflicht für Unternehmen, wird auf 2027 verschoben).
• Attraktivität als Arbeitgeber: Innovative Mobilitäts- und Benefitsprogramme stärken das Firmenimage.
Die Unternehmen greifen für die Umsetzung des Mobilitätsbudgets auf spezialisierte Apps und Anbbieter zurück, die Verwaltung und Nutzung des Mobilitätsbudgets für Mitarbeiter und Arbeitgeber einfacher und bequemer machen. Neben reinen Mobilitätsplattformen wie NAVIT, Bonvoyo der Deutschen Bahn oder uRyde sind dies auch Anbieter von BenefitsPlattformen wie Become1, Probonio oder Spendit. •••

An den Schnellladesäulen werden in Deutschland meist inakzeptable Wucherpreise verlangt. Die neue Regierung will das angeblich ändern.
Geschäftsreisende reiben sich beim Laden von Elektroautos oft verwundert die Augen, wenn sie auf die Preisangaben von Schnellladesäulen blicken. Und Mobilitätsmanagern ergeht es nicht anders, wenn sie die Abrechnungen von Ladekosten sehen. Gegen den Strompreis-Wahnsinn wollen VDA und Regierung vorgehen.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) und auch die neue Bundesregierung fordern angesichts der teils sehr hohen Kosten und der zunehmenden Komplexität beim öffentlichen Laden von Elektrofahrzeugen Maßnahmen zur Preistransparenz sowie zur Entlastung der Verbraucher. Denn für die Mobilitätswende sei es entscheidend, dass das Laden von Elektrofahrzeugen einfach und transparent ist und vor allem einen Preisvorteil bietet, betont VDAPräsidentin Hildegard Müller.
Öffentliches Laden viel zu teuer. Öffentliches Laden kostet i.d.R. zwischen 60 und 90 Cent/kWh und damit zwei bis drei Mal mehr als beim privaten Laden daheim. Auch innerhalb des Angebots an öffentlichen Ladepunkten kann es eine enorme Preisdifferenz über die Orte, Anbieter und Tarife hinweg geben. Die Preise reichen von ca. 30 Cent / kWh, etwa an Supermärkten, bis zu knapp 90 Cent. Hinzu kommt, dass Verbraucher heute oft mehrere Ladeverträge benötigen, um günstige Tarife nutzen zu können. Das betrifft vor allem diejenigen, die keine Möglichkeit haben, zu Hause oder am Arbeitsplatz zu laden.
„Wir brauchen dringend Lösungen, die den Umstieg auf die Elektromobilität erleichtern –
nicht erschweren. Aktuell ist das zu komplex –und für die gleiche Menge Strom teils das Dreifache zu zahlen, ist schlichtweg nicht tragbar“, so Müller. VDA und neue Regierung sprechen sich für eine Senkung der Stromnebenkosten aus, darunter Netzentgelte, Steuern und Abgaben. Diese machen einen wesentlichen Teil der hohen Ladepreise aus. „Eine Reduzierung der Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz wäre ein erster wichtiger Schritt“, sagt Müller.
VDA: Vergleichsportal für Ladetarife. Ein unabhängiges Vergleichsportal für Ladetarife –ähnlich wie bei Tankstellen – ist ein zentraler Schritt, um das Vertrauen in die Ladeinfrastruktur zu stärken und Transparenz zu schaffen, so der Lobbyverband weiter. Die EU-Vorgabe AFIR schreibt u.a. Transparenz und Angemessenheit bei Ladepreisen vor. Zudem sollte die EU-Gebäude-Energierichtlinie EBPD im nationalen Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz verankert werden, um private Lademöglichkeiten zu fördern. Der VDA setzt sich zudem entschieden gegen unnötige Standund Blockiergebühren an öffentlichen Ladepunkten ein. Diese ebenfalls vollkommen überzogenen Gebühren dürfen ausschließlich der Sicherstellung der Verfügbarkeit von Lad-
einfrastruktur dienen und die missbräuchliche Nutzung von Parkplätzen verhindern. Konkret fordert der VDA die Erhebung von Blockiergebühren erst nach Abschluss des Ladevorgangs sowie keine Gebühren in der Nachtruhezeit in Wohngebieten.
Ziel: flächendeckende, bezahlbare Ladeinfrastruktur. Die THG-Quote (TreibhausgasMinderungsquote) bietet Ladepunktbetreibern die Möglichkeit, Einnahmen durch den Verkauf von Emissionsminderungen an Mineralölunternehmen zu erzielen. Der VDA betont jedoch, dass die Erlöse im Jahr 2024 mit wenigen Cent pro Kilowattstunde deutlich zurückgegangen und somit schwer planbar sind. Um die Elektromobilität langfristig zu fördern, fordert der VDA eine ambitionierte Umsetzung der Renewable Energy Directive (RED III) in nationales Recht. Ziel ist es, durch eine hohe THG-Minderungsquote den Einsatz erneuerbarer Energien im Straßenverkehr zu stärken und gleichzeitig Potenziale zur Senkung der Stromkosten an öffentlichen Ladepunkten auszuschöpfen. „Nur so können wir sicherstellen, dass die Elektromobilität für alle attraktiv wird – und Deutschland auf dem Weg zur klimafreundlichen Mobilität führend bleibt“, schließt Hildegard Müller. •••
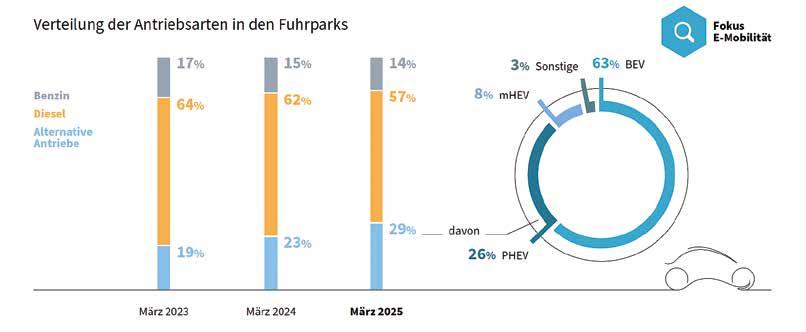
Batterieelektrische Pkw werden 2025 und in den Folgejahren in den Fuhrparks einen neuen Aufschwng erleben.
Auch wenn noch viele Flottenchefs und Dienstwagenberechtigte Vorbehalte haben, dürfte das den Siegeszug der batterieelektrischen Modelle in den kommenden zehn Jahren nicht aufhalten. Heute sind BEV in Fuhrparks schon wichtigster alternativer Antrieb.
Unter allen gewerblichen Zulassungen – und diese machen in Deutschland gut zwei Drittel der Neuzulassungen aus – sind Fuhrparks die volumenstärkste Sparte. Grundsätzlich ist die Bereitschaft, ein BEV zu fahren, in Fuhrparks stärker ausgeprägt als bei privaten Endverbrauchern. Einer der Gründe: Die Mehrheit der Fuhrparkleiter bestätigte in der Befragung für das DAT Barometer, dass vor allem die steuerlichen Vergünstigungen zur Anschaffung von BEV (und PHEV) geführt haben. Auch ist der Unterhalt der E-Autos günstiger als der von Verbrennern. Im Zuge der Elektrifizierung der Fuhrparks spielen auch Pkw-Hersteller aus China eine Rolle.
BEV sind in Fuhrparks wichtigster alternativer Antrieb. In den gewerblichen Fuhrparks ist die Durchdringung mit alternativen Antrieben (BEV, PHEV, HEV, mHEV, Sonstige) in den vergangenen drei Jahren von 19 auf 29 % gestiegen. Die rein batteriebetriebenen Pkw machen unter allen alternativen Antrieben mit 63 % den Löwenanteil aus. Für die Fuhrparks bleibt aber der Dieselmotor noch ein paar Jahre die wichtigste Antriebsart (57 % aller Pkw). Benziner mach nur noch 14 % aus, insbesondere wenn es um Fuhrparks mit kleinen Pkw wie etwa bei den Pflegediensten geht.
Steuerliche Vorteile sind Treiber. Wenn es um die Einflottung von BEV geht, war Tesla bis 2024 immer ein Thema, Aktuell überdenken 35 % der befragten Fuhrparkleiter grundsätzlich die Beschaffung von Tesla-Fahrzeugen wegen Elon Musk. Ansonsten sind es eher die steuerlichen Vorteile und die der sehr viel geringeren Unterhaltskosten von E-Autos, die für BEV sprechen, sagen 68 % der Fuhrparkleiter. Weiterer Punkt im Stimmungsbild: 57 % halten grundsätzlich den politisch gewollten Verbrennerausstieg für den falschen Weg.
Chinesische Pkw im Fokus. 43 % der Fuhrparkverantwortlichen können sich vorstellen, im eigenen Fuhrpark auch auf chinesische Fabrikate umzusteigen, die derzeit erst ansatzweise auf dem deutschen Markt verfügbar sind Nahezu gleichauf ist der Anteil derjenigen, die dies wegen Unwissenheit klar verneinen. 8 % gaben zu Protokoll, dass sie bereits Pkw chinesischer Hersteller in ihrem Fuhrpark haben.
E-Fuels. Die Hälfte der befragten Flottenchefs findet E-Fuels vielversprechend: Aber dese künstlich produzierten und superteuren Kraftstoffe sind inzwischen etwas aus der öffentlichen Diskussion gerückt. Von synthetischen Kraftstoffen haben 96 % aller Fuhrparkleiter
schon mal etwas gehört oder gelesen. Deutlich gewachsen ist dagegen der Anteil derjenigen, die viel davon gehört und gelesen haben, von 27 auf heute 41 %. 35 % dagegen halten nichts von diesen Kraftstoffen. E-Fuels bzw. synthetische Kraftstoffe sind für viele eine denkbare Möglichkeit, den Pkw-Bestand zu dekarbonisieren, Aber mutmaßlich keiner weiß, dass E-Fuels für den Straßenverkehr nur in geringen Mengen zur Verfügung stehen werden und wenn, dann wird der Liter etwa dreimal soviel kosten wie heute herkömmlicher Benzin- oder Dieselkraftstoff. Das ist gleichbedeutend mit einem No Go.
Auto-Abos. Bei der Fuhrparkleiterbefragung der DAT bestätigten 14 %, dass ihre Dienstwagenberechtigten derzeit ein Abo nutzen würden. Bei deutlich über 80 % ist das nicht der Fall. Mit der Thematik Auto-Abo auseinandergesetzt haben sich allerdings sehr viele (71 %). Falls aufgrund einer Interimslösung die Mobilität im Unternehmen sichergestellt werden muss, nutzen aber nur 18 % der Fuhrparkchefs ein Abo. Die große Mehrheit aber überbrückt den Mobilitätsbedarf z.B. mit eigenen Poolwagen oder Angeboten von Autovermietern. Die tatsächliche Nutzung bleibt aber verhalten. •••


hat mit seinen E-Modellen auf dem deutschen Markt zu kämpfen. Der Q6 e-tron ist aber ein Top-Geschäftswagen, besser als der Q5 Verbrenner.
Bei Audi geht es wieder Schlag auf Schlag, insbesondere 2025 und den Folgejahren fluten die Audianer nach zwei schwierigen Jahren den Markt mit elektrifizierten Modellen. Mitte 2024 erschienen der Q6 e-tron auf den man lange wegen diverser Unstimmigkeiten im Konzern hat warten müssen. Auch der Q6 e-tron ist Teil der Businesslösungen für Geschäftskunden. Wir haben das Top-SUV gefahren.
Der Audi Q6 e-tron steht auf der neuen „Premium Platform Electric“ (PPE-Plattform), die gemeinsam mit Porsche entwickelt worden ist. Dank der neuen PPE, die dezidiert für E-Mobilität entwickelt wurde, weist das Fahrzeug zudem ein großzügiges Raumgefühl und Platzangebot sowie eine hohe Alltagstauglichkeit auf. Die neue Plattform trägt neben dem E-Macan auch den Q6-etron Sportback sowie den A6 e-tron. Konkurrenten sind aus München der iX3, aus Stuttgart der EQE SUV, aus Grünheide das Model Y sowie diverse Fahrzeuge aus dem Reich der Mitte. Zielgruppen hier zu Lande sind zuvorderst gewerbliche Kunden. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der Wagen eine dicke Brieftasche erfordert, gleich ob man ihn kauft, finanziert oder least. Von 63.500 Euro bis zu über 120.000 Euro ist alles möglich.
Exterieur. Das Design kommt einem irgendwie bekannt vor. Nichts Aufregendes, aber dennoch ansprechend. Audi spricht von einer weiteren Evolutionsstufe des e-tron-Designs. Die aufrechte Front mit dem komplett geschlossenen und invertierten Singleframe folgt der für Audi E-Modelle spezifischen Designsprache. Eine Maske in Selenitsilber oder
Schwarz Hochglanz fasst den stark dreidimensional durchgeformten Grill und die seitlichen Lufteinlässe ein. Das hoch platzierte Tagfahrlicht verleiht dem Q6 e-tron eine sehr markante und eigenständige Erscheinung. Nach hinten ist die Karosserie etwas eingezogen und die flach geneigten D-Säulen fließen elegant in die Karosserieschultern ein. Der Schweller ist schwarz abgesetzt und betont so den Bereich, in dem sich die Batterie befindet. Hier schlägt das Herz des vollelektrisierten Fahrzeugs mit 800-Volt-Technologie. Das dynamisch eingezogene Heck mit dem durchgehenden Leuchtenband erzeugt sportlicher Eleganz.
Interieur. Das Ambiente im Innenraum wurde betont wohnlich gestaltet. Der sogenannte Softwrap erstreckt sich von den Türen über das komplette Cockpit bis hin zur Mittelkonsole und erzeugt auf diese Weise ein homogenes und umschließendes Raumgefühl. Die Farben und die hochwertigen Materialien, die zum Teil aus Rezyklaten bestehen, finden sich auch in den Sitzen wieder. Dachhimmel, Säulen und Sonnenblenden sind aus dem Stoff Draft gefertigt, der ebenfalls zu 100 % aus recyceltem Polyester besteht. Vorn bietet der Q6 mehr Raum und viel Kopffreiheit, nicht ganz so üppig geht es im Fond zu. An Bord sind die Sportsitze Serie, und die bieten Vielfahrern hohe Seitenhalt, strammer Polsterung und einer merklich höheren Lehne mit besserer Unterstützung im Schulterbereich.
Im Cockpit gibt es laut Audi das größte und beste Head-up-Display und die besten AR-Grafiken am Markt, sondern auch eine neue Bildschirmlandschaft nebst neuem Bediensystem. Fahrer und Beifahrer erwartet eine stylische Wohlfühllandschaft bestehend aus hochwertigen und angenehmen Materialien und weichen Oberflächen. Highlight ist das freistehende Curved Display, das sich in einem leichten Bogen um den Fahrer schmiegt. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein 11,9 Zoll großes Display, das die wesentlichen Informationen bereitstellt Direkt daran schließt sich der zweite Bildschirm mit 14,5 Zoll an, über den die üblichen Einstellungen für Navi, Entertainment usw. getätigt werden.

Beim Q6-etron-Cockpit gibt es auch für den Beifahrer ein optionales Display.
Die Menüs hat Audi zumindest entrümpelt, sodass man sich nicht durch zahllose Unterpunkte quälen muss und vieles bereits auf der obersten Ebene und auch über Direktwahltasten findet. Das Beifahrerdisplay gibt es im Tech-pro-Paket für happige 8.500 Euro. Das nur wenig konfigurierbare Kombiinstrument bietet freilich sehr viele Funktionen und logische Menüs. Auch die Sprachführung empfanden wir als nahezu perfekt. Immer dargestellt werden am unteren Rand die „Tasten“ für Heizung und Klimaanlage.
Akku. Die neue Lithium-Ionen-Batterie mit erhöhtem Nickelanteil sowie wenig Kobalt und Mangan stellt rund 100 kWh Energie zur Verfügung, die in der Theorie je nach Version bis zu 641 km Fahrstrecke ermöglichen soll. Die Batterie ist 94,9 kWh (netto) groß. Die WLTP-Verbräuche geben die Audianer je nach Version, Ausstattung und Radgröße zwischen 16,0 und 19,7 kWh pro 100 km an. Sie hängen natürlich auch von der Fahrweise ab. Im DMM-Test betrug der Stromverbrauch knapp unter 20 kWh. Audi gibt auch Reichweiten von bis zu 641 km an. In unserem Test schaffte der Q6 e-tron quattro rund 420 km. An Bord sind Plug & Charge sowie Navigation inklusive Planung von Ladestopps und entsprechender Vortemperierung der Batterie. Das AC-Laden funktioniert derzeit nur mit 11 kW. Dafür hat Audi zwei Ladedosen im Fahrzeug untergebracht: den CCS-Anschluss auf der Fahrerseite links, den Typ-2-AC-Anschluss an der rechten Fahrzeugflanke hinten. Eine Wärmepumpe ist immer an Bord.
Technik. Die Technik teilt sich der Q6 e-tron mit dem Porsche Macan (Premium Platform Electric mit 800 Volt). Die Systemleistung liegt im Q6 e-tron quattro bei 387 PS. Mühelos erreicht man Tempo 210 km/h; wir empfehlen aber der Effizienz halber (wegen des Stromverbrauchs) eine eher moderate Fahrweise. Das E-System reagiert feinfühlig, die Rekuperation arbeitet auf Wunsch kräftig, ist mit den Paddles am Lenkrad in drei Stufen verstellbar. Es gibt eine fast perfekt ausgelegte Automatikfunktion und einen One-Pedal-Modus bis zum Stillstand. Auch die Verzögerung funktioniert hervorragend.
Fahreindruck. Der mit 2,5 t bestimmt nicht leichtgewichtige Audi fühlt
„Audis
E-SUV Q6 e-tron hat uns absolut überzeugt. Hohe Fahrkultur, viel Platz und eine ausreichende Reichweite.“
sich erstaunlicherweise ziemlich agil an. Dabei federt der Ingolstädter überaus komfortabel. Die Lenkung wirkt sehr harmonisch. Generell bescheinigen wir dem Ingostädter einen erstklassigen Fahrkomfort, wozu es noch nicht mal das optionale Luftfederfahrwerk braucht. Auch die Akustiker haben ganze Arbeit geleistet. Von der Außenwelt dringt so gut wie nicht nach innen. Nicht vergessen wollen wir die zahlreichen Assistenzsysteme, die einen hervorragenden Job machen. •••
••• Technische Daten und Betriebskosten
L x B (inkl. Sp.) x H mm 4.771 x 2.193 x 1.665
Batterie Leistung (kWh) 94,9
System-Leistung (kW I PS) 285 I 387
Stromverbrauch kWh/100 km 18,9
Max. Drehmoment (Nm) bei min −1 580 ab 0
Beschleunigung (s) 1) I V.max (km/h) 5,9 I 210
CO2 /km/h 0
Reichweite elektrisch km (WLTP) 562
Ladedauer AC Wallbox 11 kW 10 Stunden
Kofferrauminhalt (l) I Zuladung (kg) 511–1.373 I 540
Netto-Preis € (Basis) 64,789,92
Betriebskosten (Cent/km) 86,20 (36 Mon., 40.000 km) 104,30 (60 Mon., 20.000 km)
Versicherung HP I TK I VK 21 I 24 I 27
1) von 0 auf 100 km/h
••• Unsere Meinung
Der Audi Q6 e-tron ist luxuriös, verfügt über State-of-the-Art-Technologien und er ist auch sehr geräumig. Mit dem Q6 e-tron, der wohl zum allergrößten Teil gewerblich genutzt wird, bekommt man ein gut aussehendes SUV, einen Geschäftswagen, der durch sehr gute Fahrleistungen und schnelles Laden besticht. Die Reichweite freilich liegt weit unter dem, was Audi verspricht. Wenn etwas stört, dann ist es schlichtweg der doch recht hohe Preis.


Mit dem Mercedes EQS SUV wurde der Luxuslimousine EQS ein gewaltiges SUV mit über fünf Metern Länge zur Seite gestellt. Es ist das Flaggschiff der elektrischen SUV-Modelle. Gedacht für den chinesischen und US-amerikanischen Markt, findet das SUV auch hierzulande Kunden, die US-Gardemaße nicht stören. Trotz seiner Größe wirkt das EQS SUV aber gefällig in seinen Proportionen. DMM hat dem mächtigen BEV auf die Räder gefühlt.
Unser Testwagen, der EQS SUV 450+ in Sodalithblau, bildet das Einstiegsmodell. Bei ihm sitzt eine 265 kW/360 PS starke E-Maschine auf der Hinterachse. Um es gleich vorweg zu nehmen: Viel komfortabler als im EQS SUV kann man kaum unterwegs sein. In unserem Testwagen blieben beinahe keine Wünsche offen: Angefangen bei Sitzen mit diversen Massagefunktionen über Komfort-Kopfstützen bis hin zum riesigen Panorama-Glasschiebedach. Annehmlichkeiten, wie eine intelligente Laderoutenplanung oder ein adaptives Luftfahrwerk, sind bereits serienmäßig an Bord. Das EQS SUV hat einen enormen Radstand von 3.210 mm, ist jedoch über 20 cm höher als die Limousine. Macht beachtliche Innenraummaße. Auch „Riesen“ mit 2 m und mehr finden komfortabel Platz. Die zweite Sitzreihe kann serienmäßig elektrisch verstellt werden.
Mit ENERGIZING AIR CONTROL Plus sorgt Mercedes-Benz stets für hohe Luftqualität. Der HEPA-Filter (High Efficiency Particulate
Air) filtert auf seinem sehr hohen Filtrationsniveau Feinstaub, Kleinstpartikel, Pollen und weitere Stoffe aus der einströmenden Außenluft. Das Cockpit entspricht 1:1 dem der Limousine. Highlight ist der MBUX Hyperscreen (Sonderausstattung). Diese große, gewölbte Bildschirmeinheit zieht sich schwungvoll nahezu von A-Säule bis A-Säule. Drei Bildschirme sitzen unter einem gemeinsamen Deckglas und verschmelzen optisch. Darstellung, Brillanz und Reaktionsschnelligkeit sind top, Bedienung und Menüführung intuitiv. Wer keine Lust auf klicken hat, drücken oder wischen will, nutzt einfach die MBUX-Sprachsteuerung. Mit lernfähiger Software stellt sich MBUX ganz auf seine Nutzer ein und unterbreitet ihnen personalisierte Vorschläge für zahlreiche Infotainment-, Komfort- und Fahrzeugfunktionen. Mit dem 12,3 Zoll großen OLED-Display für den Beifahrer hat dieser seinen eigenen Anzeige- und Bedienbereich.
Navigation. Die Navigation mit Electric Intelligence plant auf Basis zahlreicher Faktoren die schnellste und komfortabelste Route inklusive Ladestopps und reagiert dynamisch beispielsweise auf Staus oder eine Änderung der Fahrweise. Das hilft freilich wenig; wenn auch die anderen Verkehrsteilnehmer die vorgeschlagenen Umleitungen nutzen. Manuell hinzugefügte Ladestationen entlang der Route werden bei der Routenberechnung präferiert. Vorgeschlagene Ladestationen können ausgeschlossen werden. Die voraussichtlichen Ladekosten pro Ladestopp werden berechnet. Das funktioniert so lala.
Motor. Hohe Motorleistungen und ein Gewicht von über 2,5 t verlangen nicht nur nach einer großen Batterie, sondern auch nach einem leistungsfähigen Lademanagement. Für Zuhause ist ein 11-kW-OnBoard-Charger vorgesehen, 22 kW gibt es als 1.000 Euro teures Extra. An CCS-High-Performance-Ladesäulen (Gleichstrom), wie sie entlang der Autobahnen stehen, sind bis 200 kW Ladeleistung möglich. Der hohe Ladestrom kann möglichst lange konstant gehalten werden.

Der EQS, ein schicker Geschäftswagen, aber leider ziemlich teuer.
Was das Füllen des Akkus angeht, so dauert die Prozedur an Schnellladesäulen mit Gleichstrom per CCS-Stecker auf ca. 80 % der Akkukapazität übliche 30 Minuten.
Ladenetz. Mercedes me Charge ist eines der größten Ladenetzwerke weltweit: Aktuell verfügt es über 700.000 AC- und DC-Ladepunkte, davon rund 300.000 in Europa. Seit 2021 sorgt Mercedes-Benz für einen nachträglichen Ausgleich durch Grünstrom, wenn Kunden über Mercedes me Charge laden. Hochwertige Herkunftsnachweise stellen sicher, dass so viel grüner Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist wird, wie über Mercedes me Charge entnommen wird. Eine feine Sache ist, dass sich der Wagen mit der me Charge Funktion Plug & Charge an Plug & Charge-fähigen öffentlichen Ladesäulen bequem laden lässt. Laut Mercedes wird es für EQE und EQS sowie deren SUVPendants keine Nachfolger geben. Sie verkaufen sich ausgerechnet in den Märkten China und USA schlechter als erhofft und sind schlichtweg zu teuer. •••

Bei 98 % Ladung wollte unser Testwagen keine 300 km weit kommen...
„Der Mercedes EQS SUV ist zweifellos eines der besten Elektroautos, luxuriös, aber für hiesige Verhältnsse doch etwas groß.
••• Technische Daten und Betriebskosten
L x B (inkl. Sp.) x H mm 5.125 x 2.157 x 1.718
Batterie Leistung (kWh) 118
System-Leistung (kW I PS) 265 I 360
Stromverbrauch (kWh/100 km) 22,7–19,3
Max. Drehmoment (Nm) bei min−1 568 bei 0
Beschleunigung (0–100 s I Vmax km/h) 6,8 I 210
CO2/km/h 0
Reichweite (km) (WLTP) 599–705
Ladedauer AC Wallbox (11 kW in Std.) 12,25
Kofferrauminhalt (l) I Zuladung (kg) 645–2.100 I 520
Netto-Preis € (Basis) 93.270,00
Betriebskosten (Cent/km) 132,0 (36 Mon., 40.000 km) 154,3 (60 Mon., 20.000 km)
Versicherung HP I TK I VK 22 I 31 I 29
••• Unsere Meinung
Das elektrische Flaggschiff aus Stuttgart ist unglaublich komfortabel und erstaunlicherweise sehr effizient. Wir hatten einen durchschnittlichen Stromkonsum von 21,2 kWh pro 100 km, Ladeverluste berücksichtigt. Das ist schon bemerkenswert angesichts des Gewichts und der Leistungsfähigkeit des Boliden. Mit der alltagstauglichen Reichweite ist es zumindest in der kalten Jahreszeit nicht weit her. Knappe 360 km sind schon etwas wenig, obschon wir sehr moderat unterwegs waren. In Sachen Fahrkultur ist das SUV absolut top. Die Akustiker haben ganze Arbeit geleistet; denn in allen Fahrsituationen herrscht absolute Stille an Bord. Dass der EQS SUV nicht für jedermann’s Geldbeutel passt, naja, das ist bei der Konkurrenz nicht anders. Teuer ist nicht nur die Anschaffung, ob gekauft, finanziert oder geleast, sondern auch der Unterhalt, wie die hohen Versicherungseinstufungen beweisen. Wir vergeben dem Elektro-SUV die Schulnote 2. Die 1 verpasst das Modell, weil es bei der Reichweite einfach schwächelt.

„Man kann vor BYD eigentlich nur den Hut ziehen. Was die Chinesen auf den Markt bringen, hat Hand und Fuß und ist der deutschen Konkurrenz mindestens ebenbütig.“
Gernot Zielonka I CEO zic
BYD hat in Deutschland Großes vor, das betont der chinesische Autogigant immer wieder. Und tatsächlich: In Q1 2025 legt BYD um mehr als 200 % zu. Schon liegt die weltweite Nr. 3 in Deutschland vor Marken wie Subaru und Lexus. Und so wird es wohl weitergehen. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg dürfte der ATTO 2 sein, das überaus preiswerte und top ausgestattete Kompakt-SUV.
Das SUV verbindet kompakte Abmessungen mit hoher Agilität. Es verfügt über die revolutionäre Blade-Batterie und die innovative Cellto-Body-Bauweise (CTB), hochmoderne intelligente Technologie im Innenraum und eine umfangreiche Serienausstattung, von der sich die deutsche Konkurrenz aber auch die aus Japan und Korea ein paar Scheiben abschneiden darf. Der Wagen zeigt, dass BYD, heute bereits die Nr. 3 der Welt unter den Autobauern hinter Toyota und VW, vergleichbaren deutschen Modellen technisch und in Sachen Ausstattung ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen ist. Wir haben den Atto 2 gefahren. Kleines Fazit vorab: Das SUV eignet sich nicht nur für den Privatmarkt, sondern auch für gewerbliche Kunden. Der Wagen ist vollgepackt mit modernster Technik und der innovativsten Batterie (Bladebatterie), frei von Kobalt, Mangan und Nickel. Und: Der Akku kann nie brennen. Dass der Atto 2 über das beste PreisLeistungsverhältnis aller vergleichbaren Modelle auf den Weltmärkten verfügt, betone Maria Grazia Davino, neue Regional Managing Director für Deutschland, die Schweiz, Polen, Österreich und Tschechien. Von Haus aus verfügt das modern gestylte City-SUV über Vehicle-toLoad-Funktion (V2L), über ein drahtloses Smartphone-Ladedock, über ein Panoramaglasdach, Wärmepumpe, durchgehend elektrisch verstellbare und beheizbare Frontsitze, vegane Lederbezüge, 360°-Kamera an Bord. Und nahezu alle Funktionen lassen sich per Sprachbefehl
(Hey BYD) steuern. Wir haben’s probiert, und es funktionierte wunderbar. Unser Fahreindruck: Der Wagen ist sein Geld allemal wert. Nirgendwo Hartplastik, stattdessen angenehm weiche Umschaumung auch des Cockpits. In Sachen Innenraumakustik präsentiert sich der Atto 2 sogar auf Oberklasse-Niveau.
120 Standorte Ende 2025. Zur Zeit gebe es sechs Partner und 27 Standorte. Bis Ende 2025 soll das Vertriebsnetz auf 120 Standorte wachsen, so Maria Grazia Davino. Patrick Schulz, Director Sales BYD Deutschland, umriss die Vorzüge der jüngsten Kreation von BYD. Die Reichweite der frontgetriebenen Normalversion liegt bei echten 312 km; Im Jahresverlauf werden die Ausstattungslinien Active und Boost des ATTO 2 um eine dritte Variante ergänzt. Der ATTO 2 Comfort bietet eine nochmals größere Reichweite. Er verfügt über eine größere Batterie sowie einen stärkeren Motor und kann rund 420 km zurücklegen. Wer einen Atto erwirbt, bekommt eine sechs Jahre Komplettgarantie (bis 150.000 km Laufleistungen). Auf die vermutlich unverwüstliche Bladebatterie gibt BYD 8 Jahr Garantie.
Interieur. Im Innenraum vereinen sich elegantes Design und hochwertige Materialien mit einem großzügigen Platzangebot und intelligent integrierter Technik. Das Cockpit greift mit klaren Linien das Außendesign auf. Gepolsterte Oberflächen, wie bei den vorderen und hinteren Türgriffen und in der Mittelkonsole, tragen zum Wohlfühlambiente bei. U.a. sein vergleichsweise langer Radstand von 2.620 mm hilft dabei, das Platzangebot im Inneren zu vergrößern. Beide Vordersitze lassen sich in allen Varianten des ATTO 2 elektrisch einstellen. In der höheren der beiden Ausstattungslinien sind die Vordersitze sowie das Lenkrad zudem beheizbar. Die Mittelkonsole enthält zwei Getränkehalter und eine Armlehne, in der eines von mehreren Ablagefächern integriert ist. Der Getriebewählhebel besticht durch eine ausgefallene Diamantenoptik. Wichtige Bedienfunktionen befinden sich auf nebenliegenden Tasten. Dazu gehören beispielsweise die Aktivierung der Lüftung, der Drehregler für die Lautstärke des Soundsystems und der Schalter für die Fahrmodi. Davon gibt es vier Stück, die sich zwischen dem Eco-, Normal-, Sport- und Schnee-Modus unterscheiden.


Das serienmäßige Panorama-Glasdach sorgt für ein lichtdurchflutetes Ambiente im Innenraum. Ein elektrisches Sonnenverdeck garantiert an warmen Tagen stets angenehme Temperaturen im Fahrzeug. Der ATTO 2 nutzt die von BYD entwickelte e-Plattform 3.0, die speziell für Elektroautos entwickelt wurde und sich unter anderem durch einen flachen Boden auszeichnet. So offeriert das Elektro-SUV auch auf der Rückbank ausreichend Bein- und Kopffreiheit. Alle Varianten des BYD ATTO 2 besitzen ein 8,8-Zoll-Instrumentendisplay. Das Infotainment-System kommt in der Active-Version mit 10,1-Zoll-Display, während die Boost-Edition einen 12,8-Zoll-Bildschirm besitzt. Natürlich ist der Wagen in der Lage, Over-the-Air-Update (OTA) zu empfangen. Darüber hinaus erlaubt das System eine kabellose Verbindung von Android Auto und Apple CarPlay.
Batterie. Der ATTO 2 ist mit einer Blade-Batterie mit 45,12 kWh Kapazität ausgestattet, die in Cell-to-Body-Bauweise (CTB) eingesetzt wird. Bei diesem Verfahren ist die Batterie vollständig in das Fahrzeugchassis integriert, wobei die obere Abdeckung der Batterie als Boden für den Fahrgastraum dient. Die Blade-Batterie ist in puncto Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung in ihrer Klasse führend ist. Diese Technologie
L x B (o. Sp.) x H mm 4.310 x 1.830 x 1.675
Batterie Leistung (kWh) 45,1
System-Leistung (kW I PS) 130 I 177
Stromverbrauch (kWh/100 km) 19–16
Max. Drehmoment (Nm) bei min −1 290 bei 0 –
Beschleunigung (s) 1) I V.max (km/h) 7,9 I 160
CO2/km/h 0
Reichweite km (WLTP) 312
Ladedauer AC Wallbox 11 kW 4,5 Stunden
Kofferrauminhalt (l) I Zuladung (kg) 400–1.340 I 410
Netto-Preis € (Basis) 26.882,33
Betriebskosten (Cent/km) 43,0 (36 Mon., 40.000 km) 62,1 (60 Mon., 20.000 km)
Versicherung HP/TK/VK 17 I 23 I 27
erweist sich zudem als äußerst platzsparend, da die rechteckigen, langen Zellen sich nicht in einzelnen Modulen befinden, sondern direkt in den Batteriekörper installiert sind. Dadurch können auf gleicher Fläche mehr Zellen untergebracht werden als bei einer herkömmlichen Akkubauweise. Ein weiteres wichtiges Merkmal: Die BYD-Blade-Batterie verwendet Lithiumeisenphosphat (LFP) als Kathodenmaterial. LFP-Batterien weisen im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-IonenBatterien ein höheres Maß an Sicherheit sowie Haltbarkeit auf und ist zudem umweltfreundlich, da sie zu 100 % frei von giftigen Schwermetallen wie Kobalt und Nickel ist. LFP-Batterien besitzen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen, sind weniger empfindlich bei Temperaturschwankungen und können mehr Lade- und Entladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust überstehen. Über den 65-kW-DC-Lader lässt sich die Batterie in 37 Minuten von 10 auf 80 % ihrer Kapazität laden. Serienmäßig verfügt der BYD ATTO 2 über ein 11-kW-AC-Lader, der die Batterie in fünfeinhalb Stunden von Null auf 100 % bringt. Die serienmäßige Wärmepumpe steigert die Effizienz und die Reichweite unter extremen Bedingungen.
Antrieb. Der Frontmotor leistet 130 kW (177 PS, 290 Nm Drehmomen)So beschleunigt das vorderradangetriebene SUV in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Der ATTO 2 ermöglicht den Zugang zum Fahrzeug auf vielfältige Weise – entweder mit dem regulären Schlüssel oder dank NFC-Technologie mit einer schlanken Schlüsselkarte, einem Smartphone oder einem anderen tragbaren elektronischen Gerät. Der Fernzugriff per Smartphone über die BYD-App ermöglicht es den Nutzern außerdem, verschiedene Fahrzeugfunktionen, darunter die Vorklimatisierung des Innenraums und die Aktivierung der Sitzheizung, zu steuern. •••
••• Unsere Meinung
Die Chinesen und speziell BYD haben es drauf. Der ATTO 2 ist nicht nur optisch ein Hingucker, auch technisch hat er es faustdick hinter den Ohren. Die Reichweite ist zwar mit 312 km überschaubar. Aber mit diesem Wagen bekommt man ein x-fach umweltfreundlicheres Fahrzeug als vergleichbare Verbrenner oder PHEV. Ohne zu übertreiben müssen wir dem Atto 2 eine klare Note 2+ geben was Preis, Leistung und Ausstattung betrifft. Richtig attraktiv werden Kauf, Finanzierung/Leasing aber erst, wenn das Händlernetz ausgebaut ist.

Es ist unzulässig, wenn eine Airline im geschäftlichen Verkehr gegenüber Kunden im Rahmen von Flugbuchungen auf der Internetseite Mietwagenreservierungen anbietet oder anbieten lässt, sie aber nicht darüber informiert, um welche Art von Dienstleistung es sich bei dem Anbieten von Mietautos handelt, wenn sie auf der Website neben der Schaltfläche für Flüge über eine Schaltfläche „Mietwagen“ die Möglichkeit anbietet, Autos zu reservieren und Kunden personenbezogene Daten angeben müssen.
Der Reservierungsvorgang sieht vor, dass beim Anklicken einer Schaltfläche „Mietwagen“ Anmietstation, Rückgabestation und Anmietzeitraum nebst Uhrzeit eingegeben und ein Mietwagen aus einer Liste ausgewählt werden können. Über der Auswahlliste findet sich der Hinweis „Mietwagenreservierung bereitgestellt durch unsere Partner“, gefolgt von Geschäftslogos mehrerer Mietwagenunternehmen mit Preisangaben über diesen Mietwagen. Wird ein Mietwagen ausgewählt, besteht auf einer sich öffnenden weiteren Unterseite die Möglichkeit, Extras hinzu zu buchen. Unter der Warenkorbanzeige findet sich der Hinweis „Mietwagenreservierung. Reservierungen (später bezahlen)“. In einer Fußnote steht: „Es erfolgt eine unverbindliche Reservierung, mit der Sie noch keine Zahlungsverpflichtungen eingehen. Der Vertrag über die Anmietung kommt erst bei Abholung des Fahrzeuges zustande.“
Verbraucher erwarten Klarheit. In der nächsten Schaltfläche, die der Eingabe persönlicher Daten dient, können Allgemeine Geschäftsbedingungen abgerufen und bestätigt werden. In diesen AGB heißt es u.a. „Der Vertrag wird an der Mietwagenstation abgeschlossen. Es gelten die lokalen Geschäftsbedingungen. Nähere Informationen über Ihre spezielle Mietwagenstation finden Sie auf der Webseite des Mietwagenanbieters Ihrer Wahl“. Dort wird auch die Website des Mietwagenunternehmens aufgeführt. Über den Eingabefeldern zur Eingabe der persönlichen Daten findet sich der Hinweis „Die Reservierung Ihres Mietwagens erfolgt direkt über unseren Partner … Der Mietvertrag wird an
der Station geschlossen. Die Zahlung erfolgt bei Anmietung des Fahrzeugs.“
Das Fehlen von Informationen über die Rolle der Fluggesellschaft beim Reservierungsvortrag betrifft eine wesentliche Information über eine Dienstleistung, die der Verbraucher benötigt, um eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob er die Reservierung vornehmen möchte, weil er Klarheit darüber erwartet, ob und inwieweit er den Dienstleister in Bezug auf die Dienstleistung in Anspruch nehmen kann. Die Informationen werden vom Verbraucher daher benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung im Sinne des § 5a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UWG zu treffen. Auch wenn das Mietverhältnis über ein konkretes Fahrzeug nicht schon durch die Ausfüllung der Reservierung entsteht, insbesondere die Fluggesellschaft nicht selbst in die Vermieterstellung rückt, so nimmt die Airline dennoch auf den Inhalt dieses Mietverhältnisses Einfluss. Sie ist nicht derart passiv, dass sie nur ein Buchungsfenster zugänglich macht. Sie baut diese Buchungsmöglichkeit in ihren Webauftritt ein, zudem signalisiert sie durch weitere Angaben, dass bestimmte Vertragsbedingungen (z.B. Freikilometer oder auch ein besonderer Buchungspreis für Flugkunden) in der Reservierung gesichert werden können. Sie nimmt damit einerseits auf die Reservierungsbereitschaft Einfluss, andererseits erweckt sie den Eindruck, dass Kunden besondere Konditionen erhalten. Dies führt sie in die Position eines Dienstleistungserbringers. Wichtig wird das, wenn es Streit darüber gibt, ob die Reservierungsbedingungen auch tatsächlich halten. Das betrifft das Risiko von Flugverspätungen wie das Preisrisiko und die
Frage, ob die reservierte Leistung tatsächlich so wie reserviert auch bereitgestellt wird, und wer für diese Bedingungen einsteht, wenn dem nicht so ist. Wäre dies nur der Mietwagenunternehmer, so bestünde für den Verbraucher das Risiko, dass erhoffte Konditionen von dessen Entscheidung und Bereitschaft abhängen. Ob und wie die Fluggesellschaft für diese Konditionen auch selbst einsteht, sei es durch vertragliche Bedingungen, die sie mit dem Mietwagenunternehmer vereinbart hat, sei es durch eigene Zusatzleistungen (Gewährleistungen), bleibt offen. Bleibt all dies dem Mietwagenunternehmer überlassen, liegt genau hierin eine mögliche Benachteiligung des Flugund Mietwagen Buchenden, der über das Portal bucht, aus der konsequenterweise das Informationsbedürfnis des Verbrauchers folgt.
Unerfüllter Informationsbedarf. Daher besteht aus Verbrauchersicht ein berechtigtes Anliegen, darüber aufgeklärt zu werden, in welcher Rolle die Beklagte vermittelnd oder nur zugangsöffnend oder aber auch mit einer Leis-tungsbereitschaft tätig wird. Die Fluggesellschaft kann nicht darauf verweisen, dass dies dem Verbraucher gleichgültig sei oder der Verbraucher schon selbst verstehen werde, dass er sich nur an das Mietwagenunternehmen halten könne. Schon die Bereitschaft, bestimmte Konditionen im Mietwagenvertrag bereits in der Reservierung sichern zu können und dies über die Vermittlung der Fluggesellschaft zu tun, zeigt, dass ein Informationsbedarf besteht, den die Fluggesellschaft nicht erfüllt. •••
Köln I 08.12.2023 I Az: I-6 U 43/23
Kettenkarambolage vor Gericht Wer zahlt für den Blechschaden? In Osnabrück wurde ein Fall verhandelt, bei dem sich die Frage stellte, wer nach einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten die Verantwortung trägt. Der Fall: Der Sohn des Klägers, der Zeuge W befuhr am 16.01.2020 mit einem Audi A3 des Klägers die Autobahn in Fahrtrichtung A. Vor ihm befand sich der Zeuge X mit seinem VW Golf, hinter ihm die Zeugin Y mit einem bei der Beklagten haftpflichtversicherten Opel Corsa. Vor einer Ampel kollidierten die Fahrzeuge, wobei der Ablauf des Unfalls im Einzelnen streitig ist. Der Kläger verkaufte den A3 am 29.01.2020 zu einem Restwert in Höhe von 1.450,00 €. Mit Anwaltsschreiben vom 05.02.2020 ließ der Kläger die Beklagte unter Fristsetzung auf den 19.02.2020 erfolglos zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 5.798,61 € auffordern. Der Betrag setzte sich aus den folgenden Einzelpositionen zusammen, die Gegenstand der Klage wren: Fahrzeugschaden 4.250,00 €; An- und Abmeldekosten (pauschal) 75,00 €; Nutzungsausfall (20 Tage) 760,00 €; Sachverständigenkosten 688,61 € und Kostenpauschale 25,00 € Der Kläger behauptet, Fahrer W habe den A3 hinter dem Golf bis zum vollständigen Stillstand abgebremst, wobei nicht ausgeschlossen werden könne, dass es einen leichten Kontakt zwischen dem Golf und dem A3 gegeben habe. Sekunden später sei dann Frau Y mit dem von ihr gesteuerten Opel Corsa auf den Audi A3 aufgefahren. Durch die Kollision sei der A3 auf den Golf aufgeschoben worden. Hierdurch sei der A3 an der Front und am Heck erheblich beschädigt worden. Die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges belege, dass der Kläger im Zeitraum 16.01.2020 bis 04.02.2020 (20 Tage) gewillt gewesen sei, sein Fahrzeug zu nutzen. Bei einem angemessenen Tagessatz in Höhe von 38 € ergebe sich ein Nutzungsausfall in Höhe von 760 €. Der Kläger beantragte, die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an ihn 5.798,61 € und Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 20.02.2020 zu zahlen; zudem die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, ihn von der Forderung seiner Prozessbevollmächtigten anlässlich des Verkehrsunfalls vom 16.01.2020 in Höhe von 571,44 € freizustellen. Die Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen. Sie behauptete, der Audi sei mit erheblicher Restgeschwindigkeit auf den Golf aufgefahren. Allein hierdurch sei der Fahrzeugschaden an der Fahrzeugfront des Audi A3 entstanden und ebenso ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wiederbeschaffungswert nach Eintritt des Frontschadens habe allenfalls 2.000 € betragen. Der erst nachträglich eingetretene Heckschaden habe zu keiner Schadenserweiterung mehr geführt. Hinsichtlich der abgetretenen Gutachterkosten sei der Kläger nicht aktivlegitimiert. Das Ersatzfahrzeug sei – wie der vorgelegte Kaufvertrag zeige – unstreitig nicht durch den Kläger angeschafft worden. Der Tagessatz für den Nutzungsausfall liege bei allenfalls 29 €; An- und Abmeldekosten könnten nicht pauschal geltend gemacht werden. Die zulässige Klage hatte nur teilweise Erfolg. Fest steht, dass es schon vor dem Anstoß des Opel Corsa gegen den Audi A3 einen Kontakt zwischen dem A3 und dem vorausfahrenden Golf gegeben hat. Weil dies feststeht, bevor der Corsa auf den A3
aufgefahren ist, kann sich der Kläger nicht auf einen Anscheinsbeweis mit dem Inhalt berufen, dass auch der Frontschaden durch den Letztauffahrenden schuldhaft verursacht worden sei (vgl. OLG München, Endurteil v. 12.5.2017 – 10 U 748/16, BeckRS 2017, 109598 Rn. 6). Aufgrund dieser Bekundungen steht für die Kammer fest, dass alle drei Fahrzeuge vor der Kollision auf eine Ampel zufuhren, der vorausfahrenden Golf aufgrund des Ampelsignals abbremsen und anhalten musste und deshalb auch die nachfolgenden Fahrzeuge hätten abbremsen und anhalten müssen. Vielmehr hätten die Fahrer beider hinterherfahrenden Autos (A3 und Corsa) sicherstellen müssen, dass sie rechtzeitig hinter den an einer Ampelanlage anhaltenden Fahrzeugen zum Stehen kommen. Dem sind die Zeugen X und Y nicht gerecht geworden. Ob dies Folge einer überhöhten Geschwindigkeit, eines zu geringen Abstands oder mangelnder Aufmerksamkeit gewesen ist, ist im Ergebnis irrelevant. Denn in jedem dieser Fälle ergibt sich, dass der Fahrer des hinterherfahrenden Fahrzeuges nicht die für die Fahrt in einer Fahrzeugkolonne erforderlicher Sorgfalt gewahrt hat. Der ersatzfähige Schaden des Klägers beträgt laut Urteil in Summe 2.675,15 €. Die Entscheidung basierte auf der Annahme, dass das hintere Fahrzeug i.d.R. für den Auffahrunfall verantwortlich ist, wenn nicht besondere Umstände vorliegen. Die Kosten des Rechtsstreits wurden zwischen Kläger und Beklagter aufgeteilt. Das Urteil zeigt die Praxis der Gerichte, den Anscheinsbeweis bei Kettenauffahrunfällen anzuwenden, um eine faire und zügige Haftungsverteilung zu erreichen.
LG Osnabrück I Az.: 1 O 1867/20 I Urteil vom 29.03.2022
Flug überbucht …
Eine Fluggesellschaft muss dem/der Betroffenen, auch wenn er/sie freiwillig auf den überbuchten Flug verzichtet hat, nach dessen Wahl eine anderweitige Beförderung zum frühestmöglichen oder, falls entsprechende Plätze verfügbar sind, zu einem dem/der Betroffenen passenden Zeitpunkt anbieten. Falls man den Flug nicht mehr antreten will, muss die Airline den kompletten Flugpreis (einschließlich Steuern und Gebühren) erstatten. In geeigneten Fällen kann die alternative Beförderung zum Endziel auch durch andere Verkehrsmittel wie Eisenbahn, Bus oder Schiff erfolgen. Bietet die Airline keinen oder nur einen unangemessen späten Alternativflug an – und sind günstigere Flüge (auch bei anderen Fluggesellschaften) verfügbar, kann man der Fluggesellschaft eine Frist für ein entsprechendes Angebot setzen. Wie lang eine solche Frist sein muss, hängt davon ab, wieviel Zeit noch bis zum ursprünglich geplanten Abflugtermin verbleibt. Erfahren gebuchte Passagiere z. B. erst am Flughafen von der Überbuchung, können wenige Stunden reichen. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist darf man selbst einen Ersatzflug bei einem anderen Flugunternehmen buchen und die Kosten als Aufwendungsersatz für die Selbsthilfe geltend machen. Nimmt man einen von der Airline angebotenen Ersatzflug an oder bucht man einen Flug im Rahmen der beschriebenen Selbsthilfe, stehen einem Betreuungsleistungen (Mahlzeiten, Erfrischungen, Taxis oder auch ggf. Hotelkosten …) zu, wenn man am Flughafen länger
warten oder einen Hotelaufenthalt verlängern muss. Die Betreuungsleistungen kann man jedoch nicht verlangen, wenn man freiwillig auf den überbuchten Flug verzichtet hat.
Verbraucherzentrale
Reisepass vergessen Wer seinen Reisepass vergisst und deshalb eine gebuchte Reise am Flughafen nicht antreten kann, hat keinen Anspruch auf die Erstattung der Reisekosten. Ein Mann buchte für sich und seine Lebensgefährtin eine Pauschalreise nach Marokko zum Preis von 958 Euro. Der Reiseveranstalter stellte für den Weg zum Flughafen ein „Rail & Fly“Ticket zur Verfügung. Der Zug hatte jedoch am Abreisetag Verspätung. Um den Flug noch rechtzeitig zu erreichen, nahmen die beiden Reisenden für 30 Euro ein Taxi. Am Flughafen stellten sie dann fest, dass sie ihre Pässe vergessen hatten. Für die Einreise nach Marokko ist ein Reisepass aber Pflicht; sie konnten deshalb nicht einchecken. Da den Passagieren kein anderer Flug oder andere Reise angeboten wurden, kündigte der Mann den Reisevertrag und klagte auf Rückzahlung des Reisepreises sowie Erstattung der Taxikosten. Der Bundesgerichtshof hat die Klagen der Kunden abgewiesen. Begründung: Der Kläger kann den Reiseveranstalter nicht dafür verantwortlich machen, dass er am Airport nicht einchecken konnte. Denn der Veranstalter hatte mehrmals auf die Einreisebestimmungen im Zielland aufmerksam gemacht. Der Mann hatte bereits bei der Buchung im Internet bestätigt, dass er die Einreisebestimmungen zur Kenntnis genommen hat.te Demnach ist ein Reisepass für Marokko Pflicht. Mit der Buchungsbestätigung bekam er einen erneuten Hinweis. Dass die Reisenden ohne Pass in Hannover am Flughafen erschienen, habe der Veranstalter deshalb nicht zu vertreten. Der Mann argumentierte dagegen, ihm sei der Check-in nicht wegen der fehlenden Pässe, sondern wegen der späten Ankunft am Flughafen verweigert worden. Grund dafür sei der Ausfall des Zugs gewesen. Das erschien dem Amtsgericht wenig plausibel. Ein Rücktritt vom Reisevertrag komme nicht in Betracht, da die Reise bereits mit der Zugfahrt begonnen hatte: Nach Auffassung des Tichters war der „Zug zum Flug“-Fahrschein eine eigene Reiseleistung Veranstalters und keine vermittelte Fremdleistung der DB. Der Reisende wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass er eine Verbindung wählen soll, mit der er spätestens zwei Stunden vor Abflug am Airport ist. In der Buchungsbestätigung war der „Zug zum Flug“-Fahrschein als inkludierte Zusatzleistung sowie kostenloser Zug zum Flug 2. Klasse bezeichnet. Die Zugverspätung rechtfertigt auch keine Reisepreisminderung. Zum einen war die Beförderung zum Flughafen eine kostenlose Zusatzleis-tung. Zum anderen sei der Stress durch die Zugverspätung eine Unannehmlichkeit, die bei Antritt einer Reise zumutbar sei. Dem Kläger steht auch kein Anspruch auf Erstattung der Taxikosten zu. Zwar habe die Taxifahrt ein späteres Eintreffen am Flughafen verhindert, doch wegen der vergessenen Reisepässe konnte die Reise ohnehin nicht stattfinden. Auf den gesamten Kosten blieb der Mann also sitzen.
Amtsgericht Hannover I Urteil vom 7.10.2016 I Az.: 410 C 3837/16


VORBILD UND MODELL
Es gibt wohl kaum einen Geschäftsreisenden aus der DACH-Region, aus Polen, Tschechien oder Italien, der nicht schon mal in einem Eurocity, mit einer Taurus-E-Lok an der Spitze unterwegs war. 2025 jährt es sich zum 25. Mal, dass die erste von zahlreichen dieser Hightech-Lokomoticen das Siemens-Mobility-Werk in München-Allach verlassen hat. Aktuell fährt einer dieser Taurus als Wien-Botschafter für Wien Tourismus durch halb Europa.
Die Lokomotiven der Reihen 1016, 1116 und 1216 der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind vierachsige elektrische Universallokomotiven, die von Siemens Trnsportation Systems (heute Siemens Mobility) und Kraus Maffei entwickelt wurden. Ein Teil der Fertigung und die Endmontage der Lokomotiven wurde von ÖBB Technische Services im Werk Linz drchgeführt. Die 50 Einsystemlokomotiven der Reihe 1016 und 282 Zweisystemlokomotiven der Reihe 1116 sind seit dem Jahr 2000 bei den ÖBB im Einsatz. Die Maschinen kommen landesweit vor allen Zugarten zum Einsatz. Eine Weiterentwicklung der Fahrzeuge ist die Reihe1216, welche seit 2005 im Einsatz ist. Bei den ÖBB tragen die Lokomotiven den geschützten Namen „Taurus“ (Stierm ein Symbol für Kraft). Laut ÖBB werden die Hightech-Loks nach und nach fit gemacht für weitere 15 Jahre.
Zwar wurden bis 1995 in Form der Reihe 1044 insgesamt 217 neue Hochleistungstriebfahrzeuge beschafft, jedoch war diese Reihe konzeptionell bereits überholt. Spätestens mit der Serienfertigung der DB-Baureihe 120 ab 1987 kam der Durchbruch der Drehstromtechnik, die seitdem aktueller Stand der Technik ist. Daher starteten auch die ÖBB die Entwicklung von Drehstromlokomotiven. Mit den Lokomotiven der Reihen 1012 und 1822 wurden Prototypen beschafft. Diese eigneten sich jedoch nicht als Universallokomotive, die die ÖBB in großer Stückzahl hätten beschaffen können. Im Falle der 1012 war der damalige Stückpreis von 70 Mio. Schilling (5,1 Mio. Euro) enorm hoch, während die ÖBB die Zweisystemlokomotiven der Reihe 1822 aufgrund technischer Komplikationen und damals unklarer Verwendungsmöglichkeiten nicht weiter in Betracht zogen.


Nach Ausschreibung und umfangreicher Prüfung ging Siemens als Sieger hervor. Die ÖBB gaben beim deutschen Technikkonzern 50 Ein- und 25 Zweisystemlokomotiven in Auftrag, verknüpft mit einer Option auf weitere 325 Zweisystemmaschinen. Der Preis pro Lokomotive betrug 2,63 Mio. Euro. Der erste Taurus Taurus (1016 001) wurde am 12. Juli 1999 bei Krauss-Maffei in MünchenAllach offiziell vorgestellt. Die Lokomotiven 1016 002 und 003 folgten kurze Zeit später. Alle weiteren Maschinen wurden im österreichischen Linz gebaut.
Einsatz. Gemäß der Beschaffung als Universallokomotiven werden die Tauri sowohl im schweren Güter- als auch im schnellen Fernverkehr eingesetzt. Die Maschinen sind fast europaweit anzutreffen. 2005 kamen die Taurus 1116 141 und 142 und später die 1016 014


Am 2. September 2006 stellte eine 1216 auf der Schnellfahrtstrecke NürnbergIngolstadt einen neuen GeschwindigkeitsWeltrekord für konventionelle Elektrolokomotiven auf. Die 6.400 kW starke Mehrsystemlok erreichte um 16:03 Uhr auf Höhe von Hilpoltstein (Streckenabschnitt Allersberg–Kinding) die neue Rekordmarke von 357,0 km/h. Sie überbot den Rekord einer französischen BB 9004 mit 331 km/h vom 29. Mai 1955 und wurde damit zur schnellsten Lokomotive der Welt.
und 036 im CAT-Design vor den Doppelstockzügen zwischen Wien City und dem Flughafen zu Einsatz. Am bekanntesten bei Geschäftsreisenden wurde die Tauri als Loks für die Railjet-Garnituren, die u.a. regelmäßig München bedienen sowie bis 2024 vor Railjets, die Wien über Innsbruck, Lindau, Friedrichshafen, Ulm, und Stuttgart mit Frankfurt verbanden. Die Deutsche Bahn orderte seinerzeit 25 Einheiten der 1116 und reihte sie als „182“ in ihen Fuhrpark ein. Die Maschinen sind heute vorwiegend in den neuen Bundesländern vor Regionexpresszüge zu finden.
Weitere Entwicklungen. Eine Weiterentwicklung ist die Reihe 1216, die als Dreisystem-Universallok für Wechselspannungen von 15 und 25 kV sowie 3 kV Gleichspannung ausgelegt ist, bei Bedarf aber auch als Viersystemlokomotive gebaut werden konnte. Diese Lokomotiven sind an zwei Einstiegstüren pro Seite, die in die Führerstände führen, erkennbar. 1216er werden seit Mai 2010 vor den DBÖBB-EC zwischen Norditalien und München grenzüberschreitend eingesetzt und erreichen Verona, Bologna und Venedig.
Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2008 wurden die 1216er vor den EC-Zügen (Graz–Wiener Neustadt–) Wien–Breclav–Prag- Dresden eingesetzt. Am 09. April 2013 wurde die 1216 229 als erste 1216 im ÖBB-Railjet-Design fertiggestellt, sieben wurden im blaugrauen CD-Railjet-Design lackiert. Seit Dezember 2014

Taurus-Varianten mit Weltrekor-Lok.
verkehren die sieben CD-Garnituren gemeinsam mit drei ÖBB-RJ-Garnituren im Zweistundentakt zwischen Graz und Prag. Der CDRailjet 256/257 wurde im Juli 2020 von Prag über Dresden nach Berlin verlängert, ebenfalls bespannt mit einer 1216, abwechselnd mit einer CD- und ÖBB-Maschine.
Neue Johann-Strauss-Lokomotive als Wien-Botschafterin. Wien feiert 2025 den 200. Geburtstag von Johann Strauss. Unter dem Motto „King of Waltz. Queen of Music.“ macht der WienTourismus den Walzerkönig zum Mittelpunkt seines Jahresthemas. Passend dazu haben die ÖBB eine ihrer Lokomotiven in einem beeindruckenden Design zum Strauss-Themenjahr gestaltet. Klaus Garstenauer, Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG, und WienTourismus-Direktor Norbert Kettner tauften die Lokomotive am Wiener Hauptbahnhof, bevor sie sich auf ihre erste Fahrt nach Zürich begab. Die Strauss-Lokomotive wird als rollendes Symbol für Wiens einzigartiges kulturelles Erbe in Europa unterwegs sein – und so die Walzerstadt als internationale Kulturmetropole und beliebtes Reiseziel weiter stärken.
„Rund 30 % der Wien-Gäste kommen mit dem Zug, das sind um ein Drittel mehr als noch vor fünf Jahren. Dieser Erfolg, der sich nahtlos in die Visitor Economy Strategie des WienTourismus einfügt, wäre ohne die enge Kooperation mit unserem langjährigen Partner, den
Etwa 1.500 Menschen verfolgten die rasante Fahrt entlang der Strecke und am Bahnhof Kinding. Gegen 16:30 Uhr traf die Lok dort ein, wo eine Feier und eine Fahrzeugschau stattfanden; dabei konnten auch die beiden französischen RekordLokomotiven besichtigt werden. Die 1216 025 der ÖBB wurde nach der Weltrekordfahrt umlackiert und besitzt seitdem ein dunkelgraues Farbkleid mit auf den Weltrekord hinweisenden Aufschriften.
••• Modelle von Taurus I bis III
Nahezu alle Modellbahnhersteller von Märklin/Trix über Roco, Piko, Fleischmann, Tillig, u.v.a.m. haben Taurus-Loks in allen Spurweiten von N über TT und H0 bis Spur 1 im Sortiment. Vor allem Roco lieferte in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten auch zahllose Modelle mit den beim Vorbild vorhandenen Werbefolien. Die Modell-Tauri der Jahrgänge 2024 und 25 sind i.d.R. voll digitalisiert und optional auch mit Sund-Funktion erhältlich.
Österreichischen Bundesbahnen, nicht möglich. Wien ist Europas am besten per Bahn angebundene Stadt. In bewährter Partnerschaft mit den ÖBB bauen wir auf diese Stärke und schicken anlässlich das Strauss-Jubiläums 2025 eine Wien-Botschafterin auf die Schiene, die Lust auf die Kulturmetropole Wien macht“, betonte WienTourismus Direktor Norbert Kettner. •••





Audi. Vertriebschef Marco Schubert erwartet dank der runderneuerten Modellpalette in 2025 einen deutlichen Rückenwind bei den Absatzzahlen der VW-Premiumtochter. In China lief es 2024 überhaupt nicht rund und was den Markt USA betrifft, dürfte der Optimismus des Vertriebschefs möglicherweise etwas verfrüht sein. Im vorigen Jahr hatten die Ingolstädter beim Fahrzeugabsatz ein Minus von 11,8 % eingefahren. Insbesondere auf dem deutschen Markt gab es ein schwaches Ergebnis von -21 %. Audii bringt ca. 20 neue Modelle auf den Markt und das in einem Mix aus Verbrennern, Plug-in-Hybriden und batterieelektrischen Modellen. In diesem Jahr sind das A5, Q5 und Q3. Zudem erweitern die Ingolstädter ihr PHEV-Angebot auf alle Modellreihen. In Norwegen verkauft Audi 100 % BEV, sehr hohe BEV-Prozentsätzre weisen alle anderen skandinavischen Länder, Niederlande, Belgien und das Vereinigte Königreich auf. Mit temporären Vertriebsaktionen sollen Finanzierung und Leasing von E-utos angekurbelt werden. Eine Frage der mehr der weniger nahen Zukunft wird bei Audi sein, Preisparität zwischen BEV und Vebrennern zu haben.
Genesis. Die Premiummarke wird ab Juni 2025 vollständig in die Struktur von Hyundai Motor Deutschland integriert. Das südkoreanische Fabrikat Genesis kam in Deutschland so gut wie gar nicht an. 2024 gab es nur rund 1.000 Neuzulassungen.
Mercedes. Der schwäbische Autobauer setzt alle Hoffnung auf den neuen elektrischen CLA. Mit der 85 kWh-Batterie soll der Neuling angeblich bis zu 792 km weit kommen. Dank 800 Volt-Technologie können ca. 300 km Strecke in 10 Minuten geladen werden. Der global funktionierende CLA soll Vorreiter von mehr als 20 neuen Modellen bis 2027 sein. Wenn Verbrennungsmotoren kommen, stammen sie von Geely aus China. Die Listenpreise für EQE und das Elektro-Flaggschiff EQS waren in der Vergangenheit für die allermeisten Kunden ein Ausschlusskriterium. 2021 war das Aufsehen groß, als die Schwaben den EQS und 2022 die SUV-Version präsentierten. So rosig die Zukunftsaussichten damals aussehen, so schnell kam schnell die Ernüchterung. Der EQS wird mit der Neuvorstellung der nächsten S-Klasse ohne Nachfolger verschwinden. Der Hintergrund des plötzlichen Aus ist, dass man die S-Klasse zukünftig ebenfalls rein elektrisch anbieten wird und demnach keinen Grund dafür sieht, zwei Modelle parallel in dem schmalen Segment der Luxusklasse zu führen. Die Grundlage des Fahrzeugs könnte die MB.EA Large-Plattform bieten. Bevor es aber soweit ist, gibt es erstmal ein Facelift für die S-Klasse (2026) sowie auch für den EQS (2025). Damit könnte der Stromer auch auf die 800-VoltArchitektur umsteigen und damit die Ladezeiten deutlich reduzieren. Anfang des Jahres wurde die 108-kWh-Batterie gegen eine neue, größere 118-kWh-Eineit getauscht. Kleine optische Veränderungen gab es ebenfalls. Fast ident wie bei der S-Klasse und dem EQS ist man eine Stufe darunter mit der E-Klasse und dem ebenfalls vollelektrischen EQE
aufgestellt. Auch hier gibt es zusätzlich zur Limousine den EQE als SUV. Eine Zusammenlegung von E-Klasse und EQE ist nicht komplett auszuschließen.
Porsche SE. Die Porsche SE, Holding der Familien Porsche und Piëch, will angeblich ins Rüstungsgeschäft einsteigen, um das Portfolio zu erweitern und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Wie berichtet hat die Sportwagenschiede dank massiver Managementfehler 2024 einen Milliarden-Nettoverlust von 20 Mr. Euro eingefahren. Nun hat die Porsche SE u.a. eine Beteiligung am Rüstungs-Start-up Quantum Systems erworben. Das Unternehmen baut militärische Drohnen, die senkrecht starten und landen können. Die Spannweite beträgt 2,80 m, die Rumpflänge 1,63 m. Für einen besseren Transport lassen sie sich zerlegen. Viele europäische Staaten erhöhen derzeit die Verteidigungsausgaben, um der wachsenden Gefahr einer russischen Aggression gegen weitere europäische Staaten entgegenzuwirken. Porsche ist nicht das einzige Unternehmen aus der Automobilindustrie, das sich neuerdings für das Thema interessiert. Rheinmetall signalisierte bereits Interesse am VW-Werk Osnabrück, um dort Militärfahrzeuge zu bauen.
PwC/Bloomberg. 2024 kletterten die weltweiten BEV-Verkäufe um 16 % auf 10,4 Mio. Einheiten. Im Mega-Markt China waren es +53 %, in Großbritannien +23 %. In Deutschland, dem Land, in dm das Automobil erfunden wurde, schrumpften die BEV-Neuzulassungen um -27,5 %. Mittelfristig bis 2040 erwarten die Analysten von Bloomberg einen globalen Marktanteil der BEV von 45 %Treiber der Entwicklung wird China sein. Der VDA erwartet in 2025 einen Anstieg der BEVNezulassungen um 77 % auf 666.000 Einheiten
Tesla. Der Protest gegen Elon Musk und sein Autoimperium Tesla hält in vielen Ländern an. Die Vancouver International Auto Show hat Tesla nun aus Sorgen um die Sicherheit von Besuchern, Ausstellern und Mitarbeitenden von der Teilnahme ausgeschlossen. Musk hatte den nördlichen Nachbarn Kanada mit einem Posting gegen sich aufgebracht, indem er Kanada als keinen echten Staat bezeichnete. Die Ansichten des Chefs beschädigen das Image der Marke. Daher kommt es z.B. auch in Deutschland zu schleppenden Verkäufen. In der Gigafactory Grünheide soll wahrscheinlich Teslas Robotaxi (Basis Model Y) von den Bändern laufen.
VW. Beim geplanten ID.1 müssen die Wolfsburger ihr Preisversprechen halten und dürfen den Elektro-Kleinwagen nicht mit einer zu kleinen Batterie ausstatten. Denn das kleine BEV, das sich im gewerblichen Bereich sehr gut für Liefer- und soziale Dienste eignen wird, soll mindestens 250 km Reichweite haben, Steigen die Wolfsburger mit einem kleineren Akku ein, setzen sie den Erfolg des Stromers aufs Spiel, sagen Experten.


Christiane Benne (57), seit Oktober 2023 Erste Vorsitzende der IG Metall, hat im Aufsichtsrat des VW-Konzerns den Sitz ihres Vorgängers Jörg Hofmann übernommen. Die Dipl-Soziologin wurde gleichzeitig Stellvertreterin des Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch. Benner rückte auch ins Präsidium nach, das die wichtigsten Entscheidungen des Präsidiums vorbereitet.
Susanne Eiber (40) hat die Marketingleitung von BMW Deutschland übernommen. Seit 2021leitete sie die Markenkommunikation und das Produktmarketing von Mini Deutschland. Zuvor war sie Leiterin der BMW-Niederlassung in Mannheim. Sie folgte auf Jennifer Treiber-Ruckenbrod, die jetzt das globale Marketing von Mini verantwortet. Daniela Humele hat die Leitung Marketing und Produktmanagement von MINI Deutschland übernommen. Humele ist seit 1999 bei der BMW Group und verfügt über langjährige Marketingerfahrung.
Melanie Falkenstern (38) hat die alleinige Geschäftsführung von Shell Fleet Solutions in der DACHRegion übernommen Sie verantwortet Mobilitätsdienstleistungen rund um die Shell Card für Pkw, Transporter und Lkw. Falkenstern folgt auf Sönke Kleymann und Silke Evers, die sich das Geschäft bislang geteilt hatten. Shell Fleet Solutions bietet ganzheitliche Mobilitätsdienstleistungen für Flottentypen jeder Art und Größe. In Deutschland und Österreich gehört Shell Recharge schon heute zu den führenden Ladeanbietern, in der Schweiz ist Shell durch die Akquisition von evpass sogar Marktführer. Mit 800.000 Ladepunkten im Roaming-Netz ist Shell einer der größte Ladepartner-Anbieter in Europa.
Wayne Griffiths (59), CEO der spanischen VW-Tochter Seat, hat seinen Job Ende März 2025 hingeworfen. Er hatte seit Oktober 2020 an der Spitze von Seat und dessen Performance-Tochter Cupra gestanden. Insgesamt war der Brite über 30 Jahre bei Volkswagen aktiv. In Spanien übernahm für ihn


vorerst der bisherige Seat-Produktionschef Markus Haupt. Offiziell ist der Engländer auf eigenen Wunsch gegangen und Griffiths wollel sich neuen Herausforderungen widme, schreibt der VWKonzern. Inzwischen ist bekannt, dass Stellantis ihn gerne als CEO verpflichten würde. diums vorbereitet.
Wolfgang Peter Kopplin (57) hat als Deutschlandchef die Schweizer Emil-Frey-Gruppe verlaasen. Der Ex-Ford-Deutschland-Geschäftsführer verantwortete beim Handelsriesen die die Geschäftsaktivitäten außerhalb der Schweiz.
Stefan Kühr ist bei Marriott International neuer Regional Vice President für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er trägt Verantwortung für das gesamte Portfolio von 146 Hotels unter 14 verschiedenen Marken im Premium- und Select-Service-Segment, sowohl im Management als auch im Franchise-Bereich. Bis Dezember 2023 leitete er als Market Vice President Qatar die Vorbereitung auf die Fußball-WM 2022 und koordinierte die Eröffnung von acht Hotels innerhalb von nur vier Monaten. Von 2018 bis 2022 war er ebenfalls als Market Vice President für 24 Hotels in Russland, Kasachstan und Armenien verantwortlich. Zuvor war er in diversen Hotels als General Manager u.a. in Moskau, St. Petersburg und Baku. Kühr verfügt über ein Diplom in Tourismusmanagement sowie in Hotelmanagement der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser. Zusätzlich hat er ein Studium in E-Commerce und General Management of SME an der FH Kufstein absolviert. Weiterbildungen an renommierten Institutionen wie der Harvard Business School, der University of North Carolina und der Cornell University runden sein Profil ab.
Dr. Joachim Post wird bei BMW zum 01. Juni die Nachfolge für das Vorstandsressort Entwicklung von Frank Weber übernehmen. Weber scheidet nach erfolgreichem Abschluss der Serienentwicklung der „Neuen Klasse“ aus seiner Funktion aus. Nachfolger von Joachim Post für das Vorstandsressort Ein-


kauf und Lieferantennetzwerk wird Nicolai Martin. Post trat 2002 in die BMW AG ein und ist seit Januar 2022 Mitglied des Vorstands für Einkauf und Lieferantennetzwerk. Er war zuvor u.a. Leiter Produktlinie Mittelklasse BMW im Ressort Entwicklung sowie Leiter Fahrzeugstrategie. Als Nachfolger für Joachim Post wurde Nicolai Martin zum 01. Juni in den Vorstand der BMW AG berufen. Er ist derzeit Produktlinienleiter Oberklasse BMW, Rolls-Royce und hatte zuvor Führungsfunktionen in Entwicklungsressorts inne. als Vorsitzender von Polestar.
Barbi Reim ist neue Implementierungsmanagerin für Neulunden im Eigenvertrieb bei DER Business Travel. Zuvor war sie als Key Account Managerin bei Lufthansa City Center tätig. In ihrer neuen Rolle verantwortet Reim die Integration neuer Kunden in die Business-Lösungenvon DER BT.
Håkan Samuelsson (74) ist wieder CEO von Volv Cars. Der Verwaltungsrat von Volvo Cars hatte zuvor den bisherigen Vorstandschef, den Briten Jim Rowan, entlassen. Samuelsson soll die Position zwei Jahre bekleiden, bis ein Nachfolger gefunden ist. Rowans Abgang erfolgte nur etwa drei Jahre nach seiner Ernennung im Januar 2022. Der Brite war kurz nach dem Volvo-Börsengang an der Stockholmer Börse auf den Chefsessel gekommen und führte das Unternehmen durch mehrere wirtschaftlich sehr gute Jahre. Samuelsson gehörte dem Vorstand bereits ab 2010 an und war von 2012 bis 2022 Volvo-CEO. Anschließend fungierte er bis 2024 als Vorsitzender von Polestar.
Christine Wolburg hat zum 01. April 2025 die neu geschaffene Position Chief Brand Officer der Marke Volkswagen übernommen. Zudem übernimmt sie die Marketingleitung der Marke Volkswagen von Susanne Franz, die eine andere Aufgabe im Konzern übernehmen wird. Christine Wolburg verfügt über Expertise und Erfahrung sowohl in der Automobilindustrie als auch bei der Entwicklung und Implementierung zukunftswei-


sender Markenerlebnisstrategien. Gemeinsam mit ihrem Team soll sie die Entwicklung einer ganzheitlichen Markenerlebnisstrategie für Volkswagen entwerfen und als zentrale Schnittstelle zu Schlüsselbereichen wie Fahrzeugstrategie, Design, Digital Business und Kommunikation fungieren. Ferner verantwortet sie die Einführung und Umsetzung einer Brand Governance über alle Regionen hinweg mit dem Ziel, ein weltweit einheitliches Markenerlebnis zu schaffen. Wolburg absolvierte bis 2004 ein BWL-Diplomstudium mit Schwerpunkt Marketing in Aschaffenburg. Im Anschluss startete sie bei Mercedes-Benz im Smart-Produktmanagement. Ab 2016 leitete sie fast 5 Jahre die Produktkommunikation für Mercedes Pkw und Smart in Deutschland. 2021 wechselte sie zu den Berliner Verkehrsbetrieben und war dort Head of Sales & Marketing.
Andreas Weber und Maximilian Küppers sind seit 01. April 2025 neue Doppelspitze von DERPART. Beide folgten auf Thomas Osswald, der DERPART Ende März verlassen hat. Andreas Weber, vormals Senior Vice President bei DERPART, verantwortet als Geschäftsführer die operative und kommerzielle Leitung der Reisebüroorganisation. Maximilian Küppers, vormals kaufmännischer Geschäftsführer der ReisebüroKooperationen der DERTOUR Group und Finanzchef der DERTOUR Online GmbH, übernahm als Chief Financial Officer (CFO) die kaufmännische Leitung sowie die Führung des GeschäftsreisenBereichs und der Reisebüro-Technologie. Andreas Weber bringt langjährige Tourisikerfahrung mit. Seinen Werdegang startete der gebürtige Westfale beim Regionalflughafen Dortmund, wo er eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation und ein Studium der Wirtschaftswissenschaften absolvierte. Maximilian Küppers ist ebenfalls aus den Reihen der DERTOUR Group in die DERPART Geschäftsführung gestoßen. Der studierte Betriebswirtschaftler und Reiseverkehrskaufmann ist seit 30 Jahren für die DERTOUR Group tätig.


Kurz nach 11 Uhr ging am 29. Oktober 2024 bei der Polizei die Meldung ein, dass eine Straßenbahn in ein Geschäft in der Storgata im Stadtzentrum von Oslo gefahren sei. Die Straßenbahn kam aus Richtung Jernbanetorget, bevor sie an der Kreuzung in Storgata entgleiste und in das Eplehuset krachte - ein AppleStore. Nach Angaben der Polizei befanden sich etwa 20 Personen an Bord des viergliedrigen blauen Triebzugs, als der Unfall geschah. Neben dem Straßenbahnfahrer wurden vier weitere Personen in der Tram verletzt. Im Apple-Store gab es niemand, der zu Schaden gekommen war. Das Gebäude, in das die Straßenbahn gekracht war, wurde bis zur Untersuchung des Unfalls evakuiert. Nach Zeugenaussagen war die Tram mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs, als sie in der engen Gleiskurve aus den Schienen sprang und in den Store krachte. Verletzt wurde niemand.

Vorschau DMM 07-09.2025

Titelstory
IAA Mobility. Die Messe in München will eine Mobilitätsmesse sein, ist sie aber nicht. Denn die großen Verkehrsträger Luftfahrt und Bahn spielen so gut wie keine Rolle. Das gilt auch für das Fahrrad. Und in Sachen Auto spielt Shanghai die erste Geige.
Aus aktuellem Anlass kann es zu Themen- und Terminänderungen kommen.
Impressum
Anschrift Verlag und Redaktion
Schlütersche Fachmedien GmbH
Geschäftsführung: Ingo Mahl
Hans-Böckler-Allee 7
D-30173 Hannover
Tel. +49(0)5118550-0
E-Mail: info@schluetersche.de www.dmm.travel
Chefredakteur
Gernot Zielonka (v.i.S.d.P)
Tel. +49 (0)9321.23282 I E-Mail: gz@vfm.travel
Redaktion online/Newsletter
Julia Zielonka Tel. +49 (0)9321.23282
E-Mail: jz@vfm.travel; Autorenteam DMM
Anzeigenverkauf
Jürgen Dölling
Tel. +49 (0) 511 8550 2643
E-Mail: juergen.doelling@schluetersche.de
Leserservice/Vertrieb vertrieb@schluetersche.de
Tel. +49(0)5118550-8822
Grafik
HMF GmbH
Im Unterfeld 1 b, 82024 Taufkirchen
E-Mail: m.fischer@hmf-gmbh.com
Polizei holt renitenten Passagier aus dem Flugzeug Ein 53-jähriger Deutscher verhinderte mit aggressivem Verhalten den pünktlichen Start einer Boeing 737 ab Bremen Richtung Palma de Mallorca. Der Mann ignorierte Sicherheitshinweise und pöbelte die KabinenCrew derart an, dass der Pilot kurzerhand die Startposition verließ und zum Gate zurückrollte. Dort wartete bereits die Bundespolizei, die den renitenten Passagier aus dem Flieger holte – seine Ehefrau verließ freiwillig mit ihm das Flugzeug. Beide wurden zur Wache gebracht, der Mann verweigerte einen Atemalkoholtest, gab aber an, vor dem Abflug Alkohol konsumiert zu haben. Die Maschine hob mit 45 Minuten Verspätung ohne das Ehepaar ab. Jetzt droht dem MallorcaFan nicht nur ein sattes Bußgeld – auch Regressforderungen der Airline könnten folgen
Müllwagen rammt Tragfläche
Wegen eines Crashs mit einem Müllwagen brauchten die Passagiere und Crewmitglieder einer B737-800 der American Airlines auf dem Flughafen von Greensboro (North Carolina) viel Geduld. Die Maschine befand sich bereits kurz vor dem Start in Richtung Dallas-Fort Worth International Airport (Texas) als es plötzlich laut knallte. Verursacher war ein Müllwagen, betrieben von einem Vertragspartner der AA, der die linke Tragfläche gerammt hatte und teilweise dort stecken blieb. Das Flugzeug musste aus dem Verkehr gezogen werden. Der Flug nach Dallas konnte erst mit mehreren Stunden Verspätung mit einer Ersatzmaschine durchgeführt werden.

Hotel & MICE
Studie: Deutschland hält seine Spitzenposition im Veranstaltungsmarkt. Dies insbesondere bei Messen und Kongressen.

Geschäftswagen
PHEV. Die Nachfrage nach Plug-in-Hybrid-Modellen bleibt in Fuhrparks auch in 2025 hoch.
SSN Deutsche Bibliothek 1861-2679
Erscheinungsweise vierteljährlich (4 Ausgaben 2025) Bezugspreise/Abonnements Einzelausgabe € 6,50 Jahres-Abo € 42,-
Bankverbindung Commerzbank Hannover
IBAN: DE21 2504 0088 0331 8961 00
BIC: COBADEFXX
Umsatzsteuer: DE 316433496
Für eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Für die namentlich gekennzeichneten Beiträge übernimmt die Redaktion nur die presserechtliche Verantwortung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand Hannover






Unser elektrisches SUV mit Backup-Plan. ¹ WLTP-Reichweite (kombinierte Werte) ² Ersparnis auf Basis der UVP, max. Ersparnis bei der Ultra Dark Business Edition. Angebot gültig bis 30.06.2025. Verbrauch:
Der Volvo XC60 Plug-in Hybrid bietet maximalen Fahrkomfort bei optimierter Effizienz: Mit einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 82 km¹ meistern Sie Ihren Alltag – und für alle längeren Dienstreisen können Sie sich auf den Hybridantrieb verlassen.

volvocars.de/ XC60

Jetzt mit bis zu 9.624 € Hybrid Bonus.²


