SCHLOSSSEITEN
SCHLÖSSER, ARCHITEKTUR, INTERIORS, KUNST UND HANDWERK

SCHLÖSSER, ARCHITEKTUR, INTERIORS, KUNST UND HANDWERK
ITALIENISCHES FLAIR IN DEN ALPEN











erhalten, Verantwortung beweisen. Seit 1994.
Schloss Neudau, erbaut 1740, versichert seit 1994. partner of

kotax.com
SCHLOSSSEITEN – AUSGABE 1/2025

Liebe Leserinnen und Leser!
Der Frühling hält Einzug – eine Zeit des Neubeginns, des Lichts und der Inspiration. Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die Natur wachküssen, erleben wir eine ganz besondere Energie. Diese Saison erinnert uns daran, wie eng Schönheit, Kunst und Lebensraum miteinander verwoben sind –sei es in der Natur, in der Architektur oder in der Fotografie.
Apropos Fotografie: Kaum eine Kunstform vermag es so sehr, das Flüchtige einzufangen und in einen zeitlosen Moment zu verwandeln. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen besondere Perspektiven präsentieren – visuelle Reisen durch Räume und Stimmungen, festgehalten mit einem Blick für das Außergewöhnliche. Ein Meister seines Fachs, der diese Kunst beherrscht, ist Hubertus von Hohenlohe. Sein Gespür für das Besondere und sein Verständnis für Farben, Kontraste und Stimmungen spiegeln sich in seinen Arbeiten wider. Man könnte fast meinen, er sei der Erfinder des Selfies – definitiv sind seine Werke einzigartig: Seite 60. Auch Daisy Seilern berichtet von ihren außergewöhnlichen Erlebnissen in Afrika, wo sie unglaubliche Momente mit den Wildtieren der Welt einfangen durfte. Zudem hatte sie die Möglichkeit, ihre Kunst durch ihre Galerie auf der Art Miami zu präsentieren – und es gelang ihr, international wirklich zu punkten: Seite 70. Jamie McGregor Smith ist für mich aktuell ein Rising Star. Der gebürtige Engländer, der mit seiner Frau und seinen Kindern in Wien lebt, hat bereits für internationale Modekampagnen fotografiert. Außerdem sind seine beeindruckenden Aufnahmen von Kirchen und Industriegebäuden käuflich zu erwerben – ich empfehle Ihnen, jetzt zuzuschlagen!
Dass Interior-Design ebenfalls eine Form der Kunst ist, beweist uns Marie-Caroline Willms auf Seite 90. Räume erzählen Geschichten, sie sind Ausdruck unserer Persönlichkeit. Die hohe Kunst besteht darin, Stoffe und Interior harmonisch zu kombinieren und selbst in Altbauten zum Strahlen zu bringen. In dieser Ausgabe treffen wir zudem auf Herren, die jahrhundertealte Immobilien in die Gegenwart transformieren. Chris Müller, verantwortlich für die Projektentwicklung des Otto-Wagner-Areals in Wien, bezeichnet sich selbst als „charismatischen Visionär, Philanthropen und Vorreiter des digitalen Humanismus in Österreich“. Er berichtet uns von seinen Projekten. Paul Lensing, selbst Immobilienmanager mit dem Fokus auf nachhaltige Immobilien und Stadtentwicklung, wirft einen Blick nach Solomeo, den Geburtsort von Brunello Cucinelli. Der italienische Modedesigner hat das Dorf mit viel Feingefühl restauriert und in ein einzigartiges Juwel verwandelt –mit liebevoll renoviertem Altbestand und behutsamen Neuadaptionen, die sich nahtlos in den bestehenden Stil einfügen. Zudem wurden Arbeitsplätze für Kreative geschaffen und eine Schule für Handwerkskunst gegründet. Lensing meint: „Können wir nicht alle ein bisschen mehr wie Brunello Cucinelli sein?“
Ein hervorragendes Buch zur Geschichte und Bedeutung der Gründerzeithäuser ist „Das Gründerzeithaus – Bewahren. Restaurieren. Bewirtschaften.“ von Dr. Markus P. Swittalek. Es bietet einen umfassenden Überblick über den Gebäudetyp des Zinshauses aus historischer, kultureller und technischer, aber auch aus rechtlicher und wirtschaftlicher Perspektive. Wir trafen ihn zum Interview.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen – genießen Sie unsere SCHLOSSSEITEN!
Ihre Lisa Gasteiger-Rabenstein



Paparazzo seines Lebens


108 SOUND OF ...

Blue, Green, Tracht und Garten
116 HILSCHER KANN KULTUR
Juwelierkunst in München 118 SCHLOSS IM SALZKAMMERGUT ... sucht einen neuen Besitzer 122 OH, DU MEIN ÖSTERREICH
Martina Hohenlohe kocht 128
Wertschätzung für den besten Freund
GUSTAV Der Schlosshund

142 DER TOMATENPRINZ
In Frankreich bei Louis Albert de Broglie
150 GARTENINSPIRATIONEN 154 DIE PERFEKTE VERSICHERUNG ... für ihr Erbe 160 GROSSE FRÜHJAHRSAUKTION
Auf Schloss Ahlden
162 DRY DINNER GIBT ES NIE
Bei Teresa Pagitz 172 NEUES LEBEN IN ALTEM KLEID 174 CHRIS MÜLLER
Innovator von Orten
182 DIE RENAISSANCE UNSERES BAULICHEN ERBES
Paul Lensing lobt Brunello Cucinelli
188 DAS WIENER GRÜNDERZEITHAUS
Architektonisches Erbe



192 SANDERSON

Seit 100 Jahren königlicher Hoflieferant
196 EXQUISITE BÖDEN
Schubert Stone verbindet Tradition & Design
204 SCHLOSS HELLBRUNN
Lebenslust seit 1615
208 RAUM & KLANG Styriarte 2025
210 SALZBURGER HEIMATWERK Eleganz trifft Tradition
212 PLACES2GO Oberösterreich & Salzburg
216 SEEVIBES Chic im Salzkammergut
218 GRAND HOTEL KVARNER PALACE 130 Jahre Eleganz und Erholung
222 DANUBE PRIVATE UNIVERSITY
Wissenschaft, Forschung und Lehre

228 FRÜHLINGSGENUSS in Kitzbühel
230 BILDERWENDE. ZEITENWENDE Fotografie Rupertium
234 SIMULATED GAME DAYS Jagen 2.0
240 LORI ROSENBERG Im Reich der Kamele
246 DIENER SEIN DER HERREN KRANKEN Die Malteser in Österreich
254 VERBALE MÄNNERVERGRÄMUNG Kolumne von Eva-Maria von Schilgen
256 FREUNDSCHAFT Kolumne von Beatrice Tourou

ABO BESTELLEN E-Mail: abo@schlossseiten.at Telefon: +49 40 23670 308










Franziska und Michael Liphart in einem der Wohnräume ihres Schlosses Mühlau mitten in Innsbruck

Das Ehepaar Liphart zog 2023 in das Familienschloss Mühlau ein und brachte damit neues Leben in die geschichtsträchtigen Mauern. Die SCHLOSSSEITEN besuchten das Ehepaar in Tirol und warfen einen interessierten Blick hinter die Fassade des spätbarocken Architekturjuwels.
Text: Beatrice Tourou, Fotos: Lisa Gasteiger-Rabenstein
Manchmal spiele ich schon mit dem Gedanken, wie es sich wohl anfühlt, wenn man in ein ganz leeres Haus einzieht, das man ganzjährig vollumfänglich heizen kann“, erklärt Hausherr Michael Liphart, als wir im Freskensalon des Schlosses stehen und über die weitläufige Gartenanlage blicken.
Zuvor haben wir das Schlossareal durchlaufen, in dem sich auch der private Bereich der Familie Liphart befindet. Zum Anwesen gehören außerdem eine große Kirche und eine kleine Kapelle sowie der ehemalige landwirtschaftliche Teil, der nun Mietwohnungen und ein Architekturbüro beherbergt. Und ein Pavillon, in dem im Sommer Trauungen stattfinden. Die alten Mauern erzählen viel Geschichte, den Rest flüstern die Möbel.
„Egal, welches Möbelstück man öffnet, überall findet man etwas. Die Nachkriegsgeneration hat ja nichts weggeworfen. Da gab es kistenweise Tischdecken mit Löchern, die sorgfältig beschriftet wurden. Aber eben alle kaputt. Allein die Sichtung des Bestands dauerte eine Ewigkeit. Das Entsorgen und Umstellen der Möbel, bevor wir überhaupt behutsam ans Werk gehen konnten, war eine richtige Mammutaufgabe“, erklärt Michael Liphart, dessen Urgroßmutter damals in die vor allem in Tirol und Südtirol bekannte Adelsfamilie Sternbach – und damit in das Schloss und das Erbe – einheiratete.
Das Anwesen liegt nur sieben Fahrradminuten von der Innsbrucker Innenstadt entfernt und ist ideal erreichbar für den gelernten Juristen, der sich gegenwärtig um die Verwaltung des Hauses, den Forst und die eigenen Lie

Ein einzigartiger Ausblick aus dem barocken Prunksaal über die Tiroler Alpenkette. Rustikale Festlichkeit, die man selten in dieser Kombination vereint sieht.
Rechts: Die neuen Schlossherren haben sich mit einer Ahnengalerie der anderen Art (wie der fröhlichen Tapete im Waschbereich) verewigt. Die Vespa ist das favorisierte Fortbewegungsmittel von Michael Liphart.

Wandgestaltung im Laufe der Jahrhunderte im Schloss Mühlau




Vom Boden bis zum Luster –allesamt Originale. Die Fresken und Wandmalereien gehören de facto zum Tiroler Kulturgut. Die Prunkräume werden in den warmen Monaten für Events vermietet.

„Mein
Hausherr Michael Liphart
genschaften kümmert. Franziska Liphart-Paumgartten, gelernte Bildhauerin und Goldschmiedin, konnte ihre Leidenschaft für das Organisieren von Veranstaltungen schon am ersten gemeinsamen Wohnsitz, der Thierburg in Fritzens, ausleben. Die neu organisierte Hochzeitsagenda übernimmt sie gemeinsam mit ihrer Schwägerin Lydia.
Wohnen im Schloss – Herausforderungen und Tradition
Tatsächlich nutzt die Familie Liphart privat eine Wohnung innerhalb des Schlosses. Diese wird mit einer Zentralheizung, unterstützt von Kachelöfen, auch im strengen Tiroler Winter gut gewärmt – allerdings kippt dann die Luftfeuchtigkeit gerne unter 30 %, was die alten Holzmöbel nicht sehr erfreut. „In einem so alten Haus ist es immer ein Abwägen, das lernt man schon als Kind. Es gibt zwar keinen Lift, aber dafür stramme Beine“, erklärt der Schlossherr lachend.
Wer sich eines Familienerbes dieser Dimension annimmt, weiß in der Regel, worauf er sich einlässt – in erster Linie auf den Erhalt des Anwesens. Es gilt, so wenig wie möglich zu veräußern und so viel wie möglich zu restaurieren. Denn der Porsche, der in der Gasse parkt, welche die beiden Anwesen Rizol und Grabenstein zur heutigen Anlage Schloss Mühlau verbindet, gehört einem Mieter. „Mein Porsche steckt in den Dächern“, meint Michael Liphart scherzhaft.
Es ist eine bewusste Entscheidung, die viele alte Familien treffen, wenn sie sich auf ein Leben in geschichtsträchtigen Gemäuern einlassen. Ein solches Haus ist auch immer eine Zeitachse in die Vergangenheit, an der man monarchisches Leben, Weltkriege, Aufstände und Glanzzeiten ablesen kann.
Schloss Mühlau und seine historische Bedeutung Meisterhafte Wandmalereien schmücken die Prunkräume, in denen heute auch Trauungen stattfinden, und bieten einen sagenhaften, unverbauten Blick auf die Gebirgsketten vor Innsbruck. Die barocke und selbstbewusste Frömmigkeit des Bauherrn um 1709 (mit der Familie Sternbach zog das große Vermögen in das Anwesen) ließ damals sowohl eine Schlosskirche als auch eine Schlosskapelle entstehen – ein übliches Merkmal großer Adelssitze und heute willkommenes Asset, um die großen Anwesen auch als Hochzeits-Location bespielen zu können.
Die Gestaltung der Gartenanlage war schon damals mit einem beträchtlichen Arbeitsaufwand verbunden. Umgrabungen auf verschiedenen Niveaus, kunstvolle Parterres,

Boskette sowie eine Gloriette machten den Schlossgarten zu einer beeindruckenden Anlage – auch wenn die Anlage damals gar nicht der tatsächliche Repräsentationssitz der Familie Sternbach war.
Denn Mühlau war niemals das gesellschaftliche Zentrum der Familie – dieses spielte sich in Südtirol ab. Das heutige Schloss Mühlau hatte immer einen eher bäuerlichen Charakter, mit Landwirtschaft und Hühnern im Erdgeschoss.
Höhen und Tiefen der Schlossgeschichte
Nach der wirtschaftlichen Blütezeit folgten schwierige Jahre: Die schrittweise Grundentlastung und die Aufhebung der privaten Gerichtsbarkeit brachten erhebliche Einnahmenverluste. Auch die Erträge aus den Bergwerken in Südtirol, aus denen die Familie Sternbach ursprünglich ihr Vermögen bezog, verloren an Bedeutung.
Während der Franzosenkriege um das Jahr 1809 wurde Theresa Sternbach (geb. Obholzer) zu einer der Hauptfiguren des Freiheitskampfes. Ihr mutiger Einsatz bei der Bewaffnung, Ausrüstung und Verpflegung der Kämpfer führte zu ihrer Verhaftung und Deportation nach Frankreich. Sie überstand alles mit „männlicher Tapferkeit“ und erhielt für ihre Verdienste eine hohe Auszeichnung des Kaisers.
Dennoch brachte ihre bürgerliche Herkunft Schwierigkeiten mit sich. Die finanziellen Verluste der Kriegstage waren beträchtlich, und die Plünderung des Schlosses hinterließ tiefe Spuren. Der langsame Niedergang begann.
Im Jahr 1931 starb der Mühlauer Zweig der Familie Sternbach aus. Erst als Michael Lipharts Großmutter in die Familie und in das Schloss einheiratete, wurde mit großen Anstrengungen daran gearbeitet, Schloss Mühlau



Picknick oder Ja-Wort? Wenn der Pavillon nicht gerade von einer Hochzeitsgesellschaft bespielt wird, dann vom Nachwuchs der Hausherren.


in seiner ursprünglichen Schönheit wieder zum Leben zu erwecken.
Besonders aber lagen Dr. Bernhard Liphart – Michaels Onkel und langjähriger Präsident des Österreichischen Burgenvereins – die Restaurierung sowie der Erhalt der prunkvollen Repräsentationsräume inklusive der Kapellen mit ihren Deckenfresken und Stuckarbeiten sehr am Herzen. Mit viel Engagement und Kunstverständnis seinerseits wurden diese der nächsten Generation in bestem Zustand überlassen.
Schloss Mühlau heute – eine Spurensuche Heute ist Schloss Mühlau eines der reizvollsten, aber weniger bekannten historischen Gebäude Innsbrucks, da es bis vor Kurzem der Öffentlichkeit so gut wie nicht zugänglich war. Die jetzigen Schlossherren, Franziska und Michael Liphart, vermieten bestimmte Teile des Schlosses, die barocke Schlosskapelle sowie die Gartenanlage für festliche Anlässe. So wird das historische Bauwerk in den warmen Monaten mit Leben gefüllt. „Vieles finden wir erst langsam heraus. Die Orangerie beispielsweise war damals mit einem eigenen Heizsystem ausgestattet worden“, erzählt Michael Liphart.
Das ist aber schon längst Vergangenheit, genauso wie der hauseigene Heizer, der gleichzeitig als Gärtner tätig war und nach seiner Einberufung in den Feldzug gegen Russland durch einen Traktor ersetzt wurde, der heute noch vom Schlossherrn höchstpersönlich gefahren wird.
Franziska kümmert sich um das Interior und die Wohnlichkeit der Privaträume. Die Liebe zur Farbe ist ersichtlich.
Einmal im Jahr werden die Hecken geschnitten, und punktuell wird zudem noch ein wenig Hilfe eingekauft, um den Garten in Schuss zu halten. Denn die wilde Weitläufigkeit allein in den Griff zu bekommen, erweist sich dann doch als eher schwierig. Selbst Hand anzulegen, ist für das Ehepaar aber selbstverständlich: „Wir haben tage-, wenn nicht sogar wochenlang alte Leimfarbe von den Wänden gekratzt und mussten an vielen Stellen neu verspachteln“, erinnert sich das Ehepaar Liphart. Und auch jetzt gibt es nach wie vor an zahlreichen Ecken und Enden ständig etwas zu tun, denn ein so altes Haus ist ja niemals komplett fertig. „Ist man dann endlich durch, muss man wieder von vorn anfangen.“ Aber das dürfte künftig die Aufgabe des Filius sein, der bereits heute von seinen Eltern lernt, was es bedeutet, ein Anwesen wie das Schloss Mühlau erfolgreich in die Zukunft zu führen.
SCHLOSS MÜHLAU
Jetzt auch für Hochzeiten, Taufen und private Events zu mieten: Sternbachplatz 1 6020 Innsbruck schlossmuehlau-events@gmx.at Tel.: +43 699 10374372 www.schloss-muehlau-events.com

Das Boutiquehotel mit exzellenter Küche versprüht eine einzigartige Atmosphäre. Diese verleihen nicht nur die alte Mauern des Hauses, denn das ganze Team empfängt mit Charme, welcher selten noch zu finden ist. Auch die liebevoll eingerichteten und mit Antiquitäten ausgestatteten Zimmer im originalen BiedermeierStil schaffen eine warme und stilvolle Umgebung.
Kulinarisch verwöhnt das erstklassige Restaurant mit raffinierten Gerichten, kreiert von Laura Pichler und ihrem Team. Regionale Zutaten stehen im Mittelpunkt – Wild kommt größtenteils aus der hauseigenen Jagd im Lungau, Obst, Gemüse und Eier stammen von Bauern aus der Umgebung. Besonders beliebt für ein Mittagessen ist der idyllische Garten – ein Tisch sollte unbedingt reserviert werden. Die Umgebung lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein – direkt nebenan liegt das verwunschene Schloss Anif. Das großzügige
Zimmerdesign kombiniert nostalgisches Flair mit modernem Komfort. Hier wird Gastfreundschaft großgeschrieben – ein perfekter Rückzugsort für Genießer.

INFOBOX
Schlosswirt zu Anif
Salzachtalbundesstraße 7, 5081 Anif T: +43 6246 72175
M: info@schlosswirt-anif.at schlosswirt-anif.at

Tirol PLACES TO GO
Könnten die Wände des Hotels Schwarzer Adler sprechen, würden sie von Kaisern, Rebellen und flüchtenden Prinzessinnen erzählen. Seit über 500 Jahren prägt das Haus Innsbrucks Geschichte. Hoteliersfamilie Ultsch bewahrt dieses Erbe seit dem Jahr 1918 – Inhaberin Sonja Ultsch teilt es gern mit ihren Gästen.
Das historische Wirtsschild mit dem Habsburger Doppeladler erinnert an die Zeit, als Kaiser Maximilian I. Innsbruck zur Finanzhauptstadt machte. In seiner Nähe ließ er das berühmte Goldene Dachl errichten. Die heutige Tiroler Landeshauptstadt war damals Dreh- und Angelpunkt des Adels. Wohlhabende Bürger wandelten die einstige Herberge in ein Patrizierhaus um. Im 18. Jahrhundert machte eine Prinzessin auf der Flucht den Schwarzen Adler zur königlichen Zuflucht. Maria Clementina Sobieska, die polnische Königstochter, versteckte sich hier vor
der britischen Regierung, um heimlich ihrem Verlobten, König James III., zu begegnen. In der Eile ließ sie ihre Kronjuwelen zurück – heute erinnert der Swarovski Signature Room mit funkelnden Kristallen an ihre Geschichte.
Auch der Tiroler Rebellenführer Andreas Hofer hinterließ Spuren im Hotel. 1809 lagerte er hier Beutegut nach seinem Sieg über die Bayern auf dem Bergisel. Bis heute passieren Gäste die Tische, an denen er einst mit seinen Mitstreitern saß.
INFOBOX
Hotel Schwarzer Adler Innsbruck Kaiserjägerstraße 2 6020 Innsbruck Tel.: +43 512 587109 info@deradler.com deradler.com

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman
Aktuelle Ausstellung: „Der Himmel trägt Rosa heut Nacht“ von Künstler Johannes Kofler. Mit großer Beharrlichkeit treibt Johannes Kofler die Entwicklung seines Werkes voran, sich stets der Herausforderungen bewusst, einen eigenständigen Beitrag zur zeitgenössischen Malerei zu leisten.

Stay Away From Gretchen
Die Geschichte erzählt von der Beziehung eines deutschen Soldaten zu einer jungen Frau in einem von den Nazis kontrollierten Umfeld. Ihre Liebe wird durch Rassismus und die nationalsozialistische Ideologie erschwert, da die Frau einer anderen ethnischen Herkunft angehört. Gesellschaft und militärische Normen lehnen ihre Verbindung ab, was die tiefen Wurzeln der Rassenideologie verdeutlicht. Ein wunderschönes Buch, sehr berührend.
GASTHAUS ZUM WILDEN MANN
„Es ist immer eine gute Adresse für besondere Anlässe. Wenn wir internationale Freunde in Innsbruck zu Gast haben, fahren sie gerne nach Lans in das authentische Restaurant.“
www.wildermann-lans.at


Gründerin von thelineup.at
Die studierte Kunsthistorikerin, die an der Columbia University in New York studierte, hat ihren Lebensmittelpunkt in Innsbruck gefunden. Nach internationaler Tätigkeit in der Kunstszene gründete sie The Line Up, eine Plattform zur Förderung zeitgenössischer Kunst. Zuvor war sie Projektmanagerin bei Fürstenberg Zeitgenössisch, aktuell leitet sie Fundraising-Projekte am Tiroler Landesmuseum. Neben ihrer Arbeit als zweifache Mutter genießt sie Kultur und gutes Essen.

ANNA LERCHBAUMER
Die in Innsbruck geborene und in Wien lebende Künstlerin Anna Lerchbaumer erforscht in ihren Werken die Beziehung zwischen Umwelt, Mensch und Technologie. Sie kombiniert traditionell gedrechseltes Holz mit modernen Materialien wie 3D-Druck und Industriemetall und schafft so Skulpturen, die Verfall, Geschlecht und Konnektivität hinterfragen.

RESORT INNSBRUCK
Ein tolles Geschäft mit den verschiedensten Angeboten von Interiors über Duftkerzen bis Parfums. Aber auch besondere Accessoires kann man dort entdecken. Am liebsten gehe ich dahin, wenn ich ein Geschenk für jemanden benötige. Sehr inspirierend, und man findet immer etwas Passendes. Hier ein Duft von WienerBlut® namens „Hesperia“ – ein aromatischer Duft mit Zitrusnoten. www.resort-innsbruck.com

MARIA KÖFLER
Titel der Arbeit: „Silence“, Öl auf Leinwand, 220 x 160 cm, 2024 Was mich besonders an Maria Köflers Œuvre interessiert, ist ihre spielerische Art, tiefsinnige Themen zu bearbeiten. Silence ist eine deutungsoffene Einladung an seinen Betrachter, an der Grenze zwischen Landschaftsbild und Abstraktion.



















A.E. Köchert
Neuer Markt 15 · 1010 Wien (43-1) 512 58 28

A.E. Köchert
Alter Markt 15 · 5020 Salzburg (43-662) 84 33 98 www.koechert.com



Dagobert Peche, Porträt, 1920
DAGOBERT PECHE UND SEINE SPUREN IN DER GEGENWART
Das „Ornamentgenie“ Dagobert Peche (1887–1923) ließ die Formensprache der Wiener Werkstätte (WW) gleichsam explodieren: Auf die Geometrie der WW-Gründer Josef Hoffmann und Koloman Moser antwortete er mit opulenten und poppigen, aus der Natur gewonnenen Dekoren. Gebrauchsgegenständen verlieh er eine Vielschichtigkeit, die Logik und Nutzwert bewusst unterlief.
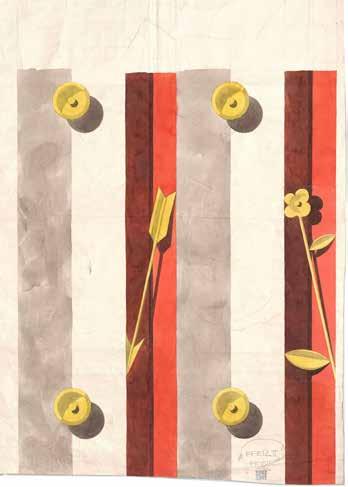

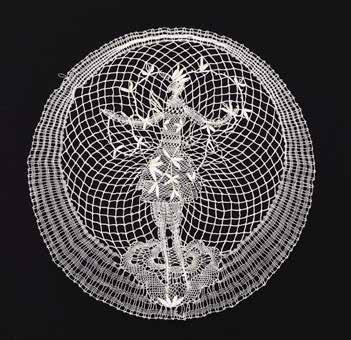

Links oben: Dagobert Peche, WW-Tapete „Pfeil“, 1921 | Rechts oben: Dagobert Peche, Spitzeneinsatz Frühling, um 1920
Links unten: Uli Aigner, OFFENE FORM 85 – Dagobert Peche und Ich – Die Überwindung der Utilität, 2018 Rechts unten: Dagobert Peche, Wiener Werkstätte, Tapete „Schilf II“, 1922
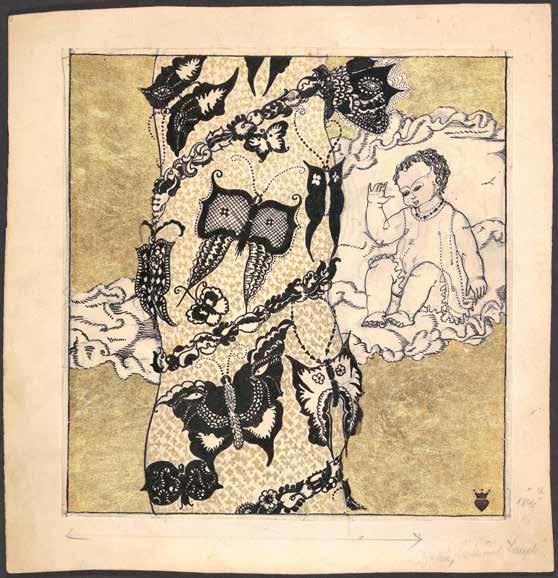
Dagobert Peche, Motiv aus dem Zyklus „Liebe und Tand“, 1912
Nach mehr als einem Vierteljahrhundert widmet das MAK dem Visionär und „Enfant terrible“ der Wiener Werkstätte erneut eine Großausstellung. Rund 650 Objekte zeigen den unverwechselbaren Peche-Kosmos und die faszinierende Wirkung seiner Arbeiten auf das Design des 20. und 21. Jahrhunderts auf – vom Artdéco-Stil über die Postmoderne bis in die Gegenwart.
Es war Josef Hoffmann, der Dagobert Peche als „das größte Ornamentgenie, das Österreich seit der Barocke besessen hat“ bezeichnete – so erzählt es die Journalistin Berta Zuckerkandl 1923 in ihrem Nachruf auf den Künstler. Tatsächlich führte Peche die Formensprache der Wiener Werkstätte in eine gänzlich neue Richtung: weg von der Geometrie und hin zu opulenten Dekoren, die er aus der Natur gewann. Er arbeitete mit unterschiedlichen Materialien – Silber, Glas, Keramik, Leder und Papier –, entwarf Schmuck, Möbel und Ausstellungs-Displays sowie sensationelle Stoffmuster.
1887 in St. Michael im Lungau geboren, wächst Dagobert Peche in Oberösterreich auf und maturiert 1906 in Salzburg. Eigentlich will er Maler werden, studiert aber auf Wunsch des Vaters Architektur in Wien an der Technischen Hochschule sowie an der Akademie der bildenden Künste bei Friedrich Ohmann. Als Vertreter einer romantisch-malerischen Richtung fördert dieser Peches emotionalen Zugang zum Objekt sowie dessen zeichnerisches Talent. Bezeichnenderweise schlägt sich eine Reise nach England mit dem Architektenverein nicht in baulichen Entwürfen, sondern in deutlich von Aubrey Beardsley (1870–1898) beeinflussten Grafikzyklen nieder. Auf einer Reise nach Paris wiederum entdeckt Peche im Jahr 1912 die Kunstgewerbesammlungen des Louvre und kreiert nach der Rückkehr seinen „Ersten Sessel“ in der Art des Rokokos.
Nachdem ihn Josef Hoffmann 1915 als Entwerfer in die Wiener Werkstätte geholt hat, inszeniert Peche die Modeausstellung 1915/16 im ehemaligen Öster

Dagobert Peche, Möbel aus der Wohnung von Wolko Gartenberg
reichischen Museum für Kunst und Industrie (heute MAK). Er verwandelt die Säulenhalle in eine weißrosa Tüllwelt mit geheimnisvollen dunklen Umgängen. Wenig später wird er Leiter der neuen WW-Zweigstelle in Zürich und gestaltet das dortige Geschäft als Daphne-Paraphrase mit hängenden Fruchtgirlanden und sprießenden Blattmotiven.
Aus der Schweizer Idylle kehrt Peche 1919 zurück in das Nachkriegswien, wo er eine baufällige Wohnung beziehen muss. Der Architekt von Luxuswohnungen ist Opfer der Wiener Wohnungsnot und haust in einem maroden Loch. Spätestens jetzt kommt das Unheimliche in Peches Werk zum Vorschein: Die Formen verfestigen sich, das Ornament wird herb und scharfkantig. Er beschreibt sich selbst als „Mumie, die schon lange hat geruht in jenem Sarkophag, beklebt mit viel Papier, umwickelt mit den toten Blumen aus Brokat …“.
Doch bevor der „Künstler-Handwerker“, wie ihn der Peche-Biograf Max Eisler so treffend bezeichnet, 1923 an einer Krebserkrankung stirbt, hat er noch große Auftritte. Mit seinen monumentalen Kästen auf der Kunstschau 1920 spaltet er die Kritik, die entweder von „schrankenlosester Abgeschmacktheit“ spricht oder von der „erfrischenden Belebung des Wohnraums durch dekorativen Instinkt“. Außerordentlichen Erfolg hat Peche 1922 mit einer WW-Tapetenkollektion, ausgeführt von der Kölner Firma Flammersheim & Steinmann. Hier zieht er noch einmal alle Register, schichtet verschiedene Muster übereinander oder erfindet „elementare“ Motive wie „Das Wasser“ oder „Der Stein“. Das von ihm so geschätzte Ombré, ein Farbverlauf von dunkel zu hell, charakterisiert seine
letzten Wohnungseinrichtungen, etwa für den Wiener Architekten, Designer und Kunstsammler Wilhelm (Wolko) Gartenberg.
In Dialog mit Peches Werk treten in der Ausstellung Arbeiten unter anderem von: Uli Aigner, Richard Artschwager, Friedrich von Berzeviczy-Pallavicini, Götz Bury, Marco Dessí, Hans Hollein, Jakob Lena Knebl, Adolf Krischanitz, Claude Lalanne, Alessandro Mendini, Olaf Nicolai, Michèle Pagel, Gio Ponti, Nathalie du Pasquier, Bořek Šípek, Andreas Slominski, Robert Smithson, Ettore Sottsass, Philippe Starck, Robert Venturi, Franz West, Vivienne Westwood, Wiener Times, Maria Ziegelböck und Heimo Zobernig.

MAK Ausstellungshalle EG
Stubenring 5, 1010 Wien bis 11. Mai 2025
Di. 10–21 Uhr, Mi. bis So. 10–18 Uhr www.mak.at



Investieren Sie jetzt in ein Zinshaus von JP in bester Lage. Denn keine Anlageform ist aktuell so krisensicher wie ein Investment in Immobilien. Lassen Sie sich ausführlich von unseren Spezialist*innen beraten, und wir sind uns sicher: Gemeinsam finden wir das Richtige für Sie.
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Projekte:
→ zinshaus@jpi.at
Atelier d’Ora, Emilie Flöge in einem Kleid aus dem Salon „Schwestern Flöge“

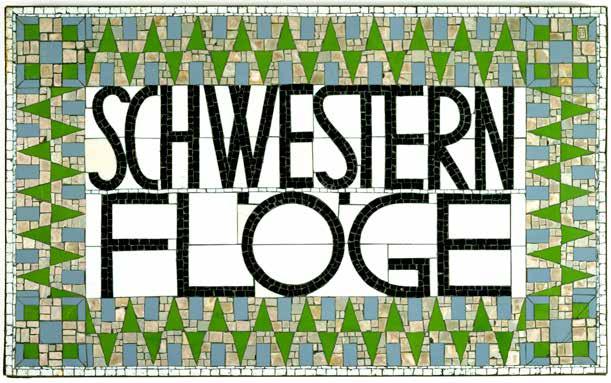
Der Serie 2. Teil
Gustav Klimt (1862–1918), einer der bedeutendsten Künstler des Wiener Jugendstils, war nicht nur für seine Kunst bekannt, sondern auch für zahlreiche Liebschaften. Meist waren es sehr junge Frauen aus einfachen Verhältnissen – Dienstmädchen, Näherinnen und Wäscherinnen –, die sich als Aktmodelle etwas dazuverdienten. Aktdarstellungen spielten eine zentrale Rolle in Klimts Werk, und so hielten sich in seinem Atelier häufig nackte Mädchen auf. Hier fertigte er jene Skizzen und Zeichnungen an, es sollen an die 4000 Blätter gewesen sein, die sie in sinnlichen, erotischen Posen zeigen. 250 Modelle notierte Klimt in seinem Notizbuch, ihre Namen kürzte er ab; drei davon sind als Mütter seiner Kinder bekannt. Aber auch einigen der von ihm porträtierten Damen der Gesellschaft sagte man eine intime Beziehung zu dem Maler nach.
Klimts Affären waren meist nur von kurzer Dauer – doch es gab eine Ausnahme: Mit Emilie Flöge pflegte der Maler bis zu seinem Tod eine enge Verbindung, die von tiefer Nähe und gegenseitiger Zuneigung geprägt war. Klimt und Flöge wohnten nie zusammen; er lebte bei seiner Mutter und zwei Schwestern, sie in einer eigenen Wohnung. Bis heute ist nicht eindeutig erwiesen, ob sie jemals eine intime Beziehung hatten.


Gustav Klimt ist 28 Jahre alt, als er die erst 16-jährige Emilie Flöge kennenlernt. Ihre Beziehung ist ein faszinierendes Beispiel einer künstlerischen und emotionalen Partnerschaft, die sich über die gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit hinwegsetzt. Die beiden werden so oft zusammen gesehen, dass Emilie in der Wiener Gesellschaft mit „Frau Klimt“ angesprochen wird. Mit ihren unkonventionellen Entwürfen, ihrem Engagement in der Wiener Avantgarde und ihrem ausgezeichneten Geschäftssinn wurde Emilie Flöge zu einer Pionierin der modernen Frau.
Emilie Flöge entstammte einer gutbürgerlichen Familie; sie war die jüngste der drei Töchter des erfolgreichen Drechselmeisters und Meerschaumfabrikanten Hermann Flöge, der seine Erzeugnisse bis nach England exportierte.
Gustav Klimt lernt sie um 1890 kennen, als sich sein Bruder Ernst mit ihrer Schwester Helene verlobt und diese im Jahr darauf heiratet. Im selben Jahr porträtiert Klimt Emilie Flöge zum ersten Mal als Zuschauerin in der Menschenmenge auf dem Ölgemälde „Der Hanswurst auf der Jahrmarktsbühne in Rothenburg ob der
Tauber“. Das Sujet verwenden die beiden Brüder für ein Deckengemälde im Stiegenhaus des Burgtheaters. Als Ernst 1892 stirbt, übernimmt Gustav Klimt die Vormundschaft für dessen Tochter Helene und unterstützt die Witwe seines Bruders.
Wie ihre Schwestern Pauline und Helene erlernt auch Emilie Flöge nach der Grundschule den Beruf der Schneiderin. Pauline eröffnet 1894 eine private Lehranstalt für Kleidermacher. Mit einem Großauftrag für die Arbeitskleidung der Teilnehmerinnen einer Kochausstellung erwirtschaften die Schwestern das Startkapital für einen eigenen Modesalon. Zu-

„Das reizvolle Antlitz, subtil und fein modellirt, wird durch die seltene Umrahmung noch gehoben, Das Haupt umgibt ein aureolartiger grün-blauer Blüthenkranz, der die Farbenmystik byzantinischer Hintergründe hat.“
Berta Zuckerkandl (1864–1945).
Wiener Salonnière und Kunstkritikerin, 1908
nächst befindet sich dieser in der Neubaugasse in Wien; 1904 übersiedelt die Werkstätte in die Mariahilfer Straße 1 in die erste Etage über dem bekannten Café Casa Piccola.
So innovativ wie Emilie Flöges Modeentwürfe ist auch das Unternehmenskonzept des Salons. Mit der Inneneinrichtung werden Kolo Moser und Josef Hoffmann von der 1903 gegründeten Wiener Werkstätte beauftragt; das Signet des Unternehmens entwirft Gustav Klimt. Vom Ladenschild über die Drucksachen, das Briefpapier und die Rechnungen bis hin zu den Stoffetiketten für die Kleider wird der Auftritt des Salons einheitlich gestaltet. Mit der Veröffentlichung von Fotografien von Kreationen aus dem Salon wird in Kunstzeitschriften in Österreich und Deutschland geworben.
Bald zählt der Modesalon „Schwestern Flöge“ zu einem der exklusivsten Wiens und beschäftigt zeitweise 80 Schneiderinnen sowie drei Zuschneider. Die Schwestern teilen sich die Arbeit: Helene ist für die Betreuung der Kundinnen zuständig, Pauline leitet das Büro, Emilie ist die Chefdesignerin. Die Architektin Liane Zimbler (1892–1987) wird als Modedesignerin engagiert; angefertigt wird ebenso nach Entwürfen der von Eduard Josef Wimmer-Wisgrill geleiteten Modeklasse der Wiener Werkstätte, und auch Gustav Klimt soll Ideen geliefert haben.
Neben der konventionellen Mode widmet sich Emilie Flöge dem sogenannten „Reformkleid“. Im Gegensatz zu den engen, taillierten Kleidern der damaligen Zeit verzichtet dieses auf Korsett und Schnürungen, betont weder Taille noch Brust und ermöglichte es den Frauen, sich freier zu bewegen. So wird das Reformkleid zu einem Symbol der Emanzipation und Ausdruck der modernen Frauenbewegung, die sich für mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit einsetzt.


Der Salon profitiert von den künstlerischen Kontakten Klimts. Er empfiehlt ihn den von ihm porträtierten Damen der Gesellschaft, darunter Adele Bloch Bauer (1881–1925), Margarethe Stonborough-Wittgenstein (1882–1958) und Berta Zuckerkandl (1864-1945).
Die Sommermonate verbringt Emilie Flöge von 1900 bis 1912 und von 1914 bis 1917 mit Gustav Klimt in der Villa Paulick in Seewalchen am Attersee. 1902 malt Gustav Klimt ein Ganzkörperporträt von ihr, das 1903 in der Secession erstmals ausgestellt wird.
Sowohl Emilie als auch ihrer Mutter gefällt das Bild jedoch nicht, und so verkauft es Klimt 1908 an das Niederösterreichische Landesmuseum; heute befindet es sich im Wien Museum am Karlsplatz.
Mehrmals im Jahr reist Emilie Flöge nach Paris, um sich bei internationalen Modehäusern über die aktuellen Trends zu informieren und Stoffe zu kaufen, viele davon mit kunstvollen, abstrakten Mustern. Manche Kunsthistoriker vermuten, dass Klimts berühmte, ornamental reich gestaltete Goldperiodenwerke von Flöges textilen Kreationen inspiriert worden waren.
1918 stirbt Gustav Klimt. Emilie Flöge soll danach im Atelier körbeweise Aufzeichnungen und Briefe verbrannt haben.
Während der Salon die Auswirkungen des 1. Weltkriegs fast unbeschadet übersteht, haben die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre sowie der aufkommende National-
sozialismus gravierende Auswirkungen auf das Unternehmen. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich (1938) schließt Emilie Flöge das Geschäft, denn viele ihrer vermögenden jüdischen Kundinnen werden vertrieben oder ermordet. Sie übersiedelt mit einem Teil der Einrichtung des Salons in eine Wohnung in der Ungargasse 3, wo sie bis zu ihrem Tod bleibt. 1945 bricht in der Wohnung ein Brand aus, der einen Großteil ihrer Textilsammlung, fast sämtliche Möbel und viele wertvolle Gegenstände von Klimt zerstört. Am 25. Mai 1952 stirbt Emilie Flöge; ihr Grab befindet sich am Wiener Zentralfriedhof.
Emilie Flöge hinterließ Schmuck und Objekte der Wiener Werkstätte, außerdem eine Sammlung textiler Volkskunst, die sie in einer Vitrine des eleganten Empfangsraums ihres Modesalons präsentiert hatte. 369 Stücke dieser Sammlung bewahrt heute das Österreichische Museum für Volkskunde auf. Erhalten geblieben sind auch ca. 400 Briefe zwischen Flöge und Klimt aus der Zeit zwischen 1897 und 1917, jedoch lässt sich nur aus einem Schriftstück aus dem Jahr 1897 eine Liebesbeziehung zwischen den beiden erahnen.
„... morgen Freitag Wiedersehen mein Herz und nun schönes liebes Miderl schau diesen langen Kuss an und leb wol noch einmal“
Aus einem Brief von Gustav Klimt in München an Emilie Flöge in Wien, Poststempel vom 3.6.1897, Privatbesitz
Text: Eva von Schilgen

Gotischer Christus
Giovanni di Enrico da Salisburgo, Umkreis
Italien, zweite Hälfte
15. Jahrhundert
Höhe 157 cm, Breite 163 cm
Aus dem Arbeitszimmer des Maestros, zuvor Galerie St. Raphael, Wien


„Heiliger Georg und heiliger Florian“ Salzburg, um 1700 wohl Meinrad Guggenbichler
Höhe ca. 90 cm
Ehemals Sammlung
Schloss Oberköllnbach, Bayern
Kunstmesse Art&Antique, Residenz Salzburg, 12. – 21. April 2025, Konferenzsaal
ART
13 A-1010 Wien Telefon +43 1 512 88 03
office@lillys-art.com www.lillys-art.com


Von kunstvoller Handwerkskunst bis hin zu ausdrucksstarken Möbelstücken –diese erlesene Auswahl vereint Eleganz, Geschichte und Inspiration. Ob durch kunstvolle Schmuckstücke oder stilvolle Kunstwerke für das Zuhause – sich mit Schönheit zu umgeben, bereitet große Freude.




1. Seltener NAUTILUS POKAL, in SILBER, Deutsch punziert, Höhe 55 cm, von antik-strassner.com, um € 18.000 | 2. Artdéco-Sekretär, Frankreich (1930er-Jahre), von René Prou, um € 12.800 | 3. Paar signierte Eisensessel, Italien (2021), von Anacleto Spazzapan, um € 9.600 | 4. Brutalistischer Sofatisch in Eisen, Belgien (1960er-Jahre), um € 4.400 (alle Objekte 2.–4. bei studio5salzburg.com | 5. Steinfigur, Triton als Wasserspeier darstellend, nahezu Lebensgröße, Sandsteinguss, 19. Jh., vollkommen original, bei SCHAUER Antiquitäten, Pfarrplatz 13, 3500 Krems an der Donau, schauer.kunst@aon.at, um € 9.500 | 6. Kopfskulptur, aus Messing (späte 1970er-Jahre), Höhe 54 cm, Länge 43,5 cm, Breite 14,5 cm, Franz Hagenauer, Werkstätte Hagenauer Wien, von floriankolhammer.com, Preis auf Anfrage










Neuproduktion
23.01. / 27.01. / 30.01. Haus für Mozart



Mozarteumorchester
Salzburg



mozartwoche.at






Beschaulich liegt das Schloss Gumpoldskirchen am malerischen Kirchenplatz des gleichnamigen Weinortes. Die 4000-SeelenGemeinde vor den Toren Wiens besticht durch ihren historischen Kern. Wer durch die Wiener Straße zum Schloss schlendert, fühlt sich in eine andere Zeit versetzt: Hier dominieren keine Supermarktketten, sondern historische Altbauten, kleine Restaurants sowie gemütliche Weinlokale und Heurige, in denen Winzer ihre edlen Tropfen ausschenken. Eine idyllische Szenerie, die durch das Schloss Gumpoldskirchen mit seinem historischen Burggraben und dem beruhigenden Plätschern des Wassers perfekt ergänzt wird. Unmittelbar hinter dem Schloss erstrecken sich die traumhaften Weinberge der Region.
Ein Schloss mit bewegter Vergangenheit
Das Schloss Gumpoldskirchen ist heute ein Beherbergungsbetrieb und ein exklusives Seminarhotel. Es thront über dem Kirchenplatz und bildet gemeinsam mit der benachbarten Michaelskirche das Zentrum der Marktgemeinde. Die Anlage, deren Ursprünge auf eine
mittelalterliche Wehranlage mit zwei Befestigungstürmen zurückgehen, wurde im Jahre 1241 von Friedrich II. dem Deutschen Orden übergeben. Im Laufe der Jahrhunderte erfuhr das Schloss zahlreiche bauliche Veränderungen: 1931 wurde es umfassend umgebaut und aufgestockt. Eine besonders bewegte Zeit erlebte das Gebäude während des Zweiten Weltkrieges, als es

Die Zimmer des Ordensschlosses

Das vielseitige Angebot an Veranstaltungsräumen reicht vom großzügigen Festsaal (97 m², max. 120 Personen) bis zum gemütlichen Seminarraum (30 m², max. 15 Personen) –inklusive Gartensaal, Foyer, Schloss-Innenhof, Schlossgarten und Kapelle für unvergessliche Events.
zur Forschungsanstalt für Weinbau umfunktioniert und unter dem Namen „Erstes Reichsweingut“ geführt wurde. Zwischen 1998 und 1999 erfolgte eine aufwendige Generalsanierung, und seither wird das Schloss wieder als Gästehaus betrieben. Seit 2017 liegt die Leitung des Hauses in den Händen seines Pächters und Inhabers Ladislaus Edmund Batthyány-Strattmann – ein Name, den man eher im Burgenland als in Gumpoldskirchen vermuten würde.
Die Familie Batthyány – eine Dynastie mit Geschichte
Die Familie Batthyány zählt heute rund 60 Namensträger, Tendenz steigend. Der bekannteste Vorfahre, Dr. Ladislaus Batthyány-Strattmann, wurde 2003 seliggesprochen. Ladislaus Edmund Batthyány-Strattmann, ein Urenkel des seligen Ladislaus, ist das derzeitige Oberhaupt der Familie und der Gastgeber von Schloss Gumpoldskirchen. Als engagierter Malteserritter und Präsident des caritativen Sankt Stefan Vereins setzt er sich aktiv für wohltätige Zwecke ein. Auch die Erhaltung historischer Stätten liegt ihm am Herzen: So steht er als Kurator der Fürstlichen Burgund Klosterstiftung Güssing vor. Der gebürtige Wiener fand durch einen glücklichen Zufall seine Berufung als Gastgeber dieses historischen Hauses.
Ein Fürst als Gastgeber
Nach seiner Schulzeit (unter anderem im Wiener Theresianum) sammelte Ladislaus Edmund BatthyányStrattmann Erfahrungen in renommierten Hotels in ganz Europa. Seit über zwei Jahrzehnten widmet er sich mit Leidenschaft der Welt der Hotellerie. Seine Karriere führte ihn quer durch Europa – von den prestigeträchtigen Luxushäusern Londons, darunter das berühmte Ritz Hotel und die Savoy Hotel-Gruppe, über renommierte Stationen in Spanien, Irland und Ungarn bis nach Deutschland. Als letzte Station, bevor es nach Gumpoldskirchen ging, leitete er über drei Jahre lang das traditionsreiche 4-Sterne-Hotel Kummer an der Wiener Mariahilferstraße. Überall standen für ihn die Liebe zur Gastfreundschaft und die Suche nach neuen, spannenden Herausforderungen im Mittelpunkt.
In dem historischen Schloss, das er in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Orden als Pächter führt, hat er nun seine wahre Bestimmung gefunden. Diese altehrwürdigen Mauern bergen eine reiche Geschichte und sollen zu neuem Leben erweckt werden. „Als sich die Gelegenheit ergab, das Schloss als Pächter zu übernehmen, erkannte ich darin meine neue Berufung!“, so Batthyány-Strattmann. Heute führt er das kleine Seminarhotel mit seinen 18 individuell gestalteten Zim





Das idyllische und doch pulsierende Gumpoldskirchen ist der ideale „Stützpunkt“ für die Erkundung der schönen Gegend, der Weinberge und der Region. Und natürlich auch für einen Abstecher ins nahe gelegene Wien oder Baden. Egal, ob Sie sich der Kulinarik, dem Wein, der Unterhaltung, dem Sport oder einfach nur dem Genuss oder der „Entschleunigung“ hingeben wollen.
mern mit viel Leidenschaft und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse seiner Gäste. „Ein Haus wie dieses muss man lieben – es ist buchstäblich immer etwas zu tun. Unsere Philosophie ist es, die Einrichtung bewusst schlicht zu halten und uns voll und ganz auf die Bedürfnisse von Seminargästen und Erholungssuchenden zu konzentrieren. Hier erleben unsere Gäste eine wohltuende Ruhe und können vollkommen abschalten“, erklärt der Schlossherr. Sein Lebensmittelpunkt bleibt Wien, wo er mit seiner Frau Maria und den Kindern Klara und Tivadar lebt; im Sommer verbringen sie gerne die Wochenenden in Gumpoldskirchen. „Viele unterschätzen das Potenzial dieser Region. Dabei ist sie eine wahre Perle – perfekt für Ausflüge und Kurzurlaube!“
Exklusives Seminarhotel in einzigartiger Umgebung
Das Schloss hat sich als erstklassige Destination für kleine Gruppen etabliert, die nicht weit reisen wollen, aber dennoch in einem stilvollen Ambiente tagen möchten. Die Kombination aus historischem Flair, moderner Ausstat-

tung und ungestörter Atmosphäre macht es zum idealen Ort für Seminare, Teambuilding-Events und private Feiern. Die Gäste schätzen besonders die ruhige Lage und die hervorragende Schlafqualität – ein „Kraftort“, wie Batthyány-Strattmann es treffend beschreibt.
Genuss & Wein – ein Paradies für Feinschmecker Gumpoldskirchen ist ein wahres Paradies für Weinliebhaber. Die Hauptsorten der Region sind Weißburgunder, Neuburger, Zierfandler und Rotgipfler – edle Tropfen, die auf der kalkreichen Braunerde prächtig gedeihen. Auch Burgundersorten wie Chardonnay finden hier perfekte Bedingungen vor. Die zahlreichen Heurigen und Weingüter laden dazu ein, die lokalen Weine in stimmungsvoller Atmosphäre zu genießen. Fazit: ein Ort, der begeistert. Schloss Gumpoldskirchen ist mehr als nur ein Seminarhotel – es ist ein Kraftort, an dem Geschichte, Genuss und Gastlichkeit aufeinandertreffen.
Text: Lisa Gasteiger-Rabenstein

Hotel Schloss Gumpoldskirchen
Kirchenplatz 4, 2352 Gumpoldskirchen
Tel.: +43 676 3964185
E-Mail: direktion@schlossgumpoldskirchen.at www.schlossgumpoldskirchen.at
T E A W O R K P M U

M E D I Z I N ,
P H A R M A Z I E U N D
P F L E G E W I S S E N S C H A F T
U N T E R E I N E M D A C H .



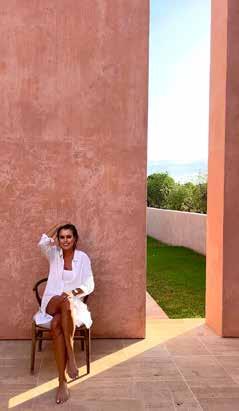
Ein Gespräch mit Sophie Neuendorf-Teba
Sophie Neuendorf-Teba ist eine der prägenden Stimmen im digitalen Kunstmarkt. Als Teil der renommierten Artnet-Familie vereint sie Tradition mit Innovation und steht für eine nachhaltige, transparente und zukunftsorientierte Kunstwelt. In einem exklusiven Interview mit den SCHLOSSSEITEN gibt sie spannende Einblicke in ihre berufliche Laufbahn, ihren persönlichen Stil und die Kunst, die sie umgibt.
Sie sind in eine Familie hineingeboren, die tief in der Kunstwelt verwurzelt ist. Wie hat Ihre Kindheit Ihr heutiges Verständnis und Ihre Leidenschaft für Kunst geprägt?
Ich bin mit Kunst aufgewachsen und habe früh gelernt, ihre kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung zu schätzen. Der tägliche Austausch über Kunst, Märkte und Sammlungen hat mir ein tiefes Verständnis für die Besonderheiten und Entwicklungen der Branche vermittelt. Diese Erfahrungen haben nicht nur meine Leidenschaft für Kunst geprägt, sondern auch mein Engagement für Innovationen in diesem Bereich gefestigt.
Artnet gilt als Pionier im Online-Kunsthandel. Welche aktuellen Trends beobachten Sie im digitalen Kunstmarkt, und wie positioniert sich Artnet in diesem sich ständig weiterentwickelnden Umfeld?
Ein wesentlicher Trend ist die zunehmende Digitalisierung im Kunstmarkt. Künstliche Intelligenz
spielt eine immer größere Rolle bei der Analyse von Preistrends und der Bereitstellung personalisierter Empfehlungen. Zudem wächst die Nachfrage nach transparenten und schnellen Online-Transaktionen. Artnet setzt genau hier an – mit innovativen Technologien, präzisen Datenanalysen und einer Plattform, die Käufern und Verkäufern gleichermaßen Vertrauen und Effizienz bietet.
Die Kunstwelt erlebt derzeit einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und sozialem Bewusstsein. Wie integriert Artnet diese Themen in seine Geschäftsstrategie und welche Rolle spielen sie in Ihrer täglichen Arbeit?
Wir setzen uns für einen transparenten und zugänglichen Kunstmarkt ein, indem wir Wissen und Daten demokratisieren. Darüber hinaus tragen wir durch digitale Lösungen dazu bei, den CO₂-Fußabdruck des Kunsthandels zu reduzieren, indem physische Auktionen und Transporte minimiert werden. In meiner täglichen Arbeit geht es darum, nachhaltige
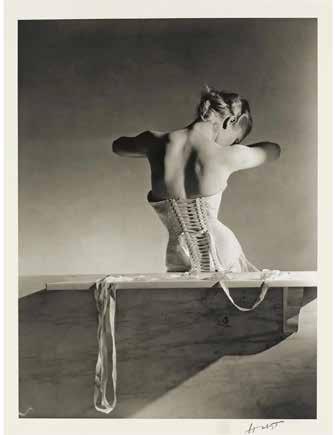
Innovationen voranzutreiben, die sowohl wirtschaftlich als auch ethisch sinnvoll sind.
Sie haben in verschiedenen Städten wie Frankfurt, New York, Berlin, London und Madrid gelebt. Wie beeinflussen diese kulturellen Erfahrungen Ihre Perspektive auf Kunst und Ihren Lebensstil?
Ich habe einen sehr nomadischen Lebensstil. Mein Vater gründete die Firma Artnet mit Headquarter in New York City, und so verbrachte ich dort meine Kindheit und Jugend. Später habe ich in London, Paris und Berlin gelebt. Ich bin sehr dankbar für diese vielseitige kulturelle Erfahrung und habe das Gefühl, dass ich dadurch der Kunst in all ihren Facetten sehr offen und neugierig gegenüberstehe.
Welche Künstler oder Kunstwerke haben derzeit einen besonderen Platz in Ihrem Zuhause, und warum?
Zu Hause in Madrid hängen einige Bilder, die mir persönlich sehr viel bedeuten. Zum Beispiel eines von meinem Großvater Georg Karl Pfahler. Er hat Deutschland auf der Biennale von Venedig sowie auf der Biennale von São Paulo vertreten. Ich stand ihm schon als Kind sehr nahe, habe oft mit ihm zusammen in seinem Atelier gemalt. Auch hängen dort ein Bild von dem herrlichen West Coast Pop Art Künstler Billy Al Bengston sowie eine Skulptur von dem mexikanisch-amerikanischen Künstler
Robert Graham. Kürzlich habe ich ein Werk der Künstlerin Danielle McKinney erworben, deren Bilder sehr sinnlich sind.
Mit welchen Persönlichkeiten – sei es aus der Kunstwelt oder anderen Bereichen – umgeben Sie sich gerne in Ihrer Freizeit?
Ich umgebe mich gern mit allen, die der Welt mit Neugierde, Humor und Freundlichkeit gegenüberstehen. Aber vor allem Künstler haben meist eine sehr besondere Einschätzung der Welt – es ist immer ein Vergnügen, sich mit ihnen zu unterhalten.
Sie haben während der Coronapandemie Kurse zum Thema nachhaltige Unternehmensführung in Oxford belegt. Wie hat dieses Wissen Ihren Ansatz in der Kunstbranche beeinflusst?
Ich sehe Nachhaltigkeit nicht nur als ökologisches, sondern auch als wirtschaftliches und soziales Konzept. In der Kunstwelt bedeutet das, langfristige Strategien zu entwickeln, die Transparenz, Effizienz und Fairness fördern. Bei Artnet setzen wir auf digitale Lösungen, die den CO₂-Fußabdruck reduzieren, indem physische Prozesse wie Auktionen und Katalogdrucke durch datenbasierte OnlineAlternativen ersetzt werden. Zudem stärken wir mit unseren Marktanalysen die Informationsfreiheit und ermöglichen es Sammlern, Galerien und Institutionen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch diesen bewussteren Ansatz integrieren wir nachhaltige Praktiken in unser Geschäftsmodell und tragen dazu bei, dass der Kunstmarkt langfristig widerstandsfähiger, effizienter und zugänglicher wird.
Welche Hobbys oder Leidenschaften, die vielleicht weniger bekannt sind, verfolgen Sie abseits der Kunst?
Ich gehe sehr gerne reiten und schätze vor allem die enge Beziehung, die ich zu meinem Pferd habe. Es ist ein wunderbares Vertrauensverhältnis. Er ist fast menschlicher als viele Menschen.
Welches war das erste Kunstwerk oder Foto, das Sie für sich selbst gekauft haben, und was hat Sie daran fasziniert?
Ehrlich gesagt, sammeln meine Brüder und ich schon sehr lange und tauschen uns vor jedem Kauf untereinander aus. Eines der ersten Bilder, das ich gekauft habe, war von dem sehr besonderen Künstler Tunji Adeniyi-Jones. Sein Werk ist stark durch seine westafrikanischen Wurzeln geprägt.
Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? Gibt es Rituale oder Hobbys, die Ihnen helfen, abzuschalten?
Für mich gilt: Strong body, strong mind. Ich mache sehr gerne Sport. Er hilft mir teilweise, um abzuschalten, aber auch, um nachzudenken und mit Stress umzugehen.
Haben Sie ein persönliches Motto oder eine Philosophie, die Sie im Leben und in der Arbeit leitet?
Knowledge is power. Ich habe viel erlebt und auch einige Fortbildungen gemacht. Jetzt unterrichte ich an der IE-Uni in Madrid und bin auch Mentorin, um andere in deren Werdegang zu unterstützen.
Wenn Sie ein Dinner mit drei historischen oder zeitgenössischen Künstlern oder Fotografen Ihrer Wahl veranstalten könnten – wen würden Sie einladen, und warum?
Artemisia Gentileschi, Tamara de Lempicka und Élisabeth Vigée Le Brun – drei Frauen, die sich als Künstlerinnen behauptet haben in einer Zeit, da nur sehr wenige es geschafft haben, diesen Beruf auszuüben.
Welche Faktoren machen ein Foto zu einem wertvollen Kunstwerk? Liegt es eher an der technischen Meisterschaft, der erzählten Geschichte oder dem kulturellen Kontext?
Die Wertigkeit der Fotografie ergibt sich aus einer Kombination verschiedener Faktoren. Technische Meisterschaft, erzählerische Tiefe, Relevanz innerhalb der Kunstgeschichte und kultureller Kontext spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aber ihre Gewichtung kann je nach Werk und Betrachter variieren. Einige Bilder sind rein aufgrund ihrer Ästhetik begehrt, andere aufgrund ihrer emotionalen Tiefe oder ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Die größten Meisterwerke vereinen jedoch alle diese Aspekte in einem einzigen Bild.

Fotografie hat in den letzten Jahren einen immer höheren Stellenwert im Kunstmarkt erhalten. Wie sehen Sie die Rolle der Fotografie heute im Vergleich zu traditionellen Medien wie Malerei oder Skulptur?
Ein wesentlicher Unterschied liegt in der technischen Reproduzierbarkeit der Fotografie, die den Markt beeinflusst. Limitierte Editionen und Zertifizierungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Wertbestimmung. Gleichzeitig ermöglicht die Fotografie eine besondere Art der Dokumentation und Reflexion zeitgenössischer gesellschaftlicher Entwicklungen, wodurch sie eine starke narrative Kraft entfaltet.
Welche Fotografen schätzen Sie persönlich besonders – sei es aus künstlerischer oder aus marktstrategischer Sicht?
Mir gefallen viele Fotografen, das ist eine schwere Entscheidung – aktuell vor allem Hiroshi Sugimoto, Sebastião Salgado und Horst P. Horst.
Artnet bietet eine umfassende Datenbank für Auktionspreise. Sehen Sie einen Trend, dass Fotografie zunehmend als Investitionsobjekt betrachtet wird?
Ja, es gibt tatsächlich einen klaren Trend, dass Fotografie in einem immer stärkeren Maße als Investitionsobjekt betrachtet wird. Unsere Auktionsdaten zeigen, dass etablierte Fotografen eine hohe Nachfrage und starke Wertsteigerungen verzeichnen. Dank der zunehmenden Anerkennung, institutionellen Unterstützung und Digitalisierung bietet Fotografie sowohl für traditionelle als auch für neue Investoren interessante Möglichkeiten. Artnet trägt dazu bei, diesen Markt transparenter und zugänglicher zu machen, indem wir umfassende Daten und Marktanalysen bereitstellen.
Ich umgebe mich gern mit allen, die der Welt mit Neugierde, Humor und Freundlichkeit gegenüberstehen. Aber vor allem Künstler haben meist eine sehr besondere Einschätzung der Welt –es ist immer ein Vergnügen, sich mit ihnen zu unterhalten.
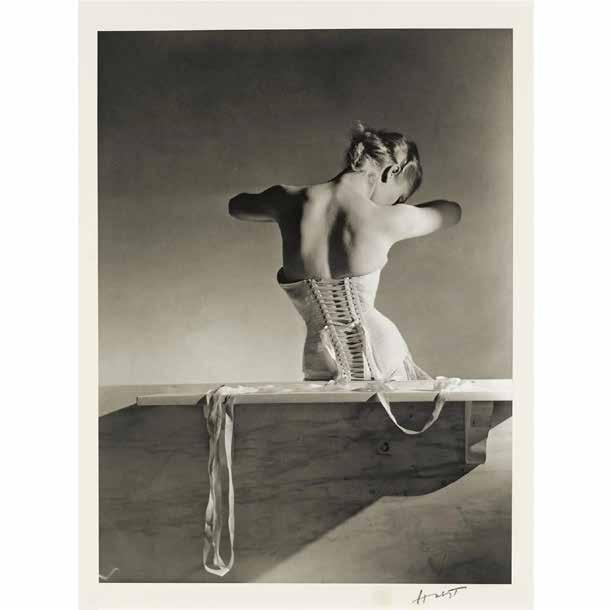
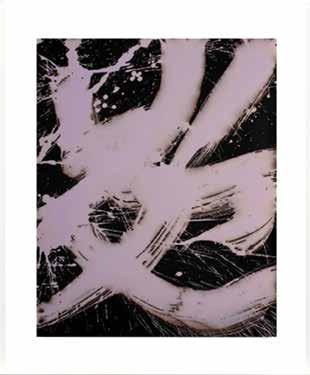
GRÜNDUNG
1989 von Hans Neuendorf
BÖRSENNOTIERUNG
seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse
etwa 25 Millionen aus 239 Ländern
AUKTIONSERGEBNISSE
über 10 Millionen Euro aus den letzten 30 Jahren
rund 320.000
Sie haben in Städten wie London, Berlin und Madrid gelebt – allesamt Orte mit einer faszinierenden Mischung aus historischer Architektur und modernen Strukturen. Welche Stadt hat Sie architektonisch am meisten beeindruckt und warum?
In New York fühle ich mich wie zu Hause. Es ist eine sehr freie, inspirierende und beeindruckende Stadt – natürlich auch architektonisch. Als ich bis vor Kurzem dort lebte, war ich in einem von Frank Gehry entworfenen Gebäude zu Hause. Dadurch, dass unser Haus auf Mallorca von den Architekten John Pawson und Claudio Silvestrin entworfen wurde, fühle ich mich in der minimalistischen, modernen Architektur natürlich besonders wohl.
Viele Sammler kombinieren moderne Kunst mit historischen Räumen. Wie stehen Sie zu diesem Spannungsfeld zwischen alten Mauern und zeitgenössischer Kunst? Mir gefällt dieses Spannungsfeld sehr! Wir gestalten
CEO-WECHSEL
2012 übernahm Jacob Pabst
unser Zuhause in diesem Stil. Zum Beispiel hängt bei uns ein Bild von Cranach dem Älteren neben einem zeitgenössischen Bild – ich habe es auch bei Freunden und Bekannten schon sehr bewundert.
Sie sind viel in der internationalen Kunstszene unterwegs. Gibt es eine Galerie oder ein Museum, das Sie architektonisch besonders beeindruckt hat?
Besonders gut gefällt mir, wie die Galerie Hauser & Wirth sowohl mit Kunst als auch mit Architektur umgeht. Ich war sehr von ihrer Dependance auf Menorca beeindruckt. Dieses Jahr habe ich vor, ihr Schloss in Schottland zu besuchen.
Wenn Sie ein eigenes Kunstzentrum oder eine Galerie eröffnen würden – würden Sie einen modernen Bau bevorzugen oder lieber einen historischen Ort mit Geschichte umgestalten?
Das kommt ganz auf die Stadt an, in der die Galerie wäre. Wir überlegen, eine Galerie in Madrid zu eröffnen. Dann wäre es wahrscheinlich in einem Belle-Époque-Gebäude, aber vom Interior eher minimalistisch.
HERRENSTRASSE 1 | 96049 BAMBERG | TEL.: +49 (0) 951 52244 | WWW.FRANKE-KUNSTHANDEL.DE | INFO@FRANKE-KUNSTHANDEL.DE

FAMILIENPORTRAIT DER HERZOGIN HELENE ZU WÜRTTEMBERG-OELS,
GEB. PRINZESSIN ZU HOHENLOHE-LANGENBURG
Carl Rothe, Breslau um 1834
Das Gemälde zeigt die zweite Frau von Herzog Eugen II. v. Württemberg-Oels (Oels 1788 – 1857 Karlsruhe), Herzogin Helene (Langenburg 1807– 1880 Heinrichsruh bei Schleiz) mit drei ihrer vier Kinder. Höhe 136,5 cm, Breite 111 cm.

BayernPLACES TO GO
Das Münchner The Hotel , Teil der Rocco Forte Hotels, hat seine Zimmer und Suiten neu gestaltet und setzt dabei auf ein frisches, biophiles Design. Lady Olga Polizzi, Leiterin des Rocco Forte Design-Departments, ließ sich für die Farbpalette von der Natur des angrenzenden Alten Botanischen Gartens inspirieren. Zart gestreifte Tapeten verleihen den Räumen Leichtigkeit, während Akzente in Gelb und Türkis für Strahlkraft sorgen.
Bei der Neugestaltung lag der Fokus auf hochwertigen, nachhaltigen Materialien. Die Polstermöbel stammen aus Deutschland, die Stoffe aus Europa. Neben der Ästhetik spielte auch die Funktionalität eine zentrale Rolle: Kopfteile wurden neu gepolstert und mit flexiblen Leselampen versehen, größere Schreibtische bieten Platz für optimierte TV-Geräte,
und Bücherregale schaffen eine wohnliche Atmosphäre in den Junior-Suiten.
„Design kann zeitlos sein und dennoch mit durchdachten Entwicklungen begeistern“, so Polizzi. Das 5-Sterne-Superior-Hotel überzeugt mit seinem eleganten Stil und großzügigen Zimmern, die mit mindestens 40 Quadratmetern zu den größten in München zählen. Mit dem sanften Re-Design bleibt The Charles Hotel seinem Stil treu und schafft zugleich eine moderne, noch einladendere Atmosphäre.
INFOBOX
The Charles Hotel
Sophienstraße 28, 80333 Munich, Germany +49 89 5445550 info.charles@roccofortehotels.com www.roccofortehotels.com

Wien PLACES TO GO
Das The Amauris Vienna ist ein wahres Hoteljuwel im Herzen Wiens, das historischen Charme und modernes Design in perfekten Einklang bringt. Das prachtvolle Stadtpalais aus dem 19. Jahrhundert in bester Ringstraßenlage wurde nach sorgfältiger Renovierung zu einem exklusiven Luxury-Boutiquehotel, das anspruchsvolle Reisende und Kunstliebhaber gleichermaßen anzieht. Zwischen Wiener Kultur und Kunst vereint das Hotel meisterhaft zeitgenössischen Luxus mit traditioneller Eleganz. Die 62 Zimmer und Suiten bestechen durch ein stilvolles Interieur, das höchsten Komfort und Ruhe bietet. Gelebte Gastfreundschaft, gehobene Kulinarik und Nachhaltigkeit werden hier großgeschrieben. Der renommierte CEO Johann Breiteneder von der Breiteneder Immobilien Parking AG hebt hervor: „Unsere Philosophie basiert auf höchster Qualität in allen Berei-
chen. Die individuelle Betreuung unserer Gäste steht stets an erster Stelle.“ Diese Werte spiegeln sich auch in der Mitgliedschaft bei der exklusiven Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux wider, die für ihre hohen Standards bekannt ist. Das The Amauris Vienna ist nicht nur ein Ort des gehobenen Komforts, sondern auch ein einzigartiges Refugium für Liebhaber exquisiter Gastlichkeit. Ausgezeichnet mit zwei MICHELIN Schlüsseln, setzt das Hotel neue Maßstäbe für Luxus in Wien.
INFOBOX
The Amauris Vienna Kärntner Ring 8 1010 Wien +43 1 22122 vienna@theamauris.com www.theamauris.com


Hubertus von Hohenlohe, ein Dandy, eine schillernde Persönlichkeit, ein echter Weltbürger, der Kunst, Musik und Sport auf einzigartige Weise verbindet. Hochherrschaftliche Wurzeln und Jetset-Leben treffen bei ihm auf pure Lebensfreude, auf vorurteilsfreie Offenheit und Neugierde gegenüber allem Neuen.
Text von Clarissa Mayer-Heinisch


Karierte Hosen, ein Pulli mit bunten Applikationen, die Haare in wildem Durcheinander und ein strahlendes Lachen auf den Lippen. Das ist Hubertus von Hohenlohe. Er ist so etwas wie ein wandelndes Kunstprojekt, ein Tausendsassa mit Hang zur Kunst. Ganz sicher aber ist er ein Dandy, der sich nicht auf eine einzige Schublade festlegen lässt. Und das sieht man ihm auch an: Seine Outfits sind ebenso legendär wie seine Auftritte. Egal ob auf der Piste, mit einem Mikrofon auf der Bühne oder vor der Kamera – Zurückhaltung ist nicht sein Ding. Er ist überall und nirgends, seine Wohnsitze Marbella, Ronda, Cortina, Bologna, Vaduz und Wien spiegeln seinen Lebensstil wider – ein ständiges Pendeln zwischen Kunst, Musik, Sport und vermutlich auch der Frage: „Wo bin ich gerade?“
Musikalisch ist Hubertus von Hohenlohe kürzlich wieder ein großer Coup gelungen: Er veröffentlichte das Lied „Puente de Ronda“, eine Hommage an die spanische Stadt Ronda. Im dazugehörigen Musikvideo tummeln sich illustre Gäste wie Juan Motos, der Neffe des Flamenco-Sängers Diego El Cigala, sowie der ehemalige Stierkämpfer Francisco Rivera Ordóñez. Ein Skirennfahrer, ein Flamenco-Musiker und ein
Ex-Stierkämpfer gemeinsam in einer Musikvideoproduktion – das ist gelebte Kunst! Doch Hubertus wäre einfach nicht Hubertus, würde er sich nicht nach wie vor sportlich engagieren. Mit seinen 66 Jahren nahm er auch heuer wieder für das mexikanische Team an der Weltmeisterschaft in Saalbach teil. Es war sein insgesamt 21. Start bei einer WM, aber nicht nur für seinen Mut und seine Kondition, mit denen er sich die steilsten Pisten hinunterlässt, sondern auch für seine extravaganten Rennanzüge war und ist er immer schon berühmt.
Ob im mexikanischen „Mariachi“-Design oder mit Pop-Art-Motiven – er macht die Hänge kurzerhand zur Laufstegbühne. Im nächsten Winter will er mit einem Slalom Abschied vom professionellen Skisport nehmen. Mit Sicherheit wird er das in einem Rennanzug tun, der genauso auffällig ist wie seine Karriere.
Auch als Fotograf hat sich Hubertus von Hohenlohe längst einen Namen gemacht. Internationale Galerien stellen seine Bilder aus, Sammler aus aller Welt sind interessiert; und wer die riesengroßen Formate schon einmal gesehen hat, weiß: Hohenlohes Werke bestechen durch eine poppige Ästhetik und fangen
Hubertus von Hohenlohe ist ein Meister der visuellen Ästhetik.
Seine Fotokunst verbindet Popkultur, Farben und ironische Eleganz zu einzigartigen Werken, die den urbanen Zeitgeist einfangen. Mit seinem scharfen Blick für Details spielt er mit Licht, Perspektiven und Symbolik, wodurch seine Bilder eine unverkennbare Handschrift tragen.
Oft verschmelzen Retro-Elemente mit moderner Extravaganz, schafft er ikonische Motive, die Kunst und Gesellschaft auf kreative Weise reflektieren.




prominente Persönlichkeiten und urbane Szenen mit einem Augenzwinkern ein. Ob „Inside Gucci Chairs“ oder sein ikonisches Porträt von Zinédine Zidane –er versteht es, Luxus und Persönlichkeit in Szene zu setzen. Seine Bilder sind farbenfroh und oft ironisch. Man könnte meinen, er spielt mit seinem eigenen Image. Als Sohn von Alfonso Prinz von HohenloheLangenburg, dem Gründer des Marbella Club Hotels, und Prinzessin Ira von Fürstenberg, einer SocietyLady mit Hollywood-Flair, wuchs er in einem Umfeld auf, das Jetset und Glamour atmete und ihn prägte. Erst vor wenigen Jahren hat Hubertus von Hohenlohe auch privat sein Glück gefunden.
1994 lernte er bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer Simona Gandolfi kennen. Die beiden trennten sich für einige Jahre, fanden aber 2019 in Vaduz wieder zusammen – eine Romanze mit Happy End. Hubertus ist nicht nur Ehemann, Sportler, Musiker, Künstler oder Fotograf – er ist ein Gesamtkunstwerk. Ein Mann, der das Leben mit einer Mischung aus aristokratischem Charme, unbändiger Kreativität und einem guten Schuss Selbstironie genießt. Sein Motto: „Warum sich für eine Sache entscheiden, wenn man alles machen kann?“
Wir haben ihn zum Gespräch getroffen.




Wo erreichen wir Hubertus von Hohenlohe gerade?
HH: Ich war in Toblach in Südtirol und bin jetzt in Cortina. Ich habe die Skimeisterschaften organisiert, mit 150 Teilnehmern aus exotischen Skinationen wie Nepal, Taipeh, Hongkong, Iran oder Libanon. Für sie handelt es sich um das Highlight im Rennkalender. Es ist kein Juxrennen, denn es geht um die Qualifikation für die nächsten Olympischen Spiele. Als Vorläufer hatten wir den dreimaligen Olympiasieger Matthias Meyer. Es waren super Tage: hochkarätiges Skifahren und Megaparty.
Du hast selbst Kultstatus in der Ski-Welt, bist nicht weniger als sieben Mal bei olympischen Winterspielen und 21 Mal bei Weltmeisterschaften gestartet. Bist du in Toblach selbst auch mitgefahren?
HH: Natürlich. Aber einmal habe ich im ersten Slalom-Durchgang eingefädelt, und einmal bin ich im zweiten Lauf gestürzt. Pech.
Erst kürzlich ist ein neues Musikvideo von dir herausgekommen. Wie kam es dazu und warum spielt es im andalusischen Ronda?
HH: Die Idee kam, weil unsere Familie seit jeher zwischen Marbella und Ronda gelebt hat. Meine Urgroßmutter war eine wohltätige Person in Ronda, darum ist auch der Hauptplatz, die Plaza Duquesa de Parcent, nach ihr benannt. Sie hatte das schönste Haus hier, die Casa del Rey Moro. Später dann hat mein Vater eine Finca gekauft. Diese Gegend war also immer schon wichtig für unsere Familie. Ich selbst bin beeindruckt von der Stadt und der idyllischen Landschaft rundherum. In meinem Lied geht es darum, dass der Lärm der Welt die Liebe stört. Wenn du an einem schönen Platz bist, der von sich aus strahlt, besonders wenn du an der Brücke stehst, die über die tiefe Schlucht von Ronda führt, dir in die Augen schaust, dann musst du nicht viel sagen. Durch Instagram und Social Media vergisst man oft, die Schönheit der Dinge zu sehen. Ich möchte gerne der nächsten Generation, die 40 km von Ronda entfernt im turbulenten Marbella Partys macht, diese wunderbare Ortschaft ans Herz legen. Auch Rainer Maria Rilke und Ernest Hemingway waren zu ihrer Zeit hier und fanden Inspiration für ihre Texte.
Wie sind Lied und Video entstanden? Stammt alles aus deiner Feder?
HH: Nein, nicht ganz. Die Idee kam von mir. Ich habe in Wien begonnen und mit dem Bassisten Helmut Schachtelmüller, der auch für Hubert von Goisern produziert, an dem Konzept gefeilt. Dann ka-
men ein Flamenco-Sänger und ein Gitarrist dazu. Das Video hat Eva Nilsen gedreht, sie ist Fotografin und Regisseurin. Wir durften mit Drohnen und Kameras in das ehemalige Gefängnis von Ronda, das sich unter der Brücke befindet und eigentlich nie aufgemacht wird. So sind die spektakulären Aufnahmen entstanden. Der Clip wird über Universal Music promotet.
Was verbindet dich mit Marbella?
HH: Mein Vater, Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg, hat hier den legendären Marbella Club gegründet. Der Ort war damals nicht bedeutend und hatte zu Beginn einfach nur eine Bar. Marbella hat sich erst im Laufe der Zeit zu dem entwickelt, was es heute ist. Es war für uns als Kinder, wenn wir von der Schule in Österreich auf Ferien nach Marbella kamen, das Schlaraffenland. Man konnte hier von Minigolf bis Tennis spielen alles machen. Es gab das Hotel mit schönen Zimmern, einen Park mit Pool, alles ganz nahe vom Strand, und auch verschiedene Restaurants. Rundherum hatten berühmte Leute ihre Häuser, von Gina Lollobrigida bis Audrey Hepburn. Es war eine Mischung aus Rockstars, Musikern und Hollywoodstars. Nennen wir es einmal so: Es war ein Aufwachsen fernab von der wirklichen Realität.
Hast du in diesem Umfeld deine Talente, deine Kreativität entdeckt?
HH: Nein. Eigentlich hab ich es schon immer gespürt, dass ich zeichnen, Musik machen und auch fotografieren kann. Ich hatte stets so ein quirliges Kreativding. Der Moment, an dem ich dachte, ich möchte Künstler werden, kam, während ich bei Andy Warhol in dessen Factory war. Da hab ich mir gedacht: Wow, ist das cool – bildende Kunst zu machen oder vielleicht Musik, Videos, Filme ...
Wie ist es dir gelungen, zu Andy Warhol ins Atelier gehen zur dürfen?
HH: Mein Bruder absolvierte damals ein Praktikum in einem Hotel in New York. Er war mit einem Mädchen namens Carmen Delassio befreundet. Sie machte PR für das Studio 45, den berühmten Club in Midtown. Dort haben wir ihn kennengelernt. Warhol war ein Fan meiner Mutter, Ira von Fürstenberg, und wollte sogar ein Porträt von ihr machen – aber sie lehnte ab. Ich selbst war dann jedenfalls des Öfteren bei Andy Warhol im Atelier. Ich war für ihn der „fresh prince in town“.
Wie waren deine Anfänge in der Fotografie?
HH: Ich hab immer schon Fotos gemacht. Aber ich glaube, ich habe erst, als die Digitalkameras 2000 auf

den Markt kamen, gesehen, was in meiner Fotografie zu chaotisch oder schlampig war, was ich korrigieren kann. Ich habe allerdings auch entdeckt, dass ich ein gutes Auge für die Bildkomposition habe.
Welche Motive interessieren dich?
HH: Eigentlich bin der Paparazzo meines Lebens und der Zeit, in der ich lebe. Ich versuche, mein Leben widerzuspiegeln – mit Konsequenz, mit einem künstlerischen Auge und als Erzähler. Es gibt sicherlich auch ein voyeuristisches Moment, aber es ist halt die Wahrheit, weil die Szenen authentisch passieren und nicht gestellt sind. Manchmal geht es um mich, manchmal um andere Personen, manchmal um ganz anderes, zum Beispiel eine Kartonfabrik oder eine Landschaft. „Urban Jungles“, „Self-Portraits“ oder „Papiergeschichten“ sind einige der Titel meiner Serien.
Wie kann man sich dein Fotografieren vorstellen?
HH: Ich fotografiere, was ich sehe. Aber ich beschließe nicht, zu fotografieren, sondern es ergibt sich etwas.
Was ist für dich noch offen? Gibt es neben Sport, Fotografie, Musik und Social Life noch einen Traum, den du dir gerne erfüllen willst?
HH: Ich glaube, im Design könnte ich noch einiges machen. Ich habe schon ein paar Sachen designt, auch für wichtige Leute. Da habe ich meinen eigenen
Stil, eine Art angewandte Kunst aus dem, was ich fotografiere. Ich kann daraus Stoffe machen, Teppiche, Einrichtungsgegenstände. Ich glaube, da könnte ich ein Wörtchen mitreden und was Tolles machen. Ein Buch ist auch in Arbeit, ein großes Porträt-Buch mit Leuten, die ich getroffen und fotografiert habe. Ich suche gerade nach dem besten Herausgeber. Und in New York habe ich kürzlich einen Videoclip für ein Hotel gedreht, auf eine coole Art und Weise: nicht Zimmer für Zimmer oder Rezeption und Restaurant, sondern mehr Image, also Musik und good vibes.
Wie würdest du dich selbst beschreiben? Wer bist du und wie bist du?
HH: Ich bin frei und ich bin freundlich, ich bin talentiert, irgendwie das zu machen, was ich spüre, und fern von Vorurteilen. Ich lasse die Sachen auf mich wirken und ändere auch mal meine Meinung. Ich glaube, dass ich dem Leben offen gegenüberstehe, positiv und optimistisch. Das Leben muss zelebriert werden.
Neuer Song: hubertus.lnk.to/PuenteDeRonda INFOBOX
Hubertus von Hohenlohe www.hubertushohenlohe.com

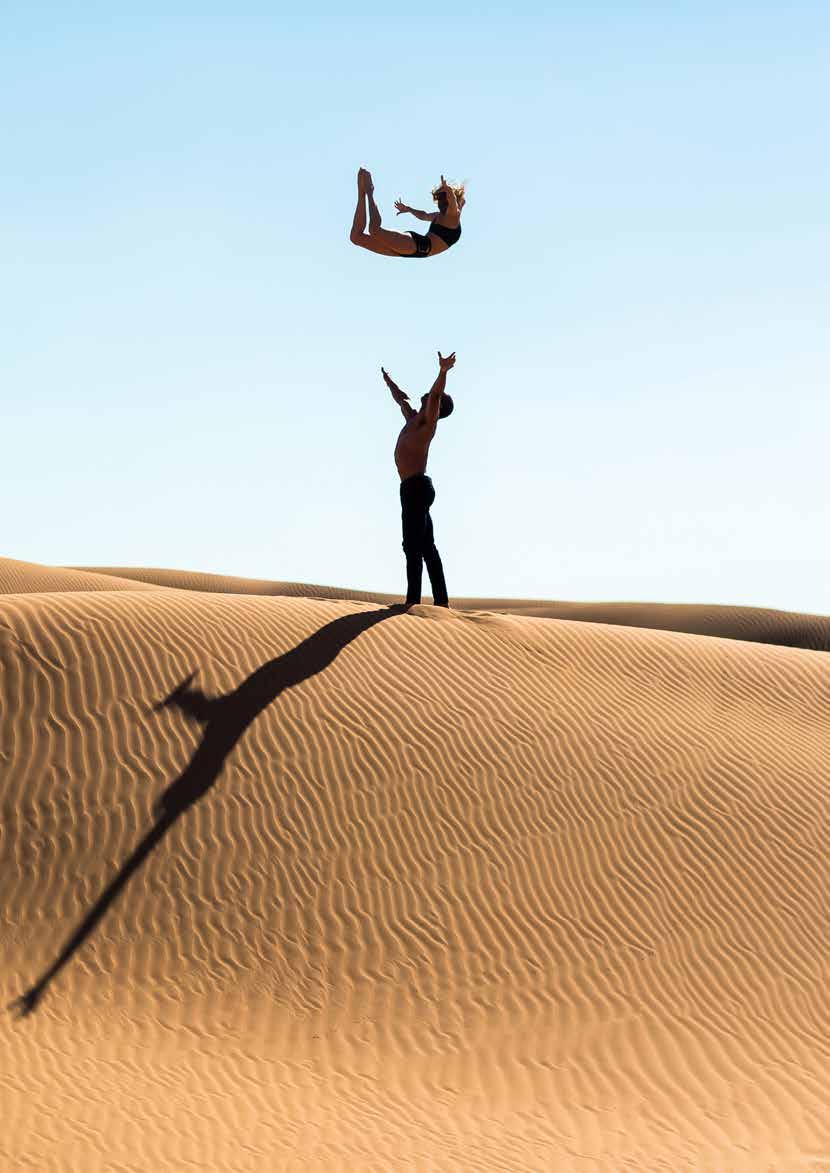

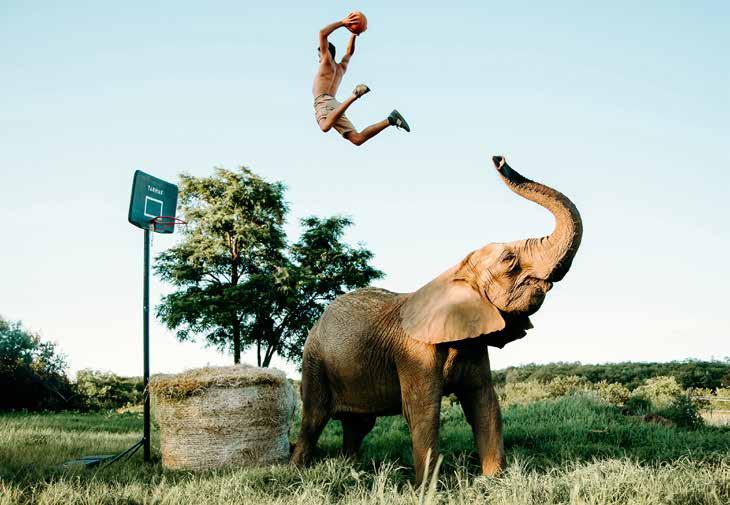

Daisy Seilern
Fotografin
SALZBURG
Daisy Seilern ist eine Fotografin, die das Licht nicht nur nutzt, sondern jagt. Die perfekte Balance zwischen Licht und Schatten ist das zentrale Element ihrer Kunst. Besonders in der Aktfotografie reizt sie die Spannung zwischen Sichtbarem und Verborgenem aus, spielt mit der Vorstellungskraft des Betrachters und schafft so Bilder von einzigartiger Intensität. In der Natur setzt sie auf das unberechenbare, magische Licht der Umgebung, während sie im Studio präzise mit künstlichen Lichtquellen arbeitet.
Ein weiteres Markenzeichen ihrer Arbeiten ist die Symmetrie. Perfekte Linien, sich wiederholende Muster und durchkomponierte Bewegungen sind wesentliche Bestandteile ihrer Bilder. Ihre Tänzerinnen müssen oft zahlreiche Sprünge und Posen wiederholen, bis der ideale Winkel getroffen ist – ein Aufwand, der sich lohnt, denn die Ergebnisse sprechen für sich.
Doch Daisy Seilern ist nicht nur Perfektionistin, sondern auch Abenteurerin. Für das perfekte Bild scheut sie keine Herausforderung – sei es ein waghalsiger Paragleitflug, das Klettern auf hohe Kräne oder das Fotografieren aus nächster Nähe vor einem wilden
Elefanten. Ihre Leidenschaft für Afrika und WildlifeFotografie lebt sie in ihrer Freizeit aus. Im März reist sie nach Kenia in den Amboseli-Nationalpark, um die letzten „Big Tusker“, die ältesten Elefanten mit den größten Stoßzähnen, zu fotografieren.
Bereits mit 15 Jahren begann Seilern mit der Kamera ihres Vaters zu experimentieren. Ihre ersten Fotokurse belegte sie mit 17, und schon bald zog es sie nach Florenz, wo sie am Istituto del Arte Lorenzo de’ Medici Fotografie und Videoproduktion studierte. Von Anfang an faszinierten sie die Darstellung von Frauen und die Magie des Lichts. Neben der Fotografie etablierte sie sich als Journalistin und schrieb fast ein Jahrzehnt lang für die Zeitschrift BUNTE
Mit der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2009 verlagerte sich ihr Fokus auf Neugeborenen-Fotografie, doch nach Jahren in diesem Bereich sehnte sie sich nach neuen Herausforderungen. Die COVID-Pandemie brachte schließlich eine entscheidende Wende: Sie begann ein Buchprojekt über Tänzer, Extremsportler und Adrenalinjunkies, Menschen, die ihre eigenen Grenzen überschreiten. Doch schnell erkannte sie, dass sie dabei auch ihre eigenen Ängste überwinden musste.


Besonders eindrücklich war für sie ein Paragleitflug in 3.000 Metern Höhe – eine Herausforderung, da sie unter Höhenangst leidet. Doch der Moment, in dem sie trotz ihrer Angst das perfekte Bild erschuf, war auch für sie ein unvergesslicher Adrenalinkick.
Die letzten zwei Jahre waren für Daisy Seilern ein Triumphzug. Internationale Auszeichnungen, Ausstellungen in Paris und Mailand ... Die größte Überraschung erlebte sie jedoch auf der Art Miami, einer der renommiertesten Kunstmessen der USA, wo sie mit der renommierten Gallery Budja ausstellte. Ein Freund hatte sie vorgewarnt: Als unbekannte Künstlerin sei es unwahrscheinlich, beim ersten Mal etwas zu verkaufen. Also reiste sie mit ebendieser Erwartung an – doch es sollte ganz anders kommen: Innerhalb kürzester Zeit waren alle ihre Werke verkauft. Der Erfolg war überwältigend, aber noch bedeutender ist für sie die Unterstützung ihrer Familie. Ihr Mann hält ihr den Rücken frei, ihr Sohn widmet ihr sein Kunstprojekt, und ihre Töchter feiern ihre Erfolge mit ihren Freundinnen.
„Für mich fängt ein gelungenes Porträt die Essenz einer Person ein –nicht nur ihr Aussehen, sondern ihre Geschichte, ihre Ausstrahlung, ihr authentisches Selbst.“

Besonders bewegend war für sie der Moment mit einem 14-jährigen Mädchen, das sie als Vorbild bezeichnete, weil sie bewiesen habe, dass Frauen mit Mut und harter Arbeit alles erreichen können. Seilern erwiderte:
„Suche dir große Ziele – die trifft man leichter.“
Ein Satz, der ihre Philosophie perfekt zusammenfasst. Denn für Daisy Seilern gibt es keine Grenzen – nur neue Herausforderungen, die darauf warten, mit Licht und Leidenschaft erobert zu werden.




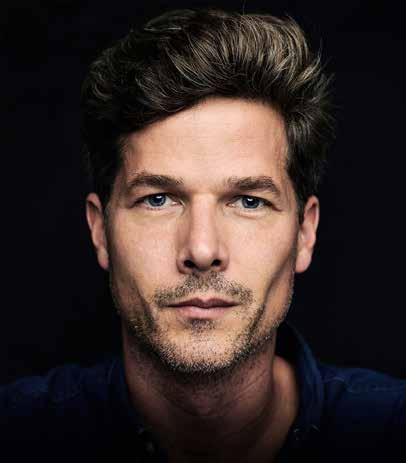
Jamie McGregor Smiths Arbeit basiert auf der Leidenschaft für dokumentarische Fotografie mit der Intention, die Dynamik von Natur, Architektur und sozialen Veränderungen zu erkunden.
Man geht am Mölker Steig in Wiens innerster Innenstadt das Kopfsteinpflaster steil bergauf, bevor man vor dem sogenannten „Dreimäderlhaus“ steht – einem barocken Juwel, in dem nicht nur der feine Ludwig Reiter Shop, sondern auch das Atelier des Fotografen Jamie McGregor Smith beheimatet ist. Die Tür in sein Reich öffnet sich. Zu entdecken ist ein strahlender, reflektierter junger Engländer inmitten seiner Kunst.
Großformatige Bilder, auf denen beeindruckende, menschenleere Kirchenräume zu sehen sind, detail-
verliebte Aufnahmen in europäischen Urwäldern, Architektur und Architektursünden aus Stahl und Beton in London, in Essex oder New York, atemberaubende Landschaften in Kalifornien, Kappadokien oder Madeira laden zu Reisen im Kopf ein. Bekannte Sujets, die Jamie McGregor Smith in Szene setzt. „Fotografie ist weit mehr als das Festhalten eines Augenblicks – sie ist ein Fenster in eine andere Welt, ein Medium, das Geschichten erzählt, Emotionen weckt und Botschaften vermittelt“, so der Fotograf, der inzwischen längst international renommiert ist und mit dem man bereits ab dem ersten Augenblick des Kennenlernens in medias res ist.

Ludwig Reiter „Maronibrater“-Campaign – 2024
Jamie McGregor Smith hat die Kunstform der Fotografie bereits auf vielfältige Weise erprobt. Sein Schaffen reicht von dokumentarischen Aufnahmen bis hin zur Arbeit für Luxusmarken, für Magazine wie Wallpaper, Architectural Digest, Vanity Fair und die New York Times, von Werbesujets bis zu Porträts, von Architektur bis zu Landschaften. Dabei bleibt er stets seiner Philosophie treu, die Welt mit Neugier, Geduld und einem unverstellten Blick zu betrachten. „Mir ist es schon sehr früh darum gegangen, Geschichten aufzudecken, die durch die Zeit hallen“, erzählt er.
Die Liebe hat ihn nach Wien getrieben. Anna ReiterSmith, die neben der gemeinsamen Kinderschar auch noch für das Marketing der Schuhdynastie Ludwig Reiter verantwortlich zeichnet, und er haben sich in London kennengelernt. Genau wie Anna war auch Jamie damals für Louis Vuitton tätig. Sein Weg hatte ihn von einer ländlichen Kindheit in Somerset und Cornwall über das Studium an der Staffordshire University schließlich ins hippe London geführt.


Hier probierte sich Jamie McGregor Smith vorerst einmal in der Welt der Mode. Anstatt die Realität einfach abzubilden, „lag der Fokus auf der Inszenierung und dem Spiel mit Emotionen. Große Teams, aufregende Sets und die Möglichkeit, visuelle Geschichten zu kreieren, machen diese Art der Fotografie zu einer faszinierenden Herausforderung“, empfindet er.
Insbesondere die Industrialisierung sowie ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und Stadtlandschaften wurden immer mehr zu einem zentralen Thema seiner Arbeit. „Meine Bilder bieten Einblicke und ermöglichen es dem Betrachter, selbst zu entscheiden, was er darin sehen möchte.“ Die Fotografien, die unter dem Titel „Motor City“ bereits während des Studiums entstanden sind und sich mit dem Verfall der einstigen Automobilmetropole Detroit beschäftigen, aber auch die Serie an Bildern, die Jamie McGregor Smith in dem seit dem Jahr 2004 ungenutzten und in Vergessenheit geratenen Athener Olympiastadion geschossen hat, zeugen von seiner Erkenntnis, dass Bauwerke
immer gesellschaftliche, politische sowie kulturelle Veränderungen widerspiegeln.
Ein großes Projekt in Jamies Karriere führte ihn in den letzten verbliebenen Urwald Europas, der sich zwischen Polen und Belarus erstreckt. Diese unberührte Wildnis mit ihren uralten Bäumen und einzigartigen Lichtstimmungen bot ihm eine ganz besondere Kulisse. Mit viel Geduld wartete er auf den perfekten Moment, um die Essenz dieses Ortes einzufangen. „Es geht nicht nur um das Bild, sondern um die Reise dahin“, betont er. Die Fotografie wird für ihn zu einer Art Meditation, zu einem Prozess des Verstehens und Verbindens, und es ist ihm wichtig, nicht nur auf die Schönheit des Urwaldes, sondern auch auf dessen Verletzlichkeit und die Notwendigkeit seines Schutzes aufmerksam zu machen.
Besonders eindrucksvoll ist die Werkserie „Sacred Modernity“, die im vergangenen Frühjahr beim Verlag Hatje Cantz als Bildband verlegt wurde. Darin geht

es um die dokumentarische Erkundung religiöser Architektur in Europa aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Sakrale Bauwerke auf ihre Gestaltung, Funktion und Symbolik hin zu betrachten, auf gewagte, oft experimentelle Designs hinzuweisen und das Verständnis von Spiritualität und Religion in einer sich wandelnden Welt aufzuzeigen, darum geht es dem Fotografen in diesem Projekt.
„Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Fotograf mitbringen muss, um mehr als nur Abbildungen entstehen zu lassen?“, frage ich Jamie McGregor Smith und bekomme sofort eine klare Antwort: „Geduld und eine konzentrierte Auseinandersetzung mit dem Motiv.“ Eine analoge Kamera und verschiedenste Objektive sind sein Werkzeug, mit dem er die „bewusste Reduktion auf subtile Details eines Motivs“ zu erreichen versucht. Auch der Bildausschnitt ist wichtig: „Man muss sich vorstellen können, wie ein Bild aussehen wird, bevor man es aufnimmt.“
Ein zentrales Element in Jamies Fotografie ist das Spiel mit Licht und Schatten. Er wartet oft stundenlang auf die richtige Beleuchtung, um eine Szene und die Atmosphäre eines Ortes einzufangen. „Das Licht ist der Schlüssel zu allem“, betont er. „Es kann eine alltägliche Szene in etwas Magisches verwandeln.“ In seinen wildromantischen Urwald-Bildern, wo Baumwurzeln kreuz und quer liegen, wo sich hohe Stämme in einem Flüsschen spiegeln und wo Unterwuchs samt
Moos grün leuchtet, kann man diesen Zugang ganz besonders gut erkennen.
Das nächste große Vorhaben ist schon in der Pipeline: Die Länder Osteuropas ziehen ihn an, er ist fasziniert von den kulturellen und politischen Veränderungen in dieser Region und möchte deren Auswirkungen auf Landschaft und Architektur dokumentieren. „Für mich ist Osteuropa eine riesige Schatzkammer an Geschichten“, schwärmt der Fotokünstler.
Für Jamie McGregor Smith ist Fotografie längst nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensweise. Seine Arbeit ist die ständige Suche nach neuen Perspektiven, nach Wegen, die Welt zu verstehen und zu dokumentieren. Ob in der Modewelt, in urbanen Landschaften oder in der wilden Natur – Jamies McGregor Smiths Fotografien sind stets von Leidenschaft und dem Gespür für Details geprägt. Mit jedem Bild erzählt er eine Geschichte und lädt den Betrachter ein, Teil dieser Reise zu werden. Seine Arbeiten sind im Atelier, aber auch in Ausstellungen und etlichen wunderschönen Bildbänden zu sehen. Jamie McGregor Smith Mölker Steig 1, 1010 Wien www.jamiemcgregorsmith.com jamie@jamiemcgregorsmith.com










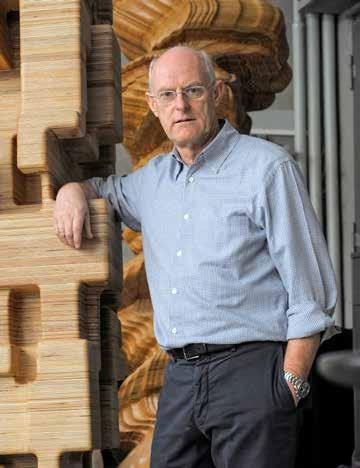
Meterhohe Skulpturen in originellen Farben und organischen Formen kommunizieren mit den altehrwürdigen historischen Schlossmauern. Mitten in England konnte man im vergangenen Sommer diese inspirierende Mischung aus Alt und Neu erleben.
Text: Clarissa Mayer-Heinisch
Die eindrucksvollen Skulpturen des britisch-deutschen Künstlers Tony Cragg belebten ein halbes Jahr lang Park und Salons des Castle Howard in North Yorkshire. Thaddaeus Ropac hat dabei geholfen. Der österreichische Galerist weiß, was wirkt, setzt er doch in seinen Salzburger Residenzen – der Villa Kast und dem Schloss Emslieb – schon seit vielen Jahren auf Kunst in neuem Kontext.
Welcher Schlossbesitzer kennt sie nicht, die Mühen des Alltags: Das Haus samt Möbeln, Teppichen und Kunstwerken, der Garten oder Park mit Bäumen, Blumen, Wasserbecken und schönen Flächen wird aufwendig
gepflegt, für Hochzeiten, Feste und Ähnliches vermarktet und vermietet – und dennoch gibt es Zeiten, zu denen niemand die viele Hintergrundarbeit sieht. Die Eigentümer des prachtvollen Castle Howard im englischen Yorkshire haben sich etwas einfallen lassen: Neben den klassischen Garten-Touren, bei denen man jahrhundertealte Bäume, ausgefallene Büsche und Blumen, aber auch einfach nur die Weite von Wiesen und Weiden erleben kann, bietet die Familie Übernachtungen in Zelten an. Und im letzten Sommer erstmals jede Menge Kunst. Es waren die übergroßen Skulpturen des renommierten Künstlers Tony Cragg, die dieser gemeinsam mit dem Hausherrn Nicholas Howard in und um das Schloss platziert hatte und
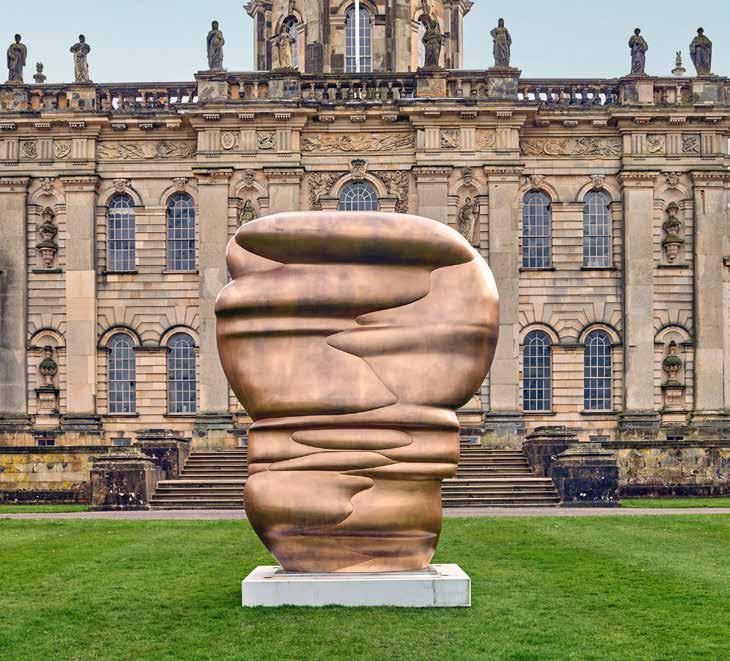
die sich als magnetische Anziehungskraft erwiesen. Tausende von Besuchern wollten die Gegensätze von moderner Kunst und historischem Anwesen erleben.
Castle Howard ist eines der prächtigsten Landhäuser Englands und wurde im späten 17. Jahrhundert für die Familie Howard entworfen. Von diesem Zeitpunkt an dauerte es noch 100 Jahre, bis alles fertiggestellt war. Kein Wunder also, dass Barock, Rokoko und klassizistische Elemente hier miteinander verschmelzen.
Schon die Anfahrt zu Castle Howard verschlägt einem den Atem. Eine weitläufige Landschaft von sanften Hügeln, grünen Wiesen und prachtvollen Alleen, vorbei an einem barocken Pförtnerhaus, über steinerne Brücken und Tore und schließlich auf das mächtige Schloss zu – ein großer Kuppelbau, flankiert von zwei breiten Flügeln, die eine eindrucksvolle Symmetrie ergeben. Gärten und Parkanlagen sind mit Tempeln,
Teichen, Wasserspielen und Ähnlichem geschmückt. Und antike Skulpturen zeugen von Jahrhunderten der Sammel- und Lebenslust der Schlosseigentümer.
Bis heute ist die Familie Howard hier zu Hause. Für Besucher gibt es ein Museum, Künstlern steht das Anwesen für Ausstellungen und als Filmkulisse zur Verfügung; und einige Monate des Jahres kann auch der Park besucht werden. Die Architektur, aber auch die hauseigene Kunstsammlung lohnen einen Besuch. Gemälde von Holbein, Canaletto, Rubens oder Tintoretto sind hier ebenso zu sehen wie historische Tapisserien und Möbel. Alles zeugt vom Kunstverständnis der Howards.
Im vergangenen Sommer wurde dieses wiederum unter Beweis gestellt, als aufsehenerregende Kunstwerke des in Deutschland lebenden englischen Künstlers



Tony Cragg temporär Park und Haus bevölkerten. So standen großformatige, glänzende, oft fluid wirkende Skulpturen aus Bronze, Edelstahl und Aluminium, aus Holz und Stein, aus Kunststoff und Glasfasern rund um das elegante Schloss, einige auch im Inneren des Hauses. Cragg ist für seine innovativen, oft organisch wirkenden Skulpturen bekannt und gilt als einer der einflussreichsten zeitgenössischen Bildhauer.
Die Schlossbesitzer Nicholas Howard und seine Frau Victoria Barnsley hatten Craggs Werke bereits bewundert, insbesondere seine Bronzeplastik „Caldera“ in Salzburg. Gemeinsam mit dem Kurator Greville Worthington besuchten sie dann Craggs Atelier in Wuppertal, wo er rund um die restaurierte Villa Waldfrieden einen 30 Hektar großen Skulpturenpark geschaffen hat. Howard erinnerte sich an diesen Besuch:
„Wir fanden ein historisches Haus aus dem Jahr 1950, das Tony liebevoll restauriert hatte. Es ist umgeben von Lichtungen, Rasenflächen, Bäumen und Skulpturen. Ich dachte: Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Also schien es, dass Tony Craggs Arbeiten diejenigen sein sollten, die unsere neue Ära zeitgenössischer Arbeiten in Castle Howard eröffnen.“
„Over the Earth“ aus 2015, eine fünf Meter breite Arbeit, die auf einem Sockel platziert wurde, „Eroded Landscape“ aus 1999, die im berühmten „Temple of the Four Winds“ von Castle Howard aufgestellt war, und „Points of View“ aus 2018 sind nur einige der Arbeiten aus Tony Craggs Fundus. Zu sehen waren aber auch eigens für die Ausstellung entworfene Arbeiten, beispielsweise „Industrial Nature“ (2024), eine Aluminiumskulptur, die hybride Formen zwischen

organischem Wachstum und maschineller Fertigung darstellt, oder die Bronzeskulptur „Masks“ (2024) mit ihren ineinandergreifenden Formen als Symbol für die Untrennbarkeit menschlicher Identität, die direkt vor der Fassade der großen Kuppelhalle ihren Platz fand. Sie alle fügten sich nahtlos in die Szenerie und traten in einen spannenden Dialog mit der historischen Architektur. „Es ist faszinierend, zu sehen, wie Craggs Arbeiten mit unserer Sammlung interagieren und die Bedeutung dieser Kunstform für das heutige Publikum hervorheben“, beobachtete der Hausherr.
Nach Präsentationen von Tony Craggs Werken in diversen Parks und historischen Stätten weltweit sagte er vorab: „Die Einladung, eine Ausstellung in Castle Howard in Yorkshire zu machen, ist etwas Besonderes, und ich freue mich, hier Arbeiten zu präsentieren. In der schönen Landschaft und der historischen Architektur dieses Ortes, zwischen Natur und Geschichte, ist es interessant zu sehen, wo neue und zeitgenössische Formen ihren Platz finden und welche Rolle sie spielen könnten.“
Die Ausstellung wurde von der Galerie Thaddaeus Ropac unterstützt.

Es war spektakulär, die Werke von Tony Cragg im letzten Sommer in Castle Howard zu sehen – die erste Ausstellung eines zeitgenössischen Künstlers, die in dem barocken Herrenhaus gezeigt wurde. Das historische Haus und das Gelände boten einen unvergleichlichen Rahmen – ganz anders als in einer Galerie oder einem Museum –, in dem die Skulpturen des Künstlers in neuen Kontexten betrachtet werden konnten. Besonders der Dialog zwischen der natürlichen und der menschengemachten Welt, der Craggs Skulpturen maßgeblich prägt, wurde in diesem atemberaubenden Setting hervorgehoben.
Die Eigentümer dieser großen Häuser gestalten ihre Ausstellungsprogramme weitgehend eigenständig und pflegen oft eine langjährige Beziehung zu den Künstlern, die sie ausstellen. So auch Victoria und Nicholas Howard, die das Werk von Tony Cragg seit Jahren bewundern. Aber wie bei allen öffentlichen Institutionen oder privaten Museen unterstützen wir auch diese Projekte gerne je nach Bedarf. Wir bringen uns auf unterschiedliche Weise ein, beispielsweise bei der Bereitstellung von Recherche-, Archiv- und Textmaterial zu den Werken des Künstlers, oder unser Team unterstützt bei der Produktion von Videos oder Publikationen zur Ausstellung.
Tony Cragg: Immer da Von Donnerstag, 24. 7. 2025 bis Montag, 6. 10. 2025 | In den Prunkräume der Residenz zu Salzburg www.domquartier.at

DIE STADT GEHÖRT IHNEN! MITTEN IM KULTURELLEN UND TRENDIGEN
ZENTRUM WIENS ERWARTET SIE EIN LUXURIÖSES WOHNGEFÜHL:
EIN REFUGIUM FÜR GENIESSER DER ÖSTERREICHISCHEN KÜCHE AUF
HAUBENNIVEAU, EXKLUSIVE ORIGINALE VON ROY LICHTENSTEIN, EIN GROSSZÜGIGER SPA-BEREICH MIT DEM LÄNGSTEN INDOOR-POOL
DER STADT. DAS SANS SOUCI WIEN ERWARTET SIE.



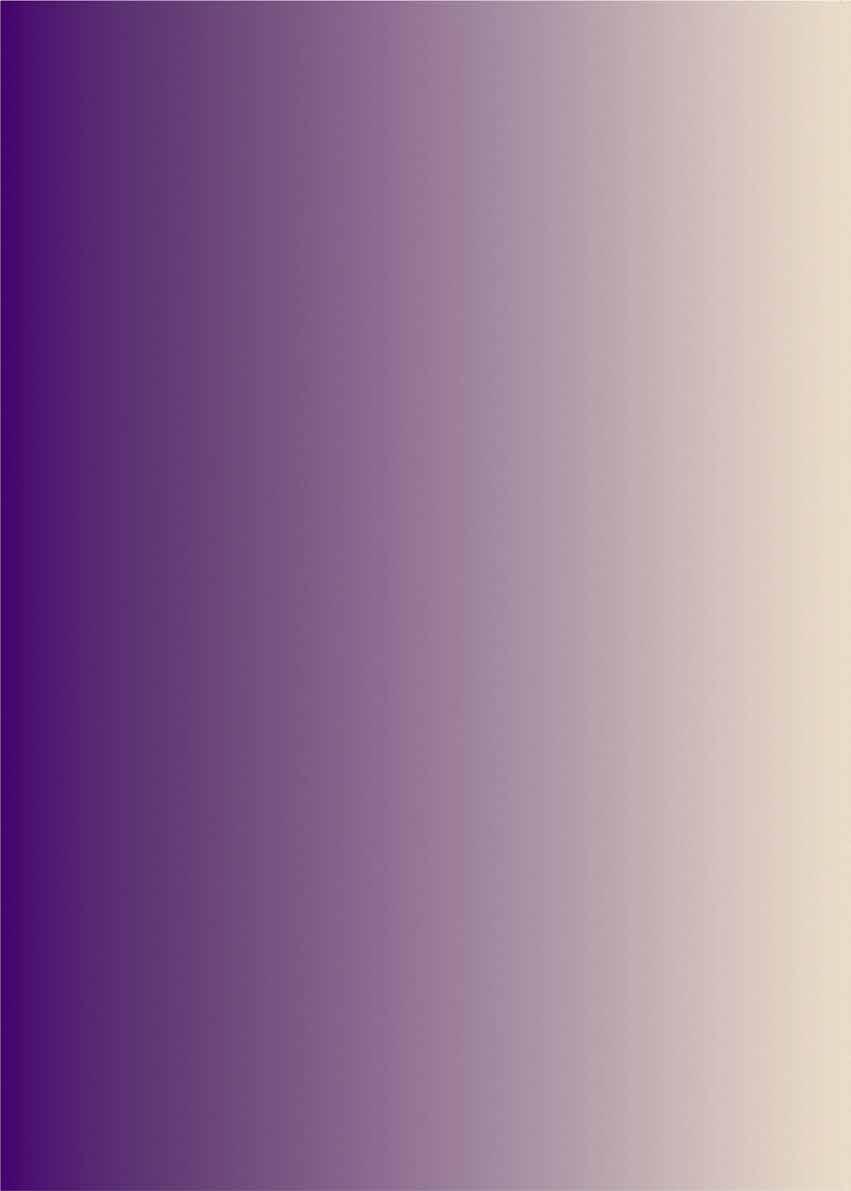




Ein Gespräch mit MARIE-CAROLINE WILLMS
Die Interior-Designerin hat das gekonnte Stilbrechen zu ihrem Signature-Look erhoben und designt die gefragtesten Hotelprojekte, Privatresidenzen sowie Gastro-Projekte von Marbella bis nach Berlin und nochmals rund um den Globus. Den SCHLOSSSEITEN erzählt sie, wie es sich als kreatives Powerhouse in der andalusischen Sonne arbeitet und wie sie die Welt mit ihren atmosphärischen Interior-Entwürfen erhellt.
Text: Beatrice Tourou Fotos: bereitgestellt & EMCI Design Studio

Wer heute an einen Interior-Designer denkt, weiß eigentlich gar nicht, wie unterschiedlich dieses Berufsprofil tatsächlich ausfallen kann. Da gibt es Stardesigner wie Kelly Wearstler, die ein 100-köpfiges Team haben und große Designkooperationen mit Möbelund Leuchtenfirmen eingehen. Dann gibt es exklusive „Maisons“ wie Pinto, die in ihrem Pariser Studio Privatjets, Yachten und Residenzen gestalten und Kunden unter 500 m² Nutzfläche gar nicht erst aufnehmen. Und dann gibt es eine illustre Elite an Designern, die neue Trends formen, weil sie mit ihrer Kreativität und ihrem Gestaltungsgeist neue Wege beschreiten. Diese Trends landen später – viel später – in den Wohnzimmern der breiten Bevölkerung, oft in der Ästhetik von Zara Home.
Eine dieser exklusiven Kreativköpfe ist Marie-Caroline Willms, die bereits als Teenager wusste, dass sie InteriorDesignerin werden wollte, nachdem sie die ersten Projektentwürfe ihrer Mutter gesehen hatte. Der kreative Werdegang eines Menschen ist nie nur an einem einzelnen Moment festzumachen, sondern eine Verkettung von Umständen – allen voran aber an der Willenskraft. „It is always your own willpower which makes you the captain of the team, or will keep you as the benchwarmer“, ist Willms überzeugt. „Der eigene Anspruch an sich selbst, der Drive, den man aus sich selbst generiert, ist letztendlich das, was dein Leben bestimmt. Und das hat man selbst in der Hand.“
Als Teenager arbeitete sie in ihrer Freizeit bei Hermès, um ihre Kasse aufzubessern, und half Interior-Designern im Büro, wo sie konnte, ehe sie in London und später in Florenz ihre Ausbildung zur Interior-Designerin absolvierte. Willms wusste, dass dies ihre Bestimmung und ihre Passion war – ein Kompromiss war ausgeschlossen. „Die Hausfrau mit Hobby war ich nie“, macht Willms deutlich.
Die Liebe führte sie allerdings nach Spanien, was sie auch ästhetisch stark prägte. „Ich lasse eigentlich alles, außer Elektrisches, anfertigen. Am liebsten arbeite ich mit begabten Artesanos“, erzählt sie. Und genau so, wie sich Spanien in ihre Ästhetik eingeschlichen hat, beherrscht es inzwischen auch ihren Sprachgebrauch. Willms selbst lebt mit zwei Töchtern zwischen Madrid und Marbella, wo sie meisterhaft die Hotel-Ikone Marbella Club Hotel gestalten durfte und bewies, wie man ein vergessenes Hotel durch Neuinterpretation des „Old World Charm“ aus seiner goldenen Ära für den heutigen Jetset wieder erstrahlen lässt. Obwohl sie exklusive Projekte betreut –von Privatinseln mit Soundstudio bis zur Gestaltung von Helikoptern –, hält Willms fest: „Es geht niemals um ein großes Budget, sondern um die Freiheit der Kreativität.“ Vom Begriff „Luxus“ will sie sich ebenso distanzieren wie von greige-beigen Wohnlösungen. „Das kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Mein Ziel ist es, Atmosphäre zu schaffen,
neue Wege zu beschreiten, ungewöhnliche Lösungen zu finden. Oft mixe ich Stoffe, die auf den ersten Blick gar nicht funktionieren, sich aber am Ende harmonisch vereinen.“
Genauso bunt gemischt wie ihre Signature-Materialien sind auch ihre Wanderjahre: Deutschland, Österreich, USA, Luxemburg, Großbritannien, Italien und Spanien.
Am liebsten arbeitet Marie-Caroline regional. „Ich frage mich auch bei Hotelprojekten wie zum Beispiel dem Marbella Club: Was will der Tourist denn hier erleben? Regionale Authentizität natürlich. Das Licht, die Pflanzen, die Luft, das Material ... Deshalb arbeite ich am liebsten regional. Besonders inspiriert hat mich hier Prinz Alfonso, der mit seinem Esprit die ganze Gegend geprägt hat und Marbella tatsächlich erstmals zu einem Begriff geformt hat. Diese andalusische Essenz wollte ich einfach in Formensprache, vor allem aber in Atmosphäre packen.“
Obwohl Willms viele aufwendige Hotelprojekte gestaltet, wohnt sie am liebsten bei Freunden statt im Hotel: „Für mich sind Heart-to-Heart-Connections die Lebensessenz. Deshalb verbringe ich lieber meine Zeit mit Freunden auf der Couch als allein im Hotel.“
Genug Gespür dafür, was ein Hotel gelungen macht, hat sie trotzdem. Selbst das Le Jardin im ikonischen Hotel Bristol in Paris sollte ursprünglich nur ein Pop-up werden – doch es kam so gut an, dass daraus ein permanentes Projekt wurde.
Inspiration holt sich die gebürtige Deutsche überall –auch auf der Maison & Objet in Paris, allerdings mehr von den vielen Satelliten-Events, die die Pariser InteriorMesse flankieren. „Man lernt auf diesen Dinner- und Cocktailpartys wahnsinnig interessante Menschen aus der Branche kennen, und die Events sind immer sehr lustig. Auch wenn die ,Maison‘ generell etwas angesnobbt wird, finde ich dort immer etwas – es ist einfach das wichtigste Event für meine Industrie.“ Egal, wo man Willms trifft, sie ist am Arbeiten. Sie bezeichnet sich selbst als „Arbeitstier“, das am liebsten 24/7 in Projekte eintaucht. „Ich nehme mir sehr wohl auch Zeit für meine Kinder und Freunde, aber meine Arbeit erfüllt mich sonst vollkommen.“
Ihr langfristiges Lebensziel? Ihre Firma so aufzubauen, dass ihre beiden Töchter sie eines Tages übernehmen können. Und was hält das Jahr 2025 für sie bereit? „Das Glück, dass meine Tochter ein Stipendium für die schottische Boarding School Glenalmond bekommen hat und dort wahnsinnig glücklich ist.“
Derzeit möchte ihre Tochter noch Modedesignerin werden – aber der Sprung von dort in die Inneneinrichtung ist ja nicht weit.


Die Geschichte des Marbella Club Hotels beginnt mit Prinz Alfonso von Hohenlohe. Er hatte sich in die andalusische Küste verliebt und verwandelte 1954 ein charmantes Anwesen in ein exklusives Boutiquehotel, das schnell zum Treffpunkt für Aristokraten, Filmstars und Wirtschaftsmagnaten wurde – von Brigitte Bardot über Audrey Hepburn bis zu Familien wie den Bismarcks. Heute vereint das Marbella Club Hotel Tradition mit zeitgemäßem Design. Die 115 Zimmer, Suiten und privaten Villen spiegeln den andalusischen Stil wider und werden ergänzt durch moderne Annehmlichkeiten. Weiß getünchte Fassaden, üppige Bougainvillea und handbemalte Fliesen prägen das Bild. Gestaltet von Marie-Caroline Willms.


It is never too much, really Marie-Caroline Willms sucht die Perfektion in der Imperfektion. Ziel ist eine gemütliche Atmosphäre mit einem lässigen Mitch-Match, das dennoch elegant wirkt.

Details matter. Die Verspieltheit reist von Marbella bis nach Berlin (rechts oben), wo selbst ein Kinderzimmer unkapriziös wirken kann.


Rechts: das Garten-Restaurant des Hotel Bristol in Paris.













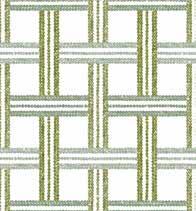



Farben zu kombinieren, will gelernt sein. Doch schon kleine Akzente können viel bewirken – man muss sich nur trauen! Und wer sich unsicher ist, bittet am besten einen Profi um Hilfe.





1. Mit wundervollen Tapeten lässt sich schnell ein Raum neu gestalten, von annawillms.com | 2. Die bunten Ölgemälde von Gottfried Pengg-Auheim mit Motiven aus der Natur geben einen gekonnten Kontrast, Preis auf Anfrage | 3. Die olivgrünen PapageienKerzenhalter versprühen Charakter und Charme, von mrsalice.com, um € 248 | 4. Der Alok-Kissenbezug (50 x 50 cm) von Chhatwal & Jonsson ist oftmals der gekonnte Farbklecks auf der Couch, bei nordicnest.de, um € 85 | 5. Elegant, handgemacht, symmetrisch und funktional finden wir den Rattan-Kaffeetisch „Adeline“, von sharland-england.com, um € 1.950 | 6. Weil immer viel Klimbim herumliegt – genau dafür eignet sich eine schöne Schale in dunkelgrüner Farbe aus glasierter Keramik, von Ferm Living, um € 139 | 7. Der Rattan Lily Dining Chair gibt ein Bistro-Feeling sowohl indoor als auch im überdachten Outdoorbereich, via soane.co.uk, Preis auf Anfrage


ZIEGEL UND KLINKER
Für den Innen- und Außenbereich

LEHMPRODUKTE
Lehm, Lehmziegel, etc.

HANDGEMACHTE ZIEGEL
Traditionell im Ringofen gefertigt

COTTO I TERRACOTTA
Bodenplatten, Ziegelböden, etc.

ALTE BAUSTOFFE
Mauerziegel, Dachziegel, Bodenplatten, etc.

SONDERFORMATE
Vielfalt an Formen, Größen und Farben
Die Familie Nicoloso widmet sich seit 400 Jahren dem Ziegelhandwerk – heute in 3. Generation in Österreich. Ihr Sortiment umfasst klassische, moderne und handgefertigte Ziegel, Terrakotta, Klinker & Sonderanfertigungen. Viele Produkte entstehen in traditioneller Handarbeit, gebrannt im letzten Hoffmann-Ringofen Österreichs. Auch für denkmalgeschützte Projekte fertigt die Manufaktur hochwertige Ziegel nach Maß. Durch die enge Zusammenarbeit mit innovativen italienischen Familienbetrieben bringt Nicoloso mediterranes Flair nach Österreich. Besuchen Sie die Manufaktur in Pottenbrunn!
Filmplakat

Jährlich besuchen rund 300.000 Touristen, besonders aus den USA, Kanada, Großbritannien und Australien, die ehemaligen Drehorte des Films wie Pilgerstätten, was auf die enorme Popularität der Musical-Verfilmung über das Leben der Trapp-Familie zurückzuführen ist. Die Salzburger hingegen stehen dem Film eher ambivalent gegenüber, da die Hollywood-Produktion deren Geschichte aus ihrer Perspektive verkitschte und politisierte. Genau wie der Genius loci Mozart beeinflusst jedoch auch der Hype um „The Sound of Music“ Salzburg nicht nur touristisch, sondern auch kulturell und wirtschaftlich.
Georg Ludwig Ritter von Trapp wird 1880 in Zara im heutigen Kroatien und damaligen Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie geboren. Schon mit 14 Jahren tritt er in die Marine-Akademie in Fiume, dem heutigen Rijeka, ein. Als junger Kadett von 18 Jahren nimmt er mit dem Panzerkreuzer Kaiserin und Königin Maria Theresia an den Kämpfen anlässlich der Boxerunruhen in China teil. Er wird 1902 Offizier und übernimmt 1910 sein erstes U-Boot.
1911 heiratet er Agathe Whitehead, die Tochter des Torpedofabrikanten John Whitehead und Enkelin des Erfinders des Torpedos, Robert Whitehead. Zu Beginn des 1. Weltkrieges übersiedelt seine Frau mit den ersten zwei Kindern zu ihrer Mutter nach Zell am See. Das Ende des Krieges mitsamt dem Verlust aller Seehäfen Österreichs beendet Trapps Offizierskarriere. Er wird Privatier und zieht mit der Familie – indessen war die Kinderschar auf sechs angewachsen – nach Klosterneuburg bei Wien, wo 1921 das letzte Kind
Die Trapp-Familie

geboren wird. Kurze Zeit danach stirbt Agathe an den Folgen einer Scharlacherkrankung. Auf dem Sterbebett soll sie ihren Mann gebeten haben, um der Kinder willen wieder zu heiraten.
Welcher Grund von Trapp bewegte, 1925 nach Salzburg zu ziehen, ist unbekannt. Er kauft im vornehmen Stadtteil Aigen ein großzügiges Herrenhaus mit einem malerischen Park und sucht für seine herzkranke
Tochter Maria eine Hauslehrerin. Die Benediktiner-Äbtissin des Stiftes Nonnberg vermittelt ihm die erst 20jährige Maria Augusta Kutschera, die an der Klosterschule arbeitet. 1927 heiratet von Trapp die um 25 Jahre jüngere Frau in der Nonnberg-Abtei, 1929 und 1931 werden zwei Töchter geboren.
„We are not poor. We just don’t have any money!“
„We learned the shocking truth that ,home‘ isn’t necessarily a certain spot on earth. It must be a place where you can ,feel‘ at home, which means ,free‘ to us.“
Maria Augusta Trapp, aus „The Story of the Trapp Family“
1933 verliert von Trapp infolge einer Fehlspekulation seiner Hausbank sein gesamtes Vermögen. Die praktisch veranlagte Maria entlässt die Hausangestellten und die Familie bezieht die Dienstbotenzimmer unter dem Dach. Die repräsentablen Räume werden indes an Paying Guests der Salzburger Festspiele vermietet, unter anderem an die weltberühmte Wiener Sängerin Lotte Lehmann. Sie hört den Familienchor, dessen musikalische Leitung Franz Wasner, der Hauskaplan der Familie, übernommen hatte, und animiert die Trapps dazu, an einem Volkslied-Wettbewerb teilzunehmen, den diese überraschenderweise gewinnen. Es folgt ein vielbeachtetes Radiokonzert.
Maria Augusta Trapp, aus „The Story of the Trapp Family“
Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland befürchtet Georg von Trapp, der für seine zahlreichen Einsätze im Ersten Weltkrieg vielfach ausgezeichnet worden war (unter anderem mit dem Ritterkreuz des Maria-Theresien-Ordens), zur deutschen Marine eingezogen zu werden. Auch will er eine Einladung, anlässlich des Geburtstages von Adolf Hitler am
20. April 1938 in München aufzutreten, nicht annehmen. Da ein Angebot zu einer Konzertreise nach Italien vorliegt, vermietet er die Villa an einen geistlichen Orden; während der Zeit des Nationalsozialismus wird Heinrich Himmler, der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, hier residieren. Die Trapps und Kaplan Wasner reisen mit dem Zug zuerst nach Italien, von wo aus es über London in die USA geht, wo sie sich in Vermont niederlassen. 1939 kommt der letzte Trapp-Sohn auf die Welt. Die Familie bestreitet ihr Auskommen mit zahlreichen Konzerttourneen und tritt unter dem Namen „Trapp Family Singers“ auf. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges organisiert Maria von Trapp eine Hilfsaktion unter dem Namen „Trapp Family Austrian Relief Inc.“ und sammelt Kleidungsstücke sowie Nahrungsmittel für Österreich. 1947 stirbt
Georg von Trapp, 1950 reist Maria von Trapp mit ihren Kindern zurück nach Salzburg, um bei den Festspielen aufzutreten. 1957 wird der Chor, der mehr als 2000 Konzerte weltweit gab, aufgelöst.
DAS MUSICAL
Maria von Trapp schrieb einige Bücher, darunter 1949 die Autobiographie „The Story of the Trapp Family Singers“, in der sie ihre Familie stark idealisierte und sich selbst zu einer „von Gott geliehenen Novizin und zum Musterbild der katholischen Frau und Mutter ihrer Zeit“ machte. In Deutschland erschien das Buch 1952 unter dem Titel „Die Trapp-Familie. Vom Kloster zum Welterfolg“.

Das Musical „The Sound of Music“ (Musik: Richard Rodgers; Texte: Oscar Hammerstein) basiert auf dem Buch der Pulitzer-Preisträger Howard Lindsay (US-Dramatiker und Drehbuchautor) und seines Partners Russel Crouse. Die beiden hatten bereits die Bücher für sehr erfolgreiche Musicals geschrieben, darunter „Anything goes“ und „Red, Hot and Blue“ (Musik: Cole Porter) sowie „Call me Madam“ (Musik: Irving Berlin). Die Premiere von „The Sound of Music” fand am 16. November 1959 am Broadway in New York statt, das Stück wurde 1443-mal gespielt. In London erreichte die Produktion von 1961 sogar 2386 Aufführungen! Deutschsprachige Aufführungen erfolgten erst 1982 im Stadttheater Hildesheim, 1996 in Innsbruck, 2005 in der Volksoper Wien und 2008 im Landestheater Salzburg.
„Ein mit immensem äußerem Aufwand produzierter Unterhaltungsfilm, der durch eindrucksvoll fotografierte und arrangierte Breitwand-Panoramen, (im Original) schöne Songs und eine bemerkenswerte Hauptdarstellerin fesselt. An der Grenze zur Peinlichkeit ist indes die oberflächliche Aufbereitung des politischen Hintergrundes. Der deutsche Verleih kürzte den Film nach der Erstauswertung rigoros, um alle politischen Elemente zu eliminieren, so dass der Film ‚freundlicher‘ und konsumierbarer, in seiner Konzeption freilich zerstört wurde.“
Aus dem Lexikon des internationalen Films (CDROM-Ausgabe), Systhema, München 1997
Der Filmproduzent Wolfgang Reinhardt, Sohn des Salzburger Festspielgründers Max Reinhardt, erkannte das Potenzial der berührenden Geschichte. Er kaufte Maria von Trapp die Rechte für nur 9.000 Dollar ab und produzierte 1956 den Film „Die Trapp-Familie“, der als einer der erfolgreichsten deutschen Filme der Nachkriegszeit gilt. Die Hauptrollen spielten Ruth Leuwerik als Maria von Trapp, Hans Holt als Ritter von Trapp und Josef Meinrad als Hauskaplan Georg Wasner; die Regie führte Wolfgang Liebeneiner. Kurz darauf (1958) folgte die weniger erfolgreiche Fortsetzung „Die Trapp-Familie in Amerika“.
Regisseur Robert Wise von 20th Century Fox Studios beginnt mit den Dreharbeiten zum Film „The Sound of Music“ im Jahr 1964, in dem Julie Andrews Maria von Trapp und Christopher Plummer Georg von Trapp spielen. Plummer, als Shakespeare-Darsteller bereits berühmt, fühlt sich anfangs bei der Filmcrew deplatziert: „I tried to be as snobbish as possible until I realized, these were highly professionals.“
Gedreht wird auch in Salzburg, wobei viele Fakten dramaturgisch „interessanter“ interpretiert werden: So wird Maria Augusta als junge Novizin dargestellt,


Georg Steinitz und Regisseur Robert Wise – „The Sound of Music wurde so erfolgreich, weil er eine wahre Geschichte in einer der schönsten Städte Europas erzählt.“
die als Kindermädchen engagiert wird; geheiratet wird im Film in der prachtvollen Kirche von Mondsee. Als ihre Villa wird das Schloss Leopoldskron von der Seeseite her gefilmt, die Rückseite des Hauses ist jene der Salzburger Fronburg. Nach einer tränenreichen Abschiedsszene der ältesten Tochter mit dem Postboten im berühmten Pavillon flieht die Familie, von den Nazis verfolgt, des Nachts zu Fuß im Schein der Laternen und mit Rucksäcken bepackt über ein Gebirge direkt von Salzburg in die Schweiz – Szenen, die, als der Film am 25. Dezember 1965 in die Kinos kommt, diejenigen Salzburger belustigen oder verärgern, welche die Familie kennen. Bereits drei Tage später wird der Film abgesetzt; da hilft es auch nicht, dass in der stark gekürzten deutschen Fassung alle Bezüge auf den Nationalsozialismus fehlen und der Film mit der Hochzeit Marias endet und nicht mit der Flucht der Trapp-Familie aus Österreich. Schließlich erwirkt das amerikanische Produktionsstudio jedoch, dass dieser dritte Akt des Films auch in der deutschen Fassung gezeigt wird.
Bei den Filmarbeiten werden österreichische Firmen zugezogen, unter anderem die Filmfirma Otto Dürer. Dort hatte sich der junge Salzburger Schauspieler Georg Steinitz beworben; engagiert wird er allerdings nur als Chauffeur des Chefs und als Aushilfe in der Telefonzentrale. Zwar macht ihm das Lenken des mondänen Jaguars „Mark X“ Spaß, doch als er durch ein mitgehörtes Telefonat erfährt, dass der erste Regieassistent, Dürers Adoptivsohn, von den Amis gefeuert wurde, bewirbt er sich bei den Amerikanern umgehend mit den Worten: „I am the one you are looking for.“ Nach einer anstrengenden Probewoche – untertags
arbeitet Steinitz als Chauffeur, in der Nacht bei den Dreharbeiten in der Felsenreitschule – wird er mit einer für damalige Begriffe sagenhaft hohen Gage als Regieassistent für die Kommunikation mit den „Locals“, den Statisten, eingesetzt. Kein einfacher Job: So sollte bei einer Szene der österreichische Chor das Lied „Edelweiß“ singen, doch zur großen Verwunderung des Regisseurs war dieses den meisten Choristen unbekannt. „Wieso kennen die Leute es nicht?“, fragte er. „Ist denn das nicht Österreichs Nationalhymne …?“
Fast hätte es einen politischen Skandal gegeben, denn die Amerikaner wollten unbedingt die Szenen des „Anschlusses“ mit Hunderten von Soldaten und großer Nazi-Beflaggung am Residenzplatz filmen, was Salzburgs Stadtväter in helle Aufregung versetzte. Man einigte sich letztlich auf drei große Hakenkreuzfahnen und bestellte 50 unbewaffnete Soldaten, die ohne Rücksicht auf ihren tatsächlichen Dienstgrad mit Wehrmachtsuniformen aus dem Kostümfundus ausgestattet wurden. So kam es, dass ein einfacher Soldat zum Kommandanten wurde, während der eigentliche Kommandant als einfacher Soldat mitmarschierte. Als die Marschbefehle missglückten, rief dieser aus den hinteren Reihen: „Wennst uns so weiterkommandierst, rennen wir frontal gegen die Dommauer.“
Die Filmarbeiten dauerten noch an, als am Abend die ersten Gäste eines internationalen Postkongresses in der Residenz eintrafen. Man sagt, einige Teilnehmer waren beim Anblick der Hakenkreuzfahnen mehr als erstaunt darüber, was im Salzburg des Jahres 1964 noch möglich war.
Steinitz arbeitete 1965 noch an zwei weiteren US-Produktionen mit: „The Great Race“ mit Natalie Wood, Toni Curtis und Jack Lemmon sowie „Der Spion, der aus der Kälte kam“ mit Richard Burton und Oskar Werner. Mehr als 30 Jahre war er danach beim ORF beschäftigt, u. a. als Spartenleiter für Jugend, Sport und Gesellschaft, und moderierte 10 Jahre lang die Sendung „Salzburg heute“.
An die 1,2 Milliarden Menschen haben den Film bisher weltweit gesehen; er zählt zu den erfolgreichsten Filmproduktionen und wurde mit 5 Oscars ausgezeichnet. Julie Andrews erhielt als beste Hauptdarstellerin den Golden Globe Award. Das American Film Institute wählte das Lied „The Sound of Music“ 2004 auf Platz 10 der 100 besten US-amerikanischen Filmsongs. Bei der Oscarverleihung 2015 sang Lady Gaga ein Tribute zu „The Sound of Music“; nach ihrem Auftritt erschien Julie Andrews und bedankte sich für die musikalische Darbietung.
Und so werden weiterhin „The Sound of Music“Touristen in Scharen nach Salzburg kommen, um „Schnitzels with Noodles“ und „Crisp Applestrudels“ zu essen, die Mondseer Kirche wie auch Schloss Hellbrunn besuchen und Tränen der Rührung beim Anblick des Pavillons vergießen, in dem sich das junge Liebespaar traf. Auch von als Nonnen verkleidete Touristinnen, die singend durch den Park von Schloss Leopoldskron tanzen, wurde berichtet. An Fäden tanzen die Trapps im Salzburger Marionettentheater, deren Produktion von „The Sound of Music“ auch im Jubiläumsjahr die Zuschauer begeistern wird. Das Salzburger Landestheater wird ebenfalls mit dem Musical punkten und zudem im Oktober 2025 eine besondere „The Sound of Music“-Jubiläumsgala in der eindrucksvollen Felsenreitschule – einem der Originalschauplätze des Films – mit ausrichten.
DAS MUSEUM
Damit die historischen „Freiheiten“ des Films richtiggestellt werden – und um die wahre Geschichte der Familie Trapp zu erzählen –, haben Land und Stadt Salzburg das Salzburg Museum mit der Realisierung eines eigenen „The Sound of Music“-Museums beauftragt. Dessen Chefkurator und Leiter der Neuen Residenz, Mag. Peter Husty, hat die Koordination übernommen.
Peter Husty: „2011 wurde bereits vom Salzburg Museum eine Ausstellung in Salzburg konzipiert, die das Leben der Familie Trapp und auch das zeigte, was der Broadway und Hollywood daraus kreiert hatten.

Fotos: Georg Steinitz, Dreharbeiten zum Film „The Sound of Music“, Salzburg



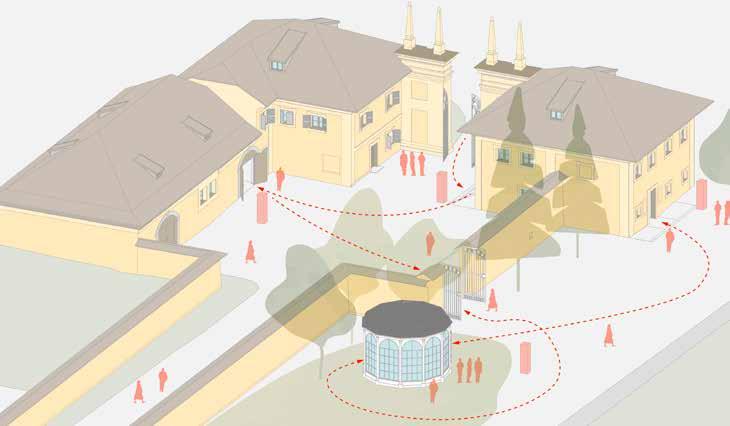


Viele Salzburger, die Maria von Trapp noch kannten, haben sich seither gemeldet, um ihre Erinnerungen in Form von Objekten, Schallplatten des Trapp-Chors, Briefen, Postkarten und vielem mehr dem Salzburg Museum zu schenken. 2024 gelang es uns, zusätzlich die Sammlung des Niederländers Roger Pluijm zu erwerben, der den Film als Jugendlicher im Kino gesehen und über 25 Jahre alles gesammelt hatte, was zu dem Thema zu erwerben war. Seine Sammlung umfasst mehr als 2500 Objekte, darunter Filmplakate, Kinowerbungen, Poster, Billcards sowie Film- und Tonträger in Form von Schallplatten, CDs, Videokassetten, DVDs, Blu-Ray-Discs und vieles mehr.“
Standorte des zukünftigen Museums werden die Remise von Schloss Hellbrunn mit Jäger- und Tierwärterhaus sowie der Schlosspark, wo bereits jetzt der „Sound of Music“-Pavillon steht. Das prachtvolle frühbarocke Lustschloss, das 1613 bis 1615 unter Erzbischof Markus Sittikus erbaut wurde, ist berühmt für seine kunstvollen, einzigartigen Wasserspiele, eine Serie von Brunnen und Wasserscherzen, die den Besucher überraschen und unterhalten sollen.
Die Eröffnung des Museums ist für 2026 geplant.
Text: Eva von Schilgen
Salzburg Museum www.salzburgmuseum.at
„The Sound of Music“ trifft auf Salzburger Tradition: In edlem Salzburger Blau vereinen sich Nostalgie und Eleganz zu einem harmonischen Klangbild. Ein Tribut an die weltberühmte Melodie, stilvoll interpretiert.







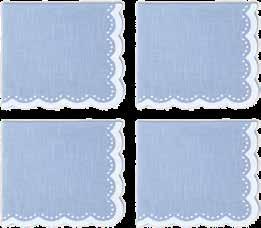

1. Sommerlicher Leinenjanker von Poldi, via Lodenfrey, um € 699 | 2. Fairytale Bluse, das Must-have der Saison, von mariadelaorden.com, um € 140 | 3. Blaubestickte Leinenservietten, 4er-Pack, von HMA | Blank Space, um € 105 | 4. Mobile LEDLeuchte, gehört in jeden Haushalt, von Zafferano, um € 169 | 5. Elegante Strickjacke, in Aquamarin, von Mirabell Kollektion via susanne-spatt.com, um € 559 | 6. Schöne Loafer mit dem Namen „Heaven Argento“, von bellas-vienna.at, um € 189 | 7. Ring, mit Saphir und Diamanten, von Juwelier A.E. Köchert, soll auf jede Wunschliste für den Frühling, ab € 1.400 | 8. Dieses entzückende Mädchenkleid mit Handdruck wird mit viel Liebe in Salzburg in der hauseigenen Schneiderei produziert, von babogi.at, ab € 115 | 9. Kaffeehäferln kann man niemals genug haben, von gmundner.at, um € 39,90



BELLAS WIEN
Dorotheergasse 5 1010 Wien

SPRING-SUMMER COLLECTION 2025

Bellas Vienna hat den Anspruch, Eleganz mit hohem Tragekomfort zu kombinieren. Mit diesen Schuhen aus feinsten Materialien schaffen wir für Sie die passenden Begleiter zu jedem Outfit. Viele Farben und zahlreiche neue Modelle zeichnen die diesjährige Spring-Summer Collection aus Wir freuen uns die Liebe zu wunderschönen und bequemen Schuhen mit Ihnen teilen zu können - und natürlich auf Ihren Besuch bei Bellas und in unserem Online-Store.
BELLAS SALZBURG
Getreidegasse 47 5020 Salzburg
BELLAS MÜNCHEN
Fürstenfelder Straße 12 80331 München

Zwischen sattem Grün und prunkvollen Schlosskulissen entfaltet sich der Zauber von „The Sound of Music“. Die Natur der Alpen und die Eleganz historischer Gemäuer verschmelzen zu einer Welt voller Harmonie und Geschichte. Ein Leben wie im Film – inspiriert von Salzburgs Schönheit.




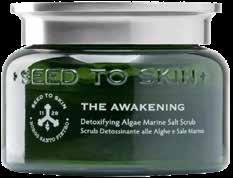


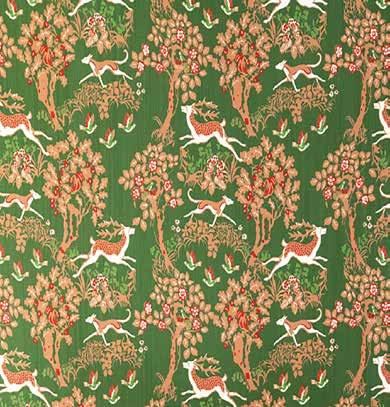

1. Gentlemanstyle mit dem Sakko aus Brillantsamt in Dunkelgrün, handgefertigt bei madlsalzburg.com, um € 2.150 | 2. Eine elegante Uhr aus dem Jahr 1976 ist die Rolex „Day-Date Ref. 1803“, sie verfügt über ein 36-mm-Gehäuse aus 18 kt. Gold mit einer klassischen geriffelten Lünette, erhältlich bei dem absoluten Vintage-Uhrenspezialisten von München reygers.com, um € 13.750 | 3. Duft „Tragedy of Lord George“, von Penhaligon’s, um € 260 | 4. Körperpeeling, von Seed to Skin, um € 145 | 5. Der Stoff Hohenberg verleiht jedem alten Möbelstück wieder neuen Glanz, von jordis.at | 6. Olivfarbene Wolldecke, in Fischgrät, von lodenfrey.com, um € 349 | 7. Backgammon-Spiel, aus Walnussholz gefertigt, mit kratzfestem und wasserabweisendem Kalbsleder ummantelt, von Giobagnara, um € 1.499 | 8. MEN Furlane Velluto Loden, mit Leder gefüttert, bei bellas-vienna.at, um € 149 | 9. Duftkerze, mit holzigen Noten, von L’Artisan Parfumeur, um € 85

„The Sound of Music“ und Salzburger Tracht – eine Verbindung voller Tradition und Geschichte. Inspiriert von der berühmten Filmkulisse, bringen diese Trachten den Zauber der Alpen stilvoll zur Geltung. Ein Stück Heimat zum Tragen und Erleben.







1. Die ersten Sonnenstrahlen abwehren mit dem Strohhut, der aus dem Salzkammergut kommt, von bittner.co.at, um € 255 | 2. Leaf Clip-Ohrringe, in Flaschengrün und Gold, von Olivia Dar bei lodenfrey.com, um € 240 | 3. Trachten-Lammvelour-Jacke „Fidelia“ für Damen, in Braun, von habsburg.co.at, um € 1.599 | 4. Für die jungen Herren findet man die schönsten TrachtenOutfits bei susanne-spatt.com | 5. Beim Maibaum-Aufstellen im Dirndl glänzen, das kann man am besten in der edlen Kombi von Susanne Spatt, gesehen bei lodenfrey.com um € 1.599 | 6. Wenn es nicht regnet, tanzt man in den Ballerinas „Mary Jane“ aus taupe-farbenem Samt mit Perlen-Schnalle am Verschluss am besten, von bellas-vienna.at, um € 229 | 7. Klassische Herrenstrickjacke, mit farblich abgesetzter, handgehäkelter Einfassung, aus 100 % weicher Merinowolle, mit echten Hirschhornknöpfen, in Deutschland gestrickt, von alippa.com, um € 349

Blühende Gärten, perlender Cham pagner und die Leichtigkeit eines Som mertages, inspiriert von „The Sound of Music“. Ob stilvolles Picknick oder ele gante Gartenparty – hier trifft Genuss auf idyllische Kulisse. Ein Fest für die Sinne unter freiem Himmel.









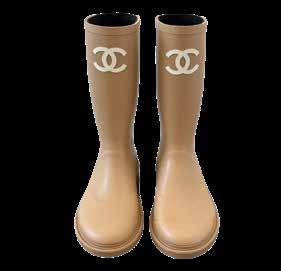

1. Schaffe dir für den Garten mit dem Sonnenschirm „Umbra“ ein schönes, schattiges Plätzchen für warme Sommertage, von ermellino.at, um € 249 | 2. Blumenring, mit Diamanten und Saphiren, von rozetundfischmeister.at, um € 7.000 | 3. Sugar Plum Fairy Kipferl, von windymagdalena.com, um € 89 | 4. Was nicht ins Bett kommt, hüpft in den Terrakotta-Topf, von Lederleitner, um € 155 | 5. Midikleid Phare, aus einer Seidenmischung mit Falten, von Staud, bei net-a-porter.com, um € 800 | 6. Wenn es mal gatschig ist, kann man die komplett überteuerten Gummistiefel von Chanel wählen, gebraucht ab € 2.800 | 7. Loungemusik im Garten abspielen mit dem Outdoorspeaker „Emberton III“, von Marshall, um € 179 | 8. Gaumenfreude mit dem Champagner „Dom Perignon Vintage 2015“, via weisshaus.at, um € 229 | 9. Lobmeyr Gläser gefallen nicht nur, sie bestechen durch ihr zeitloses Design, Champagne Cup und Tumbler „Persian Flowers Large No.1“ | 10. Sandalen „Kristen“, von Hermès, um € 1.100





Das im Jahr 1945 von Carl Hilscher gegründete Luxus-Juwelierunternehmen gehört heute zu den führenden Juwelieren Deutschlands und ist für seine Zuverlässigkeit, Flexibilität und Professionalität bekannt. Als langjähriger Partner exklusiver Uhren- und Juwelenmarken sowie als Anlaufstelle für Liebhaber seltener Luxusmarken bietet das Unternehmen eine herausragende Goldschmiede und eine der besten Uhrmacherwerkstätten des Landes.
Unter der Führung von Brigitte und Manfred Hilscher sowie Geschäftsführer Kai Pierre Thieß hat sich das Familienunternehmen als Botschafter bayerischer Handwerkskunst etabliert und engagiert sich stark in den Bereichen Sport, Kultur und Lifestyle. Das Netzwerk von Inhaber Manfred Hilscher und Geschäftsführer Kai Pierre Thieß ist beeindruckend. Gepflegt werden mehr als 25 Partnerschaften und Sponsorings. Die klassische Kultur wiederum ist das ganz persönliche Steckenpferd von Kai Pierre Thieß – von der Münchner Staatsoper über die Salzburger Osterfestspiele bis hin zum Musikfestival „Klassik Unique“ am schönen Achensee. Kai Pierre Thieß ist zudem im Vorstand der „Freunde der Münchner Philharmoniker“. Überall findet sich das Unternehmen Hilscher als Unterstützer.
Hilscher ist bodenständig und bescheiden – und doch mehrfach ausgezeichnet: in Hamburg als einer

Ohrhänger, 18k Rosegold, Citrin, Rhodolith, weißer Mondstein und Diamanten
Armband, 18k Rosegold, Citrin, Rutilquarz und Diamanten


Ring, 18k Rosegold, Saphire und Diamanten
der besten Juweliere Deutschlands, in Wien bei der Schmuckstars-Gala mit dem ausländischen Ehrenpreis für das beste Juweliergeschäft und von der Leitmesse Inhorgenta als eine der besten Adressen des Landes.
Neben Unternehmern und Privatiers, die die Werte des Unternehmens schätzen und teilen, hat sich Juwelier Hilscher einen besonderen Namen in Adelskreisen gemacht. Nicht selten ist die Nordendstraße 50 in München die Anlaufstelle, wenn es gilt, einem historischen Juwel von unschätzbarem Wert ein neues Leben zu geben oder dieses historisch fachmännisch korrekt zu reparieren. Aktuell arbeitet das HilscherTeam eine Fabergé-Brosche um, mehrere Juwelen aus der Schmiede des über Jahrhunderte etablierten Meisters Fabergé sowie ein Diadem, das nachweislich der Familie Romanow gehörte. Was zuerst wie ein Sakrileg erscheint, erhält Verständnis, wenn das Juwel als Familienerbstück betrachtet wird, das noch getragen werden soll. Und darin liegt schließlich dessen Bestimmung.
Hilscher feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Jubiläum und plant den großen Umbau, im Zuge dessen die komplette Kernsanierung und Erweiterung des Stammhauses in Schwabing anstehen. Hilscher investiert zudem ein paar Häuser weiter – übrigens jene Adresse, an der Carl Hilscher 1945 sein erstes kleines Geschäft eröffnete. „Unser kleines Geschäft wird ,Uhrsprung‘ heißen, eine Adresse für den distinguierten Handel von Vintage-

Collier, 18k Rosegold, Saphire, Amethyst, Aquamarin, Citrin
Juwelen.“ Außerdem steht die Eröffnung des „Hilscher Solitärs“ in der Motorworld in München kurz bevor.
Juwelier Hilscher ist heute definitiv ein Ort des Luxus, aber nicht nur der seltenen Uhren und kostbaren Juwelen wegen. Es ist einer dieser Orte mit echten Menschen, die ihre Berufung gefunden haben und diese mit Freude mit jedem teilen, der die Türschwelle überscheitet.

Juwelier Hilscher Stammhaus Schwabing Nordendstr. 50 80801 München
Telefon: +49 89 27275178 servus@juwelier-hilscher.de www.juwelier-hilscher.de

MODERNER WOHNKOMFORT IN HISTORISCHEN MAUERN
Schloss Windern – eine Residenz voller Pracht, Geschichte und Eleganz!
Eingebettet in die zauberhafte Landschaft des Salzkammerguts, umrahmt von uralten Baumriesen und üppigem Grün, thront das prächtige Schloss Windern wie ein Märchen aus vergangenen Zeiten.
Mit seinen historischen Mauern, kunstvollen Details und einer Aura von Erhabenheit lädt dieses einzigartige Anwesen dazu ein, in eine Welt voller Anmut, Noblesse und zeitloser Schönheit einzutreten.
Seit seiner ersten Erwähnung im Jahr 1185 hat Schloss Windern viele Jahrhunderte überdauert, edle Familien beherbergt und sich immer wieder gewandelt – ohne je seinen erhabenen Charakter zu verlieren. Erbaut von angesehenen Adelsfamilien, war
es Schauplatz glanzvoller Empfänge, bedeutender Entscheidungen und gelebter Tradition. Heute erstrahlt es in restaurierter Pracht, bereit für eine neue Ära voller Leben und Geschichte.
Ein fast quadratisches Hauptgebäude, umgeben von einer wehrhaften Mauer mit zwei Rundtürmen, erhebt sich majestätisch inmitten eines weitläufigen Parks. Vier charmante Vierecktürmchen mit filigranen Blechfiguren der Evangelisten schmücken die Ecken des Schlosses und verleihen ihm eine feenhafte Silhouette.

Hinter den ehrwürdigen Fassaden verbirgt sich ein Wohnensemble einzigartiger Schönheit. Weitläufige Räume mit herrschaftlichen Deckenhöhen, prunkvollen Stuckarbeiten und originalen Holzvertäfelungen erzählen Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten.
Prunkvolle Kamine laden zu gemütlichen Stunden in aristokratischer Atmosphäre ein, während die charmante Schlosskapelle zum Hl. Nepomuk – geschmückt mit kunstvollen Rokokoaltären und Werken des Barockmalers Bartolomeo Altomonte (1769) –diesem Anwesen eine spirituelle Note verleiht.
Der weitläufige Schlossgarten ist eine Oase der Ruhe und Schönheit. Alte Bäume, die rauschend ihre Geschichten flüstern, Rosenbeete, die mit ihrem betörenden Duft die Sinne umschmeicheln, und gepflegte Parkanlagen, die zu ausgedehnten Spaziergängen einladen – all das macht dieses Schloss zu einem wahren Ort der Inspiration und Entspannung.
Seit 2006 mit viel Liebe und Sorgfalt restauriert, verbindet Schloss Windern antiken Charme mit modernem Wohnkomfort. Ob als repräsentative Residenz, als Veranstaltungsort für exklusive Anlässe oder als kulturelles Denkmal – die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Erdgeschoss Großzügige Räumlichkeiten im prächtig sanierten Gewölbe, ideal für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.
Beletage Prunkvoller Wohnsalon mit Kamin, elegante Salons, eine exquisite Küche, ein stilvolles Esszimmer und private Gemächer.

Zweites Obergeschoss
Drei charmante Gästeappartements mit eigenen Bädern.
Nebentrakte
Zwei vollständige Wohneinheiten für Gäste oder Personal sowie Stallungen/Garagierungsmöglichkeiten.
Treten Sie ein in diese prachtvolle Residenz, spüren Sie den Hauch der Geschichte und lassen Sie sich von der Magie dieses einzigartigen Schlosses verzaubern. Vereinbaren Sie gerne noch heute eine Besichtigung: Hermann Richter-Irsigler | Tel. +43 664 1278927
LAGE
Eingebettet in die malerische Landschaft Oberösterreichs, entfaltet sich die Gemeinde Desselbrunn wie ein verstecktes Juwel zwischen den glitzernden Wassern von Traun und Ager. Die unberührten, dicht bewaldeten Flussufer erzählen Geschichten von ungezähmter Natur und zeitloser Schönheit, während der wildromantische Traunfall mit seinem tosenden Wasserspiel zum Staunen einlädt.
Desselbrunn vereint ländliche Idylle mit lebendiger Kultur und wirtschaftlicher Dynamik. Die Nähe zum bezaubernden Attersee und zum majestätischen Traunsee verleiht der Region einen besonderen Reiz – ein Paradies für Naturliebhaber, Wanderer und Erholungssuchende.















Die kulinarische Seele Österreichs – Martina Hohenlohes neues Kochbuch feiert die Vielfalt der heimischen Küche. Es ist dies ihr erstes Kochbuch über die österreichische Küche, doch sie kann versichern: Es wird nicht das letzte sein.

Was macht die österreichische Küche aus?“ Diese Frage stellte sich Martina Hohenlohe nicht nur selbst, sondern bekam sie auf unerwartete Weise von einem französischen Spitzenkoch serviert – mit der provokanten Gegenfrage, ob es diese überhaupt gebe. Die Antwort darauf liefert ihr neues Kochbuch mit einem klaren „Ja!“ und einer leidenschaftlichen Reise durch die regionalen Spezialitäten Österreichs.
Von Altausseer Saibling über burgenländische Grammelpogatscherln bis hin zu Kärntner Kasnudeln – Martina Hohenlohe erkundet die kulinarische DNA der neun Bundesländer und entdeckt dabei nicht nur traditionelle Gerichte, sondern auch die Geschichten und Eigenheiten, die sie begleiten. Besonders spannend: die sprachlichen Eigentümlichkeiten der heimischen Küche, in der Begriffe wie „Affenfett“ oder „Bröselgeier“ zum humorvollen Nachschlagen einladen.
Mit ihrem neuen Werk gelingt es Martina Hohenlohe, die österreichische Küche in ihrer ursprünglichen, herzhaften und authentischen Form zu präsentieren – ein Buch, das nicht nur den Gaumen, sondern auch das Herz anspricht.
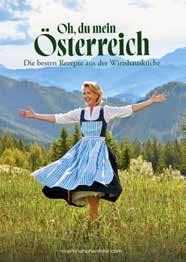
Oh, du mein Österreich
Die besten Rezepte aus der Wirtshausküche von Martina Hohenlohe
Verlag: KMH Media Consulting
200 Seiten | ISBN: 978-3-9519970-6-3
Preis: 30,95 €

ZUBEREITUNG:
WIENER SCHNITZEL
Figlmüller
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN (45 Minuten)
4 Kalbsschnitzel à 100 g
100 g griffiges Mehl
2 Eier
140 g Semmelbrösel
500 g Butterschmalz Salz
1 Zitrone
Die Schnitzel zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie legen und mit einer mittelschweren Pfanne vorsichtig auf 3 bis 4 Millimeter flachklopfen. Drei Teller mit Mehl, verquirltem Ei und Bröseln vorbereiten.
Die Schnitzel mit Salz würzen, im Mehl wenden, durch das Ei ziehen und danach in den Bröseln wenden.
In einer großen, hohen Pfanne das Butterschmalz auf 170 Grad erhitzen und die Schnitzel schwimmend gold-
gelb ausbacken. Die Pfanne immer wieder rütteln, damit das Fett über die Oberseite des Schnitzels schwappt. Diese Methode nennt man soufflieren.
Beim Wenden nicht mit einer Gabel anstechen, denn dann wirft die Panier nicht die typischen Blasen. Am besten eine Zange verwenden.
Die Schnitzel vorsichtig aus dem heißen Fett nehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Zitrone und Erdäpfelsalat servieren.
APFELSCHEITERHAUFEN
Puchegger Wirt
ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN (50 Minuten)
3–4 Äpfel, säuerlich
1 kleiner Striezel (evtl. vom Vortag)
2 Eier
200 ml Milch
35 g Zucker
1 TL Zimt
1 Prise Salz
Mark von 1/3 Vanilleschote
1 Schuss Rum
1 EL Rosinen (optional)
Baiser
1 Eiklar
25 g Zucker
Vanillesauce
500 ml Milch
75 g Zucker
Mark von ¾ Vanilleschote
3 Eidotter
20 g Maizena

1 Schuss Schlagobers
ZUBEREITUNG
Die Äpfel waschen, entkernen, halbieren und feinblättrig schneiden. Den Striezel ebenso in feine Scheiben (Dicke circa 3 bis 5 Millimeter) schneiden. Die Äpfel mit Zimt und Zucker vermengen und abschmecken. Milch, Eier, Salz, Vanillemark, Rum und Rosinen verrühren.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Striezelscheiben in die Milch tunken und abwechselnd mit den marinierten Äpfeln aufs Backblech schichten. Mit der restlichen Milch begießen und etwas andrücken.
Bei 160 Grad Ober- und Unterhitze 30 bis 35 Minuten backen.
Eiklar mit dem Mixer rühren, bis es Blasen wirft, den Zucker dazugeben und steif schlagen. In einen Spritzbeutel füllen und bis zum Anrichten in den Kühlschrank geben.
Für die Sauce 3 Esslöffel Milch mit dem Maizena verrühren. Die restliche Milch mit Zucker und Vanille zum Kochen bringen, vom Feuer nehmen und die Maizena-Mischung einrühren. Unter ständigem Rühren noch einmal aufkochen.
Circa 3 Minuten abkühlen lassen und die 3 Dotter schnell einrühren. Mit einem Schuss Schlagobers vollenden.
Die Sauce darf ab jetzt nicht mehr aufkochen.
Zum Anrichten den lauwarmen Scheiterhaufen in 4 Stücke portionieren. Das Baiser darauf dressieren und mit dem Bunsenbrenner flämmen oder unter dem Grill im Backofen hellbraun backen. Dazu die warme Vanillesauce servieren.
Zum Apfelscheiterhaufen passt besonders gut ein Glas Champagner aus dem Hause Laurent-Perrier.



www.salzburgglobal.org
www.schlossleopoldskron.com



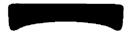

GROSSGLOCKNER
HOCHALPENSTRASSE
Die Großglockner Hochalpenstraße am Fuße des höchsten Berges Österreichs bietet spektakuläre Ausblicke auf die hochalpine Natur. Die 1935 eröffnete Panoramastraße ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und gilt als eine der beeindruckendsten Gebirgsstraßen der Welt. Erleben Sie dieses Naturjuwel und seine faszinierende Tierwelt im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern – auf Augenhöhe mit 30 Dreitausendern!

Österreichs schönste Panoramastraße erstreckt sich über 48 Kilometer und führt in 36 spektakulären Kehren durch den Nationalpark Hohe Tauern bis auf eine Höhe von 2571 Metern. Sie verbindet die Bundesländer Salzburg und Kärnten und bietet atemberaubende Ausblicke auf den 3798 Meter hohen Großglockner, den höchsten Berg Österreichs. Ursprünglich als wirtschaftliches Infrastrukturprojekt geplant, entwickelte sich die Straße zu einem kulturellen und touristischen Highlight sowie zu einer der bedeutendsten Panoramastraßen Europas.
BTickets auch online erhältlich
48 km Panoramastraße
15 Ausstellungen
7 Themenwanderwege
30 Dreitausender kostenlose Führungen
14 Gasthöfe & Almen Spielplätze
ereits vor über 3500 Jahren haben Menschen diese Alpenregion überquert, um Handel zu treiben. 1933 wurde in 2600 Metern Höhe eine bronzene Herkulesstatuette entdeckt, 1994 folgte die Freilegung eines Passheiligtums mit zahlreichen Bronzefragmenten sowie römischen und keltischen Münzen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Diese Fundstücke weisen darauf hin, dass entlang des Passes mehrere kleine Götterschreine existierten.
Im Jahr 1800 erfolgte die Erstbesteigung des Großglockners durch eine aus 62 Personen bestehende Gruppe
grossglockner.at
unter der Leitung von Franz II. Xaver Salm-Reifferscheidt-Krautheim, Fürstbischof von Gurk/Kärnten. Es folgten weitere Expeditionen, die in erster Linie der Wissenschaft, Forschung und Kartographie dienten. Die Habsburger nutzten das Glockner-Gebiet als Jagdrevier; 1856 unternahm Kaiser Franz Joseph eine Wanderung zu einer Stelle, die seither als „Kaiser-Franz-Josefs-Höhe“ bekannt ist.
Nach dem Ersten Weltkrieg und der Abtrennung Südtirols verlor die Region eine wichtige innerösterreichische Verkehrsverbindung über den Brennerpass, wodurch

Oberkärnten und Osttirol vom direkten Straßenverkehr mit dem Norden des Landes abgeschnitten waren. Daher schlug im Jahr 1922 das damalige „Büro für Fremdenverkehr“ im Bundesministerium für Handel und Gewerbe den Bau einer Straße vor. Diese Pläne wurden aufgrund von Geldmangel und ungewissen Erfolgsaussichten eingestellt. Erst 1924 konkretisierte sich die Idee einer „Großglockner Hochalpenstraße“ als private Mautstraße zwischen Heiligenblut und Ferleiten. Der in Kärntner Landesdiensten stehende Ingenieur Franz Wallack (1887–1966) wurde mit der Planung beauftragt. Sein Ziel war es, eine moderne, landschaftsfreundliche Alpenstraße zu entwerfen, die sowohl technisch als auch wirtschaftlich sinnvoll war.
In Salzburg ergriff nun Landeshauptmann Franz Rehrl (1890–1947) – ihm verdankt Salzburg sein Festspielhaus – die Initiative, und im März 1930, mitten in der Weltwirtschaftskrise, beschloss der Salzburger Landtag unter seiner Führung den Bau der Großglocknerstraße.
Die Herausforderungen waren immens: Neben der Logistik und der Finanzierung in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten war es vor allem das raue alpine Klima mit langen Wintern und Schneehöhen von bis zu 8 Metern. Während der fünfjährigen Rekord-Bauzeit waren insgesamt 3200 Arbeiter beschäftigt, wurden 870 000 Kubikmeter Erde und Fels bewegt, 115 750 Kubikmeter Mauerwerk errichtet, 67 Brücken gebaut und
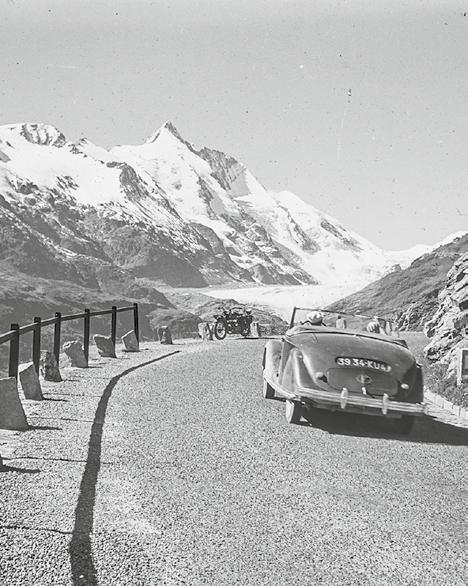
ein Straßentelefon mit 24 Sprechstellen installiert. Die Gesamtkosten für den Bau der Nord-Süd-Verbindung über den Alpenhauptkamm in den Jahren 1931–1935 betrugen umgerechnet rund 82,5 Mio. Euro.
EIN HISTORISCHES SYMBOL –„IN TE DOMINE SPERAVI“
Bei Grabungen im Jahr 1933 wurde am nördlichen Hochtor-Tunnelportal eine Münze aus der Zeit Maria Theresias (1717–1780) mit der Inschrift „In Te Domine Speravi“ („Auf Dich, oh Herr, habe ich gehofft“) gefunden. Franz Wallack sah darin ein gutes Omen und ließ diese Worte über den Portalen des Hochtors einmeißeln.

Der begeisterte Autofahrer Franz Rehrl wollte als Erster die neue Alpenstraße befahren. In einem umgebauten, 1,58 m breiten Steyr 100 befuhr er in Begleitung des Straßenbau-Ingenieurs Franz Wallack am 22. September 1934 die Großglockner Hochalpenstraße auf der noch nicht fertiggestellten, stellenweise nur 1,65 m breiten Fahrbahn. Die Fahrzeit dieses riskanten Ausflugs nach Heiligenblut betrug hin und wieder zurück knapp 7 Stunden.
Die feierliche Eröffnung fand am
3. August 1935 durch den österreichischen Bundespräsidenten Wilhelm Miklas statt.
EINE DER BEDEUTENDSTEN
SEHENSWÜRDIGKEITEN ÖSTERREICHS
Heute zählt die einzigartige Gebirgsstraße neben dem Schloss Schönbrunn und der Festung Hohensalzburg zu den Top-Sehenswürdigkeiten Österreichs. Abseits der spektakulären Naturerlebnisse erwartet die Besucher ein vielfältiges touristisches Angebot mit Shops, Gastronomiebetrieben, Erlebnisspielplätzen für Kinder sowie Museen mit interaktiven Ausstellungen. Die 12 Erlebniswelten umfassen unter anderem:
• Naturlehrwege und ein Hochgebirgs-ÖkologieMuseum mit Murmeltier-Kino
• eine Ausstellung zum Bau der Straße im originalen Straßenwärterhäuschen
• die geologische Freiluftausstellung „Tauernfenster“
• die weltweit höchstgelegene Motorrad- und Automobilausstellung
• das „Passheiligtum Hochtor“ mit der berühmten Herkules-Bronzestatuette
• die Geschichte der Alpinistinnen, erzählt in der Ausstellung „Berg, die – Frauen im Aufstieg“
Der Höhepunkt der außergewöhnlichen Panoramastraße ist die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf 2369 Metern, die einen einzigartigen Blick auf den Großglockner, den Johannisberg und die Pasterze bietet. Entlang der Strecke laden Hütten, Gasthöfe und Restaurants zum Verweilen ein – besonders beeindruckend ist es, den Sonnenaufgang oder -untergang inmitten der imposanten Berglandschaft zu erleben.
SCHNEERÄUMUNG AUF DER GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE
Jeden April beginnt die spektakuläre Schneeräumung der Großglockner Hochalpenstraße. In rund 15 Tagen werden bis zu 700 000 Kubikmeter Schnee entfernt –teils aus bis zu 10 Meter hohen Schneewänden. Mit Rotationspflügen nach dem „System Wallack“ wird die Straße für den Frühling sicher und befahrbar gemacht.
GEÖFFNET VON MAI BIS NOVEMBER
Die Großglockner Hochalpenstraße ist jährlich von Anfang Mai bis Anfang November befahrbar.
Text: Eva von Schilgen



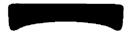
GROSSGLOCKNER
HOCHALPENSTRASSE
Die Großglockner Hochalpenstraße am Fuße des höchsten Berges Österreichs bietet spektakuläre Ausblicke auf die hochalpine Natur. Die 1935 eröffnete Panoramastraße ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und gilt als eine der beeindruckendsten Gebirgsstraßen der Welt. Erleben Sie dieses Naturjuwel und seine faszinierende Tierwelt im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern – auf Augenhöhe mit 30 Dreitausendern!

Tickets auch online erhältlich
48 km Panoramastraße
15 Ausstellungen
7 Themenwanderwege
30 Dreitausender kostenlose Führungen
14 Gasthöfe & Almen
Spielplätze



Salzburg PLACES TO GO

tilvoll in den Tag. Ein Frühstück mit Silbergeschirr versprüht einen Hauch von Luxus, Eleganz und Nostalgie. Das kühle, glatte Metall in der Hand, das leise Klingen von edlem Silberbesteck auf feinem Porzellan – all das verleiht dem Moment eine fast royale Atmosphäre. Es erinnert an eine Zeit, in der Tischkultur zelebriert wurde, in der man sich bewusst dem Genuss hingab.
Man nimmt sich Zeit, nippt an duftendem Tee oder aromatischem Kaffee aus einer zarten Porzellantasse, streicht cremige Butter mit einem schweren Silbermesser auf ein frisches Croissant, der silberne Eierbecher ist elegant, wertig und zeitlos. Ein solches Frühstück ist mehr als eine Mahlzeit, es ist ein sinnliches Erlebnis. Wer den Tag auf die stilvollste Weise beginnen möchte, gönnt sich diesen kleinen Luxus und genießt den Moment in vollen Zügen.
Katharina Baumgartner: „Ich freue mich auf Ihren Besuch. Oder stöbern Sie online in unserem Katalog –Sie werden eine Vielzahl an ausgewählten, besonderen Stücken finden.“
INFOBOX

Katharina Baumgartner-Nedwed Goldgasse 16, 5020 Salzburg +43 676 391 99 91 silber@glasergewoelbe.at www.glasergewoelbe.at


In Salzburg, wo Kultur und Eleganz aufeinandertreffen, bieten zwei hochmoderne Lagergebäude maßgeschneiderte Lösungen für die stilvolle Aufbewahrung wertvoller Besitztümer. Auf drei Ebenen stehen 500 exklusive Lagerabteile von 1 bis 200 Quadratmetern zur Verfügung – perfekt für Kunstsammler, Unternehmer oder Privatpersonen, die höchste Ansprüche an Sicherheit, Flexibilität und Service stellen.
EIN SERVICE, DER HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN GERECHT WIRD
Für unsere geschätzten Kunden bieten wir weit mehr als nur eine Lagerfläche – wir bieten eine Rundum-Betreuung mit höchster Diskretion und Komfort:
• Individuelle Hilfestellung bei Transport und Übersiedlungen
• Flexible Zwischenlagerlösungen für temporären Bedarf
• Kostenloser Anhängerverleih für maximale Mobilität
• Verlässliche Paket- und Warenannahme sowie -abgabe
• Exklusiver Konferenz- und Besprechungsraum zur kostenlosen Nutzung
Ob wertvolle Kunstwerke, edle Antiquitäten oder sensibles Geschäftsinventar – Ihre Besitztümer sind bei uns in besten Händen. Mit täglichem Zugang von 6 bis 22 Uhr – 365 Tage im Jahr – genießen Sie maximale Flexibilität und Verfügbarkeit, wann immer Sie dies wünschen.
Erleben Sie eine neue Dimension der Einlagerung –diskret, sicher und auf höchstem Niveau.
INFOBOX

MultiStorage GmbH
Scherenbrandtnerhofstraße 11, 5020 Salzburg
Tel.: +43 662 879494 | office@multistorage.at www.multistorage.at

Seevillen beim Golfplatz. Infos zu Größeneinheiten & Preise geben wir gerne.
Das Interesse an einer Seeimmobilie in Kärnten ist nicht nur den Österreichern vorbehalten, auch Familien aus den Nachbarländern haben die Vorzüge und die Einmaligkeit eines Wohnsitzes am Wasser im Süden Österreichs lieben gelernt. Im Zentrum des Interesses sind Immobilien an und nahe den Seen im Zentralraum Kärntens, eben zwischen Klagenfurt, Villach und Feldkirchen. Hier liegt der Wörthersee, der Ossiacher See und der Faaker See nebeneinander, diese bieten die perfekte Kombination aus

Badehaus am Wörthersee, 47 m² Wfl. (Massivbau), Eigenufer, Bootsplatz. KP € 995.000,-
Mag. Alexander Tischler | +43 676 60 74 134
Dkfm. Alfred Tischler | +43 664 43 54 157
Ikfm. Daniel Bujar | +43 670 40 15 344
Ruhe, Erholung und sehr guter Infrastruktur. Innerhalb von 20 Minuten sind alle Städte erreichbar bzw. sind Sie auch rasch in Italien oder Slowenien. Als Spezialist für Seeimmobilien in Kärnten seit 1971 hat Familie Tischler für Sie einige interessante Immobilien im Angebot. Ob kleine oder große Seeliegenschaften, Seewohnungen zw. 30 und 300 m², oder Villen bzw. Landsitze. Hier werden Sie vom ganzen Team bestens beraten.

Tel. 04248 3002
office@atv-immobilien.at www.atv-immobilien.at Social Media: @seelage.at


Ein Hund ist nicht einfach nur ein Tier – er ist ein treuer Gefährte, ein Familienmitglied und oft auch ein Statussymbol. Doch wahre Wertschätzung zeigt sich nicht in luxuriösen Accessoires, sondern in der sorgfältigen Pflege. Ein seidig glänzendes Fell, wache Augen und ein aufmerksa-
mes Wesen sind untrügliche Zeichen für einen Hund, der geliebt und betreut wird. Im Laufe der Geschichte finden sich zahlreiche Beispiele für adelige und königliche Persönlichkeiten, die ihre Hunde hingebungsvoll pflegten. Zu ihnen zählte auch die österreichische Kaiserin Elisabeth, bekannt als Sisi, die ihre Hunde mit
größter Hingabe umsorgte. Ihre Afghanischen Windhunde waren nicht nur elegante Begleiter, sondern wurden von ihr persönlich betreut, gebürstet und mit ausgewähltem Futter versorgt. Sisi erkannte, dass das Wohlbefinden ihrer Tiere nicht nur von ihrem physischen Zustand, sondern auch von der emotionalen Bindung zu ihr abhing. Katharina die Große hielt ebenfalls eine Vielzahl von Hunden, die auf exquisiten Stoffen gebettet wurden und sich in den prunkvollen Palästen frei bewegen durften. Die russische Zarin betrachtete ihre Hunde als loyale Freunde, die nicht nur gut gepflegt wurden, sondern auch stets an ihrer Seite waren.
Diese historische Tradition setzt sich bis heute fort. Hunde von wohlhabenden und liebevollen Besitzern
erkennt man sofort: Das gepflegte Fell, die gesunden Krallen und eine aufrechte Haltung sprechen Bände. Doch wahre Majestät offenbart sich nicht nur im äußeren Erscheinungsbild, sondern auch im Verhalten des Hundes. Ein Hund, der Vertrauen und Geborgenheit erfährt, strahlt eine besondere Würde aus – eine Würde, die von echter Liebe zeugt.
Die Pflege eines Hundes ist somit weit mehr als nur eine kosmetische Aufgabe – sie ist ein Zeichen von Respekt, Hingabe und tiefer Verbundenheit. Wer seinen Hund mit Sorgfalt pflegt, zeigt, dass er ihn als würdevolles Lebewesen betrachtet. Denn wahre Majestät entsteht nicht durch Abstammung oder Titel, sondern durch die Art, wie wir miteinander umgehen – ob Mensch oder Tier.

Im exklusiven Baur au Lac, einem der ältesten und renommiertesten Luxushotels Zürichs, erwartet vierbeinige Gäste eine wahrhaft königliche Behandlung, die ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Hier dreht sich alles um individuellen Komfort – von kuscheligen Schlafplätzen über maßgeschneiderte Wasserschüsseln bis hin zu einem speziellen Hundemenü mit leckeren, nahrhaften Optionen. Die Speisekarte für die vierbeinigen Gäste umfasst eine ausgewogene und exquisite Auswahl, die selbst die wählerischsten Fellnasen begeistert: zarte Filets, gedünstetes Gemüse und frische Zutaten, die mit Bedacht zusammengestellt werden.
Die Terrasse des Restaurants Marguita bietet einen perfekten Platz, um gemeinsam die kulinarischen Köstlichkeiten des Hauses zu genießen. Zürich selbst ist ein Paradies für Entdeckungstouren mit Hund. Der hoteleigene „Royal Canine Guide“ führt durch die schönsten Parks, über malerische Spazierwege entlang des Sees und zu versteckten Pfaden, die zu entspannten Ausflügen einladen. Ob ein Spaziergang durch den Baur au Lac Park oder ein ausgedehnter Rundgang durch Zürich – die Stadt hält hundefreundliche Abenteuer für jeden Geschmack bereit.
INFOBOX
BAUR AU LAC
Talstrasse 1, 8001 Zürich, Schweiz +41 44 220 50 20 bauraulac.ch



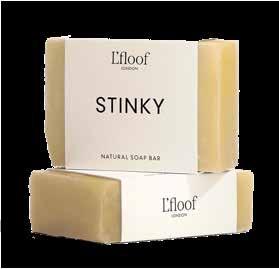


Diese zeitlosen Essentials zeichnen sich durch unvergängliche Eleganz, Liebe zum Detail und besondere Handwerkskunst aus. Jedes Produkt wurde mit höchster Präzision gefertigt, um sowohl Stil als auch Funktionalität zu vereinen.

1. Dackel-Regenmantel, maßgeschneidert für lange Körper und kurze Beine, von ludomoipretasortir.com, ab € 180 | 2. Die RavaLeine, der perfekte Begleiter aus feinstem Narbenleder, gefertigt mit einem in 12-stündiger Handarbeit geflochtenen Griff, von pagerie.com, um € 533 | 3. Dinner wird im Keramiknapf mit Efeu-Details serviert, von mungoandmaud.com, ab € 82 | 4. Für den täglichen Bedarf – Poop-Beutel-Tasche, von goyard.com, um € 335 | 5. Wohlfühlen nach dem Bad mit dem Baumwoll-Bademantel von poldodogcouture.com, um € 49 | 6. Natürliche Fellpflege, L’floof Bergamot & Lavender Seifenbar, von fluffycollective.com, um € 16 | 7. Franzi Couture Hunde-Janker – traditioneller Loden aus Bayern in Hellgrau und Moosgrün, von lodenfrey.com, ab € 280


Die maßgefertigte Hundetreppe von Colours of Arley wurde speziell zum zehnten Geburtstag von Patch, dem Hund der Gründerin Louisa Tratalos, kreiert.
Die Streifen der Treppe erinnern an Tennisbälle und Eichhörnchen – zwei von Patchs Lieblingsjagdobjekten. Diese exklusive Hundetreppe vereint Funktionalität und stilvolles Design. Sie wird nach Maß für die Bedürfnisse Ihres Hundes gefertigt. Für den Stoff stehen unzählige Farbkombinationen für Streifen, Karos und Wellen zur Auswahl, um das Stück perfekt in Ihr Zuhause zu integrieren (ab € 605). Weitere Details finden Sie unter coloursofarley.com.

8. Komfortables Hundekissen aus regional verarbeiteter Baumwolle, eingefasst mit roter Paspel, von topdogcoolcat.com, ab € 270 | 9. Faltbar, praktisch und stilvoll – die perfekte Reisematte mit Riemen, von poltronafrau.com, um € 348 | 10. Fellpflege auf höchstem Niveau mit der Hundebürste aus Holz, von celine.com, um € 90


GUSTAV – der Vizsla
EIN BLICK IN DEN SPIEGEL
Neulich erlebte ich im Schloss eine Begegnung der besonderen Art. Ich war gerade auf meiner gewohnten Runde durch die prunkvollen Gänge unterwegs, als ich plötzlich einem Hund begegnete, der genauso aussah wie ich! Wer war dieser Eindringling in meinem Zuhause? Bevor ich ihn jedoch vertreiben wollte, musste ich erst einmal herausfinden, wer er war und was er hier wollte. Sofort lief ich auf ihn zu, bellte freundlich und wedelte aufgeregt mit der Rute.
Zu meiner Verwunderung tat der Hund genau das Gleiche wie ich: Er stellte sich auf die Hinterbeine, blickte mich aufmerksam an und bewegte sich synchron mit mir. Konnte es sein, dass das die hübsche Vizsla-Dame war, die mich besuchen wollte? Vorsichtig ging ich näher heran, um ihren Duft zu prüfen – und stieß mit der Schnauze gegen einen Spiegel! Jemand hatte ihn zum
Reparieren auf den Boden gestellt, und ich – Gustav, der Schlosshund – hätte mich beinahe mit mir selbst angefreundet. Wie peinlich!
Hoffentlich hatte das niemand gesehen. Doch anstatt mich zu ärgern, betrachtete ich mich neugierig in dem großen, alten Spiegel mit seinen goldenen Verzierungen. Als Schlosshund hat man selten Zeit für Eitelkeit, aber ich muss zugeben: Meine braunen Augen und die samtweichen Ohren sind wirklich schön! Vielleicht hätte auch meine verehrte Vizsla-Dame Gefallen an mir gefunden.
Während ich mich selbst bewunderte, wurde ich von den Kindern des Hauses entdeckt. Sie lachten und begannen, vor dem Spiegel herumzutanzen. Die Tochter des Hauses zog ihre schönsten Grimassen, während der Sohn mit seinem ferngesteuerten Auto um meine Pfoten sauste. Sehr lästig, aber als Schlosshund bleibt man ein Gentleman.
Also zog ich mich würdevoll zurück, ohne das Auto zu zerbeißen –obwohl ich es mir kurz überlegte.
Also zog ich mich würdevoll zurück, ohne das Auto zu zerbeißen – obwohl ich es mir kurz überlegte.
DAS LEBEN IM SCHLOSS
Erziehung ist eine schwierige Angelegenheit, dachte ich. Wäre ich Vater von Welpen, würde ich sie am Nacken packen und an einen ruhigeren Ort tragen. Doch mit Menschenkindern funktioniert das wohl nicht. Meine Herrin und der Schlossherr beklagen sich oft über den Lärm, aber ich ziehe mich dann lieber auf mein Sofa zurück. Dort kommen die Kinder schließlich zu mir, setzen sich mit einem Buch neben mich und streicheln mich sanft. Ein stilles Zeichen der Versöhnung – und ich bin ja nicht nachtragend.
Der Sohn des Hauses teilt oft heimlich sein Essen mit mir, indem er mir unter dem Tisch kleine Happen zuschiebt. Die Tochter ist vorsichtiger, aber beim Ballspielen haben wir immer gemeinsam Spaß. So viele unterschiedliche Charaktere unter einem Dach – doch das Schloss ist groß genug für uns alle.
Jedes Wochenende kommen Gäste, dann wird eine festliche Tafel gedeckt, Kerzen leuchten und reichlich Essen wird serviert. Ich beobachte das bunte Treiben mit einer Mischung aus Neugier und Gelassenheit. Manche Kinder haben Angst vor mir. Warum eigentlich? Natürlich bin ich größer als ein Mops – aber gefährlich? Niemals! „Schau mal, was für große Zähne der Hund hat! Der kann beißen, wenn du ihn ärgerst!“, sagte neulich eine Mutter zu ihrem Kind. Selbstverständlich könnte ich –aber ich würde es niemals tun. Meine Herrin sagt immer, ich habe einen außergewöhnlich guten Charakter, und das macht mich sehr stolz.
DAS ALTER UND DIE WEISHEIT EINES SCHLOSSHUNDES
Kürzlich hörte ich, dass die Lebenserwartung eines Magyar Vizsla zwischen zwölf und fünfzehn Jahren liegt. Ich bin inzwischen neun Jahre alt, meine Pfoten werden langsam weiß, aber mein Fell ist immer noch schön cog-
nacbraun. Ich springe nicht mehr ganz so ausgelassen herum wie früher, doch meine Familie sagt, ich sei jetzt viel braver und werde überallhin mitgenommen – sogar ins Restaurant. Dort lege ich meine Schnauze nicht mehr auf den Tisch, sondern werfe nur meinen treuen Blick in die Runde und hoffe auf eine kleine Aufmerksamkeit. Mein Fell bleibt trotz des Alters wunderbar dicht, was man von meinem Herrchen nicht behaupten kann – sein Haar ist ihm bereits abhandengekommen. Dafür hat meine Herrin wunderschöne braune Locken. Die Kinder haben dieses Problem noch nicht, ihre blonden Haare glänzen in der Sonne. Aber auch ich kann mich sehen lassen. Mein schlichtes, elegantes Lederhalsband genügt mir völlig –Mode interessiert mich wenig, solange jemand die Gummistiefel anzieht, denn dann weiß ich: Es geht hinaus!
Draußen gibt es so viel zu entdecken! Die Luft ist frisch, die Gerüche erzählen Geschichten. Es ist wie eine Tageszeitung für Hunde: Wer war hier, wer hat sein Revier markiert? Natürlich sorge auch ich dafür, dass meine Duftmarke nicht fehlt – schließlich muss der Marder wissen, dass das Schloss mein Revier ist und dass er gefälligst keine Kabel in den Autos durchbeißen soll.
DANKBARKEIT EINES SCHLOSSHUNDES Vor Kurzem war ich beim Tierarzt, weil ich weniger gefressen hatte. Die Diagnose? „Gustav ist kerngesund und für sein Alter in bester Verfassung!“ Was für ein Glück! Ich weiß, dass ich es gut habe. Ich könnte irgendwo auf der Straße leben, ohne Familie, ohne Liebe. Stattdessen genieße ich das Leben auf dem Schloss mit meiner Familie, die mich liebt und mich als ihren treuen Begleiter schätzt.
Mein Motto? „Live for today, not for tomorrow.“ Solange ich meine Familie, mein Schloss und die Sonne im Schlosshof genießen kann, bin ich glücklich. Meine weißen Pfoten erinnern mich daran, dass ich älter werde, aber jeder Tag ist ein Geschenk.
Ein bisschen Glück ist jedem Schlosshund vergönnt – und ich habe meines gefunden.


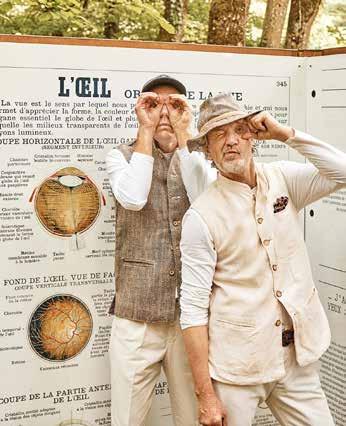
Louis Albert de Broglie hat seinen Bankiersessel gegen ein Schloss eingetauscht und definiert seit dem Ankauf von Château de La Bourdaisière Biodiversität neu. Mit dem im Jahr 1991 gegründeten Verein The National Tomato Conservatory (Le Conservatoire National de la Tomate) wurde das Königreich der Tomaten geschaffen. Mit Schürze und Strohhut seiner Tomatenzucht zugewendet, haben seine Freunde ihm den Spitznamen „Le Prince Jardinier“ gegeben. Dieser sollte über die vergangenen Jahrzehnte zu einer internationalen Marke wachsen, welche seit 2023 nun auch sein Neffe Nicholas mit jugendlichem Esprit ergänzt. Die SCHLOSSSEITEN haben gelernt, dass französische Tomaten mit besonderem Charme gedeihen.
Text von Beatrice Tourou

Inmitten der malerischen Landschaft des LoireTals liegt das Château de La Bourdaisière, ein historisches Anwesen, das seit 1991 nicht nur das Zuhause eines ehemaligen Bankiers, sondern auch von 700 Tomatensorten ist. Das Schloss ist über die Jahre zum Zentrum für nachhaltige Landwirtschaft, botanische Vielfalt und gärtnerische Innovation herangereift und bringt Schulen, Wissenschaftler und Interessierte gleichermaßen ins Staunen. Hinter dieser grünen Oase steht Louis Albert de Broglie, ein Mann mit einer außergewöhnlichen Vision für die Natur und den Erhalt seltener Pflanzenarten.
Le Prince Jardinier, wie er mittlerweile auch international genannt wird, hat eine Karriere im Finanzsektor gegen seine Leidenschaft für die Natur und den Erhalt der Biodiversität eingetauscht und zeigt nun, wie man sich stilecht der Landwirtschaft widmen kann, denn „Slow Living“ hat längst den Kapitalismus überholt: „Ich habe die Finanzwelt verlassen, weil ich in etwas Sinnvolleres investieren wollte – in den Erhalt des Lebens selbst“, erklärt de Broglie. In den 1990er-Jahren erwarb er das Château de La Bourdaisière, das er in einen experimentellen Garten und ein Zentrum für ökologische Innovation verwandelte. Sein Hauptaugenmerk lag auf der Förderung alter und seltener Pflanzensorten – insbesondere der Tomate. Daraus ent-
„Biodiversität ist der Schlüssel zu unserer Zukunft. Ohne sie verlieren wir unsere Wurzeln und unsere Widerstandsfähigkeit.“
Louis Albert de Broglie


stand das Conservatoire National de la Tomate (Nationales Tomatenkonservatorium), das sich auf dem Gelände des Schlosses befindet. Hier werden über 700 Tomatensorten aus aller Welt kultiviert, darunter viele historische und seltene Varianten, wie beispielsweise die Noire de Crimée (Schwarze Krim), eine dunkelviolette bis fast schwarze Tomate mit süßlichem Aroma. Oder die Ananas – eine gelb-orange gestreifte große Fleischtomate mit fruchtigem Geschmack. Connaisseure freuen sich auch über die Green Zebra, eine kleine, grün-gelb gestreifte Tomate mit würzigem Geschmack. Das Konservatorium dient nicht nur der Erhaltung dieser Sorten, sondern auch der Forschung und Aufklärung. Besucher können die unterschiedlichen Tomaten entdecken, probieren und mehr über die Bedeutung von Biodiversität in der Landwirtschaft erfahren.
Jedes Jahr im Herbst zieht das Festival de la Tomate zahlreiche Gäste an, die sich von der unglaublichen Vielfalt dieser Frucht begeistern lassen.
Neben seiner Arbeit auf dem Schlossgelände gründete Louis Albert de Broglie die Marke „Le Prince Jardinier“, unter der er hochwertige Gartenwerkzeuge, Möbel und Accessoires anbietet. Angestoßen wurde der Zeitgeist durch seinen Neffen Nicholas, der das Erbe seit 2023 in die Zukunft begleitet.

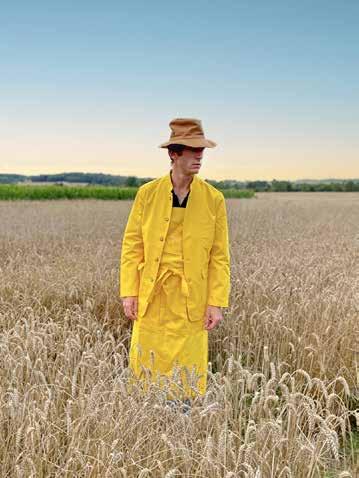



Louis Alberts Neffe Nicholas baut auf einem stilvollen Erbe auf und verjüngt gleichzeitig die Zielgruppe. Denn der Garten ist längst generationenübergreifend zu einem begehrlichen Accessoire herangereift. Um die Idylle in die Stadt zu tragen, ist Le Prince Jardinier eine Kooperation mit der Sneaker-Marke Hirundo Midnight Sneakers eingegangen. Et voilà!





Louis Albert de Broglie
National Tomato Conservatory. Auf dem Château de La Bourdaisière wird die Tomate gefeiert wie normalerweise die Rose. Deshalb wird ihr alljährlich ein ganzes Festival gewidmet. Um die Tomate in all ihrer Pracht besser zu verstehen, lädt das National Tomato Conservatory auch Wissenschaftler zum Studieren der schmackhaften Frucht ein. Mehr als 700 Sorten bieten eine gute Bandbreite. „Die Tomate ist ein Symbol für Vielfalt und kulturelles Erbe. Jede Sorte erzählt die Geschichte eines Ortes, eines Klimas, einer Tradition“, erklärt de Broglie.
Château de La Bourdaisière. Das Schloss wurde im 15. Jahrhundert erbaut und hat im Laufe der Jahrhunderte viele Veränderungen erfahren. Es wurde von verschiedenen Adelsfamilien bewohnt und trägt heute noch den Charme vergangener Epochen. Inzwischen beherbergt es auch ein Hotel. Die Zimmer und Suiten sind stilvoll und gemütlich mit antiken Möbeln eingerichtet, die den Charme vergangener Zeiten bewahrt haben, und bieten moderne Annehmlichkeiten wie kostenloses WLAN sowie hochwertige Badezimmer. Man kommt aber wegen des Gartens. Zimmerpreise beginnen bei etwa 110 € pro Nacht.
Vêtements – zu Deutsch „Kleidung“. Le Prince Jardinier hat das Gärtnern zu einer Königsdisziplin erhoben, wo man nicht minder gekleidet auftreten soll. Die korrespondierende Bekleidungslinie spiegelt den Kleidungsanspruch wider: Vom klassischen Gartenoverall über praktische Westen bis hin zu stilvollen Jacken und T-Shirts ist jedes Stück so konzipiert, dass es den Bedürfnissen eines modernen Gärtners gerecht wird. Zu den neuesten Ergänzungen gehören Sneakers. Nachhaltige Produktion, die den Prinzipien von Le Prince Jardinier und seinem Engagement für ökologische Verantwortung entspricht.
Stilvoll graben. Nie hat man eleganter gegraben als mit den Werkzeugen von Le Prince Jardinier. Der Stil dieser Werkzeuge passt perfekt zu den Prinzipien des „Slow Living“, die Louis Albert de Broglie verkörpert. Es geht nicht nur um effiziente Gartenarbeit, sondern auch um eine Verbindung zur Natur und um die Freude am Gärtnern. Mit den Werkzeugen von Le Prince Jardinier wird jede Gartenarbeit zu einem meditativen Moment.

Jedes Jahr im September verwandelt sich das Château de La Bourdaisière im Loire-Tal in ein wahres Paradies für Tomatenliebhaber. Das Festival de la Tomate ist eine der einzigartigsten Veranstaltungen in Frankreich und widmet sich ganz der Vielfalt und dem Geschmack dieser beliebten Frucht.

Tomatenverkostung und Marktplatz
Auf dem Festival-Gelände gibt es zahlreiche Stände, an denen die Besucher die unterschiedlichsten Tomatensorten probieren können.

Workshops und Vorträge
Experten aus der Landwirtschaft und der Gastronomie geben spannende Einblicke in den ökologischen Anbau, die Bedeutung alter Sorten und die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft.

Kulinarische Kreationen rund um die Tomate Spitzenköche und regionale Produzenten präsentieren innovative Rezepte mit Tomaten. Von klassischen französischen Gerichten wie der „Tarte à la Tomate“ bis hin zu exotischen Spezialitäten

Gartenführungen durch das Tomatenkonservatorium
Ein Highlight des Festivals ist die geführte Tour durch das Conservatoire National de la Tomate.

Kunst, Musik und Familienaktivitäten
Neben kulinarischen Genüssen gibt es Kunstinstallationen, Livemusik und kreative Workshops für Kinder. Das Festival ist ein familienfreundliches Event, das Natur, Kultur und Genuss auf einzigartige Weise verbindet.

„Ohne Vielfalt keine Zukunft“ – so lautet das Motto von Château de La Bourdaisière

Château de La Bourdaisière, 25 Rue de la Bourdaisière, 37270 Montlouis-sur-Loire, Frankreich
Wann: jedes Jahr im September
Tickets sind vor Ort oder online erhältlich: www.conservatoiredelatomate.fr





Carole Bamford hat mit ihrem Landgut Daylesford nicht nur einen neuen Industriezweig begründet, sondern mit Bamford auch einen der gefragtesten (Kosmetik-) Brands weltweit. Nun definierte sie holistisches Well-Being in ihrem Garten Club in den Cotswolds neu – natürlich auf Membership-Basis. Österreich wartet gespannt auf ein Pendant. *Räusper*







In Paris sitzt es sich outdoor andernorts kaum eleganter als auf der Gartenterrasse des Bristol, umgeben von großgewachsenen Trompetenbäumen, designt von Marie-Caroline Willms. Gedeckte Farben und schmiedeeiserne Stühle sind die Basis für das Flair. Und natürlich die richtige Attitüde.





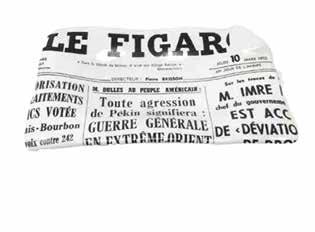


1. Sitzkissen, von H&M, um € 13 | 2. Aschenbecher „Le Figaro“, von Fornasetti, um € 180 | 3. Teller, über habitat.de, um € 48 | 4. Stuhl „Romeo“, von MBM Möbel, um € 139 | 5. Geschirrtuch, Blockprint, von mtstofferie.de, um € 10 | 6. Porzellan-Cup „Nomade“, von Bernardaud, um € 189 | 7. Pflanzentrog „Caisse de Versailles“, von classic-garden-elements.de, ab € 3.078
Einem Garten in Waldrandlage wohnt ein besonderer Zauber inne: In diesem findet sich reichlich Geäst, aber auch ausnehmend viel Vogelgezwitscher. Man könnte sogar meinen, dass dieser pflegeleichter sei, weil man sich einfach nicht um das Immergrün kümmern muss. Und dennoch kommt man nicht aus, ohne Hand anzulegen. In echter Wienerwald-Ästhetik ist das ja auch gar kein Problem.






1. Gartenschrank „Savoca“, von Beliani, um € 799 | 2. Strohhut, von Mühlbauer, um € 480 | 3. Gartenschürze, von Manufactum, um € 199 | 4. Rattankorb XL, von Zara Home, um € 99 | 5. Geschnitztes Rotkehlchen, von Manufactum, um € 29 | 6. Handcreme, von Panier des Sens, ab € 17
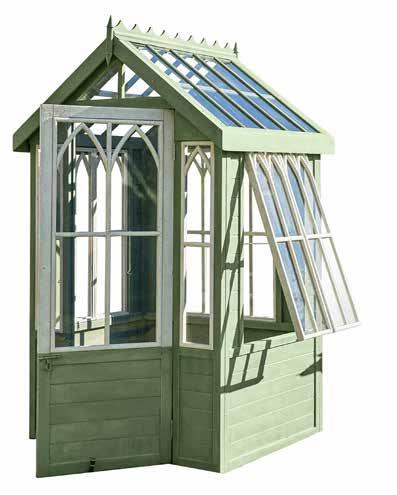


Gediegener Rückzug im eigenen Garten wird heute mit einem Picknick gefeiert. Dabei wird auch gleich die Landschaftsarchitektur studiert, denn es gibt immer Raum zur Veränderung. Manche Dinge kommen allerdings, um zu bleiben. Der Geräteschuppen zum Beispiel, der auch als Glashaus funktioniert.




1. Teller, von Mateus, über Nordicnest, um € 32 | 2. Weinglas, von Westwing, 2 Stück um € 45 | 3. Kissen, von Etsy, um € 35 | 4. Sessel, von Ikea, um € 39 | 5. Gartenhaus „Anyós“, von Loberon, um € 2.998 | 6. Stoffservietten, Gingham, 2 Stück, von Jotex, um € 13 | 7. Buch „Gardens of Style“, von Rizzoli, um € 53

ZEITLOSE WERTE, MASSGESCHNEIDERTER SCHUTZ
Exklusive Absicherung für das Besondere: Wie Douglas, Machat & Cie. Kunst, Schmuck und andere Luxusgüter schützen
in funkelndes Collier, ein Gemälde mit jahrhundertealter Geschichte oder die prachtvollen Gemächer eines historischen Anwesens – sie alle haben eines gemeinsam: Sie erzählen Geschichten. Doch wie schützt man das, was nicht nur einen materiellen, sondern auch einen emotionalen und historischen Wert besitzt? Welche Risiken bestehen? Und wie kann man sich klug und nachhaltig absichern? Eine Antwort lautet: Mit einer maßgeschneiderten Versicherung, die nicht nur Sicherheit bietet, sondern auch den wahren Wert des Besonderen versteht.
EXPERTEN FÜR KUNSTUND WERTVERSICHERUNGEN
Philip Machat und Benedikt Douglas haben sich auf
den Schutz von wertvollen Sammlerstücken, Kunst und historischen Besitztümern spezialisiert. Ihre Firma Douglas, Machat & Cie. bietet individuelle Versicherungslösungen für hochwertige Privatvermögen.
„Philip ist Jurist, ich bin Kunsthistoriker“, erklärt Benedikt Douglas. „Zusammen haben wir über 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungswelt.“ Ihr Weg begann Anfang der 2000er-Jahre bei einer spezialisierten Agentur in Wien, die als Erste Kunstversicherungen nach Österreich brachte. Philip Machat war von Anfang an dabei und spezialisierte sich auf die Absicherung von Kunst- und Schmucksammlungen. Benedikt Douglas stieß 2012 nach mehreren Jahren beim renommierten Auktionshaus Christie’s in Wien, New York und London dazu.

„Ich war immer in der Kunstwelt unterwegs und bin eher zufällig zur Versicherung gekommen. Es hat mich aber sofort fasziniert, weil es ein unglaublich spannender Bereich ist, in dem Kunst und Wirtschaft aufeinandertreffen.“
Nach dem Verkauf der ursprünglichen Agentur an einen großen internationalen Versicherungskonzern veränderte sich vieles. „Plötzlich waren wir Teil einer riesigen Industriemaschine – und das passte überhaupt nicht zu unserer Philosophie und unseren Kunden.“ 2016 entschieden sie sich daher, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, um individuelle Lösungen für die Absicherung vermögender Privatkunden mit dem Schwerpunkt auf Kunst, Schmuck, hochwertige Immobilien und andere Wertgegenstände anzubieten.
EINZIGARTIGE VERSICHERUNGSLÖSUNGEN JENSEITS VON STANDARDPRODUKTEN
Von Anfang an war klar, dass sie nicht auf klassische Versicherungsprodukte setzen wollten. „Wir haben uns gefragt: Was genau wollen wir anbieten? Und schnell wurde klar, dass es nicht nur um Kunst geht, sondern um Schmuck, Oldtimer, Ferienhäuser und exklusive Sportwagen – also um hochwertiges Privatvermögen.“
Anders als viele andere Makler verkaufen sie keine Standardprodukte großer Versicherungen. „Wir haben uns dazu entschieden, unsere eigenen Produkte zu entwickeln, die die konkreten Bedürfnisse unserer Kunden abdecken“, betont Philip Machat. Die partnerschaftliche Kundennähe sowie das tiefe Verständnis

von Lebenswelten vermögender Kunden unterscheidet Douglas, Machat & Cie. deutlich von klassischen Versicherungsanbietern.
PASSION ASSETS: EMOTIONALE WERTE ABSICHERN
Oft geht es um sogenannte „Passion Assets“ – also um Gegenstände mit hoher persönlicher Bedeutung. „Es geht um Objekte, die unsere Kunden leidenschaftlich sammeln und lieben, wie edle Taschen, seltene Uhren, klassische Autos oder Kunstwerke“, erklärt Philip Machat. „Wir verstehen diese Leidenschaft und die Geschichten dahinter. Ob jemand nun Vintage-Uhren sammelt oder eine bedeutende Kunstsammlung besitzt – wir bieten den besten Schutz.“


EXKLUSIVE VERSICHERUNGSLÖSUNGEN
OHNE KLASSISCHE WERBUNG
Ihre Kunden finden sie nicht durch Werbung, sondern durch Mundpropaganda und Empfehlungen. „Unsere Kunden sehen, was wir tun, und sagen: ,Genial, ihr seid genau die Richtigen dafür.‘ Wir machen keine klassische Werbung, das ist auch gar nicht notwendig. Ähnlich einem Club empfehlen uns unsere Kunden stetig weiter.“ Für eine ausgewählte Klientel ist man in der Lage, über eigene Versicherungsprodukte weit höhere Werte und speziellere Gegenstände zu versichern sowie einen weit umfangreicheren Deckungsumfang anzubieten. „Es gibt viele Dinge, die nur sehr wenige Versicherer abdecken können“, sagt Machat. Ein Beispiel ist ein Fall, bei dem zwei Bugattis bei einer Rallye in Marokko verunglückten. „Nirgendwo sonst kann man einen solchen Schadenfall abdecken und den Schaden vollumfänglich abwickeln. Aber wir verstehen genau diese Risiken.“ – „Mundpropaganda ist für uns die beste Werbung – besonders, wenn es zu einem Versicherungsfall kommt“, erzählt Douglas. „Bei einem Fall in München wurde in einer noblen Wohngegend in mehrere Villen eingebrochen. Zwei der betroffenen Häuser waren bei uns versichert, und die Besitzer konnten ihre Wertgegenstände innerhalb von wenigen Wochen vollständig ersetzen. Die
anderen hingegen mussten bis zu einem halben Jahr warten. Nach diesem Vorfall sprach sich das natürlich in der Nachbarschaft herum – und am Jahresende war fast die gesamte Straße bei uns versichert.“
INTERNATIONALE ABSICHERUNG FÜR EINZIGARTIGE WERTE
Douglas, Machat & Cie. sind nicht nur in Österreich tätig, sondern international aufgestellt. „Unsere Kunden sitzen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien.“ Ihr Job ist es, Kunstsammlungen in Paris ebenso zu versichern wie Boote in der Karibik. „Wir definieren alle Risiko-Orte: Wohnungen, Villen, Schlösser, Boote – alles, wo hohe Werte gelagert, ausgestellt und zugänglich gemacht werden.“
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR BESONDERE KUNDENWÜNSCHE
Die Vielseitigkeit ihres Jobs macht die Arbeit spannend. „Es wird nie langweilig. Mal sind es Autos, mal ist es Kunst. Wir haben Zugang zu Sammlungen, die sonst niemand zu Gesicht bekommt. Wir haben für unsere Kunden ganz spezielle Services, denn unsere Kunden und deren Hab und Gut ist einzigartig, und dies wollen wir auch zeigen.“ Ein besonderes Beispiel:

Eine Kundin überraschten sie mit einem exklusiven Coffee Table Book über ihre Kunstsammlung. Nachdem im Rahmen der Versicherung sämtliche Werke katalogisiert und fotografiert worden waren, wurde alles zusammengefasst und in dunkelgrünes Leder mit goldener Prägung gebunden. „Wir haben dieses Buch erstellt, damit es in ihren Residenzen als repräsentatives Werk ihrer Sammlung dient“, erzählt Machat. Fazit: Schutz für exklusive Werte
Der Versicherungsansatz von Douglas, Machat & Cie. geht weit über Standardlösungen hinaus. Sie bieten ihren Kunden nicht nur Schutz vor Verlust oder Schäden, sondern ein umfassendes Sicherheitskonzept für hochwertige Sammlerstücke. In einer Welt, in der die Vermögen so individuell wie ihre Besitzer sind, gewährleistet ihr Versicherungsmodell die perfekte Lösung für anspruchsvolle Sammler.
INFOBOX
Douglas · Machat & Cie. GmbH
Parkring 18/2, 1010 Wien +43 660 3709277 office@dmc.insure www.dmc.insure
1. Ist eine eigene Wertgegenständeversicherung sinnvoll? Sind Wertgegenstände nicht im Rahmen der Haushaltsversicherung versichert?
Wertgegenstände sind in manchen Haushaltsversicherungen zwar mit einer eigenen Summe versicherbar, aber nicht richtig. Sie sollten nicht nur gegen „klassische“ Gefahren wie Feuer, Leitungswasser und Diebstahl versichert werden, sondern gegen alle Risiken, inklusive Verlieren, Liegenlassen und jede Art von Beschädigung. Und das Ganze nicht nur in der Wohnung, sondern auch außerhalb und während Transporten. Zumal eine Kunstversicherung meist sogar günstiger ist als eine Haushaltsversicherung.
2. Wie beeinflusst der Klimawandel die Versicherung von hochwertigen Immobilien?
Steigende Temperaturen und extreme Wetterereignisse erhöhen die Risiken für die Versicherungswirtschaft auch in den Sparten für private Gebäude. Die Folge ist, dass sich immer mehr Versicherer aus dem Markt zurückziehen oder die angebotenen Deckungssummen reduzieren. Bei gleichzeitig steigenden Baukosten ist es zunehmend schwieriger, große Anwesen, Villen oder Ferienhäuser am Markt zu platzieren. Spezialisierte Nischenanbieter können hier meist noch eine Lösung bieten, wo andere nicht mehr weiterhelfen können.
3. Wie können Kunstsammler ihre Werke optimal schützen?
Regelmäßige Neubewertungen, professionelle Ausstellung und Lagerung sowie insbesondere eine Spezialversicherung sind essenziell, um die Sammlungen, die nicht zuletzt einen erheblichen Anteil am Gesamtvermögen einer Familie ausmachen können, physisch und finanziell abzusichern und für die kommenden Generationen zu bewahren.

Jan Brueghel d. J. (1601–1678), Allegorie der Luft, Öl/Kupfertafel, 69 x 87 cm, Schätzpreis 60.000 €

Feine Auswahl an Picasso-Keramiken aus einer norddeutschen Privatsammlung
Mit einer imposanten Offerte startet das Kunstauktionshaus Schloss Ahlden am 10./11. und 16./17. Mai ins Auktionsjahr 2025. Über 3.500 mit viel Fachkenntnis zusammengestellte Positionen aus Kunst, Antiquitäten, Schmuck und Luxus-Accessoires kommen hier zur Frühjahrsauktion zur Versteigerung und bieten Liebhabern, Händlern und Sammlern eine ideale Gelegenheit zur Erfüllung lange gehegter Wünsche, spontaner Käufe oder der Entdeckung des ein oder anderen besonderen Schatzes. Bereits ab dem 27. April stehen dabei die Pforten zur exklusiven Auktionsvorbesichtigung im außergewöhnlichen Ambiente des ehemaligen Wasserschlösschens offen. Im Nachgang der Auktion finden zudem gesonderte Nachverkaufsausstellungen für Schnäppchenjäger statt. Einige ausgewählte Highlights der Auktion werden darüber hinaus bereits vorab von 24. bis 26. April in der hauseigenen Berliner Repräsentanz zu sehen sein. Wer dennoch nicht persönlich vor Ort sein kann, sichtet die hochwertig gestalteten Auktionskataloge stattdessen einfach von zu Hause aus und beteiligt sich bequem online über Schloss Ahlden Live oder am Telefon.
Neben klassischen Bereichen wie Porzellan, Silber, Mobiliar, Teppichen und Luxus-Accessoires lohnt erneut auch eine exzellente Auswahl an alten, modernen und zeitgenössischen Skulpturen und Gemälden einer näheren Betrachtung. Aus der Vielzahl spannender Arbeiten namhafter moderner Künstler wie Max Pechstein (1881–1955), Bruno Bruni (*1935), Georg Kolbe (1877–1947), Walter Dexel (1890–1973) und Pablo Picasso (1881–1973) stechen dabei nicht zuletzt eine Berliner Allee im Tiergarten von Max Liebermann (1847–1935) zu 150.000 €, ein auf 28.000 € geschätztes Porträt Liz Tay-
lors von Andy Warhol (1928–1987) sowie einige Bilder von Carl Spitzweg (1808–1885) aus einer herausragenden süddeutschen Unternehmersammlung hervor. In Sachen Altmeister fallen Gemälde von Jan Brueghel dem Jüngeren (1601–1678) ins Auge, darunter eine um 1740 entstandene Allegorie der Luft mit einem Startpreis von 60.000 €. Interessant verspricht auch eine außergewöhnliche Kollektion an attraktiv bepreisten Autographen von Sigmund Freud (1856–1939), Pablo Picasso (1881–1973), Joan Miró (1893–1983), Otto Dix (1891–1969), D. H. Lawrence (1885–1930) und mehreren weiteren Persönlichkeiten sowie Künstlerbüchern, etwa von Pierre Soulages (1919–2022) und Georges Braques (1882–1963) zu werden. In der Luxussparte fallen neben einigen ausgesprochen schönen Handtaschen von Cartier und Hermès unter anderem eine seltene Patek Philippe Armbanduhr „Nautilus“ aus Stahl zu 36.000 € sowie eine 75karätige Saphirbrosche aus preußischem Adelsbesitz zu 85.000 € unter die Höhepunkte. Alle angebotenen Objekte können von 27. April bis 8. Mai im historischen Ambiente von Schloss Ahlden besichtigt werden. Entsprechende Auktionskataloge sind ab Ostern unter www.schloss-ahlden. de kostenlos einsehbar. Einlieferungsanfragen für künftige Auktionen können jederzeit gerne per E-Mail unter info@schloss-ahlden.de gestellt werden.
Kunstauktionshaus Schloss Ahlden Große Str. 1, D-29693 Ahlden/Aller +49 5164 80100 | info@schloss-ahlden.de www.schloss-ahlden.de
Nächste Auktion: 10./11. und 16./17. Mai 2025 Vorbesichtigung: 27. April – 08. Mai 2025











NÄCHSTE AUKTION: 10. + 11. und 16. + 17. Mai 2025
Vorbesichtung: 27. April - 08. Mai 2025, 14:00 - 18:00 Uhr.
Bitte beachten Sie auch unser fortlaufendes Online Angebot.


Zu Besuch bei TERESA PAGITZ
Ein langer Tisch, die bunte Tischdecke, ein fröhlich elegantes Service, hübsche Weingläser, schön gebügelte Servietten und mehrere dicht gefüllte Blumenvasen laden dazu ein, sich hier wohlzufühlen. Wir sind zu Gast bei Teresa Pagitz, die sich neben ihrer großen Familie und etlichen beruflichen Engagements auch noch die Zeit nimmt, um Dinnerpartys zu schmeißen.
Text: Clarissa Mayer-Heinisch Fotos: Nuno Filipe Oliveira

Teresa Pagitz-Draxler ist Familienmensch, Unternehmerin und hat gerne Gäste.
Wie sieht Gastfreundschaft für dich aus?
Teresa Pagitz: Ich habe das GastgeberSein irgendwie in meiner DNA. Und dieses Gen ist sehr stark ausgeprägt. Nämlich so stark, dass wir sogar ein Hotel entwickelt und gebaut haben – den GROSSARLER HOF in Großarl in den Hohen Tauern. Aber ich habe auch zu Hause gerne Gäste.
Was ist dir wichtig, wenn Gäste kommen?
TP: Sie sollen es gemütlich haben und fröhlich sein. Ich liebe leuchtende Farben, wie du hier sehen kannst. Ich finde, das verleiht dem Raum eine besondere Atmosphäre, die ausstrahlt.
Nach welchen Kriterien hast du eingerichtet?
TP: Da hat kein Interior-Designer mitgewirkt, es ist ein Sammelsurium. Manche Dinge sind aus dem Dorotheum, anderes – der Kasten beispielsweise –stammt von meiner Schwiegermutter. Das Silberbesteck habe ich von meiner Großmama bekommen, das Geschirr zur Hochzeit. Es ist aus der Serie „Reichenbach“ von Lobmeyr. Wir haben es uns damals ausgesucht, und ich liebe es noch immer. Auch die Gläser sind von Lobmeyr.
An den Wänden hängt viel Kunst. Sammelt ihr?
TP: Auch hier ein Sammelsurium. Die Bilder sind im Laufe der Zeit zu uns gekommen. Manche hat mein Mann Jakob gekauft, wie die Zeichnungen des amerikanischen Künstlers George Condo. Andere haben wir zum Beispiel bei Charity-Auktionen ersteigert oder geschenkt bekommen.
Auffallend sind die Stoffe, die du offensichtlich liebst. Gefütterte Vorhänge, aber auch die Tischtücher wirken orientalisch.
TP: Dieses Tischtuch habe ich besonders gern – es ein Patchwork aus Ikatstoffen, das ich in Paris auf der Messe gefunden habe. Die Stehlampen stammen von Objet Insolite. Übrigens auch die Lampen für unser Hotel – da gibt es immerhin 50 Zimmer mit bis zu 130 Betten. Es ist ein größeres Boutiquehotel im alpenländischen Stil. Man soll da hineinkommen und sich fühlen wie in einem alten Jagdhaus – aber chic eingerichtet und trotzdem mit allem modernen Komfort, den man sich vorstellen kann.
Wo hast du das Gastgeber-Sein gelernt?
TP: Ich habe das zu Hause gesehen, bei meiner Mami und den Großmüttern abgeschaut. Und immer schon, sogar als Kind, begeistert mitgeholfen und serviert.
Wie oft kommen Gäste zu dir nach Hause?
TP: Ich habe viel zu selten Gäste – leider. Ich hatte immer sehr gerne Gäste, aber im Moment ist mein aktuelles Arbeitspensum zu groß. Die drei Kinder, das Hotel, diverse Immobilienprojekte, zwei Baustellen, ein Aufsichtsratsmandat und ehrenamtliche Tätigkeiten wie beispielsweise für das Grüne Kreuz.
Wenn dann aber doch Gäste kommen – wie bereitest du alles vor?
TP: Es muss nicht Perfektionismus sein, aber ich habe schon gerne einen schön gedeckten Tisch. Im Sommer plündere ich meinen Garten für die Blumen, im Winter muss ich sie dann eben kaufen gehen. Ich habe sehr viele Vasen in unterschiedlichen Größen und stelle auch gerne viele davon auf den Tisch.
Was wird gekocht, wenn Gäste kommen?
TP: Bei uns gibt es fast immer Wild. Das bringen Jakob oder einer meiner Brüder von der Jagd. Als Vorspeise meist Suppe oder kalten Fisch. Meine Lieblingsnachspeisen sind Mousse au Chocolat und Bayrische Creme mit Früchten. Und dazu trinken wir Himmelstrassler.
Wir haben einen kleinen Weingarten ganz nah am Schenkenberg. Es sind Weißburgunder Reben, die das Weingut Mayer am Pfarrplatz für uns keltert. Wir lassen aus unseren Trauben übrigens auch Frizzante herstellen, der eignet sich gut als Aperitif. Jakob hat im Keller eine große Auswahl an Rotweinen, die passen noch besser zum Wild. Ein Dry Dinner gibt es bei uns jedenfalls so gut wie nie.
Last, but not least – wie wichtig ist es, den Tisch für Gäste besonders zu gestalten?
TP: Manche Gäste sehen die Details und die Mühe ganz genau und loben das auch, andere nehmen es gar nicht wahr. Mir selbst ist es sehr wichtig. Ich habe einfach gerne das schöne Bild eines ordentlich gedeckten Tisches.
Wer den Wein von Teresa Pagitz gerne einmal kosten möchte, kann sich eine Kostprobe bestellen unter:
www.himmelstrassler.at

„Ich
habe das Gastgeber-Sein in meiner DNA“, sagt
Teresa Pagitz-Draxler

Die Hausfrau liebt Farben – die roten Wände und das bunte Geschirr auf dem gemusterten Tischtuch beweisen das. Den Luster über dem Tisch hat Teresa in Portugal gekauft.


SIMPLY PERFECT
Blumen in unterschiedlich großen Vasen schmücken den Tisch. Teresa arrangiert die Blumen am liebsten selbst. Im Sommer holt sie diese aus ihrem Garten.

Das Silberbesteck stammt von der Großmama, Gläser und Geschirr sind von der Hochzeitsliste bei Lobmeyr.


Teresa Pagitz
„Gäste sollen es gemütlich haben und fröhlich sein. Dazu trägt ein schön gedeckter Tisch samt bunten Blumen und Kerzen bei.“












1. Himmelstrassler Weissburgunder mit zartem Duft nach gelben Saftbirnen, Haselnuss und Lindenblüten um € 11,90 | 2. Wein und Wasserglas No. 98 mit einfachem Facettenschliff von lobmeyr.at ab € 459 | 3. Kelche Set 6Stk. auf Silbertablett in Sterling Silber und 7. Silberbesteck von Sturm Silber Wien, Preis auf Anfrage | 4. Rechteckige Vase von Leonardo um € 25 | 5. Ikat Tischtücher baut man sich am besten aus Baumwollestoffen,s unsere Empfehlung einen Sprung bei mfaber.at vorbeizusschauen | 6. Kerzen von Lobmeyr um € 4 das Stück | 8. Porzellanteller Lobmeyr Color Serie in Kooperation mit Reichenbach bei lobmeyr.at um € 64 | 9. Leinenserviette mit Monogramm personalisierbar etsy ab € 45

Teresa führt mit Liebe den GROSSARLER HOF im Salzburger Land Der GROSSARLER HOF im Chalet-Stil vereint Luxus und Natur. Gäste genießen Erholung im Spa „Erlenreich“, die Gourmetküche mit erlesenen Weinen und romantische Auszeiten auf der Mooslehenalm. Ideal für Aktivurlaub in den Hohen Tauern – ein Hide-away für Genießer! www.grossarlerhof.at


Historische Gebäude sind mehr als nur architektonische Relikte aus vergangenen Zeiten – sie sind Zeugnisse kultureller Identität, städtischer Geschichte und handwerklicher Kunstfertigkeit. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung zentrale Themen sind, gewinnt die Revitalisierung historischer Bauten zunehmend an Bedeutung. Die Herausforderung besteht darin, sie in die modernen Ansprüche zu integrieren, ohne dass sie ihren ursprünglichen Charme und ihre geschichtliche Relevanz verlieren. Im Grunde ist das architektonische Erbe eine eigene Assetklasse für die Stadt, die einen ganzen Industriezweig bespielt; denn die jährlich 18,9 Mio. Nächtigungen allein in Wien beruhen direkt oder indirekt großteils auf der außergewöhnlichen Stadtarchitektur vergangener Tage.
Moderne Nutzungskonzepte für historische Gebäude
Die Revitalisierung historischer Gebäude eröffnet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, die sowohl wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Als Co-Working-Spaces zum Beispiel. Viele alte Fabrikhallen, Bahnhofsgebäude oder Lagerhäuser werden zu flexiblen Arbeitsräumen umgestaltet. Sie bieten Start-ups, Freiberuflern und Kreativen inspirierende Orte zum Arbeiten und Netzwerken. Am häufigsten allerdings werden Bestandsentwicklungen als
Mischkonzepte für Wohnen & Arbeiten projektiert: Historische Bauten eignen sich in der Regel gut für Wohnräume, kleine Geschäfte und Büroräume – auch in der Kombination. Aber nicht jedes Gebäude lässt sich auf moderne Ansprüche ausweiten. Die räumlichen Dimensionen ermöglichen häufig keine private Nutzung, weil viel unbespielter Raum, der früher einfach als Repräsentationsraum genutzt wurde, heute dem Denkmalschutz unterliegt und nicht gewinnbringend verwertet werden kann. Dann springt die Stadt gerne ein und es entstehen kulturelle und soziale Einrichtungen: Theater, Schulen, Bibliotheken oder soziale Treffpunkte profitieren von der besonderen Atmosphäre alter Gebäude und machen sie für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Ein dankbares Konzept ist oft die Gastronomie & Hotellerie: Alte Burgen, Bahnhöfe oder Industrieanlagen werden zunehmend als Hotels, Restaurants oder Markthallen genutzt – wie zum Beispiel die alte Markthalle in Wien Währing, die schon seit Langem eine SPAR-Filiale beherbergt.
Die Umnutzung historischer Gebäude ist eine komplexe Aufgabe, die sorgfältige Planung sowie ein durchdachtes Konzept erfordert. Man muss vieles berücksichtigen, allem voran den Denkmalschutz, der ein wichtiges Kontrollelement ist und Sorge trägt, dass der Charakter der Region nicht verloren geht.

Die Herausforderung besteht darin, historische Bausubstanz zu bewahren und gleichzeitig moderne Standards in Bezug auf Energieeffizienz, Barrierefreiheit und Gebäudetechnik zu erfüllen.
Nachhaltigkeit als Schlüsselprinzip
Der Erhalt bestehender Bausubstanz ist per se nachhaltig, da er Ressourcen und Energie spart. Zudem können moderne Technologien wie Wärmedämmung, Solartechnik oder Smart-Building-Lösungen integriert werden, um langfristige ökologische Vorteile zu gewährleisten. Eine erfolgreiche Revitalisierung berücksichtigt die Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Bürgerbeteiligung, kreative Workshops und öffentliche Diskurse helfen dabei, Akzeptanz für das Projekt zu schaffen und es an die Anforderungen der Bevölkerung zu adaptieren.
Gebäude, die sich an veränderte Anforderungen anpassen können, bleiben langfristig wirtschaftlich tragfähig. Modulare Raumgestaltung und multifunktionale Flächen ermöglichen es, historische Gebäude über Jahrzehnte hinweg lebendig zu halten. Und da die Architektur das Gesicht der Region ist, hilft diese, es auch zu wahren. Öffentliche Fördermittel und Expertise helfen, wenn das Kapital der Privatinvestoren nicht ausreicht. Man nennt diese gängigen
RELIKTE VERGANGENER TAGE – neu gedacht
Wo früher ein Fürst oder König einen Hofstaat unterhielt, lebte es sich zeremoniell und in einer kastenartigen Hierarchiepyramide, die überwiegend aus Dienerschaft bestand. Man brauchte Platz. Heute leben Superreiche in mehreren Wohnsitzen über den Erdball verteilt. In Europa werden ehemalige Schlösser kaum mehr von einzelnen Familien bewohnt, oftmals ist die Instandhaltung schlichtweg zu mühsam. Nun teilt man sich gerne den Luxus – wie beim Schloss Freihof Projekt in Wien 1190.
Modelle zur Finanzierung derartiger Projekte dann Public-Private-Partnerships. Ein solches fand sich auch bei der gelungenen Revitalisierung des Gasometer Wien: Die ehemaligen Gasbehälter wurden in ein modernes Quartier mit Wohnungen, Büros, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen umgewandelt – ein gutes Beispiel für multifunktionale Nutzung und vorher fast schwer vorzustellen. Auch Zeche Zollverein in Essen, das ehemalige Steinkohlebergwerk, ist heute UNESCOWelterbe und beheimatet Museen, Büros sowie kulturelle Einrichtungen. Selbst der Elbphilharmonie in Hamburg war der Umbau eines alten Kaispeichers in ein modernes Konzerthaus vorausgegangen, ehe es sich in ein ikonisches Wahrzeichen wandeln konnte.
Die Revitalisierung historischer Gebäude ist eine kreative und wirtschaftlich sinnvolle Lösung für die Herausforderungen moderner Stadtentwicklung. Sie ermöglicht es, Identität und Geschichte zu bewahren, während neue, innovative Nutzungen entstehen. Entscheidend für ihren Erfolg sind durchdachte Konzepte, die Denkmalschutz, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Bedürfnisse miteinander in Einklang bringen. Was für einzelne Objekte gilt, trifft für ganze Regionen umso mehr zu.
Mehr beleuchten wir nun mit Chris Müller.

Chris Müller, NESTROY-Preisträger und Gründungsdirektor der Tabakfabrik Linz, kreiert, entwickelt und managt unkonventionell und erfolgreich komplexe Projekte.
Unternehmer und Visionär
www.chrismueller.at
Wenn es nicht mehr darum geht, „nur“ ein Schloss oder ein einzelnes Objekt zu revitalisieren, sondern mitunter ganze Stadtteile, wendet man sich gerne an Chris Müller. Denn dieser hilft gegenwärtig mit, das Otto-Wagner-Areal mit einer neuen Rolle zu versehen. In der Vergangenheit hat er unter anderem bereits mit dem Großprojekt der Tabakfabrik Linz bewiesen, wie man ein ganzes Areal komplett neu denken kann.
„Fabriken gibt es viele, auch viele gute. Aber das OttoWagner-Areal gibt es in dieser Form nur ein einziges Mal. Deshalb ist es eine besondere Ehre für mich, dass ich dieses große Projekt in die Zukunft begleiten darf“, erklärt Müller gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Sich richtig zu titulieren, fällt selbst ihm schwer: „Was ich mache und wer ich bin, wird ja oft von außen bewertet. Ich würde mich als Entrepreneur sehen, denn ich unternehme Dinge. Verschiedene Dinge. Parallel.“
Die Liste der Projekte, die Müller 2025 antreibt, ist lang: ein ehemaliges Kloster in Steyr, das auch ein Theater und ein Gefängnis beherbergte, das Otto-WagnerAreal, ein Brownfield-Projekt in Mödling, in Tirol wird ein Experience Center neu gedacht, in Tschechien wird gerade ein neues Büro eröffnet. Dort werden im Zuge der Aufarbeitung des Kommunismus und der Restitutionsthematik Industrieareale und Schlösser revitalisiert – Ostrava und Opatija gelten als „Brownfield-Paradiese“. Auch das Wasserschloss in Weizenkirchen wird mit einer Agrar-Tech-Lösung von Müller beraten. Der studierte Bildhauer und Bühnenvisionär hat seinen Weg vom Theater auf eine viel größere Bühne gefunden. In seinen Entwicklungsprojekten inszeniert er Lebenswelten, in die das tatsächliche Leben einzieht, und überlässt den Dingen ihren Lauf.
„Ein Projekt wie die Tabakfabrik wächst über Jahre oder Jahrzehnte. Man entwickelt ein Soziotop in der Größe einer Kleinstadt, wo Tausende Menschen wohnen, ar-
beiten und miteinander auskommen sollen. Nach fast einem Jahrzehnt ist die Tabakfabrik Linz nun quasi beendet, ausvermietet und in der Gewinnzone.“ Das mag auch daran liegen, dass sich Menschen wie eben Chris Müller intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie sich dieser Ort anfühlen soll. Denn: Von der Excel-Tabelle aus zu planen, funktioniert in der Regel nicht so gut. Man muss sich mit der Geschichte des Gebäudes und der Region auseinandersetzen und auf Spurensuche gehen. „Wir beginnen immer mit der Recherche und der Aufarbeitung, ehe wir in die Konzeption gehen“, berichtet der Unternehmer, der sich nun der Herausforderung stellt, dem Otto-Wagner-Areal einen neuen Zukunftsplan zu geben.
„Der ,Campus der guten Hoffnung‘ ist unser Mission Statement, nachdem wir uns eingehend mit der –manchmal doch sehr tragischen – Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Dort wollen wir den Weg aus dem Schatten ins Licht ermöglichen. Dieser Weg wird gerade mit einem hochkompetenten Team der Stadt Wien ergründet. Die oft forensische Zusammenarbeit mit absoluten Vollprofis macht demütig“, erklärt Chris Müller. Doch Bauträger ist er nicht. Auch wenn er als ehemaliger Geschäftsführer der Tabakfabrik Linz um bauliche Maßnahmen nicht herumkam, denkt Müller zuerst über die Rolle eines Gebäudes oder Ortes nach und besiedelt diese, wie ein Theaterproduzent die verschiedenen Akteure zusammenschließt, ehe das Stück aufgeführt wird. Dafür setzt er sich zuallererst mit den Nachbarn zusammen.
„Oft werden wir von den letzten Arbeitern einer Fabrik durch das Gelände geführt, wo einem dann erzählt wird: ,Da hat mein Sohn auch zehn Jahre in der Kantine gearbeitet.‘ Man merkt, dass den Leuten der Abschied schwerfällt. Man geht ja in eine ungewisse Zukunft. Aber das ist auch notwendig.“ Die Wehmut weicht der Zuversicht, wenn die neue Projektplanung beginnt. Es geht darum, Empfindungen zu kanalisieren, die den Ort definieren.
„Wir haben untersucht, warum es in Schlössern zu Spukverhalten kommt. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Eine Ahnengalerie zum Beispiel hat den Effekt, dass man sich beobachtet fühlt, weil das Gehirn nicht gut unterscheiden kann, ob das Gemälde lebendig ist oder nicht. Dann kommt noch ein Windstoß hinzu –das führt zu einer Empfindung.“ Mit dem Studium des transmedialen Raums hat Müller bereits die Phänomenologie des Raums erforscht, wo Gefühle durch unterschiedliche Aspekte ausgelöst werden: „Wenn wir gemeinsam bei Sonnenschein über das Otto-WagnerAreal spazieren und ein Eichhörnchen unseren Weg kreuzt, haben wir ein anderes Erlebnis, als wenn wir denselben Weg bei Nebel und Vollmond gehen und ein Hund bellt.“ Die Inszenierung von Lebensraum ist eine transmediale Disziplin, die sich auf Gerüche, Geräusche, Ästhetik und Haptik konzentriert. „Wir messen auch, wie oft ein Flugzeug über ein Areal fliegt.“ Denn genauso wichtig wie die Firmen, die sich ansiedeln, ist die Infrastruktur. Es ist aber der passende Mieter, der gesucht wird, nicht der zahlungskräftigste.
Ein großes Learning aus der Tabakfabrik war, bei der Besiedlung in Phasen zu arbeiten: Da gibt es zum Beispiel eine Art „Artist in Residence“-Variante – das ist die sogenannte Zwischennutzung. Danach folgt die Pioniernutzung und zuletzt die Dauernutzung. Dies sind zwar drei unterschiedliche Phasen, es können aber letzten Endes sogar dieselben Mieter sein. Denn zwischen diesen Phasen geht es um Reevaluierung – darum, herauszufinden, was das Areal noch braucht: Welche Infrastruktur? Welche Gastronomie? Welche Start-ups, die sich synergetisch ergänzen?
Der Campus-Bereich am Otto-Wagner-Areal ist allerdings durch die Bebauung der GESIBA abgegrenzt, die eigene Pavillons bespielt. Dort haben sich zwischen den Altbauten viele Neubauten gedrängt, die im Campus-Areal jedoch nicht zugelassen sind: „Der Neubau der GESIBA hat in der Nachbarschaft eine erhitzte Diskussion entstehen lassen. Darauf folgte ein Gemeinderatsbeschluss, der den großen Grünbereich rund um die Pavillons unberührt lässt und damit auch eine neue Bebauung ausschließt.“ Das GESIBA-Areal ist infrastrukturell nicht erschlossen – es gibt keinen Greißler, kein Café, keine Nahversorgung. Da kommt es gelegen, dass Chris Müller die Grundbedürfnisse des Menschen versteht und der Campus sich darum nicht sorgen muss.
Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Auszug von Chris Müllers Projekten.


Chris Müller ist ein Innovator von Orten, der Philosoph unter den Unternehmern. Mit seinem Engagement versteht er es, Altbestand sinnvoll zu bespielen und dadurch neuen Lebensraum zu erschaffen – an Orten, die andere übersehen haben.


... ist ein markantes Beispiel für die erfolgreiche Revitalisierung eines historischen Industriegebäudes in Österreich. Ursprünglich als Produktionsstätte für Tabakwaren errichtet, hat sich das Areal unter der Leitung von Chris Müller zu einem pulsierenden Zentrum für Kreativität, Innovation und Wirtschaft entwickelt.
Geschichte der Tabakfabrik Linz
Die Tabakfabrik wurde in den 1930er-Jahren erbaut und diente jahrzehntelang als Produktionsstätte für Tabakwaren. Nach der Schließung im Jahr 2009 stand das Areal vor einer ungewissen Zukunft. Mit der Entscheidung der Stadt Linz, das Gelände zu erwerben und einer neuen Nutzung zuzuführen, begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Tabakfabrik.
Die Rolle von Chris Müller
Im Jahr 2012 übernahm Chris Müller die Position des Direktors für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenden der Tabakfabrik Linz. Unter seiner Führung wurde das ehemalige Industrieareal in einen modernen Campus für Kreativwirtschaft, Digitalisierung und Start-ups transformiert. Müllers Vision und Engagement waren für die erfolgreiche Neuausrichtung der Tabakfabrik maßgeblich verantwortlich, als deren Geschäftsführer er zudem fungierte.
Transformation und Entwicklung
Seit ihrer Revitalisierung hat sich die Tabakfabrik Linz zu einem bedeutenden Zentrum für Kreativwirtschaft und Innovation entwickelt. Aktuell arbeiten dort rund 3.000 Personen in über 250 Unternehmen, Organisationen, Start-ups und Initiativen. In den kommenden Jahren ist eine weitere Expansion geplant. Mit dem Neubauprojekt Quadrill sollen bis zum Jahr 2025 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und Wohnraum für etwa 370 Menschen realisiert werden. Somit werden zukünftig mehr als 5.000 Personen in der Tabakfabrik leben und arbeiten.
Abschied von Chris Müller
Nach über einem Jahrzehnt entschied sich Chris Müller, die Tabakfabrik Linz zu verlassen. Am 30. April 2023 verabschiedete er sich, um sich neuen Herausforderungen als Unternehmer, Berater, Vortragender und Autor zu widmen. In Tschechien wird dieses Jahr noch ein Büro eröffnet, in dem man sich auf sogenannte „Brownfield“-Projekte konzentrieren wird.


Chris Müller konzipiert und managt komplexe Entwicklungsprojekte. Seine Arbeit zeichnet sich durch die Verbindung von Kunst, Kultur und Wirtschaft aus, wobei er stets innovative Nutzungskonzepte für historische Bauten verfolgt und mittlerweile in der Stadtentwicklung eingesetzt wird.
Ein historisches Juwel
Das Otto-Wagner-Areal, vor fast 120 Jahren vom Architekten Otto Wagner entworfen, diente ursprünglich als psychiatrische Heilanstalt. Mit seinen denkmalgeschützten Pavillons und der beeindruckenden Steinhofmauer stellt es ein bedeutendes architektonisches Ensemble dar. Nach mehr als einem Jahrhundert klinischer Nutzung plant die Stadt Wien, das Areal zu einem Wissenschafts-, Kultur- und Bildungsstandort zu transformieren. Dieser ist abgegrenzt von der GESIBAEntwicklung, die sich auf den Wohnbau konzentriert.
Müllers Engagement für das Otto-Wagner-Areal
Nach einem europaweiten Vergabeverfahren wurde Chris Müller mit der Neubesiedlung und Entwicklung des OttoWagner-Areals beauftragt. Seine Vision ist es, das Areal in eine „Heilanstalt für die Welt und ihre Schieflagen“ zu verwandeln, indem Wissenschaft, Forschung, Kunst und unternehmerische Kreativität miteinander verknüpft werden. Dieses Projekt von europäischer Dimension soll Humanität und Aufklärung in den Mittelpunkt stellen.
Zukunftspläne und Herausforderungen
Die geplante Transformation des Otto-Wagner-Areals sieht vor, die historische Bausubstanz zu erhalten und gleichzeitig moderne Nutzungen zu integrieren. Geplant sind Einrichtungen für Wissenschaft, Bildung, Soziales, Gesundheit sowie Kunst und Kultur. Dabei sollen die Bedürfnisse der Bevölkerung und der angrenzenden Bezirke berücksichtigt werden. Die Umsetzung dieses ambitionierten Projekts erfordert eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt und anderen relevanten Institutionen, um den denkmalgeschützten Charakter des Areals zu bewahren.


Das Otto-Wagner-Areal (Steinhof-Areal) in Wien ist ein historisch und architektonisch bedeutendes Gebiet mit einer Fläche von rund 63 Hektar. Es befindet sich im 14. Bezirk (Penzing) und wurde ursprünglich als Niederösterreichische Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke Am Steinhof konzipiert.
Geschichte und Architektur
Die Anlage wurde zwischen 1904 und 1907 nach den Plänen von Otto Wagner erbaut und gilt als ein Meisterwerk des Wiener Jugendstils. Ein zentrales Wahrzeichen ist die Kirche St. Leopold, auch bekannt als Otto-Wagner-Kirche, die als eine der schönsten Jugendstil-Kirchen weltweit gilt. Das Areal bestand ursprünglich aus 60 Pavillons, die nach modernen medizinischen Standards der damaligen Zeit gestaltet wurden.
Heutige Nutzung
Ein Teil des Areals wird weiterhin als Klinik Penzing (ehem. Otto-Wagner-Spital) genutzt, die psychiatrische sowie neurologische Abteilungen umfasst. Ein anderer Bereich ist für kulturelle und soziale Einrichtungen geöffnet, darunter die Jugendstiltheater Halle E sowie diverse Bildungsprojekte. Es gibt Überlegungen zur Ausrichtung des Geländes, die eine Nutzung als Wissenschafts-, Kultur- und Bildungsstandort vorsieht.


Die Welt ist voller Missverständnisse. Eines der größten: Nachhaltiges Bauen bedeute automatisch Neubau. Man stelle sich eine Podiumsdiskussion vor – ein Architekt, ein Politiker, ein Immobilienentwickler. Alle drei sind sich einig: „Unsere Städte müssen klimafit werden.“ Die Lösung? Zertifizierte Gebäude, High-Tech-Fassaden, vertikale Gärten. Nur eines wird dabei vergessen: Das nachhaltigste Gebäude ist nicht jenes, das neu gebaut wird, sondern das bereits bestehende.
Embedded Carbon und der Irrsinn der Wegwerfgesellschaft. Europa produziert Müll. Viel Müll. 8 % davon entstehen in privaten Haushalten, 30 % durch die Bauindustrie. Jahr für Jahr verschwinden funktionstüchtige Gebäude unter der Wucht von Abrissbirnen, nur um Neues zu errichten, das in wenigen Jahrzehnten wieder weichen muss. Ein absurdes Ritual, das Ressourcen vernichtet, Geschichte auslöscht. Die Gründerzeitbauten unserer Städte sind ökologische Schätze. Sie wurden errichtet, als man noch baute, um zu bleiben – nicht, um zu ersetzen. Ihre eingebettete Energie – das bereits verbrauchte
und gespeicherte CO₂ – ist längst investiert. Abriss bedeutet, wertvolle Handwerkskunst zu vernichten und zusätzliche Emissionen freizusetzen: für Abtransport, für Entsorgung, für Neubau. Ein Gebäude abzureißen, um anschließend ein „nachhaltiges“ Haus zu errichten, ist ungefähr so klug, wie ein Buch zu verbrennen, nur um es danach aufwendig neu zu schreiben.
Von der Schönheit, die wir verloren haben
Doch es geht nicht nur um Zahlen, es geht auch um Ästhetik. Was tun wir? Wir reißen kunstvoll verzierte Fassaden ab, um sie durch Glas und Stahl zu ersetzen –

Blick auf die Hauptstraße von Solomeo (1913) – 1978 gründete Brunello Cucinelli die Aktiengesellschaft
Brunello Cucinelli S.p.A. und siedelte sie in der Nähe seines Heimathofes in der 1985 erworbenen Burg von Solomeo an. Die Firma beschäftigt etwa tausend kleine Familienbetriebe, die in Auftragsfertigung arbeiten und in der Umgebung von Solomeo ansässig sind.
nur um dann mit Pflanzen das Unvermeidliche zu kaschieren. Hätte man die floralen Stuckverzierungen nicht gleich belassen können?
Der Mensch sehnt sich nach Natur. Doch während drinnen Holzbalken und Vintage-Möbel gefeiert werden, wird draußen alles Historische ausradiert und durch Belangloses ersetzt. Was bleibt, sind sterile Fassaden, so nichtssagend, dass man sich bei ihrer Betrachtung an seine Adresse erinnern muss, um sicherzugehen, dass man vor dem richtigen Gebäude steht. Das, was auf der Hand liegt, wird uns verwehrt. Der Mensch sehnt sich nach Bezug zur Natur, er sucht Harmonie, Rhythmen, Vertrautheit.
Das Zinshaus als unterschätzte Oase
Dabei liegt die Lösung oft direkt vor unseren Augen: die Innenhöfe der Zinshäuser. Kein Smart-CityKonzept der Welt könnte sie intelligenter planen, als
die Baumeister des 19. Jahrhunderts dies getan haben. Diese Höfe sind das, was heute unter dem Namen „Shared Space“ als urbanistische Innovation gefeiert wird: ein gemeinsamer Raum, der seiner Zeit voraus ist, wo Generationen miteinander ins Gespräch kommen, statt sich über digitale Nachbarschaftsforen anonym übereinander zu beschweren. Ein Stück Stadt, das nicht kontrolliert, sondern belebt wird. Man müsste diese Räume nur nutzen! Statt strikter Verwaltung und bürokratischer Hürden könnte man sie in grüne Oasen verwandeln – mit Bäumen, Sitzplätzen, vielleicht einem Gemeinschaftsgarten. Ein bisschen wie in Italien, ein bisschen wie im Süden. Wäre das nicht eine Stadt, in der man gerne lebt?
Brunello Cucinelli und die Rückkehr zum Maßvollen
Wer glaubt, dass Nachhaltigkeit gleichzeitig auch immer mit Verzicht einhergehen muss, sollte einen Blick

Um zu verhindern, dass unsere Jugend unser kulturelles Erbe aufgibt, entschied sich Brunello Cucinelli, die Schule für zeitgenössische hohe Handwerkskunst und Künste in Solomeo zu gründen.
nach Italien werfen. Brunello Cucinelli, Unternehmer, Philosoph und Schöngeist, hat in Umbrien, oft als das „grüne Herz des Landes“ bezeichnet, eine Vision verwirklicht, die beweist: Kapitalismus und Humanismus sind keine Feinde, sondern Partner.
In seinem Heimatdorf Solomeo, einem Ortsteil der Gemeinde Corciano in der Provinz Perugia, bewahrte er nicht nur historische Bausubstanz, sondern schuf auch ein humanistisch geprägtes Arbeitsumfeld, das auf Respekt, Ästhetik und sozialem Gleichgewicht basiert. Er zeigt, dass Nachhaltigkeit nichts mit moralischem Zeigefinger zu tun haben muss, sondern mit einer Haltung, die Schönheit, Würde und Verantwortung verbindet.
Diese Philosophie könnte eine Blaupause für die Immobilienwelt sein. Nicht jedes Problem verlangt nach einer neuen Konstruktion. Manche erfordern lediglich einen neuen Blick auf das Bestehende.
„Nachhaltigkeit ist nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle Frage.“
Ein Fazit – oder besser: eine Einladung für klugen Erhalt
Nachhaltigkeit ist nicht nur eine technische, sondern auch eine kulturelle Frage. Es reicht nicht, CO₂-Bilan
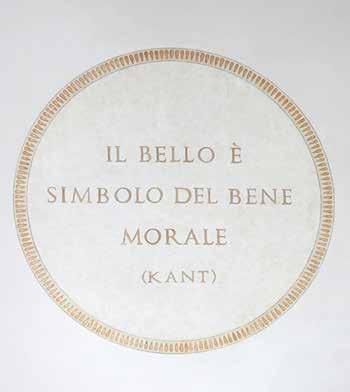

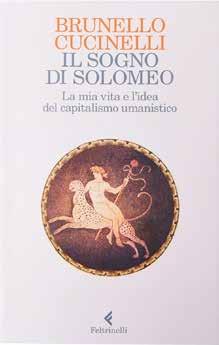
zen zu optimieren, wenn wir dabei unsere Städte in seelenlose Betonlandschaften verwandeln. Der Wert eines Gebäudes bemisst sich nicht nur in Kilowattstunden, sondern auch in seiner Fähigkeit, Menschen ein Zuhause zu bieten – physisch, ästhetisch und sozial.
„Unsere Zeit zwingt uns, mit weniger mehr zu erreichen. Auf den ersten Blick mag das nach Einschränkung klingen, doch in Wahrheit ist es eine Befreiung – von unnötigem Abriss, von kurzlebigen Trends, von der Vorstellung, dass Fortschritt immer mit Zerstörung beginnen muss.“
Denn Fortschritt bedeutet nicht, das Alte um jeden Preis durch das Neue zu ersetzen. Fortschritt bedeutet, das Bestehende zu verstehen, seine Qualitäten zu erkennen und es so weiterzuentwickeln, dass es auch kommenden Generationen erhalten bleibt. Ein nachhaltiges Gebäude ist kein Produkt einer Norm, sondern das Ergebnis einer klugen Entscheidung.
Die Renaissance der Zinshäuser ist keine sentimentale Träumerei. Sie ist eine logische Konsequenz. Wer bereit ist, sie mit dem richtigen Blick zu sehen, erkennt nicht nur ihr wirtschaftliches Potenzial, sondern auch ihre kulturelle Kraft. In ihren Mauern steckt nicht nur graue Energie, sondern auch gelebte Geschichte, städtische Identität, sozialer Zusammenhalt.
Brunello Cucinelli hat es verstanden: Wer Werte bewahren will, muss wissen, was er hat. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns wieder darauf besinnen. Es geht nicht darum, die Vergangenheit zu verklären, sondern sie als wertvolle Ressource zu begreifen. Eine Ressource, die nicht nur CO₂ spart, sondern Schönheit bewahrt. Eine Ressource, die nicht nur langlebig ist, sondern lebensfreundlich. Eine Ressource, die uns die Möglichkeit gibt, klug zu investieren – in Gebäude, die nicht nur Bestand haben, sondern Bestand geben.
Denn letztlich geht es um mehr als um Zinshäuser. Es geht um die Frage, in welcher Welt wir leben wollen: Eine Welt, in der wir das Vorhandene schätzen und weiterdenken? Oder eine, in der wir gedankenlos zerstören, um das zu simulieren, was wir zuvor vernichtet haben?
Die Antwort liegt auf der Hand. Man muss nur den Mut haben, sie auszusprechen.
Text: Paul Lensing

PAUL LENSING
Selbstständiger Asset Manager www.realestateheritage.at
belebt jahrhundertealte Immobilien, indem er sie in die Gegenwart transformiert.
Er ist ein Immobilienmanager mit Fokus auf nachhaltige Immobilien- und Stadtentwicklung, Hochbau. Hier zu sehen in einem Wiener Geschäfts- und Warenhaus, welches unter Denkmalschutz steht; er wartet auf seinen Brunello Cucinelli, der es erhält und mit einer Seele wiederbelebt.

Text: Hannelore Lensing
Durchstreift man eine Stadt wie Wien, dann zeigt sich ihr Charakter in unterschiedlichen Vierteln, geprägt durch die Organisation von Raum, die darauf errichteten Bauten, Freiflächen, Straßen. Und natürlich auch die dort lebenden Menschen. Die Frage „Wem gehört die Stadt?“ lässt sich am ehesten historisch beantworten: Waren es im Castell Vindobona noch die Römer, die für die erste Planung des Legionslagers, seiner Bauten und der wichtigsten Verbindungsstraßen als Architekten tätig waren, so veränderte sich das Stadtbild im Laufe der Jahrhunderte je nach Epoche und Herrschaftsverhältnissen. Maßgeblich war aber immer der Besitz und damit die Verfügbarkeit von Grund und Boden. Wie auch heute erforderte die Errichtung eines Bauwerks nicht nur den Willen und die finanziellen Mittel, sondern es galten und gelten strenge Bauvorschriften. Das Gefälle von Repräsentationsbauten im Stadtkern über die umliegenden Bezirke bis hin zu den Außenbezirken wird bei einer Fahrt durch Wien deutlich sichtbar.
Im privaten Bereich bleibt die Einrichtung der Wohnung oder des Hauses eine individuelle Angelegenheit, doch im öffentlichen Raum prägt die Gestaltung das Stadtbild. Was also ist notwendig, um diesem Anspruch gerecht zu werden? Diese Frage ist immer im zeitlichen und ökonomischen Kontext zu beantworten. Während im Barock mit prunkvollen Schlössern, Palais und herrschaftlichen Häusern Macht und Einfluss zur Schau gestellt wurden, erforderten die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert eine andere Art von Bauweise. Die Bevölkerungsexplosion und der damit verbundene Bedarf an Wohnraum führten zum massenhaften Bau der sogenannten „Gründerzeithäuser“, die bis heute das Wiener Stadtbild prägen.
Nach der Revolution von 1848 fielen feudale Strukturen und es konnten große städtebauliche Projekte umgesetzt werden. Ab 1858 war das Gebiet innerhalb der Stadtmauern dicht bebaut, während sich außerhalb die ab-

Das Haus „Zum weißen Elefanten“ in der Kärntner Straße
getrennten Vorstädte befanden. Kaiser Franz Joseph entschied daraufhin, die Stadtbefestigungsanlagen und das Glacis abzutragen, um Platz für eine Stadterweiterung zu schaffen. Dies markierte den Beginn der großen Umgestaltung Wiens, insbesondere mit dem Bau der Wiener Ringstraße. Zu Reichtum gekommene Industrielle und Unternehmer errichteten nun großzügig gestaltete Häuser, die in ihrer Ausstattung oft den Palais des Adels glichen. Neben öffentlich errichteten Prachtbauten wie der Oper, dem Parlament, der Universität, dem Burgtheater und dem Rathaus rahmen diese privaten Großbauten noch heute die Ringstraße ein.
Durch Neuparzellierungen und den florierenden Grundstückshandel entstanden neue Bauflächen für Gründerzeithäuser, was einen beispiellosen Bauboom auslöste. Ein wesentliches Baumaterial war der Ziegelstein, der in der Wienerberger Ziegelfabrik von Heinrich Drasche in großen Mengen produziert wurde. Entlang der Ringstraße entstanden die teuersten und prestigeträchtigsten Wohnungen Wiens, aber auch in den umliegenden Bezirken und Vorstädten wurde eifrig gebaut, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Neben der noch barocken Innenstadt und den kleinen, meist zweigeschossigen Biedermeierhäusern der Vorstädte entstanden nun fünfgeschossige Gründerzeithäuser mit hohen Innenräumen, großen Fenstern und oft reich dekorierten Fassaden. Im neuen Wien wurden zwischen 1860 und 1914 zahlreiche dieser Häuser in unterschiedlichsten Gegenden errichtet.

Die Nutzung dieser Bauten war primär auf Mieteinnahmen ausgerichtet. Wer es sich leisten konnte, eine Wohnung in einem Gründerzeithaus zu mieten, entkam den substandardisierten Wohnverhältnissen der früheren Zeiten. Während zuvor viele Menschen in kleinen Wohnungen mit Zimmer, Küche, Kabinett und Gemeinschafts-WCs am Gang lebten, boten die neuen Mietshäuser einen wesentlich höheren Komfort. Gelegentlich gab es sogar ein Dienstbotenzimmer, einen Erker oder Balkon. Wohnungen mit Vorzimmer, Küche, Toilette, Wasseranschluss und mehreren Zimmern waren der Standard für die neue bürgerliche Mittelschicht. Die Gründerzeithäuser zeichnen sich durch ihre solide Bausubstanz aus. Es heißt oft, sie seien stabiler als viele Bauten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ihre hohe Bauqualität zeigt sich auch in ihrer langen Nutzungsdauer. Bis heute sind Altbauwohnungen in diesen Häusern begehrt, nicht zuletzt wegen ihrer hohen Räume, historischen Flügeltüren, Sternparkettböden und großen Fenster mit Oberlichtern. Die sorgfältig gestalteten Fassaden mit Anleihen aus dem Klassizismus tragen bis heute zum historischen Flair Wiens bei und sollten dringend erhalten werden.
Ein hervorragendes Buch zur Geschichte und Bedeutung der Gründerzeithäuser ist „Das Gründerzeithaus – Bewahren. Restaurieren. Bewirtschaften.“ von Dr. Markus P. Swittalek. Es gibt einen umfassenden Überblick über den Gebäudetyp des Zinshauses aus historischer, kultureller und technischer, aber auch aus rechtlicher und wirtschaftlicher Perspektive.
Obwohl die Wiener Gründerzeithäuser mittlerweile weit über hundert Jahre alt sind, bleiben sie ein Symbol für gehobenes Wohnen und städtische Identität. Sie zu bewahren und sorgsam zu renovieren, ist nicht nur aus architektonischer Sicht eine Verpflichtung, sondern auch ein Beitrag zum Erhalt eines wesentlichen Stücks Wiener Geschichte.
Fragen an Dr. Markus P. Swittalek
Ihr Buch beleuchtet das Gründerzeithaus aus verschiedenen Perspektiven. Was hat Sie persönlich dazu inspiriert, sich mit diesem Gebäudetyp so intensiv auseinanderzusetzen?
MS: Schon seit meiner Jugend begleitet mich dieser Baustil. Meine Schule war ein gründerzeitlicher Backsteinbau im Stil der Neogotik, mitten im Wald. Da mir der Unterricht oft langweilig erschien, begann ich, Gründerzeitvillen zu entwerfen. Bis zur Matura hatte ich 165 Entwürfe angefertigt. Meine Faszination für diese Epoche ist also langjährig und tief verwurzelt.
Wie unterscheiden sich die Bauweise und Materialqualität von Gründerzeithäusern im Vergleich zu späteren Wohnbauten des 20. Jahrhunderts?
Gründerzeithäuser wurden aus nachhaltigen und langlebigen Materialien errichtet. Ziegel und Bauholz – nahezu alle Baustoffe konnten aus der unmittelbaren Umgebung bezogen und verarbeitet werden. Damals setzte man auf bewährte Handwerkstechniken, während heute meist industrielle Bausysteme zum Einsatz kommen.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Restaurierung und Bewirtschaftung von Gründerzeithäusern, insbesondere im Hinblick auf moderne Wohnstandards und den Denkmalschutz?
Moderne Wohnstandards und Denkmalschutz lassen sich hervorragend miteinander vereinen. Entscheidend ist das Wissen um traditionelle Handwerkstechniken und Materialien. Mit diesem Know-how kann eine Restaurierung nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll umgesetzt werden.
Viele Gründerzeithäuser sind heute stark gefragt. Was macht sie Ihrer Meinung nach – abgesehen vom historischen Charme – für Bewohner so attraktiv? Gründerzeithäuser überzeugen durch hohe Räume und ein angenehmes Raumklima. Gerade die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns gezeigt, wie essenziell ein gesundes Wohnumfeld für unser Wohlbefinden ist.
Gibt es bestimmte architektonische Merkmale oder Gestaltungselemente der Gründerzeit, die besonders erhaltenswert sind, aber oft übersehen werden? Das wichtigste Element eines Gebäudes sind seine „Augen“ – die Fenster. Gründerzeithäuser verfügen über Holzkastenfenster, die nicht nur eine hervorragende Wärmedämmung bieten, sondern auch immer wieder repariert werden können. Meine eigenen Holz-

kastenfenster sind 164 Jahre alt – und noch lange nicht am Ende ihrer Lebensdauer angelangt.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Baupolitik in Wien in Bezug auf den Erhalt und die Nachverdichtung von Gründerzeithäusern?
Wenn wir historische Gebäude bewahren wollen, brauchen wir eine eigene „Umbauordnung“. Die bestehenden Bauvorschriften in Österreich sind primär auf Neubauten ausgelegt und berücksichtigen nicht die besonderen Qualitäten von Gründerzeithäusern.
Gibt es Beispiele für besonders gelungene Sanierungen oder Umnutzungen von Gründerzeithäusern, die als Vorbild für weitere Projekte dienen könnten?
Ja, zahlreiche! Einige davon stelle ich in meinem Buch vor. Besonders wichtig ist, dass bei Sanierungen nicht nur die äußere Struktur, sondern auch die historischen „Weichteile“ eines Gebäudes erhalten bleiben – dazu zählen etwa Türen, Fußböden und andere charakteristische Oberflächen.
Wie steht es um den ökologischen Aspekt dieser Gebäude? Sind Gründerzeithäuser nachhaltiger als moderne Neubauten?
„Graue Energie“ bezeichnet jene Energiemenge, die für die Herstellung von Baustoffen und die Errichtung eines Gebäudes aufgewendet wird. Je länger also ein Gebäude genutzt wird, desto besser verteilt sich sein Gesamtenergiebedarf – und genau das macht es nachhaltig. Gründerzeithäuser haben sich bewährt, sonst wären sie heute nicht mehr existent. Die meisten dieser Gebäude sind inzwischen mindestens 110 Jahre alt oder älter. Kennen Sie einen Neubau, der dieses Alter erreichen wird? Viele der heutigen Gebäude werden das lange Bestehen von Gründerzeithäusern wohl kaum erreichen.

Welche Rolle spielt der UNESCO-Welterbestatus Wiens für den Erhalt der Gründerzeitarchitektur?
Die Wiener Ringstraße mit ihrer einzigartigen Gründerzeitarchitektur war eines der entscheidenden Kriterien für die Verleihung des UNESCO-Welterbestatus an Wien. Doch es reicht nicht, sich nur auf diesen Status zu verlassen – wir alle sollten den Wert dieser historischen Bauten erkennen und aktiv zu ihrem Erhalt beitragen.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine städtebauliche Maßnahme in Wien umzusetzen, um das Erbe der Gründerzeithäuser besser zu schützen oder weiterzuentwickeln – was wäre Ihre erste Handlung?
Ich würde ein städtebauliches Prinzip aus der Gründerzeit wiederbeleben: Hochhäuser, die die Silhouette des Stadtzentrums prägen, sollten nur dann errichtet werden, wenn sie eine öffentliche und architektonisch prägende Funktion haben – wie einst Kirchtürme, Museumskuppeln oder ein neuer Rathausturm.
INFOBOX

Das Gründerzeithaus – Bewahren. Restaurieren. Bewirtschaften. Kral-Verlag, 374 Seiten
ISBN: 978-3-99103-008-9
€ 40,50
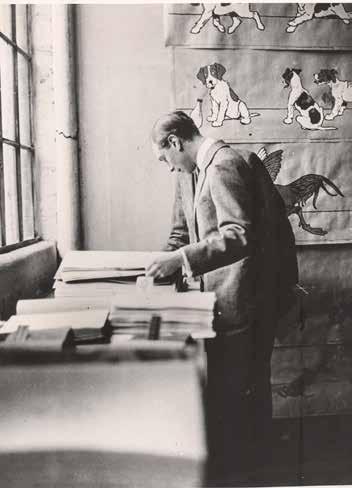
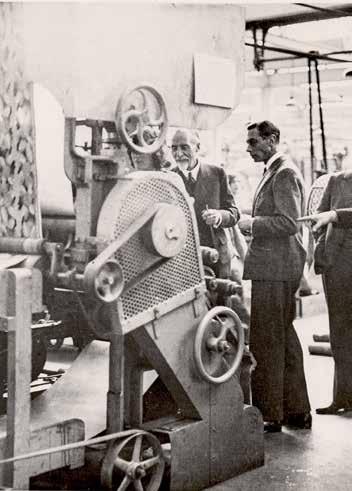
Seit einem Jahrhundert steht Sanderson für britische Handwerkskunst, zeitlose Eleganz und exzellente Qualität. Als einer der renommiertesten Hersteller von Stoffen und Tapeten darf das Traditionsunternehmen mit Stolz das Royal Warrant führen.
Dies ist eine Auszeichnung, die nur jene Unternehmen erhalten, die das britische Königshaus mit herausragenden Produkten beliefern. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums als königlicher Hoflieferant wirft das SCHLOSSSEITEN Magazin einen Blick auf die beeindruckende Geschichte, die neuesten Kollektionen sowie die Markenwelt der Sanderson Design Group unter der Leitung von CEO Lisa Montague.
Die Geschichte von Sanderson reicht bis ins Jahr 1860 zurück, als Arthur Sanderson das Unternehmen gründete. Bereits früh etablierte sich die Marke als Synonym für exquisite britische Tapeten und Stoffe. 1924 erhielt Sanderson erstmals den begehrten Royal Warrant – eine Anerkennung, die bis heute Bestand hat. Sogar König
Georg VI. besuchte die Produktionsstätten des Unternehmens und machte sich persönlich ein Bild von der einzigartigen Qualität.
Die Royal Warrants werden regelmäßig überprüft und nur Unternehmen verliehen, die höchste Standards in Qualität, Handwerkskunst und Service gewährleisten. Dass Sanderson dieses Prädikat auch unter König Charles III. erneut erhielt, unterstreicht das traditionsreiche Engagement für exzellente britische Designkultur.
Die neuesten Kollektionen: Tradition trifft Innovation. Zum feierlichen Anlass des 100-jährigen Jubiläums präsentiert Sanderson neue Kollektionen, die ihre Wurzeln in der britischen Landschaft und in der traditionsreichen Handwerkskunst haben.

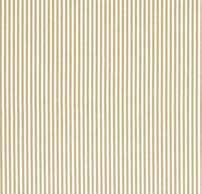

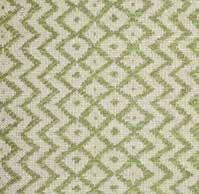
Country Woodland – eine Hommage an die Natur. Die neue Tapetenkollektion „Country Woodland“ ist von der Schönheit englischer Landschaften inspiriert. Sie verbindet klassische Muster wie Spaliere, Eichenblätter und Gingham-Karos mit modernen Akzenten. Designs wie „Tapestry Trees“ – eine Hommage an die üppigen Baumkronen – und „Tomato Leaf“ mit filigranen Zweigmusterungen verleihen jedem Raum eine natürliche Eleganz.
Rebecca Craig, Chefdesignerin von Sanderson, beschreibt die Kollektion als eine perfekte Symbiose aus Vergangenheit und Gegenwart: „Unsere Designs greifen traditionelle Motive auf und kombinieren sie mit mo-
dernen Elementen, um einen zeitlosen, aber frischen Look zu schaffen.“
Auch die Stoffkollektion „Orwell Weaves“ setzt auf naturnahe Farben und traditionelle Webtechniken. Inspiriert von Spaziergängen durch die britische Landschaft, bietet diese Kollektion klassische Streifen, Chevrons, Tupfen und Rauten in erdigen Tönen. Die Namensgebung erinnert an ikonische Orte Englands wie Burnham, Hinton oder Benwick.
Sanderson ist Teil der Sanderson Design Group, die mehrere exklusive Marken unter einem Dach vereint. Neben Sanderson selbst stehen Marken wie Morris & Co.,



TAPETE: Die Tapetenkollektion „Disney Home X Sanderson“ erweckt Vintage-Designs aus den Sanderson-Archiven zum Leben. Viele Designs wurden in der Original-Farbgebung wieder aufgelegt, die auch bei der historischen Zusammenarbeit zwischen Sanderson und Walt Disney verwendet wurde.
PÖLSTER: Immer ein Klassiker sind Pölster in Sanderson Klassiker-Stoffen, über Jahrzehnte in Gebrauch.

Harlequin und Zoffany für höchste Designqualität. Jede dieser Marken bringt ihre eigene Handschrift mit und bedient unterschiedlichste Stilrichtungen, von klassisch-britisch bis avantgardistisch-modern.
CEO Lisa Montague treibt die Marke mit einem klaren Fokus auf Heritage, Nachhaltigkeit und Innovation voran. Wir trafen sie in München beim Stofffrühling, wo sie uns in einem Gespräch erzählte, dass es ihr Ziel sei, „das Erbe britischen Designs zu bewahren, aber gleichzeitig moderne Trends aufzugreifen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu stellen“.
Sanderson ist bekannt für Kooperationen mit renommierten Designern und Künstlern. Jüngste Projekte umfassen Partnerschaften mit britischen Mode- und Interior-Design-Ikonen, die die traditionelle Ästhetik von Sanderson in moderne Kontexte setzen. Nachhaltigkeit bleibt dabei ein zentrales Thema: Umweltfreundliche Materialien, innovative Druckverfahren und ressourcenschonende Produktionstechniken sind fest in der Unternehmensphilosophie verankert.
Eine Kooperation, die bis zum Jahr 1930 zurückreicht, ist jene mit Disney. Damals wurde Sanderson mit der Produktion einer ersten Mickey-Mouse-Tapete beauftragt. 1930 besuchte auch der Herzog von York, der spätere König Georg VI. und Vater von Elisabeth II., die Produktionsstätte im englischen Uxbridge und warf einen Blick auf die damalige Kollektion. Mit der Tapeten-Kollektion „Disney Home X Sanderson“ lässt der englische Tapetenhersteller legendäre WaltDisney-Motive aus seinen Archiven wiederauferstehen. Die ikonischen Designs, die in wunderbaren Vintage-Farbgebungen umgesetzt wurden, holen die nostalgischen Fantasiewelten von Bambi, Mickey
LISA
MONTAGUE
CEO der Sanderson Design Group
„Die Designs vereint eine harmonische Balance zwischen Tradition und Moderne. Sie sind universell einsetzbar.“
Mouse, Donald Duck und vielen anderen DisneyCharakteren zurück an die Wand.
Die britische Traditionsmarke ist bekannt für ikonische florale und botanische Stoffe und Tapeten, die man nicht nur in britischen Adelshäusern, sondern hierzulande auch in Altbauwohnungen, Herrenhäusern, Landsitzen und Schlössern immer wieder vorfindet. Dies liegt natürlich an der Zeitlosigkeit, die diese Stoffe verbreiten. Besonders im Auge sollte man die Outdoor Collection von Morris & Co. behalten. Denn wir wissen alle: Ein schöner Garten ist Balsam für die Seele, und der Frühling verleitet zum Umdekorieren!
Text: Lisa Gasteiger-Rabenstein

SANDERSON DESIGN GROUP
Auf der Website findet man Händler in der Nähe: sanderson.sandersondesigngroup.com

Schachbrettboden, Kalkstein, geschliffen, 40 x 40 cm, angrenzend an ein Eichenparkett, angeräuchert, aus französischem Fischgrät, in einer Villa im Wiener Cottage-Viertel

Kalksteinboden „Levante Crema Rosa“, patiniert, 60 x 60 cm, im Foyer von Schloss Rotenturm im Burgenland
Edle Bodenbeläge verleihen Räumen Charakter, Beständigkeit und eine unverwechselbare Ausstrahlung. SCHUBERT STONE ist seit über 50 Jahren der Inbegriff für hochwertige Naturstein- und Bodenlösungen, die Tradition mit modernem Design vereinen. Insbesondere in historischen Gebäuden wie Schlössern, Palais oder Herrenhäusern spielen die richtigen Materialien eine entscheidende Rolle. Geschäftsführer Thomas Schubert gibt spannende Einblicke in die Philosophie des Unternehmens und in aktuelle Trends im Bereich exklusiver Bodenbeläge.
SCHUBERT STONE steht für herausragende Qualität und exklusives Design in der Welt der Boden- und Wandgestaltung. Was einst als Pionierarbeit mit Naturstein begann, hat sich über fünf Jahrzehnte zu einem führenden Anbieter für hochwertige Materialien entwickelt. Mit über 2.000 Materialsorten und einer 3.000 m² großen Ausstellung in Wien verbindet das Familienunternehmen traditionelle Handwerkskunst mit innovativen Gestaltungskonzepten. Qualität, Verlässlichkeit und Kundenorientierung stehen dabei stets im Mittelpunkt. Geschäftsführer Thomas Schubert gewährt uns spannende Einblicke in die Philosophie des Unternehmens und aktuelle Trends im Bereich exklusiver Bodenbeläge. Durch die persönliche Betreuung von anspruchsvol-
len Bauherr:innen und Architekt:innen kommt er seit Jahrzehnten immer wieder mit neuen Materialwünschen und Ideen in Verbindung. Durch die langjährigen Beziehungen zu seinen Lieferwerken im In- und Ausland agiert er stets am Puls der Zeit und kann schon früh beraten, bevor etwas überhaupt Trend ist. Gemeinsam mit seinem Design-Team werden regelmäßig weniger gefragte Materialien aus der Kollektion eliminiert und durch neue, edle Steine und Hölzer ersetzt. In einer eigenen Musterwerkstätte werden die umfangreichen Ausstellungsbereiche in der Werkhalle immer auf dem neuesten Stand gehalten. Aber das erzählt uns Thomas Schubert, Geschäftsführer von SCHUBERT STONE, der auf 30.000 realisierte Projekte zurückblicken kann, im Interview auf den kommenden Seiten selbst …

„Der Poolbereich verdient es, mit hochwertigem Stein gewürdigt zu werden.“
Thomas Schuster

Quarzit-Großplatten, poliert, für Poolrand, Poolwände und Poolboden, Kalkstein „Levante Crema feinrau“, 60 x 60 x 3 cm, im 1. Stock eines Stadtpalais in der Wiener Innenstadt

Ihr Unternehmen ist seit 1973 in Familienbesitz. Wie hat sich SCHUBERT STONE im Laufe der Jahre entwickelt? Und welche Werte stehen im Mittelpunkt Ihrer Unternehmensphilosophie? Meine Eltern gründeten 1973 gemeinsam das Unternehmen und verkauften als Vorreiter in Wien damals Porphyr-Naturstein und Solnhofener Kalkstein an private Bauherr:innen. Damals hatten sie die Musterplatten oft im Kofferraum und fuhren von Kunde zu Kunde oder legten sie in ihrem Privathaus zur Bemusterung auf. Im Jahr 1978 konnten sie aufgrund der ersten Geschäftserfolge den Standort in die Breitenfurter Straße im 23. Wiener Bezirk verlegen. Die anfangs angemieteten historischen Gebäude aus dem Jahr 1905 konnten nach einiger Zeit erworben werden, wodurch die gesamte Liegenschaft in den Besitz der Familie gelangte. Seitdem haben sich die Firma sowie die Ausstellung stetig voranentwickelt und das Sortiment wurde vor allem seit 1981 unter meiner Führung stark erweitert.
Von anfangs nur Naturstein in vielen Sorten und Varianten können Bauherr:innen mittlerweile auch hochwertigstes Feinsteinzeug, Wandfliesen, edle Holzböden, Terrakotta, Ziegelriemchen, Betonstein und viele andere Materialien bei uns erwerben. Daraus ergeben sich mannigfaltige Möglichkeiten in der Ausstattung von Immobilien mit hochwertigen Böden, Terrassen, Wänden, Fassaden, Mauern, Einfahrten, Wegen etc. Durch das materialübergreifende Sortiment auf einem Standort sparen unsere Kunden und Kundinnen wertvolle Zeit bei der Auswahl. Den Rundum-Service haben wir über die Jahrzehnte perfektioniert. Dank kompetenter Verlegeund Steinmetz-Partner können wir anspruchsvollste Projekte mit maßgefertigten Produkten umsetzen.
„Gemeinsam mit den Bauherr:innen erörtern wir, welche Einrichtung und welcher Stil in den verschiedenen Räumen geplant ist.“
Thomas Schubert
CEO & Projektkunden-Betreuung
Was bedeutet für Sie persönlich der Slogan „Timeless way of living“ und wie spiegelt sich dieser in Ihren Produkten wider?
Böden im Innenbereich sind die Unterlage für hochwertige Einrichtungen. Sie müssen Trends und Moden überdauern, optimal zum Gebäude passen und sowohl den aktuellen Bauherr:innen als auch den kommenden Generationen gefallen: zeitloses Lebensgefühl auf Schritt und Tritt. In Wohnräumen historischer Gebäude werden Böden eingesetzt, die es früher auch gegeben hätte: entweder Kalksteinböden, Terrakotta- oder Holzböden. Für Gewölbe oder sehr alte Gebäudeteile werden entweder antike Kalksteinplatten, benutzte originale alte Kalksteinböden oder Terrakotta-Böden aus dem Abbruch von Altgebäuden ausgewählt. Bei eleganten Räumen werden Kalksteinböden mit exakten Kanten und patinierter Oberfläche eingesetzt. Edle Holzböden bringen Behaglichkeit und Wärme in Wohn- und Esszimmer. Bei sehr historisch wirkenden Räumen werden häufig lange Schloss-Dielen von 4 bis 14 Meter Länge eingesetzt. Für große, elegante Räume bietet sich Tafelparkett in seinen vielen Varianten oder auch ein großer Fischgrätparkett mit einem Fries rundherum an. In Bädern historischer Gebäude können neben Kalkstein- und Marmorplatten auch dezente und zeitlose Feinsteinzeug-Großplatten zur Anwendung kommen, die nahezu fugenlos raumhoch verlegt werden. Diese robusten und porenfreien Platten sind besonders widerstandsfähig gegen Flecken, Chemikalien und aggressive Reinigungsmittel und bleiben durch den minimalen Fugenanteil lange schön.
Gibt es ein Schloss oder ein historisches Gebäude, an dessen Sanierung Sie mitgewirkt haben und das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Auf der Terrasse eines Wiener Stadtpalais im ersten Bezirk war ein Pool mit hellblauen-hellgrünen Steinplatten geplant. Wir haben dann aus mehreren Quarzitblöcken einen passenden, sehr edlen Stein ausgewählt und dem Bauherrn vorgeschlagen. Danach haben wir aus den 2 cm starken Platten durch Gehrungsschnitte mit verklebter Blende die Kanten optisch stärker gemacht und im Anschluss gebogen, gefräst und poliert. Gemeinsam mit unserem Werkstätten- und Verlegepartner wurden große Platten nach Maß im gesamten Pool, auf den Stufen und am Poolrand verlegt.

Tafelparkett aus angeräucherter Eiche nach historischem Vorbild, auf die Raumgröße nach Maß produziert für ein Vorstadtschlössel im Westen von Wien
Welche aktuellen Trends beobachten Sie im Bereich hochwertiger Bodenbeläge und wie reagieren Sie darauf?
Der Trend in Wohnräumen historischer Gebäude geht zu zeitlosen, gemütlichen, hochwertigen Holzböden oder edlen, repräsentativen und strapazierfähigen Kalksteinböden, die gleichermaßen im Laufe der Jahrzehnte eine Patina durch die Benutzung bekommen. Auf Terrassen werden überwiegend edle Kalksteine und Dolomite mit rutschfester Oberfläche verlegt. Bei manchen Objekten kommen absolut frostbeständige, robuste und wie Naturstein aussehende Feinsteinzeug-Platten zum Einsatz. Bei Hauszufahrten und Carports werden gerne historische, benutzte Pflastersteine aus dem alten Wien angewendet, als Baustoffrecycling und für ein authentisches Erscheinungsbild. Wir haben unsere Kollektionen durch europaweites Material-Scouting bei unseren über 100 Lieferanten in unseren weitläufigen Ausstellungsbereichen im Innenund Außenbereich stark ausgeweitet und komplettiert, um den verschiedenen Wünschen und Ansprüchen der Bauherr:innen historischer Gebäude gerecht zu werden. Wir empfehlen in den meisten Fällen zum Stil des Projektes passende, zeitlose Böden, die es schon gegeben hatte, als die Gebäude errichtet wurden.
Mit über 30.000 realisierten Projekten haben Sie eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Können Sie einige Ihrer bemerkenswertesten Projekte oder Kooperationen hervorheben?
Der Besitzer von Schloss Rotenturm kam zu einem Termin zu mir, um den passenden Boden für sein Schloss mit einer kräftig rosafarbenen Fassade auszuwählen. Er hat zielsicher zu unserem beige-rosa Hartkalkstein „Levante Crema Rosa“ gegriffen und bat mich um einen stärkeren Anteil der rosa Farbe in den zu liefernden Steinplatten. Wir haben mit unserem Lieferwerk gemeinsam besonders passende Blöcke gefunden und die 400 m² Bodenplatten in einer sehr harmonischen Farbgebung geliefert. Oder ein anderes Beispiel: In einer Villa im Wiener Cottage-Viertel war ein dezenter Schachbrettboden aus grauen und beigen Kalksteinen gewünscht. Da die Böden aus zwei verschiedenen Lieferwerken in unterschiedlichen Größen geliefert wurden, mussten alle Platten mit Wasserstrahl auf das exakte Maß von 40 x 40 cm geschnitten werden.
Welche Rolle spielt die Handwerkskunst bei der Aufbereitung und Anpassung von Naturstein für historische Gebäude?
Bei manchen antiken Kalksteinen werden die Kanten

Originale historische Kalksteinplatten aus Abbruchhäusern, 300 Jahre benutzt, in unregelmäßigen, zufälligen Plattengrößen, in einem historischen Landanwesen in der Steiermark

„Levante Crema antik“, 40 x 60 x 3 cm, Platten im Arkadengang des Barockschlosses Schloss Hof in Niederösterreich

Originale abgefahrene alte Pflastersteine aus dem alten Wien aus der Zeit des Wiener Kongresses (um 1815), auf die Hälfte gespalten, im Innenhof eines Landanwesens in der Steiermark

Marmor-Intarsien-Boden in einem Wiener Stadtpalais, mit Wasserstrahl in der Werkstätte vorgeschnitten, in Modulen verklebt und in den Räumen nach der Verlegung plan geschliffen und poliert

Kalksteinboden antik, in Bahnen, 35 x 35/60 x 1 cm, in einem Vorstadtschlössel im Westen von Wien
per Hand behauen und die Oberfläche unregelmäßig mit Handwerkzeugen bearbeitet, um Benutzungsspuren von Jahrhunderten zu interpretieren und die Böden von Anfang an so aussehen zu lassen, als ob sie schon viele Jahrzehnte benutzt worden wären. Dann werden sie im Laufe der nächsten hundert Jahre durch die Patina, die sie bekommen, immer schöner. Bei originalen alten Kalksteinböden müssen durch geschickte und versierte Verleger die passenden Platten zueinander aussortiert und durch Behauen angepasst werden.
Stundenlang könnte man sich mit Thomas Schubert über die Möglichkeiten der Bodenverlegung unterhalten – er verfügt über ein Gespür, wie man es nur selten findet. Und das Schöne, wenn wir es so nennen dürfen: Er besitzt wirklich einen ausgezeichneten Geschmack. Wer es nicht bis nach Wien schafft, kann die Möglichkeit eines Videocalls nutzen – man geht schließlich mit der Zeit, auch wenn viele der Steine schon 300 Jahre alt sind.
INFOBOX

SCHUBERT STONE GmbH
Breitenfurter Straße 249, 1230 Wien Mo.–Fr. 10–17 Uhr, Sa. 9–13 Uhr
Inspiration & Online-Terminbuchung www.schubertstone.com





Stilvolle Eigentumswohnungen mit ca. 42 bis zu ca. 137m2
Das mondäne Leben am See Velden am Wörthersee spielt gerne alle seine Trümpfe aus. Neben der malerischen Lage am wohl schönsten See Österreichs punktet der beliebte Urlaubsort auch als exklusiver Wohnort. Hier finden Sie alles, was Sie für den Alltag brauchen – und noch viel mehr. Spannende Veranstaltungen, beeindruckende Events und ein Zuhause in ruhiger Umgebung verbinden das mondäne Leben am See mit Ihrem privaten Rückzugsort.
Das Quartett – Luxus und Komfort in Velden
Wenn Sie sich ein bisschen mehr Luxus in Ihrem Alltag wünschen, wird “Das Quartett” Sie begeistern. In der 10.-Oktober-Straße 16 entstehen in vier modernen Villen stilvolle Eigentumswohnungen, die in Sachen Lebensfreude und Komfort neue Maßstäbe setzen. Entdecken Sie lichtdurchflutete Räume, attraktive Außenflächen und eine Top-Ruhelage – kombiniert mit einem exklusiven privaten Seezugang und Badehaus.
Gönnen Sie sich diesen Luxus und machen Sie Das Quartett zu Ihrem neuen Zuhause – dort, wo mondänes Leben am See auf exklusiven Wohnkomfort trifft.

RGB Bauträger GmbH Schleppe-Platz 8 9020 Klagenfurt / Wörthersee
KONTAKT
Telefon: +43 463 444 033 33
E-Mail: verkauf@riedergarten.at
Webseite: riedergarten.at


Wasserspiele, Schloss-Weiher, Fürstentisch
Er hatte Spaß, so viel steht fest. Seine Gäste auch: „Man lässt sich nicht ohne Freude und Vergnügen beleidigen und muss trotz der Unhöflichkeit lachen“, schrieb etwa D. Gisberti im Jahre 1670. Viele lachende Gesichter sieht man noch heute rund um Schloss Hellbrunn.
Markus Sittikus von Hohenems war ein Lebemensch und eine prägende Persönlichkeit für Salzburg; zwischen 1612 und 1615 erbaute er seinen Landsitz Schloss Hellbrunn. Nicht, um Macht oder Recht auszuüben, sondern zum Jagen und der Lust wegen. Lustschlösser waren um 1615 groß in Mode, doch dieses ist einzigartig, und das war so gewollt.
Sittikus wollte einen Ort erschaffen, den es so noch nie gegeben hatte. Dabei ging es nicht so sehr um Pracht
und Größe als um Fantasie, Originalität, Einfallsreichtum und Lust am Spiel. Die berühmten Hellbrunner Wasserspiele sind potenzierter Manierismus und ein wahres Spektakel, das heute noch so erlebt werden kann wie vor über 400 Jahren: Mystische Grotten, von Wasserkraft angetriebene Figuren und tückische Wasserstrahlen überraschen die Gäste, fabelhafte Wesen und Sinnestäuschungen versetzen in Erstaunen. Im Brunnen der Neptungrotte wartet das Germaul, eine blecherne, wasserbetriebene Fratze, die ihre Augen rollt und dem Betrachter respektlos die Zunge raus-

Aktaion, Nahaufnahme
beeindruckt mit Wänden voller Fantasieund Fabelwesen …
streckt. In der Venusgrotte tritt Venus auf den Kopf eines Delfins, aus dessen Mund ein Wasserstrom quillt, der sich dann glockenförmig über einen Blumenstrauß ergießt. In der Vogelsanggrotte ertönen aus etlichen Nischen der Tuffverkleidung überraschend verschiedene Vogelstimmen, und das ganz ohne Abspielgerät. Markus Sittikus trieb Schabernack mit seinen Gästen. Er erstaunte und unterhielt sie, führte sie an der Nase herum. Aus versteckten Düsen ergießt sich ein plötzlicher Platzregen, Wasser spritzt aus Wandnischen hervor, Güsse aus dem Boden versperren den Weg. Sogar aus den steinernen Hockern, auf denen die Gäs-

Schlossausstellung Oktogon
te saßen, konnte es der Gastgeber bei Bedarf spritzen lassen. Ein manieristisches Spielzeug für große Kinder, und doch mehr: ein einzigartiges Kulturjuwel sowie eine technische Meisterleistung.
Das zeigt auch die interaktive Dauerausstellung „SchauLust – Die unerwartete Welt des Markus Sittikus“ im Schloss. Das Innere des Schlosses beeindruckt mit Wänden voller Fantasie- und Fabelwesen, illusionistischen Architekturmalereien, Fresken und prächtigen Kachelöfen. In manchen Räumen können heute noch Feste gefeiert werden.
Der Hellbrunner Schlosspark ist zugleich ein naturbelassenes Biotop, 60 Hektar groß, mit Kinderspielplatz, Wasserwundergarten, Sportparcours und im Winter bei ausreichend Schnee gespurten Loipen. Die verschwenderisch anmutende Naturpracht von Menschenhand geht sanft in die Bergwelt der Alpen über.
Der Weg über den Hellbrunner Berg, vorbei am Steintheater und am Watzmannblick, führt die Besucher zum

Monatsschlössl, um das sich viele Geschichten ranken. Heutzutage beheimatet es das Volkskundemuseum. Von dort aus hat man einen wunderschönen Blick über die gesamte Anlage. Wer noch Zeit hat, kann einen Abstecher zum weltberühmten „Sound of Music“-Pavillon im Schlosspark machen. Die Originalkulisse aus dem Film von 1965 zieht jedes Jahr Tausende Besucher an.
Zum Verweilen laden neben den Parkbänken rund um das Wasserparterre im historischen Teil der Schlossanlage auch das Parkcafé sowie das Gasthaus zu Hellbrunn ein. Die beiden gastronomischen Betriebe warten mit schönen Gastgärten und einem umfangreichen kulinarischen Angebot auf.
Aber Schloss Hellbrunn bietet noch mehr. Für Feiern jeglicher Art bildet es eine einzigartige Kulisse, egal ob im kleinen Kreis eines Business-Meetings, für den runden Geburtstag, die Hochzeit oder den besonderen Firmenevent. Tauchen Sie mit Ihren Gästen in die einzigartige Welt ab und lassen Sie sich verzaubern. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Gästen oder Businesspartnern im Rahmen einer Exklusivführung durch die Wasserspiele und bei einem besonderen Abschluss am Fürstentisch einen ganz besonderen Abend zu bereiten. Es besteht auch die Möglichkeit,
dem hektischen Treiben des Marmorsaales im Schloss Mirabell zu entfliehen und in ruhiger Atmosphäre im Schlosspark oder in den Schlossräumlichkeiten standesamtlich zu heiraten. Für weitere Fragen bezüglich einer Veranstaltung steht Ihnen das Team jederzeit gerne zur Verfügung.

Schloss Hellbrunn
Fürstenweg 37, 5020 Salzburg (etwa 8 km südlich von Salzburgs Zentrum gelegen) Tel.: +43 662 820372-0
E-Mail: info@hellbrunn.at www.hellbrunn.at
NEU ab April 2025
OUTDOOR PADEL TENNIS COURT
INDOOR SALZ SANDKISTE

ADULTS ONLY
In unserem Dach-Spa genießen Erwachsene Momente der Ruhe.


















SUMMER FEELING





KINDERPROGRAMM



















Täglich ganze 11 Stunden Spiel, Spaß und Spannung.


















Erleben Sie einen unvergesslichen Sommerurlaub voller Abenteuer, Spaß und Erholung!


Im Urlaub schmeckt’s am Besten!





WASSERWELT













Actionfans genießen unsere große Indoor Rutschenanlage.












19. Juni – 20. Juli 2025
Den Klängen und ihrer Geschichte Raum geben: Kaum ein Festival tut das so leidenschaftlich wie die Styriarte, die steirischen Festspiele in und um Graz. Seit 40 Jahren locken ihre Konzerte Menschen von nah und fern, weil sich hier der Zauber der Musik mit den fantastischen Räumen der steirischen Hauptstadt verbindet. Rund um Graz, in den Landschaften der Steiermark, entdeckt das Festival einen „Lebensraumklang“ von unverwechselbarer Eigenart.
elchen Glanz entfalten die großartigen Räume aus Mittelalter, Renaissance und Barock, wenn unter ihren Gewölben die passende Musik erklingt! Vor 400 Jahren begann der Ausbau von Schloss Eggenberg zur Musterresidenz. Zum Jubiläum erzählt die Styriarte Geschichten aus dem steirischen Escorial, der 2025 auch die Steiermark-Schau des Landes beherbergt. Das reicht vom intimen Lautenabend über den „Kastraten aus Eggenberg“ bis zur Barockoper. Auch im Mausoleum und in der Grazer Burg finden sich Räume, die das Festival restlos mit Klang erfüllt. Seit mehr als 100 Jahren zählt der Grazer Stefaniensaal zu den schönsten Konzertsälen der Welt. Wie er seinerzeit anno 1908 mit Beethovens Neunter neu eröffnet wurde, wird im Festival 2025 neu erlebbar.
In der Helmut List Halle mit ihrer vorzüglichen Akustik findet das Festival eine unendlich flexible Raum-
Klang-Spielfläche: einmal zeitgenössisch experimentell, ein andermal im Luxus-Klang der Alten Musik. Wenn Eddie Luis die Größen des Austropop zitiert oder Elisabeth Fuchs dem legendären Freddie Mercury sinfonischen Tribut zollt, erreicht der Raumklang hier seine maximale Ausdehnung. Noch höher hinaus wollen nur Mei-Ann Chen und das Styriarte Youth Orchestra, wenn sie in die unendlichen Weiten des Weltraums abheben, oder Jordi Savall, der mit seinen Klangpanoramen zutiefst überzeugt.
Styriarte-Kartenbüro: Sackstraße 17, 8010 Graz Tel.: 0316 825000 tickets@styriarte.com styriarte.com regiongraz.at

Wie aufregend, wie vielfältig, wie schön sind die Räume, die Graz und die Steiermark für klangvolle Erlebnisse zu bieten haben. Die steirischen Festspiele Styriarte verschreiben sich vom 19. Juni bis zum 20. Juli 2025 unter dem Motto „RAUM&KLANG“ der Erkundung dieser großartigen Räume durch Weltstars der Klassik.


ls Plattform und Bühne für kreatives Handwerk gehört das Heimatwerk zu Salzburgs beliebtesten Trachtenadressen. In den eindrucksvollen, neu renovierten Räumlichkeiten am Residenzplatz direkt unter dem Glockenspiel sind nicht nur die schönsten Stoffe und Trachten beheimatet, sondern auch die hauseigene Schneiderei und das Know-how um die Kulturgeschichte dahinter. Tracht ist mehr als nur traditionelle Kleidung – sie ist lebendiges Zeugnis kultureller Identität, Handwerkskunst und regionaler Vielfalt. Und besonders jetzt im Frühling ein frischer Ausdruck von Lebensfreude. In der hauseigenen Maßschneiderei werden neben regionalen Trachten auch edle Hochzeits- und Festdirndln gefertigt und entstehen kunstvolle Unikate. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich von der aktuellen Kollektion verzaubern.
Veranstaltungstipp – „Dirndl meets Hollywood“ Sommerausstellung anlässlich des 60-Jahre-Jubiläums von „The Sound of Music“, von 3.7. bis 6.9.2025
INFOBOX

Salzburger Heimatwerk Residenzplatz 9, 5010 Salzburg +43 662 844110 salzburgerheimatwerk.at



Die Weite des Traunsees, seine unergründliche grünschwarze Tiefe, sanfte Hügel, schroffe, ins Wasser stürzende Felswände, das zauberhafte Seeschloss Ort, das geheimnisvolle Kloster Traunkirchen – und Gmunden, die behagliche Stadt mit ihrem mediterranen Flair, in deren verwinkelten Gassen der See zwar nicht immer sicht-,
Stillen Sie diese Sehnsucht und genießen Sie die Faszination des Wassers bei einer Schifffahrt auf dem Traunsee!


finden das
Für Reiseveranstalter werden sieben attraktive Gruppenfahrten ab 30 Personen angeboten.

Für besondere Anlässe (Hochzeiten, Firmenfeiern, etc.) kann jedes Schiff auch individuell gechartert werden.

Oberösterreich PLACES TO GO
Lensing Mode Bad Ischl zählt zu den größten und traditionsreichsten Mode- und Trachtenhäusern im Salzkammergut. Mit Liebe und Charme geführt von Cosima Lensing und ihren Töchtern – sie selbst eine GoldhaubenTrägerin –, verbindet das Geschäft alte Werte mit tragbarer, moderner Mode. Exklusive Marken wie Oui, Max Mara Weekend oder Wenger Trachten sowie elegante, sportive Alltagskleidung und Trachten für Damen und Herren gehören zum Sortiment. Seit diesem Jahr wird eine eigene Dirndlkollektion umgesetzt, die nur im Geschäft erhältlich ist. Alte Hüte gibt es hier nicht – dafür jedoch stilvolle Kopfbedeckungen, klassisch und modern, die unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Ischler Traditionsunternehmen Bittner entstehen.
Bei einem Spaziergang durch Bad Ischl sollte man unbedingt vorbeischauen und sich gleich für den Urlaub im Salzkammergut einkleiden.
INFOBOX
C. Lensing Mode
Auböckplatz 12, 4820 Bad Ischl +43 664 5407417 www.lensing-mode.com



Wenn der Frühling in Bad Ischl Einzug hält, verwandelt sich die charmante Kaiserstadt in ein blühendes Paradies. Ein Spaziergang durch den Kaiserpark oder auf der Katrin-Alm verspricht atemberaubende Ausblicke auf die erwachende Natur des Salzkammerguts. In den traditionsreichen Kaffeehäusern genießt man die ersten Sonnenstrahlen bei einer Tasse Kaffee, während die Vögel zwitschernd den Frühling begrüßen. Bad Ischl erblüht – eine Einladung zum Genießen und Entdecken!
Frühlingshighlights 2025
• Ausstellungen in den Kaiserlichen Stallungen
• Operettensalon
• Jodelkurse auf der Katrin
• Mariensingen in der Wallfahrtskirche Lauffen
• „Aufg‘spüt“ mit Peter Gillesberger
• Kaiservilla & -park
• Weindorf
• Stadtfest Bad Ischl
• Bad Ischler Kurkonzerte



Zu allen Veranstaltungen geht es hier lang



Salzburg PLACES TO GO

Der Partner für maßgeschneiderte Einrichtungslösungen
Ein Zuhause sollte mehr sein als nur ein Ort –es ist ein persönlicher Rückzugsort, der Geborgenheit und Stil vereint. Gehmacher in Salzburg verbindet Tradition mit Innovation und schafft individuelle Einrichtungskonzepte, die Wohnträume wahr werden lassen.
Ob ein neues Sofa, ein gemütlicher Sessel oder stilvolle Accessoires – jedes Detail trägt dazu bei, Räume mit Charakter und Atmosphäre zu füllen. Die Experten von Gehmacher begleiten von der ersten Inspiration bis hin zur vollständigen Umsetzung. Wer sich eine ganzheitliche Veränderung wünscht, erhält Unterstützung bei der Farb- und Materialwahl sowie bei der Planung und Neugestaltung von Wohn- und Schlafräumen.
Für umfassendere Projekte wie Küchen- oder Badumbauten steht mit Innenarchitektin Selina Binder ein
kompetentes Team zur Seite. Auch Grundriss- und Elektroplanungen werden individuell auf Bedürfnisse und Stil abgestimmt.
Gehmacher kreiert Wohnwelten für Wohnungen, Häuser, Ferienunterkünfte und Hotels – stets mit dem Ziel, ein harmonisches und behagliches Ambiente zu schaffen. Ein Besuch im Store in Salzburg inspiriert dazu, das eigene Zuhause in eine Wohlfühloase zu verwandeln.
INFOBOX
GEHMACHER
Home & Outdoor & Lifestyle
Alter Markt 2 5020 Salzburg +43 662 845506 home@gehmacher.at www.gehmacher.at

Oberösterreich PLACES TO GO
Das Glück des Wohlfühlens finden Sie mitten in Bad Ischl, bei uns im Goldenen Ochsen, direkt an der Traun gelegen. Ankommen, tief durchatmen und sich Zeit nehmen – als Paar, mit Freunden oder für eine wohlverdiente Me-Time. Das kleine Kaiserstädtchen bietet allerlei Sehenswertes, Abwechslungs- sowie Unterhaltungsreiches, und der Goldene Ochs ist der ideale Ausgangspunkt – zum Flanieren und Genießen. Entschleunigung, um den Gedanken freien Lauf zu lassen, und Weitblick, um Kraft zu schöpfen, finden alle unsere Gäste in der nächsten Umgebung.
Wie wär’s einmal mit süßem Nichtstun? Da sind Sie im Goldenen Ochsen genau richtig – einfach treiben lassen in unserem weitläufigen Wellnessbereich, tauchen Sie ins warme, mit klarem Bergquellwasser gefüllte Schwimmbad ein oder nützen Sie unsere Saunen, Massagen u. v. m. Sie können auch auf einer gemütlichen Liege in unserem Garten ihr Lieblingsbuch genießen. Das alles nach einem relaxten, reichhaltigen Frühstück
vom Buffet, das sie in unserem Wintergarten oder auf der Terrasse einnehmen. Sollten Sie am Abend Lust auf typische, traditionelle österreichische Küche haben, erwarten wir Sie gerne in unseren Restaurantstuben oder auf der Terrasse im Traungartl direkt am Wasser und verwöhnen Sie mit regionaler Speisenauswahl.

INFOBOX
Hotel Goldener Ochs
Griesgasse 1, 4820 Bad Ischl +43 6132 23529
office@goldenerochs.at www.goldenerochs.at
Ein Likörchen in Ehren kann keiner verwehren – aber eventuell sollte man die Zeit nicht aus den Augen lassen, denn gerade am See ist die Sonne schnell intensiv. Deshalb, Ladies and Gentlemen, Skincare nicht vergessen. Prost!









1. IKAT ist Trumpf, das weiß auch nataliedemblindesign.com und hat eine eigene Ikat-Kollektion designt, Kleid „Lavinia“, um € 189 | 2. Die Haut schützen mit THE SUN KISS, um € 36, und dann verwöhnen mit THE SKIN OIL, um € 45 (von der Münchner Marke cosmenia.de) | 3. Cool kombiniert mit der Trachtenjoppe von POLDI, von lodenfrey.com, um € 629 | 4. Die Zeit nicht übersehen mit der „Seamaster Aqua Terra Shades 34 mm“, von omegawatches.com, um € 7.300 | 5. Marillenlikör, pur genießen, zur Verfeinerung diverser Desserts oder im Kaffee für den perfekten Biedermeier-Kaffee, von meinlamgraben.eu, um € 24,99 | 6. Mundgeblasenes Glas, macht Lust auf mehr, von dolcegabbana.com, um € 185 | 7. Buntes Strandtuch, aus 100 % Baumwolle, 100 x 150 cm, bei ikea.com, um € 12,99 | 8. Wohin mit den Kleinigkeiten? – Am besten in die Unisex Tasche „Positano“, aus hochwertigem geprägtem Leder. Und falls die Farbe nicht gefällt – es gibt noch 14 andere, bei rhorns.com, um € 455
Exklusiv schenken,

MEINLS GESCHENKKÖRBE
Julius Meinl am Graben, Graben 19, 1010 Wien, meinlamgraben.eu Mo-Fr 08:00-19:30 Uhr, Sa 09:00-18:00 Uhr
Jetzt online bestellen!



130 Jahre Eleganz und Erholung: Das Kvarner Palace erstrahlt in neuem Glanz.
Eine Hommage an die Vergangenheit – eine Vision für die Zukunft. Seit über einem Jahrhundert ist das Kvarner Palace ein Ort des Wohlbefindens und der Erholung. Mit Respekt vor seiner glanzvollen Geschichte und einer klaren Vision für die Zukunft etabliert sich das Hotel erneut als Juwel an der Crikvenica Riviera – eine perfekte Symbiose aus Tradition, Innovation und luxuriösem Lebensgefühl. Inmitten des heilklimatischen Kurorts Crikvenica, mit einem majestätischen Blick auf die Kvarner Bucht, feiert das traditionsreiche Kvarner Palace ein besonderes Jubiläum: 130 Jahre Hotelgeschichte, geprägt von Eleganz, Erholung und gesundheitsfördernder Atmosphäre. Zum Saisonauftakt am 9. April 2025 erwartet die Gäste eine beeindruckende Neuerung: eine moderne, weitläufige Poollandschaft, die luxuriösen Komfort mit historischem Charme verbindet.
Ein Palasthotel mit Geschichte und Vision Einst als „Hotel Erzherzog Josef“ im Jahr 1895 im prachtvollen Stil der Belle Époque erbaut, diente das Haus bereits zu Zeiten der österreichisch-un-
garischen Monarchie als exklusive Rückzugsoase für anspruchsvolle Gäste. Mit der Ernennung Crikvenicas zum offiziellen Luftkurort im Jahr 1906 avancierte das Hotel zu einer der ersten Adressen für Gesundheitsund Badetourismus. Heute führt die Salzburger Hoteliersfamilie Holleis diese Tradition fort und entwickelt das Kvarner Palace kontinuierlich zur führenden Wellness- und Regenerationsdestination der Region.

Die Zimmer sind im Belle-Époque-Stil gestaltet.

Kulinarisch verwöhnt Küchenchef Danijel Ljubijankić mit besten regionalen Produkten und frischen Fischen aus der Adria, die die Gäste hier genießen dürfen. Besonders hervorzuheben: die berühmten Kvarner Scampi, die für ihre außergewöhnliche Qualität geschätzt werden.
Luxus trifft auf mediterrane Natur
Der 30.000 m² große, üppige Park des Hotels bildet die perfekte Kulisse für Entspannung und Genuss. Die neu gestaltete, in den eleganten Neubauflügel integrierte Poollandschaft umfasst einen 25 Meter langen, beheizten Meerwasserpool mit Innen- und Außenbereich sowie großzügige Liegeflächen. Hier verschmelzen stilvolle Architektur und der atemberaubende Ausblick auf das azurblaue Meer zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Der „Kvarner Effekt“ –natürliche Heilkräfte für Körper und Geist
Bis 2026 wird sich das Wohlfühlangebot um einen 2.500 m² großen Wellnessbereich mit Saunalandschaft, Event-Sauna, Warmbädern, Behandlungs- und Ruheräumen sowie einer großzügigen Sonnenterrasse erweitern. Mit diesem visionären Ausbau setzt Hotelier Wilfried Holleis neue Maßstäbe in Sachen Wellness, Regeneration und Gesundheitsvorsorge an der Crikvenica Riviera. Die Magie des Kvarner Palace geht
weit über seine beeindruckende Architektur hinaus: Das besondere Mikroklima, die salzhaltige Meeresluft sowie die reiche Pflanzenwelt der Region entfalten nachweislich positive Effekte auf die Gesundheit. Unter dem Begriff „Kvarner Effekt“ bekannt, können Atemwegserkrankungen, Rheuma und Hautprobleme durch den bloßen Aufenthalt in dieser einzigartigen Umgebung gelindert werden.

Hotel Kvarner Palace
Ul. Braće Dr. Sobol 1, 51260 Crikvenica, Kroatien Tel.: +385 51 38 00 00 | hotel@kvarnerpalace.info www.kvarnerpalace.info
Das abwechslungsreiche Programm der Kunst & Kulinarik Festspiele Golling aus Schauspiel, Gesang und Musik verspricht auch im kommenden Sommer grandiose, mitreißende und zauberhafte Festspiel-Momente. Diese bunte Veranstaltungsvielfalt wird stets von kulinarischen Höhenflügen in Döllerers Wirtshaus und Restaurant begleitet, welche die Festspiele auf der Burg Golling so besonders machen.
Freuen Sie sich in diesem Jahr auf 20 Veranstaltungen, bei denen u. a. hochkarätige SchauspielerInnen wie Erwin Steinhauer, Fritz Karl und Birgit Minichmayr ebenso auftreten werden wie der amtierende Jedermann Philipp Hochmair und Opernstar Natalia Ushakova!


KARTENVERKAUF sowie KUNST- & KULINARIK-ANGEBOTE
Online: www.festspielegolling.at/karten oder zu den Öffnungszeiten im Kartenbüro der Festspiele Golling kartenbuero@doellerer.at T: +43 (0)6244 4220 159
Festspiele Golling festspiele_golling




Dienstag, 15. Juli 2025 20.00 Uhr ERIKA PLUHAR
I GIB’ NET AUF –Zum 86. Geburtstag
Die Texte und Lieder von Publikumsliebling Erika Pluhar zur Zeit und zum Leben werden vom Pianisten Roland Guggenbichler musikalisch gekonnt untermalt. Freuen Sie sich auf einen Abend zwischen Ernst & Humor, Anspruch & Übermut!
Sonntag, 3. August 2025 20.00 Uhr
FLORIAN SCHEUBA & ENSEMBLE SALZBURG-WIEN
RUSSISCHE KLASSIK STATT
RUSSIA TODAY
Kabarettist Florian Scheuba und das Ensemble Salzburg-Wien unter dem Primgeiger der Wiener Philharmoniker Martin Kubik präsentieren ein einzigartiges Programm, bei dem humorvolle Spitzen gegen Fake News & Propaganda auf Haydn & Beethoven treffen.

In den Wäldern der Wachau

Die Danube Private University (DPU) verbindet Wissenschaft, Forschung und Lehre in der Medizin und Zahnmedizin mit einem humanistischen Leitbild. Stefanie Arco-Zinneberg, MA, begab sich auf einen philosophischen Spaziergang durch die Natur und spannte einen Bogen zu medizinischen Fragestellungen.
Die Morgensonne erwachte. Ich brach in den Wald auf. Seine Düfte beflügelten mich. Die Reflexionen des Lichts erleuchteten meinen Geist. Reine Luft durchströmte meine Lungen. Erst mäandernde Wege über Wurzeln und knisterndes Eichenlaub, wie Meridiane, dann ein Korridor, der Weg wurde klarer und mein Gang mit jedem Schritt aufrechter. Ich breitete meine Arme weit aus, als ich am Himmel einen Falken erblickte. Intuitiv folgte ich ihm, fasziniert von seiner Freiheit, mit mir verbunden zu sein. Zu meiner Rechten mein Schimmel, der es vermochte, Sanftheit, Stärke und Kraft zu vereinen. Ein treuer Begleiter der Reisenden in andere Dimensionen. Ein harmonischer Dreiklang in Synchronität zwischen Himmel und Erde. Alle Sinne waren wach, als würde das Leben selbst alle notwendigen Signale senden und sich in Wahrhaftigkeit offenbaren.
Ich erreichte eine Quelle, erinnerte König Artus und sein Camelot, das er als primus inter pares regierte. Sein Reich erschien mir in einer Matrix: Einer makrophysikalischen Welt, in der Strategien conditio sine qua non für das Britannien des 5. Jahrhunderts, zum Ende der römischen Herrschaft, durch die zwölf Ritter der Tafelrunde, gelebt wurden. Camelot präsentierte sich in dynamischer Pro-Aktion männlicher Attribute, in wörtlicher Bedeutung des Kreises als Symbol der Unendlichkeit. All dies bis zu einer Nebelwand nach Avalon!
In Avalon wurde das Heiligtum der Kelten bewahrt. Es implizierte eine stigmatisierte Bewahrung weiblicher Attribute und stand in wörtlicher Bedeutung des Apfels als Symbol des Paradieses. Die Hohepriesterin führte hier charismatisch und transformativ eine Zwischenwelt, die sich für systemischen Ausgleich, eine
Harmonisierung des Seins, auch in Verknüpfung von Koinzidenzen, sinngemäßen Querverbindungen und akausalen Zusammenhängen auszeichnete und nur für Auserwählte zugelassen war. Sie hütete den Gral.
Das Fortbestehen beider Welten, Camelots und Avalons, bedingte sich gegenseitig, was eine gewisse Zerrissenheit aufwarf und die notwendige Transzendenz von Ratio und Empfindsamkeit als existenziell postulierte. Avalon war die Reminiszenz an archaische Werte in Personifikation der Hohepriesterin, welche an die TugendenLiebe, Glaube, Hoffnung, Gerechtigkeit, Mäßigung, Tapferkeit und Klugheit - des Artus appellierte. Sie war seine Heilerin und Mentorin. Heutzutage könnte sie als Artus’ Leadership Coach bezeichnet werden.
„Transzendenz von Ratio und Empfindsamkeit ist existenziell.“
Mein Blick schweifte hinab in das Donautal und meine Gedanken verbanden sich mit unserer Universität: Auch ein Arzt ist ein (Heiler), ein Leader - er war es schon immer. So schwört er seit 400 v. Chr. den Hippokratischen Eid, einen Ehrenkodex in Bezug auf seinen Berufsstand und dessen Ausübung zum Wohle

Miteigentümerin der Danube Private University (DPU), Direktorin für Marketing und Management
seiner Patienten. Die moderne Schulmedizin obliegt ganz klar naturwissenschaftlich augerichteten Gesetzen. Sie ist evidenzbasiert und bestrebt, den Krankheiten mit Einzelfakten auf den Grund zu gehen - dies auf der Basis von Biotechnologie,


Private Bildimpressionen aus Naturerlebnissen
Präventivmedizin und Künstlicher Intelligenz (KI). Technische Innovationen und wissenschaftlicher Fortschritt vollziehen sich weltweit in rasanter Geschwindigkeit. Schließlich sind Longevity und der Schlüssel zu dieser ein Ziel.
Gleichwohl: So, wie eine dünne Nebelwand Camelot von Avalon trennt, sind Excalibur und der Gral Symbole für die unbegrenzten Mysterien zwischen Leben und Tod, die bis heute das Spannungsfeld in der Medizin bedeuten.
Das Ideal eines Arztes mit seinen Patienten könnte sich in einem Gatekeeper der integrativen Medizin, die sich der modernen Technologie zum Vorteil bedient, personalisierte Gesundheitsstrategien entwickelt und den Menschen als Ganzes wahrnimmt, entfalten: All senses, all organs, all desires and all relations. Hierbei müsste sich der Arzt dem Anspruch eines Lifelong-Learning-Konzeptes verpflichten, um den dynamischen Entwicklungen der Medizin-Technik gewachsen zu sein.
Neben der konservativen Versorgung ist die Aktivierung der Selbstheilungskräfte der Patienten essenziell: Der Impetus, im Patienten die intrinsische Motivation zu wecken, entweder Krankheiten besser zu überwinden, indem das Immunsystem und die autonome Balance mobilisiert werden, oder sogar im best case einen salutogenetischen Ansatz im Sinne von Healthy
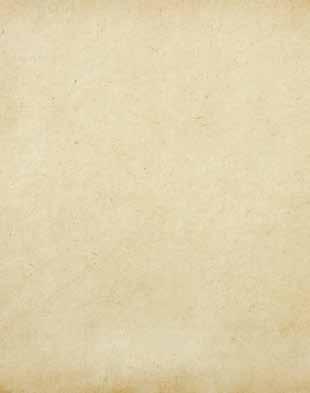
Leadership-Kreisdiagramm der Hohenpriesterin
Living zu gestalten, d. h. durch eine Optimierung der Lebensbedingungen - Schlaf, Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit, Umwelt und Technik - anzustoßen. Hierbei bedarf es einer ausgeprägten Empathie, in indvidueller Form Diagnose- und Therapiewege anzulegen sowie Hoffnung für einen würdevollen Abschied zu geben.
Nun fragte ich mich, wie der Arzt den Prämissen einer modernen Medizin folgen und gleichsam Transmissionsriemen für die Gesundheit seiner Patienten sein könnte. Entsprechend meiner Neugier, konsultierte ich unseren Rektor.
Univ.-Prof. Dr. Dr. Dieter Müßig: Das Aufgabengebiet und das Berufsbild des Arztes werden sich in der Zukunft erweitern und damit auch die Anforderungen an die Person des Arztes und an die ärztliche Ausbildung. Traditionell galt der Arzt als Heiler von Krankheiten und als Retter bei Verletzungen oder Verwundungen. In Zukunft wird er vom Anfang bis zum Ende des Lebens ein Begleiter sein, der den Menschen wissenschaftlich basiert und individualisiert dabei hilft, ihren persönlichen Weg zu einem möglichst langen Leben in Gesundheit zu finden und zu beschreiten.
Biotechnische Möglichkeiten zur Erkennung von genetischen Dispositionen, zur Bestimmung des oralen und enteralen Mikrobioms, der Einsatz von Biomarkern aus Körperflüssigkeiten, wie z. B. dem Speichel, und die umfangreiche Analyse bildgebender Verfahren, wie Magnetresonanztomographie und dreidimensionale Röntgenbildtechnik, sind die diagnostischen Fundamente auf

Rektor der Danube Private University (DPU)

Transzendente Dimensionen
denen das erweiterte medizinische Konzept gründet. Die synoptische Analyse des unfassbar umfangreichen diagnostischen Datenmaterials ist nur mit Hilfe eines digitalen Workflows und der Anwendung von KI möglich, die eine Filterfunktion besitzt, indem sie aus der Gesamtheit der Daten jene herauszieht, die in einem diagnostischen Zusammenhang stehen können. Diagnosestellung und medizinisches Prozedere sind und werden auch in Zukunft eine rein ärztliche Entscheidung bleiben.
Durch den präzisen Einblick, den die Analyse dieser Datenmenge liefert, kann eine Personalisierung vorgenommen werden, sowohl für die Behandlung einer Erkrankung als auch für deren Prävention bis hin zur Erstellung eines individuell gesundheitsfördernden Lebensstils. Dadurch wird der Begriff Longevity seine Substanz erhalten.
Neben dem medizinischen Basiswissen muss der Arzt auch fundamentale Kenntnisse und Fähigkeiten im Gebrauch von Software, digitalem Workflow, Robotik sowie Verständnis und Fertigkeiten im Umgang mit KI im Rahmen seiner Ausbildung erwerben. Er muss von Natur aus die Fähigkeiten zur kritischen Reflexion, zur Kommunikation, zur Empathie, zur Offenheit und die Liebe zum Menschen besitzen. Vor allem muss er bereit sein, ein Leben lang zu lernen. Durch den immer weiter reichenden Einsatz der KI wird sich das biomedizinische Wissen exponentiell vermehren. Die Anwendung der elektronischen und digitalen Hard- und Software erfordert eine ständige Anpassung an neue

Danube Private University GmbH (DPU) Steiner Landstraße 124 3500 Krems an der Donau AUSTRIA
Kontakt
Melanie Buchinger, BEd
Assistenz Direktorat Marketing und Management melanie.buchinger@dp-uni.ac.at www.dp-uni.ac.at
„Das Ideal eines Arztes kann ein Gatekeeper der integrativen Medizin sein.“
Applikationen. Durch telemedizinische Technologien wird nicht mehr der Patient zum Arzt kommen, sondern gewissermaßen umgekehrt der Arzt zu seinem Patienten. Ein 24-Stunden-Monitoring via Chip von gesundheits- oder krankheitsrelevanten Daten auf eine App erlaubt es dem Arzt, den Gesundheitszustand seiner „Klienten“ kontinuierlich zu verfolgen, falls diese es wünschen. Bei besorgniserregenden Veränderungen wird die KI eine Alarmmeldung beim Arzt absetzen. Der Arzt wird dadurch zum Begleiter seiner Patienten in Gesundheit und Krankheit im klassischen Sinne des Wortes ( paidagogós) und kann in diesem Sinne gesundheitsdidaktisch wertvolle Dienste für den Einzelnen und die Gesellschaft leisten. Hohe empathische Fähigkeiten des Arztes sind unverzichtbar, um das Ziel der medizinischen Fürsorge in die familiäre, mentale, soziale, geistige und kulturelle Welt einzubetten.
Für die medizinischen Universitäten stellt sich die Aufgabe, diesen hohen und umfangreichen Anforderungen gerecht zu werden. Dies setzt nicht nur eine rasche, wegweisende und stetige Anpassung der Curricula voraus, sondern auch ein sich ständig wandelndes, globales, postgraduales State of the Art-Bildungswesen.

Brand-new: Der DPU Podcast! Expert*innen-Talks zu Trends und Innovationen im Gesundheitswesen.
Einfach den QR-Code scannen.

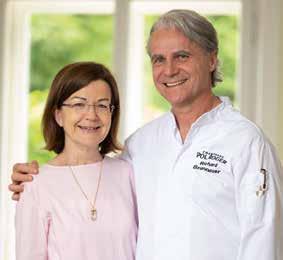


Das stimmungsvolle Ambiente der Ceconi-Villa, mit einzigartigem Festungsblick, ist bereits seit über 8 Jahren die Wirkungsstätte für Brunnauers 3-Hauben Küche.
Leidenschaft zum Handwerk, naturbelassene Aromen, schonende Zubereitung und der respektvolle Umgang mit Grundprodukten bilden das perfekte Rezept für puren und unverwechselbaren Geschmack.
Zusätzlich zur Speisekarte und den Mittagsmenüs runden Spezialitätenwochen das Angebot im Einklang der Jahreszeiten ab.
Für alle besonderen Momente, ob Feste und Feierlichkeiten oder Geschäftsessen, bietet das Restaurant Brunnauer die passende Räumlichkeit.
Genießen Sie ein paar Stunden fernab des Alltags, um verwöhnt zu werden und zu genießen.
MONTAG
18:00 bis 24:00 Uhr
DIENSTAG BIS FREITAG
12:00 bis 14:30 Uhr
18:00 bis 24:00 Uhr
FESTSPIELZEITEN UND ADVENT Erweiterte Öffnungszeiten

Fürstenallee 5, 5020 Salzburg, Tel. +43 662 251010
www.restaurant-brunnauer.at
office@restaurant-brunnauer.at

Wenn der Schnee sich langsam zurückzieht und die Tage immer länger werden, erwacht der Frühling in Kitzbühel. Während in der Natur alles zu blühen beginnt, bietet die Region eine Vielfalt an Aktivitäten und Veranstaltungen, die sowohl Sportbegeisterte als auch Kultur- und Genussliebhaber:innen ansprechen.
EIN PARADIES FÜR GOLFER
Für Golffreund:innen ist Kitzbühel ein wahres Eldorado. Die Region beherbergt vier erstklassige Golfplätze, die sich harmonisch in die atemberaubende Berglandschaft einfügen. Sobald die Temperaturen steigen, erwachen die perfekt gepflegten Fairways aus dem Winterschlaf und laden zu unvergesslichen Golfrunden ein. Mit einer beeindruckenden Bergkulisse als Hintergrund erleben Golfer:innen hier sportliche Herausforderungen und pure Erholung zugleich. Da jeder Platz auf seine Weise einzigartig und unterschiedlich ist, lohnt es sich, alle vier Kitzbüheler Plätze mindestens einmal pro Jahr zu spielen. Der 18-Loch-Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith zeichnet sich durch ein beeindruckendes Panorama zwischen Hahnenkamm, Kitzbüheler Horn und Wildem Kaiser aus. Dichte Laubwälder und lange Pars charakterisieren den großzügig angelegten 18-Loch-Championship-Course Eichenheim. Im Zielgelände der legendären Streif-Abfahrt liegt
der 9-Loch-Golfplatz Red Bull Golf am Rasmushof. Der 9-Loch-Golfplatz Kitzbühel-Kaps liegt direkt am A-ROSA Resort Kitzbühel und wartet mit seinen zwei Inselgrüns auf Golfer:innen aller Spielstärken.
Ob entspannte Übungsstunden auf der Driving Range oder anspruchsvolle Turniere – Kitzbühel vereint exzellente Golfmöglichkeiten mit einer einzigartigen Atmosphäre: ab Mitte Mai auch mit neuer Driving Range inklusive modernster Technologie, und ab Anfang Juli mit einer neuen Golfakademie.
ELEGANZ AUF VIER RÄDERN –
DIE KITZBÜHELER ALPENRALLYE
Ein Highlight im Frühling ist die Kitzbüheler Alpenrallye, bei der Liebhaber:innen klassischer Automobile auf ihre Kosten kommen. Seit ihrer Gründung zieht die Veranstaltung Teilnehmer:innen und Zuschauer:innen aus aller Welt an, die die Eleganz und den Charme

historischer Fahrzeuge inmitten der beeindruckenden Bergwelt erleben möchten. Kitzbühel wird vom 4. bis zum 7. Juni 2025 zum ultimativen Treffpunkt für Oldtimer-Liebhaber:innen. Über 600 Kilometer malerischer Bergstrecken warten darauf, bezwungen zu werden.
KLASSIK TRIFFT ALPENCHARME –
KITZBÜHEL KLASSIK VON 2. BIS 5. JULI 2025
Mit „Kitzbühel Klassik“ wird die Stadt zur Bühne für Nachwuchsopernstars. Junge Talente aus dem Opernstudio der Wiener Staatsoper sowie Gewinner:innen des Wettbewerbs „Zukunftsstimmen“ präsentieren ihr Können im idyllischen Kitzbühel. Die eindrucksvolle Verbindung aus klassischer Musik und einzigartiger alpiner Kulisse schafft eine magische Atmosphäre, in der nicht nur die Stimmen, sondern auch die Stadt selbst für das Publikum noch intensiver erlebbar werden. Kitzbühel bietet damit aufstrebenden Künstler:innen eine wertvolle Plattform, um Bühnenerfahrung zu sammeln und Opernliebhaber:innen in eine musikalische Welt voller Emotionen zu entführen.
In Kitzbühel wird Genuss großgeschrieben, überzeugt die Stadt doch mit erstklassiger Gastronomie. Der renommierte Guide MICHELIN zeichnete kürzlich zwei Restaurants mit den begehrten Sternen aus. Das „Berggericht Kitzbühel“ unter der kreativen Leitung von Chefkoch Marco Gatterer erhielt einen Stern für seine

innovative Küche, die regionale Zutaten mit modernen Akzenten vereint. Ebenfalls mit einem Stern wurde das „Les Deux Kitzbühel“ prämiert, das französische Klassiker mit alpinem Charme neu interpretiert. Mit dem Bib Gourmand wurde das „Mocking – Das Wirtshaus“ geehrt – eine Auszeichnung für exzellente Küche mit besonderem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob Haute Cuisine oder bodenständige Wirtshauskultur – Kitzbühel bietet kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau.
Ob sportliche Herausforderungen, kulturelle Höhepunkte oder kulinarische Genüsse – der Frühling in Kitzbühel vereint all das zu einem unvergesslichen Erlebnis. Inmitten der erwachenden Natur entfaltet die Stadt ihren ganz besonderen Charme und lädt dazu ein, die warme Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen. Egal ob Aktivurlaub oder entspannte Genussmomente – Kitzbühel ist der perfekte Ort, um den Frühling in allen seinen Facetten zu erleben.
Alle Informationen zu den Veranstaltungen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter: kitzbuehel.com

Die Stadt Salzburg verändert innerhalb weniger Jahrzehnte ihr Gesicht. Frühe Fotografien dokumentieren den rasanten Wandel.

Foto: © Salzburg Museum

Franz Segl, Porträt von vier Offizieren vor ihrem Abgang nach „Romanien“, Juli 1860, Salzpapier
Mit einer spektakulären Ausstellung über die Anfänge der fotografischen Kunst vor knapp 200 Jahren in Salzburg setzt das Salzburg Museum in Kooperation mit dem Museum der Moderne Salzburg eine neue Landmark: Die Geschichte der frühen Fotografie in Salzburg, 1839–1878.
Die mächtigen fürstlichen Erzbischöfe waren Geschichte, Napoleons Truppen wieder abgezogen, die Hoheit über das vormalig reiche und europapolitisch schwergewichtige Fürsterzbistum Salzburg war nach diversen Verschiebungen zwischen Italien, Bayern, Linz und Wien zur Unwichtigkeit geronnen.
Nach Jahren des Versinkens in die zuvor nie gekannte Unbedeutsamkeit der Provinzialität entdeckt Salzburg die Kraft der Bürgerschaft. Die Stadt wird umgebaut, von Festungsmauern befreit und – getragen von neuem Selbstbewusstsein – vom Barock in die bürgerliche
Neuzeit überführt. Festungswälle werden geschliffen, die Salzach wird reguliert und damit Land für neuzeitliche Stadtentwicklung erschlossen. Parallel zur einigermaßen radikalen gesellschaftlichen Zeitenwende ab den 1840er- bis in die frühen 1880er-Jahre bewegen sich auch die Errungenschaften der physikalischen und technischen Wissenschaften in großen Sprüngen Richtung Zukunft: in unserem Fall die Entwicklung von Methoden, „Lichtbilder“ der Gegenwart aufzunehmen, sichtbar, reproduzierbar und – zumindest in Teilbereichen – für die Verbreitung in der Gesellschaft verfügbar zu machen. Ganz ähnlich wie heute waren mehrere Vordenker auf dem Innovationsgebiet am Start.
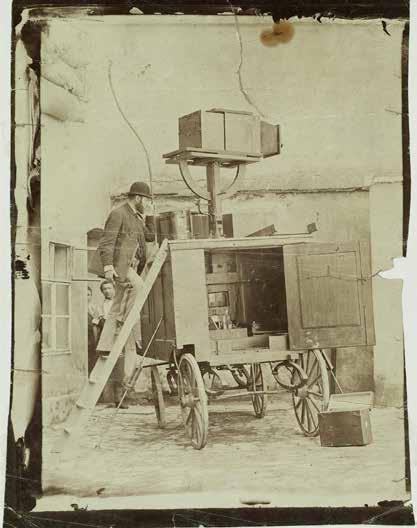
ABER ...
Im August 1839 war das Rennen um die Fotografie entschieden: Der Ruhm fiel dem französischen Maler Louis Daguerre (1787–1851) zu, der das erste Patent erhielt und damit in die Geschichtsbücher einging. Die Versuche, ein Lichtbild der „Camera obscura“ zu fixieren, hatten schon Jahrzehnte davor begonnen. Viele Forschende waren bemüht, leisteten Beiträge und kamen zu teils unterschiedlichen Lösungen. Mit dem Negativ-Positiv-Verfahren und der Möglichkeit, beliebig viele Abzüge zu erstellen, löste William Henry Fox Talbot (1800–1877) das Unikatverfahren von Daguerre ab. Er hatte den Streit um das erste Patent zwar verloren, aber jenes Prinzip erfunden, das in der analogen Fotografie bis heute grundlegend ist.
DAMIT IST ABER NOCH LANGE NICHT
SCHLUSS ...
Die Ausstellung „Bilderwende. Zeitenwende – Geschichte der frühen Fotografie in Salzburg“ sowie die zugrunde liegende Publikation spannen einen Bogen von den Anfängen des neuen Mediums Fotografie in den 1840er-Jahren bis zu seiner breiten Wirksamkeit für Gesellschaft, Kultur und Alltag in den 1870erJahren. Damit umschließt das Gesamtprojekt auch einen für die Geschichte Salzburgs hochbedeutsamen
Foto links: Gustav Jägermayer, Selbstporträt mit Aufnahmewagen, um 1860, Albumin
Rechts: Max Balde, Selbstporträt, um 1875, Kabinettfoto. Albumin
Unten: Karl Boos, Hotel de l’Europe, 1866/68, Albumin
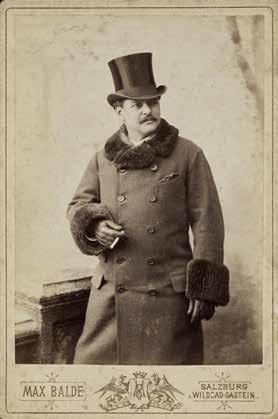

Zeitraum der Neudefinition der fürsterzbischöflichen Residenzstadt als urbaner Raum bürgerlicher Kultur.
Die frühe Fotografie begleitete diesen Wandel und war gleichzeitig sein symptomatischer Ausdruck: Vor der Kamera wurde die Zeitenwende in der Geschichte Salzburgs durch Fotografien von Menschen, Bauten, Stadtund Naturlandschaften sichtbar; hinter der Kamera wurde die Bilderwende durch Fotografinnen und Foto-

Ausstellungsansicht „Bilderwende. Zeitenwende“, im Vordergrund Porträt der Elise Blümsrieder (Krimpelstätter-Wirtin in Salzburg) und ihrer Brüder, um 1855/60, Salzpapier, koloriert
grafen in Stadt und Land Salzburg getragen und mit immer neuen technischen Möglichkeiten vorangetrieben.
Im Sinne ihres programmatischen Titels widmet sich die Ausstellung beiden Aspekten vor und hinter der Kamera und kann somit viele neue Erkenntnisse zu fotografischen Bildern und ihren Urheber*innen präsentieren. Das Konzept referenziert auf die Erfindung eines Mediums aus Salzburger Sicht und zeigt mit frühesten Bilddokumenten, wie dieses auch in Salzburg Bildmotive, Blickweisen und Darstellungen revolutionierte.
Die Fotografie etablierte sich als Medium des Bürgertums, das Repräsentationsweise und Schaulust auf neue Art bediente.
229 Originalfotografien aus vier Jahrzehnten führen durch die vier Ausstellungsräume im Rupertinum und erzählen vom Wandel der Salzburger Gesellschaft, dokumentieren den technischen Fortschritt und die selbstbewusste Umgestaltung der Stadt. Und sie zeigen, in welch kurzer Zeit der Beruf des Fotografen bzw. der Fotografin etabliert wurde.
50 Jahre nach der ersten Bearbeitung der „Geschichte der Fotografie in Österreich“ stellt das Projekt „Bilderwende. Zeitenwende“ mit dem Fokus auf Salzburg eine
substanzielle Neuvermessung der frühen Fotografie in Österreich dar. Umfassende Recherchen zu Bildern, Motiven, Techniken, Ateliers und Biografien liefern neue Erkenntnisse zu den Anfängen, Kontexten, Leistungen und Protagonist*innen dieses Mediums, das mit seiner Erfindung 1839 eine Bilderwende einläutete und nicht nur in Salzburg eine Zeitenwende sichtbar machte.
Die wissenschaftliche Grundlage zur Publikation und Ausstellung verdanken wir den Forschungen von Erich Wandaller, der in enger Kooperation mit dem Salzburg Museum und in intensiver Zusammenarbeit mit seinem Co-Kurator Werner Friepesz, dem Leiter der fotografischen Sammlung des Salzburg Museums, einen historischen Meilenstein zur Fotografie-Geschichte unseres Landes vorlegt.
Bilderwende. Zeitenwende Geschichte der frühen Fotografie in Salzburg 1839–1877
14. März bis 19. Oktober 2025 Salzburg Museum – Gastspiel im Museum der Moderne Salzburg (Rupertinum) www.salzburgmuseum.at



Ein paar jagdaffine Freunde, ein eigener Wald oder einfach nur die Lust am Tontaubenschießen sind genügend Gründe, um Harry Reuss und Kilian Knorr zu bitten, einen „Simulated Game Day“ zu organisieren. Dass es ein erlebnisreicher und fröhlicher Tag wird, ist hiermit garantiert.





Tipps und Tricks beim Schießen stehen Harry und Kilian zur Verfügung.
Wenn man gerne in waidmännischem Outfit und mit Flinte bewaffnet auf Wald und Feld Aufstellung nimmt, wenn man gerne zwischen den Jagdsaisonen das Schießen trainiert, und wenn es einem Spaß macht, das jagdliche Mittagessen gemeinsam mit Freunden in einem privaten Stadl serviert zu bekommen, dann ist man bei Harry Reuss und Kilian Knorr richtig. Die beiden haben erst kürzlich ihr Unternehmen gegründet und bieten unter dem Titel „Simulated Game Days“ genau das an. Die SCHLOSSSEITEN waren am Heldenberg mit dabei.
Es ist noch früh, als Harry und Kilian mit einem alten Feuerwehrauto daherkommen. Es ist vollgepackt mit Tontauben-Wurfmaschinen, mit Gewehren und Patronen, mit Thermoskannen und Servietten. Alles, was man für einen Tag braucht. Die Idee hatten die beiden schon länger. In England hatten sie gesehen, dass „Simulated Game Shooting“, das ursprünglich als wirksame Trainings- und Simulationsmethode für getriebene Fasanjagden gedacht war, sich längst als salonfähige Ergänzung zur herkömmlichen Flintenjagd etabliert hat. Harry Reuss, der selbst langjährige Erfahrung im Waffen- und Ausrüstungshandel mitbringt, außerdem ausgebildeter Forstwart und Berufsjäger ist, und Kilian Knorr, der geprüfte Pädagoge und Sportdi-
„Der Erfolg unserer Shooting School hat uns auf die Idee gebracht, all das Wunderbare, das Flair, das Erlebnis, die Seele des Flintenschießens, das wegen strenger werdender Regulierungen in Bezug auf das Aussetzen

Mit einem Unimog werden die Schützen zu den Trieben gefahren. daktiker, langjähriger Schießtrainer und Trainercoach in der Jägerausbildung, sind seit Jahren eng befreundet. Nicht von ungefähr kam also die Idee, vorerst einmal eine Schießschule zu gründen – die „Shooting School“ war geboren (shootingschool.at).

Ab acht Schützen, ihre Begleiter und Hunde erleben einen abwechslungsreichen Jagdparcours. Zwischen den einzelnen Trieben bleibt Zeit für Snacks, Drinks und Gespräche. Alles genau so, wie der Kunde es wünscht.
von jagdbarem Wild schwieriger wird, auf neue Beine zu stellen. Mit unserem Maschinenpark können wir einzigartige Events in privatem Umfeld organisieren“, erzählt Harry Reuss. „Wir können je nach Wunsch des Auftraggebers mit Hunderten von Tontauben jegliche Form der getriebenen Flugwildjagd simulieren und ein jagdliches Übungsschießen im Stil einer klassischen englischen Flugwildjagd höchster Qualität anbieten“, ergänzt Kilian Knorr.
Von der Planung der einzelnen Triebe über die Erstellung von Sicherheitskonzepten bis hin zur Erfüllung kulinarischer Wünsche wird nichts dem Zufall überlassen, um den „Simulated Game Day“ nach allen Regeln der Kunst zu gestalten. Nicht nur zum Vergnügen der Schützen, zum Training und zur Verlängerung der Saison, sondern auch aus dem Bewusstsein der ökologischen Verantwortung und des Fußabdrucks macht dieses Konzept Sinn. Nicht zuletzt, weil sowohl Munition als auch die Wurftauben biologisch abbaubar sind.
Jedes Revier bringt besondere Gegebenheiten mit sich. Nicht nur das Gelände ist unterschiedlich, auch das Haus als Zentrum der Veranstaltung, die Gästeschar und die Ansprüche sind es. Reuss und Knorr haben sich
vorgenommen, auf alle Wünsche bestmöglich einzugehen, um Gastgebern und Gästen einen schönen Jagdtag zu ermöglichen. Mundpropaganda ist die beste Werbung, und sie scheint zu funktionieren:
Allein für das heurige Jahr sind bereits 15 Simulated Game Days in unterschiedlichen Locations gebucht.
Text: Clarissa Mayer-Heinisch

Shootingschool Event KG
Obere Hauptstraße 6 2004 Niederhollabrunn office@shootingschool.at +43 676 4085812 www.simulatedgamedays.at

3002 PURKERSDORF
• ca. 5.207 m 2 Grundstücksfläche
• ca. 735 m 2 Nutzfläche
• Gästehaus
• Wellnessbereich mit Indoor-Pool
• Klimaanlage
• Parkähnlicher Garten
• 7 Garagenplätze



Aus Freude am Töpfern hat die Künstlerin Lori Rosenberg vor vielen Jahren ihr Atelier gegründet und sich mit ihren kreativen Lampen inzwischen längst einen Namen gemacht.
Ein Steckschild über der Tür zieht Fußgänger an, die durch die stille Wassergasse im 3. Bezirk gehen. Das gelbe Kamel, das einen rot gestreiften Lampenschirm trägt, ist das Symbol der Lori Rosenberg; es zeugt von ihrer Faszination für diese Tiere und von den Anfängen ihrer Tätigkeit. Eine Abenteuerreise durch Algerien gab einst den Ausschlag. „Kamele haben mir damals schon gefallen. Sie sind so merkwürdig, schauen vertrottelt aus, aber sie sind eigenständig und eigensinnig.“ Überdies waren die klassischen Wiener Lampenschirme Lori Rosenberg ein Dorn im Auge. „Diese alten Offwhite-Schirme mit einem Samtband am oberen und unteren Rand – da muss es doch Alternativen geben“, dachte sie. Damit hat alles begonnen.
Tag für Tag und Nacht für Nacht hat Lori Rosenberg ihrer Fantasie gefrönt, und wer heute in die Auslagen ihres Ateliers schaut, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Da stehen bunt bemalte Papageien mit lustig geformten Lampenschirmen über ihren Köpfen, da sieht man hölzerne Pferde, metallene Frösche, naturnah bemalte Enten, lustige Flohmarktobjekte, einen Stapel Bücher und dazwischen immer wieder Kamele. Sie alle tragen Lampenschirme, die aus Wachspapier oder Bast, aus Stroh, aus Stoffen, Federn oder sonstigen Materialien und Fundstücken hier im Atelier entstehen. Der Fantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt, und auch die Handwerkskunst beherrscht Lori Rosenberg perfekt: Jedes Stück ist handgemacht und damit ein Unikat.

Auf der Werkbank stehen gerade zwei noch unfertige, aus Ton modellierte Esel. „Bei den Tieren hilft mir jetzt zum Glück Andreas“, erzählt Lori Rosenberg. Angesprochen ist ihr Ehemann, der lange Jahre als Grafiker beim ORF tätig und nebenbei ohnehin bereits sein ganzes Leben hindurch als Künstler aktiv war. Esel, Ziegen, Schafe, ein Murmeltier und jede Menge Hunde, denen oft private Fotos als Modell dienen, entstehen unter seinen Händen. Einen Tag dauert es in etwa, um den Ton kunstvoll zu formen, eine Woche, um das Material zu trocknen; danach wird gebrannt und von Lori mit Acrylfarben fantasievoll bemalt. Auch das Elektrifizieren beherrscht sie inzwischen längst selbst, und so verlassen in arbeitsreichen Wochen ein bis zwei Kunstwerke das Atelier.
Viele der Lampen sind Auftragswerke. Tischlampen, Stehlampen, Wandlampen oder Hängelampen entstehen hier, und obwohl jedes Stück für sich einzigar-
Obwohl jedes Stück für sich einzigartig wirkt, zieht sich doch ein roter Faden durch Rosenbergs Produktion.
tig wirkt, zieht sich doch ein roter Faden durch Rosenbergs Produktion. In den Regalen sieht man, warum: Stoffe und Papiere folgen ihrem ästhetischen Anspruch. Teils sind es Wachspapiere aus Nepal, teils sind es grafische Entwürfe des österreichischen Künstlers Tone Fink, teils sind es edle Stoffreste, die Lori Rosenberg zusammenträgt, dann wieder sind





es Strohhüte oder andere Geflechte, aus denen die Schirme entstehen. Die Farben wirken stark und satt, niemals grell oder billig. Die Formen variieren und reichen von rund bis eckig, von klein bis groß, von niedrig bis hoch.
„Das Licht muss gut durchscheinen“ – so lautet der Anspruch, den Lori Rosenberg an alle ihre Lampenschirme stellt. Schlussendlich dienen diese dazu, die Sockelobjekte so richtig in Szene zu setzen. „Ein bisschen Kolonialstil, ein bisschen altmodisch, ein biss-
chen Shabby Chic“, beschreibt die Künstlerin lachend ihre Kreationen. Die Kunden und Auftraggeber scheinen genau das zu lieben und gerne in ihr Reich der Kamele und anderen Tiere einzutauchen.
Lori Rosenberg Wassergasse 19, 1030 Wien +43 664 2428759 www.lorirosenberg.at

Brandl, Ohne Titel, 2013, Öl auf Leinwand, 150 x 196 cm, Schätzwert € 60.000 – 90.000, Auktion 21. Mai 2025
Auktionen 20.5. – 5.6.
Moderne und Zeitgenössische Kunst Editions, Juwelen Uhren
Palais Dorotheum Wien +43-1-515 60 570 Hamburg +49-40-879 63 14 70
Düsseldorf +49-211-210 77 47 München +49-89-244 43 47 30 dorotheum.com


Ordensregel des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens, 1290
Auf fast 1000 Jahre Geschichte kann der Souveräne Malteser-Ritter-Orden zurückblicken, auch bekannt als Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom Heiligen Johannes zu Jerusalem, genannt von Rhodos genannt von Malta. Der Orden ist eine der ältesten bestehenden christlichen Organisationen; seine Geschichte spiegelt die religiösen, politischen und sozialen Umbrüche Europas und des Nahen Ostens wider. Text: Eva von Schilgen
Um das Jahr 1048 gründen Kaufleute der Seerepublik Amalfi in Jerusalem zum Zwecke der Beherbergung, Verköstigung und Pflege der Pilger ein Hospiz. Nach der Eroberung der Stadt durch die Kreuzritter während des Ersten Kreuzzuges (1095–1099) und der Gründung des Königreichs Jerusalem wird dem Orden der Johanniter die Verantwortung übertragen, zusätzlich zu seinem Hospitaldienst die eroberten muslimischen Gebiete militärisch zu schützen. Als Symbol wird das achtspitzige weiße Kreuz eingeführt, das bis heute das Zeichen des Ordens geblieben ist.
Mit der päpstlichen Bulle „Pie postulatio voluntatis“ vom 15. Februar 1113 wird die Hospitalbruderschaft der Johanniter zu einem eigenständigen Orden. Nach
dem Fall Jerusalems (1187) durch das Heer von Sultan Saladin zieht sich der Orden bis zum Jahr 1291 in die Hafenstadt Akkon zurück. Nach dem endgültigen Verlust des Heiligen Landes flüchten die wenigen überlebenden Ordensritter zunächst nach Zypern, wo man weitere Hospitäler gründet und – begünstigt durch die strategisch gute Lage der Insel – beginnt, eine Flotte zum Schutz der Pilger auf ihrem Weg ins Heilige Land aufzubauen. 1310 wählt der Orden die Insel Rhodos als Hauptsitz und konstituiert sich als souveräner Staat. Mit ihren Schiffen kontrollieren die Ritter von hier aus das östliche Mittelmeer.
Die Belagerung der Insel im Jahr 1522 durch Sultan Süleyman den Prächtigen führt zum Verlust von Rhodos. Von Kaiser Karl V. und Papst Clemens VII. er-

halten sie 1530 die Insel Malta übertragen, die sich unter ihrer Regierung zu einem Zentrum von Kunst, Kultur und Seefahrt entwickelt. Die Hauptstadt Valletta, benannt nach dem Großmeister Jean de la Valette, wird zum Symbol für die Stärke des Ordens, jetzt als „Malteserorden“ bekannt. Paläste und Kirchen werden errichtet, neue gewaltige Verteidigungsanlagen angelegt sowie ein großes Hospital erbaut, das als eines der am besten organisierten und effizientesten der Welt gilt. Mit der Einrichtung einer Anatomieschule und einer Medizinischen Fakultät leistet der Orden wichtige Beiträge zur Entwicklung insbesondere der Augenheilkunde und der Pharmakologie.
1798 erobert Napoleon Bonaparte während seines Ägyptenfeldzuges Malta. Um einen militärischen Konflikt zu vermeiden, kapituliert der Orden; die wenigen verbliebenen Mitglieder gehen nach Rom, um sich nun ausschließlich dem Dienst der Kranken und Bedürftigen zu widmen. Die meisten Mitglieder sind verheiratete Ordensritter, welche kein Ordensgelübde (Profess) ablegen und die Wiederbelebung der Hospitalidee wesentlich mittragen, so durch Dienste in Lazaretten während der Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts sowie durch die Gründung von Krankenhäusern.
Neben dem Deutschen Orden (der mittlerweile ein geistlicher Orden mit einem angeschlossenen Laien-
„Unsere Bruderschaft wird unvergänglich sein, weil der Boden, auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend der Welt ist, und weil – so Gott will – es immer Menschen geben wird, die daran arbeiten, dieses Leid geringer, dieses Elend erträglicher zu machen.“
Fra’ Gérard (Gerhard Sasso), Ordensgründer, * um 1040 in Martigues (Provence) oder in Scala (Herzogtum Amalfi), † 3. September 1120 in Jerusalem
institut von Familiaren wurde) und dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist auch der katholische Malteserorden eine päpstlich anerkannte Laien-Ordensgemeinschaft. In über 120 Ländern der Welt tätig, ist er unterteilt in 11 Priorate, 48 nationale Assoziationen, 133 diplomatische Missionen, 1 weltweites Hilfswerk, 33 Freiwilligenkorps sowie zahlreiche medizinische Einrichtungen und Fachzentren. Volle diplomatische Beziehungen bestehen zu 114 Staaten, dem Europarat, der Europäischen Kommission sowie den internationalen Organisationen in New York, Genf, Paris, Rom und Wien. Der Orden ist internationales Völkerrechtssubjekt sowie ein souveräner Staat mit einer Verfassung, öffentlichen Institutionen und Gerichten.

GEGEN DAS ACHTFACHE ELEND
Krankheit und Hunger
Schuld und Unglaube
Heimatlosigkeit und Verlassenheit
Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit
Seit dem Jahr 1834 befindet sich der Regierungssitz des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens im Palazzo Magistrale in der Via dei Condotti in Roms Altstadt. Das Ministerium des Inneren, das Außenministerium, der Hospitalier, das Ministerium für Finanzen und das Pressebüro der Regierung des Malteserordens haben ihren Sitz im Palast, ebenso die Zentralbibliothek und die Archive; im Erdgeschoss des Gebäudes gibt es eine Tagesstätte. Auch die Magistrale Münzprägeanstalt und das Postamt befinden sich hier, von wo man seine Korrespondenz mit Briefmarken des Malteserordens in 58 Staaten schicken kann, mit denen Postverträge bestehen. Ein neu eröffnetes Besucherzentrum bietet Passanten die Gelegenheit, mehr über den Malteserorden zu lernen.
Im Magistralpalast residiert das religiöse und staatliche Oberhaupt, der Großmeister, welcher an der Spitze einer hierarchischen Struktur von Rittern, Geistlichen und Freiwilligen steht. Er wird für die Dauer von 10 Jahren gewählt und übt die höchste Amtsgewalt aus. Zusammen mit dem Souveränen Rat ist er für den Erlass von nicht in der Verfassungscharta vorgesehenen gesetzgeberischen Maßnahmen, den Erlass von Gesetzen und die Ratifizierung internationaler Abkommen zuständig. Er verwaltet über den Rezeptor des Gemeinsamen
Herr Jesus Christus, Du hast mich aus Gnade berufen, Dir als Malteserritter zu dienen. Demütig bitte ich Dich auf die Fürsprache Unserer Lieben Frau von Philermos, des heiligen Johannes des Täufers, des seligen Gerhard und aller Heiligen: Lass die Treue zu unserem Orden mein Leben und Handeln durchdringen. Im Bekenntnis zur römisch-katholischen und apostolischen Kirche will ich mit Deiner Hilfe den Glauben standhaft bezeugen und ihn entschlossen gegen alle Angriffe verteidigen. Dem Nächsten will ich in Liebe begegnen, besonders den Armen und unseren Herren Kranken. Gib mir die nötige Kraft, diesem Vorsatz gemäß selbstlos und als aufrechter Christ zu leben, zur größeren Ehre Gottes, für den Frieden der ganzen Welt und zum Wohl unseres Ordens. Amen.
Schatzamtes das Vermögen des Ordens und beruft das Kapitel der Professen und das Generalkapitel ein. Staaten, zu denen der Orden diplomatische Beziehungen unterhält, räumen dem Großmeister die Vorrechte sowie die Immunität und auch die Ehrenbezeugungen ein, die einem Staatsoberhaupt zustehen.
In Österreich ist der Orden seit 1146 aktiv, pflegt seit dem 14. Jahrhundert diplomatische Beziehungen und ist heute durch eine Botschaft vertreten. Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter des Ordens bei der Republik Österreich ist S.E. DI Sebastian Prinz von Schoenaich-Carolath.
Im Malteserorden gibt es drei Stände: Die Profess-Ritter legen als Laien die ewigen Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam ab und führen ein religiöses Leben. Die Ritter und Damen der Obedienz als zweiter Stand des Ordens legen das Gelübde des Gehorsams ab, ohne sich vollständig dem religiösen Leben zu widmen. Die Ritter und Damen (dritter Stand) sind Personen, welche sich für den Orden engagieren, ohne ein Gelübde abzulegen. Um Ordensmitglied zu werden, bedarf es der Empfehlung eines bestehenden Mitgliedes. Die Mitgliedschaft ist in der Regel auf praktizierende Katholiken beschränkt; das Engagement für karitative sowie soziale Aufgaben ist eine weitere Voraussetzung.

„Tuitio fidei et obsequium pauperum“ –Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen
MALTESER International ist das internationale Hilfswerk des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens. Unterstützt werden in 120 Ländern weltweit über 15 Millionen notleidende Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung.
In Österreich besteht die Tätigkeit aus den hauptamtlichen Hilfswerken MALTESER Ordenshaus (Pflegewohnheim) und MALTESER Care (mobile Pflegedienste), der MALTESER Kinderhilfe (Kinderpflegeheim) sowie dem ehrenamtlichen Hilfswerk MALTESER Hospitaldienst Austria (MHDA) mit Standorten in Wien, Salzburg, Tirol, Oberösterreich und der Steiermark. Unter den mehr als 2200 ehrenamtlichen Mitgliedern finden sich auch einige Ordensmitglieder. Indem sie Menschen unterstützen, die Hilfe benötigen, tragen sie zur Umsetzung der christlichen Werte der Nächstenliebe und der Solidarität bei, insbesondere im Rettungs- und Sozialbereich sowie beim Katastrophenschutz, so in den Bereichen Sanitätsdienste (Ambulanzdienste, Krankentransporte, Rettungsdienst, Ärztefunkdienst), Sozialdienste (Betreuungsdienst, Betreuung HIV-Betroffener, Jugendinitiativen, Palliativbetreuung, Pflegedienste, Friedhofbegleitdienst) Wallfahrten, Verkehrscoaching, Katastrophenhilfe, Integrationshilfe und MALTES-
ER Herzenswunsch. Bekannt sind die Wallfahrten der MALTESER, insbesondere nach Lourdes und Rom, mit Kranken sowie Menschen mit Beeinträchtigungen.
Ab dem Alter von 18 Jahren kann man Mitglied des MHDA werden; Voraussetzung sind die Bereitschaft, ehrenamtlich zu arbeiten, sowie die Identifikation mit den christlichen Werten und die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche als getauftes, aktives Mitglied. Vor der aktiven Mitarbeit werden Schulungen angeboten wie Erste-Hilfe-Kurse, spezielle Ausbildungen für die jeweilige Aufgabe, wie beispielsweise der Umgang mit Menschen mit Behinderungen oder Katastrophenschutztraining.
Der MHDA finanziert sich über die Einnahmen im Rettungsdienst, Spenden und Förderungen und gehört zum internationalen Netzwerk des Malteserordens, was ihm zusätzliche Ressourcen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Ländern ermöglicht.
Seine Exzellenz Stephan Turnovszky, seit 2008 Weihbischof von Wien, ist seit 1987 ehrenamtlich für den MALTESER Hospitaldienst Austria aktiv. Er wuchs in WienDöbling auf und begann seine akademische Laufbahn mit einem Studium der technischen Chemie an der Technischen Universität Wien. Nach seinem Abschluss arbeitete er in der Privatwirtschaft, bevor seine Berufung ihn ins Wiener Priesterseminar führte. 1998 empfing er die Priesterweihe und begann seine seelsorgerische Tätigkeit. In der Österreichischen Bischofskonferenz ist Turnovszky seit 2009 als Referatsbischof für Kinder- und Jugendpastoral sowie für die religiösen Bewegungen zuständig. In der Erzdiözese Wien fungiert er als Bischofsvikar für das Viertel Unter dem Manhartsberg. Regelmäßig veröffentlicht er Kolumnen für die NÖ Nachrichten sowie für die Wiener Kirchenzeitung „Der Sonntag“.
EvS: Wie hat sich Ihre Sicht auf die soziale Arbeit durch Ihre Tätigkeit verändert?
Exz. ST: Durch die Arbeit bei den MALTESERN kann ich nicht nur über bedürftige Menschen sprechen, sondern mit ihnen. Das verändert alles. Ich habe dadurch aber nicht nur für die Situation der Betreuten mehr Verständnis erworben, sondern auch für die der betreuenden Personen, die oft Übermenschliches leisten, gerade im familiären Kontext. Ich wünsche jedem jungen Menschen ein soziales Praktikum, denn das öffnet Herz und Horizont. Bei den MALTESERN habe ich wahrgenommen, wie vielfältig die Betätigungsfelder im Sozialbereich sind – von der unmittelbaren Begegnung mit bedürftigen Menschen über deren medizinische Versorgung und deren Verpflegung bis hin zum Krankentransportwesen, zur Technik und zur Öffentlichkeitsarbeit. Je nach Begabung und Interesse ist bei den MALTESERN für jeden etwas dabei.
EvS: Gibt es ein besonderes Erlebnis, das Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
Exz. ST: Meine erste Wallfahrt mit Betreuten nach Lourdes ist mir unvergesslich. Mit einem Sonderzug inklusive Lazarettwaggon waren wir circa 36 Stunden lang pro Richtung unterwegs. Dort haben wir bis zur Erschöpfung gepflegt, geplaudert, betreut und täglich große Heilige Messen gefeiert. Die Erholung bestand in der abendlichen stillen Zeit an der Grotte und in den Momenten der Freude auf den Gesichtern der Betreuten, die alle Mühen vergolten. Ich habe dort erfahren, dass Gottesdienst aus Liturgie und aus dem Dienst an Bedürftigen besteht und dass das zusammengehört. Das prägt mich bis heute.

Mag. Johann-Philipp Spiegelfeld wurde im April 2024 zum neuen Kommandanten des MALTESER Hospitaldienstes Austria gewählt. Spiegelfeld ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Seit 2001 arbeitet er als Flugkapitän bei den Austrian Airlines. 2010 wurde er Mitglied im MHDA, seit 2011 ist er Rettungssanitäter und seit 2016 Mitglied des Malteserordens. Im ORF moderiert er den Quotenhit „Herrschaftszeiten!“.
EvS: Was würden Sie jemandem raten, der darüber nachdenkt, bei den MALTESERN anzufangen?
JS: Ich würde sagen: Mach es! Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele junge Menschen uns unterstützen! Ihre Begeisterung, ihr Engagement und ihre frische Perspektive bringen eine unglaubliche Energie in die Arbeit. Der MALTESER Hospitaldienst steht für Hilfe: Dort, wo Not ist, dort, wo sonst keiner hingreift, da greifen wir hin und unterstützen wir – und das mit großer Freude. Man spürt eine tiefe Dankbarkeit. Es tut gut zu helfen, helfen zu können. Es ist schön zu sehen, wie Hilfe angenommen wird. Es ist schön, das Lächeln zurückzubekommen, welches man selbst gibt. Ganz ehrlich: Ich hoffe, dass es auch jemanden gibt, der mir hilft, wenn ich selbst in Not bin.
EvS: Welche Rolle spielen die christlichen Werte bei Ihrer Arbeit?
JS: Christliche Werte sind das Herzstück der MALTESER-Arbeit. Nächstenliebe und Respekt für die Würde jedes Einzelnen leiten uns in allem, was wir tun. Es geht nicht nur darum, Menschen zu helfen, sondern ihnen mit Offenheit und Liebe zu begegnen –unabhängig von ihrem Hintergrund. Der Glaube, dass jeder Mensch wertvoll ist und Hilfe verdient, gibt uns die Kraft und Motivation, uns für andere einzusetzen. Diese Werte sind für uns mehr als nur Worte – sie sind der Grund, warum wir uns mit ganzem Herzen für die Schwächeren in der Gesellschaft engagieren und täglich einen kleinen Unterschied im Leben anderer machen wollen.

Mag. Isabella Hartmann-Goertz machte die MALTESER-Ausbildung in den 80er-Jahren in Wien, wo sie während ihrer Studienzeit Erfahrungen bei Diensten im Sozial- und Sanitätsbereich sammelte. Besonders die großen MALTESER Wallfahrten nach Lourdes und Rom sowie die Teilnahme am ersten Internationalen MALTESER Sommerlager für behinderte Menschen aus vielen europäischen Ländern waren für sie prägende Erlebnisse. Sie war vom Zeitungsreferat bis zur Vizekommandantin in vielen Funktionen innerhalb der Organisation tätig und ist seit 2003 Mitglied des Malteserordens. Isabella Hartmann-Goertz lebt in Salzburg.
EvS: Was motiviert dich an deiner Arbeit bei den MALTESERN?
IH: Bei den MALTESERN engagieren sich viele Generationen in einer familiären Gemeinschaft. Auch viele unserer Betreuten, die wir über lange Zeit auf Wallfahrten und Unternehmungen für Menschen mit Behinderung begleiten dürfen, gehören zu dieser großen Malteserfamilie. Die Freude und der Glaube dieser oft von sehr schwierigen Lebensverhältnissen Betroffenen schenkt große Kraft für den eigenen Alltag.
EvS: Was hat dich bewogen, beim MALTESER Hilfsdienst ehrenamtlich mitzuwirken?
FS: Es gibt viele Wege, um sich einzubringen, zum Beispiel indem man Verantwortung für verschiedene Dienste wie Monatsmessen, Theaterbesuche, Bastelabende, Krankentransporte, Besuchsdienste, Ambulanzen oder Wallfahrten übernimmt und diese auch mitgestaltet. In unserer Organisation lernt man viel für sein Leben, kann Spaß haben, Neues ausprobieren und den zu betreuenden Menschen Zuwendung schenken. Die ehrenamtliche Tätigkeit beschenkt auch einen selbst, wenn man die Freude in den Augen der anderen sieht.
Laurine Bachour meldete sich mit 14 Jahren zusammen mit Freunden, deren Eltern bereits MALTESER waren, bei den Malteens an und wurde im Alter von 17 Jahren als Mitglied aufgenommen. Ein Jahr später übernahm sie die Leitung des Referats Public Relations in Salzburg. Heute ist sie 19, studiert am Juridicum in Wien Internationale Rechtswissenschaften und ist sowohl im Bereich Salzburg als auch in Wien für die MALTESER aktiv.


www.kunstmesse-kammer.com




„Ich frage mich manchmal, ob Männer und Frauen wirklich zueinanderpassen. Vielleicht sollten sie einfach nebeneinander wohnen und sich nur ab und zu besuchen.“
Katharine Hepburn (*1907, † 2003), US-amerikanische Schauspielerin
Nein, eine Frau muss nicht so streitsüchtig sein wie Xanthippe, die Ehefrau des griechischen Philosophen Sokrates (469–399 v. Chr.), um einem Mann das Leben schwerzumachen. Sie kann ihren nicht mehr geliebten Partner auch mit ganz harmlosen, ja sogar liebevoll erscheinenden Sätzen enttäuschen, verärgern, verletzen oder in den Wahnsinn treiben. Und ihn ganz freiwillig das Weite suchen lassen. Beispielweise so:
1. „LIEBST DU MICH?“ – Diesen Satz können sich wirklich nur Jungverliebte leisten. In späteren Beziehungsjahren kann es sein, dass diese Frage von ihm mit einem sachlichen „EH“, einem verlegenen „SCHON“ oder einem unbeholfenen „PASST“ beantwortet wird. Wenn er aber clever schnell genug antwortet: „JA, ICH LIEBE DICH“, können Sie immer noch nachsetzen: „ACH, DAS SAGST DU DOCH NUR SO.“
2. „GEFALLE ICH DIR?“ – Was, um Gottes willen, soll der arme Kerl denn anderes antworten als „JA“!? Ein erfahrener Mann weiß, dass er sich, je schneller er dies tut, umso früher wieder seinen anderen Beschäf-
tigungen zuwenden kann. Lassen Sie nun aber nicht locker! Weitere Fragen sind: „BIN ICH DIR NICHT ZU DICK / DÜNN / BLOND / LAUT / LEISE …?“ Ihrer Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt, und irgendwann wird ihm der Geduldsfaden schon reißen.
3. „VERMISST DU MICH?“ – Dieser Satz ist besonders dann geeignet, wenn Sie wissen, dass er in Gesellschaft telefoniert. Flüstert er ein leises „JA“ ins Telefon, legen Sie mit „WIE SEHR?“ nach – das wird ihn verlegen und unsicher machen.
4. „HAST DU EINE ANDERE?“ – Ist Ihr Partner Ihnen treu, verletzt ihn Ihr Misstrauen. Ist er Ihnen untreu, möchte Sie aber (noch) nicht freiwillig verlassen, muss er lügen. Das kann für phantasielose Männer ausgesprochen mühsam sein. In beiden Fällen haben Sie Ihr Ziel, ihn aufzuregen, erreicht.
5. „WO WARST DU?“ – Die meisten Männer hassen es, kontrolliert zu werden. Wenn er Ihnen wahrheitsgemäß antwortet, setzen Sie nach: „UND MIT WEM?“ Spätestens dann wird er sich eingeengt fühlen.
Nein, eine Frau muss nicht so streitsüchtig sein wie Xanthippe, die Ehefrau des griechischen Philosophen Sokrates (469–399 v. Chr.), um einem Mann das Leben schwerzumachen.
6. „DU HAST SCHON WIEDER …!“ – Vollkommen egal, mit welchem Argument Sie diesen Satz fortsetzen, er kann Ihren Partner zur Weißglut bringen.
7. „WAS SOLL ICH ANZIEHEN?“ – Vier Worte, die an und für sich wie eine harmlose Frage klingen, aber die meisten Männer werden garantiert in diese Falle stolpern. Um das Problem zu lösen, werden sie Ihnen Vorschläge machen. Der Clou liegt nun darin, zum Beispiel weder das von ihm vorgeschlagene gelbe noch das grüne Kleid anzuziehen, sondern in einem blauen Hosenanzug oder Outfit zu erscheinen, von dem Sie wissen, dass er es nicht leiden kann. Anfangs wird Ihr Partner sich nur wundern, später haben Sie das erreicht, was Sie wollen: Er wird sich ärgern.
8. „ZU HAUSE HABEN WIR DAS IMMER SO GEMACHT.“ – Auf diese Weise zeigen Sie Ihrem Partner, dass Sie etwas Besseres sind und er Ihnen nicht im Mindesten das Wasser reichen kann. Auch Vergleiche mit seinen Eltern könnten ihn rasend machen.
9. „MEINE FREUNDIN HAT GESAGT …“ –Stundenlange Monologe über Ihre beste Freundin werden ihm hoffentlich klarmachen, dass diese für Sie an erster Stelle steht. Geschichten über deren neuen Liebhaber werden ihn wohl kaum aufregen – es sei denn, er selbst ist der besagte Lover.
10. „WANN KOMMST DU NACH HAUSE?“ –Diese Frage ist für einen freiheitsliebenden Mann so was von lästig, besonders wenn er sich auf den Weg zu seinen Kumpeln, zu Sportveranstaltungen oder gar zu einer noch geheim gehaltenen neuen Liebe macht.
11. „SOLLTEN WIR NICHT BESSER DOCH EINEN FACHMANN RUFEN?“ – Dieser Ausspruch wirkt leider nur bei übertrieben selbstsicheren Hobby-Handwerkern, aber davon gibt es ja eine Menge.
12. „FRAG DOCH MAL …“ – Dass Sie ihm die Lösung des Problems nicht zutrauen, wird ihn ärgern, und sein Selbstwertgefühl sinkt, wenn er zugeben muss, dass er etwas nicht weiß oder nicht allein bewältigen kann.
13. „JETZT NICHT!“ – Eine solche Zurückweisung ist dann angebracht, wenn sich Ihr Partner Ihnen zärtlich zuwendet. Lässt er nicht von Ihnen ab, legen Sie sich eine Reihe von wirksamen Ausreden zurecht, sei es Migräne, die „Tage“ (die auch Monate dauern können), die Kinder, der Stress mit der Putzfrau oder ein Telefonat mit Ihrer besten Freundin. Letzteres wird ihn wahrscheinlich am meisten treffen.
14. „SCHLÄFST DU SCHON?“ – Diese Frage wirkt insbesondere dann, wenn er müde und erschöpft von der Tagesarbeit neben Ihnen im Bett liegt und keinerlei Anstalten macht, sich Ihnen zu widmen.
15. Hat er die Punkte 1 bis 14 geduldig ertragen, könnten Sie ihn ernsthaft verletzen, indem Sie ihn, wenn er sich nach erfolgtem Liebesspiel stolz und seiner Männlichkeit bewusst in die Laken fallen lässt, fragen: „WAR’S DAS ETWA SCHON?“
Bleibt nach Befolgung dieser Ratschläge Ihr Partner immer noch an Ihrer Seite, dann ist er entweder lethargisch, taub oder ein Masochist. In jedem Fall sollten Sie sich überlegen, ob das Leben mit ihm nicht auch positive Seiten hat.

ZWISCHENZEUGNIS
Wenig bereitet einen auf das erste Gespräch über die akademischen Leistungen des eigenen Kindes vor. Denn noch viel schlimmer, als selbst beurteilt zu werden, ist es, die Beurteilung über sein eigenes Kind zu erdulden – und vor allem anzunehmen. Ich selbst war keine eifrige Schülerin und dennoch – zumindest in der Volksschule – immer mit Vorzug gesegnet. Nun musste ich lernen, dass es gar keine Noten mehr gibt, die einen direkten Vergleich zulassen. Nein, nun sind es Farben, um die Kinder nicht zu kränken. Dafür wurde ein Farbschema erdacht, das die Noten ersetzen soll; dazu kommt ein schriftlicher Aufsatz der Lehrerin, in dem sie die Leistungen des Kindes beschreibt. Klingt trotzdem nach Beurteilung – und das Farbsystem ersetzt dann eben das Zahlensystem. Aber Beurteilung ist nun einmal Beurteilung, und dann kränkt vielleicht keine Zahl 3, sondern die Farbe Orange. Doch vielleicht sehe ich das als Nicht-Pädagogin zu eng. Obwohl ich während meines Studiums Nachmittagsbetreuung in zwei Wiener Privatschulen gab – Computerkurse. Da lernte ich die kindliche Seele kennen und ver stand, dass das Leben nicht Schwarz und Weiß ist. Ich erkannte auch, dass die Wertzuweisung durch eine Autoritätsperson mit ziemlicher Wahr scheinlichkeit das Ego eines Menschen bis zum letzten Atemzug prägt. Ein Mensch wird Zeit seines Lebens versuchen, seinen Selbstwert zu mes sen oder aufzubauen. Oftmals einen Wert, den er von Pädagogen zugewiesen bekam oder – im tragischen Fall – eben nicht. Eltern spielen hier manchmal eine tragende Rolle, oft aber lediglich eine Nebenrolle. Ein Pädagoge hingegen kann das Leben eines Menschen mit Zuspruch fundamen tal verändern. Nehmen Sie mich zum Beispiel: Hätte mir Herr Professor Steiner, mein damaliger Deutschlehrer, nicht gesagt: „Beatrice, du bist he rausragend, die deutsche Sprache ist dein Talent“, würden Sie hier niemals etwas zu lesen bekommen. Bis zu seinem Urteil war ich mir dessen als Teenager gar nicht bewusst gewesen. Ich dachte, ich wäre sogar völlig talentbefreit. Denn meine Volksschullehrerin hat mich – trotz meiner guten Noten – niemals gelobt. Das Zeugnis meines Sohnes war grün, aber wir stehen ja erst am Anfang.
Beatrice Tourou, bt@schlossseiten.at
Es ist wohl vielen Menschen nicht klar, aber Freundschaft kann man lernen. Und auch lehren. Ein Kind ist ja nicht a priori angepasst, es passt sich langsam an die Gegebenheiten an, wo auch immer dieses Kind ist. Weltweit gibt es kulturelle und schichtabhängig eklatante Unterschiede im sozialen Miteinander. Was jedoch alle eint, ist, dass ein hilfsbereiter Mensch schon mal bessere Karten hat als ein boshafter. Ein guter Leitgedanke ist, sich immer aus einem Gefühl der Großzügigkeit dem anderen zu nähern. Dr. Jordan Peterson, ein kanadischer Intellektueller, meint, es wäre die Aufgabe der Eltern, ein Kind bis zum 6. Lebensjahr so zu erziehen, dass es sozialisationsfähig ist und andere Kinder mit ihm spielen möchten, da sich sonst eine Spirale nach unten öffnet, wo das Kind verbittert. Wer also seinem Kind das Geschenk der Freundschaft machen möchte, erklärt, wie man sich großzügig gibt, den Keks teilt, das Auto borgt oder auf jemanden zugeht und sagt; „Ich möchte gerne dein Freund sein.“

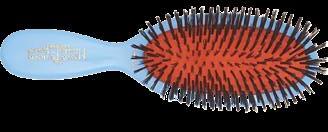


Während unseres kürzlichen London-Trips ist uns bei Harrods dieses Bett ins Auge gesprungen. Es hat viel gekostet. Wie viel genau, haben wir verdrängt. Waren es 10.000 GBP? Oder doch 20.000 GBP? Egal, jedenfalls ist es unique.
1. Bett, „The Dragons JB23 – Jeep Bed“, bei Harrods, Preis auf Anfrage | 2. Bettwäsche, von H&M, um € 39 | 3. Borstenbürste, von Mason Pearson, um € 114 | 4. Pyjama, von Trotters, um € 70






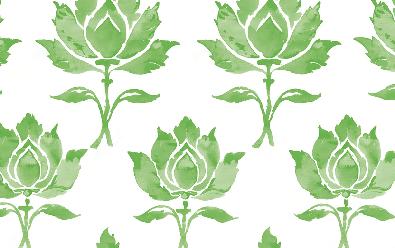
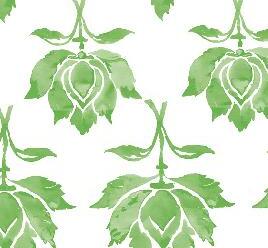




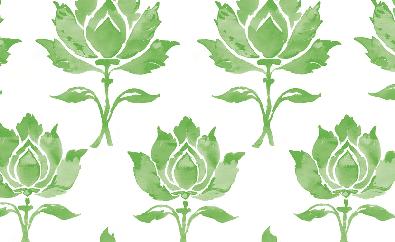


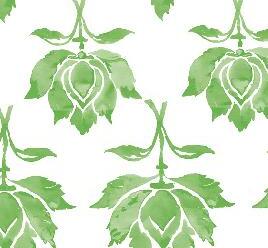




SCHLOSSSEITEN
Lensing Kommunikationsagentur Himmelpfortgasse 11/14 1010 Wien, Österreich
Tel: +43 664 527 30 70 http://magazin.schlossseiten.at magazin@schlossseiten.at
HERAUSGEBER: Lisa Gasteiger-Rabenstein
Joseph Gasteiger-Rabenstein
REDAKTION: Lisa Gasteiger-Rabenstein Mag. Clarissa Mayer-Heinisch
Mag. Eva-Maria von Schilgen-Arnsberg
Dr. Hannelore Lensing, Laura Stauder Beatrice Tourou, Sophia Sungler
ANZEIGEN: Lisa Gasteiger-Rabenstein
PROJEKT MANAGEMENT BRANDS: Andrea Ponholzer
LEKTORAT: Die Fehlerwerkstatt www.diefehlerwerkstatt-sbg.at
LAYOUT UND GRAFIK : Marie Riedl – www.marieriedl.com
Joseph Gasteiger-Rabenstein Beatrice Tourou
FOTOS: Joseph Gasteiger-Rabenstein
IDEAS & CONNECTIONS: Mag. Eva-Maria von Schilgen-Arnsberg
ABONNEMENT/AUSGABE NACHBESTELLEN: abo@schlossseiten.at +49 40 23670 308
Unser Abo wird über die PrimaNeo GmbH & Co. KG, Überseering 10a, D-22297 Hamburg abgewickelt.
DRUCK:
Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H. Wienerstraße 80, A-3580 Horn
Die Zeitschrift und alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Für unverlangt eingesandtes Bild- und Textmaterial wird keine Haftung übernommen.




Abonnement mit 4 Heften
inkl. Versand & MwSt.
49, - EUR (Österreich) 54, - EUR (Deutschland) 59, - CHF (Schweiz)
Bestellen Sie ganz einfach per E-Mail: abo@schlossseiten.at , per Telefon +49 40 23670 308 oder online unter http://magazin.schlossseiten.at

Mag. Evelyn Hendrich, MSc


BURGANLAGE

Imposante, sanierte (Event-) Burganlage mit 2.750 m² Nutzfläche, großteils barrierefrei, umgeben von 19,5 Hektar Grund im Murtal, moderner Panoramalift, Wärmepumpen-Heizung, privates Hideaway oberhalb der Burg mit herrlichem Ausblick über das Tal, Parkplatz für 100 PKWs und Hubschrauberlandeplatz, 25 km von Graz, KP 9.950.000 €
BAD ISCHL IM SALZKAMMERGUT

JAHRHUNDERTWENDEVILLA

Mehrparteien-Jahrhundertwendevilla in der Kaiserstadt mit einer 240 m² Maisonettewohnung mit hohem großen Salon, Terrasse und Wintergarten sowie drei weiteren 50-60 m² Wohnungen mit eigenem seitlichen Eingang auf 2.233 m² großem parkartigem Grundstück mit schönem Altbaumbestand, KP 1.980.000 €

SCHLOSSANLAGE

Sanierte, erhaben situierte Schlossanlage mit ca. 5.000 m² Nutzfläche in geschichtsträchtiger Marktgemeinde, verteilt auf ein Schloss mit Innenhof und vielseitig nutzbarem Nebengebäude, über 4 Hektar umgebender Grund, wenige Minuten zur A1 Linz-Salzburg & Pyhrn-Autobahn, HWB 216, KP 4.990.000 €
BAD ISCHL IM SALZKAMMERGUT

JAHRHUNDERTWENDEVILLA

Repräsentatives zentrumsnahes Anwesen mit schöner Jahrhundertwendevilla, mit 11 hellen Zimmern und 5 eleganten Marmorbädern auf ca. 484 m² Wohnnutzfläche zzgl. Balkonen, auf großzügigen 5,7 ha Grund mit Altbaumbestand und kleinem Teich sowie Alleezufahrt mit Vorfahrtsrondell, KP 4.690.000 €
KÄRNTEN KÄRNTEN


Liebevoll saniertes barockes Gewerken-Schloss mit ca. 830 m² WFl., auf ca. 3.167 m² Grund, 20 Zimmer, 9 Bäder, schöner Innenhof, viele originale Ausstattungsdetails wie Türen, Böden, Geländer, Öfen, sehr guter Zustand inkl. Kaltdach, teilweise Luftwärmpumpe, 17 km nach Klagenfurt, HWB 252, fGEE 2,31, KP 1.990.000 €

SCHLOSS HISTORISCHER WOHNTURM

Ensemble einer mittelalterlichen Befestigungsanlage mit sanierten Wohn-/ Wehrturm mit ca. 120 m² WNFl. auf 3.463 m² Grund oberhalb des Friesacher Ortskerns samt Panoramablick, Wohnzimmer mit Galerie, Küche, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, 4 separate WCs, Dachterrasse samt Sauna, Zufahrtsmöglichkeit, angeschlossen an Strom, Wasser, Kanal, KP 700.000 €


ACCESSOIRE
Wie der Stern, der bei 6 Uhr die Zifferblätter der neuen Constellation Kollektion erhellt, strahlt auch Kaia Gerber mit einem Modell aus MoonshineTM Gold an ihrem Handgelenk. Zwei Stars in perfekter Harmonie, vereint in einem Spiel aus Licht und Schatten, Schönheit und Präzision.