Bericht Sabbatical
Christoph Schindler
Zeitraum April bis Juni 2025
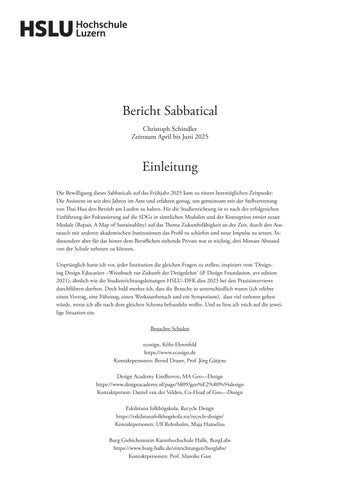
Christoph Schindler
Zeitraum April bis Juni 2025
Die Bewilligung dieses Sabbaticals auf das Frühjahr 2025 kam zu einem bestmöglichen Zeitpunkt: Die Assistenz ist seit drei Jahren im Amt und erfahren genug, um gemeinsam mit der Stellvertretung von Thai Hua den Betrieb am Laufen zu halten. Für die Studienrichtung ist es nach der erfolgreichen Einführung der Fokussierung auf die SDGs in sämtlichen Modulen und der Konzeption zweier neuer Module (Repair, A Map of Sustainablity) auf das Thema Zukunftsfähigkeit an der Zeit, durch den Austausch mit anderen akademischen Institutionen das Profil zu schärfen und neue Impulse zu setzen. Insbesondere aber für das hinter dem Beruflichen stehende Private war es wichtig, drei Monate Abstand von der Schule nehmen zu können.
Ursprünglich hatte ich vor, jeder Institution die gleichen Fragen zu stellen, inspiriert vom ‘Designing Design Education –Weissbuch zur Zukunft der Designlehre’ (iF Design Foundation, ave edition 2021), ähnlich wie die Studienrichtungsleitungen HSLU–DFK dies 2023 bei den Praxisinterviews durchführen durften. Doch bald merkte ich, dass die Besuche so unterschiedlich waren (ich erlebte einen Vortrag, eine Führung, einen Werkstattbesuch und ein Symposium), dass viel verloren gehen würde, wenn ich alle nach dem gleichen Schema behandeln wollte. Und so liess ich mich auf die jeweilige Situation ein.
Besuchte Schulen
ecosign, Köln-Ehrenfeld
https://www.ecosign.de
Kontaktpersonen: Bernd Draser, Prof. Jörg Gätjens
Design Academy Eindhoven, MA Geo—Design
https://www.designacademy.nl/page/5809/geo%E2%80%94design
Kontaktperson: Daniel van der Velden, Co-Head of Geo—Design
Eskilstuna folkhögskola, Recycle Design
https://eskilstunafolkhogskola.nu/recycle-design/ Kontaktpersonen: Ulf Rehnholm, Maja Hamelius
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, BurgLabs
https://www.burg-halle.de/einrichtungen/burglabs/ Kontaktpersonen: Prof. Mareike Gast
Wie kam der Kontakt zustande?
Von der ecosign hörte ich erstmals 2021 im Rahmen der Weiterbildung «Nachhaltigkeit für Lehrpersonen in Design & Kunst» über einen Gastbeitrag von Davide Brocchi, damals Dozierender an der ecosign und Mitherausgeber von «Die Geschichte des nachhaltigen Designs», den ich daraufhin auch noch einmal in die Vortragsreihe «Objektdesign Perspektiven» einlud. Rückblickend fand ich heraus, dass die erste Leiterin des Master Design an der HSLU, Nina Gellersen, zwischen 2009 und 2011 drei «Sustainable Summer Schools» gemeinsam mit der ecosign und dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie organisiert und durchgeführt hatte.
Was ist die ecosign?
Die ecosign Akademie ist eine private Hochschule in Köln mit Fokus Nachhaltigkeit, selbst bezeichnet sie sich als Akademie. Sie wurde 1994 von der damals 26jährigen Simone Fuhs https://de.wikipedia.org/wiki/Karin-Simone_Fuhs ins Leben gerufen. Sie sah die bestehenden Hochschulen so weit weg von einem Engagement im Bereich Nachhaltigkeit, dass sie sich mehr davon versprach, ihre eigene Hochschule zu stemmen. Heute hat die ecosign in Köln Ehrenfeld 300 Studierende in jeweils BA/MA Ausbildungen in Nachhaltiges Design und Nachhaltiges Design Management, die jeweils im Frühjahr und im Herbst starten.
Was ist mir geblieben?
‘Nachhaltiges Design’ umfasst verschiedene Ausrichtungen von Produktdesign über Fotografie, Illustration und Kommunikationdesign. Allein gemein ist eine Grundausbildung Nachhaltigkeit, die Spezialisierung wird über Wahlfächer nach Ermessen der Studierenden zusammengestellt. Anders gesagt ist die Nachhaltigkeit an der ecosign das, was bei HSLU–DFK die jeweilige Bachelor-Studienrichtung ist, die Profilierung an der ecosign erfolgt vergleichbar mit der Auswahl der Wahlfächer bei DFK.
Die Studierenden kommen aus der Region. Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Direktorin Simone Fuhs war wegen Krankheit abwesend, ich wurde von Jörg Gätjens https://www.ecosign.de/team/gaetjens-joerg/ und Bernd Draser https://www. ecosign.de/team/draser-bernd/ empfangen.
Vogelsanger Strasse 250 50825 Köln-Ehrenfeld
Deutschland
https://www.ecosign.de
Kontaktpersonen: Bernd Draser, Prof. Jörg Gätjens
Die Werkstatt ist, wie bei einer privat geführten Institution nicht anders zu erwarten, insgesamt klein und nur mit Handwerkzeugen ausgerüstet, die ein Arbeiten mit geringem Unfallrisiko erlauben. Bei den Abschlussarbeiten auf der Webseite und auch in der Dauerausstellung im Foyer zeigt sich, dass die formale Ausarbeitung der Projekte nicht mit unseren fokussierten Bachelor-Programmen mithalten können. Es wäre spannend gewesen, sich hierüber mit den Studierenden auszutauschen – anders als bei Besuchen an anderen Schulen wurde ich an der ecosign nicht in den Unterricht einbezogen. 2/3 der Absolvent:innen gehen in die Selbstständigkeit, sagten mir die beiden Dozierenden – aus der eigenen Erfahrung ahne ich dahinter das Prekariat.
Was nehme ich mit?
Aus dem Besuch an der ecosign nehme ich zwei Dinge mit:
• Ich habe grossen Respekt vor den beiden Büchern, die in vermutlich unbezahlter Arbeit mit grosser Sorgfalt von den Dozierenden der ecosign zusammengestellt wurden. So gelungen mir beide Werke erscheinen, haben sie erstaunlich wenig Beachtung gefunden, vielleicht auch, weil sie in kleinen, spezialisierten Verlagen veröffentlicht wurden. Wie so oft bestätigt sich hier, dass Erfolg und Qualität nicht zwingend aneinander gekoppelt sind.
• Die zweite Beobachtung hängt eng mit der ersten zusammen: Es ist nicht nur eine (administrative) Last, sondern auch ein grosses Geschenk, eine öffentliche, in unserem Fall kantonale Institution wie die HSLU zu sein und dadurch Förderung wie auch Sichtbarkeit zu erhalten. Die ecosign kennt selbst in der Nachhaltigkeitsszene kaum jemand – beispielsweise Tom Wüthrich, der sich wirklich in das Thema Nachhaltigkeit im Produktdesign vertieft hat und die beiden oben genannten Bücher nicht nur kannte, sondern sogar im eigenen Werk darauf referenziert, war die ecosign als Institution nicht bekannt.

Die Dozierenden teilen sich eine gemeinsame Küche mit den Studierenden, was zusätzliche Kontaktmöglichkeiten schafft. Alles blitzsauber, aufgeräumt und angeschrieben.

So wie hier sehen die Unterrichtsräume aus: Keine Ateliers, sondern veranstaltungsbezogene Räume, die nach den Farben ihrer Wände benannt sind.

Im Foyer werden Besucher:innen mit einer Dauerausstellung ausgewählter Bachelor-Arbeiten begrüsst.

Die Werkstatt ist übersichtlich, wie bei einer Privatschule nicht anders zu erwarten. Es werden nur Werkzeuge mit einer vertretbaren Verletzungsgefahr zur Verfügung gestellt. Links eine kleine Designsammlung.
> Geo–Design MA
Wie kam der Kontakt zustande?
Die Design Academy Eindhoven DAE kenne ich mit Abstand am längsten der besuchten Schulen. Es muss 1999 gewesen sein, als ich während des Praktikums in Rotterdam mit Kolleg:innen anlässlicher Präsentation der DAE Masterarbeit von Peter Trummer https://www.petertrummer.com/about zum ersten Mal die Witte Dame https://www.dewittedame. nl/ betrat – ein frühes Philips-Fabrikgebäude aus den 1920er Jahren mitten im Zentrum, direkt gegenüber der ersten Philips-Glühlampenproduktion, die heute das Philips-Museum beherbergt. Möglicherweise wurde dort in den 1950er Jahren das Röhrenradio produziert, das von meiner Mutter erst an mich und vor ein paar Jahren an meinen Sohn weitergegeben wurde.
Spätestens jetzt verliere ich mich gänzlich, denke aber, das deutlich geworden ist, dass sich meine Wege mit der DAE schon viele Male gekreuzt haben. Nur eines noch: Die DAE zählt zweifelsohne zu den relevanten Ausbildungsstätten im europäischen Design. Nicht zuletzt, weil sie sich immer neu erfindet. Vom Geo-Design Master erzählte mir zuerst Suzan Curtis, unsere längst pensionierte ‘Contemplation & Critique’ (Englisch)-Dozierende.
Was ist der MA Geo—Design?
Der Geo—Design Master wurde 2020 von Formafantasma –Andrea Trimachi und Simone Farresin — https://formafantasma.com/ aufgebaut und wird seit Herbst 2023 von Metahaven – Vinca Kruk und Daniel van der Velden — weitergeführt. Ich konnte jeweils die ersten beiden Jahrgänge der Abschlussarbeiten während der Dutch Design Week besuchen. Ich hatte Mühe, in der Kürze einer Ausstellung den Zugang zu finden, spürte aber, dass sich dahinter mehr verbarg, als ich sah. Geo—Design ist der jüngste Masterstudiengang an der DAE. Geo-Design – „Design mit der Erde“ – verwebt die klassische Definition von Design - die Komposition von in sich geschlossenen Objekten und Systemen, die auf singuläre Probleme antworten - mit dem erweiterten Kontext von Rückkopplungsschleifen und Komplexität, die die kognitiven, ökologischen und ethischen Grundlagen des Designs aufbrechen.
Emmasingel 14
5611 AZ Eindhoven
Niederlande
https://www.designacademy.nl/
Kontaktperson: Daniel van der Velden
Der Geo—Design MA untersucht, wie Design mit Hilfe von Forschung, neuen Objekten, neuen Prototypen und Aktionen, Grafikdesign und Kino eine Schnittstelle zu Phänomenen in der physischen und materiellen Welt bilden kann. Der Begriff Nachhaltigkeit fällt dabei bewusst nicht, obwohl sämtliche Projekt sich im Kontext der ökonomischen, ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeit verorten. Ich konnte einen halben Tag im Unterricht verbringen und mit Daniel van der Velden zu Mittag essen – aufgenommen habe ich hier nicht. Konkret konnte ich einen Vortrag von Daniel besuchen und mich dann eine Stunde mit den Studierenden über ihre Projekte austauschen. Das war enorm anregend, weil die Studierenden aus den verschiedensten Bereichen kamen, über die sie klug und differenziert reflektierten – ich erinnere mich an Industrial Design, aber auch Kunst, Graphic Design und Architektur. Unter den etwa dreissig Personen im 1. und 2. Jahr waren nur zwei Niederländer:innen. Das Studienjahr ist (an der gesamten DAE) in Trimester geteilt, was insbesondere für Studierende aus sonnigeren, wärmeren und trockeneren Ländern im Wintertrimester anspruchsvoll sein kann.
Während des Lunch mit Daniel diskutierten wir die Zukunft der DAE. Ohne hier ins Detail gehen zu wollen, spielt ASML für Eindhoven aktuell und in der Zukunft die Rolle, die Philips bis in die 90er Jahre gespielt hat. Entsprechend führt kein Weg an einer Auseinandersetzung mit den Themen von ASML vorbei. Hierbei kann insbesondere Geo-Design mit einer Aufarbeitung all der komplexen Zusammenhänge in der Entwicklung von Maschinen für die Produktion von Chips eine wichtige Rolle spielen.
Was ist mir geblieben?
• die klassischen Designdisziplinen mit ihrem Fokus auf singuläre Produkte bilden die Komplexität der Verknüpfungen nicht ab, lassen sie aber bereits ahnen – dem Bedürfnis, diesen nachzuspüren, gehen die Studierenden des Geo-Design Master nach
• ich habe bisher noch kein Masterprogramm besucht, dass seinen Namen so sehr verdient wie dieses – ohne ein Grundlagenverständnis und aus einem Bachelor, ggf. ergänzt mit der Praxis wäre es schwer möglich, den komplexen Zusammenhängen nachzugehen.
• es gibt keine separaten Theorievorlesungen, die Theorie ist fach- und projektbezogen. Oder anders gesagt, die Studierenden äussern ihre theoretischen Überlegungen nicht in Text-, sondern in Projektform.
• Der Geo-Design Master versucht nicht, auf bestehende Berufskategorien abzuzielen. Verschiedene Studierende haben geäussert, dass sie sich mit einem erweiterten Horizont wieder mit der Disziplin, aus der sie kommen, auseinandersetzen möchten, aber nicht in ihrer ursprünglichen Rolle.
• der Anspruch des Masters, aus einer konkreten Beobachtung in der Welt auf eine Metaebene zu kommen und von dort wieder zurück in eine physische Umsetzung ist sehr hoch, was wohl auch der Grund dafür ist, dass ich zu den Abschlussprojekten der ersten beiden Durchführungen keinen Zugang nicht finden konnte.
Was nehme ich mit?
Luzern ist nicht Sitz von ASML, aber es gibt immerhin Emmi, Schindler und Mobility, letzteres sogar eine Firma mit einem zukunftsorientierten Anspruch. Wäre es nicht vielversprechend, hier Synergien zu suchen? Im grösseren strategischen Rahmen ist dies nicht Aufgabe einer einzelnen Studienrichtung, aber auch einfache modulbezogene Kooperationen wären lohnend.
Der Master Geo-Design hatte eine wirklich tolle Atmosphäre, was ich vor allem an den Menschen festmache – sowohl den geistig beweglichen internationalen Studierenden, die die Sicherheit der Menschen aus Elternhäusern ausstrahlen, in denen sie diesen Umgang mit der Welt bereits früh kennenlernen durften, aber auch Daniel van der Veldens ungewöhnlichen und herausfordernden Gedankengängen an den Rändern der Designwelt. Metahaven halten sechs solche Vorträge pro Jahr (oder war es das Trimester?).
Im Objektdesign wäre das geeignete Gefäss für eine solche Haltung die Fachtheorie mit Mònica Gaspar und Vera Sacchetti, dort sind wir anders als in den Methodenmodulen frei in den Inhalten.
Konkret würde ich gerne mit Mònica und Vera darüber nachdenken, wie sich ein Modul gestalten würde, wenn es seinen Ausgang nicht in der Designer:innen Praxis nimmt, sondern in der Reflexion, um nicht Theorie zu sagen. Dies würde vermutlich bedeuten, die Modulleitung eines Fachmoduls auf Mònica und/oder Vera zu übertragen.
Der andere Umgang mit der Komplexität der Welt wäre reflektiertes Vermeiden davon – in der Firma gehen wir meist diesen Weg. Wir produzieren so lokal wie möglich mit Partnerfirmen unseres Vertrauens und sehr wenigen Materialien, deren Wege bei Beschaffung und Weiterverwendung überschaubar sind (vor allem Holz, wenig Metall).
Ich glaube aber, dass dies für die Lehre zu einschränkend und auch langweilig wäre – es scheint intellektuell fordernder und weitaus interessanter, die Studierenden der Komplexität auszusetzen und sie allenfalls deren Einschränkungen selbst treffen zu lassen.

Der Eingang zur Design Academy Eindhoven im 2. Stock der Witte Dame sieht aus wie der Eingang in eine Firma, rechts davon (nicht im Bild) sogar ein Drehkreuz. Die Studierenden nehmen lieber den Hintereingang.

Warteplätze für die Werkstätten, hier für die Holzwerkstatt. Wie lange es wohl dauert, bis Wood 15 an der Reihe ist?

In den Werkstätten kann die HSLU–DFK gut mithalten, ist sogar vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet.

Die Atelierplätze im MA Geo—Design. Es gibt persönliche Tische und eine geteilte Besprechungsfläche, jedoch im Vergleich mit den Produktdesign-Ateliers bei HSLU–DFK weniger Stauraum.
Wie kam der Kontakt zustande?
Von der Eskilstuna folkhögskola hatte ich erstmals vor sechs Jahren gehört, als eine unserer Studierenden sich nach dem ersten Semester für einen Abbruch im Objektdesign entschied, um in Eskilstuna ‘Recycle Design’ zu studieren. 2021 gründete sie das Recycle Design Bern https://recycledesign.be/. Vor der Reise berichtete sie mir ausführlich beim einem Zmittag von ihren Erfahrungen.
Was ist das Recycle Design?
Folkhögskola heisst tatsächlich Volkshochschule, spielt allerdings im schwedischen Ausbildungssystem eine ganz andere Rolle als in der Schweiz oder anderen Ländern. Viele der dortigen Studierenden, mit denen ich gesprochen hatte, betrachten das Jahr dort als eine Vorbereitung für ein Hochschulstudium – ganz ähnlich der Rolle des Vorkurses in der Schweiz, nur sind die Ausbildungen an der schwedischen Volkshochschule bereits auf eine Ausbildungsrichtung fokussiert. Die Hochschulausbildungen reservieren jeweils bestimmte Kontingente für Absolvent:innen der Volkshochschulen.
Ich konnte mich zwei Stunden mit Ulf Rehnholm, dem Co-Rektor, austauschen und verbrachte weitere vier Stunden im ‘Recycle Design’ selbst mit Maja Hamelius, einer der drei Dozierenden.
Anders als die anderen Ausbildungen ist das Recycle Design nicht im Stadtzentrum, sondern als Teil der ReTuna återvinningscentral (wörtlich Nachnutzungszentrale) am Stadtrand angesiedelt und dort seit zehn Jahren mit der ReTuna Återbruksgalleria https://www.retuna.se/english kombiniert, der weltersten Recycling Mall. Diese einzigartige Konstellation macht den Reiz der Ausbildung aus. Inzwischen folgten einige andere schwedische Volkshochschulen dem Ansatz des ‘Recycle Design’ aus Eskilstuna, die Verknüpfung zum Recyclingzentrum und zur Shopping Mall bleibt jedoch einzigartig. Die Stadt Eskilstuna ist über die Volkshochschule hinaus bestrebt, Verbindungen des Recycling Center mit ihren 70 Kindergärten und 35 Primarschulen zu etablieren, um dort den sorgsamen Umgang mit Materialien und Produkten von Beginn an Teil des Unterrichts zu machen. Die Mall besteht aus etwa zehn unterschiedlichen Second Hand Läden mit unterschiedlichen Schwerpunkten, es gibt etwa Antiquitäten, servicebetreutes HiFi, Spielzeug und einen Second Life IKEA.
ReTuna återbruksgallerie
Folkestaleden 7
635 10 Eskilstuna Schweden https://eskilstunafolkhogskola.nu/recycle-design/
Kontaktpersonen: Ulf Rehnholm, Maja Hamelius
Dennoch ist im Verlauf der zehn Jahre seines Bestehens das ‘Recycle Design’ kein Phänomen mehr, das ein nationales oder sogar internationales Publikum anzieht: die Studierenden kommen allesamt aus der Region um Eskilstuna, Unterrichtssprache ist Schwedisch. Das zeigt sich insbesondere darin, dass die Eltern aller Studierenden, mit denen ich gesprochen hatte, bei Volvo arbeiten.
Die Atmosphäre war eher die eines Hobbyraumes oder eines Hauswirtschaftsunterrichts. Ich bin vorsichtig genug, dies nicht in direkten Zusammenhang mit dem denkbar unausgeglichenen Geschlechterverhältnis zu stellen.
Für die Projekte stehen die Materialien aus dem Recyclingzentrum zur Verfügung. Es ist überraschenderweise nicht die Idee, daraus verkaufsfähige Produkte zu machen und so entstehen recht aufwändige Bastelprojekte für den persönlichen Gebrauch. Obwohl die Objekte im Zentrum stehen, sind die Bearbeitungsmöglichkeiten sehr bescheiden, was den Bastelcharakter verstärkt. Keine der Studierenden hat davon gesprochen, aus diesem Ansatz eine Berufsbefähigung zu machen. Die Stimmung ist seltsam müde und uninspiriert, ganz anders als in der Social Science Klasse im Zentrum von Eskilstuna, die ich am Morgen besucht hatte.
Das Shopping Center wirkt insgesamt etwas in die Jahre gekommen, wird aber dennoch recht gut besucht, allerdings von einem ganz anderen Publikum als in einem kommerziellen Shopping Center.
Was nehme ich mit?
Am meisten hatte ich bereits vor drei Jahren mitgenommen: Das Modell aus Eskilstuna diente mir als Vorbild, als ich vor drei Jahren versuchte, den damaligen OFFCUT Luzern möglichst nah und eng am Departement Design Film Kunst zu positionieren. Das geschäftliche Scheitern des OFFCUT Luzern wäre durch eine engere Bindung an die HSLU wohl nicht verhindert worden.
Nach dem Besuch und dem Austausch mit den Studierenden bin ich allerdings nicht mehr so sicher, ob ein so enger Rahmen genügend Möglichkeiten bietet.

Am Stadtrand von Eskilstuna liegt links des Zaunes die ReTuna Återbruksgalleria (Recycling Mall), rechts davon die ReTuna Återvinningscentral (Recycling Center) – und integriert in die Reycling Mall die Eskilstuna Folkhögskola mit ihrer Ausbildung Recycle Design – Återbruk.

Jedes Unternehmen in der ReTuna Återbruksgalleria verfügt über eine Lagerfläche in der gemeinsamen Lagerhalle.

IKEA Second Chance hat in der Lagerhalle eine kleine Reparaturwerkstatt integriert.

Die Eingangshalle der zweigeschossigen Återbruksgalleria — den besten Platz gegenüber vom Eingang sichert sich IKEA Second Chance mit einem Angebot, dass so auch in schweizerischen IKEA Filialen zu finden ist.

Ihre Materialien bezieht die Recycle Design Ausbildung direkt aus der ReTuna Återvinningscentral. Es gibt einen Schwerpunkt auf Textiles, im Materiallager wie in der Bearbeitung.

Im zweiten Stock sind die Räume der Eskilstuna Folkhögskola – Recycle Design untergebracht. Die anderen Ausbildungen der Volkshochschule befinden sich im Stadtzentrum, so das es nur wenige Schnittflächen mit anderen Studierenden gibt.

Die Werkstatt ist gleichzeitig der Seminarraum.
> BioLab, SustainLab, XLab
Wie kam der Kontakt zustande?
Über Martin Büdel, den Leiter der Zentralen Werkstätten und des Designhauses, habe ich im Sommer 2003(?) während eines Workshops bei Peter Sulzer, dem Biographen Jean Prouvés, die Burg Giebichenstein kennengelernt. Mareike Gast, seit 2016 Professorin an der Burg Giebichstein, hatten wir im Oktober 2018 in unsere Vortragsreihe Objektdesign Perspektiven eingeladen und umgekehrt nahm ich dann 2019 bei einer Podiumsdiskussion der Burg am Bauhaus Dessau teil. Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Saale) ist für unsere Absolvent:innen jeweils eine interessante Adresse für ihre Masterausbildung. Im vergangenen Herbst hatten wir unseren Auftritt an der Dutch Design Week schräg gegenüber dem Auftritt der Burg Giebichenstein. Insbesondere auf der Assistenzebene fand dort ein intensiver Austausch mit gegenseitigen Besuchen über Bigna Suter (OD) und Laura Schwyter (TX) statt.
Was sind die BurgLabs?
«Die BurgLabs sind Plattformen für disziplinübergreifende Forschung» heisst es auf der entsprechenden Webseite. Es gibt drei unterschiedliche Labs. Alle drei Ansätze sind relativ weit weg vom klassischen Profil einer Produktdesigner:in, öffnen aber auch das Feld:
BioLab (platform for living matter)
SustainLab (platform for critical matter) XLab (platform for digital matter)
Das BioLab der Burg Giebichenstein befasst sich mit Produkten, die aus wachsenden Mikroorganismen hergestellt werden. Voraussetzung dafür sind sterile Räume, wie sie eine Kunsthochschule üblicherweise nicht bieten kann und was auch für das BioLab an der Burg Giebichenstein eine grosse Herausforderung darstellt. Der entscheidende Baustein für die erfolgreiche Projekte im BioLab scheint mir weniger die industrieküchenartige Einrichtung mit ihren Edelstahloberflächen, sondern vielmehr die Anstellung eines Biotechnlogen zu sein. Dessen Expertenwissen macht den entscheidenden Unterschied, auch zu den anderen beiden Labs, die sich zwar nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, aber ohne die entsprechenden Experten auch weit weniger Profilierung haben.
ReTuna återbruksgallerie
Folkestaleden 7
635 10 Eskilstuna Schweden https://eskilstunafolkhogskola.nu/recycle-design/
Kontaktpersonen: Mareike Gast
Das SustainLab ist in den gleichen Räumen wie die Materialsammlung der Burg Giebichenstein (seit 2021 als einzige nichtschweizerische Institution Teil des Materialarchivs) untergebracht und wird von den gleichen Personen betreut, wodurch die Grenzen zwischen den beiden Bereichen unscharf bleiben. Inhaltlich fokussiert das SustainLab auf Materialien aus dem ‘Boden’, also auf den Bereich der Erdkruste zwischen dem darunterliegenden Gestein und dem darüberliegenden abgestorbenen Pflanzenmaterial, wie etwa Sand oder Lehm.
Das XLab empfinde ich vor meinem Hintergrund aus der Digitalen Fabrikation (sechs Jahre CAAD Digitale Fabrikation am D-ARCH der ETH, Mitgründung designtoproduction GmbH, Promotion in der technikhistorischen Aufarbeitung im Bereich Digitale Fabrikation) als die am wenigsten eigenständige Einrichtung der drei Labs. Beinahe jede Architekturhochschule hat in den letzten fünfzehn Jahren in Roboterarme investiert, das D-ARCH der ETH mit ihrem NCCR (National Competence Center in Research) Digital Fabrication ist dort über den vom Bund grosszügigst finanzierten Zeitraum von zwölf Jahren zum Flaggschiff aufgestiegen. Daneben gibt es für eine Kunsthochschule mit zwei kleinen Roboterarmen nichts mehr zu gewinnen. Eine Verbindung mit der Industrie ist hier wenig spürbar, ganz anders als in der ETH.
Was nehme ich mit?
Mit vergleichsweise wenig Aufwand kann sich die Kunsthochschule Halle mit den BurgLabs in der Aussenwahrnehmung profilieren. Die allermeisten Zutaten davon sind bei uns ebenfalls vorhanden: ein Teil des Materialarchivs, computergestützte Steuerung (Modul von Tom Pawlowsky bei Digital Ideation), die Ansätze eines BioLabs. HSLU–DFK hat hervorragende Werkstätten, die international keinen, aber auch gar keinen Vergleich scheuen müssen, dürfte sich aber wie auch an anderen Stellen herausnehmen, etwas selbstbewusster mit Alleinstellungsmerkmalen zu kommunizieren. Dies gilt für HSLU—DFK auf Departementsebene wie auf der Ebene der Studienrichtung.

Das BioLab wirk auf den ersten Blick wie eine etwas kleinere, sterile Industrieküche.

Das XLab ist das Robotic-Lab und besteht im Kern aus zwei kleinen, vielfältig nutzbaren Roboterarmen.

Das SustainLab ist in den gleichen Räumen wie die Materialsammlung untergebracht und wird von den gleichen Personen betreut, wobei die Grenzen unscharf bleiben.

Die Zwischenpräsentation ihres Moduls kombiniert Mareike Gast mit einem kleinen Symposium. Hervorzuheben ist die Beteiligung der ‘Bundesagentur für Sprunginnovationen’.
Ich habe dieses Sabbatical als enormes Geschenk und auch als Privileg empfunden. Drei Monate lang die Administrationsroutine delegieren zu dürfen und sich interessengesteuert und frei im Fachgebiet zu bewegen, ist eine Chance, die nicht viele Arbeitnehmer:innen bekommen.
Wenn ich die tatsächliche Durchführung des Sabbaticals mit dem Antrag vergleiche, habe ich meine Ziele vollumfänglich erreichen können:
Schulen besuchen
Die im Antrag für den Austausch angegebenen Schulen ecosign in Köln, Geo-Design MA an der Design Academy Eindhoven, Recycle Design an der Folkhögskola Eskilstuna konnte ich besuchen, darüber hinaus hatte ich noch Gelegenheit, die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle zu besuchen. Diese Art der Einblicke und zahlreiche Gespräche mit Studierenden wären in den Semesterferien ausserhalb eines Sabbaticals so nicht möglich gewesen.
Konkrete Erkenntnisse
• Aufwertung des Hintergrundwissens / Theorie, Co-Modulleitung Theorie/Praxis, Auseinandersetzung mit Komplexität der Welt jenseits des singulären Produkts (von DAE, Eskilstuna)
• Verknüpfung/Module mit den grossen lokalen Firmen: Emmi, Schindler, Mobility (von DAE)
• Relevanz von formaler Professionalität, Attraktivität
• Inspiration Sommerworkshop? (ecosign)
• Vortragende Bernd Draser (ecosign), Zeinab Serage (Recycle Design Bern via Folkhögskola Eskilstuna)
• Vorstellung Masterprogramme Geo—Design und Burg Giebichenstein im Objektdesign
SAC Tourenleiter Sommer II Alpinismus ist seit fünfundzwanzig Jahren Teil meines Lebensentwurfs, zunächst über Skitouren des Zürcher Studenten (sic) Skitourenclub ZSS, ab 2010 dann über die Zürcher Sektion Uto des SAC. Seit 2014 bin ich Tourenleiter Sommer für Hochtouren und Alpinklettern, seit 2023 bin ich die Tourenbereichsleitung Hochtouren der Sektion Uto mit ihren 12’000 Mitgliedern, nicht unähnlich meiner Rolle als Studienrichungsleitung.
An der nächsten Stufe der Tourenleiterausbildung ‘Sommer II’ (tatsächlich eine Prüfungswoche), bin ich zweimal gescheitert: 2018 habe ich die Prüfungswoche unterschätzt und mich unzureichend vorbereitet, 2022 wurde ich bereits nach dem Hüttenaufstieg mit starken Krämpfen und schmerzbedingtem Bewusstseinsschwund ausgeflogen.
Die Sommer II Ausbildung findet jeweils parallel zur Werkschau statt, ein Fokus darauf ist im normalen Anstellungsverhältnis nicht möglich. Und rückblickend auf die jüngsten Erfahrungen komme ich zur Einsicht, dass ab einem bestimmten alpinistischen Niveau eine Vereinbarkeit mit einem bürgerlichen Leben nur schwer möglich ist. Und so habe ich das gesamte Sabbatical um diese Prüfung herum gebaut.
Über das gesamte Sabbatical legte ich einen Schwerpunkt auf körperliche Aktivitäten, nicht alle davon mit dem Alpinismus verbunden. Unter anderem konnte ich mir die Zeit nehmen, das Kletterzentrum im Gaswerk Schlieren kennenzulernen und mit dem Velo den Stelvio überqueren. Aber es waren auch unspektakuläre Dinge dabei, wie die Slackline im Kongens Have in Kopenhagen oder die lange Wanderung mit meinem Sohn in überschwemmungszerstörten Schluchten in der Comarca Los Serranos.
Dank des Fokus konnte ich im dritten Anlauf die Prüfungswoche bestehen, komme aber auch zur Einsicht, dass ich im Begriff bin, damit meinen alpinistischen Zenit zu überschreiten. Ich möchte nicht zur Risikogruppe der 50jährigen, sich selbst überschätzenden Männer gehören und werde mich längerfristig neu orientieren.
Christoph Schindler im Juli 2025