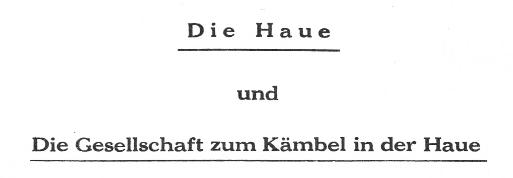
und
Die Gesellschaft zum Kämbel in der Haue.
Vortrag von Herrn Dr. Hans Steiner, 1. Zunftschreiber.
Sechseläuten 1962
Sehr geehrter Herr Zunftmeister! Sehr geehrte Herren Zünfter!
Die Vorsteherschaft hielt es für angezeigt - dies auch um verschiedenen Wünschen entgegenzukommen -, die Zünfter wieder einmal über das "Haus zur Haue" und die "Gesellschaft zum Kämbel in der Haue" zu unterrichten.
Ich hole dazu etwas aus und zwar zuerst mit einer kurzen historischen Skizze, dann wie es überhaupt zum Kauf der Haue und zur Gründung der Gesellschaft zum Kämbel in der Haue kam, und schliesslich wie diese Gesellschaft heute finanziell dasteht.
Historisches.
Ueber die baulichen Verhältnisse in der Stadt Zürich bis ins frühe Mittelalter ist nur sehr wenig bekannt. Bei der ersten Stadtbefestigung bildete ein Moränenhügel hinter dem Haus zur Haue zusammen mit den Bauten des heutigen Zunfthauses zur Saffran und der Haue die äusserste Wehranlage der Stadt flussabwärts. Den Abschluss dieses Festungsringes gegen die Limmat machte wahrscheinlich ein Tor, das an Stelle des Hauses zur Haue gestanden haben muss. Es ist denkbar, dass dieses Tor Vorläufer der späteren Arkaden mit den drei wuchtigen Eckpfeilern dieses Gebäudes und auch der anderen Bögen am Limmatquai geworden ist.
Die Häuser in nächster Nähe des Rathauses gehörten im Alten Zürich zu den begehrtesten Privathäusern, denn das Rathaus war nicht nur politisch sondern auch wirtschaftlich der Mittelpunkt Zürichs. Anstelle der Haue standen ursprünglich drei einzelne Häuser: Die beiden sog. "Wetzwilerhäuser", die Berchtold Wetzwiler (1325-1344) gehörten, und das sog. "Rapoltzhus" (vermutlich das Hinterhaus
der Haue), das um 1425 in den Urkunden erscheint. An der Front standen das obere und das untere Wetzwilerhaus; das obere, anstossend an den "Büchsenstein", einem Johann, das untere einem Hartmann Wetzwiler gehörend. 1280 wird das obere erwähnt als Haus des Ritters Rudolf von Glarus. Die Wetzwiler waren reiche und angesehene Kaufleute, die meist auch dem Rate angehörten. Beide Häuser wurden um 1375 in ein Haus, das "Wetzwilerhus", verwandelt. Die Wetzwilerhäuser grenzten flussabwärts an das Haus zum "Mörsel", welches seinerseits an dasjenige zum "Schiff" anstiess. Diese letztgenannten beiden Häuser gehörten der Krämerzunft und wurden später in eines (Saffran) zusammengezogen. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts ordnete ein Schiedsspruch des Stadtbaumeisters einen Streit zwischen den Wetzwilern und den Krämern wegen einem Kamin und einem Ehgraben, die sich zwischen dem Wetzwilerhaus und dem Haus der Krämer befanden.
Die fahrbare Strasse unter den Bögen war die alte Reichsstrasse und wurde bis zum "Rüden" "Fischmäret“, "Hüenermäret" oder auch "Ankemäret" genannt. Da wurde, wie die Namen sagen, der Fischmarkt und der Hühnermarkt abgehalten. Nach den Stadtbüchern vom Jahre 1344 war jeder Klasse von Verkäufern ihr besonderer Standort angewiesen. Dieser Handel stand in den Händen der Gremplerzunft. Die Gasse war mit hölzernen Dielen überdeckt und wurde deshalb vom Schiff his zum Rüden auch mit dem Namen “unter den Tilenen" bezeichnet. Unter den Tilenen befanden sich zu jener Zeit 11 Häuser; heute sind es noch fünf. Damals standen die Häuser noch unmittelbar an der Limmat. Die Gegend um die Marktgasse hiess Salzmarkt. Da trieben schon im 13. Jahrhundert die Salzleute ihren dazumal noch privaten Salzhandel. Erst ums Jahr 1483 wurde der Salzhandel städtisches Regal. Die Salzleute gehörten ursprünglich in die Krämerzunft und kamen erst später - etwa um 1650 - zum Kämbel.
Das Wetzwilerhaus kam dann ums Jahr 1442 in den Besitz der Salzleute. Diese gaben dem Haus das Emblem des Bergbaues, eine Haue, und nannten es fortan "Salzlütenhus" oder "Salzhouwe" oder kurz "Houwe". Aus dieser Zeit, um 1450, stammen die beiden wuchtigen Spitzbogen und die gotischen Gewölbe unter den Arkaden.
Der Name "Haue" erscheint erstmals ums Jahr 1450. Von 1440 bis 1486 war die Ziegerschaft als Gruppe der Gremplerzunft in der Haue sesshaft und entrichtete der Bruderschaft zum Grossmünster einen jährlichen Zins von einem Pfennig. Die Haue war zu jener Zeit nämlich ein Erblehen der Abtei des Gotteshauses Felix und Regula. Die Grempler hatten in der Haue für sich eine Trinkstube eingerichtet. Es bestanden dazumal neben den Weinhäusern, die für jedermann offen waren; für besondere geschlossene Kreise sog. "Trinkstuben", die gewöhnlich nur den Mitgliedern offen standen. Eine Sitte, die sich nach der Brun'schen Zunftverfassung (1336) auf alle Zünfte ausdehnte noch ehe sie besondere Zunfthäuser für ihre Zwecke erwarben. So auch die Grempler im Haus zur Haue, bis sie 1487 das Haus zum Kämbel am Münsterhof erwarben und sich seither Kämbler und nicht mehr Grempler nannten. Uebrigens ging es in diesen Trinkstuben gar nicht immer sehr sittsam zu. Aus alten Urkunden ist darüber zu erfahren, dass im Jahre 1465 die Brüder Heini und Hans Waldmann in die Haue kamen um mit andern Bekannten zu Nacht zu speisen und dort einen Rudolf Meyer trafen, der dann; nachdem die Waldmann’s fortgegangen waren, Hans Waldmann's Weib öffentlich der Unzucht zeihete. Das wurde den beiden gleich in die Peterhofstatt, wo sie "im grossen Mugg" wohnten, hinterbracht. Sofort begaben sie sich in die Haue zurück - Hans barschenkel und mit einem Schwert versehen. Damit schlug und verwundete er den Meyer. Die Sache kam vor den Rat und am Sonntag darauf musste Meyer
auf der Kanzel der Kirche öffentlich seine Anschuldigungen zurückziehen. Auch im Jahre 1467 ist von einem grossen Streit auf der "Drinkstuben zu der Howen" die Rede und anno 1488 war der Stubenknecht Rudy Weingarten Zeuge in einem Schlaghandel beim Kartenspiel auf der "Howen". Vergessen wir nicht, es war dies die Zeit nach dem alten Zürichkriegdie Stadt verlottert, das Volk verwildert und hemmungslos. Zürich hatte durch Krieg und Pest sehr stark gelitten. Die Einwohnerzahl war von 12’000 im Jahre 1350 auf 4’500 im Jahre 1467 gesunken. Die Stadt hatte damals 1200 Häuser, wovon 73 leer standen und über 100 Häuser gehörten der Geistlichkeit. In den engen Gassen grenzten die Häuser gewöhnlich an die schmalen sog. Ehgräben (gemeinsame Gräben), in welche die Aborte mündeten, Küchenabwasser flossen etc. Die Stadt war ein kleiner Ort; die Häuser, selbst der Vornehmen, meist aus Holz gebaut mit Ställen und Gäden, die Strassen ohne Pflaster. Hunde, Katzen, Hühner und Schweine liefen oft noch frei auf den Gassen und Plätzen herum. So waren die Verhältnisse in Zürich, dem Vorort der Eidgenossenschaft, zu einer Zeit da Zürich begann in der Weltpolitik eine bedeutende Rolle zu spielen, da fremde Gesandte und Fürsten die Stadt besuchten. Erst die Züge in fremde Länder und besonders die Burgunderkriege machten das Volk mit einem gewissen Luxus bekannt.
Im Jahre 1465 erwarb ein Hans Peter Nüscheler die Haue, in der er bereits seit 1454 wohnte. Dieser war Gürtler und stammte aus Reutlingen (Württemberg); er gehörte zur Zunft zur Saffran. Nüscheler wurde später Bürgermeister; er starb 1485. Hans Peter Nüscheler ist der mutmassliche Stammvater dieses Geschlechts, dem in der Folge namhafte Zürcher-Bürger entstammten, u.a. auch der bekannte Glasmaler Heinrich Nüscheler.
Nach Nüscheler wechselte das Haus verschiedene
Male die Hand (1500 Heinrich Kramer, 1516 Heinrich Fürstenauer, 1517 Tuchhändler Hans Müller) bis im Jahre 1532 der Tuchhändler (Gwandtmann) Konrad Rollenbutz - ebenfalls Saffranzünfter - die "Houwe unter den Tilenen" kaufte und dabei 11 Gültbriefe, die das Spital auf dem Haus hatte, ablöste. Am 26. März 1553 starb Konrad Rollenbutz des Raths, und die Haue wurde von seinen drei Söhnen eine zeitlang gemeinschaftlich besessen. Nach dem Tode des ältesten Sohnes Hans teilten die beiden andern Mathee und Cunrat, nach Auskauf des Sohnes ihres Bruders, das Haus. Es wurde dabei genau festgelegt, welche Teile des Hauses samt "Zugehörung" jeder dieser Brüder erhalten soll. Jeder gewährte dem andern für dessen Anteil ein Vorkaufsrecht. Aus dieser Teilung geht deutlich die mittelalterliche und komplizierte Gliederung des ursprünglichen Doppelhauses hervor. Aus jener Zeit, anno 1567 (2. August) stammt ein Beschluss des Rates, wonach das Aufhängen der Wäsche unter den zwei Bogen unter dem RollenbutzenHaus und auf dem ganzen Fischmarkt bei zehn Pfund Busse verboten, dagegen von der Ankenwaage bis zum Rüden erlaubt sei.
In den Jahren 1577 — 1583 ging die Liegenschaft dann allmählich ganz in den Besitz des Schultheissen Salomon Hirzel-Rollenbutz (1544-1601) über. 1562 heiratete nämlich die Enkelin Regula, Tochter des sehr begüterten Mathäus Rollenbutz zur Haue, den genannten Salomon Hirzel. Auch dieser war Saffranzünfter. Nach dessen Tod gelangte die Haue erbweise zuerst an seinen Sohn Jakob und als dieser 1609 ohne Leibeserben gestorben, an dessen Bruder Salomon Hirzel (1580-1652), der 1613 Zunftmeister zur Saffran und 1637 Bürgermeister wurde. Er wohnte selbst in der Haue. Im Jahre 1620 liess Salomon Hirzel das Haus vollständig umbauen und kaufte noch das Hinterhaus, genannt "zum Schlegel", dazu. Bei diesem Umbau liess Hirzel den markanten Erker am
Haus anbauen, zuoberst auf dem Staffelgiebel den in Stein gehauenen liegenden Hirsch - das Wappentier der Hirzel - aufsetzen und im Giebelfeld das Doppelwappen der Familien Hirzel, Keller vom Steinbeck und Meyer von Knonau anbringen. Elisabeth Keller vom Steinbock und Küngolt Meyer von Knonau waren die beiden Gattinnen von Salomon Hirzel. Ein ähnliches Wappenrelief mit den drei Schildern und der Jahreszahl 1630 befindet sich heute noch im Treppenhaus der Haue. Seither hat das Aeussere der Haue keine wesentlichen Veränderungen mehr erfahren. Ueber 200 Jahre blieb das Haus im Besitz der Familien Hirzel; 1637 wohnte im väterlichen Haus auch Hans Caspar Hirzel-von Orelli (1617-1691), seit 1669 Bürgermeister.
Nach dem Tod von Bürgermeister Salomon Hirzel fiel die Haue seinem Sohne Salomon Hirzel-Werdmüller (1605-1664) zu, der wie sein Vater Kaufmann war und im politischen Leben als Statthalter eine angesehene Stellung einnahm. Eine von ihm übernommene Handlung führte zu grossen Verlusten, die dann seine Söhne Salomon, Beat, Hans Jakob und Bernhard Hirzel in Konkurs brachten. Aus der Konkursmasse zog ihr Onkel, der oberwähnte Bürgermeister Hans Caspar Hirzel-von Orelli, die Häuser zur Haue und zum Schlegel an sich. In der Folge vererbten sich die beiden Häuser an:
Hans Jakob Hirzel-Escher (1658-1706), 1687 Zwölfer zur Saffran, Heinrich Hirzel-Locher (1683-1751), 1710 Zwölfer zum Kämbel, Hans Jakob Hirzel-Heidegger 1723-1751) und dessen Bruder Heinrich Hirzel-Hottinger (1724-1787), welcher 1780 in Konkurs geriet.
Am 27. September 1780 wurden laut Weisung betreffend den Konkurs des Tuchhändlers Heinrich Hirzel zur Hauen die Häuser "zur Haue" und "zum Schlegel" 6
den drei Kindern für ihr Muttergut zugesprochen, und am 28. Februar 1781 durch den Ratsprocurator Joh. Casp. Waser als Curator ad litem der drei Hirzel'schen Geschwister an Frau Anna Barbara Sprüngli geb. Albrecht verkauft. Noch im gleichen Jahre verkaufte Frau Sprüngli das Haus "zum Schlegel" an den Buchdrucker Heinrich Ziegler.
Durch Erbschaft gelangte die Haue 1783 an das Geschlecht der Rordorf, zuerst an J. Rudolf RordorfSprüngli (1746-1808), Obmann der Goldarbeiter, Schwiegersohn der Anna Barbara Sprüngli-Albrecht. Sein Sohn Johann Jakob Rordorf (1789-1825) war ebenfalls Goldschmied, zugleich aber auch Maler. Von ihm stammen die 3 auf Türfüllungen gemalten Bilder im Entresol:
Haue-Fassade, unter den Bögen und davor spielende Kinder(Reifler und Stelzenläufer);
Männerfigur in Prunkgewand mit grossem Hut und Federbüschen, gestützt auf ein Wappenschild (Rordorf);
Edelmann mit grossem Hut und Federbusch und Wappenschild (Sprüngli).
Die drei Kinder dieses J.J. Rordorf blieben unverheiratet; Johann Rudolf (1817-1899) verliess das elterliche Haus, während die beiden Töchter Barbara Louise (1816-1870) und Emilie (1819-1891) bis zu ihrem Tode in der Haue wohnten.
So hat die Zunft zum Kämbel eigentlich keine engeren historischen Beziehungen zur Haue; vielmehr ist damit die Zunft zur Saffran verbunden. Eine historische Beziehung des Kämbels zu ihr besteht lediglich durch die Tatsache, dass die Grempler im 15. Jahrhundert während einigen Dezennien in der Haue regelmässig ihre Zusammenkünfte hielten und dort ihre Trinkstube eingerichtet hatten; in einem gewissen Grad auch noch dadurch, dass die Grempler nach 1486 noch eine Gült auf dem Hause besassen.
Aus einer Urkunde, datiert vom 7. Juli 1487 (Samstag nach St. Ulrich), geht nämlich hervor, dass auf dem Haus zur Haue eine Gült von 10 Pfund zu Gunsten der Gremplerzunft bestand. Diese Urkunde mit Siegel des Kapitels des Gotteshauses Felix und Regula zu der Abtei Zürich befindet sich im Archiv der Haue. 1592, am 31. Oktober, wurde diese Gült der Grempler durch Salomon Hirzel-Rollenbutz abgelöst. Erwähnt könnte noch folgende Tatsache werden, dass im Jahre 1694 ein Hirzel, Johann Ludwig Hirzel, Zunftmeister vom Kämbel war, also nicht zur Saffran gehörte. Dieser Johann Ludwig Hirzel (geb. 16. Dezember 1652, gest. 5. Mai 1710) war 1675 Zünfter zum Kämbel, 1681 Pfleger der Zunft und wurde 1694 Zunftmeister und am 22. April 1710 Bürgermeister. Er starb aber bereits kurz nach seiner Wahl am 5. Mai 1710. Auch er wohnte in der Haue, war verheiratet zuerst mit einer Ursula Hess und kurz vor seinem
Tod noch, am 11. April 1710, mit einer Anna Landolt. Er starb kinderlos. Das Portrait (ein Stich) dieses "Dom. Joh. Ludovicus Hirzelius" befindet sich im Archiv der Zunft.
Im Jahre 1878 kaufte August Beckert (1845-1926) von Emilie Rordorf die Haue. Dieser stammte aus Todtnau (Schwarzwald) und war Kolonialwarenhändler. Er benützte die ausgedehnten Kellerräumlichkeiten als Lagerraum für Obst und Südfrüchte. Im Hause soll es dazumal herrlich von Orangen etc. geduftet haben. August Beckert liess das ganze Gebäude im Jahre 1879 vollständig restaurieren. Vor diesem Umbau sah das Haus in der Fassade ungefähr so aus wie heute; nur auf den Stufen des Treppengiebels standen vasenähnliche Aufsätze aus Stein. Bei dieser Renovation liess Herr Beckert die Fassade mit Stuckgesimsen und gemalten Ornamenten versehen; auch wurden die gotischen Fenster der oberen Stockwerke verändert. Als August Beckert im Jahre 1926 starb, wurde sein Neffe Albert Beckert-Irniger (1882-
1953) Eigentümer der Liegenschaft. Dieser unterzog das Haus nochmals einer durchgreifenden Renovation. Dabei wurde das an der Fassade 1879 angebrachte Stuckwerk entfernt und der Treppengiebel wieder in die ursprüngliche Gestalt gebracht, d.h. die Vasenaufsätze beseitigt. Bei diesem Umbau wurde auch der Hirsch oben auf dem Giebel durch eine originalgetreue Kopie ersetzt. Dieser Hirsch gab vor Jahren Anlass zu einer amüsanten Episode. In einem Lokalkurier vom Februar 1936 ist zu lesen:
“Im Gweih vom Hirsch uf der Haue hät sich e Chatz so dumm verfange, dass sie eifach nümme hindersi und fürsi hät chöne. Sie hat gmiauet jämmerli. Viel Volch hät sich agsammlet und a de Hirsch ufe glueget und Verbarme gha mit dem arme Tierli. Es isch gläschteret worde über d'Architäkte, de Huseigetümer und d‘Behörde, wie me au chöni e sonen blöde Hirsch uf das Dach ufe setze. Derigs sötti me polizeilich verbüte. Anderi händ gmeint, me sött grad ufe gha und de stumpfsinnig Hirsch aberisse. D‘Polizei isch dänn cho, aher die hät au nöd chöne uf's Dach ufe. Zletscht isch d'Fürwehr mitere grosse Leitere agruckt. Dä wo hät müesse ufe chlättere, hät fürchterlich gfluechet wäge dem Mistvieh. Die Chatz heig ja nüt det obe zsueche, me sött ere grad de Grind umedreihe ...... Schliessli isch er dänn mit dem Büsi abecho, hät es uf do Bode gstellt, la laufe lah, und er sälber isch für sini heldehafti Tat frenetisch bejubelt worde."
Von der Erbengemeinschaft dieses Albert BeckertIrniger erwarb dessen Sohn, Walter Beckert, das Haus. 1956 verkaufte es derselbe mir, bzw. einer zu gründenden Gesellschaft. Herr Walter Beckert und Frau bewohnen heute noch die sehr schön eingerichtete Wohnung im zweiten Stock.
Hauskauf.
Anfangs März 1956 erfuhr ich, dass das Haus zur Haue verkauft werden soll. Ich kannte die Liegenschaft, denn bereits vor Jahresfrist war vom Kauf derselben die Rede. Meine Gesellschaft, die "NEUENBURGER" hatte sich dazumal sehr dafür interessiert und es im Hinblick auf einen eventuellen Kauf durch Architekt K. Knell begutachten und schätzen lassen. Was Lag für mich näher, als an ein Zunfthaus für den Kämbel zu denken! Interessenten waren eine Menge da. Ich setzte mich sofort mit dem Zunftmeister Dr. Hans Glarner - der gerade in Arosa in den Ferien war - in Verbindung, weiter mit Walter Guggenbühl, Notar Emil Bühler, Emil Kofmehl, Dr. Niklaus Rappold und einigen andern Zünftern, bei denen ich mich über die Idee eines Kaufes der Haue erkundigte. Alle waren davon begeistert.
In einer ausserordentlichen Vorsteherschaftsitzung wurde daraufhin beschlossen, sich grundsätzlich für den Kauf zu interessieren. Ich verhandelte daher sofort mit Herrn Walter Beckert über den Kaufpreis. Er nannte zuerst einen Preis um Fr. 780'000.- bis Fr. 800‘000.-. Inzwischen sprach sich die Verkaufsabsicht immer mehr herum; allerlei Interessenten meldeten sich, u.a. auch ein Widderzünfter und ein Saffranzünfter, und natürlich auch viele Spekulanten.
Eines Tages über Mittag telephonierte mir Herr Beckert, die Sache pressiere nun sehr, die Erben möchten abgelöst sein, wir müssten uns in den nächsten 48 Stunden entscheiden. Als Kaufpreis nannte er Fr. 810'000.--, dazu Teilung der Kosten, jedoch unter der Bedingung sofortiger Auszahlung von Fr. 330'000.-- in bar. Wo sollte ich so schnell einen solchen Betrag auftreiben? Der Umstand, dass die NEUENBURGER das Haus kannte und bereits früher schätzen liess, kam mir sehr zu statten. Ver-
schiedene dringende Telephongespräche mit meiner Direktion und mit Dr. Hans Glarner führten zur Zusicherung eines sofortigen Darlehens seitens der NEUENBURGER für eine erste und zweite Hypothek. Wir rechneten mit einem Darlehensbetrag von Fr. 700'000.-- in der Annahme, unter uns den Rest von Fr. 130'000.-- aufbringen zu können.
Mit dieser Zusicherung seitens der Direktion der NEUENBURGER und einigen begeisterten Zünftern im Rücken kaufte ich rasch entschlossen das Haus für mich. Notar Emil Bühler stand mir dabei für die zu erfüllenden Formalitäten unermüdlich bei. Er redigierte den Kaufvertrag für die öffentliche Beurkundung. Am 10. März 1956 kaufte ich das Haus von Walter Beckert mit einem übertragbaren Kaufrecht, jedoch befristet bis l. Juni 1956. Am gleichen Tag, am 10. März 1956, zahlte ich Walter Beckert den Betrag van Fr. 330'000.-- Die Haue war damit vorläufig in meinem Besitz.
Bis zum 31. Mai 1956 mussten wir uns entscheiden, ob schliesslich die Uebertragung meines Kaufrechtes auf die Zunft oder eine Gesellschaft von Zünftern oder auf die NEUENBURGER, die fest mit dam Hause rechnete, erfolgen soll. So war ich einige Zeit alleiniger Besitzer der Haue. Es ist Herrn Walter Beckert hoch anzurechnen, dass er bis zur Beurkundung sich an das mir gegebene Wort, das Haus für mich resp. für eine historische Gesellschaft zu reservieren, und sich auch an den mir genannten Kaufpreis hielt. Er hätte ohne weiteres etwas mehr erhalten können, besonders von einem bekannten Liegenschaften- und Landspekulanten, der beabsichtigte aus der Haue ein Appartementhaus zu machen. Für Herrn Beckert war es jedoch eine Ehrensache und die Erfüllung eines früher gehegten Wunsches seines Vaters, dass das Haus einmal in den Besitz einer ehrwührdigen Zunft übergehen sollte. Er persönlich wollte auch zur traditionellen Erhaltung des Hauses
beitragen und daraus kein Spekulationsobjekt werden lassen. Ohne uns wäre es vielleicht heute ein Appartementhaus. Meine Direktion hat es mir nicht so leicht verziehen, dass ich das Haus für den Kämbel reservierte. Für mich kam jedoch nichts anderes in Frage - und das hat meine Direktion, die mich als Zürcher und eifrigen Kämbler kennt, auch begriffen - als die Haue für den Kämbel zu retten, sofern dieser sich dazu bereit erklärte und sich auch Zünfter bereit fanden, ein mutiges Opfer zu bringen.
Am 4. April 1956 erliess dann die Vorsteherschaft einen Aufruf an alle Zünfter, sich am Kauf der Haue zu beteiligen. Am 7. Mai 1956 beschloss die Zunft in einem ausserordentlichen Hauptbott, sich am Kauf der Haue mit Fr. 30’000.-- zu beteiligen. Es fehlte dazumal nicht an Stimmen, die vom Kauf dringend abrieten; zum Teil aus sehr verständlichen Gründen und auch aus andern. Jeder Zünfter, der dazumal an diesem denkwürdigen Hauptbott teilnahm, wird sich an die ernsten Worte des verstorbenen Ehrenzunftmeisters Dr. Adolf Spörri erinnern, über die Verantwortung des guten und weisen pater familias sich selbst und seinen Kindern gegenüber. Dr. Spörri hatte ja neben guten auch schwere Zeiten auf dem Liegenschaftenmarkt erlebt. Er fand das Haus renditenmässig gesehen einfach zu teuer und hegte grosse Bedenken wegen der eventuell zu erwartenden Ueberraschungen mit einem "alten Haus" am Limmatquai. Es gab auch andere Stimmen, die herumboten der Steiner wolle der Zunft ein Haus anhängen und ein Geschäft machen, und solche, die sich gegen den Kauf wehrten, weil ihrer Ansicht nach das Haus sich nie zu einem Zunfthaus werde umbauen lassen.
Auf die Umfrage der Vorsteherschaft hatten sich 69 Zünfter bereit erklärt Anteilscheine zu Fr. 1'000.-- zu zeichnen, mit einem Totalbetrag von Fr. 228‘000.--. Ein voller, unerwarteter Erfolg in so
kurzer Zeit. Mit den Fr. 30'000.-- der Zunft standen uns Fr. 258'000.-- zur Verfügung. Dies erlaubte uns, mit einer 2. Hypothek von Fr. 100'000.-- auszukommen, während wir ursprünglich mit einer solchen von Fr. 200'000.-- rechneten.
So konnten wir an die Gründung einer Gesellschaft denken. Am 25. Mai 1956 gründete Dr. Niklaus Rappold, Dr. Hans Steiner, Rudolf Naegeli, Dr. Robert Lang, Heinrich Hatt-Bucher, Emil Kofmehl und Emil Bühler die "Gesellschaft zum Kämbel in der Haue". Wiederum hatte Notar Emil Bühler alles sachgemäss, fein säuberlich vorbereitet. Es ist überaus lobenswert, wie sich Emil Bühler von Anfang an mit Eifer und Begeisterung für den Haue-Kauf einsetzte.
Am 31. Mai 1956, d.h. am letzten Tage der mir gegebenen Frist, erfolgte die Uebertragung von mir auf den Namen dieser neu gegründeten Gesellschaft.
Der Kaufpreis betrug Fr. 810'000.-dazu kamen:
Beurkundungskosten Fr. 1'012.--
Schuldbrieferrichtungskosten Fr. 1'418.--
Handänderungssteuer Fr. 19'022.--
Total Kaufpreis Fr. 831'450.--
Im Anschluss daran erfolgten dann die StatutenBeratungen, eine konstituierende Generalversammlung der Zünfter die sich zum Mitmachen entschlossen hatten, und die Bestellung des ersten Vorstandes mit:
Dr. Niklaus Rappold als Vorsitzender, Dr. Hans Steiner als stellvertretender Vorsitzender und Aktuar, Rudolf Naegeli als Kassier, und den weitern Mitgliedern:
Dr. Robert Lang, Heinrich Hatt-Bucher, Dr. Hans Glarner, Carl Gianotti jun.,
d.h. 7 Mitgliedern, davon 4 aus der Vorsteherschaft und 3 andern Zünftern.
Haue-Gesellschafter können nur Zünfter der Zunft zum Kämbel sein. Der Zunftmeister soll gleichzeitig auch im Vorstand der "Gesellschaft zum Kämbel in der Haue" sein; so wurde in der Generalversammlung vom l. Juli 1957 beschlossen.
Zum Hause selbst wäre folgendes zu sagen:
Die Haue gehört zweifellos zu einem der markantesten Häuser am ganzen Limmatquai. Sie wirkt ganz besonders architektonisch mit ihrer hochaufstrebenden Fassade, mit den beiden wuchtigen Spitzbogen und den Kreuzrippengewölben, dem steilen Staffelgiebel mit seinen 7 Absätzen auf jeder Seite und der Krönung mit der Steinfigur des liegenden Hirschen, sowie dem ins Auge springenden zierlichen Erker im l. Stock mit den drei heute neu bemalten und goldverzierten Erkerwangen: links ein Schiff auf Wellen, vorne in der Mitte ein WappenschildMann mit Haue -, rechts eine Krämergestalt mit einer Waage und Salzsäcken und der Jahreszahl 1442, die an den einstigen Besitz durch die Salzleute erinnern sollen. Dieser Erker gibt dem Haus eine sehr vornehme und charakteristische Note. Die drei Wappenschilder oben im Giebelfeld (Hirzel, Keller vom Steinbock und Meyer von Knonau) sind heute leider etwas verwittert. Das Haus besteht aus zwei ineinandergehenden Häusern mit einem gemeinsamen Treppenhaus, dem Vorderhaus mit der Giebeltreppenfront, und einem Hinterhaus und zu hinterst einem kleinen Hofraum mit einem Schopf, der inzwischen abgebrochen wurde; Grundfläche: total 357,66 m2. Das Hinterhaus liegt um einige Stufen höher als das Vorderhaus. An der hinteren Hausfront finden sich über der Türe noch zwei kleine Wappenschilder aus Stein und der Jahrzahl 1620, die an den seinerzeitigen durch Salomon Hirzel vorgenommenen Umbau erinnern.
Am Fenster darüber ist auch noch die Jahrzahl 1548 im Gesims eingehauen mit dem Steinmetzzeichen des Meisters Melchior Bodmer (1543-1563).
Das Haus enthält zwei Läden im Erdgeschoss, Lagerräumlichkeiten im Keller und Sous-Sol, dazu 5 Mietwohnungen in den oberen Stöcken.
Auch im Innern des Hauses hat es heute noch bemerkenswerte Zeugen seiner Vergangenheit und Ausstattung. Das Hirzelwappen im Treppenhaus ist schon erwähnt worden. Im 1. Stock hat es eine altertümliche heimelige Stube mit einem alten Getäfer, einer spätgotischen Balkendecke und einem gut erhaltenen alten Turmkachelofen mit schwarz gemalten Landschaften; eine Zürcherarbeit ums Jahr 1790. In dieser Stube (heute Bureau Dr. Rappold) befindet sich auch um eine Stufe erhöht der viereckige Erker. Erwähnenswert ist auch das gut erhaltene gedrechselte Treppengeländer. In der Diele des 2. Stocks findet sich ein älteres Buffet mit eingelegten Feldern und gewellten Stäben, sowie in einem Wohnzimmer eine gut erhaltene Felderdecke, zwei schöne gewundene Türkonsolen mit reich geschnitzten Kapitellen.
Vermögenslage der Gesellschaft (Ende 1961):
Das Haus steht zu Buch mit Fr. 863'623.--
Vermögen in Wertschriften, Bankguthaben und Saalbaufonds Fr. 119'000.--
l. Hypothek Fr. 500'000.-- *
2. Hypothek Fr. 100’000.-- *
*beide zu 3¾ %
Zur Zeit des Hauskaufes betrugen die Zinseinnahmen Fr. 31'244.--; heute betragen dieselben netto Fr. 41'459.75. Es wird mit der Möglichkeit gerechnet, die Zinseinnahmen in den nächsten Jahren noch weiter um ca. Fr. 6'000.-- bis zu Fr. 8'000.-- erhöhen zu können. Das Haus warf im Jahre 1960 einen Gewinn von Fr. 13'552.50 und im Jahre 1961 von Fr. 16'176.80 ab.
Die „Gesellschaft zum Kämbel in der Haue“ zählt per Ende März 1962 95 Mitglieder von total 124 Zünftern, d.h. rund 75.6%
Das Eigenkapital der Haue beträgt Fr. 303'000.--; davon hat die Zunft 49 Anteilscheine, d.h. Fr. 49'000.-- in ihrem Besitz, und zwar:
Fr. 30'000.-- die seinerzeitige Einlage der Zunft,
Fr. 10'000.-- Geschenk von Ehrenzunftmeister Dr. Adolf Spörri,
Fr. 2'000.-- Geschenk von Emil Kofmehl-Steiger sel.,
Fr. 1'000.-- Geschenk von Dr. Emil Knopfli sel.,
Fr. 1'000.-- Geschenk von Eduard Elwert,
Fr. 1'000.-- Geschenk von Carl Gasteyger,
Fr. 1'000.-- Geschenk von Carl Gianotti sen.,
Fr. 2'000.-- Geschenk der Familie Ernst Manz, Fr 1'000.-- Geschenk der Veteranen 1961
_____________ Rebsamen, Dr. Wärtli und Zimmermann
Fr. 49'000.--
Im Besitze der Hinterbliebenen von verstorbenen Zünftern sind noch Titel über
Fr. 1'000.-- Ernst Kessler sel.,
Fr. 1'000.-- Otto Hartmann sel.,
Fr. 5'000.-- Jakob Schmid sel., welche der Zunft inzwischen testamentarisch vermacht worden sind.
Vom verstorbenen Zünfter und Veteran J.C. Müller hat die Gesellschaft letztwillig Fr. 1'000.-- erhalten.
11 Zünfter haben seinerzeit Beträge von je Fr. 10'000.--, 8 Zünfter von je Fr. 5'000.-- gezeichnet. Diese namhaften Zeichnungen gestatteten uns mit einer 2. Hypothek von nur Fr. 100'000.-- auszukommen.
Seit dem Erwerb der Haue sind darin verschiedene Umbauten vorgenommen worden; so wurde eine Zentralheizung eingerichtet, deren Kosten auf Fr. 38'000.- zu stehen kamen; sodann wurde die Wohnung im 1. Stock durch Dr. N. Rappold kostspielig renoviert und zu Bürozwecken hergerichtet. Er hat dies in sehr gediegener Weise getan, sämtliche nicht geringen Kosten des Umbaues und der Einrichtung auf sich genommen. Es ist damit ohne Zweifel der Wert der Liegenschaft erhöht worden. Bei dieser Sachlage kann ruhig gesagt werden, dass - auch vom finanziellen Standpunkt aus - der Kauf der Haue kein schlechtes Geschäft war.
In der Diskussion am ausserordentlichen Hauptbott vom 7. Mai 1956 spielte die Frage, ob in diesem Hause je ein Zunftsaal eingebaut werden könne, eine gewichtige Rolle. Diese Möglichkeit hatte vor dem Hauskauf Architekt Knell bereits entschieden bejaht. Seither ist dieses Problem weiter vom Vorstand verfolgt worden. Es steht heute fest, dass in der Haue für die Zunft ein Saal - wie er den Bedürfnissen der Zunft entsprechen soll – eingebaut werden kann, und zwar ohne das Vorderhaus zu beeinträchtigen, d.h. ohne wesentliche Einbusse an den Zinseinnahmen. Wie dieser Saalbau im Detail gestaltet und finanziert werden soll, darüber besteht noch Ungewissheit.
Der Frage jedoch, ob dieser Saalbau in der nächsten Zeit oder in einer etwas entfernteren Zukunft ausgeführt werden kann, darf im heutigen Zeitpunkt nicht allzu grosse Bedeutung beigemessen werden. Im Vordergrund steht doch in erster Linie und vor Allem die rühmliche Tatsache, dieses stattliche historische Haus an einer der schönsten Lagen der Altstadt für die Zunft gerettet und es für immer der Spekulation entzogen zu haben. Deshalb hat uns der Erwerb der Haue soviele Gratulationen aus allen Kreisen der Stadt, aller Zünfte, der gesamten Presse
und sogar in schriftlicher Form persönlich von Stadtpräsident Dr. Emil Landolt eingetragen.
Der Kämbel hat damit eine Mission übernommen und eine Tat vollbracht, die sich würdig anreiht an jene andere der Zunft, dem Reiterstandbild auf der andern Seite der Limmat - schräg vis-à-vis der Haue.
Zürich, Sechseläuten 1962.
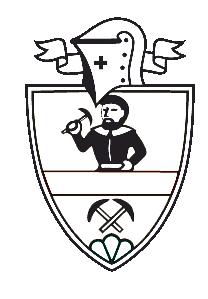
Originalgetreuer Nachdruck der schriftlichen Ausführungen von Dr. Hans Steiner, basierend auf einem Vortrag, den er an der Zunftversammlung vom 11. Dezember 1961 gehalten hat.
Geschenk des Haueherrn Rudolf M. Fürrer anlässlich seines runden Geburtstags, Weihnachten 2013
