DIE TOTE STADT

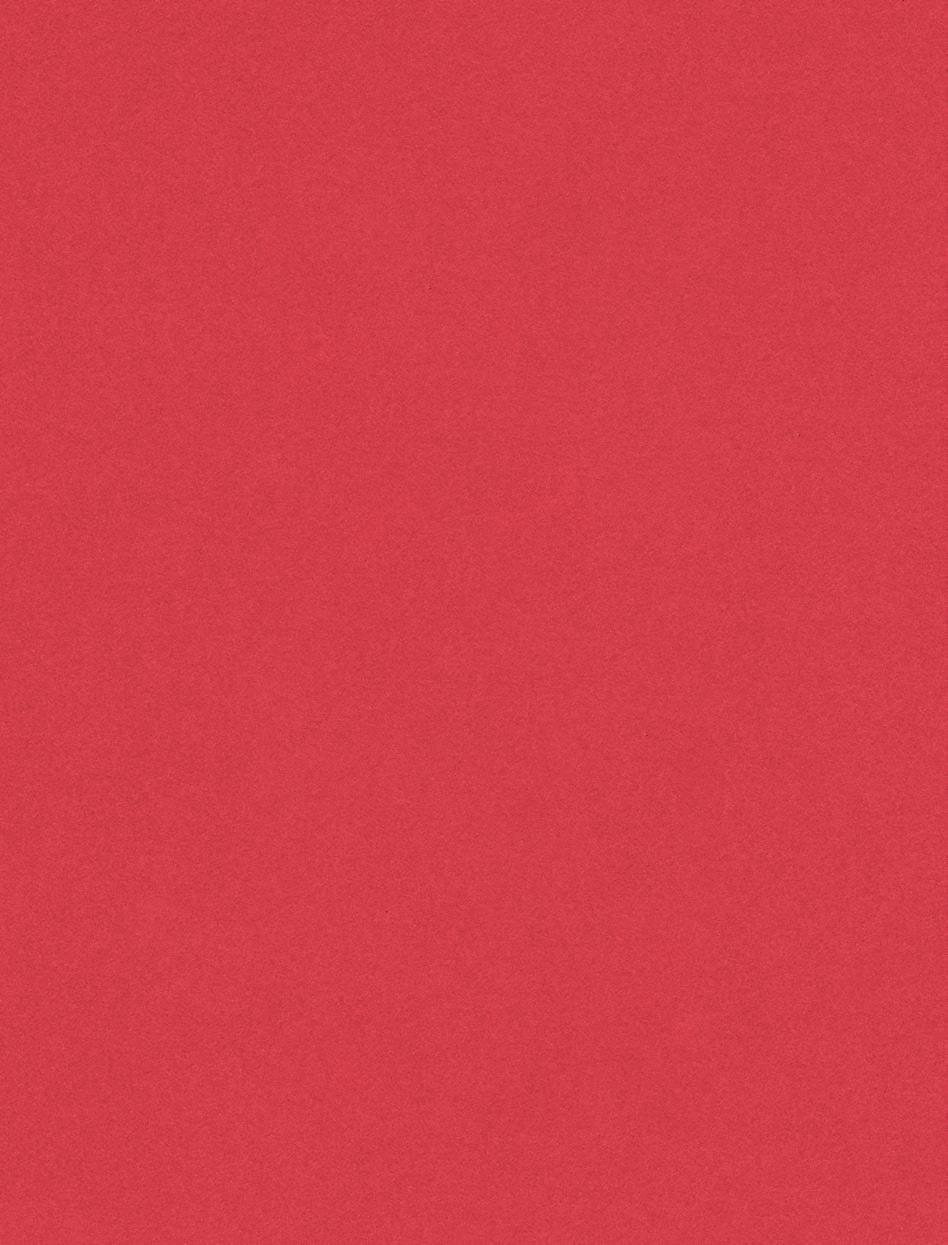
ERICH WOLFGANG KORNGOLD
Jetzt entdecken



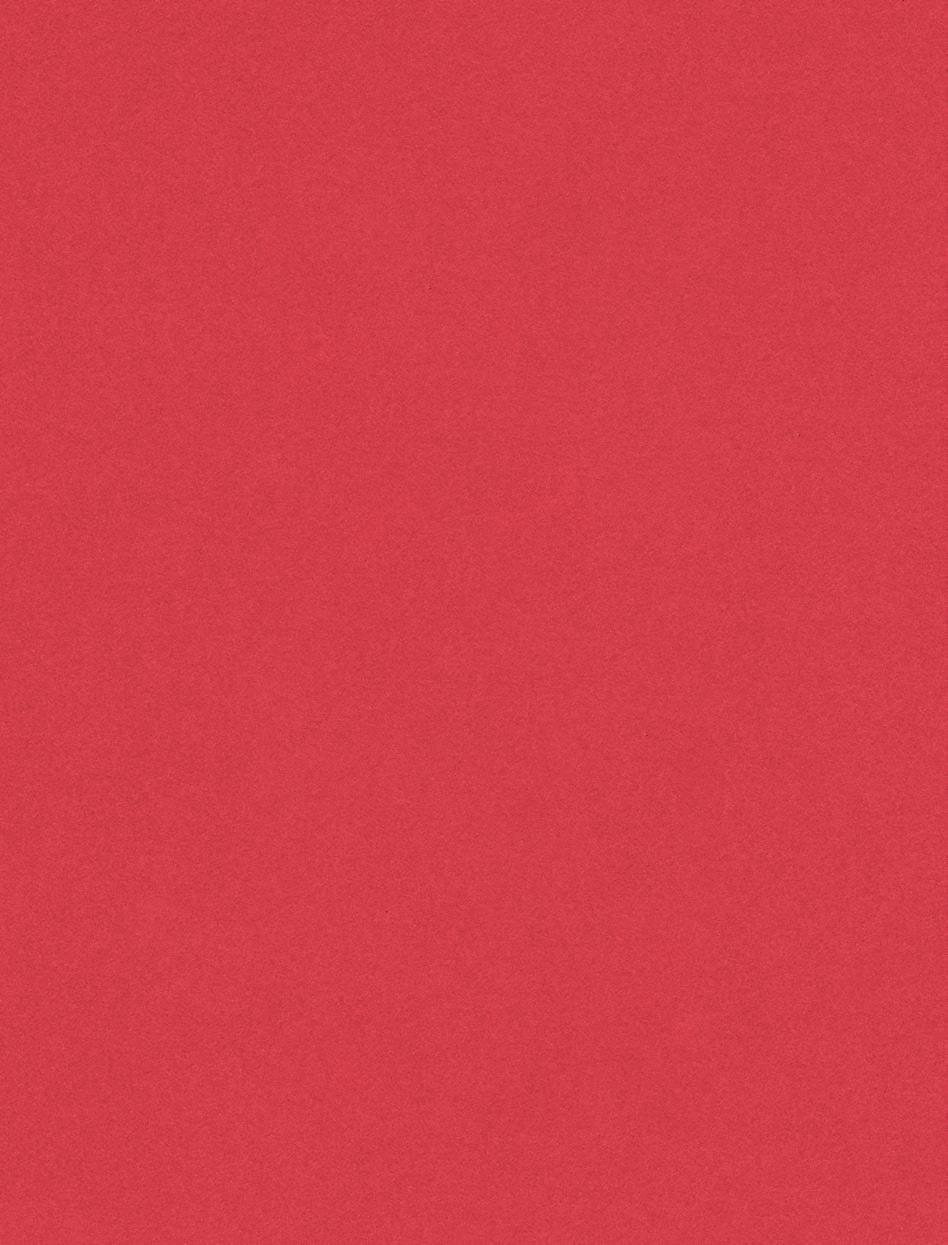
ERICH WOLFGANG KORNGOLD
Jetzt entdecken

Der neue Tayron ist ein wahres Platzwunder. Er besticht mit bis zu sieben Sitzen und einem geräumigen Kofferraum. Das macht ihn zum perfekten Begleiter für Alltag und Abenteuer. Sein modernes und ausdrucksstarkes Design verbindet Eleganz und Funktionalität. Und als Plug-in-Hybrid* vereint der neue Tayron zwei Antriebe zu maximalem Fahrspass. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!
Unterstützt von


Erstes Bild
Der Witwer Paul trauert um seine vor kurzem verstorbene Frau Marie; seine Wohnung hat er in eine «Kirche des Gewesenen» verwandelt.
Brigitta, eine Freundin der Verstorbenen, zeigt Frank, einem alten Bekannten Pauls, die Wohnung des Witwers. Hier gibt es keinen Winkel, der nicht von Marie spricht.
Etwas später erzählt Paul Frank, er habe auf der Strasse ein Mädchen getroffen, das auf erstaunliche Weise Marie zu ähneln schien; er habe das Mädchen zu sich nach Hause eingeladen.
Dieses Mädchen heisst Marietta und kommt schliesslich zu Paul zu Besuch. Ohne ihr zu erklären warum, bittet Paul Marietta, ein Halstuch seiner verstorbenen Frau anzulegen, und gibt ihr eine Laute in die Hand – auf diese Weise stellt er ein Bild Maries nach. Für Marietta ist das alles völlig unverständlich.
Von draussen dringen die Stimmen von Mariettas Freunden herein; Marietta möchte deshalb aus dem Fenster auf die Strasse schauen. Paul hält sie zurück; er hat Angst, dass die Nachbarn sie in seinem Haus sehen und schlecht über ihn reden könnten. Stattdessen kommt es zwischen Paul und Marietta deswegen zum Streit. Marietta behauptet, sie müsse jetzt sofort gehen, und bemerkt, Paul wisse ja, wo er sie finden könne, falls er sie in Zukunft wiedersehen wolle.
Unterdessen wird Paul von äusserster Unruhe erfasst. Er fühlt sich zerrissen zwischen seiner Treue gegenüber Marie und den Gefühlen, die ihn während des Treffens mit Marietta überwältigt haben. In einem inneren Zwiegespräch mit der Verstorbenen empfindet Paul eine grosse Schuld ihr gegenüber und erkennt zugleich seine Abhängigkeit von ihr.
Zweites Bild
Paul streift durch die Strassen der nächtlichen Stadt; er möchte Marietta wiedersehen.
Plötzlich trifft er Brigitta, die gekleidet ist wie eine Nonne. Sie sagt, sie habe Paul wegen seiner Sünden verlassen; im Gegensatz zu ihm bleibe sie jedoch dem Andenken der verstorbenen Marie treu.
Der plötzlich auftauchende Frank prahlt Paul gegenüber damit, dass er im Besitz des Schlüssels zu Mariettas Haus sei. Paul begreift, dass er und Frank Rivalen sind. Paul entreisst Frank den Schlüssel. Frank verschwindet.
Paul beobachtet von seinem Fenster aus, wie eine Gruppe von Stadtbewohnern ausgelassen feiert. Etwas später kommt auf einmal Marietta hinzu, die heftig mit den Männern flirtet. Paul erträgt das nicht länger. Er verlässt seinen geschützten Ort und versucht, die Vorgänge zu stoppen. Marietta beruhigt die Situation, indem sie ihre Freunde fortschickt. Zwischen ihr und Paul kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Marietta schleudert Paul eine Anschuldigung ins Gesicht: Der Grund seiner Leidenschaft für sie sei sein Wunsch, in ihr seine verstorbene Frau wiederzufinden.
Marietta will die unsichtbaren Bande zerstören, die Paul an die verstorbene Marie fesseln – Paul soll sie, Marietta, um ihrer selbst willen lieben. Paul erträgt den Gedanken nicht, dass Marietta ihn verlassen könnte. Er ist bereit, sich ihr zu fügen.
Marietta erwacht in Pauls Wohnung, wo die beiden seit einiger Zeit zusammen leben. An diesem Tag findet in der Stadt ein religiöses Fest statt. Paul beobachtet die festliche Prozession von seinem Fenster aus. Marietta erlaubt er hingegen nicht, sich neben ihn zu stellen, weil er Angst hat, jemand könne sie zusammen sehen.
Marietta wird die Rolle, die Paul ihr in seinem Leben zugedacht hat, zunehmend unerträglich. Die ständigen Vergleiche mit seiner verstorbenen Ehe
frau empfindet sie als erniedrigend. Sie fordert Pauls ganze Aufmerksamkeit. Paul bittet Marietta, sich nicht mit Marie zu vergleichen, die ein Vorbild an Reinheit gewesen sei. Marietta wiederum beschuldigt ihn der Heuchelei: Er träume von der Reinheit der verstorbenen Frau und begehre zur gleichen Zeit den Körper der «Verworfnen». Paul ist ausser sich. Er beschuldigt Marietta der Lasterhaftigkeit und will sie hinauswerfen. Doch Marietta ist nicht bereit, sich zu unterwerfen; sie beginnt, mit seinen «Reliquien» zu spielen und sich über diese lustig zu machen – es sind Dinge, die Paul von seiner verstorbenen Frau geblieben sind. Es folgt eine wütende, handgreifliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf Paul Marietta schliesslich umbringt.




Regisseur Dmitri Tcherniakov im Gespräch
Dima, du entwirfst alle Bühnenbilder für deine Inszenierungen selbst. Wovon bist du ausgegangen, als du die Konzeption für die Tote Stadt entwickelt hast? Hat der Titel des Stückes gleich zu einer räumlichen Assoziation geführt?
Mehr noch als der Titel des Stückes hat mich die Hauptfigur Paul interessiert. Dass das Stück Die tote Stadt heisst, bedeutet für mich zunächst nicht mehr als das, was auch Marietta im ersten Akt sagt: Nämlich dass der Ort der Handlung äusserst langweilig und tot ist. Meine Konzeption für die Tote Stadt entstand ganz aus der Hauptfigur und aus dem, was in ihrem Inneren vorgeht. Für mich hat sich die Psychologie Pauls durch zwei Werke von Fjodor Dostojewski erschlossen: Die Sanfte und Aufzeichnungen aus einem Kellerloch. Ich glaube, durch diese beiden Erzählungen Dostojewskis können wir der Hauptfigur dieser Oper neue, unerwartete Perspektiven hinzufügen. Beide Erzählungen sind aus der Sicht eines Mannes geschrieben, der viele Misserfolge im Leben hatte, sich ausgegrenzt fühlt und dessen Selbstwertgefühl fast völlig zerstört ist. Ein Mensch, der sein Leben verspielt hat und nun die ganze Welt dafür verantwortlich macht anstatt sich selbst. Die Psychologie der Opernfigur Paul nur aus seiner Trauer um die verstorbene Frau zu entwickeln, schien mir nicht ausreichend. Der Roman Bruges-la-Morte, der dieser Oper zugrunde liegt, bietet da auch nicht viel mehr Material; er ist nicht unbedingt ein Meisterwerk…
… vermutlich würde kaum jemand heute den Roman kennen, wenn Korngold und sein Vater nicht ein Opernlibretto daraus gemacht hätten … Das Libretto ist um einiges interessanter als die Romanvorlage! Aber weder im Roman noch im Libretto erfahren wir etwas darüber, wie das Leben Pauls
mit seiner Frau verlaufen war, bevor sie gestorben ist. Das war aber für mich sehr wichtig, um Paul besser zu verstehen. Wenn ich mir anschaue, wie sich Pauls Beziehung zu Marietta im Laufe der Oper entwickelt, so scheint es mir, als sei auch die Beziehung zu seiner verstorbenen Ehefrau sehr problematisch, vielleicht sogar pathologisch gewesen. Pauls grösstes Problem ist nicht der Verlust der geliebten Frau, nicht die Trauer, über die er nicht hinwegkommen kann.
Sondern?
Das Leben, das Pauls Ehefrau mit ihm geführt hat, muss die Hölle für sie gewesen sein. Ich stelle mir die Beziehung der beiden vor wie im Film Gaslighting. Oder so wie in der Erzählung Die Sanfte, die ich vorhin schon erwähnt habe und aus der wir einen Ausschnitt für den Prolog verwendet haben, den wir der Oper voranstellen: Die Titelheldin erträgt das Leben mit ihrem Mann nicht mehr, weil der sie behandelt wie ein Despot, und bringt sich um. Natürlich trauert Paul nach dem Tod seiner Frau; er ist einsam und kann kaum so weiterleben. Er kann nicht ohne sie sein – aber er konnte eben auch nicht mit ihr sein. Wir sehen Paul in der Pose des Trauernden, der die Haare seiner Frau aufbewahrt wie eine Reliquie. Mir kommt das kitschig vor. Mir scheint, dass der Tod seiner Frau nicht bloss eine Tragödie ist für Paul, sondern darüber hinaus verbunden mit einem Gefühl schwerer Schuld. Ich denke nicht, dass er Marie umgebracht hat. Aber es gibt viele Dinge, die einen Menschen dazu bringen können, dass er lieber sterben als unter den gegebenen Umständen weiterleben möchte.
Ist Paul psychisch krank?
Auf diese Frage kann ich unmöglich eindeutig antworten. Eine solche Diagnose kann nur ein Psychiater stellen. Und es wäre mir auch viel zu simpel, Paul als psychisch krank darzustellen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer würden denken: Ach so, es geht um jemanden, der psychisch krank ist, also geht es mich nichts an. Aber mir scheint, dass jeder von uns das Potenzial hätte, zu einem Menschen «aus dem Kellerloch» zu werden, wie ihn Dostojewski beschreibt. Es geht ja auch nicht darum, diese Figur zu verurteilen,
ihr ein Stigma zu verpassen, sondern darum, sie sehr genau zu erforschen, mit der Lupe gewissermassen, und sich dabei bewusst zu sein, dass man auch in sich selbst ähnliche Bedürfnisse entdecken könnte – wie zum Beispiel den Wunsch, jemand anderen zu erniedrigen. Das Gefühl, dass man über allen steht und niemand in der Welt einen versteht, ist vermutlich vielen von uns nicht ganz unbekannt. Auch wenn wir solche Bedürfnisse und Gefühle nicht mal vor uns selbst zugeben würden. Sich mit diesen inneren Abgründen zu beschäftigen, scheint mir sehr wichtig zu sein.
Spiegelt sich das «Kellerloch», das Dostojewskis Erzählung den Titel gab, im Bühnenbild wider?
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Einen Keller im wörtlichen Sinne gibt es auf der Bühne nicht. Denn mit dem Keller ist zuallererst die innere Verfasstheit Pauls gemeint. Er hat Angst vor Nähe, aber auch Angst, seine Wohnung, seinen sicheren Ort zu verlassen. Sein Interesse an Marietta ist geprägt von seiner Überzeugung, dass eine Begegnung mit ihr sowieso zu nichts führen wird. Das erste Treffen mit Marietta im ersten Akt hat Paul ganz genau vorbereitet, er hat Requisiten dafür besorgt und den Verlauf des Treffens detailliert geplant. Er provoziert Marietta zu den Reaktionen, die er braucht. Aber der Ausgang des Treffens ist in seinem Kopf nur verschwommen vorhanden, den möchte er sich lieber nicht vorstellen. Paul besitzt diesen Altar, auf dem er wie eine Reliquie das Haar seiner verstorbenen Frau hütet; viel wichtiger aber ist, was er hinter dem idealisierten Bild seiner verstorbenen Frau versteckt, an deren Tod er aus meiner Sicht schuld war. Ihr Tod schmerzt ihn, er wollte nicht, dass sie stirbt; er ist zu weit gegangen.
Wie würdest du das beschreiben, was Paul wirklich versteckt?
Er hat extrem wenig Selbstachtung und deshalb das Bedürfnis, dass irgendjemand Achtung vor ihm empfindet, dass wenigstens ein menschliches Wesen ihm huldigt, als wäre er ein Märtyrer und zugleich ein Held. Dieses Wesen möchte er sich selbst erschaffen, und es soll auf die Knie gehen vor seiner Grösse. Jede beliebige Frau, die in sein Leben tritt, wird für ihn zur Verkörperung eines solchen Wesens. So wie in den Aufzeichnungen aus einem
Kellerloch: Dort hat der Erzähler sich vollkommen in seiner inneren Welt eingeschlossen, er kann diese Welt nicht mehr verlassen. Paul sucht nicht Liebe, sondern Macht, despotische, grenzenlose Macht über eine Frau.
Sucht Paul auch in der Begegnung mit Marietta diese Macht? Und wie wichtig ist es dabei, dass Marietta Marie ähnelt, dass Paul also das Gefühl hat, seine tote Frau sei wiederauferstanden?
Dass Paul plötzlich eine Frau trifft, die aussieht wie seine verstorbene Ehefrau, ist für mich nicht glaubwürdig; das hat ein bisschen was von Groschenroman. Ausserdem scheint mir, dass diese Geschichte von der Doppelgängerin oder Wiedergängerin, einer Frau also, die der verstorbenen Marie zum Verwechseln ähnlich sieht, schon zur Genüge durchdekliniert wurde. Alfred Hitchcock hat dieses Thema erschöpfend in seinem Film Vertigo behandelt. Deshalb ist unsere Marietta der verstorbenen Frau Marie überhaupt nicht ähnlich. Wir sehen in jedem der drei Akte unterschiedliche Frauen, um diesen Moment der physischen Ähnlichkeit gar nicht erst aufkommen zu lassen. Paul sucht keine Frau, die seiner verstorbenen Ehefrau ähnlich sieht, sondern er sucht eine Frau, auf die er das Verhaltensmuster übertragen kann, das auch schon seine frühere Beziehung geprägt hat und das ihn nach wie vor beherrscht. Die Beziehung zu seiner Ehefrau war toxisch, denke ich, und sehr erniedrigend für sie. Das überträgt Paul nun auch auf Marietta, indem er sie beschuldigt, unrein zu sein, und gleichzeitig seine verstorbene Frau als rein und geradezu heilig verklärt. Er versucht die Beziehung zu Marietta so zu gestalten, dass er sich moralisch überlegen fühlt. Er projiziert also dieses Bedürfnis zu erniedrigen, zu kontrollieren und sich selbst überlegen zu fühlen in eine Zufallsbekanntschaft. Beinahe jede Frau wäre aus seiner Sicht dafür geeignet. Es geht nicht um physische Ähnlichkeit, sondern um die psychologischen Bedürfnisse Pauls – es geht also nicht um sie, sondern um ihn.
Und doch ist ja Marietta eine reale Figur, die eigenständig handelt… Ja, Marietta ist eine reale Figur. Und im zweiten Akt erkennt Paul, dass er eine Sehnsucht hat, sich dieser Marietta, die im zweiten Akt eine andere, sehr starke Frau ist, die sich nicht von ihm manipulieren lässt, zu unterwerfen;
plötzlich empfindet er eine unerwartete Notwendigkeit, das zu tun. Die Psychologie dieses Menschen «aus einem Kellerloch» ist äusserst komplex; zum einen sucht er eine Frau, die in sein Verhaltensmuster passt; zum anderen sucht er aber auch eine Frau, die ganz und gar nicht in dieses Muster passt, um sie dann als seiner unwürdig zu verstossen und sich wiederum überlegen zu fühlen.
Am Schluss unterscheidet sich die Oper stark von der Romanvorlage Bruges-la-Morte: Korngold und sein Vater, die gemeinsam das Libretto geschrieben haben, fügten ein positives Ende hinzu. Paul erwacht und stellt fest, dass alles, was er glaubte zu erleben, nur ein Traum war, und auch Marietta, die er doch gerade eben getötet hatte, ist plötzlich wieder lebendig. Daraufhin fühlt sich Paul von seiner Trauer geheilt und kann sich nun vorstellen, Brügge, die «tote Stadt», zu verlassen, um ein neues Leben zu beginnen. Glaubst du an eine solche Heilung durch den Traum?
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Nein, natürlich nicht. Das wäre nicht nur naiv, sondern würde in meinen Augen auch all das abwerten, was zuvor passiert ist. Paul überschreitet am Schluss der Oper eine rote Linie, das ist völlig klar für mich. Die Zuschauerinnen und Zuschauer befinden sich im Theater – zumal in Zürich, dieser Stadt, die auf mich zuweilen wie ein Kurort wirkt – in Sicherheit; sie können auf der Bühne etwas über die Abgründe der menschlichen Natur sehen, in der Pause ein Glas Champagner trinken und dann weiter der furchtbaren Bühnenhandlung zuschauen. Das heisst, hier existiert bereits eine Distanz, aus der man gefahrlos diese schrecklichen Dinge betrachten kann. Ich denke, im Theater sollten wir versuchen, diese Distanz zu überwinden, die Zuschauerinnen und Zuschauer in Situationen zu versetzen, die sie aus ihrer Bequemlichkeit herausholen können, dafür sorgen, dass sie dieses Gefühl der Sicherheit verlieren, sie gewissermassen aus ihrer Komfortzone herausholen. Das geht natürlich leichter an einem Ort wie der Jahrhunderthalle in Bochum, wo ich Aus einem Totenhaus inszeniert habe und die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz nah am Geschehen waren und die Kämpfe zwischen den Gefangenen aus weniger als zwei Metern sehr unmittelbar miterlebten. Wenn
ich den Zuschauerinnen und Zuschauern diese grausame Geschichte der Toten Stadt dadurch versüssen würde, dass sie sich am Ende als Traum entpuppt, dann wäre das für mich wie ein zusätzlicher «Airbag», der vor eventuellen Gefahren schützt. Deshalb würde ich diese Schraube, mit der ich dem Sujet zusätzliche Dringlichkeit verleihen kann, immer maximal anziehen wollen. Auch wenn ich damit gegen die sogenannte Werktreue verstosse. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass eher die allerletzte Szene, in der Marietta auf einmal wieder lebendig ist und Brigitta und Frank von irgendwoher wieder auftauchen, ein Traum zu sein scheint oder zumindest auf die gestörte Realitätswahr nehmung Pauls verweist. Die Beziehung Pauls zu Marietta endet in jedem Fall tragisch. Dass diese Geschichte nicht gut ausgehen kann, ist von Anfang an klar – sie ist zu einem tragischen Ausgang verdammt.
Das komplette Programmbuch können Sie auf
Das Gespräch führte Beate Breidenbach
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Fjodor Dostojewski
Ich bin ein kranker Mensch… Ich bin ein zorniger Mensch. Ein hässlicher Mensch bin ich.
Zu jener Zeit war ich gerade einmal vierundzwanzig Jahre alt. Ich führte schon damals ein verdriessliches, liederliches und zurückgezogenes, beinahe menschenscheues Leben. Ich pflegte mit niemandem Umgang, vermied sogar Unterhaltungen und verkroch mich immer mehr in meinem Winkel.
Meine Wohnung war mein Schloss, meine Eierschale, meine Schutzhülle, in der ich mich vor der gesamten Menschheit versteckte…
Heute ist mir vollkommen klar, dass ich aufgrund meiner grenzenlosen Eitelkeit und wohl auch meiner hohen Ansprüche an mich selbst allzu oft mit wütender Unzufriedenheit auf mich blickte, die sich bis zur Abscheu steigerte, und daher gedanklich meinen eigenen Blick auf mich jedem anderen zuschrieb. Ich hasste, beispielsweise, mein Gesicht, fand es widerwärtig und meinte gar, es sei abstossend.
Ein Mensch von Reife und Anstand kann nicht eitel sein, ohne an sich selbst grenzenlose Ansprüche zu stellen und ohne sich selbst, in manchem Augenblick bis hin zum Selbsthass, zu verachten. Doch egal, ob ich mich selbst verachtete oder sie über mich stellte – ich schlug vor jedem, dem ich begegnete, die Augen nieder.
Doch wie viel Liebe, o Gott, wie viel Liebe erlebte ich immer wieder in meinen Fantasien… Ich triumphiere beispielsweise über alle; alle liegen, selbstredend,
vor mir im Staub und sind genötigt, aus freien Stücken meine Vollkommenheit anzuerkennen, ich aber vergebe ihnen allen. Ich, ein berühmter Poet und Kammerherr, verliebe mich; erhalte Millionensummen und spende sie umgehend zum Wohl der Menschheit, beichte vor allen meine Schandtaten, die, selbstredend, nicht einfach nur Schandtaten waren, sondern ausserordentlich viel «Schönes und Erhabenes» in sich tragen. Alle weinen und küssen mich, und ich ziehe baren Fusses und hungrig aus, um neue Ideen zu predigen…
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Fjodor Dostojewski
Aus welchem Schmutz habe ich sie damals herausgezogen! Das musste sie doch begreifen, musste meine Handlungen doch würdigen!
Das waren mancherlei Gedanken, die mir gefielen, zum Beispiel dass ich einundvierzig war und sie erst sechzehn. Das entzückte mich, dieses Gefühl der Ungleichheit, gar zu wonnig ist das, gar zu wonnig.
Verschiedene meiner Ideen konnte ich damals immerhin schon bei ihr anbringen, damit sie wenigstens eine Ahnung davon hatte.
Ich wusste doch, für eine Frau, noch dazu eine sechzehnjährige, gibt es nichts anderes, als sich dem Mann vollständig unterzuordnen. Die Frauen haben keine Originalität, das ist ein Axiom!
Eine liebende Frau vergöttert selbst die Laster, selbst die Missetaten des geliebten Wesens.
Wie schmal sie auf dem Totenlager aussieht, wie spitz das Näschen! Wie kleine Pfeile liegen die Wimpern auf den Wangen. Und wie sie nur gestürzt ist – nichts zerschmettert, nichts gebrochen! Nur eben ein wenig Blut, «für die hohle Hand».
Ein seltsamer Gedanke: Ob es möglich wäre, sie nicht zu begraben? Denn wenn man sie so fortträgt, so… o nein, es ist fast unmöglich, man darf sie nicht forttragen! Gewiss, ich weiss, man muss sie forttragen, ich bin nicht verrückt, und ich rede keineswegs im Fieber, im Gegenteil, noch nie war mein Verstand so wach und klar – aber wie soll das sein: wieder niemand im Hause, wieder die beiden Zimmer, wieder ich allein…
Die Wanduhr tickt gefühllos, widerwärtig. Zwei Uhr nachts. Ihre Schühchen stehn am Bett, als warteten sie… Nein, ernsthaft, wenn man sie morgen fortträgt, was fang ich an?



Dirigent Lorenzo Viotti im Gespräch
Lorenzo, du hast dir gewünscht, die Oper Die tote Stadt zu dirigieren.
Was fasziniert dich an diesem Komponisten?
Schon ganz zu Beginn meiner Dirigentenlaufbahn habe ich mich mit der Musik von Erich Wolfgang Korngold beschäftigt. Mich hat fasziniert, dass er – als Wunderkind – sehr jung seine ganz eigene musikalische Sprache gefunden und so fantastische Musik geschrieben hat. Auch seine Lebensgeschichte fand ich spannend. Nach seinen frühen, rauschenden Erfolgen musste er in die USA emigrieren. Als er nach dem Krieg dann nach Österreich zurückkam, konnte er nicht mehr an die Erfolge von damals anknüpfen.
Hast du bereits andere Werke von Korngold dirigiert?
Ja, ich habe einige Orchesterwerke dirigiert und mich auch intensiv mit seinen Liedern befasst. Und als Andreas mich vor einigen Jahren fragte, was ich gern am Opernhaus dirigieren würde, ist mir Die tote Stadt eingefallen.
Wahrscheinlich war ich gerade in KorngoldLaune… ich bin ein bisschen launisch, ich hätte damals auch etwas ganz anderes wählen können…
Bist du jetzt glücklich damit, dass du damals in Korngold-Laune warst?
Absolut! Seit meiner Beschäftigung mit Korngold habe ich viele Opern von anderen Komponisten dirigiert, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Jules Massenet, dessen Werther ich auch hier in Zürich gemacht habe. Mein Herz schlägt immer für die Werke, mit denen ich mich gerade im Moment beschäftige. Und nun freue ich mich, dass ich zu Korngold zurückkehren und meine Auseinandersetzung mit ihm fortsetzen kann. Die musikalische Welt Korngolds ist sehr vielfältig. Und die Partitur der Toten Stadt ist wahnsinnig anspruchsvoll, für die Musikerinnen und Musiker im Orchester,
aber auch für die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und für den Dirigenten. Ich denke, vor ein paar Jahren wäre ich noch nicht reif gewesen für dieses Stück. Jetzt ist genau der richtige Moment dafür.
Wie würdest du die Herausforderungen des Stücks beschreiben?
Zunächst muss man ein tiefes Verständnis für Stimmen haben und dafür, welche Stimmtypen sich Korngold für diese Oper vorgestellt hat. Wenn man sich die Orchestrierung anschaut, fragt man sich zunächst, wie die Singstimmen überhaupt über das Orchester kommen sollen. Man versteht dann mit der Zeit, dass das, was Korngold vorschwebte, nicht die hochdramatischen WagnerStimmen sind, sondern etwas zwischen dem italienischen und dem deutschen Fach. Da ich beides viel dirigiert habe, denke ich, dass ich inzwischen ganz gut verstehe, worauf es ankommt. Man braucht nicht nur viel Kraft in der Stimme, um diese Partien singen zu können, sondern auch eine unglaubliche Flexibilität und die Fähigkeit, sehr lange Bögen zu spannen.
Die Uraufführung der Toten Stadt fand 1920 gleichzeitig in zwei Städten statt, in Hamburg und Köln, und war ein riesiger Erfolg beim Publikum; was denkst du, womit hing dieser Erfolg zusammen?
Aus der damaligen Situation heraus finde ich es erstaunlich, dass dieses Stück einen solchen Erfolg hatte, weil es wirklich unglaublich komplex ist. Ich denke, dass das Publikum damals sehr gebildet war und geradezu hungrig nach Neuem, vielleicht mehr als wir heute. Ausserdem war Korngold damals bereits berühmt, man nannte ihn den neuen Mozart, weil er so früh schon als Komponist so erfolgreich war. Trotz aller Schwierigkeiten ist die Partitur trotzdem zugänglich.
Liegt es daran, dass Korngold keine Scheu hatte vor der Tonalität und auch nicht davor, schöne Melodien zu komponieren?
Er benutzt einfach alles, was man sich zu seiner Zeit vorstellen konnte. Was im Orchester passiert, ist der reine Wahnsinn – es gibt mal einen Cluster hier, mal Bitonalität da, die Rhythmen sind zum Teil gegeneinander verschoben und so schwierig, dass Richard Strauss daneben wirkt wie Kindergarten. Dann
das Lied des Baritons «Mein Sehnen, mein Wähnen» im zweiten Bild, das ein Hit wurde, weil es eine so eingängige Melodie besitzt, gleichzeitig aber auch sehr schwer zu singen ist. Zum Glück haben wir mit Björn Bürger einen Sänger, der mit den Herausforderungen dieser Partie wunderbar klarkommt. Manchmal denke ich, dass wir heute im Vergleich zu dem, was Künstlerinnen und Künstler zur Zeit Korngolds geleistet haben, ein bisschen faul geworden sind, und dass man damals generell eher bereit war, künstlerische Risiken einzugehen.
oder am Vorstellungsabend
Korngold emigrierte nach Hollywood, du hast es schon gesagt, und komponierte dort hauptsächlich Filmmusik. Hört man denn den späteren Filmmusik-Komponisten schon in der Toten Stadt? Im zweiten Bild höre ich den Soundtrack zu einem Horrorfilm! Alle Horrorfilme, die wir heute kennen, sind inspiriert von diesen Klängen. Die Partitur ist möglicherweise auch deshalb so komplex, weil Korngold ein so begnadeter Pianist war und fantastisch improvisieren konnte. Seine Inspiration kam aus dem Moment. Selbst Dinge, die einfach klingen, sind oft sehr kompliziert notiert. Korngold verstand viel vom Theater, er wusste, was er auf der Bühne sehen wollte. Darin ähnelt er Puccini, der ebenfalls die Vorgänge auf der Bühne sehr genau in die Partitur hineingeschrieben hat. Mir gefällt auch, wie man gleich zu Beginn des Stücks mitten hineingeworfen wird in diese Stimmung. Man sieht sofort Bilder. Man sieht, was auf der Bühne passiert, wenn man diese Musik hört. Dazu muss man gar kein Filmregisseur sein.
Welche Einflüsse anderer Komponisten hörst du in dieser Partitur?
Neben Puccini auch Richard Strauss. Und die ganze sogenannte Zweite Wiener Schule. Aber auch Richard Wagner: Vor dem berühmten Lied «Mein Sehnen, mein Wähnen» gibt es sogar ein Zitat aus dem Rheingold Wirklich faszinierend ist, dass man trotz dieser Einflüsse und trotz des jungen Alters, in dem Korngold die Tote Stadt komponiert hat, sofort die eigene musikalische Identität dieses Komponisten hören kann. Das hat vor allem mit dem besonderen Sound zu tun, den Korngold hier herstellt, mit seinen Klangfarben. Glockenspiel, Harfe, dazu das Flageolett in den mehrfach
geteilten Geigen, das ist sehr eigen. Auch das Libretto hat Korngold selbst geschrieben, zusammen mit seinem Vater. Zunächst unter Pseudonym, aber ein paar Jahre nach der Uraufführung war klar, dass mit Paul Schott Julius Korngold gemeint war. Wir vergessen manchmal, was zu Korngolds Zeit in Wien alles los war. Die Kultur hatte einen absoluten Höhepunkt erreicht, viele berühmte Komponisten und Schriftsteller lebten dort, und es war zugleich der Moment kurz vor einer grossen Explosion. Man spürte, dass etwas passieren würde, dass Gefahr drohte. Deshalb verliess Korngold auch Österreich und ging nach Amerika. Er folgte 1934 einer Einladung von Max Reinhardt, und entschied sich dann, nicht mehr nach Wien zurückzukehren, weil er Jude war und inzwischen die Nazis dort die Macht übernommen hatten. Als er nach dem Krieg nach Österreich kam, war er ein Niemand. Keiner kannte ihn mehr; er starb allein und verarmt. Als Wunderkind wurde er vergöttert, und in die USA kam er zur genau richtigen Zeit, gewann sogar zwei Oscars für seine Filmmusiken. Aber in seiner Heimat war während seiner Abwesenheit so viel passiert, die Menschen hatten so viel Neues kennengelernt, aber auch so tragische Erfahrungen gemacht, dass die Musik Korngolds einerseits als überzuckert, andererseits als «oldfashioned» wahrgenommen wurde.
Seit einiger Zeit werden die Werke Korngolds wiederentdeckt, man kann von einer regelrechten Korngold-Renaissance sprechen… … zum Glück ist das so! Ich würde wahnsinnig gern seine Violanta oder Das Wunder der Heliane dirigieren.
Wir sprachen über die Orchesterbehandlung und über die besonderen Klänge, die Korngold in dieser Oper erzeugt; würdest du sagen, er ist mit 22 Jahren bereits ein Meister der Instrumentation gewesen? Er war sicher ganz aussergewöhnlich begabt, was die Orchesterbehandlung angeht; aber aus der Perspektive der Orchestermusikerinnen und musiker ist diese Partitur sehr viel weniger gut zu spielen als beispielsweise die Partituren von Richard Strauss. Manchmal scheint Korngold ein bisschen über sein Ziel hinauszuschiessen. Auch die Art und Weise, wie manche Rhythmen
können Sie auf
notiert sind, macht mir Kopfzerbrechen; es gibt da einen Takt, da habe ich im Moment noch keine Ahnung, wie ich den dirigieren werde. Und dann diese Stellen mit viel Ritenuto und Rubato mit dem gesamten Orchester, die muss man erst mal zusammenkriegen… Korngold gibt unglaublich viele Informationen; man muss diejenigen herausfiltern, die wirklich wichtig sind. Und man muss seine eigene Freiheit im Umgang mit dieser Musik finden. Wenn man sie zu technisch angeht, wird sie unspielbar. Man muss einen guten Flow finden. Ein bisschen wie bei Puccini. Nur dass Korngold ungefähr zehnmal so schwer ist. Ich denke, Die tote Stadt ist eine der schwierigsten Opern überhaupt. Man muss all die Farben zum Leuchten bringen, die in diesem riesigen Orchester stecken, und man muss eine gute Balance finden zwischen Stimmen und Orchester. Die Orchesterstimmen sind extrem virtuos, und das Orchester muss sehr flexibel reagieren zwischen dreifachem Pianissimo und einem Forte, das zwar kräftig und klangvoll, aber nicht zu laut sein muss. Dann gibt es aber wieder Stellen, die durchaus aggressiv klingen müssen. Eine enorme Farbpalette!
Auch die Gesangspartien sind extrem fordernd… Absolut. Besonders für Paul. In dieser Partie gibt es im Verlauf des Stückes eine riesige Entwicklung. Jeder Tenor hat Respekt vor dieser Partie, vor allem wenn er sieht, was im Orchester los ist. Da braucht man viel Vertrauen in den Dirigenten. Denn wenn der die Pferde nicht im Zaum halten kann, wird Paul zur KillerPartie. Man braucht nicht nur einen Heldentenor für diese Partie. Klar, man muss eine grossartige Höhe haben und das Orchester überstrahlen. Aber man muss auch Pianissimo singen können, und man muss sowohl die Ekstase und Sinnlichkeit als auch die Verzweiflung ausdrücken können, die in dieser Figur stecken. Sie hat so viele Facetten! Es ist ein grosses Glück, dass wir Eric Cutler für diese Partie gewinnen konnten. Er ist unglaublich offen und ein sehr kluger Sänger. Perfekt für diese Rolle. So wie auch Vida Miknevičiūtė als Marietta, die diese Eigenschaften ebenfalls mitbringt. Ich kann mir keine bessere Besetzung vorstellen.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach




Regine Palmai
Erich Wolfgang Korngold wurde als Sohn des späteren Musikkritikers der Wiener «Neuen Freien Presse» Julius Korngold am 29. Mai 1897 im mährischen Brünn geboren. Mit 11 Jahren schrieb das hoch begabte Wunderkind sein erstes Bühnenwerk, die Ballettpantomime Der Schneemann, die in der Orchestrierung von Alexander von Zemlinsky an keinem geringeren Ort als der Wiener Hofoper 1910 uraufgeführt wurde.
Das Aufsehen unter Fachleuten nach weiteren erstaunlich reifen Jugendwerken des kleinen Erich war gross, die Bewunderung von Gustav Mahler, Richard Strauss, Hermann Kretschmar, Felix Weingartner, Arthur Nikisch, Engelbert Humperdinck («ein Wunderkind aus dem Feenreich») wurde vom stolzen Vater wirkungsträchtig bekannt gemacht. Ganz Wien feierte einen heranwachsenden «neuen Mozart», der als Vorbild durch den Zweitnamen Wolfgang dem Sohn vom Vater schon bei der Geburt beigegeben worden war.
Julius Korngold war ein Kämpfer gegen die Zweite Wiener Schule und gegen die «atonale Grippe», ein fast fanatisch Konservativer, der selbst Debussy «nur in den geringsten Dosen» ertrug. Sein grösster Wunsch, selbst ausübender Musiker zu sein, blieb ihm versagt, sein Traum erfüllte sich in seinem Sohn, dessen Entwicklung er sorgfältig förderte. Dem Knaben schien jedoch tatsächlich «das Wunder eines angeborenen musikalischen Talents» (Bruno Walter) gegeben. Bald flossen dem unbekümmert den Status seiner Berühmtheit hinnehmenden Erich, der inzwischen von Zemlinsky unterrichtet wurde, 1913 Der Ring des Polykrates und 1914 Violanta in einer musikalischen Flut sinnlicher Melodik und Harmonik aus der Feder. Die beiden Einakter wurden am 28. März 1916 unter Leitung von Bruno Walter in München uraufgeführt und vermehrten Erfolg und Bewunderung für das junge Musikgenie. Sein Status schützte ihn nicht vor der Einberufung zum Militärdienst 1917, wegen Kriegsuntauglich
keit wurde er jedoch in die Musikkapelle eines Infanterieregiments kommandiert.
Vom ShawÜbersetzer Siegfried Trebitsch erhielt der junge Komponist 1916 den Hinweis auf einen möglichen neuen Opernstoff: Georges Rodenbachs gerade von Trebitsch unter dem Titel Trugbild ins Deutsche übertragenes Drama nach dem Roman Das tote Brügge. Unter dem Pseudonym Paul Schott (Paul nach der Hauptfigur des Librettos, Schott nach Korngolds Mainzer Musikverlag) formte Vater Julius in enger Beratung mit Erich Wolfgang den Stoff zu einem passenden Operntext. Sofort begann die Komposition der neuen grossen Oper, die am 15. August 1920 abgeschlossen wurde. Noch im gleichen Jahr, am 4. Dezember, wurde dem Werk die seltene Ehre einer Doppeluraufführung, gleichzeitig in Köln unter Otto Klemperer und in Hamburg unter Egon Pollak, zuteil. Nach den ersten Orchesterproben, die in Wien in Vorbereitung einer baldigen Erstaufführung stattfanden, stellte der Komponist beruhigt fest, alles klinge, wie er es sich vorgestellt habe, alles habe «Charakter, Farbe und Stimmungskraft».
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Eine Uraufführung in Wien verwarf Korngold senior wegen der Befürchtung, der künstlerischen Leistung seines Sohnes könne aufgrund seiner unabhängigen, gefürchteten und nicht unumstrittenen Musikkritikertätigkeit keine gerechte Beurteilung widerfahren. Auch alle späteren Werke wurden ausserhalb Wiens uraufgeführt, um dem Vorwurf der Protektion auszuweichen. Die Erstaufführung in der Heimatstadt erfolgte wenige Monate später 1921 mit der berühmten Alaria Jeritza in der Hauptrolle. Mit ihr als Marietta/Marie wurde Die tote Stadt als erstes deutsches Werk nach dem Ersten Weltkrieg auch an der New Yorker Metropolitan Opera herausgebracht, was einen amerikanischen KorngoldRausch auslöste, der dem späteren jüdischen Emigranten nützlich werden sollte. In Hamburg schlug dem Werk schon bei den Proben «leider allgemeine Begeisterung» entgegen, wie Korngold humorvoll seinem Vater nach Wien depeschierte. Einen wichtigen Aspekt des Erfolgs hob der Dirigent der Hamburger Uraufführung, Egon Pollak, hervor: «Die Hauptsache bleibt, dass wieder einmal ein Werk da ist, das auch die grosse Masse anzieht, das Tagesgespräch bildet und – ausserdem ein Meisterwerk ist.» In Hamburg kam es schnell zu 60 Folgeaufführungen, ebenso in Wien. Den Erfolg festigten Aufführungen auf 78 deutschen und ausländischen Bühnen. Die Münchner Erstaufführung
fand 1922 unter Hans Knappertsbusch statt, in Berlin kam die Oper 1924 unter George Szell mit Lotte Lehmann und Richard Tauber auf die Bühne der Hofoper. Hier trübte sich erstmals der legendäre Ruf der Toten Stadt als Erfolgsgarant beim Publikum. Es gab nörgelnde Kritiken und wenig Folgeaufführungen. Später resümierte Korngold, Berlin sei «nicht seine Stadt», seine Stadt sei Hamburg.
Nach der Toten Stadt, im dreiundzwanzigsten Lebensjahr, war Erich Wolfgang Korngold plötzlich berühmt und neben Richard Strauss der meistgespielte lebende Opernkomponist im deutschsprachigen Raum. Der «kleine Korngold» war der «junge Korngold», ein anerkannter, seriöser Komponist geworden. Jetzt begann seine grosse Zeit. Der immer noch blutjunge Künstler galt als Institution in Wien, die von auswärtigen Besuchern pflichtgemäss kontaktiert werden musste. Es gab Anfragen und Aufträge aus der angrenzenden europäischen Kunstszene, die das Genie, auch als temperamentvollen Interpreten eigener Klavierstücke oder als Dirigenten, präsentieren wollte. Nicht nur dem Opernkomponisten erwies sich Theater nunmehr in mehrfacher Hinsicht als Lebensnotwendigkeit. Die Vorliebe für die Werke des Operettenkönigs Johann Strauss teilte Korngold gleichfalls mit seinem Vater. Mit dem Nebeneffekt regelmässiger Einnahmen zum Erhalt seiner eben gegründeten Familie begann Korngold, Operetten für das Theater an der Wien zu bearbeiten und leitete damit eine StraussRenaissance ein, die u. a. Die Nacht in Venedig in einer eigenen Einstudierung für die Wiener Staatsoper zum heutigen Ansehen verhalf.
Korngolds neuer Ruf als Johann StraussExperte verschaffte ihm zahlreiche Engagements als Bearbeiter und Dirigent. Für Berlin gewann ihn 1929 Max Reinhardt zur Mitarbeit an seiner szenischen Version der Fledermaus am Deutschen Theater und lobte «die dramaturgischen Fähigkeiten des genialen Musikers». Korngold leitete alle 86 Aufführungen als Dirigent selbst vom Klavier aus. 1931 entstand für das Theater am Kurfürstendamm in beider Zusammenarbeit auch die Inszenierung der OffenbachOperette Die schöne Helena. Diese künstlerische Partnerschaft dauerte bis zu Reinhardts Tod an and führte 1934 direkt nach Hollywood.
In Amerika war Korngold keineswegs unbekannt. Schon 1910 waren in amerikanischen Zeitungen Berichte über das Wiener Wunderkind erschienen,
und nach dem legendären Opernerfolg von The dead city erwartete den eintreffenden ÜberseeReisenden in New York eine von ihm für das Theater an der Wien zusammengestellte StraussRevue: Walzer aus Wien liefen hier täglich ausverkauft unter dem Titel The great waltz als überdimensionale MusicalShow. In Kalifor nien kam es mit Reinhardt zur Zusammenarbeit in einem Genre, das in kürzester Zeit zu einer «abenteuerlichen Weltherrschaft emporschnellte» (Julius Korngold): dem Film. Der grosse Theaterregisseur hatte sich als Stoff für seine erste Filmproduktion Shakespeares Sommernachtstraum gewählt. Zur genregemässen Bearbeitung der Mendelssohnschen Schauspielmusik für den Film erschien ihm niemand geeigneter als Korngold. Zunächst probten beide Künstler wochenlang mit den Schauspielern, als handele es sich um eine Inszenierung unter ganz normalen Theaterbedingungen. PlaybackAufnahmen wurden verweigert, und Korngold koordinierte Musik und Szene während der Aufnahme direkt am Set, wenngleich unter teils ungewöhnlichen Bedingungen: In einer Szene dirigierte er, auf dem Bauch unter einem künstlichen Strauch im Bühnenwald liegend, vor der Kamera verborgen die musikalisch komplizierte Stelle.
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Mit dieser Arbeit «trat der Hollywoodzauber in sein Leben», trauerte Vater Julius, der besorgt das «Abgelenktwerden des Operndramatikers von seiner eigentlichen Bestimmung» voraussah. Überrascht konstatierte der Vater aber auch ein spezifisches Talent des Sohnes für Filmmusik, «für deren Verschmelzung mit Filmbild and Filmwort ja erfinderisches Eindringen in die Filmtechnik» sowie ein «unerwartetes Interesse an der neuen Kunstübung», mit dem nicht zu rechnen gewesen war. In Hollywood begann Korngolds zweite Karriere. Befördert wurde die Hinwendung zum neuen Betätigungsfeld durch eine schnell etablierte künstlerische Wertschätzung in Amerika, die lukrative und schmeichelhafte Angebote für den «Puccini des Films» nach sich zog.
Den Stoff für ein zweites grosses Opernwerk fand Korngold im ihm gewidmeten Libretto des jung gestorbenen Wiener Dramatikers Hans Kalteneker. Das Wunder der Heliane inspirierte ihn zu einem «impressionistischen Gewebe unirdisch zarter, edelsüsser Melodie» (Julius Korngold). Bruno Walter, damals Direktor der Städtischen Oper Charlottenburg (der heutigen Deutschen Oper Berlin), hielt Heliane für Korngolds bedeutendstes Werk und plante sogar, eine
Berliner Uraufführung selbst zu dirigieren – die allerdings nicht zustande kam. Dennoch erwies sich die Heliane nicht als sehr publikumswirksam. Im Hamburger Uraufführungstheater wurde jedoch – ebenso wie kurze Zeit später in Wien and München – wiederum ein grosser Erfolg gefeiert, der achtzehn Bühnen zum Nachspielen im selben Jahr veranlasste, was erst durch einen heftigen Berliner Misserfolg unter Bruno Walter gebremst wurde.
Die fünfte und letzte Oper Korngolds, die den in Amerika bereits äusserst erfolgreichen Filmkomponisten 1937 nach Europa zurückführte, war Die Kathrin, nach einem Libretto von Ernst Décsey. Die Uraufführung des Werkes in Wien fand wegen der eintretenden politischen Umstände, der Annexion Österreichs und der Kriegsgefahr, nicht mehr statt. Erst 1939 wurde das Werk in Stockholm erstmals auf die Bühne gebracht.
Korngold, der stets neue Angebote aus Hollywood abgewehrt hatte, hatte intuitiv ein neuerliches Angebot für den Film Robin Hood angenommen –es war die «Rettung vor dem sicheren Untergang», wie er später selbst urteilte. Er weilte zu Filmkompositionen in Amerika, während er in der Heimat in der Ausstellung «Der ewige Jude» stigmatisiert and beschimpft wurde. Es gelang, die gesamte Familie in Kalifornien zu versammeln, nachdem auch die Eltern Korngolds mit seinem älteren Sohn und weiteren Verwandten Anfang 1938 in letzter Minute über die Schweiz emigriert waren. Den Lebensunterhalt in Amerika ermöglichten die weiterhin grosszügigen Angebote der Warner Brothers, die zu ErfolgsFilmtracks mit OscarPrämierungen führten, unter anderem Captain Blood (mit Errol Flynn und Olivia de Havilland), Anthony Adverse, The Sea Hawk, Der Günstling der Königin (mit Bette Davis), Give us this night, Juarez, The Sea Wolf und der WagnerFilm Magic Fire. In den Jahren 1935 bis 1957 schrieb Korngold 19 SoundTracks mit einem für Filmkompositionen bisher ungekannten Publikumserfolg. KorngoldFanClubs entstanden, und man bat den Komponisten, seine Filmmusiken zu Suiten zusammenzufassen und als Konzertmusik aufzuführen. Einige der populärsten SoundTracks sind heute auf CD herausgegeben.
Zum Freundeskreis der Korngolds auf der «europäischen Insel» in Kalifornien gehörten emigrierte Künstler wie Thomas and Heinrich Mann, Alma MahlerWerfel, Franz Werfel, Leonhard Frank, Max Reinhardt, Fritzi Massary,
Bruno Walter, Otto Klemperer, Arnold Schönberg. Julius Korngold starb dort 1945, Erich Wolfgang 1957, nur sechzig Jahre alt geworden. Noch zweimal war er nach Europa zurückgekehrt. Die erste, unter grossen Erwartungen angetretene Reise in die europäische Heimat 1949 wurde zur bitteren Erfahrung. Künstlerische Vorlieben fanden, wenn, dann nur unter dem Aspekt moralischer Verpflichtung gegenüber seiner Vergangenheit statt. Nach der Wiener Erstaufführung der Oper Die Kathrin an der Staatsoper, dem Ort seiner einstigen grössten Erfolge, stellte Korngold resigniert fest: «Das ist kein KorngoldHaus, ich bin vergessen!» Der Plan einer Wiederaufführung der Toten Stadt wurde fallengelassen, und niemand hielt das einstmals umschwärmte, nun gealterte Wunderkind, als es nach Amerika zurückkehrte. Eine zweite EuropaReise brachte 1954 die Uraufführung der grossen Sinfonie in Fis, deren RadioMitschnitt der Komponist aber löschen liess. In Bayreuth wurden Filmaufnahmen für den WagnerFilm Feuerzauber (Magic Fire) gemacht, Korngold stand, als Hans Richter maskiert, im Orchestergraben des Festspielhauses and dirigierte einige Stellen aus dem Ring, die in den Film eingingen. Die Uraufführung seiner musikalischen Komödie Die stumme Serenade 1954 in Dortmund löste enttäuschte Reaktionen aus. Die begeisterte Wiederaufnahme seiner Toten Stadt in München bildete jedoch noch einmal einen versöhnlichen Abschied von der alten Heimat.
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
Erich Wolfgang Korngold, der symbolistischexpressionistische, postveristischspätromantische Musiker, gehört, wie Helmut Pollmann schreibt, zu den Komponisten, die in eine musikhistorische Endzeit hineingewachsen waren, ohne sie je hinter sich lassen zu können. Die Tragik Korngolds bestehe darin, den Komponisten der «hohen Kunst» wie Zemlinsky, Schreker, Mahler zugehören zu wollen, aber in den «mittleren Bereichen» Operette und Film reüssiert zu haben. Ein stilistischer Querschnitt durch das musikalische Repertoire des Wiener Jahrhundertbeginns verschmolz durch seine hohe kompositorische Begabung zum einzigartigen Personalstil. Das erklärt seine umstrittene Beurteilung und seine lange Abwesenheit – praktisch seit Ende der zwanziger Jahre –von den grossen Opernbühnen; eine steile Kurve auf den Gipfel der Popularität in die schnelle, totale Vergessenheit. Bis dann in den 1970er Jahren die internationale KorngoldRenaissance begann.

Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen im Gespräch
Elisabeth Bronfen, Korngolds Oper trägt den Titel Die tote Stadt. Paul trauert um seine verstorbene Ehefrau und setzt die Stadt mit dieser Frau gleich: «Die tote Frau, die tote Stadt flossen zu einem geheimnisvollen Gleichnis zusammen.» Warum eignet sich überhaupt eine Stadt als Metapher, was ist damit gemeint?
Ich denke, bei der Toten Stadt geht es um zwei Dinge. Einerseits ist hier die Stadt Brügge gemeint. Das heisst, es geht um die etwas deprimierende Stimmung in dieser Stadt, die keine lebendige Stadt ist, sondern vielmehr ein Ort, an dem Menschen melancholisch sind; es herrscht hier so etwas wie Grabesstimmung. Noch interessanter aber ist, dass kulturhistorisch die Stadt mit dem weiblichen Körper in Verbindung gebracht wird. Schon im Mittelalter gibt es diese Verbindung von Stadt und Frauen, das wird deutlich in der Idee, dass man eine Stadt kriegerisch belagert, um sie dann einzunehmen. Die Verweiblichung der Stadt zieht sich durch das ganze 19. bis hinein ins 20. Jahrhundert. Die Stadt ist der Ort, wo der Mann flanieren kann, sie ist der Hintergrund für die männlichen Abenteuer, ob man nun nachts flaniert und sich verlustiert oder seine Kreativität ausübt; genau wie der weibliche Körper die Leinwand ist, das Musikinstrument oder die Muse, durch die der Künstler sich ausdrücken kann.
Vorlage für Korngolds Oper war die Erzählung Bruges-la-Morte von Georges Rodenbach. Am Schluss dieser Erzählung gibt es eine zweite tote Frau: Paul hat Marietta, die er als Wiedergängerin seiner toten Frau
Marie sieht, umgebracht. Ist diese Erzählung also ein weiteres Beispiel dafür, dass «der Tod einer schönen jungen Frau das poetischste Thema der Welt» ist, wie Edgar Allen Poe meinte – und wie Sie das auch in Ihrem Buch Nur über ihre Leiche beschreiben? Bei Poe gibt es eine ganz ähnliche Geschichte mit dem Titel Ligeia, in der der Erzähler seine Geliebte verliert, in tiefe Trauer verfällt, schliesslich eine zweite Frau heiratet – und über deren Leiche kommt gewissermassen die tote Geliebte zu ihm zurück. Es ist die Idee des Wiederholungszwangs, die Bruges la Morte mit Ligeia verbindet; in beiden Erzählungen hält die Hauptfigur an der Trauer und an der Melancholie fest, anstatt irgendwann einmal die Trauerzeit zu beenden. Man will das Objekt der Trauer wiedergewinnen, aber, und das ist die Ironie: als Tote. Ganz ähnlich wie übrigens in Alfred Hitchcocks berühmtem Film Vertigo, in dem genau dieses Thema durchgespielt wird. Es geht hier nicht nur darum, die tote Geliebte zurückzugewinnen. Man könnte das auch mit dem Mythos von Orpheus und Eurydike zusammendenken. Denn man muss sich doch fragen: Warum dreht Orpheus sich um? Will er wirklich seine tote Eurydike, oder will er noch ein zweites Mal eine tote Eurydike? Wenn man diesem Gedankengang folgt, stellt man fest: Hier wird der Todesdrang unterstrichen, der bei dieser Art von Liebesidealisierung im Vordergrund steht. Und das war auch das, was Poe interessiert hat: Der Tod einer besonders schönen Frau macht die Trauerarbeit für den – männlichen – Künstler zu einem extrem kreativen Akt. Damit wird noch einmal klar, wie sehr die Frau das Blickobjekt, die Materie, die Leinwand, der Resonanzboden für den Mann ist. Es geht hier nicht um eine erwachsene Liebe, in der die beiden Liebenden gleichwertige, voneinander unabhängige Wesen sind, sondern es ist eine Geschichte, in der klar wird, dass die Liebesgeschichte etwas Tödliches hat, weil die Frau das Objekt, die Projektionsfläche, das Supplement des Mannes ist. Deshalb ist sie in gewisser Weise immer schon tot, bevor sie gestorben ist.
Denken Sie, dass Alfred Hitchcock Bruges-la-Morte und Ligeia kannte? In diese Aufzählung gehört auch noch Die Nächste von Alfred Schnitzler, eine ganz ähnliche Geschichte. Vermutlich kannte Hitchcock Edgar Allen Poe,
Rodenbach und Schnitzler kannte er wohl eher nicht. Umso interessanter sind diese Parallelen, denn sie zeigen, dass die tote Geliebte, die noch ein zweites Mal umgebracht wird, eine Art Denkbild ist, das immer wieder auftaucht. Interessant daran ist die Vorstellung, man könne den Tod kraft der eigenen Imagination, kraft des eigenen Begehrens, kraft eines poetischen Mediums überwinden. Und gleichzeitig ist es doppelt befriedigend, wenn die Frau dann noch einmal stirbt.
auf www.opernhaus.ch/shop
Paul kann die Trauer um Marie, seine verstorbene Frau, nicht überwinden, er spinnt sich ein in einen Kokon der Trauer und will eigentlich selbst nicht mehr leben – bis er Marietta sieht, die seiner verstorbenen Frau unglaublich ähnlich sieht. Ist es wirklich eine Doppelgängerin Maries, die er trifft? Oder ist es nicht viel mehr die Projektion seines Wunsches, die sich auf beinahe jede Frau richten könnte? Sigmund Freud spricht von Liebesgeschichten als Wiederholungsgeschichten und davon, dass der Mann in der Geliebten die Mutter sucht. Rodenbach schreibt seine Erzählung zwar ein bisschen früher als Freud, und doch kommt beides aus einem ähnlichen Kontext. Dass es die Mutter ist, ist nicht so entscheidend; wichtig ist eher, dass es mit etwas bereits Vertrautem verbunden ist. Das ganz Andere hat nicht den gleichen Reiz. Wenn man das als eine narzisstische Liebesgeschichte sieht, könnte man sagen: Paul spiegelt sich in allen Frauen. Aber der Reiz scheint mir hier zu sein, dass es bei aller Ähnlichkeit auch eine Differenz gibt. Lebensbejahend wäre es, wenn er sehen würde, Marietta ist Marie ähnlich, aber sie ist auch anders, und ich kann mich auf etwas Neues einlassen; so würde Paul aus der Trauer herausfinden. Die Wiederholung jedoch hat etwas Tödliches. Denn wenn die Wiederholung exakt dasselbe ist wie das, was vorher war, sind alle Entwicklungsmöglichkeiten abgeschnitten.
Sie sprachen von einer «narzisstischen Liebesgeschichte». Interessant ist in diesem Zusammenhang der Moment, in dem Paul Marietta zum ersten Mal erblickt. In der Oper erzählt er seinem Freund Frank davon: Er schaute auf einen See, genannt Minnewasser, und als er wieder aufblickte,
sah er Marietta. Ein narzisstisches Bild, das da beschrieben wird… Paul sieht Marietta zunächst als Spiegelung, erst dann wird sie Körper. Es ist offensichtlich, dass es sich hier um eine narzisstische Liebe handelt. In Hitchcocks Vertigo ist es übrigens ähnlich: Scottie sieht Judy bzw. Madeleine zuerst im Spiegel. Darin steckt die Idee, dass es sich nicht um eine reale Frau handelt, sondern um eine Spiegelung, ein Bild. Damit wird noch mal betont: Es geht nicht um die reale Frau, sondern das Bild, das der Mann sich von ihr macht, und zwar in Bezug auf ein Bild, das er bezüglich einer anderen Frau bereits hat.
Paul trifft Marietta und meint, in ihr eine Wiedergängerin seiner toten Frau Marie zu erblicken; er möchte, dass Marietta die Kleider seiner Frau trägt, ihr Instrument in die Hand nimmt, immer mehr dem Bild seiner Frau gleicht, das in seinem Zimmer hängt. Geht es in der Art und Weise, wie Paul seine Frau wiederauferstehen lassen will, auch darum, Macht und Kontrolle über sie auszuüben?
Natürlich versucht Paul, über die Frau Kontrolle zu gewinnen, und über die tote Frau kann er leichter Kontrolle gewinnen als über die lebende Frau, denn die könnte ja Widerstand leisten. Wenn sie tot ist, hat er die Deutungshoheit, kann sich ihrer bemächtigen. Gleichzeitig sind das Stellvertretergeschichten, die darauf zielen, wie man mit dem eigenen Tod umgeht. Das heisst, auf die Frau werden die Ängste, die die eigene Sterblichkeit betreffen, ausgelagert. Wenn man die Tote beherrschen und wieder zum Leben erwecken kann, beherrscht man nicht nur die Eigenständigkeit der Frau, sondern man kann sich auch einreden, dass man selbst unsterblich ist. Wenn man aus der toten Frau eine lebende machen kann, ist das eine Möglichkeit, sich zu sagen: Ich bin am Leben. In der westlichen Kultur herrscht Angst vor dem Tod, vor der Sterblichkeit und der Versehrtheit. Und diese Erzählungen sind Versuche, das auszublenden.
Brügge ist nicht nur die «tote» Stadt, sondern auch eine sehr katholische Stadt. Paul scheint die Moralvorstellungen dieser Stadt verinnerlicht zu haben und projiziert diese auf Marietta…
Wenn Paul Marietta erotisch geniesst, dann ist das für den Trauernden eine Art Ehebruch. Denn wenn man einer Frau gegenüber einen Treueschwur geleistet hat, kann man auch nach deren Tod keine andere Frau lieben. Es geht also um eine ambivalente Erotik, um die Fantasie, ich könnte mit der Wiedergängerin ein erotisches Verhältnis haben, was mir erlauben würde, mit meiner verstorbenen Frau wieder ein Verhältnis zu haben – also Nekrophilie. Auch in Hitchcocks Vertigo geht es letztlich um Sex mit einer Leiche. Man kann sich dieser Sehnsucht in der Fantasie hingeben, aber gleichzeitig gibt es das Verbot, diese Sehnsucht auszuleben, was noch zusätzlichen Reiz ausübt. Auch das ist Teil einer narzisstischen Logik. Es geht um eine sekundäre erotische Befriedigung, es hat etwas geradezu Masturbatorisches.
Paul hebt seine tote Frau Marie auf ein Podest, sie ist für ihn die Heilige, wohingegen er Marietta als schmutzig und unrein bezeichnet. Schliesslich gibt er Marietta sogar die Schuld dafür, dass sie nicht so sein kann wie Marie. Aber Marietta wehrt sich…
Das Libretto stammt aus den 20erJahren, und hier manifestiert sich schon ein neues Frauenbild. Man könnte das zusammendenken mit Wedekinds Lulu und der Verfilmung dieses Stoffes von Georg Wilhelm Pabst: Lulu ist sich sehr genau dessen bewusst, was sie tut und was die Männer von ihr wollen, sie spielt damit und macht sich sogar darüber lustig. Damit, dass sie sich wehrt, droht Marietta, Pauls Fantasiegebäude zum Einsturz zu bringen…
… und sie entzieht sich seiner Kontrolle, weil sie ein Eigenleben hat … und einen eigenen Standpunkt. Das ist in den Vorgängertexten von Poe und Schnitzler weniger der Fall. Die Oper kann das, weil sie die Sängerin hat, die noch mal ganz anders Widerstand leistet. Hitchcocks Judy bzw. Madeleine ist hilfsbedürftig und liebesbedürftig, sie verkörpert eine masochistische Position. Das ist in der Oper ganz anders.
Aber Marietta muss ihre Eigenständigkeit mit dem Tod bezahlen … Ja, das ist die Logik. Lebend kann sie nicht davonkommen. Da würde die Pointe dieser Genregeschichte verlorengehen. Denn dann würde die Gewalt
dieser narzisstischen Liebe, an die auch Kreativität geknüpft ist, nicht deutlich. Marietta muss sterben, damit klar wird, wie furchtbar eine Liebesökonomie ist, die auf Projektionen und Austausch basiert.
Nachdem er Marietta umgebracht hat, sagt Paul: «Jetzt gleicht sie ihr ganz.» Er meint damit Marietta, die nun endlich vollkommen seiner toten Frau Marie gleicht…
Ja, im Tod ist die Differenz ausgeschaltet, jetzt haben wir absolute Identität. Dieser Gedanke ist natürlich misogyn, aber zugleich steckt darin auch eine Reflexion über das Misogyne: Der Wunsch nach Perfektion oder in diesem Fall nach absoluter Gleichheit ist ein tödliches Begehren – aber es setzt sich durch. Und dann hat der Mann die ganze Kontrolle – und auch keine. Er hat bewiesen: Der Tod ist wieder eingetreten, er hat den Tod eintreten lassen, sie gehört jetzt ganz ihm, denn sie ist genau wie die vorhergehende Frau –aber sie ist auch nicht mehr da. Das ist dramaturgisch stärker, als wenn sie einfach abhauen würde. Feministisch wäre es interessanter. Aber als Kritik an misogynen Fantasien wäre dieses Ende weniger wirkungsmächtig.
Das Libretto nimmt gegenüber der literarischen Vorlage eine entscheidende Veränderung vor: Paul begreift, dass alles, was er erlebt hat, inklusive dem Mord an Marietta, nur ein Traum war, und durch den Traum geläutert, findet er zurück ins Leben. Ist diese Heilung durch einen Traum realistisch?
Wenn man den Traum anschliessend noch auf der Couch mit Freud bespricht, dann vielleicht. Aber mir scheint es ein bisschen zu optimistisch; es hat etwas geradezu Naives.
Können Sie also nachvollziehen, dass das in einer heutigen Aufführung nicht mehr als glaubwürdig empfunden wird?
Ja, absolut. Das Kino der 1930erJahre hat solche TraumGeschichten oft durchgespielt. Aber das war auch eine Konzession an das KinoPublikum, das kein tragisches Ende wollte.
Vielleicht war dieser positive Schluss dem Zeitgeist geschuldet; man wollte 1920 die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs überwinden. Hat dies womöglich zum Erfolg der Oper beigetragen? Möglich wäre es. Dann wäre die Trauer um die tote Frau die Trauer um eine verlorene Welt, die es vor dem Ersten Weltkrieg gab. Und mit der Überwindung des Todes der Frau kann man auch diese verlorene Welt loslassen. Aber vielleicht war der Grund für den überwältigenden Erfolg dieser Oper doch eher der, dass die Partitur Korngolds schon die spätere Filmmusik erahnen lässt, mit der er in Hollywood zwei Oscars gewinnen sollte. Diese Oper verbindet das Populäre mit der hohen Kunst. Und Marietta ist einfach eine für die 1920erJahre sehr moderne, grossstädtische, selbstbewusste Frau, die sehr gut in den Zeitgeist passte.
Das
Gespräch führte Beate Breidenbach
können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben






Tim Martin Hoffmann
Nicht selten sind Opern untrennbar mit ihrem Schauplatz verbunden. Ob der Handlungsort wie im Barbiere di Siviglia oder den Meistersingern von Nürnberg den Werktitel bestimmt oder die Musik, etwa in der Entführung aus dem Serail oder Carmen, von einem den Exotismus streifenden «Lokalkolorit» geprägt ist:
Das Repertoire kennt verschiedenste Werke, denen örtliche Gegebenheiten immanent sind. Die Kategorie des musikalischen Kolorits, der couleur locale, durchzieht insbesondere die Operngeschichte des 19. Jahrhunderts. Suchten Komponisten unter den geistesgeschichtlichen Vorzeichen des europäischen Nationalismus nach einem als originär und authentisch imaginierten nationalen Ton, bildete der Exotismus als Entdeckung und Akzentuierung eines Anderen ein hierzu komplementäres Pendant. Je distinkter ein Handlungsraum definiert ist, desto klarer treten seine Konturen zutage. Orte sind Produkt von Grenzziehungen.
Was jedoch geschieht, wenn in der Wahrnehmung Grenzen durchlässig werden, wenn Konturen im Traum verschwimmen? Jener Frage hat Erich Wolfgang Korngold in seiner Oper Die tote Stadt ein musikdramatisches Denkmal gesetzt. Vermeintlich eindeutig verweist die Handlung nach Brügge, wird doch bereits im Untertitel der Partitur eine «Oper in 3 Bildern frei nach G. Rodenbach: ‹Brugeslamorte›» ausgewiesen. Tatsächlich greift das Textbuch auf jenen Stoff zurück, den Georges Rodenbach 1892 zunächst in Form des Romans Bruges-la-Morte schuf, um ihn in seinem Todesjahr 1898 selbst unter dem Titel Le Mirage als Schauspiel zu adaptieren. Die Geschichte rund um den Witwer Hugues Viane (Korngolds späteren Protagonisten Paul), dessen Trauer sich im Bilde Brügges spiegelt, jener Stadt, die Ende des 19. Jahrhunderts fürwahr nur noch als Schatten der einst florierenden mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handelsmetropole gelten konnte, trug 1916 der Schriftsteller Siegfried Trebitsch
an den Komponisten heran. Hatte Korngold zunächst Hans Müller, den Librettisten seiner zweiten Oper Violanta, mit der Ausarbeitung eines Textbuches betraut, quittierte dieser jedoch spätestens im Frühjahr 1918 seine Mitarbeit. Dem ungewöhnlichen Umstand, dass Erich Wolfgang Korngold und sein Vater, der einflussreiche Musikkritiker Julius Korngold, bis 1920 selbst unter dem Pseudonym Paul Schott ans Werk schritten, ist dabei vermutlich der gravierendste Eingriff in die literarische Vorlage zu verdanken: der Transfer einer realistischen, klar konturierten Handlung in die Sphäre von Traum und Vision.
Korngolds Oper im zeitgeschichtlichen Kontext
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
«Die Umgestaltung zu einer Traumhandlung war meine Idee», konstatiert Julius Korngold in seinen Memoiren. Jene in der Oper waltende «moderne Mischung von Realistik und Phantastik» sei es, die den von Rodenbach vorgelegten «sketchartigen Schluss der Erdrosselung einer Frau» zugunsten eines «versöhnenden elegischen Ausklang[s]» mildern sollte. Dass die Tote Stadt im Gestus der Milderung realistischer Traumata nicht minder nach Wien als nach Brügge verweist, ist schon der ersten Szene – gleichsam botanisch – eingeschrieben. Wenn der Protagonist Paul seine «Kirche des Gewesenen», insbesondere das Portrait der verstorbenen Marie, mit den besungenen «Rosen und Levkojen» schmücken lässt, ist dies ein verstecktes, jedoch blumensprachlich unmissverständliches Zeichen. Zur roten Liebesblume hinzu tritt mit der Levkoje ein Symbol der Treue, das bereits der Wortherkunft vom griechischen leukós nach mit der weissen Farbe verbunden ist. Die vermeintlich beiläufige Beobachtung, dass die über den Tod hinaus beschworene Liebestreue just mit der Reverenz an die Nationalfarben Österreichs einhergeht, erweist sich mit Blick auf den Opernschluss als kulturgeschichtliches Sinnbild. Pauls im Traum gewonnene Einsicht, dass es im Hier und Jetzt «kein Auferstehn» gibt, geriert sich vor dem Hintergrund des im Herbst 1918 besiegelten Niedergangs des Habsburgerreiches als Rede an die in Nostalgie verharrende Nation: «Wie weit soll unsre Trauer gehn, wie weit darf sie es, ohn’ uns zu entwurzeln?» Unumwunden

leistet Korngold der vom Vater proklamierten «besondere[n] Sendung» der Operngattung Gefolgschaft, «zur Stärkung der Lebensenergien beizutragen, deren diese schwere, verdüsterte Zeit bedarf». Weitergehend scheint das in der Schlussszene variierte Lautenlied «Glück, das mir verblieb» selbst den zeitgeschichtlichen Kontext des Ersten Weltkriegs zu referenzieren. Drohte bereits 1916 Korngolds Einberufung zum Militär – was im Frühjahr des Folgejahres Realität werden sollte –, so glaubte der Vater aus dem «volkstümliche[n], seelenhafte[n] Lied zur Laute […] so etwas wie den Schwanengesang des von den Gefahren des Krieges Bedrohten herauszuhören». Dem rotweissroten Trauerschmuck entsprechend, werden in der toten Marie schliesslich gleichermassen die zahllosen Gefallenen des Krieges wie der mit ihm einhergehende Zerfall des Habsburgerreiches betrauert.
Canal Grande, Ufer des Rheins,
Minnewater
Dass Korngolds Oper die Mauern Brügges planvoll transzendiert, wird paradoxerweise besonders dort ersichtlich, wo Orte scheinbar am distinktesten benannt werden. Schauplatz des zweiten Bildes ist ein «öder, einsamer Kai», gelegen an jenem Gewässer, das Paul bereits im ersten Bild als «Minnewasser» besingt. Während das hier gemeinte Minnewater bis dato den Ort kontemplativen Erinnerns an die verstorbene Marie darstellte, wird es nun Kulisse für das wilde Treiben von Mariettas Schauspieltruppe. Mit dem Ideal treuer, ehelicher Liebe haben die zur Schau gestellten Liebeleien Mariettas reichlich wenig zu tun, vielmehr entspinnt sich eine «burleske Nachtszene», die dem genius loci handfest den Kampf ansagt: «Schach Brügge! Und Schach der dumpfen Lüge!»
Emblematisch eingeleitet wird die karnevaleske Szenerie dabei gar auf venezianische Art, wenn die «Tänzergesellschaft» in Booten zu den Worten «Träume dich auf Wasserflut nach Venedig» am Kai anlangt. Als wären der Ortswechsel damit nicht genug, fordert Marietta den als Pierrot verkleideten Fritz zu einem Lied auf, das sich zum «Tanze am Rhein, bei Mondenschein» zurückträumt und, dem wagnerisch anmutenden Incipit «Mein Sehnen, mein Wähnen» nach,
mit einer motivischen Allusion an das Rheingold anhebt. Bald Canal Grande, bald Ufer des Rheins, ist das Minnewater mehr künstlerischer Topos denn klar umrissener Handlungsort. Es ist die Idee der Minne, die der Traumsequenz als dramatische Kontrastfolie dient – und dies ungeachtet dessen, dass die niederländische Etymologie rein gar nichts mit dem mittelhochdeutschen Begriff zu tun hat.
Wird sich Korngolds Ortskenntnis ohnehin weitgehend auf die Fotografien und Schilderungen aus Rodenbachs Roman beschränkt haben, zumal er Brügge nachweislich erst 1955 mit seiner Gattin Luzi bereisen sollte, liefe der Versuch eines kartographisch präzisen Nachvollzugs der Bühnenanweisungen überdies der Intention des Werkes zuwider. Im Vorfeld der im Januar 1921 realisierten Wiener Erstaufführung etwa teilte Korngold dem Bühnenbildner Alfred Roller mit, die Szenerie des «Brüggeakt[s]» solle mehr den Eindruck eines «fantastisch öden, einsamen» Kais erwecken. Auch Julius Korngold wird nicht müde, die romantische Kategorie der Fantastik als zentrales Charakteristikum der Oper hervorzuheben. So preist er im Sommer 1919 gegenüber dem Verleger das Libretto als «kühnes, eigenartiges Buch mit phantastischen, stark gefühlsmässigen und explosivleidenschaftlichen Elementen, eines so recht für Erichs Musikeigentümlichkeiten». Neben der «visionären Einkleidung der Handlung» ziehe das Werk seine «grundlegende Stimmungsfarbe» aus der «stillen, frommen Glockenstadt Brügge». Doch auch der die Traumsequenz durchziehende Glockenklang ist nur bedingt als realistische couleur locale aufzufassen. Wenn Paul zu Beginn des zweiten Bildes ins Zwiegespräch mit jenen «Beichtiger[n] aus Erz» tritt, läuten die in der Partitur notierten tiefen Glocken zwar in üblichen Terz und Quartintervallen, doch wird die realitätsnahe Klangsignatur rasch zugunsten einer Pentatonik preisgegeben, die von der kontrastierenden, grellen Farbe von Celesta, SoloFlöte und StreicherPizzicato bestimmt ist. Die vermeintlich exotistische Tonsprache markiert jedoch weder Chinoiserie noch Japonismus, vielmehr ein Überall und Nirgends: das Geisterreich des Traumes. Diesem bleibt auch die Prozession des dritten Bildes verhaftet, wenngleich sie auf die traditionelle, seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert in Brügge belegte HeiligBlutProzession Bezug nimmt. Auch hier dürfte Korngolds Kenntnis des rituellen Spektakels vorwiegend literarisch vermittelt gewesen sein –
zumal er offenbar einem Irrtum des Übersetzers Trebitsch aufsass: Während sich in Rodenbachs Le Mirage die weibliche Hauptperson Jane nach der Bedeutung der «fameuse procession du SaintSang» erkundigt, legt ihr Trebitsch die Frage nach einer Fronleichnamsprozession in den Mund. Ungeachtet dessen, dass die HeiligBlutProzession recte an Christi Himmelfahrt stattfindet, bezieht Korngold den auf Thomas von Aquin zurückgehenden Fronleichnamshymnus Pange lingua in den Operntext ein. Aus Trebitschs misreading wird ein künstlerisch produktiver Fehler: Der lateinische Hymnus besingt das Geheimnis des Leibs, das mysterium corporis, das Paul in der vermeintlichen Reinkarnation seiner Toten in der noch dazu der Fleischeslust frönenden Tänzerin Marietta leibhaftig vor Augen steht. Musikalisch verzichtet Korngold jedoch auf das Zitieren des zugehörigen gregorianischen Chorals. Stattdessen erweist sich das von der Gruppe der Mönche vorgebrachte Pange lingua als eine Reihung von Tritoni, deren geballte Präsenz im liturgischen Kontext die historische Deutung des Intervalls als diabolus in musica konterkariert. Während Rodenbachs Roman sogar mit Fotografien der Brügger HeiligBlutBasilika und des in ihr verwahrten Reliquienschreins aufwartet, führt der Weg der Oper ins Abstrakte. Fotorealismus weicht Fantastik.
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer
Raum für Ortswechsel und Aktualisierung
erwerben
Der Befund, dass das Brügge des ausgehenden 19. Jahrhunderts zwar den Schauplatz der Oper bildet, eine historisch und geografisch korrekte Darstellung allerdings nicht intendiert ist, wirft beinahe unweigerlich die Frage nach dem Werktitel auf. Wohl weil Georges Rodenbachs Bruges-la-Morte in der zeitgenössisch populärsten Übersetzung als Das tote Brügge firmierte, zog auch Erich Wolfgang Korngold zwischenzeitlich jenen Titel in Betracht. Bis heute prangt er, nur zart mit Bleistift durchgestrichen, mittig auf der ersten Seite seines Particells. Erst am unteren Blattrand wird man des endgültigen Titels Die tote Stadt gewahr. Was ist geschehen? – Als Julius Korngold dem Verlag Schott gegenüber im bereits zitierten Brief aus dem Sommer 1919 erstmals detaillierte Einblicke
in die neue, noch unfertige Oper seines Sohnes gibt, steht der endgültige Titel noch nicht fest. Für Anregungen sei man offen. Er selbst habe bereits an Die Auferstandene, Das Phantom oder Vision gedacht; jedenfalls sei es gut, «wenn das Traumhafte, Halluzinatorische der Handlung schon irgendwie im Titel durchleuchtet». Wenige Wochen später teilt der Verleger mit, sich über den Titel «lange den Kopf zerbrochen» zu haben: «Am besten noch» habe Die tote Stadt «gefallen», wenngleich man zugeben müsse, «dass der Titel nur in sehr losen Beziehungen mit dem Inhalt» stehe. Alternativ schlage man etwa Die Rivalin, Im Bann des Todes oder Genesung vor – Varianten, die Korngold alsbald verwarf, um stattdessen den erstgenannten Vorschlag festzuhalten.
Die der Umformung zur Traumhandlung gemässe Polyvalenz des Ortes mag wohl den Ausschlag gegenüber der selbst ersonnenen Lösung gegeben haben. Wenn im finalen Werktitel der distinkte Schauplatz Brügge hinter den künstlerischen Topos einer «toten» Stadt zurücktritt, bietet dies zuletzt auch szenisch Raum für Ortswechsel und Aktualisierungen. Konnte das Publikum der Wiener Erstaufführung im Brügger Minnewater zugleich den Donaukanal erblicken, so wohnt der Toten Stadt, in der vermeintlich alles «alt» ist und «gespenstisch», eine unverbrüchliche Aktualität inne – das Potential, den zweischneidigen «Traum der Wiederkehr» auch andernorts zu träumen.
Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben



ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897–1957)
Oper in drei Bildern
Libretto von Paul Schott (Julius und Erich Wolfgang Korngold)
nach dem Roman «Bruges-la-morte» und dem Schauspiel «Le Mirage» von Georges Rodenbach
Personen
Paul Tenor
Marietta / Marie Sopran
Frank / Fritz der Pierrot Bariton
Brigitta Alt
Juliette Sopran
Lucienne Mezzosopran
Gaston Tenor
Victorin Tenor
Graf Albert Tenor
Chor, Kinderchor
Beghinen, die Erscheinung der Prozession, Tänzerinnen, Tänzer
Brügge, Ende des 19. Jahrhunderts
Bei Paul. Ein kleines Gemach von geringer Tiefe mit alten schweren Möbeln. Der düstere Eindruck langer Unbenütztheit und Unbewohntheit liegt darüber. Gestelle mit alten Nippes und Photographien, eine Glastruhe, darin eine Haarflechte. – Sonniger Spätherbstnachmittag.
BRIGITTA schliesst von aussen auf und lässt Frank eintreten Behutsam! Hier ist alles alt, und gespenstig. Bis gestern drang keiner in diese Stube ausser ihm und mir, die Jahre durch, die er in Brügge lebt.
FRANK
Und gestern –?
BRIGITTA
Sie sind sein Freund, Herr Frank –so sei’s gesagt. Gestern schien er ganz gewandelt. Er bebte vor Erregung, schluchzt’ und lachte. «Türen auf!» so sagte er, «Licht in meinen Tempel! Die Toten stehen auf!»
FRANK
Dies hab ich nie von ihm gehört. Sonderbar!
BRIGITTA
Seht – Rosen und Levkojen an den Rahmen und an der Türe zu ihrem Zimmer, in dem sie starb. Besonders aber dies Bild hat er schön geschmückt.
FRANK
Ist sie das –? Marie?
BRIGITTA
Ja, das war sie. In dem hellen, weichen Kleide, das er so liebte.
FRANK
Schön –!
Herrgott! Wie leuchtet dies Haar!
BRIGITTA zeigt auf die Kristalltruhe
Da drunter liegt ein Strähn von diesem Haar. Flüssige Dukaten, nicht wahr?
FRANK
Er hat es aufbewahrt? Seltsam.
BRIGITTA
Und hier –mit einer Bewegung über den ganzen Raum hin kein Fleck, der nicht von seiner Toten spräche. Er nennts: Kirche des Gewesenen.
FRANK
So lebt er stets?
BRIGITTA
Bis gestern immer so. Er sagte: «Brügge und ich, wir sind eins. Wir beten Schönstes an: Vergangenheit.»
FRANK
Und du, Brigitt? Erträgst du das? Du – eine Frau? Lockts dich ins Leben nicht hinaus?
BRIGITTA leiser
Was das Leben ist, weiss ich nicht, Herr Frank. Denn ich bin allein. Hier aber, hier ist Liebe, Herr Frank, das weiss ich. Und wo Liebe, dort dient eine arme Frau zufrieden. es schellt draussen Da ist er.
2. SZENE
Paul tritt ein, nervös von einem Erlebnis erregt.
PAUL Frank! Freund!
FRANK lächelnd Brigitta führte mich in die «Kirche des Gewesenen»
PAUL lebhaft
Des Gewesenen? Nein!
zu Brigitta Lauf schnell hinab zum Gärtner – hol’ Rosen! Zwei Arme voll! Es soll erglühen hier von roten Rosen. er hat Brigitta hinausgedrängt zu Frank
Du sahst ihr Bild –
FRANK
Ja, sie war schön, und viel hast du verloren –
PAUL in das Bild versunken
Marie, Marie, dein Atem, deine Augen! zu Frank
Wie sagst du? Sie war schön?
FRANK Gewiss!
PAUL
Das komplette
Sie war schön, sagst du? leidenschaftlich Sie ist schön! Sie ist! Sie ist!
FRANK blickt ihn forschend an In deiner Fantasie –?
PAUL
Nein, nein, sie lebt!
Ein Schatten gleitet übers Wasser. Ich blicke auf:
Vor mir steht eine Frau im Sonnenlicht.
Frank! Frank! Eine Frau… im Mittagsglast erglänzt Mariens Goldhaar, den Lippen entschwebt Mariens Lächeln.
Nicht Ähnlichkeit mehr – nein, ein Wunder, Begnadigung! Es schien sie selbst, sie mein Weib.
Ja, mein lebend, mein atmend Weib!
Ein Fieber fasst mich nach altem Glück. Gott, schrie ich, wenn du mir gnädig bist, gib sie mir zurück!
Und heute Mittag sprach ich sie, bebenden Herzens, zweifelswund –und der Wunder grösstes: Mariens Stimme klang aus ihrem Mund!
FRANK Im öden Brügge eine Unbekannte?
können Sie auf
PAUL Ich weiss nicht, wer sie ist –lud sie zu mir in meine Einsamkeit. Und sie kommt, und in ihr kommt meine Tote, kommt Marie.
www.opernhaus.ch/shop oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Bald ist sie hier, sie kehrt zurück. O hör ein Märchen, ein Wunder!
Du weisst, dass ich in Brügge blieb, um allein zu sein mit meiner Toten. Die tote Frau, die tote Stadt, flossen zu geheimnisvollem Gleichnis. Und täglich schritt ich gleichen Weg mit ihrem Schatten Arm in Arm, zum Minnewasser, auf die Fläche starrend, ihr teures Bild mit Tränen mir ersehnend, den süssen, sanft in sich gekehrten Blick, den Schimmer ihres goldnen Haars. Und gestern wieder träumt ich am Gitter von der Entschwundnen, von ihr, Marie. Holt mir ihr Antlitz aus der Tiefe, hold und rein. So ganz war sie mir nah, wie einst in den Tagen des Glücks – sehnend, liebend.
In meines Schauns Versunkenheit schallen Schritte.
Ich horche…
FRANK ernst
Hör Paul, du wagst gefährlich Spiel. Du bist ein Träumer, bist ein Geisterseher. Ich seh die Dinge, seh die Frauen so wie sie sind. Willst du zum Herrn dich über Tod und Leben schwingen? Ein lebend Sein zur Puppe des Verstorbnen zwingen? Bescheide dich! Zu lang warst du allein, dein Blut murrt gegen diese Trauer. Seis drum, umarm eine schöne Frau, doch Tote lass mir schlafen.
PAUL wie einer der nicht zugehört hat, ekstatisch Ich will den Traum der Wiederkehr vertiefen, will sie durch diese Türe schreiten, den Raum durchleuchten sehn, in dem ihr holder Duft noch schwebt, der Rhythmus ihres süssen Wesens webt. In ihr kommt Marie, kommt meine Tote.
Programmheft
DIE TOTE STADT
Das komplette
Oper in drei Bildern von Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) Libretto von Paul Schott (Julius und Erich Wolfgang Korngold) nach dem Roman «Bruges-la-morte» und dem Schauspiel «Le Mirage» von Georges Rodenbach
Premiere am 21. April 2025, Spielzeit 2024/25
Herausgeber Opernhaus Zürich
können Sie auf www.opernhaus.ch/shop
Intendant Andreas Homoki
Zusammenstellung, Redaktion Beate Breidenbach Layout, Grafische Gestaltung Carole Bolli Anzeigenverkauf Opernhaus Zürich, Marketing Telefon 044 268 66 33, inserate@opernhaus.ch
Schriftkonzept und Logo Studio Geissbühler Druck Fineprint AG
oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben
Textnachweise:
Die Handlung schrieb Dmitri Tcherniakov (Deutsch von Beate Breidenbach). Die Gespräche mit Dmitri Tcherniakov, Lorenzo Viotti und Elisabeth Bronfen sowie der Text von Tim Martin Hoffmann sind Originalbeiträge für dieses Programmheft. Regine Palmai, Wunderkind und Puccini des Films, aus: Programmheft der Deutschen Oper Berlin, Spielzeit 2003/04 (leicht gekürzt).
Fjodor Dostojewski, Die Sanfte, Ausschnitte aus der Übersetzung von Werner Creutzinger, Berlin 1990. Fjodor Dostojewski, Auf-
zeichnungen aus dem Kellerloch, Ausschnitte aus der Übersetzung von Ursula Keller, München 2021.
Bildnachweise:
Monika Rittershaus fotografierte die Klavierhauptprobe zur «Toten Stadt» am 11. April 2025.
Urheber, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.
Die Werkeinführungen der Dramaturgie sind auch online und mobil auf jedem Smartphone abrufbar.
Unsere Vorstellungen werden ermöglicht dank der Subvention des Kantons Zürich sowie der Beiträge der Kantone Luzern, Uri, Zug und Aargau im Rahmen der interkantonalen
Kulturlastenvereinbarung und der Kantone Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Schaffhausen.
PRODUKTIONSSPONSOREN
AMAG
Atto primo
Clariant Foundation
Freunde der Oper Zürich
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG
René und Susanne Braginsky-Stiftung
Freunde des Balletts Zürich
Ernst Göhner Stiftung
Hans Imholz-Stiftung
Max Kohler Stiftung
Kühne-Stiftung
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung
Hans und Edith Sulzer-Oravecz-Stiftung
Swiss Life
Swiss Re
Zürcher Kantonalbank
Josef und Pirkko Ackermann
Alfons’ Blumenmarkt
Familie Thomas Bär
Bergos Privatbank
Elektro Compagnoni AG
Stiftung Melinda Esterházy de Galantha
Fitnessparks Migros Zürich
Egon-und-Ingrid-Hug-Stiftung
Walter B. Kielholz Stiftung
Klinik Hirslanden
KPMG AG
Landis & Gyr Stiftung
Die Mobiliar
Annina und George Müller-Bodmer
Fondation Les Mûrons
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
StockArt – Stiftung für Musik
John G. Turner und Jerry G. Fischer
Else von Sick Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
Elisabeth Weber-Stiftung
Art Mentor Foundation Lucerne
Theodor und Constantin Davidoff Stiftung
Dr. Samuel Ehrhardt
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Garmin Switzerland
Elisabeth K. Gates Foundation
Stiftung LYRA zur Förderung hochbegabter, junger Musiker und Musikerinnen
Minerva Kunststiftung
Irith Rappaport
Luzius R. Sprüngli
Madlen und Thomas von Stockar
















