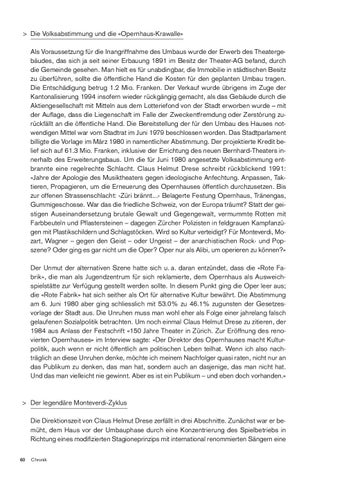> Die Volksabstimmung und die «Opernhaus-Krawalle» Als Voraussetzung für die Inangriffnahme des Umbaus wurde der Erwerb des Theatergebäudes, das sich ja seit seiner Erbauung 1891 im Besitz der Theater-AG befand, durch die Gemeinde gesehen. Man hielt es für unabdingbar, die Immobilie in städtischen Besitz zu überführen, sollte die öffentliche Hand die Kosten für den geplanten Umbau tragen. Die Entschädigung betrug 1.2 Mio. Franken. Der Verkauf wurde übrigens im Zuge der Kantonalisierung 1994 insofern wieder rückgängig gemacht, als das Gebäude durch die Aktiengesellschaft mit Mitteln aus dem Lotteriefond von der Stadt erworben wurde – mit der Auflage, dass die Liegenschaft im Falle der Zweckentfremdung oder Zerstörung zurückfällt an die öffentliche Hand. Die Bereitstellung der für den Umbau des Hauses notwendigen Mittel war vom Stadtrat im Juni 1979 beschlossen worden. Das Stadtparlament billigte die Vorlage im März 1980 in namentlicher Abstimmung. Der projektierte Kredit belief sich auf 61.3 Mio. Franken, inklusive der Errichtung des neuen Bernhard-Theaters innerhalb des Erweiterungsbaus. Um die für Juni 1980 angesetzte Volksabstimmung entbrannte eine regelrechte Schlacht. Claus Helmut Drese schreibt rückblickend 1991: «Jahre der Apologie des Musiktheaters gegen ideologische Anfechtung. Anpassen, Taktieren, Propagieren, um die Erneuerung des Opernhauses öffentlich durchzusetzen. Bis zur offenen Strassenschlacht: ‹Züri brännt...› Belagerte Festung Opernhaus, Tränengas, Gummigeschosse. War das die friedliche Schweiz, von der Europa träumt? Statt der geistigen Auseinandersetzung brutale Gewalt und Gegengewalt, vermummte Rotten mit Farbbeuteln und Pflastersteinen – dagegen Zürcher Polizisten in feldgrauen Kampfanzügen mit Plastikschildern und Schlagstöcken. Wird so Kultur verteidigt? Für Monteverdi, Mozart, Wagner – gegen den Geist – oder Ungeist – der anarchistischen Rock- und Popszene? Oder ging es gar nicht um die Oper? Oper nur als Alibi, um operieren zu können?» Der Unmut der alternativen Szene hatte sich u. a. daran entzündet, dass die «Rote Fabrik», die man als Jugendzentrum für sich reklamierte, dem Opernhaus als Ausweichspielstätte zur Verfügung gestellt werden sollte. In diesem Punkt ging die Oper leer aus; die «Rote Fabrik» hat sich seither als Ort für alternative Kultur bewährt. Die Abstimmung am 6. Juni 1980 aber ging schliesslich mit 53.0% zu 46.1% zugunsten der Gesetzesvorlage der Stadt aus. Die Unruhen muss man wohl eher als Folge einer jahrelang falsch gelaufenen Sozialpolitik betrachten. Um noch einmal Claus Helmut Drese zu zitieren, der 1984 aus Anlass der Festschrift «150 Jahre Theater in Zürich. Zur Eröffnung des renovierten Opernhauses» im Interview sagte: «Der Direktor des Opernhauses macht Kulturpolitik, auch wenn er nicht öffentlich am politischen Leben teilhat. Wenn ich also nachträglich an diese Unruhen denke, möchte ich meinem Nachfolger quasi raten, nicht nur an das Publikum zu denken, das man hat, sondern auch an dasjenige, das man nicht hat. Und das man vielleicht nie gewinnt. Aber es ist ein Publikum – und eben doch vorhanden.»
> Der legendäre Monteverdi-Zyklus Die Direktionszeit von Claus Helmut Drese zerfällt in drei Abschnitte. Zunächst war er bemüht, dem Haus vor der Umbauphase durch eine Konzentrierung des Spielbetriebs in Richtung eines modifizierten Stagioneprinzips mit international renommierten Sängern eine 60
Chronik