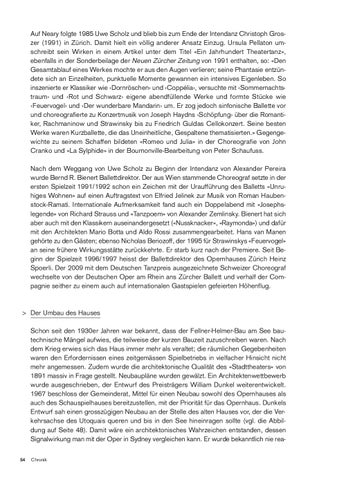Auf Neary folgte 1985 Uwe Scholz und blieb bis zum Ende der Intendanz Christoph Groszer (1991) in Zürich. Damit hielt ein völlig anderer Ansatz Einzug. Ursula Pellaton umschreibt sein Wirken in einem Artikel unter dem Titel «Ein Jahrhundert Theatertanz», ebenfalls in der Sonderbeilage der Neuen Zürcher Zeitung von 1991 enthalten, so: «Den Gesamtablauf eines Werkes mochte er aus den Augen verlieren; seine Phantasie entzündete sich an Einzelheiten, punktuelle Momente gewannen ein intensives Eigenleben. So inszenierte er Klassiker wie ‹Dornröschen› und ‹Coppélia›, versuchte mit ‹Sommernachtstraum› und ‹Rot und Schwarz› eigene abendfüllende Werke und formte Stücke wie ‹Feuervogel› und ‹Der wunderbare Mandarin› um. Er zog jedoch sinfonische Ballette vor und choreografierte zu Konzertmusik von Joseph Haydns ‹Schöpfung› über die Romantiker, Rachmaninow und Strawinsky bis zu Friedrich Guldas Cellokonzert. Seine besten Werke waren Kurzballette, die das Uneinheitliche, Gespaltene thematisierten.» Gegengewichte zu seinem Schaffen bildeten «Romeo und Julia» in der Choreografie von John Cranko und «La Sylphide» in der Bournonville-Bearbeitung von Peter Schaufuss. Nach dem Weggang von Uwe Scholz zu Beginn der Intendanz von Alexander Pereira wurde Bernd R. Bienert Ballettdirektor. Der aus Wien stammende Choreograf setzte in der ersten Spielzeit 1991/1992 schon ein Zeichen mit der Uraufführung des Balletts «Unruhiges Wohnen» auf einen Auftragstext von Elfried Jelinek zur Musik von Roman Haubenstock-Ramati. Internationale Aufmerksamkeit fand auch ein Doppelabend mit «Josephslegende» von Richard Strauss und «Tanzpoem» von Alexander Zemlinsky. Bienert hat sich aber auch mit den Klassikern auseinandergesetzt («Nussknacker», «Raymonda») und dafür mit den Architekten Mario Botta und Aldo Rossi zusammengearbeitet. Hans van Manen gehörte zu den Gästen; ebenso Nicholas Beriozoff, der 1995 für Strawinskys «Feuervogel» an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrte. Er starb kurz nach der Premiere. Seit Beginn der Spielzeit 1996/1997 heisst der Ballettdirektor des Opernhauses Zürich Heinz Spoerli. Der 2009 mit dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnete Schweizer Choreograf wechselte von der Deutschen Oper am Rhein ans Zürcher Ballett und verhalf der Compagnie seither zu einem auch auf internationalen Gastspielen gefeierten Höhenflug.
> Der Umbau des Hauses Schon seit den 1930er Jahren war bekannt, dass der Fellner-Helmer-Bau am See bautechnische Mängel aufwies, die teilweise der kurzen Bauzeit zuzuschreiben waren. Nach dem Krieg erwies sich das Haus immer mehr als veraltet; die räumlichen Gegebenheiten waren den Erfordernissen eines zeitgemässen Spielbetriebs in vielfacher Hinsicht nicht mehr angemessen. Zudem wurde die architektonische Qualität des «Stadttheaters» von 1891 massiv in Frage gestellt. Neubaupläne wurden gewälzt. Ein Architektenwettbewerb wurde ausgeschrieben, der Entwurf des Preisträgers William Dunkel weiterentwickelt. 1967 beschloss der Gemeinderat, Mittel für einen Neubau sowohl des Opernhauses als auch des Schauspielhauses bereitzustellen, mit der Priorität für das Opernhaus. Dunkels Entwurf sah einen grosszügigen Neubau an der Stelle des alten Hauses vor, der die Verkehrsachse des Utoquais queren und bis in den See hineinragen sollte (vgl. die Abbildung auf Seite 48). Damit wäre ein architektonisches Wahrzeichen entstanden, dessen Signalwirkung man mit der Oper in Sydney vergleichen kann. Er wurde bekanntlich nie rea54
Chronik