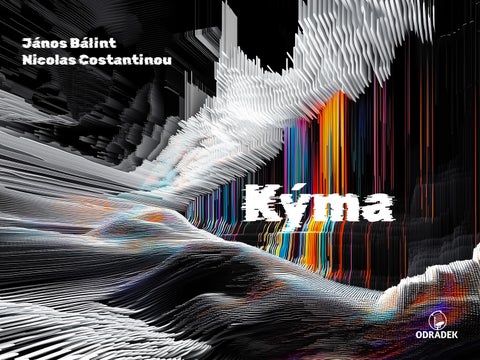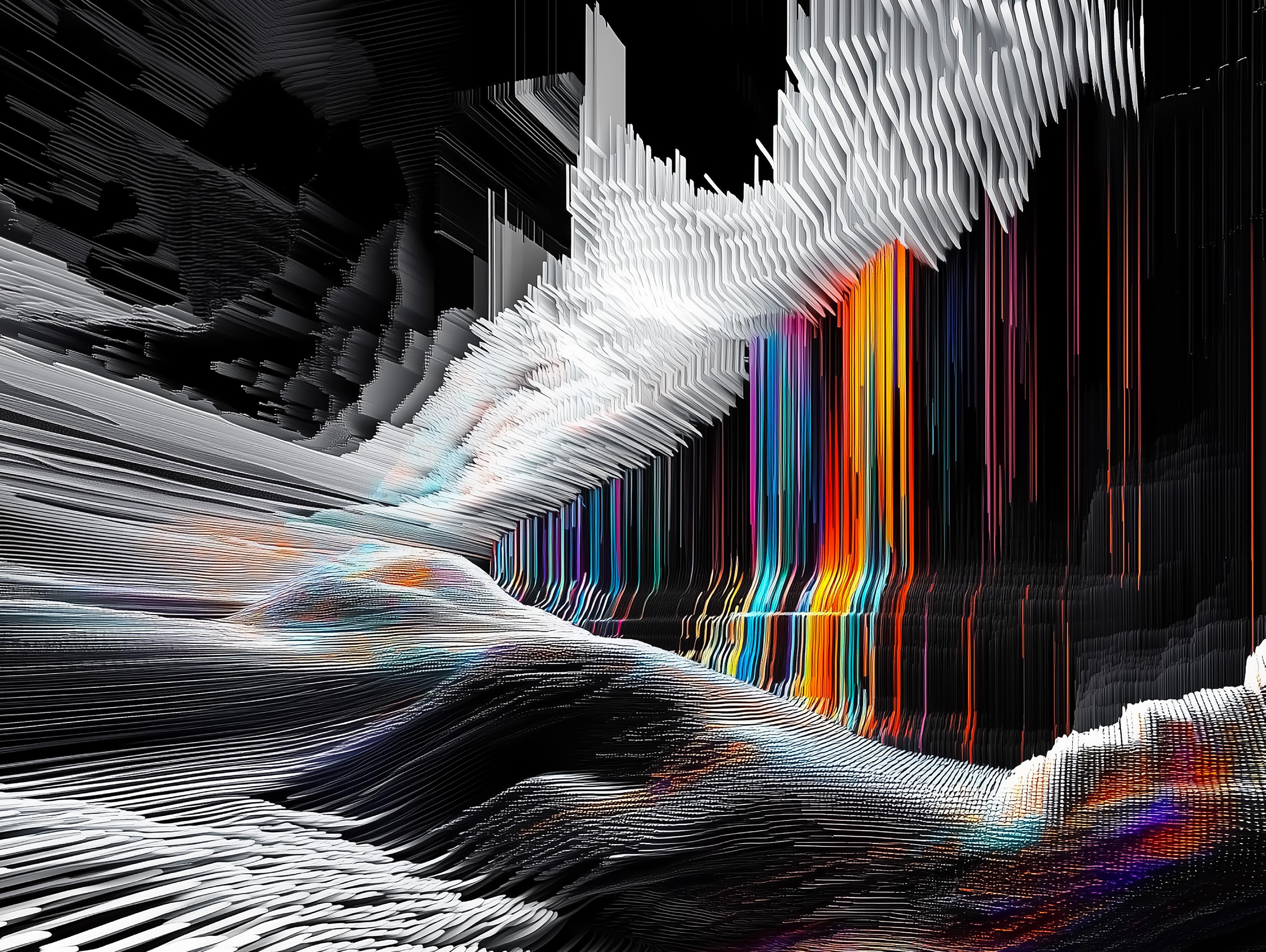
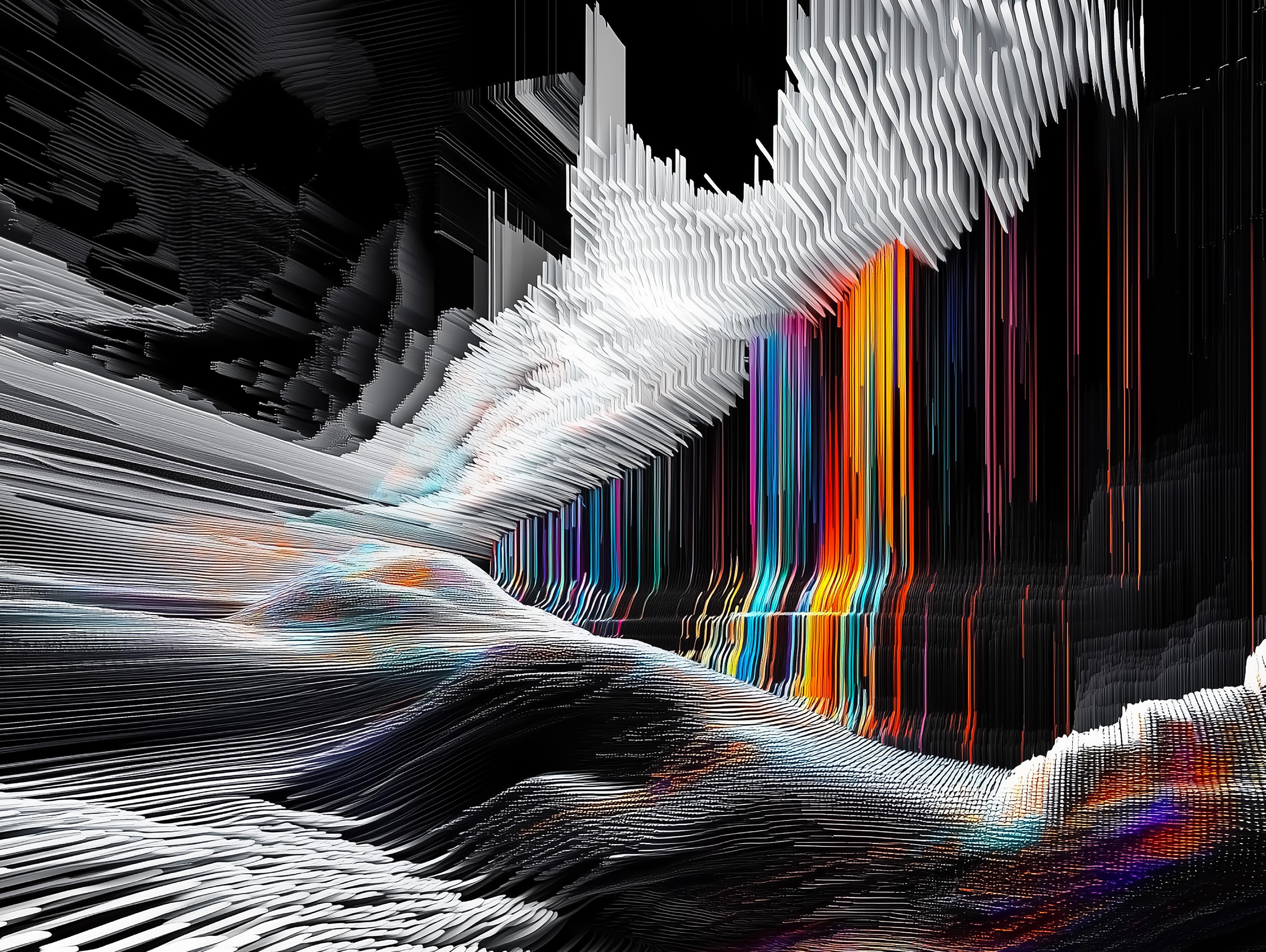
János Bálint
Nicolas Costantinou
7.
FRANCIS POULENC
Sonata for Flute and Piano
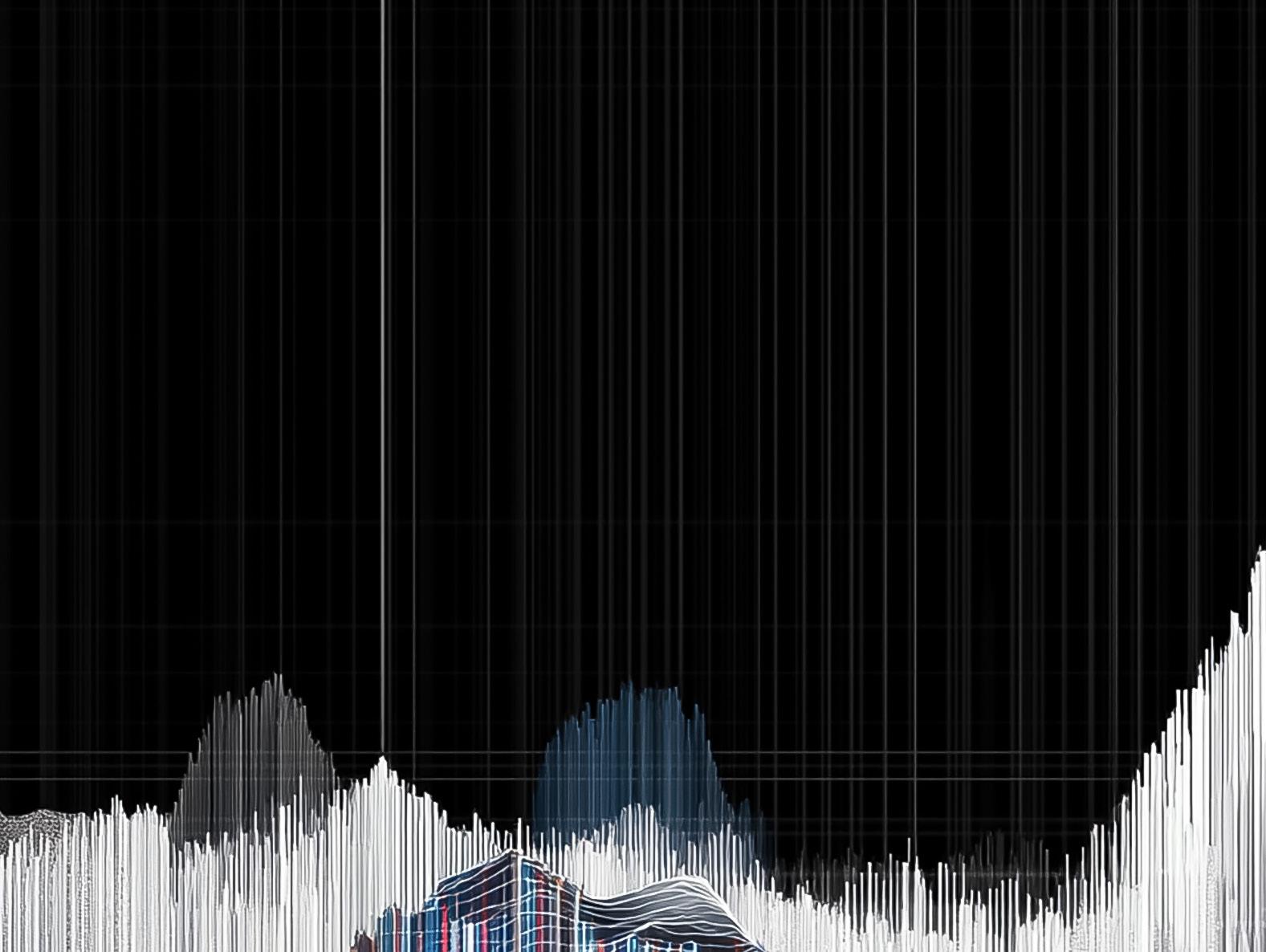
PETER MIEG (1906-1990)
Sonata for Flute and Piano (1963)
CONSTANTINOS Y. STYLIANOU (b. 1972)
Sonata for Flute and Piano * (2021)
Play Time: 63’15 * World Premiere Recording



The title Kýma refers to the Greek word for ‘wave’, encapsulating the concept of continuous flow and movement, much like both sound and waves. This idea serves as a metaphor for the transmission of musical energy, as it is emitted by the flautist and pianist and travels through the air, reaching the listener, just as sea waves carry energy through water.
The pieces featured in the album reflect diverse musical languages and styles, yet they are interconnected by their Neoclassical elements. The album opens with the popular Sonata by the French composer Francis Poulenc. Poulenc’s work is characterised by a bittersweet charm, wit, irony, and emotion, standing out for its modern aesthetic, which challenges the emotionalism of César Franck and distances itself from the Impressionism of Debussy and Ravel.

Following this is the Sonata by Swiss composer, critic and painter Peter Mieg. Mieg’s piece is rich in inventiveness and melodic material, offering a unique take on the flute, revealing his deep affinity for the instrument while exploring new sonic possibilities.
The album concludes with the Sonata by Constantinos Y. Stylianou. His work highlights his preference for the traditional Classical sonata form, which he views as a constructive framework within the limits of tonality. Stylianou’s Sonata, filled with lyricism and musical creativity, brings the album to a close with a contemporary yet tradition-rooted composition.
It is with great pleasure that we share a sample of our musical collaboration with you, and we hope you enjoy it as much as we did creating it.

Nicolas Costantinou & János Bálint






Poulenc began thinking about composing a Sonata for flute and piano in 1952, but the composition of other works, such as the Sonata for Two Pianos and the opera Dialogues des Carmélites, kept him busy. The opportunity presented itself in 1956, when the Elizabeth Sprague Coolidge Foundation asked him to compose a work in honour of its founder, either for two pianos or a combination of up to six instruments. In addition to being an exceptional pianist, Coolidge (1864–1953) was a hugely significant patron of the arts in America. Even so, Poulenc admitted to the flautist Jean-Pierre Rampal that the Sonata was written for him, as he did not know Mrs Coolidge. The work was completed in the winter of 1956–57 in Cannes, at the Hôtel Majestic. The two performed the work in June 1957 at the Strasbourg Music Festival as part of the agreement between the composer and the institution in exchange for the manuscript of the Sonata, which was to be kept in the archives of the Library of Congress. The American premiere took place with Rampal and pianist Robert Veyron-Lacroix in the Library’s Coolidge Hall on 14 February 1958, to great acclaim.

Francis Poulenc was one of the six French composers, known as Les Six, who wanted to liberate French classical music from foreign influence, such as the Germanophile emotionality of César Franck and his disciples, as well as the Impressionism of Debussy and Ravel, and each in their own way sought to restore the French classical principles of restraint and clarity.
The style of Poulenc’s music can perhaps best be defined in his own words: “I’m a melancholic person who loves to laugh like all melancholic persons”. Willard J. Hertz explains: “As suggested by this paradox, there are two contradictory strains in his music – one of wit, even sardonic humour and irony; the other of melancholy, even tragedy [...]. Beyond these conflicting strains, his music is marked by the use of spare harmony and dissonance, a search for new combinations of instrumental sound, a sense of elegance and a gift for melody”. In addition, his deep Catholic faith inherited from his father and his mother’s artistic influence created a duality of “sacred vs. profane” that permeated much of his work, as Amanda Cook has observed.


By the composer’s own admission, the Sonata’s dimensions follow Debussy’s example. The Sonata is imbued with bittersweet grace, irony and emotion, elements that manifest themselves differently in each of the three movements. The first movement makes the composer’s elegiac intentions clear, while the second is a sublime cantilena. The Sonata concludes with a brilliant, skittish and vivacious finale. While



each movement has its own melodic material, the composer reuses fragments from the first movement, both as fleeting memories and as an integral part of the work’s development.
Peter Mieg was a composer, painter, and critic from Lenzburg in the canton of Argovia, Switzerland. He studied Art History and Music History, as well as Archaeology and Literature. The Sonata for flute and piano was commissioned by the city of Olten. It was premiered on 22 November 1963 by Joseph Bopp and Charles Dobler.



Mieg once confessed, “If I don’t write completely subjectively and personally, it has no value at all”. Indeed, Mieg’s music is a personal form of Neoclassicism, and his musical language is heavily enriched by contemporary harmonic trends of the time, such as his use of the octatonic scale. Mieg preferred the traditional, Classical sonata form, realising that it could be used as a constructive form while remaining within the boundaries of tonality.
The flautist and musicologist, Thomas Strässle, has commented that “Mieg was not an innovator amongst composers, nor did he want to be one. His music does not stride forth ambitiously but rather dances unashamedly on the spot. Mieg’s ambition was to achieve airy, cheerful music that would at the same time be playful and singable. Formal concision, transparency of sound, rhythmic variety, and melodic elegance are its characteristics. His pieces are like watercolour paintings transposed into music, such as the watercolours he painted himself”.
The composer explains:



“I was completely free in my use of instruments and in the orchestration and treatment, but I kept to the traditional structure of the sonata, with two themes and development, especially in the first movement. Both instruments had to be used playfully and in concertante style, supporting each other but always remaining in transparent interaction. The singing-in-tone middle movement is interrupted by a whimsical intermezzo. The finale, which is fast-paced and has occasional virtuosic moments, is in 5/8 time, which is not immediately apparent to the listener, and leads to a calm farewell with an augmentation of the original theme.”
Dr. Nicolas Costantinou




Of his Sonata for flute and piano, the composer Constantinos Y. Stylianou writes:
“For several years now, I have been looking into the sonata form very closely and composing several sonatas for violin, viola, and cello. This happened parallel to an intense focus on melody as the primary force that sets in motion a piece of music. In essence, I am exploring how these two elements (the sonata form in conjunction with melody) can be relevant to my work and within current frameworks/times. This by no means diminishes the importance of harmony, rhythm, or the use of form in a more general sense. I was simply intrigued by the role of melody within this dialectic form. I felt that melody deserves to be rediscovered in a way that points the way forward. The aim is for melodies to be vehicles for varied and different emotions in a current context, not simply to allude to the past (although this can also be a part of the wider gamut).


I was drawn to the sound of the flute yet again after composing a piece for flute solo. I felt the need to explore the combination of the soundworld of the flute with that of the piano and how certain gestures can be shared. By gestures, I mean motifs that can be seen in a more organic way, rather than simply specific notes or durations. Such a gesture could be a single note that is repeated, a feature of standard flute technique that is not so easy to achieve on the piano due to its construction. Or a fast, rising scale, which creates many varied soundscapes on both instruments. Furthermore, something that might seem straightforward can in fact create different challenges for either instrument: long, slow, unfolding melodies that require extreme control of breathing for the flute and extreme control of touch for the piano. None of




these were meant as exercises or an exploration in their own right, but are simply starting points for what I hoped would be a celebration of the sound of the flute and melody in general.
First movement: The powerful opening gesture sets in motion a dialectic of maximum contrast between a rhythmically repetitive first subject (and a diametrically opposed image: an unfolding scale, either ascending or descending) and a melodic second one. All the material is thrown together to create intense peaks throughout the development section. A slower section that links development and recapitulation could also be interpreted as false recapitulation.



Second movement: a waltz-like melody that, even though elegant and light, contains elements of an insistent motif. The mood changes in the middle section, both rhythmically (3/4 becomes 5/4) and emotionally, where it gradually becomes more intensely passionate, before finally returning to the initial melody.
Third movement: a long and slow unfolding melody that tries to overcome its sadness by maintaining its dignity. This leads to the middle section, where certain polyphonic elements lend an air of nostalgia and allude to a kind of Baroque atmosphere, a period crucial to the development of flute music.
Fourth movement: playful and majestic at the same time, this rondo takes full advantage of certain characteristics of the flute to create this atmosphere. One of the contrasting sections evokes the mood of a Cypriot folk melody, whereas a further contrasting section has an air of Latin music. The energetic and glorious finale goes back full circle to the first movement and ends with the same defiant feeling.”




Constantinos Y. Stylianou



Flautist János Bálint was born in Hungary. He graduated from the Franz Liszt Academy of Music in Budapest in 1984, complementing his education with masterclasses from András Adorján. He has won numerous awards at international competitions, such as those held in Ancona and Leipzig. Between 1981 and 1991, he served as the First Flute of the Hungarian Radio Symphony Orchestra; in 1998, he was appointed Artistic Director of the Auer Summer Academy; and in 1999, he founded the Doppler Music Institute in Hungary, of which he was the President.
Since 2000, he has been the First Flautist of the Hungarian National Philharmonic Orchestra. In 1986, he became a featured soloist with the Cziffra Foundation, which helped launch his international career. Since then, he has performed at some of the most important festivals in Europe and appeared in some of the most prestigious venues in cities like London, Paris, Bratislava, Rome, Assisi, Moscow, Helsinki, Salzburg and Budapest. He has also frequently toured Israel and the United States. His partners include Ruggiero Ricci, Gervase de Peyer, Pierre Pierlot, Miklós Perényi, Alain Marion, Maxence Larrieu, Georges Cziffra, Tamás Vásáry, Zoltán Kocsis, András Adorján, Ransom Wilson and Jean-Claude Gérard, while he has collaborated with various ensembles and orchestras such as the English Chamber Orchestra, the Radio Orchestra of Bratislava, the European Soloists (Luxembourg), the Kodály and Bartók String Quartets, and the most important Hungarian symphony and chamber orchestras.

János regularly makes radio and TV recordings, including live performances. He has released 30 CD recordings with labels such as Naxos, Hungaroton and Capriccio. His recordings of transcriptions of works by Paganini and Felix Mendelssohn with the Budapest Symphony Orchestra and conductor Piergiorgio Morandi and by Franck, Schubert and Dvořák with pianist Zoltán Kocsis, both with Hungaroton, have enjoyed tremendous success.
János regularly serves as a jury member at several international flute and chamber music competitions in countries such as Hungary, Serbia, the USA, Italy, Poland, Austria, Romania and Japan. He currently teaches at the Accademia Flautistica in Imola and the Hochschule für Musik in Detmold, and gives regular masterclasses worldwide. His students have received more than 20 prizes in international competitions.

János has performed all the main literature that includes the flute as a solo instrument, which encompasses over 1,000 pieces, ranging from Baroque to contemporary, and has made several transcriptions and arrangements of works written for other instruments. Several composers have written and dedicated works to him, and his interpretations of these compositions have received numerous awards.







Steinway Artist Nicolas Costantinou is renowned for captivating audiences with his bold repertoire choices, blending both classical and contemporary works, and his collaborations with outstanding instrumentalists and ensembles. Critics have praised him as “an artist of deep emotions, capable of performing music with his whole being and soul” (Kaleva, 2003), while his interpretations have been described as “colossal” and “dramatic” (Dimitri Nicolau, 2002).
Costantinou has performed extensively across Europe, the USA and the Middle East, including recitals at prestigious venues such as London’s Wigmore Hall, the Brahms Saal at Vienna’s Musikverein, the Beethoven-Haus in Bonn, and the Grand Hall of the Franz Liszt Academy of Music in Budapest. His festival appearances include the Kuhmo Chamber Music Festival and Oulunsalo Soi Music Festival in Finland, as well as the Gödöllő Chamber Music Festival in Hungary. He has also performed concertos with renowned orchestras, including the Philharmonia Orchestra, the Russian Chamber Philharmonic of St Petersburg, the Budapest Concert Orchestra, and the Cyprus Symphony Orchestra, under the baton of maestros such as Konrad von Abel, Juri Gilbo and Esa Heikkilä, among others.


Alongside his solo career, Costantinou enjoys making music in the company of others and occasionally engages in interdisciplinary collaborations with dancers, choreographers, painters and other multimedia artists. His partners include violinists Chloë Hanslip, Simos Papanas and Vilmos Szabadi; violist Máté Szűcs; cellists Tytus Miecznikowski, Erkki Rautio, Gustav Rivinius and Péter Somodari; flautist János Bálint; clarinettist Gábor Varga; and the Meta4 string quartet. Costantinou also has a deep passion for art song and frequently collaborates with a wide range of singers. He regularly performs works by living composers, many of them world premieres.
Costantinou’s passion for music and the arts developed from a young age, growing up in a family of renowned musicians, artists, actors, dancers, choreographers and architects. He pursued his piano studies in Hungary, the USA and the UK, earning degrees from the Faculty of Music at the University of Szeged and the Franz Liszt Academy of Music in Budapest. He also holds a Master of Music in Performance from the Cleveland Institute of Music. In 2013, Nicolas was awarded a Doctor of Philosophy from the Royal College of Music in London.







Der Titel Kýma bezieht sich auf das griechische Wort für „Welle“ und verweist auf das Konzept des kontinuierlichen Flusses und der Bewegung, ähnlich wie bei den Schallwellen. Diese Idee dient als Metapher für die Übertragung musikalischer Energie, wie sie vom Flötisten und Pianisten ausgestrahlt wird und durch die Luft an den Zuhörer gelangt, so wie Meereswellen Energie durch Wasser transportieren.
Die auf dieser CD enthaltenen Werke spiegeln unterschiedliche musikalische Sprachen und Stile wider; sie sind jedoch durch ihre neoklassischen Elemente miteinander verbunden. Die CD beginnt mit der beliebten Sonate des französischen Komponisten Francis Poulenc. Typisch für sein Werk sind ein bittersüßer Charme, Witz, Ironie und Emotion; dabei zeichnet es sich durch seine moderne Ästhetik aus, die den Emotionalismus von César Franck hervorhebt und sich vom Impressionismus von Debussy und Ravel distanziert.

Darauf folgt die Sonate des Schweizer Komponisten, Kritikers und Malers Peter Mieg. Miegs Werk ist reich an Erfindungsreichtum und melodischem Material und zeugt von einer einzigartigen Kenntnis der Flöte. Es offenbart seine tiefe Affinität zu diesem Instrument und erkundet gleichzeitig neue Klangmöglichkeiten.
Im letzten Track befindet sich die Sonate von Constantinos Y. Stylianou. Sein Werk unterstreicht seine Vorliebe für die traditionelle klassische Sonatenform, die er als konstruktiven Rahmen innerhalb der Grenzen der Tonalität betrachtet. Bei Stylianous lyrischer und ideenreicher Sonate handelt es sich um eine zeitgenössische und doch in der Tradition verwurzelte Komposition.
Es ist uns eine große Freude, eine Kostprobe unserer musikalischen Zusammenarbeit mit Ihnen zu teilen, und wir hoffen, dass Sie daran genauso viel Freude haben wie wir bei der Darbietung.

Nicolas Costantinou & János Bálint







Poulenc begann 1952 über die Komposition einer Sonate für Flöte und Klavier nachzudenken, aber die Komposition anderer Werke, wie der Sonate für zwei Klaviere und der Oper Dialogues des Carmélites, beanspruchte ihn zu dieser Zeit vorrangig. Die Gelegenheit bot sich dann 1956, als die Elizabeth Sprague Coolidge Foundation ihn bat, ein Werk zu Ehren ihrer Gründerin zu komponieren, entweder für zwei Klaviere oder für eine Besetzung von bis zu sechs Instrumenten. Coolidge (1864–1953) war eine außerordentliche Pianistin und darüber hinaus eine bedeutende Förderin der Künste in Amerika. Trotzdem gab Poulenc gegenüber dem Flötisten Jean-Pierre Rampal zu, dass die Sonate für ihn geschrieben wurde, da er Mrs. Coolidge nicht kannte.
Das Werk wurde im Winter 1956–57 in Cannes im Hôtel Majestic fertiggestellt. Beide Interpreten führten das Werk Juni 1957 beim Straßburger Musikfestival auf. Dies war Teil einer Vereinbarung zwischen dem Komponisten und der Stiftung, die darin bestand, das Manuskript der Sonate, das im Archiv der Library of Congress aufbewahrt werden sollte, der Institution zu überreichen. Die amerikanische Erstaufführung fand am 14. Februar 1958 mit Rampal und dem Pianisten Robert Veyron-Lacroix in der Coolidge Hall der Bibliothek mit großem Erfolg statt.
Francis Poulenc war einer der sechs französischen Komponisten aus der Gruppe „Les Six“, die die klassische französische Musik von ausländischen Einflüssen befreien wollten, etwa von der deutschfreundlichen Einstellung von César Franck und seinen Schülern oder dem Impressionismus von Debussy und Ravel, wobei jeder von ihnen auf seine Weise versuchte, die klassischen französischen Prinzipien der Schlichtheit und Klarheit wiederherzustellen.








Der Stil von Poulencs Musik lässt sich vielleicht am besten mit seinen eigenen Worten darlegen: „Ich bin ein melancholischer Mensch, der wie alle melancholischen Menschen gerne lacht.“ Willard J. Hertz erklärt: „Wie dieses Paradoxon andeutet, zeigen sich in seiner Musik zwei widersprüchliche Tendenzen –eine von Witz, ja sogar sarkastischem Humor und Ironie; die andere von Melancholie, ja sogar Tragik [...]. Über diese widersprüchlichen Tendenzen hinaus ist seine Musik geprägt von harmonischer Sparsamkeit und der Verwendung von Dissonanzen, einer Suche nach neuen instrumentalen Kombinationen, Sinn für Eleganz und einer Begabung für Melodiebildungen.“ Zudem schufen sein vom Vater geerbter tiefer katholischer Glaube und der künstlerische Einfluss seiner Mutter eine Dualität vom Typ „heilig vs. profan“, die einen Großteil seiner Arbeit durchdrang, wie Amanda Cook beobachtet hat.
Nach eigenen Angaben des Komponisten folgen die Dimensionen der Sonate dem Beispiel Debussys. Die Sonate ist von bittersüßer Anmut, Ironie und Emotion durchdrungen, die sich in jedem der drei Sätze unterschiedlich äußern. Der erste Satz verdeutlicht die elegischen Absichten des Komponisten, während der zweite eine erhabene Kantilene darstellt. Die Sonate endet mit einem brillanten, unruhigen und lebhaften Finale. Während jeder Satz sein eigenes melodisches Material besitzt, verwendet der Komponist Fragmente aus dem ersten Satz sowohl als flüchtige Erinnerungen, als auch als integralen Bestandteil der Entwicklung des Werks.
Peter Mieg war ein Komponist, Maler und Kritiker aus Lenzburg im Schweizer Kanton Aargau. Er studierte Kunstgeschichte und Musikgeschichte sowie Archäologie und Literatur. Die Sonate für Flöte und Klavier wurde von der Stadt Olten in Auftrag gegeben und am 22. November 1963 von Joseph Bopp und Charles Dobler uraufgeführt.
Mieg gestand einmal: „Wenn ich nicht vollkommen subjektiv und persönlich schreibe, hat es überhaupt







keinen Wert.“ Tatsächlich ist Miegs Musik eine persönliche Form des Neoklassizismus, und seine musikalische Sprache ist von zeitgenössischen harmonischen Trends stark durchdrungen, wie etwa seine Verwendung der oktatonischen Tonleiter. Mieg bevorzugte die traditionelle, klassische Sonatenform, da er erkannte, dass sie als konstruktive Form verwendet werden kann, während man innerhalb der Grenzen der Tonalität bleibt.
Der Flötist und Musikwissenschaftler Thomas Strässle hat dazu bemerkt: „Mieg war kein Neuerer unter den Komponisten und wollte auch keiner sein. Seine Musik schreitet nicht ehrgeizig voran, sondern tanzt unverhohlen auf der Stelle. Miegs Ehrgeiz war es, eine luftige, heitere Musik zu schaffen, die zugleich spielerisch und singbar ist. Formale Prägnanz, Transparenz des Klangs, rhythmische Vielfalt und melodische Eleganz sind ihre Merkmale. Seine Stücke sind wie in Musik umgesetzte Aquarelle, wie die, die er selbst malte.“
Der Komponist erklärt:


„Ich war in der Instrumentierung wie auch in der Orchestrierung und Bearbeitung völlig frei, hielt mich aber insbesondere im ersten Satz an die traditionelle Struktur der Sonate mit zwei Themen, sowie an die Durchführung. Beide Instrumente mussten spielerisch und konzertant eingesetzt werden, sich gegenseitig unterstützen, aber immer in transparenter Interaktion bleiben. Der im Ton singende Mittelsatz wird durch ein skurriles Intermezzo unterbrochen. Das rasante und mit gelegentlichen virtuosen Momenten versehene Finale steht im für den Hörer nicht unmittelbar erkennbaren 5/8-Takt und mündet in einen ruhigen Abschied mit einer Augmentation des ursprünglichen Themas.“
Nicolas Costantinou


Autor des Textes Dr Nicolas Costantinou (Übers. Antonio Gómez Schneekloth) / Odradek Records, LLC ist im Besitz einer Creative Commons-Namensnennung-Keine Bearbeitungen-4.0 Internationalen Lizenz. Genehmigungen, die über den Geltungsrahmen dieser Lizenz hinausgehen, kann man bei www.odradek-records.com erhalten.

Dr



Über seine Sonate für Flöte und Klavier schreibt der Komponist Constantinos Y. Stylianou:
„Seit einigen Jahren befasse ich mich eingehend mit der Sonatenform und habe mehrere Sonaten für Violine, Viola und Cello komponiert. Dies geschieht parallel zu einer intensiven Konzentration auf die Melodie als primäre Kraft, die ein Musikstück in Bewegung setzt. Im Wesentlichen erforsche ich, wie diese beiden Elemente (die Sonatenform und die damit in Verbindung gesetzte Melodie) für meine Arbeit und innerhalb der derzeitigen Rahmenbedingungen relevant sein können. Dies reduziert keineswegs die Bedeutung von Harmonie, Rhythmus oder der Verwendung von Form im allgemeineren Sinne. Ich war einfach fasziniert von der Rolle der Melodie innerhalb dieser dialektischen Form. Ich hatte das Gefühl, dass die Melodie es verdient, auf eine Weise wiederentdeckt zu werden, die den Weg nach vorn weist. Das Ziel ist, dass Melodien vielfältige und unterschiedliche Emotionen im aktuellen Kontext auslösen und nicht nur auf die Vergangenheit anspielen (obwohl dies auch Bestandteil einer größeren Bandbreite sein kann).




Nachdem ich ein Werk für Soloflöte komponiert hatte, fühlte ich mich erneut von ihrem ??? angezogen. Ich verspürte das Bedürfnis, die Kombination der Klangwelt der Flöte mit der des Klaviers sowie die Art und Weise zu erforschen, wie bestimmte Gesten gemeinsam getragen werden können. Unter Gesten verstehe ich Motive, die auf eine organische Weise wahrgenommen werden, und nicht nur bestimmte Tonhöhen oder Dauern. Eine solche Geste könnte eine einzelne, sich wiederholende Note sein, ein Merkmal der Standardflötentechnik, das auf dem Klavier aufgrund seiner Konstruktion nicht so leicht zu realisieren ist. Oder eine schnelle, ansteigende Tonleiter, die auf beiden Instrumenten viele verschiedene Klanglandschaften erzeugt. Darüber hinaus kann etwas, das unkompliziert erscheinen mag, für beide Instrumente tatsächlich unterschiedliche Herausforderungen hervorrufen: lange, langsame, sich entfaltende Melodien, die bei der Flöte eine höchste Kontrolle der Atmung und beim Klavier eine ausgesprochene Kontrolle des Anschlags voraussetzen. Keines davon war als Übung oder Experiment an sich gedacht, sondern es sind lediglich Ausgangspunkte für das, was ich mir unter einer Feier des Flötenklangs und der Melodie im Allgemeinen vorgestellt habe.




Erster Satz: Die kraftvolle Eröffnungsgeste setzt eine Dialektik des maximalen Kontrasts zwischen einem rhythmisch repetitiven ersten Thema (und einem diametral entgegengesetzten Bild: einer sich entfaltenden Tonleiter, entweder aufsteigend oder absteigend) und einem melodischen zweiten Thema in Gang. Das ganze Material wird zusammengeworfen, um intensive Höhepunkte im gesamten Durchführungsabschnitt zu erzeugen. Ein langsamerer Abschnitt, der Durchführung und Reprise verbindet, könnte auch als falsche Reprise interpretiert werden.
Zweiter Satz: Eine walzerartige Melodie, die zwar elegant und leicht ist, aber Elemente eines eindringlichen Motivs enthält. Die Stimmung ändert sich im mittleren Abschnitt sowohl rhythmisch (3/4 wird zu 5/4) als auch emotional, wobei sie allmählich intensiver, leidenschaftlicher wird, bevor sie schließlich zur ursprünglichen Melodie zurückkehrt.

Dritter Satz: eine lange und sich langsam entfaltende Melodie, die dabei ist, ihre Traurigkeit zu überwinden, indem sie ihre Würde bewahrt. Dies führt zum mittleren Abschnitt, in dem ihr bestimmte polyphone Elemente einen Anflug von Nostalgie verleihen und auf eine Art Barockatmosphäre anspielen, eine Epoche, die für die Entwicklung der Flötenmusik ausschlaggebend war.
Vierter Satz: Spielerisch und majestätisch zugleich, bedient sich dieses Rondo bestimmter Eigenschaften der Flöte, um diese Atmosphäre zu schaffen. Einer der kontrastierenden Abschnitte evoziert die Stimmung einer zypriotischen Volksmelodie, während ein weiterer kontrastierender Abschnitt einen Hauch lateinamerikanischer Musik verströmt. Das energiegeladene und glorreiche Finale beschließt den Kreis zum ersten Satz und endet mit demselben widersprüchlichen Gefühl.“



Autor des Textes Constantinos Y. Stylianou (Übers. Antonio Gómez Schneekloth) / Odradek Records, LLC ist im Besitz einer Creative Commons-Namensnennung-Keine Bearbeitungen-4.0 Internationalen Lizenz. Genehmigungen, die über den Geltungsrahmen dieser Lizenz hinausgehen, kann man bei www.odradek-records.com erhalten.

Constantinos Y. Stylianou



Der Flötist János Bálint wurde in Ungarn geboren. Er schloss 1984 sein Studium an der Franz-LisztMusikakademie in Budapest ab und ergänzte seine Ausbildung mit Meisterkursen bei András Adorján. Herr Bálint hat in dieser Zeit zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben gewonnen, u. a. in Ancona und Leipzig. Zwischen 1981 und 1991 war er Soloflötist des Ungarischen Rundfunk-Sinfonieorchesters; 1998 wurde er zum künstlerischen Leiter der Auer-Sommerakademie ernannt; 1999 gründete er das Doppler-Musikinstitut in Ungarn und übernahm seinen Vorsitz.
Seit 2000 ist er Soloflötist der Ungarischen Nationalphilharmonie. 1986 wurde er Solist der Cziffra-Stiftung, was ihm den Start seiner internationalen Karriere ermöglichte. Seitdem ist János Bálint bei einigen der wichtigsten europäischen Musikfestivals aufgetreten und hat an einigen der renommiertesten Konzertsäle in London, Paris, Bratislava, Rom, Assisi, Moskau, Helsinki, Salzburg und Budapest gespielt. Darüber hinaus hat er häufig Tourneen durch Israel und die Vereinigten Staaten unternommen. Zu seinen Partnern zählen Ruggiero Ricci, Gervase de Peyer, Pierre Pierlot, Miklós Perényi, Alain Marion, Maxence Larrieu, Georges Cziffra, Tamás Vásáry, Zoltán Kocsis, András Adorján, Ransom Wilson und Jean-Claude Gérard, während er mit verschiedenen Ensembles und Orchestern zusammengearbeitet hat wie dem English Chamber Orchestra, dem Radio Orchestra of Bratislava, den European Soloists (Luxemburg) Kodály- und Bartók-Streichquartette sowie den wichtigsten ungarischen Symphonie- und Kammerorchestern.

Herr Bálint nimmt regelmäßig an Radio- und Fernsehsendungen teil, darunter auch in Live-Auftritten. Er hat dreißig CDs mit den Labels Naxos, Hungaroton und Capriccio veröffentlicht. Seine Aufnahmen mit Bearbeitungen von Werken von Paganini und Mendelssohn mit dem Budapester Symphonieorchester und dem Dirigenten Piergiorgio Morandi sowie von C. Franck, Fr. Schubert und A. Dvořák mit dem Pianisten Zoltán Kocsis, beide bei Hungaroton, hatten großen Erfolg.
Herr Bálint ist regelmäßig ein Jurymitglied bei mehreren internationalen Flöten- und Kammermusikwettbewerben in Ländern wie Ungarn, Serbien, den USA, Italien, Polen, Österreich, Rumänien und Japan.
Herr Bálint unterrichtet zurzeit an der Accademia Flautistica in Imola und an der Hochschule für Musik in Detmold und erteilt weltweit regelmäßig Meisterkurse. Seine Schüler erhielten insgesamt mehr als zwanzig Preise bei internationalen Wettbewerben.

Er hat das gesamte kammermusikalische und solistische Flötenrepertoire gespielt, das über tausend Stücke vom Barock bis zur Gegenwart umfasst, sowie mehrere Transkriptionen und Bearbeitungen von Werken angefertigt, die ursprünglich für andere Instrumente bestimmt waren. Verschiedene Komponisten haben ihm ein Werk gewidmet, und die Aufführungen dieser Kompositionen wurden mehrfach ausgezeichnet.






Der Steinway-Künstler Nicolas Costantinou hat sich einen Namen mit seiner gewagten, das Publikum beeindruckenden Auswahl an altem und neuem Repertoire, sowie seiner Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Instrumentalensembles gemacht. Kritiker priesen ihn als „… einen Künstler mit tiefen Gefühlen, dem es gelingt, Musik mit seinem ganzen Wesen und seiner ganzen Seele zu spielen…“ (Kaleva, 2003), während seine Interpretationen als „kolossal“ und „dramatisch“ beschrieben wurden (Dimitri Nicolau, 2002).
Nicolas hat zahlreiche Konzerte in Europa, den USA und im Nahen Osten gegeben, sowie Liederabende in der Londoner Wigmore Hall, im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins, im Beethoven-Haus in Bonn und im Großen Saal der Franz-Liszt-Musikakademie in Wien. Außerdem trat er auf internationalen Festivals wie dem Kuhmo Chamber Music Festival, dem Oulunsalo Soi Music Festival (Finnland) und dem Gödöllő-Kammermusik-Festival (Ungarn) auf. Auch mit dem Philharmonia Orchestra, der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg, dem Budapest Concert Orchestra und dem Zyprischen Symphonieorchester und mit Maestros wie Konrad von Abel, Juri Gilbo, Esa Heikkilä und anderen ist er aufgetreten.


Neben seiner Solokarriere musiziert Nicolas gerne in Gesellschaft Anderer und pflegt hin und wieder interdisziplinäre Kooperationen mit Tänzern, Choreografen, Malern und Multimedia-Künstlern. Zu seinen Partnern zählen die Geiger Chloë Hanslip, Simos Papanas und Vilmos Szabadi, der Bratscher Máté Szűcs, die Cellisten Tytus Miecznikowski, Erkki Rautio, Gustav Rivinius und Péter Somodari, der Flötist János Bálint, der Klarinettist Gábor Varga und das Meta4-Streichquartett. Nicolas hat eine besondere Vorliebe für das Kunstlied und arbeitet gerne mit einer Vielzahl von Sängern zusammen. Er führt regelmäßig Werke lebender Komponisten auf; viele davon sind Uraufführungen.
Nicolas’ Interesse an Musik und den Künsten im Allgemeinen entwickelte sich schon in früher Kindheit; er stammt aus einer Familie angesehener Musiker, Künstler, Schauspieler, Tänzer, Choreografen und Architekten. Er hat Klavier in Ungarn, den USA und Großbritannien studiert und erhielt Abschlüsse der Musikfakultät der Universität Szeged sowie der Franz-Liszt-Musikakademie in Budapest. Er besitzt auch einen Master of Music in Performance vom Cleveland Institute of Music. Im Jahr 2013 wurde ihm der Doktortitel der Philosophie vom Royal College of Music in London verliehen.
























(Dialogues des Carmélites
































Ruggiero Ricci, ο Gervase de Peyer, ο Pierre Pierlot, ο Miklós
Perényi, ο Alain Marion, ο Maxence Larrieu, ο Georges Cziffra, ο Tamás Vásáry, ο Zoltán Kocsis, ο András
Adorján, ο Ransom Wilson
Jean-Claude Gérard.
Kodály,






für Musik,

Zoltán Kocsis,








Philharmonia,


Konrad von Abel, Juri Gilbo, Esa Heikkilä



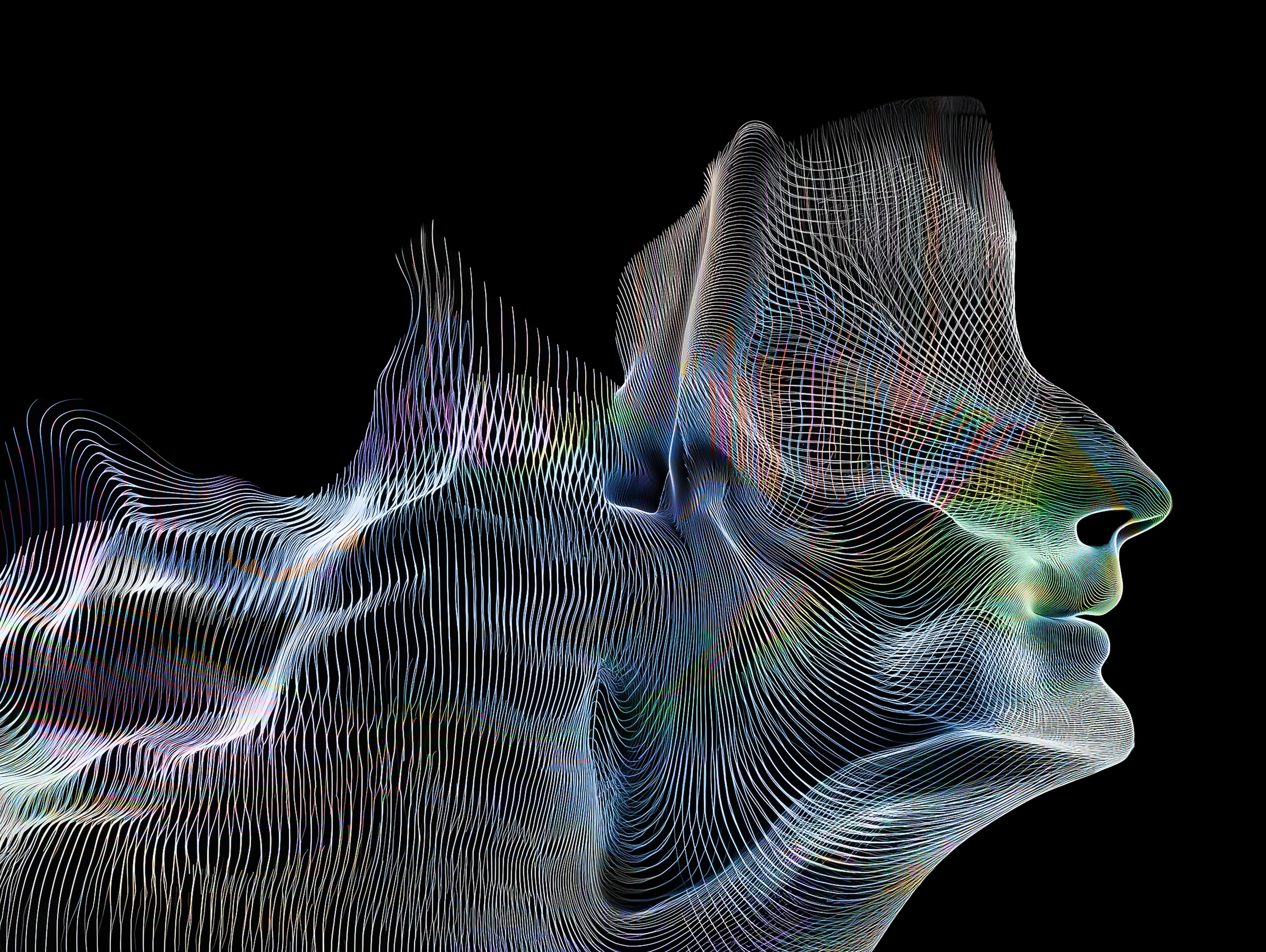
This album was made possible through the generous sponsorship of the Peter Mieg Foundation in Switzerland. Dieses Album wurde durch die großzügige Unterstützung der Peter Mieg Stiftung in der Schweiz ermöglicht.

3-5 October 2023
Piano: Steinway D 573751
Piano Technician: Constantinos Loizou
Photography and Artwork: Elena Paraskeva Translations: Christakis Poumbouris (German)
Graphics: marcoantonetti.com
www.costantinou.com
www.janosbalint.com
www.odradek-records.com