COMPLETE SYMPHONIES




ANDREA LORENZO SCARTAZZINI (1971)
1. Torso, for Orchestra (2018) 05'47 GUSTAV MAHLER (1860-1911) Symphony No. 1 in D major (1884-88)
2. I. Langsam. Schleppend 15'58
3. II. Kräftig, bewegt, doch nicht zu schnell 07'45
4. III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 09'49
5. IV. Stürmisch bewegt 19'40 Total Play Time: 59'03
JENAER PHILHARMONIE
SIMON GAUDENZ conductor
JENAER MADRIGALKREIS · BERIT WALTHER CHORUS MASTER *
NINA KOUFOCHRISTOU SOPRANO ** EVELYN KRAHE CONTRALTO +
GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Symphony No. 10 in F-sharp minor (1910)
1. I. Adagio 23'11 ANDREA LORENZO SCARTAZZINI (1971)
2. Torso, for Orchestra (2018) 05'14
3. Epitaph, for Choir ad lib. and Orchestra * (2019) 07'35
4. Spiriti, for Orchestra (2019) 05'22
5. Incantesimo, for Soprano and Orchestra ** (2020) 05'17
6. Einklang, for Orchestra (2021) 05'11
7. Omen, for Orchestra (2023) 04'56
8. Orkus, for Orchestra (2023) 05'06
9. Anima, for Contralto, Choir (ad lib.) and Orchestra *+ (2024) 06'15
10. Enigma, for Choir (ad lib.) and Orchestra * (2024) 05'31
11. Einkehr, for Soprano, Contralto, Choir and Orchestra *+** (2024) 04'56

Total Play Time: 78'41
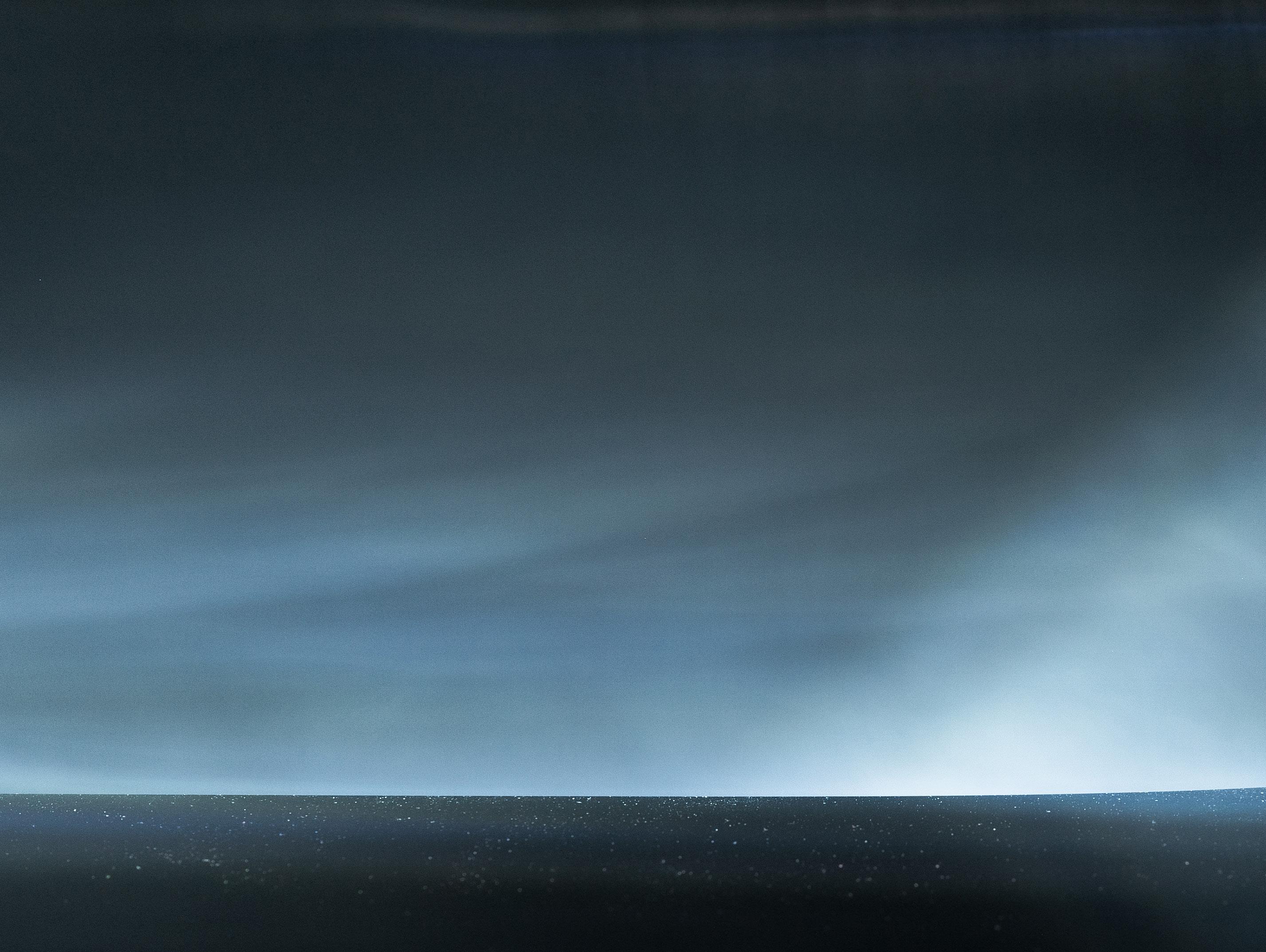
SIMON GAUDENZ conductor
JENAER MADRIGALKREIS · BERIT WALTHER CHORUS MASTER *
NINA KOUFOCHRISTOU SOPRANO ** EVELYN KRAHE CONTRALTO +



As conductor, composer and orchestra, we are passionate about the music of Gustav Mahler. In this complete recording, we play and mirror his 10 symphonies with 10 short contemporary works written especially for this cycle – a homage to Mahler’s sound cosmos; a personal view from the present upon his rich musical heritage.








Since 2018, Andrea Lorenzo Scartazzini has been Composer-in-Residence with the Jena Philharmonic. Scartazzini has been writing a new companion piece to each of Gustav Mahler’s symphonies, which are being performed in Jena as a cycle in chronological order. This collaboration over a period of seven years is remarkable in many respects. At the end of the cycle there will be 10 new works, each of which can be performed individually or in groups before the Mahler symphonies, but also as full-length concert works. Andrea Scartazzini has been passionately committed to the task from the beginning, especially as Mahler’s music is particularly close to his heart: “I have a deep love for the work of Gustav Mahler; his symphonies have been my musical companions for many years, and every time I hear them again I am moved by the sheer abundance of inspiration and emotionality,” he wrote at the start of the cycle. “I will react with pleasure to this illustrious proximity, distancing myself or coming closer to create an overriding dramaturgy. In this way, both approaches should succeed: creating one’s own work and building bridges.” Now, halfway through the premieres, he speaks of how the renewed engagement with Mahler’s work has influenced his own language and compositional style, for never before, he says, has he composed so close to tonality.



“The constant preoccupation with Mahler’s symphonies must lead me down different paths, because there is always so much to discover in this cosmos,” as he had suspected from the beginning. Scartazzini talks about how he relates a new work to the respective symphony by Mahler. It is the dialectic of distance and proximity. He looks at the Mahler symphony in a similar way to a viewer approaching an object in a museum, who can walk around the work in space and move away from it again. However, Scartazzini does not establish a distanced relationship with the piece, but rather traces how his new work can enter into a symbiotic relationship with the respective Mahler symphony. He avoids quotations, as these would merely restrict his own space. Instead, he seeks an intellectual connection to the symphony he is currently working on, a “niche”, so that his work corresponds with Mahler and does not compete with it. Scartazzini’s compositions lead to the first movement of Mahler’s symphony – without the usual applause. Sometimes the two pieces are only separated by a brief pause, sometimes his music leads directly into Mahler’s flow of sound.





When the Jena Philharmonic Orchestra and its General Music Director Simon Gaudenz decided in 2018 to perform all ten of Gustav Mahler’s symphonies in a cycle, something unique was created at the same time: Swiss composer Andrea Lorenzo Scartazzini was commissioned to write a short work of his own for each symphony. Over a period of seven years, parallel to Mahler’s symphonic cosmos, a contemporary cycle of ten pieces was created, each of which stands alone yet together form a large-scale work in their own right. ‘I didn’t plan an hour of music on the drawing board, but each time sought a new mental bridge to the respective symphony,’ says Scartazzini, describing his process.


The basic idea was not to compete with Mahler, but to engage in dialogue. “I was looking for a niche, a conceptual connection and sometimes a contrast. I refrained from using quotations, because they restrict your own space”, explains Scartazzini. His pieces lead directly into the flow of sound of Mahler’s symphony, without applause. Sometimes the two are separated only by a short pause; sometimes the music intertwines to form a single arc.

This dramaturgy gave rise to something that goes far beyond individual premieres. “My idea from the outset was to engage the audience by playing the pieces over and over again. Repeated listening makes the music familiar and strengthens the connection to contemporary music”, says Gaudenz. Jena offered this rare opportunity: listeners experienced Scartazzini’s works several times and were thus able to develop a relationship with them that is otherwise almost only possible with classics.
His preoccupation with Mahler and the years-long duration of the project have had a noticeable influence on Scartazzini’s musical language, and he has increasingly integrated tonal elements. His response to Mahler’s Fourth, for example, was a simple orchestral song that takes up a highly romantic, seemingly naïve tone. Alongside this are complex pieces such as Omen and Orkus, nocturnes full of menace and profundity, or Enigma, which is reminiscent of late Mahler and fades into silence with ethereal sounds.


Despite these differences, the cycle is permeated by internal references. Motifs, sounds and structures reappear, referring back and forward, creating cohesion. “I had to condense my ideas in such a way that, despite the brevity of the individual compositions, the impression of unity is created”, says Scartazzini. Performed together, the ten works form a symphonic whole lasting just under sixty minutes.



This long-term project also offered new experiences for the musicians. “It suited us to work on these smaller sections again and again. Gradually, a larger picture emerged, and we also developed a new visual and emotional relationship with Mahler”, recalls Gaudenz. And Scartazzini sums it up: “It’s a unique opportunity to develop something together with an orchestra over many years as Composer-in-Residence. The rehearsals and numerous concert experiences have had a positive influence on the creative process.”
The Mahler cycle in Jena thus became much more than a series of concerts. It became an artistic experiment of rare consistency which, through the interplay of revisiting and rediscovering, created a work that is unprecedented in music history – a symphonic counterpart of our time to Gustav Mahler.
Mahler: Symphonies Nos. 1 and 10


This album encompasses both the beginning and the end of Gustav Mahler’s symphonic cosmos: the First Symphony in D major, with which the composer found his unmistakable tone in 1889, and the Tenth in F-sharp major, which remained unfinished in 1910 and thus forms his legacy. Together, they span a wide arc – from the dawn of a new world of sound to the shattering final notes that break off into fragments.
Fahrende Gesellen: a Wayfarer

“I devour more and more books! They are, after all, the only friends I have with me!” wrote Mahler at the turn of the year 1894/95. His insatiable appetite for reading was unusual for a composer of his time (Malte Fischer). But while many of his colleagues commented on their works, Mahler remained largely silent –with one important exception: the Songs of a Wayfarer (1883–85), for which he wrote the lyrics himself.
“The songs are conceived as if a wandering journeyman who has had a fate is now setting out into the world and wandering along,” he noted. These songs not only characterise his songwriting, but also his first four symphonies.


Mahler opens the first movement “like a sound of nature”: a floating tapestry of flageolets, cuckoo calls, fourths and fifths – as if he wanted to showcase the elements of music itself. He strings together fragments of sound until a quotation from the Gesellen-Lieder crystallises: “Ging heut’ morgen übers Feld” (Went across the field this morning). Wandering rhythms, idyllic village music, distant horn signals and unbroken ‘Dionysian jubilation’ combine to form a mosaic of song, nature and symphony.



The following movements also refer to this world: the Ländler in the second movement continues Schubert and Bruckner’s dance tradition, but Mahler’s reworking gives it its own distinctive character. In the third movement, ‘Brother Jacob’ in minor becomes a funeral march, interrupted by the consolation of the Wayfarer’s song “Die zwei blauen Augen” (The Two Blue Eyes). The final movement begins with a “terrible cry” (Mahler) and unfolds in a dramatic crescendo, whose lyrical middle section already points to later adagios. A horn call even announces the theme “I will die in order to live” from the Second Symphony. At the end, the natural sound from the beginning returns – as if music and life were coming full circle.
From the outset, the work oscillated between different titles: premiered in 1889 as a “symphonic poem”, then a “tone poem in symphonic form” (Titan), it was not until 1896 that it was finally given the simple title “Symphony”. But the characteristics of Mahler’s symphonic world are already there: the fusion of song and symphony, the narrative form, the inclusion of the everyday in the big picture.


In the context of the Jena cycle, the beginning of this symphony takes on a new dimension: it follows Scartazzini’s Torso, a deliberately fragmentary, open piece. When heard on its own, it remains a torso –but in concert, the unfinished work leads directly into Mahler’s symphony. Suddenly, its opening seems like a response, a completion that encompasses the fragment. Here, rupture and wholeness appear as interrelated opposites that only unfold their full effect when combined.


When Gustav Mahler died on 18 May 1911, he left behind two completed works that he himself was unable to perform: Das Lied von der Erde (The Song of the Earth) and the Ninth Symphony. In addition, there were sketches for a Tenth – a work that remained a fragment. It was no coincidence that Andrea Scartazzini chose the title Torso for the start of his Mahler cycle: an unfinished body, but essentially recognisable.
Mahler’s sketches for the Tenth are marked by a premonition of death and personal crisis: “Only you know what it means. Oh! Oh! Oh! Farewell, my string music!” or “Live for you! Die for you! Almschi (his pet name for Alma)”, he noted in the score. Alma Mahler initially tried to hide these traces before allowing friends to see them and publishing facsimiles in 1924. Parts of the Tenth were then performed in Vienna, supplemented by Franz Schalk and Ernst Krenek. However, many great composers – Berg, Schoenberg, Shostakovich – refused to complete it.





It was not until Erwin Ratz’s first edition in 1964 that the sources became widely available. Only the first movement, the Adagio, was included in the critical edition and is now an integral part of the repertoire. It shows Mahler in a new, radically concentrated musical language: restrained, transparently orchestrated, with a polyphonic texture of strings, carried by a melancholic viola phrase that recurs repeatedly. At the end, a shattering nine-note chord piles up before the music disintegrates into individual fragments and falls silent.
The plan was to compose a five-movement work with Purgatorio at its centre. But Mahler never stopped viewing his symphonies as works in progress – always open, always changeable. Even the Ninth and Das Lied von der Erde had been perceived as “composed farewells”. The Tenth follows on from this, but remains a fragment.


Arnold Schoenberg summed this up in his speech commemorating Mahler in 1912: “It seems that the Ninth is a boundary. Anyone who wants to go beyond it must leave.”

For Scartazzini’s cycle, the open, unfinished nature of the adagio from Mahler’s Tenth had a special significance: he deliberately designed his last work, Einkehr, as the actual ‘conclusion’ – with soloists, choir and orchestra – thus setting a counterpoint to Mahler’s unfinished Tenth, which remained incomplete due to his early death. Thus, this album spans an arc from beginning to end – from Mahler’s first symphonic departure to his last, fragmentary soundscape, from Scartazzini’s fragmentary Torso to the peaceful ending of Einkehr.
Scartazzini’s cycle: The individual works
I. Torso


Scartazzini’s cycle also begins with distant instruments, which play such an important role in Mahler’s work. In Torso, there are two trumpets positioned on the balcony at the back of the hall. “Their music jumps like a spark and makes the orchestra sing”, says the composer. The title alludes to a magical process of awakening, which is the subject of Rainer Maria Rilke’s sonnet Archaic Torso of Apollo. In it, the poet describes a glow, a mysterious life inherent in the sculpture of the god: “In the text, Rilke reverses the normal situation of observation. For this youthful torso leads a life of its own, it glows and shimmers. When you




look at it, it looks back at you. There is an analogous interaction between the ‘pair of eyes’ of the two distant trumpets and the gradually enlivening sound ‘body’ of the orchestra. At first, only the high and low edges sound, then a broad string sound develops, a slowly breathing and pulsating centre into which woodwind lines are drawn like blood vessels. After a crescendo, the piece finally culminates in a spacious octave sound, a kind of dominant to the beginning of Mahler’s Symphony No. 1”. If Torso is followed instead by Scartazzini’s second composition, Epitaph, the two pieces merge seamlessly.


Mahler, who later rejected programme notes for his works, once mentioned that the hero of the First Symphony would be carried to his grave in the Second. His Second was nicknamed ‘Resurrection’, and even though this was not Mahler’s own title, the work is underpinned by themes of death and eternal life. Scartazzini’s Epitaph from 2018/19 also revolves around these themes, but in a quieter way that emphasises doubt and uncertainty. It is a tomb inscription made of sound. After a wild percussive beginning, the music calms down, a long solo cello cadenza emerges, first rebellious, then increasingly resigned. And once again, it is lines by Rainer Maria Rilke that Scartazzini contemplates and puts into the mouths of the choir: haltingly, syllable by syllable, as if the weathered letters on a gravestone were difficult to decipher: “For we are only the shell and the leaf. The great death that everyone has within them is the fruit around which everything revolves.” (Rainer Maria Rilke, from The Book of Poverty and Death)



Behind Scartazzini’s Spiriti lies the ‘programme’ of Mahler’s Third, which he mentioned to friends but never published, certainly not in the sheet music. ‘Pan awakens’, ‘the animals in the forest tell their tales’ and the ‘flowers in the meadow’, the angels and love. With Spiriti, Scartazzini tongue-in-cheek adds the spirits of nature to this round dance. These are ethereal sounds, often bustling and shadowy. The woodwinds create the breath of the spirits with their key noises and flutes with gentle whistles. Above all, the percussionists complement the palette with airy and fast-paced sounds with marimba and vibraphone parts. Indefinable and mysterious colours come from the chimes (wind chimes) and the ‘Nicophone’, a new metal instrument whose immense colour spectrum ranges from long-reverberating metallic tones to sounds reminiscent of those from early electronic studios. The delicate, fragile sounds form a deliberate contrast to the powerful first movement of Mahler’s Third.




The soprano song that ends Mahler’s Fourth is Scartazzini’s starting point for his fourth piece. With an orchestral song based on a poem by Joseph von Eichendorff, he frames Mahler’s work, and the high soprano voice of ‘heavenly life’ can now also be heard before the symphony. Scartazzini calls his piece Incantesimo, meaning ‘spell’. Incantesimo contains the syllable ‘cant’ (from ‘cantare’ – to sing). Scartazzini explains: “The title of the piece refers on the one hand to the soprano’s singing and on the other to the theme of the poem itself: in the silence of the falling night, a lonely sailor sings a song to his beloved. It is a highly romantic, dreamlike, transfigured evening atmosphere that the poet conjures up. The ambiguity of the supposedly naive, with echoes of children’s songs, the sound of fiddles and the image of a land of milk and honey as an otherworldly utopia, is the defining feature of Mahler’s Fourth. Incantesimo also embraces this ‘as if’ and, with its simple strophic evening serenade, immerses itself in a distant world of longing.”
V. Einklang


Einklang (unison) is intended to form the antithesis to Mahler’s wild drama, a moment of inner reflection before the storm breaks. In Scartazzini’s cycle of ten pieces, it represents the calm centre. The title refers to two aspects: it is essentially a sound on which the piece is based, a C major chord that fans out to the 15th overtone and is mirrored downwards in a kind of undertone series. This huge soundscape in the strings is presented several times in different ways; sometimes the closely spaced overtones can be heard very clearly, sounding like a bright glare or radiance. Sometimes the calm basses stand out as the foundation. And twice the basic chord is rearranged so that the close overtones lie in the middle and the chord expands downwards and upwards. This chord is a kind of “natural sound”, to use Mahler’s words; it symbolises the vastness and tranquillity that one finds in nature or even within oneself when one is completely ‘in harmony’ with oneself. Out of this atmospheric sound of tranquillity, short, sublime brass motifs and a longer cantilena sound several times.



According to Greek and Roman beliefs, an omen was a phenomenon or event that promised good or bad luck in the future or signalled a message from the gods. Almost anything could be a sign: dreams, celestial phenomena, lightning, comets, eclipses and even raindrops. In Scartazzini’s Omen, there are musical omens that hint at impending doom. In the fourth movement of his Sixth Symphony, Mahler has a large hammer strike twice, a final gesture that can take the breath away from the music. Was it superstition




that Mahler removed a third strike after rehearsals? “With internalised string solos, softly shimmering vibraphone sounds and delicate string tones, the music initially remains in a state of almost timeless intimacy”, says Scartazzini. It is based on an echo of the great C major chord from Einklang, which fades and spreads in all directions and gradually rises as a seven-time varied passage of thirteen (!) chords. A tam-tam beat abruptly interrupts the musical flow. Like a sign of fate, a murmuring sound appears and sets in motion a dramatic event that culminates in an orchestral cry into the vortex of Orcus.


In Roman mythology, orcus was both a place and a person, ruler of the underworld and the underworld itself. Even today, orcus is known as an abyss or as an idiom (in German “to send to Orcus”). Scartazzini’s Orcus is, like the middle movements of Mahler’s Seventh, a nocturne. After downward swirls and dull percussive passages, the murmuring chord from Omen manifests itself once again: the sound effect –all the strings humming to their softly tremoloing tones – is reminiscent of the voices of departed souls. Afterwards, the scene calms down: “In an increasingly faltering flow, the music explores the ambivalence of the night – fears and dreamlike confusion, but also peace and tranquillity when gazing at the starry sky. Finally, the lonely trace of a bass clarinet is lost in the darkness”, is how the composer describes the atmosphere.



Anima was composed by Scartazzini to correspond with Mahler’s Eighth Symphony as a setting of Goethe’s Song of the Spirits over the Waters, which has been set to music several times and is well known from Schubert’s composition for male choir. Inspired by the natural spectacle of the waterfall in the Swiss Lauterbrunnen Valley, Goethe compares the human soul to the cycle of water, which comes from the sky and rises to the sky in eternal change. The metaphorical image of a cycle of the soul in the Song of the Spirits is concretely illustrated in the purification of Faust’s soul (set to music by Mahler in the second movement of his Eighth Symphony). The music of Anima follows the path of water, from gentle murmuring to wild foaming to the calm lake. One always hears a ghostly undertone in the music, from which the song rises.






According to Scartazzini, Enigma “draws on Mahler’s language more strongly than any other piece in this cycle. The harmony and slow tempo create a connection to the fourth movement of his Ninth Symphony, especially the final adagissimo bars. In Enigma, the music rises higher and higher until it finally disappears completely. What remains is a rustling and airy sound that traces a melodic movement from which all colour has escaped. The vessel is still there, but the contents have evaporated; the 19th century is over, and so is Mahler’s life. Like a riddle, after a long pause, the choral song from Epitaph sounds a second time: For we are but the shell and the leaf. / The great death that everyone has within them / is the fruit around which everything revolves.”


Einkehr for soprano, alto, choir and orchestra is a setting of the first stanza of Hölderlin’s elegy Brot und Wein (Bread and Wine). The poem evokes touching images of a city coming to rest, of the day drawing to a close, of silence and contemplation. Scartazzini thus “accompanies the fragmentary nature of Mahler’s Tenth with music of peace and completion. The piece begins onomatopoeically: the wind carries delicate sounds, a hint of bells ringing, the distant clatter of horses’ hooves, the murmur of fountains, a soft harp melody. And then the calm singing of the choir begins, at first evenly, later branching out polyphonically, but always carried by the warm sound of the strings and brass. In the last third, the soprano and alto solos join in, their singing accompanied by the melody of the two solo trumpets from Torso, the first of the ten pieces. Further motifs are recalled and, after a crescendo, lead back to the beginning, to the C-sharp of the trumpet with which the cycle began.”
Gernot Wojnarowicz







Distinguished, lively, versatile – three characteristics that describe Simon Gaudenz’s musical interpretations. Since 2018, he has been General Music Director of the Jenaer Philharmonie, where he also inspires audiences with high-energy concerts, innovative ideas and unusual programme concepts.
As an internationally sought-after conductor, Simon Gaudenz is a guest on the podium of numerous important orchestras in Germany, Scandinavia, France and Switzerland. He is a welcome guest at festivals such as the Schleswig-Holstein Musik Festival, the Berliner Festwochen and the Schwetzinger Festspiele. He works closely and intensively with outstanding interpreters such as Anne-Sofie von Otter, Veronika Eberle, Renaud Capuçon, Arabella Steinbacher, Michael Barenboim, Benjamin Appl, Lilya Zilberstein, Lise de la Salle, Julian Steckel and Maximilian Hornung.

After his first position as Principal Conductor of the Collegium Musicum Basel, he was appointed Principal Guest Conductor of the Odense Symphony Orchestra in 2010. In 2012 he was appointed Principal Conductor of the Hamburger Camerata, with whom he regularly performs at the Elbphilharmonie Hamburg and continues to be associated as a guest conductor.
From his discography, the complete recording of Robert Schumann’s symphonies with the Odense Symphony Orchestra stands out, as does the Opus Klassik 2020 award-winning recording of symphonies by Haydn contemporary François-Joseph Gossec with the Deutsche Kammerakademie Neuss. Simon Gaudenz recorded Louis Spohr’s complete works for clarinet and orchestra with clarinettist Christoffer Sundqvist and the NDR Radiophilharmonie. He also makes regular recordings with the Jenaer Philharmonie, championing rarely performed repertoire – including works by Hugo Wolf, Carl Loewe and Karl Weigl.








Andrea Lorenzo Scartazzini (*1971 in Basel) writes music of high expressivity, harmonic richness and formal clarity. While studying literature at the Universität Basel, he began studying composition at the Musikakademie Basel with Rudolf Kelterborn. He later continued his training in London and with Wolfgang Rihm in Karlsruhe. This was followed by periods as a lecturer and Composer-in-Residence in Witten/ Herdecke, Shanghai and Bamberg. Scartazzini has received several prizes for his work, including the Ernst von Siemens Foundation Study Prize in Munich and the Jakob Burckhardt Award from the Goethe Foundation in Basel. His compositions are performed at numerous festivals (including Osterfestspiele Salzburger, Lucerne Festival, Mahler Musikwochen Toblach, Internationale Ferienkurse Darmstadt, Lied Basel), in renowned concert halls (Elbphilharmonie Hamburg, KKL Lucerne) and by numerous worldrenowned ensembles and orchestras. The operas Edward II (Deutsche Oper Berlin), Der Sandmann (Oper Basel, Oper Frankfurt) and Wut (Theater Erfurt, Theater Bern) are another central component of his oeuvre. From 2018 to 2025, Scartazzini was Composer-in-Residence at the Jenaer Philharmonie.









The Jena Madrigalkreis (Madrigal Circle) is the most ambitious vocal ensemble of the three choirs under the umbrella of the Jena Philharmonic Orchestra. Under the direction of choir director Berit Walther, it sings a demanding, stylistically diverse repertoire in programmes with the Jena Philharmonic Orchestra, but also performs in numerous concerts of its own and international guest performances.
With its outstandingly varied, exciting programmes and lively performances, the Jenaer Philharmonie is one of the top concert orchestras in Germany. With its innovative concert formats and unusual collaborations, the orchestra has its finger on the pulse. Simon Gaudenz has been the orchestra’s General Music Director since 2018/2019. The Jena Philharmonic Orchestra performs in the most important concert halls in Germany and has also made a name for itself internationally with many tours that have taken it to Italy, France, Switzerland, Poland, Slovenia, Slovakia, Armenia and China. Twice, in 1999 and 2002, the Jena Philharmonic Orchestra received the prize for the best concert programme of the season. From 2017 to 2020, the orchestra was one of the orchestras funded by the German government as part of the ‘Excellent Orchestral Landscape Germany’ programme. The orchestra is a long-standing cooperation partner for the conducting classes at the Weimar University of Music, as well as for the annual ‘International Weimar Master Classes’. The venue for the Jena Philharmonic Orchestra and the choirs is the Volkshaus, built around 1900, with its recently renovated historic Ernst Abbe Hall.



The repertoire of Greek soprano Nina Koufochristou ranges from early Baroque to contemporary music. She can be heard in the coloratura soprano roles of Mozart’s operas, as Micaëla in Carmen, as Olympia in Offenbach’s Les contes d’Hoffmann, as Violetta in La traviata and as Adina in L’elisir d’amore. Nina Koufochristou was a member of the Wuppertal Opera ensemble and performs internationally. She has won many competitions, including the Concurso Montserrat Caballé (2015), Grand Prix Maria Callas (2014), and Concours de Chant Lyrique de Marmande (2012). She obtained her music diplomas in Thessaloniki. With a scholarship, she continued her studies in Cologne, where she completed master’s and concert exams in Opera as well as a master’s degree in Baroque singing.






Als Dirigent, Komponist und Orchester brennen wir für die Musik Gustav Mahlers. In dieser Gesamtaufnahme spielen und spiegeln wir seine zehn Sinfonien mit zehn kurzen zeitgenössischen Werken, die eigens für diesen Zyklus entstanden sind – eine Hommage an Mahlers klingenden Kosmos, ein persönlicher Blick aus der Gegenwart auf dessen reiches musikalisches Erbe.


Simon Gaudenz, Andrea Lorenzo Scartazzini und die Jenaer Philharmonie







Seit 2018 ist Andrea Lorenzo Scartazzini Composer in Residence der Jenaer Philharmonie. Zu jeder von Gustav Mahlers Symphonien, die in Jena als Zyklus in chronologischer Reihenfolge gespielt werden, schreibt Scartazzini ein neues Werk. Eine Kooperation über einen Zeitraum von sieben Jahren ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Am Ende des Zyklus’ werden 10 Werke stehen, die jeweils einzeln oder in Gruppen vor den Mahler-Symphonien, aber auch als abendfüllendes Gesamtwerk aufgeführt werden können. Andrea Scartazzini hat sich der Aufgabe von Beginn an mit großer Leidenschaft verschrieben, zumal Mahlers Musik ihm besonders am Herzen liegt: „Zum Werk Gustav Mahlers hege ich eine tiefe Liebe, seine Symphonien sind tönende Gefährten seit vielen Jahren, und bei jedem Wiederhören bin ich ergriffen von der schieren Fülle an Inspiration und Emotionalität,“ schrieb er zum Auftakt des Zyklus’. „Ich werde mit Lust auf die illustre Nachbarschaft reagieren, mich abgrenzen oder annähern im Sinne einer übergeordneten Dramaturgie. So soll beides gelingen: das Eigene schaffen und die Brücke schlagen.“ Nach über der Hälfte der Uraufführungen spricht er davon, dass die erneute Auseinandersetzung mit dem Werk Mahlers seine eigene Sprache und Kompositionsweise beeinflusst habe, denn nie vorher, sagt er, habe er so nahe an der Tonalität komponiert.



„Die ständige Beschäftigung mit der mahlerschen Symphonik muss mich auf verschiedene Wege führen, weil es in diesem Kosmos immer wieder so viel zu entdecken gibt,“ hatte er schon von Anfang an vermutet. Scartazzini spricht inzwischen davon, wie er ein neues Werk zu der jeweiligen Symphonie von Mahler in Beziehung setzt. Es ist die Dialektik von Distanz und Nähe. Er schaue sich die Mahler-Symphonie an, ähnlich wie ein Betrachter, der sich im Museum dem Objekt nähert, der um das Werk im Raum herumgehen und sich wieder davon entfernen kann. Aber Scartazzini baut keine distanzierte Beziehung zum Stück auf, sondern spürt nach, auf welche Weise sein neues Werk zu der jeweiligen Mahler-Symphonie eine symbiotische Beziehung eingehen kann. Hierbei stellt er sich immer die Frage: „Welche Position nehme ich zum Stück ein? Denn Mahlers Musik umspannt eine ganze Welt, ist immer fordernd, energiereich, stürmisch und zerrissen, also suche ich in der jeweiligen Mahler-Symphonie eine ‚Nische‘, vielleicht auch einen Gegenpol, also einen Ansatz, damit mein Werk mit Mahler korrespondiert und nicht konkurriert. Daher vermeide ich Zitate, denn die engen den eigenen Raum ein. Vielmehr suche ich eine gedankliche Verbindung zur Symphonie, mit der ich mich gerade auseinandersetze. Meine Kompositionen führen – ohne den im Konzertbetrieb üblichen Applaus – zum Kopfsatz der Mahler-Symphonie. Manchmal trennt die beiden Stücke nur ein kurzes Innehalten, manchmal mündet meine Musik auch direkt in den mahlerschen Klangfluss.“




Ein einzigartiger Zyklus: Scartazzinis Dialog mit Mahler
Als die Jenaer Philharmonie 2018 gemeinsam mit ihrem Generalmusikdirektor Simon Gaudenz den Entschluss fasste, alle zehn Sinfonien Gustav Mahlers zyklisch aufzuführen, wurde gleichzeitig etwas Einzigartiges ins Leben gerufen: Der Schweizer Komponist Andrea Lorenzo Scartazzini erhielt den Auftrag, zu jeder Symphonie ein kurzes eigenes Werk zu schreiben. Über sieben Jahre hinweg entstand so –parallel zu Mahlers sinfonischem Kosmos – ein zeitgenössischer Zyklus von zehn Stücken, die einzeln bestehen, in ihrer Gesamtheit jedoch eine eigenständige Großform bilden. „Ich habe nicht am Reißbrett eine Stunde Musik geplant, sondern jedes Mal von Neuem eine gedankliche Brücke zur jeweiligen Symphonie gesucht“, beschreibt Scartazzini seinen Prozess.


Die Grundidee war keine Konkurrenz zu Mahler, sondern ein Dialog. „Ich suchte eine Nische, eine gedankliche Verbindung und manchmal einen Kontrast. Auf Zitate verzichtete ich, denn diese engen den eigenen Raum ein“, erklärt Scartazzini. Seine Stücke führen – ohne Applaus – unmittelbar in den Klangfluss der Mahler-Symphonie. Mal trennt die beiden nur ein kurzes Innehalten, mal verschränkt sich die Musik zu einem einzigen Bogen.


Mit dieser Dramaturgie entstand etwas, das weit über einzelne Uraufführungen hinausgeht. „Meine Idee war von Anfang an, das Publikum mitzunehmen, indem man die Stücke immer wieder hört. Durch Wiederhören wird die Musik vertraut, und der Bezug zur zeitgenössischen Musik gestärkt“, so Gaudenz. In Jena bot sich diese seltene Gelegenheit: Die Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten Scartazzinis Werke mehrfach und konnten so ein Verhältnis zu ihnen entwickeln, wie es sonst fast nur bei Klassikern möglich ist.
Die Beschäftigung mit Mahler und die auf Jahre angelegte Dauer des Projektes haben Scartazzinis Tonsprache merklich geprägt, vermehrt integrierte er auch tonale Elemente. Auf Mahlers Vierte etwa reagierte er mit einem schlichten Orchesterlied, das einen hochromantischen, scheinbar naiven Ton aufgreift. Daneben stehen komplexe Stücke wie Omen und Orkus, Nachtstücke voller Bedrohung und Abgründigkeit, oder Enigma, das an den späten Mahler erinnert und mit zunehmend ätherischen Geräuschklängen in die Stille entschwindet.







Trotz dieser Unterschiedlichkeit ist der Zyklus von inneren Bezügen durchzogen. Motive, Klänge und Strukturen tauchen wieder auf, verweisen zurück und voraus, schaffen Zusammenhalt. „Ich musste meine Ideen so verdichten, dass bei aller Kürze der einzelnen Kompositionen der Eindruck von Geschlossenheit entsteht“, sagt Scartazzini. Zusammen aufgeführt bilden die zehn Werke ein symphonisch Ganzes von knapp sechzig Minuten Dauer.
Auch für die Musikerinnen und Musiker bot dieses Langzeitprojekt neue Erfahrungen. „Es kam uns entgegen, diese kleineren Abschnitte immer wieder zu erarbeiten. So erschloss sich nach und nach eine größere Linie, und wir bekamen auch zu Mahler eine neue bildliche und emotionale Beziehung“, erinnert sich Gaudenz. Und Scartazzini resümiert: „Es ist eine einmalige Gelegenheit, als Composer in Residence über viele Jahre mit einem Orchester gemeinsam etwas zu entwickeln. Die Probenarbeit und die zahlreichen Konzerterfahrungen haben den Schaffensprozess positiv geprägt.“
So entstand aus dem Jenaer Mahler-Zyklus weit mehr als eine Konzertreihe. Es wurde ein künstlerisches Experiment von seltener Konsequenz, das im Wechselspiel von Wiederhören und Neu-Hören ein Werk geschaffen hat, das in der Musikgeschichte ohne Vorbild ist – ein symphonisch Gegenstück unserer Zeit zu Gustav Mahler.
Mahler: die Symphonien Nr. 1 und Nr. 10

Dieses Album umfasst gleichsam Anfang und Ende von Gustav Mahlers symphonisch Kosmos: die Erste Symphonie in D-Dur, mit der der Komponist 1889 seinen unverwechselbaren Ton fand, und die Zehnte in Fis-Dur, die 1910 unvollendet blieb und damit sein Vermächtnis bildet. Gemeinsam öffnen sie einen weiten Bogen – vom Aufbruch einer neuen Klangwelt bis zu den erschütternden, ins Fragment abbrechenden letzten Tönen.


„Bücher fresse ich immer mehr und mehr! Sie sind ja doch die einzigen Freunde, die ich mit mir führe!“ schreibt Mahler zum Jahreswechsel 1894/95. Seine unersättliche Lektüresucht war außergewöhnlich für einen Komponisten seiner Zeit (Malte Fischer). Doch während viele Kollegen ihre Werke kommentierten,




schwieg Mahler weitgehend – mit einer wichtigen Ausnahme: den Liedern eines fahrenden Gesellen (1883-85), deren Texte er selbst schrieb. „Die Lieder sind so zusammengedacht, als ob ein fahrender Gesell, der ein Schicksal gehabt, nun in die Welt hinauszieht und so vor sich hinwandert“, notierte er. Diese Lieder prägen nicht nur sein Liedschaffen, sondern auch die ersten vier Symphonien.
Die Erste eröffnet Mahler „wie ein Naturlaut“: ein schwebendes Klanggewebe aus Flageoletts, Kuckucksrufen, Quarten und Quinten – als wolle er die Elemente der Musik selbst vorführen. Bruchstückhaft reiht er Klangsplitter aneinander, bis sich daraus ein Zitat der Gesellen-Lieder kristallisiert: „Ging heut’ morgen übers Feld“. Wanderrhythmus, Dorfmusik-Idyll, ferne Hörnersignale und ein ungebrochener „dionysischer Jubel“ fügen sich zu einem Mosaik aus Lied, Natur und Symphonie.


Auch die folgenden Sätze verweisen auf diese Welt: Der Ländler des Zweiten führt Schuberts und Bruckners Tanztradition weiter, doch durch Mahlers Überarbeitung erhält er eine eigene Handschrift. Im dritten Satz wird „Bruder Jakob“ in Moll zum Trauermarsch, durchbrochen vom Trost des Gesellenlieds „Die zwei blauen Augen“. Der Finalsatz beginnt mit einem „entsetzlichen Aufschrei“ (Mahler) und entfaltet eine dramatische Steigerung, deren lyrische Mitte bereits auf spätere Adagios verweist. Ein Hornruf kündigt gar das Thema „Sterben werd’ ich, um zu leben“ der Zweiten Symphonie an. Am Ende kehrt der Naturlaut des Beginns wieder – als ob Musik und Leben einen Kreis schließen.

Von Anfang an oszillierte das Werk zwischen Bezeichnungen: 1889 als „Symphonisches Gedicht“ uraufgeführt, dann „Tondichtung in Symphonieform“ (Titan), erhielt es erst 1896 endgültig den schlichten Titel Symphonie. Doch die Merkmale von Mahlers symphonischer Welt sind schon da: die Verschmelzung von Lied und Symphonie, die erzählerische Form, der Einzug des Alltäglichen ins große Ganze.


Im Kontext des Jenaer Zyklus erhält der Beginn dieser Symphonie eine neue Dimension: Er folgt auf Scartazzinis Torso, ein bewusst fragmentarisches, offenes Stück. Hört man es allein, so bleibt es ein Torso – im Konzert jedoch führt das Unvollendete unmittelbar in Mahlers Sinfonie hinein. Plötzlich wirkt deren Auftakt wie eine Antwort, eine Vollendung, die das Fragment umschließt. Bruch und Ganzheit erscheinen hier als aufeinander bezogene Gegensätze, die erst gemeinsam ihre volle Wirkung entfalten.




Abschied
Als Gustav Mahler am 18. Mai 1911 starb, hinterließ er zwei vollendete Werke, die er selbst nicht mehr aufführen konnte: Das Lied von der Erde und die Neunte Symphonie. Dazu kamen Skizzen einer Zehnten – einem Werk, das Fragment blieb. Nicht zufällig wählte Andrea Scartazzini für den Auftakt seines MahlerZyklus den Titel Torso: ein unvollendeter Körper, doch im Wesentlichen erkennbar.
Mahlers Skizzen zur Zehnten sind von Todesahnung und privater Krise gezeichnet: „Du allein weißt, was es bedeutet. Ach! Ach! Ach! Leb’ wohl mein Saitenspiel!“ oder „Für dich leben! Für dich sterben! Almschi“ notierte er in die Partitur. Alma Mahler versuchte, diese Spuren zunächst zu verbergen, bevor sie Freunden Einblick gewährte und 1924 Faksimiles herausgab. In Wien erklangen daraufhin Teile der Zehnten, von Franz Schalk und Ernst Krenek ergänzt. Viele große Komponisten – Berg, Schönberg, Schostakowitsch – lehnten eine Vervollständigung jedoch ab.


Erst der Erstdruck von Erwin Ratz 1964 machte die Quellen allgemein zugänglich. Nur der erste Satz, das Adagio, fand Eingang in die Kritische Gesamtausgabe und ist heute fester Bestandteil des Repertoires. Er zeigt Mahler in einer neuen, radikal konzentrierten Tonsprache: verhaltener, durchsichtig orchestriert, mit einem polyphonen Gewebe aus Streichern, getragen von einer melancholischen Bratschenphrase, die immer wiederkehrt. Am Ende türmt sich ein erschütternder Neuntonakkord auf, bevor die Musik in einzelne Fragmente zerfällt und verstummt.


Geplant war ein fünfsätziges Werk mit einem Purgatorio im Zentrum. Doch Mahler hat nie aufgehört, seine Symphonien als work in progress zu begreifen – stets offen, stets wandelbar. Schon die Neunte und Das Lied von der Erde waren als „auskomponierte Abschiede“ empfunden worden. Die Zehnte knüpft daran an, doch bleibt sie ein Fragment. Arnold Schönberg brachte dies 1912 in seiner Rede zum Gedenken an Mahler auf den Punkt: „Es scheint, die Neunte ist eine Grenze. Wer darüber hinaus will, muss fort.“
Für Scartazzinis Zyklus hatte das Offene, Unabgeschlossene des Adagios aus Mahlers Zehnter eine besondere Bedeutung: Sein letztes Werk Einkehr gestaltet er bewusst als eigentlichen „Schluss“ – mit Solistinnen, Chor und Orchester – und setzt damit einen Kontrapunkt zur unvollendet gebliebenen Zehnten Mahlers.

So spannt dieses Album einen Bogen von Anfang bis Ende – von Mahlers erstem symphonischen Aufbruch bis zu seinem letzten, ins Fragment abbrechenden Klangraum, von Scartazzinis bruchstückhaftem Torso zum friedvollen Ende von Einkehr.




Scartazzinis Zyklus: Die einzelnen Werke
I. Torso


Mit Ferninstrumenten, die in Mahlers Werk eine so wichtige Rolle spielen, beginnt auch Scartazzinis Zyklus. In Torso sind es zwei Trompeten, auf dem Balkon am hinteren Ende des Saals positioniert. „Ihre Musik springt wie ein Funke über und bringt das Orchester zum Klingen“, so der Komponist. Der Titel spielt auf einen magischen Vorgang des Erweckens an, der in Rainer Maria Rilkes Sonett Archaischer Torso Apollos thematisiert ist. Darin beschreibt der Dichter ein Leuchten, ein geheimnisvolles Leben, das der Skulptur des Gottes innewohnt: „Rilke kehrt im Text die normale Situation des Betrachtens um. Denn dieser Jünglingstorso führt ein eigenes Leben, er glänzt und flimmert. Wenn man ihn anschaut, schaut er zurück. Eine analoge Wechselwirkung besteht zwischen dem ‚Augenpaar‘ der beiden Ferntrompeten und dem sich allmählich belebenden Klang-‚Körper‘ des Orchesters. Zuerst klingen nur die hohen und die tiefen Ränder, danach entwickelt sich ein breiter Streicherklang, ein langsam atmendes und pulsierendes Zentrum, in das Holzbläserlinien wie Blutbahnen gezogen werden. Nach einer Steigerung mündet das Stück zuletzt in einen großräumigen Oktavklang, eine Art Dominante zu dem Beginn von Mahlers Symphonie Nr. 1“. Folgt auf Torso stattdessen Scartazzinis zweite Komposition Epitaph, verschmelzen die beiden Stücke bruchlos miteinander.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Archaischer Torso Apollos
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug.



Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle; und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.






Mahler, der zwar später von Programmnotizen zu seinen Werken nichts mehr wissen wollte, hatte einmal erwähnt, dass der Held der ersten Symphonie in der zweiten zu Grabe getragen würde. Seine Zweite erhielt den Beinamen „Auferstehung“, und auch wenn es nicht Mahlers eigener Titel war, Hintergrund des Werkes sind Tod und ewiges Leben. Scartazzinis Epitaph von 2018/19 kreist auch um diese Themen, aber auf eine stillere Weise, die eher den Zweifel und die Ungewissheit betont. Es ist eine Grabinschrift aus Klang. Nach einem wilden perkussiven Anfang beruhigt sich die Musik, ein lange Solo-Cello-Kadenz stellt sich aus, erst aufbegehrend, dann zusehends resignativ. Und wieder sind es Zeilen von Rainer Maria Rilke, die Scartazzini mitdenkt und dem Chor in den Mund legt: stockend, Silbe für Silbe, als würden die verwitterten Buchstaben auf einer Grabplatte nur mühsam zu entziffern sein: „Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. / Der große Tod, den jeder in sich hat, / das ist die Frucht, um die sich alles dreht.“ (Rainer Maria Rilke, aus Das Buch von der Armut und vom Tode)


Hinter Scartazzinis Spiriti steht das „Programm“ von Mahlers Dritter, das der zwar gegenüber Freunden erwähnt, aber nie veröffentlicht hatte, schon gar nicht in den Noten. Da „erwacht Pan“, da „erzählen die Tiere im Wald“ und die „Blumen auf der Wiese“, die Engel und die Liebe. Scartazzini ergänzt mit Spiriti augenzwinkernd diesen Reigen um die Geister der Natur. Es sind ätherische Klänge, oft wuselig und schattenhaft. Den Windhauch der Geister gestalten die Holzbläser mit ihren Klappengeräuschen und Flöten mit sanftem Pfeifen. Vor allem die Perkussionisten ergänzen die Palette mit luftigen und temporeichen Klängen mit Marimbaphon- und Vibraphonpartien. Undefinierbare und geheimnisvolle Farben kommen von den Chimes (Windspiel) und dem „Nicophone“, einem neuen Metallinstrument, dessen immenses Farbspektrum von lange nachhallenden metallischen Tönen bis hin zu Klängen reicht, die an die Sounds aus den früheren elektronischen Studios erinnern. Die feinen zerbrechlichen Klänge bilden einen bewussten Gegensatz zum wuchtigen ersten Satz von Mahlers Dritter.







Der Soprangesang, mit der Mahlers Vierte endet, ist Scartazzinis Ansatzpunkt für sein viertes Stück. Mit einem Orchesterlied auf ein Gedicht von Joseph von Eichendorff rahmt er Mahlers Werk ein, die hohe Sopranstimme des „himmlischen Lebens“ ist nun auch vor der Symphonie zu hören. Incantesimo nennt Scartazzini sein Stück, also „Zauber“. In Incantesimo steckt die Silbe „cant“ (von „cantare“ – singen). Scartazzini erläutert: „So verweist der Titel des Stücks einerseits auf den Gesang des Soprans und andererseits auf das Thema des Gedichtes selbst: In die Stille der hereinbrechenden Nacht erklingt das Lied eines einsamen Schiffers an sein Liebchen. Es ist eine hochromantische, traumhaft verklärte Abendstimmung, die der Dichter heraufbeschwört. Die Doppelbödigkeit des vermeintlich Naiven mit Anklängen an Kinderlieder, Fidelklang und dem Bild eines Schlaraffenlandes als Jenseits-Utopie ist der bestimmende Wesenszug von Mahlers Vierter. Incantesimo macht sich dieses ‚Als-ob‘ ebenfalls zu eigen und taucht mit seinem schlichten strophischen Abendständchen in eine weit entrückte Sehnsuchtswelt ein.“
Joseph von Eichendorff (1788-1857): Abendständchen
Schlafe, Liebchen, weil’s auf Erden
Nun so still und seltsam wird!
Oben gehn die goldnen Herden, Für uns alle wacht der Hirt.
In der Ferne ziehn Gewitter;
Einsam auf dem Schifflein schwank, Greif ich draußen in die Zither, Weil mir gar so schwül und bang.
Schlingend sich an Bäum und Zweigen, In dein stilles Kämmerlein Wie auf goldnen Leitern steigen
Diese Töne aus und ein.


Und ein wunderschöner Knabe
Schifft hoch über Tal und Kluft, Rührt mit seinem goldnen Stabe
Säuselnd in der lauen Luft.
Und in wunderbaren Weisen
Singt er ein uraltes Lied, Das in linden Zauberkreisen
Hinter seinem Schifflein zieht.
Ach, den süßen Klang verführet
Weit der buhlerische Wind, Und durch Schloß und Wand ihn spüret

Träumend jedes schöne Kind.






Einklang soll den Gegenpol zur wilden Dramatik Mahlers bilden, einen Moment der innerlichen Einkehr, bevor der Sturm losbricht. Im Zyklus der zehn Stücke Scartazzinis stellt es die in sich ruhende Mitte dar. Der Titel verweist auf zwei Aspekte: Es ist im Wesentlichen ein Klang, auf dem das Stück aufgebaut ist, ein C-Dur-Akkord, der sich bis zum 15. Oberton auffächert und nach unten in eine Art Untertonreihe gespiegelt ist. Diese riesige Klangfläche in den Streichern wird mehrmals unterschiedlich präsentiert, manchmal hört man die eng beieinander liegenden Obertöne sehr gut, was wie ein helles Gleißen oder Strahlen klingt. Manchmal stehen die ruhigen Bässe als Fundament im Vordergrund. Und zweimal ist der Grundakkord so umgestellt, dass die engen Obertöne in der Mitte liegen und sich der Akkord gegen unten und oben ausweitet. Dieser Akkord ist eine Art „Naturlaut“, um mit Mahler zu sprechen, er symbolisiert die Weite und Ruhe, wie man sie in der Natur oder auch in sich selbst findet, wenn man ganz mit sich „im Einklang“ ist. Aus diesem atmosphärischen Ruheklang heraus ertönen mehrmals kurze erhabene Blechbläsermotive und eine längere Kantilene.



Omen war nach griechischem und römischem Glauben ein Phänomen oder Ereignis, das Glück oder Unglück in der Zukunft verhieß oder einen Wink der Götter bedeutete. Fast alles konnte ein Zeichen sein: Träume, Himmelserscheinungen, Blitze, Kometen, Finsternisse und sogar Regentropfen. In Scartazzinis Omen gibt es musikalische Vorzeichen, die ein nahendes Unheil andeuten. Mahler lässt im vierten Satz seiner Sechsten zwei Mal einen großen Hammer niederfahren, eine finale Geste, die der Musik den Atem nehmen kann. War es Aberglauben, dass Mahler einen dritten Schlag nach den Proben wieder strich? „Mit verinnerlichten Streichersoli, leise schimmernden Vibraphon-Klängen und zarten Streichertönen verharrt die Musik zuerst in einem Zustand fast zeitloser Innigkeit“, so Scartazzini. Zugrunde liegt ihr ein Echo des großen C-Dur- Akkords aus Einklang, der sich in alle Richtungen abschleift und aufspreizt und als sieben Mal variierte Passage aus dreizehn (!) Akkorden allmählich in die Höhe schraubt. Jäh unterbricht ein Tam-Tam-Schlag den musikalischen Fluss. Wie ein Schicksalszeichen scheint ein raunender Klang auf und setzt ein dramatisches Geschehen in Gang, das mit einem orchestralen Aufschrei in die Strudel von Orkus mündet.






In der römischen Mythologie war Orkus beides, Ort und Person, Herrscher der Unterwelt und die Unterwelt selbst. Noch heute kennt man Orkus als Abgrund oder als Redewendung: „in den Orkus schicken“. Scartazzinis Orkus ist, wie die Mittelsätze von Mahlers Siebter, ein Nachtstück. Nach Abwärtsstrudeln und dumpfen perkussiven Passagen manifestiert sich noch einmal der raunende Akkord aus Omen: Der Klangeffekt – alle Streicher summen zu ihren leise tremolierenden Tönen – lässt an die Stimmen verstorbener Seelen denken. Danach beruhigt sich die Szenerie: „In immer stockenderem Fluss ertastet die Musik die Ambivalenz der Nacht – Ängste und Traumeswirren, aber auch Ruhe und Frieden beim Blick in den Sternenhimmel. Zuletzt verliert sich die einsame Spur einer Bassklarinette im Dunkel”, beschreibt der Komponist die Atmosphäre.
VIII. Anima


Anima komponierte Scartazzini korrespondierend zu Mahlers Achter als Vertonung von Goethes Gesang der Geister über den Wassern – bereits mehrfach in Musik gesetzt und bekannt durch Schuberts Komposition für Männerchor. Inspiriert vom Naturschauspiel des Wasserfalls im schweizerischen Lauterbrunnental vergleicht Goethe die menschliche Seele mit dem Kreislauf des Wassers, das in ewigem Wechsel vom Himmel kommt und zum Himmel steigt. Das metaphorische Bild eines Seelenzyklus im Gesang der Geister erfährt in der Läuterung von Fausts Seele (von Mahler im zweiten Satz seiner Achten vertont) eine konkrete Veranschaulichung. Die Musik von Anima folgt dem Weg des Wassers, vom leisen Rauschen zum wilden Schäumen bis in den ruhigen See. Immer hört man einen geisterhaften Grundklang in der Musik, aus dem der Gesang aufsteigt.





Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832): Gesang der Geister über den Wassern
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es, Zum Himmel steigt es, Und wieder nieder
Zur Erde muß es Ewig wechselnd.
Strömt von der hohen
Steilen Felswand
Der reine Strahl
Dann stäubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels, Und leicht empfangen, Wallt er verschleiernd, Leisrauschend
Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen
Dem Sturze entgegen, Schäumt er unmutig
Stufenweise
Zum Abgrund.

Im flachen Bette
Schleicht er das Wiesental hin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlitz
Alle Gestirne.
Wind ist der Welle
Lieblicher Buhler;
Wind mischt vom Grund aus Schäumende Wogen.


Seele des Menschen,
Wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen, Wie gleichst du dem Wind!







Enigma, so Scartazzini, „ist so stark wie kein anderes der Stücke dieses Zyklus an die Sprache Mahlers angelehnt. Die Harmonik und das langsame Tempo schaffen einen Bezug zum vierten Satz von dessen Neunter Symphonie, insbesondere zu den letzten Adagissimo-Takten. In Enigma steigt die Musik immer höher, bis sie schließlich ganz entschwindet. Zurück bleiben ein Rauschen und Luftgeräusche, die eine melodische Bewegung nachvollziehen, aus der alle Farbe entwichen ist. Das Gefäß ist noch da, aber der Inhalt verdunstet; das 19. Jahrhundert zu Ende und das Lebens Mahlers auch. Wie ein Rätsel erklingt nach einer langen Pause, ein zweites Mal der Chorgesang aus Epitaph: „Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. / Der große Tod, den jeder in sich hat, / das ist die Frucht, um die sich alles dreht.“



Einkehr für Sopran, Alt, Chor und Orchester ist eine Vertonung der ersten Strophe von Hölderlins Elegie Brot und Wein. Auf berührende Weise evoziert das Gedicht Bilder einer Stadt, die zur Ruhe kommt, vom Tag, der zu Ende geht, von Stille und Einkehr. Damit stellt Scartazzini: „dem Fragmentarischen von Mahlers Zehnter eine Musik des Friedens und der Vollendung zur Seite. Das Stück beginnt lautmalerisch: der Wind weht feine Klänge heran, eine Ahnung von Glockengeläut, entferntes Geklapper von Pferdehufen, das Rauschen der Brunnen, eine leise Harfenmelodie. Und dann setzt der ruhige Gesang des Chors ein, zuerst gleichmäßig, später sich polyphon verästelnd, doch immer getragen vom warmen Klang der Streicher und Blechbläser. Im letzten Drittel treten die Soli von Sopran und Alt hinzu, deren Gesang von der Melodie der beiden Solotrompeten aus Torso, dem ersten der zehn Stücke, umspielt wird. Weitere Motive rufen sich in Erinnerung und führen Einkehr nach einer Steigerung ganz zurück zum Anfang, zum Cis der Trompete, mit dem der Zyklus begonnen hat.“




Friedrich Hölderlin (17070-1843): Brot und Wein
Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse
Und, mit Fackeln geschmückt, rauschen die Wagen hinweg.
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen, Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen, Und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt.


Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann

Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen, Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet. Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken, Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf, Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt, Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen, Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.



Gernot Wojnarowicz
Autor des Textes Gernot Wojnarowicz / Odradek Records, LLC ist im Besitz einer Creative Commons-NamensnennungKeine Bearbeitungen-4.0 Internationalen Lizenz. Genehmigungen, die über den Geltungsrahmen dieser Lizenz hinausgehen, kann man bei www.odradek-records.com erhalten.





Profiliert, lebendig, vielseitig – drei Charakteristika, die Simon Gaudenz’ musikalische Interpretationen beschreiben. Seit 2018 ist er Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie, wo er mit energiereichen Konzerten, innovativen Ideen und außergewöhnlichen Programmkonzepten begeistert. Als international gefragter Dirigent steht Simon Gaudenz am Pult zahlreicher bedeutender Klangkörper in Deutschland, Skandinavien, Frankreich und der Schweiz. Er ist gern gesehener Gast bei Festivals wie dem SchleswigHolstein Musik Festival, den Berliner Festwochen oder den Schwetzinger Festspielen. Eine enge und intensive Zusammenarbeit verbindet ihn mit herausragenden Interpret:innen, darunter Anne-Sofie von Otter, Veronika Eberle, Igor Levit, Renaud Capuçon, Arabella Steinbacher, Michael Barenboim, Benjamin Appl, Lilya Zilberstein, Lise de la Salle und Maximilian Hornung. Nach der ersten Station als Chefdirigent des Collegium Musicum Basel, wurde er 2010 zum Ersten Gastdirigenten des Odense Symphony Orchestra ernannt. 2012 folgte die Berufung zum Chefdirigenten der Hamburger Camerata, mit der er regelmäßig in der Elbphilharmonie Hamburg auftritt. Aus seiner Diskographie sticht die Gesamtaufnahme von Robert Schumanns Symphonien mit dem Odense Symphony Orchestra hervor, ebenso die mit dem Opus Klassik 2020 ausgezeichnete Einspielung von Symphonien des Haydn-Zeitgenossen François-Joseph Gossec mit der Deutschen Kammerakademie Neuss. Louis Spohrs Gesamtwerk für Klarinette und Orchester nahm Simon Gaudenz mit dem Klarinettisten Christoffer Sundqvist und der NDR Radiophilharmonie auf. Auch mit der Jenaer Philharmonie entstehen regelmäßig Einspielungen, mit der er sich für selten gespieltes Repertoire einsetzt – darunter Werke von Hugo Wolf, Carl Loewe und Karl Weigl.









Andrea Lorenzo Scartazzini (*1971 in Basel) schreibt Musik von hoher Expressivität, harmonischer Fülle und formaler Klarheit. Bereits während des Studiums der Literaturwissenschaft an der Universität Basel begann er ein Kompositionsstudium an der Musikakademie Basel bei Rudolf Kelterborn. Später setzte er seine Ausbildung in London und bei Wolfgang Rihm in Karlsruhe fort. Es folgten Aufenthalte als Dozent und Composer in Residence in Witten/Herdecke, in Shanghai sowie in Bamberg. Für sein Schaffen erhielt Scartazzini mehrere Preise, darunter den Förderpreis Komposition der Ernst von Siemens Stiftung, den Jakob-Burckhardt-Preis der Goethe-Stiftung Basel. Seine Kompositionen werden bei zahlreichen Festivals (u.a. Osterfestspiele Salzburger, Lucerne Festival, Mahler-Musikwochen Toblach, Internationale Ferienkurse Darmstadt, Lied Basel), in renommierten Konzerthäusern (Elbphilharmonie Hamburg, KKL Luzern) und durch zahlreiche weltbekannte Ensembles und Orchester aufgeführt. Einen weiteren zentralen Bestandteil seines Schaffens bilden die Opern Edward II (Deutsche Oper Berlin), Der Sandmann (Oper Basel, Oper Frankfurt) sowie Wut (Theater Erfurt, Theater Bern). Von 2018 bis 2025 war Scartazzini Composer in Residence der Jenaer Philharmonie.









Der Jenaer Madrigalkreis ist das ambitionierteste Vokalensemble der drei Chöre unter dem Dach der Jenaer Philharmonie. Unter Leitung der Chordirektorin Berit Walther singt er ein anspruchsvolles, stilistisch weitgefächertes Repertoire in Programmen mit der Jenaer Philharmonie, tritt aber auch bei zahlreichen eigenen Konzerten und internationalen Gastspielen auf.
Die Jenaer Philharmonie zählt mit ihren abwechslungsreichen und spannenden Programmen und lebendigen Aufführungen zur oberen Liga der Konzertorchester in Deutschland. Mit seinen innovativen Konzertformaten und außergewöhnlichen Kooperationen ist das Orchester am Puls der Zeit. Die Jenaer Philharmonie gastiert in den wichtigsten Konzerthäusern Deutschlands und profiliert sich auch international durch viele Tourneen, die sie bisher nach Italien und Frankreich, in die Schweiz, nach Polen, nach Slowenien, in die Slowakei, nach Armenien und China führten. Einladungen zu Festivals in der Schweiz und Italien, darunter mehrmals die Mahler-Musikwochen in Toblach, standen in jüngster Zeit im Kalender. 2024 gastierte man im Concertgebouw Amsterdam.1999 und 2002 wurde die Jenaer Philharmonie mit dem Preis für das beste Konzertprogramm der Saison ausgezeichnet. Von 2017 bis 2020 gehörte das Orchester zu den Klangkörpern, die im Rahmen des Programms „Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland“ von der Bundesregierung gefördert wurden. Für die Dirigierklassen der Musikhochschule Weimar ist das Orchester der langjährige Kooperationspartner, wie auch für die jährlich stattfindenden Internationalen „Weimar Master Classes“. Spielstätte der Jenaer Philharmonie und der Chöre ist das um 1900 gebaute Volkshaus mit seinem soeben renovierten historischen Ernst-Abbe-Saal.



Evelyn Krahe studierte Pädagogik in Trier und ließ parallel dazu ihre Stimme von Diane Pilcher ausbilden. Sie war als Chorsängerin in Stralsund engagiert, später an der Oper Bonn. 2008 verpflichtete man sie als Solistin an das Landestheater Detmold. Wichtige Partien waren dort alle tiefen Frauenrollen in Wagners Ring sowie Dalila in Saint-Saëns’ Samson et Dalila, Azucena in Il Trovatore und die Titelrolle in Carmen. 2013 wechselte sie ans Nationaltheater Mannheim. Seit 2015 arbeitet Eveyln Krahe freischaffend. Sie ist Trägerin des Detmolder Theaterrings. Evelyn Krahe gastierte an zahlreichen Bühnen im In- und Ausland, u.a. dem Staatstheater Braunschweig, der Deutschen Oper am Rhein, der Longborough Festival Opera in England sowie an der Den Nye Opera in Bergen, Norwegen. Als Konzertsängerin war sie bereits mehrfach in großen Konzerthäusern wie der Kölner Philharmonie und der Tonhalle Düsseldorf zu hören. Und auch mit der Jenaer Philharmonie stand sie immer wieder auf der Bühne.





Das Repertoire der griechischen Sopranistin Nina Koufochristou reicht vom Frühbarock bis zur zeitgenössischen Musik. In den Koloratursopranpartien der Mozart-Opern kann man sie ebenso hören wie als Micaëla in Carmen, als Olympia in Offenbachs Les Contes d’Hoffmann, als Violetta in La traviata oder Adina in L’elisir d’amore. Nina Koufochristou gehörte dem Ensemble der Oper Wuppertal an und gastiert international. Sie ist Preisträgerin vieler Wettbewerbe wie dem Concurso Montserrat Caballé (2015), Grand Prix Maria Callas (2014) und dem Concours de Chant Lyrique de Marmande (2012). Sie erwarb ihre Diplome in Tessaloniki. Mit einem Stipendium setzte sie ihre Studien in Köln fort, wo sie Master- und Konzertexamen in Oper und einen Master in Barockgesang abschloss.






With
the kind support of Pro Helvetia

Recording dates and venues: Mahler 10 and Scartazzini I-X: Ernst Abbe Saal, Volkshaus Jena 4-6 June 2025 Mahler 1: Ernst Abbe Saal, Volkshaus Jena 5-7 October 2023
Recording Producer and mastering: Aki Matusch
Recording Engineers: Christoph Binner, Florian B. Schmidt and Johann Günther Scartazzini’s works are published by Bärenreiter-Verlag
Photos: Cover: TommasoTuzj.com
Gaudenz and Scartazzini: Lucia Hunziker Design: MarcoAntonetti.com

www.jenaer-philharmonie.de www.scartazzini.com www.simongaudenz.com www.odradek-records.com