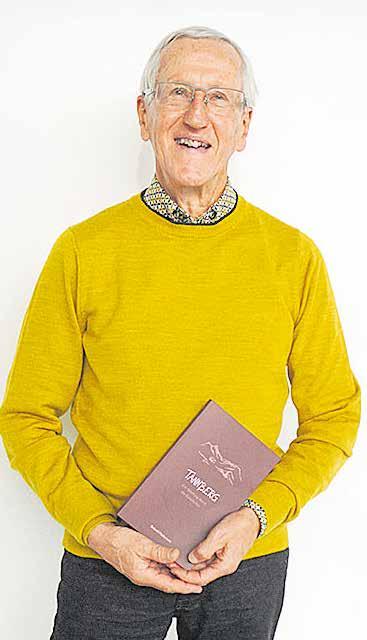
5 minute read
Dr. Roland Pfefferkorn
WILDES GEBIRGE
Das Buch „Tannberg – ein Streifzug durch die Geschichte“ befasst sich mit dem Leben der Bergbauern im Gebiet Schröcken, Warth, Zürs und Lech.
Dr. Roland Pfefferkorn mit seinem Erstlingswerk „Tannberg“.
Zur Person
Dr. Roland Pfefferkorn Wohnort: Lech Beruflicher Werdegang: Dem technischen Physikstudium in Wien folgt eine Assistenzstelle an der Montanuniversität Leoben. Nach 15 Jahren in Liechtenstein tritt er die Stelle als Geschäftsführer bei Getzner Werkstoffe in Bürs an. 16 Jahre später verabschiedet er sich in seine verdiente Pension und widmet seine Zeit der lokalen Geschichte der Tannberger Gemeinden. Als Vorstand des Lechmuseums befasst er sich mit einem Projekt zum Aufbau einer neuen Museumsinfrastruktur. LECH: Der Tannberg war ein Gerichtsbezirk im heutigen Vorarlberg, bestehend aus dem Gebiet Schröcken, Hochkrumbach am Hochtannbergpass, Warth, Lech, Mittelberg und Zug. Der pensionierte Physiker Roland Pfefferkorn ist seinem Geburts- und Heimatort Lech und dem Tannberg trotz seines bewegten beruflichen Lebens stets eng verbunden geblieben. Die freie Zeit der Lockdowns 2020 boten genügend Freiraum für tiefgründige und detaillierte Recherchen, die so zahlreich und spannend waren, dass die vorliegende Erzählung gut und gerne weitere Buchbände füllen könnte. Im Gespräch erzählt der Autor mehr über die faszinierende Lebensweise unserer Vorfahren.
Seit wann befassen Sie sich mit der Geschichte des Tannbergs?
Roland Pfefferkorn: Das Thema beschäftigt mich schon seit langer Zeit. Es war immer schon ein Wunsch von mir, mehr darüber zu erfahren, denn publiziert wurde darüber recht wenig. Die Berichte, die es über die Zeit gibt, befassen sich hauptsächlich wissenschaftlich mit dem Thema. Das Leben der Bergbauern damals wird quasi nirgends behandelt. Als ich 2020 aus dem Urlaub zurückkam, folgte unmittelbar darauf der erste Lockdown. Ich habe die Zeit genutzt und angefangen zu recherchieren, viel Material zusammengetragen und sukzessive Gedanken niedergeschrieben. Daraus ist so viel Spannendes entstanden, von dem ich überzeugt war, dass es auch andere interessieren könnte. Den letzten Schubs hat mir die FH-Absolventin Daniela Lang gegeben, die mit mir das Buch gestaltet hat. Das Buch ist im Selbstverlag entstanden und mit viel historischem Bildmaterial untermalt, damit man sich die Gegebenheiten besser vorstellen kann. Über 80 Bilder aus früheren Zeiten lassen die Geschichte lebendig erscheinen.
Wie haben Sie das Buch konzipiert?
Roland Pfefferkorn: Ich habe mit dem Groben begonnen und mich dann zu den feinen Details vorgearbeitet. So beginnt das Buch mit der Geschichte Vorarlbergs und warum das Gebiet des Tannbergs so interessant für die Habsburger war. Geplant war ein Alpenstaat zwischen den Habsburger Besitztümern östlich des Arlbergs, der heutigen Schweiz und des Elsass, der die Wege nach Italien beherrschen sollte. Diese Barriere zwischen Deutschland, Frankreich und Italien hätte durch Steuern und Grenzzölle die Taschen der Habsburger gefüllt. Der Tannberg war in Vorarlberg ein Bereich, der nicht den Grafen von Montfort gehört hat. Lech hatte sogar ein eigenes Gericht. Zürs und Stuben gehörten zu Sonnenberg, wurden aber später in den Tannberg eingemeindet.
Dann habe ich die Geschichte der einzelnen Orte, die Verkehrswege nach Oberstdorf sowie die Entsiedlung der Weiler Bürstegg, Hochkrummbach und Älpele im Detail behandelt. Ich habe wesentliche Faktoren aus dem Gemeindebuch Lech verwendet, mich aber mehr auf das Leben unserer Vorfahren konzentriert. Das Ergebnis ist ein leicht lesbares, kurzweiliges Buch, das eine Beschreibung der damaligen Verhältnisse beinhaltet und keine Jahreszahlen aneinanderreiht. Das Buch liegt bereits in einigen Lecher Hotels auf und ist nicht nur für Touristen wahnsinnig interessant.
Welche Bedeutung haben die Saumpfade für Tannberg?
Roland Pfefferkorn: Saumpfade sind die kleinste Einheit eines Verkehrswegs. Man kann gerade mal einen Karren drüberziehen oder ein Pferd oder eine Kuh drüberführen. Diese Saumpfade waren für die Versorgung von Lech, Warth und Schröcken essenziell, um Nahrung und Gebrauchsgüter aus Oberstdorf zu beziehen. Der Flexenpass war früher als Saumpfad eine echte Hürde, der vielen Lechern zum Verhängnis wurde. Bis zum Bau der Flexenstraße 1895–97 war Birgsau bei Oberstdorf für die Bauern der Region sicherer zu erreichen und der wichtigste Handelsplatz für den Verkauf von Vieh der Tannberger. Mit der Fertigstellung der neuen Flexenstraße 1897 wurde dann der gesamte Transport der benötigten Waren von Lech und Zürs über die neue Bahnstation in Langen abgewickelt. Nach dem Bau des Arlbergtunnels für die Bahn brachen harte Zeiten für die Bevölkerung von Stuben an, weil das Säumen von Personen und Waren wegfiel. Viele wanderten ab, die Häuser verfielen. Der Bau der Flexenstraße brachte für die Bewohner des Ortes wieder mehr Arbeit. Um 1900 setzte auch ein bescheidener Fremdenverkehr ein, der nach dem 2. Weltkrieg vom Skitourismus abgelöst wurde und für mehr Einkommen in Stuben sorgte. Die Arbeit als Säumer war ein Geschäftsmodel das für viele Stubener lange Zeit eine Überlebensstrategie war.
Die Walser spielen für die Besiedelung der Bergregionen eine große Rolle. Wie verhält es sich mit dem Tannberg?

Roland Pfefferkorn: Ich räume im Buch mit der Annahme auf, dass die Walser die ersten waren, die Lech besiedelt haben. Der spätromanische Vorgängerbau der Lecher Kirche aus dem 13. Jahrhundert wurde mit Holz des Winterhalbjahres 1339/40 ausgebaut. 1382 etwa wurde die Alpe Wöster an Heinz den Metzger aus Bregenz verkauft. Daraus lässt sich schließen, dass wohl schon vor der weiteren Besiedelung durch die Walser das Gebiet bereits bewohnt wurde. Die Walser bewiesen großes Geschick bei der Rodung der höher gelegenen Waldgebiete und lebten fast ausschließlich von der Vieh- und Milchwirtschaft. Sie waren maßgeblich an der erfolgreichen Errichtung von Dauersiedlungen in diesen Höhenlagen unter derart harten Bedienungen beteiligt.
Heute ist Lech ein tolles Skigebiet, zur Zeit der Besiedelung vor 1300 jedoch lag die Baumgrenze noch 200 Meter höher. Daher wurden die noch höhergelegenen Flächen zur Besiedelung Foto: Daniela Lang vorgezogen, da sie frei von Bäumen waren. Zürs war zum Beispiel früher eine bekannte Alpe, weil die Flächen so hoch lagen, dass es keinen Wald gab. Im ausgelassenen Spullersee fand man Überreste von Bären und massive Hirschgeweihe. Weiters ist urgeschichtlich bekannt, dass in Hochkrummbach Brandrodungen durchgeführt wurden. Das Gebiet war also stark bewaldet. Bis zur Kleinen Eiszeit Ende des 17. Jahrhunderts wuchsen in Lech sogar Getreide und Kartoffeln. Um 18020 gab es unfassbar viel Schnee und Lawinen im Tannberg-Gebiet. Durch die Rodungen gab es keine Bäume zum Heizen mehr, das Futter für das Vieh ging aus. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie furchtbar hart diese Jahrzehnte gewesen sein müssen. Bedeutend war, dass die Walser keine Leibeigenen, sondern freie Leute waren. Sie mussten Steuern zahlen und für Kriegsdienste zur Verfügung stehen. Sie durften ihren Besitz und ihre Höfe allerdings vererben. Für die damals ansässigen Grafen waren die Walser äußerst spannend. Mit ihrer Hilfe konnten entlegene Gebiete besiedelt werden und die Einkünfte durch die Steuerabgaben sorgten für Wohlstand. Informationen
„Tannberg – ein Streifzug durch die Geschichte“ ist im Verkehrsamt, Museum und Tourismus in Lech Zürs sowie in Pfefferkorns Geschenkeboutique erhältlich. Auch in Warth und Schröcken liegt es in den Tourismusbüros auf. Die Distribution über den Buchhandel erfolgt in Kürze.





