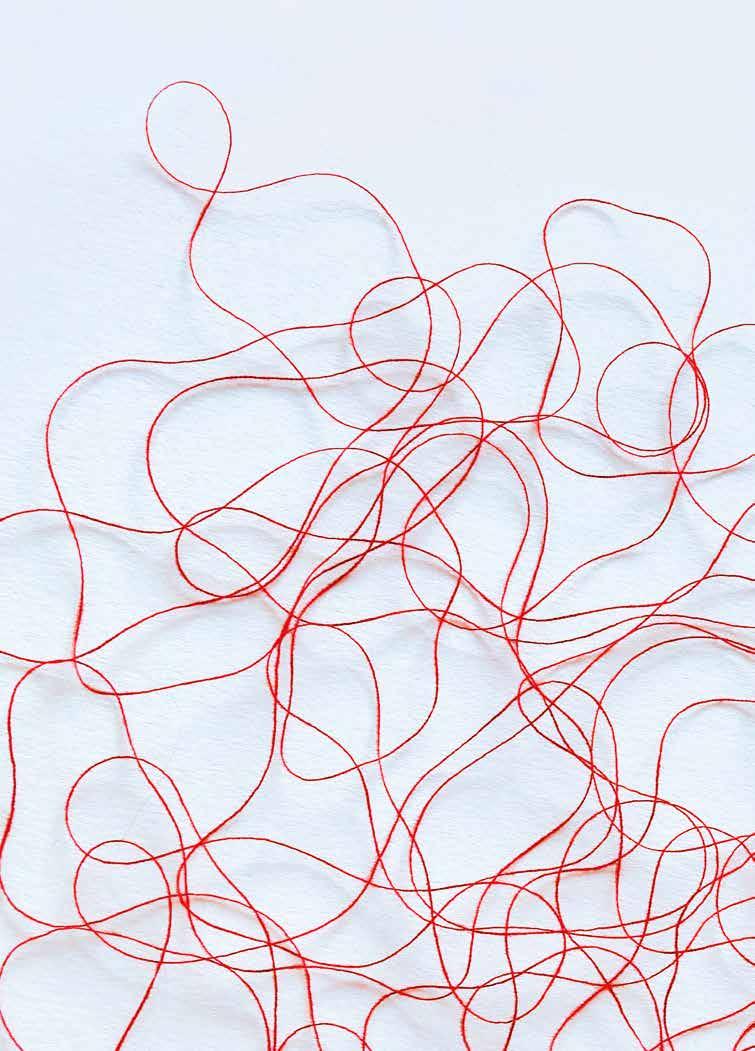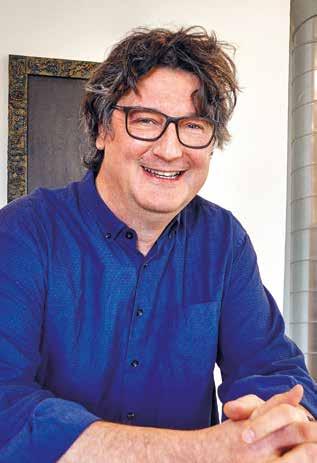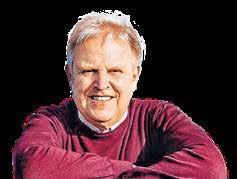36 minute read
Impressum
Trans* Lexikon sex: das körperliche Geschlecht. gender: das soziale Geschlecht (Rollenbilder, Erziehung). queer: bezeichnet Dinge, Handlungen oder Personen, die von der Norm abweichen. Transgender: Personen, die sich nicht – oder nicht nur – mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Transsexualität: ist der rechtlich korrekte Begriff für Transge- schlechtlichkeit Transgeschlechtlichkeit: beinhaltet sowohl die körperliche Kom- ponente (transsexuell) als auch die soziale (transgender). Transidentität: betont, dass es um die Identifikation mit dem anderen Geschlecht und nicht um die Sexualität geht. Trans*: Das „Trans-Sternchen“ bildet den Versuch, einen nicht wertenden und nicht kategorisierenden Oberbegriff für das gesamte Trans*-Spektrum zu finden. Intersexualität/Intergeschlechtlichkeit: das Vorkommen von sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechtsmerkmalen bei einer Person. Transvestit: Menschen, die sich (zeitweise) entgegen ihres bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts kleiden. Heute verwendet man dafür eher den Begriff Cross-dressing. Transfrau: Eine Person, die sich als Frau identifiziert, obwohl ihr bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeordnet wurde. Transmann: Eine Person, die sich als Mann identifiziert, obwohl ihr bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde. Cisgender: Der Gegensatz zu „trans“ (lateinisch: jenseitig) ist „cis“, was auf deutsch „diesseitig“ bedeutet. „Cisgender“ ist die Bezeichnung für Menschen, die sich mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht iden- tifizieren. Cisfrau: Eine Person, der bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde und die sich damit identifiziert. Cismann: Eine Person, der bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde und die sich damit identifiziert. Transphobie: Die Ablehnung von Trans-Menschen – oft verbunden mit Diskriminierung und Gewalt gegen Trans-Menschen. LGBT: ist die Abkürzung für „Lesbian, Gay, Bisexual and Transgen- der“ und steht für die Gemeinschaft von Lesben, Schwulen, Bisexuel- len und Transgendern. Heute sagt man auch LGBTQIA+, was für lesbische, schwule, bise- xuelle, transsexuelle, transgender, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen steht. Als Abkürzung davon ist LGBTIQ* gebräuchlich. (Quelle: Puls Trans-Begriffe: Wie mensch über Transgender spricht: https://www. br.de/puls/themen/leben/transgender-begriffe-und-formulierungen-100.html
Adressen: Selbsthilfegruppe Dornbirn: www.selbsthilfe-vorarlberg.at/ transidentitat-transsexualitat-intersexualitat/ und „s‘Freiräumle“ Trans* und Inter*Café in Hohenems: www.freiraeumle.at Impressum Grundlegende Richtung Die Straßenzeitung marie versteht sich als Sprachrohr für die Anliegen von Randgruppen unserer Gesellschaft. marie ist ein Angebot zur Selbsthilfe für Menschen an oder unter der Armutsgrenze, die ihren Lebensmittelpunkt in Vorarlberg haben. Ziel ist die Förderung des Miteinanders von Menschen am Rande der Gesellschaft und der Mehrheitsgesellschaft. Die Hälfte des Verkaufspreises von 2,80 Euro verbleibt den Verkäufern. marie ist ein parteiunabhängi- ges, soziales und nicht auf Gewinn ausgerichtetes Projekt. Redaktion marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung, Am Kehlerpark 5, Top 34, 6850 Dornbirn Telefon: 0677 61538640 eMail: redaktion@marie-strassenzeitung.at Internet: www.marie-strassenzeitung.at Redaktion: Frank Andres, Christina Vaccaro MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Eckart Drössler, Daniela Egger, Guntram Gärtner, Simone Fürnschuß-Hofer, Christine Mennel, Gitte Nenning, Hans Platzgumer, Brigitta Soraperra, Gerhard Thoma Zeitungsausgabestellen: Dornbirn: Kaplan Bonetti Sozialwerke Kaplan-Bonetti-Straße 1 Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 9 Uhr Bregenz: dowas, Sandgrubenweg 4 Montag und Donnerstag 8.30 bis 10.30 Uhr Bludenz: do it yourself, Kasernplatz 5-7/3b Montag und Mittwoch 14 bis 16 Uhr Feldkirch: Caritas-Café, Wohlwendstraße 1 Dienstag und Freitag 10 bis 12 Uhr Anzeigen Kontakt: anzeigen@marie-strassenzeitung.at Medieninhaber und Herausgeber Verein zur Förderung einer Straßenzeitung in Vorarlberg, ZVR-Zahl 359044778 6833 Klaus eMail: redaktion@marie-strassenzeitung.at Externe Beiräte DSA Markus Hämmerle, DSA Heidi Lorenzi, Cornelia Matt, Mag. Peter Mayerhofer, Dr. Claudio Tedeschi Druck: Russmedia Verlag GmbH, Schwarzach Auflage: 15.000 Exemplare Erscheinungsweise monatlich Layout/DTP Alexander Grass Bildbearbeitung Fitz Feingrafik Bankverbindung & Spendenkonto Raiffeisenbank im Rheintal IBAN: AT94 3742 0000 0648 3580 BIC: RVVGAT2B420 © 2020 marie. Alle Rechte vorbehalten.
Advertisement
EIN FREI-DAY FOR FUTURE PRO WOCHE
Die Berliner Bildungsinnovatorin Margret Rasfeld, 68, Schulleiterin i.R, Mitbegründerin der Initiative „Schule im Aufbruch“, Nachhaltigkeitsexpertin, Buchautorin und weltweit Vortragende, ist Anfang März zu Besuch in Vorarlberg. Wir haben im Vorfeld mit ihr gesprochen: darüber, worunter Schüler*innen am meisten leiden, wohin sich Schule entwickeln sollte und was es mit dem FREI-DAY for future auf sich hat.
Interview: Simone Fürnschuß-Hofer, Fotos: Shutterstock, privat
marie: Sie haben zwei Schulen gegründet, sie erfolgreich geführt, Auszeichnungen dafür bekommen. Was zeichnet diese Schulen denn aus? Margret Rasfeld: Diese – und etliche weitere – zeichnet eine andere Haltung aus: Wir trauen den Kindern sehr viel zu und bieten ihnen möglichst viele Gelegenheiten, sich auszuprobieren. Lehrer verstehen wir als Unterstützer des Lernprozesses und nicht als Wissensvermittler. Schulen wie diese haben das Lernen an echten Herausforderungen und Realaufgaben strukturell verankert. Denn Verantwortung zu übernehmen, mit Ungewissheiten umzugehen oder selbstbestimmt auf Situationen zu reagieren, lernt man nicht am Tisch mit Arbeitsblättern. Dazu muss man sich rausbegeben ins wahre Leben. Und so haben wir einige ungewöhnliche Fächer wie „Verantwortung“ oder „Herausforderung“ kreiert. Welche Fächer fehlen noch an unseren Schulen? Wir müssen weg von den Fächern. Wir zersplittern den Schulalltag in Fächer, die nichts miteinander zu tun haben. Es wäre wichtig, über Projekte zu lernen, Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Und selber aktiv zu werden, eigene Fragen stellen zu dürfen, anstatt nach Antworten zu suchen, die als Lösung längst im Lehrerhandbuch stehen ... ... und nur ein Richtig oder Falsch zulassen. Genau. Und wir wundern uns dann, wenn Kinder ihre Kreativität verlieren! Wer zehn Jahre lang fremde Fragen beantwortet, verlernt, eigene Fragen zu stellen. Am besten wäre es, man würde nur noch in Projekten arbeiten. Aktuell versuchen wir in Deutschland mit dem „FREI-DAY for future“ zumindest einen Tag pro Woche für projektbasiertes Lernen strukturell zu verankern: also mindestens vier Stunden pro Woche dem Lernbereich Zukunft und damit Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, Frieden zur Verfügung zu stellen. Wissen, Handeln, Netzwerke aufbauen, um diese drei Aspekte geht es. Alleine kann keiner diesen Wandel schaffen. Wir brauchen Bündnisse und wir haben Menschen mit sehr viel Expertise, die allerdings durch die herkömmliche Stundenplan-Taktung nicht in die Schulen reinkommen. Ein FREI-DAY könnte das ändern, könnte Schulen für Netzwerke öffnen. Worunter leiden Schüler*innen aktuell denn am meisten? Unter Langeweile. Darunter, dass sie Dinge lernen müssen, die wenig Sinn machen und sie nicht für die großen
Themen befähigen. Im Grunde sind sie überfordert von fremdbestimmten Inhalten und unterfordert in ihrem Humanpotenzial. Es fehlt an Sinn und Beteiligung. Stattdessen werden Kinder und Jugendliche zu Leistungsablieferanten, gefangen im Hamsterrad, fühlen sich zunehmend krank und schlecht, weil sie glauben, nicht zu genügen oder zu enttäuschen. Das ist gefährlich und entspricht weder den Kinderrechten noch der Würde des Menschen. Was hat Sie eigentlich selbst zu der Pädagogin gemacht, zu der Sie geworden sind? Ich bin aufgewachsen in der 68er-Zeit mit all dem Engagement für Ökologie und Frieden und gegen Atomkraftwerke. Das hat mich sehr geprägt und ich habe von Anfang an Projekte mit Schülern gemacht und dabei gesehen, wie sehr sie sich begeistern lassen. Immer mehr habe ich die Räume dafür geöffnet und verankert. Zurück zur Frage: Im Grunde also all die Erfahrungen, die du machst, wenn du loslässt. Aus aktuellem Anlass: In Vorarlberg wurde eine Petition gestartet, die sich gegen den wieder eingeführten Notenzwang richtet und sich für die freie Wahl der Leistungsbeurteilung ausspricht. Was sagen Sie dazu? Die Noten müssen dringend abgeschafft werden, dürfen nicht mal mehr zur frei en Wahl stehen. Wir befinden uns aktuell in der Transformation vom „Höher-Schneller-Weiter“ hin zur Kraft des Wir. In der Arbeitswelt hat man verstanden: Für kreative Lösungen brauchst du heterogene Teams. Durch die Leistungsgesellschaft und das Internet landen junge Menschen allerdings im Optimierungswahn. Noten unterstützen genau diese Ausrichtung und deshalb gehören sie dringendst zu Gunsten von individuellen Feedbacks abgeschafft. Future-Skills, also Metakompetenzen wie Teamarbeit, Empathie, Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz, Umgang mit Fremdem und so weiter sind ja alle nicht ablesbar von der Note. Noten fokussieren den Vergleich, die Konkurrenz, und festigen diese antiquierten Haltungen. Sind wir damit bei jenen Musterbrüchen, die Sie einfordern, damit sich etwas ändern kann? Musterbrüche helfen uns, nicht mehr in altes Verhalten zurückzurollen. Ein solcher Musterbruch kann die Jahr gangsmischung sein, die keine Frontalbeschallung im Gleichschritt mehr zulässt. Oder die gewollte Heterogenität statt Selektion. Ja, auch Noten zu überwinden kann ein Musterbruch sein, weil dann etwas Gewohntes wegfällt und uns fordert, etwas Neues zu entwickeln. Wir entwerfen in Deutschland gerade eine Art „Alternativwährung“: ein digital gestütztes, übers Handy bedienbares Feedbacksystem. Hier können Schüler selber ihre Metakompetenzen eintragen und belegen, wie sie sie erworben haben. Da geht es also um Future Skills – nicht um Mathematik. Nochmals zurück zu „höher, schneller, weiter“ als nicht zukunftsfähiges Paradigma. Hängen da aber Politik und Wirtschaft nicht noch an alten Zöpfen? Das würde ich so nicht sagen. Die Politik war vielleicht noch nie geeignet für Musterbrüche, die Zivilgesellschaft ist da gefragt. Das Denken in Konkurrenz, die Orientierung am Profit statt am Menschen hat zwar alle Bereiche erfasst, aber überall spürt man inzwischen auch die Bestrebungen, genau das zu überwinden. Unternehmen wissen „new work“ braucht „inner work“ und auch am Beispiel der Alternativen Medizin oder Öko-Landwirtschaft sehen wir: Da gibt es große Entwicklungen. Überall. Und die Bildungspolitik ist halt Parteipolitik, das hat ja nicht viel mit Bildung zu tun, aber dagegen müssen wir uns wehren. Wer aber sind „wir“? Oder anders gefragt: Wer hat die Hebel in der Hand, um Schule zu reformieren? Am besten ist immer: von unten gewollt und von oben unterstützt. Schulen, die etwas anders machen, müssen hinausgehen und sich zeigen, so, wie auch Schule im Aufbruch vernetzt, inspiriert und zu einer Art Mutmachbewegung geworden ist. Bei „Schule im Aufbruch Österreich“ haben wir erlebt, dass auch Schulinspektoren Teil der Bewegung werden. Wer aufbricht, bekommt von uns jedenfalls Unterstützung.
Bildungsinnovatorin Margret Rasfeld
Pädagogische Fachtagung „Mut zum Leben – Was Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft brauchen“; Freitag, 6.3., 14 - 21 Uhr, Bildungshaus Batschuns Margret Rasfeld referiert zum Thema „Was wirklich zählt“, alle weiteren Vortragenden siehe www.bildungshaus-batschuns.at
Petition des Vorarlberger Vereins „Gemeinsam Zukunft Lernen“: NEIN zum Notenzwang, JA zur Wahlfreiheit der Beurteilungsform: www.openpetition.eu oder www.gemeinsamzukunftlernen.at
JUGEND AM WORT
Das MediaLab (www.whocares.resso.it) ist ein journalistisches Experimentierlabor für junge Menschen im Rahmen des groß angelegten Workshop-Programms „MY FUTURE – WHO CARES?“ von CARE Austria und dem Vorarlberger Landestheater. Für die vorliegende Ausgabe der marie durften Jungautorinnen erste Erfahrungen im Printjournalismus sammeln.
Fast Fashion und deren verheerende Folgen Folgende MediaLab-Autorinnen haben in dieser Ausgabe der marie mitgear beitet:•Sarina Grabher,16, Lustenau, Schülerin an der Tourismusschule Bezau, Caritas-Jugendbotschafterin •Laura Wachter,18, Lingenau, absolviert gerade ihr „Freiwilliges Sozialjahr Vorarlberg“, Caritas-Jugendbotschafterin •Carla Sophie Raffl,18, Langenegg, ebenfalls Absolventin des „Freiwilligen Sozialjahres Vorarlberg“, Caritas-Jugendbotschafterin
Sarina konsumiert nur, was sie vertreten kann und lebt seit drei Jahren vegan. Was den Klimawandel und Konsumfragen angeht, setzt sie auf akribische Recherche, um gut informiert zu sein und die richtigen Antworten zu finden.
Heutzutage ist Fast Fashion nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Doch nur wenige wissen, welche gravierenden Auswirkungen diese auf die Umwelt und den Menschen hat.
Unter „Fast Fashion“ versteht man im Grunde jene Mode, die in kürzester Zeit und in Massen produziert und dann zu Billigstpreisen angeboten wird. Durch den Anspruch nach ständig neuen Kollektionen sind die Vorlaufzeiten für diese sehr gering. Oftmals liegen zwischen Entwurf und Verkauf im Laden nur zwei bis drei Wochen. Dabei will man die Kosten minimal halten, Umweltaspekte geraten meist völlig in den Hintergrund. Bekannte Modelabels wie Zara mit 24 Kollektionen pro Jahr oder H&M mit 12 bis 16 Kollektionen pro Jahr, aber auch Luxusmarken wie Chanel oder Louis Vuitton verfolgen die Fast Fashion Strategie.
Enormer Kleidungsverbrauch Weltweit werden jährlich rund 80 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Laut einer Studie von Greenpeace besitzt jede*r Österreicher*in rund 85 Kleidungsstücke – macht insgesamt 547 Millionen landesweit. Davon wird jedes achte – und damit rund 72 Millionen Teile – selten oder gar nicht getragen. Die Kombination aus schlechter Qualität und niedrigen Preisen führt zu einer verkürzten Nutzungsdauer und fördert unsere Wegwerfmentalität. Zudem stammen zirka 90 Prozent der gekauften Kleidung aus dem Import aus China, der Türkei und Bangladesch.
Auswirkungen auf Umwelt und Mensch Verheerend, was dabei unsere Umwelt tragen muss: Das Wasser wird verschmutzt, die Produktion erfordert eine hohen Chemikalieneinsatz und eine zunehmende
Menge an Textilabfällen füllt die Deponien. Laut Greenpeace sind bereits zwei Drittel der chinesischen Flüsse und Seen stark verunreinigt. Die Giftstoffe gelangen ungeklärt ins Grundwasser. Die Textilfärberei gilt weltweit als zweitgrößter Verschmutzungsgrund von Wasser, gleich nach der Landwirtschaft. Der beliebteste Stoff in der Mode ist Polyester. Doch sobald dieser in der Waschmaschine landet, gibt das Material kleinste Mikrofasern ab, die von unseren Kläranlagen nicht gänzlich herausgefiltert werden können. Somit gelangt das Mikroplastik in unsere Meere, Flüsse und in unser Grundwasser. Da Mikroplastik aber nicht biologisch abbaubar ist, ist es eine starke Bedrohung für die Wasserlebewesen. Das Mikroplastik ist so klein, dass Plankton dies als Nahrung zu sich nimmt und die Fische infolge das Plankton mit dem Mikroplastik fressen. Der Fisch wird von uns Menschen verzehrt und somit gelangt das Mikroplastik auch in unseren Körper.
Problemfall Baumwolle Zudem ist der größte Teil der Baumwolle gentechnisch manipuliert, um sie gegen Krankheiten resistent zu machen. Dadurch verbessert sich der Ernteertrag und der Pestizideinsatz kann unter Umständen sogar verringert werden – vorläufig. Langfristig bilden sich Resistenzen, sodass schließlich immer stärkere Gifte eingesetzt werden müssen. Außerdem erfordert der Anbau von Baumwolle hohe Mengen an Wasser, um Ernteausfälle zu verhindern. Der Dokumentarfilm „The True Cost“ veranschaulicht die drastischen Folgen für die Menschen in den Anbaugebieten. Unter anderem berichtet er vom Tod eines Bauern durch einen Gehirntumor oder von schweren Geburtsfehlern bei Kindern indischer Baumwollbauern. Die Modemarken wurden durch Aufklärungskampagnen von Greenpeace stark
Übervolle Kleiderkästen durch schnelle, billige Einkäufe. Kleiderbörsen, Up- und Recycling sind Antworten gegen zu viel Fast Fashion. Fotos: Mitja Kobal, Greenpeace


unter Druck gesetzt. Greenpeace testete eine Reihe von Labels auf giftige Chemikalien – leider positiv. Viele dieser Stoffe sind in einigen Ländern inzwischen verboten, da sie hormonstörend, krebserregend oder giftig für den menschlichen Organismus sind.
Gegenbewegung Einen Gegentrend zur Fast Fashion zeichnet sich mit der aktuellen Slow Fashion Bewegung ab. Sie setzt auf nachhaltige, bewusste und entschleunigte Mode mit einer fairen Bezahlung und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen für die Arbeiter*innen. Das Angebot an fairer Kleidung bzw. Upcycling Mode im Ländle ist derzeit noch begrenzt. Slow Fashion kann man zum Beispiel im Kleidergrün in Feldkirch oder in einem der Vorarlberger Weltläden kaufen. Auch Bio-Baumwolle ist stark im Kommen, jedoch macht die Gesamtverwendung weniger als ein Prozent der jährlichen Baumwollernte aus. H&M und Inditex, Muttergesellschaft von Zara, gehörten 2016 zu den fünf größten Bio-Baumwollverbrauchern.
Nachhaltige Mode in Vorarlberg Laut Greenpeace zeigt sich ein langsamer Wandel bei den Teenagern. Rund ein Drittel tauschen bereits ihre Kleidung, wenn diese nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt. Die Erfahrungen von Karin Bastiani, Inhaberin einer Änderungsschneiderei in Lustenau, bestätigen das Umdenken bei den Jungen. Generell würden immer mehr Kunden ihr Geschäft aufsuchen, um verschiedene Teile reparieren bzw. ändern zu lassen. Diese fasst sie in drei Gruppen zusammen: Jene, welche ihr Lieblingsteil bringen, jene, die sehr teure Kleidung ausbessern lassen, und dann gäbe es noch viele Aufträge, hier vor allem von älteren Personen, die ihre Kleidung bis zum endgültigen Abnutzen zu tragen gewohnt sind. Karin Bastiani selbst ist begeistert vom Upcycling und stöbert gerne immer wieder in Second Hand Stores. Dies sind in Vorarlberg unter anderem der Integra Shop „Siebensachen“ in Bregenz oder die Carla Stores der Caritas. Ob stylish oder funktional, ob neu oder recycelt, an einer Änderung unseres Konsumverhaltens werden wir jedenfalls nicht vorbeikommen.
Ein Baumwoll-T-Shirt in Zahlen: • 15.000 Liter Wasser braucht es für die Herstellung eines Kilos Baumwolle. • 1 kg Baumwolle benötigt es für ein T-Shirt. • 1 kg umweltschädliche Chemikalien entfallen auf 1 kg fertige T-Shirts. • 8-9 kg CO 2 Ausstoß verursachen Produktion und Waschen eines T-Shirts. • Der Transport des T-Shirts vom Entwicklungsland zu uns nach Europa ist hier noch nicht einberechnet!
Nr. 1935
Nach dem Ersten Weltkrieg herrschten Hunger, Leid und Not. Hitler versprach, das Reich neu aufzubauen und die Men- schen verspürten große Hoff- nung. An die Stelle von Hoffnung trat jedoch Hoffnungslosigkeit für jeden, der nicht ins System passte. 1938 verweigerte Ernst Reiter Soldat zu werden und wurde daraufhin zu sechs Monaten Einzel- und Dunkelhaft verurteilt und aufgrund seines Ungehorsams zusätzlich noch zu 18 Monaten Zuchthaus. 1940 wurde er ins KZ Flossenbürg gebracht, welches als Arbeitslager diente. Von da an war er nicht mehr „Ernst Reiter“, sondern die Nummer „1935“.*
Kein Mensch, der es nicht selbst erlebt hat, kann sich auch nur ansatzweise vorstellen, wie unmenschlich die Umstände dort waren. Zwölf Stunden schwerste körperliche Arbeit. Eine schreckliche Schlafsituation. Keine Intimität. Verfaultes Essen. Grausame Foltermethoden. Wer sich auch nur in irgendeiner Weise weigerte, Befehle zu befolgen, musste dafür womöglich mit seinem Leben bezahlen. Ernst Reiter hat viereinhalb Jahre lang all das überlebt. Zu oft wird vergessen, dass all dies für viele Menschen heutzutage Realität ist. Das Globale Ziel 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ soll zu einer erheblichen Reduktion von Gewalt, Korruption und Bestechung weltweit beitragen. Zur Erreichung dieses Zieles kann aber jeder einen Beitrag leisten, indem man sich immer wieder vor Augen führt: Jeder macht Fehler, niemand ist perfekt und trotzdem sollte man immer das Gute im Menschen sehen und tolerant, offen und wertschätzend mit jedem Menschen umgehen. Wir können uns alle ein Beispiel an Ernst Reiter nehmen – er war trotz all seiner schrecklichen Erfahrungen nie nachtragend und verurteilte keinen Menschen. *Ingrid Portenschlager, eine Zeitzeugin zweiter Generation, arbeitet mit dem Verein „Lila Winkel“ – einer Vereinigung zur Rehabilitierung und Unterstützung von Opfern der NS-Zeit – zusammen und erzählte bei ihrem Besuch am BORG Egg vom Schicksal Ernst Reiters. Du bist dran: Buy less, choose well! Laura schreibt nicht nur gerne, auch an sich selbst versucht sie
ständig zu arbeiten und ist dabei, nach und nach ihren
Plastikkonsum zu verringern.

Plastik raus aus den Schulen: Mit dem Projekt „drastic Plastic“ sollen alle Getränkeautomaten an den Schulen auf Glasflaschen umgestellt werden.

Plastik, ein Thema, über das inzwischen kritisch diskutiert wird, das einen durch den Alltag begleitet und das auch in den Nachhaltigkeitszielen eine wichtige Rolle spielt – insbesondere in den SDGs 12 „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“ und 14 „Leben unter Wasser“.
tung und Wiederverwendung von Plastik großes Verbesserungspotential. Mehr als zwei Drittel des Plastikmülls in Österreich werden verbrannt. Unmengen an CO2, sowie weitere, unter anderem krebserregende Giftstoffe gelangen so in die Atmosphäre. Umso wichtiger ist es, in einer Gesellschaft, die Plastik als typisches Wegwerfprodukt sieht, Alternativen wie Mehrwegplastik zu bieten und Bewusstseinsarbeit zu betreiben.
Wusstest du, dass in Österreich jährlich nicht einmal ein Drittel des Plastikmülls wiederverwertet wird? Trotz des gut funktionierenden Abfallsystems in Österreich gibt es in den Bereichen der Wiederverwer
Pfandsystem Vor neunzehn Jahren wurde in Österreich das verpflichtende Pfand auf Plastikgebinde abgeschafft. Seitdem fokussiert sich das Flaschensortiment im Supermarkt stark auf Einwegplastikflaschen, was eine
MY FUTURE – WHO CARES? Night
Do, 6.2., 19:30 Uhr mit Keynote Speaker*innen Ingrid Brodnig, Anika Dafert und Felix Finkbeiner sowie Premiere des eigens komponierten MFWC-Songs von Philipp Lingg
Vorarlberger Landestheater, Großes Haus, Tickets über Kartenbüro des Vorarlberger Landestheaters
Carla Sophie – Cadie – bringt sich in Nachhaltigkeitsthemen mit viel Kreativität ein und weiß ihre Stimme für benachteiligte Menschen einzusetzen.
Nachhaltigkeitsziele/SDG/ Agenda 2030 – Was soll das sein?
• SDG steht für „Sustainable Development Goals“ und bedeutet „Ziele für eine nachhaltige Entwicklung“ • 2015 haben alle UNO-Mitgliedstaaten die Agenda 2030 unterzeichnet, in der die 17 Ziele beschrieben sind und • einen Anstoß zu nachhaltigen Maßnahmen in ökonomischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen geben: Armut und Hunger sollen besiegt werden, alle Kinder sollen zur Schule gehen können, die Umwelt soll geschützt werden, Ungleichheiten sollen bekämpft werden, … • Alle Länder müssen an einem Strang ziehen, damit unser Planet auch für zukünftige Generationen lebenswert ist. • Die Umsetzung dieser Ziele kann nur gelingen, wenn jeder Mensch mitwirkt – jeder einzelne muss bei sich selbst anfangen und sein Konsumverhalten überdenken.
massive Umweltbelastung zur Folge hat. Es ist prinzipiell umweltschonender, Flaschen, ganz unabhängig vom Material, mehrmals zu befüllen. Entscheidend ist ein gut funktionierendes Pfandsystem, bei dem sowohl Konsument als auch Produzent eingebunden sind. Idealerweise in Kombination mit weiterentwickelten Möglichkeiten des Recyclings. Österreich hätte zudem ein großes Einsparungspotenzial bei Plastik an Schulen. Aufgrund von Automaten mit verpackten Brötchen oder Riegeln und Getränkeautomaten mit Plastikflaschen produzieren Schulen Unmengen an Plastik. Mit dem Projekt „Drastic Plastic“ der Jugendbotschafter der Caritas Auslandshilfe sollen alle Schulen in Vorarlberg von Plastikflaschenautomaten auf Glasflaschenautomaten mit Pfandsystem umgestellt werden – als starkes Zeichen für den Klimaschutz!
Plastik statt Fische Wusstest du außerdem, dass 2050 mehr Plastikteilchen als Fische im Meer schwimmen werden? Durch Plastikmüll im Meer wird Mikroplastik von Meerestieren über Algen oder durch Verwechslung mit Plankton aufgenommen und gelangt deshalb in unsere Nahrungskette. Das hat unter anderem zur Folge, dass auch im menschlichen Körper immer größere Mengen an Plastik gefunden werden, was schwere Folgen für die Gesundheit mit sich bringen kann. Meerestiere und Vögel verhungern qualvoll, wenn sie Plastikmüll mit Nahrung verwechseln und ihnen lebensnotwendige Nährstoffe fehlen.
106 kg Kunststoffabfall im Jahr 106 kg an Kunststoffabfall produziert durchschnittlich jeder einzelne von uns in Österreich pro Jahr. Plastikreduktion oder -vermeidung hat dabei oft nichts mit einer radikalen Lebensumstellung zu tun. Ein bewusster Umgang bzw. eine Haltungsänderung kann schon viel bewirken. Vor allem sollten wir unsere „Wegwerf-Haltung“ überdenken, der Wiederverwendung und Wiederverwertung einen höheren Stellenwert einräumen und Alternativen prüfen. Alternativen wie feste Haar -und Körperseifen, Bambuszahnbürsten, Bienenwachstücher anstelle von Frischhaltefolie oder waschbare Wattepads, die man mittlerweile in jedem Bioladen und in jeder Drogerie findet. Ich. Du. Wir alle sind aufgefordert, jeder kann einen Beitrag leisten – sei es durch weniger oder richtigen Konsum. Oder idealerweise beides!
• SDG 12: Artikel 12.5: „Bis 2030 soll das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringert werden.“ • SDG 14: Artikel 4.1: „Bis 2025 sollen alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhütet und erheblich verringert werden.“
Der „James Bond“ aus Vorarlberg
Er spielte mit Clint Eastwood („Für eine Handvoll Dollar“, 1964), Richard Burton, Rod Steiger, Klaus Kinski, Götz George, Hildegard Knef und hätte das Zeug gehabt, einer der ganz Großen des Action-Kinos zu werden. Aber nicht zuletzt seine schwierige Psyche verhinderte, dass es der Vorarlberger Schauspieler Sieghardt Rupp dauerhaft an die Spitze der internationalen Leinwandstars schaffte. Sein Tod vor fünf Jahren war ebenso geheimnisvoll wie sein Leben.
Text: Gerhard Thoma, Fotos: Archiv
ieghardt Rupp wurde am 14. Juni 1931 in Bregenz als Sohn eines Lehrers geboren. Er absolvierte das Max-Reinhardt-Seminar in Wien und durfte in Klagenfurt, Salzburg und Linz auf die Bühne, ehe man ihn 1959 ans Wiener Volkstheater holte. Dort wurden Mitarbeiter der „Rex“-Filmproduktion auf den feschen jungen Mann aufmerksam und nahmen ihn unter Vertrag. Unter dem Künstlernamen Tommy Rupp wurde er als Liebhaber und Mädchenschwarm in Heimatfilmen eingesetzt. Sein Filmdebüt feierte der Bregenzer 1959 in „Mädchen für die Mambo-Bar“. Es folgten typische Nachkriegsstreifen wie „Heimweh nach dir, mein grünes Tal“, „Die Försterchristel“ und „Mariandls Heimkehr“ (1962). Rupp agierte neben österreichischen Filmgrößen wie Paul Hörbiger und Peter Weck, aber schon bald wurden ausländische Filmagenten auf den Mimen mit den markanten Gesichtszügen aufmerksam. Rupp packte die Gelegenheit beim Schopf: 1964 wurde er in dem Sergio-Leone-Klassiker „Für eine Handvoll Dollar“ an die Seite von Clint Eastwood geholt, in dem Rupp eine Hauptrolle in Form des Schurken Esteban Rojo verkörperte. Die Filmmusik S
Frauenheld, Macho, Raucher: So kannte man den gebürtigen Bregenzer in Film und Fernsehen. Er war populär. Im „richtigen“ Leben flüchtete Sieghardt Rupp vor Medien und der Öffentlichkeit so gut es ging.

komponierte Ennio Morricone. Kritiker waren von der Leistung des Vorarlbergers begeistert. Historisch läutete der Streifen das Ende des glorifizierenden Wild-West-Mythos ein. Es folgten etliche Western- und Karl-May-Filme mit Pierre Brice, Lex Barker und Stewart Granger: „Unter Geiern“, „Sie nannten ihn Gringo“ etc. Für Sieghardt Rupp hätte es das Sprungbrett ins internationale Action-Kino sein können. Doch der medienund öffentlichkeitsscheue Schauspieler wollte sich nicht in eine Schublade stecken lassen und wechselte sein Aktionsfeld. Im deutschsprachigen Raum gelangte er nun als „Tatort“-Ermittler zu Berühmtheit. Sein Gastspiel als Zollfahnder Kressin dauerte von 1971 bis 1973 und spaltete die Geister. Rupp trat in smarter James-Bond-Manier auf, mit Charme, Charisma, coolen Sprüchen und begleitet von hübschen Mädchen in schnellen Autos. Unkonventionell und nicht teamfähig. Mit reichlich Haargel, lässiger Kleidung und sportlicher Figur stellte er sich allen Herausforderungen. Nach zehn Folgen und internen Querelen beim produzierenden Westdeutschen Rundfunk (WDR) war für Rupp zwar Sendeschluss, aber nie zuvor hatten sich so viele junge Leute in Österreich und Deutschland für einen Job als Zollfahnder beworben. Zehn Jahre später sollte Götz George („Schimanski“) als unangepasster Ermittler in Rupps Fußstapfen treten. Rupp selbst kehrte wieder vermehrt auf die Theaterbühne zurück. Mit Filmrollen ging er wählerisch um: 1979 wirkte er im zweiten
In den Siebzigern war das noch gut möglich: Als Zollfahnder Kressin durfte Sieghardt Rupp im „Tatort“ den Frauenschwarm geben. Sieghardt Rupp (1931-2015), der wohl berühmteste TV- und Filmschauspieler Vorarlbergs.

Teil des Kriegsepos „Steiner – Das eiserne Kreuz“ mit. 1981 agierte der mittlerweile 50-Jährige im legendären „Bockerer“ mit Karl Merkatz.
Leiser Abschied Da er sehr zurückhaltend gelebt hat, ist über sein Privatleben wenig bekannt. Man weiß, dass Rupp nach 30-jähriger Ehe von seiner Frau Gotlinde, einer Schauspielerin, in den 1980er Jahren geschieden wurde und seine Tochter Iris-Angela 2013 im Alter von 56 Jahren verstorben ist. In Kollegenkreisen galt er als ver schlossen und schwierig, zuweilen litt er an Depressionen und überlebte 1985 einen Selbstmordversuch. „Ich ertrage keine Langeweiler. Ich verlange ständige Präsenz“, sagte Rupp in einem Interview über sich selbst. Inkonsequenz sei ihm ein Gräuel. Seine Schauspielkollegin Dunja Rajter sagte: „Er war stolz, charmant, eitel, aber witzig.“ Andere Kollegen beschrieben ihn auch als „zu anspruchsvoll“.
Jahrelang Schauspieler am Theater in der Josefstadt in Wien, brillierte Rupp noch zur Spielzeit 1997/98 im Rabenhof (bis 2000 Nebenspielstätte der „Josefstadt“), wo er für seine Darstellung des Dirigenten Wilhelm Furtwängler mit der Kainz-Medaille ausgezeichnet wurde. Daneben unterrichtete er am „Reinhardt-Seminar“ im Fach „Rollengestaltung“. Ein letztes Mal überzeugte Rupp seit der Premiere im Dezember 1998 als charismatischer Fliegergeneral Harras in dem Drama „Des Teufels General“ von Carl Zuckmayer. Regie führte Otto Schenk. Danach zog sich der Schauspieler endgültig ins Privatleben zurück. Abgeschieden lebte er in seiner Wohnung in Wien, wo er am 20. Juli 2015 im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus verstarb. Von seinem Ableben erfuhr die Öffentlichkeit erst Ende Mai 2016 – durch Zufall. Das Filmar
Sieghardt Rupp in seiner Paraderolle als übler Schurke in dem Western-Klassiker „Für eine Handvoll Dollar“ (1964). An der Seite von Clint Eastwood spielte er eine der Hauptrollen.

chiv Austria wollte Rupp anlässlich seines 85. Geburtstages ehren und zu einer Retrospektive seines Schaffens einladen. Dabei stellte sich heraus, dass Rupp bereits vor fast einem Jahr verstorben war. Sein letzter Wille war, sich still und leise zu verabschieden. Seine letzte Betreuerin, Caritas-Mitarbeiterin Elisabeth Stocker, musste ihm versprechen, seinen Tod nicht öffentlich zu machen: „Wir haben viele Gespräche geführt. Er war ein tiefer, kluger und ernster Mensch, der aber auch Humor hatte und vor allem ein großes soziales Gewissen. Ich habe ihm versprochen, seinen Tod geheim zu halten. Das wollte er so. Herr Rupp hat sehr zurückgezogen gelebt, er wollte nicht in der Öffentlichkeit stehen.“ Bis 2016 flatterte Fanpost aus aller Welt bei seiner Wohnadresse ein – vor allem Autogrammwünsche aus den USA, Kanada und Deutschland. Solange er konnte, hat er diese Anfragen beantwortet. Sieghardt Rupp wurde auf dem Neustifter Friedhof in Wien an der Seite seiner Tochter bestattet. Nur drei Trauergäste sollen bei der Beerdigung gewesen sein.
Filmographie Sieghardt Rupp hat als Film- und TV-Schauspieler von 1959 bis 1995 in mehr als 70 Filmen und TV-Serien mitgewirkt. 1954 gab er sein Debüt als Theaterschauspieler am Landestheater Klagenfurt, ab 1956 in Salzburg und ab 1958 in Linz. Ab 1959 war er beim Volkstheater in Wien beschäftigt.
KUNST IN DER KANTINE

„Ich liebe Ecken und Kanten – nur eine Null hat keine“. Dies ist der Titel eines Kunstwerks, das gemeinsam mit einer Reihe anderer Arbeiten ab dem 6. Februar in der Kantine des Hauses Kaplan Bonetti zu sehen sein wird – gemeinsam mit Künstlerin May-Britt Chromy haben Gäste und Mitarbeitende des Hauses an den „Alltagsbildern“ gearbeitet. Mit der Vernissage ab 19:30 Uhr feiert Kaplan Bonetti bereits die zweite Ausstellung im Rahmen von „Kunst in der Kantine“.
Text: Daniela Egger Fotos: Karlheinz Pichler
ay-Britt Chromy kam zunächst mit einem Auftrag für die Teilnehmenden ins Haus – sie sollten allerlei Gegenstände sammeln, die in ihrem Alltag eine Rolle spielen. In den acht Workshops, die danach folgten, kamen immer wieder neue Ideen und Impulse dazu, aber auch neue Interessierte nahmen ihren Mut zusammen und probierten aus, was sich mit Kreativität und dem Material alles machen lässt.
„Sie ist wirklich gut darin, zu motivieren“, sagt etwa Gerd Neswadba über die Begleitung durch May-Britt Chromy. Er war von Anfang an dabei und das Projekt beschäftigte ihn sehr intensiv – er begann seine Arbeit mit einer Collage M
aus Bonbon-Papier, das sich häufig in seinem Zimmer ansammelt. Außerdem trinkt er liebend gerne Energy-Drinks – die leeren Dosen wurden danach ebenfalls verarbeitet. Dass der gesamte Prozess vom Einkauf im Spar, dem Austrinken bis zur Verarbeitung unter professioneller Begleitung zum Kunstwerk dazu gehört, versteht sich von selbst. „Es sind aber auch viele gekommen, die nur zugeschaut haben“, sagt er – das bedauert er, denn: „Mir hat es großen Spaß gemacht.“
Eingeladen waren alle, die im Haus zu tun haben – Gäste, Mitarbeitende und Langzeitbewohner.
„Es steckt schon ein bisschen Herzblut in den Bildern“, sagt etwa Bragi Zedrosser, der schon seit langer Zeit im Haus wohnt. „Ich war schwer überrascht, wie viel Einsatz gezeigt wurde.“ Von ihm stammt auch das eingangs genannte Zitat, während etwa Helga M. über ihr Bild mit Putzutensilien bemerkte: „Unterhaltsame Sauberkeit, saubere Unterhaltung – ein unendliches Ritual.“
Ort der Begegnung May-Britt Chromy hat bereits viel Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Teilnehmenden an ihren Kreativworkshops und ist überzeugt davon, dass es für ein Projekt im Haus Kaplan Bonetti seltsam wäre, fremde Werke aufzuhängen. „Wir haben den Prozess bis zur Ausstellung geöffnet, damit alle einen direkten Zugang finden – immerhin sind es ihre Räume. Das begann schon damit, dass wir die Kantine in eine
Ort der Begegnung – im Haus Kaplan Bonetti ist die Kantine bei Bedarf auch Werkstatt und Ausstellungsraum.

Werkstatt umfunktioniert haben – und schon waren wir das Gesprächsthema Nummer Eins im Haus.“ Die Interessierten fanden einen schnellen Zugang zum Thema Alltag und während der insgesamt acht Workshop-Nachmittage wurde konzentriert gearbeitet. „Mir gefiel auch der respektvolle Umgang miteinander während der Arbeit – teilweise haben harte Schicksale dazu geführt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt im Haus leben. Und doch gab es schöne Momente und einen feinen Humor in der Zusammenarbeit, auch bei Menschen, die sich vorher kaum begegnet sind,“ berichtet die Künstlerin.
Was auch auf die Grundidee der Ausstellungsreihe „Kunst in der Kantine“ hinweist – sie soll immer mehr zum Ort der Begegnung werden, auch für
„Mit gefiel der respektvolle Umgang miteinander während der Arbeit – teilweise haben harte Schicksale dazu geführt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt im Haus leben. Und doch gab es schöne Momente und einen feinen Humor in der Zusammenarbeit, auch bei Menschen, die sich vorher kaum begegnet sind,“
May-Britt Chromy
Menschen, die sonst keinen Grund haben, das Haus Kaplan Bonetti zu betreten. Ungewöhnliche Kunstwerke und eine Feier führen Menschen zusammen – Begegnung ist das, was jeder Mensch braucht.
Ausstellungseröffnung Alltagsbilder Donnerstag, 6. Februar 2020, 19.30 Uhr; Kantine Kaplan Bonetti, Dornbirn; Begrüßung Cornelia Matt, Geschäftsführerin; Eröffnungsrede Karlheinz Pichler
Ja, ich werde Mitglied im marie-Freundeskreis. Damit unterstütze ich die Arbeit von marie.
Meine Jahresspende beträgt:
60,- Euro (Mindestbeitrag für Schüler/Studenten/Senioren)
100,- Euro
Euro
Datum/Unterschrift
Meine Adresse:
Name, Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Beruf
Geburtsjahr
Einzugsermächtigung: Ich erteile eine Ermächtigung zum Bankeinzug meiner Jahresspende.
IBAN
BIC
Bankinstitut
Wir versichern, dass Ihre Angaben nur für interne Zwecke bei marie verwendet werden. Ihre Mitgliedschaft im Freundeskreis ist jederzeit kündbar.
Bitte Coupon ausschneiden und senden an: marie-Freundeskreis Am Kehlerpark 5 Top 34 6850 Dornbirn
Fr., 14. Februar, 20 Uhr, Remise, Bludenz, Eintritt: 20,- Euro
VERANSTALTER AKZEPTIEREN DEN KULTURPASS FÜR FREIEN/ERMÄSSIGTEN EINTRITT Infos über den Kulturpass unter www.hungeraufkunstundkultur.at
Do., 6. Februar, 20 Uhr, Bücherei Hohenems, Eintritt: 8,- Euro
„AUGENBLICKE – KURZFILME“ Eine bunte Rolle mit den besten Kurzfilmen der letzten Jahre. Es sind Filme ganz unterschiedlicher Genres und Inhalte, Komisches und Aufwühlendes, Spannendes und Berührendes.
Foto: Veranstalter

Fr., 7. Februar, 20.30 Uhr, Spielboden, Dornbirn,Eintritt: 16,-/19,- Euro
KONZERT: HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS Die energischen Live-Shows von Hannah Williams und ihren Affirmations haben Maßstäbe gesetzt, und das neue Album versucht nichts weniger, als genau diese Energie auf Platte zu bannen. Im Oktober erscheint mit „50 Foot Woman“ das neue Album von Hannah Williams & The Affirmations. Produziert wurde das Werk von keinem geringeren als dem Tausendsassa Shawn Lee (Amy Winehouse, Lana Del Rey, Alicia Keys), der der Soul-Queen einen einzigartigen Sound auf den Leib geschneidert hat. Weltbekannt wurde die Combo vor zwei Jahren, als Jay-Z den Song „Late Nights And Heartbreak“ gesampelt hat. Foto: Samuel Colombo

Fr., 7. Februar, 20 Uhr, Conrad Sohm, Dornbirn, Eintritt: 34,90 Euro
KONZERT: DAME – ZEUS TOUR 2020 Spätestens seit sich DAME mit seinen letzten drei Alben die Spitze der heimischen Charts sichern konnte, ist das österreichische Ausnahmetalent längst kein Geheimtipp mehr. Zahlreiche, nahezu ausverkaufte Tourneen, begehrte Positionen auf den Bühnen der renommiertesten Festivals und über 735.000 treu ergebene YouTube-Abonnenten verschaffen einem nur einen kleinen Einblick in seine sagenhafte Karriere.
Fr., 14. Februar, Spielboden, Dornbirn, Eintritt: 15,-/18,- Euro
EIN ABEND FÜR NOLDE Mit Michael Köhlmeier, Günther Sohm, The Gamblers u.a. Vorarlberg um 1970: Blasmusik statt Rock’n’Roll, Filmverbote, Langhaarige, die im Gasthaus eher a Watsch’n als ein Bier bekamen. Sie pfiffen auf das Establishment und veranstalteten Konzerte und Lesungen. Flint-Festival, die Bregenzer Randspiele. Die jungen Intellektuellen traten für ein Offenes Haus in Dornbirn ein und bekamen reichlich spät den Spielboden. Immer mittendrin – Reinhold „Nolde“ Luger. Das vorarlberg museum zeigt das Lebenswerk des Grafikers in einer Ausstellung, der Spielboden Dornbirn ehrt mit einem besonderen Programm einen seiner Gründer.
FEMALE VOICES – IRIS GOLD Energiegeladen, mit ihrem natürlichen Charme und gefühlvollen Gesang sowie dem coolem Rap-Flow im Gepäck kommt Iris Gold mit neuem Album zurück nach Österreich. Ihre Inspiration kommt u.a. von Prince, Janelle Monae, Lizzo und Wu Tang Clan Tribut. Diesen Sommer veröffentlichte sie ihr lang erwartetes Debütalbum „Planet Cool“ und seitdem geht es steil bergauf: Sie trat für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf, als er sie in den Élysée-Palast nach Paris einlud. Im August trat sie gemeinsam mit den beiden Legenden Nile Rodgers und Dave Stewart beim Meltdown-Festival in der ausverkauften Royal Festival Hall in London auf. Zudem spielten Iris und ihre Band im Sommer 2019 auf über 30 Festivals. Jetzt werden sie ihren Konzertmarathon mit der Lunar Luna Tour Anfang nächsten Jahres fortsetzen.
Fr., 14. Februar, 9 bis 11 Uhr, Frauenmuseum, Hittisau, Eintritt: frei
FRAUENCAFÉ IM FRAUENMUSEUM Freundschaften beginnen immer mit einer Begegnung Die Frauen*cafés im Frauenmuseum sind Orte, die verbinden, Verständnis und Toleranz wecken, Begegnungen ermöglichen, Beziehungen und Freundschaften entstehen lassen. Das Museum lädt zu einem gemeinsamen Vormittag ein und freut sich über eine kleine, selbstgemachte Köstlichkeit. Alle Frauen* sind herzlich eingeladen.
Fr., 14. Februar, 20 Uhr, Remise, Bludenz, Eintritt: 10,-/7,- Euro
DAS KLEINE ICH-BIN-ICH Auf der bunten Blumenwiese geht ein kleines Tier spazieren, das nicht weiß, wie es heißt. Weil es aber gut ist zu wissen, wer man ist und zu wem man gehört, macht es sich auf die Suche. Es fühlt sich mit vielen anderen Tieren verwandt, obwohl es keinem ganz gleicht. Es ist kein Pferd, keine Kuh, kein Vogel, kein Nilpferd. Auf dem Weg zur Erkenntnis begleiten die Zuschauer das kleine Ich bin Ich auf der Suche nach der eigenen Identität, der eigenen Kultur, die Suche nach Familie, Freunden und Freundinnen, Liebe, Geborgenheit. Das Stück begleitet das Ich-bin-Ich auf diesem Weg und zeigt sehr berührend seine Emotionen, seine Traurigkeit, seine Neugier und seine Entschlossenheit.
So., 16. Februar, 10.30 Uhr, Theater am Saumarkt, Feldkirch,Eintritt: 8,- Euro

DER BLAUE KRANICH Literaturmatinée – Aly El Ghoubashy Wenn sich die abzeichnenden Eindrücke in der neuen Heimat und die Prägungen und Erinnerungen an die alte vermischen, rücken Themen wie Verwurzelung, Entwurzelung und Neuverwurzelung in den Mittelpunkt. Während es zur neuen Erfahrung wird, die eigene Kultur mit den Augen eines Außenstehenden wahrzunehmen, wird gleichzeitig das Bewusstsein für die eigene Kultur geschärft und bereits vorgefasste Meinungen beginnen auf allen Seiten zu bröckeln. Auf ebenso gefühl- wie humorvolle Weise werden die beste henden Unterschiede zwischen den Menschen geschildert und es wird doch auch aufgezeigt, wie ähnlich sie sich am Ende sind.

Foto: Veranstalter
Do., 20. Februar, 18 Uhr, Kunsthaus, Bregenz, Eintritt: 5,- Euro
DIALOGFÜHRUNG MIT DR. CHRISTINE KNECHT-KLEBER Gewalttaten erschüttern nicht nur Betroffene, sondern ganze Gesellschaften. Geschehenes wird über die Medien kollektiv verarbeitet und erinnert. Welche persönlichen und gesellschaftlichen Anliegen treten dabei auf? Und wie gehen wir mit dem Thema Tod in Zeiten von Social Media um? KUB Direktor Thomas D. Trummer spricht mit Dr. Christine Knecht-Kleber, Rechtsanwältin und Expertin für Medienrecht.
Mi., 26. Februar, 20.30 Uhr, Kammgarn, Hard, Eintritt: ab 35,- Euro
ALPINALE KURZFESTIVAL – LÄNDLE TOUR 2020 Mit den Favoriten vom Publikum und Jury im Gepäck tourt das Alpinale Kurzfilmfestival jedes Frühjahr durchs Ländle und macht auch Halt in Hard. Insgesamt sichtete das Alpinale Team vergangenes Jahr über 1100 Kurzfilme und nominierte drei Dutzend Filme für das internationale Kurzfilmfestival. Gezeigt werden bei der Ländle-Tour in zwei Stunden sechs ausgewählte Werke, die im Jahr zuvor den größten Zuspruch von Publikum bzw. Jury ernteten. Die Lieblingsfilme spiegeln die Vielfalt des abwechslungsreichen Programms des Alpinale Kurzfilmfestivals wider. Ernste Themen treffen auf lustvoll inszenierte Geschichten. Die Beiträge regen zum Nachdenken an und sorgen für Gesprächsstoff. Dieses Jahr unter anderen mit dem britischen Animationsfilm „Widdershins“, dem Stop-Motion Film „Inanimate“, die Hochschul-Produktion „Der Hund bellt“, den Publikumspreisträger „Die Schwingen des Geistes“ und der deutsch-türkischen Produktion „Hörst Du, Mutter?“.
Foto: Veranstalter
Di., 18. Februar, 9 Uhr, Domino‘s Hus am Kirchplatz, Frastanz, Eintritt: 24,- Euro für drei Einheiten
ZISCHTIG MORGA „Fünf Tage im Mai“ (Elisabeth Hager) Seit 23 Jahren treffen sich Menschen, die gerne lesen, zu diesem „Zischtig Morga“ im Domino. Das Jahresthema „weitsichtig“ beinhaltet Bücher, die uns anregen sollen, über den Tellerrand hinaus zu schauen – hinein in die Geschichte des letzten Jahrhunderts, in gesellschaftliche Fragen unserer Zeit. Teilnehmer erfahren etwas über den Autor, die Autorin, besprechen Inhalt und Form des Buches und nehmen Stellung zu den aufgeworfenen Fragen im Buch. Zusätzlich bleibt noch Zeit, um mitgebrachte Bücher persönlich vorzustellen.

Do., 27. Februar, 19.30 Uhr, Spielboden, Dornbirn, Eintritt: 8,- Euro
Foto: Charlotte Abramov
So., 23. Februar, 19 Uhr, Festspielhaus, Bregenz, Eintritt: 10,- Euro
STAATLICHES SINFONIEORCHESTER RUSSLAND Mit seiner überschäumenden Vitalität und einer enormen Bühnenpräsenz begeistert der serbische Geiger Nemanja Radulović. In seinem Spiel haben sich zwei grundverschiedene musikalische Welten getroffen und sind aufs Glücklichste miteinander verschmolzen. Die Tradition der sogenannten Zigeunergeiger, mit ihrer aberwitzigen Virtuosität und dem feurigen Musikantentum – auf der anderen Seite die französische Violinschule, geprägt von vornehmer Gradlinigkeit. Nemanja Radulović wurde im Alter von 14 Jahren am renommierten Pariser Konservatorium aufgenommen und nahm teil an Meisterklassen von Yehudi Menuhin, Joshua Epstein, Dejan Mihailovic und Salvatore Accardo. 2015 wurde er mit dem ECHO Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres ausgezeichnet.
NEUE SPIELRÄUME: GEHÖRT DER BALKAN (WIRKLICH) ZU EU-ropa? Über sichtbare und unsichtbare Grenzen Europas in den Prozess der EU-Erweiterung. Bereits seit 2000 besitzen die Staaten des ehemaligen Jugoslawien und Albanien eine Perspektive auf die Mitgliedschaft in der EU. Weit in diesem Prozess sind sie aber – mit Ausnahme Sloweniens und Kroatiens, die mittlerweile beigetreten sind, nicht gekommen. Die Staaten und ihre Bevölkerungen sind in der endlosen Warteschleife mit vielen Frustrationen gefangen. Das jüngste Nein des französischen Präsidenten Macron zur Aufnahme der Verhandlungen mit Nord-Mazedonien und Albanien hat die Debatte intensiviert. In diesem Vortrag des Politikwissenschaftlers Vedran Džihić soll der Frage nachgegangen werden, ob denn der Balkan zu EU-ropa dazugehört und dazugehören soll, ob sichtbare und unsichtbare Grenzen und Vorurteile einer Europäischen Zukunft der Region im Wege stehen und ob man das Erweiterungsprojekt wiederbeleben wird können.
Do., 27. Februar, 20.15 Uhr, Theater am Saumarkt, Eintritt: frei

OUT OF BALANCE: WESHALB WIR ÜBER VERMÖGENSUNGLEICHHEIT SPRECHEN SOLLTEN Mathias Schnetzer, Vortrag und Diskussion: Die verfügbaren Daten und wissenschaftlichen Auswertungen zeigen, dass die Vermögensungleichheit in Österreich sehr hoch ist. Einige wenige besitzen Reichtum in Milliardenhöhe, während die ärmere Hälfte der Bevölkerung sich nicht einmal vier Prozent des gesamten Vermögens teilt. Was bedeutet diese Ungleichheit für die Gesellschaft, Wirtschaft und Demokratie? Und wie verfestigt sich Vermögensungleichheit auch durch Bildungsvererbung über Generationen hinweg? Dr. Matthias Schnetzer ist Ökonom in der Arbeiterkammer Wien und Universitätslektor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Verteilung von Einkommen und Vermögen sowie soziale Mobilität.

Foto: Veranstalter
Mi., 26. Februar bis Fr., 28. Februar, jeweils 19 Uhr, Altes Hallenbad Feldkirch, Eintritt: 18,- Euro pro Abend
DREI ABENDE, DREI BEGRÄBNISSE Mit Philosophie, Musik und Architektur. Drei Auftragsnachrufe, eine Totenkapelle und Trauermusik: Drei Philosophen halten eine Trauerrede. Dazu gibt es herzzerreißende Musik von den Holzbläsern des Vienna Reed Quintet in einem ganz besonderen Raum. Jeder Abend ist einzeln buchbar. Das Begräbnis der Gewissheiten durch die Philosophin Alice Lagaay ist am Mittwoch, 26. Februar, 19 Uhr. Das Begräbnis der Privatsphäre durch den ehemaligen deutschen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar ist am Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr. Das Begräbnis der Muße durch den Philosophen Thomas Macho ist am Freitag, 28. Februar, 19 Uhr. Foto: Veranstalter

Sa.,29. Februar, 15 Uhr, Spielboden, Dornbirn, Eintritt: 7,- Euro
SUSI CLAUS: JANOSCHS „DAS APFELMÄNNCHEN“ Als Wünschen noch geholfen hat – zu dieser Zeit, da war einmal ein armer Mann. Der hatte einen Apfelbaum. Doch der trug nie eine Frucht und nie eine Blüte. Das machte den Mann traurig. Und er wünschte sich? Richtig. Einen einzigen Apfel. Ein märchenhaftes Stück mit Puppen für Kinder ab 4 Jahren.
Foto: Michael Topyol

Fr., 28. Februar, 21 Uhr, Spielboden, Dornbirn, Eintritt: 25,-/28,- Euro
KONZERT: LOLA MARSH Lola Marsh stehen für Pophits, warme Harmonien und smarte Texte. Zusammen mit ihrer fünf-köpfigen Band machten sie beim Primavera Sound 2014 zum ersten Mal in großem Stil auf sich aufmerksam. Es folgten Festivalauftritte, wie beim Exit und Pukkelpop, und eine große Europatour. Foto: George Etheredge
Fr., 28. Februar, 19 Uhr, Kunsthaus, Bregenz, Eintritt: frei
POETRY SLAM Bunny Rogers ist nicht nur bildende Künstlerin und Performerin, sondern auch Lyrikerin. Anlässlich ihrer Ausstellung stellt das Kunsthaus Bregenz die große Bühne für einen Poetry Slam. Meldet euch an und sammelt bei einem kostenfreien Ausstellungsbesuch Inspiration für eure Texte. Moderiert von Markim Pause. Anmeldung für Slammer*innen unter: b.straub@kunsthaus-bregenz.at
Sa., 29. Februar, 20.30 Uhr, Kammgarn, Hard, Eintritt: 25,-/22,- Euro
KABARETT: THOMAS MAURER: „WOSWASI“ Es gibt Fakten. Rund 83 Prozent der Österreicher können sinnerfassend lesen, 57 Prozent sind Mitglieder der katholischen Kirche, 4 Prozent sind Vegetarier, ca. 1,3 Prozent spielen Golf. Und es gibt Meinungen. 100 Prozent der Österreicher haben eine Meinung, das ist ein Fakt. Schätzungsweise 98 Prozent sogar zu allem. Und ein erheblicher Prozentsatz braucht dafür nicht einmal Fakten. Meint Thomas Maurer.