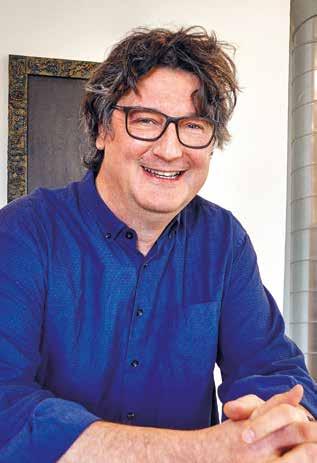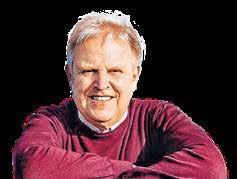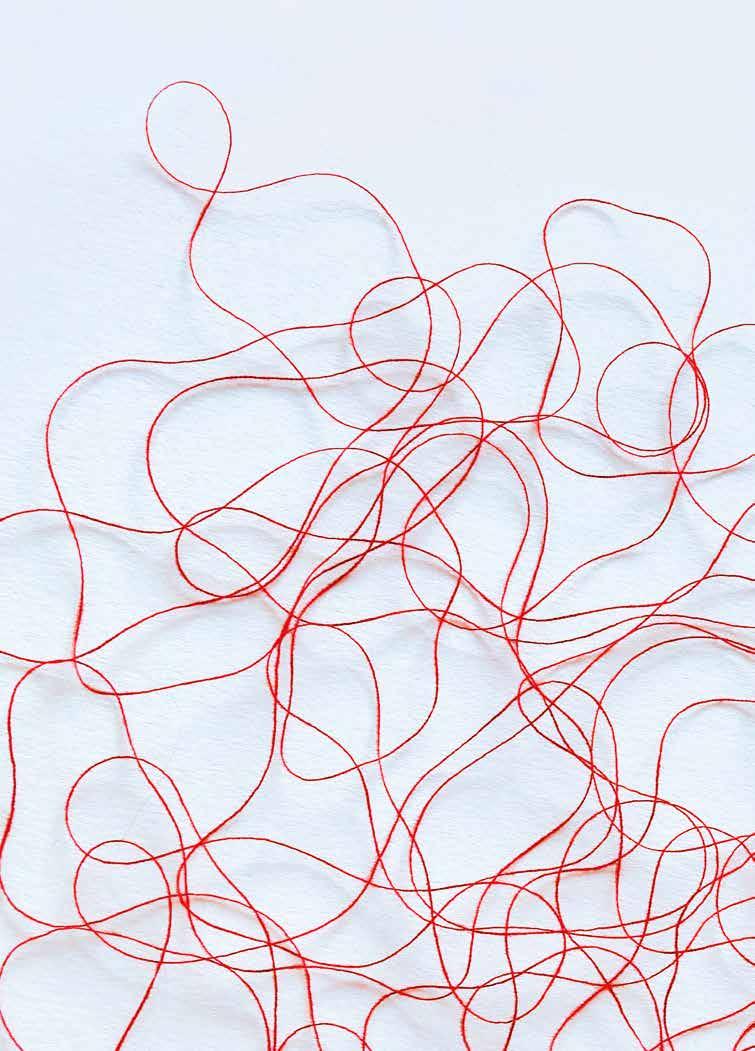9 minute read
Rechenrätsel
Rasche Integration zahlt sich aus
Die Integration von asylberechtigten Menschen in den Arbeitsmarkt in Vorarlberg funktioniert gut und in der Folge wirkt sich das auch gesamtwirtschaftlich durchaus positiv aus. Dieses Fazit ergibt sich für Landesrätin Katharina Wiesflecker aus dem aktuellen Bericht zur Integration von Flüchtlingen in Vorarlberg sowie einer aktuellen Studie über ökonomische Effekte von Asylwerbenden und Asylberechtigten. Laut Studie der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung in Innsbruck zeigte sich, dass ab dem siebten Jahr des Aufenthaltes die abgeführten Abgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten, Steuern) die Transferleistungen (Grundversorgung, Mindestsicherung, Arbeitslosengeld) übersteigen.
Advertisement
Auch die Konsumausgaben der Asylwerbenden/Asylberechtigten schlagen zu Buche: Im Zeitraum 2004 bis 2018 hat das in Vorarlberg zu einem zusätzlichen jährlichen Bruttoregionalprodukt von 28 Millionen Euro und einer zusätzlichen Beschäftigung von 197 Jahres-Vollzeitäquivalenten geführt. Die damit verbundenen fiskalischen Rückflüsse sind höher als die Transfers, die Asylwerbende/Asylberechtigte netto (das heißt nach Abzug ihrer abgeführten Abgaben) vom Staat erhalten, erläuterte Studienautor Stefan Haigner. Die Studienergebnisse zeigen deutlich, dass der Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt die Grundlage für ein steigendes Abgabenaufkommen ist.
In Vorarlberg sind rund 2500 Menschen aus den Herkunftsländern Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Russische Föderation und Somalia unselbständig beschäftigt. Ende November 2019 waren 973 Flüchtlinge beim AMS vorgemerkt. Die sogenannte Register-Arbeitslosigkeit (diese bezieht sich auf Menschen aus den oben genannten wichtigsten Herkunftsländern) beträgt aktuell 17,4 Prozent. Damit liegt Vorarlberg im Bundesländervergleich im Spitzenfeld – nur in Tirol ist dieser Wert niedriger, bundesweit beträgt er 29,4 Prozent.
.com/vordermann.at BRING´S AUF VORDERMANN.AT PROBLEME IM JOB?
Bezahlte Anzeige
Lösen Sie es in 60 Sekunden
Beginnen Sie die Kopfrechnung mit der Zahl im Feld ganz links. Rechnen Sie von links nach rechts. Die Lösung im leeren Feld rechts eintragen. Jede Rechnung unabhängig von der Schwierigkeit sollte in weniger als 60 Sekunden gelöst werden. Keinen Taschenrechner verwenden!
Für Anfänger
7 ×9 -9 ÷2 +21 ÷3 +5 ×3 +17 ÷5
Lösung
Für Fortgeschrittene
47 -11 ÷3 -48 ÷3 ×8 ÷16 3/4 der Summe 1/3 der Summe zum Quadrat
Lösung
Für Genies
Lösung
Nein zu Hass im Netz

Über Hetze im Internet sprach die marie mit Roland Alton (55, Dornbirn), Hochschullehrer der FH Vorarlberg und Social Media-Experte. Ob die Aggressivität wirklich zugenommen
hat, weshalb es Hasspostings gibt und was man gegen sie tun kann, lesen
Sie im Interview mit dem Dozenten für Online-Kampagnen und Medienethik.
Interview: Christina Vaccaro, Foto: FHV Sabine Sowieja, Shutterstock
marie: Die Hasspostings gegen Justizministerin Alma Zadic rücken das Thema der Hetze in Sozialen Medien wieder in den Fokus. Nimmt der Hass im Netz zu? Roland Alton: Hasspostings haben zugenommen, weil die Aktivität der Nutzer höher ist und wesentlich mehr und breitere Bevölkerungsschichten sehr regelmäßig Soziale Medien nutzen. Doch Verleumdung, Hass und schlechte Nachrede gab es schon immer und überall. Jetzt haben wir mehr Flächen, das auszuleben und vor allem wahrzunehmen. Täuscht es, dass der Ton aggressiver geworden ist? Die Aggressivität ist sichtbarer geworden. Ich vermute, dass man in den 70er, 80er Jahren genauso schlecht über Poltiker geredet hat. Aber das blieb am Stammtisch, im kleinen Kreis oder im Verein, und hat nicht die Welt gesehen. Ist die Hetze gegen Zadic dann nur eine AufmerksamkeitsMasche? Immerhin hat sie Morddrohungen erhalten und steht seit ihrer Angelobung unter Polizeischutz. Hasspostings muss man ernst nehmen. Menschen, die Hasspostings lesen und schreiben, bleiben in dieser Wahrnehmungsblase gefangen und wiegeln sich gegenseitig auf. Jemand, der in einer instabilen Lebenssituation ist, wird durch so einen Hassposting-Zirkel befeuert, mitunter eine Kurzschlusshandlung durchzuführen. Die Gefahr ist sicher erhöht. Was hat so jemand davon, ein Hassposting zu setzen? Was Soziale Medien vor allem leisten ist, den Menschen das tägliche Quantum an Aufmerksamkeit zu geben. Da ist viel und jedes Mittel recht, um sichtbar zu werden. Es gibt die Beflissenen, die bloggen, schreiben über Gutes, geben Tipps und Tricks für das Leben im Alltag. Und es gibt jene, die gerne kommentieren. Analysiert man Kommentare, sieht man die Oberflächlichkeit der Leute – viele kennen sich mit einem Thema gar nicht aus, Hauptsache es wird darüber gespro
Gesellschaftspolitischer Stammtisch: Wenn der Hass im Netz explodiert Montag, 3. Februar, 20 Uhr; Kolpinghaus Dornbirn Impulsvortrag von Dr.in Claudia Paganini, Philosophin, Universität Innsbruck Auf dem Podium: Dr.in Claudia Paganini, Gebhard Bargetz (Bezirkspolizeikommando Feldkirch), Dr. Günther Rösel (Psychotherapeut), Marc Springer (Chefredakteur vol.at), Dr. Harald Walser (ehem. Politiker) Rückfragehinweis: Martina Winder, MA. EthikCenter, Katholische Kirche Vorarlberg. T 05522 3485 201. www.ethikcenter.at
chen. Es geht dann einfach darum, sich Bälle zuzuwerfen und gehört zu werden. Warum brauchen wir die Sozialen Medien dafür? Weil es diese gemeinsamen Räume des Austausches immer weniger gibt. Früher ist man nach der Messe noch eine Stunde am Kirchplatz zusammengestanden. Die Orte, an denen ich mich heute treffen und kommunizieren kann, reduzieren sich auf Blasen Gleichgesinnter in Online-Gruppen. Laut Antidiskriminierungsstelle gelten 25 Prozent der gemeldeten verächtlichen Kommentare Migranten, 8 Prozent Politikern, größtenteils weiblichen. Warum ist das so? Menschen mit Migrationshintergrund sind für manche fremd und Fremdartigkeit bedroht. Speziell dann, wenn jemand sich gut integriert hat, die deutsche Sprache gut spricht, studiert hat und Karriere macht – dann ist es besonders bedrohlich, insbesonders wenn ich mich selbst auch bemüht habe, aber meine Karriere oder mein Lebensentwurf vielleicht geknickt sind. Man ist dem Fremden den Erfolg neidig? Ja. Ich habe diesen Erfolg, obwohl ich Österreicher bin, nicht. Zu den anderen Punkten: Frauen haben es in der Politik schwerer, gerade im Bereich Justiz, weil manche Männer meinen, ungerechter behandelt zu werden. Und die Arbeit in der Politik wird durch Medien sehr reduziert, gerne auf Missgeschicke. Es ist leicht, nicht das beste Bild von Politikern zu zeigen. Der Stand der Politik hat ein massives Problem in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Wir haben jetzt einen Kanzler, der gut kommunizieren kann und Message Control macht. Er lässt sich in gutem Licht bestrahlen und kaum Kritik zu. Sich möglichst unangreifbar zu machen kann man auch als Reaktion auf dieses Problem sehen. Stichwort Message Control: Laut Antidiskri

minierungsstelle wird Hetze im Internet immer systematischer. Während des Bundeswahlkampfes haben sich Redaktionen für Hasspostings etabliert, um diese zu inszenieren und die Wellen hochgehen zu lassen. Den Menschen, die das tun, gibt es ein Machtgefühl, Nachrichten kontrollieren zu können. Wenn ich 10 bis 20 Menschen gezielt auf ein Thema losschicke, können diese Lawinen lostreten. Was kann man dagegen tun? Gegenstrategie ist, dass sich jene, die sich eine gute Kommunikation in den Sozialen Medien wünschen, auch zusammentun. In jeder Gemeinde könnte es einen Social Media-Verein geben, Menschen, die sich wöchentlich treffen, ein Thema wählen und es positiv bespielen. Die FH Vorarlberg hat zwei Jahre lang das Projekt „Gemeindekommunikation im 21. Jahrhundert“ begleitet und im Walgau eine Bürgerredaktionsgruppe ausgebildet. Menschen, die gerne schreiben und fotografieren, treffen sich nun regelmäßig und verwenden den gemeinsamen Hashtag #Walgau in Sozialen Medien. Wie kann man sich vor Hetze im Internet schützen? Bei Hasspostings gilt die Tugend der sachlichen Gegenrede: möglichst rasch sollte klargestellt werden, dass die Postings übertrieben, nicht relevant sind, und idealerweise wird ein Faktum mit dazu geliefert. Dann sollte man jenen, die Hasspostings machen, nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken und sie auch nicht mit Gegen- oder Androhungen reizen und selbst untergriffig werden. Große soziale Plattformen bieten einen Mechanismus, etwa über „Abuse-Buttons“, den Missbrauch zu melden. Wichtig ist auch, Screenshots von den Postings zu machen, da Plattformbetreiber die Einträge mitunter löschen. In schlimmen Fällen, etwa mit Morddrohungen, kann man parallel eine Anzeige bei der Polizei einbringen. Was kann man juristisch tun? Juristisch gibt es im Gesetzbuch ganz klare Grenzen, was man darf und was nicht. Es geht vor allem nicht, jemanden zu beleidigen, wenn das öffentlich sichtbar ist. In einem Zweiergespräch oder einer Gruppe darf ich ohne juristische Konseqenzen befürchten zu müssen unfläti- >>
ge Worte verwenden, doch wenn dies den kleinen Kreis verlässt und Öffentlichkeit erlangt, ist das unzulässig. Zwei weitere Kriterien sind, dass etwas nicht auf Fakten basiert und mir Schaden zufügt. Dann sind die Grenzen überschritten und dann kann ich das juristisch anfechten. Der Schaden ist dann doch schon passiert... Natürlich, aber dann greifen die Gesetze. Ich muss nachweisen können, dass mir die Nachrede schadet. Wenn Faschingszeit ist und jemand beim Narrenabend durch den Kakao gezogen wird, ist das Teil der Kultur. Satire ist erlaubt und Teil der Meinungsfreiheit. Kritik muss möglich sein und Kritik kann auch mal ein bisschen daneben greifen, aber Kritik darf nicht zu Gewalt aufrufen oder Gewalt androhen. Der Öster
reichischen Bundesregierung ist das Thema der Hetze im Internet voll bewusst, sie setzt auf Aufklärung und Bewusstseinsbildung. Neue Gesetze braucht es meiner Meinung nach nicht. Allenfalls müssen Plattformbetreiber in angemessener Frist schneller und besser reagieren. Was würden Sie Betroffenen von Hetze im Netz raten? Wichtig ist, dass Opfer von Hetze verstehen, dass diese Hasspostings nicht von so vielen wahrgenommen werden, wie man es selbst tut. Durch die Algorithmen der Plattformen befinden sie sich in einer eigenen Echokammer und lesen diese Postings öfter. Doch sie sind nicht der Mittelpunkt, weder dieser Plattform noch der Welt noch anderer Medien. Ich rate immer auch zu einer gewissen Gelassenheit zu dem, was online abgeht.
Hass im Netz Definition: Worte, Fotos oder Videos, die absichtlich im Internet eingesetzt werden, um andere anzugreifen oder abzuwerten, nennt man „Hasspostings“ oder „Hate Speech“. Dazu zählt auch, zu Hass oder Gewalt gegen bestimmte Menschen(gruppen) aufzurufen. Oft handelt es sich um rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare. Beispiele für Hasspostings: • Menschen werden in Schubladen gesteckt (z. B. „Alle … sind …“) • Jemand wird beschimpft oder diskri miniert, z. B. aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder weil jemand schwul/lesbisch/transgender ist. • Es werden falsche Gerüchte, gemeine Geschichten oder erfundene „Tatsachen“ über bestimmte Gruppen verbreitet, um diese schlecht zu machen oder politische Meinungsmache zu betreiben (z. B. „Ausländer beuten unser Sozialsystem aus.“) • Verschwörungstheorien (z. B. „Dahinter steckt ein geheimer Plan…“) Wichtig (!): nicht jedes Posting teilen, das einen stört – dadurch erhält es nur mehr Aufmerksamkeit
Hasspostings sind kein harmloser Spaß, um dem eigenen Ärger Luft zu machen – sie können strafbar sein. In Österreich gibt es zwar kein eigenes Gesetz gegen Hate Speech, es können aber verschiedene Straf tatbestände erfüllt sein, z.B.: Verhetzung (§ 283 StGB), Verstoß gegen das Verbotsgesetz (nationalsozialistische Wiederbetätigung), Cyber-Mobbing (§ 107c StGB), Üble Nachrede (§ 111 StGB), Beleidigung (§ 115 StGB), Gefährliche Drohung (§ 107 StGB). Tipps: • Im Netz ist man nicht so anonym, wie man glaubt! Strafbare Hasspostings können meistens bis zum Autor bzw. zur Autorin zurückverfolgt werden. • Nicht jeder hasserfüllte Kommentar ist strafbar – vieles fällt in Österreich unter die Meinungsfreiheit! • Nationalsozialistische Inhalte kannst du anonym an die Stopline melden: www. stopline.at • Mehr Infos zur rechtlichen Lage: Leitfa den „Aktiv gegen Hasspostings“: www. saferinternet.at/broschuerenservice So kannst du mithelfen, Hass im Internet zu bekämpfen: • Blockieren: Selbstschutz geht vor! Wird deine Seite zugemüllt, kannst du die da für verantwortlichen Personen sperren. • Melden: In den meisten Sozialen Netzwerken sind Hasspostings unerwünscht – tauchen trotzdem welche auf, kannst du sie bei den BetreiberInnen der Seite melden: www.saferinternet.at/leitfaden • Dagegenreden: Mach klar, dass du mit Hasspostings nicht einverstanden bist! Auch wenn du damit die ErstellerInnen nicht überzeugst – vielleicht aber die MitleserInnen. Bleib dabei unbedingt sachlich! • Anzeigen: Hetze, Beleidigungen und Beschimpfungen sind auch online straf bar – du kannst solche Beiträge bei jeder Polizeidienststelle anzeigen. Wichtig: Erstelle vorher Screenshots und sichere somit Beweise! • Hilfe holen: Du musst das nicht alles alleine machen! Hole dir Unterstützung bei Leuten, denen du vertraust, oder wende dich an eine Beratungsstelle. Weitere Tipps & Hilfe: • Saferinternet.at: Tipps und Infos zur sicheren Internet- und Handynutzung: www.saferinternet.at und www.staysafe.at • 147 Rat auf Draht: Notruf für Kinder und Jugendliche – rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Per Telefon (einfach 147 wählen), OnlineBeratung oder Chat: www.rataufdraht.at • ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit: Nimmt Meldungen über Hasspostings entgegen und unterstützt kostenlos bei rechtlichen Schritten: www.zara.or.at • Stopline: Stößt du auf Beiträge mit nationalsozialistischen Inhalten, kannst du diese anonym melden: www.stopline.at • Beratungsstelle Extremismus: Hilft dir kostenlos und anonym, wenn sich Familienmitglieder oder FreundInnen rechtsextremem oder radikal islamistischem Gedankengut zuwenden. Hotline: 0800 20 20 44 oder per Mail: office@ beratungsstelleextremismus.at Quelle: Saferinternet.at