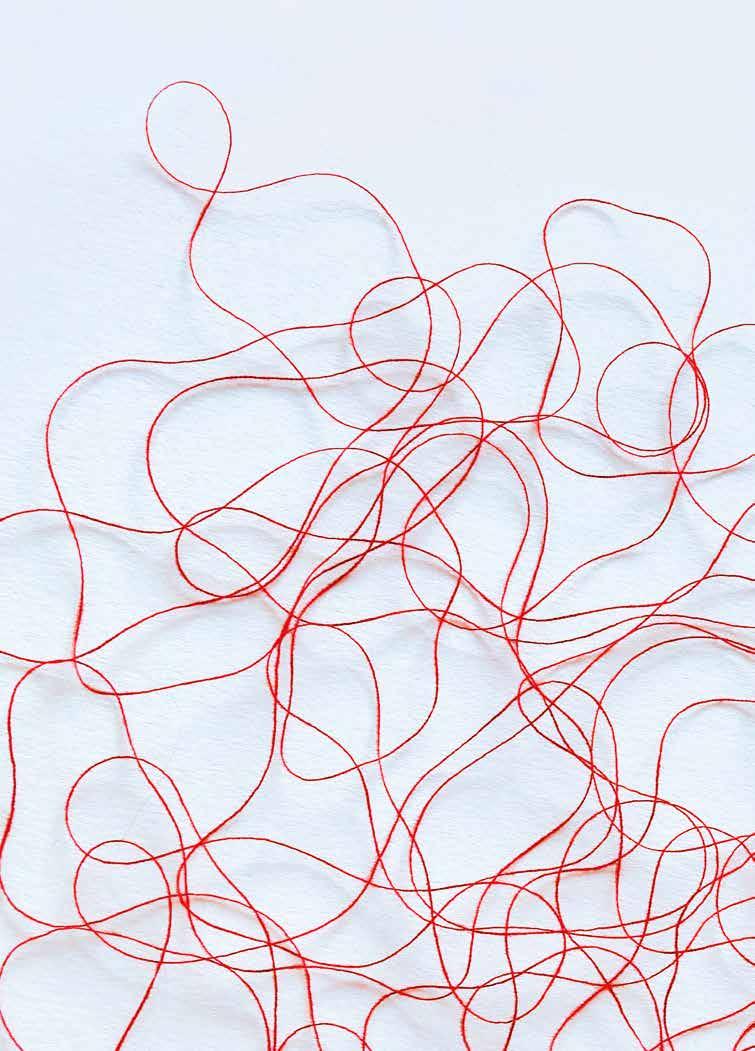10 minute read
Sudoku
Bildungshaus Batschuns Ort der Begegnung
Bezahlte Anzeige
Advertisement
Weg der weisen Frauen | Jahresgruppe 15. – 16. Feb. 2020 / 27. – 28. Juni 2020 10. – 11. Okt. 2020 / 6. – 7. Feb. 2021 Jamila M. Pape, Mentorin Dances of Universal Peace | D — Glauben und Wissen. Auf dem Weg zu vernünftiger Freiheit | Nach-Denken Di 3. März und Di 17. März ab 19.30 h Dr. Peter Natter, Dornbirn — Verwöhn- und Wohlfühltag | Seminar für Frauen Sa 7. März 9.00 – 17.00 h Hildegund Engstler, Bludenz — Ungesunde Gedanken verändern und loslassen | Seminar für Frauen Fr 20. März 9.00 – 17.00 h Birgit Gebhard, Klaus — Spiele mit Pfiff | Spiele für die Gruppenarbeit Fr 27. März 9.00 – 17.00 h Olaf Möller, Hackenstedt | D — Info und Anmeldung: bildungshaus@bhba.at | T 055 22 /44 2 90 - 0 www.bildungshaus-batschuns.at
Fertig gerieben und unglaublich praktisch verpackt

Vorarlberg ist bekannt für seine Käsekultur – und seinen Sinn fürs Praktische. Deshalb gibt es die beliebtesten Käsesorten von Alma küchenfertig gerieben in der wiederverschließbaren Frischeverpackung. Für Pizza, Käsknöpfle, Aufläufe und alle Ihre Lieblingsgerichte.
alma_sennerin
Alma Sennerin
Bezahlte Anzeige Alma Sennerin


shop.alma.at
Zwischentöne zur Selbstvergessenheit
Was bedeutet es, sich zu verlieren? Wann ist ein Sich-Verlieren wünschenswert – und wann nicht? Und was hat das alles mit Kunst zu tun? Diesen Fragen widmen sich die Montforter Zwischentöne mit ihrem ersten Schwerpunkt 2020 (3. bis 29. Februar). Neben der Erfahrung des Sich-Verlierens als einem Erlebnis tiefer Berührung und manch neuer Erkenntnis, geht das Festival auch einer aktuell hoch brisanten Frage nach: Wo haben wir uns in der Komplexität unserer Welt verloren (oder verlieren uns gerade), weil wir als Individuen, aber auch als Gesellschaft, nicht aufgepasst haben?
Starten wird der Schwerpunkt „(sich) verlieren“ mit dem traditionellen Gruß aus der Küche am 3. Februar im Montforthaus. Zu Gast sind die beiden Leiter des Vorarlberger Landeskonservatoriums Jörg Maria Ortwein und Peter Schmid sowie die Architekten der Bestattungskapelle für Muße, Privatsphäre und Gewissheiten, Helmut Dietrich und Hugo Dworzak.
Sudoku
So geht‘s: Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem Block (= 3×3-Unterquadrat) die Ziffern 1 bis 9 genau einmal vorkommen. Viel Spaß!
3 4
6
7 5
8 7 3 46 1 1 6 8 2
3 9 7
6 8 6 57
2 1
9
4
UNTERWEGS MIT HANS PLATZGUMER
Neu-Delhi
INDIEN
Mumbai
Berichte aus dem Irgendwo
Seit der in Innsbruck geborene, in Lochau wohnhafte Autor und Musiker Hans Platzgumer im Juni 1987 seine Geburtsstadt verließ, ist er unterwegs. Am Tag nach seiner Matura setzten sich ein Freund und er auf ein Moped, eine KTM Quattro, und zogen aus – mit allem, was sie transportieren konnten. Die Fahrt nach Wien dauerte drei Tage. Der Rest der Welt wurde dann ohne Moped erfahren.
Text und Foto: Hans Platzgumer Illustration: Shutterstock
Die wahren Abenteuer sind im Kopf, singt André Heller. Das weiß Hans Platzgumer. Und er weiß auch, dass jeder Ortswechsel eine Horizonterweiterung ist. Er hat in vielen Ländern und auf vielen Kontinenten gewohnt, ist an unterschiedlichsten Orten und Unorten gewesen, in überfüllten Straßen und menschenleeren Einöden, hierzulande und sonstwo. Für die marie erzählt sein literarisches Ich in unregelmäßigen Abständen von eindrücklichen Begebenheiten, diesmal von einer Zugfahrt aus der indischen Hauptstadt Neu-Delhi nach Mumbai, die am dichtesten besiedelte Mega-City der Welt, in der über 25 Millionen Menschen Tag ein, Tag aus ein Dasein meistern.
Der Zug, den ich in Delhi besteige, ist natürlich vollkommen überfüllt. Im Gegensatz zu vorigen Reisen aber gelingt es mir, mich an Bord zu zwängen. Ich besitze ein Ticket der höchsten Klasse. Eisern umklammere ich diesen Schein mit dem ampelroten Logo der Indian Railways, der meinen Sitzplatz ausweist. Ich bin registriert als einer von acht Milliarden Passagieren, die dieses Unternehmen jährlich transportiert, ich bestehe darauf, transportiert zu werden. Ich kämpfe mich, während der Zug bereits Fahrt aufnimmt, stur zu meinem Waggon durch, es dauert über eine halbe Stunde, bis ich mein Abteil ausfindig mache. Außerhalb der schmierigen Fenster löst sich Delhi in den dieser Stadt eigenen rostigen Farben auf. Die Welt verschmilzt zu diesem indifferenten Erdton, der früher oder später alles hier einzunehmen versteht, jede Gasse, jedes Gebäude, jeden Rasen, jeden Bewohner. Die ockerfarbenen, klobigen Bauten Delhis verschwinden im Staubnebel, bald gibt es durch das Fenster nichts mehr zu sehen, außer das wüstenhafte Fehlen von allem.
Ich schaffe es, das mir zugewiesene Sleeper-Abteil zu erreichen. Tatsächlich ist ein Sitzplatz für mich freigehalten. Es ist ein Privileg, sich setzen zu dürfen, erfreut grüße ich die elf Mitreisenden, die das enge Abteil mit mir teilen. Keiner von ihnen erwidert meinen Gruß. Es ist heiß, stickig, die Klimaanlage zeigt praktisch keine Wirkung, wahrscheinlich ist den Leuten das Reden zu anstrengend. Mein Hemd ist durchgeschwitzt, die Hose klebt an den Beinen, als ich mich setze, ich wische mit einem Stofftuch den Schweiß von der Stirn. Die kommenden achtzehn
Stunden werde ich mich nicht von meinem Platz erheben. Auf dem Sitz mir schräg gegenüber schläft ein mit Tüchern verhüllter Mann. Auch die restlichen Fahrgäste – fünf ältere und jüngere Männer, zwei Frauen, zwei Buben, ein Mädchen – sind schweigsam. Sie führen eine Unmenge von Taschen, Tüten, Koffern und Kartons mit sich. Ich nehme an, es handelt sich um eine Familienübersiedlung, denn sie alle scheinen miteinander verwandt zu sein. In einer vertrauten Weise schweigen sie sich und mich an. Sofort spüre ich, dass ich ihre Gemeinschaft störe. Ich bin ein Fremdkörper, meine Mitreisenden vermeiden jeglichen Kontakt mit mir und werfen sich gegenseitig klandestine Blicke zu. Es kommt mir vor, als würden sie ein Geheimnis vor mir bewahren. Nur der Schlafende scheint mich gar nicht wahrzunehmen. Lautlos, reglos verharrt er auf seinem Sitz, nichts kann seinen Schlaf stören, nicht einmal der Schaffner, der unsere Tickets kontrolliert. Einer der Gruppe trägt die Fahrkarten für alle Reisenden bei sich. Bloß ich gehöre nicht dazu.
Nachdem der Schaffner gegangen ist, nimmt das beharrliche Schweigen erneut unser Abteil ein. Die Luft ist zunehmend verbraucht. Ich wundere mich, dass dem Schlafenden in dem grauen Baumwollanzug, den er trägt, nicht viel zu heiß ist? Wohl hat er seinen Kopf fast lückenlos mit bunten Seidentüchern umwickelt, überlege ich, um sich eine Privatsphäre zu schaffen. Oder ist er krank? Jedenfalls beneide ich ihn um seinen behüteten Schlaf. So sehr ihn das Wackeln des Zuges auch rüttelt, seine Angehörigen achten darauf, dass er nicht vom Sitz rutscht. Unsere Eisenbahn fährt in die Dunkelheit der Nacht hinein. Ich kann nicht zur Ruhe kommen. Der Sitz ist hart und eng, ich bezweifle, dass ich hier jemals Schlaf finde. Das Abteil ist mittlerweile von einem schummrigen, orangefarbenen Notlicht beleuchtet. In der Fensterscheibe gibt es nichts mehr zu sehen, außer die trübe Spiegelung des Wageninneren. Ein verblichener, ausgefranster Stoffvorhang wird aufgezogen. Das letzte bisschen Ablenkung, das mir gegeben war, verschwindet.
Bei dem Gerüttel und diesen Licht verhältnissen ist an Lesen nicht zu denken. Vielleicht gelingt es mir zu meditieren? Ich rufe mir Krishnamurtis Lehren ins Gedächtnis. Meditation sei das Ende des Denkens, sagte er. Man könne inmitten eines überfüllten Busses meditieren, erlernen aber könne man es nur von sich selbst. Ich zwinge mich, die Augen geschlossen zu halten und meinen >>

Zur Person Hans Platzgumer, geboren 1969 in Innsbruck, wohnt in Lochau und Wien, wo er als Autor und Komponist tätig ist. Hans Platzgumer schreibt Romane, Essays, Theatermusiken und Hörspiele. Zuletzt erschienen: „Willkommen in meiner Wirklichkeit“ (Essay, 2019).
Atem zu kontrollieren. Pranayama. Ich atme doppelt so lange aus wie ein, ich schiebe alles weg, was mir in den Sinn kommt, alle Realität, alle Vorstellung, alle Erinnerung. Ich versuche mich daran, bis mir schwindelig wird und ich Schweiß ausbrüche bekomme. Krishnamurti lehrte, die Meditation dürfe keine Anstrengung sein. Sie sei wie ein Regentropfen, in dem alle Ströme, die großen Flüsse, Seen und Wasserfälle vereint seien. Zur Flucht aber könne sie nicht dienen.
Ich gebe das Meditieren auf und versuche, mich mit demografischen Gedankenspielen zu beschäftigen. Zu meiner Schulzeit war Mumbai noch so groß wie Berlin, überlege ich, heute hat es mehr Einwohner als Australien. Vierzigtausend Mumbaianer pro Quadratkilometer, ich versuche, es mir bildlich vorzustellen, täglich kommen Tausend neue dazu. Elf davon verbringen die Nacht mit mir in diesem Abteil, wortlos. Der Schläfer schläft, die Restlichen dösen vor sich hin oder mustern mich heimlich. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Zugfahrt noch ertragen kann. Wie lange werde ich es aushalten, nicht aufs Klo zu gehen? Die Toilette dieses Zuges will ich meiden, so gut es geht.
Hin und wieder döse ich ein. Wenigstens zeitweise gelingt es mir, mich in ein Loch im Raum und in der Zeit fallenzulassen. Eine Art Ohnmacht überkommt mich.
Irgendwann ist die Hälfte der Reise überstanden. Draußen graut der Tag, er wirft mattes, märchenhaftes Licht in unser Abteil. Wie mich scheint dieser neue Tag auch meine Mitreisenden zu beleben. Einer nach dem anderen streckt sich, gähnt, hustet. Nur der, den ich mittlerweile als Alten bezeichne, obwohl ich sein Gesicht nie gesehen habe, regt sich nicht. Die runzligen Hände, die er nach wie vor reglos im Schoß hält, lassen auf sein hohes Alter schließen. Ist er ein Meister der Meditation? Vollkommen unbeeindruckt von allem wirkt er, tief ruht er in sich. Seinen Angehörigen behagt es weiterhin nicht, wenn ich ihn betrachte. Sobald es einer bemerkt, steht er auf, lenkt meinen Blick auf sich oder stellt sich zwischen mich und ihn. Sie hindern mich daran, diesen Mann anzusehen. Und ich werde umso neugieriger, desto wacher und gelangweilter ich bin. Dieser Alte schläft unaufhörlich wie ein Stein. Wie tot.
In den Vormittagsstunden überkommt mich endlich Gewissheit. Die Sonne steht wie ein Suchscheinwerfer drohend am östlichen Himmel. Der Kopf des Alten ist goldfarben angestrahlt, das Licht gräbt sich durch die Tücher hindurch, die ihn verhüllen. Nicht einmal die unbarmherzige indische Sonne vermag es, ihn zu wecken, aber zum ersten Mal bekomme ich einen Eindruck von seiner aschfahlen, leblosen Haut. Plötzlich muss ich nicht länger hinsehen. Ich erkenne: Dieser Mann wird nie aus dem Schlaf erwachen. Er muss bereits entschlafen gewesen sein, als seine Verwandten ihn in dieses Abteil schulterten. Während der ganzen Fahrt bin ich einem Toten gegenüber gesessen. Einmal habe ich ihn versehentlich mit dem Fuß berührt und mich dafür entschuldigt.
Die folgenden Stunden verharre ich ähnlich reglos auf meinem Platz wie er auf seinem. Ich stelle mich tot, wie er es ist. Verstohlen wandern meine Augen hin und wieder zu seinen Begleitern. Ich will diese Leichentransporteure meine Erkenntnis nicht spüren lassen. Wer weiß, warum sie den Toten diese Fahrt machen lassen? Vielleicht muss er an einen ihm angestammten oder heiligen Platz gebracht werden? Wohl ist die Zugfahrt, die auch für eine derartige Strecke keine tausend Rupien kostet, der billigere, schnellere Weg als in einem gekühlten Leichenwagen. Doch warum bringen sie ihn nicht nach Varanasi oder einen der anderen Tirthas-Orte am Ganges, wo er am Ufer verbrannt oder auch ohne Ritual den heiligen Fluten der Kloake überge ben wird, damit seine Seele ins Nirvana eingehen kann? Wieso muss er durch den halben Subkontinent befördert werden, so weit von der Göttin Ganga entfernt und mir so nah?
Ich überlege, vor wie langer Zeit er verstorben ist? War ursprünglich vorgesehen, dass er die Fahrt lebendig antrat, oder ist er schon seit Tagen tot? Ich achte auf Verwesungsgerüche. Es stinkt, ja. In der indischen Luft liegt immer ein Hauch von Verwesung, sage ich mir. Ich glaube nicht, das Verfaulen eines Mitreisenden zu riechen, trotzdem atme ich bis zum Ende der Fahrt so flach wie möglich. Absurd, dass ich mich wenige Stunden zuvor hier noch an yogischer Tiefenatmung versucht habe.
So sitzen wir also, wir zwölf, schweigend, verstummt, wortlos aus Pietät oder aus einem Schamgefühl heraus, die verbleibenden Stunden unserer Reise ab. Ich habe längst jede Kommunikation aufgegeben und ziehe mich, so weit es geht, in mich zurück. Gäbe es bloß einen Vorhang, denke ich, ich würde ihn sofort vor das Fenster ziehen, um unser Abteil zu beschatten. Dieser dünne Stofffetzen an einer verrosteten Schiebebahn reicht nicht aus, um die Sonne abzuhalten. Mit all ihrer Klarheit strahlt sie den umhüllten Kopf des Verstorbenen an, noch stundenlang erhitzt sie die abgestandene Luft, bis wir endlich in Mumbais Victoria Terminus eintreffen.